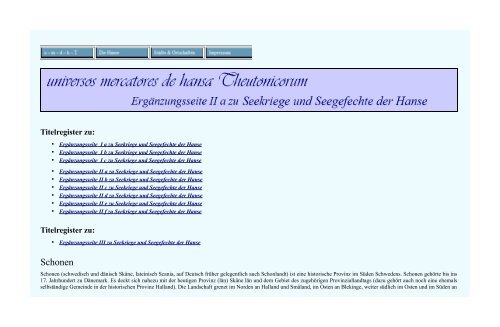Titelregister zu - universos mercatores de hansa Theut...
Titelregister zu - universos mercatores de hansa Theut...
Titelregister zu - universos mercatores de hansa Theut...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Titelregister</strong> <strong>zu</strong>:<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite I a <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite I b <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite I c <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite II a <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite II b <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite II c <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite II d <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite II e <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite II f <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
<strong>Titelregister</strong> <strong>zu</strong>:<br />
• Ergän<strong>zu</strong>ngsseite III <strong>zu</strong> Seekriege und Seegefechte <strong>de</strong>r Hanse<br />
Schonen<br />
Schonen (schwedisch und dänisch Skåne, lateinisch Scania, auf Deutsch früher gelegentlich auch Schonlandt) ist eine historische Provinz im Sü<strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>ns. Schonen gehörte bis ins<br />
17. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong> Dänemark. Es <strong>de</strong>ckt sich nahe<strong>zu</strong> mit <strong>de</strong>r heutigen Provinz (län) Skåne län und <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>s <strong>zu</strong>gehörigen Provinziallandtags (da<strong>zu</strong> gehört auch noch eine ehemals<br />
selbständige Gemein<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r historischen Provinz Halland). Die Landschaft grenzt im Nor<strong>de</strong>n an Halland und Småland, im Osten an Blekinge, weiter südlich im Osten und im Sü<strong>de</strong>n an
die Ostsee und im Westen an <strong>de</strong>n Öresund.<br />
Wichtige Städte sind Malmö (Provinzhauptstadt), Helsingborg, Kristianstad, Landskrona, Lund, Trelleborg und Ystad. Schonen gehört <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n dänischen Inseln Seeland,<br />
Bornholm, Lolland, Falster und Mön <strong>zu</strong>r transnationalen Öresundregion.<br />
Geografie und Geologie<br />
Die südlichste historische Provinz Schwe<strong>de</strong>ns ist eine überwiegend flachwellige Halbinsel, die schwere, nährstoffreiche Tonbö<strong>de</strong>n aufweist. Dies hat die Kulturlandschaft <strong>zu</strong> einem <strong>de</strong>r<br />
ergiebigsten Agrargebiete Nor<strong>de</strong>uropas gemacht. Schonen war jahrhun<strong>de</strong>rtelang die Kornkammer Dänemarks und wird auch heute noch oft die Kornkammer Schwe<strong>de</strong>ns genannt. Selbst<br />
heute noch <strong>de</strong>cken die Fel<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s vielfarbigen Flickenteppichs (Selma Lagerlöf) gut 30 Prozent <strong>de</strong>s schwedischen Agrarbedarfs. Im nordöstlichen Teil <strong>de</strong>r Region wird das<br />
Landschaftsbild hingegen schon von <strong>de</strong>n überall in Schwe<strong>de</strong>n typischen bewal<strong>de</strong>ten Anhöhen aus Gneis und Granit geformt. Mitten durch Schonen verläuft die so genannte Bruchzone,<br />
welche das geologische Ur-Europa <strong>de</strong>s Nor<strong>de</strong>ns vom eigentlichen, jüngeren Mitteleuropa trennt. Die Hügel in Nord- und Mittelschonen sind durch diese geologische Bruchzone bedingt<br />
und trennen Schonen von <strong>de</strong>n nördlicheren Landschaften. Der bekannteste dieser Hügel ist <strong>de</strong>r Hallandsåsen.<br />
Geschichte<br />
Frühzeit<br />
Älteste Grab- und Wohnstättenfun<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Nähe von Trelleborg wur<strong>de</strong>n auf ca. 5000 v. Chr. datiert. Die zahlreichen jungsteinzeitlichen Hünengräber und die bronzezeitlichen Grabhügel<br />
lassen darauf schließen, dass Schonen schon früh eine hohe Bevölkerungsdichte aufwies. Die Steinbauten (z.B. die Megalithanlagen von Hagestad) stammen aus <strong>de</strong>r Zeit zwischen 3500<br />
und 2800 v. Chr., die Hügel stammen von 1800 bis 500 v. Chr. Das Gräberfeld von Vätteryd vertritt die nachfolgen<strong>de</strong> Perio<strong>de</strong>. Ein regionales Han<strong>de</strong>lszentrum <strong>de</strong>r Eisenzeit war z. B. die<br />
Siedlung Uppåkra, südlich von Lund. Dieser Platz, <strong>de</strong>r mit gleichartigen Zentren wie Gudme auf Fünen <strong>zu</strong> synchronisieren ist, wur<strong>de</strong> 1990 ent<strong>de</strong>ckt und ist seit<strong>de</strong>m Objekt intensiver<br />
archäologischer Ausgrabungen. Unter an<strong>de</strong>rem fand man die Reste eines heidnischen Tempels.<br />
Das erste schriftliche Dokument mit <strong>de</strong>r Bezeichnung Schonen ist ein Frie<strong>de</strong>nsvertrag von 811, <strong>de</strong>n Karl <strong>de</strong>r Große mit <strong>de</strong>n Dänen schloss. Im dänischen Gefolge war ein Osfrid von<br />
Schonen, <strong>de</strong>r wahrscheinlich ein regionaler Herrscher war. Eine weitere Erwähnung erfolgte etwa 870, als <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lsmann Wulfstan eine Reise längs <strong>de</strong>r südschwedischen Ostseeküste<br />
unternahm. Inwieweit die Nennung schonischer Könige in nordischen Hel<strong>de</strong>ngedichten historisch verwertbar ist, ist nicht ausreichend diskutiert.<br />
Mittelalter<br />
Das Verhältnis zwischen Schonen und Dänemark <strong>zu</strong>m Beginn <strong>de</strong>r Staatswerdung Dänemarks wird in <strong>de</strong>r Wissenschaft kontrovers diskutiert. Die eine Auffassung meint, dass die<br />
ursprüngliche Zugehörigkeit Schonens, wie auch <strong>de</strong>r jetzigen schwedischen Landschaften Blekinge und Halland, <strong>zu</strong> Dänemark auf eine Anlage <strong>zu</strong>m Älteren Västgötalag <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>führen<br />
ist. Danach soll die Grenze zwischen Dänemark und Schwe<strong>de</strong>n 1050 festgestellt wor<strong>de</strong>n sein. Inzwischen ist nachgewiesen, dass diese Anlage aus wesentlich späterer Zeit stammt.[2]<br />
Von einem dänischen Land o<strong>de</strong>r dänischen Reich, das Schonen umfasst haben soll, kann nach dieser Auffassung daher nicht gesprochen wer<strong>de</strong>n. Die an<strong>de</strong>re Auffassung nimmt an, dass<br />
das Kernland Dänemarks ursprünglich Schonen mit <strong>de</strong>n ostdänischen Inseln war. Sie stützt sich auf die Nie<strong>de</strong>rschrift Alfreds <strong>de</strong>s Großen über die Fahrten Ottars und Wulfstans (das<br />
früheste Zeugnis da<strong>zu</strong>), in <strong>de</strong>r als „Dänemark“ Südschwe<strong>de</strong>n einschließlich Schonen, Falster, Lolland, Langeland, wahrscheinlich auch Seeland und die übrigen ostdänischen Inseln<br />
bezeichnet wor<strong>de</strong>n seien. Erst <strong>de</strong>r nordjütische Skivum-Stein aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Jelling-Steins habe auch Nordjütland <strong>zu</strong> Dänemark gerechnet, möglicherweise eine Folge <strong>de</strong>r Einigung<br />
unter Harald Blauzahn. Unter diesem Gesichtspunkt wür<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>m Jellingstein berichtet, dass Harald Ostdänemark erobert habe.[3] Der Differenz dürfte eine unterschiedliche<br />
Auffassung darüber <strong>zu</strong> Grun<strong>de</strong> liegen, was unter „Dänemark“ verstan<strong>de</strong>n wird. Die erste Auffassung geht vom heutigen Begriff „Dänemark“ aus und fragt, ob Schonen <strong>zu</strong> diesem<br />
Herrschaftsgebiet, wie auch immer es damals geheißen haben mag, gehört hat. Die zweite fragt danach, was die Zeitgenossen Alfreds <strong>de</strong>s Großen und Harald Blauzahns unter<br />
„Dänemark“ verstan<strong>de</strong>n haben. Abgesehen davon wur<strong>de</strong> mit „Schonen“ ein Gebiet mit stark wechseln<strong>de</strong>r Aus<strong>de</strong>hnung bezeichnet. Adam von Bremen schrieb im 11. Jahrhun<strong>de</strong>rt, dass<br />
Skåne an Västergötland grenze,[4] was be<strong>de</strong>uten wür<strong>de</strong>, dass damals Halland <strong>zu</strong> Skåne gehörte. König Christian III. sprach von vaart land Skaane (unser Land Schonen), womit er<br />
Schonen, Halland und Blekinge meinte. Zusammen mit <strong>de</strong>r Insel Bornholm ist für diese Gebiete bei Historikern manchmal <strong>de</strong>r Begriff Skåneland gebräuchlich. Wenn auch Harald<br />
Blauzahn, <strong>de</strong>r im 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt das Christentum einführte und dadurch ein dauerhaftes gesamtdänisches Königreich schuf, in Schonen einen starken Einfluss hatte, so ist doch
zweifelhaft, ob es bereits ein Teil seines Reiches war.[5] Immerhin war <strong>de</strong>r Öresund mit <strong>de</strong>n damaligen Verkehrsmitteln <strong>de</strong>utlich leichter <strong>zu</strong> durchqueren als die dichten småländischen<br />
Wäl<strong>de</strong>r.<br />
Man geht davon aus, dass es damals zwei verschie<strong>de</strong>ne Landschaftstypen gab, was sich auch in einer unterschiedlichen Lebensweise <strong>de</strong>r Bewohner bemerkbar machte: Das Flachland<br />
ohne Wald, wo Ackerbau betrieben wur<strong>de</strong> und dichte Siedlungen vorherrschten, und das Waldland, wo Vieh<strong>zu</strong>cht und Holzwirtschaft das Leben bestimmte. Dort herrschten einsame<br />
Einzelgehöfte vor. Es han<strong>de</strong>lte sich um Laubwald; Fichten gab es damals dort nicht. Diese unterschiedlichen Bedingungen führten <strong>zu</strong> stark unterschiedlichen Lebensstilen, die noch<br />
heute archäologisch in unterschiedlichen Begräbnissitten fassbar sind.[6] Die Ackerbaubevölkerung begrub ihre Toten in Särgen. Im waldreichen Osten herrschen Brandgräber vor.<br />
Zu Zeiten Sven Gabelbarts und Knuts <strong>de</strong>s Großen bestand die Handwerker- und Bildungselite in Schonen im wesentlichen aus Englän<strong>de</strong>rn, die die Könige aus England mitgebracht<br />
hatten. So fin<strong>de</strong>n sich Kunstwerke in englisch-skandinavischem Mischstil und in ausgesprochenem Winchesterstil. Die königlichen Münzmeister kamen aus England nach Lund, wo die<br />
dänischen Münzen geprägt wur<strong>de</strong>n. Man fand eine Schreibfe<strong>de</strong>rschatulle mit <strong>de</strong>r Aufschrift „LEOWINE ME FECIT“ (Leowine stellte mich her). Den Namen Leowine fin<strong>de</strong>t sich auch<br />
auf Münzen aus Lund. Er kam aus Lincoln in England, wo er für König Æthelred Münzen geschlagen hatte.<br />
Als kulturelles Zentrum <strong>de</strong>s dänischen Reiches beherbergte Schonen von 1060 bis 1066 zwei rivalisieren<strong>de</strong> Bischöfe: Den Englän<strong>de</strong>r Henrik in Lund und <strong>de</strong>n Deutschen Egino in Dalby.<br />
Als Henrik starb und Dänemark gleichzeitig die Verbindung mit <strong>de</strong>m Danelag in England verlor, zog Egino nach Lund, um dort das Amt <strong>zu</strong> übernehmen, und so kam das Bistum Lund<br />
unter <strong>de</strong>n Erzbischof von Hamburg-Bremen. Gleichwohl blieb Lund eine kleine christliche Insel in heidnischem Umland, wie die noch Jahrzehnte später angelegten Gräber belegen.[7]<br />
1103 wur<strong>de</strong> Lund <strong>zu</strong>m Erzbischofssitz für ganz Skandinavien erhoben. Absalon von Lund, <strong>zu</strong>vor Bischof von Roskil<strong>de</strong>, war im letzten Viertel <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts Erzbischof von Lund.<br />
Sein Drängen auf die Abführung <strong>de</strong>s Zehnten und auf die strenge Durchführung <strong>de</strong>s Priesterzölibats führte 1181 <strong>zu</strong>m Bauern- und Priesteraufstand in Schonen und <strong>zu</strong>r Schlacht an <strong>de</strong>r<br />
Dösjöbro. Sein Nachfolger in Lund wur<strong>de</strong> Andreas Sunononis (dän. Suneson).<br />
König Magnus Eriksson kaufte Schonen im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt von einem holsteinischen Grafen, <strong>de</strong>r es <strong>zu</strong>m Pfand hatte, für 34.000 Mark Silber. Kurz darauf wur<strong>de</strong> er von <strong>de</strong>n Einwohnern<br />
Schonens <strong>zu</strong>m König ausgerufen. So wur<strong>de</strong> Schonen vorübergehend <strong>zu</strong> einem souveränen Königreich, unabhängig von Schwe<strong>de</strong>n und Dänemark.[8] Allerdings wur<strong>de</strong> dieses Königtum<br />
vom Papst nicht anerkannt.<br />
Wegen <strong>de</strong>s Reichtums an Heringen vor seiner Küste war Schonen vom Mittelalter bis <strong>zu</strong>r Neuzeit ein Zielgebiet hanseatischer Kaufleute (Schonenfahrer).<br />
Neuzeit<br />
Die dänische Reformation fing in Malmö an. Hier wur<strong>de</strong> sowohl die erste lutherische Predigt gehalten als auch die erste dänische Bibel herausgegeben, was die Bildung einer dänischen<br />
Hochsprache vorantrieb.[9]<br />
Während <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges marschierten 1643 in einem Überraschungsangriff und ohne Kriegserklärung schwedische Truppen in Jütland und in Schonen ein. Dieser Krieg<br />
wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n schwedischen Befehlshabern Torstensson (in Jütland) und Horn (in Schonen) benannt (siehe Torstenssonkrieg). In Schonen eroberten sie eine Reihe damals noch<br />
dänischer Städte wie Lund, Landskrona und Helsingborg, während sich die Festungen in Malmö und Kristianstad hielten. Im August 1643 wur<strong>de</strong>n die Schwe<strong>de</strong>n wie<strong>de</strong>r aus Schonen<br />
vertrieben. Im Frie<strong>de</strong>n von Brömsebro musste Dänemark-Norwegen <strong>de</strong>nnoch erste größere Gebietsverluste hinnehmen.<br />
Während <strong>de</strong>s Zweiten Nordischen Krieges erklärte Dänemark im Juni 1657 Schwe<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Krieg. Diese Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng en<strong>de</strong>te im Frie<strong>de</strong>n von Roskil<strong>de</strong> von 1658 damit, dass<br />
Dänemark seinen Besitz in Skåneland (<strong>de</strong>m heutigen Südschwe<strong>de</strong>n) räumen musste. Schonen samt Bornholm, Blekinge und Halland wur<strong>de</strong>n an Schwe<strong>de</strong>n abgetreten. Bornholm<br />
gelangte zwei Jahre später, im Frie<strong>de</strong>n von Kopenhagen, an Dänemark <strong>zu</strong>rück. Dabei wur<strong>de</strong>n auch die noch heute gelten<strong>de</strong>n Grenzen zwischen Dänemark, Norwegen und Schwe<strong>de</strong>n<br />
nach Jahrhun<strong>de</strong>rten kriegerischer Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen festgelegt.<br />
Im Schonischen Krieg 1676–1679, einem Teilkrieg <strong>de</strong>s Nordischen Krieges, versuchte Dänemark letztlich erfolglos die verlorengegangen Provinzen <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>erobern. Der Schonische<br />
Krieg en<strong>de</strong>te 1679 mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Lund.<br />
In <strong>de</strong>n Jahrzehnten nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Roskil<strong>de</strong> 1658 entwickelte sich in Schonen, Halland und Blekinge ein Guerillakrieg gegen die neue schwedische Staatsmacht. Der<br />
Guerillakrieg gegen die Schwe<strong>de</strong>n war im Nor<strong>de</strong>n und Nordosten <strong>de</strong>r Provinz bitter und blutig und hörte erst um 1715/20 allmählich auf. Die Freischützen wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n
abwertend als Schnapphähne bezeichnet. Der letzte Freischütz, Nils Tuasen, wur<strong>de</strong> 1700 hingerichtet. Pläne, die angestammte schonische Bevölkerung ins Baltikum um<strong>zu</strong>sie<strong>de</strong>ln,<br />
wur<strong>de</strong>n nicht umgesetzt.<br />
Nach <strong>de</strong>m Übergang <strong>zu</strong> Schwe<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> Schonen von einem Generalgouverneur verwaltet. Im Jahre 1683 wur<strong>de</strong> das aus dänischer Zeit stammen<strong>de</strong> Schonische Recht durch das<br />
schwedische Recht abgelöst. Im Jahre 1719 wur<strong>de</strong> das Generalgouvernement aufgehoben und Schonen in die normale schwedische Verwaltungsordnung eingeglie<strong>de</strong>rt. Es wur<strong>de</strong>n zwei<br />
Verwaltungsprovinzen, Malmöhus län und Kristianstads län, eingerichtet (die 1999 <strong>zu</strong>m Skåne län <strong>zu</strong>sammengelegt wur<strong>de</strong>n).<br />
Um Schonen enger mit <strong>de</strong>m schwedischen „Altreich“ <strong>zu</strong> verbin<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong> schon 1666 in Lund die Regia Aca<strong>de</strong>mia Carolina als vierte Universität <strong>de</strong>s damaligen schwedischen Reiches<br />
(nach Uppsala, Dorpat und Åbo) gegrün<strong>de</strong>t, so dass die Stu<strong>de</strong>nten nicht mehr nach Kopenhagen <strong>zu</strong> fahren brauchten. Die schwedische Rechtsordnung und die schwedische<br />
Kirchenordnung wur<strong>de</strong>n 1683 eingeführt.<br />
Der letzte dänische Versuch, die verlorene Provinz <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>erobern, scheiterte 1710 in <strong>de</strong>r Schlacht von Helsingborg. Dies war die letzte Schlacht in Schonen zwischen Dänemark und<br />
Schwe<strong>de</strong>n.<br />
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt erlebte Schonen einen ökonomischen Aufschwung. Die Kontakte <strong>zu</strong> Dänemark verbesserten sich, da die letzten bestehen<strong>de</strong>n Restriktionen abgeschafft wur<strong>de</strong>n. Die<br />
industrielle Revolution machte sich vor allem in Malmö bemerkbar. Insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n Orten, die einen Eisenbahnanschluss erhielten, stieg <strong>de</strong>r Lebensstandard <strong>de</strong>utlich.<br />
Unabhängigkeitsbestrebungen<br />
Schonen ist Mitglied <strong>de</strong>r UNPO. Zum Erhalt <strong>de</strong>r kulturellen I<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>r Region for<strong>de</strong>rt man ein regionales Parlament und die Dezentralisierung von Verwaltungsfunktionen.<br />
Verkehr<br />
In Schonen begann man in <strong>de</strong>n 1950er Jahren mit <strong>de</strong>m Bau von Autobahnen. Der Abschnitt zwischen Malmö und Lund war sogar die erste Autobahn Schwe<strong>de</strong>ns, <strong>de</strong>r Anfang <strong>de</strong>r<br />
heutigen E 22. Kurz darauf entstan<strong>de</strong>n weitere Strecken, die nach <strong>de</strong>utschem Vorbild vernetzt wur<strong>de</strong>n. Damit unterschied sich Schonen anfänglich von an<strong>de</strong>ren schwedischen Regionen,<br />
wo in <strong>de</strong>n 1960er Jahren nur kurze, un<strong>zu</strong>sammenhängen<strong>de</strong> Autobahnen entstan<strong>de</strong>n. Das schonische Autobahnnetz begann meist an <strong>de</strong>n internationalen Fährhäfen und auch die<br />
Öresundbrücke wur<strong>de</strong> mit eingebun<strong>de</strong>n.<br />
Auch das Eisenbahnnetz Schonens ist gut ausgebaut. So beginnt in Malmö eine Linie <strong>de</strong>s Hochgeschwindigkeits<strong>zu</strong>ges X2000 nach Stockholm. Für <strong>de</strong>n regionalen Bahnverkehr haben<br />
Pågatåg und Öresundståg die wichtigste Be<strong>de</strong>utung. Mit Einrichtung <strong>de</strong>r Öresundverbindung än<strong>de</strong>rte man <strong>de</strong>n Takt <strong>de</strong>r schonischen Eisenbahnen so, dass sie mit <strong>de</strong>n Zügen Seelands in<br />
Dänemark im Einklang stehen.<br />
Name<br />
Der Name „Skåne“ bzw. „Schonen“ hat ebenso wie englisch „Scania“ vermutlich dieselbe Etymologie wie „Skandinavien“ („Scandinavia“).[10][11][12][13] Die südlichste Spitze <strong>de</strong>s<br />
heutigen Schwe<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Römern Scania genannt. Der Name stammt möglicherweise von <strong>de</strong>m germanischen Wortstamm *Skaðin-awjo ab, welcher im Altnordischen als<br />
Skáney auftritt.[14] Nach Ansicht einiger Forscher kann die Be<strong>de</strong>utung mit <strong>de</strong>r germanischen Wurzel *Skaðan- („Gefahr“ o<strong>de</strong>r „Scha<strong>de</strong>n“) in Verbindung gebracht wer<strong>de</strong>n.[15] Dieselbe<br />
Wurzel skan besitzt auch <strong>de</strong>r Name <strong>de</strong>r Stadt Skanör in Schonen, kombiniert mit <strong>de</strong>r Endung ör, welche „Sandbänke“ be<strong>de</strong>utet.<br />
Æthelweard, ein angelsächsischer Historiker, berichtet von Scani,[16] und in <strong>de</strong>r fiktionalen Erzählung Beowulf wer<strong>de</strong>n die Namen Sce<strong>de</strong>nige und Sce<strong>de</strong>land für das „dänische Land“<br />
genannt.[17]<br />
Sprache<br />
Amtssprache und Umgangssprache in Schonen ist Schwedisch. Die meisten Schonen sprechen jedoch mehr o<strong>de</strong>r weniger stark Dialekt. Das in Schonen gesprochene Schwedisch weist<br />
noch immer einige Merkmale <strong>de</strong>s Dänischen auf.
Kultur<br />
• In Lund, <strong>de</strong>m ursprünglichen kulturellen Zentrum Schonens, bis ca. 1400 auch Dänemarks, und <strong>de</strong>r im Mittelalter führen<strong>de</strong>n Stadt Skandinaviens, befin<strong>de</strong>t sich mit <strong>de</strong>m Dom <strong>zu</strong><br />
Lund (1085–1145) das einzige reine romanische Sakralbauwerk Skandinaviens.<br />
• Im Jahr 1666 wur<strong>de</strong> die Universität Lund gegrün<strong>de</strong>t.<br />
• Selma Lagerlöf lässt die Reise Nils Holgerssons auf <strong>de</strong>m Rücken <strong>de</strong>s Gänserichs über „<strong>de</strong>m großen gewürfelten Tuch“ von Schonen beginnen.<br />
• Durch die Kriminalromane <strong>de</strong>s aus Härjedalen stammen<strong>de</strong>n Autors Henning Mankell, die meist im Umfeld von Ystad spielen, wur<strong>de</strong> Schonen literarisch bekannter, obwohl<br />
Mankell insbeson<strong>de</strong>re die Winter meist als grau, nass und <strong>de</strong>primierend beschrieb.<br />
• An <strong>de</strong>r Küste bei Kåseberga östlich von Ystad, liegen die Ales Stenar, die größte Steinset<strong>zu</strong>ng Skandinaviens.<br />
• Bei Simrishamn liegt die mittelalterliche Burg Glimmingehus.<br />
Berühmte Schonen (auch Schoninger genannt) [Bearbeiten]<br />
• Rollo (Hrolf Ganger), <strong>de</strong>r erste Lehnsherr <strong>de</strong>r Normandie<br />
• Tycho Brahe, kaiserlicher Hofastronom<br />
• Dietrich Buxtehu<strong>de</strong>, Organist und Komponist <strong>de</strong>s Barock<br />
• Marie Fredriksson, Sängerin<br />
• Per Albin Hansson, ehemaliger Premierminister von Schwe<strong>de</strong>n<br />
• Gustaf Wilhelm Palm, Maler<br />
• Ruben Rausing, Erfin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Tetra-Paks<br />
• Gunhild Sehlin, Kin<strong>de</strong>rbuchautorin<br />
• Birgit Nilsson, Opernsängerin<br />
• Jarl Kulle, Schauspieler<br />
• Max von Sydow, Schauspieler<br />
• Anita Ekberg, Mo<strong>de</strong>l und Schauspielerin<br />
• Siw Malmkvist, Schlagersängerin<br />
• Stellan Skarsgård, Schauspieler<br />
• Henrik Larsson, Fußballspieler<br />
• Eagle-Eye Cherry, Pop-Sänger<br />
• Zlatan Ibrahimović, Fußballspieler<br />
Landschaftssymbole<br />
• Blume: Margerite<br />
• Tier: Rothirsch<br />
• Vogel: Rotmilan
• Fisch: Aal<br />
Statistik<br />
• Bevölkerung: 1.184.500 (31. Dezember 2006) = 13% <strong>de</strong>r Bevölkerung Schwe<strong>de</strong>ns[18]<br />
• davon Auslän<strong>de</strong>r: 64.437<br />
• Fläche: 11.368 km²<br />
• Landwirtschaftlich genutzt: 5.607 km² (49,4%)<br />
• Bewal<strong>de</strong>t: 3.825 km² (33,7%)<br />
• Bevölkerungsdichte: 104 Bewohner/km²<br />
• Arbeitslosenquote: 2,3% (Juli 2008)[19]<br />
• Mittlere Temperatur<br />
• Januar: 0 bis −2° C<br />
• Juli: 17° C<br />
• Jährliche Nie<strong>de</strong>rschläge: 500–800 mm<br />
• Höchste Erhebung: Sö<strong>de</strong>råsen 211 m ü.d.M.<br />
• Größter See: Ivösjön<br />
Literatur<br />
Film<br />
• Magistri Adam Bremensis: Gesta Hammaburgensis ecclesiae Pontificum (Bischofsgeschichte <strong>de</strong>r Hamburgischen Kirche) In: Quellen <strong>de</strong>s 9. und 11. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong>r Geschichte<br />
<strong>de</strong>r Hamburgischen Kirche und <strong>de</strong>s Reiches. Darmstadt 1978, ISBN 3-534-00602-X.<br />
• Eldbjørg Haug: Margrete. Den siste Dronning i Sverreætten.Oslo 2000, ISBN 82-02-17642-5.<br />
• Arbetsförmedlingen (PDF-Datei; 11 kB)<br />
• Fredrik Svanberg: Vikingati<strong>de</strong>n i Skåne. Lund 2000, ISBN 91-89442-04-0.<br />
• Bil<strong>de</strong>rbuch: Südschwe<strong>de</strong>n – Halbinsel Schonen. Dokumentation, Deutschland, 45 Min., Produktion: NDR, Buch und Regie: Cornelius Kob, Erstausstrahlung: 16. November<br />
2008, Inhaltsangabe <strong>de</strong>r ARD<br />
Einzelnachweise und Anmerkungen<br />
1. ↑ Folkmängd i landskapen<br />
2. ↑ Svanberg, S. 12<br />
3. ↑ Herbert Jankuhn und an<strong>de</strong>re: Völker und Stämme Südostschleswigs im frühen Mittelalter. Schleswig 1952, S. 151 ff.<br />
4. ↑ Verum Westragothia confinis est provinciae Danorum, quae Sconia dicitur (Västergötland grenzt an die dänische Provinz, die Schonen genannt wird.) Adam IV 23.<br />
5. ↑ Svanberg a.a.O.
6. ↑ Svanberg, S. 17.<br />
7. ↑ Svanberg, S. 93.<br />
8. ↑ Haug, S. 46. Ein Brief <strong>de</strong>s Königs vom 4. Juli 1343 aus Helsingborg beginnt mit <strong>de</strong>n Worten: „Magnus medr guds nad Noreghs Svyia ok Skana konongr …“ Diplomatarium<br />
Norvegicum Nr. 220:<br />
9. ↑ Søren Sørensen: Den danske litteratur begyn<strong>de</strong>r i Malmø, In: Nor<strong>de</strong>n Nu, Juni 2008<br />
10.↑ Einar Haugen: The Scandinavian Languages: An Introduction to Their History. Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1976.<br />
11.↑ Knut Helle (ed. E. I. Kouri et al.): The Cambridge History of Scandinavia. Cambridge University Press, Cambridge 2003, ISBN 0-521-47299-7; Introduction, p. XXII: “The<br />
name Scandinavia was used by classical authors in the first centuries of the Christian era to i<strong>de</strong>ntify Skåne and the mainland further north which they believed to be an island.”<br />
(„Der Name Skandinavien wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n klassischen [römischen] Autoren in <strong>de</strong>n ersten Jahrhun<strong>de</strong>rten <strong>de</strong>r christlichen Ära benutzt, um Skåne/Schonen und das nördliche<br />
Festland [Schwe<strong>de</strong>n, Norwegen, Finnland] <strong>zu</strong> bezeichnen, von <strong>de</strong>m sie glaubten, dass es eine Insel sei.“)<br />
12.↑ Kenneth R. Olwig: The Nature of Cultural Heritage, and the Culture of Natural Heritage—Northern Perspectives on a Contested Patrimony. In: International Journal of<br />
Heritage Studies, Vol. 11, No. 1, March 2005; Introduction, p. 3: “The very name ‘Scandinavia’ is of cultural origin, since it <strong>de</strong>rives from the Scanians or Scandians (the<br />
Latinised spelling of Skåninger), a people who long ago lent their name to all of Scandinavia, perhaps because they lived centrally, at the southern tip of the peninsula.” („Der<br />
Name ‚Skandinavien‘ selbst ist kultureller Herkunft, da er sich von <strong>de</strong>n Scanians o<strong>de</strong>r Scandians (latinisierte Form von Skåninger) herleitet, einem Volk, welches sehr früh<br />
seinen Namen ganz Skandinavien lieh – vielleicht weil sie zentral am Sü<strong>de</strong>n<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Halbinsel lebten.“)<br />
13.↑ Uffe Østergård: The Geopolitics of Nordic I<strong>de</strong>ntity – From Composite States to Nation States. In: Øystein Sørensen, Bo Stråth (eds.): The Cultural Construction of Nor<strong>de</strong>n.<br />
Scandinavian University Press, Oslo 1997, p. 25–71.<br />
14.↑ Carl Edlund An<strong>de</strong>rson: Formation and Resolution of I<strong>de</strong>ological Contrast in the Early History of Scandinavia. PhD dissertation, Department of Anglo-Saxon, Norse & Celtic<br />
(Faculty of English), University of Cambridge, 1999.<br />
15.↑ Knut Helle (ed. E. I. Kouri et al.): The Cambridge History of Scandinavia. Cambridge University Press, Cambridge 2003, ISBN 0-521-47299-7; Introduction.<br />
16.↑ Erik Björkman: Studien über die Eigennamen im Beowulf. M. Sändig, 1973, ISBN 3-500-28470-1, p. 99.<br />
17.↑ Richard North: Heathen Gods in Old English Literature. Cambridge University Press, Cambridge 1997, ISBN 0-521-55183-8, p. 192.<br />
18.↑ Statistiska Centralburån Befolkning.<br />
19.↑ Arbetsförmedlingen<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Visby<br />
Visby (<strong>de</strong>utsch auch Wisby) ist eine Stadt an <strong>de</strong>r Westküste <strong>de</strong>r schwedischen Ostseeinsel Gotland. Visby ist die Hauptstadt <strong>de</strong>r Provinz Gotlands län in <strong>de</strong>r historischen Provinz Gotland
und Hauptort <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Gotland sowie Bischofssitz <strong>de</strong>s gleichnamigen Bistums. Das Stadtwappen zeigt das Lamm Gottes.[2]<br />
Geschichte<br />
Der Name Visby (nord. „vi“ = Opferplatz) <strong>de</strong>utet darauf hin, dass <strong>de</strong>r Ort vorchristliche Be<strong>de</strong>utung hatte. Die Spuren <strong>de</strong>r ältesten Besiedlung sind spärlich, aber seit <strong>de</strong>r Wikingerzeit (ab<br />
800 n. Chr.) ist <strong>de</strong>r Platz kontinuierlich bewohnt wor<strong>de</strong>n. Überreste von Holzhäusern wur<strong>de</strong>n im Almedalen gefun<strong>de</strong>n. Das älteste erhaltene Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt ist „Kruttornet“ (<strong>de</strong>r<br />
„Pulverturm“), nach 1151 angelegt.<br />
1161 erteilte Heinrich <strong>de</strong>r Löwe mit <strong>de</strong>m Artlenburger Privileg ein Han<strong>de</strong>lsprivileg, das die Rechtssicherheit in <strong>de</strong>r Ostsee herstellte. Während <strong>de</strong>r Hun<strong>de</strong>rte von Jahren andauern<strong>de</strong>n<br />
Missionen und Christianisierung Nord- und Osteuropas, angefangen mit Ansgar, wur<strong>de</strong> Visby die Mutterstadt <strong>de</strong>r um 1200 gegrün<strong>de</strong>ten Stadt Riga in Livland (heute Lettland). Visby war<br />
erster Hauptort <strong>de</strong>r Hanse in <strong>de</strong>r Ostsee, und die Gotlandfahrer hatten spezielle Privilegien. Lange Zeit waren die Hälfte <strong>de</strong>r Bürger Visbys Deutsche. Das 13. und 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt waren<br />
die Blütezeit <strong>de</strong>r Insel, und die Stadt erhielt <strong>de</strong>n Beinamen „Regina Maris“ (Königin <strong>de</strong>s Meeres). Trotz<strong>de</strong>m eskalierte 1288/89 <strong>de</strong>r Konflikt, <strong>de</strong>n die Stadt mit <strong>de</strong>m verarmen<strong>de</strong>n Umland<br />
hatte, <strong>zu</strong> einem blutigen Bürgerkrieg, <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r schwedische König Magnus Ladulås (König 1275–1290) been<strong>de</strong>te. Gotland hatte bis dahin separate Herrscher.<br />
1361 wur<strong>de</strong> Visby vom dänischen König Wal<strong>de</strong>mar IV. Atterdag (König 1340–1375) erobert. Von 1394 bis 1398 suchten die Vitalienbrü<strong>de</strong>r Schutz hinter Visbys Stadtmauern. Bis <strong>zu</strong>r<br />
Vertreibung durch ein Heer <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns erlangten die Vitalienbrü<strong>de</strong>r von Visby aus die Seeherrschaft in <strong>de</strong>r Ostsee. Insel und Stadt fielen bereits 1408 wie<strong>de</strong>r an Dänemark.<br />
1411 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r Visborg begonnen.<br />
Visby wur<strong>de</strong> 1525 von Truppen <strong>de</strong>r Hansestadt Lübeck angegriffen. Es wur<strong>de</strong>n unter an<strong>de</strong>rem alle Kirchen mit Ausnahme <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kaufmannskirche St. Marien, <strong>de</strong>m heutigen<br />
Dom St. Maria, zerstört.<br />
Durch <strong>de</strong>n 1645 geschlossenen Frie<strong>de</strong>n von Brömsebro wur<strong>de</strong> Visby mit Gotland ein Teil Schwe<strong>de</strong>ns.<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
Die „Hansestadt Visby“ wur<strong>de</strong> bereits 1805 unter Denkmalschutz gestellt, seit 1995 ist sie mit ihren zahlreichen mittelalterlichen Bauten Teil <strong>de</strong>s Weltkulturerbes <strong>de</strong>r UNESCO.<br />
Außer<strong>de</strong>m steht die ganze Innenstadt als Gebiet von „Reichsinteresse“ unter Denkmalschutz.[3] Herausragen<strong>de</strong>r Teil ist die fast vollständig erhaltene 3,6 km lange mittelalterliche<br />
Stadtmauer mit <strong>de</strong>r Ruine <strong>de</strong>r Visborg. Die Stadt gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n sehenswertesten Städten in Schwe<strong>de</strong>n, wo<strong>zu</strong> auch <strong>de</strong>r Dom <strong>zu</strong> Visby, ursprünglich Sankt-Maria-Kirche aus <strong>de</strong>m 13.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt, sowie einige <strong>de</strong>r zahlreichen Kirchenruinen wie St. Karin und St. Nikolaus beitragen.<br />
Seit 1984 fin<strong>de</strong>t je<strong>de</strong>s Jahr Anfang August – stets in <strong>de</strong>r 32. Kalen<strong>de</strong>rwoche – auf Gotland und vor allem in Visby die Me<strong>de</strong>ltidsveckan (Mittelalterwoche) statt, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Living-History-<br />
Darsteller aus ganz Europa anreisen. Die Festwoche mit großem historischen Spektakel, Ritterturnieren, Konzerten, mittelalterlichem Markt und an<strong>de</strong>ren Kulturveranstaltungen erinnert<br />
an die Eroberung <strong>de</strong>r Stadt und <strong>de</strong>r Insel Gotland durch <strong>de</strong>n dänischen König Wal<strong>de</strong>mar IV. Atterdag im Jahre 1361.<br />
Am ehemaligen Hafen aus <strong>de</strong>m Mittelalter, <strong>de</strong>r heute verlan<strong>de</strong>t ist, befin<strong>de</strong>t sich die Hochschule auf Gotland.<br />
Etwa fünf Autominuten von Visby liegt <strong>de</strong>r Freizeit- und Vergnügungspark Kneippbyn, u.a. mit <strong>de</strong>m Originalgebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Villa Kunterbunt, bekannt aus Astrid Lindgrens Pippi-<br />
Langstrumpf-Büchern. 13 Kilometer nördlich von Visby liegt am Weg <strong>zu</strong>r Kirche von Lummelunda das Naturschutzgebiet <strong>de</strong>r Grotte von Lummelunda, die vom Fluß Lummelundaån<br />
durchflossen wird.<br />
Energieversorgung<br />
In <strong>de</strong>r Nähe von Visby befin<strong>de</strong>t sich seit 1999 die erste Stromrichterstation <strong>zu</strong>r HGÜ-Ankopplung eines Windparks.<br />
Verkehr
In Visby verkehren eine Ost-West- und eine Nord-Süd-Buslinie. Von Montag bis Samstag besteht <strong>zu</strong>r Hauptverkehrszeit ein 15-Minuten-Takt. An Sonn- und Feiertagen ruht <strong>de</strong>r Betrieb.<br />
Mit <strong>de</strong>m schwedischen Festland ist Visby verbun<strong>de</strong>n durch Fähren nach Oskarshamn in Småland und nach Nynäshamn südlich von Stockholm. Der Flughafen Visby liegt rund fünf<br />
Kilometer von <strong>de</strong>r Stadt entfernt.<br />
Städtepartnerschaften<br />
Städtepartnerschaften bestehen mit Lübeck in Schleswig-Holstein und Soest in Nordrhein-Westfalen sowie <strong>zu</strong>r Stadt Rhodos auf <strong>de</strong>r gleichnamigen Insel in <strong>de</strong>r östlichen<br />
Ägäis,Griechenland.<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
• Jacob Niclas Ahlström (1805–1857), Komponist<br />
• Elfrida Andrée (1841–1929), Komponistin<br />
• Eric Gadd (* 1965), Sänger und Songschreiber<br />
• Lars Gullin (1928–1976), Jazz-Saxophonist (Bariton)<br />
• Gabriel Gustafson (1853–1915), Archäologe<br />
• Thomas Ihre (1659–1720), Theologe<br />
• Erik af Klint (1816–1866), schwedischer Seeoffizier in österreichischen Diensten<br />
• Håkan Loob (* 1960), ehemaliger schwedischer Eishockeyspieler<br />
• Thomas Lövkvist (* 1984), Radrennfahrer<br />
• Jakob Pleskow (um 1323–1381), Bürgermeister <strong>de</strong>r Hansestadt Lübeck<br />
• Christopher Polhem, Wissenschaftler und Erfin<strong>de</strong>r<br />
• Hermann Swerting (1280–1342), <strong>de</strong>utsch-gotländischer Hansekaufmann und Bürgermeister in Visby<br />
• Simon Swerting (vor 1340–nach 1388), Bürgermeister von Lübeck<br />
Literatur<br />
• Robert Bohn: Wisby – Die Keimzelle <strong>de</strong>s hansischen Ostseehan<strong>de</strong>ls. In: Jörgen Bracker (Hrsg.): Die Hanse – Lebenswirklichkeit und Mythos, 2 B<strong>de</strong>., Hamburg 1989. In:<br />
Katalog <strong>de</strong>r Ausstellung <strong>de</strong>s Museums für Hamburgische Geschichte in Hamburg 24. August – 24. November 1989, S. 269–282. Textteil in 4. Auflage, Schmidt-Römhild,<br />
Lübeck 2006. ISBN 3-7950-1275-9<br />
• Marita Jonsson/Sven-Olof Lindquist: Kulturführer Gotland. <strong>de</strong>utsch Visby 1993, ISBN 91-88036-09-X<br />
• Ulrich Quack: Gotland: die größte Insel <strong>de</strong>r Ostsee; eine schwedische Provinz von beson<strong>de</strong>rem Reiz; Kultur, Geschichte, Landschaft. DuMont Köln 1991, ISBN 3-7701-2415-4<br />
Literarisches<br />
• Selma Lagerlöf: Wal<strong>de</strong>mar Atterdag brandschatzt Visby (erzählt wird die Sage von <strong>de</strong>m jungen Mädchen, das sich in einen <strong>de</strong>r Fein<strong>de</strong> verliebte und ihnen die Stadtpforte<br />
öffnete; sie wur<strong>de</strong> lebendig eingemauert)
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Kopenhagen - København<br />
Kopenhagen (dänisch København, mitteldänisch Køpmannæhafn = „Kaufmannshafen“, latein Hafnia, schwed. Köpenhamn) ist die Hauptstadt Dänemarks und das kulturelle und<br />
wirtschaftliche Zentrum <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Sie ist außer<strong>de</strong>m Sitz <strong>de</strong>s Parlaments (Folketing), <strong>de</strong>r Regierung und <strong>de</strong>s Königshauses.<br />
Kopenhagen gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n be<strong>de</strong>utendsten Metropolen Nor<strong>de</strong>uropas und zählt dort <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n meistbesuchten Städten. Die Stadt hat 528.208 Einwohner (2010)[5] (inklusive<br />
Hovedstadsområ<strong>de</strong>t 1.181.239 (2010)[6]) und gehört <strong>zu</strong>r dänischen Verwaltungsregion Region Hovedsta<strong>de</strong>n.<br />
Geografie<br />
Kopenhagen liegt auf Dänemarks größter Insel Seeland (Sjælland), von <strong>de</strong>r Stadt Malmö im schwedischen Schonen durch <strong>de</strong>n Öresund getrennt. Ein kleinerer Teil Kopenhagens liegt<br />
auf <strong>de</strong>r Insel Amager. Geologisch befin<strong>de</strong>t sich die gesamte Stadt auf <strong>de</strong>r eiszeitlichen Grundmoränenlandschaft, die weite Teile Dänemarks einnimmt. Bei Kopenhagen ruht die Moräne<br />
auf relativ hoch gelegenem Kalkstein, <strong>de</strong>r aus Krei<strong>de</strong>kalkstein <strong>de</strong>r Oberkrei<strong>de</strong> (Maastricht) besteht und beim Bau <strong>de</strong>r Metro erhebliche Probleme mit sich brachte.<br />
Unterschie<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n muss zwischen <strong>de</strong>r eigentlichen Stadt Kopenhagen, <strong>de</strong>m Großraum Kopenhagen, Groß-Kopenhagen, <strong>de</strong>m ehemaligen Verkehrsverbund und <strong>de</strong>r Hauptstadtregion:<br />
• Zur Stadt Kopenhagen gehören <strong>de</strong>r eigentliche, von <strong>de</strong>n Kopenhagener Seen und <strong>de</strong>m Hafen umgebene Stadtkern, die „Brückenquartiere“ (Brokvarterer): Østerbro, Nørrebro,<br />
Vesterbro, Amagerbro; die Stadtteile Christianshavn, Ørestad, Islands Brygge, Valby, Vanløse und Brønshøj; aber nicht die eigenständige, kreisfreie Gemein<strong>de</strong> Fre<strong>de</strong>riksberg.<br />
• Der Großraum Kopenhagen (Hovedstadsområ<strong>de</strong>t) umfasst die Städte Kopenhagen, Fre<strong>de</strong>riksberg sowie das Gebiet <strong>de</strong>s ehemaligen Regierungsbezirks Københavns Amt, bil<strong>de</strong>t<br />
aber keine eigenständige Verwaltungseinheit. Kopenhagen und die schwedischen Städte Malmö und Lund bil<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>sammen eine grenzüberschreiten<strong>de</strong> Metropolregion, die<br />
Öresundregion.<br />
• Zum ehemaligen Verkehrsverbund (HT-områ<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r Hovedstadsregionen, nicht <strong>zu</strong> verwechseln mit Region Hovedsta<strong>de</strong>n) gehören <strong>de</strong>r Großraum Kopenhagen sowie das<br />
Gebiet, das in etwa von Helsingør über Fre<strong>de</strong>rikssund und Roskil<strong>de</strong> bis nach Køge abgegrenzt ist, teilweise erstreckt sich <strong>de</strong>r Verbund noch etwas weiter. Landgebiet: 2673 km²;<br />
Einwohner: 1.835.467 (2008); 686 Ew./km². Die Gemein<strong>de</strong>n Greve, Solrød, Køge, Roskil<strong>de</strong> und Lejre wer<strong>de</strong>n statistisch Østsjælland (Ost-Seeland) genannt. Die seit <strong>de</strong>m 1.<br />
Januar 2007 bestehen<strong>de</strong> neue Verkehrsverbundgesellschaft heißt Trafikselskabet Movia und umfasst ganz Ostdänemark (45 Kommunen), jedoch ohne die Kommune Bornholm.<br />
• Die Hauptstadtregion Region Hovedsta<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Kommunalreform vom 1. Januar 2007 eingeführt. Sie ist weitgehend i<strong>de</strong>ntisch mit <strong>de</strong>m HT-områ<strong>de</strong>, umfasst jedoch<br />
<strong>zu</strong>sätzlich Bornholm, während Roskil<strong>de</strong> außerhalb liegt.*<br />
• Schließlich existiert <strong>zu</strong>sätzlich <strong>de</strong>r Begriff Storkøbenhavn (Groß-Kopenhagen), <strong>de</strong>r überwiegend dasselbe Gebiet wie das Hovedstadsområ<strong>de</strong>t umfasst.<br />
Die Gemein<strong>de</strong>n in nächster Nähe von und einschließlich Kopenhagens, insgesamt 33, machen 6,3 Prozent <strong>de</strong>s Gesamtgebiets von Dänemark aus und wer<strong>de</strong>n von 33,5 % seiner<br />
Gesamtbevölkerung bewohnt. Stevns Kommune gehört in Zukunft statistisch <strong>zu</strong> Vest- og Sydsjælland.
Geschichte<br />
Mittelalter und frühe Neuzeit<br />
Im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> am Øresund eine Burg errichtet, die <strong>de</strong>n kleinen Han<strong>de</strong>lshafen nach Schonen und Amager an <strong>de</strong>r Fischersiedlung Havn („Hafen“) sichern sollte. Nicht <strong>zu</strong>letzt<br />
die günstige Lage ungefähr halbwegs zwischen <strong>de</strong>m wichtigen Bischofssitz in Roskil<strong>de</strong> und <strong>de</strong>m skandinavischen Erzbischofssitz in Lund (damals dänisch) war von entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r<br />
Be<strong>de</strong>utung. Entsprechend erhielt auch die mit <strong>de</strong>r Burg neu gestaltete Siedlung <strong>de</strong>n Namen Køpmannæhafn („Kaufmännerhafen“). 1254 erhielt das junge Kopenhagen von Bischof Jakob<br />
Erlandsen sein erstes Stadtrecht, allerdings wur<strong>de</strong> die Stadt in <strong>de</strong>n Jahren 1362 und 1368 als unliebsamer Konkurrent <strong>de</strong>r Hanse <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Burg zerstört.<br />
Die Entwicklung ließ sich jedoch nicht mehr aufhalten: 1416 wur<strong>de</strong> die wie<strong>de</strong>raufgebaute Stadt Resi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>s Königs, und 1443 übernahm sie von Roskil<strong>de</strong> die Hauptstadtfunktion. In<br />
<strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts blühte Kopenhagen unter Christian IV. Auf.<br />
Kopenhagen erlebte in seiner Geschichte immer wie<strong>de</strong>r Katastrophen, Seuchen und Kriege. Von 1658 bis 1659 hielt die Stadt einer Belagerung stand, während das übrige Dänemark von<br />
<strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n vollständig besetzt war. Im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt starb nach Pest und Seuchen ein Drittel <strong>de</strong>r Stadtbewohner. 1728 sowie 1795 wüteten zwei Stadtbrän<strong>de</strong>. Der Wie<strong>de</strong>raufbau<br />
führte <strong>zu</strong>r heutigen, vom Baustil <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts geprägten Altstadt. Bei <strong>de</strong>r Seeschlacht von Kopenhagen 1801 sowie 1807 beschossen die Englän<strong>de</strong>r die Hauptstadt Dänemarks, da<br />
es sich nicht auf die Seite Englands in <strong>de</strong>ssen Krieg gegen Frankreich stellen wollte, und richteten vor allem durch <strong>de</strong>n im zweiten Angriff ausgelösten Großbrand erheblichen Scha<strong>de</strong>n<br />
an. Nach <strong>de</strong>m Sieg <strong>de</strong>r Englän<strong>de</strong>r musste Kopenhagen sämtliche hier ankern<strong>de</strong>n Schiffe ausliefern und konnte sich erst nach Jahrzehnten wie<strong>de</strong>r von dieser Nie<strong>de</strong>rlage erholen. 1848<br />
zwangen öffentliche Demonstrationen in Kopenhagen König Fre<strong>de</strong>rik VII. <strong>zu</strong> Reformen und <strong>de</strong>m Erlass eines Grundgesetzes. Mit <strong>de</strong>n nationalen Spannungen und Dänemarks Verlust<br />
von Schleswig und Holstein im Krieg von 1864 verließen auch viele <strong>de</strong>utschsprachige Beamte und Kaufleute die Stadt, die sie bis dahin jahrhun<strong>de</strong>rtelang mitgeprägt hatten.<br />
Frühes 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Mit <strong>de</strong>r Industrialisierung im späten 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt wuchs die Stadt durch Zuwan<strong>de</strong>rung vom Land rasch an. Die Befestigungsanlagen wur<strong>de</strong>n geschleift und teilweise in Parks (unter<br />
an<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>n Tivoli, Ørstedsparken und Østre Anlæg) umgewan<strong>de</strong>lt. Die am östlichen En<strong>de</strong> gelegene Wallanlage sowie die Festung Kastellet sind jedoch erhalten. Um die Mittelalterstadt<br />
herum wuchsen schnell Arbeiter- und Bürgerviertel, die bis heute noch aus um 1870 bis 1900 gebauten Häusern bestehen.<br />
Zweiter Weltkrieg<br />
Am 9. April 1940 wur<strong>de</strong> Kopenhagen kampflos von <strong>de</strong>utschen Truppen eingenommen. Die Stadt blieb wie das übrige Dänemark bis <strong>zu</strong>m 5. Mai 1945 besetzt, aber bis auf wenige<br />
Ausnahmen von Kriegszerstörungen verschont. Einige Industriebauten wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Ziel von Angriffen dänischer Wi<strong>de</strong>rstandskämpfer. Als am 29. August 1943 die dänische Regierung<br />
<strong>zu</strong>rücktrat, folgte eine unruhige Zeit. Im Juni 1944 begann im Arbeiterviertel Nørrebro ein gegen die Besat<strong>zu</strong>ngsmacht gerichteter Generalstreik, <strong>de</strong>r sich auf ganz Dänemark ausbreitete.<br />
Im August 1944 wur<strong>de</strong>n im Zuge einer Vergeltungsaktion weite Teile <strong>de</strong>s Tivolis, die Königliche Porzellanmanufaktur, ein Bürgerversammlungshaus und ein Stu<strong>de</strong>ntenwohnheim von<br />
<strong>de</strong>r Schalburg-Gruppe, einem dänischen SS-Korps, gesprengt. Am 21. März 1945 bombardierten alliierte Flugzeuge das Shell-Haus, das von <strong>de</strong>n Deutschen als Gestapo-Hauptquartier<br />
benutzt wur<strong>de</strong>; dabei kamen etwa 125 Menschen um. Eines <strong>de</strong>r niedrig fliegen<strong>de</strong>n, angreifen<strong>de</strong>n Flugzeuge streifte am Bahnhof einen Lichtmast und stürzte bei <strong>de</strong>r Französischen<br />
Schule ab. Die darauffolgen<strong>de</strong> Explosion ließ nachfolgen<strong>de</strong> Piloten glauben, das sei das Ziel, worauf von ihnen die Schule bombardiert wur<strong>de</strong>; insgesamt 900 Menschen kamen dabei<br />
um. Von diesem Bombar<strong>de</strong>ment in <strong>de</strong>n letzten Tagen <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges abgesehen, blieb Kopenhagen von Kriegszerstörungen verschont.<br />
Neuere Geschichte<br />
1948 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r „Fingerplan“ entworfen. Wie die ausgestreckten Finger einer Hand sollten Vororte an fünf S-Bahnlinien entlang ausgebaut wer<strong>de</strong>n, während das Land zwischen <strong>de</strong>n<br />
Fingern als grüne Zonen erhalten blieb. Von circa 1960 bis 1990 sank die Einwohnerzahl <strong>de</strong>r Stadt, da viele Menschen in die Vororte zogen.<br />
Seit 1990 fin<strong>de</strong>t eine neue Stadtentwicklung statt, unter an<strong>de</strong>rem mit <strong>de</strong>r Errichtung vieler mo<strong>de</strong>rner Bauten am Hafen, wie <strong>zu</strong>m Beispiel <strong>de</strong>s „Schwarzen Diamanten“ (Königliche<br />
Bibliothek), <strong>de</strong>s 2005 eröffneten Opernhauses und <strong>de</strong>s 2008 eröffneten neuen Schauspielhauses. Die 2002 eingeweihte Metro soll bis 2015 auf mehrere Linien erweitert wer<strong>de</strong>n. 2000
wur<strong>de</strong> die Öresundverbindung eröffnet und <strong>de</strong>r südschwedische Raum um Malmö durch ein regionales Schnell<strong>zu</strong>gnetz mit Kopenhagen verbun<strong>de</strong>n. Arbeits- und Wohnungsmarkt<br />
bei<strong>de</strong>rseits <strong>de</strong>s Öresunds sind <strong>zu</strong>m Teil <strong>zu</strong>sammengewachsen. Kopenhagen erlebt einen Zustrom von wissensbasierten und kreativen Betrieben sowie von Stu<strong>de</strong>nten aus ganz<br />
Skandinavien und bleibt das unbestrittene Kraftzentrum Dänemarks. Als Ergebnis stiegen jedoch Wohnungspreise und Verkehrsprobleme kräftig an. Der Bau von Hochhäusern wur<strong>de</strong><br />
vorgeschlagen, die <strong>de</strong>m Wohnungsmangel abhelfen und <strong>de</strong>r Stadt ein „Metropolgepräge“ geben sollten; von Gegnern wird jedoch hervorgehoben, dass eben die Abwesenheit von hohen<br />
Bauten charakteristisch für Kopenhagen sei.<br />
In <strong>de</strong>n ersten Monaten <strong>de</strong>s Jahres 2007 kam es <strong>zu</strong> gewalttätigen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen Polizei und Jugendlichen, insbeson<strong>de</strong>re Autonomen, die auch international Beachtung<br />
fan<strong>de</strong>n. Hintergrund war die Räumung <strong>de</strong>s autonomen Jugendzentrums Ungdomshuset.<br />
Im Jahre 2009 fand am 7. bis 18. Dezember o, Bella Center in Kopenhagen die 15. UN-Klimakonferenz, <strong>de</strong>r Vertragsstaaten <strong>de</strong>r Klimakonvention <strong>de</strong>r vereinten Nationen statt. Es war<br />
gleichsam das 5. Treffen im Rahmen <strong>de</strong>s Kyoto-Protokolls.<br />
Laut <strong>de</strong>r Forbes-Liste <strong>de</strong>r World's Most Expensive Cities To Live von 2009 gilt Kopenhagen als eine <strong>de</strong>r teuersten Städte <strong>de</strong>r Welt.[7]<br />
Einwohnerentwicklung<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r Einwohnerzahl (ab 1971: per 1. Januar):<br />
• 1450 – ca. 4–5.000<br />
• 1500 – ca. 10.000<br />
• 1650 – ca. 30.000<br />
• 1700 – ca. 65.000<br />
• 1769 – 80.000<br />
• 1787 – 90.032<br />
• 1801 – 100.975<br />
• 1840 – 120.819<br />
• 1850 – 129.695<br />
• 1860 – 155.143<br />
• 1870 – 181.291<br />
• 1880 – 234.850<br />
• 1890 – 312.859<br />
• 1901 – 360.787<br />
• 1901 – 400.575<br />
• 1911 – 462.161<br />
• 1921 – 561.344<br />
• 1930 – 617.069<br />
• 1940 – 700.465<br />
• 1950 – 768.105
• 1960 – 721.381<br />
• 1963 – 706.000<br />
• 1966 – 678.000<br />
• 1970 – 622.773<br />
• 1971 – 625.678<br />
• 1972 – 610.985<br />
• 1973 – 595.751<br />
• 1974 – 576.030<br />
• 1975 – 562.405<br />
• 1976 – 545.350<br />
• 1977 – 529.154<br />
• 1978 – 515.594<br />
• 1979 – 505.974<br />
• 1980 – 498.850<br />
• 1985 – 478.615<br />
• 1990 – 466.723<br />
• 1992 – 464.566<br />
• 1995 – 471.300<br />
• 1999 – 491.082<br />
• 2000 – 495.699<br />
• 2001 – 499.148<br />
• 2002 – 500.531<br />
• 2003 – 501.289<br />
• 2004 – 501.664<br />
• 2005 – 502.362<br />
• 2006 – 501.158<br />
• 2007 – 503.699<br />
• 2008 – 509.861<br />
• 2009 – 518.574<br />
Im Verhältnis <strong>zu</strong> an<strong>de</strong>ren europäischen Hauptstädten hat Kopenhagens Innenstadt nur wenige Einwohner. Das liegt daran, dass Kopenhagen nie durch größere Eingemeindungen<br />
erweitert wur<strong>de</strong>. Selbst die Gemein<strong>de</strong> Fre<strong>de</strong>riksberg mit 95.029 (Stand: 2009; am 7. November 1950: 118.993) Einwohnern, die von <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Kopenhagen vollständig umgeben ist,<br />
wur<strong>de</strong> nicht eingemein<strong>de</strong>t. Hintergrund dafür ist, dass aufgrund <strong>de</strong>r Erfahrungen im Ausland in <strong>de</strong>n politisch von <strong>de</strong>n Konservativen geprägten Umlandgemein<strong>de</strong>n eine Einvernahme<br />
durch die Sozial<strong>de</strong>mokraten befürchtet wur<strong>de</strong>, während diese einen Verlust ihres Einflusses im Stadtgebiet befürchteten. So sind alle mit <strong>de</strong>m jetzigen, ungewöhnlich erscheinen<strong>de</strong>n
Zustand <strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>n. Die <strong>zu</strong>sammenhängen<strong>de</strong> Besiedlung <strong>de</strong>hnt sich auf <strong>de</strong>n gesamten Großraum Kopenhagen - dänisch "Hovedstadsområ<strong>de</strong>t" - (Gemein<strong>de</strong>n Kopenhagen, Fre<strong>de</strong>riksberg<br />
und 16 weitere (davon fünf nur teilweise) Gemein<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Region Hovedsta<strong>de</strong>n und Greve Kommune in Region Sjælland) aus, mit insgesamt 1.153.615 Einwohnern (Stand: 2008).<br />
Politik<br />
Das Schloss Christiansborg ist Sitz <strong>de</strong>s Parlaments, <strong>de</strong>s Ministerpräsi<strong>de</strong>nten und <strong>de</strong>s Obersten Gerichts. Bedingt durch <strong>de</strong>n Hauptstadtcharakter sind in Kopenhagen die Botschaften und<br />
Emissäre von 187 Staaten vertreten.<br />
Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
Oper, Ballett und Schauspiel<br />
Das wohl berühmteste Theater <strong>de</strong>r Stadt ist das Königliche Theater. Das 1874 errichtete Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 1748 gegrün<strong>de</strong>ten Etablissements befin<strong>de</strong>t sich am Kongens Nytorv und bietet 1500<br />
Zuschauern Platz. Hier wer<strong>de</strong>n Opern- und Ballettaufführungen dargeboten. Seit 2005 wird ein zweites, mo<strong>de</strong>rnes Opernhaus bespielt: die Operaen, welches auf <strong>de</strong>r Insel Holmen liegt<br />
und ebenfalls <strong>zu</strong>m Kongelige Teater gehört. 2008 wur<strong>de</strong> am Hafen ein neues Schauspielhaus eröffnet.<br />
Im Mermaid-Theater (Mermaid Teater) wer<strong>de</strong>n alle angekündigten Vorstellungen in englischer Sprache dargeboten. Die bekanntesten dänischen Schauspieler treten hingegen im Ny-<br />
Theater auf.<br />
Im nördlichen Teil <strong>de</strong>s Kopenhagener Stadtteils Ørestad befin<strong>de</strong>t sich auf <strong>de</strong>r Insel Amager das neue Konzerthaus Kopenhagen (DR Koncerthuset). Es wur<strong>de</strong> nach Plänen <strong>de</strong>s<br />
französischen Architekten Jean Nouvel gebaut und im Januar 2009 eröffnet.<br />
Museen<br />
• Arken<br />
• Arsenal (Tojhusmuseet)<br />
• Statens Museum for Kunst<br />
• Davidsche Sammlung (Davids Samling) – Dänische Gemäl<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>m 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
• Eksperimentarium<br />
• Louis Tussaud's Wachsfigurenkabinett<br />
• Geologisches Museum<br />
• Museum Erotica<br />
• Arbeitermuseum<br />
• Kunstindustrimuseet<br />
• Hirschsprung-Sammlung<br />
• Tycho Brahe Planetarium<br />
• Ny Carlsberg Glyptotek<br />
• Thorvaldsen Museum mit Skulpturen von Bertel Thorvaldsen.<br />
• Medizinisch Historisches Museum<br />
• Nationalmuseum (Nationalmuseet) – Überblick über die dänische Geschichte von <strong>de</strong>r Steinzeit bis heute
• Stadtmuseum<br />
• Zoologisches Museum<br />
• Technisches Museum<br />
Bauwerke<br />
Die 1,25 Meter große Kleine Meerjungfrau (dän. Den lille Havfrue) <strong>de</strong>s Kopenhagener Bildhauers Edvard Eriksen (* 1876, † 1959) ist das bekannteste Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt, sie wur<strong>de</strong><br />
von <strong>de</strong>m Brauer Carl Jacobsen in Auftrag gegeben und am 23. August 1913 eingeweiht. Eriksen hatte für die Titelfigur <strong>de</strong>s Märchens von Hans Christian An<strong>de</strong>rsen das Gesicht <strong>de</strong>r<br />
damals in Kopenhagen berühmten Primaballerina Ellen Price und <strong>de</strong>n Körper seiner Frau Eline als Vorlage benutzt.<br />
Der gegenüber vom Hauptbahnhof gelegene Tivoli ist einer <strong>de</strong>r ältesten Freizeitparks <strong>de</strong>r Welt (<strong>de</strong>r älteste, Dyrehavsbakken, liegt im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt) und das 1960 von Arne Jacobsen<br />
errichtet Radisson SAS Royal Hotel, das erste Hochhaus in Kopenhagen. Am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Parks läuft <strong>de</strong>r HC An<strong>de</strong>rsens Boulevard entlang, an <strong>de</strong>m sich auch das Rathaus befin<strong>de</strong>t. Es<br />
wur<strong>de</strong> zwischen 1892 und 1905 im Stil <strong>de</strong>r italienischen und normannischen Renaissance erbaut. Das Gebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> am 12. September 1905 eingeweiht ist mit vielen Skulpturen<br />
geschmückt. Der Rathausturm ist mit 105,6 Metern Dänemarks höchster Turm.<br />
In <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r Universität Kopenhagens liegt die St.-Petri-Kirche (Sankt Petri Kirke). Sie ist seit 1586 Pfarrkirche <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Gemein<strong>de</strong> und die älteste erhaltene Kirche von<br />
Kopenhagen. Östlich schließt sich die Liebfrauenkirche (Vor Frue Kirke) an, das klassizistische Meisterwerk von Christian Fre<strong>de</strong>rik Hansen, ausgestattet mit Statuen von Bertel<br />
Thorvaldsen, darunter sein Segnen<strong>de</strong>r Christus.<br />
Weiter nördlich liegt <strong>de</strong>r 34.8 Meter hohe Run<strong>de</strong> Turm (Run<strong>de</strong> Tårn). Ein 209 Meter langer, stufenloser Wen<strong>de</strong>lgang führt auf diesen zwischen 1637 und 1642 erbauten Aussichtsturm<br />
hinauf. An <strong>de</strong>n Turm schließt sich die Dreifaltigkeitskirche (Trinitatis Kirke) an. Hier befin<strong>de</strong>n sich auch die Einkaufsstraßen Strøget und Stræ<strong>de</strong>t. Sie bil<strong>de</strong>n mit über einem Kilometer<br />
Länge eine <strong>de</strong>r längsten Fußgängerzonen Europas und sind ein beliebtes Einkaufszentrum.<br />
Zwischen <strong>de</strong>n Fußgängerzonen und <strong>de</strong>m In<strong>de</strong>rhavn erstreckt sich einer <strong>de</strong>r wichtigsten Touristenmagnete <strong>de</strong>r Stadt, das Schloss Christiansborg (Christiansborg Slot). Dieses Gebäu<strong>de</strong>,<br />
das seit 1918 Sitz <strong>de</strong>s Parlaments ist, befin<strong>de</strong>t sich an <strong>de</strong>r Stelle <strong>de</strong>r von Bischof Absalon im Jahre 1167 erbauten ersten Burg Kopenhagens. Der heutige Gebäu<strong>de</strong>komplex mit <strong>de</strong>m 90<br />
Meter hohen Schlossturm entstand während einer mehr als zwanzigjährigen Bauzeit in <strong>de</strong>n Jahren 1907 bis 1928. An <strong>de</strong>r Nordseite <strong>de</strong>s Schlosses steht die 1826 vollen<strong>de</strong>te klassizistische<br />
Schlosskirche (Slotskirke). Unmittelbar neben <strong>de</strong>m Schloss Christiansborg befin<strong>de</strong>t sich Børsen, die ehemalige Kopenhagener Börse. Dieser Renaissancebau entstand zwischen 1619 und<br />
1640 und ist mit seinem 54 Meter hohen Turm in Form von verschlungenen Drachenschwänzen ein weiteres Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt. Bis 1974 diente das Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>m ursprünglichen<br />
Zweck und wird seit <strong>de</strong>m als Bürogebäu<strong>de</strong> genutzt. Ebenfalls neben <strong>de</strong>m Schloss liegt die Königliche Bibliothek Dänemarks, die Nationalbibliothek.<br />
Über einen Kanal führt von hier aus die Børsbroen <strong>zu</strong>r Nationalbank und <strong>zu</strong>r Holmens Kirke, die genau gegenüber <strong>de</strong>r Börse und <strong>de</strong>m Schloss Christiansborg liegt. Sie wur<strong>de</strong> im 17.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt erbaut. Von <strong>de</strong>r Börse führt auch die Knippelsbro, eine interessante Klappbrücke, über <strong>de</strong>n In<strong>de</strong>rhavn nach Amager. Über sie gelangt man auch am besten <strong>zu</strong>r im Stadtteil<br />
Christianshavn gelegenen Erlöserkirche (Vor Frelsers Kirke). Diese barocke Kirche aus <strong>de</strong>n Jahren 1602 bis 1692 besitzt <strong>de</strong>n mit 93 Metern zweithöchsten Turm Kopenhagens. Er ist<br />
Wahrzeichen <strong>de</strong>s Stadtteils Christianshavn und lässt sich über eine 1752 konstruierte Wen<strong>de</strong>ltreppe besteigen.<br />
Eine ebenfalls herausragen<strong>de</strong> Sehenswürdigkeit ist <strong>de</strong>r Nyhavn. Diese Straße mit <strong>de</strong>n schmucken Giebelhäusern bei<strong>de</strong>rseits <strong>de</strong>s gleichnamigen Hafenarms ist Zentrum <strong>de</strong>r Gastronomie<br />
in Kopenhagen. Mehr da<strong>zu</strong> im Artikel Nyhavn.<br />
Am westlichen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Nyhavns befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Königliche Neue Markt (Kongens Nytorv). Von diesem größten und wichtigsten Platz <strong>de</strong>r Stadt führen sternförmig ein gutes Dutzend<br />
Straßen weg. An <strong>de</strong>m Platz mit einem Standbild Christians V., volkstümlich auch Hesten – das Pferd – genannt, liegen das Königliche Theater, das Kaufhaus Magasin du Nord, das<br />
Thotts Palais 1685 und das in <strong>de</strong>n Jahren 1672 bis 1683 erbaute Schloss Charlottenborg. Es beherbergt heute die Kunstaka<strong>de</strong>mie und steht in Verbindung mit <strong>de</strong>m neuen<br />
Kunstausstellungsgebäu<strong>de</strong>.<br />
Nordwestlich vom Kongens Nytorv befin<strong>de</strong>t sich das Schloss Rosenborg (Rosenborg Slot). Das 1607 bis 1617 als Sommerresi<strong>de</strong>nz für Christian IV. erbaute, durch holländische<br />
Architektur beeinflusste Renaissanceschloss beherbergt die dänischen Kronjuwelen. Seit 1833 ist es ein Museum. Sehenswert sind <strong>de</strong>r Elfenbeinthron mit drei silbernen Löwen und die
mit E<strong>de</strong>lsteinen verzierte Goldkrone Christians IV. Gegenüber <strong>de</strong>m Schloss liegt <strong>de</strong>r Botanische Garten mit einem Gewächshaus.<br />
Die Fre<strong>de</strong>rikskirche (Fre<strong>de</strong>rikskirken), auch Marmorkirche genannt, ist ein von Nicolai Eigtved entworfenes und 1740 begonnenes, 84 m hohes Gotteshaus mit einer 45 m hohen,<br />
freskengeschmückten Kuppel, eine <strong>de</strong>r größten Europas und ein Abbild <strong>de</strong>s Petersdoms in Rom. Geldmangel führte <strong>zu</strong> einer längeren Baupause. Erst durch die finanzielle Unterstüt<strong>zu</strong>ng<br />
<strong>de</strong>s Großindustriellen C. F. Tietgen konnte die Kirche 1894 fertiggestellt wer<strong>de</strong>n. Im Inneren sind Denkmäler be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r kirchlicher Persönlichkeiten, wie Moses o<strong>de</strong>r Martin Luther,<br />
aufgestellt. Unmittelbar neben <strong>de</strong>r Kirche befin<strong>de</strong>t sich das Schloss Amalienborg. Das Schloss, in <strong>de</strong>m die Königin lebt, wur<strong>de</strong> 1749 bis 1760 errichtet und besteht aus vier<br />
gegenüberliegen<strong>de</strong>n Palästen. In <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s großen, achteckigen Schlossplatzes (Amalienborg Plads) steht das Reiterstandbild Fre<strong>de</strong>riks V. Je<strong>de</strong>n Mittag um zwölf Uhr fin<strong>de</strong>t hier die<br />
Wachablösung <strong>de</strong>r Gar<strong>de</strong> statt.<br />
Nördlich von Schloss Amalienborg erstreckt sich das Kastell (Kastellet), ein Überbleibsel <strong>de</strong>r alten Stadtbefestigung. Unterhalb <strong>de</strong>r Festungswälle verläuft die Promena<strong>de</strong> Langelinie, die<br />
direkt <strong>zu</strong>r kleinen Meerjungfrau führt.<br />
Der Zooturm ist ein 43,5 m hoher Aussichtsturm im Zoo Kopenhagen. Er wur<strong>de</strong> 1905 errichtet und ist einer <strong>de</strong>r höchsten aus Holz gebauten Aussichtstürme.<br />
Im Stadtteil Bispebjerg fin<strong>de</strong>t sich mit <strong>de</strong>r von Pe<strong>de</strong>r Klint begonnen und von seinem Sohn Kaare Klint vollen<strong>de</strong>ten Grundtvigskirche ein seltenes Beispiel eines expressionistischen<br />
Sakralbaus.<br />
Freistadt Christiania<br />
Die Freistadt Christiania (auch Das freie Christiana) ist eine „alternative“ Wohnsiedlung im Kopenhagener Stadtteil Christianshavn, die seit 1971 besteht. Das ehemalige Militärgelän<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Bådsmandsstræ<strong>de</strong>s-Kaserne umfasst ein 34 Hektar großes Gebiet auf <strong>de</strong>n historischen Wallanlagen <strong>de</strong>r Stadt. Die Bewohner betrachten sich selbst als in einer Freistadt lebend, die<br />
sich unabhängig von <strong>de</strong>n staatlichen Behör<strong>de</strong>n verwaltet. Diesen gilt Christiania jedoch als Drogenhan<strong>de</strong>lszentrale.[8]<br />
Sport<br />
In Kopenhagen sind die folgen<strong>de</strong>n Fußballvereine <strong>de</strong>r dänischen Superliga <strong>zu</strong> Hause:<br />
• FC Kopenhagen – Dänischer Meister 1993, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2009 und 2010; Pokalsieger 1995, 1997, 2004, 2009.<br />
Sowie vor <strong>de</strong>n Toren <strong>de</strong>r Stadt in Brøndby:<br />
• Brøndby IF – Dänischer Meister 1985, 1987, 1988, 1990, 1991, 1996, 1997, 1998, 2002, 2005; Pokalsieger 1989, 1994, 1998, 2003, 2005.<br />
Wirtschaft und Infrastruktur<br />
Die Innenstadt beherbergt wie in fast je<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren europäischen Großstadt das Dienstleistungszentrum, Handwerksbetriebe und Industrieanlagen (Maschinen-, Porzellan- und<br />
Textilfabriken), die – soweit noch nicht in an<strong>de</strong>re Län<strong>de</strong>r ausgeglie<strong>de</strong>rt – größtenteils an <strong>de</strong>n Stadtrand verlegt wur<strong>de</strong>n. Die dänische Hauptstadt gilt als sehr teuer, die<br />
Lebenshaltungskosten gehören <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n höchsten in ganz Europa. [9]<br />
Verkehr<br />
Bahn und Straße<br />
Kopenhagen ist trotz seiner auf das Land bezogenen Randlage <strong>de</strong>r wichtigste Verkehrsknotenpunkt Dänemarks. Auf die Stadt laufen sowohl alle wichtigen Straßen als auch Eisenbahnen<br />
sternförmig <strong>zu</strong>. Über die Schiffsverbindung Vogelfluglinie ist Kopenhagen mit Lübeck und Hamburg, über die Öresundverbindung mit Malmö und Lund verbun<strong>de</strong>n.
ÖPNV<br />
S-Bahn und Metro<br />
Kopenhagen und seine Vororte wer<strong>de</strong>n durch ein S-Bahn-System (s-tog) erschlossen, das im Hauptbahnhof (København H) sein Zentrum hat. Die Linien <strong>de</strong>r S-Bahn führen bis Køge,<br />
Høje-Taastrup, Fre<strong>de</strong>rikssund, Farum, Hillerød und Klampenborg.<br />
Da<strong>zu</strong> kommt die mo<strong>de</strong>rne, am 19. Oktober 2002 eröffnete Metro Kopenhagen, <strong>de</strong>ren Züge vollautomatisch und damit ohne Bediener fahren. Sie verläuft von Vanløse im Westen über<br />
Fre<strong>de</strong>riksberg und <strong>de</strong>n Bahnhof Nørreport nach Christianshavn, wo sie sich in einen Streckenast nach Vestamager im Sü<strong>de</strong>n und einen in Richtung <strong>de</strong>s Flughafens Kastrup im Südosten<br />
aufteilt.<br />
Straßenbahn<br />
Vom 22. Oktober 1863 bis <strong>zu</strong>m 22. April 1972 besaß Kopenhagen ein ausge<strong>de</strong>hntes Straßenbahnnetz, das 1953 mit 19 Linien seinen Höhepunkt erreichte. Heute kann man mit <strong>de</strong>r alten<br />
Straßenbahn im Straßenbahnmuseum Skjol<strong>de</strong>næsholm auf Mittel-Seeland fahren. [2] Das Wie<strong>de</strong>reinführen <strong>de</strong>r Straßenbahn in Form eines Light-Rail-Netzes wur<strong>de</strong> vorgeschlagen, bis<br />
auf weiteres jedoch <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r Metro, die weiter ausgebaut wer<strong>de</strong>n soll, verworfen.<br />
Fahrrad<br />
Der Radverkehr hat einen wichtigen Stellenwert in <strong>de</strong>r Stadt. In nahe<strong>zu</strong> je<strong>de</strong>r wichtigen Straße gibt es eigene Radwege o<strong>de</strong>r Radfahrstreifen, die von <strong>de</strong>r Fahrbahn getrennt geführt<br />
wer<strong>de</strong>n. Der Anteil <strong>de</strong>s Radverkehrs am gesamten Verkehrsaufkommen <strong>de</strong>r Stadt ist mit über 36 %[10][11] im Vergleich <strong>zu</strong> an<strong>de</strong>ren europäischen Großstädten außeror<strong>de</strong>ntlich hoch<br />
(<strong>zu</strong>m Beispiel Wien: 5 %).[12] Täglich wer<strong>de</strong>n in Kopenhagen 1,3 Millionen Kilometer mit <strong>de</strong>n Fahrrad <strong>zu</strong>rückgelegt. Von Stadtplanern und Vertretern von Radfahr-Lobbys aus <strong>de</strong>r<br />
ganzen Welt wird Kopenhagen immer wie<strong>de</strong>r als vorbildliches Beispiel für die Bevor<strong>zu</strong>gung <strong>de</strong>s Radverkehrs genannt.[13][14]<br />
Außer<strong>de</strong>m gibt es von Frühling bis Herbst insgesamt circa 100 Stationen, an <strong>de</strong>nen man sich kostenlos Fahrrä<strong>de</strong>r ausleihen kann. Diese sogenannten Citybikes (Bycykler) erhält man<br />
gegen ein Pfand von 20 Kronen, die man nach <strong>de</strong>m Einkaufswagenprinzip einsteckt und <strong>zu</strong>rückerhält, wenn man das Fahrrad wie<strong>de</strong>r an eine <strong>de</strong>r Stationen <strong>zu</strong>rückstellt (siehe auch<br />
Helsinki City Bike). Die Fahrrä<strong>de</strong>r dürfen nur in <strong>de</strong>r Innenstadt benutzt wer<strong>de</strong>n. Im Winter wer<strong>de</strong>n sie von Häftlingen in einem Gefängnis gewartet.<br />
Luftverkehr<br />
In Kastrup befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r internationale Flughafen von Kopenhagen mit Direktverbindungen nach vier Kontinenten. Es gibt einen eigenen Bahnanschluss, <strong>de</strong>r unter an<strong>de</strong>ren von <strong>de</strong>n<br />
Zügen nach Malmö bedient wird, bevor sie die Öresundbrücke überqueren.<br />
Øresundbrücke<br />
Die Verbindung mit Malmö wird seit 2000 von <strong>de</strong>r Öresundverbindung hergestellt. Über diese verkehren sowohl die Öresundzüge, die für die bei<strong>de</strong>n nationalen Strom- und<br />
Signalsysteme eingerichtet sind, als auch Autos auf einer vierspurigen Autobahn. Früher fuhren nach Malmö Fähren und Tragflügelboote.<br />
See<br />
Kopenhagen ist per (Auto-) Fähre aus Polen (Swinemün<strong>de</strong>) und Oslo <strong>zu</strong> erreichen. Ein neuer Schiffsterminal im Nordhafen (Nordhavn) bedient sowohl Linien- als Kreuzfahrtschiffe.<br />
Die herkömmliche Route nach Bornholm wur<strong>de</strong> 2005 <strong>zu</strong>m Hafen Køge verlegt.<br />
Im Innenhafen läuft <strong>de</strong>r Hafenbus (Havnebussen), Passagierboote im ÖPNV-Netz, <strong>de</strong>r unter an<strong>de</strong>rem die Oper mit <strong>de</strong>r gegenüberliegen<strong>de</strong>n Altstadt verbin<strong>de</strong>t. Im Sommer kann man<br />
<strong>zu</strong>sätzlich von einem <strong>de</strong>r vielen Rundfahrtboote aus Stadt und Hafen besichtigen, <strong>zu</strong>m ehemaligen Seefort Trekroner o<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>r Insel Hven im Öresund fahren.
Ansässige Unternehmen<br />
Die in Kopenhagen ansässigen namhaften Brauereien Tuborg und Carlsberg (inzwischen <strong>zu</strong>r Carlsberg A/S fusioniert) lagern ihre Produktionsbetriebe <strong>zu</strong>nehmend aus, <strong>zu</strong>m Teil bis nach<br />
Jütland, was durch die Brücke über <strong>de</strong>n Großen Belt möglich wur<strong>de</strong>. Außer<strong>de</strong>m sitzt in Kopenhagen die weltgrößte Container-Ree<strong>de</strong>rei A. P. Møller-Mærsk. Im Stadtteil Bagsværd hat<br />
<strong>de</strong>r Pharmakonzern Novo Nordisk, bekannt für seine Enzym- und Insulinproduktion, seinen Stammsitz. Das pharmazeutische Unternehmen Lundbeck hat seinen Stammsitz ebenfalls in<br />
Kopenhagen.<br />
Medien<br />
• Danmarks Radio, in Ørestad<br />
• JP/Politikens Hus, Herausgeber <strong>de</strong>r Tageszeitungen Ekstra Bla<strong>de</strong>t, Politiken (bei<strong>de</strong> in Kopenhagen) und Jyllands-Posten (in Århus-Viby) und mehrerer Internet-Angebote.<br />
• Berlingske Media, Herausgeber <strong>de</strong>r Tageszeitungen Berlingske Ti<strong>de</strong>n<strong>de</strong>, B.T. und ErhvervsBla<strong>de</strong>t sowie <strong>de</strong>r Wochenzeitung Weekendavisen. Mehrheitseigner mehrerer<br />
Zeitungsverlage in ganz Dänemark und Teil <strong>de</strong>r Mecom Group.<br />
• Dagbla<strong>de</strong>t Information, linksliberale Tageszeitung.<br />
• Kristeligt Dagblad, christliche Tageszeitung.<br />
• TV 2, ein Public-Service-Fernsehsen<strong>de</strong>r aus O<strong>de</strong>nse, hat seinen Zweitsitz in Kopenhagen.<br />
Bildung<br />
In Kopenhagen und im Großraum gibt es:<br />
• Universität Kopenhagen: 1479 gegrün<strong>de</strong>t<br />
• Königliche Bibliotheksschule Dänemarks mit <strong>de</strong>r Dänischen Königlichen Bibliothek, ist <strong>zu</strong>gleich National- und Universitätsbibliothek<br />
• Hochschule für bil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Kunst und Architektur<br />
• Han<strong>de</strong>lshochschule Kopenhagen (Copenhagen Business School)<br />
• Dänemarks Technische Universität<br />
• IT-Universität Kopenhagen: ITU, seit 1999<br />
• Pädagogische Universität Dänemarks<br />
• Rytmisk Musikkonservatorium (Rhythmisches Musikkonservatorium) und das Königlich Dänische Musikkonservatorium<br />
• Staatliche Theaterschule Kopenhagen<br />
• Schule für mo<strong>de</strong>rnen Tanz Kopenhagen<br />
• Dänische Filmschule Kopenhagen<br />
• Dänische Designschule Kopenhagen<br />
• Ingenieurhochschule Kopenhagen: seit 1881<br />
• Königlich Dänische Kunstaka<strong>de</strong>mie<br />
• Königlich Dänische Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Wissenschaften<br />
• Deutsche Schule St. Petri Kopenhagen
Persönlichkeiten<br />
• Hans Christian An<strong>de</strong>rsen<br />
• Rudolph Bergh<br />
• Carl Theodor Dreyer<br />
• Theophil Hansen<br />
• Søren Kierkegaard<br />
• Carl Nielsen<br />
• Jørgen Bentzon<br />
• Niels Bohr<br />
• Pe<strong>de</strong>r Gram<br />
• Johanne Luise Heiberg<br />
• Christian Gottlieb Kratzenstein<br />
• Bertel Thorvaldsen<br />
• Niels Viggo Bentzon<br />
• Karen Blixen<br />
• N.F.S. Grundtvig<br />
• Ludvig Holberg<br />
• Margrethe II. von Dänemark<br />
• Magnús Eiríksson<br />
• Andreas Peter Berggreen<br />
• Tycho Brahe<br />
• Christian Fre<strong>de</strong>rik Hansen<br />
• Arne Jacobsen<br />
• Hans Lassen Martensen<br />
• Robert Jacobsen<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Danmarks Statistik - Areal for<strong>de</strong>lt efter områ<strong>de</strong> og tid<br />
2. ↑ Danmarks Statistik - BEF1A07: Folketal pr. 1. januar efter kommune/region, civilstand, al<strong>de</strong>r og køn<br />
3. ↑ Danmarks Statistik - BEF1A07: Folketal pr. 1. januar efter kommune/region, civilstand, al<strong>de</strong>r og køn<br />
4. ↑ Befolkning Region Hovedsta<strong>de</strong>n<br />
5. ↑ Danmarks Statistik - BEF1A07: Folketal pr. 1. januar efter kommune/region, civilstand, al<strong>de</strong>r og køn<br />
6. ↑ Danmarks Statistik - Byopgørelse - Hver femte dansker bor i Hovedstadsområ<strong>de</strong>t
7. ↑ Forbes-Liste: Teuerste Städte <strong>de</strong>r Welt <strong>zu</strong>m Leben<br />
8. ↑ http://www.xxx<br />
9. ↑ Financial Times Deutschland: http://www.xxx<br />
10.↑ [1]<br />
11.↑ Badische Zeitung: Die Dänen ra<strong>de</strong>ln allen davon<br />
12.↑ VCÖ:Mehr Radverkehr in Wien bringt weniger Staus<br />
13.↑ IG-Fahrrad: Wien darf Kopenhagen wer<strong>de</strong>n!<br />
14.↑ xxx: Innovative Fahrradverleihsysteme für die Städte<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Helsingborg<br />
Helsingborg (historisch auch Hälsingborg; hoch<strong>de</strong>utsch veraltet Helsingburg, nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch Helseburch) ist eine Stadt im südschwedischen Schonen in <strong>de</strong>r Provinz Skåne län. Sie hat<br />
92.105 Einwohner (Stand 1. Januar 2007). Damit ist sie die achtgrößte Stadt Schwe<strong>de</strong>ns und nach Malmö die zweitgrößte Stadt Schonens. Helsingborg ist <strong>de</strong>r Hauptort <strong>de</strong>r<br />
gleichnamigen Gemein<strong>de</strong>. Die Stadt ist ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Industriestandort; ihr Hafen ist <strong>de</strong>r zweitgrößte im Land.<br />
Geographie und Geologie<br />
Helsingborg liegt an <strong>de</strong>r Westküste Schonens an <strong>de</strong>r schmalsten Stelle <strong>de</strong>s Öresunds, <strong>de</strong>r Meerenge zwischen Schwe<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r dänischen Insel Seeland, gegenüber <strong>de</strong>r dänischen Stadt<br />
Helsingør. Im Nor<strong>de</strong>n, Osten und Sü<strong>de</strong>n ist die Stadt von offenem Land, das vorwiegend landwirtschaftlich genutzt wird, umgeben.<br />
Prägend für das Stadtbild ist eine geologische Verwerfungszone, die sich leicht lan<strong>de</strong>inwärts entlang <strong>de</strong>s Öresun<strong>de</strong>s zieht und die Stadt in einen höher- und einen tiefergelegenen Teil<br />
glie<strong>de</strong>rt. Die Verwerfungskante, Teil <strong>de</strong>r Tornquistzone, einer Verwerfung, die sich diagonal vom Kattegat durch Schonen bis nach Bornholm erstreckt, und die östlich angrenzen<strong>de</strong><br />
hochgelegene Ebene tragen die Bezeichnung landborgen. Einige wenige natürliche Einschnitte in <strong>de</strong>m Hang, <strong>de</strong>r im Stadtzentrum eine Höhe von 20 bis 40 Meter erreicht, verbin<strong>de</strong>n die<br />
historische Altstadt mit <strong>de</strong>n Stadtteilen oberhalb <strong>de</strong>s Hangs. Die Altstadt liegt eingezwängt zwischen landborgen und <strong>de</strong>m Öresund auf Meeresniveau. Über die durch die landborgen<br />
gezogene natürliche Grenze hat sich die Innenstadt bis heute nicht lan<strong>de</strong>inwärts ausge<strong>de</strong>hnt. Statt<strong>de</strong>ssen wur<strong>de</strong> durch Landgewinnung im Öresund neues Bauland im Zentrum<br />
Helsingborgs geschaffen.<br />
Im Sü<strong>de</strong>n Helsingborgs mün<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Fluss Råån in <strong>de</strong>n Öresund.
Klima<br />
Durch die Lage Helsingborgs am Öresund herrscht in <strong>de</strong>r Stadt ein kühlgemäßigtes Klima mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 8,2 Grad Celsius. Die mittlere Monatstemperatur<br />
im Januar liegt bei -0,1 Grad Celsius, im Juli bei 16,8 Grad Celsius. Die durchschnittliche jährliche Nie<strong>de</strong>rschlagsmenge beträgt 568 mm[2].<br />
Namensherkunft<br />
Der Stadtname leitet sich vermutlich von hals für „Hals“, einer Bezeichnung für die schmalste Stelle <strong>de</strong>s Öresunds, "ing" für "Leute, Gefolge, Bewohner" und borg für „Burg“ ab. Nach<br />
einer Rechtschreibreform 1906 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Name 1912 in Hälsingborg geän<strong>de</strong>rt, um ihn <strong>de</strong>n neuen Schreibregeln an<strong>zu</strong>passen. Diese Än<strong>de</strong>rung wur<strong>de</strong> im Rahmen einer Gemein<strong>de</strong>reform<br />
im Jahre 1971 rückgängig gemacht.<br />
Geschichte<br />
Helsingborg, ursprünglich eine dänische Stadt, ist eine <strong>de</strong>r ältesten Städte im heutigen Schwe<strong>de</strong>n und war wegen seiner strategisch günstigen Lage am Öresund immer wie<strong>de</strong>r umkämpft.<br />
Die Siedlung wur<strong>de</strong> um 1070 erstmals in einem Brief Adam von Bremens erwähnt; jedoch gilt heute die erste urkundliche Nennung unter <strong>de</strong>r Bezeichnung Helsingaburgh durch <strong>de</strong>n<br />
dänischen König Knut IV. vom 21. Mai 1085 als Geburtsstun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Man vermutet, dass es hier schon <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 9. Jahrhun<strong>de</strong>rts eine kleinere Befestigungsanlage <strong>zu</strong>m Schutz <strong>de</strong>r Überfahrt zwischen Schonen und Seeland gab. Zu <strong>de</strong>n ersten größeren<br />
Bauten im Umkreis <strong>de</strong>r Burg gehörten die drei Kirchen St. Clemens, St. Petri und St. Olai. Die einfache Festung wur<strong>de</strong> im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt durch ein Burgschloss aus Sandstein ersetzt,<br />
<strong>de</strong>ssen dominieren<strong>de</strong>r Teil ein run<strong>de</strong>r Turm mit etwa vier Meter dicken Wän<strong>de</strong>n war. Die Stadt wuchs und immer mehr Menschen sie<strong>de</strong>lten am Ufer <strong>de</strong>s Öresunds im Schutze <strong>de</strong>r Burg.<br />
Im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt zählte Helsinborg <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n wichtigsten Städten Dänemarks. Die Burg gehörte mit ihrem um diese Zeit errichteten Verteidigungsturm, bezeichnet als Kärnan, <strong>zu</strong> einer<br />
<strong>de</strong>r stärksten Festungen Nor<strong>de</strong>uropas. Auch die neuerbaute Sankt-Marien-Kirche, eine die größten Stadtkirchen Dänemarks in dieser Perio<strong>de</strong>, zeugte von <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung Helsingborgs.<br />
1329 pfän<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r dänische König Christoph II. Helsingborg – wie ganz Schonen und Blekinge – an Graf Johann III. von Holstein-Kiel und 1332 erkaufte Magnus von Norwegen und<br />
Schwe<strong>de</strong>n das Pfand.<br />
Nach <strong>de</strong>m Erwerb <strong>de</strong>s Pfands behauptete Magnus auch die Souveränität über Blekinge und Schonen und ließ sich als König von Schonen und Blekinge huldigen. Blekinge und Schonen,<br />
und damit Helsingborg, kamen so in eine Personalunion mit Norwegen und Schwe<strong>de</strong>n. Die Souveränität <strong>de</strong>s Magnus wur<strong>de</strong> 1343 von Wal<strong>de</strong>mar IV. Atterdag von Dänemark, vom Papst<br />
aber nie, anerkannt. Wal<strong>de</strong>mar nahm 1360 Schonen und Blekinge <strong>zu</strong>rück.<br />
1369 eroberten die Truppen <strong>de</strong>r Kölner Konfö<strong>de</strong>ration unter <strong>de</strong>m Kommando <strong>de</strong>s Lübecker Bürgermeisters Bruno von Warendorp die Festung Helsingör. Die Einnahme dieser<br />
strategischen Schlüsselposition am Sund war Vorausset<strong>zu</strong>ng für die Beendigung <strong>de</strong>s Zweiten Hanse-Dänemark-Krieges zwischen <strong>de</strong>r Hanse und Dänemark durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von<br />
Stralsund 1370.<br />
Trotz <strong>de</strong>r Einführung <strong>de</strong>s Sundzolls 1429 nahm die Be<strong>de</strong>utung Helsingborgs im 15. und 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt ab, nach<strong>de</strong>m in Helsingør auf <strong>de</strong>r gegenüberliegen<strong>de</strong>n Seite <strong>de</strong>s Sunds die<br />
mo<strong>de</strong>rnere Festung Schloss Kronborg errichtet wor<strong>de</strong>n war. Im 17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt war das Geschick <strong>de</strong>r Stadt von schweren Verwüstungen durch die dänisch-schwedischen Kriege<br />
bestimmt, die die Bevölkerung oftmals <strong>zu</strong>r Flucht zwangen.<br />
Die Stadt geriet 1658 durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Roskil<strong>de</strong> an die schwedische Krone. Im Schonischen Krieg zwischen 1675 und 1679 wur<strong>de</strong> Helsingborg zwei Mal von Dänemark<br />
<strong>zu</strong>rückerobert. Aus diesem Grund beschloss <strong>de</strong>r schwedische König Karl XI. <strong>de</strong>n Abriss <strong>de</strong>r Stadtmauern und <strong>de</strong>s größten Teils <strong>de</strong>s Schlosses. Einzig <strong>de</strong>r Turm Kärnan blieb bestehen.<br />
Im Verlauf <strong>de</strong>s Großen Nordischen Krieges lan<strong>de</strong>te 1709 ein starkes dänisches Heer unter Christian Detlev von Reventlow südlich von Helsingborg und nahm die Stadt ein. Der<br />
schwedischen Generalgouverneur von Schonen, Magnus Stenbock, besiegte am 28. Februar 1710 die dänische Armee in <strong>de</strong>r Schlacht von Helsingborg und die Stadt wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r von<br />
<strong>de</strong>r schwedischen Krone regiert. 1719 wur<strong>de</strong> Helsingborg, wie ganz Schonen, Teil von Schwe<strong>de</strong>n.<br />
Für die Bevölkerung <strong>de</strong>r Stadt waren die vielen Kriege verheerend. Seuchen und <strong>de</strong>r <strong>zu</strong> Kriegszeiten stark eingeschränkte Han<strong>de</strong>l über <strong>de</strong>n Öresund sorgten für eine Stagnation <strong>de</strong>r
Bevölkerungszahlen und <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Entwicklung. 1711 brach <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die Pest aus, die ein Jahr später überwun<strong>de</strong>n war.<br />
Erst in <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts begann sich die Stadt langsam wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> erholen. Vor allem viele neue Industriebetriebe und die Abschaffung <strong>de</strong>s sogenannten Sundzolls<br />
für die Passage <strong>de</strong>s Öresunds 1857 führten <strong>zu</strong> einem starken Bevölkerungswachstum. Im Jahr 1884 hatte Helsingborg 14.279 Einwohner. 1892 nahm die erste Fährverbindung nach<br />
Helsingør mit Dampfschiffen ihren Betrieb auf. Der Hafen wur<strong>de</strong> be<strong>de</strong>utend für <strong>de</strong>n Export von Getrei<strong>de</strong> und an<strong>de</strong>ren Gütern. Mehrere Industrielle, die oft gleichzeitig Ämter in <strong>de</strong>r<br />
Gemein<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r im schwedischen Reichstag innehatten, trieben die Entwicklung <strong>de</strong>r Stadt voran.<br />
Um die Jahrhun<strong>de</strong>rtwen<strong>de</strong> expandierte die Stadt schnell und wuchs mit ehemals eigenständigen Ortschaften <strong>zu</strong>sammen, die nun einer Stadt gehörten, die in <strong>de</strong>n 1920ern bereits mehr als<br />
50.000 Einwohner zählte und damit Schwe<strong>de</strong>ns fünftgrößte Stadt war. 1903 wur<strong>de</strong> im Rahmen <strong>de</strong>r sogenannten „Helsingborgausstellung“ 1903 ein Straßenbahnnetz eingeweiht, das bis<br />
1967 bestand.<br />
Im Zweiten Weltkrieg führte zwischen 1940 und 1943 die <strong>de</strong>n Deutschen von <strong>de</strong>r schwedischen Regierung <strong>zu</strong>gestan<strong>de</strong>ne Versorgungslinie (permittenttågen) <strong>de</strong>r Wehrmacht <strong>zu</strong>r<br />
russischen Front in Finnland und ins besetzte Norwegen durch Helsingborg. Nach <strong>de</strong>r Auflösung <strong>de</strong>s Vertrages und <strong>de</strong>r einsetzen<strong>de</strong>n Verfolgung unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>r jüdischen<br />
Bevölkerung in Dänemark flüchteten 1943 Nacht für Nacht hun<strong>de</strong>rte Menschen über <strong>de</strong>n Öresund und suchten in Helsingborg Schutz.<br />
Stadtglie<strong>de</strong>rung<br />
Die Stadt Helsingborg besteht aus <strong>de</strong>n 32 <strong>de</strong>r 42 Gemein<strong>de</strong>bezirke (b-områ<strong>de</strong>n) <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Helsingborg, die <strong>de</strong>n „Innenbezirk“ (innerområ<strong>de</strong>) <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> bil<strong>de</strong>n. Ein Stadtbezirk<br />
ist jeweils nach einem <strong>de</strong>r Stadtteile, die er umfasst, benannt. Speziell am Stadtrand können auch umgeben<strong>de</strong> Industriegebiete sowie große Wald- und landwirtschaftlich genutzte Flächen<br />
<strong>zu</strong> einem Stadtbezirk zählen.<br />
Die Charaktere <strong>de</strong>r einzelnen Stadtteile sind sehr unterschiedlich. So gibt es die historische Altstadt (Gamla stan) mit einer <strong>zu</strong>m Teil mehrere Jahrhun<strong>de</strong>rte alten Bebauung,<br />
Massenwohnsiedlungen am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt wie Drottninghög, die in <strong>de</strong>n 1960er und 70er Jahren im Rahmen <strong>de</strong>s sogenannten Millionenprogramms, einem lan<strong>de</strong>sweiten<br />
Wohnungsbauprojekt <strong>de</strong>r schwedischen Regierung, entstan<strong>de</strong>n, städtische Villengegen<strong>de</strong>n wie Olympia aus <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Hochzeit <strong>de</strong>r Stadt und eher ländliche Gegen<strong>de</strong>n wie in<br />
Råå.<br />
Bevölkerung<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r Einwohnerzahl<br />
Bis etwa 1800 zählte Helsingborg unter 1500 Einwohner. In <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts und Anfang <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts stieg die Bevölkerungszahl sprunghaft an, was vor<br />
allem auf die <strong>zu</strong> dieser Zeit boomen<strong>de</strong> Wirtschaft, aber auch auf Eingemeindungen kleinerer umgeben<strong>de</strong>r Ortschaften <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>führen ist.<br />
Die folgen<strong>de</strong> Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen von Helsingborg von 1570 bis 2005. Die Angaben beziehen sich vor 1862 (wahrscheinlich) auf die Stadt Helsingborg (s), von 1862<br />
bis 1970 auf die Stadtgemein<strong>de</strong> Helsingborg (g) und ab 1971 auf <strong>de</strong>n Innenbezirk (innerområ<strong>de</strong>) <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Helsingborg (i).<br />
Bevölkerung mit ausländischem Hintergrund<br />
Der Anteil <strong>de</strong>r Bevölkerung mit ausländischem Hintergrund an <strong>de</strong>r Gesamtbevölkerung beträgt in Helsingborg 23,2 Prozent. Dabei sind unter „Bevölkerung mit ausländischem<br />
Hintergrund“ die Einwohner <strong>zu</strong> verstehen, die entwe<strong>de</strong>r im Ausland geboren sind o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>ren bei<strong>de</strong> Elternteile im Ausland geboren sind.<br />
Die wichtigsten Herkunftslän<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r im Ausland Geborenen, insgesamt sind es rund 150 Nationen, und die Zahl <strong>de</strong>r von dort stammen<strong>de</strong>n Personen zeigt für das Jahr 2006 die<br />
Tabelle[5]. Die Zahlen beziehen sich auf die Gemein<strong>de</strong> Helsingborg; allerdings lassen sich durchaus Rückschlüsse auf die Situation in <strong>de</strong>r Stadt Helsingborg ziehen, da rund 84,5 Prozent<br />
<strong>de</strong>r ausländischen Bevölkerung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Stadt leben.
- Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: vorhan<strong>de</strong>ne Tabelle wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Vereinfachung nicht übernommen!<br />
Religion<br />
Da in Schwe<strong>de</strong>n keine Daten <strong>zu</strong>r Religions<strong>zu</strong>gehörigkeit erhoben wer<strong>de</strong>n dürfen und <strong>de</strong>shalb keine offiziellen Statistiken existieren, lassen sich diesbezüglich nur Vermutungen<br />
anstellen.<br />
Die größte religiöse Gruppe bil<strong>de</strong>n die Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r evangelisch-lutherischen Schwedische Kirche, die bis 1999 Staatskirche war. Nach eigenen Angaben zählte sie am 1. November<br />
2005 in <strong>de</strong>n vier Gemein<strong>de</strong>n (församlingar) Maria, Filborna, Gustaf Adolf und Raus, die im Stadtgebiet liegen, 62.747 Mitglie<strong>de</strong>r[6]. Seit <strong>de</strong>m 1. Januar 1990 ist mit <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> St.<br />
Basilus <strong>de</strong>n Store auch die serbisch-orthodoxe Kirche in Helsingborg vertreten. Seit 1996 besitzt die für Nordwestschonen <strong>zu</strong>ständige Gemein<strong>de</strong> ein eigenes Kirchengebäu<strong>de</strong>[7].<br />
Daneben existieren mehrere freikirchliche Gemein<strong>de</strong>n, unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>r Kirche Jesu Christi <strong>de</strong>r Heiligen <strong>de</strong>r Letzten Tage, <strong>de</strong>r Pfingstbewegung, <strong>de</strong>r Evangelischen Vaterlandsstiftung<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Schwedischen Missionskirche.<br />
Neben <strong>de</strong>n christlichen Glaubensgemeinschaften gibt es auch eine jüdische Gemein<strong>de</strong> mit einer Synagoge im Zentrum Helsingborgs. Der Ahel-Al-Sunnah-Verein ist die größte<br />
islamische Vereinigung in Helsingborg und hat im Stadtteil Högasten ihre Versammlungsräume[8].<br />
Soziale Struktur<br />
Zwischen <strong>de</strong>n zentralen Stadtteilen nördlich und südlich <strong>de</strong>s Zentrums bestehen traditionell <strong>de</strong>utliche Unterschie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r sozialen Struktur. Waren die südlichen Stadtteile früher die<br />
Wohngebiete <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n benachbarten Industriegebieten beschäftigten Arbeiter und die nördlichen Stadtteile Heimat <strong>de</strong>r bessergestellten Bürger, so bestehen zwischen <strong>de</strong>m Sü<strong>de</strong>n mit<br />
Stadtteilen wie Sö<strong>de</strong>r, Planteringen und Högaborg und <strong>de</strong>m Nor<strong>de</strong>n mit Stadtteilen wie Norr und Tågaborg heute erhebliche Unterschie<strong>de</strong> unter an<strong>de</strong>rem bei Auslän<strong>de</strong>ranteil,<br />
Arbeitslosenquote, Einkommensverteilung und Bildungsstand.<br />
Zu <strong>de</strong>n Gegen<strong>de</strong>n mit überwiegend sozial schwacher Bevölkerung gehören heute auch viele <strong>de</strong>r im Rahmen <strong>de</strong>s Millionenprogramms entstan<strong>de</strong>nen Stadtteile wie Drottninghög im<br />
Nordosten <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Die Unterschie<strong>de</strong> lassen sich anhand <strong>de</strong>r oben genannten statistischen Merkmale Auslän<strong>de</strong>ranteil, Arbeitslosenquote, Bildungsstand (am Beispiel <strong>de</strong>s Bevölkerungsanteils mit<br />
nachgymnasialem Bildungsabschluss) und durchschnittliches Jahreseinkommen belegen:<br />
Graphik<br />
Aus <strong>de</strong>n Ergebnissen einer Studie <strong>de</strong>s schwedischen Integrationsverket geht hervor, dass sich die Segregation in Helsingborg in <strong>de</strong>n Jahren 1997–2004 weiter verstärkt hat[13].<br />
Politik<br />
Die verwalten<strong>de</strong> Instanz <strong>de</strong>r Stadt ist die Gemein<strong>de</strong> Helsingborg (Helsingborgs stad). Ihr Gebiet erstreckt sich jedoch über die Grenzen <strong>de</strong>r eigentlichen Stadt in<br />
siedlungsgeographischem Verständnis (tätort) hinaus und schließt außerhalb gelegene Ortschaften mit ein.<br />
Helsingborg ist <strong>de</strong>r Hauptort (centralort) <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> und damit Sitz <strong>de</strong>r kommunalen Verwaltung.<br />
Helsingborg ist traditionell sozial<strong>de</strong>mokratisch geprägt. Seit <strong>de</strong>r letzten Gemein<strong>de</strong>wahl im Jahre 2006 wird die Gemein<strong>de</strong>politik maßgeblich von <strong>de</strong>r sogenannten „Bürgerlichen Allianz“<br />
aus Konservativen, Christ<strong>de</strong>mokraten, Zentrum und <strong>de</strong>r Liberalen bestimmt.<br />
Historische Entwicklung<br />
1862 wur<strong>de</strong> Helsingborg mit Inkrafttreten von Gemein<strong>de</strong>gesetzen in eine Stadtgemein<strong>de</strong> umgewan<strong>de</strong>lt, in <strong>de</strong>r alle <strong>de</strong>r Stadt Steuer zahlen<strong>de</strong>n Personen das Recht hatten, <strong>de</strong>n Stadtrat <strong>zu</strong><br />
wählen. Vorher war dies <strong>de</strong>n Stadtbewohnern, die <strong>zu</strong>m Stand <strong>de</strong>r Bürger (burskap) gehörten, vorbehalten. Die neue Stadtgemein<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> von einem Magistrat geleitet, hatte aber auch
einen 26-köpfigen Gemein<strong>de</strong>rat (stadsfullmäktige). Jeweils <strong>de</strong>r halbe Gemein<strong>de</strong>rat wur<strong>de</strong> je<strong>de</strong>s zweite Jahr für vier Jahre gewählt. Da es <strong>zu</strong> dieser Zeit keine Parteien und damit wenig<br />
konträre politische Debatten gab, war das Interesse <strong>de</strong>r Bevölkerung an <strong>de</strong>n Wahlen anfangs gering. Das Wahlsystem sah vor, das je<strong>de</strong>r Einwohner bis <strong>zu</strong> 100 Stimmen haben konnte, je<br />
nach<strong>de</strong>m, wie viel Steuern er an die Gemein<strong>de</strong> zahlte. Die Höchstzahl <strong>de</strong>r Stimmen wur<strong>de</strong> 1909 auf 40 gesenkt und 1918 wur<strong>de</strong> diese Form <strong>de</strong>s Wahlsystems abgeschafft. 1899 wur<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r erste Sozial<strong>de</strong>mokrat in <strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>rat gewählt. Dies geschah auf Initiative <strong>de</strong>s Unternehmers Nils Persson und <strong>de</strong>s Reichstagsmitglieds Oscar Trapp, die es als wichtig ansehen,<br />
dass die Arbeiterbewegung über Mitsprache im Gemein<strong>de</strong>rat verfügte. Durch die Wahlreform 1909 verdreifachte sich <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r Sozial<strong>de</strong>mokraten im Gemein<strong>de</strong>rat und 1918 wur<strong>de</strong>n<br />
sie <strong>zu</strong>r größten Fraktion.<br />
In <strong>de</strong>n Jahren 1905, 1907, 1917 und 1918 wur<strong>de</strong>n viele Orte <strong>de</strong>r die Stadt umgeben<strong>de</strong>n Landgemein<strong>de</strong>n in die Stadtgemein<strong>de</strong> Helsingborg eingemein<strong>de</strong>t. 1971 wur<strong>de</strong> die Stadtgemein<strong>de</strong><br />
Helsingborg bei einer Kommunalreform mit vier bei <strong>de</strong>r früheren Kommunalreform von 1952 gebil<strong>de</strong>ten Landgemein<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>sammengelegt und ist seit<strong>de</strong>m ein Teil <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong><br />
Helsingborg. Die Gemein<strong>de</strong> ist eine von dreizehn im Land, die in <strong>de</strong>r Eigenbezeichnung stad anstelle von kommun verwen<strong>de</strong>t.<br />
Liste <strong>de</strong>r Bürgermeister (borgmästare)Michael Pe<strong>de</strong>rsen (vor 1380)<br />
• Thorborn Brun (vor 1380)<br />
• Johannes Skytte (vor 1380)<br />
• Matts Pe<strong>de</strong>rsen Tön<strong>de</strong>bin<strong>de</strong>r (um 1530)<br />
• Bertel Svart (1592)<br />
• Hans Thomeson (bis 1597)<br />
• Thomans Hansen Moet (bis 1612)<br />
• Willom Willomsen (bis 1622)<br />
• Jens Olufsen (ab 1622)<br />
• Jesper Pe<strong>de</strong>rsen (ab 1627)<br />
• Pe<strong>de</strong>r Pe<strong>de</strong>rsen (ab 1627)<br />
• Jens Christensen (ab 1641)<br />
• Ennert Pe<strong>de</strong>rsen (1650-1655) Christen Nilsen Brock (ab 1655)<br />
• Jens Nilsen (ab 1655)<br />
• Eggert Elers (ab 1656)<br />
• Hindric Mårtensson Hierzeel (ab 1660)<br />
• Bengt Pihl, gea<strong>de</strong>lt Pihlcrona 1675 (ab 1668)<br />
• An<strong>de</strong>rs Ekebom (ab 1672)<br />
• Gabriel Hillersten<br />
• Magnus Paulin (ab 1681)<br />
• Bengt Langh (ab 1682)<br />
• Anton Perment (ab 1696, abgesetzt 1704)<br />
• Gabriel Löfman (1704–1710)<br />
• Henric Sylvius (1710–1738)
• Petter Pihl d. J. (1738–1759) Michael Andreas Cöster (1759–1761)<br />
• Nicolaus Cervin (1761–1791)<br />
• Lars Mathias Gülich (Vize 1790–1791, 1791–1792)<br />
• Carl Gustaf Ekerholm (1793–1808)<br />
• An<strong>de</strong>rs Petter Ståhle (1809–1832)<br />
• Håkan Lundberg (1832–1849)<br />
• Lars Magnus Wejlan<strong>de</strong>r (1849–1864)<br />
• Victor Lan<strong>de</strong>gren (1864–1868)<br />
• Eric von Stockenström (1868–1899)<br />
• Gustaf Hoff (1899–1911)<br />
• Johan Bååth (1911–1936)<br />
• Joel Laurin (1936–1948)<br />
• Lars Gunnar Ohlsson (1948–1970)<br />
Gemein<strong>de</strong>ratsvorsitzen<strong>de</strong> (stadsfullmäktige) bis 1970Rudolf Tornérhjelm (1862–1885)<br />
• Gustaf Peyron (1885–1887)<br />
• Petter Olsson (1888–1903)<br />
• Nils Persson (1904–1908)<br />
• Malte Sommelius (1908–1919)<br />
• K. Jacob Beskow (1919)<br />
• Carl Johansson (1919–1930) Hjalmar Forsberg (1931–1941)<br />
• Edwin Berling (1941–1951)<br />
• An<strong>de</strong>rs Persson (1951–1954)<br />
• Börje Skarstedt (1955–1960)<br />
• Karl Salomonsson (1961–1966)<br />
• Gunnar Nordqvist (1967–1973)<br />
Wappen<br />
Das Stadtwappen von Helsingborg ist eine Weiterentwicklung eines Siegels aus <strong>de</strong>m 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Das Siegel zeigt eine Burg mit einem zentralen, von einem Kreuz gekrönten Turm<br />
mit spitzem Dach hinter einer Mauer mit Zinnen. Der Turm stellt wahrscheinlich einen Kirchturm dar. Unwahrscheinlich ist die ältere Deutung, das es sich um <strong>de</strong>n Turm Kärnan han<strong>de</strong>lt.<br />
Nach neueren archäologischen Erkenntnissen ist dieser Turm jünger als das Siegel. Das Siegel wur<strong>de</strong>n zweimal, 1916 und 1946, von König Gustav V. als Wappen festgestellt. Seit 1971<br />
wird das Wappen von <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Helsingborg verwen<strong>de</strong>t. Es wur<strong>de</strong> 1974 für die Gemein<strong>de</strong> beim schwedischen Patentamt registriert.<br />
Städtepartnerschaften
Helsingborg war eine <strong>de</strong>r ersten Städte <strong>de</strong>r Welt, die eine Städtepartnerschaft einging. Die Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>m dänischen Helsingør begann bereits 1838. 1849 trafen sich<br />
Repräsentanten bei<strong>de</strong>r Städte auf <strong>de</strong>m <strong>zu</strong>gefrorenen Öresund, um eine Freundschaftsbekundung <strong>zu</strong> unterzeichnen. Nach <strong>de</strong>m Beschluss <strong>de</strong>s Baus <strong>de</strong>r Öresundverbindung zwischen<br />
Malmö und Kopenhagen und im Hinblick auf <strong>de</strong>n daraus folgen<strong>de</strong>n Verlust <strong>de</strong>r kürzesten Verbindung zwischen Schwe<strong>de</strong>n und Dänemark und die Verlagerung <strong>de</strong>r Hauptverkehrsrouten<br />
Richtung Sü<strong>de</strong>n unterzeichneten Vertreter <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Städte 1995 ein Zusammenarbeitsabkommen („HH-samarbetet“) in <strong>de</strong>n Bereichen Wirtschaft, Tourismus, Verkehrsinfrastruktur,<br />
Umwelt, Kultur und Bildung.<br />
Heute hat Helsingborg vier Partnerstädte (vänorter):<br />
• Helsingør (Dänemark), seit 1849<br />
• Pärnu (Estland)<br />
• Dubrovnik (Kroatien), seit 1998<br />
• Alexandria, VA (USA)<br />
Neben <strong>de</strong>n oben genannten Städtepartnerschaften gibt es noch zahlreiche weitere Partnerschaften zwischen Schulen <strong>de</strong>r Stadt Helsingborg mit an<strong>de</strong>ren Schulen auf <strong>de</strong>r Welt. So fin<strong>de</strong>t<br />
beispielsweise seit vielen Jahren ein jährlicher Schüleraustausch zwischen einem Gymnasium in Helsingborg und <strong>de</strong>m Campe-Gymnasium in Holzmin<strong>de</strong>n (Nie<strong>de</strong>rsachsen) statt.<br />
- Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T <strong>zu</strong>m Thema ,,Städtepartnerschaften”: Stand 2010<br />
Stadtbild<br />
Trotz <strong>de</strong>s hohen Alters <strong>de</strong>r Stadt gibt es nur wenige Gebäu<strong>de</strong>, die davon zeugen. Ein Großteil <strong>de</strong>r alten Bauten wur<strong>de</strong> Opfer <strong>de</strong>r Verwüstungen, die die über Jahrhun<strong>de</strong>rte immer wie<strong>de</strong>r<br />
die Stadt hereinbrechen<strong>de</strong>n Kriege zwischen Dänen und Schwe<strong>de</strong>n mit sich brachten. Beson<strong>de</strong>rs schlimm waren die Zerstörungen im Schonischen Krieg, als <strong>de</strong>r dänische König Kristian<br />
V. große Teile Helsingborgs nie<strong>de</strong>rreißen ließ, um mit <strong>de</strong>m gewonnenen Material die Stadtbefestigungnen <strong>zu</strong> verstärken. Karl XI. zerstörte das Schloss Helsingborgs, von <strong>de</strong>m nur <strong>de</strong>r<br />
Turm Kärnan übrig blieb. Die einzigen Profanbauten aus <strong>de</strong>m 17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt, die die Jahrhun<strong>de</strong>rte überlebten, sind das Jacob-Hansen-Haus (Jacob Hansens hus), <strong>de</strong>r<br />
Gamlegård und <strong>de</strong>r Henckelsche Hof (Henckelska går<strong>de</strong>n).<br />
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt entwickelte sich Helsingborg <strong>zu</strong> einer „geteilten“ Stadt mit <strong>de</strong>n reichen nördlichen Stadtteilen und <strong>de</strong>n ärmeren Arbeiterquartieren im Sü<strong>de</strong>n. Die traditionelle Grenze<br />
war die Straße Trädgårdsgatan. Diese Teilung ist noch heute sichtbar, so hat <strong>de</strong>r südliche Stadtteil Sö<strong>de</strong>r die höchste Einwan<strong>de</strong>rerdichte. Als Grün<strong>de</strong> für diese Separierung <strong>de</strong>r<br />
Bevölkerungsschichten gilt sowohl die Nähe <strong>de</strong>r südlichen Stadtteile <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Industriegebieten als auch, dass <strong>de</strong>r Nor<strong>de</strong>n durch seinen direkten Zugang <strong>zu</strong>m Wasser, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n<br />
Wohngebieten im Sü<strong>de</strong>n durch <strong>de</strong>n Hafen und die Eisenbahn verwehrt blieb, die attraktivere Wohngegend darstellte.<br />
Baugeschichte<br />
Die ersten Häuser <strong>de</strong>r Stadt lagen auf <strong>de</strong>m Hang im Schutze <strong>de</strong>s Schlosses. Die Stadt wuchs dann weiter in Richtung Öresund. In <strong>de</strong>n Bereichen die an <strong>de</strong>n Turm Kärnan anschließen,<br />
kann man auch heute noch ein mittelalterliches Straßenmuster mit unregelmäßigen Wohnquartieren erkennen. Hier liegt auch Helsingborgs erste Hauptstraße, Storgatan, die heute in<br />
einen nördlichen und einen südlichen Teil aufgeteilt ist. An dieser Straße liegen einige <strong>de</strong>r historisch wertvollsten Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt. Da<strong>zu</strong> zählen die Sankt-Marien-Kirche und das<br />
älteste Wohnhaus Helsingborgs, das Jacob-Hansen-Haus, welches als einziges in <strong>de</strong>r Stadt von vor 1670 stammt.<br />
Bis <strong>zu</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts baute man die Häuser vorwiegend im Fachwerkstil. Mit <strong>de</strong>r dann einsetzen<strong>de</strong>n neuen Blüte <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong>n viele <strong>de</strong>r alten Bauten durch eine<br />
protzigere Architektur ersetzt. Mit <strong>de</strong>r Errichtung <strong>de</strong>s Zentralhafens 1832 wuchs <strong>de</strong>r Ort auch in <strong>de</strong>n Öresund hinein. Auf <strong>de</strong>r neu gewonnenen Landfläche entstan<strong>de</strong>n viele Prunkbauten<br />
entlang <strong>de</strong>r <strong>zu</strong> dieser Zeit angelegten Para<strong>de</strong>straßen Drottninggatan und Järnvägsgatan, <strong>de</strong>r heutigen Hauptverkehrsachse, sowie <strong>de</strong>m zentralen Platz Stortorget, darunter das Hotel<br />
Mollberg und das 1897 erbaute Rathaus im neugotischen Stil, das als Zeichen für die gestiegene Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Stadt gelten sollte.<br />
An <strong>de</strong>r Straße Järnvägsgatan wur<strong>de</strong> 1865 <strong>de</strong>r Hauptbahnhof errichtet, <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Hafen eine Grundlage für viele neue Industriebetriebe darstellte. Im Anschluss an diese Betriebe
entstan<strong>de</strong>n Arbeiterquartiere, die <strong>zu</strong>sammen <strong>de</strong>n Stadtteil Sö<strong>de</strong>r bil<strong>de</strong>ten. Hier baute man die Gustav-Aldof-Kirche und <strong>de</strong>n Platz Nya torg (heute Gustaf Adolfs torg genannt) als zweites<br />
Stadtzentrum.<br />
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>n auch die Befestigungsanlagen östlich <strong>de</strong>s Schlosses abgerissen. Hier entstan<strong>de</strong>n vor allem Gebäu<strong>de</strong> für verschie<strong>de</strong>ne Institutionen wie das<br />
Han<strong>de</strong>lsgymnasium von 1863, das Lazarett von 1878, die Armenpflegestation von 1888 und die Nicolaischule von 1898. Mit diesen Bauten etablierte sich <strong>de</strong>r Stadtteil Olympia mit<br />
Villen im Jugendstil. Mit Hilfe einer Spen<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Industriellen Henry Dunker konnte die Stadt 1927 einen Wettbewerb für ein neues Konzerthaus starten. Diesen Wettbewerb gewann <strong>de</strong>r<br />
Architekt Sven Markelius. Sein siegreicher Vorschlag war ein Funktionsgebäu<strong>de</strong> mit weißem Putz, das 1932 fertiggestellt war und heute das beste Beispiel für funktionelle Architektur in<br />
Schwe<strong>de</strong>n ist.<br />
Durch die andauern<strong>de</strong> Expansion Helsingborgs sind in <strong>de</strong>r Stadt alle Baustile <strong>de</strong>r letzten zwei Jahrhun<strong>de</strong>rte vertreten. Auch das schwedische Millionenprogramm hat hier in <strong>de</strong>n<br />
Stadtteilen Dalhem, Fredriksdal und Adolfsberg seine Spuren hinterlassen. Genauso blieb Helsingborg nicht von <strong>de</strong>r großen Abrisswelle <strong>de</strong>r 1970er-Jahre verschont. Viele ältere<br />
Gebäu<strong>de</strong> im Zentrum mussten neuen Ziegelbauten weichen. Zwei dieser mo<strong>de</strong>rnen Bauten sind das Firmengebäu<strong>de</strong> von Skandia und die SEB-Bank.<br />
Das größte Bauprojekt <strong>de</strong>r neusten Zeit sind die Gebäu<strong>de</strong>, die 1999 für die Architekturausstellung H99 am Nordhafen im neuen Funktionalstil errichtet wur<strong>de</strong>n.<br />
Plätze<br />
Der älteste Platz Helsingborgs heißt Stortorget und erstreckt sich von einer Treppenanlage im Osten bis <strong>zu</strong>r Straße Drottninggatan (Konsul Trapps plats) im Westen, wo eine Reiterstatue<br />
steht, die Magnus Stenbock zeigt. Der Platz verdankt seine spezielle längliche Form <strong>de</strong>r Tatsache, dass dänische Truppen im Schonischen Krieg (1676-1679) eine breite<br />
Versorgungsschneise zwischen Schloss und Hafen durch die Stadt schlugen. Nach Kriegsen<strong>de</strong> nutzte man die Freifläche bis En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong> Han<strong>de</strong>lszwecken. Im Laufe <strong>de</strong>r<br />
Zeit entstan<strong>de</strong>n rund um <strong>de</strong>n Platz große Gebäu<strong>de</strong> mit Prunkvollen Fassa<strong>de</strong>n.<br />
Weiter Richtung Hafen liegt <strong>de</strong>r Platz Hamntorget, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n 1890er-Jahren im Zusammenhang mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s Nordhafens geschaffen wur<strong>de</strong>. Im Alltag als Parkplatz genutzt, fin<strong>de</strong>n<br />
auf ihm aber auch <strong>zu</strong> beson<strong>de</strong>ren Anlässen, wie <strong>de</strong>m Helsingborgsfestival Konzerte statt. Am Platz liegt das Alte Zollhaus (Gamla tullhuset), heute Abfahrt von Öresundsfähren, und die<br />
alte Fährstation, heute ein Rockclub. Direkt am Pie steht die Statue Sjöfartsgudinnan („Seefahrtsgöttin“), die von Carl Milles geschaffen wur<strong>de</strong>. Daneben steht ein Monument, dass an<br />
die Landung Karl XIV. Johans in Helsingborg erinnert.<br />
Zwischen Hamntorget und Knutpunkten, <strong>de</strong>m (Bus-)Bahnhof und Fährterminal, liegt <strong>de</strong>r Kungstorget, <strong>de</strong>r früher, als die Bahngleise noch quer durch die Stadt führten, Bahn- und<br />
Parkgelän<strong>de</strong> war. Heute gibt es hier im Sommer Freiluftgaststätten und Bühnen für unterschiedliche Veranstaltungen.<br />
Der Sundstorget wur<strong>de</strong> 1865 auf <strong>de</strong>m Öresund abgewonnenem Land angelegt. Rund um <strong>de</strong>n Platz baute man einige monumentale Gebäu<strong>de</strong> und verlegte später einen großen Teil <strong>de</strong>s<br />
Markthan<strong>de</strong>ls vom Stortorget hierher, nach<strong>de</strong>m in <strong>de</strong>r Westhälfte <strong>de</strong>s Platzes eine Markthalle gebaut wor<strong>de</strong>n war. In <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong> diese jedoch wie<strong>de</strong>r<br />
abgerissen und <strong>de</strong>r Platz als Parkplatz genutzt. 2004 wur<strong>de</strong>n bei Umbauarbeiten die Autos unter die Er<strong>de</strong> verbannt. Im Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Platzes entstand eine neue Markthalle aus Glas. Entlang<br />
<strong>de</strong>r Nordseite <strong>de</strong>s Platzes liegen einige Restaurants mit Terrassen. Im Westen wird <strong>de</strong>r Platz von Dunkers kulturhus begrenzt.<br />
Einige Plätze tragen <strong>de</strong>n Namen von Personen, die für die Entwicklung <strong>de</strong>r Stadt von Be<strong>de</strong>utung waren. Beispiele sind Henry Dunkers plats zwischen <strong>de</strong>m Konzerthaus (Konserthuset)<br />
und <strong>de</strong>m Stadttheater (Stadsteatern), <strong>de</strong>r seinen Namen während <strong>de</strong>r Architekturausstellung H99 verliehen bekam, um die Verdienste Dunkers um das Kulturleben <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> ehren.<br />
Konsul Olssons plats liegt von kleinen Gassen umgeben mitten in <strong>de</strong>r Altstadt in <strong>de</strong>r Nähe eines Lagergebäu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Unternehmers Petter Olsson. Im Stadtteil Sö<strong>de</strong>r liegt Konsul<br />
Perssons plats. Hier stand einst Nils Perssons Schwefelsäurefabrik; seit 2005 wird <strong>de</strong>r Platz vom neuerbauten Tingshuset, <strong>de</strong>m Sitz <strong>de</strong>s Amtsgerichts (tingsrätt) dominiert. Nördlich <strong>de</strong>s<br />
Platzes schließt sich Mäster Palms plats mit <strong>de</strong>m Kaufhaus Sö<strong>de</strong>rpunkten an. Etwas weiter südlich liegt Gustav Adolfs torg, ehemals Nya Torg, <strong>de</strong>r an <strong>de</strong>n meisten Tagen <strong>de</strong>r Woche als<br />
Marktplatz genutzt wird.<br />
Parks und Grünanlagen<br />
Viele Parks liegen am Rand <strong>de</strong>r Innenstadt und bil<strong>de</strong>n einen Grüngürtel. Oft haben sie ihren Ursprung in privaten Gärten, die später <strong>de</strong>r Stadt geschenkt wur<strong>de</strong>n. Die meisten Parks
entstan<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r kräftigen Expansion Helsingborgs. Sie waren als grünes Gegengewicht <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n neuen Gebäu<strong>de</strong>n und<br />
Industrieanlagen gedacht.<br />
Der erste richtige Park war Krookska planteringen, gelegen zwischen <strong>de</strong>r Innenstadt und <strong>de</strong>m damals neuen Stadtteil Sö<strong>de</strong>r. Als man beabsichtigte die Freifläche <strong>zu</strong> bebauen, kauften die<br />
Geschwister Krook das Gelän<strong>de</strong> und schenkten es <strong>de</strong>r Stadt mit <strong>de</strong>r Bedingung, es in einen Park <strong>zu</strong> verwan<strong>de</strong>ln. 1873 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Park, <strong>de</strong>r heute allgemein als Stadtpark (Stadsparken)<br />
bezeichnet wird, fertiggestellt.<br />
Eine weiterer früher Park ist <strong>de</strong>r Öresundpark, <strong>de</strong>r 1877 entlang eines natürlichen Einschnittes in <strong>de</strong>r landborgen angelegt wur<strong>de</strong>, als man hier, im ältesten Industriegebiet <strong>de</strong>r Stadt,<br />
angesie<strong>de</strong>lte Wassermühlen in das neue Industriegebiet im Sü<strong>de</strong>n verlegte. Durch <strong>de</strong>n Park führt die Haupt<strong>zu</strong>fahrtsstraße <strong>zu</strong>r Innenstadt aus Richtung Nordost. Der Park zieht sich bis auf<br />
das Plateau <strong>de</strong>r landborgen hinauf, von wo man <strong>de</strong>n Öresund überblicken kann.<br />
Zum Anlass <strong>de</strong>r „Helsingborgausstellung“ (Helsingborgsutställningen) 1903 wur<strong>de</strong> das ehemalige Burggelän<strong>de</strong> um <strong>de</strong>n Turm Kärnan, seit <strong>de</strong>r Schleifung <strong>de</strong>r Festungsanlagen stets nur<br />
dünn bebaut, in einen Park namens Slottshagen verwan<strong>de</strong>lt. Heute gibt es dort einen Rosengarten und ein Freilufttheater.<br />
Im Stadtteil Olympia liegt das Freilichtmuseum Fredriksdal, das <strong>de</strong>r Stadt 1918 von Gisela Trapp, <strong>de</strong>r Witwe <strong>de</strong>s Konsuls Oscar Trapp, geschenkt wur<strong>de</strong>. Der Park beherbergt<br />
Fredriksdals herrgård, einen botanischen Garten, einen Garten mit Obstbaumbestand und das Theater Fredriksdal.<br />
Nach <strong>de</strong>m Tod König Gustav VI. Adolfs erhielt Helsingborg das Schloss Sofiero nördlich <strong>de</strong>r Stadt als Geschenk. Der da<strong>zu</strong>gehörige Park verdankt seine Bekanntheit <strong>de</strong>n vielen dort<br />
wachsen<strong>de</strong>n Rhodo<strong>de</strong>ndronarten sowie Veranstaltungen wie Orchi<strong>de</strong>enwettbewerben und Oldtimerausstellungen.<br />
Eine Schenkung von Ida und Otto Banck aus <strong>de</strong>m Jahre 1912 ist die Villa und <strong>de</strong>r Park Vikingsberg im höhergelegenen Teil Helsingborgs. Die Villa war lange Jahre Herberge für die<br />
städtische Kunstsammlung. Heute befin<strong>de</strong>t sich hier eine private Kunstgalerie.<br />
Ein weiterer bekannter Park ist <strong>de</strong>r Brunnenpark Ramlösa (Ramlösa brunnspark) im Sü<strong>de</strong>n von Helsingborg. Hier lag die alte, 1707 in Betrieb genommene Ramlösaquelle und hier war<br />
<strong>de</strong>r Ort, wo im 18. und 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt Kurgäste mit Heilwasser ihre Lei<strong>de</strong>n kurierten. im Park stehen einige gelbgestrichene, mit Holzsägearbeiten verzierte Holzhäuser.<br />
Im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt liegt <strong>de</strong>r Wald von Pålsjö (Pålsjö skog) in Nachbarschaft <strong>zu</strong>m Schloss Pålsjö und <strong>de</strong>m da<strong>zu</strong>gehörigen Schlosspark. Im Sü<strong>de</strong>n liegt das Naturschutzgebiet Rååns<br />
dalgång, <strong>de</strong>r auf einer Seite vom Fluss Råån begrenzt wird. Am Ran<strong>de</strong> liegt die Kirche von Raus (Raus kyrka), die älteste Kirche Helsingborgs, <strong>de</strong>ren Geschichte bis ins 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
<strong>zu</strong>rückgeht.<br />
Entlang <strong>de</strong>s Rands <strong>de</strong>r landborgen wur<strong>de</strong> die Landborgspromena<strong>de</strong> geschaffen, die mehrere Parks <strong>de</strong>r Stadt von Pålsjö skog bis Råådalen durch einen Wan<strong>de</strong>rweg verbin<strong>de</strong>t, von <strong>de</strong>m<br />
aus man <strong>de</strong>n Ausblick über <strong>de</strong>n Öresund genießen kann.<br />
Kultur, Sehenswürdigkeiten und Freizeit<br />
Helsingborg verfügt über ein großes Spektrum an Kultur- und Freizeiteinrichtungen. Die Stadtverwaltung unterstützt diese oft mit finanziellen Mitteln. Mit <strong>de</strong>r Errichtung <strong>de</strong>s<br />
Kulturhauses (Dunkers kulturhus) erhielt Helsingborg eine zentrale Einrichtung für Kunst, Musik und Ausstellungen.<br />
Theater<br />
Bereits seit 1813 gab es ein Theater in <strong>de</strong>r Stadt. Zu dieser Zeit wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>m damaligen Besitzer <strong>de</strong>s Heilwasserbrunnens in Ramlösa, Achates von Platen, die Erlaubnis erteilt, ein<br />
„provisorisches Theaterhaus aus Holz“ in <strong>de</strong>r Straße Prästgatan <strong>zu</strong> errichten. 1859 wur<strong>de</strong> das Theater von <strong>de</strong>r Stadt aufgekauft und bald wur<strong>de</strong>n Stimmen laut, die einen neuen und<br />
zeitgemäßen Theaterbau for<strong>de</strong>rten. Das neue, 1877 eröffnete Theater zog immer öfter umherreisen<strong>de</strong> Theatergruppen an und Anfang <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts kam <strong>de</strong>r Wunsch nach einem<br />
festen Ensemble auf. 1921 wur<strong>de</strong> so das erste fest mit einem Stadttheater verbun<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Theaterensemble Schwe<strong>de</strong>ns gegrün<strong>de</strong>t. Durch die höheren (vor allem räumlichen)<br />
Anfor<strong>de</strong>rungen, die dies mit sich brachte, wur<strong>de</strong>n das Theater schnell <strong>zu</strong> klein und unfunktionell. Auch wuchs <strong>de</strong>r Anspruch <strong>de</strong>s Publikums. So wur<strong>de</strong> 1976 das neue Stadttheater neben<br />
<strong>de</strong>m Konzerthaus errichtet, das über eine „die Große“ (Storan) genannte große und eine kleinere, folgerichtig „die Kleine“ (Lillan) genannte Bühne verfügt. Das alte Theater wur<strong>de</strong> im
selben Jahr trotz großer Proteste nie<strong>de</strong>rgerissen.<br />
Theatervorstellungen fin<strong>de</strong>n auch in Dunkers kulturhus statt. Im Sommer ist ein Besuch <strong>de</strong>s 1932 gegrün<strong>de</strong>ten Freilufttheater Fredriksdal beliebt. Es ist lan<strong>de</strong>sweit durch die<br />
Übertragung von Vorstellungen im Fernsehen sowie durch das langjährige Wirken <strong>de</strong>s Schauspielers Nils Poppe bekannt. Revuen unter freiem Himmel sind im Sommer im Park<br />
Slottshagen <strong>zu</strong> sehen.<br />
Museen<br />
Stadtmuseum<br />
Der geschichtsinteressierte Konsul Oscar Trapp schlug Anfang <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts die Einrichtung eines Museums in Helsingborg vor. 1909 eröffnete das neue Stadtmuseum in einem<br />
ehemaligen Schulgebäu<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Straße Södra Storgatan. Es zeigte neben Kunstwerken Sammlungen mit naturwissenschaftlichen, archäologischen, ethnografischen und<br />
kulturhistorischen Themen, die <strong>zu</strong>m Teil schon ab 1890 begonnen wor<strong>de</strong>n waren. Nach <strong>de</strong>r Schenkung <strong>de</strong>r Villa Vikingsberg an die Stadt durch Otto Banck konnte die Kunstsammlung<br />
1929 dorthin umziehen. Mit <strong>de</strong>r Zeit wur<strong>de</strong>n die Lokalitäten in <strong>de</strong>r Södra Storgatan auch für die verbleiben<strong>de</strong>n Ausstellungen <strong>zu</strong> klein und man suchte nach Ausweichmöglichkeiten. Die<br />
Raumfrage konnte erst 2002 gelöst wer<strong>de</strong>n, als man sowohl das Stadtmuseum als auch die Kunstsammlung aus <strong>de</strong>r Villa Vikingsberg in Dunkers kulturhus verlegte. Das Stadtmuseum<br />
zeigt heute neben stadtgeschichtlichen Ausstellungen grafische Blätter, Ölgemäl<strong>de</strong>, Kunsthandwerk und Designmöbel, die hauptsächlich aus <strong>de</strong>m nordwestlichen Bereich Schonens<br />
stammen.<br />
Freilichtmuseum Fredriksdal<br />
1918 stiftete Oscar Trapps Witwe Gisela Trapp das Gut Fredriksdal mit <strong>de</strong>n <strong>zu</strong>gehörigen Län<strong>de</strong>reien <strong>de</strong>m Museum mit <strong>de</strong>r Bedingung, dass ein dort ein Freilichtmuseum eingerichtet und<br />
die Län<strong>de</strong>reien <strong>zu</strong>r Finanzierung <strong>de</strong>s Museumsbetriebes Verwendung fin<strong>de</strong>n sollten. Das Freilichtmuseum Fredriksdal wur<strong>de</strong> im Laufe <strong>de</strong>r Jahre um weitere historische Hofanlagen aus<br />
verschie<strong>de</strong>nen Gegen<strong>de</strong>n Schonens und kulturhistorisch interessante Gebäu<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>n alten Stadtvierteln Helsingborgs erweitert. In einem <strong>de</strong>r alten Häuser aus <strong>de</strong>r Stadt liegt das<br />
Grafische Museum (Grafiska museet) – das größte dieser Art in Schwe<strong>de</strong>n –, das die Geschichte <strong>de</strong>r Druckkunst von Gutenbergs Zeit bis heute zeigt. Im Anschluss an Fredriksdal liegt<br />
das „Kulturlager“ (Kulturmagasinet), wo große Teile <strong>de</strong>r umfassen<strong>de</strong>n Sammlungen Helsingborger Museen (zwischen)lagern. Das Kulturmagasinet ist daneben <strong>de</strong>r Eigentümer <strong>de</strong>s<br />
Burgturms Kärnan und damit für <strong>de</strong>ssen Erhalt verantwortlich.<br />
Weitere Museen<br />
Östlich <strong>de</strong>s Kärnan liegen zwei weitere Museen – das Schulmuseum (Skolmuseet) und das Medizinhistorische Museum (Medicinhistoriska museet). Das Schulmuseum wur<strong>de</strong> 1985 in<br />
<strong>de</strong>r alten Östra skolan neben <strong>de</strong>r Slottsvångschule eingerichtet. Es zeigt restaurierte alte Schuleinrichtungen und Lehrmittel aus verschie<strong>de</strong>nen Volksschulen in und um Helsingborg. Das<br />
Medizinhistorische Museum in einem ehemaligen Kin<strong>de</strong>rkrankenhaus zeigt historische Krankenhauseinrichtungen und Gegenstän<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>m Bereich <strong>de</strong>r Pflege. Das Helsingborger<br />
Sportmuseum (Helsingborgs Idrottsmuseum) in <strong>de</strong>r Straße Carl Krooks gata in Sö<strong>de</strong>r vermittelt einen Einblick in die lange Sportgeschichte Helsingborgs und verleiht <strong>de</strong>n Preis „Sportler<br />
<strong>de</strong>s Jahres in Helsingborg“ (Årets idrottare i Helsingborg). Außerhalb <strong>de</strong>r Stadt liegt das „Bereitschaftsmuseum“, das in <strong>de</strong>r unterirdischen Batterie Helsingborg (Batteri Helsingborg),<br />
gebaut 1940, von <strong>de</strong>n Umstän<strong>de</strong>n in Schwe<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs erzählt und Kriegsmaterial aus dieser Zeit zeigt.<br />
Musik<br />
Noch bis weit ins 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt hinein war ein Konzert ein eher ungewöhnliches Ereignis in <strong>de</strong>r Stadt am Öresund. Lediglich einige wenige Ensembles spielten hin und wie<strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>n<br />
Heilquellen <strong>de</strong>r Stadt, <strong>de</strong>r Sofienquelle (Sofiakällan) und <strong>de</strong>r Ramlösaquelle, und <strong>de</strong>r Chor Husarrengementets musikkår gab vereinzelte öffentliche Konzerte. 1896 grün<strong>de</strong>te sich die<br />
Helsingborger Musikgesellschaft (Helsingborgs musiksällskap), um die Musikliebe <strong>de</strong>r Helsingborger Bürger mit regelmäßigen Konzertveranstaltungen <strong>zu</strong> wecken und <strong>zu</strong> för<strong>de</strong>rn. 1911<br />
beschloss <strong>de</strong>r schwedische Reichstag die För<strong>de</strong>rung von Orchestern in Schwe<strong>de</strong>ns Provinzstädten. Da sich die Stadt an <strong>de</strong>n För<strong>de</strong>rmaßnahmen ebenfalls beteiligte, entstand noch im<br />
selben Jahr die Orchestervereinigung Nordwestliches Schonen (Nordvästra Skånes Orkesterförening), aus <strong>de</strong>r später das Sinfonieorchester Helsingborg hervorging. Das große Interesse,<br />
auf das die neue Einrichtung in <strong>de</strong>n ersten Jahren stieß, drohte bald <strong>zu</strong> schwin<strong>de</strong>n, da es an einem festen Konzerthaus mangelte. 1932 schließlich stand das neue Haus. Das vom
Architekten Sven Markelius entworfene Helsingborgs konserthus sorgte für einen <strong>de</strong>utlich <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>s Musikinteresse in <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Das Kulturleben in Helsingborg kann sich heute auf ein reiches Musikangebot aller Richtungen – von Klassik über Jazz bis <strong>zu</strong> eher mo<strong>de</strong>rner Musik – stützen. Im Konzerthaus kann man<br />
neben regelmäßigen Auftritten <strong>de</strong>s Sinfonieorchesters Helsingborg auch vielen Gastauftritten beiwohnen. Dunkers kulturhus ist eine bekannte Lokalität für Konzerte in kleinerem<br />
Rahmen, beispielsweise für Auftritte <strong>de</strong>r Musikschule. Auch in <strong>de</strong>n Kirchen <strong>de</strong>r Stadt, vor allem in <strong>de</strong>r Marienkirche und <strong>de</strong>r Gustav-Adolf-Kirche, wer<strong>de</strong>n oft musikalische<br />
Veranstaltungen verschie<strong>de</strong>ner Ausprägungen wie Taizémessen o<strong>de</strong>r Solokonzerte ausgerichtet. Liebhaber beschwingter Musik sind in <strong>de</strong>n Kellerräumen <strong>de</strong>s Jazzklubs in <strong>de</strong>r Straße<br />
Kullegatan am richtigen Ort. The Tivoli am Nordhafen ist <strong>de</strong>r einzige Rockklub <strong>de</strong>r Stadt und bietet regelmäßige Konzerte angesagter Gruppen. Daneben gibt es in Helsingborg<br />
verschie<strong>de</strong>ne Musikgruppierungen, darunter <strong>de</strong>r Kammerchor Helsingborg (Helsingborgs kammarkör), die Kammermusikvereinigung Helsingborg (Helsingborgs<br />
kammarmusikförening), Visans vänner („Freun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Weise“), Pearls of the Sound und das Vokalensemble Helsingborg (Helsingborgs vokalensemble).<br />
Bauwerke<br />
Zu <strong>de</strong>n „herausragen<strong>de</strong>n“ Sehenswürdigkeiten Helsingborgs gehört <strong>de</strong>r restaurierte Burgturm Kärnan, einzig übergeblieben von <strong>de</strong>r mittelalterlichen Befestigungsanlage Helsingborg, die<br />
1150 erbaut, 1680 geschleift wur<strong>de</strong>. Von ihm aus hat man einen hervorragen<strong>de</strong>n Blick über <strong>de</strong>n Öresund in Richtung Dänemark. Sehenswert sind auch das Rathaus, erbaut 1857, und die<br />
Freitreppe am Stortorget sowie die Sankt-Marien-Kirche aus <strong>de</strong>m 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt.<br />
Das Brunnenhotel Ramlösa (Ramlösa brunnshotell, auch Stora hotellet, „Großes Hotel“), erbaut zwischen 1876 und 1882 im Stadtteil Ramlösa, <strong>de</strong>r hauptsächlich durch das hier<br />
gewonnene Mineralwasser bekannt ist, ist das größte skandinavische Gebäu<strong>de</strong> aus Holz. Das umliegen<strong>de</strong> parkartige Wohngebiet war lange ein Treffpunkt für die soziale Oberschicht<br />
Schonens. Rund 3 km nördlich <strong>de</strong>r Stadt liegt das von Parkanlagen umgebene Schloss Sofiero, ehemalige Sommerresi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>r königlichen Familie. Lan<strong>de</strong>sweit bekannt ist das<br />
Freilufttheater Fredriksdal im Freilichtmuseum Fredriksdal.<br />
Gastronomie und Nachtleben<br />
Helsingborg hat neben einer Reihe populärer Restaurants eine <strong>de</strong>r höchsten Kneipendichten Schwe<strong>de</strong>ns <strong>zu</strong> bieten.<br />
Immerhin drei von zwanzig Restaurants <strong>de</strong>r „schwedischen Meisterklasse“ sind laut <strong>de</strong>m Restaurantführers „White Gui<strong>de</strong> 2006“ in Helsingbrog <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n[14]. Neben weiteren guten und<br />
populären Adressen neueren Datums gibt es auch einige Restaurants, die auf eine lange Tradition <strong>zu</strong>rückblicken können und auch heute noch beliebt sind, allen voran Mollbergs matsalar<br />
(etwa „Mollbergs Speisesäle“), die an das Hotel Mollberg angeschlossen sind. An dieser Stelle gibt es seit <strong>de</strong>m 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt einen Gaststättenbetrieb. Aufgrund <strong>de</strong>r Lage Helsingborgs<br />
am Öresund gibt es entlang <strong>de</strong>r Wasserfront eine Reihe Restaurants im Bereich <strong>de</strong>s Nordhafens, <strong>de</strong>r Kaipromena<strong>de</strong> (Kajpromena<strong>de</strong>n) und <strong>de</strong>r Strandpromena<strong>de</strong> (Strandpromena<strong>de</strong>n), die<br />
im Sommer auch unter freiem Himmel servieren. Außer<strong>de</strong>m gibt es eine Vielzahl an Gaststätten mit Speisen aus aller Welt. Auch einige Konditoreien und Cafés mit teils über<br />
hun<strong>de</strong>rtjähriger Geschichte sind in Helsingborg <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n. Wie für Städte dieser Größenordnung üblich, unterhalten auch die weit verbreiteten Fastfoodrestaurant- und Caféketten wie<br />
McDonalds und Wayne's Coffee in <strong>de</strong>r Stadt Filialen.<br />
Nachtclubs und Kneipen konzentrieren sich im Stadtzentrum, aber auch <strong>de</strong>r Stadtteil Sö<strong>de</strong>r hat ein Nachtleben <strong>zu</strong> bieten.<br />
Strandgebiete<br />
Helsingborg ist eine <strong>de</strong>r wenigen Städte in Schwe<strong>de</strong>n, wo man ansprechen<strong>de</strong> Ba<strong>de</strong>strän<strong>de</strong> vorfin<strong>de</strong>t, die nur zehn Minuten Fußweg vom Zentrum entfernt sind. Im Sommer sieht man oft<br />
Leute, die die Stadt in Ba<strong>de</strong>sachen durchstreifen. Der stadtnächste Ba<strong>de</strong>platz heißt „Tropical Beach“ mit Palmen und Sonnenstühlen. Er wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Ausstellung H99 angelegt und<br />
liegt direkt an <strong>de</strong>r Hafeneinfahrt <strong>de</strong>s Inneren Hafens (Inre hamn).<br />
Nördlich <strong>de</strong>s Nordhafens (Norra hamn) liegen die sandlosen Ba<strong>de</strong>stellen namens „Järnvägsmännens“ und „Gröningen“ mit großer Liegewiese und Ba<strong>de</strong>steg. Weiter nördlich liegt das<br />
Örestrandsbad (auch „Fria bad“ genannt), einer <strong>de</strong>r populärsten Strän<strong>de</strong>, so wie ganz im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt <strong>de</strong>r „Wikingerstrand“ (Vikingstrand), <strong>de</strong>r behin<strong>de</strong>rtengerecht eingerichtet ist.<br />
Südlich von Helsingborg ist das Ufer <strong>de</strong>s Öresun<strong>de</strong>s recht seicht, was da<strong>zu</strong> führt, dass die hier liegen<strong>de</strong>n Strän<strong>de</strong> Råå vallar und Örby ängar von Familien mit Kleinkin<strong>de</strong>rn bevor<strong>zu</strong>gt
wer<strong>de</strong>n. Zwischen diesen Strän<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>m Hafengelän<strong>de</strong> liegt Helsingborgs FKK-Strand, Knähakens bad.<br />
Außer<strong>de</strong>m gibt es in Helsingborg drei Seeba<strong>de</strong>häuser (kallbadhus), gelegen südlich <strong>de</strong>s Wikingerstrands, (Pålsjöba<strong>de</strong>n), zwischen Örestrandsbad und Gröningen (Norra Kallbadhuset<br />
o<strong>de</strong>r „Kallis“), sowie im Sü<strong>de</strong>n bei Råå (Råå kallbadhus).<br />
Sport<br />
Helsingborger Olympia<strong>de</strong><br />
Helsingborg blickt auf eine lange Sportgeschichte <strong>zu</strong>rück. Bereits 1834 wur<strong>de</strong>n bei Ramlösa eine erstes Sportfest in <strong>de</strong>r olympischen Tradition veranstaltet. Hinter <strong>de</strong>n Spielen stand <strong>de</strong>r<br />
„Olympische Verein“ (Olympiska föreningen), <strong>de</strong>ssen Ziel es war, das Interesse an <strong>de</strong>n Olympischen Spielen in Schwe<strong>de</strong>n und Norwegen <strong>zu</strong> wecken. Als Disziplinen waren bei dieser<br />
Helsingborger Olympia<strong>de</strong> Gymnastik (gymnastik), Laufen (kapplöpning), Ringen (brottning) und Klettern (klättring) vertreten. Die Spiele zogen eine beachtliche Anzahl Zuschauer an<br />
und wur<strong>de</strong>n einmalig 1836 wie<strong>de</strong>rholt. Einige Straßen in <strong>de</strong>r Gegend um <strong>de</strong>n Austragungsort, heute ein Industriegebiet um <strong>de</strong>n Bahnhof Ramlösa, tragen heute noch Namen wie<br />
Kapplöpningsgatan, Fäktmästargatan und Rännarbanan <strong>zu</strong>r Erinnerung an das Geschehen.<br />
Fußball<br />
Die dominieren<strong>de</strong> Sportart in Helsingborg ist das Fußballspiel und es gibt eine Vielzahl von Fußballvereinen in <strong>de</strong>r Stadt. Der erfolgreichste unter ihnen ist Helsingborgs IF (HIF),<br />
entstan<strong>de</strong>n 1907 durch die Zusammenlegung <strong>de</strong>r Vereine Svithiod und Stattena. Der HIF spielt <strong>zu</strong>r Zeit in <strong>de</strong>r höchsten schwedischen Liga, <strong>de</strong>r Fotbollsallsvenskan. Von <strong>de</strong>n späten<br />
1920ern bis Anfang <strong>de</strong>r 1940er war Helsingborgs IF eine <strong>de</strong>r besten Mannschaften Schwe<strong>de</strong>ns und gewann 1929, 1930, 1933, 1934 und 1941 die Meisterschaft. Darauf folgte eine Phase<br />
mit eher beschei<strong>de</strong>neren Erfolgen und 1968 schließlich stieg <strong>de</strong>r Verein in die Division 1 ab. Der Wie<strong>de</strong>raufstieg gelang erst 1992, worauf 1999 <strong>de</strong>r Gewinn <strong>de</strong>s Meistertitels folgte. Das<br />
Heimatstadion <strong>de</strong>s HIF ist das Olympia, eines <strong>de</strong>r ältesten Stadien Schwe<strong>de</strong>ns, erbaut 1898. Die ursprünglich für sowohl Fußball- als auch Leichtathletikveranstaltungen gebaute Arena<br />
ist heute ein reines Fußballstadion mit Platz für etwa 16.700 Zuschauer. Im Umfeld <strong>de</strong>s Stadions liegen zahlreiche weitere Sportanlagen.<br />
Der HIF war jedoch nicht immer <strong>de</strong>r einzige Repräsentant Helsingborgs in <strong>de</strong>r Fotbollsallsvenskan. In <strong>de</strong>n Jahren 1951 und 1952 spielte dort auch <strong>de</strong>r Råå IF, <strong>de</strong>ssen größter Triumph<br />
1948 <strong>de</strong>r Sieg <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>spokals war. Heute spielt <strong>de</strong>r Verein im Amateurbereich. Weitere Fußballvereine <strong>de</strong>r Stadt sind <strong>de</strong>r 1927 gegrün<strong>de</strong>te Högaborgs BK, Heimatverein von Henrik<br />
Larsson, und <strong>de</strong>r 1991 aus <strong>de</strong>r Zusammenlegung von Helsingborgs Södra BK, Helsingborgs BoIS und BK Drott entstan<strong>de</strong>ne Verein Helsingborgs Södra BIS, die <strong>de</strong>rzeit jeweils nur<br />
unterklassig antreten.<br />
Helsingborgs erfolgreichste Damenfußballmannschaft gehört <strong>zu</strong>m Stattena IF, gegrün<strong>de</strong>t 1922. Sie spielt heute in <strong>de</strong>r Division 1 nach zwei Spielzeiten in <strong>de</strong>r Allsvenskan <strong>de</strong>r Damen<br />
2003 und 2004.<br />
IFK Helsingborg<br />
Helsingborgs Sportkameradschaft (Idrottsföreningen Kamraterna), <strong>de</strong>r IFK Helsingborg, wur<strong>de</strong> 1896 von <strong>de</strong>m erst 16-jährigen Hjalmar He<strong>de</strong>nblad als Sällskapet Idrottsvänner<br />
(„Gesellschaft <strong>de</strong>r Sportfreun<strong>de</strong>“) gegrün<strong>de</strong>t und wur<strong>de</strong> eine zeitgleich mit <strong>de</strong>r Zusammenlegung mit <strong>de</strong>m Fußballverein GFK <strong>zu</strong>r Sportkameradschaft. Der Verein war in seiner<br />
Geschichte in vielen Disziplinen wie Fußball, Radfahren, Schwimmen, Orientierungslauf, Handball, Turnen, Eishockey und Basketball tätig. Heute vertretene Sportarten sind<br />
Leichtathletik (als einzige seit <strong>de</strong>r Gründung mit dabei), Skifahren, Tennis, Bowling, Eiskunstlauf, Volleyball und Triathlon. Der IFK ist auf <strong>de</strong>m Sportplatz He<strong>de</strong>n und im „Haus <strong>de</strong>s<br />
Sports“ <strong>zu</strong>hause.<br />
Übrige Sportarten<br />
Das „Haus <strong>de</strong>s Sports“ (Idrottens hus) ist die größte Sporthallenanlage <strong>de</strong>r Stadt. Die größte Halle fasst 1800 Zuschauer. Das Haus <strong>de</strong>s Sports wird unter an<strong>de</strong>rem vom Handballverein<br />
Olympic/Viking Helsingborg HK, <strong>de</strong>m Innebandyverein FC Helsingborg und <strong>de</strong>m Basketballverein Helsingborg Pearls für Training und Heimspiele genutzt. Der Handballverein<br />
Olympic/Viking entstand 1994 aus seine Vorgängern Olympia und Vikingarna und spielt 2009/2010 in <strong>de</strong>r Elitserien i handboll för herrar, die Frauen in <strong>de</strong>r Division 2. Der FC
Helsingborg, gegrün<strong>de</strong>t 2003, spielt in <strong>de</strong>r Innebandy-Elitserie. Der Basketballverein Helsingborg Pearls – mit 900 Mitglie<strong>de</strong>rn und 20 Jugendmannschaften – spielt seit 2003 in <strong>de</strong>r<br />
schwedischen Basketligan unter <strong>de</strong>m Namen <strong>de</strong>s Hauptsponsors, Öresundkraft. Eishockey steht in Helsingborg etwas abseits im Schatten <strong>de</strong>s Fußballs.<br />
Der Eishockeyverein <strong>de</strong>r Stadt, <strong>de</strong>r HHC Redskins, gegrün<strong>de</strong>t 1977, spielt in <strong>de</strong>r Division 2. Das Heimatstadion, Olympiarinken, fasst 2100 Zuschauer.<br />
Eine Vielzahl von Turnvereinen, GF Fram, GF Ling, Helsingborgs Turnéförening und Råå GF, die alle Helsingborgs Gymnastikförbund angehören, sind im „Haus <strong>de</strong>r Gymnastik“<br />
(Gymnastikens Hus) im Sü<strong>de</strong>n Helsingborgs angesie<strong>de</strong>lt.<br />
Der Schwimmverein <strong>de</strong>r Stadt, Helsingborgs Simsällskap, ist einer <strong>de</strong>r erfolgreichsten in ganz Schwe<strong>de</strong>n. Der Verein betreibt die Schwimmhalle Filborna im Stadtteil Ättekulla. Südlich<br />
<strong>de</strong>s Stadtzentrums steht die Schwimmhalle Simhallsba<strong>de</strong>t.<br />
Neuere Zugänge in <strong>de</strong>r Sportlandschaft Helsingborgs sind Rugby (Rugby Club Gripen) und American Football (Helsingborg Crocodiles).<br />
An<strong>de</strong>re in Helsingborger Sportvereine sind <strong>de</strong>r Tischtennisverein BTK Rekord, <strong>de</strong>r Laufverein HLK-92 und <strong>de</strong>r Badmintonklub Helsingborg <strong>zu</strong> nennen.<br />
Wirtschaft und Infrastruktur<br />
Wirtschaft<br />
In Helsingborg sind über 10.000 steuerpflichtige Unternehmen registriert, von <strong>de</strong>nen 94 mehr als 50 Angestellte haben. Rund 3.100 Betriebe beschäftigen zwischen 2 und 49 Menschen<br />
und etwa 7.000 sind Ein-Mann-Unternehmen. Die Unternehmen bieten insgesamt rund 58.000 Arbeitsplätze.<br />
Die größten Wirtschaftszweige sind die Bereiche Han<strong>de</strong>l und Verkehr mit rund 15.000 Beschäftigten. Weitere Schwerpunkte liegen in <strong>de</strong>r Lebensmittel-, chemischen und<br />
Pharmaindustrie. Am schnellsten wächst <strong>de</strong>r Dienstleistungssektor, <strong>de</strong>r sich in <strong>de</strong>n letzten zwanzig Jahren verdoppelt hat.<br />
Diese Angaben beziehen sich auf die gesamte Gemein<strong>de</strong> Helsingborg, lassen aber Rückschlüsse auf die Situation in <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong>, da diese das Zentrum <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Tätigkeit in<br />
<strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> darstellt.<br />
Ansässige Unternehmen<br />
Die verkehrsgünstige Lage Helsingborgs war und ist ein Grund für das gute Wirtschaftsklima[15] <strong>de</strong>r Stadt. Helsingborg und die nähere Umgebung zählt nach Stockholm, Göteborg und<br />
Malmö die meisten Unternehmenshauptsitze in Schwe<strong>de</strong>n.<br />
Einige große, <strong>zu</strong>m Teil international bekannte, in Helsingborg tätige Unternehmen sind ABB, <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lsunternehmen ICA, <strong>de</strong>r Möbelkonzern Ikea, das Pharmaunternehmen Pfizer,<br />
SKF Multitec AB, <strong>de</strong>r Schuh- und Tennisballhersteller Tretorn, <strong>de</strong>r Mineralwasserhersteller Ramlösa Hälsobrunn AB und Unilever Bestfoods.<br />
Einzelhan<strong>de</strong>l<br />
Durch die Umwandlung <strong>de</strong>r Straße Kullagatan <strong>zu</strong>r Fußgängerzone im Jahre 1961 erhielt Helsingborg die erste Fußgängerzone Schwe<strong>de</strong>ns. Heute liegt ein Großteil <strong>de</strong>r Lä<strong>de</strong>n im<br />
Zentrum an dieser Straße, wovon viele Filialen <strong>de</strong>r in ganz Schwe<strong>de</strong>n vertretenen Han<strong>de</strong>lsketten sind. Die Einkaufsstraße setzt sich in Richtung Sü<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>n Straßen Mariagatan und<br />
Bruksgatans fort. Hier und parallel <strong>zu</strong>r Kullegatan in <strong>de</strong>r Norra und Södra Storgatan, die keine Fußgängerzone sind, fin<strong>de</strong>t man weitere, vermehrt nicht kettenangehörige Einzelhändler.<br />
Am Mäster Palms plats im Stadtteil Sö<strong>de</strong>r liegt die Einkaufszentrum Sö<strong>de</strong>rpunkten mit einer Reihe von Lä<strong>de</strong>n großer Ketten und Imbisse. Etwas weiter südlich am Platz Gustav Adolfs<br />
torg fin<strong>de</strong>t an <strong>de</strong>n meisten Tage <strong>de</strong>r Woche ein Markt statt.<br />
Etwa sechs Kilometer außerhalb <strong>de</strong>r Stadt liegt das Einkaufszentrum Väla (Väla centrum), eines <strong>de</strong>r Größten in Schwe<strong>de</strong>n mit einer Fläche von 47.000 Quadratmetern und über<br />
einhun<strong>de</strong>rt Geschäften verschie<strong>de</strong>ner Größe. Daneben gibt es in Stadtnähe je ein Kaufhaus <strong>de</strong>r großen Ketten ICA (ICA Maxi) und Coop (Coop Forum).
Eine weitere Einkaufsalternative ist Helsingør auf <strong>de</strong>r dänischen Seite <strong>de</strong>s Öresund, das mit <strong>de</strong>r Fähre in rund zwanzig Minuten vom Stadtzentrum aus <strong>zu</strong> erreichen ist. Die beson<strong>de</strong>re<br />
Attraktivität Helsingørs, die viele Kun<strong>de</strong>n aus Helsingborg und Umgebung anlockt, liegt in <strong>de</strong>n geringeren Spirituosenpreisen in Dänemark.<br />
Wirtschaftsgeschichte<br />
Die Industriegeschichte Helsingborgs begann am Anfang <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts, als die ersten kleinen Fabriken, in <strong>de</strong>nen unter an<strong>de</strong>rem Tabakwaren und Textilien hergestellt wur<strong>de</strong>n,<br />
öffneten. Die erste größere Unternehmung war die Fayence och porcellainsfabrique bei Pålsjö im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt, gegrün<strong>de</strong>t 1766 von Michael Andreas Cöster und bereits 1774 nach<br />
wirtschaftlichen Problemen wie<strong>de</strong>r geschlossen. 1799 grün<strong>de</strong>te Graf Erik Ruuth eine Eisengießerei und eine Keramikfabrik am südlichen Stadtrand. Bekannt unter <strong>de</strong>m gemeinsamen<br />
Namen Ruuthska bruket waren lange Zeit die größten Arbeitgeber in Helsigborg.<br />
In <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts erlebt die Stadt einen starken wirtschaftlichen Aufschwung mit einem explosionsartigen Anstieg <strong>de</strong>r Zahl <strong>de</strong>r Unternehmensneugründungen,<br />
worauf ein ähnlich starkes Bevölkerungswachstum folgte. Diese Entwicklung war vor allem <strong>de</strong>r Weitsicht und <strong>de</strong>m Unternehmergeistes zweier Personen <strong>zu</strong> verdanken:<br />
Einer von ihnen war <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lsunternehmer Petter Olsson, <strong>de</strong>r ein großer Vermögen mit <strong>de</strong>m Export von Getrei<strong>de</strong> gemacht hatte. Als Mitglied <strong>de</strong>s Stadtrats war Olsson eine treiben<strong>de</strong><br />
Kraft, wenn es um die Verbesserung <strong>de</strong>r Verkehrsinfrastruktur <strong>de</strong>r Stadt ging. Mit seinem Privatvermögen beteiligte er sich an <strong>de</strong>r Finanzierung zahlreicher Projekte, wie im Jahre 1880<br />
am Ausbau <strong>de</strong>s Südhafens (Södra hamnen) und zwölf Jahre später auch <strong>de</strong>s Nordhafens (Norra hamnen). Er stand auch hinter <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r Eisenbahnstrecken zwischen Helsingborg und<br />
Eslöv, Hässleholm, Landskrona und Värnamo, die stark <strong>zu</strong>m wirtschaftlichen Wachstum <strong>de</strong>r Stadt in dieser Zeit beitrugen. Weitere Aktivitäten Olssons, zwischenzeitlich <strong>zu</strong>m Konsul<br />
ernannt, bestan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Gründung zahlreicher Industrieunternehmen, darunter die dampfkraftbetriebene Mühle Helsingborgs Ångqvarns AB 1884, die Zuckerfabrik Sockerbruket (in<br />
<strong>de</strong>ren Gebäu<strong>de</strong>n heute einige Einheiten <strong>de</strong>s Möbelkonzerns Ikea ihren Sitz haben) 1890, Helsingborgs Gummifabriks AB gemeinsam mit Johan Dunker, <strong>de</strong>m Vater von Henry Dunker,<br />
und an<strong>de</strong>ren 1891, und die Skånska Jutefabriks AB 1896.<br />
Die an<strong>de</strong>re Person von großer Be<strong>de</strong>utung war Nils Persson, mit <strong>de</strong>m <strong>zu</strong>sammen Olsson die Zuckerfabrik grün<strong>de</strong>te – auch er später <strong>zu</strong>m Konsul ernannt. Er begann seine<br />
Unternehmerkarriere als Händler und Importeur von Kunstdünger. Er grün<strong>de</strong>te die Superfosfat- & Svavelsyrefabriks AB im Jahre 1874. Als Rohstoff importierte er Schwefelkies aus<br />
seinen eigenen Gruben im norwegischen Sulitjelma. Da das Gebirge in jener Region auch reich an Eisenerz war, nahm 1886 sein kupferverarbeiten<strong>de</strong>r Betrieb Helsingborgs Kopparverk<br />
die Produktion auf. Darüber hinaus hatten auch Helsingborgs Ångtegelbruk AB (1873), die bereits genannte Zuckerfabrik und Helsingborgs Cin<strong>de</strong>r- och Kalbfabriks AB ihre Existenz<br />
Persson <strong>zu</strong> verdanken.<br />
Nach bei<strong>de</strong>n Konsuln wur<strong>de</strong>n später Plätze in <strong>de</strong>r Stadt benannt. Konsul Olssons plats liegt im nördlichen Stadtzentrum, Konsul Perssons plats im Stadtteil Sö<strong>de</strong>r gegenüber <strong>de</strong>m<br />
Südhafen.<br />
Viele <strong>de</strong>r Industriebetriebe, die im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n, haben bis heute überlebt, wenn auch unter an<strong>de</strong>rem Namen. So wur<strong>de</strong> Ruuthska bruket 1869 in Helsingborgs Jern-<br />
och Lerkärlsfabriks AB umbenannt, und als die Eisengießerei 1885 nach Sö<strong>de</strong>r umzog, än<strong>de</strong>rte sich damit ebenfalls ihr Name und sie hieß fortan Helsingborgs Mekaniska Verkstad. 1918<br />
ging sie in die AB Elektromekano über, die später ein Teil <strong>de</strong>s ASEA-Konzerns, <strong>de</strong>r heutigen ABB, wur<strong>de</strong>. Aus Perssons Schwefelsäurefabrik wur<strong>de</strong> 1918 Reymersholms Gamla Industri<br />
AB, die 1963 vom Bergbauunternehmen Boli<strong>de</strong>n AB aufgekauft wur<strong>de</strong>. 1977 entstand daraus die Boli<strong>de</strong>n Kemi AB, die 1989 schließlich von <strong>de</strong>m finnischen Chemieunternehmen<br />
Kemira Oy gekauft wur<strong>de</strong> und heute <strong>de</strong>n Namen Kemira Kemi AB trägt. Helsingborgs Gummifabriks AB heißt heute Tretorn Swe<strong>de</strong>n AB.<br />
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>n auch mehrere Ree<strong>de</strong>reien in Helsingborg gegrün<strong>de</strong>t. Die ersten Ree<strong>de</strong>r waren die Brü<strong>de</strong>r Carl August, Otto und Bror Banck, die 1873 die C A Banck & Co<br />
schufen. Auch Konsul Olsson betätigte sich im Ree<strong>de</strong>reigeschäft, und war <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m Schiffsmakler Axel Pyk und Konsul N. C. Corfitzon Teilhaber an <strong>de</strong>r Re<strong>de</strong>rie AB<br />
Helsingborg (1896). Anfang <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts entstan<strong>de</strong>n weitere Ree<strong>de</strong>reibetriebe und beim Ausbruch <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges gab es in Helsingborg um die 50 Ree<strong>de</strong>reien. Die<br />
größten unter ihnen waren Transmarin, Gorthons und Hillerströms. In <strong>de</strong>n 1970ern und 1980ern gerieten viele Ree<strong>de</strong>r in wirtschaftliche Schwierigkeiten, was da<strong>zu</strong> führte, dass heute<br />
kein einziges Unternehmen <strong>de</strong>r Branche ihren Sitz in <strong>de</strong>r Stadt hat.<br />
Verkehr<br />
Helsingborg ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in <strong>de</strong>r Öresundregion und verfügt über Anbindung an das schwedische und indirekt auch an das dänische Straßen- und Bahnnetz. Die
Stadt ist außer<strong>de</strong>m auf <strong>de</strong>m See- und Luftweg <strong>zu</strong> erreichen.<br />
See<br />
Drei Ree<strong>de</strong>reien betreiben Fährverbindungen nach Helsingør auf <strong>de</strong>r dänischen Seite <strong>de</strong>s Öresunds. Der größte Akteur auf <strong>de</strong>r umgangssprachlich HH-le<strong>de</strong>n genannten Strecke ist die<br />
dänisch-<strong>de</strong>utsche Scandlines mit <strong>de</strong>n Fähren M/S Tycho Brahe, M/S Aurora af Helsingborg und M/S Hamlet. Sie verkehren tagsüber alle 20 Minuten, nachts etwas seltener, ab<br />
Knutpunkten, <strong>de</strong>m zentralen Knotenpunkt zwischen Zug-, Bus- und Fährverbindungen. Die Fähren M/S Mercandia IV und M/S Mercandia VIII <strong>de</strong>r Ree<strong>de</strong>rei HH-Ferries verkehren<br />
halbstündlich (nachts stündlich) ab Nordhafen (Nordhamnen). Sowohl Scandlines als auch HH-Ferries beför<strong>de</strong>rn Personen auch Kraftfahrzeuge, Busse und Lastkraftwagen, wogegen <strong>de</strong>r<br />
dritte Mitwettbewerber, Sundsbussarna, auf seinen Personenfähren M/S Sundbuss Pernille und M/S Sundbuss Mag<strong>de</strong>lone keine Fahrzeuge übersetzt. Sundsbussarna-Fähren verkehren ab<br />
<strong>de</strong>m alten Zollhaus am Hafenplatz halbstündlich, jedoch nur tagsüber.<br />
Auch wenn die Verbindung Helsingborg–Helsingør seit <strong>de</strong>r Einweihung <strong>de</strong>r Öresundverbindung im Jahr 2000 <strong>de</strong>utlich an Be<strong>de</strong>utung verloren hat, ist sie immer noch eine <strong>de</strong>r am<br />
dichtesten befahrenen Fährrouten <strong>de</strong>r Welt. Die Fahrtzeit auf dieser mit 4,9 Kilometern kürzesten Verbindung zwischen Schwe<strong>de</strong>n und Dänemark beträgt rund 20 Minuten.<br />
Straße<br />
Das Gebiet von Helsingborg war lange Zeit ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Knotenpunkt im schwedischen Wegenetz. Dies beruhte unter an<strong>de</strong>rem auf <strong>de</strong>r Fähranbindung <strong>de</strong>r Stadt an Dänemark. So<br />
trafen sich hier die seinerzeit wichtigen Reichsstraßen (riksväg) 1 und 2. Im Laufe <strong>de</strong>r Jahre wur<strong>de</strong> das Straßennetz <strong>de</strong>r Stadt mehrfach umgebaut und heute ist Helsingborg von<br />
verschie<strong>de</strong>nen Autobahnen umgeben. Im Osten verläuft die Europastraße 6/20 von Malmö nach Göteborg, von <strong>de</strong>r nordöstlich <strong>de</strong>r Stadt die Europastraße 4 Richtung Stockholm<br />
abzweigt.<br />
Schiene<br />
Helsingborg ist ein wichtiger Eisenbahnknotenpunkt. Die Stadt liegt an <strong>de</strong>r Bahnlinie Malmö–Lund–Landskrona–Helsingborg–Ängelholm–Göteborg (Västkustbanan). Daneben<br />
beginnen hier die Strecken Helsingborg–Teckomatorp–Lund–Malmö sowie Helsingborg–Åstorp–Hässleholm–Kristianstad (Skånebanan).<br />
Helsingborg ist in das schonische Pågatåg- und das schwedisch-dänische Öresundståg-Netz eingebun<strong>de</strong>n. Daneben verkehren Züge <strong>de</strong>r schwedischen Eisenbahngesellschaft Statens<br />
Järnvägar (SJ). Direktverbindungen bestehen unter an<strong>de</strong>rem nach Göteborg, Lund, Malmö, Kristianstad, Kopenhagen und Helsingør.<br />
Neben <strong>de</strong>m Hauptbahnhof Helsingborg C gibt es seit 1998 beziehungsweise 1999 die Haltepunkte Ramlösa im Sü<strong>de</strong>n und Maria im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt. Helsingborg C ist Bestandteil <strong>de</strong>s<br />
zentralen Verkehrsknotenpunktes Knutpunkten, an <strong>de</strong>m Übergang <strong>zu</strong> Öresundfähren nach Helsingør und <strong>zu</strong>m Stadt- und Regionalbusnetz besteht.<br />
Vor <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r Öresundbrücke verkehrten zwischen Helsingborg und Helsingør Eisenbahnfähren, die einen Teil <strong>de</strong>r Bahnlinie Kopenhagen–Stockholm darstellten. Diese Verbindung<br />
war vor allem <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Kalten Krieges von entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung für Schwe<strong>de</strong>n, da sie die einzige Strecke war, über die schwedische Personenzüge ohne Transit durch ein<br />
Ostblockland das übrige Westeuropa erreichen konnten. Seit <strong>de</strong>r Verlegung <strong>de</strong>s grenzüberschreiten<strong>de</strong>n Zugverkehrs auf die Öresundverbindung und <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>nen Stilllegung<br />
<strong>de</strong>r Eisenbahnfähren hat Helsingborg seine tragen<strong>de</strong> Rolle im Fernverkehr verloren und ist heute vor allem von regionaler Be<strong>de</strong>utung.<br />
Für die Zukunft ist die Verlegung <strong>de</strong>r innerhalb <strong>de</strong>r Stadt verlaufen<strong>de</strong>n Bahnstrecke und <strong>de</strong>r Bau eines Eisenbahntunnels unter <strong>de</strong>m Öresund hindurch nach Helsingør im Gespräch[16].<br />
Luft<br />
Vom Flugplatz Ängelholm-Helsingborg gibt es Inlandsflüge nach Stockholm. Zum internationalen Flughafen Kastrup in Kopenhagen verkehren Direktzüge.<br />
Innerstädtischer öffentlicher Personennahverkehr<br />
Der innerstädtische öffentliche Personennahverkehr besteht aus 16 Buslinien, die teilweise im 5-Minuten-Takt verkehren. Zwei Servicelinien, die unter an<strong>de</strong>rem das Krankenhaus
ansteuern, und vier Linien, die morgens und abends im Berufsverkehr verkehren, erweitern das Angebot. Drei weitere Linien wer<strong>de</strong>n bei Spielen <strong>de</strong>s Fußballvereins Helsingborgs IF im<br />
Stadion Olympia eingesetzt. Seit 2005 wird das Busnetz im Auftrag von Skånetrafiken durch das Busunternehmen Arriva betrieben.<br />
Von 1903 bis <strong>zu</strong>r Umstellung von Links- auf Rechtsverkehr in Schwe<strong>de</strong>n im Jahre 1967 verfügte die Stadt auch über ein Straßenbahnnetz.<br />
Bildung<br />
Helsingborg bietet ein komplettes Schulangebot, das Kin<strong>de</strong>rgärten (förskolor), Grundschulen (grundskolor) und Gymnasien (gymnasieskolor) umfasst. Daneben gibt es Son<strong>de</strong>rschulen<br />
(särskolor, träningsskolor) auf Grundschul- und Gymnasialniveau für unter an<strong>de</strong>rem autistische und verhaltensgestörte Kin<strong>de</strong>r, sowie in an<strong>de</strong>re Schulen integrierte Son<strong>de</strong>rschulklassen<br />
(särskoleklasser).<br />
Im ehemaligen Produktionsgebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Gummiprodukteherstellers Tretorn am Südhafen ist seit 2000 <strong>de</strong>r „Campus Helsingborg“ <strong>de</strong>r Universität Lund untergebracht. Hier studieren rund<br />
3000 Stu<strong>de</strong>nten in <strong>de</strong>n Richtungen Bauingenieurwesen, Informatik, Lebensmitteltechnik, Dienstleistungsmanagement, Kommunikationswissenschaft, Umweltmanagement,<br />
Meeresbiologie und Sozialarbeit.<br />
Öffentliche Einrichtungen<br />
Als Hauptort <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> haben in Helsingborg Gemein<strong>de</strong>rat und Gemein<strong>de</strong>verwaltung ihren Sitz. Des Weiteren sind in <strong>de</strong>r Stadt die Judikative mit <strong>de</strong>m Amtsgericht (tingsrätt) und<br />
das Finanzamt (Skatteverket) mit einer Außenstelle vertreten.<br />
Medien<br />
In Helsingborg erscheint mit Helsingborgs Dagblad (HD) eine traditionelle Tageszeitung. Die 1867 als Helsingborgs Tidning gegrün<strong>de</strong>te Zeitung ist seit 2001 eine von drei<br />
Regionalausgaben <strong>de</strong>s Verlages Helsingborgs Dagblad AB. Zusammen sind die unter <strong>de</strong>n traditionellen Namen Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar und Landskrona<br />
Posten laufen<strong>de</strong>n Zeitungen mit einer Gesamtauflage von 87.000 Exemplaren und einer Reichweite von rund 200.000 Lesern nach eigenen Angaben die fünftgrößte Tageszeitung<br />
Schwe<strong>de</strong>ns[17].<br />
Die Boulevardzeitung Aftonbla<strong>de</strong>t erscheint in einer speziellen Helsingborger Ausgabe. Daneben wer<strong>de</strong>n die kostenlose Helsingborger Tageszeitung xtra! sowie Regionalausgaben <strong>de</strong>r<br />
Gratiszeitungen metro und Punkt SE verteilt.<br />
Persönlichkeiten<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
• Christoph III. (1416–1448), Unionskönig von Dänemark, Schwe<strong>de</strong>n und Norwegen<br />
• Tycho Brahe (1546–1601), kaiserlicher Hofastronom, wur<strong>de</strong> auf Schloss Knutstorp, 20 km außerhalb von Helsingborg geboren<br />
• Dietrich Buxtehu<strong>de</strong> (1637–1707), Komponist, wahrscheinlich in Helsingborg geboren und aufgewachsen, bis 1658 Kantor an <strong>de</strong>r Sankt-Marien-Kirche<br />
• Svante Elis Strömgren (1870–1947), Astronom<br />
• An<strong>de</strong>rs Österling (1884–1981), schwedischer Dichter, von 1941-1964 Ständiger Sekretär <strong>de</strong>r Schwedischen Aka<strong>de</strong>mie<br />
• Ruben Rausing (1895–1983), Erfin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Tetra-Paks<br />
• Ninne Olsson (* 1945), Dramatikerin, Regisseurin und Theaterleiterin<br />
• Stellan Skarsgård (* 1951), in Helsingborg aufgewachsener Schauspieler (Die unerträgliche Leichtigkeit <strong>de</strong>s Seins, Breaking the Waves, Dancer in the Dark)<br />
• Sven Nordqvist (* 1946), Zeichner und Autor von Kin<strong>de</strong>rbüchern, unter an<strong>de</strong>rem von Pettersson und Findus
• Gunnar Nilsson (1948–1978), Formel-1-Fahrer<br />
• Lennart Björneborn (* 1957), Wissenschaftler an <strong>de</strong>r Royal School of Library and Information Science in Kopenhagen<br />
• Mats Magnusson (* 1963), Fußballspieler.<br />
• Henrik Larsson (* 1971), Fußballspieler<br />
• Marcus Lantz (* 1975), Fußballspieler<br />
• Erik Edman (* 1978), Fußballspieler<br />
• Alexan<strong>de</strong>r Farnerud (* 1984), Fußballspieler<br />
• Andreas Lilja (* 1975), Eishockeyspieler<br />
Mit <strong>de</strong>r Stadt beson<strong>de</strong>rs verbun<strong>de</strong>ne Personen<br />
• Henry Dunker, Unternehmer, Philanthrop und Kulturmäzen<br />
• Petter Olsson, Unternehmer<br />
• Nils Persson, Unternehmer<br />
Literatur<br />
• Charlotta Jönsson: Fragment: en utställning om Helsingborgs historia. Stadshistoriska avd., Dunkers kulturhus, Helsingborg 2003, ISBN 91-974550-0-8.<br />
• Henrik Ranby: Helsingborgs historia, <strong>de</strong>l VII:3: Stadsbild, stadsplanering och arkitektur - Helsingborgs bebyggelseutveckling 1863-1971. Kulturförvaltningen, Helsingborg<br />
2005, ISBN 91-631-6844-8.<br />
• Gösta Johannesson: Helsingborg - stad i 900 år. AWE/Geber, Stockholm 1980, ISBN 91-20-06249-4.<br />
• Helsingborgs kommun (Hrsg.): Helsingborg 900 år. Helsinborgs kommun, Helsingborg 1985, ISBN 91-7690-156-4.<br />
• Stadsbyggnadskontoret (Hrsg.): Arkitekturgui<strong>de</strong> för Helsingborg. Stadsbyggnadskontoret, Helsingborg 2005, ISBN 91-975719-0-3.<br />
Quellen<br />
1. ↑ a b Gemein<strong>de</strong> Helsingborg: Folkmängd efter ål<strong>de</strong>r 1 januari 2006 (pdf)<br />
2. ↑ sverige.<strong>de</strong> ___ Das Portal rund um Schwe<strong>de</strong>n<br />
3. ↑ Universität Stockholm, Institut für Stadt- und Gemein<strong>de</strong>geschichte: Helsingborgs befolkningsutveckling 1570-1995<br />
4. ↑ Gemein<strong>de</strong> Helsingborg: Befolkningsutvecklingen 2000–05 (pdf)<br />
5. ↑ Gemein<strong>de</strong> Helsingborg: Ministatistik Helsingborg: Befolkningsutvecklingen 2005 och Folkmäng<strong>de</strong>n efter ål<strong>de</strong>r i Helsingborg 1 jan 2006 (pdf), Tabelle 5<br />
6. ↑ Schwedische Kirche: In- och utträ<strong>de</strong>n på församlingsnivå, 2 november 2004–1 november 2005 (xls)<br />
7. ↑ Serbisch-orthodoxe Gemein<strong>de</strong> St. Basilus <strong>de</strong>n Store<br />
8. ↑ Anteckningar från medborgarutskott Syds möte med Ahel- Al Sunnah föreningen vom 26. April 2005<br />
9. ↑ Gemein<strong>de</strong> Helsingborg: Folkmängd med utländsk bakgrund efter ål<strong>de</strong>r 2005-12-31 (pdf)<br />
10.↑ Gemein<strong>de</strong> Helsingborg: Arbetslösa okt 2005 (pdf)<br />
11.↑ Gemein<strong>de</strong> Helsingborg: Befolkningen, 20-64 år, efter utbildningsnivå 2005-12-31 (pdf)
12.↑ Gemein<strong>de</strong> Helsingborg: Arbetsinkomst 2004 (inkl. 0-inkomsttagare) (pdf)<br />
13.↑ Integrationsverket: Utvecklingen av boen<strong>de</strong>segregationen i storstä<strong>de</strong>r och me<strong>de</strong>lstora kommuner<br />
14.↑ White Gui<strong>de</strong> - Sveriges bästa restauranger<br />
15.↑ Svenskt näringsliv: Förutsättningar för företagan<strong>de</strong> i Skåne 2003 (pdf)<br />
16.↑ Järnvägstunnlar i Helsingborg – Idéstudier (pdf)<br />
17.↑ Helsingborgs Dagblad: Om företaget<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Helsingør<br />
Helsingør (schwedisch Helsingör, ebenso in <strong>de</strong>utschsprachigen Hamlet-Ausgaben) ist eine Stadt in Dänemark mit 46.189 Einwohnern (Stand 1. Januar 2010[1]) und liegt am<br />
Nordosten<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Insel Seeland (Sjælland) am nördlichen Ausgang <strong>de</strong>s Öresund, gegenüber <strong>de</strong>r schwedischen Stadt Helsingborg.<br />
Die Stadt gehört <strong>zu</strong>r Helsingør Kommune in <strong>de</strong>r Region Hovedsta<strong>de</strong>n. Ein Teil <strong>de</strong>s Stadtgebietes liegt allerdings auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Fre<strong>de</strong>nsborg Kommune, so daß <strong>zu</strong>r Zeit (Stand: 1.<br />
Januar 2010) 64 Bewohner von Helsingør in dieser Kommune wohnen.<br />
Helsingør ist als Schauplatz <strong>de</strong>s Dramas Hamlet von William Shakespeare bekannt.<br />
Einwohnerzahl<br />
Entwicklung <strong>de</strong>r Einwohnerzahl (1. Januar)[1]:<br />
• 2006: 35.075<br />
• 2007: 34.339<br />
• 2008: 34.350<br />
• 2009: 46.028 + 73<br />
• 2010: 46.125 + 64<br />
Verkehr<br />
Helsingør ist nordöstlicher Eckpunkt <strong>de</strong>s Eisenbahnnetzes <strong>de</strong>r Dänischen Staatsbahnen. Hier befin<strong>de</strong>t sich ein Kopfbahnhof mit dichtem Taktverkehr nach Kopenhagen und weiter über<br />
die Öresundverbindung nach Schwe<strong>de</strong>n. Früher bestand eine direkte Eisenbahnfährverbindung nach Helsingborg. Am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Stadtzentrums entlang fährt ferner die Privatbahn nach<br />
Gilleleje, die innerhalb <strong>de</strong>r Stadt ähnlich einer Straßenbahn verkehrt.<br />
Zwischen Helsingør und Helsingborg verkehren Autofähren <strong>de</strong>r Ree<strong>de</strong>reien Scandlines und HH-Ferries, die diesen Abschnitt <strong>de</strong>r Europastraße E4 überbrücken.
Sehenswürdigkeiten<br />
Bauwerke<br />
• Schloss Kronborg<br />
• Schloss Marienlyst<br />
• Stadtkirche St. Olai, heute Dom<br />
• mehrere restaurierte Straßenzüge in <strong>de</strong>r Altstadt<br />
Verlorene Bauten<br />
• Das Alte Theater (1961 wie<strong>de</strong>raufgebaut in Den Gamle By)<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
• Edgar Aabye, Sportler<br />
• Ludvig Lorenz, Physiker<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ a b c Statistikbanken -> Befolkning og valg -> BEF44: Folketal pr. 1. januar for<strong>de</strong>lt på byer (dänisch)<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Schloss Kronborg<br />
Schloss Kronborg (dänisch Kronborg Slot; <strong>de</strong>utsch veraltet Kroneburg) ist eine Festung in Helsingør auf <strong>de</strong>r dänischen Insel Seeland. Kronborg liegt auf einer Land<strong>zu</strong>nge am äußersten<br />
nordöstlichen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Insel Seeland. Nur etwa 4 km von <strong>de</strong>r schwedischen Küste bei Helsingborg entfernt, bewacht die Festung die Einfahrt in <strong>de</strong>n Öresund. Berühmt wur<strong>de</strong> das<br />
Schloss, da William Shakespeare hier die Handlung von Hamlet spielen ließ.<br />
Geschichte<br />
Erich von Pommern errichtete unter <strong>de</strong>m Namen Kogen 1420 die erste Festung an dieser Stelle, die allerdings nur aus einer quadratischen Mauer mit etwa 80 m Seitenlänge und
Wachhäusern in <strong>de</strong>n Ecken bestand. Ab 1429 wur<strong>de</strong> sie genutzt, um <strong>de</strong>n Sundzoll von <strong>de</strong>n Schiffen <strong>zu</strong> erheben, die <strong>de</strong>n Öresund durchqueren wollten.<br />
Der dänische König Friedrich II. ließ die mittelalterliche Festung zwischen 1574 und 1585 im Stil <strong>de</strong>r Renaissance erweitern. Die Planung übernahm <strong>de</strong>r flämische Architekt Hans van<br />
Paeschen, <strong>de</strong>r aber die Baustelle drei Jahre später nach Uneinigkeiten mit <strong>de</strong>m König verließ. Am 24. Januar 1577 wur<strong>de</strong> per königlichem Dekret <strong>de</strong>r Name <strong>de</strong>r Festung in Kronborg<br />
geän<strong>de</strong>rt, es war von nun an per Strafe verboten, <strong>de</strong>n alten Namen <strong>zu</strong> verwen<strong>de</strong>n. Obwohl die inzwischen von Anton van Obberghen geleiteten Bauarbeiten noch bis 1585 andauerten,<br />
erfolgte die offizielle Einweihung von Kronborg bereits am 15. April 1582. Das Schloss war nun auch königlicher Wohnsitz.<br />
Durch die Unachtsamkeit zweier Arbeiter brannte Kronborg 1629 fast vollständig ab, nur die Schlosskapelle blieb verschont. Christian IV. beauftragte Hans van Steenwinckel mit <strong>de</strong>r<br />
Wie<strong>de</strong>rherstellung, die bis 1639 dauerte. Bis auf einige Details <strong>de</strong>s Innenausbaues und die fehlen<strong>de</strong> Spitze <strong>de</strong>s südlichen Turms wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r ursprüngliche Zustand wie<strong>de</strong>rhergestellt.<br />
Während <strong>de</strong>s Zweiten Nordischen Krieges gelang es schwedischen Truppen unter Carl Gustav Wrangel die Festung 1658 nach dreiwöchiger Belagerung <strong>zu</strong> erobern. Bis <strong>zu</strong>r<br />
Unterzeichnung <strong>de</strong>s Vertrags von Kopenhagen 1660 blieb Kronborg besetzt.<br />
Zwischen 1688 und 1690 wur<strong>de</strong> Kronborg von <strong>de</strong>m dänischen Generalbaumeister Lambert van Haven ausgebaut und verstärkt. Durch <strong>zu</strong>sätzliche Wälle auf <strong>de</strong>r Landseite entstand die<br />
stärkste Festung dieser Zeit.<br />
Später diente Kronborg als Gefängnis (von 1739 bis in die Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts) und als Kaserne (zwischen 1785 und 1922).<br />
Seit <strong>de</strong>m 30. November 2000 gehört Kronborg <strong>zu</strong>m Weltkulturerbe <strong>de</strong>r UNESCO.<br />
Hamlet<br />
Ursprünglich geht die Figur Hamlet auf einen jütländischen Prinzen <strong>zu</strong>rück, <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>r Insel Mors lebte. William Shakespeare verlegte für seine Tragödie "Hamlet" <strong>de</strong>n Ort <strong>de</strong>s<br />
Geschehens nach Schloss Kronborg in Helsingør (engl. Elsinore).<br />
Zum 200. To<strong>de</strong>stag von William Shakespeare 1816 wur<strong>de</strong> erstmals "Hamlet" in <strong>de</strong>n Mauern von Kronborg gespielt. Schauspieler waren Soldaten aus <strong>de</strong>r Garnison von Kronborg. In <strong>de</strong>n<br />
folgen<strong>de</strong>n Jahren gibt es immer wie<strong>de</strong>r Gastspiele berühmter Hamletdarsteller in Kronborg, darunter 1938 Gustaf Gründgens mit Marianne Hoppe als Ophelia.<br />
Holger Danske<br />
In <strong>de</strong>n Kasematten unter Schloss Kronborg befin<strong>de</strong>t sich eines <strong>de</strong>r nationalen Symbole Dänemarks: Holger Danske.<br />
Der Ursprung dieser mythischen Gestalt geht auf <strong>de</strong>n im Rolandslied beschriebenen "Ogier le Danois" <strong>zu</strong>rück. Seit 1510 ist Holger Danske in Skandinavien bekannt, seine Geschichte<br />
wird durch Christian Pe<strong>de</strong>rsens "King Olger Danske's Chronicle" von 1534 und später durch Hans Christian An<strong>de</strong>rsens Märchen "Holger Danske" (1845) populär.<br />
Nach <strong>de</strong>r Legen<strong>de</strong> kehrte dieser unbesiegbare Krieger vom Heimweh geplagt von einem Feld<strong>zu</strong>g nach Dänemark <strong>zu</strong>rück und fiel dort in einen tiefen Schlaf. Sollte das dänische<br />
Königreich von einem Feind ernsthaft bedroht sein, dann wird Holger Danske wie<strong>de</strong>r erwachen und in <strong>de</strong>n Kampf ziehen.<br />
Hans Pe<strong>de</strong>rsen-Dan formte 1906 ein Gipsmo<strong>de</strong>ll von Holger Danske als Auftragsarbeit für das Hotel Marienlyst in Helsingør. Während die daraus entstan<strong>de</strong>ne Bronze keine beson<strong>de</strong>re<br />
Popularität erreichte, wur<strong>de</strong> das Gipsmo<strong>de</strong>ll <strong>zu</strong>m Inbegriff <strong>de</strong>s mythischen Holger Danske.<br />
Literatur<br />
• Charles Christensen: Kronborg, Fre<strong>de</strong>rik II s Slot og <strong>de</strong>ts vi<strong>de</strong>re Skæbne. Kopenhagen, 1950.<br />
• David Hohnen: Hamlet's castle and Shakespeare's Elsinore. Kopenhagen, 2000. ISBN 87-7241-899-0<br />
• Vibeke Woldbye, Lars Holst: Kronborg: the castle and the royal apartments. Kopenhagen, 2001. ISBN 87-987994-5-2
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Christiansborg<br />
(Weitergeleitet von Schloss Christiansborg)<br />
Die Christiansborg (<strong>de</strong>utsch Christiansburg), auch Christiansborg Slot, ist <strong>de</strong>r Sitz <strong>de</strong>s dänischen Folketing, also <strong>de</strong>s dänischen Parlaments. Es war früher ein Schloss <strong>de</strong>s Königs und<br />
befin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Innenstadt von Kopenhagen auf <strong>de</strong>r Insel Slotsholmen.<br />
Geschichte<br />
Bereits um 1167 errichtete hier Erzbischof Absalon, <strong>de</strong>r als Grün<strong>de</strong>r Kopenhagens gilt, eine Burg. Diese gelangte unter Wal<strong>de</strong>mar <strong>de</strong>m Großen in Besitz <strong>de</strong>r Krone von Dänemark. Die<br />
Befestigungsanlage war mehrfach Angriffen unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>r Rügener Wen<strong>de</strong>n ausgesetzt. Die von <strong>de</strong>n dänischen Monarchen weiter ausgebaute Anlage wur<strong>de</strong> im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt nach<br />
<strong>de</strong>m zweiten Krieg gegen die Hanse von <strong>de</strong>n Gegnern <strong>de</strong>s unterlegenen Königs Wal<strong>de</strong>mar Atterdag geschleift. Auf <strong>de</strong>n Trümmern entstand das Københavns Slot, eine polygonale<br />
Burganlage mit Wassergraben, die von <strong>de</strong>n dort residieren<strong>de</strong>n Herrschern über die Jahrhun<strong>de</strong>rte aus- und umgebaut wur<strong>de</strong>, bis sie einem Neubau weichen musste.<br />
1736 ließ König Christian VI. die erste Christiansborg als absolutistischen Repräsentationsbau durch <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Architekten Elias David Häusser errichten. Es entstand ein<br />
vierflügeliger Rokoko-Palast mit Reitbahn, Hoftheater (die heute noch existieren) und Schlosskirche am gegenwärtigen Ort. Der Bau war extrem teuer: Die Errichtung kostete annähernd<br />
zwei Drittel <strong>de</strong>r Jahreseinnahmen <strong>de</strong>s ganzen Reiches o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Wert <strong>de</strong>s Eigentums auf Seeland. In knapp 50 Jahren entwickelte sich ein großartiges Hofleben am Schloss.<br />
Am 26. Februar 1794 brach vermutlich durch einen Kachelofen nachmittags ein Brand im Hauptflügel aus, bei <strong>de</strong>m das Schloss mitsamt <strong>de</strong>r Schlosskirche und <strong>de</strong>r königlichen<br />
Musikbibliothek bis in die frühen Morgenstun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Folgetages ausbrannte. Die Reitanlage, von <strong>de</strong>r auch die Brandbekämpfung mit einer Feuerspritze geführt wur<strong>de</strong>, überstand die<br />
Katastrophe.<br />
Der zweite Palast Christiansborg wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Jahren 1806–28 im zeitgemäßen Stil <strong>de</strong>s Klassizismus von <strong>de</strong>m Architekten Christian Fre<strong>de</strong>rik Hansen (1756–1845) – einem Freund<br />
Schinkels – errichtet. Dies war das Schloss, das <strong>de</strong>n Übergang <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s vom Absolutismus <strong>zu</strong>m Parlamentarismus erlebte. Im März 1848 versammelte sich eine Volksmenge vor<br />
Christianborg, woraus später Dänemarks erstes <strong>de</strong>mokratisches Grundgesetz resultierte. Der König gab einige seiner Gemächer an <strong>de</strong>n Reichstag ab, <strong>de</strong>r seine Arbeit im Januar 1850 im<br />
selben Flügel aufnahm, in <strong>de</strong>m heute <strong>de</strong>r Saal <strong>de</strong>s Folketings liegt. Dieser zweite Palast brannte am 3. Oktober 1884, wie<strong>de</strong>rum wahrscheinlich wegen eines Ofenbran<strong>de</strong>s. Zwar war das<br />
Gebäu<strong>de</strong> im Unterschied <strong>zu</strong>m Vorgängerbau mit Brandschutzwän<strong>de</strong>n, Hydranten und an<strong>de</strong>ren Vorrichtungen versehen, doch das Gewirr <strong>de</strong>r Abluftrohre und -schächte, durch das sich die<br />
Flammen ausbreiteten, war <strong>de</strong>n Löschkräften kaum bekannt. Nur die 1846 vollen<strong>de</strong>te klassizistische Schlosskirche überstand das Feuer.<br />
1907 begann man, nach<strong>de</strong>m es <strong>zu</strong>vor jahrelange Diskussionen um <strong>de</strong>n Sinn eines solchen Gebäu<strong>de</strong>s bei <strong>de</strong>n verän<strong>de</strong>rten politischen Gegebenheiten gegeben hatte, mit <strong>de</strong>r Errichtung <strong>de</strong>r<br />
dritten Christiansborg unter Verwendung <strong>de</strong>r Grundmauern <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n vorangehen<strong>de</strong>n Schlösser. Als Baustil wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r „strenge“ Klassizismus abgelöst durch <strong>de</strong>n Neobarock. Die<br />
resultieren<strong>de</strong> Wuchtigkeit sollte die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Schlosses als politischer Mittelpunkt <strong>de</strong>s Reiches unterstreichen. Der Bau mit <strong>de</strong>m 90 m hohen Schlossturm wur<strong>de</strong> 1928 been<strong>de</strong>t. Seit<br />
1918 ist das Schloss Sitz <strong>de</strong>s heutigen dänischen Parlaments (Folketing).
1992 verwüstete ein neuerlicher schwerer Brand die Schlosskirche, sie konnte erst 1997 nach umfangreichen Restaurierungsarbeiten wie<strong>de</strong>r eröffnet wer<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Malmö<br />
Malmö ['malmø:](dän. Malmø, altschwedisch Malmöughe, von Malm und högar (die Haufen), die Sandhaufen)[1] ist eine Großstadt in <strong>de</strong>r historischen schwedischen Provinz Schonen<br />
(Skåne) und Hauptstadt <strong>de</strong>r heutigen Provinz Skåne län sowie Hauptort <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Malmö.<br />
Malmö ist nach Stockholm und Göteborg die drittgrößte Stadt <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s.<br />
Geografie<br />
Malmö liegt im äußersten Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Die Entfernung nach Mailand (ca. 1159 km) ist geringer als die nach Kiruna (ca. 1392 km). Nach Kopenhagen, das etwa 27km entfernt ist,<br />
sind Göteborg (ca. 214 km), Kiel (ca. 232 km), Hamburg (ca. 300 km), Oslo (ca. 498 km) und Stockholm (ca. 514 km) die nächstgelegenen Großstädte. [2]<br />
Seit <strong>de</strong>r Einweihung <strong>de</strong>r Öresundbrücke im Jahr 2000 bil<strong>de</strong>t die Metropolregion Malmö <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m am Öresund gegenüber liegen<strong>de</strong>n Kopenhagen eines <strong>de</strong>r Zentren <strong>de</strong>r<br />
Öresundregion. Die Stadt hat einen eigenen Strand.<br />
Bevölkerung<br />
66 % <strong>de</strong>r Bevölkerung gehören <strong>zu</strong>r eingesessenen schwedischen Bevölkerung, 34 % haben einen Migrationshintergrund. Aufgrund <strong>de</strong>r liberalen Einwan<strong>de</strong>rungs- und Asylgesetze steigt<br />
die Zahl <strong>de</strong>r Menschen mit Migrationshintergrund in <strong>de</strong>r Stadt jährlich um etwa 3.500 o<strong>de</strong>r einen Prozentpunkt <strong>de</strong>r Stadtbevölkerung. Im Stadtteil Rosengård haben 85 % <strong>de</strong>r Bewohner<br />
einen Migrationshintergrund. Dort sammeln sich vor allem Muslime.<br />
Geschichte<br />
Die Stadt wur<strong>de</strong> seit 1116 als Landungsstelle unter <strong>de</strong>m Namen Malmhaug, später als Malmoge, Malmöyghe o<strong>de</strong>r Malmey (lat. Malmogia) erwähnt. Der Name stammt wahrscheinlich<br />
vom altdänischen Malmhaugar = Kieshaufen. Von nord<strong>de</strong>utschen Kaufleuten wur<strong>de</strong> sie wegen <strong>de</strong>r Form ihrer Küste Ellenbogen genannt. Die Landungsstelle diente <strong>zu</strong>nächst <strong>de</strong>m<br />
dänischen König vor allem, um in das be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>re Lund <strong>zu</strong> gelangen. Sie hob sich bald durch Heringsfischerei und Han<strong>de</strong>l, <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utsche Kaufleute entlang <strong>de</strong>r schonischen Küste<br />
betrieben hervor und profitierte dabei ebenso von ihrer strategischen Lage. Da <strong>de</strong>r dänische König die Kontrolle über die Häfen im Nor<strong>de</strong>n und Sü<strong>de</strong>n hatte, konnte er <strong>de</strong>n südlichen<br />
Öresund abriegeln lassen.<br />
1319 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Grundstein für die St. Petri och Pauli Kyrka gelegt und etwa <strong>zu</strong>r gleichen Zeit entstand auch das erste Rathaus. Die ältesten Stadtprivilegien stammen vom 20. Dezember<br />
1353 und wur<strong>de</strong>n später mehrmals bestätigt und erweitert. Malmö übernahm nun mehr und mehr die Rolle Lunds als wichtigste Stadt in Schonen. Die ältesten, heute noch vorhan<strong>de</strong>nen<br />
Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt stammen aus dieser Zeit, so z. B. auch die Festung Malmöhus, die im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt von Erich von Pommern gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>.
Zwischen 1318 und 1658 wur<strong>de</strong> die dänische Stadt mehrmals von Schwe<strong>de</strong>n besetzt und einmal für kurze Zeit einverleibt. Malmö gilt als Geburtsort <strong>de</strong>r dänischen Reformation: Die<br />
erste lutheranische Predigt wur<strong>de</strong> in Malmö gehalten und die erste Bibel in dänischer Sprache wur<strong>de</strong> hier gedruckt.<br />
Im 16. und 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> Malmö bald von Schwe<strong>de</strong>n, bald von Dänemark belagert. Am 23. April 1512 wur<strong>de</strong> hier <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong> von Malmö zwischen Dänemark und <strong>de</strong>r Hanse<br />
und ein Waffenstillstand Dänemarks mit Gustav Wasa von Schwe<strong>de</strong>n geschlossen. Zu Hansezeiten stand sie unter <strong>de</strong>utschem Einfluss. Durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Roskil<strong>de</strong> unter Karl X.<br />
Gustav wur<strong>de</strong> Malmö 1658 schwedisch. 1775 erhielt die Stadt <strong>de</strong>n künstlich geschaffenen Hafen.<br />
Am 26. August 1848 wur<strong>de</strong> daselbst ein Waffenstillstand zwischen Dänemark und Preußen auf sieben Monate geschlossen. Malmö profitierte stark von <strong>de</strong>r industriellen Revolution.<br />
Hier starb am 18. September 1872 König Karl XV.<br />
Im Jahr 1886 hatte Malmö 45.143 Einwohner.<br />
Mit Fertigstellung <strong>de</strong>r Öresundbrücke im Jahr 2000 ergeben sich neue Impulse für die wirtschaftliche Lage <strong>de</strong>r Stadt als Verkehrsknotenpunkt zwischen Skandinavien und <strong>de</strong>m übrigen<br />
Europa.<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• In <strong>de</strong>r Altstadt Malmös sind noch viele Fachwerkhäuser erhalten, bekannt vor allem ist <strong>de</strong>r Lilla Torg (kleiner Markt), <strong>de</strong>r 1591 entstand.<br />
• Rathaus: nicht weit von <strong>de</strong>r Altstadt entfernt liegt das 1546 unter <strong>de</strong>m Bürgermeister Jörgen Kock errichtete und immer wie<strong>de</strong>r umgestaltete Rathaus.<br />
• Reiterstatue König Karl X. Gustav: befin<strong>de</strong>t sich auf <strong>de</strong>m Marktplatz<br />
• St. Petri Kyrka: die gotische Krypta befin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Rathauses<br />
• Malmöhus ist ein altes Schloss und einziger Überrest <strong>de</strong>r ehemaligen Befestigung. Als dänisches Kastell war es im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt von strategischer Be<strong>de</strong>utung. Danach wur<strong>de</strong><br />
es eine schwedische Festung gegen Dänemark. Zwischen 1828 und 1914 als Zuchthaus benutzt, befin<strong>de</strong>t sich dort heute das Stadtmuseum mit einer Ausstellung <strong>zu</strong>r<br />
Stadtgeschichte von <strong>de</strong>r frühen Steinzeit bis heute, einer botanischen Fachausstellung mit Aquarium und Terrarium (u. a. Fle<strong>de</strong>rmäuse) sowie wechseln<strong>de</strong>n Kunstausstellungen.<br />
Malmöhus ist von einer sehenswerten Parkanlage umgeben, in <strong>de</strong>m mit <strong>de</strong>r Schlossmühle eine Hollän<strong>de</strong>rwindmühle aus <strong>de</strong>m Jahre 1851 steht.<br />
• Seefahrt- und Technikmuseum: das Seefahrt- und Technikmuseum mit einem begehbaren U-Boot aus <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg befin<strong>de</strong>t sich nahebei.<br />
Die Öresundausstellung (Öresundutställning) gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n neuen Glanzpunkten <strong>de</strong>r Stadt.<br />
• Koggenmuseum: Im Hafen von Malmö befin<strong>de</strong>t sich ein 'Koggenmuseum', das im Sommer regelmäßige Fahrten mit <strong>de</strong>m Nachbau einer mittelalterlichen Kogge im Hafen von<br />
Malmö durchführt. Das Museum wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Mitarbeitern <strong>de</strong>s Museums Foteviken geplant und erbaut. Dieses „belebte“ Freilichtmuseum liegt etwa 20 km südlich von<br />
Malmö in Höllviken und bietet seinen Besuchern einen außergewöhnlichen Einblick in die Wikingerzeit.<br />
• Bis <strong>zu</strong> seiner Demontage im Jahr 2002 war <strong>de</strong>r Kockumskran, <strong>de</strong>r Kran <strong>de</strong>r Kockums-Werft, ein Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt.<br />
In Malmö wur<strong>de</strong> 2001 die ökologische Bauausstellung Bo01 auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>s Westhafens, einem ehemaligen Industriegebiet (u. a. Kockums-Werft) durchgeführt. Dort begann,<br />
orientiert an Nachhaltigkeitskriterien, <strong>de</strong>r Neubau <strong>de</strong>s Stadtviertels Västra Hamnen.<br />
• Im August 2005 wur<strong>de</strong> dort mit <strong>de</strong>m Turning Torso ein neues Kennzeichen <strong>de</strong>r aufstreben<strong>de</strong>n Stadt eingeweiht – mit 190 Metern Höhe das höchste Gebäu<strong>de</strong> in Nor<strong>de</strong>uropa.<br />
Seine Beson<strong>de</strong>rheit ist die sich um 90 Grad <strong>zu</strong>r Spitze hin drehen<strong>de</strong> Fassa<strong>de</strong>. Mit <strong>de</strong>m Ankar Park (auch Kanalpark), <strong>de</strong>m Dania Park und <strong>de</strong>r Sundspromena<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n<br />
ambitionierte Freiräume geschaffen.<br />
• Eine Beson<strong>de</strong>rheit ist auch das kleine Gewächshaus Glasbubbla am Scaniaplatz.[3]
Von Malmö aus lohnen sich Ausflüge <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Schlössern Svaneholm und Torup.<br />
Regelmäßige Veranstaltungen<br />
• Malmöfestival: Seit 1984 fin<strong>de</strong>t je<strong>de</strong>s Jahr im August das 'Malmöfestival' statt. Das Hauptaugenmerk <strong>de</strong>r Aktivitäten liegt auf internationaler Küche und musikalischen<br />
Darbietungen, die auf verschie<strong>de</strong>nen Freilichtbühnen stattfin<strong>de</strong>n.<br />
Kultur und Freizeit<br />
• Malmö Opera och Musikteater: Das Malmö Opera och Musikteater, das Musiktheater <strong>de</strong>r Stadt ist Skandinaviens größtes Opernhaus. Es wur<strong>de</strong> vom Architekten Sigurd<br />
Lewerentz entworfen und 1944 eingeweiht. Im Gebäu<strong>de</strong>, das kurzzeitig auch durch Ingmar Bergman geleitet wur<strong>de</strong>, fand 1995 die Uraufführung <strong>de</strong>s Musicals Kristina från<br />
Duvemåla statt.<br />
• Casino: Das Restaurant Kungsparken wur<strong>de</strong> 2001 <strong>zu</strong>m Casino umgebaut. Malmö erhielt dadurch eines <strong>de</strong>r vier staatlich geleiteten Casinos in Schwe<strong>de</strong>n.<br />
• Vergnügungszentrum 'Slagthuset': Im Vergnügungszentrum 'Slagthuset' befin<strong>de</strong>t sich Malmös größter Nachtclub, sowie ein Hotel, mehrere Büro-, Messe- und Konferenzräume<br />
und Theaterbühnen.<br />
• Vergnügungspark Folkets Park: Im Vergnügungspark 'Folkets Park' steht Skandinaviens größtes Riesenrad, mit 45 m Höhe. Weiters gibt es hier Tanzlokale, Restaurants, ein<br />
Reptilienzentrum, Minigolfbahnen und weiteres.<br />
Wirtschaft<br />
Historisch waren <strong>de</strong>r Schiffbau und seine Zulieferer das wirtschaftliche Standbein Malmös, insbeson<strong>de</strong>re die Werft Kockums. Als Folge <strong>de</strong>r Werftenkrise <strong>de</strong>r 1970er Jahre, die sich bis in<br />
die 1990er Jahre hinzog, stieg die Arbeitslosenquote stark an. 1995 hatte Malmö die höchste Arbeitslosenquote in Schwe<strong>de</strong>n.<br />
Die wirtschaftliche Wie<strong>de</strong>rbelebung <strong>de</strong>r Stadt ist nicht <strong>zu</strong>letzt auch durch <strong>de</strong>n Bau <strong>de</strong>r Öresundbrücke (Fertigstellung 2000) bedingt, <strong>de</strong>r die Möglichkeiten, als Einwohner Malmös in<br />
Kopenhagen <strong>zu</strong> arbeiten, <strong>de</strong>utlich verbessert hat. Auch die durch die Brücke verbesserte Transportinfrastruktur kam <strong>de</strong>r heimischen Wirtschaft <strong>zu</strong>gute. Dennoch ist die Arbeitslosenquote<br />
in Malmö noch immer höher als in Stockholm o<strong>de</strong>r Göteborg. Das Bauunternehmen Skanska ist größter Arbeitgeber in <strong>de</strong>r Stadt. Malmö ist aber auch als Einkaufsstadt bekannt.<br />
Verkehr<br />
Südlich von Malmö befin<strong>de</strong>t sich die Öresundbrücke, eine kombinierte Eisenbahn- und Straßenbrücke über <strong>de</strong>n Öresund. Malmö ist das wichtigste Verkehrszentrum in Südschwe<strong>de</strong>n,<br />
mit großem Bahnhof, von <strong>de</strong>m Züge nach Stockholm, über Göteborg nach Norwegen, nach Kopenhagen, nach Hamburg (über die Vogelfluglinie), nach Berlin (über die Königslinie) und<br />
in die Umgebung abfahren. Etwa 20 km östlich von Malmö befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Malmö Airport, dieser wird jedoch vom nahegelegenen Flughafen Kastrup in Kopenhagen dominiert.<br />
Malmö ist ein wichtiger Seehafen mit festen Verbindungen nach Lübeck-Travemün<strong>de</strong> und Rostock. Bis kurz nach <strong>de</strong>r Eröffnung <strong>de</strong>r Öresundbrücke im Jahr 2000 war hier die wichtigste<br />
Fährverbindung zwischen Limhamn (Stadtteil von Malmö) und Dragør auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite <strong>de</strong>s Öresunds.<br />
2005 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s Citytunnels begonnen, <strong>de</strong>r 2011 fertig gestellt sein soll. Mit <strong>de</strong>m Eisenbahntunnel wird Malmös Hauptbahnhof von einem Kopfbahnhof <strong>zu</strong> einem<br />
Durchfahrtsbahnhof umgestaltet.<br />
Der innerstädtische Personennahverkehr wird mit Bussen abgewickelt, nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Straßenbahnverkehr 1973 eingestellt wur<strong>de</strong>. Eine Museumsstraßenbahn verkehrt ab <strong>de</strong>m Museum<br />
für Technik <strong>zu</strong>m Park von Malmöhus.<br />
Städtepartnerschaften
• Vaasa, Finnland, seit 1940<br />
• Warna, Bulgarien, seit 1987<br />
• Tangshan, Volksrepublik China, seit 1987<br />
• A<strong>de</strong>lai<strong>de</strong>, Australien, seit 1988<br />
• Florenz, Italien, seit 1989<br />
• Tallinn, Estland, seit 1989<br />
• Stettin, Polen, seit 1990<br />
• Stralsund, Mecklenburg-Vorpommern, seit 1991<br />
Des Weiteren bestehen spezielle Übereinkommen mit <strong>de</strong>r russischen Stadt Kaliningrad, <strong>de</strong>r italienischen Provinz Chieti, sowie mit Newcastle in Großbritannien.[4]<br />
Sport<br />
• Hallenbad: in Malmö befin<strong>de</strong>t sich Skandinaviens größtes Hallenbad<br />
Mannschaften<br />
• Fußballverein Malmö FF: Der bekannteste Sportverein <strong>de</strong>r Stadt ist <strong>de</strong>r Fußballverein 'Malmö FF' mit seinen 15 Meistertiteln. Ebenfalls einen hohen Bekanntheitsgrad haben die<br />
Malmö Redhawks, <strong>de</strong>r Eishockeyverein hat zwei schwedische Meistertitel vor<strong>zu</strong>weisen.<br />
• Weitere bekanntere Fußballmannschaften sind Bunkeflo IF, IFK Malmö und Malmö Anadolu BI. Das Damenteam LdB FC Malmö spielt ebenfalls in <strong>de</strong>r höchsten schwedischen<br />
Liga, <strong>de</strong>r Damallsvenskan.<br />
• Im Handball spielt das Herrenteam <strong>de</strong>s HK Malmö in <strong>de</strong>r höchsten Liga und auch die American-Footballer <strong>de</strong>r Limhamn Griffins vertreten die Stadt in <strong>de</strong>r höchsten Liga, <strong>de</strong>r<br />
Superserien, die sie bisher dreimal mit <strong>de</strong>m Meistertitel abschließen konnten.<br />
Verschie<strong>de</strong>ne große Sportveranstaltungen fan<strong>de</strong>n in Malmö statt, darunter:<br />
• Gruppenspiele <strong>de</strong>r Fußball-Weltmeisterschaft 1958<br />
• Die Europameisterschaft im Tischtennis 1964<br />
• Die Weltmeisterschaft <strong>de</strong>r Handballjunioren 1977<br />
• Die Weltmeisterschaft im Badminton 1977 und 1994<br />
• Die Europameisterschaft im Badminton 2002<br />
• Die Europameisterschaft im Eiskunstlauf 2003<br />
• Die Europameisterschaft im American Football 2005<br />
Persönlichkeiten<br />
Söhne und Töchter:<br />
• Alex Ārash Labāf (Arash), Sänger<br />
• Mattias An<strong>de</strong>rsson, Handball-Nationaltorhüter
• Caspar Bartholin <strong>de</strong>r Ältere, Universalgelehrter<br />
• An<strong>de</strong>rs Bergcrantz, Jazzmusiker<br />
• Matías Concha, Fußballspieler<br />
• Staffan Ehrlin, Musikproduzent und DJ<br />
• Sixten Ehrling, Dirigent<br />
• Mats Ek, Choreograph<br />
• Anita Ekberg, Schauspielerin<br />
• Hjalmar Gullberg, Dichter<br />
• Ulf Hannerz, Professor für Sozialanthropologie<br />
• Håkan Har<strong>de</strong>nberger, Trompeter<br />
• Malin Hartelius, Opernsängerin<br />
• Jonny Hector, Schachspieler<br />
• Johan Hellsten, Schachspieler<br />
• Ronnie Hellström, Fußballspieler<br />
• Tiger Hillarp Persson, Schachspieler<br />
• Zlatan Ibrahimović, schwedischer Fußballspieler bosnischer Abstammung<br />
• Jonny Jakobsen, Eurodance-Sänger<br />
• Andrée Jeglertz, Fußballspieler und -trainer<br />
• Kjell Johansson, Tischtennisspieler<br />
• Jörgen Kock, Bürgermeister in <strong>de</strong>r Reformationszeit<br />
• Daniel Majstorović, Fußballspieler<br />
• Gustaf Malmström, Ringer<br />
• Lukas Moodysson, Schriftsteller und Filmregisseur<br />
• Siegfried Naumann, Komponist<br />
• Gunnar Nilsson, Formel-1-Fahrer<br />
• Karl-Erik Palmér, Fußballspieler<br />
• Mikael Pernfors, ehemaliger Tennisspieler<br />
• Baltzar von Platen, Erfin<strong>de</strong>r<br />
• Henrik Reuterdahl, Kirchenhistoriker<br />
• Markus Rosenberg, Fußballspieler<br />
• Henric Schartau, Priester, Prediger und Initiator einer schwedischen Erweckungsbewegung<br />
• Mona Seilitz, Schauspielerin, Synchronsprecherin und Mo<strong>de</strong>ratorin<br />
• Lars-Erik Skiöld, Ringer
• Jan Troell, Filmregisseur<br />
• Göte Turesson, Evolutionsbiologe und Ökologe<br />
• Nils Västhagen, Professor für Betriebswirtschaftslehre<br />
• Andreas Vinciguerra, Tennisspieler<br />
• Mats Wahl, Schriftsteller<br />
• Carl Westergren, Ringer<br />
• Bo Wi<strong>de</strong>rberg, Filmregisseur und Drehbuchautor<br />
• Christian Wilhelmsson, Fußballspieler<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Svensk etymologisk ordbok<br />
2. ↑ www.xxx – alle Angaben sind Luftlinie.<br />
3. ↑ Was ist Landschaft? Der Ankarpark in Malmö.<br />
4. ↑ Malmös Städtepartner (schwedisch)<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Falsterbo<br />
Die Halbinsel Falsterbo liegt an <strong>de</strong>r südwestlichsten Spitze <strong>de</strong>r skandinavischen Halbinsel. Sie bil<strong>de</strong>t die Grenze zwischen <strong>de</strong>r Ostsee und <strong>de</strong>m Öresund. Sie liegt etwa 25 Kilometer<br />
südlich von Malmö.<br />
Die Halbinsel ist durch <strong>de</strong>n Falsterbo-Kanal vom Festland getrennt, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Weg zwischen <strong>de</strong>m Öresund und <strong>de</strong>r Ostsee verkürzt.<br />
Geografie<br />
Geografisch glie<strong>de</strong>rt sich die Halbinsel in zwei Bereiche:<br />
• <strong>de</strong>r längliche, riffähnliche Westteil,
• das Gebiet westlich und östlich <strong>de</strong>s 1,6 km langen Falsterbo-Kanals<br />
Im Westteil <strong>de</strong>r Halbinsel liegt die historisch be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Stadt Skanör med Falsterbo mit <strong>de</strong>n Ortsteilen Falsterbo im Sü<strong>de</strong>n und Skanör <strong>zu</strong>m Nor<strong>de</strong>n. An <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>r Halbinsel liegen<br />
westlich bzw. östlich <strong>de</strong>s Falsterbo-Kanals die Orte Ljunghusen und Höllviken.<br />
Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Halbinsel für <strong>de</strong>n Vogel<strong>zu</strong>g<br />
Wegen <strong>de</strong>r beson<strong>de</strong>ren Lage (südwestlichster Landzipfel Schwe<strong>de</strong>ns) ist die Falsterbo sehr be<strong>de</strong>utend für <strong>de</strong>n Vogel<strong>zu</strong>g in Skandinavien. Die meisten Vogelarten wan<strong>de</strong>rn in<br />
südwestlicher Richtung und da fast alle Arten Angst vor <strong>de</strong>r Meerüberquerung haben, lassen sie sich entlang <strong>de</strong>r Küstenlinie schließlich nach Falsterbo leiten, bis es nicht mehr<br />
weitergeht. Verstärkt wird dieser Effekt, auch „flyway-Effekt“ genannt, durch <strong>de</strong>n vorwiegen<strong>de</strong>n Südwestwind (Gegenwind!), <strong>de</strong>r die Vögel da<strong>zu</strong> zwingt, in Bo<strong>de</strong>nnähe bei <strong>de</strong>r dort<br />
herrschen<strong>de</strong>n geringeren Windgeschwindigkeit <strong>zu</strong> fliegen. Durch die damit verbun<strong>de</strong>ne Nähe <strong>zu</strong>m Wasser orientieren sie sich umso eher am Küstenverlauf. Dadurch gelangen die<br />
meisten Singvogelarten auf die Halbinsel und nutzen sie als Rastplatz vor <strong>de</strong>m Weiter<strong>zu</strong>g. Ein beträchtlicher Teil von <strong>de</strong>n ca. 500 Millionen Vögeln, die im Herbst von <strong>de</strong>r<br />
skandinavischen Halbinsel aus nach Sü<strong>de</strong>n ziehen, zieht über Falsterbo. [1] Der Weiter<strong>zu</strong>g führt je nach Windrichtung über die Ostsee Richtung Dänemark auf das mitteleuropäische<br />
Festland. [2] [3]<br />
Sehenswertes<br />
Falsterbo ist bekannt für die Vogelwarte Falsterbo, da die meisten Zugvögel die skandinavische Halbinsel über das fünf Kilometer lange Falsterbo-Riff südwärts verlassen. Das Riff und<br />
die feinen Sandsträn<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Halbinsel bieten einen <strong>de</strong>r schönsten Strän<strong>de</strong> Südschwe<strong>de</strong>ns, umgeben von sehr lange blühen<strong>de</strong>n Hei<strong>de</strong>flächen.<br />
Verkehr<br />
Es bestehen gute, vom ÖPNV-Unternehmen Skånetrafiken betriebene, Busverbindungen nach Trelleborg und Malmö. Von Skanör nach Ystad verläuft eine malerische Küstenstraße, an<br />
<strong>de</strong>r man viele gut ausgeschil<strong>de</strong>rte Zeltplätze und eine Jugendherberge fin<strong>de</strong>t.<br />
Einzelnachweis<br />
1. ↑ Exkursionsbericht <strong>de</strong>s DJN über <strong>de</strong>n Vogel<strong>zu</strong>g auf <strong>de</strong>r Halbinsel Falsterbo [1]<br />
2. ↑ Karlsson, Lennart (Hrsg.)(2004): Wings over Falsterbo, Falsterbo Vogelstation, 180 S. ISBN 91-86572-45-8<br />
3. ↑ John van <strong>de</strong>r Wou<strong>de</strong> (2004): Birding trip South Swe<strong>de</strong>n, Exkursionsbericht [2]<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Skanör med Falsterbo
(Weitergeleitet von Skanör)<br />
Skanör med Falsterbo ist eine Stadt in <strong>de</strong>r südschwedischen Provinz Skåne län und <strong>de</strong>r historischen Provinz Schonen.<br />
Der Ort in <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Vellinge ist durch das Zusammenwachsen <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n vormals selbständigen Städte Skanör und Falsterbo entstan<strong>de</strong>n - mit Skanör als <strong>de</strong>m<br />
bevölkerungsreicheren Teilort.<br />
Geographie<br />
Skänör-Falsterbo liegt im länglichen, riffähnlichen Westteil <strong>de</strong>r südschwedischen Halbinsel Falsterbo zwischen Öresund und Ostsee mit Falsterbo im Sü<strong>de</strong>n und Skanör im Nor<strong>de</strong>n.<br />
Geschichte<br />
Skanör und Falsterbo zählen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n ältesten Städten Schwe<strong>de</strong>ns. Zwischen <strong>de</strong>m 12. und 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> jährlich von En<strong>de</strong> Juli bis Oktober, manchmal bis in <strong>de</strong>n November<br />
verlängert, am Strand zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Städten einer <strong>de</strong>r wichtigsten Han<strong>de</strong>lsmärkte Nor<strong>de</strong>uropas, <strong>de</strong>r sogenannte Skånemarkna<strong>de</strong>n („Schonenmarkt“), abgehalten. Seine Be<strong>de</strong>utung<br />
erhielt er durch die reichen Heringsvorkommen im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Halbinsel. Die aus <strong>de</strong>m Marktbetrieb erzielten Steuern waren die Haupteinnahmequelle unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>s dänischen<br />
Königs Wal<strong>de</strong>mar IV. Atterdag.<br />
Als die Heringsbestän<strong>de</strong> im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt abnahmen, verlor <strong>de</strong>r Markt an Be<strong>de</strong>utung und wur<strong>de</strong> nicht mehr fortgeführt, wodurch auch die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Städte abnahm.<br />
Falsterbo und Skanör waren fortan kleine Fischerorte mit Stadtrechten.<br />
Im Jahre 1754 wur<strong>de</strong>n die bei<strong>de</strong>n eigenständigen Städte Skanör und Falsterbo <strong>zu</strong>sammengelegt, und es entstand die Stadt Skanör-Falsterbo.<br />
1904 wur<strong>de</strong> die Eisenbahnlinie Malmö–Vellinge mit <strong>de</strong>n zwei Haltestellen Skanör und Falsterbo gebaut. Entlang <strong>de</strong>r Eisenbahn wuchsen neue Wohngebiete heran. Die Eisenbahn wur<strong>de</strong><br />
schließlich 1971 stillgelegt und im folgen<strong>de</strong>n Jahr komplett abgebaut.<br />
Während <strong>de</strong>s Ersten Weltkriegs wur<strong>de</strong> eine Stichstrecke <strong>zu</strong>m heutigen Kleinboothafen in Skanör verlegt, an <strong>de</strong>m seinerzeit eine Zementfabrik errichtet wur<strong>de</strong>. Gerüchten <strong>zu</strong>folge war sie<br />
eigentlich ein Kriegsmateriallager für <strong>de</strong>n Fall, daß Schwe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Krieg involviert wer<strong>de</strong>n sollte. An<strong>de</strong>ren Berichten nach wur<strong>de</strong> die Fabrik von <strong>de</strong>utschen Interessen beeinflusst<br />
erbaut. Das gewaltige Fundament, das heute das einzige Zeugnis <strong>de</strong>r alten Anlage ist, sollte <strong>de</strong>mnach Standort einer größeren Kanone gewesen sein, die <strong>zu</strong>sammen mit ihrem Gegenstück<br />
im dänischen Køge die Meerenge bewachen sollte.<br />
Sehenswertes<br />
• Die Kirchen von Skanör und Falsterbo stammen aus <strong>de</strong>m 13. und 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt.<br />
• Falsterbo veranstaltet ein jährliches Spring- und Dressurreitturnier, die Falsterbo Horse Show (Wertungsprüfung <strong>de</strong>s Nations Cups <strong>de</strong>r Springreiter und <strong>de</strong>r World Dressage<br />
Masters).<br />
• Skanör hat einen kleinen Fischerei- und Yachthafen, <strong>de</strong>r heute überwiegend von <strong>de</strong>r Sportschiffahrt genutzt wird.<br />
Verkehr<br />
Von Skanör-Falsterbo bestehen gute Busverbindungen nach Malmö, die vom schonischen ÖPNV-Unternehmen Skånetrafiken betrieben wer<strong>de</strong>n.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Tätorternas landareal, folkmängd och invånare
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Trelleborg<br />
Trelleborg ist eine Stadt in <strong>de</strong>r schwedischen Provinz Skåne län und <strong>de</strong>r historischen Provinz Schonen. Die südlichste Stadt Schwe<strong>de</strong>ns liegt rund 30 km südlich von Malmö in <strong>de</strong>r<br />
Öresundregion. Trelleborg ist <strong>de</strong>r Hauptort <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Trelleborg.<br />
Geschichte und Sehenswürdigkeiten<br />
Sehenswert ist die alte Bebauung um <strong>de</strong>n Gamla Torg (alter Marktplatz) sowie die Klosterruine (Klostergrän<strong>de</strong>n). Nicht weit von Trelleborg fin<strong>de</strong>t man auch die Skegriedösen, mit einem<br />
Alter von über 5000 Jahren. Der Langdolmen liegt direkt an <strong>de</strong>r Europastraße 6 und ist umgeben von 18 Steinen.<br />
In <strong>de</strong>r Wikingerzeit, nach 980 ließ König Sven Gabelbart die sog. Trelleborg (dänisch/schwedisch trelleborg), eine Ringburg von 140-143 m Durchmesser errichten, mit Toren in alle<br />
Himmelsrichtungen und einer Palisa<strong>de</strong> aus Eichenstämmen. Seit 1995 wird eine halbkreisförmige Rekonstruktion gezeigt. Sie ähnelt <strong>de</strong>r gleichnamigen Burg auf <strong>de</strong>r dänischen Insel<br />
Seeland (bei Slagelse). Im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Anlagen von Trelleborg bei Slagelse, Aggersborg und Fyrkat ist sie jedoch nicht exakt kreisrund son<strong>de</strong>rn erscheint im südwestlichen Viertel<br />
im Grundriss etwas eingedrückt <strong>zu</strong> sein. Möglicherweise nimmt die Anlage auf eine ältere Bebauung Rücksicht. Denn es lassen sich zwei Bauphasen unterschei<strong>de</strong>n. Die erste Phase war<br />
kleiner mit schmalerem Wall. Sie scheint später vergrößert wor<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> sein, wobei <strong>de</strong>r Wall auch verbreitert wur<strong>de</strong>. Der Wall war später wohl 6 m hoch und 16-17 m breit. Im Inneren<br />
konnte keine Bebauung festgestellt wer<strong>de</strong>n, was auch durch die späteren Baumaßnahmen, die alle Zeugnisse zerstört haben, bedingt sein kann. Aber außerhalb <strong>de</strong>r Anlage <strong>zu</strong>m Strand<br />
hin fand man eine umfassen<strong>de</strong> zeitgenössische Bebauung. Die Bebauung verschwand um 1000.[2] Ergraben wur<strong>de</strong>n 1988 das nördliche und das westliche Tor, sowie <strong>de</strong>r Wall- und<br />
Grabenabschnitt dazwischen. Außer<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> das östliche Tor untersucht, sowie im südöstlichen und südlichen Bereich Teile <strong>de</strong>s Grabens erfasst. Rekonstruiert wur<strong>de</strong> nur das<br />
nordwestliche Viertel <strong>de</strong>r Anlage.<br />
Im Jahr 1257 wird <strong>de</strong>r Ort <strong>zu</strong>m ersten mal schriftlich erwähnt, als Trelleborg <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m nahen Malmö vom dänischen König Erik Plovpenning <strong>de</strong>m jungen Brautpaar Sophie<br />
von Dänemark, seiner Tochter und Val<strong>de</strong>mar Birgersson, <strong>de</strong>r als Wal<strong>de</strong>mar I. König von Schwe<strong>de</strong>n war, <strong>zu</strong>m Hochzeitsgeschenk gemacht wur<strong>de</strong>. Allerdings wur<strong>de</strong> Trelleborg bald von<br />
<strong>de</strong>n Dänen <strong>zu</strong>rück erobert. Endgültig ging <strong>de</strong>r Ort erst 1658 an Schwe<strong>de</strong>n (Frie<strong>de</strong>n von Roskil<strong>de</strong>) als Dänemark ganz Schonen an Schwe<strong>de</strong>n verlor.<br />
Seinen Status als Stadt verlor Trelleborg im April 1619 und erlangte die vollen Stadtrechte erst 1867 wie<strong>de</strong>r nach<strong>de</strong>m ihr schon 1840 <strong>de</strong>r Status einer Han<strong>de</strong>lsstadt <strong>zu</strong>gestan<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n.<br />
Die Kirche St. Nicolai stammt aus <strong>de</strong>m 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt und die ursprüngliche Kirche aus <strong>de</strong>m 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Im Stadtmuseum mit <strong>de</strong>m Schwerpunkt Vor- und Frühgeschichte <strong>de</strong>r<br />
Region fin<strong>de</strong>n auch Wechselausstellungen über die Wikingerzeit statt. Die Ebbes Konsthall zeigt Skulpturen <strong>de</strong>s Bildhauers Axel Ebbe und wechseln<strong>de</strong> Ausstellungen.<br />
Von Axel Ebbe wur<strong>de</strong> auch die Statue einer nackten Frau geschaffen, die seit 1930 über <strong>de</strong>n Hafen blickt. Mo<strong>de</strong>ll für das Kunstwerk mit <strong>de</strong>m Titel Famntaget (dt. „Umarmung“) stand<br />
Birgit Holmquist, die Großmutter <strong>de</strong>r US-amerikanischen Schauspielerin Uma Thurman.[3]<br />
Auf <strong>de</strong>r Ostseite <strong>de</strong>s Gemein<strong>de</strong>friedhofes liegt ein <strong>de</strong>utsches Gräberfeld mit 103 Kriegstoten <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges und 10 Gefallenen <strong>de</strong>s Ersten Weltkrieges, die hier, im neutralen<br />
Schwe<strong>de</strong>n, ihre letzte Ruhestätte fan<strong>de</strong>n.
Um die südliche Lage <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> ver<strong>de</strong>utlichen, wer<strong>de</strong>n je<strong>de</strong>n Sommer von <strong>de</strong>r Stadtverwaltung an <strong>de</strong>r Straße, die parallel <strong>zu</strong>m Hafen verläuft, Kübel mit Palmen aufgestellt.<br />
Verkehr<br />
1909 wur<strong>de</strong> die Fährstrecke nach Sassnitz eröffnet, die so genannte Königslinie. Nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong> die Strecke nach Lübeck-Travemün<strong>de</strong> am be<strong>de</strong>utendsten. Auf <strong>de</strong>r<br />
Route Travemün<strong>de</strong> verkehrten die Schwesterschiffe <strong>de</strong>r TT-Line Nils Holgersson und Peter Pan im 7-Stun<strong>de</strong>n-Takt; von Sassnitz auf Rügen fuhren die Sassnitz und Rügen im 4-<br />
Stun<strong>de</strong>n-Takt. Einzig auf <strong>de</strong>r Route Sassnitz–Trelleborg bestand ein Kombitransport von PKW, LKW und Eisenbahn. Der Verkehr von <strong>de</strong>r DDR nach Trelleborg war nur für<br />
Skandinavier, Nicht-Deutsche, West-Berliner, West<strong>de</strong>utsche Bürger und beglaubigte DDR-LKW-Fahrer nutzbar.<br />
Nach <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Wie<strong>de</strong>rvereinigung hat <strong>de</strong>r Verkehr nach Sassnitz und Rostock spürbar <strong>zu</strong>genommen. Von Trelleborg besteht eine Eisenbahnfährverbindung <strong>de</strong>r Scandlines nach<br />
Sassnitz. Fähren <strong>de</strong>r TT-Line verkehren nach Rostock und Travemün<strong>de</strong>.<br />
Die Europastraße 22, von Norrköping und Kalmar kommend, führt via Fähre nach Sassnitz und Rostock.<br />
Wirtschaft<br />
Trelleborgs Hamn AB<br />
Alle Aktivitäten im Hafen liegen heute in <strong>de</strong>r Hand <strong>de</strong>r Trelleborgs Hamn AB, die 1999 durch die Zusammenlegung <strong>de</strong>r Trelleborg Terminal AB und Trelleborgs hamn entstand. Das<br />
Unternehmen hat drei Geschäftsbereiche: Hafen, Umschlag und Immobilien. Das Unternehmen hat 97 Beschäftigte und einen Umsatz von ca. 150 Millionen Schwedischen Kronen.<br />
Trelleborgs Hafen ist einer <strong>de</strong>r größten Fähr- und RoRo Häfen Skandinaviens. Im Jahr 2004 wur<strong>de</strong>n fast 11 Millionen Tonnen Güter sowie rund zwei Millionen Passagiere abgefertigt.<br />
Trelleborg ist die schwimmen<strong>de</strong> Brücke <strong>zu</strong>m Kontinent – <strong>de</strong>r direkte Weg von und nach Europa mit über 34 täglichen Verbindungen.<br />
Trelleborg AB<br />
Trelleborg ist Sitz <strong>de</strong>s Mischkonzerns Trelleborg AB, <strong>de</strong>r mit 25.000 Mitarbeitern in 40 Län<strong>de</strong>rn tätig ist.<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
• Peter Hanson, Profigolfer<br />
• Andreas Isaksson, Fußballspieler<br />
Literatur<br />
Fredrik Svanberg: Vikingati<strong>de</strong>n i Skåne. Lund 2000.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Tätorternas landareal, folkmängd och invånare<br />
2. ↑ Svanberg S. 80 ff.<br />
3. ↑ Artikel im Sydsvenskan über die Statue am Hafen von Trelleborg.
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Lund<br />
Lund ist eine Stadt in <strong>de</strong>r südschwedischen Provinz Skåne län und <strong>de</strong>r historischen Provinz Schonen.<br />
Die sogenannte „Stu<strong>de</strong>ntenstadt“ (mehr als ein Drittel <strong>de</strong>r Einwohner sind Stu<strong>de</strong>nten) ist die elftgrößte Stadt Schwe<strong>de</strong>ns und, nach Malmö und Helsingborg, die drittgrößte Stadt<br />
Schonens. Sie ist geprägt von zahlreichen Cafés, Parks und alten Backstein-Fassa<strong>de</strong>n. Die Universitätsstadt gilt als kulturelles Zentrum <strong>de</strong>s Sü<strong>de</strong>ns und ist Hauptort <strong>de</strong>r gleichnamigen<br />
Gemein<strong>de</strong>. Sie gilt als die am schnellsten wachsen<strong>de</strong> Stadt <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s.[2][3]<br />
Geographie<br />
Lund liegt unweit <strong>de</strong>s Öresunds, etwa 17 km nordöstlich von Malmö und nur 60 km von <strong>de</strong>r dänischen Hauptstadt Kopenhagen entfernt, im äußersten Südwesten Schwe<strong>de</strong>ns, bei 55° 42'<br />
10 nördlicher Breite und 13° 11' 35 östlicher Länge. Die Entfernungen <strong>zu</strong> einigen an<strong>de</strong>ren schwedischen Städten sind <strong>de</strong>mentsprechend groß. So ist Göteborg etwa 250 km, Stockholm<br />
600 km und Umeå knapp 1200 km entfernt. Die Stadt gehört <strong>zu</strong>r transnationalen Öresundregion und ist Teil <strong>de</strong>r Großstadtregion Malmö (Groß-Malmö).<br />
Lund liegt am nordwestlichen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Romeleåsen, Schwe<strong>de</strong>ns südlichstem Horst, <strong>de</strong>r sich 30 Kilometer in südöstliche Richtung bis nach Ystad erstreckt. Bedingt durch die Lage<br />
befin<strong>de</strong>t sich Lunds höchster Punkt im Nordosten <strong>de</strong>r Stadt, die stetig gen Südwesten abfällt.<br />
Klima<br />
In Lund herrscht feuchtkontinentales Klima. Durch die Nähe <strong>zu</strong>m Öresund und die ungeschützte Lage auf <strong>de</strong>r schonischen Halbinsel herrscht durchweg windiges Wetter vor, mit Wind<br />
meist aus Süd bis Süd-West. Dies hat relativ geringe Temperaturschwankungen <strong>zu</strong>r Folge. Die Winter sind <strong>zu</strong>meist nass, mit wenig bis keinem Schnee, im Sommer übersteigen die<br />
Temperaturen selten die 25-Grad-Marke. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 7,9 Grad, <strong>de</strong>r Jahresnie<strong>de</strong>rschlag beträgt 655 mm.[4]<br />
Geschichte<br />
Gründung und Frühgeschichte<br />
Gegrün<strong>de</strong>t um 990 n. Chr. vom dänischen Wikingerkönig Sven Gabelbart, gilt Lund gleichauf mit Sigtuna als älteste Stadt Schwe<strong>de</strong>ns. Der Name Lund (dänisch, norwegisch und<br />
schwedisch für Hain) <strong>de</strong>utet darauf hin, dass <strong>de</strong>r Platz bereits <strong>zu</strong>r Wikingerzeit kultische Be<strong>de</strong>utung hatte. In <strong>de</strong>r nordischen Mythologie wur<strong>de</strong>n u. a. Haine und Quellen als heilig<br />
verehrt. Archäologische Fun<strong>de</strong> bei Uppåkra weisen darauf hin, dass die Stadt nach ihrer Gründung, wahrscheinlich auf königliche Initiative hin, etwa fünf Kilometer nach Nor<strong>de</strong>n<br />
verschoben wur<strong>de</strong>. Die Fun<strong>de</strong> geben Anlass <strong>zu</strong>r Annahme, dass die Stadt schon vor <strong>de</strong>r Verschiebung als Zentralort für das damalige Südwestschonen fungierte. Auch wird die Siedlung<br />
in <strong>de</strong>r ältesten Geschichte <strong>de</strong>s Nor<strong>de</strong>ns als eine durch Schifffahrt und Han<strong>de</strong>l mächtige Stadt erwähnt.<br />
Die neue Lage <strong>de</strong>r Stadt war von strategischem Vorteil, da die bessere Sicht von Romeleåsen, sowie Moor- und Sumpfbö<strong>de</strong>n längs <strong>de</strong>s Flusses Höje å <strong>zu</strong>sätzlichen Schutz gaben. Wie<br />
schon in Uppåkra, verlief die wichtige Landstraße (Länsväg) in Nord-Süd-Richtung auch an Lund vorbei, aber Lund lag nun <strong>zu</strong>sätzlich an <strong>de</strong>r Landstraße in Ost-West-Richtung und die<br />
Annahme liegt nahe, dass die Stadt dadurch neues Gewicht innerhalb Schonens erlangte. Die Gründung <strong>de</strong>r Stadt kann <strong>de</strong>shalb in einer Reihe mit Versuchen gesehen wer<strong>de</strong>n, ein
einheitlich-dänisches Königtum <strong>zu</strong> schaffen.<br />
Mittelalter<br />
Bis in die erste Hälfte <strong>de</strong>s 11. Jahrhun<strong>de</strong>rts war Lund Suffragandiözese <strong>de</strong>s Erzbistums von Canterbury. Diese Verbindung löste sich allmählich, als Lund mit Einführung <strong>de</strong>s<br />
Christentums um 1050 ein kirchliches Zentrum und im Jahre 1060 selbst Bischofssitz wur<strong>de</strong>, da sich Dänemark in neue Diözesen aufteilte. Ab 1066, unter Bischof Egino, wur<strong>de</strong> Lund<br />
<strong>de</strong>m Erzbistum Hamburg-Bremen unterstellt, in <strong>de</strong>n Grenzen <strong>de</strong>r heutigen Diözese, mit <strong>de</strong>n Gebieten Bornholm und Halland.<br />
1085 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Katedralskolan, die älteste Schule Skandinaviens gegrün<strong>de</strong>t. Knut <strong>de</strong>r Große wollte Lund <strong>zu</strong> einem zweiten London, <strong>zu</strong>r Metropole Skandinaviens, machen. Die<br />
Entwicklung <strong>zu</strong>m neuen Machtzentrum ging aber nicht problemfrei vonstatten, da auch Dalby, etwa 10 km östlich von Lund, um <strong>de</strong>n Bischofssitz konkurrierte und dort damit begonnen<br />
wur<strong>de</strong>, eine Domkirche <strong>zu</strong> errichten, welche jedoch nie fertiggestellt wor<strong>de</strong>n ist.<br />
Im Jahr 1103 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Dom <strong>zu</strong> Lund <strong>de</strong>r nun älteste Dom Skandinaviens errichtet, was da<strong>zu</strong> führte, dass sich die Stellung Lunds weiter festigte und Dalby, wie vorher Uppåkra, an<br />
Wichtigkeit verlor. Ein Jahr später wur<strong>de</strong> Lund Erzbistum, <strong>zu</strong>nächst für die Nordischen Län<strong>de</strong>r und, nach<strong>de</strong>m Norwegen (1152) und Schwe<strong>de</strong>n (1164) unabhängige Erzbistümer wur<strong>de</strong>n,<br />
auch von Dänemark. Der Erzbischof erhob bis <strong>zu</strong>r Reformation Ansprüche auf die Suprematie über alle nordischen Prälaten. In diesen Zeiten war Lund die geistliche, und in gewissem<br />
Sinn auch die weltliche Hauptstadt <strong>de</strong>s dänischen Reichs (metropolis Daniae), <strong>de</strong>ssen Münzen in Lund geprägt wur<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>ssen Könige sich auf <strong>de</strong>r St. Liboriushöhe huldigen ließen.<br />
Ihre größte Blütezeit erlebte die Stadt im 13. und 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt als be<strong>de</strong>utendste Stadt Dänemarks. Knut I. von Schwe<strong>de</strong>n feierte 1177 hier seine Hochzeit, 1202 wur<strong>de</strong> König<br />
Wal<strong>de</strong>mar II. (<strong>de</strong>r Sieger) in Lund gekrönt und 1409 die Hochzeit von Erich von Pommern mit Philippa, <strong>de</strong>r Tochter Heinrichs IV. von England, gefeiert.<br />
In <strong>de</strong>n Folgejahren blieb Lund eine <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Städte Dänemarks, verlor aber mit <strong>de</strong>m Aufstieg Malmös im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt an Be<strong>de</strong>utung: Nach<strong>de</strong>m erst <strong>de</strong>r Feld<strong>zu</strong>g Karls VIII.<br />
von Schwe<strong>de</strong>n nach Schonen 1452 <strong>de</strong>m Wohlstand <strong>de</strong>r Stadt einen schweren Schlag versetzt hatte, sank sie durch die Reformation und die damit einhergehen<strong>de</strong> Trennung von Religion<br />
und Staat vollends in einen Zustand von Verfall und Be<strong>de</strong>utungslosigkeit. Mit Ausnahme <strong>de</strong>s Doms und <strong>de</strong>r Klosterkirche Sankt Peters wur<strong>de</strong>n die übrigen Kirchen nie<strong>de</strong>rgerissen, die<br />
Häuser verfielen und Plätze blieben unbebaut.<br />
Neuzeit<br />
Während <strong>de</strong>s Zweiten Nordischen Krieges erklärte Dänemark im Juni 1657 Schwe<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Krieg. Diese Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng en<strong>de</strong>te im Frie<strong>de</strong>n von Roskil<strong>de</strong> von 1658 damit, dass<br />
Dänemark unter an<strong>de</strong>rem seinen Besitz im heutigen Südschwe<strong>de</strong>n räumen musste, und so wur<strong>de</strong> die Stadt im gleichen Jahr <strong>zu</strong>sammen mit ganz Schonen an Schwe<strong>de</strong>n abgetreten.<br />
Die folgen<strong>de</strong>n Kriegsjahre unter Karl XI., mit <strong>de</strong>m Sieg <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Schlacht bei Lund am 4. Dezember 1676, und unter Karl XII., mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n zwischen Schwe<strong>de</strong>n und<br />
Dänemark am 6. Oktober 1679, vollen<strong>de</strong>ten <strong>de</strong>n Abstieg <strong>de</strong>r Stadt. Es dauerte lange, bis Lund, vor allem durch die 1666 gegrün<strong>de</strong>te Universität, wie<strong>de</strong>r überregionale Be<strong>de</strong>utung<br />
gewann.<br />
Die Gründung <strong>de</strong>r Universität hatte vor allem <strong>zu</strong>m Zweck, das ehemals dänische Gebiet nachhaltig an Schwe<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> bin<strong>de</strong>n, was <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st mittelfristig Auswirkungen auf die Stellung<br />
<strong>de</strong>r ehemals wichtigen Stadt hatte. Denn ab <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts schien Lund, vor allem durch die Universität, <strong>zu</strong> altem Glanz <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>gelangen: Samuel von Pufendorf<br />
veröffentlichte an ihr 1672 seine humanistisch-<strong>de</strong>mokratische Universalethik.<br />
Schwe<strong>de</strong>n wird aus Lund regiert<br />
Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 17. und Anfang <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong> Schwe<strong>de</strong>n von weiteren Kriegen heimgesucht, was die Lage in <strong>de</strong>r Stadt erschwerte. 1703 und 1711 wüteten Brän<strong>de</strong>, von<br />
1712 bis 1713 die Beulenpest. Als zwischen <strong>de</strong>m 6. September 1716 und 11. Juni 1718 Karl XII. im Kungshuset residierte, wur<strong>de</strong> Schwe<strong>de</strong>n aus Lund regiert und zwei Feldzüge gegen<br />
Norwegen geplant und vollzogen. In <strong>de</strong>n letzten Jahren <strong>de</strong>s Großen Nordischen Krieges kamen Diplomaten aus ganz Europa nach Lund und die Stadt erreichte neue politische<br />
Be<strong>de</strong>utung.
Industrialisierung<br />
Die Industrielle Revolution und die darauf folgen<strong>de</strong> Urbanisierung erreichten die Stadt mit <strong>de</strong>r Eröffnung <strong>de</strong>s ersten Teilstücks <strong>de</strong>r Södra stambanan von Malmö nach Lund im Jahre<br />
1856. Dennoch wur<strong>de</strong> Lund, an<strong>de</strong>rs als an<strong>de</strong>re Städte in Schwe<strong>de</strong>n, nicht übermäßig industrialisiert, <strong>de</strong>r Lage an <strong>de</strong>r Eisenbahn <strong>zu</strong>m Trotz. Denn ein Großteil <strong>de</strong>r Industrie sammelte sich<br />
vorerst in Malmö, und auch die alten Han<strong>de</strong>lsrouten, die nun allmählich durch Eisenbahnstrecken ersetzt wur<strong>de</strong>n, hatten nun Malmö als Endstation. Weitere Faktoren, die <strong>zu</strong>r schwachen<br />
Industrialisierung beitrugen, waren die Dominanz <strong>de</strong>r Universität und <strong>de</strong>r Kirche. Da diese Institutionen seit jeher eine große Rolle gespielt hatten, verzichtete man auf eine breite<br />
Ansiedlung von Industrie. Dennoch wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Bau weiterer Eisenbahnlinien begonnen, wie etwa mit <strong>de</strong>r nach Trelleborg (1877), nach Bjärred (1901) und <strong>de</strong>r heutigen<br />
Västkustbanan nach Göteborg (1888), ursprünglich eine Nebenstrecke nach Kävlinge.<br />
Auch die Universität erlebte einen neuen Aufschwung: Neue Fakultäten wur<strong>de</strong>n gegrün<strong>de</strong>t und neue Gebäu<strong>de</strong>, wie das Hauptverwaltungsgebäu<strong>de</strong>, wur<strong>de</strong>n errichtet. Anfangs <strong>de</strong>s 19.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts wohnten und arbeiteten berühmte Persönlichkeiten, wie etwa Esaias Tegnér, Carl Adolph Agardh o<strong>de</strong>r Pehr Henrik Ling, in <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Nachkriegszeit<br />
Nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs erlebte die Stadt ein starkes Bevölkerungswachstum, so lebten bereits 1950 etwa 35.000 Menschen in Lund. Frühere Ackerlandflächen wie<br />
Norra Fäla<strong>de</strong>n, Östra Torn-Mårtens Fälad und Klostergår<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> neuen Stadtteilen erschlossen. 1951 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Neubau für das 1768 gegrün<strong>de</strong>te Universitätskrankenhaus Lund<br />
eröffnet. Auch die Lehrangebote an <strong>de</strong>r Universität wur<strong>de</strong>n weiter ausgebaut und 1961 die Technische Hochschule Lund (Lunds tekniska högskola, LTH) gegrün<strong>de</strong>t. 1983 begann man<br />
mit <strong>de</strong>m Bau von Schwe<strong>de</strong>ns erstem Gewerbegebiet I<strong>de</strong>on, heute ein Firmenpark vor allem für Informations- und Biotechnologiefirmen.<br />
Stadtbild<br />
Als Lund im 12. und 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt Sitz <strong>de</strong>s Erzbischofs war, entstan<strong>de</strong>n in und außerhalb <strong>de</strong>r Stadt viele Kirchengebäu<strong>de</strong>. Zeitweilig gab es 27 Kirchen und Klöster in Lund. Im Laufe<br />
<strong>de</strong>r Reformation wur<strong>de</strong> jedoch ein Großteil <strong>de</strong>r religiösen Gebäu<strong>de</strong> abgerissen. Der mittelalterliche Stadtkern wird noch durch die Struktur <strong>de</strong>s Straßennetzes am <strong>de</strong>utlichsten, die sich bis<br />
in die heutige Zeit bewahrt und, im Ganzen gesehen, die Form eines menschlichen Herzes hat, was typisch für <strong>de</strong>n Städtebau im Mittelalter ist. Die Straßen <strong>de</strong>s Innenstadtbezirks<br />
Centrum bestehen außer<strong>de</strong>m ausschließlich aus Kopfsteinpflaster, welches trotz <strong>de</strong>s regen Busverkehrs nicht durch gewöhnlichen Asphalt ersetzt, son<strong>de</strong>rn beständig erneuert wird.<br />
Weiteres Merkmal sind eine Anzahl mittelalterlicher Gebäu<strong>de</strong>, wie etwa <strong>de</strong>r Dom, das Königshaus (Kungshuset) und die Kathedralsschule aus <strong>de</strong>m Jahr 1085.<br />
Bis ins 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt war auch <strong>de</strong>r Bau von Fachwerkhäusern nicht ungewöhnlich, was <strong>de</strong>n Einfluss etwa aus Nord<strong>de</strong>utschland <strong>de</strong>utlich macht. Die Mehrzahl <strong>de</strong>r heutigen Häuser<br />
stammt aus eben dieser Zeit. Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong>n viele alte Häuser erweitert o<strong>de</strong>r durch mehrstöckige Gebäu<strong>de</strong> ersetzt, so etwa das Hauptgebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Kathedralsschule o<strong>de</strong>r das Grand Hotel. Von 1902 bis 1907 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Neubau <strong>de</strong>r Universitätsbibliothek auf <strong>de</strong>m Helgonabacken errichtet. An<strong>de</strong>re Universitätsgebäu<strong>de</strong> kamen im<br />
Universitätsviertel da<strong>zu</strong>. Gera<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Innenstadt, aber auch in und um das Universitätsgelän<strong>de</strong>, bestehen weiterhin viele Backstein-Fassa<strong>de</strong>n.<br />
In <strong>de</strong>n 1960er Jahren bestand <strong>de</strong>r Plan <strong>de</strong>s Genombrottet, <strong>de</strong>s Durchbruchs einer vierspurige Straße direkt durch <strong>de</strong>n Stadtkern. Dieser Plan wur<strong>de</strong> vor Allem von <strong>de</strong>n bürgerlichen<br />
Parteien unterstützt, jedoch ließ man in <strong>de</strong>n späteren Jahren davon ab und beschloss 1968, das Projekt <strong>zu</strong> stoppen. An einigen <strong>de</strong>r Stellen, wo mit <strong>de</strong>m Abriss begonnen wur<strong>de</strong>, fin<strong>de</strong>t<br />
man noch heute größere Brachflächen. Auch die Verlagerung von Einkaufszentren an die Peripherie <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> lange Zeit abgelehnt. So entstand Nova Lund, die erste und bisher<br />
einzige <strong>de</strong>rartige Einrichtung, erst 2002.<br />
Außerhalb <strong>de</strong>s Zentrums (Centrala sta<strong>de</strong>n) ist Lund durch Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Universität und <strong>de</strong>r Technischen Hochschule, sowie von Häusern mit Vorortscharakter geprägt. Ältere<br />
Wohngebäu<strong>de</strong> bestehen unter an<strong>de</strong>rem in <strong>de</strong>n Stadtteilen Värpinge und Östra Torn-Mårtens Fälad.<br />
Stadtglie<strong>de</strong>rung<br />
Lund glie<strong>de</strong>rt sich in 14 administrative Stadtteile:[5] Centrala sta<strong>de</strong>n, Gunnesbo, Järnåkra-Nilstorp, Klostergår<strong>de</strong>n, Kobjer, Linero, Möllevången, Norra Fäla<strong>de</strong>n, Nöbbelöv, Östra Torn-<br />
Mårtens Fälad, Tuna, Vallkärratorn-Stångby, Värpinge und Väster.
Plätze<br />
Wichtigster Platz und Mittelpunkt <strong>de</strong>r Stadt ist Stortorget, südlich <strong>de</strong>s Doms. Dieser wird durch das Rathaus (Rådhuset), sowie einige Geschäfte und Cafés beherrscht. Am Platz vorbei<br />
führt Kyrkogatan. Rechts <strong>de</strong>s Rathauses schließt dich das Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadthalle (Stadshallen) an, in <strong>de</strong>r sich neben einem Konzertsaal, Sit<strong>zu</strong>ngssäle befin<strong>de</strong>n, die für Sit<strong>zu</strong>ngen <strong>de</strong>s<br />
Stadtrats genutzt wer<strong>de</strong>n.<br />
Der Platz Mårtenstorget ist ein alter Han<strong>de</strong>lsplatz auf <strong>de</strong>m regelmäßig Märkte abgehalten wer<strong>de</strong>n. Er liegt in etwa 200 m Entfernung <strong>de</strong>s Rathauses, in südöstlicher Richtung. Des<br />
Weiteren dient <strong>de</strong>r Platz als Abstellfläche für PKWs. Weitere Plätze sind Botulfsplatsen zwischen Stortorget und Mårtenstorget, Clemenstorget nördlich <strong>de</strong>s Bahnhofs, Bantorget mit <strong>de</strong>m<br />
Grand Hotel, sowie Knut <strong>de</strong>n Stores torg und Krafts torg.<br />
Parks<br />
In Lund gibt es mehrere Parks, wobei <strong>de</strong>r Lundagård <strong>de</strong>r Zentralste ist. Der Park mit dichtem, altem Baumbestand, liegt zwischen <strong>de</strong>m Dom im Sü<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>r Universität im Nor<strong>de</strong>n, wo<br />
<strong>de</strong>r Universitätsplatz eine natürliche Fortset<strong>zu</strong>ng bil<strong>de</strong>t. Im Westen wird er von <strong>de</strong>r Kyrkogatan, <strong>de</strong>r alten Hauptstraße Lunds, begrenzt. Im Osten grenzt er an <strong>de</strong>n Tegnérsplatsen und <strong>de</strong>n<br />
Krafts torg. Die Geschichte <strong>de</strong>s Parks hängt eng mit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong>sammen. In ihm wur<strong>de</strong> um 1000 n. Chr. ein Park für <strong>de</strong>n dänischen König angelegt. Der Park, damals noch von einer<br />
Mauer umgeben, beherbergte die Resi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>s Bischofs (Kungshuset), die königliche Münzprägeanstalt sowie mehrere Wirtschaftshäuser.<br />
Durch die geographische Nähe <strong>zu</strong> wichtigen Universitätsgebäu<strong>de</strong>n wie <strong>de</strong>m Hauptgebäu<strong>de</strong> und <strong>de</strong>m Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Aka<strong>de</strong>mischen Vereinigung (AF-Borgen), kann <strong>de</strong>r Park gleichwohl als<br />
aka<strong>de</strong>misches Zentrum <strong>de</strong>r Stadt bezeichnet wer<strong>de</strong>n. In ihm fin<strong>de</strong>t seit 1849 alle vier Jahre <strong>de</strong>r Lundakarnevalen statt, ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r stu<strong>de</strong>ntischer Brauch mit Festumzügen.<br />
Der Stadtpark (Stadsparken) liegt südwestlich <strong>de</strong>s Stadtkerns. Er wur<strong>de</strong> zwischen 1909 und 1911 um <strong>de</strong>n Högevall herum angelegt, einem Stadtwall aus <strong>de</strong>m Mittelalter. Im Park, <strong>de</strong>r bei<br />
schönem Wetter von <strong>de</strong>r Bevölkerung stark frequentiert wird, befin<strong>de</strong>n sich mehrere Skulpturen verschie<strong>de</strong>ner Künstler.<br />
Der Botanische Garten (Botaniska trädgår<strong>de</strong>n) ist <strong>de</strong>r dritte Park im Stadtgebiet. Er wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts angelegt und beherbergt heute tausen<strong>de</strong> verschie<strong>de</strong>ne<br />
Pflanzenarten, sowie mehrere Gebäu<strong>de</strong>, die von <strong>de</strong>r Universität genutzt wer<strong>de</strong>n. Darunter befin<strong>de</strong>t sich ein Gewächshaus mit neun Klimazonen.<br />
Einwohnerentwicklung<br />
Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts nahm die Bevölkerung in <strong>de</strong>r kirchlich geprägten Stadt im Zuge <strong>de</strong>r Reformation und <strong>de</strong>r Säkularisierung <strong>zu</strong>nehmend ab. Die Stadt sollte sich bis ins<br />
19. Jahrhun<strong>de</strong>rt nicht davon erholen. Auch die Gründung <strong>de</strong>r Universität im Jahre 1666 sorgte mittelfristig nicht für <strong>de</strong>n erhofften Bevölkerungs<strong>zu</strong>wachs. Esaias Tegnér bezeichnete<br />
Lund um 1800 als „aka<strong>de</strong>misches Bauerndorf“.<br />
Erst ab Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts fan<strong>de</strong>n starke <strong>de</strong>mographische Verän<strong>de</strong>rungen statt. Begrün<strong>de</strong>t vor allem durch die Ansiedlung von Industriebetrieben und Gewerbe, entwickelte sich<br />
die Stadt <strong>zu</strong> einem kommerziellen und finanziellen Zentrum für die umliegen<strong>de</strong>n Orte und die Region. Große Be<strong>de</strong>utung hatte die Einweihung <strong>de</strong>r Södra stambanan 1856, einer<br />
Eisenbahnlinie von Malmö über Nässjö nach Falköping. Die bessere Anbindung sorgte für überdurchschnittlichen Bevölkerungs<strong>zu</strong>wachs in jener Zeit. Ab <strong>de</strong>m 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt sorgte vor<br />
allem <strong>de</strong>r Ausbau <strong>de</strong>r Universität, sowie <strong>de</strong>s Gesundheitssektors für Zuwächse.<br />
Politik<br />
Die verwalten<strong>de</strong> Instanz <strong>de</strong>r Stadt ist die Gemein<strong>de</strong> Lund (Lunds kommun). Ihr Gebiet erstreckt sich jedoch über die Grenzen <strong>de</strong>r eigentlichen Stadt in siedlungsgeographischem<br />
Verständnis (tätort) hinaus und schließt außerhalb gelegene Ortschaften mit ein. Lund ist Hauptort (centralort) <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> und damit Sitz <strong>de</strong>r kommunalen Verwaltung.<br />
Seit <strong>de</strong>r letzten Gemein<strong>de</strong>wahl (kommunval) im Jahre 2006 wird die Stadt und die Gemein<strong>de</strong> von einer bürgerlichen Mehrheit aus Konservativen, Liberalen und Zentrum regiert<br />
(kommunfullmäktige).
Wappen<br />
Das Wappen <strong>de</strong>r Stadt wird seit Mitte <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts verwen<strong>de</strong>t. Die Blasonierung spricht von einem silbernen Schild, darin eine auf grünem Grund stehen<strong>de</strong>, rote Mauer mit<br />
Zinnen und einem Turm. Darauf, und jeweils an bei<strong>de</strong>n Seiten, ein weiterer Turm. Entgegen <strong>de</strong>r Blasonierung, wird das Wappen im heutigen Gebrauch mit einer gol<strong>de</strong>nen,<br />
geschwungenen Mauerkrone gezeigt, wie etwa beim Wappen <strong>de</strong>r Stadt Helsingborg. Diese Krone soll das freie Bürgertum versinnbildlichen.<br />
Was genau das Wappen darstellt, ist nicht gänzlich <strong>zu</strong> bestimmen. Zum Einen könnte ein Kirchengebäu<strong>de</strong> dargestellt sein, dafür spricht die kreuzähnliche Aussparung in <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s<br />
Hauptturms. Durch die befestigten Mauern und Türme erscheint jedoch auch eine Burg möglich.<br />
Das Wappen wur<strong>de</strong> 1913 in dieser Form von König Gustav V. festgestellt. Seit 1971 wird es von <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Lund und von <strong>de</strong>r Stadt verwen<strong>de</strong>t.<br />
Verkehr<br />
Fernstraßen<br />
Durch Lund führt seit 1953, von Malmö kommend, die Europastraße 22, Schwe<strong>de</strong>ns älteste Autobahn (schwedisch motorväg). Des Weiteren existieren Anbindungen an alle wichtigen<br />
Fernstraßen, wie etwa <strong>de</strong>r Riksväg 16, <strong>de</strong>r Lund an die Europastraße 6 anbin<strong>de</strong>t, sowie <strong>de</strong>r Länsväg 108, mit Anbindung an die E 65.<br />
Eisenbahn und ÖPNV<br />
Seit 1856 besteht die wichtige Zugverbindung in Richtung Malmö (Teil <strong>de</strong>r Södra stambanan), die heute mit <strong>de</strong>r Öresundverbindung über die Öresundbrücke weiter nach Kopenhagen<br />
und nach Helsingør führt. Bedient wird diese, als auch die Strecke Helsingør - Kalmar, hauptsächlich durch <strong>de</strong>n Öresundståg, welcher gemeinsam von <strong>de</strong>n DSB (auf dänischem Gebiet),<br />
<strong>de</strong>r Skånetrafiken (innerhalb Schonens), sowie von SJ (bei Fahrten nach Kalmar und Göteborg) betrieben und verantwortet wird. Des Weiteren verkehrt <strong>de</strong>r sogenannte Pågatåg vor<br />
allem zwischen Malmö und Lund. Da sich die Eisenbahnlinien <strong>de</strong>r Västkustbanan sowie <strong>de</strong>r Södra stambanan in Lund kreuzen, ist es möglich die drei größten Städte Schwe<strong>de</strong>ns<br />
(Stockholm, Göteborg und Malmö) <strong>zu</strong> erreichen, ohne umsteigen <strong>zu</strong> müssen.<br />
Der ÖPNV fin<strong>de</strong>t mit <strong>de</strong>m gut ausgebauten Busnetz von Lund Stadsbuss (betrieben von Bergkvarabuss) seine Anwendung. Im Stadtgebiet befin<strong>de</strong>n sich etwa 400 Bushaltestellen.<br />
Innerhalb <strong>de</strong>r Stadt wer<strong>de</strong>n die elf Stammlinien von umweltfreundlichen Nie<strong>de</strong>rflurbussen bedient, 90 % <strong>de</strong>r Fahrzeuge fahren mit Naturgas. Außer<strong>de</strong>m betreiben die Skånetrafiken (mit<br />
Subunternehmen wie Swebus AB) <strong>de</strong>n regionalen Busverkehr in viele Städte Schonens, so etwa auch nach Malmö.[7]<br />
Flugverkehr<br />
Lund liegt unweit <strong>de</strong>s Flughafens Malmö, <strong>de</strong>r vor allem für innerschwedische Flüge von großer Be<strong>de</strong>utung ist. Daneben ist vor allem die Nähe <strong>zu</strong>m Flughafen Kopenhagen-Kastrup von<br />
großer Wichtigkeit. Dieser ist in etwa 45 min mit <strong>de</strong>m Öresundståg, <strong>de</strong>m Flygbuss o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Auto <strong>zu</strong> erreichen. Daneben existiert in ungefähr zwei Kilometern Entfernung <strong>de</strong>r Flugplatz<br />
Hasslanda, <strong>de</strong>r aber ausschließlich für Sportflüge genutzt wird.<br />
Radverkehr<br />
Wie in je<strong>de</strong>r mittelgroßen Universitätsstadt ist auch in Lund das Fahrrad das wichtigste Verkehrsmittel. Etwa 22.000 Fahrradfahrer passieren die Innenstadt pro Tag, 90 % <strong>de</strong>r Einwohner<br />
haben Zugang <strong>zu</strong> einem Fahrrad.[8] Die Gemein<strong>de</strong> als verwalten<strong>de</strong> Instanz för<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>n Ausbau <strong>de</strong>s Wegenetzes und die Erhöhung <strong>de</strong>r Sicherheit mit etwa 80. Mio SEK seit 1998.[9] Am<br />
Bahnhof Lund C besteht seit 1996 mit Lundahoj[10] ein Fahrradreisezentrum mit 780 überdachten und bewachten Fahrradstellplätzen und einem Fahrradverleih. Das Projekt wird durch<br />
staatliche Zuschüsse finanziert, mit För<strong>de</strong>rung durch INTERREG III B <strong>de</strong>s Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE).[11]<br />
Sehenswürdigkeiten und Kultur
Lund ist dank seiner Lage Ausgangspunkt für Ausflüge durch Schonen, sowie für Tagesausflüge nach Malmö o<strong>de</strong>r Kopenhagen. Weithin sichtbares Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt ist <strong>de</strong>r<br />
romanische Dom (domkyrkan). Eine Beson<strong>de</strong>rheit stellen die zahlreichen Wassertürme dar, unter <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Gamla Vattentornet mit etwa 75 m Höhe <strong>de</strong>r Größte ist.<br />
Kulturell ist die Stadt für ihre Größe hervorragend ausgestattet: So gibt es mehrere Theater, Kinos, sowie unzählige Cafés in <strong>de</strong>nen Lesungen o<strong>de</strong>r Filmvorführungen stattfin<strong>de</strong>n. Des<br />
Weiteren erwähnenswert sind das Kunstmuseum Skissernas museum (Museum <strong>de</strong>r Skizzen), das Freilichtmuseum Kulturen, sowie die Mejeriet (Molkerei), ein Kulturhaus in <strong>de</strong>m<br />
Konzerte stattfin<strong>de</strong>n. Die Stadt Lund bewarb sich als Europäische Kulturhauptstadt 2014, unterlag jedoch Umeå in <strong>de</strong>r Endauswahl.<br />
Bildung und Wissenschaft<br />
Die Universität Lund ist heute mit rund 35.000 Stu<strong>de</strong>nten eine <strong>de</strong>r größten Universitäten Skandinaviens und ist inoffiziell die älteste Universität Schwe<strong>de</strong>ns. Zwar wur<strong>de</strong> sie rund 200<br />
Jahre nach <strong>de</strong>r Universität in Uppsala gegrün<strong>de</strong>t, doch bestand schon im Jahre 1425 das Studium generale, ein Vorgänger <strong>de</strong>r heutigen Universität.<br />
Wichtige Fakultäten sind <strong>de</strong>r Fachbereich für Medizin mit <strong>de</strong>m Universitätskrankenhaus und die naturwissenschaftlich-technische Fakultät mit <strong>de</strong>m Laserzentrum und <strong>de</strong>r<br />
Synchrotronstrahlungsquelle MAX-lab. Bis 2018 wird mit <strong>de</strong>r Europäische Spallations-Neutronenquelle (ESS) und <strong>de</strong>r neuen Synchrotronstrahlungsquelle MAX IV eine Anlage für<br />
Materialforschung und Synchrotronlicht-Forschung errichtet wer<strong>de</strong>n.[12]<br />
Mit <strong>de</strong>m Familienarchiv von Alfred Nobel, dass im Lan<strong>de</strong>sarchiv Lund verwahrt wird, besteht eines von vier Weltdokumentenerben Schwe<strong>de</strong>ns in Lund. Das Lan<strong>de</strong>sarchiv, eines von<br />
fünf Lan<strong>de</strong>sarchiven in Schwe<strong>de</strong>n, verwahrt unter an<strong>de</strong>rem eine umfangreiche Sammlung dänischer Schriften aus <strong>de</strong>r Zeit vor <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Lund.<br />
Wirtschaft<br />
1951 wur<strong>de</strong> in Lund die Tetra Pak AB gegrün<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>ren Stammwerk sich noch immer hier befin<strong>de</strong>t. Alfa Laval, ein weiteres be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>s Unternehmen das in Lund ansässig ist, gehörte<br />
zwischen 1991 und 2000 <strong>zu</strong>r Tetra Pak Gruppe, wur<strong>de</strong> aber inzwischen wie<strong>de</strong>r teilweise ausgeglie<strong>de</strong>rt. Das Medizintechnikunternehmen Gambro hat seinen Sitz ebenfalls in Lund.<br />
Darüber hinaus haben die Firmen AstraZeneca und Sony Ericsson Standorte in <strong>de</strong>r Stadt.<br />
1983 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Wissenschaftspark IDEON die erste Einrichtung dieser Art in Skandinavien gegrün<strong>de</strong>t. Auf heute etwa 100.000 m2[13] sie<strong>de</strong>ln sich vor allem kleine und<br />
mittelständische Betriebe aus <strong>de</strong>n Bereichen IT, Biotechnologie und Hochtechnologie im Stadtteil Tuna an.[14] Es wird dabei eng mit <strong>de</strong>r Universität Lund, vor allem mit <strong>de</strong>r<br />
Technischen Hochschule (LTH) <strong>zu</strong>sammengearbeitet. Nennenswerte Unternehmen sind beispielsweise Deloitte, Skandia o<strong>de</strong>r QlikTech.<br />
Medien<br />
In Lund wur<strong>de</strong>n in früheren Tagen zwei Tageszeitungen herausgegeben: Lunds Dagblad und Folkets Tidning. Bei<strong>de</strong> existieren nicht mehr. Aktuell größte Zeitung ist die Malmöer<br />
Sydsvenskan, das Skånska Dagbla<strong>de</strong>t hat eine Redaktion in Lund. Seit 15 Jahren existiert die Zeitung Lundaliv, welche über Neuigkeiten und Trends aus Lund informiert. Des Weiteren<br />
fin<strong>de</strong>t die Gratiszeitung metro großen Absatz. Im lokalen Fernsehen wird <strong>de</strong>r Stu<strong>de</strong>ntenkanal Steve ausgestrahlt, mit Radio AF existiert auch im Hörfunk ein Stu<strong>de</strong>ntensen<strong>de</strong>r.<br />
Sport<br />
Lund kann als Handballstadt bezeichnet wer<strong>de</strong>n. Allein zwei Vereine aus <strong>de</strong>r Stadt spielen in <strong>de</strong>r ersten Liga: H 43 Lund und LUGI HF, letzterer wur<strong>de</strong> 1980 Schwedischer Meister. Seit<br />
1978 wird mit Lundaspelen das nach eigenen Angaben größte Handballturnier <strong>de</strong>r Welt veranstaltet.[15] Lund ist Austragungsort <strong>de</strong>r Handball-Weltmeisterschaft <strong>de</strong>r Herren 2011.<br />
Die Fußballmannschaft <strong>de</strong>s Lunds BK spielt in <strong>de</strong>r Division 2 Södra Götaland, <strong>de</strong>r vierten Liga Schwe<strong>de</strong>ns. Bekannte Spieler wie Martin Dahlin und Roger Ljung spielten bereits im<br />
Verein. Im Basketball ist die Abteilung <strong>de</strong>r LUGI (Lunds Universitets Gymnastik och Idrottsförening) und <strong>de</strong>r Eos Lund IK <strong>zu</strong> nennen, letzterer spielt in <strong>de</strong>r zweiten Liga. Die<br />
Innebandymannschaft <strong>de</strong>r LUGI spielt in <strong>de</strong>r vierten schwedischen Liga.<br />
Wichtigste Sportstätten sind die allgemeine Sporthalle (Lunds Idrottshall), die Färs och Frosta Sparbank Arena, das Ballhaus (Bollhuset) in <strong>de</strong>m Ballsportarten <strong>zu</strong> Hause sind, die Eos-<br />
Halle, sowie das Victoriastadion und <strong>de</strong>r Sportplatz (Centrala idrottsplatsen).
Persönlichkeiten<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
Folgen<strong>de</strong> Persönlichkeiten wur<strong>de</strong>n in Lund geboren:<br />
• Arvid Ahnfelt, Literaturhistoriker<br />
• Einar Billing, Bischof<br />
• Martin Dahlin, ehemaliger Fußballspieler<br />
• Viking Eggeling, Künstler<br />
• Kim Ekdahl Du Rietz, Handballer<br />
• Nils Gran<strong>de</strong>lius, Schachspieler<br />
• Magnus Gustafsson, ehemaliger Tennisspieler<br />
• Mikael Håfström, Regisseur<br />
• Carl August Hagberg, Sprachforscher<br />
• Carl Fredrik Hill, Maler<br />
• Johan Ihre, Sprachforscher<br />
• Andreas Jakobsson, Fußballspieler<br />
• Amanda Jenssen, Sängerin<br />
• Joachim Johansson, Tennisspieler<br />
• Caroline Jönsson, Fußballspielerin<br />
• Mia Leche Löfgren, Schriftstellerin<br />
• Jan Malmsjö, Schauspieler<br />
• Carl Wilhelm Oseen, Physiker<br />
• Torkel Petersson, Schauspieler<br />
• Mårten Sandén, Jugendbuchautor<br />
• Karl-Aage Schwartzkopf, Schriftsteller<br />
• Kai Siegbahn, Physiker und Nobelpreisträger<br />
• Göran Sonnevi, Schriftsteller<br />
• Henrik Sundström, ehemaliger Tennisspieler<br />
• Max von Sydow, Schauspieler<br />
• Linus Thörnblad, Hochspringer<br />
• Uffe Thrugotsen, Erzbischof<br />
• Timbuktu, Musiker<br />
• Anna Wahlgren, Schriftstellerin<br />
• Per Wahlöö, Schriftsteller<br />
• Ivar Wickman, Mediziner<br />
• Måns Zelmerlöw, Sänger, Mo<strong>de</strong>rator
Weitere Persönlichkeiten (Aus<strong>zu</strong>g)<br />
Folgen<strong>de</strong> Persönlichkeiten sind nicht in Lund geboren, wirk(t)en bzw. leb(t)en aber hier:<br />
• Nils Alwall, Nephrologe, Erfin<strong>de</strong>r einer Künstlichen Niere<br />
• Amelia An<strong>de</strong>rsdotter, Politikerin<br />
• An<strong>de</strong>rs Arborelius, Bischof<br />
• Sune Bergström, Biochemiker<br />
• Bror von Blixen-Finecke, Baron<br />
• Ingvar Carlsson, Politiker und ehemaliger schwedischer Ministerpräsi<strong>de</strong>nt<br />
• Pehr Edman, Biochemiker<br />
• Tage Erlan<strong>de</strong>r, Politiker und ehemaliger schwedischer Ministerpräsi<strong>de</strong>nt<br />
• Jakob Erlandsen, Erzbischof<br />
• Elias Magnus Fries, Botaniker<br />
• Torsten Hägerstrand, Geograph<br />
• Bengt Lidner, Dichter<br />
• Lars Hörman<strong>de</strong>r, Mathematiker<br />
• Absalon von Lund, Erzbischof<br />
• Jörgen Nilsen Schaumann, Dermatologe<br />
• Sven Nordqvist, Zeichner und Autor<br />
• Lars Norén, Lyriker und Dramatiker<br />
• Christiern Pe<strong>de</strong>rsen, Schriftsteller<br />
• Samuel von Pufendorf, Rechtsphilosoph und Historiker<br />
• Johannes Rydberg, Physiker<br />
• Henric Schartau, Prediger<br />
• Ruth Sey<strong>de</strong>witz, Schriftstellerin<br />
• Erik Johan Stagnelius, Dichter<br />
• August Strindberg, Schriftsteller und Künstler<br />
• Esaias Tegnér, Dichter<br />
• Erik Wallenberg, Erfin<strong>de</strong>r<br />
• Helgo Zettervall, Architekt<br />
Literatur<br />
• K. Arne Blom: Me<strong>de</strong>lti<strong>de</strong>ns Lund. Lund 1999, ISBN 91-973770-0-7.<br />
• Bengt Liljegren: Karl XII i Lund: När Sverige styr<strong>de</strong>s från Skåne (Illustrerad historia). Lund 1999, ISBN 91-88930-51-3.<br />
• Ragnar Blomqvist: Lunds Historia, Me<strong>de</strong>lti<strong>de</strong>n. Lund 1951, ISBN 91-40-30125-7.<br />
• Ragnar Blomqvist: Lunds Historia, Nyare ti<strong>de</strong>n. Lund 1978, ISBN 91-40-04391-6.
Einzelnachweise<br />
1. ↑ a b Tätorter; arealer, befolkning<br />
2. ↑ Sydsvenskan: Lund växer mest av storstä<strong>de</strong>rna<br />
3. ↑ Svenska Dagbla<strong>de</strong>t: Efter grannen Lund är Malmö <strong>de</strong>n stad som växer mest i Sverige.<br />
4. ↑ Temperaturen och ne<strong>de</strong>rbör<strong>de</strong>n i Sverige 1961 – 1990: referensnormaler / Hans Alexan<strong>de</strong>rsson och Carla Eggertsson Karlström. – Utgåva 2. – Norrköping: Sveriges<br />
meteorologiska och hydrologiska institut, 2001. – 71 S.: Kt.; 30 cm. – (Meteorologi / SMHI; 99. 2001)<br />
5. ↑ Übersichtskarte <strong>de</strong>r Stadtteile<br />
6. ↑ Universität Stockholm, Institut für Stadt- und Gemein<strong>de</strong>geschichte: Lunds befolkningsutveckling 1570-1995<br />
7. ↑ Lund Stadsbuss (schwedisch)<br />
8. ↑ Lundacyklisten i siffror (schwedisch)<br />
9. ↑ Cyklist (schwedisch)<br />
10.↑ Hoj ist das schonische Wort für Fahrrad<br />
11.↑ Lundahoj - cykelresecentrum (schwedisch)<br />
12.↑ ESS in Lund<br />
13.↑ IDEON - en berättelse om framgång<br />
14.↑ Allt du behöver är en god idé<br />
15.↑ xxx<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Ystad<br />
Ystad (<strong>de</strong>utsch historisch: Ystadt, dänisch historisch: Ysted) ist eine Stadt in <strong>de</strong>r südschwedischen Provinz Skåne län und <strong>de</strong>r historischen Provinz Schonen an <strong>de</strong>r schwedischen<br />
Südküste. Die Stadt ist Hauptort <strong>de</strong>r gleichnamigen Gemein<strong>de</strong>.<br />
Geografie
Von Ystad zieht sich <strong>de</strong>r Järavall, ein aus Steinen und Kies bestehen<strong>de</strong>r Landrücken, längs <strong>de</strong>r Küste nach Trelleborg und Falsterbo hin. Er soll <strong>de</strong>r „Iöravalla“ sein, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Völuspá<br />
(Vers 14) genannt wird.<br />
Geschichte<br />
Der dänische Name Ysted wur<strong>de</strong> 1244 erstmals in <strong>de</strong>n Lun<strong>de</strong>r Annalen erwähnt, doch war das Stadtgebiet bereits früher besie<strong>de</strong>lt. Die Ursprünge <strong>de</strong>r Hauptkirche <strong>de</strong>r Stadt, <strong>de</strong>r Sankt-<br />
Marien-Kirche (Sankta Maria kyrka), stammen aus <strong>de</strong>m Beginn <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Das 1258 gegrün<strong>de</strong>te Kloster <strong>de</strong>r Franziskaner (Gråbrö<strong>de</strong>rklostret) St. Petri zählt <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n<br />
besterhaltenen mittelalterlichen Klosteranlagen in Schwe<strong>de</strong>n und beherbergt heute das Stadtmuseum. In <strong>de</strong>r Altstadt sind viele Fachwerkhäuser aus <strong>de</strong>m 17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt erhalten.<br />
Die wirtschaftliche Grundlage für <strong>de</strong>n Aufschwung <strong>de</strong>r Stadt bil<strong>de</strong>ten die Fischerei und <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l mit Heringen, <strong>de</strong>ren Vorkommen in <strong>de</strong>r südlichen Ostsee im ausgehen<strong>de</strong>n Mittelalter<br />
enorme Ausmaße hatte, um 1500 jedoch plötzlich drastisch abnahm.<br />
Verkehr<br />
Von Ystad aus bestehen Fährverbindungen <strong>zu</strong>r dänischen Insel Bornholm und ins polnische Świnoujście (Swinemün<strong>de</strong>). Ystad ist Endpunkt <strong>de</strong>r Eisenbahnlinie Malmö–Ystad, über die<br />
auch Direktverbindungen nach Kopenhagen bestehen, um die Bornholmfähre mit <strong>de</strong>r Hauptstadt und <strong>de</strong>m dänischen Schienennetz <strong>zu</strong> verbin<strong>de</strong>n. Eine weitere Eisenbahnstrecke<br />
verbin<strong>de</strong>t Ystad über Tomelilla mit Simrishamn an <strong>de</strong>r Ostküste Schonens.<br />
Ystad als Wallfahrtsort für Krimi-Fans<br />
Ystad wur<strong>de</strong> durch die dort spielen<strong>de</strong>n Kriminalromane von Henning Mankell mit Kommissar Kurt Wallan<strong>de</strong>r als fiktivem Protagonisten europaweit bekannt. Alle Plätze, Straßen und<br />
Restaurants, die in <strong>de</strong>n Büchern erwähnt wer<strong>de</strong>n, existieren in <strong>de</strong>r Realität,[2] wie <strong>zu</strong>m Beispiel das Wohnhaus Wallan<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>r Mariagatan 10, ein schlichtes Gebäu<strong>de</strong> aus rotem<br />
Backstein. Aus diesem Grun<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> Ystad seit Beginn <strong>de</strong>r 1990er Jahre <strong>zu</strong> einem beliebten Pilgerort für Mankell-Leser.<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
• Ivar Jacobson, Informatiker<br />
• Ernst-Hugo Järegård, Schauspieler<br />
• Anna Q. Nilsson, Schauspielerin<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Helårsstatistik – Församling och landskap – Församlingsfolkmängd efter kön 31 <strong>de</strong>cember 2009<br />
2. ↑ Auf Wallan<strong>de</strong>rs Spuren. Ein Wegweiser über Ystad und Umgebung für alle Fans <strong>de</strong>r Romanfigur Kurt Wallan<strong>de</strong>r.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Simrishamn<br />
Simrishamn ist ein Ort (tätort) in <strong>de</strong>r südschwedischen Provinz Skåne län und <strong>de</strong>r historischen Provinz Schonen, an <strong>de</strong>r Ostsee gelegen.<br />
Der Name <strong>de</strong>r Hafenstadt leitet sich von <strong>de</strong>n Worten simris für Springquelle o<strong>de</strong>r wasserreiche Fläche und hamn für Hafen ab. Von hier gibt es eine Fährverbindung nach Allinge-<br />
Sandvig auf <strong>de</strong>r dänischen Insel Bornholm. Simrishamn ist Hauptort <strong>de</strong>r gleichnamigen Gemein<strong>de</strong>.<br />
Geschichte<br />
Anfänglich war Simrishamn ein kleines Fischerdorf <strong>zu</strong>r Versorgung <strong>de</strong>r östlich gelegenen Stadt Tumathorp (heute Östra Tommarp). Es gehörte wie die gesamte Region <strong>zu</strong> Dänemark. In<br />
<strong>de</strong>r Heimskringla wird berichtet, wie <strong>de</strong>r Norweger Sigurd Jorslafare 1123 nach Simrishamn (Svimvaros) segelte, um danach die Stadt Tumathorp <strong>zu</strong> plün<strong>de</strong>rn.<br />
Die Kirche St. Nicolai wird schon in einer Urkun<strong>de</strong> von 1161 erwähnt und ist seit dieser Zeit ein Richtpunkt für die Schifffahrt. Nach einem großen Stadtbrand in Tumathorp gewann<br />
Simrishamn, das damals Simmershavn hieß, immer mehr an Be<strong>de</strong>utung. In <strong>de</strong>r Regierungszeit von Christian IV. blühte <strong>de</strong>r Ort auf, doch 1655 wur<strong>de</strong>n große Teile <strong>de</strong>r Bevölkerung von<br />
<strong>de</strong>r Pest nie<strong>de</strong>rgestreckt.<br />
Durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Roskil<strong>de</strong> kam Simrishamn <strong>zu</strong>sammen mit Schonen und an<strong>de</strong>ren Gebieten <strong>zu</strong> Schwe<strong>de</strong>n. Noch bis in die Achtziger Jahre <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts hatte die Stadt<br />
Schwe<strong>de</strong>ns größte Fischereiflotte, doch heute wird diese durch Fangauflagen und Mangel an Fisch stark beeinträchtigt.<br />
Partnerstädte<br />
• Kołobrzeg (Kolberg), Polen<br />
• Barth, Mecklenburg-Vorpommern<br />
Quellen<br />
1. ↑ Tätorternas landareal, folkmängd och invånare<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Møn – Moen (Insel)<br />
Møn ist eine 218 Quadratkilometer große Insel im dänischen Teil <strong>de</strong>r Ostsee, zwischen <strong>de</strong>r Südspitze Sjællands und <strong>de</strong>r Ostspitze Falsters gelegen.<br />
Møn war bis En<strong>de</strong> 2006 eine eigene Gemein<strong>de</strong> im Verwaltungsbezirk Storstrøms Amt und ist seit <strong>de</strong>r dänischen Kommunalreform <strong>zu</strong>m 1. Januar 2007 ein Teil <strong>de</strong>r Großgemein<strong>de</strong><br />
Vordingborg, <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n ehemaligen Gemein<strong>de</strong>n Langebæk, Præstø und Vordingborg <strong>de</strong>r größeren Nachbarinsel Sjælland. Größter Ort ist Stege an <strong>de</strong>r gleichnamigen Bucht und
am Stege Nor. Im äußersten Osten <strong>de</strong>r Insel befin<strong>de</strong>t sich die steile Krei<strong>de</strong>küste Møns Klint, die einen Anziehungspunkt für <strong>de</strong>n Frem<strong>de</strong>nverkehr darstellt. Die Insel Møn kann als<br />
kleinere Schwester <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Insel Rügen bezeichnet wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn die Inselgebiete, welche aus 17 Millionen Jahre altem Muschelkalk bestehen, wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r selben Zeit durch<br />
tektonische Bewegungen an die Erdoberfläche gehoben. Bei<strong>de</strong> Inseln gehörten <strong>zu</strong> einer größeren wie<strong>de</strong>r abgesunkenen Landmasse, von <strong>de</strong>r in dieser Region nur noch diese bei<strong>de</strong>n Inseln<br />
als höchste Erhebungen übrig sind.<br />
Møn hat 9909 Bewohner (1. Januar 2010[1]); die Einwohnerzahl lag noch 1965 bei über 12.000.<br />
Seit ein paar Jahren besteht eine Insel-Partnerschaft zwischen <strong>de</strong>r dänischen Insel Møn und <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Ostseeinsel Fehmarn, die von <strong>de</strong>r Europäischen Union im Rahmen ihres<br />
INTERREG-Programmes geför<strong>de</strong>rt wird.<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
Neben <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Steilküste Møns Klint ist beson<strong>de</strong>rs die Westseite <strong>de</strong>r Insel reich an vorzeitlichen Denkmälern. Auf <strong>de</strong>r Insel sind 119 Hünengräber bekannt, von <strong>de</strong>nen 38 unter Schutz<br />
stehen. Unter diesen ragen die folgen<strong>de</strong>n Megalithanlagen heraus:<br />
• Busemarkedysse (Langdysse von 27 x 8 m),<br />
• Grønjægers Høj o<strong>de</strong>r Grønsalen (eine im Neolithikum entstan<strong>de</strong>ne Langdysse mit zwei Urdolmen),<br />
• Jor<strong>de</strong>høj, ein Ganggrab,<br />
• die Doppelkammer im Klekken<strong>de</strong> Høj,<br />
• Kong Asgers Høj,<br />
• Sprovedyssen,<br />
• Sømarkedyssen mit über 450 Schalen.<br />
Weitere Sehenswürdigkeiten:<br />
• Schloss Liselund ist ein klassizistisches Landhaus in einem englischen Landschaftspark bei Møns Klint; es ist einer <strong>de</strong>r Standorte <strong>de</strong>s Dänischen Nationalmuseums.<br />
• Der Märchenwald Ulvshale im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Insel ist eine Ent<strong>de</strong>ckung wert, da ihn eine Vielfalt handgemachter Filzfiguren lebendig machen.<br />
• Der Fischerort Nyord liegt abgeschie<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>r Insel Nyord am nordwestlichen Zipfel von Møn, umgeben von einem Naturschutzgebiet. Nyord ist ein Paradies für<br />
Ornithologen. Auf <strong>de</strong>n Salzwiesen vor Nyord kann man viele Vogelarten beobachten.<br />
• Die Kalkmalereien <strong>de</strong>s um 1400 arbeiten<strong>de</strong>n Elmelun<strong>de</strong>-Meisters sind in <strong>de</strong>n Kirchen von Elmelun<strong>de</strong>, Fanefjord und Keldby <strong>zu</strong> besichtigen.<br />
• Klintholm Havn, ein Fischerei- und Freizeithafen im Südosten <strong>de</strong>r Insel.<br />
• Møn Fyr, ein 1845 erbauter Leuchtturm.<br />
• Höchste Erhebung ist mit 143 Metern <strong>de</strong>r Aborrebjerg.<br />
Tourismus<br />
Auf Møn kann man Ferienhäuser mieten. Beliebt sind die Ferienhäuser und Strän<strong>de</strong> in Råbylille und Ulvshale. In Ulvshale Skov gibt es einen Wald sowie <strong>de</strong>n größten Campingplatz <strong>de</strong>r<br />
Insel. In <strong>de</strong>r Nähe von Møns Klint und südlich von Harbölle befin<strong>de</strong>n sich weitere Campingplätze. Ein häufiger Urlaubsgast in <strong>de</strong>r Nähe von Ulvshale ist <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsche Schriftsteller<br />
Günter Grass.<br />
Verkehr<br />
Møn ist auf <strong>de</strong>r Straße über Brücken, Dämme und Fähren erreichbar.
• Eine Brücke zwischen Kalvehave auf Sjælland (dt: Seeland) und Koster auf Møn.<br />
• Ein Damm führt über die Inseln Bogø und Farø <strong>zu</strong>r Europastraße E 47, wo eine Brückenanbindung nach Seeland und Falster besteht.<br />
• Eine Fähre verbin<strong>de</strong>t Falster mit Bogø.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ a b Statistikbanken -> Befolkning og valg -> BEF4: Folketal pr. 1. januar for<strong>de</strong>lt på øer (dänisch)<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Falster<br />
Falster ist eine <strong>zu</strong> Dänemark gehören<strong>de</strong> 514 km² große Insel mit 43.389 Einwohnern (1. Januar 2010).[1] Über ein Drittel <strong>de</strong>r Einwohner leben in Nykøbing Falster. Falster und die<br />
Nachbarinsel Lolland sind infrastrukturell eng miteinan<strong>de</strong>r verbun<strong>de</strong>n und nur durch <strong>de</strong>n schmalen Guldborgsund getrennt. Dieser wird bei von einem Straßentunnel im Verlauf <strong>de</strong>r E 47<br />
unterquert sowie von einer Eisenbahn- und Straßenbrücke in Nykøbing und einer Straßenbrücke in Guldborg überquert. Mit <strong>de</strong>r Kommunalreform in Dänemark <strong>zu</strong>m 1. Januar 2007<br />
wur<strong>de</strong>n die ehemaligen vier Kommunen auf Falster mit zwei ehemaligen Kommunen <strong>de</strong>s östlichen Lollands <strong>zu</strong>r neuen Guldborgsund Kommune in <strong>de</strong>r Region Sjælland<br />
<strong>zu</strong>sammengeschlossen. Die neue Kommune erstreckt sich über ein Gebiet von 903,42 km² und wird von 63.211 Einwohnern (1. Januar 2009)[2] bewohnt. Die ehemaligen Kommunen<br />
auf Falster hießen: Nykøbing Falster, Nørre Alslev, Stubbekøbing und Sydfalster. Die ehemaligen Kommunen auf Lolland waren Nysted und Sakskøbing.<br />
Geschichte<br />
Die erfassbare Geschichte beginnt in <strong>de</strong>r Steinzeit, die einige Monumente und Siedlungsreste wie die von Radbjerg und Skelby hinterlassen hat. Schwedische und slawisch-wendische<br />
Ortsnamen, für die die Suffixe "by" bzw. "itse" stehen, <strong>de</strong>uten einige Verbindungen an. Aus dieser Zeit stammt das Virket, ein Erdwerk in <strong>de</strong>r Inselmitte. Mit <strong>de</strong>r Zentralisierung<br />
dänischer Macht im Königtum wächst ab 1000 n. Chr. <strong>de</strong>r Wi<strong>de</strong>rstand gegen die eingesickerten Wen<strong>de</strong>n.<br />
Geologie<br />
Die Inseloberfläche mit Moränen, Toteisseen und Höhenrücken wur<strong>de</strong> durch die Eiszeit geprägt. Der Sü<strong>de</strong>n verdankt sein heutiges Bild <strong>de</strong>n Deichprojekten die <strong>de</strong>r König Christian II. ab<br />
1522 mit Hilfe nie<strong>de</strong>rländischer Experten schuf. Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt kamen weitere Ein<strong>de</strong>ichungen da<strong>zu</strong>, die durch die Sturmflut von 1872 unterbrochen wur<strong>de</strong>n.<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Ganggrab von Listrup<br />
• Falsters Virke, ein Wallsystem<br />
• Gangrab Ørnehøj, im Corselitse Osterskov
• Halskov Vænge<br />
Die größten Orte sind Nykøbing Falster, Stubbekøbing und Nørre Alslev. Auf Falster liegt <strong>de</strong>r Ferienort Marielyst und <strong>de</strong>r südlichste Punkt Dänemarks bei Gedser.<br />
Verkehr<br />
Falster ist mit <strong>de</strong>r nördlich gelegenen Insel Seeland durch die Storstrømbrücke, eine kombinierte Straßen- und Eisenbahnbrücke (Vogelfluglinie) über die kleine Insel Masnedø,<br />
verbun<strong>de</strong>n. Über die kleine Insel Farø besteht ferner mit <strong>de</strong>r Farø-Brücke eine Straßenbrücke im Verlauf <strong>de</strong>r E47 von Hamburg nach Kopenhagen. Auf Farø existiert eine Abzweigung,<br />
die über die Insel Bogø <strong>zu</strong>r Insel Møn führt.<br />
Nach Lolland bestehen zwei Straßen- und eine Eisenbahnbrücke sowie ein Straßentunnel im Verlauf <strong>de</strong>r E47 (Rødby - Kopenhagen).<br />
Es gibt im Südosten <strong>de</strong>r Insel Falster einen circa 20 km langen Sandba<strong>de</strong>strand. Dieser ist sehr kin<strong>de</strong>rfreundlich, weil er flach ins Wasser abfällt. Bekannte Ba<strong>de</strong>orte/Ferienhausgebiete in<br />
Südfalster sind unter an<strong>de</strong>rem Ge<strong>de</strong>sby und Marielyst/Bøtø.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Statistikbanken -> Befolkning og valg -> BEF4: Folketal pr. 1. januar for<strong>de</strong>lt på øer (dänisch)<br />
2. ↑ www.xxx → Befolkning og valg → Folketal → Tabelle BEF44: Folketal pr. 1. januar for<strong>de</strong>lt på byer (2006-2009), abgerufen am 4. Oktober 2009<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Langeland (Dänemark)<br />
Langeland ist eine 52 km lange und bis <strong>zu</strong> 11 km breite Ostseeinsel in <strong>de</strong>r Region Syddanmark in Dänemark. Sie ist über ein Brückensystem erreichbar, das die Inseln Siø und Tåsinge<br />
einschließt und das an das nordwestlich gelegene Fünen angebun<strong>de</strong>n ist. Die Insel Langeland mit 13.277 Einwohnern (1. Januar 2010)[1] und bil<strong>de</strong>t <strong>zu</strong>gleich auch eine Großgemein<strong>de</strong><br />
(seit 2007). Östlich von Langeland erstreckt sich <strong>de</strong>r Langelandsbelt. Er ist eine südliche Verlängerung <strong>de</strong>s Großen Belts, <strong>de</strong>r einen <strong>de</strong>r dänischen Ostsee<strong>zu</strong>gänge bil<strong>de</strong>t. Langeland ist<br />
Teil <strong>de</strong>r Inselwelt <strong>de</strong>r sogenannten Dänischen Südsee (im Dänischen: Sydfynske øhav).<br />
Geografie, Verwaltung und Verkehr<br />
Die 284 km² große Insel Langeland glie<strong>de</strong>rte sich ursprünglich in zwei Har<strong>de</strong>n, die Nord- (Langelands Nørre Herred) und die Südhar<strong>de</strong> (Langelands Søn<strong>de</strong>r Herred) im Svendborg Amt,
die mit <strong>de</strong>r Kommunalreform 1970 von Nord nach Süd in drei historische Verwaltungsbezirke (Kommunen) aufgeteilt wur<strong>de</strong>n, die <strong>zu</strong>m damaligen Fyns Amt gehörten:<br />
Tranekær<br />
• Hier ist das Schloss Tranekær eine <strong>de</strong>r Hauptsehenswürdigkeiten. An <strong>de</strong>r Nordspitze Langelands liegt <strong>de</strong>r kleine Hafenort Lohals. Die von hier aus nach Korsør auf Seeland<br />
(Querung <strong>de</strong>s Großen Belts) verkehren<strong>de</strong> Fähre wur<strong>de</strong> 1998 eingestellt.<br />
Rudkøbing<br />
• Rudkøbing ist <strong>de</strong>r Hauptort <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Langeland und bil<strong>de</strong>t die Inselmitte. Rudkøbing beherbergt die südlichste Hauptverkehrsachse Dänemarks in West-Ost-Richtung. Die<br />
Verbindung nach Westen wird über die Brücke in Rudkøbing, die nach Osten mit <strong>de</strong>r Fährverbindung Spodsbjerg-Tårs (Insel Lolland) hergestellt. Durch außeror<strong>de</strong>ntlich flache<br />
Gewässer vor <strong>de</strong>r Westküste Langelands verkehrt außer<strong>de</strong>m eine mo<strong>de</strong>rne Fähre von Rudkøbing nach Marstal auf <strong>de</strong>r Nachbarinsel Ærø.<br />
Südlangeland<br />
• Der südliche Inselteil liegt abseits <strong>de</strong>r großen Verkehrswege. Im November 2003 wur<strong>de</strong> die jahrzehntelang existieren<strong>de</strong> Fährlinie nach Deutschland (Bagenkop - Kiel) mit einer<br />
bis <strong>zu</strong> 140 PKW fassen<strong>de</strong>n Auto/Personen-Fähre endgültig eingestellt, da sie nach Beendigung <strong>de</strong>s zollfreien Einkaufs innerhalb <strong>de</strong>r EU (Butterfahrt) nicht mehr wirtschaftlich<br />
rentabel betrieben wer<strong>de</strong>n konnte. Der ehemalige Fähranleger in Bagenkop ist mittlerweile komplett <strong>zu</strong>rückgebaut.<br />
Im Zuge <strong>de</strong>r dänischen Verwaltungsreform <strong>zu</strong>m 1. Januar 2007 wur<strong>de</strong>n diese drei Kommunen <strong>zu</strong>r Langeland Kommune <strong>zu</strong>sammengefasst.<br />
Ortschaften <strong>de</strong>r Insel<br />
Auf <strong>de</strong>r Insel liegen die folgen<strong>de</strong>n Ortschaften mit über 200 Einwohnern (byer nach Definition <strong>de</strong>r dänischen Statistikbehör<strong>de</strong>), bei einer eingetragenen Einwohnerzahl von Null hatte<br />
<strong>de</strong>r Ort in <strong>de</strong>r Vergangenheit mehr als 200 Einwohner:<br />
• Ortschaft Einwohner[1] Einwohner[1]<br />
• Bagenkop 535<br />
• Humble 645<br />
• Lin<strong>de</strong>lse 359<br />
• Lohals 541<br />
• Rudkøbing 4641<br />
• Snø<strong>de</strong> 346<br />
• Spodsbjerg 210<br />
• Tryggelev 0<br />
• Tullebølle 824<br />
Touristisches<br />
Touristisch interessante Punkte in Südlangeland sind u. a. das Ristinge-Kliff in Sichtweite <strong>de</strong>r Insel Ærø und <strong>de</strong>r Leuchtturm "Keldsnor Fyr" nahe <strong>de</strong>m Fischer- und Segelhafen<br />
Bagenkop an <strong>de</strong>r Südspitze <strong>de</strong>r Insel. Auch befin<strong>de</strong>t sich hier das Langelandsfort, ein Militärstützpunkt während <strong>de</strong>s kalten Krieges, verlor es nach <strong>de</strong>ssen En<strong>de</strong> seine Be<strong>de</strong>utung. Es
wur<strong>de</strong> 1993 in ein Museum umgewan<strong>de</strong>lt, in <strong>de</strong>m unter an<strong>de</strong>rem zwei Düsenjäger (Saab J-35 Draken und MIG-23) <strong>zu</strong> besichtigen sind.<br />
Archäologie<br />
Langeland ist durch eine Reihe prähistorischer Denkmäler interessant. Darunter ragen die Ganggräber und Dolmen im Skovtofte, im Tvedskov, in Herslev (Megalithanlagen von<br />
Herslev), "Kong Humbles Grav", bei Ristinge Nor und das von Hjulberg sicher heraus.<br />
Geologie<br />
Auf Langeland befin<strong>de</strong>n sich etwa 690 allein stehen<strong>de</strong> Hügel, die sich trotz ihrer relativ geringen Höhe von nur 10 bis 20 Metern <strong>de</strong>utlich von <strong>de</strong>r sie umgeben<strong>de</strong>n flachen Landschaft<br />
abheben. Diese hutförmigen Hügel (dän.: hatbakker) bil<strong>de</strong>n eine einzigartige Landschaftsform und sind das herausragen<strong>de</strong> landschaftliche Element <strong>de</strong>r Insel. Die Hügel erstrecken sich<br />
in einer langen Reihe über die gesamte Insel, mit Ausnahme <strong>de</strong>r Halbinsel Ristinge. Die Hügelreihe setzt sich in <strong>de</strong>n Großen Belt hinein fort und führt in einem Bogen von Lohals bis<br />
Korsør auf Seeland. Die Hügel bestehen überwiegend aus vom Schmelzwasser eiszeitlicher Gletscher abgelagertem Kies und Sand, wobei die Lagen aufrecht stehen und <strong>zu</strong>m Zentrum<br />
<strong>de</strong>r Anhöhe hin geneigt sind.<br />
Bis heute liegt keine gesicherte Erklärung über die Entstehung dieser Huthügel vor. Es ist möglich, dass sie aus kleinen Seen entstan<strong>de</strong>n, die sich auf <strong>de</strong>m vor<strong>de</strong>ren Teil eines <strong>zu</strong>m<br />
Stillstand gekommenen Gletschers gebil<strong>de</strong>t haben. In diesem Abschnitt <strong>de</strong>s Gletschers bil<strong>de</strong>ten sich Spalten in einem schachbrettartigen Muster, eine Erscheinung, die mit <strong>de</strong>m<br />
russischen Wort „krevasser“ bezeichnet wird. Dort, wo die Spalten im rechten Winkel aufeinan<strong>de</strong>r treffen, entstand eine kleine Senke. Vom Schmelzwasser <strong>de</strong>s Gletschers wur<strong>de</strong>n Kies,<br />
Sand und Ton in das kleine Becken verfrachtet. Der weiter <strong>zu</strong>rück liegen<strong>de</strong> aktive Teil <strong>de</strong>r Gletscher stieß <strong>zu</strong> einem späteren Zeitpunkt auf das Toteis mit seinen Seen o<strong>de</strong>r fuhr darüber<br />
hinweg. Dabei wur<strong>de</strong>n die Lagen gefaltet und die Spitzen dieser Falten abgehobelt. Einige Stellen wur<strong>de</strong>n mit Geschiebemergel über<strong>de</strong>ckt. Als das Eis schmolz, blieben die Hügel auf<br />
einer flachen Oberfläche in einer langen Reihe <strong>zu</strong>rück.<br />
Eine weitere geologische Sehenswürdigkeit ist "Keldsnor" im äußersten Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Insel. Es han<strong>de</strong>lt sich um einen Strandsee, <strong>de</strong>r aus einer früheren Meeresbucht entstan<strong>de</strong>n ist, die von<br />
einem Nehrungshaken und steinigen Strandwällen vom offenen Meer abgeschnürt wur<strong>de</strong>.<br />
Verschie<strong>de</strong>nes<br />
Der berühmteste Sohn <strong>de</strong>r Insel ist <strong>de</strong>r Ent<strong>de</strong>cker <strong>de</strong>s Elektromagnetismus Hans Christian Ørsted.<br />
Literatur<br />
• • Denkmäler auf Langeland (auf dt. im Langelandmuseum erhältlich)<br />
• • Gunnar Larsen: Fyn og Øerne (erschienen in <strong>de</strong>r Reihe Geologisk set) - 144 S., zahlr. Abb. und Karten, Geografforlaget, Bren<strong>de</strong>rup (DK) 2002.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ a b c Ungültige Metadaten-Quelle Insel<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Seeland (Dänemark)<br />
Seeland (dänisch Sjælland) ist die größte Ostseeinsel (7.031 km²) Dänemarks im Osten <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Mit 2.164.217 Einwohnern (1. Januar 2010[1]) ist Seeland <strong>zu</strong>gleich die mit Abstand<br />
bevölkerungsreichste Insel Dänemarks.<br />
Name<br />
Die genaue Herkunft <strong>de</strong>s dänischen Namens „Sjælland“ ist umstritten. „Sjæl“ be<strong>de</strong>utet im heutigen Dänisch zwar „Seele“, aber aufgrund älterer Aufzeichnungen kann man diese<br />
Deutung ausschließen. Auch eine <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Namen entsprechen<strong>de</strong> Ableitung aus „siô/sæ“ („See“, mit <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung „Meer“) wird heute weitgehend abgelehnt – es kann jedoch<br />
sein, dass <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsche Name entstand, als die dänische Forschung <strong>zu</strong>r Wortherkunft noch nicht <strong>de</strong>n heutigen Stand erreicht hatte; die Dänen also selbst annahmen, dass <strong>de</strong>r Name<br />
„Seeland“ be<strong>de</strong>utet. Die heute vorherrschen<strong>de</strong> Auffassung ist: Die altdänische Form „Siâland“ stammt von einer Zusammenset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Wortes *selha- mit <strong>de</strong>r Endung *wundia-.<br />
Letzteres be<strong>de</strong>utet „weist auf, ähnelt“. Das Wort *selha- kann zwei verschie<strong>de</strong>ne Be<strong>de</strong>utungen haben: Es kann <strong>zu</strong>m einen „Seehund“ be<strong>de</strong>uten (im heutigen Dänisch „sæl“) und <strong>zu</strong>m<br />
an<strong>de</strong>ren „tiefe Bucht, För<strong>de</strong>“ be<strong>de</strong>uten. Da <strong>de</strong>r wichtigste Ort auf Seeland früher Roskil<strong>de</strong> war, das auf <strong>de</strong>m Seewege nur durch <strong>de</strong>n engen und verzweigten Roskil<strong>de</strong>fjord <strong>zu</strong> erreichen<br />
ist, wird meist angenommen, dass die Seefahrer nach diesem die Insel benannt haben.[2]<br />
Geographie<br />
Im Nordosten von Sjælland befin<strong>de</strong>t sich die dänische Hauptstadt Kopenhagen, die sich <strong>zu</strong>m Teil auf die Nachbarinsel Amager erstreckt. Mit <strong>de</strong>n umliegen<strong>de</strong>n Orten bil<strong>de</strong>t Kopenhagen<br />
die Hauptstadtsregion (Region Hovedsta<strong>de</strong>n), eine <strong>de</strong>r fünf Verwaltungsregionen Dänemarks. Sie hat auf einer Fläche von 2.561 km² 1.167.569 Einwohner (1. Januar 2009)[3],<br />
beherbergt also auf weniger als 6 % <strong>de</strong>r Fläche <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s mehr als 20 % <strong>de</strong>r dänischen Bevölkerung. Damit ist dieser Teil Seelands das mit Abstand größte Ballungszentrum<br />
Dänemarks. Zugleich bil<strong>de</strong>t es <strong>de</strong>n dänischen Teil <strong>de</strong>r Öresundregion.<br />
Zur westlichen Nachbarinsel Fyn (<strong>de</strong>utsch: Fünen), ihrerseits durch zwei Brücken im Nordwesten mit <strong>de</strong>m dänischen Festland verbun<strong>de</strong>n, führt die Storebælt-Brücke. Seit 2000 hat<br />
Seeland über die Öresundverbindung, einer Brücken- und Tunnelkombination, direkten Anschluss an die schwedische Provinz Schonen.<br />
Eine weitere wichtige Stadt ist die ehemalige Hauptstadt Roskil<strong>de</strong> mit ihrem Weltkulturerbe, <strong>de</strong>m Dom <strong>zu</strong> Roskil<strong>de</strong>.<br />
Höchste natürliche Erhebung Seelands ist <strong>de</strong>r Kobanke mit 122,9 Metern. Gyl<strong>de</strong>nløves Høj ist mit 125,5 Metern zwar höher, aber seine natürliche Höhe beträgt nur 121,3 Meter. Im<br />
Nordteil <strong>de</strong>r Insel ist <strong>de</strong>r Maglebjerg mit 91 Metern die höchste Erhebung. Er liegt im Ru<strong>de</strong>wald (Ru<strong>de</strong> Skov) unmittelbar östlich von Ebberødgård.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ a b Statistikbanken -> Befolkning og valg -> BEF4: Folketal pr. 1. januar for<strong>de</strong>lt på øer (dänisch)<br />
2. ↑ Beitrag von Jan Katlev, Mitverfasser Politikens Etymologisk Ordbog<br />
3. ↑ www.xxx → Befolkning og valg → Folketal → Tabelle BEF44: Folketal pr. 1. januar for<strong>de</strong>lt på byer (2006-2009), abgerufen am 5. Oktober 2009<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Köln<br />
Köln (bis 1919 auch Cöln, unter <strong>de</strong>n Römern erst oppidum ubiorum, dann CCAA, Colonia Claudia Ara Agrippinensium, im Mittelalter auf Latein meist Colonia Agrippina und Deutsch<br />
Coellen und im Kölner Dialekt Kölle genannt) ist nach Einwohnern die viertgrößte, flächenmäßig die drittgrößte Großstadt Deutschlands sowie die größte Stadt Nordrhein-Westfalens.<br />
[2] Die Stadt ist für ihre 2000-jährige Geschichte, ihr kulturelles und architektonisches Erbe sowie für ihre international be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Veranstaltungen bekannt.<br />
Neben ihrer Eigenschaft als Sitz weltlicher und kirchlicher Macht trug <strong>zu</strong>r Be<strong>de</strong>utung Kölns auch die Lage am Rhein sowie am Schnittpunkt be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r West-Ost-Han<strong>de</strong>lsstraßen bei.<br />
Die Stadt wur<strong>de</strong> so <strong>zu</strong> einem wichtigen Han<strong>de</strong>lsstandort und ist heute <strong>de</strong>r Verkehrsknotenpunkt mit <strong>de</strong>m höchsten Eisenbahnverkehrsaufkommen und mit <strong>de</strong>m größten Container- und<br />
Umschlagbahnhof Deutschlands, <strong>de</strong>m Umschlagbahnhof Köln Eifeltor. Die Rheinhäfen zählen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n wichtigsten Binnenhäfen Europas.<br />
Köln besitzt als Wirtschafts- und Kulturmetropole internationale Be<strong>de</strong>utung und gilt als eines <strong>de</strong>r führen<strong>de</strong>n Zentren für <strong>de</strong>n weltweiten Kunsthan<strong>de</strong>l. Die Karnevalshochburg ist<br />
außer<strong>de</strong>m Sitz vieler Verbän<strong>de</strong> und Medienunternehmen mit zahlreichen Fernsehsen<strong>de</strong>rn, Plattenfirmen und Verlagshäusern.<br />
Die Stadt hat mit <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong> Köln, an <strong>de</strong>r mehr als 44.000 Stu<strong>de</strong>nten eingeschrieben sind, eine <strong>de</strong>r größten Universitäten und mit 16.500 Stu<strong>de</strong>nten an <strong>de</strong>r Fachhochschule Köln<br />
die größte Fachhochschule Deutschlands und ist Sitz zahlreicher weiterer Hochschulen (siehe auch Hochschulen in Köln).<br />
Geographie<br />
Geographische Lage und Klima<br />
Das Stadtgebiet erstreckt sich über 405,15 km² (linksrheinisch 230,25 km², rechtsrheinisch 174,87 km²). Damit ist Köln flächenmäßig die sechstgrößte Stadt und drittgrößte Großstadt<br />
Deutschlands.<br />
Köln liegt 50° 56′ 33″ nördlicher Breite und 6° 57′ 32″ östlicher Länge. Der höchste Punkt liegt 118,04 Meter (<strong>de</strong>r Monte Troo<strong>de</strong>löh im Königsforst), <strong>de</strong>r niedrigste 37,5 Meter (im<br />
Worringer Bruch) über <strong>de</strong>m Meeresspiegel.<br />
Köln befin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Kölner Bucht, wie die Tallandschaft zwischen <strong>de</strong>n Stufen <strong>de</strong>s Bergischen Lan<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>r Eifel unmittelbar nach Austritt <strong>de</strong>s Rheins aus <strong>de</strong>m Rheinischen<br />
Schiefergebirge genannt wird. Diese günstige Lage verschafft Köln ein Klima, das sich durch mehrere Beson<strong>de</strong>rheiten auszeichnet:<br />
• Durch die Eifelbarriere liegt die Stadt, insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>ren linksrheinischer Teil, im Schutz und Regenschatten von Westwin<strong>de</strong>n, die außer<strong>de</strong>m einen Föhneffekt bewirken<br />
können.<br />
• Gleichzeitig wird eine Lufterwärmung durch geringen Luftaustausch mit <strong>de</strong>m Umland begünstigt. Die Innenstadt von Köln, in <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>sätzlich innerstädtische Überwärmung<br />
auftritt, gilt als <strong>de</strong>r wärmste Ort Deutschlands, noch vor Freiburg im Breisgau.<br />
• Damit verbun<strong>de</strong>n ist aufgrund <strong>de</strong>r Verdunstung <strong>de</strong>s Rheinwassers bei geringem Luftaustausch regelmäßig eine hohe Luftfeuchtigkeit, die insbeson<strong>de</strong>re im Sommer für<br />
belasten<strong>de</strong>s, schwüles Wetter sorgt und für zahlreiche Gewitter verantwortlich ist.
Köln liegt im Großraum <strong>de</strong>r Übergangszone vom gemäßigten Seeklima <strong>zu</strong>m Kontinentalklima mit mil<strong>de</strong>n Wintern (Januarmittel: 2,4 °C) und mäßig warmen Sommern (Julimittel: 18,3<br />
°C). Die mittleren Jahresnie<strong>de</strong>rschläge betragen 798 Millimeter und liegen damit im Deutschlandmittel, aber wesentlich höher als im westlich angrenzen<strong>de</strong>n Rhein-Erft-Kreis (Erftstadt-<br />
Bliesheim: 631) o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Zülpicher Bör<strong>de</strong> (Zülpich: 582), was bei Pendlern <strong>de</strong>n Eindruck eines „Regenlochs“ erweckt.[3] Laut Eurostat[4] war Köln mit 263 Regentagen (Be<strong>zu</strong>gsjahr<br />
2004) die europäische Stadt mit <strong>de</strong>n zweitmeisten Regentagen, 2001 dagegen lag Köln mit 206 im Mittelfeld von 40 <strong>de</strong>utschen Städten (Durchschnitt: 194 Regentage).[4][5] Nach<br />
<strong>de</strong>rselben Statistik waren 2004 Mönchengladbach, Moers und Trier dagegen mit 107 Regentagen die regenärmsten Städte Deutschlands.<br />
Geologie<br />
Köln liegt am Südrand <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rrheinischen Bucht <strong>zu</strong>m größten Teil im Bereich <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rterrassen, die vom Rhein aus terrassenartig leicht ansteigen. Der geologische Unterbau wird<br />
im Stadtgebiet aus bis <strong>zu</strong> 35 Meter mächtigen Ablagerungen <strong>de</strong>s Eiszeitalters (Quartär) gebil<strong>de</strong>t. Sie bestehen aus Kiesen und San<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Rhein-Maas-Systems. Ausläufer <strong>de</strong>s<br />
Rheinischen Braunkohlereviers reichen bis Köln-Kalk: Um 1860 wur<strong>de</strong> das Bergwerk Gewerkschaft Neu-Deutz gegrün<strong>de</strong>t. Auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> befin<strong>de</strong>t sich heute die Brauerei <strong>de</strong>r<br />
Gebrü<strong>de</strong>r Sünner, die das in <strong>de</strong>n Stollen eindringen<strong>de</strong> Grundwasser verwen<strong>de</strong>n konnte.[6] Im tieferen Untergrund folgen Schichten <strong>de</strong>s Tertiärs und <strong>de</strong>s Devons.<br />
Die Bo<strong>de</strong>nbeschaffenheit ist geprägt durch die fruchtbaren Bö<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Schwemmland-Ebene am Rhein. In <strong>de</strong>n westlichen Stadtteilen wer<strong>de</strong>n sie von Löss über<strong>de</strong>ckt, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong> ertragreichen,<br />
ackerbaulich genutzten Lehmbö<strong>de</strong>n (Parabrauner<strong>de</strong>n) verwittert ist. Sie sind oft mit fruchtbaren Kolluvien vergesellschaftet, die in Senken aus abgeschwemmtem Bo<strong>de</strong>nmaterial<br />
entstan<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r östlich anschließen<strong>de</strong>n Rheinebene, die durch verlan<strong>de</strong>te Altarme geglie<strong>de</strong>rt wird, lagerte <strong>de</strong>r Rhein <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r letzten Eiszeit sandige bis lehmige Sedimente ab.<br />
Daraus bil<strong>de</strong>ten sich ertragreiche Parabrauner<strong>de</strong>n und Brauner<strong>de</strong>n, die ebenfalls ackerbaulich genutzt wer<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r Rheinaue entstan<strong>de</strong>n durch periodische Überflutungen aus<br />
angeschwemmtem Bo<strong>de</strong>nmaterial fruchtbare Braune Auenbö<strong>de</strong>n. Der äußerste Osten <strong>de</strong>s Stadtgebietes zählt bereits <strong>zu</strong>m Sockel <strong>de</strong>s rheinischen Schiefergebirges. Hier sind geologisch<br />
ältere Terrassensan<strong>de</strong> und Flugsan<strong>de</strong> verbreitet, aus <strong>de</strong>nen meist ärmere Brauner<strong>de</strong>n, saure Podsol-Brauner<strong>de</strong>n und bei dichtem Untergrund auch staunasse Pseudogleye hervorgingen.<br />
Diese eher min<strong>de</strong>rwertigen Bö<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n als Hei<strong>de</strong>n beziehungsweise waldwirtschaftlich genutzt. An Bachläufen und in Rinnen bil<strong>de</strong>ten sich dort ebenso wie in <strong>de</strong>r Rheinaue<br />
Grundwasser beeinflusste Gleye. Die Verschie<strong>de</strong>nheiten in Mikroklima und Bo<strong>de</strong>nbeschaffenheit sind durch die große Fläche <strong>de</strong>r Stadt erklärbar.<br />
Durch tektonische Bewegungen <strong>de</strong>s Rheingraben-Bruchs[7] entstan<strong>de</strong>n um Köln ausgeprägte Gelän<strong>de</strong>kanten, wie etwa die Ville bei Frechen. Unmittelbar westlich davon schließt sich<br />
Deutschlands aktivste Erdbebenzone an, <strong>de</strong>ren Epizentrum im Kreis Düren liegt. Zur Erdbebenvorsorge wur<strong>de</strong> 2006 von <strong>de</strong>r Abteilung Erdbebengeologie <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong> Köln ein<br />
Messnetz mit 19 „Strong-motion“-Stationen zwischen Aachen, Bensberg, Meckenheim und Viersen installiert.[8] Mehrmals im Monat ereignen sich in <strong>de</strong>r Kölner Bucht Mikroerdbeben,<br />
die nicht wahrnehmbar sind, <strong>zu</strong>m Beispiel am 3. März 2010 um 16:45 Uhr (Stärke 1,6 nach <strong>de</strong>r Richterskala) in zehn Kilometer Tiefe bei Mützenich in <strong>de</strong>r Eifel.[9]<br />
Köln und <strong>de</strong>r Rhein<br />
Der Rhein, nach <strong>de</strong>m Austritt aus <strong>de</strong>m südlich von Köln gelegenen Schiefergebirge als Nie<strong>de</strong>rrhein bezeichnet, tritt bei Godorf in die Stadt ein und verlässt sie bei Worringen. Das<br />
Gefälle <strong>de</strong>s Rheins beträgt etwa 0,2 Promille. Sein aktueller Pegel lässt sich an <strong>de</strong>r Pegeluhr <strong>de</strong>s Pegel Köln ablesen. Der Normalpegel beträgt 3,48 Meter.<br />
Mehrfach war Köln von Hochwassern <strong>de</strong>s Rhein betroffen. Das schlimmste aufgezeichnete Hochwasser ereignete sich im Februar 1784, als nach <strong>de</strong>m extrem langen und kalten Winter<br />
1783/84 ein Temperatursprung einsetzte. Der Rhein war <strong>zu</strong> diesem Zeitpunkt fest <strong>zu</strong>gefroren und die Schneeschmelze sowie das aufbrechen<strong>de</strong> Eis sorgten für einen Rekordpegel von<br />
13,55 Meter. Die Fluten, auf <strong>de</strong>nen schwere Eisschollen trieben, verwüsteten weite Teile <strong>de</strong>r Uferbebauung und alle Schiffe. Einzelne Gebäu<strong>de</strong>, darunter auch Befestigungsbauten,<br />
stürzten aufgrund <strong>de</strong>s Schollengangs ein. 65 Tote waren <strong>zu</strong> beklagen. Die rechtsrheinisch gelegene bergische Kreisstadt Mülheim am Rhein, heute ein Kölner Stadtteil, wur<strong>de</strong> vollständig<br />
zerstört.<br />
Im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt erreichten die drei Jahrhun<strong>de</strong>rthochwasser von 1926, 1993 und 1995 Pegelstän<strong>de</strong> von bis <strong>zu</strong> 10,69 Meter. Seit 2005 wird ein Hochwasserschutzkonzept umgesetzt,<br />
das durch feste o<strong>de</strong>r mobile Wän<strong>de</strong> die Stadt bis <strong>zu</strong> einem Pegelstand von 11,90 Metern schützt. Mehrfach führte <strong>de</strong>r Rhein aber auch Niedrigwasser. Am 20. September 2003 um 8 Uhr<br />
erreichte <strong>de</strong>r Rhein am Pegel Köln die Marke von 0,80 Meter. Damit wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r niedrigste aufgezeichnete Wert aus <strong>de</strong>m Jahr 1947 unterschritten. Jedoch be<strong>de</strong>utet <strong>de</strong>r Pegel 0,00 Meter,<br />
dass die 150 Meter breite Fahrrinne in <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s Flusses noch 1 Meter Wassertiefe hat. Die Binnenschifffahrt musste starke Einschränkungen hinnehmen, wur<strong>de</strong> aber nicht wie auf<br />
<strong>de</strong>r Elbe ganz eingestellt.
Welche Wassermengen sich je nach Pegelstand durch die Stadt bewegen, macht folgen<strong>de</strong> Aufstellung <strong>de</strong>utlich: 0,80 m (niedrigster Wasserstand): 630 m³/s; 3,48 m (Normalwasserstand):<br />
2.000 m³/s; 6,20 m (Hochwassermarke I): 4.700 m³/s; 8,30 m (Hochwassermarke II): 7.200 m³/s; 10,0 m (Hochwasserschutz in Altstadt, Ro<strong>de</strong>nkirchen und Zündorf): 9,700 m³/s; 10,69<br />
m (Hochwasser im Januar 1995): 11.500 m³/s.<br />
Nachbargemein<strong>de</strong>n<br />
Köln ist Zentrum eines Ballungsraums, <strong>de</strong>r etwa zwei Millionen Einwohner umfasst. In <strong>de</strong>m geschlossenen Siedlungsraum grenzen folgen<strong>de</strong> Städte im Uhrzeigersinn, beginnend im<br />
Nordosten, unmittelbar an das Stadtgebiet an.<br />
Leverkusen (kreisfreie Stadt), Bergisch Gladbach und Rösrath (Rheinisch-Bergischer Kreis), Troisdorf und Nie<strong>de</strong>rkassel (Rhein-Sieg-Kreis), Wesseling, Brühl, Hürth, Frechen und<br />
Pulheim (alle Rhein-Erft-Kreis), Dormagen (Rhein-Kreis Neuss) und Monheim (Kreis Mettmann).<br />
Die Stadt Wesseling war <strong>zu</strong>m 1. Januar 1975 nach Köln eingemein<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n, erhielt aber nach einem Gerichtsentscheid bereits am 1. Juli 1976 ihre Selbständigkeit <strong>zu</strong>rück.<br />
Stadtglie<strong>de</strong>rung<br />
Die Stadt Köln glie<strong>de</strong>rt sich in 86 Stadtteile, die <strong>zu</strong> neun Stadtbezirken <strong>zu</strong>sammengefasst sind. Die Stadt Köln nummeriert die Stadtbezirke von 1 - 9 und die Stadtteile von 101 - 105,<br />
201 - 213, 301 - 309, 401 - 406, 501 - 507, 601 - 612, 701 - 716, 801 - 809 und von 901 - 909, wobei <strong>de</strong>r Hun<strong>de</strong>rter <strong>de</strong>r Nummer <strong>de</strong>s Stadtbezirks entspricht.<br />
Innerhalb <strong>de</strong>r Stadtteile unterschei<strong>de</strong>n die Kölner in <strong>de</strong>r Regel noch zwischen verschie<strong>de</strong>nen „Vee<strong>de</strong>ln“ (Kölsch für Stadtviertel), <strong>de</strong>ren Bewohner häufig an dörfliche Gemeinschaften<br />
erinnern<strong>de</strong> soziale Bindungen und Kontakte pflegen. Das Amt für Stadtentwicklung und Statistik hat für Köln 365 Stadtviertel <strong>de</strong>finiert, die Grenzen und Benennungen <strong>de</strong>r Viertel<br />
schwanken jedoch je nach Sichtweise <strong>de</strong>r Einwohner teils erheblich.<br />
Innenstadt (Stadtbezirk 1)<br />
Altstadt-Süd 101, Neustadt-Süd 102, Altstadt-Nord 103, Neustadt-Nord 104, Deutz 105<br />
Ro<strong>de</strong>nkirchen (Stadtbezirk 2)<br />
Bayenthal 201, Marienburg 202, Ra<strong>de</strong>rberg 203, Ra<strong>de</strong>rthal 204, Zollstock 205, Rondorf 206, Hahnwald 207, Ro<strong>de</strong>nkirchen 208, Weiß 209, Sürth 210, Godorf 211, Immendorf<br />
212, Meschenich 213<br />
Lin<strong>de</strong>nthal (Stadtbezirk 3)<br />
Klettenberg 301, Sülz 302, Lin<strong>de</strong>nthal 303, Braunsfeld 304, Müngersdorf 305, Junkersdorf 306, Wei<strong>de</strong>n 307, Lövenich 308, Wid<strong>de</strong>rsdorf 309<br />
Ehrenfeld (Stadtbezirk 4)<br />
Ehrenfeld 401, Neuehrenfeld 402, Bickendorf 403, Vogelsang 404, Bocklemünd/Mengenich 405, Ossendorf 406<br />
Nippes (Stadtbezirk 5)<br />
Nippes 501, Mauenheim 502, Riehl 503, Niehl 504, Wei<strong>de</strong>npesch 505, Longerich 506, Bil<strong>de</strong>rstöckchen 507<br />
Chorweiler (Stadtbezirk 6)<br />
Merkenich 601, Fühlingen 602, Seeberg 603, Heimersdorf 604, Lindweiler 605, Pesch 606, Esch/Auweiler 607, Volkhoven/Weiler 608, Chorweiler 609, Blumenberg 610,<br />
Roggendorf/Thenhoven 611, Worringen 612
Porz (Stadtbezirk 7)<br />
Poll 701, Westhoven 702, Ensen 703, Gremberghoven 704, Eil 705, Porz 706, Urbach 707, Elsdorf 708, Grengel 709, Wahnhei<strong>de</strong> 710, Wahn 711, Lind 712, Libur 713, Zündorf<br />
714, Langel 715, Finkenberg 716,<br />
Kalk (Stadtbezirk 8)<br />
Humboldt/Gremberg 801, Kalk 802, Vingst 803, Höhenberg 804, Ostheim 805, Merheim 806, Brück 807, Rath/Heumar 808, Neubrück 809<br />
Mülheim (Stadtbezirk 9)<br />
Mülheim 901, Buchforst 902, Buchheim 903, Holwei<strong>de</strong> 904, Dellbrück 905, Höhenhaus 906, Dünnwald 907, Stammheim 908, Flittard 909<br />
63,4 Prozent aller Einwohner <strong>de</strong>r Stadt Köln wohnen linksrheinisch (Stand: 2006).[10]<br />
Flora und Fauna<br />
Köln verfügt über ausge<strong>de</strong>hnte Grünflächen, die im städtischen Bereich als Parks gestaltet, in <strong>de</strong>n Außenbezirken <strong>zu</strong>meist bewirtschaftete Forste sind. Daneben existieren in Köln 22<br />
Naturschutzgebiete, beispielsweise <strong>de</strong>r Worringer Bruch im äußersten linksrheinischen Nor<strong>de</strong>n Kölns, ein ehemaliger, heute verlan<strong>de</strong>ter Seitenarm <strong>de</strong>s Rheins. Er bietet eine Heimat für<br />
seltene Tier- und Pflanzenarten und eine charakteristische Auen- und Waldlandschaft. Rechtsrheinisch fin<strong>de</strong>n sich hauptsächlich offene Wald- und Hei<strong>de</strong>landschaften wie beispielsweise<br />
die Wahner Hei<strong>de</strong>, das Naturschutzgebiet Königsforst und <strong>de</strong>r Dünnwal<strong>de</strong>r Wald.<br />
Die Fauna weist eine sehr hohe Zahl an Kulturfolgern auf. Neben Tauben, Mäusen und Ratten, die allgegenwärtig sind und lokal bereits als Plage wahrgenommen wer<strong>de</strong>n, sind auch<br />
Rotfüchse in be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Zahl in das Stadtgebiet eingewan<strong>de</strong>rt. Sie sind mittlerweile selbst in <strong>de</strong>r Innenstadt <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n, wo sie Kleingärten und Parks als Revier nutzen.<br />
In <strong>de</strong>n Kölner Grünanlagen haben sich, begünstigt durch das mil<strong>de</strong> Klima, diverse nicht einheimische Tiere angesie<strong>de</strong>lt. Größere Populationen von Halsbandsittichen und <strong>de</strong>m Großen<br />
Alexan<strong>de</strong>rsittich leben, unter an<strong>de</strong>rem, auf <strong>de</strong>m Melaten-Friedhof und <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Riehler Heimstätten. Ursprünglich aus asiatischen Bergregionen (Indien, Afghanistan) für die<br />
Zoo- und Wohnungshaltung nach Deutschland eingeführt, haben sich diese Papageien/Sittiche als Neozoen etabliert. Die Angaben über die Größe <strong>de</strong>r Populationen reichen von einigen<br />
100 Exemplaren bis <strong>zu</strong> über 1000 Individuen. Die Volkshochschule und einige ornithologische Vereine bieten gelegentlich Führungen <strong>zu</strong> Bäumen mit Papageienkolonien an. Die<br />
Existenz <strong>de</strong>r „Einwan<strong>de</strong>rer“ ist in<strong>de</strong>s nicht unumstritten, da diese als Konkurrenz <strong>de</strong>r „einheimischen“ Tierwelt bezüglich <strong>de</strong>s Nahrungsangebotes und <strong>de</strong>r Nistmöglichkeiten angesehen<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Geschichte<br />
Der Name Köln, <strong>zu</strong>r Römerzeit Colonia Claudia Ara Agrippinensium (CCAA), geht auf die römische Kaiserin Agrippina <strong>zu</strong>rück. Die Gattin von Claudius war am Rhein geboren und<br />
ließ das Oppidum Ubiorum (Ubiersiedlung) im Jahre 50 n. Chr. <strong>zu</strong>r Stadt erheben.[11] In <strong>de</strong>r Römerzeit war es Statthaltersitz <strong>de</strong>r Provinz Germania Inferior. Um 80 n. Chr. erhielt Köln<br />
mit <strong>de</strong>r Eifelwasserleitung einen <strong>de</strong>r längsten römischen Aquädukte überhaupt. Aus <strong>de</strong>m lateinischen Colonia, das in <strong>de</strong>n meisten romanischen und einer größeren Zahl an<strong>de</strong>rer Sprachen<br />
weiterhin als Name für Köln fungiert (beispielsweise italienisch und spanisch Colonia, portugiesisch Colônia, katalanisch Colònia, polnisch Kolonia, türkisch Kolonya, arabisch اينولوك<br />
beziehungsweise Kulunia; nie<strong>de</strong>rländisch Keulen) entwickelte sich über Coellen, Cöllen, Cölln und Cöln <strong>de</strong>r heutige Name Köln (siehe Abschnitt französische und preußische<br />
Herrschaft).<br />
Frühmittelalter<br />
Auch im Frühmittelalter war Köln eine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Stadt. Um das Jahr 455 eroberten die Franken die <strong>zu</strong>vor römische Stadt. Bis Anfang <strong>de</strong>s 6. Jahrhun<strong>de</strong>rts war Köln Hauptort eines<br />
selbständigen fränkischen Teilkönigreiches, ging anschließend im Reich Chlodwigs I. auf, bewahrte sich aber starke Eigenständigkeit im Gebiet <strong>de</strong>r Ripuarier. Die romanische<br />
Bevölkerung lebte lange Zeit parallel <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n fränkischen Eroberern in <strong>de</strong>r Stadt. Im Laufe <strong>de</strong>s 6. bis 8. Jahrhun<strong>de</strong>rts kam es <strong>zu</strong> einer vollständigen Akkulturation zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n
Bevölkerungsteilen. Die wechselseitige Beeinflussung <strong>de</strong>r fränkischen und lateinischen Dialekte ist anhand von Quellen nachweisbar. Die Franken übernahmen rasch kulturelle<br />
Errungenschaften <strong>de</strong>r römischen Stadtbevölkerung, <strong>zu</strong>m Beispiel im Bereich <strong>de</strong>r Bautechnik o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Glasherstellung. Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Merowingerzeit war Köln Resi<strong>de</strong>nzstadt.<br />
Spätestens ab karolingischer Zeit war <strong>de</strong>r Bischof beziehungsweise Erzbischof von Köln eine <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Personen im Reich.<br />
Unter <strong>de</strong>n Ottonen spielte Köln eine wichtige Rolle bei <strong>de</strong>r Annäherung <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches <strong>de</strong>utscher Nation an das Byzantinische Reich, seit die Kaiserin Theophanu,<br />
gebürtige Griechin und Gattin Ottos II., dort als Reichsverweserin residierte. Ab <strong>de</strong>m 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt setzte eine Serie von Stiftsgründungen ein, die <strong>de</strong>n romanischen Kirchenbau<br />
einläuteten. In <strong>de</strong>r Folge errang Köln unter <strong>de</strong>r Führung be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r, auch politisch versierter Erzbischöfe einen unangefochtenen Rang als geistliches Zentrum. Der Erzbischof von<br />
Köln war auch Kurfürst <strong>de</strong>s Mitte <strong>de</strong>s 10. Jahrhun<strong>de</strong>rts gegrün<strong>de</strong>ten Erzstiftes und Kurfürstentums Köln. Die Überführung <strong>de</strong>r Gebeine <strong>de</strong>r Heiligen drei Könige (siehe<br />
Dreikönigenschrein) von Mailand nach Köln durch <strong>de</strong>n Erzbischof Rainald von Dassel im Jahr 1164 machte die Stadt <strong>zu</strong> einem wichtigen Ziel für Pilger.<br />
Größte Stadt im mittelalterlichen Deutschland<br />
Köln wur<strong>de</strong> im Hochmittelalter größte Stadt Deutschlands, so dass die Stadtbefestigungen mehrfach erweitert wer<strong>de</strong>n mussten: Ab <strong>de</strong>m Jahre 1180 (Urkun<strong>de</strong>n vom 27. Juli und 18.<br />
August 1180) wur<strong>de</strong> die damals weiträumigste Stadtmauer Deutschlands mit 12 Toren und 52 Mauertürmen in <strong>de</strong>r Ringmauer und mehr als 16 Toren und Pforten in <strong>de</strong>r Rheinmauer<br />
gebaut und etwa 1225 fertig gestellt. Sie war gewaltiger als die fast <strong>zu</strong>r gleichen Zeit errichtete Mauer König Philipps II. Augustus in Paris. Die zwölf Tore (sieben gewaltige<br />
Doppelturmtorburgen, davon erhalten Eigelsteintor und Hahnentor, drei riesige Turmtorburgen, davon erhalten das Severinstor, und zwei kleinere Doppelturmpforten, siehe Ulrepforte) –<br />
in die halbkreisförmige Stadtmauer integriert – sollten an das himmlische Jerusalem erinnern.<br />
Seit <strong>de</strong>m 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt führte Köln neben Jerusalem, Konstantinopel und Rom die Bezeichnung Sancta im Stadtnamen: Sancta Colonia Dei Gratia Romanae Ecclesiae Fi<strong>de</strong>lis Filia –<br />
Heiliges Köln von Gottes Gna<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r römischen Kirche getreue Tochter. Der Name Dat hillige Coellen o<strong>de</strong>r die hillige Stat van Coellen war ein Begriff dieser Zeit. Es wur<strong>de</strong><br />
beschlossen, ein unerreicht großes und beeindrucken<strong>de</strong>s Gotteshaus <strong>zu</strong> errichten, um <strong>de</strong>n Reliquien einen angemessenen Rahmen <strong>zu</strong> geben. Die Grundsteinlegung <strong>de</strong>s Kölner Domes<br />
erfolgte 1248.<br />
Spätmittelalterliches Köln<br />
Am 7. Mai 1259 erhielt Köln das Stapelrecht, das <strong>de</strong>n Kölner Bürgern ein Vorkaufsrecht aller auf <strong>de</strong>m Rhein transportierten Waren sicherte und so <strong>zu</strong>m Wohlstand <strong>de</strong>r Kölner<br />
Bürgerschaft beitrug. Die jahrelangen Kämpfe <strong>de</strong>r Kölner Erzbischöfe mit <strong>de</strong>n Patriziern en<strong>de</strong>ten 1288 vorläufig durch die Schlacht von Worringen, bei <strong>de</strong>r das Heer <strong>de</strong>s Erzbischofs<br />
gegen das <strong>de</strong>s Grafen Adolf V. von Berg und <strong>de</strong>r Kölner Bürger unterlag. Fortan gehörte die Stadt nicht mehr <strong>zu</strong>m Erzstift, und <strong>de</strong>r Erzbischof durfte sie nur noch <strong>zu</strong> religiösen<br />
Handlungen betreten. Die offizielle Erhebung <strong>zu</strong>r Freien Reichsstadt dauerte allerdings noch bis 1475. Die Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen <strong>de</strong>m patrizischen Rat und <strong>de</strong>n nicht im Rat<br />
vertretenen Zünften führte am 20. November 1371 <strong>zu</strong>m blutigen Kölner Weberaufstand.<br />
1396 wur<strong>de</strong> durch eine unblutige Revolution die Patrizierherrschaft in Köln endgültig been<strong>de</strong>t. An ihre Stelle trat eine ständische Verfassung, die sich auf die Organisation <strong>de</strong>r Gaffeln<br />
stützt. Vorausgegangen war eine Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng innerhalb <strong>de</strong>s kölnischen Patriziats, bei <strong>de</strong>m die Partei <strong>de</strong>r Greifen mit ihrem Führer Hilger Quattermart von <strong>de</strong>r Partei <strong>de</strong>r Freun<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s Konstantin von Lyskirchen entmachtet wur<strong>de</strong>. Hilger Quattermarts Verwandter Heinrich von Stave wur<strong>de</strong> am 11. Januar 1396 auf <strong>de</strong>m Neumarkt hingerichtet, viele <strong>de</strong>r Greifen<br />
wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> lebenslanger Kerkerhaft verurteilt.<br />
Am 18. Juni 1396 versuchte Konstantin von Lyskirchen, alte patrizische Rechte wie<strong>de</strong>rher<strong>zu</strong>stellen. Die dagegen protestieren<strong>de</strong>n Handwerker- und Kaufleutezünfte wur<strong>de</strong>n von ihm<br />
„vom hohen Ross herab“ nach Hause geschickt. Daraufhin nahmen die Zünfte die Freun<strong>de</strong> in ihrem Versammlungsraum gefangen. Die Greifen wur<strong>de</strong>n befreit. Am 24. Juni 1396 trat ein<br />
48-köpfiger, provisorischer Rat aus Kaufleuten, Grundbesitzern und Handwerkern <strong>zu</strong>sammen.<br />
Der Stadtschreiber Gerlach von Hauwe formulierte daraufhin <strong>de</strong>n so genannten Verbundbrief, <strong>de</strong>r am 14. September 1396 von <strong>de</strong>n 22 so genannten Gaffeln unterzeichnet und in Kraft<br />
gesetzt wur<strong>de</strong>. Die Gaffeln sind heterogen <strong>zu</strong>sammengesetzt, in ihnen sind die entmachteten Patrizier, Ämter, Zünfte und Einzelpersonen <strong>zu</strong>sammengefasst, nicht aber die zahlenmäßig<br />
sehr starke Geistlichkeit; je<strong>de</strong>r kölnische Bürger musste einer <strong>de</strong>r Gaffeln beitreten. Der Verbundbrief konstituierte einen 49-köpfigen Rat, mit 36 Ratsherren aus <strong>de</strong>n Gaffeln und 13<br />
Gebrechtsherren, die berufen wur<strong>de</strong>n. Der Verbundbrief blieb bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Freien Reichsstadt 1794 in Kraft.
Frühe Neuzeit<br />
Ab 1500 gehörte Köln <strong>zu</strong>m neu geschaffenen Nie<strong>de</strong>rrheinisch-Westfälischen Reichskreis, ab 1512 <strong>zu</strong>m neu geschaffenen Kurrheinischen Reichskreis. 1582 sagte <strong>de</strong>r Kölner Erzbischof<br />
Gebhard Truchsess von Waldburg sich von <strong>de</strong>r katholischen Kirche los und heiratete die protestantische Stiftsdame Agnes von Mansfeld. Er wur<strong>de</strong> daraufhin von Papst Gregor XIII.<br />
exkommuniziert und <strong>de</strong>r verlässliche katholische Ernst von Bayern wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong> seinem Nachfolger bestimmt – unter an<strong>de</strong>ren, weil ein protestantischer Kölner Erzbischof die katholische<br />
Mehrheit im Kurfürstenkollegium gekippt hätte. Es kam <strong>zu</strong>m Truchsessischen Krieg (auch Kölner Krieg), <strong>de</strong>r von 1583 bis 1588 dauerte und in <strong>de</strong>ssen Verlauf Deutz, Bonn und Neuss<br />
verwüstet wur<strong>de</strong>n. Der Krieg gab in seiner Zerstörungskraft einen Vorgeschmack auf die kommen<strong>de</strong>n konfessionellen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen in Deutschland.<br />
Der Dreißigjährige Krieg ließ die Stadt aber unversehrt. Dies lag <strong>zu</strong>m Teil daran, dass sich die Stadt durch Geldzahlungen an heranziehen<strong>de</strong> Truppen von Belagerungen und Eroberungen<br />
freikaufte. Köln verdiente an <strong>de</strong>m Krieg durch Waffenproduktion und -han<strong>de</strong>l prächtig.<br />
Französische und preußische Herrschaft<br />
Mit <strong>de</strong>m Ein<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r französischen Truppen am 6. Oktober 1794 während <strong>de</strong>r Koalitionskriege en<strong>de</strong>te die Geschichte <strong>de</strong>r freien Reichsstadt. Die Stadt, die versucht hatte, neutral <strong>zu</strong><br />
bleiben, wur<strong>de</strong> kampflos an <strong>de</strong>n Befehlshaber <strong>de</strong>s linken Flügels <strong>de</strong>r Rheinarmee, Jean-Étienne Championnet übergeben.[12] Wie das gesamte linksrheinische Gebiet wur<strong>de</strong> die Stadt<br />
Bestandteil <strong>de</strong>r französischen Republik und 1798 in das Département <strong>de</strong> la Roer eingeglie<strong>de</strong>rt, <strong>de</strong>ssen Hauptstadt nicht Köln son<strong>de</strong>rn Aachen wur<strong>de</strong>. Köln wur<strong>de</strong> nur Sitz eines<br />
Unterpräfekten <strong>de</strong>s Arrondissement <strong>de</strong> Cologne. Viele Kölner Bürger begrüßten die französischen Revolutionstruppen als Befreier, am Neumarkt wur<strong>de</strong> ein Freiheitsbaum errichtet. Die<br />
bis dahin benachteiligten Ju<strong>de</strong>n und protestantischen Christen wur<strong>de</strong>n gleichgestellt. Trotz <strong>de</strong>r oft drücken<strong>de</strong>n Kontributionen blieben die Bürger loyal <strong>zu</strong>m Kaiserreich Napoleons. Bei<br />
seinem Besuch <strong>de</strong>r Stadt als eine <strong>de</strong>r „bonnes villes“ Deutschlands am 13. September 1804 wur<strong>de</strong> er begeistert empfangen. Nach <strong>de</strong>n Befreiungskriegen wur<strong>de</strong> die Stadt Köln und das<br />
Rheinland in Folge <strong>de</strong>s Wiener Kongresses 1815 Teil <strong>de</strong>s Königreichs Preußen.<br />
Mit <strong>de</strong>r Anglie<strong>de</strong>rung an Preußen gewann nationalistisches Denken <strong>zu</strong>nehmend an Be<strong>de</strong>utung. Die liberalen Französischen Gesetze wie <strong>de</strong>r Co<strong>de</strong> civil blieben jedoch in Kraft. Der Name<br />
<strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> aber sofort „germanisiert“. Der preußische Innenminister bestimmte aber 1900 durch einen Erlass, hinter <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r König und Deutsche Kaiser Wilhelm II. stand, dass die<br />
Stadt fortan nur mit C geschrieben wer<strong>de</strong>n durfte. Die liberalen Zeitungen, wie die Kölnische Zeitung, hielten sich allerdings nicht daran. Nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Kaiserreichs 1918<br />
verkün<strong>de</strong>te das Städtische Nachrichtenamt unter <strong>de</strong>m Oberbürgermeister Konrad A<strong>de</strong>nauer am 1. Februar 1919: „Der Städtenamen Köln wird von jetzt an im Bereich <strong>de</strong>r städtischen<br />
Verwaltung wie<strong>de</strong>r mit K geschrieben“.[13]<br />
Köln wur<strong>de</strong> nicht <strong>zu</strong>letzt wegen <strong>de</strong>s Engagements <strong>de</strong>r Kölner Bankhäuser im Laufe <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Jahrzehnte nach Berlin <strong>zu</strong>r wichtigsten Stadt in Preußen. Im Jahre 1880 wur<strong>de</strong> nach<br />
632 Jahren auf Betreiben <strong>de</strong>s Königs von Preußen und <strong>de</strong>utschen Kaisers <strong>de</strong>r Bau <strong>de</strong>s Kölner Doms abgeschlossen – <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st vorübergehend, <strong>de</strong>nn auch heute noch sind<br />
Reparaturarbeiten wegen <strong>de</strong>r Schä<strong>de</strong>n in Folge <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieg und Umwelteinflüssen erfor<strong>de</strong>rlich. Weil diese Arbeiten vermutlich nie abgeschlossen sein wer<strong>de</strong>n, wird <strong>de</strong>r Dom<br />
auch als die „ewige Baustelle“ bezeichnet, was Heinrich Heine schon 1844 persiflierte: „Er ward nicht vollen<strong>de</strong>t – und das ist gut. – Denn eben die Nichtvollendung – Macht ihn <strong>zu</strong>m<br />
Denkmal von Deutschlands Kraft – Und protestantischer Sendung.“<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong> die Stadt durch Kauf und Schleifung <strong>de</strong>r Stadtmauer, Wälle und Bastionen in <strong>de</strong>n Festungsrayon erweitert. Begrenzt wur<strong>de</strong> die Stadt durch <strong>de</strong>n<br />
Festungsring Köln. Die Besiedlung <strong>de</strong>r Neustadt (Köln-Neustadt-Nord, Köln-Neustadt-Süd) stellte <strong>de</strong>n Kontakt <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n schnell wachsen<strong>de</strong>n Umlandgemein<strong>de</strong>n her und schuf die<br />
Vorausset<strong>zu</strong>ng für <strong>de</strong>ren Eingemeindungen. Vom Abriss <strong>de</strong>r alten Stadtmauer blieben nur wenige exemplarische Bauwerke aufgrund einer Intervention <strong>de</strong>s preußischen<br />
Kulturministeriums verschont.<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Am 28. September 1917 wur<strong>de</strong> Konrad A<strong>de</strong>nauer erstmals <strong>zu</strong>m Kölner Oberbürgermeister gewählt. In seine Amtszeit fallen unter an<strong>de</strong>rem am 5. Oktober 1925 die Anerkennung <strong>de</strong>r<br />
größten Musikhochschule Deutschlands o<strong>de</strong>r am 18. Oktober 1929 die Ansiedlung <strong>de</strong>r Ford-Werke als größtem Kölner Arbeitgeber. A<strong>de</strong>nauer musste nach <strong>de</strong>r Machtergreifung <strong>de</strong>r<br />
Nationalsozialisten Köln am 13. März 1933 verlassen.
Köln in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus<br />
Im Zweiten Weltkrieg fielen am 18. Juni 1940 auf Köln die ersten Bomben, ab 1942 wur<strong>de</strong> das Bombar<strong>de</strong>ment durch die britische Luftwaffe intensiviert. Am 29. Juni 1943 wur<strong>de</strong> die<br />
Stadt durch britische (nachts) und amerikanische (tagsüber) Flächenbombar<strong>de</strong>ments <strong>zu</strong> über 90 Prozent zerstört; dabei wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kölner Dom schwer beschädigt. Die Bombar<strong>de</strong>ments<br />
dauerten bis <strong>zu</strong>m 2. März 1945 (siehe auch Operation Millennium). Die Einwohnerzahl sank von ehemals 800.000 bis <strong>zu</strong>m Kriegsen<strong>de</strong> auf rund 104.000 Einwohner (42.000<br />
linksrheinisch am 4. April 1945, 62.000 rechtsrheinisch am 5. Mai 1945; 490.000 bei <strong>de</strong>r ersten Volkszählung nach <strong>de</strong>m Krieg am 29. Oktober 1946), die nach <strong>de</strong>m Einmarsch <strong>de</strong>r<br />
amerikanischen Truppen am 4. März 1945 registriert wur<strong>de</strong>n.[14] Von Januar bis März 1945 wur<strong>de</strong>n in Köln 1800 in- und ausländische Wi<strong>de</strong>rstandskämpfer im Zuge <strong>de</strong>r<br />
Endphaseverbrechen von <strong>de</strong>n Nationalsozialisten ermor<strong>de</strong>t.<br />
Köln nach <strong>de</strong>m Krieg<br />
Erst 1959 erlangte Köln wie<strong>de</strong>r die Einwohnerzahl <strong>de</strong>r Vorkriegszeit.<br />
Im Jahr 1975 überschritt Köln durch eine Gebietsreform, das Köln-Gesetz, für einige Zeit die Einwohnerzahl von einer Million und war neben Berlin, Hamburg und München die vierte<br />
Millionenstadt Deutschlands. Seit <strong>de</strong>r Ausglie<strong>de</strong>rung Wesselings 1976 liegt die Einwohnerzahl jedoch wie<strong>de</strong>r unter <strong>de</strong>r Millionengrenze.<br />
Bis auf Deutz gehörten die rechtsrheinischen Stadtbezirke Kölns bis 1802 <strong>zu</strong>m Herzogtum Berg; sie waren daher überwiegend reformierter Konfession. Die heutige Altstadt bil<strong>de</strong>te die<br />
freie Reichsstadt Köln, die übrigen Stadtbezirke waren Teil <strong>de</strong>s Kurfürstlichen Erzstifts Köln. Bei<strong>de</strong> blieben katholisch.<br />
Religionen<br />
Historisch ist Köln wie das gesamte Rheinland, abgesehen vom Bergischen Land, katholisch geprägt; so sind circa 41,6 Prozent <strong>de</strong>r Einwohner katholisch, 17,5 Prozent evangelisch, 10<br />
Prozent muslimisch, die restlichen knapp 30 Prozent Anhänger an<strong>de</strong>rer o<strong>de</strong>r ohne Religion.<br />
Christentum<br />
Spätestens seit <strong>de</strong>m Jahr 313 ist Köln Bischofssitz (Erzbistum Köln). Die Bischofskirche dieser Zeit ist nicht bekannt. Der Kölner Dom gilt erst seit <strong>de</strong>r Gotik als das prägen<strong>de</strong><br />
Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt. Die romanische Kirche <strong>de</strong>s Benediktinerklosters Groß St. Martin und <strong>de</strong>r Rathausturm bestimmten bis <strong>zu</strong>r Fertigstellung <strong>de</strong>s Domes im <strong>de</strong>utschen Kaiserreich die<br />
Silhouette <strong>de</strong>r Stadt maßgeblich mit.<br />
Köln hatte nach <strong>de</strong>r Überführung <strong>de</strong>r mutmaßlichen Gebeine <strong>de</strong>r Heiligen Drei Könige (<strong>de</strong>r Weisen aus <strong>de</strong>m Morgenland) am 23. Juli 1164 schnell <strong>de</strong>n Rang als einer <strong>de</strong>r wichtigsten<br />
Wallfahrtsorte im Heiligen Römischen Reich <strong>de</strong>utscher Nation inne. Die erste Reise <strong>de</strong>r frisch gekrönten Kaiser und Könige führte von Aachen an <strong>de</strong>n Schrein <strong>de</strong>r Heiligen Drei Könige.<br />
Die Pilgermassen brachten viel Geld mit in die Stadt, was <strong>zu</strong> einer verstärkten Ansiedlung und einem sprunghaften Anstieg <strong>de</strong>r Stadtbevölkerung führte.<br />
Der Erzbischof Philipp I. von Heinsberg ließ einen kostbaren vergol<strong>de</strong>ten Schrein für die Gebeine anfertigen. Seine Nachfolger ließen ab 1248 einen neuen Dom bauen, <strong>de</strong>ssen<br />
Errichtung aufgrund von Streitigkeiten mit <strong>de</strong>m Stadtrat und <strong>de</strong>r darauf folgen<strong>de</strong>n Vertreibung <strong>de</strong>s Fürstbischofs aus Köln immer langsamer voran ging und schließlich völlig <strong>zu</strong>m<br />
Erliegen kam (siehe auch Kölner Dom).<br />
In Köln entwickelte sich im Mittelalter <strong>zu</strong> einem Zentrum <strong>de</strong>s Reliquienhan<strong>de</strong>ls, da die mittelalterlichen Menschen hofften, durch <strong>de</strong>n Besitz eines heiligen Gegenstan<strong>de</strong>s o<strong>de</strong>r Knochen<br />
einer o<strong>de</strong>r eines Heiligen <strong>de</strong>r Erlösung näher <strong>zu</strong> kommen. Diese Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Stadt brachte ihr <strong>de</strong>n Namen „heiliges Köln“ ein.<br />
Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Religion zeigt sich auch im Stadtwappen, auf <strong>de</strong>m die drei Kronen <strong>de</strong>r Heiligen Drei Könige und die elf Flammen <strong>de</strong>r heiligen Ursula von Köln und ihrer<br />
Gefährtinnen, die in Köln <strong>de</strong>n Märtyrertod erlitten haben sollen, dargestellt sind.<br />
Einer <strong>de</strong>r zahlreichen Höhepunkte <strong>de</strong>s „heiligen Kölns“ in <strong>de</strong>r jahrtausen<strong>de</strong>langen christlichen beziehungsweise katholischen Geschichte Kölns war <strong>de</strong>r 20. Weltjugendtag vom 15.<br />
August bis 21. August 2005. Rund 26.000 Freiwillige aus 160 Staaten begrüßten Gäste aus 196 Staaten in <strong>de</strong>n Städten Köln, Bonn und Düsseldorf. Zu diesem Großereignis <strong>de</strong>r „jungen
katholischen Kirche“ waren bis <strong>zu</strong>r Abschlussmesse auf <strong>de</strong>m Marienfeld, einem stillgelegten Tagebau nahe <strong>de</strong>m Vorort Frechen, über 1.000.000 Menschen im Kölner Großraum. Papst<br />
Benedikt XVI. unternahm <strong>zu</strong> diesem Anlass seine erste Pontifikalreise nach seiner Amtseinführung und besuchte die Stadt vom 18. August bis 21. August. Bei dieser Gelegenheit<br />
bestätigte er <strong>de</strong>n Titel „heiliges Köln“.<br />
Köln war vom 6. bis 10. Juni 2007 <strong>zu</strong>m zweiten Mal nach 1965 Gastgeberin für <strong>de</strong>n 31. Deutschen Evangelischen Kirchentag mit etwa 160.000 Teilnehmern. Der Evangelische<br />
Kirchenkreis Köln und Region umfasst 299.000 Protestanten gegenüber 420.000 Katholiken allein im Stadtkreis.<br />
Wallfahrtsorte<br />
Für die Stadt Köln haben neben <strong>de</strong>n Heiligen drei Königen und <strong>de</strong>r Heiligen Ursula und ihren Gefährtinnen auch <strong>de</strong>r heilige Albertus Magnus in St. Andreas und die heilige Edith Stein<br />
(Theresia Benedicta a Cruce) eine von <strong>de</strong>n Nationalsozialisten ermor<strong>de</strong>te Philosophin und Or<strong>de</strong>nsfrau, eine Be<strong>de</strong>utung für die Wallfahrt. Da<strong>zu</strong> kommen noch:<br />
• <strong>de</strong>r selige Adolph Kolping, „Gesellenvater“, in <strong>de</strong>r Minoritenkirche<br />
• <strong>de</strong>r selige Johannes Duns Scotus, ein wichtiger Philosoph, ebenfalls in <strong>de</strong>r Minoritenkirche<br />
• die Schwarze Mutter Gottes in <strong>de</strong>r Kirche St. Maria in <strong>de</strong>r Kupfergasse<br />
• die Märtyrerbrü<strong>de</strong>r Ewaldi in <strong>de</strong>r Basilika St. Kunibert.<br />
Ju<strong>de</strong>ntum<br />
Die jüdische Gemein<strong>de</strong> in Köln ist die älteste nördlich <strong>de</strong>r Alpen.[15] Sie bestand schon 321 <strong>zu</strong>r Zeit von Kaiser Konstantin. Demnach muss es auch eine ältere Kölner Synagoge<br />
gegeben haben.<br />
1183 wies <strong>de</strong>r Erzbischof <strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n ein eigenes Gebiet <strong>zu</strong>, in <strong>de</strong>m sie einigermaßen in Frie<strong>de</strong>n leben konnten. Dieses Viertel in <strong>de</strong>r Altstadt, das mit eigenen Toren geschlossen wer<strong>de</strong>n<br />
konnte, war umrissen von <strong>de</strong>r Portalgasse, <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>ngasse, Unter Goldschmied und Obenmarspforten. Es war ausschließlich <strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n vorbehalten. Hiermit war das erste Ghetto in Köln<br />
geschaffen. Die Mikwe aus dieser Zeit ist unter einer Glaspyrami<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>m Rathausvorplatz in <strong>de</strong>r Altstadt <strong>zu</strong> besichtigen.<br />
In <strong>de</strong>r Bartholomäusnacht 1349 kam es <strong>zu</strong> einem Pogrom,[16] <strong>de</strong>r als „Ju<strong>de</strong>nschlacht“ in die Stadtgeschichte einging. Ein aufgebrachter Mob drang in das Ju<strong>de</strong>nviertel ein und ermor<strong>de</strong>te<br />
die meisten Bewohner. In dieser Nacht vergrub eine Familie hier ihr Hab und Gut. Der Münzschatz wur<strong>de</strong> bei Ausgrabungen 1954 ent<strong>de</strong>ckt und ist im Stadtmuseum ausgestellt. 1424<br />
wur<strong>de</strong>n die Ju<strong>de</strong>n „auf alle Ewigkeit“ aus <strong>de</strong>r Stadt verbannt.[16] Zwischen 1424 und <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts durfte sich ohne Erlaubnis <strong>de</strong>s Kölner Rats kein Ju<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Stadt<br />
aufhalten. Nach <strong>de</strong>m Ein<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r französischen Revolutionsarmee wur<strong>de</strong>n die jüdischen Bürger, wie auch die protestantischen, <strong>de</strong>n katholischen Bürgern gleichgestellt. Erst 1801<br />
entstand unter französischer Verwaltung eine neue jüdische Gemein<strong>de</strong>.[17]<br />
Bis 1933 lebten wie<strong>de</strong>r rund 18.000 Ju<strong>de</strong>n in Köln. Sie hatten sich unter preußischer Herrschaft wie<strong>de</strong>r ansie<strong>de</strong>ln dürfen. Während <strong>de</strong>r Novemberpogrome 1938 wur<strong>de</strong>n die Synagogen<br />
in <strong>de</strong>r Glockengasse, in <strong>de</strong>r Roonstraße, auf <strong>de</strong>r Mülheimer Freiheit und in <strong>de</strong>r Körnerstraße sowie ein Betsaal in Deutz in Brand gesteckt. Die bis 1941 in Köln verbliebenen Ju<strong>de</strong>n<br />
wur<strong>de</strong>n in Sammellagern <strong>de</strong>s Fort IX (eine <strong>de</strong>r ehemaligen preußischen Festungsanlagen im Festungsring Köln im Kölner Grüngürtel) und auf <strong>de</strong>m Kölner Messegelän<strong>de</strong> eingesperrt und<br />
später <strong>de</strong>portiert. 8000 Kölner Ju<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus ermor<strong>de</strong>t.<br />
Die heutige Synagogengemein<strong>de</strong> hat wie<strong>de</strong>r über 4857 Mitglie<strong>de</strong>r. Sie besitzt einen Friedhof, eine Grundschule, einen Kin<strong>de</strong>rgarten, eine Bibliothek, einen Sportverein (Makkabi), ein<br />
koscheres Restaurant, ein Jugendzentrum und ein Altersheim mit Seniorentreff. Die Gemein<strong>de</strong> wird von zwei orthodoxen Rabbinern geleitet. Ihre 1959 wie<strong>de</strong>r aufgebaute große<br />
Synagoge steht in <strong>de</strong>r Roonstraße am Rathenauplatz. Seit 1996 gibt es außer<strong>de</strong>m die kleine jüdische liberale Gemein<strong>de</strong> Gescher Lamassoret („Brücke <strong>zu</strong>r Tradition“), die <strong>zu</strong>r Union<br />
progressiver Ju<strong>de</strong>n in Deutschland gehört. Ihre Synagoge liegt im Souterrain <strong>de</strong>r evangelischen Kreuzkapelle in Köln-Riehl.<br />
Islam<br />
Wegen <strong>de</strong>s hohen Anteils von Einwan<strong>de</strong>rern aus <strong>de</strong>r Türkei und ihren Nachkommen sowie wegen <strong>de</strong>r zentralen Lage in <strong>de</strong>r alten Bun<strong>de</strong>srepublik richteten die wichtigsten islamischen
Organisationen Deutschlands ihren Sitz in Köln und Umgebung (Kerpen) ein. Am Hauptsitz <strong>de</strong>r Türkisch-Islamischen Union <strong>de</strong>r Anstalt für Religion (DITIB) soll im Kölner Stadtteil<br />
Ehrenfeld die DITIB-Zentralmoschee Köln mit 35 Meter hoher Kuppel und zwei 55 Meter hohen Minaretten samt frei <strong>zu</strong>gänglichem Innenhof entstehen. Nach Protesten und<br />
Diskussionen wur<strong>de</strong> die Planung modifiziert (weniger Geschäfte, weniger Nebenräume), die äußerliche Gestaltung nach <strong>de</strong>m Plan <strong>de</strong>s Kölner Architekten Paul Böhm bleibt aber<br />
erhalten. Der Gebetsraum soll 1.200 Gläubigen Platz bieten. Der Ruf <strong>de</strong>s Muezzins soll lediglich im Inneren <strong>de</strong>r Moschee <strong>zu</strong> hören sein. Der Bauantrag ist im August 2008 genehmigt<br />
wor<strong>de</strong>n, als Bauzeit sind vom Bauherrn zwei Jahre geplant.[18]<br />
Einwohnerentwicklung<br />
Köln war in <strong>de</strong>n 1970er-Jahren infolge von Eingemeindungen aufgrund <strong>de</strong>s Köln-Gesetzes kurzzeitig Millionenstadt: im Zuge <strong>de</strong>r letzten Eingemeindungen <strong>zu</strong>m 1. Januar 1975 wur<strong>de</strong><br />
die Bevölkerungszahl von einer Million erreicht. Nach<strong>de</strong>m die Stadt Wesseling jedoch <strong>zu</strong>m 1. Juli 1976 durch eine Entscheidung <strong>de</strong>s Verfassungsgerichtshofs für das Land Nordrhein-<br />
Westfalen wie<strong>de</strong>r ausgeglie<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n musste, sank die Einwohnerzahl erneut unter die Millionengrenze. Am 30. Juni 2009 betrug die Einwohnerzahl Kölns nach Fortschreibung <strong>de</strong>s<br />
Lan<strong>de</strong>samtes für Datenverarbeitung und Statistik 993.509.[19] Bis <strong>zu</strong>m Jahr 2035 wird ein leichter Anstieg auf 1.030.000 Einwohner erwartet.<br />
Politik<br />
In römischer Zeit leitete <strong>de</strong>r Admiral <strong>de</strong>r Rheinflotte die städtische Verwaltung. Später wur<strong>de</strong> die römische Munizipalverfassung eingeführt. Da die Stadt Sitz eines Erzbistums war,<br />
erlangte <strong>de</strong>r Erzbischof später die vollständige Machtausübung in Köln. Doch versuchte die Stadt, sich vom Erzbischof <strong>zu</strong> lösen, was ihr schließlich im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt gelang (ab 1288<br />
<strong>de</strong> facto Freie Reichsstadt). Bereits ab 1180 ist ein Rat <strong>de</strong>r Stadt nachweisbar. Ab 1396 waren die 22 Gaffeln das politische Rückgrat <strong>de</strong>r Stadtverwaltung. Sie wählten <strong>de</strong>n 36-köpfigen<br />
Rat, <strong>de</strong>r wie<strong>de</strong>rum 13 Personen hin<strong>zu</strong>wählen konnte. Die Zusammenset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Rates wechselte halbjährlich, in<strong>de</strong>m die Hälfte <strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>r ersetzt wur<strong>de</strong>. Der Rat wählte jährlich<br />
zwei Bürgermeister. Nach <strong>de</strong>r französischen Besat<strong>zu</strong>ng 1794 wur<strong>de</strong> 1798 die Munizipalverfassung eingeführt. Nach <strong>de</strong>m Übergang an Preußen 1815 wur<strong>de</strong> Köln 1816 eine kreisfreie<br />
Stadt und gleichzeitig Sitz eines Landkreises, <strong>de</strong>r erst bei <strong>de</strong>r Gebietsreform 1975 aufgelöst wur<strong>de</strong>. An <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>r Stadt stand seit 1815 ein Oberbürgermeister, ferner gab es weiterhin<br />
einen Rat. 1856 wur<strong>de</strong> die preußische Städteordnung <strong>de</strong>r Rheinprovinz eingeführt.<br />
Während <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Oberbürgermeister von <strong>de</strong>r NSDAP eingesetzt. Nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg setzte die Militärregierung <strong>de</strong>r britischen<br />
Besat<strong>zu</strong>ngszone einen neuen Oberbürgermeister ein und führte 1946 die Kommunalverfassung nach britischem Vorbild ein. Danach gab es einen vom Volk gewählten „Rat <strong>de</strong>r Stadt“,<br />
<strong>de</strong>ssen Mitglie<strong>de</strong>r man als „Stadtverordnete“ bezeichnet. Der Rat wählte anfangs aus seiner Mitte <strong>de</strong>n Oberbürgermeister als Vorsitzen<strong>de</strong>n und Repräsentanten <strong>de</strong>r Stadt, <strong>de</strong>r<br />
ehrenamtlich tätig war. Des Weiteren wählte <strong>de</strong>r Rat ab 1946 ebenfalls einen hauptamtlichen Oberstadtdirektor als Leiter <strong>de</strong>r Stadtverwaltung.<br />
Im Jahr 1999 wur<strong>de</strong> die Doppelspitze in <strong>de</strong>r Stadtverwaltung aufgegeben. Seither gibt es nur noch <strong>de</strong>n hauptamtlichen Oberbürgermeister. Dieser ist Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Rates, Leiter <strong>de</strong>r<br />
Stadtverwaltung und Repräsentant <strong>de</strong>r Stadt. Er wird seither direkt vom Volk gewählt. Dem Oberbürgermeister stehen drei weitere Bürgermeisterinnen und Bürgermeister <strong>zu</strong>r Seite, die<br />
von <strong>de</strong>n stärksten Fraktionen <strong>de</strong>s Rats gestellt wer<strong>de</strong>n.<br />
Politische Traditionen und Entwicklungen<br />
Die lange Tradition einer freien Reichsstadt, die lange ausschließlich katholisch geprägte Bevölkerung und <strong>de</strong>r jahrhun<strong>de</strong>rtealte Gegensatz zwischen Kirche und Bürgertum (und<br />
innerhalb <strong>de</strong>ssen zwischen Patriziern und Handwerkern) hat in Köln ein eigenes politisches Klima erzeugt. Verschie<strong>de</strong>ne Interessengruppen formieren sich häufig aufgrund<br />
gesellschaftlicher Sozialisation und daher über Parteigrenzen hinweg. Das daraus entstan<strong>de</strong>ne Beziehungsgeflecht, das Politik, Wirtschaft und Kultur untereinan<strong>de</strong>r in einem System<br />
gegenseitiger Gefälligkeiten, Verpflichtungen und Abhängigkeiten verbin<strong>de</strong>t, wird auch Kölner Klüngel genannt. Dieser hat häufig <strong>zu</strong> einer ungewöhnlichen Proporzverteilung in <strong>de</strong>r<br />
Stadtverwaltung geführt und artete bisweilen in Korruption aus: Der 1999 aufge<strong>de</strong>ckte „Müllskandal“ über Bestechungsgel<strong>de</strong>r und un<strong>zu</strong>lässige Parteispen<strong>de</strong>n brachte nicht nur <strong>de</strong>n<br />
Unternehmer Hellmut Trienekens in Haft, son<strong>de</strong>rn ließ fast das gesamte Führungspersonal <strong>de</strong>r regieren<strong>de</strong>n SPD stürzen.<br />
War die Stadt aufgrund ihrer katholischen Tradition in Kaiserreich und Weimarer Republik fest <strong>de</strong>m Zentrum verbun<strong>de</strong>n, wechselte bald nach <strong>de</strong>m Krieg die politische Mehrheit von <strong>de</strong>r<br />
CDU <strong>zu</strong>r SPD. Diese regierte über 40 Jahre lang, teilweise mit absoluter Ratsmehrheit. Aufgrund liberaler Traditionen war Köln auch immer eine Hochburg <strong>de</strong>r FDP, wegen ihres
toleranten gesellschaftlichen Klimas auch <strong>de</strong>r Grünen. Bei<strong>de</strong> Parteien machen – mit wechseln<strong>de</strong>m Erfolg – <strong>de</strong>n Volksparteien <strong>zu</strong>nehmend die Mehrheiten streitig.<br />
Rat <strong>de</strong>r Stadt Köln<br />
Im Kölner Stadtrat sitzen 90 Ratsfrauen und Ratsherren. Der direkt gewählte Oberbürgermeister hat Stimmrecht und leitet die Sit<strong>zu</strong>ngen.<br />
Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der Oberbürgermeister<br />
Seit 1999 repräsentieren in Nordrhein-Westfalen die OberbürgermeisterInnen ihre Städte und Gemein<strong>de</strong>n nicht mehr ausschließlich politisch, son<strong>de</strong>rn leiten gleichzeitig die<br />
Kommunalverwaltungen.[21]<br />
Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Stadt Köln (Stadtverwaltung)<br />
Die Stadtverwaltung Köln besteht aus 7 Dezernaten, die jeweils von einem berufsmäßigen Stadtrat als kommunalem Wahlbeamten geleitet wer<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>m Dezernat <strong>de</strong>s<br />
Oberbürgermeisters. Bei <strong>de</strong>r Kölner Stadtverwaltung sind rund 17.000 MitarbeiterInnen beschäftigt.<br />
Bezirksvertretungen<br />
Parallel <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Wahlen <strong>de</strong>s Stadtrats wird in je<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r neun Stadtbezirke nach <strong>de</strong>n Vorgaben <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>ordnung Nordrhein-Westfalens je eine Bezirksvertretung gewählt. Diese<br />
vertreten die Interessen <strong>de</strong>r Bezirke und <strong>de</strong>r da<strong>zu</strong> gehören<strong>de</strong>n Stadtteile gegenüber <strong>de</strong>m Stadtrat. In Fragen geringerer Be<strong>de</strong>utung, die nicht über die Bezirksgrenzen hinaus wirken, haben<br />
sie Entscheidungsbefugnis. Näheres regelt die Hauptsat<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Stadt Köln.<br />
Das Kölner Stadtwappen<br />
Das Wappen <strong>de</strong>r Stadt Köln zeigt <strong>de</strong>n doppelköpfigen Reichsadler, <strong>de</strong>r Schwert und Zepter hält. Er erinnert daran, dass die Stadt im Mittelalter seit 1475 offiziell als Freie Reichsstadt<br />
<strong>zu</strong>m Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation gehörte. Der Adler hat zwei Köpfe, weil <strong>de</strong>r Kaiser <strong>zu</strong>gleich <strong>de</strong>r römisch-<strong>de</strong>utsche König war.<br />
Der Schild hat die Farben rot und weiß, die Farben <strong>de</strong>r Hanse. Köln gehörte als be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Han<strong>de</strong>lsmetropole nicht nur diesem Bund <strong>de</strong>r Kaufleute und Städte an, son<strong>de</strong>rn war –<br />
<strong>zu</strong>sammen mit Lübeck – Mitbegrün<strong>de</strong>rin <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Hanse und damit eine <strong>de</strong>r ältesten Hansestädte in Deutschland.<br />
Die drei Kronen sind seit <strong>de</strong>m 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt das Hoheitszeichen <strong>de</strong>r Stadt; sie erinnern an die „Heiligen Drei Könige“, <strong>de</strong>ren Reliquien 1164 <strong>de</strong>r Kölner Erzbischof Reinald von Dassel<br />
aus Mailand mitbrachte und die in einem gol<strong>de</strong>nen Schrein hinter <strong>de</strong>m Hochaltar <strong>de</strong>s Doms aufbewahrt wer<strong>de</strong>n.<br />
An <strong>de</strong>n sehr populären Kult <strong>de</strong>r heiligen Ursula erinnern die elf schwarzen „Flammen“, die seit <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt im Kölner Stadtwappen auftauchen. Ursula war <strong>de</strong>r Legen<strong>de</strong> nach<br />
eine bretonische Prinzessin, die auf <strong>de</strong>r Rückfahrt von einer Pilgerreise nach Rom mitsamt ihren Gefährtinnen von <strong>de</strong>n Hunnen ermor<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>, die damals gera<strong>de</strong> Köln belagerten. Die<br />
elf o<strong>de</strong>r 11.000 legendären Jungfrauen wer<strong>de</strong>n im Stadtwappen durch die elf tropfenförmigen Hermelinschwänze symbolisiert, die wie<strong>de</strong>rum an das Wappen <strong>de</strong>r Bretagne – <strong>de</strong>r Heimat<br />
Ursulas – erinnern könnten, das aus Hermelinfell besteht.<br />
Städtepartnerschaften<br />
Köln gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n sechs europäischen Städten, die 1958 erstmalig eine Ringpartnerschaft ins Leben riefen. Dieser unmittelbar nach Gründung <strong>de</strong>r EWG erfolgte Akt sollte die<br />
europäische Verbun<strong>de</strong>nheit unterstreichen, in<strong>de</strong>m je eine Stadt aus je<strong>de</strong>m damaligen Mitgliedsland mit allen übrigen eine Städtepartnerschaft abschloss. 1993 wur<strong>de</strong> die Partnerschaft
zwischen <strong>de</strong>n beteiligten Städten Köln, Turin, Lüttich, Esch-sur-Alzette, Rotterdam und Lille nochmals bekräftigt. Liverpool (Vereinigtes Königreich), seit 1952<br />
• Esch-sur-Alzette (Luxemburg), seit 1958<br />
• Lille (Frankreich), seit 1958<br />
• Lüttich (Belgien), seit 1958<br />
• Rotterdam (Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>), seit 1958<br />
• Turin (Italien), seit 1958<br />
• Kyōto (Japan), seit 1963<br />
• Tunis (Tunesien), seit 1964<br />
• Turku (Finnland), seit 1967<br />
• Bezirk Neukölln von Berlin (Deutschland), seit 1967<br />
• Klausenburg/Cluj-Napoca (Rumänien), seit 1976<br />
• Tel Aviv-Jaffa (Israel), seit 1979 Barcelona (Spanien), seit 1984<br />
• Peking (Volksrepublik China), seit 1987<br />
• Thessaloniki (Griechenland), seit 1988<br />
• Cork (Irland), seit 1988<br />
• Corinto/El Realejo (Nicaragua), seit 1988<br />
• Indianapolis (Vereinigte Staaten), seit 1988<br />
• Wolgograd (Russland), seit 1988<br />
• Bezirk Treptow-Köpenick von Berlin (Deutschland), seit 1990<br />
• Kattowitz (Polen), seit 1991<br />
• Bethlehem (Palästinensische Autonomiegebiete), seit 1996<br />
• İstanbul (Türkei), seit 1997<br />
Durch die eingemein<strong>de</strong>ten Städte und Gemein<strong>de</strong>n übernahm Köln <strong>de</strong>ren partnerschaftliche Beziehungen mit <strong>de</strong>n Städten Benfleet/Castle Point (Vereinigtes Königreich), Igny<br />
(Frankreich), Diepenbeek (Belgien), Brive-la-Gaillar<strong>de</strong> (Frankreich), Dunstable (Vereinigtes Königreich), Eygelshoven (Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>) und Hazebrouck (Frankreich).<br />
Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
Im Mittelalter wur<strong>de</strong> Köln <strong>zu</strong> einem be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n kirchlichen und <strong>zu</strong> einem wichtigen künstlerischen und edukativen Zentrum. Der Kölner Dom ist die größte gotische Kirche in<br />
Nor<strong>de</strong>uropa und beherbergt <strong>de</strong>n Dreikönigenschrein, in <strong>de</strong>m die angeblichen Reliquien <strong>de</strong>r Heiligen Drei Könige aufbewahrt wer<strong>de</strong>n, daher die drei Kronen im Stadtwappen. Der Kölner<br />
Dom – 1996 <strong>zu</strong>m Weltkulturerbe erklärt – ist das Hauptwahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt und dient als inoffizielles Symbol. Köln wur<strong>de</strong> im Zweiten Weltkrieg schwer zerstört. Heute ist Köln auch<br />
eine kulturelle Metropole mit vielen wichtigen Museen, Galerien, Kunstmessen sowie lebendigen Kunst- und Musikszenen. Darüber hinaus gilt Köln als Hochburg <strong>de</strong>r Schwulen und<br />
Lesben. In Köln fin<strong>de</strong>t mit <strong>de</strong>r Para<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Christopher Street Day, Höhepunkt <strong>de</strong>s jährlichen „Cologne Pri<strong>de</strong>“, am ersten Sonntag im Juli Deutschlands größte Veranstaltung von<br />
Schwulen und Lesben statt.<br />
Theater<br />
Die Geschichte <strong>de</strong>s Kölner Theaters hat ihre Wurzeln im Mittelalter. Im heutigen Köln sind zahlreiche Theater ansässig. Die Stadt ist Träger <strong>de</strong>r „Bühnen <strong>de</strong>r Stadt Köln“ mit<br />
Schauspielhaus und Oper Köln.<br />
In <strong>de</strong>r Stadt Köln gibt es <strong>zu</strong><strong>de</strong>m rund 70 professionelle freie und private Theater als Tourneetheater o<strong>de</strong>r solche mit eigenen Spielstätten. Der Großteil <strong>de</strong>r Theater ist in <strong>de</strong>r „Kölner
Theaterkonferenz e.V.“ organisiert, <strong>de</strong>r auch die städtischen Bühnen angehören. Eine Beson<strong>de</strong>rheit in <strong>de</strong>r Kölner Theaterlandschaft ist die Initiative „JuPiTer“ (Junges Publikum ins<br />
Theater), in <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>rtheatermacher gemeinsam für die Stärkung <strong>de</strong>s Kin<strong>de</strong>r- und Jugendtheaters arbeiten. Die Kölner Theaterszene bil<strong>de</strong>t das gesamte Spektrum vom Autorentheater<br />
über experimentelles Theater, Kabarett, klassisches Sprechtheater, Figurentheater, Märchenspiele, Performance, Tanztheater bis hin <strong>zu</strong>m Volkstheater ab.<br />
Bekannte Bühnen sind das Arkadaş Theater, Artheater, Atelier-Theater, Casamax-Theater, Cassiopeia Theater, Comedia Theater, Drama Köln, Freies Werkstatt-Theater, Galant-Theater,<br />
Gloria-Theater, Hänneschen-Theater (Puppenspiele <strong>de</strong>r Stadt Köln), Horizont-Theater, Kölner Künstler-Theater, Klüngelpütz Kabarett-Theater, Millowitsch-Theater, Piccolo<br />
Puppenspiele, Senftöpfchen-Theater, Studiobühne Köln, Theater am Dom, Theater am Sachsenring, Theater <strong>de</strong>r Keller, das Theater im Bauturm, Theater im Hof, Theater Tiefrot und<br />
Theaterhaus Köln.<br />
Musik<br />
Sinfonie- und Kammerorchester<br />
In Köln ist eine ganze Reihe renommierter Sinfonie- und Kammerorchester <strong>zu</strong> Hause. Das Gürzenich-Orchester wur<strong>de</strong> 1857 anlässlich <strong>de</strong>r Einweihung <strong>de</strong>s gleichnamigen Kölner<br />
Konzertsaals als Nachfolgeorganisation <strong>de</strong>r „Musikalischen Gesellschaft“ gegrün<strong>de</strong>t. Seit 1888 ist die Stadt Träger <strong>de</strong>s Orchesters. Es spielt in <strong>de</strong>r Oper Köln und gibt zahlreiche<br />
Konzerte, <strong>zu</strong>m Beispiel in <strong>de</strong>r Kölner Philharmonie. Bekannte Musikdirektoren <strong>de</strong>s Orchesters waren Conradin Kreutzer, Hermann Abendroth und Günter Wand. Seit 2003 wird das<br />
Gürzenich-Orchester von Markus Stenz geleitet.<br />
Das zweite berühmte Sinfonieorchester ist das WDR-Sinfonie-Orchester. Dieses Orchester wur<strong>de</strong> 1945 als Nachfolgeeinrichtung <strong>de</strong>s 1926 gegrün<strong>de</strong>ten Orchesters <strong>de</strong>s Reichssen<strong>de</strong>rs<br />
Köln gegrün<strong>de</strong>t. An Kammerorchestern, teilweise mit hochspezialisiertem Repertoire und internationalem Renommee (Alte Musik), sind <strong>zu</strong> nennen: Camerata Köln (gegrün<strong>de</strong>t 1979),<br />
Capella Clementina (gegrün<strong>de</strong>t 1964 als Kölner Kammerorchester), Cappella Coloniensis (in Trägerschaft <strong>de</strong>s WDR), Collegium Aureum (gegrün<strong>de</strong>t 1964), Concerto Köln (gegrün<strong>de</strong>t<br />
1985) und Musica Antiqua Köln (gegrün<strong>de</strong>t 1973).<br />
Chöre<br />
Köln verfügt über eine reichhaltige Chorszene. Über ein Dutzend Konzertchöre sind im Arbeitskreis Kölner Chöre organisiert, einer bun<strong>de</strong>sweit einmaligen Lobbyorganisation. Eine<br />
Auswahl:<br />
• Der Philharmonische Chor Köln, gegrün<strong>de</strong>t 1947 von Philipp Röhl<br />
• Die Kartäuserkantorei Köln, gegrün<strong>de</strong>t 1970 von Peter Neumann<br />
• Der Kölner Kammerchor, ebenfalls 1970 gegrün<strong>de</strong>t von Peter Neumann<br />
• Der WDR Rundfunkchor Köln, gegrün<strong>de</strong>t 1955<br />
• Die Kölner Kantorei, gegrün<strong>de</strong>t 1968 von Volker Hempfling<br />
• Der Chor <strong>de</strong>s Bach-Vereins Köln, gegrün<strong>de</strong>t 1931 von Heinrich Boell<br />
• Der Chorus Musicus Köln, gegrün<strong>de</strong>t 1985 von Christoph Spering<br />
• Der Konzertchor Köln unter Eric Ingwersen, gegrün<strong>de</strong>t 1983<br />
• Der Deutz-Chor, gegrün<strong>de</strong>t 1946 von acht Mitarbeitern <strong>de</strong>r „Klöckner-Humboldt-Deutz“ AG (KHD).<br />
Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Stand 2010<br />
Rund um <strong>de</strong>n Kölner Dom existiert die Kölner Dommusik, bestehend aus vier Chören (Kölner Domchor (Knabenchor), <strong>de</strong>r Mädchenchor am Kölner Dom, die Domkantorei Köln, das<br />
Vokalensemble Kölner Dom). Der Domchor wur<strong>de</strong> 1863 wie<strong>de</strong>rgegrün<strong>de</strong>t. Der Kölner Männer-Gesang-Verein mit seinen rund 190 aktiven Sängern ist über die Stadtgrenzen hinaus<br />
bekannt.
Außer<strong>de</strong>m gibt es in Köln eine sehr vielfältige Szene von „freien“, also nicht als klassischer Konzertchor organisierten o<strong>de</strong>r an Kirchengemein<strong>de</strong>n gebun<strong>de</strong>nen Chören, die sehr<br />
unterschiedliche Hintergrün<strong>de</strong> und Schwerpunkte haben.<br />
Musikschulen<br />
Die Hochschule für Musik und Tanz Köln als Europas größte Musikhochschule trägt <strong>zu</strong>m musikalischen Leben <strong>de</strong>r Stadt erheblich bei. Für Kin<strong>de</strong>r und Jugendliche bietet die Rheinische<br />
Musikschule an mehreren Standorten in Köln flächen<strong>de</strong>ckend Musikunterricht an. Unter <strong>de</strong>m Titel Signale aus Köln fin<strong>de</strong>n am Musikwissenschaftlichen Institut <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong> Köln<br />
Begegnungen mit zeitgenössischen Komponisten statt.<br />
Weitere Spielstätten<br />
Eine wichtige Spielstätte für Musik ist die Kölner Philharmonie mit einem breiten Spektrum von klassischer Musik über Musik <strong>de</strong>r Gegenwart bis hin <strong>zu</strong> Jazz und populärer Musik. Die<br />
Lanxess Arena, das E-Werk in Köln-Mülheim, das Palladium und die Live Music Hall sind neben <strong>de</strong>m Tanzbrunnen im Rheinpark (Freilichtbühne) weitere vielbesuchte<br />
Veranstaltungsorte. Auch in <strong>de</strong>n Sen<strong>de</strong>sälen <strong>de</strong>s West<strong>de</strong>utschen Rundfunks und <strong>de</strong>s Deutschlandfunks fin<strong>de</strong>n regelmäßig Konzerte statt. Der WDR unterhält nicht nur das oben erwähnte<br />
Sinfonieorchester, son<strong>de</strong>rn auch eine Big Band, die als eine <strong>de</strong>r besten Big Bands Europas gilt. Das Jazzhaus im Stadtgarten hat ein reichhaltiges Programm <strong>de</strong>r aktuellen Spielarten <strong>de</strong>s<br />
Jazz und <strong>de</strong>r Weltmusik; im Loft wird insbeson<strong>de</strong>re die improvisierte Musik gepflegt. Im alten Ballsaal <strong>de</strong>s mittelalterlichen Köln, <strong>de</strong>m Gürzenich, wird ebenfalls Musik aufgeführt.<br />
Kölsche Musik<br />
Eine feste Größe in Köln ist die durch <strong>de</strong>n Karneval geprägte Volksmusik. Dabei ist Volksmusik nur bedingt in Anlehnung an allgemeine Volksmusik <strong>zu</strong> sehen. Sie wird fast durchgängig<br />
in Mundart gesungen, also in Kölsch. Dabei variieren die Stilrichtungen von Schlager über Pop und Rock bis hin <strong>zu</strong> Karnevalslie<strong>de</strong>r. In jüngerer Vergangenheit hat sich auch eine Acappella-Szene<br />
gebil<strong>de</strong>t.<br />
Einige Künstler, die sich um die Kölner Musikszene verdient gemacht haben, waren <strong>zu</strong>m Beispiel Willi Ostermann und Willy Schnei<strong>de</strong>r und sind gegenwärtig beispielsweise die Bläck<br />
Fööss, die Höhner, BAP, Brings o<strong>de</strong>r die Wise Guys. Köln war auch <strong>de</strong>r Heimatort <strong>de</strong>r 1968 gegrün<strong>de</strong>ten Rockband Can, die im Laufe <strong>de</strong>r 1970er-Jahre <strong>zu</strong> einer <strong>de</strong>r international<br />
einflussreichsten <strong>de</strong>utschen Rockbands wur<strong>de</strong>.<br />
Elektronische Musik<br />
Köln war seit <strong>de</strong>n frühen 1950er-Jahren auch ein Zentrum mo<strong>de</strong>rner elektronischer Musik. Insbeson<strong>de</strong>re das seit seiner Gründung 1951 von Herbert Eimert geleitete „Studio für<br />
Elektronische Musik“ war als erstes seiner Art weltweit von internationalem Rang, neben Karlheinz Stockhausen, <strong>de</strong>r das Studio seit 1963 leitete, arbeiteten hier beispielsweise Pierre<br />
Boulez, Mauricio Kagel, Pierre Henry und Pierre Schaeffer.<br />
In <strong>de</strong>n 1990er-Jahren blühte in Köln die elektronische Musik erneut auf, diesmal jedoch unter weniger aka<strong>de</strong>mischen Vorzeichen. Ausgehend von Techno, Intelligent Dance Music und<br />
unter Rückgriff auf populärmusikalische Avantgar<strong>de</strong>genres wie Industrial, Noise, Ambient, Krautrock, Free Jazz und Free Improv etablierte sich unter <strong>de</strong>m Stichwort Sound of Cologne<br />
ein breitgefächertes Spektrum mo<strong>de</strong>rner elektronischer Musik und konnte auch international erfolgreich sein. Musiker und Bands wie Wolfgang Voigt, Whirlpool Productions o<strong>de</strong>r<br />
Mouse on Mars waren die bekanntesten Vertreter dieser Strömung, die allerdings stilistisch äußerst uneinheitlich war und eher ein soziales Phänomen war. Be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Labels <strong>de</strong>s Sound<br />
of Cologne sind <strong>zu</strong>m Beispiel Kompakt o<strong>de</strong>r A-Musik.<br />
Literatur<br />
Von Goethe über Heine bis Celan haben namhafte Autoren sich von Köln und seinen Eigenarten <strong>zu</strong> Gedichten und Balla<strong>de</strong>n inspirieren lassen. Zahlreiche <strong>de</strong>utschsprachige Romane<br />
spielen in Köln. Hans Ben<strong>de</strong>r und Dieter Wellershoff leben hier, Nobelpreisträger Heinrich Böll und Rolf Dieter Brinkmann gehörten <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n in Köln ansässigen bekannten Autoren.<br />
Literaturhaus und lit.cologne la<strong>de</strong>n Schriftsteller aus <strong>de</strong>m In- und Ausland <strong>zu</strong> literarischen Veranstaltungen ein, während die heimischen Literaten beispielsweise bei <strong>de</strong>r Lesebühne am<br />
Brüsseler Platz o<strong>de</strong>r bei Veranstaltungen in Buchhandlungen, Cafés und Kneipen auftreten. Neben großen Verlagen wie Kiepenheuer & Witsch und DuMont beleben Spezialverlage wie
<strong>de</strong>r Musikverlag Dohr und Kleinverlage wie Emons, edition fundamental, Krash Verlag, LUND, parasitenpresse, Supposé Verlag und Tisch 7 das literarische Feld. Literarische Gruppen<br />
wie die Kölner Autorenwerkstatt setzen eigene Akzente. Die Stadt vergibt zwei Literaturpreise: <strong>de</strong>n Heinrich-Böll-Preis und das Rolf-Dieter-Brinkmann-Stipendium.<br />
Das Literaturhaus Köln und <strong>de</strong>r Kölner Stadt-Anzeiger veranstalten jährlich die Aktion Ein Buch für die Stadt.<br />
Die Bürgerstiftung Köln stellt mit <strong>de</strong>m Projekt Eselsohr Öffentliche Bücherschränke im Stadtgebiet auf und veranstaltet gemeinsam mit Stadtteil-Bürgerstiftungen offene Leserun<strong>de</strong>n.<br />
Museen<br />
Unter <strong>de</strong>n zahlreichen Kölner Museen mit hochkarätigen Sammlungen sind das<br />
• Museum Ludwig (Mo<strong>de</strong>rne und Gegenwartskunst), das<br />
• Wallraf-Richartz-Museum (Kunst <strong>de</strong>s Mittelalters bis 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt) sowie das<br />
• Römisch-Germanische Museum (Kunst-, Schmuck und Alltagsgegenstän<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r römischen und merowingischen Epoche)<br />
hervor<strong>zu</strong>heben.<br />
Weitere Museen und Ausstellungsinstitute in Köln:<br />
• artothek Köln – Raum für junge Kunst (Ausleihe und Son<strong>de</strong>rausstellungen)<br />
• Agfa-Photo-Historama (Historische Fotografie)<br />
• Ausstellungsraum Jawne, Ausstellung über das ehemalige jüdische Gymnasium Kölns<br />
• Deutsches Sport & Olympia Museum<br />
• Domschatzkammer Köln<br />
• Duftmuseum im Farina-Haus, Geburtshaus <strong>de</strong>s Eau <strong>de</strong> Cologne<br />
• Historisches Archiv <strong>de</strong>r Stadt Köln (durch Einsturz am 3. März 2009 größtenteils zerstört)<br />
• Erzbischöfliches Diözesanmuseum/Kolumba<br />
• Geldgeschichtliches Museum<br />
• Käthe-Kollwitz-Museum<br />
• Kölner Karnevalsmuseum<br />
• KünstlerMuseum Beckers°Böll im Kunsthaus Rhenania<br />
• Kölner Festungsmuseum<br />
• Kölnischer Kunstverein (Gegenwartskunst)<br />
• Kölnisches Stadtmuseum Zeughaus (Stadtgeschichte)<br />
• Mikwe (mittelalterliches jüdisches Kultbad auf <strong>de</strong>m Rathausvorplatz, Außenstelle <strong>de</strong>s Römisch-Germanischen Museums)<br />
• Museum für Angewandte Kunst (Köln)<br />
• Museum für Ostasiatische Kunst (Kunst und Kunsthandwerk aus Japan, China und Korea)<br />
• Museum Schnütgen (Sakralkunst <strong>de</strong>s Mittelalters)<br />
• Odysseum (Science-Center)<br />
• Praetorium (römischer Statthalterpalast, Außenstelle <strong>de</strong>s Römisch-Germanischen Museums)<br />
• Radiomuseum (Privatmuseum)<br />
• Rautenstrauch-Joest-Museum – Museum für Völkerkun<strong>de</strong> (einziges Völkerkun<strong>de</strong>museum in Nordrhein-Westfalen)
• Rheinisches Industriebahn-Museum<br />
• Schokola<strong>de</strong>nmuseum (offiziell: Imhoff-Schokola<strong>de</strong>nmuseum)<br />
• Skulpturenpark Köln, Außenskulpturen <strong>de</strong>r Gegenwartszeit (ausschließlich Wechselausstellungen)<br />
• SK Stiftung Kultur <strong>de</strong>r Sparkasse KölnBonn – „Die Photographische Sammlung“ und Tanzmuseum<br />
• Sammlungen und Museen <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong> Köln<br />
• Theaterwissenschaftliche Sammlung Schloss Wahn (Porz-Wahn)<br />
• Weinmuseum<br />
Geplant ist folgen<strong>de</strong>s Museum:<br />
• Haus <strong>de</strong>r Jüdischen Geschichte (in Planung auf <strong>de</strong>m Platz vor <strong>de</strong>m historischen Rathaus)<br />
Archive<br />
• Archiv für Rheinische Musikgeschichte (am Musikwissenschaftlichen Institut <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong> Köln angeschlossen)<br />
• Heinrich-Böll-Archiv<br />
• Historisches Archiv <strong>de</strong>r Stadt Köln<br />
• Historisches Archiv <strong>de</strong>s Erzbistums Köln<br />
• Husserl-Archiv <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong> Köln<br />
• Max-Bruch-Archiv <strong>de</strong>s Musikwissenschaftlichen Institutes <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong> Köln<br />
• Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv<br />
Bibliotheken<br />
• Bibliothek/ Mediathek <strong>de</strong>r Kunsthochschule für Medien (KHM)<br />
• Deutsche Zentralbibliothek für Medizin<br />
• Erzbischöfliche Dom- und Diözesanbibliothek<br />
• Hochschulbibliothek <strong>de</strong>r Fachhochschule Köln<br />
• Hochschulbibliothek <strong>de</strong>r Katholischen Fachhochschule Köln<br />
• Kunst- und Museumsbibliothek <strong>de</strong>r Stadt Köln<br />
• StadtBibliothek Köln, öffentliche Einrichtung <strong>de</strong>r Stadt[22]<br />
• USB Köln, Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, zentrale Einrichtung <strong>de</strong>r Universität[23]<br />
• Wirtschaftsbibliothek <strong>de</strong>r Industrie- und Han<strong>de</strong>lskammer <strong>zu</strong> Köln<br />
• Zentralbibliothek <strong>de</strong>r Sportwissenschaften <strong>de</strong>r Deutschen Sporthochschule Köln<br />
Architektur<br />
Die Altstadt Kölns und angrenzen<strong>de</strong> Bereiche wur<strong>de</strong>n durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg <strong>zu</strong> 80 Prozent zerstört. Beim Wie<strong>de</strong>raufbau wur<strong>de</strong>n zwar <strong>de</strong>r Straßenverlauf und die<br />
historischen Straßennamen häufig beibehalten, die Bebauung erfolgte jedoch häufig im Stil <strong>de</strong>r 1950er-Jahre. Somit sind weite Teile <strong>de</strong>r Stadt von Nachkriegsarchitektur geprägt;<br />
dazwischen befin<strong>de</strong>n sich einzelne Bauten, die erhalten geblieben o<strong>de</strong>r aufgrund ihrer Be<strong>de</strong>utung rekonstruiert wor<strong>de</strong>n sind.
Römisches Köln<br />
Köln ist eine <strong>de</strong>r ältesten Städte Deutschlands. Der römische Feldherr Agrippa sie<strong>de</strong>lte 19/18 v. Chr. <strong>de</strong>n Stamm <strong>de</strong>r Ubier am Rhein an und sorgte für eine Infrastruktur nach römischem<br />
Vorbild. Das antike Straßennetz hat teilweise noch bis heute Bestand. Aus <strong>de</strong>m römischen cardo maximus wur<strong>de</strong> die Hohe Straße und <strong>de</strong>r <strong>de</strong>cumanus maximus ist heute die<br />
Schil<strong>de</strong>rgasse. Reste römischer Bauwerke fin<strong>de</strong>n sich im gesamten Innenstadtbereich. Teilweise sind sie unterirdisch unter <strong>de</strong>m Kölner Rathaus o<strong>de</strong>r in Parkhäusern und Kellern<br />
<strong>zu</strong>gängig. Darunter ist das sogenannte Ubiermonument, das älteste datierte Gebäu<strong>de</strong> aus Stein Deutschlands. Oberirdisch können Reste <strong>de</strong>r römischen Stadtmauer, <strong>zu</strong>m Beispiel <strong>de</strong>r<br />
Römerturm, besichtigt wer<strong>de</strong>n.<br />
Mittelalterliches Köln<br />
Be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> mittelalterliche Profanbauten sind erhalten o<strong>de</strong>r wie<strong>de</strong>r aufgebaut wor<strong>de</strong>n: Beispiele sind das Rathaus, das Stapelhaus, <strong>de</strong>r Gürzenich und das Overstolzenhaus, ältestes<br />
erhaltenes Wohngebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt. Teile <strong>de</strong>r mächtigen mittelalterlichen Stadtmauern sind ebenfalls erhalten, darunter auch mehrere Stadttore wie das Eigelsteintor und die Stadtmauer<br />
am Hansaring (neben <strong>de</strong>m früheren Standort <strong>de</strong>s Stadtgefängnisses Klingelpütz), das Severinstor, das Hahnentor o<strong>de</strong>r die Ulrepforte samt <strong>de</strong>r Stadtmauer am Sachsenring und <strong>de</strong>r<br />
„Weckschnapp“. Das malerische Martinsviertel besteht nur noch <strong>zu</strong>m Teil aus mittelalterlicher Bausubstanz. Viele Gebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg mehr o<strong>de</strong>r weniger<br />
stilgerecht wie<strong>de</strong>r aufgebaut.<br />
Preußisches Köln<br />
Am Römerturm 3 liegt das einzige noch erhaltene klassizistische Wohnhaus. Der Festungsring liegt in <strong>de</strong>n heutigen äußeren Stadtbezirken und diente <strong>de</strong>r Stadtbefestigung <strong>de</strong>r<br />
preußischen Zeit. Innerhalb <strong>de</strong>s äußeren Kölner Grüngürtels können noch heute einige <strong>de</strong>r Forts besichtigt wer<strong>de</strong>n. Die Neustadt ist eine ringförmig um die historische Altstadt angelegte<br />
Stadterweiterung, die sich von <strong>de</strong>r abgebrochenen mittelalterlichen Stadtmauer bis <strong>zu</strong>m inneren Festungsring erstreckt. Sie wur<strong>de</strong> ab 1880 bis circa 1920 erbaut und war die größte ihrer<br />
Zeit in Deutschland. Einst war sie ein geschlossenes Ensemble mit allen Stilrichtungen vom Historismus über Jugendstil bis hin <strong>zu</strong>m Expressionismus, konnte aber nach erheblichen<br />
Kriegsschä<strong>de</strong>n und ungezügelter Abrisswut in <strong>de</strong>r Nachkriegszeit nur noch teilweise ihren Charme erhalten. Heute ist sie kein reines Wohngebiet mehr, son<strong>de</strong>rn Zentrum verschie<strong>de</strong>nster<br />
kultureller und geschäftlicher Aktivitäten (Mediapark, Galerien, Kneipenviertel etc.). Die ursprüngliche Gestalt lässt sich in einigen Straßenzügen noch gut nachvollziehen: Hier<strong>zu</strong><br />
zählen die Südstadt (Ubierring, Alteburger Straße – hauptsächlich Jugendstil), das Universitätsviertel (Zülpicher Straße, Rathenauplatz – hauptsächlich historisieren<strong>de</strong> wilhelminische<br />
Häuser) und einzelne Patrizierhäuser im Belgischen Viertel (Aachener Straße, Lütticher Straße). Das Haus Schierenberg entstammt ebenfalls jener Zeit. In <strong>de</strong>r nördlichen Neustadt stellt<br />
die Kirche St. Agnes ein gelungenes Beispiel rheinischer Neugotik dar.<br />
1914 investierte die Stadt 5 Millionen Goldmark für die Kölner Werkbundausstellung, bei <strong>de</strong>r führen<strong>de</strong> Werkbundarchitekten exemplarische und zeitgemäße Gebäu<strong>de</strong> errichteten.<br />
Zwischen <strong>de</strong>n Weltkriegen<br />
Unter <strong>de</strong>m damaligen Oberbürgermeister Konrad A<strong>de</strong>nauer entstan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n 1920er-Jahren in Köln einige be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Bauwerke. Das Messegelän<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m markant hervorstechen<strong>de</strong>n<br />
Messeturm ist im Stil <strong>de</strong>s Backstein-Expressionismus errichtet, wobei die Bauten über ein Skelett aus Stahlbeton verfügen und die ornamentale Fassa<strong>de</strong> aus Blendklinkern besteht. Im<br />
selben Stil ist das Hansahochhaus am Innenstadtring gebaut wor<strong>de</strong>n. Zum Zeitpunkt <strong>de</strong>s Richtfestes 1924 war es das höchste Haus Europas.<br />
A<strong>de</strong>nauer ernennt 1926 <strong>de</strong>n Künstler Professor Richard Riemerschmid <strong>zu</strong>m Gründungsdirektor <strong>de</strong>r stadtkölnischen Kunsthochschule Kölner Werkschulen, einer Parallelgründung <strong>zu</strong>m<br />
Bauhaus in Dessau.<br />
Ein Beispiel für <strong>de</strong>n Baustil <strong>de</strong>r Neuen Sachlichkeit ist das Disch-Haus, die Universität wur<strong>de</strong> im Stil <strong>de</strong>s Werkbun<strong>de</strong>s bis 1929 errichtet. In <strong>de</strong>n Zwanziger Jahren erlebte <strong>de</strong>r<br />
Siedlungsbau in Köln einen Höhepunkt: Ganze Stadtteile wie Zollstock und Höhenhaus wur<strong>de</strong>n von Wohnungsgenossenschaften <strong>zu</strong>meist nach <strong>de</strong>n städtebaulichen I<strong>de</strong>alen <strong>de</strong>r Zeit und<br />
oft nach <strong>de</strong>n Prinzipien <strong>de</strong>r Gartenstadt errichtet.<br />
In <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r nationalsozialistischen Diktatur sollte Köln als Gauhauptstadt einen entsprechen<strong>de</strong>n Rahmen erhalten: Geplant war <strong>de</strong>r Abriss <strong>de</strong>r halben Altstadt und <strong>de</strong>s gesamten<br />
Stadtteiles Deutz, um Platz für Aufmarschstraßen und ein gigantisches Gauforum auf <strong>de</strong>r rechten Rheinseite <strong>zu</strong> schaffen. Das als erhaltenswert eingestufte Altstadtgebiet wur<strong>de</strong> bis 1939
komplett saniert und eine große Schneise in West-Ost-Richtung durch die Innenstadt geschlagen. Zur Ausführung <strong>de</strong>r Vorhaben kam es durch <strong>de</strong>n Krieg nicht mehr. An <strong>de</strong>r Universität<br />
Köln lehrte Wilhelm Börger <strong>de</strong>n „Deutschen Sozialismus“. Die Tanzmariechen durften auf Wunsch von Adolf Hitler keine Männer mehr sein. Statt<strong>de</strong>ssen bekamen Mädchen diese Rolle.<br />
Nachkriegszeit und neue Entwicklungen<br />
Nach<strong>de</strong>m Köln 1945 nur noch eine Trümmerwüste war, übernahm die amerikanische, später die britische Militärverwaltung erste Schritte <strong>zu</strong>r Wie<strong>de</strong>rerrichtung <strong>de</strong>r Stadt. Der<br />
vollständige, autogerechte Neubau <strong>de</strong>r Innenstadt wur<strong>de</strong> bald <strong>zu</strong>gunsten einer Kompromisslösung aufgegeben, die das Straßennetz mit <strong>de</strong>m tradierten, schmalen Zuschnitt <strong>de</strong>r<br />
Grundstücke beibehielt, aber breite Trassen durch die Innenstadt vorsah. Die Schaffung günstigen Wohnraumes stand im Vor<strong>de</strong>rgrund, so dass sich das Stadtbild <strong>de</strong>s Nachkriegs-Köln<br />
durch architektonisch belanglose, hastig errichtete Miethäuser häufig sehr gleichförmig darstellte. Gleichwohl ragen aus dieser Zeit einzelne stilbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> und wegweisen<strong>de</strong> Projekte<br />
heraus, die Köln in <strong>de</strong>n 1950er-Jahren <strong>zu</strong>m Mekka <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnen Städtebaus machten. Zu erwähnen ist die Gestaltung <strong>de</strong>s Domplatzes mit <strong>de</strong>m Blau-Gold-Haus, <strong>de</strong>r von Wilhelm<br />
Riphahn gestaltete Komplex aus Oper und Schauspielhaus und die West-Ost-Achse, die bereits En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Vierziger Jahre mit lichten Pavillons und werksteinverklei<strong>de</strong>ten Geschossbauten<br />
ausgestaltet wur<strong>de</strong>. Der Gebäu<strong>de</strong>komplex <strong>de</strong>r Gerling-Versicherung war aufgrund seiner Formensprache aus <strong>de</strong>n 1930er-Jahren dagegen sehr umstritten. 1967 wur<strong>de</strong> die Hohe Straße,<br />
eine bekannte Kölner Einkaufsstraße, als erste Straße in Köln in eine Fußgängerzone umgewan<strong>de</strong>lt.<br />
Die 1960er- und 1970er-Jahre bescherten Köln vor allem Architektur aus nacktem Beton, die bisweilen irreparable Schä<strong>de</strong>n am Stadtbild verursachte. Erst in <strong>de</strong>n 1980er-Jahren<br />
besannen sich die Kölner langsam wie<strong>de</strong>r auf Qualität: Nach <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s Fernmel<strong>de</strong>turmes Colonius wur<strong>de</strong> verstärkt die Aufwertung <strong>de</strong>r Innenstadt betrieben. Das Museum Ludwig,<br />
die Philharmonie und <strong>de</strong>r Rheinufertunnel verban<strong>de</strong>n die Stadt seit 1986 durch eine ansprechend eingerahmte Uferpromena<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Rhein; gleichzeitig wur<strong>de</strong> durch die<br />
teilweise Verlegung <strong>de</strong>r Stadtbahn in Tunnel <strong>de</strong>r Innenstadtring entlastet und in neuer Gestaltung 1987 eingeweiht. In <strong>de</strong>n Neunziger Jahren folgte <strong>de</strong>r Mediapark auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Güterbahnhofs sowie die KölnArena (heute Lanxess Arena). Das Wallraf-Richartz-Museum und das Weltstadthaus sind aktuelle Beispiele für eine eher behutsame Umgestaltung <strong>de</strong>r<br />
Innenstadt.<br />
In <strong>de</strong>n ersten Jahren <strong>de</strong>s neuen Jahrtausends entstand mit <strong>de</strong>m KölnTriangle im rechtsrheinischen Stadtteil Deutz ein neues Hochhaus mit einer Aussichtsplattform in 103 Metern Höhe.<br />
Be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Sakralbauten<br />
Das alles überragen<strong>de</strong> Kölner Wahrzeichen ist <strong>de</strong>r gotische Dom St. Peter und Maria, <strong>de</strong>r größte Kirchenbau <strong>de</strong>r Gotik überhaupt. Bis <strong>zu</strong> seiner Vollendung vergingen etwa 600 Jahre;<br />
erst in preußischer Zeit wur<strong>de</strong> er fertig gestellt. Hier sind die Reliquien <strong>de</strong>r Heiligen Drei Könige aufbewahrt, die Köln <strong>zu</strong> einem Pilgerziel ersten Ranges machten. Sie sind im prunkvoll<br />
gestalteten Dreikönigenschrein (spätes 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt/1. Hälfte 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt) im Chorraum <strong>de</strong>s Domes aufbewahrt.<br />
Kulturgeschichtlich nicht weniger be<strong>de</strong>utsam sind die insgesamt zwölf romanischen Kirchen im Innenstadtbereich: St. Severin, St. Maria Lyskirchen, Basilika St. Andreas, St. Aposteln,<br />
St. Gereon, St. Ursula, St. Pantaleon, St. Maria im Kapitol, Groß St. Martin, St. Georg, St. Kunibert und St. Cäcilien. Die meisten von ihnen wur<strong>de</strong>n im Krieg schwer beschädigt; erst<br />
1985 war die Wie<strong>de</strong>rerrichtung abgeschlossen.<br />
In <strong>de</strong>r Innenstadt fin<strong>de</strong>n sich außer<strong>de</strong>m die gotischen Kirchen Minoritenkirche und St. Peter sowie die Barockkirchen St. Mariä Himmelfahrt, St. Maria in <strong>de</strong>r Kupfergasse, St. Maria<br />
vom Frie<strong>de</strong>n und die Ursulinenkirche St. Corpus Christi. Die Protestanten durften in Köln erst ab 1802 öffentliche Gottesdienste feiern. Zu diesem Zweck bekamen sie von <strong>de</strong>n<br />
Franzosen die gotische Antoniterkirche übereignet. Ähnlich verhält es sich mit <strong>de</strong>r Kartäuserkirche, welche 1923 in evangelischen Besitz überging. Die in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Heumarkts<br />
befindliche Trinitatiskirche ist die erste als solche errichtete evangelische Kirche im linksrheinischen Köln. Im Stadtteil Mülheim, das damals <strong>zu</strong>m Herzogtum Berg gehörte, wur<strong>de</strong><br />
allerdings bereits 1786 die Frie<strong>de</strong>nskirche errichtet. Zwei Vorgängerbauten wur<strong>de</strong>n zerstört.<br />
St. Engelbert in Köln-Riehl ist <strong>de</strong>r erste mo<strong>de</strong>rne Kirchenbau Kölns.<br />
Zwei Kirchenruinen sind noch im Stadtbild vertreten: Alt St. Alban in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Rathauses mit einer von Käthe Kollwitz entworfenen Skulptur im ehemaligen Kirchenschiff und die<br />
Reste von St. Kolumba. Hier wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n 1950er-Jahren um eine erhalten gebliebene Marienfigur die Kapelle St. Maria in <strong>de</strong>n Trümmern errichtet, die völlig zerstörte Kirche behielt<br />
nur provisorisch gesicherte Stümpfe <strong>de</strong>r Umfassungsmauern. 2005 wur<strong>de</strong> auf diesen Ruinen das neue Diözesanmuseum von Peter Zumthor errichtet, <strong>de</strong>ssen Neubau die Integration <strong>de</strong>r
Überreste <strong>de</strong>utlich betont.<br />
In <strong>de</strong>r Neustadt und <strong>de</strong>n Vororten gibt es noch zahlreiche weitere Sakralbauten, unter an<strong>de</strong>rem mehrere kleine romanische und gotische Kirchen, aber auch Beispiele für <strong>de</strong>n mo<strong>de</strong>rnen<br />
Kirchenbau. Beson<strong>de</strong>rs sehenswerte Bauten wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Artikeln <strong>de</strong>r jeweiligen Stadtteile beschrieben.<br />
Rheinbrücken<br />
Acht Rheinbrücken überspannen im Kölner Stadtgebiet <strong>de</strong>n Rhein, davon zwei Eisenbahnbrücken und sechs Straßenbrücken:<br />
• die Hohenzollernbrücke in <strong>de</strong>r Achse <strong>de</strong>s Domes ist die am meisten befahrene Eisenbahnbrücke Europas<br />
• die Südbrücke entlastet die Hohenzollernbrücke vom Güterverkehr.<br />
Zwei Autobahnbrücken verbin<strong>de</strong>n die links- und rechtsrheinischen Teile <strong>de</strong>s Kölner Autobahnrings:<br />
• die Ro<strong>de</strong>nkirchener Autobahnbrücke im Sü<strong>de</strong>n und<br />
• die Leverkusener Brücke im Nor<strong>de</strong>n zwischen Köln-Merkenich und Leverkusen.<br />
Vier im Kölner Brückengrün gestrichene städtische Straßenbrücken lenken <strong>de</strong>n Verkehr im inneren Stadtgebiet über <strong>de</strong>n Rhein. Die Deutzer Brücke war <strong>de</strong>r erste Brückenneubau <strong>de</strong>r<br />
Nachkriegszeit, die Mülheimer Brücke ist <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnisierte Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>r ersten Brücke nach Mülheim. Die Severinsbrücke symbolisiert ausdrucksvoll <strong>de</strong>n Aufbruch <strong>de</strong>r<br />
Nachkriegszeit und verbin<strong>de</strong>t wie die Zoobrücke die Innenstadt mit <strong>de</strong>m rechtsrheinischen Autobahnsystem.<br />
Parks und Grünflächen <strong>de</strong>r Stadt<br />
Köln besitzt linksrheinisch zwei Grüngürtel – <strong>de</strong>n inneren und <strong>de</strong>n äußeren. Der Innere Grüngürtel ist sieben Kilometer lang, mehrere 100 Meter breit und hat eine Fläche von 120<br />
Hektar. Die Festungsgürtel <strong>de</strong>r Stadt mussten nach <strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg im Rahmen <strong>de</strong>r Versailler Verträge abgerissen wer<strong>de</strong>n, so dass hier diese große städtische Grünanlage entstehen<br />
konnte. Durch Aufschüttung von Trümmern <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges entstand im Inneren Grüngürtel <strong>de</strong>r heute dicht bewachsene 25 Meter hohe Herkulesberg. Der Innere Grüngürtel<br />
beherbergt 25 Baumarten, Wiesen und mehrere Wasserflächen.<br />
Der Äußere Grüngürtel ist auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s äußeren Festungsringes entstan<strong>de</strong>n. Die <strong>zu</strong>m Teil baumbestan<strong>de</strong>ne größte Kölner Grünanlage sollte ursprünglich fast die gesamte Stadt<br />
umschließen, was aus wirtschaftlichen Grün<strong>de</strong>n nie realisiert wur<strong>de</strong>. Dennoch entstan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n 1920er-Jahren 800 Hektar Grünfläche, unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>r Beethovenpark. Auch die<br />
Festungsanlagen auf <strong>de</strong>r rechten Rheinseite wur<strong>de</strong>n, wo möglich, in Grünanlagen umgewan<strong>de</strong>lt.<br />
Der fünf Hektar (ursprünglich: 11 ha) große Stadtgarten ist <strong>de</strong>r älteste Park in Köln. Die 175 Jahre alte Anlage wur<strong>de</strong> als Landschaftspark angelegt und besitzt seit über 100 Jahren ein<br />
Restaurant mit Biergarten. Dort ist heute auch ein Jazzclub <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n.<br />
Im über 100 Jahre alten Volksgarten <strong>de</strong>r Südstadt fin<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r warmen Jahreszeit nächtelange Grill-Happenings statt, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>nen sich oft Trommler und an<strong>de</strong>re Instrumentalisten<br />
einfin<strong>de</strong>n. Auch Klein- und Straßenkünstler sind hier <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n. Der Park ist außer<strong>de</strong>m Ort für viele kulturelle Veranstaltungen, so wer<strong>de</strong>n beispielsweise in <strong>de</strong>r Orangerie Theaterstücke<br />
aufgeführt.<br />
Die auf einer Anhöhe gelegene Grünfläche am Aachener Weiher ist insbeson<strong>de</strong>re bei Stu<strong>de</strong>nten ein beliebter Treffpunkt. Der sanfte Hügel entstand ebenfalls durch Aufschüttung von<br />
Trümmern <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs. Seit <strong>de</strong>m 7. August 2004 erinnert ein neuer Name an die Opfer <strong>de</strong>s Krieges: Hiroshima-Nagasaki-Park. Köln ist seit 1985 Mitglied <strong>de</strong>s<br />
internationalen Städtebündnisses gegen Atomwaffen, <strong>de</strong>s so genannten „Hiroshima-Nagasaki-Bündnisses“.<br />
Der Blücherpark im Stadtteil Bil<strong>de</strong>rstöckchen und <strong>de</strong>r Vorgebirgspark in Ra<strong>de</strong>rthal wur<strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>, obwohl sehr unterschiedlich gestaltet, Anfang <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts nach <strong>de</strong>n Plänen <strong>de</strong>s<br />
Gartenarchitekten Fritz Encke angelegt. Der Klettenbergpark in Köln-Klettenberg wur<strong>de</strong> zwischen 1905 und 1908 in einer ehemaligen Kiesgrube als Höhenpark angelegt. Der Fritz-<br />
Encke-Volkspark in Köln-Ra<strong>de</strong>rthal ist trotz <strong>de</strong>r Verluste (teilweise Bebauung in <strong>de</strong>n 1950er-Jahren) eine <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Anlagen <strong>de</strong>r 1920er-Jahre.
Die mit <strong>de</strong>r Stadterweiterung nach 1881 angelegte Ringstraße auf <strong>de</strong>n ehemaligen Bollwerken vor <strong>de</strong>r mittelalterlichen Stadtmauer war mit zahlreichen parkähnlichen Anlagen<br />
ausgestattet, so am Sachsenring, Kaiser-Wilhelm-Ring, Hansaring, Ebertplatz und Theodor-Heuss-Ring. Nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong>n die Anlagen verän<strong>de</strong>rt o<strong>de</strong>r weitgehend<br />
entfernt, und nur <strong>de</strong>r westliche Teil <strong>de</strong>s Parks am Theodor-Heuss-Ring mit Weiher befin<strong>de</strong>t sich noch fast im ursprünglichen Zustand.<br />
Auf <strong>de</strong>r rechten Rheinseite liegt <strong>de</strong>r Rheinpark, das weitläufige Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sgartenschau 1957 und 1971 in Köln-Deutz, das durch die Rheinseilbahn mit <strong>de</strong>n linksrheinischen<br />
Anlagen Zoo und Flora verbun<strong>de</strong>n ist. Etwas weiter entfernt liegen die Groov in Köln-Zündorf sowie <strong>de</strong>r Thurner Hof.<br />
Im Kölner Nor<strong>de</strong>n befin<strong>de</strong>t sich das Naherholungs- und Sportgebiet Fühlinger See. Es besteht aus sieben miteinan<strong>de</strong>r verbun<strong>de</strong>nen Seen und einer Regattastrecke. Das Areal bietet sich<br />
<strong>zu</strong>m Ba<strong>de</strong>n, Schwimmen, Tauchen, Angeln, Windsurfen, Kanufahren und Ru<strong>de</strong>rn an. Die u-förmig um die Regattastrecke verlaufen<strong>de</strong> Straße wird häufig von Inline-Skatern genutzt.<br />
Die Naherholungsgrünzonen am Ran<strong>de</strong> Kölns wer<strong>de</strong>n durch einen Rundwan<strong>de</strong>rweg, <strong>de</strong>n Kölnpfad, <strong>de</strong>ssen Etappen durch öffentliche Verkehrsmittel erreichbar sind, erschlossen und<br />
verbun<strong>de</strong>n.<br />
Der nahe gelegene Naturpark Rheinland jenseits <strong>de</strong>r Ville kann als dritter Kölner Grüngürtel angesehen wer<strong>de</strong>n. Auch er dient <strong>de</strong>r Stadtbevölkerung als Erholungsgebiet. Die Stadt<br />
gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Trägern <strong>de</strong>s Naturparks.<br />
Zoo und Botanische Gärten<br />
Der Kölner Zoo wur<strong>de</strong> 1859 erbaut, ist etwa 20 ha groß und beherbergt 700 Tierarten mit zirka 7000 Tieren. Beson<strong>de</strong>rs bekannt ist er für die vielen in <strong>de</strong>n Jahren 2006 und 2007<br />
geborenen Elefanten. Das neue Heim <strong>de</strong>r Elefanten, <strong>de</strong>r Elefantenpark, wur<strong>de</strong> 2005 mit Hilfe privater Spen<strong>de</strong>n erbaut und hat etwa 15 Millionen Euro gekostet.<br />
Der Botanische Garten Kölns wird Flora genannt. Er ist in das European Gar<strong>de</strong>n Heritage Network eingebun<strong>de</strong>n und 2004/2005 als herausragend in die Straße <strong>de</strong>r Gartenkunst zwischen<br />
Rhein und Maas aufgenommen wur<strong>de</strong>. Im Äußeren Grüngürtel im Stadtteil Ro<strong>de</strong>nkirchen liegt <strong>de</strong>r Forstbotanische Garten mit seiner Landschaftsparkerweiterung, <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>nswald.<br />
Sport<br />
Sportstätten<br />
Überregional bekannt sind vor allem <strong>de</strong>r Müngersdorfer Sportpark mit <strong>de</strong>m RheinEnergieStadion und die Lanxess Arena (KölnArena) in Deutz, eine <strong>de</strong>r größten Mehrzweckhallen<br />
Europas, in <strong>de</strong>r Eishockey-, Handball- und Basketballspiele ausgetragen wer<strong>de</strong>n. Daneben verfügt die Stadt über eine Radrennbahn, eine Pfer<strong>de</strong>rennbahn, eine Regattastrecke und<br />
zahlreiche weitere Sporteinrichtungen. Köln ist aufgrund seiner Infrastruktur regelmäßig Austragungsort von in Deutschland stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n internationalen Sportveranstaltungen.<br />
Die Deutsche Sporthochschule Köln ist die einzige Einrichtung dieser Art in Deutschland.<br />
Vereine und Traditionsveranstaltungen<br />
In Köln wer<strong>de</strong>n 775 Sportvereine durch die Stadt finanziell geför<strong>de</strong>rt. Der Vereinssport umfasst alle wichtigen Breitensportarten; die bekanntesten Fußballvereine sind <strong>de</strong>r 1. FC Köln,<br />
<strong>de</strong>r SC Fortuna Köln und <strong>de</strong>r SCB Viktoria Köln. Sehr erfolgreich sind <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die Kölner Haie im Eishockey und die Cologne Falcons im American Football. Im Basketball hatte Köln<br />
eine sehr erfolgreiche Zeit mit <strong>de</strong>m BSC Saturn Köln. Von 1999 bis <strong>zu</strong>r Insolvenz 2009 war die Stadt mit <strong>de</strong>n Köln 99ers in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sliga vertreten. Der Amateurverein<br />
Sportgemeinschaft Köln99ers ist weiterhin <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsche Basketballverein mit <strong>de</strong>n meisten Mitglie<strong>de</strong>rn.<br />
Seit 1997 fin<strong>de</strong>t je<strong>de</strong>s Jahr im Herbst <strong>de</strong>r Köln-Marathon statt, und <strong>de</strong>r Radsportklassiker Rund um Köln wird bereits seit 1908 jährlich durchgeführt. Seit 1984 wird <strong>de</strong>r Köln-Triathlon<br />
veranstaltet.<br />
Nachtleben
Vor allem am Wochenen<strong>de</strong> tummeln sich in <strong>de</strong>r Innenstadt Einheimische und Touristen, Jugendliche und Stu<strong>de</strong>nten in zahlreichen Diskotheken, Clubs, Bars und Lounges.<br />
Hauptanlaufpunkte sind dabei die Altstadt, das Stu<strong>de</strong>ntenviertel Kwartier Latäng um die Zülpicher und die Luxemburger Straße, das Friesenviertel in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Friesenplatzes, das<br />
belgische Viertel und die Ringe zwischen Kaiser-Wilhelm-Ring und Rudolfplatz, sowie die Südstadt zwischen Chlodwigplatz und <strong>de</strong>r Alteburger Straße.<br />
Karneval<br />
Der Kölner Karneval – die „fünfte Jahreszeit“ – beginnt am 11. November um 11:11 Uhr auf <strong>de</strong>m Alter Markt (<strong>de</strong>rzeit auf <strong>de</strong>m Heumarkt, da <strong>de</strong>r Alter Markt aufgrund <strong>de</strong>r Großbaustelle<br />
wegen <strong>de</strong>r Nord-Süd-Stadtbahn nur eingeschränkt <strong>zu</strong>gänglich ist). Nach einem kurzen, aber heftigen Auftakt legt <strong>de</strong>r Karneval bis Neujahr eine Pause ein. Dann beginnt die eigentliche<br />
„Session“, die bis <strong>zu</strong>m Aschermittwoch mit <strong>de</strong>m traditionellen Fischessen dauert. Dieser Abschied vom bunten Karnevalstreiben wird durch die sogenannte Nubbelverbrennung um<br />
Mitternacht von Karnevalsdienstag auf Aschermittwoch eingeläutet.<br />
Während <strong>de</strong>r Karnevalssession fin<strong>de</strong>n Sit<strong>zu</strong>ngen und Bälle mit ausgelassenem Karnevalsprogramm und -treiben statt. Der „offizielle“ Sit<strong>zu</strong>ngskarneval fin<strong>de</strong>t seine Anhängerschaft<br />
überwiegend im älteren und konservativeren Publikum. Vor allem <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n „Prunk“-Sit<strong>zu</strong>ngen fin<strong>de</strong>t sich die lokale Polit- und Geldprominenz ein.<br />
In <strong>de</strong>n letzten Jahrzehnten etablierte sich eine Gegenbewegung <strong>zu</strong>m überwiegend vom „Festkomitee Kölner Karneval“ kontrollierten traditionellen Sit<strong>zu</strong>ngskarneval. Ihr Aushängeschild<br />
ist die Stunksit<strong>zu</strong>ng, mittlerweile die umsatzstärkste Veranstaltung <strong>de</strong>s Kölner Karnevals mit über 40 Veranstaltungstagen in <strong>de</strong>r Kölner Veranstaltungshalle „E-Werk“. Da<strong>zu</strong> kommt noch<br />
die schwul-lesbische Rosa Sit<strong>zu</strong>ng, ihre verschie<strong>de</strong>nen Sprösslinge und die Kneipen-Bewegung „Loss mer singe“, die je<strong>de</strong>s Jahr schon vor Karneval Tausen<strong>de</strong> von Menschen beim<br />
„Einsingen“ auf die neuen Lie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Session einstimmt.<br />
Die Session gipfelt im Straßen- und Kneipenkarneval. Dieser beginnt an Weiberfastnacht, also <strong>de</strong>m Donnerstag vor Rosenmontag und versetzt die Stadt am Rhein für die nächsten sechs<br />
Tage in eine Art Ausnahme<strong>zu</strong>stand, in <strong>de</strong>m das öffentliche Leben (Behör<strong>de</strong>n, Schulen, Geschäfte) <strong>zu</strong> einem großen Teil <strong>zu</strong>m Erliegen kommt. In dieser Zeit fin<strong>de</strong>n auch die zahlreichen<br />
Karnevalszüge in <strong>de</strong>n einzelnen Stadtvierteln statt, <strong>de</strong>ren größter <strong>de</strong>r Rosenmontags<strong>zu</strong>g in <strong>de</strong>r Innenstadt ist.<br />
Eine Beson<strong>de</strong>rheit ist <strong>de</strong>r Geister<strong>zu</strong>g: Im Jahr 1991, als wegen <strong>de</strong>s Zweiten Golfkriegs <strong>de</strong>r offizielle Straßenkarneval und mit ihm auch <strong>de</strong>r Rosenmontags<strong>zu</strong>g ausfiel, lebte die alte<br />
Tradition <strong>de</strong>s Geister<strong>zu</strong>gs wie<strong>de</strong>r auf. So folgen nichtorganisierte Gruppen <strong>de</strong>m Ääzebär, <strong>de</strong>r die kalte Jahreszeit vertreiben soll. Seit<strong>de</strong>m fand je<strong>de</strong>n Karnevalssamstag <strong>de</strong>r Kölner<br />
Geister<strong>zu</strong>g statt, <strong>de</strong>r nachts durch verschie<strong>de</strong>ne Viertel <strong>de</strong>r Stadt zog. Wo es die Sicherheit erlaubte, wur<strong>de</strong> hierfür von <strong>de</strong>r Stadt die Straßenbeleuchtung abgeschaltet. Der Geister<strong>zu</strong>g<br />
2006 wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>nächst wegen Geldmangel abgesagt, fand aber, nach diversen Aufrufen <strong>zu</strong> „wil<strong>de</strong>n Umzügen“ im Internet, doch statt.<br />
Regelmäßige Veranstaltungen<br />
Die größte öffentliche Veranstaltung in Köln ist <strong>de</strong>r Karneval, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>ssen Sessionen und Umzügen in <strong>de</strong>r Karnevalswoche jährlich etwa zwei Millionen Gäste erwartet wer<strong>de</strong>n. Auf <strong>de</strong>m<br />
zweiten Platz folgt mit regelmäßig über einer Million Besuchern Cologne Pri<strong>de</strong>, nach <strong>de</strong>m Christopher Street Day auch „CSD-Para<strong>de</strong>“ genannt, die größte Lesben- und Schwulen-Para<strong>de</strong><br />
in Deutschland. Diese fin<strong>de</strong>t immer am ersten Wochenen<strong>de</strong> im Juli statt und wird von einem zweiwöchigen Rahmenprogramm ergänzt. Im Juli fin<strong>de</strong>n auch die Kölner Lichter, ein<br />
Musik- und Feuerwerksspektakel am Rhein hun<strong>de</strong>rttausen<strong>de</strong> Zuschauer.<br />
Das Ringfest, eine große Musikveranstaltung an <strong>de</strong>n Kölner Ringen mit freiem Eintritt, fin<strong>de</strong>t seit 2006 wegen finanzieller Schwierigkeiten nicht mehr statt.[24] Seit <strong>de</strong>m Weg<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r<br />
Musikmesse Popkomm nach Berlin ist hier ein bun<strong>de</strong>sweit Maßstäbe setzen<strong>de</strong>s Großevent fortgefallen. Mit <strong>de</strong>r c/o pop (Cologne On Pop), einem Festival für elektronische Popkultur,<br />
versucht die Stadt ein kleiner und spezieller dimensioniertes Musikfest <strong>zu</strong> etablieren. Steigen<strong>de</strong> Besucherzahlen und gute Kritiken scheinen diese Strategie <strong>zu</strong> belohnen. Weitere<br />
Musikveranstaltungen sind die MusikTriennale Köln, ein Festival mit Musik <strong>de</strong>s 20. und 21. Jahrhun<strong>de</strong>rts, <strong>de</strong>r Summerjam, größtes Reggae-Festival Europas am ersten Juli-Wochenen<strong>de</strong><br />
sowie die Orgelfeierstun<strong>de</strong>n, international besetzte Orgelkonzerte im Kölner Dom.<br />
Weitere Veranstaltungen sind die seit 2000 mit <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>m Erfolg und stetig wachsen<strong>de</strong>m Publikum stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Lit.Cologne, ein mittlerweile fünftägiges Literaturfestival, das<br />
Internationale Köln Comedy Festival mit 120 Veranstaltungen, die Lesebühne am Brüsseler Platz, die Jüdischen Kulturtage im Rheinland, an <strong>de</strong>nen die Stadt regelmäßig teilnimmt. Es<br />
gibt zwei große Jahrmärkte, die Frühjahrs- und die Herbstkirmes am Deutzer Rheinufer. Die Bierbörse, ein internationales Bierfestival, fin<strong>de</strong>t auch in Köln statt.
Jährlich fin<strong>de</strong>t in Köln und Umgebung <strong>de</strong>r „KulturSonntag“ <strong>de</strong>s Kölner Stadt-Anzeigers statt, <strong>de</strong>r erwachsen ist aus <strong>de</strong>r Bewerbung <strong>de</strong>r Stadt Köln <strong>zu</strong>r Kulturhauptstadt Europas 2010,<br />
die dann an das Ruhrgebiet vergeben wur<strong>de</strong>. 2010 fand <strong>de</strong>r KulturSonntag <strong>zu</strong>m siebten Mal statt.<br />
Jährlich fin<strong>de</strong>t (meist im Juni) ganztägig <strong>de</strong>r „Tag <strong>de</strong>r Forts“ statt, bei <strong>de</strong>m die meist <strong>de</strong>nkmalgeschützten Relikte <strong>de</strong>r Kölner Stadtbefestigungen kostenfrei <strong>de</strong>r Öffentlichkeit mit<br />
zahlreichen Veranstaltungen (rund 50 Vorträge und Führungen an mehr als 30 Lokalitäten im gesamten Stadtgebiet) <strong>zu</strong>gänglich gemacht wer<strong>de</strong>n. Dabei stehen die preußischen<br />
Militäranlagen im Mittelpunkt. Berücksichtigt wer<strong>de</strong>n dabei auch neue Nut<strong>zu</strong>ngsmöglichkeiten sowie die ökologische Integration.<br />
Küche<br />
Köln ist geprägt von einer langen kulinarischen Tradition, die mit importierten, teils exotischen Elementen bereichert wur<strong>de</strong>. Wegen <strong>de</strong>r herausragen<strong>de</strong>n Position im internationalen<br />
Han<strong>de</strong>l wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Küche bereits in früher Zeit Hering, Muscheln, aber auch viele Gewürze verwen<strong>de</strong>t. Im Mittelalter, als <strong>de</strong>r Lachs noch reichlich im Rhein vorhan<strong>de</strong>n war, galt<br />
dieser Fisch als Arme-Leute-Essen, während <strong>de</strong>r Hering in <strong>de</strong>r bürgerlichen Küche sehr beliebt war. Der rheinische Heringsstipp mit Äpfeln, Zwiebeln und Sahne zeugt noch heute<br />
davon. Auch Muscheln rheinische Art sind heute noch Teil <strong>de</strong>r Gastronomie.<br />
Wie im Rheinland üblich, wird Süßes und Herzhaftes häufig kombiniert. Der gute Bo<strong>de</strong>n und das Klima sorgen <strong>zu</strong><strong>de</strong>m für eine große Rolle von Gemüse in <strong>de</strong>r Kölner Küche. Ein süßsaures<br />
Gericht <strong>de</strong>r Kölner Küche sind <strong>de</strong>r Rheinische Sauerbraten, welcher ursprünglich mit Pfer<strong>de</strong>fleisch <strong>zu</strong>bereitet wur<strong>de</strong> und das einfachere Himmel un Ääd, vermengtes Kartoffel-<br />
und Apfelmus, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m gebratene Blutwurst (Flönz) gereicht wird. Wirsing und Spargel wer<strong>de</strong>n häufig als Saisongemüse angeboten.<br />
Eine beson<strong>de</strong>re Rolle in Köln spielen die Brauhäuser. Diese dienten ursprünglich <strong>zu</strong>r Bierausgabe <strong>de</strong>r Kölner Brauereien, haben sich aber <strong>zu</strong>m Hauptanbieter bürgerlicher Küche in Köln<br />
entwickelt. Neben <strong>de</strong>n erwähnten Gerichten sind hier <strong>de</strong>ftige Mahlzeiten wie Krüstchen, Eisbein (Hämchen), Hachse und Reibekuchen (Rievkooche) <strong>zu</strong> erhalten. Aufgrund <strong>de</strong>s<br />
Herstellungsaufwan<strong>de</strong>s wer<strong>de</strong>n letztere häufig nur an bestimmten Tagen gereicht. Beliebt <strong>zu</strong>m Kölsch, das in <strong>de</strong>n Brauhäusern direkt aus <strong>de</strong>m Fass gezapft wird, sind Tatar, Flönz o<strong>de</strong>r<br />
Halver Hahn.<br />
Gebäckspezialitäten sind Mutze, Mutzeman<strong>de</strong>ln und Krapfen sowie eine Vielzahl an ge<strong>de</strong>ckten und unge<strong>de</strong>ckten Torten, die hauptsächlich mit Äpfeln und Pflaumen garniert wer<strong>de</strong>n.<br />
Gesüßt wird bisweilen mit Zuckerrübensirup (Rübenkraut), das auch als Brotaufstrich benutzt wird.<br />
Wirtschaft und Infrastruktur<br />
Die Wirtschaft Kölns ist geprägt durch die Lebensmittelindustrie, <strong>de</strong>n Automobilbau, die Chemische Industrie und die Medien. Aber auch <strong>de</strong>r tertiäre Sektor mit Forschung, Verwaltung,<br />
Messe, Versicherungen, Banken und <strong>de</strong>n Zentralen von großen Industriebetrieben ist be<strong>de</strong>utend in <strong>de</strong>r und für die Stadt. Da<strong>zu</strong> kommt <strong>de</strong>r Tourismus. Die Geschichte <strong>de</strong>r Wirtschaft<br />
Kölns und <strong>de</strong>r Region wird dokumentiert und aufbereitet im Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchiv (RWWA).<br />
Messen<br />
Die bekanntesten Messen im Rahmen <strong>de</strong>r Koelnmesse sind:<br />
• die Anuga, eine Fachmesse <strong>de</strong>r Ernährungswirtschaft und Nahrungsmittelindustrie<br />
• die gamescom, eine Messe für interaktive Unterhaltungselektronik<br />
• die Photokina, eine Fachmesse <strong>de</strong>r Foto-Industrie<br />
• die Art Cologne, eine Fachmesse für Mo<strong>de</strong>rne Kunst<br />
• die imm cologne, eine Fachmesse für Möbel und Einrichtung<br />
• die intermot, Internationale Motorrad- und Rollermesse<br />
• die spogagafa, Fachmesse für Sportartikel, Campingbedarf und Gartenmöbel<br />
• die Mo<strong>de</strong>llbahn, eine Fachmesse für Mo<strong>de</strong>llbahnfans
Verkehr<br />
Schienenverkehr<br />
Der Kölner Hauptbahnhof ist die westliche Drehscheibe Deutschlands <strong>de</strong>s internationalen Schienenfernverkehrs. Von hier führen Bahnlinien in alle Richtungen:<br />
• Euskirchen–Trier (Eifelstrecke)<br />
• Düren–Aachen (Ausbaustrecke Köln–Aachen), Paris<br />
• Mönchengladbach<br />
• Neuss über Bergheim (Erftbahn)<br />
• Neuss–Krefeld über Dormagen (linksrheinisch)<br />
• Düsseldorf–Duisburg–Ruhrgebiet (rechtsrheinisch)<br />
• Opla<strong>de</strong>n–Gruiten–Wuppertal<br />
• Bergisch Gladbach<br />
• Gummersbach–Marienhei<strong>de</strong> (Aggertalbahn)<br />
• Siegburg–Siegen (Siegstrecke)<br />
• Frankfurt am Main (Schnellfahrstrecke Köln–Rhein/Main)<br />
• Troisdorf–Neuwied–Koblenz (Rechte Rheinstrecke)<br />
• Bonn–Koblenz (Linke Rheinstrecke)<br />
Luftverkehr<br />
Im Südosten <strong>de</strong>s Stadtgebiets, im Stadtbezirk Porz, befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Flughafen Köln/Bonn. Er ist einer <strong>de</strong>r umschlagsstärksten <strong>de</strong>utschen Frachtflughäfen (über 650.000 Tonnen im Jahr<br />
2005), das Europa-Drehkreuz von UPS Airlines und ein wichtiges Drehkreuz für Billigflieger (9,4 Mio. Passagiere 2005). Auf <strong>de</strong>m militärischen Teil sind die Flugzeuge und die Führung<br />
<strong>de</strong>r Flugbereitschaft <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>sministeriums <strong>de</strong>r Verteidigung stationiert. Seit 1994 trägt er <strong>de</strong>n Namen Konrad-A<strong>de</strong>nauer-Flughafen. Der Flughafen Köln/Bonn gehört mit <strong>de</strong>n<br />
Flughäfen Leipzig/Halle und Nürnberg <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Flughäfen ohne Nachtflugbeschränkung. Es wer<strong>de</strong>n 139 Flugziele in 38 Län<strong>de</strong>rn angeboten.<br />
Straßenverkehr<br />
Der Straßenverkehr in Köln ist von hoher Be<strong>de</strong>utung. Die wichtigsten Fernverkehrsstraßen bil<strong>de</strong>n die Autobahnen 3 und 4, die im Osten Kölns <strong>de</strong>n Kölner Autobahnring bil<strong>de</strong>n. Hier<br />
wur<strong>de</strong> die zweithöchste Verkehrsdichte nach <strong>de</strong>m Autobahndreieck Funkturm in Berlin gemessen. Eine weitere wichtige Verkehrsa<strong>de</strong>r ist die Autobahn 1, die im Westen von Köln im<br />
Kölner Ring verläuft.<br />
Im Sü<strong>de</strong>n von Köln bil<strong>de</strong>t die Autobahn 59 einen Teil <strong>de</strong>r „Flughafenautobahn“, die über <strong>de</strong>n Flughafen Köln/Bonn verläuft. Neben <strong>de</strong>n Autobahnen bil<strong>de</strong>n Bun<strong>de</strong>sstraßen in Köln die so<br />
genannten Inneren Ringe. Trotz <strong>de</strong>r guten Verkehrsanbindungen bil<strong>de</strong>n sich beson<strong>de</strong>rs im Kölner Osten viele Verkehrsstauungen. Hier befin<strong>de</strong>t sich eine Großbaustelle auf <strong>de</strong>r Autobahn<br />
3. Eine weitere wichtige Autobahn ist die Autobahn 57, die von <strong>de</strong>r Kölner Stadtmitte über Neuss nach Krefeld verläuft.<br />
In <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong>r aufgegebenen Planungen für die Kölner Stadtautobahn existieren mit <strong>de</strong>r B 55a und <strong>de</strong>r A 559 zwei autobahnartig ausgebaute Ein- und Ausfallstraßen. Im<br />
linksrheinischen Köln ist das Hauptstraßennetz innerhalb <strong>de</strong>s Autobahnrings geprägt durch vier Ringstraßen, die <strong>de</strong>m Verlauf früherer Stadtbefestigungen folgen. An <strong>de</strong>r innersten<br />
Ringstraße beginnt eine Vielzahl von Radialstraßen, die alle nach Orten benannt sind, in <strong>de</strong>ren Richtung sie von Köln aus führen.<br />
Schiffsverkehr
In Köln gibt es mehrere Rheinfähren, <strong>de</strong>ren Be<strong>de</strong>utung durch Brücken zwar stark <strong>zu</strong>rückging, die aber nach wie vor nicht nur touristische Be<strong>de</strong>utung haben. Die weiße Flotte <strong>de</strong>r KD<br />
(Köln-Düsseldorfer Schifffahrtsgesellschaft) beför<strong>de</strong>rt Personen auf <strong>de</strong>m gesamten Rhein und in geringem Umfang auch an<strong>de</strong>rswo.<br />
Für <strong>de</strong>n Güterverkehr auf <strong>de</strong>m Rhein war Köln durch das Stapelrecht im gesamten Mittelalter Drehkreuz zwischen <strong>de</strong>n „nie<strong>de</strong>ren Lan<strong>de</strong>n“ und <strong>de</strong>m höher gelegenen Deutschland. Köln<br />
hat zahlreiche Häfen. Erst nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg ging die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Innenstadthäfen allmählich <strong>zu</strong>rück, wur<strong>de</strong>n aber <strong>zu</strong>gleich mit <strong>de</strong>r Stadterweiterung im Nor<strong>de</strong>n<br />
umfangreiche neue Hafenanlagen möglich.<br />
Nahverkehr<br />
Den öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) bedienen S-Bahn-Linien, die Stadtbahn- und Buslinien <strong>de</strong>r Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) sowie Buslinien an<strong>de</strong>rer<br />
Verkehrsgesellschaften. Alle Verkehrsmittel in Köln sind <strong>zu</strong> einheitlichen Preisen innerhalb <strong>de</strong>s Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS) benutzbar. Dieser ist mit <strong>de</strong>m benachbarten<br />
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) verzahnt. Siehe auch Nord-Süd-Stadtbahn (im Bau).<br />
Ungefähr 2000 Kölner Taxifahrer in ihren rund 1200 <strong>zu</strong>gelassenen Fahrzeugen[25] stehen rund um die Uhr <strong>zu</strong>r Verfügung.<br />
Eine Beson<strong>de</strong>rheit ist die Rheinseilbahn, sie war bis 2010, vor Bau <strong>de</strong>r Rheinseilbahn <strong>zu</strong>r Bun<strong>de</strong>sgartenschau 2011 in Koblenz, die einzige in Betrieb befindliche Seilbahn <strong>zu</strong>r<br />
Überquerung eines Flusses in Deutschland. Angelegt wur<strong>de</strong> sie anlässlich <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sgartenschau 1957.<br />
Öffentliche Einrichtungen<br />
Köln ist Sitz zahlreicher Körperschaften <strong>de</strong>s öffentlichen Rechts. Neben einer Vielzahl von Bun<strong>de</strong>s- und Lan<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong>n haben auch kirchliche Organisationen, Verbän<strong>de</strong> und Vereine<br />
ihren Hauptsitz in Köln. Allgemeine Gerichte sind bis <strong>zu</strong>r Ebene <strong>de</strong>r Oberlan<strong>de</strong>sgerichte in Köln ansässig, auch die Finanz-, Sozial-, Verwaltungs- und Arbeitsgerichtsbarkeit ist dort<br />
vertreten.<br />
Bun<strong>de</strong>soberbehör<strong>de</strong>n mit Sitz in Köln sind <strong>de</strong>r Militärischen Abschirmdienst, das Bun<strong>de</strong>samt für Güterverkehr, das Bun<strong>de</strong>samt für Verfassungsschutz, das Bun<strong>de</strong>samt für <strong>de</strong>n Zivildienst,<br />
die Germany Tra<strong>de</strong> and Invest, das Bun<strong>de</strong>sverwaltungsamt, die Bun<strong>de</strong>szentrale für gesundheitliche Aufklärung, das Zollkriminalamt und das DIMDI.<br />
Die Bun<strong>de</strong>swehr hat in Köln eine Reihe von Schlüsselbehör<strong>de</strong>n eingerichtet; hier sitzen unter an<strong>de</strong>rem das Heeresamt, das Luftwaffenamt und das Luftwaffenführungskommando, die<br />
Offizierbewerberprüfzentrale (OPZ), das Personalamt, die Stammdienststelle <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>swehr und eine Sportför<strong>de</strong>rgruppe.<br />
Lan<strong>de</strong>sbehör<strong>de</strong>n wie das hbz und übergeordnete kommunale Einrichtungen wie <strong>de</strong>r Deutsche Städtetag, die Bun<strong>de</strong>svereinigung <strong>de</strong>r kommunalen Spitzenverbän<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r<br />
Landschaftsverband Rheinland und die <strong>de</strong>utsche Sektion <strong>de</strong>s Rat <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n und Regionen Europas haben ebenfalls ihren Sitz in Köln. Mit <strong>de</strong>r EASA ist auch eine europäische<br />
Behör<strong>de</strong> vertreten.<br />
Wichtige Verbän<strong>de</strong>, Vereine und kirchliche Organisationen mit Sitz in Köln sind unter an<strong>de</strong>rem:<br />
• Bun<strong>de</strong>sverband <strong>de</strong>r Deutschen Industrie (BDI)<br />
• Bun<strong>de</strong>sverband <strong>de</strong>utscher Banken<br />
• Bun<strong>de</strong>svereinigung <strong>de</strong>r Deutschen Arbeitgeberverbän<strong>de</strong> (BDA)<br />
• Deutscher Bühnenverein, <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sverband <strong>de</strong>utscher Theater<br />
• Gebührenein<strong>zu</strong>gszentrale <strong>de</strong>r öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland (GEZ)<br />
• Die Heilsarmee in Deutschland<br />
• Kirchliche Zusatzversorgungskasse <strong>de</strong>s Verban<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r Diözesen Deutschlands<br />
• Kolpingwerk Deutschland, Kolpingwerk Europa und Kolpingwerk International<br />
• Malteser Hilfsdienst
• PKV – Verband <strong>de</strong>r privaten Krankenversicherung<br />
Hochschulen<br />
Derzeit gibt es elf staatliche und private Hochschulen in Köln mit zahlreichen unterschiedlichen Studienrichtungen. Sie prägen das Bild <strong>de</strong>r Stadt Köln, neben Berlin und München eine<br />
<strong>de</strong>r drei größten Hochschulstädte Deutschlands. Den Ruf als multikulturelle Stadt hat Köln auch, weil viele <strong>de</strong>r Einwohner Stu<strong>de</strong>nten sind, die nicht nur aus Köln, son<strong>de</strong>rn aus ganz<br />
Deutschland und <strong>de</strong>r Welt stammen.<br />
Medien<br />
Köln ist neben Berlin, Hamburg und München mit etwa 30.000 bis 40.000 Beschäftigten in diesem Bereich einer <strong>de</strong>r größten und wichtigsten Medienstandorte in Deutschland. Die<br />
Medienlandschaft ist vielseitig; neben <strong>de</strong>n großen Unternehmen und Anstalten <strong>de</strong>r Fernseh- und Hörfunkproduktion und <strong>de</strong>n großen Verlagshäusern hat sich in Köln eine sehr<br />
differenzierte Zulieferindustrie entwickelt, die von Agenturen über Produktionsfirmen bis <strong>zu</strong> technischen Ausstattern ein breites Spektrum umfasst.<br />
Hörfunk, Fernsehen und Musikindustrie<br />
Allein <strong>de</strong>r West<strong>de</strong>utsche Rundfunk (WDR) beschäftigt an seinem Hauptsitz in Köln 3500 Mitarbeiter und betreibt neben <strong>de</strong>m WDR-Fernsehen fünf Hörfunkprogramme. Auch <strong>de</strong>r<br />
Deutschlandfunk hat als öffentlich-rechtlicher Sen<strong>de</strong>r hier seinen Sitz, bis <strong>zu</strong> ihrem Um<strong>zu</strong>g nach Bonn im Jahre 2003 außer<strong>de</strong>m die Deutsche Welle. Zwischen Januar 1954 und Oktober<br />
1990 war im Kölner Stadtteil Marienburg auch <strong>de</strong>r britische Militärsen<strong>de</strong>r BFBS angesie<strong>de</strong>lt. Der Hörfunk ist in Köln neben <strong>de</strong>n öffentlich-rechtlichen Sen<strong>de</strong>rn auch mit <strong>de</strong>r lokalen<br />
Welle Radio Köln sowie diversen kleineren Radiosen<strong>de</strong>rn vertreten.<br />
Die <strong>zu</strong>r RTL Group gehören<strong>de</strong>n privaten Fernsehsen<strong>de</strong>r RTL Television, Super RTL, VOX und n-tv haben ihren gemeinsamen Hauptsitz in die Rheinhallen im Kölner Stadtzentrum<br />
verlegt. Seit Oktober 2005 berichtet <strong>de</strong>r Fernsehsen<strong>de</strong>r Center.TV täglich ausschließlich über das Geschehen in und um Köln. In Köln hat <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die Gebührenein<strong>zu</strong>gszentrale GEZ ihren<br />
Sitz.<br />
Neben EMI Music Germany, die im August 2000 ihren Hauptsitz vom Maarweg im Stadtteil Braunsfeld in <strong>de</strong>n Mediapark verlegte, sind in Köln noch weitere kleinere Plattenlabels und<br />
Musikverlage ansässig.<br />
Die GIGA Digital Television GmbH hatte bis <strong>zu</strong>r Einstellung <strong>de</strong>s Sen<strong>de</strong>betriebs am 13. März 2009 ihre Studios in Köln.<br />
Printmedien<br />
Köln verfügt mit <strong>de</strong>m Verlag M. DuMont Schauberg über ein Zeitungshaus von <strong>de</strong>utschlandweiter Be<strong>de</strong>utung: Sowohl <strong>de</strong>r Kölner Stadt-Anzeiger als auch die Kölnische Rundschau,<br />
<strong>de</strong>ren gemeinsames Verbreitungsgebiet neben Köln und <strong>de</strong>m unmittelbaren Umland bis weit in die Eifel und das Bergische Land reicht, erscheinen hier. Das im selben Hause produzierte<br />
Boulevardblatt Express wird auch im Raum Düsseldorf verbreitet. Als in Köln erscheinen<strong>de</strong> Printmedien sind außer<strong>de</strong>m die Wirtschaftszeitschriften Capital und Impulse <strong>zu</strong> nennen.<br />
Örtliche Be<strong>de</strong>utung haben die monatlich erscheinen<strong>de</strong>n Stadtillustrierten StadtRevue und Kölner. Der Taschen-Verlag ist als international operieren<strong>de</strong>r Buchverlag mit thematischen<br />
Schwerpunkten in Kunst, Architektur und Erotik bekannt. Mit Kiepenheuer & Witsch und <strong>de</strong>m DuMont Literaturverlag beherbergt die Stadt be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> literarische Verlage. Der 1918<br />
gegrün<strong>de</strong>te subreport Verlag Schawe hat seinen Sitz seit seiner Gründung in Köln.<br />
Einrichtungen und Standorte<br />
Wichtige Medien-Einrichtungen in Köln sind beispielsweise die Kunsthochschule für Medien Köln, die Internationale Filmschule Köln und die GAG Aca<strong>de</strong>my für Nachwuchs-<br />
Comedians. Köln ist Sitz <strong>de</strong>s Filmbüros Nordrhein-Westfalen. Beson<strong>de</strong>rs im Belgischen Viertel sind viele kleine Filmproduktionsfirmen angesie<strong>de</strong>lt, die meist nicht selbst drehen,<br />
son<strong>de</strong>rn größere Filmproduktionsfirmen mit einzelnen Dienstleistungen und technischer Ausstattung unterstützen.<br />
Medienstandorte sind in Köln über das ganze Stadtgebiet verteilt. Innerstädtisch gelegen ist neben <strong>de</strong>n Hauptsitzen <strong>de</strong>r großen Sen<strong>de</strong>r auch <strong>de</strong>r Mediapark am Hansaring (20 ha, 174.000
m² Bürofläche), <strong>de</strong>r von 1992 bis 2003 auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ehemaligen Rangierbahnhofs Gereon errichtet wur<strong>de</strong>. In <strong>de</strong>n mo<strong>de</strong>rnen Gebäu<strong>de</strong>n im Mediapark, darunter <strong>de</strong>r 148 Meter<br />
hohe KölnTurm, sind etwa 250 Firmen mit etwa 5000 Beschäftigten angesie<strong>de</strong>lt, von <strong>de</strong>nen gut 60 Prozent im Medien- und Kommunikationsbereich tätig sind.<br />
Flächenverbrauchen<strong>de</strong> Studios und Filmproduktionsstätten dagegen liegen an <strong>de</strong>r Peripherie, wie etwa die WDR-Studiogelän<strong>de</strong> in Bocklemünd o<strong>de</strong>r das Medienzentrum Mülheim. Auf<br />
Teilen eines ehemaligen Fabrikgelän<strong>de</strong>s haben sich dort rund um die große Veranstaltungshalle E-Werk viele Künstler und Agenturen angesie<strong>de</strong>lt. Auch einige TV-Studios sind dort <strong>zu</strong><br />
fin<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>nen unter an<strong>de</strong>ren für Sat.1 und ProSieben produziert wird.<br />
Außer<strong>de</strong>m befin<strong>de</strong>t sich im Nordwesten <strong>de</strong>r Stadt (auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ehemaligen Militärflughafens Butzweilerhof) das Coloneum, Europas größter Studiokomplex mit einer Fläche<br />
von 35 Hektar und 20 Studios (25.000 m²) mit bis <strong>zu</strong> 30 Meter Deckenhöhe. Im Südwesten <strong>de</strong>r Stadt zwischen Köln und Hürth wur<strong>de</strong>n große Studiokomplexe für Nobeo und MMC<br />
errichtet, in <strong>de</strong>nen viele Shows für Sat.1 und RTL produziert wer<strong>de</strong>n, unter an<strong>de</strong>rem von <strong>de</strong>r Produktionsfirma action concept.<br />
Persönlichkeiten<br />
Ehrenbürger<br />
Köln hat zwischen 1823 und 2007 24 Personen das Ehrenbürgerrecht verliehen. Siehe auch: Liste <strong>de</strong>r Ehrenbürger von Köln.<br />
Seit 2002 verleiht, parallel <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r offiziellen Ehrenbürgerschaft, <strong>de</strong>r „Initiativkreis alternative Ehrenbürgerschaft“ die Alternative Kölner Ehrenbürgerschaft.<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
Be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Persönlichkeiten Kölns sind in <strong>de</strong>r Liste <strong>de</strong>r Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt Köln (+ Liste <strong>de</strong>r sonstigen berühmten Kölner) und in <strong>de</strong>r Liste <strong>de</strong>r Erzbischöfe und Bischöfe von<br />
Köln <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n.<br />
Literatur<br />
Bildbän<strong>de</strong><br />
• Detlev Arens, Celia Körber-Leupold: Köln. Eine große Stadt in Bil<strong>de</strong>rn. Greven, Köln 2006, ISBN 3-7743-0378-9.<br />
• Patrick Essex und Tobias Bungter: KölnGut. Dabbelju, Köln 2009, ISBN 3-9396-66130.<br />
• Paul Wietzorek: Das historische Köln. Bil<strong>de</strong>r erzählen. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2006, ISBN 978-3-86568-115-7.<br />
Lexika<br />
• Jürgen Wilhelm (Hrsg.): Das große Köln-Lexikon. Greven, Köln 2005, ISBN 3-7743-0355-X (rund 1130 Artikel von A bis Z von Autorenkollektiv).<br />
• Ulrich S. Soénius, Jürgen Wilhelm (Hrsg.): Kölner Personen-Lexikon. Greven, Köln 2007, ISBN 3-7743-0400-9 (rund 1850 Artikel <strong>zu</strong> verstorbenen Persönlichkeiten <strong>de</strong>r 2000jährigen<br />
Kölner Stadtgeschichte von 50 Autoren).<br />
Städtebücher und Atlanten, Straßen<br />
• Hansgerd Hellenkemper, Emil Meynen: Stadtmappe Köln. In: Heinz Stoob, Wilfried Ehbrecht, Jürgen Lafrenz und Peter Johannek (Hrsg.): Deutscher Städteatlas. Band 2, Teil 2.<br />
Dortmund 1979, ISBN 3-89115-317-1.<br />
• Dorothea Wiktorin u. a. (Hrsg.): Köln, <strong>de</strong>r historisch- topographische Atlas. Emons, Köln 2001, ISBN 3-89705-229-6.<br />
• Preußens Städte – Denkschrift <strong>zu</strong>m 100-jährigen Jubiläum <strong>de</strong>r Städteordnung vom 19. November 1808; hrsg. im Auftrag <strong>de</strong>s Vorstan<strong>de</strong>s <strong>de</strong>s Preußischen Städtetages von Prof.<br />
Dr. Heinrich Silbergleit, Berlin 1908.
• Erich Keyser (Hrsg.): Rheinisches Städtebuch; Band III 3. Teilband aus Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte. Im Auftrage <strong>de</strong>r Arbeitsgemeinschaft <strong>de</strong>r<br />
historischen Kommissionen und mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Deutschen Städtetages, <strong>de</strong>s Deutschen Städtebun<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>s Deutschen Gemein<strong>de</strong>tages. Stuttgart 1956.<br />
• Helmut Signon/Klaus Schmidt: Alle Straßen führen durch Köln. 3. Auflage. Greven, Köln 2006, ISBN 3-7743-0379-7.<br />
• Literarisches Köln. Der Dichter und Denker Stadtplan. Ansgar Bach, Jörg Reichwald (Mitarb.), Verlag Jena 1800, Berlin 2002.<br />
• Uschi Baetz (Text) und Jürgen Scha<strong>de</strong>n-Wargalla (Fotografien): Einfach Köln. 9 Stadttouren in leichter Sprache. Bachem, Köln 2009, ISBN 978-3-7616-2193-6 (Stadtführer in<br />
Großdruck).<br />
Monographien<br />
• Christian Bartz: Köln im Dreißigjährigen Krieg. Die Politik <strong>de</strong>s Rates <strong>de</strong>r Stadt (1618–1635). Vorwiegend anhand <strong>de</strong>r Ratsprotokolle im Historischen Archiv <strong>de</strong>r Stadt Köln.<br />
Frankfurt am Main 2005, ISBN 3-631-53434-5 (Militärhistorische Untersuchungen. Band 6).<br />
• Verena Berchem: Das Oberlan<strong>de</strong>sgericht Köln in <strong>de</strong>r Weimarer Republik (Rechtsgeschichtliche Schriften Band 17). Böhlau, Köln 2004, Rezension von Thomas Roth in:<br />
Geschichte in Köln Band 53, Dezember 2006, SH-Verlag Köln, S. 202–203 „Buchbesprechungen“.<br />
• Gerhard Cur<strong>de</strong>s, Markus Ulrich: Die Entwicklung <strong>de</strong>s Kölner Stadtraumes. Der Einfluss von Leitbil<strong>de</strong>rn und Innovationen auf die Form <strong>de</strong>r Stadt. Dortmun<strong>de</strong>r Vertrieb für Bau-<br />
und Planungsliteratur, Dortmund 1997, ISBN 3-929797-36-4.<br />
• Georg Dehio u. a.: Rheinland. München 2005, ISBN 3-422-03093-X (Handbuch <strong>de</strong>r Deutschen Kunst<strong>de</strong>nkmäler. Nordrhein-Westfalen 1.).<br />
• Werner Eck: Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen <strong>de</strong>s Imperium Romanum. Greven, Köln 2004, ISBN 3-7743-0357-6 (Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln in 13<br />
Bän<strong>de</strong>n. Band 1).<br />
• Hiltrud Kier: Kleine Kunstgeschichte Kölns. Beck, München 2001, ISBN 3-406-47170-6.<br />
• Martin Rüther: Köln im Zweiten Weltkrieg. Alltag und Erfahrungen zwischen 1939 und 1945. Emons, Köln 2005, ISBN 3-89705-407-8 (Schriften <strong>de</strong>s NS-<br />
Dokumentationszentrums <strong>de</strong>r Stadt Köln. Band 12).<br />
• Christian Schuh: Kölns 85 Stadtteile. Geschichte, Daten, Fakten, Namen. Von A wie Altstadt bis Z wie Zündorf. Emons, Köln 2003, ISBN 3-89705-278-4.<br />
• Arnold Stelzmann, Robert Frohn: Illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. 11. Auflage. Bachem, Köln 1990, ISBN 3-7616-0973-6 (1. Auflage 1958).<br />
• Bernhard van Treeck: Street Art Köln. Edition Aragon, Moers 1996, ISBN 3-89535-434-1.<br />
• Gerta Wolff: Das Römisch-Germanische Köln. Führer <strong>zu</strong> Museum und Stadt. Bachem, Köln 2000, ISBN 3-7616-1370-9.<br />
Reiseliteratur<br />
• Maik Kopleck (Hrsg.), Gregory Piatkowski: Von <strong>de</strong>r Colonia Agrippina bis <strong>zu</strong>m „Deutschen Herbst“. PastFin<strong>de</strong>r, Düsseldorf 2008, ISBN 978-988-99780-4-4 (Reihe PastFin<strong>de</strong>r<br />
ZikZak.).<br />
• Köln, Merian-Hefte Dezember 1979 und Juli 1988.<br />
• Dieter Luippold (Redaktion), Achim Bourmer u.&npsp;a.: Köln. 10. Auflage. Bae<strong>de</strong>ker, Ostfil<strong>de</strong>rn 2007, ISBN 978-3-8297-1131-9 (Reihe Bae<strong>de</strong>ker-Allianz-Reiseführer.).<br />
• Martin Stankowski Darum ist es am Rhein so schön. Vom Kölner Dom <strong>zu</strong>r Loreley. Der an<strong>de</strong>re Reiseführer. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2009, ISBN 978-3-462-04107-1.<br />
• Kirstin Kabasci: Köln'. Reise-Know-How-Verlag, Bielefeld 2006, ISBN 3-8317-1396-0.<br />
Historisches<br />
Zeitschriften<br />
• Geschichte in Köln. Zeitschrift für Stadt- und Regionalgeschichte (erscheint jährlich mit einem Band; 2008 erschien Band 55, SH-Verlag Köln)<br />
• Jahrbuch <strong>de</strong>s Kölnischen Geschichtsvereins e. V. (erscheint jährlich mit einem Band, 2008 erschien Jahrbuch 79, SH-Verlag Köln; in unregelmäßigen Abstän<strong>de</strong>n erscheinen
Beihefte)<br />
Monographien und Sonstiges<br />
• Carl Dietmar Jung, Werner Jung: Kleine illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. 10. Auflage, Bachem, Köln 2009, ISBN 978-3-7616-2226-1 (Son<strong>de</strong>rausgabe Historisches Archiv<br />
<strong>de</strong>r Stadt Köln.).<br />
• Sonja Endres: Zwangssterilisation in Köln 1934–1945. Emons, Köln 2009, ISBN 978-3-89705-697-8 (Schriften <strong>de</strong>s NS-Dokumentationszentrums. Band 16).<br />
• Manfred Groten (Hrsg.): Hermann Weinsberg (1518–1597). Kölner Bürger und Ratsherr. Studien <strong>zu</strong> Leben und Werk. SH-Verlag, Köln 2006, ISBN 3-89498-152-0 (Geschichte<br />
in Köln. Beiheft 1).<br />
• Alexan<strong>de</strong>r Kuffner: Zeitreiseführer Köln 1933–1945. Helios, Aachen 2009, ISBN 978-3-938208-92-2.<br />
• Horst Matzerath: Köln in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus 1933–1945. Greven, Köln 2009, ISBN 978-3-7743-0429-1 (Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Band 12).<br />
• Klaus Müller: Köln von <strong>de</strong>r französischen <strong>zu</strong>r preussischen Herrschaft, 1794–1815. Greven, Köln 2005, ISBN 3-7743-0375-4 (Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Band 8).<br />
• Martin Rüther: Köln im Zweiten Weltkrieg. Alltag und Erfahrungen zwischen 1939 und 1945. Emons, Köln 2005, ISBN 3-89705-407-8.<br />
• Werner Schäfke und Marcus Trier (Hrsg.): Mittelalter in Köln. Eine Auswahl aus <strong>de</strong>n Bestän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Kölnischen Stadtmuseums. Emons, Köln 2009, ISBN 978-3-89705-654-1.<br />
• Norbert Trippen: Sein Wirken für die Weltkirche und seine letzten Bischofsjahre. Schöningh Verlag, Pa<strong>de</strong>rborn u. a. 2005 (Josef Kardinal Frings (1887–1978). Band 2,<br />
Veröffentlichungen <strong>de</strong>r Kommission für Zeitgeschichte Reihe B. Band 104, Rezension von Wolfgang Löhr in Geschichte in Köln. Zeitschrift für Stadt- und Regionalgeschichte.<br />
Band 53, Dezember 2006, S. 206–208).<br />
• Paul Wietzorek: Das historische Köln. Bil<strong>de</strong>r erzählen. Michael Imhof Verlag, Petersberg 2006, ISBN 978-3-86568-115-7.<br />
Architektur und Denkmalpflege<br />
• Ralf Beines, Walter Geis und Ulrich Krings (Hrsg.): Köln. Das Reiter<strong>de</strong>nkmal für Friedrich Wilhelm. von Preußen auf <strong>de</strong>m Heumarkt. Bachem, Köln 2004, ISBN 3-7616-1796-<br />
8 (Stadtspuren. Denkmäler in Köln. Band 31).<br />
• Annerose Berners: St. Aposteln in Köln. Untersuchungen <strong>zu</strong>r Geschichte eines mittelalterlichen Kollegiatsstifts bis ins 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Dissertationsdruck, Bonn 2004 (phil.<br />
Dissertation Bonn 2003, 2 Bän<strong>de</strong>).<br />
• Carl Dietmar, Marcus Trier: Mit <strong>de</strong>r U-Bahn in die Römerzeit. 2. Auflage Kiepenheuer & Witsch, Köln 2006, ISBN 3-462-03575-4.<br />
• Günther A. Menne, Christoph Nötzel (Hrsg.), Helmut Fußbroich, Celia Körber-Leupold: Evangelische Kirchen in Köln und Umgebung. Bachem, Köln 2007, ISBN 978-3-7616-<br />
1943-8.<br />
• Alexan<strong>de</strong>r Kierdorf (Hrsg.): Köln. Ein Architekturführer. Architectural Gui<strong>de</strong> to Cologne. Reimer, Berlin 1999, ISBN 3-496-01181-5 (<strong>de</strong>utsch und englisch).<br />
• Ulrich Krings, Rainer Will: Das Baptisterium am Dom. Kölns erste Taufort. Greven, Köln 2009, ISBN 978-3-7743-0423-9.<br />
• Werner Schäfke: Kölns romanische Kirchen. Architektur, Kunst, Geschichte. Emons, Köln 2004, ISBN 3-89705-321-7.<br />
• Irmgard Schnellbächer: Kölns kleine Kirchen aus romanischer Zeit. Teil 2. Bernardus, 2003, ISBN 3-937634-42-8.<br />
• Max-Leo Schwering u. a.: Köln. Braunsfeld – Melaten. Kölnisches Stadtmuseum, Köln 2004, ISBN 3-927396-93-1 (Publikationen <strong>de</strong>s Kölnischen Stadtmuseums. Band 6)<br />
Kunstgeschichte<br />
• Brigitte Corley: Maler und Stifter <strong>de</strong>s Spätmittelalters in Köln 1300–1500. Ludwig, Kiel 2009, ISBN 978-3-937719-78-8.<br />
Geologie/Geographie<br />
• Ernst Brunotte, Ralf Immendorf, Reinhold Schlimm: Die Naturlandschaft und ihre Umgestaltung durch <strong>de</strong>n Menschen. Erläuterungen <strong>zu</strong>r Hochschulexkursionskarte Köln und
Sport<br />
Umgebung. 2. Auflage Geographisches Institut, Köln 1994, ISSN 0454-1294 ( Kölner geographische Arbeiten. Heft 63).<br />
• Hanns Dieter Hil<strong>de</strong>n (Hrsg.): Geologie am Nie<strong>de</strong>rrhein. 4. Auflage. Geologisches Lan<strong>de</strong>samt Nordrhein-Westfalen, Krefeld 1988.<br />
• Roland Walter: Geologie von Mitteleuropa. 5. Auflage. Schweizerbart, Stuttgart 1992, ISBN 3-510-65149-9, S. 317 ff.<br />
• Sportamt <strong>de</strong>r Stadt Köln, Verein Kölner Sportgeschichte und Stadtsportbund Köln (Hrsg.): Sport für Köln. Gestern, heute, morgen. Köln 2009, ISBN 978-3-00-029016-9.<br />
• Erich Koprowski: 12 Radtouren rund um Köln. Droste, Düsseldorf 2010, ISBN 978-3-7700-1348-7.<br />
Unterhaltsames über Köln<br />
• Jürgen Becker: Biotop für Bekloppte. Ein Lesebuch für Immis und Heimathirsche. Kiepenheuer & Witsch, Köln 1995, ISBN 3-462-02423-X.<br />
• Friedhelm Biermann: Drei Könige, elftausend Jungfrauen und noch etwas mehr. Ein unterhaltsamer Streif<strong>zu</strong>g durch die Kölner Jahrhun<strong>de</strong>rte. Emons, Köln 2001, ISBN 3-89705-<br />
228-8.<br />
• Stephan Grünewald: Köln auf <strong>de</strong>r Couch. Die Unzerstörbarkeit <strong>de</strong>r Sehnsucht.Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008, ISBN 978-3-462-03814-9 (eine tiefsinnige Analyse <strong>de</strong>r Kölner<br />
Lebensart mit viel Humor).<br />
• Luise Holthausen, Maren Briswalter (Illustrationen): Der rätselhafte Römerfund. Marzellen, Köln, ISBN 978-3-937795-10-2 (Die Kölner Geschichts<strong>de</strong>tektive. Band 2;<br />
Kin<strong>de</strong>rkrimi).<br />
• Luise Holthausen, Maren Briswalter (Illustrationen): Raub im Stadtmuseum.Marzellen, Köln 2010, ISBN 978-3-937795-15-7 (Die Kölner Geschichts<strong>de</strong>tektive. Band 3;<br />
Kin<strong>de</strong>rkrimi).<br />
• Hanns Dieter Hüsch: Köln. Eulen, Freiburg 1993, ISBN 3-89102-235-2.<br />
• Bernd Imgrund: Ohne Rhein kein Dom. 33 spannen<strong>de</strong> und ungewöhnliche Gespräche aus <strong>de</strong>m Kölner Leben. Emons, Köln 2010, ISBN 978-3-89705-713-5.<br />
• Falko Ra<strong>de</strong>macher: Köln für Imis. Ein Leitfa<strong>de</strong>n durch die seltsamste Stadt <strong>de</strong>r Welt. Emons, Köln 2006, ISBN 3-89705-249-0.<br />
• Thomas R. P. Mielke: Colonia, Roman einer Stadt. Zweitausend Jahre Kölner Geschichte unterhaltsam erzählt. Lübbe, Bergisch Gladbach 2003, ISBN 3-404-14855-X.<br />
• Stephan Meyer (Redaktion): Kleiner kölscher Kosmos. LUND, Köln 2005, ISBN 3-938486-01-5.<br />
• Stephan Meyer (Redaktion): Das kölsche Liedbuch. LUND, Köln 2005, ISBN 3-938486-00-7.<br />
• August Kopisch: Die Heinzelmännchen <strong>zu</strong> Köln:<br />
• „Gemütlich auf <strong>de</strong>r faulen Haut liegen, einen erfrischen<strong>de</strong>n Schlaf genießen und wenn man aufsteht, ist die Arbeit getan. Wer träumt nicht auch von solch paradiesischen<br />
Zustän<strong>de</strong>n?! In Köln am Rhein waren sie einst Wirklichkeit.“ Die Heinzelmännchen bei gutenberg.spiegel.<strong>de</strong>, ISBN 3-933070-89-9.<br />
Karneval<br />
• Carl Dietmar, Marcus Leifeld: Alaaf und Heil Hitler. Karneval im Dritten Reich. Herbig, München 2010, ISBN 978-3-7766-2630-8.<br />
• Petra Metzger (Hrsg.): Karneval instandbesetzt? 25 Jahre Kölner Stunksit<strong>zu</strong>ng. Einem Phänomen auf <strong>de</strong>r Spur. Edition Arge Kulturi<strong>de</strong>e, Köln 2009, ISBN 978-3-00-029202-6.<br />
• Christine Westermann, Stefan Worring: Karneval. Bil<strong>de</strong>r und Geschichten. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2009, ISBN 978-3-462-03818-7.<br />
Medien<br />
• Rheinhard Zeese: 1900 Jahre befestigtes Köln. LEB, Brühl 2006 (CD-ROM).<br />
• Rheinhard Zeese: Historische Parks und öffentliche Gärten in Köln 1801 bis 1932.' LEB, Brühl 2007 (CD-ROM).
Religion<br />
• Wilma Falk-van Rees (Hrsg.): 400 Jahre evangelisch in Mülheim am Rhein 1610–2010. CMZ, Rheinbach 2009, ISBN 978-3-87062-400-2.<br />
• •udrun Schmidt: Machtvolles Schweigen. Die Männerwallfahrt nach Kalk. Bachem, Köln 2010, ISBN 978-3-7616-2403-6.<br />
Varia/Sonstiges<br />
• Petra Hartmann, Stephan Schmitz: Die Kölner Feuerwehr. Retten, löschen, bergen, schützen. Schmitz & Hartmann, Köln 2009.<br />
• Franz Sommerfeld (Hrsg.): Der Moscheestreit. Eine exemplarische Debatte über Einwan<strong>de</strong>rung und Integration. Kiepenheuer & Witsch, Köln 2008, ISBN 978-3-462-04010-4.<br />
• Literatur von und über Köln im Katalog <strong>de</strong>r Deutschen Nationalbibliothek<br />
Einzelnachweise und Anmerkungen<br />
1. ↑ Information und Technik Nordrhein-Westfalen – Amtliche Bevölkerungszahlen (Hilfe da<strong>zu</strong>)<br />
2. ↑ Statistisches Bun<strong>de</strong>samt – Städte nach Fläche und Bevölkerung<br />
3. ↑ Deutscher Wetterdienst > Klimadaten Deutschland > Klimadaten ausgewählter <strong>de</strong>utscher Stationen > Mittelwerte: Download <strong>de</strong>r Mittelwerte <strong>de</strong>s Nie<strong>de</strong>rschlags für <strong>de</strong>n<br />
Zeitraum 1961–1990 (338 kB)<br />
4. ↑ a b Urban Audit: How cities rank (englisch)<br />
5. ↑ Halle ist die regnerischste Stadt Europas. In: Der Spiegel. 23. September 2008, abgerufen am 6. Januar 2010.<br />
6. ↑ Bahnen im Rheinland, Cologne un<strong>de</strong>rground, 1) Das Lehrbergwerk unter <strong>de</strong>r Universität Status: 12. November 2009, abgerufen am 1. März 2010<br />
7. ↑ Karte <strong>de</strong>r Beben-Stationen in <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rrheinischen Bucht, Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen, abgerufen am 5. März 2010<br />
8. ↑ Seismisches Forschungsnetz Nie<strong>de</strong>rrheinische Bucht (SeFoNiB), unter an<strong>de</strong>rem finanziert von Deutsche Forschungsgemeinschaft, Hochschulbauför<strong>de</strong>rung (HBFG),<br />
abgerufen am 5. März 2010<br />
9. ↑ Liste <strong>de</strong>r letzten zehn registrierten natürlichen Erdbeben, Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen, abgerufen am 5. März 2010<br />
10.↑ Amt für Stadtentwicklung und Statistik <strong>de</strong>r Stadt Köln<br />
11.↑ Heinrich Gottfried Philipp Gengler: Regesten und Urkun<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Verfassungs- und Rechtsgeschichte <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Städte im Mittelalter. Erlangen 1863, S. 515–599 (online).<br />
12.↑ Arnold Stelzmann, Robert Frohn: Illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. 11. Auflage. Bachem, Köln 1990, ISBN 3-7616-0973-6, S. 233 f.<br />
13.↑ Carl Dietmar: Schreiben Sie Coburg mit K. In: Kölner Stadtanzeiger. 21. Dezember 2007, S. 32.<br />
14.↑ Carl Dietmar, Werner Jung: Kleine illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. 9. Auflage. Bachem, Köln 2002, ISBN 3-7616-1482-9, S. 271.<br />
15.↑ Ernst Wey<strong>de</strong>n: Geschichte <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n in Köln am Rhein von <strong>de</strong>r Römerzeit bis in die Gegenwart. Nebst Noten und Urkun<strong>de</strong>n. Köln 1867 (online).<br />
16.↑ a b Detlev Arens, Marianne Bongartz, Stephanie Henseler: Köln. DuMont, Ostfil<strong>de</strong>rn 2003, ISBN 3-7701-6025-8, S. 19.<br />
17.↑ Suska Döpp: Jüdische Jugendbewegung in Köln 1906–1938. LIT, Münster 1997, ISBN 3-8258-3210-4, S. 29.<br />
18.↑ Homepage <strong>de</strong>r Zentralmoschee Köln<br />
19.↑ IT.NRW: Bevölkerung im Regierungsbezirk Köln<br />
20.↑ http://www.xx<br />
21.↑ http://www.xx<br />
22.↑ Stadtbibliothek Köln, öffentliche Einrichtung <strong>de</strong>r Stadt Köln, abgerufen am 10. Mai 2010<br />
23.↑ Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, zentrale bibliothekarische Einrichtung <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong> Köln, auch für an<strong>de</strong>re Kun<strong>de</strong>nkreise <strong>zu</strong>gänglich, abgerufen am 10. Mai 2010
24.↑ Internetartikel auf www.xx<br />
25.↑ Kölnmesse beschenkt Taxi-Fahrer. In: Köln Nachrichten. 12. Januar 2008, abgerufen am 7. Januar 2010.<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln<br />
Der folgen<strong>de</strong> Artikel beschäftigt sich mit <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln von <strong>de</strong>r Vorgeschichte bis in die Nachkriegszeit.<br />
Das vorrömische Köln<br />
Erste Belege menschlichen Lebens im Stadtgebiet Köln wer<strong>de</strong>n auf die Altsteinzeit geschätzt; darauf lassen Fun<strong>de</strong> eines Kernsteins in Dellbrück sowie eines Faustkeils im Königsforst<br />
und Fun<strong>de</strong> aus Köln-Worringen schließen. Hinweise auf eine feste Besie<strong>de</strong>lung gibt es ab <strong>de</strong>r Zeit um 4500 v.Chr., als <strong>de</strong>r fruchtbare Lössbo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Rheinterrassen und das mil<strong>de</strong> Klima<br />
Ackerbauern aus <strong>de</strong>m Donauraum anzog. Der be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Fund einer Bandkeramik-Siedlung aus <strong>de</strong>r Jungsteinzeit wur<strong>de</strong> 1929 in Lin<strong>de</strong>nthal gemacht. Das Lin<strong>de</strong>nthaler Dorf, das sich<br />
zwischen Hohenlind und Stüttgenhof erstreckt, wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Zeit zwischen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 5. bis Anfang <strong>de</strong>s 4. Jahrtausends mehrfach besie<strong>de</strong>lt und wie<strong>de</strong>r aufgegeben — Ursache war<br />
vermutlich eine extensive Landwirtschaft, die die Ackerbauern von Zeit <strong>zu</strong> Zeit zwang, ihre Siedlungen <strong>zu</strong> verlassen, bis sich <strong>de</strong>r ausgelaugte Bo<strong>de</strong>n erholt hatte. Überreste einer<br />
weiteren bandkeramischen Siedlung wur<strong>de</strong>n auch in Mengenich gefun<strong>de</strong>n.<br />
Zum En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Steinzeit gab es im heutigen Stadtgebiet, in Nippes und in <strong>de</strong>r Innenstadt sowie in Merheim und Brück weitere Ackerbau-Siedlungen, die <strong>de</strong>r Michelsberger Kultur<br />
<strong>zu</strong>gerechnet wer<strong>de</strong>n. Die Glockenbecherkultur, die erste metallverarbeiten<strong>de</strong> Kultur im Rheinland, sie<strong>de</strong>lte nach 2000 v. Chr. in ganz Westeuropa und hinterließ sowohl Stein- als auch<br />
Kupferwerkzeuge. Aus <strong>de</strong>r im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt v. Chr. bekannten Urnenfel<strong>de</strong>rkultur, die durch einen Wan<strong>de</strong>l in <strong>de</strong>r Bestattungskultur von <strong>de</strong>r Erd- <strong>zu</strong>r Brandbestattung gekennzeichnet<br />
ist, wur<strong>de</strong> im Sü<strong>de</strong>n von Köln ein Gräberfeld gefun<strong>de</strong>n. Belege einer wie<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren, eisenzeitlichen Bestattungskultur — Hügelgräber — wur<strong>de</strong>n vor allem im rechtsrheinischen<br />
Dellbrück aber auch linksrheinisch in Lin<strong>de</strong>nthal, Müngersdorf, Riehl, Longerich und Worringen gefun<strong>de</strong>n. 1949 betrug die nachweisbare Anzahl in Dellbrück noch 685, man schätzt das<br />
ursprüngliche Gräberfeld auf insgesamt 1200 Grabstätten.<br />
Spuren keltischer Besiedlung während <strong>de</strong>r La-Tène-Zeit fin<strong>de</strong>n sich ebenfalls in Köln, die meisten bekannten Beispiele im Linksrheinischen; aus <strong>de</strong>m ersten Jahrhun<strong>de</strong>rt v. Chr. z. B.<br />
auch an <strong>de</strong>r Südseite <strong>de</strong>s Kölner Doms. Von <strong>de</strong>r für die Kelten charakteristischen Handwerkskunst ist in Köln südöstlich <strong>de</strong>r römischen Stadtmauer ein außergewöhnliches Einzelstück<br />
gefun<strong>de</strong>n wor<strong>de</strong>n, eine etwa handflächengroße, als dreifach gehörnter Kopf geformte Henkelattache (angesetzter Gefäßhenkel). Nach Caesar[1] gehörte das Gebiet von Köln <strong>zu</strong>m<br />
Stammesgebiet <strong>de</strong>r keltischen Eburonen.
Das römische Köln<br />
Um 57 v. Chr. hatte Caesar als Statthalter Galliens die Gebiete bis <strong>zu</strong>m Rhein erobert. Ein Aufstand <strong>de</strong>r Eburonen im Jahr 54 v. Chr. wur<strong>de</strong> ein Jahr später nie<strong>de</strong>rgeschlagen und <strong>de</strong>r<br />
Stamm, <strong>de</strong>r linksrheinisch zwischen Maas, Rhein und <strong>de</strong>n Ar<strong>de</strong>nnen lebte, völlig ausgerottet. Während <strong>de</strong>r Kämpfe traf Caesar auf <strong>de</strong>n rechtsrheinisch sie<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n germanischen Stamm<br />
<strong>de</strong>r Ubier, von <strong>de</strong>m ihm einige Krieger als Kundschafter dienten. Von Caesar als „kultivierter als an<strong>de</strong>re Germanen“ gelobt, wur<strong>de</strong>n sie von ihren rechtsrheinischen Nachbarstämmen<br />
jedoch aufgrund ihrer Römerfreundlichkeit bekämpft und zogen sich schließlich auf die nun unbewohnten Gebiete westlich <strong>de</strong>s Rheins <strong>zu</strong>rück. Tacitus berichtet, dass die Ubier sich bald<br />
darauf <strong>de</strong>m Agrippa und somit <strong>de</strong>m römischen Reich unterwarfen. An<strong>de</strong>re Berichte sprechen von einem Bündnisvertrag, <strong>de</strong>n die Ubier mit <strong>de</strong>n Römern schlossen, in <strong>de</strong>m ihnen<br />
umfangreiche linksrheinische Gebiete übertragen wur<strong>de</strong>n. In bei<strong>de</strong>n Überlieferungen wird kein genaues Datum angegeben.<br />
Als Gründungsjahr für das Oppidum Ubiorum, die erste städtische Siedlung auf <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s späteren Köln, wird meist das Jahr 38 v. Chr. genannt. Fakt ist, dass Agrippa zweimal in<br />
dieser Zeit an <strong>de</strong>n Rhein reiste: in <strong>de</strong>n Jahren 40–38 v. Chr. und um 20/19 v. Chr., so dass mit Sicherheit nur behauptet wer<strong>de</strong>n kann, dass die Hauptstadt <strong>de</strong>r Ubier spätestens 19 v. Chr.<br />
gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Die Stadtsiedlung lag günstig am Schnittpunkt zweier wichtiger Han<strong>de</strong>lswege. Sie wur<strong>de</strong> schon von <strong>de</strong>n Ubiern befestigt, aber auch <strong>de</strong>n Römern diente sie bald als<br />
Garnisonsstandort und religiöses Zentrum. Ähnlich wie in Lyon für Gallien wur<strong>de</strong> auch hier ein Altarbau für die Schutzgöttin Roms errichtet, nach <strong>de</strong>m die Stadt auch Ara Ubiorum<br />
genannt wur<strong>de</strong>. Dieser Altar konnte noch nicht lokalisiert wer<strong>de</strong>n. Erstmals erwähnt wird er im Zusammenhang mit <strong>de</strong>r Varus-Schlacht 9.n.Chr. bei Tacitus.[2]<br />
Als Rom um 17 n. Chr. seine Pläne aufgab, auch das östlich <strong>de</strong>s Rheins liegen<strong>de</strong> Germanien <strong>zu</strong> erobern, konsolidierte sich die Ubiersiedlung im römischen Grenzgebiet. Bereits im Jahr<br />
15 o<strong>de</strong>r 16 n. Chr. wur<strong>de</strong> hier Agrippina die Jüngere, die spätere Gattin <strong>de</strong>s römischen Kaisers Claudius und Mutter <strong>de</strong>s Nero, geboren. Durch ihren Einfluss erhielt das Oppidum<br />
Ubiorum <strong>de</strong>n Status einer römischen Kolonie und hieß fortan Colonia Claudia Ara Agrippinensium o<strong>de</strong>r kurz CCAA. Der Name <strong>de</strong>r Stadt enthielt sowohl <strong>de</strong>n Namen Agrippinas als<br />
auch <strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Kaisers Claudius, das Ara bezieht sich auf <strong>de</strong>n römischen Altar in <strong>de</strong>r Stadt. Von <strong>de</strong>n etwa 150 römischen Coloniae ist es allein Köln, das seinen heutigen Namen von dieser<br />
Bezeichnung für das höchste römische Stadtrecht herleitet.<br />
Mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r im Durchschnitt 2,5 Meter starken und 8 Meter hohen Stadtmauer aus Stein mit 19 Rundtürmen, von <strong>de</strong>nen einer aus <strong>de</strong>m 3. Jahrhun<strong>de</strong>rt bestens erhalten ist, und neun<br />
Toren wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Ostseite schon En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 1. Jahrhun<strong>de</strong>rt n. Chr. begonnen; die Arbeiten an <strong>de</strong>r Befestigung wur<strong>de</strong> vermutlich erst im 3. Jahrhun<strong>de</strong>rt abgeschlossen. Im Jahr 68, <strong>de</strong>m<br />
To<strong>de</strong>sjahr Neros und <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>nen Staatskrise in Rom, belagerten die Bataver und mit ihnen verbün<strong>de</strong>te Stämme die Stadt und erreichten <strong>zu</strong>nächst die Aufgabe <strong>de</strong>r<br />
Bevölkerung. Die gefor<strong>de</strong>rte Nie<strong>de</strong>rlegung <strong>de</strong>r Befestigung lehnten die Agrippinenser jedoch ab und schlugen sich bald wie<strong>de</strong>r unter <strong>de</strong>n Schutz <strong>de</strong>r Römer.<br />
Als seit 81 n. Chr. <strong>de</strong>r Militärbezirk rund um Köln <strong>zu</strong>r römischen Provinz Nie<strong>de</strong>rgermanien (lateinisch Germania Inferior) erhoben wur<strong>de</strong>, erhielt das an <strong>de</strong>r römischen Rheintalstraße<br />
gelegene CCAA im Jahr 89 <strong>de</strong>n Status einer Provinzhauptstadt. Um diese Zeit wur<strong>de</strong> die Wasserversorgung <strong>de</strong>r Stadt durch einen <strong>de</strong>r längsten Aquädukte <strong>de</strong>s römischen Reiches, die<br />
Eifelwasserleitung, verbessert.<br />
Die Herrschaft Trajans seit <strong>de</strong>m Jahr 98 kennzeichnet <strong>de</strong>n Beginn einer Blütezeit für das ganze römische Reich; auch in CCAA führte eine 150 Jahre andauern<strong>de</strong>n Perio<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns<br />
<strong>zu</strong> einem wirtschaftlichen und architektonischen Aufschwung. So entstand um 180 ein neues Prätorium für die Provinzverwaltung. Die Reste <strong>de</strong>r Grundmauern wur<strong>de</strong>n im Jahr 1953<br />
beim Bau <strong>de</strong>s Spanischen Baus <strong>de</strong>s heutigen Rathauses freigelegt. Manufakturarbeiten aus Köln, vor allem Glas und Keramik, wur<strong>de</strong>n ins gesamte römische Reich und darüber hinaus<br />
geliefert.<br />
In <strong>de</strong>n Jahren 259/60 schlug sich <strong>de</strong>r Militärbefehlshaber Postumus nach einem Streit mit Saloninus, <strong>de</strong>m Sohn <strong>de</strong>s Kaisers Gallienus, auf die Seite von aufständischen Grenztruppen und<br />
wur<strong>de</strong> von diesen <strong>zu</strong>m Kaiser eines Imperium Galliarum ausgerufen. Postumus eroberte CCAA und tötete Saloninus — Köln wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Hauptstadt <strong>de</strong>s neuen Reiches, <strong>de</strong>m Gallien,<br />
zeitweise Spanien und vermutlich auch Britannien angehörten. Erst im Jahr 274 en<strong>de</strong>te dieses „Son<strong>de</strong>rreich“, das für eine weitere Glanzzeit in CCAA steht, mit <strong>de</strong>r Rückeroberung durch<br />
Kaiser Aurelian. Hochwertige Goldmünzen mit <strong>de</strong>m Bildnis <strong>de</strong>s Postumus wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> dieser Zeit in <strong>de</strong>n Münzstätten Kölns geprägt. Im Jahr <strong>de</strong>r Rückeroberung wur<strong>de</strong> Köln jedoch <strong>zu</strong>m<br />
ersten Mal von Germanen überfallen und verwüstet.<br />
Kaiser Konstantin veranlasste daraufhin um 310 <strong>zu</strong>m Schutz <strong>de</strong>r Stadt <strong>de</strong>n Bau <strong>de</strong>s rechtsrheinischen Castellum Divitia (Kastell Deutz), das außer<strong>de</strong>m durch <strong>de</strong>n Bau <strong>de</strong>r ersten festen<br />
Rheinbrücke, einer Holzkonstruktion auf steinernen Strompfeilern, mit <strong>de</strong>r Stadt verbun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>.<br />
Die Bevölkerungszahl Kölns wird näherungsweise im dritten und vierten Jahrhun<strong>de</strong>rt auf rund 15.000 Menschen <strong>zu</strong>züglich <strong>de</strong>r etwa 5.000 im Umland geschätzt. Es herrschte eine
Religions- und Kultusvielfalt; so wur<strong>de</strong>n neben <strong>de</strong>n ursprünglichen römischen Gottheiten auch Götter und Göttinnen aus <strong>de</strong>r germanischen und aus an<strong>de</strong>ren Religionen <strong>de</strong>s römischen<br />
Reiches übernommen. 1882 wur<strong>de</strong> beispielsweise eine Isis-Figur in <strong>de</strong>r Nordwand <strong>de</strong>r Ursulakirche gefun<strong>de</strong>n; im Römisch-Germanischen Museum befin<strong>de</strong>n sich weitere Fun<strong>de</strong>, z. B.<br />
für die meist in Dreizahl gezeigten Muttergöttinnen (Matronen). Beson<strong>de</strong>rs beliebt war in Köln auch <strong>de</strong>r Mithraskult.<br />
Nach <strong>de</strong>r Zerstörung <strong>de</strong>s jüdischen Tempels in Jerusalem und <strong>de</strong>r damit verbun<strong>de</strong>nen Zerstreuung (Diaspora) <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n fin<strong>de</strong>n sich Nachweise einer jüdischen Gemein<strong>de</strong> in Köln. Kaiser<br />
Konstantin genehmigte im Jahr 321 die Ansiedlung einer jüdischen Gemein<strong>de</strong> mit allen Freiheiten <strong>de</strong>r römischen Bürger. Obwohl nur wenig über die Lage <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> in Köln<br />
bekannt ist — man vermutet die Ansiedlung in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r Marspforte innerhalb <strong>de</strong>r Stadtmauer — ist die Kölner Gemein<strong>de</strong> die älteste in Deutschland nachgewiesene Gemein<strong>de</strong>.<br />
Eine Christengemein<strong>de</strong> ist ab Beginn <strong>de</strong>s vierten Jahrhun<strong>de</strong>rts in Köln nachgewiesen. Als erster bekannter Kölner Bischof gilt Maternus im Jahr 313; die erste schriftliche Bezeugung<br />
einer Kirche stammt aus <strong>de</strong>m Jahr 355, ihr Standort ist jedoch unbekannt. Ein Saalbau wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>m nördlichen Friedhof errichtet, wo <strong>de</strong>r späteren Legen<strong>de</strong> nach eine Gruppe<br />
christlicher Mädchen <strong>de</strong>n letzten Christenverfolgungen <strong>zu</strong>m Opfer gefallen wor<strong>de</strong>n sein soll — hier liegen möglicherweise die Ursprünge <strong>de</strong>s späteren Kults um „Ursula und die 11000<br />
Jungfrauen“.<br />
Seit <strong>de</strong>m Germanenüberfall im Jahr 274 sah sich die Stadt weiteren germanischen Angriffen ausgesetzt; vor allem die Franken drängten über <strong>de</strong>n Rhein. Im Herbst 355 gelang ihnen die<br />
Eroberung und Plün<strong>de</strong>rung Kölns. Wenige Monate später wur<strong>de</strong> die Stadt durch <strong>de</strong>n Caesar (in <strong>de</strong>r Spätantike: Unterkaiser) Julian, <strong>de</strong>r später <strong>zu</strong>m Kaiser (Augustus) erhoben wur<strong>de</strong>,<br />
<strong>zu</strong>rückerobert. Zu Beginn <strong>de</strong>s 5. Jahrhun<strong>de</strong>rts zeichnete sich jedoch das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Römerherrschaft in Gallien und damit auch in Nie<strong>de</strong>rgermanien ab: Den Vormarsch <strong>de</strong>r Germanen nach<br />
Westen überstand Köln noch relativ unversehrt. Eine kurze Rückeroberung durch <strong>de</strong>n weströmischen Heermeister Flavius Aëtius in <strong>de</strong>r Zeit zwischen 435 bis 446 ging mit einem Sieg<br />
gegen <strong>de</strong>n Hunnenkönig Attila einher (<strong>de</strong>r Vorbeimarsch <strong>de</strong>r Hunnen an Köln bot weiteres Legen<strong>de</strong>nmaterial <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Heiligen Ursula). Spätestens als Aëtius jedoch 454<br />
ermor<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>, be<strong>de</strong>utete dies auch das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Römerherrschaft in Köln, die Franken eroberten Köln und machten die Stadt <strong>zu</strong>m Vorposten eines ihrer „Gaue“.<br />
Das fränkische Köln<br />
Zum Beginn <strong>de</strong>r Frankenherrschaft im ehemaligen römischen Gebiet an Rhein und Mosel war <strong>de</strong>r "Stamm" <strong>de</strong>r Franken noch in Untergruppen geglie<strong>de</strong>rt; in Köln herrschte Sigibert,<br />
König <strong>de</strong>r "ripuarischen" Franken und Vetter <strong>de</strong>s Merowingers Chlodwig I. Dem "ripuarischen" Königtum wur<strong>de</strong> von Chlodwig ein En<strong>de</strong> gesetzt, in<strong>de</strong>m er Sigiberts Sohn <strong>zu</strong>nächst da<strong>zu</strong><br />
brachte, seinen Vater ermor<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> lassen, und diesen dann von seinen eigenen Boten erschlagen ließ. Als Chlodwig in Köln einzog, soll er die Verantwortung für die To<strong>de</strong>sfälle abgelehnt<br />
und <strong>de</strong>n Bürgern seinen Schutz angeboten haben — worauf diese ihn in St. Gereon jubelnd <strong>zu</strong> ihrem Herrscher und damit <strong>zu</strong>m König aller Franken ausgerufen haben sollen. Dies<br />
berichtete <strong>de</strong>r Chronist Gregor von Tours in seiner Geschichte <strong>de</strong>r Franken.<br />
In Köln lebte <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Franken ein buntes Völkergemisch von Franken, an<strong>de</strong>ren Germanen und "Römern", also <strong>de</strong>r vor Ankunft <strong>de</strong>r Franken ansässigen Bevölkerung, mit <strong>de</strong>n<br />
unterschiedlichsten Religionen. Die "romanische" Stadtbevölkerung sprach auch noch im 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt Latein. Trotz <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>n Christianisierung <strong>de</strong>s Merowingerreiches nach<br />
<strong>de</strong>r Taufe Chlodwigs und <strong>de</strong>m Status Kölns als Bischofssitz gab es noch min<strong>de</strong>stens bis ins sechste Jahrhun<strong>de</strong>rt auch nicht-christliche Kultstätten.<br />
Die Franken, ein Krieger- und Bauernvolk, nutzten in Köln die trotz <strong>de</strong>r Eroberungszüge erhalten gebliebene römische Infrastruktur, vor allem das Prätorium, in <strong>de</strong>m die Könige<br />
residierten, sowie Brücke und Stadtmauer. Auch in Landwirtschaft und Handwerk bauten sie auf römischen Grundlagen auf; so entwickelten sich <strong>zu</strong>m Beispiel aus <strong>de</strong>n zahlreichen<br />
römischen Gutshöfen rund um Köln und <strong>de</strong>n Militäreinrichtungen nach und nach fränkische Dörfer und Hofsiedlungen. Obwohl die Bevölkerungszahl in fränkischer Zeit stark<br />
<strong>zu</strong>rückgegangen war, befan<strong>de</strong>n sich Han<strong>de</strong>l und Handwerk weiterhin auf hohem Niveau, allerdings war <strong>de</strong>r Exporthan<strong>de</strong>l im sechsten Jahrhun<strong>de</strong>rt nicht mehr so ausgeprägt.<br />
Eine Bedrohung <strong>de</strong>r Stadt im Jahr 557 durch die Sachsen, die bis <strong>zu</strong>m Kastell Deutz vordringen konnten, wur<strong>de</strong> abgewen<strong>de</strong>t. Bei <strong>de</strong>n blutigen Machtkämpfen, die sich die Nachkommen<br />
Chlodwigs lieferten, wur<strong>de</strong> Köln immer wie<strong>de</strong>r involviert. So flüchtete Theu<strong>de</strong>bert nach <strong>de</strong>r Schlacht bei Toul 612 vor seinem Bru<strong>de</strong>r Theu<strong>de</strong>rich von Toul nach Köln. Als dieser ihn in<br />
einem weiteren Kampf besiegte, zog Theu<strong>de</strong>rich in Köln ein und wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n dort verbliebenen Anhängern Theu<strong>de</strong>berts <strong>zu</strong>m neuen König ausgerufen.<br />
Die Zwiste in <strong>de</strong>r Königsfamilie führten <strong>zu</strong> einem Macht<strong>zu</strong>wachs für die fränkischen Adligen — die Hausmeier —, die ihren Königen die Regierungsarbeit aus <strong>de</strong>r Hand nahmen; 687<br />
zog <strong>de</strong>r Karolinger Pippin <strong>de</strong>r Mittlere alle fränkischen Hausmeierämter an sich. Er hielt sich über längere Zeiträume in Köln auf, seine Resi<strong>de</strong>nz befand sich vermutlich in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r<br />
heutigen Kirche St. Maria im Kapitol. Aber auch unter seinen Nachfolgern kehrte keine Ruhe ein: Pippins Stiefsohn Karl Martell zwang schließlich Plektrudis, die Witwe seines Vaters,
die in Köln residierte, <strong>zu</strong>r Aufgabe ihrer Macht und <strong>zu</strong>m Gang ins Kloster in die nach hochmittelalterlichen Quellen von ihr gestiftete Kirche St. Maria im Kapitol.<br />
Die endgültige Machtübernahme <strong>de</strong>r Karolinger im Frankenreich durch Martells Sohn Pippin <strong>de</strong>n Jüngeren 751 be<strong>de</strong>utete das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Merowingerherrschaft in Franken und für Köln<br />
das En<strong>de</strong> seiner Rolle als Königssitz (die Karolinger residierten in Aachen).<br />
Eine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Rolle spielten in <strong>de</strong>r fränkischen Zeit vor allem die Kölner Bischöfe. Als wichtigster unter ihnen gilt <strong>de</strong>r um 625 wirken<strong>de</strong> Kunibert von Köln, <strong>de</strong>r schon für König<br />
Dagobert III. und <strong>de</strong>ssen Sohn Sigibert III. die Regierungsgeschäfte geführt hatte. Der Legen<strong>de</strong> nach weihte Kunibert auch die älteste noch erhaltene Kölner Kirchenglocke, <strong>de</strong>n<br />
Saufang. Die Clemenskirche, in <strong>de</strong>r Kunibert nach seinem Tod 663 bestattet wur<strong>de</strong>, hieß fortan Kunibertskirche.<br />
Das karolingische Köln<br />
Während <strong>de</strong>r Sachsenkriege unter Karl <strong>de</strong>m Großen gewann Köln sowohl politisch als auch kulturell wie<strong>de</strong>r an Einfluss; als erster karolingischer Bischof gilt Hil<strong>de</strong>gar, <strong>de</strong>r um 753 bei<br />
einer Schlacht gegen die Sachsen bei <strong>de</strong>r Iburg getötet wur<strong>de</strong>. Köln verehrte seit dieser Zeit viele christliche Märtyrer, sammelte <strong>de</strong>ren Reliquien in wertvollen Schreinen und baute für<br />
sie viele Kirchen. Im spätmerowingischen Dom wur<strong>de</strong> eine neue liturgische Einrichtung, eine Schola Cantorum eingebaut.<br />
Papst Zacharias plante, Bonifatius <strong>zu</strong>m Erzbischof Kölns <strong>zu</strong> ernennen, um von Köln aus die Bekehrung <strong>de</strong>r Sachsen und Friesen voran<strong>zu</strong>treiben. Der Plan scheiterte <strong>zu</strong>nächst an <strong>de</strong>m<br />
Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r einheimischen Bischöfe und Adligen, und Köln wur<strong>de</strong> erst 795 Erzbischofssitz. Bereits 787 hatte Karl <strong>de</strong>n Priester Hil<strong>de</strong>bold <strong>zu</strong>m Bischof von Köln eingesetzt, als die<br />
Kölner sich nicht selbst auf einen neuen Bischof einigen konnten. 795 wur<strong>de</strong> Hil<strong>de</strong>bold folgerichtig auch Kölns erster Erzbischof; er amtierte bis <strong>zu</strong> seinem Tod im Jahr 818, vier Jahre<br />
nach<strong>de</strong>m Karl <strong>de</strong>r Große gestorben war.<br />
Nach <strong>de</strong>m Tod Karls <strong>de</strong>s Großen entbrannte erneut ein Streit um das Frankenreich. Köln gehörte <strong>zu</strong>nächst <strong>zu</strong>m so genannten Mittelreich zwischen Ost- und Westfranken o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m<br />
Lotharingien von Karls Enkel Lothar II. Dessen Scheidung und Wie<strong>de</strong>rverheiratung, die durch <strong>de</strong>n Kölner Erzbischof Gunthar unterstützt wur<strong>de</strong>, führte 863 <strong>zu</strong>r Exkommunizierung<br />
Gunthars, <strong>de</strong>r aber in Köln bis 866 weiter in seinem Amt blieb. Er protestierte gegen die Herauslösung Bremens aus seinem Metropolitanverband durch die Gründung <strong>de</strong>s Erzbistums<br />
Hamburg-Bremen 848. Das führte <strong>zu</strong>nächst <strong>zu</strong> einem Stillstand. Als aber Gunthar wegen seiner Ehescheidung Lothars II. exkommuniziert wur<strong>de</strong>, stellte Papst Nikolaus I. am 31. Mai<br />
864 die Gründungsbulle für das Erzbistum Hamburg-Bremen aus. Gunthars Nachfolger Willibert weihte im Jahr 873 die Kirche, die als Alter Dom — Vorläufer <strong>de</strong>s Kölner Doms — gilt.<br />
Mit ihrem Bau wur<strong>de</strong> wahrscheinlich um 850 begonnen, weil aber Gunthar als Bauherr missliebig erschien, schrieb man sie später <strong>de</strong>m berühmteren Vorgänger <strong>zu</strong>,weshalb sie lange <strong>de</strong>n<br />
Namen Hil<strong>de</strong>bolddom trug.<br />
Nach Lothars Tod fiel Köln 876 an das ostfränkische Reich König Ludwigs <strong>de</strong>s Deutschen. Durch die innerfränkischen Kämpfe wur<strong>de</strong> das Reich nach außen <strong>de</strong>rart geschwächt, dass im<br />
Winter 881/882 die Normannen auf ihren Kriegszügen rheinaufwärts bis Köln und Bonn vordringen konnten. Sie plün<strong>de</strong>rten und brandschatzten die Städte, und in Köln blieben nur <strong>de</strong>r<br />
Dom und die Kirchen St. Severin und St. Gereon erhalten, alle an<strong>de</strong>ren Gebäu<strong>de</strong> und Kirchen sowie die Stadtmauer brannten nie<strong>de</strong>r. Allerdings sollen sich die Geistlichen <strong>de</strong>r Stadt vor<br />
<strong>de</strong>m Einfall <strong>de</strong>r Normannen mit <strong>de</strong>n wichtigsten Kirchenschätzen nach Mainz geflüchtet haben.<br />
Bereits einige Jahre nach <strong>de</strong>m Normannenangriff sollen die Kölner ihre Stadtmauer wie<strong>de</strong>r aufgebaut haben, und im Jahr 891 erhielt Köln unter seinem Erzbischof Hermann von Papst<br />
Stephan V. be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Reliquien für die wie<strong>de</strong>r aufgebauten Kirchen.<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>s 10. Jahrhun<strong>de</strong>rts wechselte in Köln ein vorletztes Mal in <strong>de</strong>r Karolingerzeit die Herrschaft: In Ostfranken wur<strong>de</strong> Konrad I., <strong>zu</strong>m König gewählt, was die lothringischen<br />
Fürsten <strong>zu</strong>r Abspaltung veranlasste und in <strong>de</strong>n Einflussbereich <strong>de</strong>s karolingischen Westfrankens brachte. Endgültig been<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong> diese Phase durch <strong>de</strong>n Sachsen Heinrich I., <strong>de</strong>r mit<br />
wenigen Eroberungszügen Lothringen wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> Ostfranken brachte. 925 wur<strong>de</strong> Lothringens — und damit Kölns — Zugehörigkeit <strong>zu</strong>m ostfränkischen Reich von <strong>de</strong>n Fürsten und <strong>de</strong>m<br />
Kölner Erzbischof bestätigt.<br />
Das hochmittelalterliche Köln<br />
Ottonische Zeit
Erzbischof Brun, <strong>de</strong>r Bru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s späteren Kaisers Otto I., war 953 <strong>zu</strong>m geistlichen Oberhaupt von Köln gewählt wor<strong>de</strong>n. Nach<strong>de</strong>m unter seiner Führung ein Aufstand in Lothringen<br />
gegen <strong>de</strong>n Bru<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Kaisers nie<strong>de</strong>rschlagen wur<strong>de</strong>, machte Otto I. <strong>de</strong>n Erzbischof auch <strong>zu</strong>m Herzog von ganz Lothringen und damit <strong>zu</strong>m weltlichen Fürsten in Köln. Damit hatte er die<br />
Gerichtsbarkeit sowie Markt- und Münzhoheit in <strong>de</strong>r Stadt — dies markierte <strong>de</strong>n Beginn einer Perio<strong>de</strong> erzbischöflicher Macht in Köln, die bis <strong>zu</strong>r Schlacht von Worringen im Jahr 1288<br />
andauerte.<br />
Brun hinterließ bleiben<strong>de</strong> Spuren in <strong>de</strong>r Stadt. So wur<strong>de</strong>n unter seiner Herrschaft <strong>de</strong>r alte Dom erweitert, mehrere Stifte und Klöster (z. B. <strong>de</strong>r Vorläuferbau <strong>de</strong>r heutigen Kirche Groß St.<br />
Martin) gegrün<strong>de</strong>t und um 950 die Siedlungen <strong>de</strong>r Rheinvorstadt, die bis dahin noch außerhalb <strong>de</strong>r Stadtmauern lagen, in die Stadt eingeglie<strong>de</strong>rt (das Gebiet um <strong>de</strong>n heutigen Alter Markt<br />
und Heumarkt). Für die Besuche <strong>de</strong>s Kaisers in Köln ließ er in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Domes vermutlich eine Pfalz errichten.<br />
Kurz nach<strong>de</strong>m Otto I. im Jahr 965 mit seiner Familie <strong>de</strong>n Erzbischof in Köln besucht hatte, verstarb Brun im Alter von 40 Jahren auf einer diplomatischen Mission in Reims. Er wur<strong>de</strong> in<br />
<strong>de</strong>r Kölner Klosterkirche von St. Pantaleon beerdigt.<br />
Nach Bruns nur kurz amtieren<strong>de</strong>m Nachfolger Folcmar trat ab 969 vor allem Erzbischof Gero in Erscheinung. Er reiste 971 nach Konstantinopel, um eine Ehefrau für Otto II. <strong>zu</strong> suchen.<br />
Geplant war die Vermählung <strong>de</strong>s Kaisersohns mit <strong>de</strong>r Tochter <strong>de</strong>s oströmischen Kaisers; Gero vermittelte schließlich die Vermählung mit <strong>de</strong>ssen Nichte Theophanu im Jahr 972. Die<br />
Kaiserin führte nach <strong>de</strong>m Tod Ottos II. 983 sechs und ein halbes Jahr für ihren unmündigen Sohn Otto III. die Regentschaft. Sie starb bereits 991; <strong>de</strong>r byzantinische Einfluss auf die<br />
<strong>de</strong>utsche Kunst und Kultur kann jedoch auf sie und ihr großes Gefolge <strong>zu</strong>rückgeführt wer<strong>de</strong>n. Nach<strong>de</strong>m sie wie Brun in St. Pantaleon beigesetzt wor<strong>de</strong>n war, sie<strong>de</strong>lten sich ihre<br />
Landsleute, Handwerker und Künstler, um diese Kirche an – was sich in Kölner Straßennamen wie Griechenmarkt nie<strong>de</strong>rschlug.<br />
Das kunsthistorisch und ikonographisch be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Gerokreuz im alten Dom soll <strong>de</strong>r Überlieferung nach 970 von Gero beauftragt und aufgestellt wor<strong>de</strong>n sein. Nach <strong>de</strong>ssen Tod wur<strong>de</strong><br />
es an seinem Sarkophag im Dom aufgestellt. Von Geros Nachfolger, Erzbischof Everger, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong> Zeiten Geros Domschatzmeister gewesen war, wird in <strong>de</strong>r Chronik Thietmar von<br />
Merseburgs berichtet, er habe sowohl Gero als auch <strong>de</strong>ssen Nachfolger Warin scheintot bestatten lassen, um ihr Amt <strong>zu</strong> übernehmen. Evergers Nachfolger wur<strong>de</strong> Erzbischof Heribert. Er<br />
regierte von 999 bis 1021 und stiftete 1003 die Abtei Deutz. Während seiner Amtszeit hatten die Kölner mit mehreren Hungersnöten und Dürren <strong>zu</strong> kämpfen. Seine Gebete sollen <strong>zu</strong>m<br />
ersehnten Regen geführt haben, so dass er nach seinem To<strong>de</strong> 1147 heilig gesprochen wur<strong>de</strong>.<br />
Salische Zeit<br />
Heriberts Amtsnachfolger Pilgrim trug durch die Königskrönung Heinrichs III. und seiner Mutter Gisela <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m dauerhaften Anrecht <strong>de</strong>r Kölner Erzbischöfe bei, in Aachen Krönungen<br />
vornehmen <strong>zu</strong> dürfen. Außer<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> er 1031 <strong>zu</strong>m Erzkanzler für Italien ernannt, ein Ehrenamt, das nach ihm alle Kölner Erzbischöfe <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches Deutscher<br />
Nation inne hatten.<br />
Der Kölner Erzbischof erhielt 1039 das Münzrecht und die Kölner Mark begann ihren Sieges<strong>zu</strong>g am Nie<strong>de</strong>rrhein. Im folgen<strong>de</strong>n Jahr (1040) wur<strong>de</strong> die erste Synagoge in Köln errichtet.<br />
Die Königin Richeza von Polen wur<strong>de</strong> 1061 in Köln beigesetzt.<br />
Im Jahre 1074 kam es <strong>zu</strong> einer Rebellion <strong>de</strong>r Kölner Bürger gegen ihren Lehnsherrn, <strong>de</strong>n Erzbischof Anno II.. Als Anno im Kölner Hafen ein Kaufmannschiff beschlagnahmen ließ,<br />
wi<strong>de</strong>rsetzte sich <strong>de</strong>r Sohn <strong>de</strong>s reichen Kaufmanns <strong>de</strong>r Beschlagnahmung. Anno konnte sich nur knapp vor <strong>de</strong>r mordlustigen Bevölkerung in Sicherheit bringen und aus <strong>de</strong>r Stadt fliehen.<br />
Er kehrte wenige Tage später mit bewaffneten Verbän<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>rück, die Stadt kapitulierte, die Rä<strong>de</strong>lsführer wur<strong>de</strong>n brutal bestraft.[3]<br />
1096 befand sich in Köln <strong>de</strong>r Sammelplatz für die Kreuzritter vom Nie<strong>de</strong>rrhein. Die Kreuzzügler plün<strong>de</strong>rten und brandschatzten das Ju<strong>de</strong>nviertel. Im Verlauf <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen<br />
zwischen Kaiser Heinrich IV. und seinem Sohn Heinrich V. wur<strong>de</strong>n 1106 neue Befestigungsanlagen errichtet. Köln schlägt sich auf die Seite Heinrichs IV. Durch diese zweite<br />
Stadterweitung umfassten die Mauern nun ein Gebiet von 203,6 Hektar. Am 25. August 1128 legte ein durch Blitzschlag verursachtes Feuer das rechtsrheinische Deutz in Schutt und<br />
Asche. Zahlreiche Gebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n zerstört. Das Kölner Rathaus wur<strong>de</strong> erstmals 1135 urkundlich erwähnt.<br />
Staufische Zeit<br />
Für 1149 ist das große Kölner Stadtsiegel erstmals belegt; seine tatsächliche Entstehungszeit ist umstritten. Gegen 1140 lebten schät<strong>zu</strong>ngsweise 20.000 Bürger in <strong>de</strong>r Stadt. Köln wur<strong>de</strong>
1150 von einem großen Brand und einer Pest-Welle heimgesucht.<br />
Der Kölner Erzbischof Rainald von Dassel brachte die Gebeine <strong>de</strong>r Heiligen Drei Könige am 23. Juli 1164 nach Köln. Dadurch wur<strong>de</strong> Köln einer <strong>de</strong>r wichtigsten Wallfahrtsorte <strong>de</strong>s<br />
christlichen Europas und lockte in großer Anzahl Pilger und Könige <strong>zu</strong>r Heiltumsfahrt nach Köln. Auch wegen <strong>de</strong>r 1121 gefun<strong>de</strong>nen und seit<strong>de</strong>m verehrten Reliquien <strong>de</strong>s Hl. Gereon und<br />
seiner Gefährten sowie <strong>de</strong>n im 12. Jhdt. gefun<strong>de</strong>nen Gebeinen <strong>de</strong>r legendären Heiligen Ursula und ihrer laut <strong>de</strong>r Legen<strong>de</strong> 11.000 Begleiterinnen wur<strong>de</strong> Köln <strong>zu</strong>sammen mit Rom und<br />
Santiago <strong>de</strong> Compostela eine <strong>de</strong>r drei großen Pilgerstätten <strong>de</strong>s Spätmittelalters. Der Reliquienschatz Kölns soll mehr als 800 Heilige enthalten haben.<br />
Im Mai 1169 bestätigte Philipp anlässlich einer Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng zwischen <strong>de</strong>m Burggrafen und <strong>de</strong>m Vogt von Köln ein altes Weistum, worin <strong>de</strong>ren amtliche Stellung und <strong>de</strong>r Umfang<br />
ihrer Befugnisse und Gerechtsame, so wie die Freiheiten <strong>de</strong>r Kölnischen Bürger aufgezeichnet wur<strong>de</strong>n.[4] 1171 erneuerten die Senatoren <strong>de</strong>r Stadt Köln <strong>de</strong>n Kaufleuten von Dinant die<br />
Zoll-Privilegien, die ihnen bereits durch <strong>de</strong>n Erzbischof Friedrich I. (†1131) verbrieft wor<strong>de</strong>n waren.[5] 1174 lieh Erzbischof Philipp I. von Heinsberg <strong>zu</strong>m Zweck eines Kriegs<strong>zu</strong>ges<br />
nach Italien von <strong>de</strong>r Stadt Köln 1000 Mark und verpfän<strong>de</strong>te ihr dafür das Münzrecht.[6]<br />
Am 27. Juli 1180 verglich sich Erzbischof Philipp hinsichtlich <strong>de</strong>r gegen sein Verbot angelegten Stadtbefestigung, dass gegen eine Zahlung von 2000 Mark und einen Grundzins <strong>de</strong>r<br />
Status quo in Be<strong>zu</strong>g auf Befestigung, Häuser und Vorbaue bleiben durfte. Damit wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bau <strong>de</strong>r Stadtbefestighung sanktioniert.[7] Der Vertrag wur<strong>de</strong> am 11. August von Kaiser<br />
Friedrich I. bestätigt.[8] Die große mittelalterliche Stadtmauer wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n sechs Jahrzehnten gebaut. Die Fläche <strong>de</strong>r Stadt wuchs von 203,6 ha auf 402,6 ha. Nach <strong>de</strong>r<br />
Fertigstellung war die Mauer mit 52 Türmen und 12 Toren das größte Befestigungswerk Europas.[9][10] Das (Leprosorium) von Köln, in Melaten verkehrsgünstig an <strong>de</strong>r Köln-Aachener<br />
Straße gelegen, wur<strong>de</strong> erstmals in <strong>de</strong>r Schreinskarte <strong>de</strong>r Pfarrei St. Aposteln 1180 erwähnt. Das zerstörte Siechenhaus wur<strong>de</strong> als hoff to Malaten buyten Colne erstmals am 25. April 1243<br />
urkundlich erwähnt.[11]<br />
Der Rat <strong>de</strong>r Stadt Köln erschien erstmals 1216 in <strong>de</strong>n tradierten Urkun<strong>de</strong>n. Der Ein<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r künftigen Kaiserin und englischen Prinzessin Isabella von England 1235 auf ihrer Reise <strong>zu</strong><br />
ihrer Hochzeit in Worms mit Kaiser Friedrich II. wur<strong>de</strong> eines <strong>de</strong>r "großartigsten gesellschaftlichen Ereignisse <strong>de</strong>s Hochmittallater" [12]. Isabella wur<strong>de</strong> mit allen Ehren empfangen und<br />
blieb sechs Wochen in Köln. Erzbischof Konrad von Hochsta<strong>de</strong>n legte am 15. August 1248 <strong>de</strong>n Grundstein für <strong>de</strong>n Neubau <strong>de</strong>s Kölner Doms. Der Kirchenlehrer Albertus Magnus spielte<br />
in seiner Kölner Zeit eine herausragen<strong>de</strong> Rolle in <strong>de</strong>n Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen Stadt und Erzbischof. Im Kleinen Schied vom 17. April 1252 und im Großen Schied vom 28. Juni<br />
1258 gutachtete er beim Streit zwischen Stadt und Bischof. Mit <strong>de</strong>m Großen Schied wur<strong>de</strong> die oberste Gerichtsgewalt und die oberste Macht <strong>de</strong>m Erzbischof <strong>zu</strong>gesprochen. Gleichzeitig<br />
bestätigte <strong>de</strong>r Spruch aber auch das Selbstverwaltungsrecht <strong>de</strong>r Kommune. Die Folge war, dass Konrad von Hochsta<strong>de</strong>n die angestrebte Lan<strong>de</strong>shoheit über Köln nicht durchsetzen kann<br />
und sich mit <strong>de</strong>r Oberaufsicht begnügen muss.[13]<br />
Das spätmittelalterliche Köln<br />
Köln trat im Juli 1254 <strong>de</strong>m Rheinischen Städtebund bei, <strong>de</strong>r 59 Städte und auch Territorialfürsten umfasste und bis 1257 bestand. Motiv für die Gründung war die Unsicherheit im<br />
Heiligen Römischen Reich <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Interregnums. Der Rheinische Städtebund for<strong>de</strong>rte die Abschaffung <strong>de</strong>r etwa 30 Rheinzölle, welche <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l stark behin<strong>de</strong>rten. Er wen<strong>de</strong>te<br />
sich gegen Feh<strong>de</strong>n und setzt Regelungen für Konfliktfälle fest.<br />
Erzbischof Konrad von Hochsta<strong>de</strong>n verlieh <strong>de</strong>r Stadt Köln am 7. Mai 1259 das Stapelrecht. Danach mussten alle an- und durchreisen<strong>de</strong> Kaufleute ihre Waren <strong>zu</strong> Köln "stapelt" und <strong>zu</strong>m<br />
Verkauf anbieten. Das Stapelrecht war maßgeblich für die Entwicklung Kölns <strong>zu</strong>r europäischen Wirtschaftsmetropole <strong>de</strong>s Spätmittelalters.[14] Erzbischof Engelbert II. von Falkenburg<br />
sicherte <strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt 1266 seinen Schutz <strong>zu</strong>. Im Streit zwischen <strong>de</strong>n Bürgern und <strong>de</strong>m Erzbischof kam es Oktober 1268 <strong>zu</strong>m Kampf an <strong>de</strong>r Ulrepforte. Der Konflikt wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r<br />
Reimchronik Gottfried Hagens dargestellt.<br />
Am 15. November 1280 starb Albertus Magnus in Köln. Die Kölner Bürger erkämpften in <strong>de</strong>r Schlacht von Worringen am 5. Juni 1288 ihre Freiheit von <strong>de</strong>r erzbischöflichen<br />
Stadtherrschaft. Bei <strong>de</strong>m Konflikt zwischen Siegfried von Westerburg, Erzbischof von Köln und Herzog Johann I. von Brabant schlug sich die Stadt Köln auf die Seite <strong>de</strong>s Herzogs. Der<br />
Erzbischof geriet in Gefangenschaft. Die Stadt Köln erlangte in <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong> facto <strong>de</strong>n Status einer Reichsstadt, wenngleich die Anerkennung <strong>de</strong> jure noch bis 1475 auf sich warten ließ.<br />
Der Chor <strong>de</strong>s neuen gotischen Doms wur<strong>de</strong> am 27. September 1322 geweiht. Die Reliquien <strong>de</strong>r Heiligen Drei Könige, Anziehungspunkt für zahlreicher Pilger, wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n neuen<br />
Dom überführt. Um 1324 war Meister Eckhart Leiter <strong>de</strong>s Studium generale in Köln. Er wur<strong>de</strong> 1325 durch Mitbrü<strong>de</strong>r beim Kölner Erzbischof Heinrich II. von Virneburg, Erzbischof von
Köln wegen angeblich häretischer Glaubensaussagen <strong>de</strong>nunziert und starb entwe<strong>de</strong>r 1327 o<strong>de</strong>r 1328 hier o<strong>de</strong>r in Avignon.<br />
In einer Eintragung in das Eidbuch <strong>de</strong>s Kölner Rats am 5. März 1341 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Karneval erstmals erwähnt. Im Sommer 1349 for<strong>de</strong>rte die Pest täglich mehr als 100 Opfer. In <strong>de</strong>r Nacht<br />
vom 23. auf <strong>de</strong>n 24. August 1349 kam es <strong>zu</strong> einem Pestpogrom, bei <strong>de</strong>m die Kölner Ju<strong>de</strong>ngemein<strong>de</strong> ausgelöscht wur<strong>de</strong>. Im „Hansasaal“ <strong>de</strong>s Kölner Rathauses tagte am 19. November<br />
1367 eine Versammlung <strong>de</strong>r Hansestädte und bil<strong>de</strong>te die Konfö<strong>de</strong>ration gegen <strong>de</strong>n dänischen König Wal<strong>de</strong>mar IV..<br />
Die Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen <strong>de</strong>n Patriziern, die <strong>de</strong>n Rat und die Richerzeche dominierten und <strong>de</strong>n aufstreben<strong>de</strong>n Zünften erreichten im so genannten Kölner Weberaufstand<br />
einen ersten Höhepunkt. Es gab in Köln gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts ungefähr 300 Weberwerkstätten mit bis <strong>zu</strong> 6000 Beschäftigten. Produziert wur<strong>de</strong>n bis <strong>zu</strong> 20.000 Ballen (1,60<br />
Meter breites Tuch von 25 Meter Länge) im Jahr. Der Kölner Gewandschnei<strong>de</strong>r Wilhelm Wavern exportierte <strong>zu</strong> dieser Zeit 10.000 Paar Hosen p.a. Ein Webergeselle verdiente damals<br />
etwa 8 Schilling pro Tag bei folgen<strong>de</strong>n Lebenshaltungskosten: ein Hahn 3 Schilling, 25 Eier 25 Schilling, ein Fisch 2 Schilling, eine Hose 32 Schilling, 1 Paar Schuhe 10 Schilling.[15]<br />
Der Weberaufstand sollte dieser immensen wirtschaftlichen Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Weberzünfte Rechnung tragen. Er begann Pfingsten 1369 und en<strong>de</strong>te in <strong>de</strong>r blutigen Weberschlacht am 20.<br />
November 1371 auf <strong>de</strong>m Waidmarkt mit einer schweren Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Weber<strong>zu</strong>nft, die daraufhin hart bestraft wur<strong>de</strong>. Vorübergehend konnten die patrizischen Familien ihre Macht<br />
wie<strong>de</strong>rherstellen. Die Richerzeche wur<strong>de</strong> restituiert, 1396 aber endgültig abgeschafft.<br />
Im Jahr 1374 kam es <strong>zu</strong>m höchsten bislang in Köln erreichten (eisfreien) Hochwasser. Nach Schneeschmelze und tagelangen Regenfällen in weiten Teilen <strong>de</strong>s Rheinein<strong>zu</strong>gsgebietes<br />
wur<strong>de</strong> am 11. Februar ein Wasserstand von etwa 13,30 m erreicht. Während <strong>de</strong>r Scheitelwelle konnten Boote über die rheinseitige Stadtmauer fahren. Es han<strong>de</strong>lte sich um ein durch<br />
zahlreiche zeitgenössische Quellen belegtes, einmaliges Ereignis. Vom April 1375 bis <strong>zu</strong>m Frie<strong>de</strong>nsschluss am 16. Februar 1377 kam es im so genannten Schöffenkrieg <strong>zu</strong> einer<br />
schwerwiegen<strong>de</strong>n Machtprobe zwischen <strong>de</strong>r Stadt Köln und Erzbischof Friedrich von Saarwer<strong>de</strong>n. Anlass war ein Kompetenzstreit im Zusammenhang mit <strong>de</strong>n Schöffen, die <strong>de</strong>m<br />
erzbischöflichen Burggrafen beim Hochgericht beisaßen o<strong>de</strong>r ihn vertraten. Im Verlauf <strong>de</strong>s Schöffenkrieges verhängte Kaiser Karl IV. die Reichsacht über Köln, und im Kölner Umland,<br />
insbeson<strong>de</strong>re in Deutz, wur<strong>de</strong>n schwere Zerstörungen angerichtet.<br />
Die Alte Kölner Universität wur<strong>de</strong> am 21. Mai 1388 von <strong>de</strong>r Kölner Bürgerschaft gegrün<strong>de</strong>t und vom römischen Papst Urban VI. bewilligt. Die Eröffnung erfolgte am Dreikönigstag<br />
1389. Gründungsrektor war Hartlevus <strong>de</strong> Marca, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Lehrbetrieb mit einer Disputation mit <strong>de</strong>m Theologieprofessor Gerhard Kikpot von Kalkar über Jesaja 60,1 („die Herrlichkeit<br />
<strong>de</strong>s Herrn ging strahlend auf über dir“) eröffnete. Die Universität ging hervor aus <strong>de</strong>n Generalstudien <strong>de</strong>r Dominikaner, die Albertus Magnus 1248 eingerichtet hatte. Die Universität <strong>zu</strong><br />
Köln war die vierte Universitätsgründung im Heiligen Römischen Reich nach <strong>de</strong>r Karls-Universität Prag (1348), <strong>de</strong>r Universität Wien (1365) und <strong>de</strong>r Ruprecht-Karls-Universität in<br />
Hei<strong>de</strong>lberg (1386). Die Alte Universität wur<strong>de</strong> 1798 von französischen Besatzern geschlossen.<br />
Am 6. November 1395, <strong>de</strong>m Freitag nach Fronleichnam, erschütterte morgens um 3 Uhr ein schweres Erdbeben die Stadt Köln, nach<strong>de</strong>m schon acht Tage vorher Hagelschauer mit<br />
Körnern so groß wie Hühnereier die Leute erschreckt hatten.<br />
Der Verbundbrief von 1396<br />
Im Jahr 1396 wur<strong>de</strong> durch eine unblutige Revolution die Patrizierherrschaft in Köln endgültig been<strong>de</strong>t. An ihre Stelle trat eine ständische Verfassung, die sich auf die Organisation <strong>de</strong>r<br />
Gaffeln stützte. Vorausgegangen waren jahrelange Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen innerhalb <strong>de</strong>s Rates und <strong>de</strong>s ihn konstituieren<strong>de</strong>n Patriziats.<br />
Am 8. Juli 1391 schaltete Hilger Quattermart, <strong>de</strong>r Führer <strong>de</strong>r patrizischen Greifen-Partei, die Schöffen <strong>de</strong>s Hochgerichts aus. Am 11. August 1391 ging das Recht <strong>de</strong>r Bürgermeisterwahl<br />
von <strong>de</strong>r Reichen-Korporation Richerzeche auf <strong>de</strong>n Rat über. Am 17. Juli 1394 beschloss <strong>de</strong>r Rat die „Ewige Verbannung“ Heinrich von Staves, eines Oheims von Hilger Quattermart,<br />
wegen <strong>de</strong>ssen Umtrieben in Sachen Deutzer Zoll. Am 26. Dezember 1395 kam es in einer stürmischen Ratssit<strong>zu</strong>ng <strong>zu</strong>r Löschung <strong>de</strong>s Verbannungs<strong>de</strong>krets Heinrich von Staves durch<br />
Hilger Quattermart aus <strong>de</strong>m Ratsbuch, danach provokatorisches Auftreten Heinrich von Staves in <strong>de</strong>r Stadt. Am 4. Januar 1396 wur<strong>de</strong> die Partei <strong>de</strong>r „Greifen“ mit ihrem Führer Hilger<br />
Quattermart von <strong>de</strong>r Partei <strong>de</strong>r am 3. Januar 1396 gegrün<strong>de</strong>ten Partei <strong>de</strong>r „Freun<strong>de</strong>“ unter Führung von Konstantin von Lyskirchen entmachtet.<br />
Hilger Quattermart floh. Sein Verwandter Heinrich von Stave wur<strong>de</strong> am 11. Januar 1396 auf <strong>de</strong>m Neumarkt hingerichtet, viele <strong>de</strong>r „Greifen“ wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> lebenslanger Kerkerhaft<br />
verurteilt. Am 18. Juni 1396 versuchte Konstantin von Lyskirchen alte patrizische Rechte wie<strong>de</strong>rher<strong>zu</strong>stellen. Die dagegen protestieren<strong>de</strong>n Handwerker- und Kaufleutezünfte wur<strong>de</strong>n von<br />
ihm „vom hohen Ross herab“ nach Hause geschickt. Daraufhin nahmen die Zünfte die „Freun<strong>de</strong>“ in ihrem Versammlungsraum gefangen. Die „Greifen“ wur<strong>de</strong>n befreit. Am 24. Juni
1396 trat ein 48-köpfiger, provisorischer Rat aus Kaufleuten, Grundbesitzern und Handwerkern <strong>zu</strong>sammen.<br />
Der Stadtschreiber Gerlach von Hauwe formulierte daraufhin <strong>de</strong>n so genannten Verbundbrief[16], <strong>de</strong>r am 14. September 1396 von <strong>de</strong>n 22 so genannten Gaffeln unterzeichnet und in<br />
Kraft gesetzt wur<strong>de</strong>. Die Gaffeln waren heterogen <strong>zu</strong>sammengesetzt, in ihnen waren die entmachteten Patrizier, Ämter, Zünfte und Einzelpersonen <strong>zu</strong>sammengefasst, nicht aber die<br />
zahlenmäßig sehr starke Geistlichkeit; je<strong>de</strong>r kölnische Bürger musste einer <strong>de</strong>r Gaffeln beitreten. Der Verbundbrief konstituierte einen 49-köpfiger Rat, mit 36 Ratsherren aus <strong>de</strong>n<br />
Gaffeln und 13 Gebrechsherren, die berufen wur<strong>de</strong>n. Der Verbundbrief blieb bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Freien Reichsstadt 1797 in Kraft. Am 14. April 1397 bestätigt <strong>de</strong>r Rat die Zunftbriefe <strong>de</strong>r<br />
Garnmacherinnen, Sei<strong>de</strong>nmacherinnen und Goldspinnerinnen analog <strong>zu</strong> übrigen Zunftordnungen. Wirtschaftlich erreichten die Kölner Frauen im Spätmittelalter eine Freiheit wie<br />
nirgends sonst im Deutschen Reich.[17] Frauen han<strong>de</strong>lten selbständig und waren weitgehend geschäftsfähig.[18]<br />
Die Freie Reichsstadt Köln<br />
Um 1400 lebten schät<strong>zu</strong>ngsweise 40.000 Bürger in <strong>de</strong>r Stadt Köln, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong> dieser Zeit größten Stadt <strong>de</strong>s Heiliges Römisches Reichs. Am 6. Januar 1401 erfolgte im Kölner Dom die<br />
Krönung von Ruprecht I. <strong>zu</strong>m <strong>de</strong>utschen König, und am 6. Juli 1402 wur<strong>de</strong> im Dom die so genannte "Englische Heirat" zwischen Blanca von England, Tochter von Henry IV., und<br />
Ludwig III., Kurfürst von <strong>de</strong>r Pfalz, Sohn König Ruprechts von <strong>de</strong>r Pfalz, geschlossen. Sie war unter Vermittlung von Unterhändlern <strong>de</strong>s Kölner Rats <strong>zu</strong> Stan<strong>de</strong> gekommen.[19] 1403<br />
verbietet <strong>de</strong>r Rat eine jegliche Vermummung an <strong>de</strong>n Fastnachtstagen.[20]<br />
Der Rathausturm wur<strong>de</strong> 1414 vollen<strong>de</strong>t, er wur<strong>de</strong> als Archiv, Waffenkammer und Feuerwache genutzt. Im gleichen Jahr begann die Herrschaft von Erzbischof Dietrich II. von Moers<br />
(1414-1463), die mit 49 Jahren längste Regierung eines Erzbischofs von Köln. Die Kölner Ju<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n nach ihrer Wie<strong>de</strong>ransiedlung von 1372 im Jahr 1424 endgültig aus <strong>de</strong>r Stadt<br />
vertrieben. Die Synagoge wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Ratskapelle "Sankt Maria in Jerusalem" umgebaut, die Kölner Mikwe verfüllt. Damit en<strong>de</strong>te die Tradition einer <strong>de</strong>r ältesten und be<strong>de</strong>utendsten<br />
Siedlung von Ju<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>utschem Bo<strong>de</strong>n.[21]<br />
Die erste Kölner Bettelordnung wird auf 1435 datiert und wur<strong>de</strong> in die Kölner Statuten von 1437 aufgenommen. Sie schreibt vor, dass Gesun<strong>de</strong> für ihren Lebensunterhalt arbeiten o<strong>de</strong>r<br />
die Stadt verlassen müssen und dass Bettler ihre Wun<strong>de</strong>n und Gebrechen nicht öffentlich <strong>zu</strong>r Schau stellen dürfen, damit die "guten Bürger" nicht belästigt wer<strong>de</strong>n. Die Bettelordnung<br />
richtete sich <strong>zu</strong><strong>de</strong>m gezielt gegen auswärtige Bettler.[22] Stefan Lochner vollen<strong>de</strong>te um 1445 das Altarbild Altar <strong>de</strong>r Stadtpatrone, das das Selbstbewusstsein <strong>de</strong>r Freien Reichsstadt<br />
wi<strong>de</strong>rspiegelt und heute im Dom ausgestellt ist. Im gleichen Jahr erteilte <strong>de</strong>r Rat am 11. Juni <strong>de</strong>n Befehl, dass alle Ferkel - bis auf die <strong>de</strong>r Bäcker, Brauer und Landwirte - innerhalb <strong>de</strong>r<br />
Stadt ab<strong>zu</strong>schaffen seien. Dieser und zahlreiche ähnliche, vermutlich ebenso wenig erfolgreiche Erlasse <strong>de</strong>s Rats werfen ein signifikantes Licht auf die innerstädtischen, hygienischen<br />
Zustän<strong>de</strong>. Mit Wilhelm Roggelin und Peter Puckgassen wur<strong>de</strong>n am 16. August 1448 die ersten amtlich bestallten Müllmänner <strong>de</strong>r Stadt bestallt.[23]<br />
Der Gürzenich, das Ball- und Tanzhaus <strong>de</strong>s Rates, wur<strong>de</strong> von 1441 bis 1447 von Stadtbaumeister Johann van Bueren errichtet. Am 26. Februar 1446 fand <strong>de</strong>r erste, urkundlich belegte<br />
Hexenprozess in Köln statt. Nach Schwören <strong>de</strong>r Urfeh<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> die Angeklagte freigelassen.[24] Der Rat <strong>de</strong>r Stadt verbot 1449 die Einfuhr frem<strong>de</strong>n Bieres nach Köln, bei<br />
Zuwi<strong>de</strong>rhandlung drohten <strong>de</strong>n Importeuren Gefängnisstrafen. 1466 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r erste bekannte Kölner Buchdruck (Liber Johannis Chrysostomi super psalmo quinquagesimo) in <strong>de</strong>r<br />
Druckerei von Ulrich Zell publiziert. Zell hatte sein Handwerk wahrscheinlich bei <strong>de</strong>n Mainzer Buchdruckern Peter Schöffer und Johannes Fust gelernt; ein Jahrzehnt später gab es<br />
bereits 10 Druckereien in Köln.[25] 1469 verfasste Heinrich van Beeck eine umfassen<strong>de</strong> Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln, die Agrippina genannte Universalchronik Chronica coloniensis.<br />
Darin wur<strong>de</strong> die Geschichte <strong>de</strong>r Stadt von <strong>de</strong>n Anfängen bis ins Jahr 1419 dargestellt. Neben <strong>de</strong>r Chronik steht in <strong>de</strong>r Handschrift gleichberechtigt ein Urkun<strong>de</strong>nteil.[26]<br />
Kaiser Friedrich III. bestätigte im Verlauf <strong>de</strong>r Kölner Stiftsfeh<strong>de</strong> 1475 offiziell <strong>de</strong>n seit 1288 praktisch bestehen<strong>de</strong>n Status als Freie Reichsstadt; die Hanse unter Führung Kölns erwarb<br />
<strong>de</strong>n Stalhof in London als Kontor. Vier Jahre später 1479 erhielt die Universität <strong>zu</strong> Köln von Kaiser Friedrich III. das Recht, Leichen <strong>zu</strong> sezieren. 1481/82 scheiterte ein Umsturzversuch<br />
<strong>de</strong>r so genannten Kleinen Schickung gegen das Finanzgebaren <strong>de</strong>s Rats, weil sich die Gaffeln mehrheitlich auf <strong>de</strong>ssen Seite schlugen. Ein Sterben<strong>de</strong>r berichtete 1484 von homosexuellen<br />
Praktiken in Köln. Eine große Untersuchung ergab, dass wohl über 200 angesehene Bürger darin verwickelt waren, so wur<strong>de</strong>n die Ergebnisse <strong>de</strong>r Untersuchung wie<strong>de</strong>r unter <strong>de</strong>n Teppich<br />
gekehrt.[27]<br />
Auf <strong>de</strong>m Reichstag 1505 <strong>zu</strong> Köln entschied <strong>de</strong>r römisch-<strong>de</strong>utsche König und spätere Kaiser Maximilian I. <strong>de</strong>n Landshuter Erbfolgekrieg: Das Herzogtum Pfalz-Neuburg entstand (so<br />
genannter Kölner Spruch). Der Dominikaner Jakob van Hoogstraten (†1527), 1504 in Köln <strong>zu</strong>m Dr. theol. promoviert und seit 1505 Regens <strong>de</strong>r Kölner Or<strong>de</strong>nsschule, wur<strong>de</strong> 1510 Prior<br />
<strong>de</strong>s Kölner Dominikanerklosters und hatte als solcher das Amt <strong>de</strong>s päpstlichen Inquisitors für die Kirchenprovinzen Köln, Mainz und Trier inne.[28] Er lässt in Köln die Bücher
Reuchlins verbrennen.<br />
Der Bürgeraufstand von 1512/13, bei <strong>de</strong>m drei Bürgermeister und sieben Ratsherren getötet wur<strong>de</strong>n, führte <strong>zu</strong>m Beschluss <strong>de</strong>s Transfixbriefs vom 15. Dezember 1513, <strong>de</strong>r Ergän<strong>zu</strong>ngen<br />
<strong>zu</strong>m Verbundbrief von 1396 enthiel und <strong>de</strong>n jahrzehntelang gewachsenen Spannungen zwischen Rat und Gemein<strong>de</strong> Rechnung trug. Im Transfixbrief, <strong>de</strong>r bis 1797 <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m<br />
Verbundbrief die Kölner Verfassung bil<strong>de</strong>te, wer<strong>de</strong>n die Rechte <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> erweitert und fortgeschrieben, insbeson<strong>de</strong>re die Unverletztlichkeit von Person und Wohnung.[29] Zu<strong>de</strong>m<br />
sollten die Macht <strong>de</strong>r Gaffeln gestärkt, die Veruntreuung städtischer Gel<strong>de</strong>r verhin<strong>de</strong>rt und die Günstlingswirtschaft <strong>de</strong>s Rates unterbun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n.[30]<br />
Albrecht Dürer besuchte im Jahr 1520 seinen Vetter Niklas in Köln. Auf <strong>de</strong>m Domhof wur<strong>de</strong>n die Schriften von Martin Luther verbrannt. Auf Melaten wur<strong>de</strong>n im Jahr 1529 die bei<strong>de</strong>n<br />
protestantischen "Ketzer" Adolf Clarenbach und Peter Flieste<strong>de</strong>n verbrannt. Die Kölner Börse wur<strong>de</strong> 1553 gegrün<strong>de</strong>t. Bei einem Fährunglück 1559 auf <strong>de</strong>m Rhein ertranken über 50<br />
Personen. Die Bauarbeiten am Kölner Dom wur<strong>de</strong>n im Jahr 1560 aus finanziellen Grün<strong>de</strong>n eingestellt.<br />
Seit <strong>de</strong>m Hochmittelalter hatten die Kölner mit Besorgnis beobachtet, dass <strong>de</strong>r Rhein begann, sich am rechten Rheinufer bei Poll ein an<strong>de</strong>res Flussbett <strong>zu</strong> suchen. Hochwasser und<br />
Eisgänge begünstigten diese Verän<strong>de</strong>rungen. Um <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn, dass es zwischen Poll und Deutz <strong>zu</strong> einem östlichen Durchbruch <strong>de</strong>s Rheins kam, wollte Köln das Ufer mit <strong>de</strong>n so<br />
genannten Poller Köpfen befestigen, doch erst 1557 konnte sich <strong>de</strong>r Rat mit <strong>de</strong>m Erzbischof über die Maßnahmen einigen. 1560 wird das Großprojekt in Angriff genommen, das über<br />
250 Jahre fortgeführt wur<strong>de</strong>. Insgesamt wur<strong>de</strong>n drei schwere Uferbefestigungen ("Köpfe") angelegt. Neben Hun<strong>de</strong>rten auf Grund gelegten Schiffen wur<strong>de</strong>n Wei<strong>de</strong>npflan<strong>zu</strong>ngen und<br />
Buhnen eingebracht, um Abweichungen <strong>de</strong>s Flussverlaufs <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn. Mit Basaltbrocken beschwert wur<strong>de</strong>n eisenbewehrte Eichenstämme - durch schwere Querbalken verbun<strong>de</strong>n - in<br />
<strong>de</strong>n Flussgrund getrieben. Der nördliche Kopf soll eine Länge von 1.500 Metern gehabt haben.[31]<br />
Seit 1577 war Köln mittels eines Abzweigers ab Wöllstein mit <strong>de</strong>m europäischen Hauptpostkurs, <strong>de</strong>m Nie<strong>de</strong>rländischen Postkurs von Brüssel über Augsburg nach Innsbruck, Trient und<br />
Italien verbun<strong>de</strong>n. Zunächst bestand eine Fußbotenpost, die jedoch 1579 vom Postmeister Jacob Henot in eine reiten<strong>de</strong> Post umgewan<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>. [32]<br />
Der Kölner Erzbischof Gebhard Truchsess von Waldburg sagte sich 1582 von <strong>de</strong>r katholischen Kirche los und heiratete die protestantische Stiftsdame Agnes von Mansfeld, trat aber als<br />
Erzbischof nicht <strong>zu</strong>rück. Gebhard Truchsess von Waldburg wur<strong>de</strong> 1583 exkommuniziert und <strong>de</strong>r verlässlich katholische Ernst von Bayern <strong>zu</strong> seinem Nachfolger bestimmt u.a. <strong>de</strong>shalb,<br />
weil ein protestantischer Kölner Erzbischof die katholische Mehrheit im Kurfürstenkollegium gekostet hätte. Es kam <strong>zu</strong>m Kölner Krieg (auch Truchsessischer Krieg), <strong>de</strong>r bis 1588<br />
dauerte. Deutz, Bonn und Neuss wur<strong>de</strong>n verwüstet. Der Rat verbot 1609 <strong>de</strong>n Frauen auch <strong>zu</strong> Karneval das Tragen von Männerkleidung. Der erste Tabakhändler eröffnete 1620 sein<br />
Geschäft in Köln.<br />
Auf Melaten wur<strong>de</strong> Katharina Henot, die Tochter Jacob Henots, im Jahr 1627 als Hexe verbrannt.[33][34] Christina Plum bezichtigte sich erstmals im Frühjahr 1629 <strong>de</strong>r Hexerei und<br />
<strong>de</strong>nunzierte bei einem Verhör im April 1629 <strong>zu</strong>nächst zehn angesehene Bürger. Nach weiteren Denunziationen erfolgten mehreren Hinrichtungen, darunter auch Christina Plum am 16.<br />
Januar 1630. Erst ab <strong>de</strong>r zweiten Jahreshälfte 1630 wur<strong>de</strong> die Hexenverfolgung in Köln ausgesetzt.[35] Wegen <strong>de</strong>r Syphilis wur<strong>de</strong>n 1631 die öffentlichen Ba<strong>de</strong>häuser geschlossen. Mit<br />
<strong>de</strong>n Wochentlichen Post-Zeitungen erschien 1632 die erste wöchentliche Zeitung in Köln. Der Rat <strong>de</strong>r Stadt verbot 1659 das Rauchen innerhalb <strong>de</strong>r Stadtmauern. 1655 wur<strong>de</strong> Enn<br />
Lennartz als Hexe enthauptet und verbrannt. Sie war das letzte Opfer <strong>de</strong>r Hexenverfolgung in Köln. Insgesamt gab es in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Hexenverfolgung (1435 - 1655) 96 aktenkundig<br />
gewor<strong>de</strong>ne Hexenprozesse, bei <strong>de</strong>nen 37 Beschuldigte hingerichtet wur<strong>de</strong>n.[36]<br />
Während <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Kriegs (1618-1648) verhielt sich Köln neutral und wur<strong>de</strong> nicht belagert, wobei <strong>de</strong>r Krieg jedoch die Wirtschaft schädigte. Der Reitergeneral Jan von Werth<br />
(†1652) wur<strong>de</strong> in Köln <strong>zu</strong>m Volkshel<strong>de</strong>n, als er die Festung Ehrenbreitstein von <strong>de</strong>n Franzosen befreite. Von ihm wur<strong>de</strong> die Sage mit <strong>de</strong>r Magd Griet berühmt. Am 6. September 1680<br />
überreichte Nikolaus Gülich (*1644) eine Klageschrift gegen innerstädtische Missstän<strong>de</strong>. Eine Untersuchungskommission wur<strong>de</strong> eingesetzt, dann aber nahm man Gülich gefangen.<br />
August 1682 wur<strong>de</strong> er aber auf Druck <strong>de</strong>r Gaffeln wie<strong>de</strong>r entlassen. Immer wie<strong>de</strong>r klagte er gegen Klüngel und Misswirtschaft. Im Sommer 1683 versuchte Gülich, <strong>de</strong>n Rat auf<strong>zu</strong>lösen,<br />
aber hauptsächlich wegen wirtschaftlichen Misserfolgs wur<strong>de</strong> bald <strong>de</strong>r Prozess gegen ihn eröffnet. 1385 wur<strong>de</strong> er von Kaiser Leopold I. als Landfrie<strong>de</strong>nsbrecher vor das kaiserliche<br />
Gericht gela<strong>de</strong>n. Am 23. Februar 1686 wur<strong>de</strong> er <strong>zu</strong>m Tod durch das Schwert verurteilt und hingerichtet. Seine Schandsäule befand sich hun<strong>de</strong>rt Jahre lang auf <strong>de</strong>m eingeebneten Platz<br />
seines Hauses.[37]<br />
Köln nahm am letzten Hansetag 1669 in Lübeck teil. Giovanni Battista Farina grün<strong>de</strong>te 1709 die heute älteste Parfumfabrik <strong>de</strong>r Welt. 1716 begann er mit <strong>de</strong>m Export seines Eau <strong>de</strong><br />
Cologne. 1714 führte <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt eine Mel<strong>de</strong>pflicht für Protestanten ein. 1734 grün<strong>de</strong>te Jean Ignace Ro<strong>de</strong>rique die Gazette <strong>de</strong> Cologne. Die französischsprachige Zeitung war<br />
neben <strong>de</strong>r Gazette d'Amsterdam, <strong>de</strong>r Gazette d'Utrecht und <strong>de</strong>r Gazette <strong>de</strong> la Haye (Den Haag) im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt europaweit verbreitet. Köln war neben Prag, Wien, Antwerpen, Rom
und Venedig wegen seiner günstigen Verkehrsverbindungen eine <strong>de</strong>r wichtigsten Städte, wo Nachrichten gesammelt wur<strong>de</strong>n. Die Gazette <strong>de</strong> Cologne hatte wegen ihrer Aktualität<br />
mehrere tausend Bezieher und war an <strong>de</strong>n Höfen in ganz Europa verbreitet. 1735 erhielt die Zeitung kaiserliches Privileg.[38]<br />
Nach <strong>de</strong>r abendlichen Schließung <strong>de</strong>r Stadttore 1736 kam man nun nur noch nach Zahlung einer Torgebühr in die Stadt. Giacomo Casanova besuchte 1760 die Stadt Köln. Nach <strong>de</strong>m<br />
strengen Winter 1783/84 richteten Packeis auf <strong>de</strong>m Rhein und dadurch verursachtes Hochwasser im Februar 1784 große Schä<strong>de</strong>n an, über 60 Menschen starben. Für Köln war es das<br />
schlimmste jemals verzeichnete Hochwasserereignis mit einem Rekordpegel von 13,55 Metern.<br />
Die Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Stadt durch die französische Revolutionsarmee im Jahr 1794 brachte das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r bisherigen Ratsherrschaft. Am 28. Mai 1796 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt aufgelöst –<br />
400 Jahre nach Inkrafttreten <strong>de</strong>s Verbundbriefs, <strong>de</strong>r alten Kölner Verfassung. An die Stelle <strong>de</strong>s Rates trat eine nach französischem Vorbild eingesetzte Munizipalverwaltung.[39]<br />
Das französische Köln<br />
Am 6. Oktober 1794 besetzten französische Truppen die Reichsstadt Köln, was durch symbolische Übergabe <strong>de</strong>r Stadtschlüssel besiegelt wur<strong>de</strong>. Zur besseren Orientierung schafften die<br />
Franzosen die bis dahin üblichen Namen <strong>de</strong>r Häuser ab und führten 1795 Hausnummern ein – dank <strong>de</strong>r Hausnummer 4711 eine <strong>de</strong>r am meisten zitierten Maßnahmen dieser Zeit, die <strong>de</strong>r<br />
Duftmarke ihren Namen gab. In <strong>de</strong>r Folge wur<strong>de</strong> Köln Teil <strong>de</strong>s 1798 gegrün<strong>de</strong>ten Rur-Départements. Im selben Jahr lösten die Franzosen die Universität <strong>zu</strong> Köln auf, viele Kirchen und<br />
Klöster in Köln und <strong>de</strong>m Rheinland fielen unter die Säkularisation.<br />
Seit 1797 besaßen sowohl Ju<strong>de</strong>n als auch Protestanten das Bürgerrecht. 1798 kehrte mit Joseph Isaak <strong>de</strong>r erste Ju<strong>de</strong> seit 1424 in die Stadt <strong>zu</strong>rück.[40] Im gleichen Jahr wur<strong>de</strong>n die Zünfte<br />
aufgelöst; von da an herrschte in Köln Gewerbefreiheit. Die wirtschaftlich einschnei<strong>de</strong>ndste Maßnahme war aber die Verlegung <strong>de</strong>r französischen Zollgrenze an <strong>de</strong>n Rhein, 1798.[41]<br />
Während <strong>de</strong>r französischen Beset<strong>zu</strong>ng wur<strong>de</strong>n zahlreiche Kunstgegenstän<strong>de</strong> geplün<strong>de</strong>rt, viel Unersetzliches zerstört, so <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>n Kölner Bürgern eroberte Fahnenwagen <strong>de</strong>s besiegten<br />
Erzbischofs aus <strong>de</strong>r Schlacht von Worringen 1288. Dem letzte Rektor <strong>de</strong>r alten Universität Ferdinand Franz Wallraf war es <strong>zu</strong> verdanken, dass <strong>de</strong>r Stadt Köln unersetzliche<br />
Kunstgegenstän<strong>de</strong>, Archive und Urkun<strong>de</strong>nbestän<strong>de</strong> erhalten blieben.[42] Im Konkordat von 1801 zwischen Napoleon und <strong>de</strong>r katholischen Kirche wur<strong>de</strong> das Kölner Erzbistum<br />
aufgehoben. An seine Stelle trat Aachen als neues Bistum.[43]<br />
1801 wur<strong>de</strong>n das linke Rheinufer und damit auch Köln gemäß <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Lunéville Teil <strong>de</strong>s französischen Staatsgebiets. Alle Kölner Bürger erhielten die französische<br />
Staatsbürgerschaft. Kaiser Napoleon und seine Gattin Josephine besuchten die Stadt vom 13. bis 17. September 1804 <strong>zu</strong>m ersten Mal. Köln war eine Station auf einer längeren Reise<br />
durch die eroberten linksrheinischen Gebiete, die Napoleon kurz nach seiner Erhebung <strong>zu</strong>m Kaiser am 18. Mai 1804 begann. Am Abend <strong>de</strong>s 13. September war Napoleon in Köln<br />
angekommen und unter Kanonendonner und Glockengeläut durch das Eigelsteintor bis <strong>zu</strong> seiner Unterkunft am Neumarkt gefahren.<br />
In die Franzosenzeit fallen auch die Gründung <strong>de</strong>r IHK <strong>zu</strong> Köln (1803), <strong>de</strong>r ersten Industrie- und Han<strong>de</strong>lskammer auf <strong>de</strong>utschem Bo<strong>de</strong>n, sowie <strong>de</strong>s Kölsche Hänneschen Theater (1802).<br />
1804 wur<strong>de</strong>n alle Pfarrfriedhöfe geschlossen, sie wur<strong>de</strong>n ersetzt durch einen Zentralfriedhof, <strong>de</strong>r an <strong>de</strong>r Stelle <strong>de</strong>s alten Siechenhauses Melaten angelegt und 1810 eröffnet wur<strong>de</strong>.<br />
Die Franzosen mussten am 14. Januar 1814 die Stadt wegen <strong>de</strong>r heranrücken<strong>de</strong>n preußischen Truppen verlassen. An die französische Besat<strong>zu</strong>ng schloss sich unmittelbar die preußische<br />
Besat<strong>zu</strong>ng an.<br />
Das preußische Köln<br />
Der Wiener Kongress sah in seiner am 9. Juni 1815 unterzeichneten Schlussakte die Beset<strong>zu</strong>ng Kölns durch preußische Truppen vor. Damit fiel die Stadt an Preußen, allerdings behielten<br />
die Kölner bis 1848 die französische Währung. Die Stadt wur<strong>de</strong> Sitz eines Landkreises und selbst eine kreisfreie Stadt. 1819 wur<strong>de</strong> in Köln <strong>de</strong>r Rheinische Appellationsgerichtshof<br />
eingerichtet.[44] 1823 wur<strong>de</strong> auf Drängen <strong>de</strong>r preußischen Verwaltung das Festkomitee Kölner Karneval als "festordnen<strong>de</strong>s Komitee" gegrün<strong>de</strong>t und veranstaltete <strong>de</strong>n ersten<br />
kontrollierten Kölner Rosenmontags<strong>zu</strong>g. 1826 wur<strong>de</strong> die erste Kölner Sparkasse eröffnet. 1837 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kölner Erzbischof Clemens August Droste <strong>zu</strong> Vischering wegen <strong>de</strong>r<br />
Mischehenfrage verhaftet. 1842 wur<strong>de</strong> Karl Marx Chefredakteur <strong>de</strong>r Rheinischen Zeitung.<br />
Nach <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rent<strong>de</strong>ckung <strong>de</strong>r Fassa<strong>de</strong>npläne <strong>de</strong>s Kölner Domes Anfang <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts erwachte das öffentliche Interesse am Fortbau <strong>de</strong>s Domes, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>m Symbol für die<br />
<strong>de</strong>utsche Nationalbewegung wur<strong>de</strong>. Joseph Görres und Sulpiz Boisserée waren die treiben<strong>de</strong>n Kräfte für die Vollendung, so dass am 4. September 1842 durch <strong>de</strong>n preußischen König
Friedrich Wilhelm IV. und <strong>de</strong>n späteren Erzbischof Johannes von Geissel <strong>de</strong>r Grundstein für <strong>de</strong>n Weiterbau <strong>de</strong>s Kölner Doms gelegt wer<strong>de</strong>n konnte. 1863 wur<strong>de</strong> das Innere <strong>de</strong>s Doms<br />
vollen<strong>de</strong>t. 1868 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r alte Dombaukran, <strong>de</strong>r ein halbes Jahrtausend lang ein Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt war, abgebrochen. Die Trennwand zwischen <strong>de</strong>m 1322 geweihten Chor und <strong>de</strong>m<br />
Langhaus wur<strong>de</strong> nach 560 Jahren eingerissen. Am 15. Oktober 1880 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r vollen<strong>de</strong>te Dom nach 632 Jahren Bauzeit mit <strong>de</strong>m Dombau-Vollendungsfest fertiggestellt.[45]<br />
Überschattet wur<strong>de</strong> das Domfest von <strong>de</strong>n Auswirkungen <strong>de</strong>s Kulturkampfes, die 1874 <strong>zu</strong>r Verhaftung <strong>de</strong>s Kölner Erzbischofs Paulus Melchers durch die preußisch-protestantische<br />
Obrigkeit geführt hatte.[46]<br />
Im Jahre 1816 erreichte mit <strong>de</strong>r englischen "Defiance" das erste Dampfschiff die Stadt. 1826 wur<strong>de</strong> die Preußisch-Rheinische Dampfschiffahrtsgesellschaft (PRDG) in Köln, die spätere<br />
Köln Düsseldorfer (KD), gegrün<strong>de</strong>t. Mit <strong>de</strong>n Raddampfern "Friedrich Wilhelm" und "Concordia" wur<strong>de</strong> die erste regelmäßige Dampfschifffahrt zwischen Köln und Mainz<br />
aufgenommen. Mit <strong>de</strong>r Rheinschiffahrtsakte von 1831 wird das Kölner Stapelrecht endgültig aufgehoben.[47] 1835 wur<strong>de</strong> die Rheinische Eisenbahngesellschaft gegrün<strong>de</strong>t. 1839 rollte<br />
<strong>de</strong>r erste Zug vom Thürmchenswall bis nach Müngersdorf. 1841 war die Strecke bis Aachen fertiggestellt. 1844 begann <strong>de</strong>r Ausbau <strong>de</strong>r Eisenbahnverbindung Rhein-Weser.[48] 1848<br />
kam es in <strong>de</strong>r Stadt im Gefolge <strong>de</strong>r Märzrevolution <strong>zu</strong> einer Arbeiter<strong>de</strong>monstration und <strong>zu</strong>m sogenannten Kölner Fenstersturz. 1849 grün<strong>de</strong>te Adolf Kolping <strong>de</strong>n Kölner Gesellenverein.<br />
[49] Von 1855 bis 1859 wur<strong>de</strong> die erste feste Rheinbrücke seit <strong>de</strong>r Römerzeit, die Dombrücke, errichtet. Der Kölner Hafen wur<strong>de</strong> Endpunkt <strong>de</strong>r Rhein-Seeschiffahrt.[50] 1859 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Kölner Hauptbahnhof eingeweiht, die linksrheinische Eisenbahnstrecke von Köln nach Bingerbrück wur<strong>de</strong> fertiggestellt. Am 22.07 1860 wur<strong>de</strong> auf Betreiben von Dr. Caspar Garthe mit<br />
einem Festakt <strong>de</strong>r Kölner Zoo eröffnet.<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts konnte sich die übervolle Stadt nach <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s äußeren Festungsrings durch Kauf und Schleifen <strong>de</strong>r Stadtmauer, Wälle und Bastionen in <strong>de</strong>n Rayon<br />
erweitern. Der mittelalterliche Mauerring von 1180, <strong>de</strong>r nie überwun<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n konnte, wur<strong>de</strong> von 1881 bis 1896 bis auf wenige Überreste wie die repräsentativsten Torburgen<br />
nie<strong>de</strong>rgelegt. Städtebauarchitekt Josef Stübben schuf an ihrer Stelle die heutigen Ringe, Kölns Prachtboulevard.[51][52] Dennoch blieb Köln noch immer Festung: in einem Umkreis von<br />
15 Kilometern wur<strong>de</strong>n neue, mo<strong>de</strong>rne Bunkerbauten und <strong>de</strong>tachierte Gürtelforts (Außenforts bzw. Biehler-Forts) errichtet, die die veralteten Festungswerke ersetzen sollten. 1863<br />
erfolgte die Fertigstellung <strong>de</strong>s inneren, 1880 die <strong>de</strong>s äußeren Festungsrings. 1887 wur<strong>de</strong> eine Rheinstromsperre gebaut.[53]<br />
Die Bevölkerung Kölns stieg in dieser Zeit sprunghaft an. Lebten 1822 noch schät<strong>zu</strong>ngsweise 56.000 Bürger in <strong>de</strong>r Stadt, so waren es 1837 über 72.000 Einwohner, 1855 107.000<br />
Einwohner, 1888, nach <strong>de</strong>r Eingemeindung mehrerer Vororte, bereits 250.000. Am 22. Mai 1911 wur<strong>de</strong> die neue Hohenzollernbrücke in Gegenwart von Kaiser Wilhelm II. feierlich<br />
eingeweiht.[54] Bis 1913 wuchs die Einwohnerzahl weiter auf 640.731. 1914 schließlich kamen weitere rechtsrheinische Stadtteile <strong>zu</strong> Köln.<br />
Nach <strong>de</strong>m Deutsch-Französischen Krieg von 1870/1871 erfasste auch Köln ein großer wirtschaftlicher und industrieller Aufschwung. Das Volumen <strong>de</strong>s Güterverkehrs betrug 1885/86<br />
auf <strong>de</strong>r linksrheinischen Eisenbahn 954.728 Tonnen und rechtsrheinisch 413.573 Tonnen. Im Jahr 1886 liefen 4859 bela<strong>de</strong>ne Schiffe mit 4.656.561 Zentner <strong>de</strong>n Kölner Hafen an, 3190<br />
bela<strong>de</strong>ne Schiffe mit 2.626.841 Zentnern verließen ihn. Außer<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong>n als Flöße 138.742 Zentner talwärts bewegt.[55]<br />
Bis 1894 war in Köln das Fahrradfahren verboten. 1898 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Rheinauhafen in Betrieb genommen. 1900 übernahm die Stadt das Straßenbahnnetz und elektrifizierte es.[56] 1906<br />
wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Dokumentation dieser rasanten Entwicklung für die preußische Rheinprovinz und Westfalen in Köln das Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsarchiv gegrün<strong>de</strong>t, das seit<strong>de</strong>m<br />
angeschlossen an die IHK Köln besteht. 1906 eröffnete das erste feste Kino.<br />
Die Mobilmachung <strong>zu</strong>m Ersten Weltkrieg 1914 wur<strong>de</strong> in Köln wie auch in an<strong>de</strong>ren Städten <strong>zu</strong>erst mit Jubel aufgenommen, doch seit 1916 wur<strong>de</strong>n die Versorgungsprobleme immer<br />
schlimmer. Im Frühjahr 1917 musste die Stadt Notgeld ausgeben. Am 18. September 1917 wur<strong>de</strong> Konrad A<strong>de</strong>nauer <strong>zu</strong>m Oberbürgermeister gewählt. Am 24. März 1918 fand das erste<br />
Bombar<strong>de</strong>ment von Köln statt.[57] Entsprechend <strong>de</strong>n Waffenstillstandsbedingungen von Compiègne wur<strong>de</strong> Köln unmittelbar nach Kriegsen<strong>de</strong> am 6. Dezember 1918 von britischen<br />
Truppen besetzt. Die Zugehörigkeit <strong>zu</strong>m preußischen Staat und <strong>zu</strong>m Deutschen Reich waren davon nicht berührt, doch wur<strong>de</strong>n die Ausübung <strong>de</strong>utscher bzw. preußischer<br />
Souveränitätsrechte und die Tätigkeit <strong>de</strong>r preußischen Verwaltung ggf. durch Besat<strong>zu</strong>ngsmaßnahmen überlagert. Mit <strong>de</strong>m Rheinlandabkommen zwischen <strong>de</strong>m Deutschen Reich und <strong>de</strong>n<br />
Siegermächten vom 28. Juni 1919 wur<strong>de</strong>n die Modalitäten <strong>de</strong>r Besat<strong>zu</strong>ng näher <strong>de</strong>finiert.<br />
Köln in <strong>de</strong>r Weimarer Republik<br />
Bei <strong>de</strong>n Wahlen <strong>zu</strong>r verfassungsgeben<strong>de</strong>n Nationalversammlung am 19. Januar 1919, bei <strong>de</strong>r erstmals auch Frauen teilnehmen konnten, stimmte in Köln die Mehrheit für die Deutsche<br />
Zentrumspartei (40,8 % - Reich: 19,7 %) vor <strong>de</strong>r Sozial<strong>de</strong>mokratischen Partei Deutschlands (38,6 % - Reich: 37,9 %) und <strong>de</strong>r Deutschen Demokratischen Partei (11,0 % - Reich: 18,5
%).[58] Am 1. Februar 1919 en<strong>de</strong>te die vom preußischen Innenministerium seit <strong>de</strong>m 30. Oktober 1900 aufgezwungene Schreibweise Cöln. Die Universität <strong>zu</strong> Köln wur<strong>de</strong> nach 121<br />
Jahren Schließung am 12. Juni 1919 feierlich wie<strong>de</strong>reröffnet.[59]<br />
Am 1. August wur<strong>de</strong> das Brückengeld (Maut <strong>zu</strong>r Überquerung <strong>de</strong>r Rheinbrücken) abgeschafft. Gemäß <strong>de</strong>m Vertrag von Versailles begann man 1921 mit <strong>de</strong>r Schleifung <strong>de</strong>r Festungsringe<br />
und legte ab 1922 auf <strong>de</strong>ren Rayons die Grüngürtel an.[60] 1922 erfolgt die Eingemeindung weiterer linksrheinischer Stadtteile im Nor<strong>de</strong>n (Details s. Tabelle Eingemeindungen). 1923<br />
wur<strong>de</strong> das erste Müngersdorfer Stadion fertiggestellt, 1924 <strong>de</strong>r Rohbau <strong>de</strong>s höchsten Wolkenkratzers seiner Zeit in Europa, <strong>de</strong>s späteren Hansahochhauses. Am 11. Mai öffnete die<br />
Kölner Messe ihre Tore. Am 30. November wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r St. Petersglocke <strong>de</strong>s Kölner Doms die mit rund 24.000 kg größte freischwingen<strong>de</strong> läutbare Glocke <strong>de</strong>r Welt geweiht. 1925<br />
nahm das Kaufhaus Tietz die erste Rolltreppe Deutschlands in Betrieb.<br />
Die Besat<strong>zu</strong>ng en<strong>de</strong>te 1926 mit <strong>de</strong>m Ab<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r britischen Truppen. Im selben Jahr zog <strong>de</strong>r Vorläufer <strong>de</strong>s WDR, die West<strong>de</strong>utschen Funkstun<strong>de</strong> AG (Wefag), von Münster nach Köln und<br />
ging als "West<strong>de</strong>utsche Rundfunk AG" (Werag) auf Sendung. Mit einem Pegelstand von 10,69 m traf im Januar 1926 das schwerste Hochwasser ohne Eisgang die Stadt Köln. Die Stadt<br />
investierte 1,6 Mio. Reichsmark in das ehemalige Militärflugfeld Butzweilerhof.[61] Am 26. Juli 1926 begann dort <strong>de</strong>r planmäßige Flugverkehr. Der Butzweilerhof entwickelte sich auf<br />
Grund seiner zentralen Lage schnell <strong>zu</strong>m zweitgrößten <strong>de</strong>utschen Flughafen. Am 10. Oktober 1928 wur<strong>de</strong> die Rheinlandhalle eröffnet. 1929 legte <strong>de</strong>r Automobilkonzern Ford <strong>de</strong>n<br />
Grundstein für das Werk in Köln-Niehl. Die Mülheimer Brücke wur<strong>de</strong> am 13. Oktober in Betrieb genommen.<br />
Köln war während <strong>de</strong>r Weimarer Republik be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Musikstadt. Be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Dirigenten wie Otto Klemperer wirkten an <strong>de</strong>r Kölner Oper. Seit 1926 verfügte die Stadt über ein<br />
Radiorundfunkorchester.[62] In Köln existierten 1929/30 insgesamt 15 Häuser mit dauerhaften o<strong>de</strong>r zeitweisen Varietéprogrammen und Revuen. Mit <strong>de</strong>m Kaiserhof erhielt Köln im<br />
September 1931 ein internationales Varieté.[63] Im Dezember 1929 wur<strong>de</strong> Konrad A<strong>de</strong>nauer für weitere 12 Jahre <strong>zu</strong>m Oberbürgermeister gewählt. Die Eröffnung <strong>de</strong>r Kraftwagenstraße<br />
Köln-Bonn als erste Reichsautobahnstrecke erfolgte am 6. August 1932.[64]<br />
Politisch spiegelte sich die <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Radikalisierung, beson<strong>de</strong>rs seit <strong>de</strong>m Schwarzen Freitag auch in Köln in immer hemmungsloseren Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen<br />
Nationalsozialisten und Kommunisten wi<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>ren Höhepunkt Mitte 1932 erreicht wur<strong>de</strong>. Zwischen 1930 und 1933 gab es dabei 19 Tote.[65]<br />
Köln in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus<br />
Bereits 1925 war Köln Hauptstadt <strong>de</strong>s NSDAP-Gaus Köln-Aachen (Name bis 1931: Gau Rheinland-Süd) gewor<strong>de</strong>n. Seit 1935 trug die Stadt <strong>de</strong>n Namens<strong>zu</strong>satz Hansestadt. In <strong>de</strong>r Villa<br />
Schrö<strong>de</strong>r (Stadtwaldgürtel 35) trafen sich am 4. Januar 1933 Adolf Hitler und Franz von Papen um ein Bündnis <strong>zu</strong> schmie<strong>de</strong>n, die Regierung Kurt von Schleichers <strong>zu</strong> stürzen und die<br />
Machtübernahme <strong>de</strong>r Nazis vor<strong>zu</strong>bereiten (Treffen Papen mit Hitler im Haus <strong>de</strong>s Bankiers Schrö<strong>de</strong>r). Die Nationalsozialisten gewannen die Kommunalwahlen vom 12. März 1933, am<br />
Tag darauf wur<strong>de</strong> A<strong>de</strong>nauer beurlaubt, am 17. Juli 1933 als Oberbürgermeister entlassen.[66] Am 17. Mai 1933 kam es vor <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong> inszenierten Bücherverbrennungen. Im<br />
Sommer begann <strong>de</strong>r Terror durch die Geheime Staatspolizei, die <strong>zu</strong>nächst im Polizeipräsidium, dann in <strong>de</strong>r Zeughausgasse und im EL-DE-Haus (NS-Dokumentationszentrum <strong>de</strong>r Stadt<br />
Köln) saß.[67]<br />
1936 marschierten <strong>de</strong>utsche Truppen in das entmilitarisierte Köln ein. Während <strong>de</strong>r Pogrome in <strong>de</strong>r so genannten Reichspogromnacht 1938 wur<strong>de</strong>n in Köln die Synagogen in <strong>de</strong>r<br />
Roonstraße, in <strong>de</strong>r Glockengasse und in <strong>de</strong>r Körnerstraße (Ehrenfeld) nie<strong>de</strong>rgebrannt, die Synagogen in <strong>de</strong>r St.-Apern-Straße, in Deutz und in Mülheim wur<strong>de</strong>n verwüstet. Der<br />
oprganisierte Mob <strong>de</strong>molierte darüber hinaus zahlloser Wohnungen und Geschäfte von jüdischen Mitbürgern.[68] Die 1938 einsetzen<strong>de</strong>n Ausbürgerungen verzögerten sich zeitweilig<br />
durch <strong>de</strong>n "Arbeitseinsatz" <strong>de</strong>r jüdischen Kölner. Seit September 1939 wur<strong>de</strong>n sie in so genannten "Ju<strong>de</strong>nhäusern" konzentriert – pro Familie ein Zimmer, von wo aus sie später<br />
<strong>de</strong>portiert wer<strong>de</strong>n. Nach <strong>de</strong>m Sieg über Polen ersetzten billige "Ostarbeiter" die Ju<strong>de</strong>n. 1940/41 wur<strong>de</strong>n über 2.000 Sinti und Roma aus Köln <strong>de</strong>portiert. Im Oktober 1941 begann die<br />
Deportation <strong>de</strong>r Kölner Ju<strong>de</strong>n, die in Zügen mit jeweils 1.000 Opfern in die Konzentrationslager im Osten verschleppt wur<strong>de</strong>n.[69] Über 7.000 ermor<strong>de</strong>te Ju<strong>de</strong>n sind namentlich bekannt,<br />
das Schicksal zahlreicher Opfer ist ungeklärt.[70]<br />
Durch Flächenbombar<strong>de</strong>ments wur<strong>de</strong>n im Zweiten Weltkrieg weite Teile <strong>de</strong>r Stadt zerstört. Am 12. Mai 1940 fand <strong>de</strong>r erste Luftangriff statt. In <strong>de</strong>r Nacht <strong>zu</strong>m 31. Mai 1942 erlebte die<br />
Stadt <strong>de</strong>n ersten Tausend-Bomber-Angriff, <strong>de</strong>r 480 Tote, 5.000 Verletzte und 45.000 Obdachlose <strong>zu</strong>r Folge hatte. Der letzte von insgesamt 262 Luftangriffen am 2. März auf die fast<br />
menschenleere Stadt sollte auch <strong>de</strong>n letzten Wi<strong>de</strong>rstand vor <strong>de</strong>r Einnahme brechen. Zum Kriegsen<strong>de</strong> waren 95% <strong>de</strong>r Altstadt zerstört.<br />
Am 6. März 1945 sprengten <strong>de</strong>utsche Pioniere mittags die Hohenzollernbrücke, die letzte intakte Rheinbrücke Kölns. Zuvor hatten sich die letzten <strong>de</strong>utschen Einheiten auf das
echtsrheinische Ufer <strong>zu</strong>rückgezogen. Am gleichen Tag rückten die amerikanischen Truppen ins Stadtzentrum vor. Es kam nur <strong>zu</strong> gelegentlichen Schusswechseln. Vor <strong>de</strong>m Dom wur<strong>de</strong><br />
ein <strong>de</strong>utscher Panzer in Brand geschossen, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>vor einen amerikanischen Panzer zerstört hatte (siehe Bild). Am 11. April 1945 erreichten amerikanische Panzerspitzen, die <strong>zu</strong>erst in<br />
Remagen <strong>de</strong>n Rhein überschritten hatten, die freie Stadt Porz. Am 14. April 1945 wur<strong>de</strong>n die rechtsrheinischen Stadtteile vollständig besetzt. Die US-Army überquerte <strong>de</strong>n Rhein mit<br />
Hilfe einer Ponton-Brücke zwischen <strong>de</strong>m Stadtteil Sürth und <strong>de</strong>m rechtsrheinischen Zündorf.<br />
Köln nach <strong>de</strong>m Krieg<br />
Politik<br />
Köln zeigte sich <strong>de</strong>n einrücken<strong>de</strong>n US-amerikanischen Befreiungstruppen als eine tote Ruinenstadt. Am 9. März 1945 wur<strong>de</strong> die US-amerikanische Militärregierung in Köln etabliert.<br />
Am 4. Mai nahm Konrad A<strong>de</strong>nauer die Amtsgeschäfte als Oberbürgermeister wie<strong>de</strong>r auf. Schon im Frühsommer 1945 kehrten die Kölner in Scharen in die Stadt <strong>zu</strong>rück. Am 21. Juni<br />
1945 wur<strong>de</strong>n die Amerikaner von <strong>de</strong>r britischen Militärregierung abgelöst. Am 6. Oktober wur<strong>de</strong> A<strong>de</strong>nauer von dieser entlassen, am 20. November 1945 wur<strong>de</strong> Dr. Hermann Pün<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>m<br />
Oberbürgermeister ernannt.[71] Am 10. Oktober spielte das Millowitsch-Theater mit <strong>de</strong>m Dreiakter "Das Glücksmä<strong>de</strong>l" wie<strong>de</strong>r. Am 10. Dezember wur<strong>de</strong> die Universität wie<strong>de</strong>reröffnet.<br />
Am 18. Februar 1946 wur<strong>de</strong> Erzbischof Joseph Frings von Papst Pius XII. <strong>zu</strong>m Kardinal ernannt. Nach britischem Vorbild wur<strong>de</strong> am 7. März 1946 die Kölnische Stadtverfassung von<br />
1946 eingeführt, die eine Teilung <strong>de</strong>r Stadtführung zwischen Oberbürgermeister als Ratsvorsitzen<strong>de</strong>m und Oberstadtdirektor als Verwaltungschef vorsah.[72] Die erste freie<br />
Stadtratswahl <strong>de</strong>r Nachkriegszeit erfolgte am 13. Oktober (CDU 53,4 %, SPD 34,6 %, KPD 9,3 %). Köln kam <strong>zu</strong>m neu gebil<strong>de</strong>ten Land Nordrhein-Westfalen. Durch das Domfest vom<br />
14. bis 22. August 1948 <strong>zu</strong>r 700jährigen Wie<strong>de</strong>rkehr <strong>de</strong>r Grundsteinlegung wur<strong>de</strong> Kölns historische Be<strong>de</strong>utung wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Fokus gerückt. Seit 1948 kann die provisorisch<br />
hergerichtete Hohenzollernbrücke wie<strong>de</strong>r mit Zügen befahren wer<strong>de</strong>n; im selben Jahr wur<strong>de</strong> die neu gebaute Deutzer Brücke eröffnet.<br />
1950 fand in Köln die erste Photokina statt. Am 1./2. Oktober 1955 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kölner Gürzenich neu eingeweiht. Zum Katholikentag vom 29. August bis <strong>zu</strong>m 2. September 1956 kamen<br />
Hun<strong>de</strong>rttausen<strong>de</strong> nach Köln. 1957 eröffnete in Köln <strong>de</strong>r erste SB-Supermarkt mit über 2.000 m² Verkaufsfläche. Im gleichen Jahr war die Stadt erstmals Gastgeber <strong>de</strong>r BUGA. Zum 7.<br />
November 1959 erlebte Köln in Anwesenheit von Kardinal Frings und Bun<strong>de</strong>skanzler A<strong>de</strong>nauer die Einweihung <strong>de</strong>r Severinbrücke.<br />
Am 31. August 1962 war die Nord-Süd-Fahrt durchgehend, und am 5. September besuchte <strong>de</strong>r französische Staatspräsi<strong>de</strong>nt Charles <strong>de</strong> Gaulle die Stadt.[73] 1963 war <strong>de</strong>r amerikanische<br />
Präsi<strong>de</strong>nt John F. Kennedy <strong>zu</strong> Gast in Köln. 1968 wur<strong>de</strong> die erste Teilstrecke <strong>de</strong>r neuen U-Bahn (Friesenplatz-Hauptbahnhof) in Betrieb genommen.<br />
Im Deutschen Herbst kidnappte die RAF am 5. September 1977 <strong>de</strong>n Arbeitgeberpräsi<strong>de</strong>nten Hanns Martin Schleyer in <strong>de</strong>r Friedrich-Schmidt-Straße am Stadtwald. Am 25. April 1990<br />
wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Mülheimer Stadthalle ein Attentat auf Oskar Lafontaine verübt. 1991 fiel wegen <strong>de</strong>s Golfkriegs <strong>de</strong>r Kölner Rosenmontags<strong>zu</strong>g offiziell aus, die Jecken zogen aber trotz<strong>de</strong>m<br />
im „Geister<strong>zu</strong>g“ durch die Stadt.<br />
Im November 1980 besuchte Lew Kopelew <strong>de</strong>n Literaturnobelpreisträger und Ehrenbürger (1982) Heinrich Böll in <strong>de</strong>ssen Wohnung. Im gleichen Jahr wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 243,3 Meter hohe<br />
Fernmel<strong>de</strong>turm "Colonius" fertiggestellt. [74] 1980 und 1987 kam Papst Johannes Paul II. in die Stadt; bei seinem zweiten Besuch sprach er im Müngersdorfer Stadion Edith Stein selig.<br />
Vom 16. - 21. August 2005 weilte sein Nachfolger Benedikt XVI. im Rahmen <strong>de</strong>s XX. Weltjugendtag in <strong>de</strong>r Stadt. 1999 tagten sowohl <strong>de</strong>r Weltwirtschaftsgipfel <strong>de</strong>r G8 als auch <strong>de</strong>r<br />
Europäische Rat in Köln. 2003 wur<strong>de</strong> in Köln die erste schwarz-grüne Koalition in einer <strong>de</strong>utschen Großstadt gebil<strong>de</strong>t.<br />
Kultur<br />
Bereits 1945 nahm die Universität wie<strong>de</strong>r ihren Betrieb auf. 1956 wur<strong>de</strong> anlässlich <strong>de</strong>s Katholikentages <strong>de</strong>r Kölner Dom wie<strong>de</strong>reröffnet, 1957 das neue Opernhaus eingeweiht, Am 18.<br />
Mai 1957 eröffnete das neue Opernhaus. Weiter erfolgte in <strong>de</strong>r Nachkriegszeit eine ganze Reihe von Museumsneugründungen, so etwa 1974 <strong>de</strong>s Römisch-Germanischen Museums, 1977<br />
<strong>de</strong>s Museums für Ostasiatische Kunst, 1986 <strong>de</strong>s Wallraf-Richartz-Museums bzw. <strong>de</strong>s Museum Ludwig und 1993 schließlich <strong>de</strong>s Schokola<strong>de</strong>nmuseums. 1986 wur<strong>de</strong> die Philharmonie<br />
eröffnet. Köln entwickelte sich als Medienstandort. 1964 erschien die erste Ausgabe <strong>de</strong>s EXPRESS. 1987 schließlich eröffnete RTL seine neue Verwaltung in <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Anfang <strong>de</strong>r 1990er Jahre plün<strong>de</strong>ten Unbekannte unersetzliche Stücke aus <strong>de</strong>r Schatzkammer <strong>de</strong>s Kölner Doms. Auf Bitten <strong>de</strong>r Geistlichkeit schaffte die einheimische Unterwelt unter
Führung von Schäfers Nas einen Teil <strong>de</strong>r Beute wie<strong>de</strong>r herbei – worauf <strong>de</strong>r Dompropst ihm <strong>zu</strong> Ehren eine Dankesmesse las.[75]<br />
1992 fand auf <strong>de</strong>m Chlodwigplatz das große Konzert Arsch huh, Zäng ussenan<strong>de</strong>r gegen Rechte Gewalt statt. 2004 erhob die UNESCO Einspruch gegen <strong>de</strong>n geplanten Bau eines 103<br />
Meter hohen Büroturm in Deutz, <strong>de</strong>r aus ihrer Sicht <strong>de</strong>n Blick auf <strong>de</strong>n Dom zerstört. Sie drohte mit <strong>de</strong>m Ent<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>s Status als Weltkulturerbe.<br />
Am 3. März 2009 stürzte beim Bau <strong>de</strong>r Nord-Süd-Stadtbahn das Historische Archiv <strong>de</strong>r Stadt Köln ein.<br />
Sport<br />
1952 erschütterte <strong>de</strong>r Skandal um <strong>de</strong>n Boxer Peter Müller ("De Aap") die Stadt. 1962 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1. FC Köln erstmals Deutscher Fußballmeister, 1964 erster Deutscher Meister in <strong>de</strong>r<br />
Bun<strong>de</strong>sligageschichte. 1978 errang <strong>de</strong>r Club gleichzeitig <strong>de</strong>n Titel <strong>de</strong>s Pokalsiegers.[76]<br />
Gebiets- und Einwohnerentwicklung<br />
Durch Eingemeindungen wuchs das Stadtgebiet bis 1975 auf über 40.000 Hektar an, und Köln wur<strong>de</strong> für 18 Monate <strong>zu</strong>m ersten Mal Millionenstadt. Gleichzeitig wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kreis Köln<br />
aufgelöst. Bereits am 1. Juli 1976 wur<strong>de</strong> Wesseling nach erfolgreicher Verfassungsklage gegen das Köln-Gesetz wie<strong>de</strong>r ausgemein<strong>de</strong>t und wur<strong>de</strong> selbstständige Stadt im Erftkreis.<br />
Dadurch verlor Köln ca. 50.000 Einwohner. 1980 zählte die Stadt Köln erneut <strong>de</strong>n einmillionsten Bürger.<br />
Eingemeindungen<br />
Ehemals selbständige Städte und Gemein<strong>de</strong>n bzw. Gemarkungen, die in die Stadt Köln eingeglie<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>n:Jahr Orte Zuwachs in ha Gesamtfläche in ha<br />
• 1. April 1888<br />
• Bayenthal, Marienburg, Arnoldshöhe, Ra<strong>de</strong>rberg mit Ra<strong>de</strong>rthal, Zollstock, Sülz, Klettenberg, Kriel und Lind, Lin<strong>de</strong>nthal, Longerich, Melaten, Braunsfeld, Müngersdorf,<br />
Ehrenfeld, Bickendorf, Ossendorf, Bocklemünd, Mengenich, Volkhoven, Nippes, Mauenheim, Merheim/linksrheinisch (nach 1945 umbenannt in Wei<strong>de</strong>npesch), Riehl, Niehl,<br />
Poll und Deutz mit <strong>de</strong>r Humboldtkolonie 10.100 11.135<br />
• 1. April 1910<br />
• Kalk mit Vingst und Gremberg 599 11.734<br />
• 1. April 1914<br />
• Mülheim am Rhein mit Buchheim und Buchforst, Merheim mit Stammheim, Flittard, Dünnwald, Dellbrück, Wichheim, Rath, Brück und Ostheim 7.968 19.702<br />
• 1. April 1922<br />
• Bürgermeisterei Worringen mit Weiler, Merkenich, Langel, Feldkassel, Rheinkassel, Fühlingen, Roggendorf und Thenhoven 5.393 25.095<br />
• 1. Januar 1975<br />
• Porz, Wesseling, Ro<strong>de</strong>nkirchen (mit Sürth, Hahnwald, Meschenich, Godorf und Rondorf), Lövenich, Wei<strong>de</strong>n, Pesch, Esch, Auweiler, Wid<strong>de</strong>rsdorf, Marsdorf und diverse<br />
kleinere Gebiete 17.900 42.995<br />
• 1. Juli 1976<br />
• Ausglie<strong>de</strong>rung von Wesseling - 2.480 40.515<br />
Literatur<br />
Quelleneditionen<br />
• Wolfgang Rosen/Lars Wirtler (Hrsg.): Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln Bd. I: Antike und Mittelalter von <strong>de</strong>n Anfängen bis 1396/97. Köln 1999, ISBN 978-3-7616-1324-5,<br />
J.P. Bachem-Verlag.
• Deeters/Helmrath (Hrsg.): Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln Bd. II: Spätes Mittelalter und frühe Neuzeit (1396-1794). Köln 1996, ISBN 978-3-7616-1285-9, J.P. Bachem<br />
Verlag.<br />
• Heinrich Gottfried Philipp Gengler: Regesten und Urkun<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Verfassungs- und Rechtsgeschichte <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Städte im Mittelalter. Erlangen 1863, S. 515-598, online.<br />
• Gottfried Hagen: Reimchronik <strong>de</strong>r Stadt Köln, hrsg. v. Kurt Gärtner, Andrea Rapp, Désirée Welter, Manfred Groten. Droste, Düsseldorf, 2008. Publikationen <strong>de</strong>r Gesellschaft für<br />
Rheinische Geschichtskun<strong>de</strong> 74. ISBN 3-7700-7627-3<br />
• Annales Colonienses maximi. [Kölner Königschronik] In: Monumenta Germaniae Historica. Georg Heinrich Pertz u. a. (Hrsg.): Scriptores (in Folio) 17: Annales aevi Suevici.<br />
Hannover 1861, S. 723–847 (Digitalisat)<br />
• Dat nuwe Boych. Zünfte und Bru<strong>de</strong>rschaften. [Buch Köln 14.Jahrhun<strong>de</strong>rt, Köln 1360-1396], in: Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln, Bd. I, Leonard Ennen und Gottfried<br />
Eckertz (Hrsg), Köln 1860, S. 422-444; online: Bonner Frühneuhoch<strong>de</strong>utschkorpus Text 151<br />
• Die Cronica van <strong>de</strong>r hilliger Stat va Coelle. [Johann Koelhoff: Chronik, Köln 1499], Köln 1499, Druck: Johann Koelhoff d.J. (Reprographischer Nachdruck, Köln 1972); online:<br />
Bonner Frühneuhoch<strong>de</strong>utschkorpus Text 153<br />
• Das Buch Weinsberg. Aus <strong>de</strong>m Leben eines Kölner Ratsherrn, hg. Von J.J. Hässlin, Stuttgart 1961; online: Die autobiographischen Aufzeichnungen Hermann Weinsbergs —<br />
Digitale Gesamtausgabe<br />
• Darstellungen<br />
Allgemein<br />
• Historische Gesellschaft Köln e. V. (Hrsg.): Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. 13 B<strong>de</strong> geplant. Köln 2004 ff., ISBN 3-7743-0360-6<br />
• Bisher erschienen:<br />
• Band 1 - Werner Eck: Köln in römischer Zeit. Geschichte einer Stadt im Rahmen <strong>de</strong>s Imperium Romanum. H. Stehkämper (Hrsg.). Greven Verlag, Köln 2004, ISBN 3-<br />
7743-0357-6.<br />
• Band 8 - Klaus Müller: Köln von <strong>de</strong>r französischen <strong>zu</strong>r preußischen Herrschaft 1794-1815. Greven Verlag, Köln 2005, ISBN 978-3-7743-0374-4<br />
• Band 12 - Horst Matzerath: Köln in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus 1933-1945. Greven Verlag, Köln 2009, ISBN 978-3-7743-0429-1<br />
• Der historische Atlas Köln. 2000 Jahre Stadtgeschichte in Karten und Bil<strong>de</strong>rn. Hrsg. v. Jansen,Heiner/Ritter,Gert/Wiktorin,Dorothea/Weiss,Günther/Gohrbandt,Elisabeth. Köln<br />
Emons 2003. ISBN 978-3-89705-265-9<br />
• Geschichte in Köln. Zeitschrift für Stadt- und Regionalgeschichte. SH-Verl., Köln 1.1978,1ff. ISSN 0720-3659<br />
• Carl Dietmar: Die Chronik Kölns. Chronik Verlag, Dortmund 1991, ISBN 3-611-00193-7<br />
• Carl Dietmar/Werner Jung: Kleine illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Köln 2002, ISBN 978-3-7616-1482-2, J.P. Bachem Verlag.<br />
• Josef Dollhoff: Die Kölner Rheinschiffahrt. Von <strong>de</strong>r Römerzeit bis <strong>zu</strong>r Gegenwart. Bachem Köln 1980, ISBN 978-3-7616-0528-8<br />
• Irene Franken: Frauen in Köln. Der historische Stadtführer. Köln 2008, ISBN 978-3-7616-2029-8, J.P. Bachem Verlag.<br />
• Leonard Ennen: Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Volks-Ausgabe in einem Ban<strong>de</strong>. Düsseldorf 1880.<br />
• Elisabeth Mick: Köln im Mittelalter. Greven Verlag, Köln 1990<br />
• Elisabeth Mick: Mit <strong>de</strong>r Maus durch Köln. 2000 Jahre Stadtgeschichte für Kin<strong>de</strong>r. 2. Aufl. 2006, ISBN 978-3-7616-1914-8, J.P. Bachem Verlag.<br />
• Irene Franken, Ina Hoener: Hexen. Die Verfolgung von Frauen in Köln. Köln 1987<br />
• Stefan Pohl/Georg Mölich: Das rechtsrheinische Köln: Seine Geschichte von <strong>de</strong>r Antike bis <strong>zu</strong>r Gegenwart. Winand Köln 1994<br />
• Andreas Rutz / Tobias Wulf (Hrsg.): O felix Agrippina nobilis Romanorum Colonia. Neue Studien <strong>zu</strong>r Kölner Geschichte - Festschrift für Manfred Groten <strong>zu</strong>m 60. Geburtstag<br />
(Veröffentlichungen <strong>de</strong>s Kölnischen Geschichtsvereins 48), Köln 2009. ISBN 978-3-89498-198-3<br />
• Arnold Stelzmann, Robert Frohn: Illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Bachem, Köln 1958, 1990 (11. Aufl.), ISBN 3-7616-0973-6
Mittelalter<br />
• Carl Dietmar: Das mittelalterliche Köln. Köln 2. Auflage 2004: J.P. Bachem Verlag<br />
• Irsigler,Franz / Lassotta,Arnold: Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker. Aussenseiter in einer mittelalterlichen Stadt. Köln 1300-1600. Greven Verlag, Köln 1984<br />
• Peter Fuchs (Hrsg.): Chronik <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Band 1: Von <strong>de</strong>n Anfängen bis 1400. Greven Verlag, Köln 3. Auflage 1999<br />
• Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln. Bd. 2: Das Bistum Erzbistum Köln im späten Mittelalter (1191-1515), 2 B<strong>de</strong>. von Wilhelm Janssen, hg. von Norbert Trippen, Bachem Köln<br />
1995/2003<br />
• Ulrike Kaltwasser: Heiliges Köln - sündiges Köln: glanzvolles Mittelalter, Köln Greven 1985 ISBN 3-7743-0218-9<br />
• Yvonne Leiverkus: Köln, Bil<strong>de</strong>r einer spätmittelalterlichen Stadt, Köln/Weimar/Wien: Böhlau 2005 ISBN 978-3-412-23805-6<br />
• Anton Legner: Kölner Heilige und Heiligtümer. Ein Jahrtausend europäischer Reliquienkultur. Greven Verlag, Köln 2003, ISBN 978-3-7743-0335-5<br />
• Matthias Schmandt: Ju<strong>de</strong>i, cives et incole. Studien <strong>zu</strong>r jüdischen Geschichte Kölns im Mittelalter, Hannover 2002<br />
• Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln. Bd. 1: Das Bistum Köln von <strong>de</strong>n Anfängen bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts, hg. von Eduard Hegel, 2. Aufl. neu bearbeitet v. Friedrich<br />
Wilhelm Oediger, Bachem Köln 1971<br />
Neuzeit<br />
• Peter Fuchs (Hrsg.): Chronik <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Band 2: Von 1400 bis <strong>zu</strong>r Gegenwart. Greven Verlag, Köln 2. Auflage 1993.<br />
• Martin Rüther: Köln im Zweiten Weltkrieg. Alltag und Erfahrungen zwischen 1939 und 1945. Darstellungen - Bil<strong>de</strong>r - Quellen. Mit Beiträgen von Gebhard A<strong>de</strong>rs. Schriften <strong>de</strong>s<br />
NS-Dokumentationszentrums <strong>de</strong>r Stadt Köln. Bd. 12. Emons, Köln 2005. 960 S., ISBN 3-89705-407-8<br />
• Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln. Bd. 3: Das Erzbistum Köln im Zeitalter <strong>de</strong>r Glaubenskämpfe 1515-1688, von Norbert Trippen, Hansgeorg Molitor (Hg.), Bachem Köln 2007<br />
• Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln. Bd. 4: Das Erzbistum Köln zwischen Barock und Aufklärung v. Pfälz. Krieg bis z. En<strong>de</strong> d. französ. Zeit, von Eduard Hegel und Norbert<br />
Trippen, Bachem Köln 1979<br />
• Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln. Bd. 5: Das Erzbistum Köln zwischen <strong>de</strong>r Restauration <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts und <strong>de</strong>r Restauration <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts, von Eduard Hegel und<br />
Norbert Trippen, Bachem Köln 1987<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Caesar: De bello gallico, V 24<br />
2. ↑ Tac. ann. 1. 57,2; erlätert bei: Rosen/Wirtler (Hrsg.): Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln Bd. I. Köln 1999, S.1f.<br />
3. ↑ Bericht darüber in: Rudolf Buchner (Herausgeber): Lampert von Hersfeld, Annalen. Darmstadt 4. Aufl. 2000<br />
4. ↑ Theodor Joseph Lacomblet: Urkun<strong>de</strong>nbuch für die Geschichte <strong>de</strong>s Nie<strong>de</strong>rrheins, Band 1, Aalen ²1966, S. 302ff Online<br />
5. ↑ Leonard Ennen und Gottfried Eckertz (Hgg.), Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln, 1. Band, Köln 1860, S. 563f Online<br />
6. ↑ Leonard Ennen und Gottfried Eckertz (Hgg.), Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln, 1. Band, Köln 1860, S. 570f Online<br />
7. ↑ Leonard Ennen und Gottfried Eckertz (Hgg.), Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln, 1. Band, Köln 1860, S. 582-585 Online<br />
8. ↑ Leonard Ennen und Gottfried Eckertz (Hgg.), Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln, 1. Band, Köln 1860, S. 585f<br />
9. ↑ Rosen/Wirtler (Hrsg.): Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln Bd. I. Köln 1999, S.154ff.<br />
10.↑ Der zweite Kölner „Festungsring“ o<strong>de</strong>r die mittelalterliche Stadtbefestigung (=Webseite <strong>de</strong>r Arbeitsgemeinschaft Festung Köln e.V.)<br />
11.↑ G.H.Klöverkorn, Der Aussatz in Köln, Leverkusen 1966<br />
12.↑ Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln, Bd. 1, Nr. 30 (S.163f.)
13.↑ Wortlaut bei: Rosen/Wirtler (Hrsg.): Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln Bd. I. Köln 1999, S.173ff.<br />
14.↑ Verleihungsurkun<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Stapelrechts bei Rosen/Wirtler (Hrsg.): Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln Bd. I. Köln 1999, S.215ff.<br />
15.↑ Kaltwasser, Heiliges Köln, S.70ff.<br />
16.↑ Edition mit erläutern<strong>de</strong>m Text: Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln II, hrsg. Joachim Deeters und Johannes Helmrath, Bachem, Köln 1996, Nr. 1, S.10<br />
17.↑ Dietmar: Chronik Köln, S. 126<br />
18.↑ Kaltwasser, Heiliges Köln, S.32ff. (Die tüchtigen Kölnerinnen., S.72<br />
19.↑ Walther Holtzmann: Die englische Heirat Pfalzgraf Ludwigs III., in: Zeitschrift für die Geschichte <strong>de</strong>s Oberrheins NF 43 (1930), 1-22<br />
20.↑ Kaltwasser, Heiliges Köln, S.50<br />
21.↑ Matthias Schmandt: Ju<strong>de</strong>i, cives et incole: Studien <strong>zu</strong>r jüdischen Geschichte Kölns im Mittelalter, Hannover 2002<br />
22.↑ Zu <strong>de</strong>n städtischen Unterschichten in Köln grundlegend: Irsigler, Franz / Lassotta, Arnold: Bettler und Gaukler, Dirnen und Henker. Aussenseiter in einer mittelalterlichen<br />
Stadt. Köln 1300-1600. München 9. Aufl. 2001. Zur Bettelordnung S.26f.<br />
23.↑ Kaltwasser, Heiliges Köln, S.47f.<br />
24.↑ Franken/ Hoerner: Hexen, S. 14<br />
25.↑ Johann Jakob Merlo: Beiträge <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r kölner Buchdrucker und Buchhändler <strong>de</strong>s 15. und 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts, in: Annalen <strong>de</strong>s Historischen Vereins für <strong>de</strong>n<br />
Nie<strong>de</strong>rrhein 19 (1868), S. 59<br />
26.↑ Vollständiger Abdruck in: Robert Meier: Heinrich van Beeck und seine "Agrippina". Ein Beitrag <strong>zu</strong>r Kölner Chronistik <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Kölner Historische<br />
Abhandlungen Band 41. Böhlau Köln 1998<br />
27.↑ Bernd-Ulrich Hergemöller: Die "unsprechliche stumme Sün<strong>de</strong>" in Kölner Akten <strong>de</strong>s ausgehen<strong>de</strong>n Mittelalters, in: Geschichte in Köln, Heft 22 (1987), S. 5-51; ausführliche<br />
Online-Dokumentation: Quellen <strong>zu</strong>r Verfolgungs- und Alltagsgeschichte <strong>de</strong>r “Sodomiter” (Homosexuellen) im späten Mittelalter und <strong>de</strong>r reformatorischen Frühzeit<br />
28.↑ Friedrich Wilhelm Bautz: Jakob von Hoogstraaten, in: BBKL Band II (1990), Spalten 1042-1045<br />
29.↑ Deeters/Helmrath (Hrsg.): Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln Bd. II, S.1ff. und S.238ff.<br />
30.↑ Stelzmann,Frohn: Illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Köln 11.Aufl.1990<br />
31.↑ Niedrigwasser macht`s möglich - Ent<strong>de</strong>ckung am Kölner Rheinufer, in: Monumente online, hg. von Deutsche Stiftung Denkmalschutz, Mai 2006<br />
32.↑ Siehe beispielsweise Ernst-Otto Simon: Der Postkurs von Rheinhausen bis Brüssel im Laufe <strong>de</strong>r Jahrhun<strong>de</strong>rte, in: Archiv für <strong>de</strong>utsche Postgeschichte 1/1990, S. 34–35.<br />
33.↑ Deeters/Helmrath: Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln Bd. II, S.220ff<br />
34.↑ Franken/Hoerner: Hexen, S. 41-48<br />
35.↑ Friedrich Wilhelm Siebel: Die Hexenverfolgung in Köln, Dissertation Bonn 1959, S. 64–75, Statistik S. 152–153.<br />
36.↑ Franken/Hoerner: Hexen, S. 25f<br />
37.↑ Chronik Köln, S198f.<br />
38.↑ Deeters/Helmrath: Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln Bd. II, S.258ff<br />
39.↑ Carl Dietmar, S. 217, 219<br />
40.↑ Peter Fuchs (Hrsg.): Chronik <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Band 2, S.113<br />
41.↑ Klara van Eyll: Köln von <strong>de</strong>r französischen Beset<strong>zu</strong>ng bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ersten Weltkriegss (1794 bis 1918), in: Peter Fuchs (Hrsg.): Chronik <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln.<br />
Band 2, S.106<br />
42.↑ Hermann Keussen: Wallraf, Ferdinand Franz, in: ADB Bd. 40, Leipzig 1896<br />
43.↑ Stelzmann/Frohn: Illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Köln 11. Aufl. 1990, S. 240ff
44.↑ Klara van Eyll, a.a.O. S.107<br />
45.↑ Paul Clemen (Hg.): Der Dom <strong>zu</strong> Köln (= Die Kunst<strong>de</strong>nkmäler <strong>de</strong>r Rheinprovinz. Band 6, Teil III). Reprint Düsseldorf Schwann 1980<br />
46.↑ Stelzmann/Frohn: Illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Köln 11. Aufl. 1990, S. 288ff<br />
47.↑ Josef Dollhoff: Die Kölner Rheinschiffahrt, Bachem Köln 1980 S. 59ff, S. 79<br />
48.↑ Dietmar, Chronik Köln, 3. Aufl. Gütersloh/München 1997, S. 237<br />
49.↑ Stelzmann/Frohn: Illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Köln 11. Aufl. 1990, S. 279f<br />
50.↑ Josef Dollhoff: Die Kölner Rheinschiffahrt, Bachem Köln 1980 - Hafen: S. 87; Seeschiffahrt: S. 93<br />
51.↑ Der dritte Kölner „Festungsring“ o<strong>de</strong>r die neupreußische Stadtbefestigung (=Webseite <strong>de</strong>r Arbeitsgemeinschaft Festung Köln e.V.)<br />
52.↑ Stelzmann/Frohn: Illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Köln 11. Aufl. 1990, S. 293<br />
53.↑ Der vierte Kölner „Festungsring“ o<strong>de</strong>r die preußische Stadtbefestigung 1871 - 1918 (=Webseite <strong>de</strong>r Arbeitsgemeinschaft Festung Köln e.V.)<br />
54.↑ Dietmar, Chronik Köln, 3. Aufl. Gütersloh/München, S. 316f<br />
55.↑ Meyers Konversationslexikon Leipzig und Wien, 4. Aufl. 1885-1892, IX S. 948<br />
56.↑ Klara van Eyll, a.a.O. S.109<br />
57.↑ Stelzmann/Frohn: Illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Köln 11. Aufl. 1990, S. 240ff<br />
58.↑ vgl. da<strong>zu</strong>: Preußische Landtagswahlen im Wahlkreis Köln-Aachen<br />
59.↑ Dietmar, Chronik Köln, 3. Aufl. Gütersloh/München, S. 341f.<br />
60.↑ da<strong>zu</strong> weiterführend: Denkmalwert und Nut<strong>zu</strong>ngspotenzial <strong>de</strong>s Stadtgartens in Köln, Bestandsanalyse, Beurteilung, Entwicklungskonzept. Diplomarbeit Heike Müller, TU<br />
Dres<strong>de</strong>n, auf: Internetpräsenz "Pro Stadtgarten e.V.<br />
61.↑ PDF-Dokument Einblick Historie auf <strong>de</strong>r Downloadseite <strong>de</strong>s Köln Bonn Airports<br />
62.↑ Horst Matzerath: Köln in <strong>de</strong>r Weimarer Republik, in: Peter Fuchs (Hrsg.): Chronik <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Band 2, S.192<br />
63.↑ Internetpräsenz <strong>de</strong>r Ausstellung »Willkommen, Bienvenue, Welcome…«. Politische Revue – Kabarett – Varieté in Köln 1928-1938 im NS-Dokumentationszentrum Köln<br />
(2008)<br />
64.↑ Stelzmann/Frohn: Illustrierte Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Köln 11. Aufl. 1990, S. 317<br />
65.↑ Horst Matzerath: a.a.O., S.191<br />
66.↑ Stelzmann/Frohn: a.a.O. S. 318<br />
67.↑ Horst Matzerath: Köln in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus, in: Peter Fuchs (Hrsg.): Chronik <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Band 2, S.222f.<br />
68.↑ Peter Fuchs (Hrsg.): Chronik <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Band 2, S.238<br />
69.↑ Horst Matzerath: a.a.O., S.225ff.<br />
70.↑ Internetpräsenz <strong>de</strong>s NS-Dokumentationszentrum <strong>de</strong>r Stadt Köln<br />
71.↑ Stelzmann/Frohn: a.a.O. S. 331<br />
72.↑ Internetpräsenz <strong>de</strong>r Stadt Köln: Rat seit 1946<br />
73.↑ Peter Fuchs (Hrsg.): Chronik <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Band 2, S.262ff.<br />
74.↑ Peter Fuchs, a.a.O.<br />
75.↑ Ist <strong>de</strong>r Probst witzig?, ZEIT-online / DIE ZEIT, 06/1996<br />
76.↑ Willy B. Wange: Die Sportstadt Köln, in: Peter Fuchs (Hrsg.): Chronik <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln. Band 2, S.349ff.
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Kölner Wappen<br />
Das Kölner Wappen existiert seit etwa 1000 Jahren. Es hat sich mehrfach in <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln geän<strong>de</strong>rt und ziert heute viele Logos Kölner Institutionen. So ist es<br />
beispielsweise im Stadtadler <strong>de</strong>r Stadtverwaltung und in vielen Unternehmen in <strong>de</strong>r Kölner Wirtschaft <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n.<br />
Abgren<strong>zu</strong>ng<br />
Das hier gezeigte Wappen geht auf das Wappen <strong>de</strong>r Freien Reichsstadt Köln (seit 1475) <strong>zu</strong>rück. Die Wappen <strong>de</strong>s (ehemaligen) Kurfürstentums und Erzstifts Köln sowie <strong>de</strong>s Erzbistums<br />
Köln zeigen in Silber ein (häufig gestän<strong>de</strong>rtes) schwarzes Balkenkreuz. Das Wappen <strong>de</strong>s Erzbistums zeigt hinter diesem Schild noch ein Doppelkreuz, das Vortragekreuz eines<br />
Erzbischofs. Das Kurkölner Wappen ist heute noch ein Bestandteil vieler Kreis-, Stadt- und Ortswappen im Kölner Umland und in <strong>de</strong>n ehemals kölnischen Gebieten Westfalens.<br />
Symbolik<br />
Blasonierung: Unter rotem Schildhaupt, darin drei gol<strong>de</strong>ne dreiblättrige Kronen in Reihe, in Silber 11 schwarze Flammen in drei Reihen (5:4:2). - Bis um 1550: Silber mit rotem<br />
Schildhaupt, darin drei gol<strong>de</strong>nen dreiblättrigen Kronen in Reihe.<br />
Köln war neben Lübeck Mitbegrün<strong>de</strong>rin <strong>de</strong>r Deutschen Hanse, <strong>de</strong>r Schild trägt daher die Farben <strong>de</strong>r Hanse: Rot und Weiß. Die drei Kronen sind seit <strong>de</strong>m 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt das<br />
Hoheitszeichen <strong>de</strong>r Stadt und erinnern an die Heiligen Drei Könige (eigentlich Stern<strong>de</strong>uter), <strong>de</strong>ren Reliquien 1164 als Geschenk <strong>de</strong>s Kaisers Friedrich I. Barbarossa nach Köln gebracht<br />
wur<strong>de</strong>n.<br />
Die elf schwarzen Tropfen (o<strong>de</strong>r Flammen, in Köln spricht man von „Tränen“) zieren seit <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt das Stadtwappen und erinnern an die Heilige Ursula, <strong>de</strong>r Legen<strong>de</strong> nach<br />
eine fromme Tochter <strong>de</strong>s Königs <strong>de</strong>r Bretagne, Maurus. Eigentlich stellen die Flammen Hermelinschwänze dar, die sich im alten Wappen <strong>de</strong>r Bretagne befan<strong>de</strong>n. Der Legen<strong>de</strong> nach<br />
befand sich die Heilige Jungfrau Ursula <strong>zu</strong>sammen mit ihren zehn jungfräulichen Gefährtinnen auf <strong>de</strong>r Rückfahrt von einer Pilgerreise nach Rom. Möglicherweise war es <strong>de</strong>r im<br />
Mittelalter aufgekommene Reliquienkult, <strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>n elf Jungfrauen 11.000 (daher „Ursula und die 11.000 Jungfrauen“) wer<strong>de</strong>n ließ. Sie wur<strong>de</strong>n bei Köln von Hunnen unter Attila<br />
ermor<strong>de</strong>t. Über die Jahre wur<strong>de</strong>n alle Gebeine, die in und um Köln gefun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n (in <strong>de</strong>r Regel römische Grabmäler, die üblicherweise an Straßen angelegt wur<strong>de</strong>n), <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n elf<br />
jungfräulichen Gebeinen gelegt, und somit hat Köln das größte Gebeinhaus nördlich <strong>de</strong>r Alpen.<br />
Das Wappen (<strong>de</strong>r Wappenschild) wird eingefasst durch einen doppelköpfigen Adler mit Zepter und Schwert. Dieses Symbol <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches, bei <strong>de</strong>m ein Adlerkopf<br />
jeweils für Kaiser- und Königsmacht stand, verkörpert <strong>de</strong>n Status als Freie Reichsstadt, <strong>de</strong>n Köln <strong>de</strong> jure 1475 erhielt (<strong>de</strong> facto bereits durch die Abschüttelung <strong>de</strong>r Erzbischofsherrschaft<br />
durch die Schlacht von Worringen 1288).<br />
Quellen<br />
• Deutsche Wappen - Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland, Stadler, K., 1964-1971, Angelsachsen Verlag, 8 Ausgaben<br />
• Heiko Steuer: Das Wappen <strong>de</strong>r Stadt Köln, Köln, 1981, Greven Verlag
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Erzbistum Köln<br />
Das Erzbistum Köln (lat.: Archidioecesis Coloniensis) ist eine römisch-katholische Diözese im Westen von Nordrhein-Westfalen und im nördlichen Rheinland-Pfalz. Es ist eines <strong>de</strong>r<br />
ältesten und mit rund 2,14 Millionen Katholiken im Diözesangebiet (Stand: 31. Dezember 2008) das größte <strong>de</strong>r Bistümer <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschsprachigen Raums. Das Erzbistum Köln bil<strong>de</strong>t<br />
<strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n Suffraganbistümern Aachen, Essen, Limburg, Münster und Trier die Kirchenprovinz Köln, <strong>de</strong>ren Metropolit <strong>de</strong>r Kölner Erzbischof ist. Seit 1989 wird dieses Amt von<br />
Joachim Kardinal Meisner beklei<strong>de</strong>t. Kathedrale <strong>de</strong>s Erzbistums Köln ist <strong>de</strong>r Kölner Dom.<br />
Geschichte<br />
Anfänge<br />
Das Erzbistum Köln geht auf die frühchristliche Gemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong>rück. Zu dieser Zeit war Köln römisch und die ersten Christen mussten sich wohl im Untergrund versammeln. Der<br />
Lyoner Bischof Irenäus erwähnt in seiner Schrift „Gegen die Häretiker“ (Adversus haereses) Christen, die in Germanien leben. Daraus wird oft auch auf Christengemein<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n<br />
Provinzhauptorten Köln und Mainz geschlossen. Der erste belegbare Bischof von Köln war <strong>de</strong>r Hl. Maternus um 313. Der erste Bischof mit fränkischem Namen war Hl. Evergislus<br />
(Eberigisil) im 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Seit ca. 795 führten die Bischöfe von Köln <strong>de</strong>n Titel eines Erzbischofs.<br />
Mittelalter<br />
Erzbischof Rainald von Dassel überführte im Jahr 1164 die Gebeine <strong>de</strong>r Hl. Drei Könige nach Köln. Mit diesem Ereignis wur<strong>de</strong> Köln <strong>zu</strong> einem <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utsamsten Wallfahrtsorte <strong>de</strong>r<br />
christlichen Welt. Auch die Vielzahl <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren „Kölner Heiligen“ wie z.B. die Hl. Ursula und <strong>de</strong>r Heilige Gereon trugen da<strong>zu</strong> bei, dass Köln fortan <strong>de</strong>n Titel „Sancta“ (heilig) im<br />
Stadtnamen trug. Der volle Titel Kölns war „Sancta Colonia Dei Gratia Romanae Ecclesiae Fi<strong>de</strong>lis Filia“ – Heiliges Köln, von Gottes Gna<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Römischen Kirche getreue Tochter.<br />
Der alte karolingische Dom war <strong>de</strong>n Pilgermassen und <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Erzbistums bald nicht mehr gewachsen, und so wur<strong>de</strong> im Jahr 1248 von Erzbischof Konrad von Hochsta<strong>de</strong>n<br />
<strong>de</strong>r Grundstein für <strong>de</strong>n neuen gotischen Dom gelegt.<br />
Im Verlauf <strong>de</strong>r Zeit hatten die Erzbischöfe von Köln als weltliche Herrscher <strong>de</strong>s Erzstifts Kurköln immer mehr Unstimmigkeiten mit <strong>de</strong>n Kölner Bürgern. Den Gipfel fan<strong>de</strong>n diese im<br />
Zuge <strong>de</strong>s limburgischen Erbfolgekrieges im Jahr 1288 mit <strong>de</strong>r Schlacht von Worringen; die Kölner Bürger hatten sich auf die Seite <strong>de</strong>r Gegner ihres Erzbischofs geschlagen. Die<br />
Erzbischöfe verloren als Ergebnis <strong>de</strong>r Schlacht die weltliche Macht über die Stadt Köln. Den fortgesetzten Anspruch auf die Stadt symbolisierte man allerdings weiter gern, etwa in<strong>de</strong>m<br />
man in Urkun<strong>de</strong>n unverdrossen von „unserer Stadt Köln“ sprach. Auch behielten die Kölner Erzbischöfe Reservatrechte über die Stadt, vor allem die Hochgerichtsbarkeit. Mehr o<strong>de</strong>r<br />
min<strong>de</strong>r permanenten Streitigkeiten über Kompetenzen innerhalb Kölns waren damit zwar über einen langen Zeitraum Tür und Tor geöffnet. De facto aber blieben die Erzbischöfe,<br />
<strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st in ihrer Eigenschaft als weltliche Territorialfürsten, Frem<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Reichsstadt, die an <strong>de</strong>ren Schlagbäumen auf ebenso sinnfällige Weise um Zugang <strong>zu</strong> bitten hatten.<br />
Der Kölner Erzbischof war bis 1803 einer <strong>de</strong>r Kurfürsten <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.
Die Reformationszeit<br />
Während die kirchliche Struktur im Großraum <strong>de</strong>s Erzbistums Köln schon um das Jahr 1000 ausgebil<strong>de</strong>t war und über das Mittelalter hinweg weitgehend konstant blieb, brachte die<br />
neuzeitliche Geschichte eine Reihe recht komplizierter Verän<strong>de</strong>rungen mit sich. Zu <strong>de</strong>ren Verständnis muss man sich <strong>de</strong>n Umstand vor Augen halten, dass „Köln“ mit <strong>de</strong>r Reichsstadt,<br />
<strong>de</strong>m weltlich regierten kleineren Erzstift und <strong>de</strong>m kirchlich verwalteten Erzbistum begrifflich drei unterschiedliche Be<strong>zu</strong>gsgrößen bezeichnet, die allerdings historisch vielfach<br />
miteinan<strong>de</strong>r verflochten waren.<br />
Die reformatorische Entwicklung war am Kölner Erzbistum im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt noch vergleichsweise unmerklich vorbeigegangen: Wohl nicht viel mehr als rund ein Zehntel <strong>de</strong>r<br />
Pfarreien wechselte vom katholischen <strong>zu</strong>m evangelischen, das heißt lutherischen o<strong>de</strong>r reformierten Bekenntnis. Dabei han<strong>de</strong>lte es sich teils um solche Orte, die aus eigenem Antrieb und<br />
gegen <strong>de</strong>n erklärten Willen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sherrn vom katholischen Glauben abrückten wie beispielsweise Wesel o<strong>de</strong>r Soest. Teils aber gab erst das spätere konfessionspolitische Einwirken<br />
<strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sherren im Sinne <strong>de</strong>s sog. Lan<strong>de</strong>sherrlichen Kirchenregiments <strong>de</strong>n Ausschlag für eine religiöse Umorientierung. Dass die Herzöge von Kleve, die bis <strong>zu</strong> ihrem Aussterben 1609<br />
und <strong>de</strong>r nachfolgen<strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>steilung Jülich, Kleve, Berg, Mark und Ravensberg beherrschten, nicht (o<strong>de</strong>r nicht offen) <strong>zu</strong>r evangelischen Kirche übertraten, sollte sich allerdings als<br />
stabilisierend für das Erzbistum Köln erweisen, das diese Territorien fast ganz umspannte. Erst als Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen 1609 das Herzogtum Kleve und später Moers an sich nahm,<br />
regierte in einem <strong>zu</strong>m Erzbistum Köln gehörigen Gebiet eine protestantische Dynastie, die die katholische Gegenreformation <strong>zu</strong> blockieren bestrebt war.<br />
Die komplizierten, durch ein mächtepolitisches Patt verursachten Konfessionsverhältnisse in <strong>de</strong>n 1609 zwischen Bran<strong>de</strong>nburg-Preußen und Pfalz-Neuburg aufgeteilten Territorien sind in<br />
<strong>de</strong>r Folge vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>s Jülich-Klevischen Erbfolgestreits (1609–1666) <strong>zu</strong> sehen. An <strong>de</strong>ssen En<strong>de</strong> galten wechselseitige Duldungsbestimmungen für die katholische,<br />
lutherische und reformierte Konfession, die – ob aus seiner Sicht positiv o<strong>de</strong>r negativ – je<strong>de</strong>nfalls außerhalb <strong>de</strong>s Zugriffs <strong>de</strong>s Kölner Erzbischofs lagen: Er sah sich in seinem<br />
Wirkungskreis ganz auf sein kleines weltliches Herrschaftsgebiet verwiesen, das mit Ausnahme von Linz am Rhein links <strong>de</strong>s Rheins lag. Angesichts <strong>de</strong>r überaus starken Stellung <strong>de</strong>r<br />
Landstän<strong>de</strong> war er allerdings in seiner Regierungsfähigkeit seit <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts stark beschränkt.<br />
Es ließe sich somit in bewusster Überspit<strong>zu</strong>ng behaupten, dass <strong>de</strong>r Kölner Erzbischof seit <strong>de</strong>m Spätmittelalter sowohl als weltlicher Fürst als auch als kirchlicher „Hirte“ <strong>zu</strong> einem<br />
wirksamen Han<strong>de</strong>ln unfähig war, wobei nicht selten persönlich wenig geeignete Bischofspersönlichkeiten am wenigsten geeignet schienen, die strukturell widrigen Umstän<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r<br />
Bistumsverwaltung in <strong>de</strong>n Griff <strong>zu</strong> bekommen.<br />
Die Rücktritte zweier Bischöfe (Friedrich von Wied und Salentin von Isenburg) und, wichtiger noch, die Reformationsversuche durch Hermann V. von Wied 1543 und Gebhard Truchseß<br />
von Waldburg 1582 hinterließen keine wirklich langfristigen Folgen für das Erzbistum. Die Neigungen Hermanns und, mehr noch, Gebhards wur<strong>de</strong>n trotz<strong>de</strong>m von <strong>de</strong>r Gegenseite als<br />
äußerst gefährlich empfun<strong>de</strong>n. Der katholischen Fraktion im Reich stand mit <strong>de</strong>r möglichen Protestantisierung <strong>de</strong>s Erzbistums nämlich nicht <strong>zu</strong> Unrecht ein Kippen <strong>de</strong>r<br />
Konfessionsverhältnisse auf breiter Ebene vor Augen: Da <strong>de</strong>r Kölner Kurfürst eines von sieben Voten bei <strong>de</strong>r Wahl <strong>de</strong>s Kaisers besaß, schien sogar langfristig ein protestantisches<br />
Kaisertum mit ungeahnten Folgen für das gesamte Herrschaftsgefüge auf europäischer Ebene möglich.<br />
Die „bayerische Herrschaft“ (1583–1761)<br />
Die relative konfessionelle Stabilität <strong>de</strong>s Erzbistums Köln angesichts einer an<strong>de</strong>rswo rapi<strong>de</strong>n Protestantisierung ist angesichts <strong>de</strong>ssen vor <strong>de</strong>m Hintergrund übergreifen<strong>de</strong>r politischer<br />
Interessen <strong>zu</strong> sehen. Dass „die Rheinlän<strong>de</strong>r“ im 16. und 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt mehrheitlich katholisch blieben, lag somit nicht daran, dass sie beson<strong>de</strong>rs glaubensstark bzw. gegenüber <strong>de</strong>r<br />
Reformation grundsätzlich abgeneigt gewesen wären. Vielmehr erwiesen sich die um die Mitte <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts verbliebenen katholischen Mächte (namentlich die Kurie, Spanien<br />
bzw. das Haus Habsburg, die bayerischen Wittelsbacher im Verband mit einer Reihe kleinerer, auf die Versorgungsstellen in <strong>de</strong>n Domkapiteln angewiesener Dynastien) als<br />
durchset<strong>zu</strong>ngsstark.<br />
Vor allem wur<strong>de</strong> die Vorherrschaft <strong>de</strong>s Katholizismus im Westen dauerhaft dadurch gestärkt, dass es die bayerischen Wittelsbacher seit <strong>de</strong>m späten 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt verstan<strong>de</strong>n, sich eine<br />
Art Daueranwartschaft auf die Fürstbistümer <strong>de</strong>s west<strong>de</strong>utschen Raums – und damit auch Kölns – <strong>zu</strong> sichern. Konkret heißt das, dass die Wittelsbacher Herzöge bzw. (ab 1623/1648)<br />
Kurfürsten Einfluss auf die 24 wahlberechtigten Domkapitulare ausübten – o<strong>de</strong>r missliebige (protestantische) Domkapitulare kurzerhand aus <strong>de</strong>m Amt entfernten („entsetzten“). Sie<br />
sicherten sich damit Wahlergebnisse in ihrem kirchenpolitischen Sinne. Nicht übersehen darf man dabei die enorme Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Bischofsamts für die stan<strong>de</strong>sgemäße Versorgung <strong>de</strong>r<br />
jüngeren, für <strong>de</strong>n geistlichen Stand vorgesehenen Söhne: Für das seit <strong>de</strong>m späteren 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt kin<strong>de</strong>rreiche Haus Bayern-München galt dies um so mehr, als die dynastischen
Hausgesetze seit 1505 im Sinne <strong>de</strong>s Primogeniturprinzips eine Teilung <strong>de</strong>r eigenen Lan<strong>de</strong> unter <strong>de</strong>n nachgeborenen Söhne unterban<strong>de</strong>n.<br />
Hier im Rheinland wie an<strong>de</strong>rswo auch wur<strong>de</strong>n die religiösen Verhältnisse also unter <strong>de</strong>m Strich nicht durch die freie Entscheidung <strong>de</strong>r Untertanen, son<strong>de</strong>rn durch die teils politisch, teils<br />
konfessionell motivierten Weichenstellungen <strong>de</strong>r jeweiligen Territorialherren vorgegeben.<br />
Die Bistumsreform 1559<br />
Die kölnische Kirchenorganisation in <strong>de</strong>r Frühen Neuzeit wur<strong>de</strong> in erster Linie durch administrative Einschnitte verän<strong>de</strong>rt. Einen ersten zog die Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng zwischen Spanien<br />
und seinen nie<strong>de</strong>rländischen Provinzen in <strong>de</strong>r unmittelbaren Nachbarschaft <strong>de</strong>s Erzbistums mit sich. Der in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n regieren<strong>de</strong> König Philipp II. nämlich setzte 1559 bei Papst<br />
Paul IV. eine grundstürzen<strong>de</strong> Neugestaltung <strong>de</strong>r Bistumsstruktur in <strong>de</strong>r Region durch. Vorgeblich ging es Philipp darum, <strong>de</strong>n um sich greifen<strong>de</strong>n Protestantismus mit geeigneten<br />
kirchenpolitischen Mitteln <strong>zu</strong> bekämpfen. Allerdings hatten die Habsburger unverkennbar starke hauspolitische Interessen im Nordwesten <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reichs <strong>de</strong>utscher<br />
Nation, die sie mit einer verstärkten Kontrolle auch <strong>de</strong>s kirchlichen Apparats <strong>zu</strong> befestigen hofften. In <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n hatten bis dahin nur sechs, relativ große Bistümer existiert, <strong>de</strong>ren<br />
Zahl auf Veranlassung Philipps nun durch Teilungen und Neugründungen auf 19 erhöht wur<strong>de</strong>. Dabei wur<strong>de</strong> ein bis 1801 fortleben<strong>de</strong>s Bistum Roermond gegrün<strong>de</strong>t, in das Pfarreien <strong>de</strong>s<br />
Erzbistums Köln im Bereich von Nijmegen und <strong>de</strong>r Flüsse Maas und Niers im sog. Oberquartier Gel<strong>de</strong>rn abgezweigt wur<strong>de</strong>n. Das Kölner Suffraganbistum Utrecht wur<strong>de</strong><br />
verhältnismäßig noch stärker verkleinert und aus <strong>de</strong>r Kölner Kirchenprovinz ganz herausgelöst, immerhin aber (wie Mechelen und Cambrai) <strong>zu</strong>m Erzbistum erhöht. Auch an<strong>de</strong>re Kölner<br />
Suffragane wie Münster erlitten 1559 Einbußen, die sich aus <strong>de</strong>r Sicht <strong>de</strong>r regieren<strong>de</strong>n Fürstbischöfe in erster Linie durch <strong>de</strong>n Ausfall von Gebühren wie z. B. bei Pfarrerbestallungen<br />
(Einset<strong>zu</strong>ngen) bemerkbar machten.<br />
Die Revolutionszeit (1794–1813)<br />
Durch die Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s gesamten linksrheinischen Raums durch französische Truppen bis <strong>zu</strong>m Oktober 1794 und ihr weiteres Ausgreifen auf <strong>de</strong>n rechtsrheinischen Raum erlebte das<br />
Erzbistum Köln innerlich wie äußerlich einen Nie<strong>de</strong>rgang: Nicht nur in <strong>de</strong>r radikalen jakobinischen Phase <strong>de</strong>r Französischen Revolution, son<strong>de</strong>rn auch <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Direktoriums von<br />
1795 bis 1799 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r katholische Kultus in <strong>de</strong>n besetzten Gebieten wie in Frankreich selbst massiv unterdrückt. Erst Napoléon Bonaparte setzte <strong>de</strong>r Bekämpfung <strong>de</strong>s Christentums<br />
ein En<strong>de</strong>, wobei ihn nicht Toleranz, geschweige <strong>de</strong>nn religiöse Überzeugung leitete, son<strong>de</strong>rn das Kalkül, sich als Wie<strong>de</strong>rhersteller eingewurzelter Traditionen profilieren <strong>zu</strong> können.<br />
Wichtig in diesem Zusammenhang ist u. a. die Rückkehr <strong>zu</strong>m Gregorianischen Kalen<strong>de</strong>r und die Veröffentlichung eines sog. Reichskatechismus 1806.<br />
Politische Konzessionen gedachte Napoleon gegenüber <strong>de</strong>r im Untergang befindlichen Reichskirche aber nicht <strong>zu</strong> machen: Nach<strong>de</strong>m durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Lunéville am 9. März 1801<br />
<strong>de</strong>r gesamte linksrheinische Raum staatsrechtlich an Frankreich gefallen war, löste Napoleon das Erzbistum Köln für seine linksrheinisch-französischen Teile im Zuge einer Neuordnung<br />
<strong>de</strong>r Bistumsstruktur umstandslos auf, womit er einer über tausendjährigen kirchengeschichtlichen Tradition im Rheinland ein En<strong>de</strong> setzte. Als Ersatz für Köln kreierte er ein Bistum<br />
Aachen unter <strong>de</strong>r bischöflichen Leitung seines Gefolgsmanns Marc-Antoine Berdolet, das <strong>de</strong>m Erzbistum Mechelen als Suffragan unterstellt war. Dass <strong>de</strong>rlei Maßnahmen von<br />
herrschaftspolitischen Motiven getragen waren, schließt allerdings nicht aus, dass Napoleon wie im weltlichen so auch im kirchlichen Bereich anerkennenswerte Reformen (etwa im<br />
Bereich <strong>de</strong>r Pfarrfinanzierung) in die Tat umsetzte.<br />
Preußische Zeit (ab 1815)<br />
Mit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r napoleonischen Herrschaft über <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Westen 1814/1815 kam es <strong>zu</strong> einem abermaligen Umbau <strong>de</strong>r kirchlichen Verhältnisse: Mit <strong>de</strong>m 1821 geschlossenen<br />
Staatskirchenvertrag zwischen <strong>de</strong>r Kurie und Preußen, das auf <strong>de</strong>m Wiener Kongress 1815 die Herrschaft im beinahe gesamten Rheinland angetreten hatte, und <strong>de</strong>r<br />
Zirkumskriptionsbulle De salute animarum (16. Juli 1821) wur<strong>de</strong> das Bistum Aachen wie<strong>de</strong>r aufgelöst, Köln dagegen wie<strong>de</strong>r belebt. Die vormals Aachener kirchlichen Gebiete wur<strong>de</strong>n<br />
nun zwischen Köln und Münster auf eine Art und Weise verteilt, die mehr Preußens administrativen Bedürfnissen als <strong>de</strong>n kirchengeschichtlichen Traditionen entsprach: Der Kölner<br />
Sprengel umfasste die Regierungsbezirke Köln, Aachen und Düsseldorf, wur<strong>de</strong> also staatlichen Distrikten angeglichen. Am nördlichen Nie<strong>de</strong>rrhein, in <strong>de</strong>m sich uralte kölnische<br />
Traditionsorte wie beispielsweise Xanten o<strong>de</strong>r Kempen befan<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r allerdings kurzlebige preußische Regierungsbezirk Kleve mit <strong>de</strong>n dort versammelten Pfarreien <strong>de</strong>m Bistum<br />
Münster einverleibt. Dessen Dekanate Kleve, Wesel, Recklinghausen und Warendorf bil<strong>de</strong>n noch heute die Grenze <strong>zu</strong>m Erzbistum Köln, <strong>de</strong>m 1957 errichteten Bistum Essen und <strong>de</strong>m<br />
später <strong>zu</strong>m Erzbistum erhobenen Pa<strong>de</strong>rborn im Osten.
Das große Entgegenkommen Preußens gegenüber <strong>de</strong>r Kurie bei <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>reinrichtung <strong>de</strong>s Kölner Erzbistums, wird als Ursache <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahrzehnten aufgetretenen<br />
Konflikte zwischen Staat und Kirche am Rhein gesehen.<br />
Deren zentrales Ereignis waren die Kölner Wirren. Als <strong>de</strong>ren Höhepunkt gilt die 1837 durch <strong>de</strong>n Preußischen Staat erfolgte Verhaftung <strong>de</strong>s ultramontan gesinnten Kölner Erzbischof<br />
Clemens August Droste <strong>zu</strong> Vischering. Es ging um <strong>de</strong>n rechtlichen Status interkonfessioneller Ehen, <strong>de</strong>n Droste <strong>zu</strong> Vischering nicht akzeptierte. Die anschließen<strong>de</strong> zweijährige<br />
Festungshaft <strong>de</strong>s Bischofs sorgte dann für eine grundlegen<strong>de</strong> Verhältnisbestimmung zwischen Preußischem Staat und Katholischer Kirche. Viele Historiker sehen in diesem Ereignis<br />
bereits <strong>de</strong>n Beginn <strong>de</strong>s Kulturkampfs im späteren Deutschen Kaiserreich. In <strong>de</strong>n sog. „res mixtae“, <strong>de</strong>njenigen Bereichen, <strong>de</strong>ren Regelung von bei<strong>de</strong>n Seiten beansprucht wur<strong>de</strong><br />
(Schulwesen, Eheschließung und -gerichtsbarkeit u. a.m.), setzte Preußen damit die Trennung zwischen Staat und Kirche durch.<br />
20. und 21. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt erfuhr das Erzbistum Köln durch die Abtrennung <strong>de</strong>s 1930 wie<strong>de</strong>r gegrün<strong>de</strong>ten Bistums Aachen im Westen und die Einrichtung <strong>de</strong>s flächenmäßig kleinen, aber an<br />
Einwohnern zahlreichen „Ruhrbistums“ Essen 1956 abermals Verän<strong>de</strong>rungen. Im Zuge <strong>de</strong>r Eingemeindung <strong>de</strong>r damaligen Stadt Kettwig nach Essen bzw. Mülheim im Jahre 1975<br />
weigerte sich <strong>de</strong>r Kölner Erzbischof Joseph Kardinal Frings die Stadt mit ihren hohen Kirchensteuereinnahmen an das Ruhrbistum ab<strong>zu</strong>geben. Kardinal Meisner stattete daher <strong>zu</strong> Beginn<br />
seiner Amtszeit sowohl <strong>de</strong>r damaligen Essener als auch <strong>de</strong>r damaligen Mülheimer Oberbürgermeisterin einen Antrittsbesuch ab.<br />
2005 war das Erzbistum Köln Ausrichter <strong>de</strong>s 20. Weltjugendtags.<br />
Seit 1954 unterhält das Erzbistum Köln auf Initiative <strong>de</strong>s damaligen Erzbischofs Joseph Kardinal Frings eine Bistumspatenschaft mit <strong>de</strong>m Erzbistum Tokio. Eine zweite<br />
Bistumspartnerschaft wur<strong>de</strong> unter Erzbischof Joachim Kardinal Meisner mit <strong>de</strong>m Bistum Dres<strong>de</strong>n-Meißen begrün<strong>de</strong>t.<br />
Die ökonomische Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Erzbistums betreffend, bezeichnete sich Köln in seiner Selbstdarstellung als „an <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>r Diözesen in Deutschland“ stehend und „weltweit <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n<br />
Bistümern mit <strong>de</strong>m größten Haushaltsvolumen“ (680 Millionen Euro 2004) gehörend. Gleichwohl übersteigen die Ausgaben die Einnahmen bei weitem. Die Situation in Köln erscheint<br />
zwar nicht so prekär wie an<strong>de</strong>rswo; beträchtliche Ausgabenkür<strong>zu</strong>ngen gelten aber als unumgänglich. Für 2010 wird ein Defizit von 45,6 Millionen erwartet. Dennoch will das Erzbistum<br />
stark investieren, vor allem in Kin<strong>de</strong>rtagesstätten ("Kitas") und die Sanierung von Schulgebäu<strong>de</strong>n.[1]<br />
Das Erzbistum Köln unterhält ein sog. "Stiftungszentrum". Es kümmert sich u.a. um Zuwendungen von Leben<strong>de</strong>n (Schenkung o<strong>de</strong>r Verstorbenen (Nachlass) an das Erzbistum o<strong>de</strong>r an<br />
Institutionen, die <strong>zu</strong>m Erzbistum gehören.[2]<br />
Bistumsgeographie<br />
Bistumsumfang<br />
Das Erzbistum umfasst in Nordrhein-Westfalen die kreisfreien Städte Köln, Bonn, Düsseldorf, Leverkusen, Remscheid, Solingen und Wuppertal, <strong>de</strong>n östlichen Teil <strong>de</strong>s Kreises<br />
Euskirchen (Städte Bad Münstereifel [einschließlich <strong>de</strong>r Ortschaften Embken, Mul<strong>de</strong>nau und Wollersheim <strong>de</strong>r Stadt Ni<strong>de</strong>ggen], Euskirchen, Zülpich, die Gemein<strong>de</strong> Weilerswist und die<br />
östlichen Ortschaften <strong>de</strong>r Stadt Mechernich), <strong>de</strong>n Kreis Mettmann einschließlich <strong>de</strong>r ehemaligen Stadt Kettwig (Essen) sowie <strong>de</strong>r Stadtteil Mülheim-Mintard, <strong>de</strong>n Oberbergischen Kreis,<br />
<strong>de</strong>n größten Teil <strong>de</strong>s Rhein-Kreises Neuss (Städte Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Neuss, die Gemein<strong>de</strong> Rommerskirchen sowie <strong>de</strong>n Ortsteil Bü<strong>de</strong>rich <strong>de</strong>r Stadt Meerbusch und die<br />
Ortsteile Glehn und Steinforth-Rubbelrath <strong>de</strong>r Stadt Korschenbroich), <strong>de</strong>n Rhein-Erft-Kreis, <strong>de</strong>n Rhein-Sieg-Kreis und <strong>de</strong>n Rheinisch-Bergischen Kreis.<br />
Zu<strong>de</strong>m gehören ihm in Rheinland-Pfalz Teile <strong>de</strong>s Landkreises Altenkirchen (Verbandsgemein<strong>de</strong>n Altenkirchen [ohne die Ortsgemein<strong>de</strong> Berod bei Hachenburg], Hamm (Sieg), Wissen<br />
und Flammersfeld [nördlich <strong>de</strong>r Wied] und die Ortsgemein<strong>de</strong> Friesenhagen) sowie <strong>de</strong>r Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Landkreises Neuwied (Verbandsgemein<strong>de</strong> Unkel und die Ortsgemein<strong>de</strong>n Asbach,<br />
Buchholz (Westerwald) sowie Windhagen) an.<br />
Bistumsglie<strong>de</strong>rung<br />
Das Erzbistum Köln glie<strong>de</strong>rt sich in acht Kreis- und acht Stadt<strong>de</strong>kanate. Der Rhein-Sieg-Kreis ist in ein rechts- und ein linksrheinisches Kreis<strong>de</strong>kanat, <strong>de</strong>r Rhein-Kreis Neuss in ein
Kreis- und ein Stadt<strong>de</strong>kanat Neuss geglie<strong>de</strong>rt.<br />
• Stadt<strong>de</strong>kanate Dekanate<br />
• Bonn Bonn-Mitte/Süd, Bonn-Nord, Bonn-Bad Go<strong>de</strong>sberg, Bonn-Beuel<br />
• Düsseldorf D-Mitte/Heerdt, D-Nord, D-Süd, D-Ost, D-Benrath<br />
• Köln Deutz, Dünnwald, Ehrenfeld, Lin<strong>de</strong>nthal, Mitte, Mülheim, Nippes, Porz, Ro<strong>de</strong>nkirchen, Worringen<br />
• Leverkusen ---<br />
• Remscheid ---<br />
• Solingen ---<br />
• Wuppertal<br />
• Kreis<strong>de</strong>kanate Dekanate<br />
• Altenkirchen ---<br />
• Euskirchen Euskirchen<br />
• Mettmann Hil<strong>de</strong>n, Langenfeld/Monheim, Mettmann, Ratingen,<br />
• Oberbergischer Kreis Gummersbach/Waldbröl, Wipperfürth<br />
• Rhein-Erft-Kreis Bedburg, Bergheim, Brühl, Erftstadt, Frechen, Hürth, Kerpen, Pulheim, Wesseling<br />
• Rhein-Kreis Neuss Grevenbroich/Dormagen, Neuss/Kaarst<br />
• Rheinisch-Bergischer Kreis Altenberg, Bergisch Gladbach, Overath<br />
• Rhein-Sieg-Kreis Bornheim, Eitorf/Hennef, Königswinter, Lohmar, Neunkirchen, Meckenheim/Rheinbach, Siegburg/Sankt Augustin, Troisdorf<br />
Mehrere Pfarrgemein<strong>de</strong>n sind jeweils <strong>zu</strong> einem Seelsorgebereich mit gemeinsamem Pfarrer und gemeinsamem Seelsorgeteam <strong>zu</strong>sammengeschlossen .<br />
Erzbischof<br />
Der Erzbischof von Köln war im Spätmittelalter und in <strong>de</strong>r Frühen Neuzeit von Amts wegen Kurfürst und Erzkanzler per Italiam <strong>de</strong>s Reiches sowie (seit 1180) Herzog von Westfalen.<br />
Die weltlichen Herrschaftsgebiete <strong>de</strong>s Kurerzbischofs waren als Kurköln bis 1803 Bestandteil <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation.<br />
In seiner kirchlichen Funktion ist <strong>de</strong>r Erzbischof von Köln noch heute Metropolit <strong>de</strong>r Rheinischen Kirchenprovinz. Seit <strong>de</strong>m 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt trägt er <strong>de</strong>n Titel eines geborenen<br />
apostolischen Legaten. Stets <strong>de</strong>m Kardinalskollegium angehörend, ist er <strong>de</strong>r erste <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bischöfe, wenngleich <strong>de</strong>r Erzbischof von Salzburg (Österreich) Primas Germaniae ist.<br />
Zu <strong>de</strong>n Erzbischöfen von Köln zählte eine Reihe intellektuell wie kirchenpolitisch herausragen<strong>de</strong>r Gestalten. So war <strong>de</strong>r Kölner Kardinal-Erzbischof Johannes von Geissel <strong>de</strong>r „Erfin<strong>de</strong>r“<br />
<strong>de</strong>r Bischofskonferenz und <strong>de</strong>r Kardinal-Erzbischof Joseph Höffner <strong>de</strong>r „Begrün<strong>de</strong>r“ <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnen Finanzverwaltung <strong>de</strong>s Apostolischen Stuhles und <strong>de</strong>s Vatikanstaates. Im 16.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt war die konfessionelle Haltung <strong>de</strong>r Kölner Erzbischöfe teils zwiespältig. Vom 17. bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts dominierte auf <strong>de</strong>m Kölner Erzstuhl <strong>de</strong>r Typus <strong>de</strong>s<br />
Simonisten, d. h. <strong>de</strong>s auf die Sammlung möglichst zahlreicher lukrativer und stan<strong>de</strong>sadäquater kirchlicher Pfrün<strong>de</strong>n erpichten Hocha<strong>de</strong>ligen. Der pastorale Aspekt trat mitunter <strong>de</strong>utlich<br />
<strong>zu</strong>rück, was schon daran erkennbar ist, dass mancher Bischof nicht sämtliche o<strong>de</strong>r auch nur die niedrigsten Weihen einholte, um sich <strong>de</strong>n Rück<strong>zu</strong>g in <strong>de</strong>n weltlichen Stand offen <strong>zu</strong><br />
halten.<br />
Erst gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts tat sich mit Maximilian Franz von Österreich eine im Reformdiskurs <strong>de</strong>s Aufgeklärten Absolutismus herausragen<strong>de</strong> Persönlichkeit hervor, <strong>de</strong>ren<br />
Wirken aber durch innere Hemmnisse im Kurstaat und natürlich durch die Rheinlandbesat<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r französischen Revolutionstruppen blockiert wur<strong>de</strong>. Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts exponierten<br />
sich die Kölner Erzbischöfe in <strong>de</strong>n Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit <strong>de</strong>m preußischen Staat (s.o.). Seit <strong>de</strong>m frühen 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt taten sie sich vor allem auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Weltkirche<br />
hervor. Joseph Kardinal Frings durchbrach die kuriale Vormundschaft und verschaffte damit <strong>de</strong>m Zweiten Vatikanischen Konzil eine starke Wirkmöglichkeit. Joseph Höffner war ein<br />
enger Berater Papst Paul VI. und Papst Johannes Paul II.. Auch Kardinal Joachim Meisner war ein enger Freund Papst Johannes Paul II. und fungierte als sein persönlicher Ratgeber.
Doch erkennt man die weltkirchliche Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Kölner Erzbischöfe an ihrer Haltung <strong>zu</strong> sozialen Fragen. So vermochten sie eine konfessionsübergreifen<strong>de</strong> Haltung in<br />
Gewerkschaftsfragen durch<strong>zu</strong>setzen, wie auch nationale und internationale Hilfswerke <strong>zu</strong> begrün<strong>de</strong>n, welche die Grundlage heutiger päpstlicher Hilfswerke bil<strong>de</strong>n.<br />
Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Erzbischofs von Köln spiegelt sich in <strong>de</strong>r Mühsamkeit bei <strong>de</strong>r Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Kölner Erzstuhles wi<strong>de</strong>r. Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt hatten (preußischer) Staat und Kirche ein<br />
meist konkurrieren<strong>de</strong>s Interesse daran, ihren Kandidaten durch<strong>zu</strong>setzen, da diesem in nationalen Kirchenfragen eine herausragen<strong>de</strong> Stellung <strong>zu</strong>kam. Dies war in <strong>de</strong>r Geschichte oftmals<br />
ein Tauziehen, bei <strong>de</strong>m die die Belange <strong>de</strong>r Erzdiözese selbst in <strong>de</strong>n Hintergrund gerückt wur<strong>de</strong>n. Domkapitular Trippen beschreibt dies in seinem Buch über die Kölner<br />
Erzbischofswahlen sehr beeindruckend. Und auch heute ist es noch so, dass die Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Kölner Erzstuhls stets ein Politikum ist.<br />
Der Erzbischof von Köln ist nicht nur <strong>de</strong>r Bischof einer <strong>de</strong>r ältesten Diözesen Deutschlands, son<strong>de</strong>rn auch Apostolischer Legat. Selbst wenn <strong>de</strong>r Kölner Erzbischof kein Kardinal ist, so<br />
trägt er Purpur, dann allerdings das Purpur <strong>de</strong>r Legaten. Als "Legatus natus" steht er im Rang eines Nuntius.<br />
Frühere Bischöfe<br />
• Karl Joseph Kardinal Schulte (1920–1942)<br />
• Joseph Kardinal Frings (1942–1969)<br />
• Joseph Kardinal Höffner (1969–1987)<br />
Das Erzbistum Köln hatte neben <strong>de</strong>m Erzbischof vier Weihbischöfe, seit 2004 noch drei. Durch <strong>de</strong>n Bevölkerungsrückgang und das Ansteigen <strong>de</strong>s Durchschnittsalters <strong>de</strong>r Bevölkerung<br />
ging auch die Zahl <strong>de</strong>r bischöflichen Amtshandlungen <strong>zu</strong>rück. So ist z. B. seit <strong>de</strong>n 1980er Jahren die Anzahl <strong>de</strong>r Firmungen von über 20.000 im Jahr auf unter 10.000 gefallen.<br />
Kirchliches Leben<br />
Das kirchliche Leben <strong>de</strong>s Erzbistums Köln ist städtisch geprägt, da auch die ländlichen Gebiete auf die Großstädte <strong>de</strong>r Rheinschiene und <strong>de</strong>s Wuppertales hin ausgerichtet sind. Es gibt<br />
im Erzbistum ein lebendiges Wallfahrtswesen und ein reges Vereinsleben. Fast in je<strong>de</strong>r Pfarrgemein<strong>de</strong> existieren Jugendgruppen, die Katholischen Frauengemeinschaft (kfd), eine<br />
Schützenbru<strong>de</strong>rschaft o<strong>de</strong>r eine Kolpingsfamilie. Die Zahl <strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>r von Kirchenchören und Messdienern wird für 2004 mit jeweils über 30.000 angegeben. Der sonntägliche<br />
Messbesuch liegt bei 12,0 % <strong>de</strong>r Kirchenmitglie<strong>de</strong>r.<br />
Die Mitverantwortung <strong>de</strong>r Christen erfolgt durchgängig durch flächen<strong>de</strong>ckend gewählte Pfarrgemein<strong>de</strong>räte auf <strong>de</strong>r Ebene <strong>de</strong>r einzelnen Seelsorgebereiche und Dekanate bis <strong>zu</strong>m<br />
Diözesanrat <strong>de</strong>r Katholiken im Erzbistum Kön.<br />
Selbstverständnis<br />
Zentrales I<strong>de</strong>ntifikationsmerkmal <strong>de</strong>r Katholiken im Erzbistum Köln ist <strong>de</strong>r 1880 fertig gestellte Kölner Dom. Der Kölner Dompropst Dr. Norbert Feldhoff sagte <strong>zu</strong>m Besuch von Papst<br />
Benedikt XVI. <strong>de</strong>s Kölner Domes: „Wir danken Ihnen für diesen Besuch und es erfüllt uns mit Stolz, dass <strong>de</strong>r Kölner Dom die erste Kathedrale außerhalb <strong>de</strong>s Bistums Rom ist, die Sie<br />
als Papst besuchen. In Kölner ‚Beschei<strong>de</strong>nheit‘ halten wir dies für angemessen, weil <strong>de</strong>r Dom <strong>de</strong>s heiligen Petrus in Köln die Bischofskirche <strong>de</strong>r ‚Ecclesia Coloniensis semper sedis<br />
Apostolicae fi<strong>de</strong>lis filia‘ ist.“<br />
Die Ecclesia Coloniensis fin<strong>de</strong>t ihre sinnfällige Einheit im Kölner Dom und einer Geschichte, die nach außen hin von Traditionalität und Glaubenseinheit zeugt. Die Aufnahme<br />
reformatorischen Gedankenguts im 16. o<strong>de</strong>r etwa <strong>de</strong>s romkritischen Febronianismus im späteren 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt zeigt allerdings, dass auch die Kölner Kirche schon in <strong>de</strong>r vormo<strong>de</strong>rnen<br />
Zeit durchaus nicht immer unverbrüchlich an <strong>de</strong>r Seite <strong>de</strong>r Kurie stand.<br />
Patrone<br />
• Heilige Drei Könige<br />
• Gereon von Köln (2. Patron von Köln)
• Pantaleon<br />
• Severin von Köln<br />
• Ursula von Köln (1. Patronin von Köln)<br />
• Quirinus von Neuss (Mitpatron <strong>de</strong>s Erzbistums)<br />
Wallfahrtsstätten<br />
• Hl. Drei Könige in <strong>de</strong>r Hohen Domkirche in Köln<br />
• Schwarze Mutter Gottes von Köln in St. Maria in <strong>de</strong>r Kupfergasse<br />
• Gräber <strong>de</strong>r Seligen Adolph Kolping und Johannes Duns Scotus, Minoritenkirche in Köln<br />
• Gna<strong>de</strong>nbild <strong>de</strong>r Mutter Gottes in St. Mariä Geburt, Grevenbroich<br />
• Maria, Königin <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns in Velbert-Neviges<br />
• Rosa Mystica in Swisttal-Buschhoven<br />
• St. Johann Baptist mit Wallfahrt <strong>zu</strong> Maria, Zuflucht <strong>de</strong>r Sün<strong>de</strong>r in Bruchhausen<br />
• Zur Schmerzhaften Mutter in Hennef-Bödingen<br />
• Zur Schmerzhaften Mutter in Marienthal (Westerwald)<br />
• St. Mariä Heimsuchung in Marienhei<strong>de</strong><br />
• Apostel Judas Thaddäus in Königswinter-Heisterbacherrott<br />
• Michaelskapelle auf <strong>de</strong>m Michelsberg bei Bad Münstereifel<br />
• Gezelinkapelle (Leverkusen-Alkenrath)<br />
• Zum Hl.Quirinus von Rom im Quirinusmünster in Neuss<br />
• Die freu<strong>de</strong>nreiche Mutter Gottes in Köln-Stammheim<br />
Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
• Altenberger Dom in O<strong>de</strong>nthal-Altenberg<br />
• Bonner Münster<br />
• Kölner Dom<br />
• Quirinusmünster Neuss<br />
• Nevigeser Wallfahrtsdom von Gottfried Böhm in Velbert-Neviges<br />
Persönlichkeiten<br />
• Albertus Magnus, Dominikaner (* um 1200 in Lauingen; † 15. November 1280 in Köln), Kirchenlehrer, 1931 heilig gesprochen<br />
• Johannes Duns Scotus, Franziskaner (* um 1266 in Duns, Schottland; † 8. November 1308 in Köln), 1993 selig gesprochen<br />
• Adolph Kolping (* 8. Dezember 1813 in Kerpen; † 4. Dezember 1865 in Köln), 1991 selig gesprochen<br />
• Edith Stein (* 12. Oktober 1891 in Breslau; † 9. August 1942 in Auschwitz), 1933 als Schwester Benedicta a Cruce in Köln in <strong>de</strong>n Karmeliteror<strong>de</strong>n eingetreten, 1998 heilig<br />
gesprochen<br />
• Joseph Kardinal Frings (* 6. Februar 1887 in Neuss; † 17. Dezember 1978 in Köln), Erzbischof 1942–1969<br />
• Liste <strong>de</strong>r Kölner Erzbischöfe und Bischöfe
• Liste <strong>de</strong>r Kölner Weihbischöfe<br />
• Liste <strong>de</strong>r Kölner Generalvikare<br />
• Liste <strong>de</strong>r Kölner Offiziale<br />
Domkapitel<br />
Das Kölner Domkapitel, Hohes Metropolitan-, Kathedral- und Domkapitel <strong>zu</strong> Köln, zählt 16 Mitglie<strong>de</strong>r, wovon vier nicht am Dom leben und als „Nichtresidieren<strong>de</strong> Domkapitulare“<br />
bezeichnet wer<strong>de</strong>n. An <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>s Kapitels stehen ein Dompropst, <strong>de</strong>n das Domkapitel wählt, und ein Dom<strong>de</strong>chant, <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Erzbischof ernennt. Die Domkapitulare wer<strong>de</strong>n durch <strong>de</strong>n<br />
Erzbischof von Köln ernannt, wobei er im Wechsel einmal auf Vorschlag <strong>de</strong>s Kapitels ernennt und dann wie<strong>de</strong>r nach Anhörung <strong>de</strong>sselben. Hausherr <strong>de</strong>r Kathedrale ist in Köln das<br />
Domkapitel und nicht <strong>de</strong>r Erzbischof. Es wählt nach <strong>de</strong>m Tod o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Rücktritt einen neuen Erzbischof und unterstützt <strong>de</strong>n Erzbischof bei <strong>de</strong>r Verwaltung <strong>de</strong>s Bistums. Die Kleidung<br />
<strong>de</strong>r Domkapitulare besteht aus einer violetten Soutane, und einer violetten Mozetta. Darauf tragen sie einen Stern (Domkapitularsstern) an einer gol<strong>de</strong>nen Kette. Residieren<strong>de</strong><br />
Domkapitulare sind <strong>de</strong>rzeit: Dompropst Dr. jur. utr. Norbert Feldhoff (1975/2004), Dom<strong>de</strong>chant Johannes Bastgen (2003), Dr. jur. can. Günter Assenmacher (2004), Weihbischof Dr.<br />
theol. Heiner Koch (1998), Weihbischof Manfred Melzer (1998), Weihbischof Dr. theol. Rainer Woelki (2003), Prof. Dr. theol. Norbert Trippen (1986), Dr. theol. Robert Kümpel (1987),<br />
Dr. theol. Dominik Schwa<strong>de</strong>rlapp (2004), Josef Sauerborn (2004), Gerd Bachner (2005), Hans-Josef Ra<strong>de</strong>rmacher (2006)<br />
Nichtresidieren<strong>de</strong> Domkapitulare: Dr. theol. Johannes Westhoff, Winfried Auel (2004), Rolf Steinhäuser (2005), Anno Burghof (2008)<br />
Emeritierte Domkapitulare: Weihbischof Dr. theol. Klaus Dick (Dom<strong>de</strong>chant em. 2003), Ludwig Schöller (em. 2004), Heinrich Barlage (em. 2005), Gottfried Weber (em. 2005)<br />
Literatur<br />
• Wilhelm Neuss, Friedrich Wilhelm Oediger: Das Bistum Köln von <strong>de</strong>n Anfängen bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Köln 1964 (31991) (Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln 1).<br />
• Wilhelm Janssen: Das Erzbistum Köln im späten Mittelalter. 1191–1515. 2 Halbbän<strong>de</strong>, Köln 1995/2003 (Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln 2).<br />
• Hansgeorg Molitor: Das Erzbistum Köln im Zeitalter <strong>de</strong>r Glaubenskämpfe. 1515–1688. Köln 2008 (Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln 3). ISBN 3-7616-1346-6.<br />
• Eduard Hegel: Das Erzbistum Köln zwischen Barock und Aufklärung. Vom Pfälzischen Krieg bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r französischen Zeit 1688–1814. Köln 1979 (Geschichte <strong>de</strong>s<br />
Erzbistums Köln 4). ISBN 3-7616-0389-4.<br />
• Eduard Hegel: Das Erzbistum Köln. Zwischen <strong>de</strong>r Restauration <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts und <strong>de</strong>r Restauration <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts. 1815–1962. Köln 1987 (Geschichte <strong>de</strong>s<br />
Erzbistums Köln 5). ISBN 3-7616-0873-X.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Kölner Stadtanzeiger.<strong>de</strong>: Einnahmen<strong>de</strong>fizit - Krise macht vor Klerus nicht halt. 22. Januar 2010.<br />
2. ↑ ERZBISTUM KÖLN: Stiftungszentrum.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Universität <strong>zu</strong> Köln<br />
Die Universität <strong>zu</strong> Köln (kurz: Uni Köln) ist eine in Forschung und Lehre international anerkannte Hochschule in Köln mit <strong>de</strong>m klassischem Fächerspektrum einer Volluniversität.<br />
Die 1388 gegrün<strong>de</strong>te Alte Universität zählte <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n ältesten Universitäten in Europa. Sie wur<strong>de</strong> 1798 von <strong>de</strong>n französischen Machthabern (Napoleon) geschlossen. Die neue Universität<br />
<strong>zu</strong> Köln wur<strong>de</strong> 1919 wie<strong>de</strong>rgegrün<strong>de</strong>t. Wie die Universität Hamburg und die (1914 gegrün<strong>de</strong>te) Universität Frankfurt am Main sollte sie die nach <strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg verlorene Kaiser-<br />
Wilhelms-Universität <strong>zu</strong> Straßburg ersetzen. Mit über 44.000 Studieren<strong>de</strong>n[1] im Wintersemester 2009/10 ist sie die drittgrößte Universität in Deutschland.<br />
Geschichte und Entwicklung<br />
Die Alte Universität<br />
Die Universität <strong>zu</strong> Köln wur<strong>de</strong> am 21. Mai 1388 als vierte Universität im Heiligen Römischen Reich nach <strong>de</strong>r Karls-Universität Prag (1348), <strong>de</strong>r Universität Wien (1365) und <strong>de</strong>r<br />
Ruprecht-Karls-Universität in Hei<strong>de</strong>lberg (1386) gegrün<strong>de</strong>t. Die Initiative da<strong>zu</strong> ging nicht wie sonst üblich vom Kaiser o<strong>de</strong>r einem Fürsten aus, son<strong>de</strong>rn vom Rat <strong>de</strong>r Freien Reichsstadt<br />
Köln, die auch die Kosten für <strong>de</strong>n Lehrbetrieb übernahm und sich umfangreiche Vorteile für die Belebung <strong>de</strong>r Stadt erhoffte.[3] Die Gründungsurkun<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> von Papst Urban VI. in<br />
Perugia unterzeichnet. Am 6. Januar 1389 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Vorlesungsbetrieb aufgenommen. Gründungsrektor war Hartlevus <strong>de</strong> Marca, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Lehrbetrieb mit einer Disputation mit <strong>de</strong>m<br />
Theologieprofessor Gerhard Kikpot von Kalkar über Jesaja 60,1 („die Herrlichkeit <strong>de</strong>s Herrn ging strahlend auf über dir“) eröffnete. Die genutzten Gebäu<strong>de</strong> waren anfangs über die Stadt<br />
verteilt.<br />
Die Universität richtete sich am angesehensten Vorbild, <strong>de</strong>r Universität von Paris, aus.[4] Sie unterschied sich von Paris insofern, als sie von Beginn an Kaiserrecht (römisches Recht)<br />
lehrte und unter römischer Observianz stand. Sie gehörte von Anfang an mit 700 Immatrikulierten (später ca. 1000) <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n größten Universitäten Europas. Sie ging hervor aus <strong>de</strong>n<br />
„Generalstudien“ <strong>de</strong>s Dominikaner-Or<strong>de</strong>ns, die 1248 von Albertus Magnus eingerichtet wor<strong>de</strong>n waren. Auch das Pfrün<strong>de</strong>nwesen kennzeichnet <strong>de</strong>n geistlichen Charakter <strong>de</strong>r Universität.<br />
An je<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r 11 großen Kölner Stiftskirchen war für die Universität ein Kanonikat vorbehalten.[5] Die Hochschule besaß alle vier damals üblichen Fakultäten: „Artes“, Theologie und<br />
Medizin; in <strong>de</strong>r Jurispru<strong>de</strong>nz bot sie außer <strong>de</strong>m Kirchenrecht auch noch das „Römische Recht“ an. Die Hochschule hatte ihre Lehrgebäu<strong>de</strong> und Bursen in einem Areal <strong>de</strong>r Stadt um <strong>de</strong>n<br />
Dom und um die Straße An <strong>de</strong>r Rechtschule (siehe dort). Die Hochschule hatte eine Reihe berühmter Professoren und Absolventen, vor allem war sie eine treue Dienerin <strong>de</strong>r Kirche. In<br />
<strong>de</strong>r frühen Neuzeit stand die Universität unter starkem Einfluss <strong>de</strong>s Humanismus, welcher <strong>zu</strong> umfassen<strong>de</strong>n Kontroversen und Bildungsreformen an <strong>de</strong>r Universität führte.<br />
Die Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Universität waren - an<strong>de</strong>rs als alle an<strong>de</strong>ren Kölner - keinem Gaffelzwang unterworfen (Zunftzwang). Gründungsmitglie<strong>de</strong>r waren 1388/89 21 Magistri; 108<br />
Theologen, 166 Juristen, 8 Mediziner wur<strong>de</strong>n unterrichtet. Hauptsächlich kamen die Immatrikulierten aus <strong>de</strong>n rheinischen, westfälischen und nie<strong>de</strong>rländischen Territorien. Ein Drittel <strong>de</strong>r<br />
Stu<strong>de</strong>nten galt als arm und wur<strong>de</strong> mit Stiftungen und Nebenverdiensten ernährt. In <strong>de</strong>n Jahren zwischen 1441 und 1500 wur<strong>de</strong>n jährlich rund 450 Stu<strong>de</strong>nten immatrikuliert. Viele<br />
Stu<strong>de</strong>nten lebten in <strong>de</strong>n so genannten Bursen, auf die im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>r Unterricht <strong>de</strong>r artistischen Fakultät überging. Der Doktorausritt nach <strong>de</strong>r Promotion war ein teures Fest, das<br />
aber <strong>zu</strong>gleich viel Reputation gewährte[6]<br />
Am 28. April 1798 wur<strong>de</strong> die Universität von <strong>de</strong>n 1794 in Köln eingerückten Franzosen mit <strong>de</strong>r Umwandlung in eine Zentralschule „Université <strong>de</strong> Cologne“ geschlossen, da sich die<br />
Kölner Professorenschaft (allen voran ihr Rektor Ferdinand Franz Wallraf) <strong>zu</strong>nächst weigerte, einen Eid auf die französische Republik <strong>zu</strong> leisten; unter <strong>de</strong>r Begründung, dass die<br />
Unabhängigkeit <strong>de</strong>r Universität gewahrt wer<strong>de</strong>n müsse und Professoren keine Verwaltungsbeamten seien. Ferdinand Franz Wallraf wur<strong>de</strong> 1799 Lehrer <strong>de</strong>r Zentralschule, nach<strong>de</strong>m er am<br />
21. Januar <strong>de</strong>s Jahres <strong>de</strong>n Eid dann doch noch geleistet hatte. Er hat für Köln als Retter vieler Kunstwerke Be<strong>de</strong>utung und konnte auch das Unversitätssiegel vor <strong>de</strong>n Franzosen<br />
verstecken. Seine Sammlung gehört heute <strong>zu</strong>m Wallraf-Richartz-Museum & Fondation Corboud.<br />
Die Neue Universität<br />
Im Verlauf <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts waren Bestrebungen <strong>de</strong>r Stadt und ihrer Bürger, eine neue Universität <strong>zu</strong> grün<strong>de</strong>n, gescheitert. Erst 1919 gelang es, die preußische Staatsregierung <strong>zu</strong>
überzeugen. Durch einen Beschluss <strong>de</strong>s Rates <strong>de</strong>r Stadt Köln wur<strong>de</strong> die städtische Universität neu gegrün<strong>de</strong>t. Am 29. Mai 1919 unterzeichnete <strong>de</strong>r damalige Oberbürgermeister Konrad<br />
A<strong>de</strong>nauer <strong>de</strong>n Staatsvertrag mit Preußen. Die Universität ging aus <strong>de</strong>r ebenfalls städtischen am 1. Mai 1901 gegrün<strong>de</strong>ten Han<strong>de</strong>lshochschule, <strong>de</strong>r Hochschule für kommunale und soziale<br />
Verwaltung von 1912 sowie <strong>de</strong>r ersten <strong>de</strong>utschen Aka<strong>de</strong>mie für praktische Medizin von 1904 hervor, die in die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät beziehungsweise die<br />
Medizinische Fakultät übergingen. Als erster Rektor wur<strong>de</strong> Christian Eckert gewählt, <strong>de</strong>r bis dahin die Han<strong>de</strong>lshochschule Köln geleitet hatte. Die Universität residierte in <strong>de</strong>n für die<br />
Han<strong>de</strong>lshochule bis 26. Oktober 1907 am Römerpark, Südstadt, errichteten Gebäu<strong>de</strong>n (jetzt durch die Fachhochschule Köln genutzt) von 1919 bis 1934. Aufgrund <strong>de</strong>r hohen<br />
Stu<strong>de</strong>ntenzahlen wur<strong>de</strong> am 26. Oktober 1929 <strong>de</strong>r Grundstein für das Hauptgebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r neuen Universität gelegt, in das 1934 umgezogen wur<strong>de</strong>.<br />
Am 2. November 1934 konnte die Universität in <strong>de</strong>n vom Architekten Adolf Abel errichteten funktional schlichten Neubau im Inneren Grüngürtel Köln-Lin<strong>de</strong>nthals nahe bei <strong>de</strong>r<br />
Medizinischen Fakultät einziehen. Bereits 1925 war die Universität <strong>zu</strong> Köln nach <strong>de</strong>r Humboldt-Universität <strong>zu</strong> Berlin die zweitgrößte preußische Universität. 1920 kamen die<br />
Rechtswissenschaftliche und die Philosophische Fakultät hin<strong>zu</strong>, von <strong>de</strong>r sich 1955 die Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät abspaltete.1980 wur<strong>de</strong>n die bei<strong>de</strong>n Kölner<br />
Abteilungen <strong>de</strong>r Pädagogischen Hochschule Rheinland als Erziehungswissenschaftliche und Heilpädagogische Fakultät <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong> Köln angeglie<strong>de</strong>rt. Die Universität wur<strong>de</strong><br />
durch Luftangriffe im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, <strong>de</strong>nnoch begann 1945 wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Vorlesungsbetrieb. Allerdings überschritten die Kosten für <strong>de</strong>n Wie<strong>de</strong>raufbau die<br />
Möglichkeiten <strong>de</strong>r Stadt, unter <strong>de</strong>ren alleiniger Trägerschaft die Universität bis 1954 stand. So wur<strong>de</strong> am 1. April 1954 die Universität <strong>zu</strong> Köln mit Wirkung vom 1. April 1953 durch das<br />
Bun<strong>de</strong>sland Nordrhein-Westfalen übernommen. Die Bindung an die Stadt und <strong>de</strong>n Regierungsbezirk Köln wur<strong>de</strong> bis <strong>zu</strong>m Jahre 2007, <strong>de</strong>m Inkrafttreten einer neuen Grundordnung,<br />
durch die Institution <strong>de</strong>s Kuratoriums gewährleistet, in <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Oberbürgermeister <strong>de</strong>n Vorsitz führte. Darüber hinaus kooperiert die Universität mit vielen städtischen Einrichtungen und<br />
Einrichtungen in <strong>de</strong>r Stadt, wie <strong>zu</strong>m Beispiel mit <strong>de</strong>m Rheinisch Westfälischen Wirtschaftsarchiv und vielen städtischen Kliniken.<br />
Der Ausbau <strong>de</strong>r Universität begann mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r Hörsaal- und Seminartrakte und <strong>de</strong>s achtgeschossigen Seminar- und Bürohochhauses für die Wirtschafts- und<br />
Sozialwissenschaftliche Fakultät von Wilhelm Riphahn zwischen 1956 und 1960. In dieser Fakultät hatte sich die Studieren<strong>de</strong>nzahl zwischen 1949 und 1955 auf über 5000 nahe<strong>zu</strong><br />
verfünffacht. Die Universitätsbibliothek folgte 1966, <strong>de</strong>r Albertus-Magnus-Platz wur<strong>de</strong> durch die Absenkung und Deckelung <strong>de</strong>r Universitätsstraße erweitert. 1968 wur<strong>de</strong> das<br />
Hörsaalgebäu<strong>de</strong> fertiggestellt, die Physikalischen und Chemischen Institute jenseits <strong>de</strong>r Zülpicher Straße folgten zwischen 1968 und 1975. Mit <strong>de</strong>m Neubau <strong>de</strong>s Philosophikums 1974<br />
war <strong>de</strong>r Campus <strong>de</strong>r Universität im Wesentlichen fertig. Der Komplex <strong>de</strong>s Klinikums mit <strong>de</strong>n alten Gebäu<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Krankenanstalten Lin<strong>de</strong>nburg wur<strong>de</strong> ab 1965 (Frauenklinik) bis 1974<br />
(Bettenhaus <strong>de</strong>s Zentralklinikums) mo<strong>de</strong>rnisiert und erweitert. Der jenseits <strong>de</strong>r Aka<strong>de</strong>mischen Lustwiese (Akaluwie) 1974 errichtete Neubau <strong>de</strong>r Zentralmensa ist immer noch einer <strong>de</strong>r<br />
mo<strong>de</strong>rnsten und größten Studieren<strong>de</strong>n-Speisebetriebe in Europa. Der Ausbau und die Mo<strong>de</strong>rnisierung <strong>de</strong>r Hochschulgebäu<strong>de</strong> wird bis in die Gegenwart fortgeführt. Die Fassa<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Hauptgebäu<strong>de</strong>s <strong>zu</strong>m Albertus-Magnus-Platz wird seit 1991 von zahlreichen Stahlriemen befestigt, die ursprünglich als Provisorium gedacht waren, um ein Herabfallen <strong>de</strong>r<br />
Sandsteinplatten <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn.<br />
Alle diese Anlagen liegen eingebettet in <strong>de</strong>n Inneren Kölner Grüngürtel und bil<strong>de</strong>ten so einen innenstadtnahen <strong>zu</strong>sammenhängen<strong>de</strong>n Universitätscampus, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>nnoch im Grünen liegt.<br />
Profil<br />
Organisation und Fakultäten<br />
Das Rektorat leitet die Universität. Es besteht <strong>de</strong>rzeit aus <strong>de</strong>m Rektor als Vorsitzen<strong>de</strong>m, drei Prorektoren und <strong>de</strong>m Kanzler. Der Rektor wird vom Hochschulrat gewählt; die erste<br />
Amtszeit beträgt min<strong>de</strong>stens sechs Jahre und weitere Amtszeiten min<strong>de</strong>stens vier Jahre. Der Rektor ist Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Rektorats und <strong>de</strong>s Senats <strong>de</strong>r Universität.<br />
Die Universität glie<strong>de</strong>rt sich in die folgen<strong>de</strong>n sechs Fakultäten:<br />
• Fakultät Studieren<strong>de</strong>1) davon Doktoran<strong>de</strong>n2) (Neu-)Gründungsjahr<br />
• Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät 8.806 609 1919<br />
• Medizinische Fakultät 3.246 262 1919<br />
• Rechtswissenschaftliche Fakultät 5.213 1.232 1920<br />
• Philosophische Fakultät 14.746 1.231 1920
• Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät 6.483 800 1955<br />
• Humanwissenschaftliche Fakultät 5.788 560 2007<br />
• Gesamt 44.282 4.694<br />
• 1)WS 2008/09, gem. Kurzstatistik <strong>de</strong>r Universität (Stand November 2008), inkl. Zweithörer, Gasthörer und Studienkollegiaten[1]<br />
• 2)Anzahl <strong>de</strong>r Doktorandinnen und Doktoran<strong>de</strong>n gem. Studieren<strong>de</strong>nstatistik WS 2006/07 (jeweils Summe Promotion 1. Fach).<br />
Auffallend ist die – bezogen auf die Fakultätsgröße – hohe Zahl von Doktoran<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Rechtswissenschaftlichen Fakultät. Innerhalb <strong>de</strong>r einzelnen Fakultäten dominieren hinsichtlich <strong>de</strong>r<br />
Anzahl <strong>de</strong>r Doktoran<strong>de</strong>n die folgen<strong>de</strong>n Fächer: an <strong>de</strong>r WiSo-Fak. BWL (338 bzw. 55 %), an <strong>de</strong>r Med. Fak. Humanmedizin (187 bzw. 71 %), an <strong>de</strong>r Phil. Fak. Germanistik und<br />
Kunstgeschichte (208 bzw. 17 % respektive 146 bzw. 12 %), an <strong>de</strong>r Math.-Nat. Fak. Biologie (365 bzw. 46 %) und an <strong>de</strong>r HW-Fak. Pädagogik (410 bzw. 73 %).<br />
Am 20. Juli 2005 beschloss <strong>de</strong>r Senat <strong>de</strong>r Universität ein Konzept <strong>zu</strong>r Neuordnung <strong>de</strong>r Fakultäten. Das Konzept brachte die Auflösung <strong>de</strong>r Erziehungswissenschaftlichen und <strong>de</strong>r<br />
Heilpädagogischen Fakultät in ihrer bisherigen Form sowie die Gründung einer neuen „sechsten“, <strong>de</strong>r Humanwissenschaftlichen, Fakultät. Die Vertreter <strong>de</strong>r didaktischen Fächer, die<br />
bisher vor allem an <strong>de</strong>r Erziehungswissenschaftlichen Fakultät tätig waren, wur<strong>de</strong>n im Zuge <strong>de</strong>r Umstrukturierung <strong>de</strong>n ihrem Fach entsprechen<strong>de</strong>n Fakultäten als eigene Fachgruppe für<br />
Didaktik <strong>zu</strong>geordnet (<strong>zu</strong>m Beispiel „Biologie und ihre Didaktik“, „Chemie und ihre Didaktik“ als neue didaktische Fachgruppe an <strong>de</strong>r Math.-Nat.-Fak.), während an <strong>de</strong>r neuen<br />
Humanwissenschaftlichen Fakultät vor allem die pädagogischen, heilpädagogischen und psychologischen Fächer verblieben beziehungsweise aus <strong>de</strong>r Philosophischen und <strong>de</strong>r<br />
Erziehungswissenschaftlichen Fakultät überführt wur<strong>de</strong>n. Die Neuorganisation <strong>de</strong>r Fakultäten wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Errichtung <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Gremien formal <strong>zu</strong>m 1. Januar 2007<br />
umgesetzt.<br />
Beson<strong>de</strong>re För<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Forschung<br />
DFG<br />
EU<br />
• 10 DFG-Son<strong>de</strong>rforschungsbereiche und 2 Beteiligungen an Son<strong>de</strong>rforschungsbereichen an<strong>de</strong>rer Hochschulen<br />
• 5 DFG-Graduiertenkollegs (vgl. Graduiertenprogramme)<br />
• Functional Genomics in Embryonic Stem Cells (FunGenEs)<br />
• Diagnostische molekulare Bildgebung für Neurologie und Herzgefäßerkrankungen (DIMI)<br />
• Innovative Collaborative Work Environments for Individuals and Teams in Design and Engineering (CoSpaces) im sechsten Forschungsrahmenprogramm seit 2006<br />
• Citizenmedia im sechsten Forschungsrahmenprogramm seit 2006<br />
Graduiertenprogramme<br />
• International Graduate School in Genetics and Functional Genomics (NRW Graduate School)<br />
• International Max Planck Research School on the Social and Political Constitution of the Economy (IMPRS-SPCE) (seit 2007)<br />
• Internationaler Promotionsstudiengang Molekulare Medizin (ZMMK)<br />
• Graduiertenkolleg „SOCLIFE (Social Or<strong>de</strong>r and Life Chances in Cross-National Comparison)“ (seit 2008)<br />
• Cologne University Bioinformatics Center (CUBIC) (eingestellt 06/2006)<br />
• Graduiertenkolleg „Theoretische und empirische Grundlagen <strong>de</strong>s Risikomanagements“ (seit 2002)<br />
• Graduiertenkolleg „Globale Strukturen in Geometrie und Analysis“ (seit 2006)<br />
• Graduiertenkolleg „Azentrische Kristalle“ (seit 1999)
• Graduiertenkolleg „Molekulare Analyse von Entwicklungsprozessen bei Pflanzen“ (seit 1997)<br />
• Graduiertenkolleg „Genetik zellulärer Systeme“ (seit 1997)<br />
• Bonn-Cologne Graduate School of Physics and Astronomy<br />
Kooperation mit Großforschungseinrichtungen<br />
Kölner Professoren sind gleichzeitig Mitglie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Großforschungseinrichtungen, auch Studieren<strong>de</strong> können dort mitforschen.<br />
• Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR)<br />
• Forschungszentrum Jülich in <strong>de</strong>r Helmholtz-Gemeinschaft<br />
• Fraunhofer Institut für Algorithmen und Wissenschaftliches Rechnen (SCAI)<br />
• Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung (MPIFG)<br />
• Max-Planck-Institut für neurologische Forschung (MPInF)<br />
• Max-Planck-Institut für Züchtungsforschung (MPIZ)<br />
• Max-Planck-Institut für Biologie <strong>de</strong>s Alterns (Gründung 2008)<br />
Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis<br />
Den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis erhielten:<br />
• Martin R. Zirnbauer (2009)<br />
• Jens Claus Brüning (2007)<br />
• Thomas Mussweiler (2006)<br />
• Axel Ockenfels (2005)<br />
• Martin Krönke (2001)<br />
• Andreas Kablitz (1997)<br />
• Ulf-Ingo Flügge (1996)<br />
• Thomas Schweizer (1995)<br />
• Peter Schnei<strong>de</strong>r (1992)<br />
Sofja-Kovalevskaja-Preis<br />
Der Sofja-Kovalevskaja-Preis ist überreicht wor<strong>de</strong>n an:<br />
• Mirka Uhlirova, Tschechien, Institut für Genetik und Cluster of Excellence CECAD (Professor in Maria Leptin) (2008)<br />
• Mark Depauw (2004)<br />
• Manuel Koch (2002)<br />
• Joachim Schultze (2002)<br />
Universitätspreis für herausragen<strong>de</strong> Dissertationen<br />
• 2008: Gabriela-Elena Oprea (Biogentechnik) – Analyse <strong>zu</strong>r Muskelatrophie
Schmittmann-Wahlen-Stipendium<br />
• 2008: Sarah Remboldt (Medizin) – Frühintervention bei somatoformen Störungen in <strong>de</strong>r Hausarztpraxis<br />
Drittmittelvolumen<br />
Das Drittmittelvolumen (Drittmitteleinnahmen) lag im Jahr 2004 bei 73,4 Mio. €. Der mit Abstand größte Drittmittelgeber war mit 27,6 Mio. € bzw. 37,4 % die Deutsche<br />
Forschungsgemeinschaft (DFG). Von diesem Betrag entfielen 12,4 Mio. € bzw. 44,8 % auf das För<strong>de</strong>rinstrument Son<strong>de</strong>rforschungsbereiche. Die übrigen Drittmitteleinnahmen stammen<br />
ebenfalls <strong>zu</strong> einem Großteil von kompetitiven Drittmittelgebern (insb. EU, BMBF, Stiftungen).<br />
Stiftungsprofessuren<br />
Die Universität hat eine Reihe von Stiftungsprofessuren eingeworben, die <strong>zu</strong>m Teil längerfristig, <strong>zu</strong>m Teil für einige Jahre eingerichtet wur<strong>de</strong>n, und dann in <strong>de</strong>r Regel vom Land<br />
weitergetragen wer<strong>de</strong>n.<br />
• Bayer-Stiftungsprofessur für Technische Chemie, seit 1986<br />
• Stiftungsprofessur für Tumorimmunologie <strong>de</strong>r Deutschen Krebshilfe, seit 2002<br />
• Stiftungsprofessur für Palliativmedizin, finanziert durch die Deutsche Krebshilfe, seit Oktober 2005<br />
• Alfried Krupp von Bohlen und Halbach-Professur für alte Geschichte, seit 2006 für 7 Jahre<br />
• Stiftungsprofessur für Energiewirtschaft, finanziert von <strong>de</strong>r Energiewirtschaft, seit April 2007<br />
Umfangreiche Informationen über das Gesamtspektrum <strong>de</strong>r Forschungsprojekte enthält <strong>de</strong>r Forschungsbericht <strong>de</strong>r Universität.<br />
Lehre<br />
Aufbauend auf ihrem breiten Fächerspektrum bietet die Universität eine Vielzahl an grundständigen, Aufbau- und Weiterbildungsstudiengängen, die im Internetangebot <strong>de</strong>r Universität<br />
<strong>de</strong>tailliert dargestellt sind. Bei <strong>de</strong>r Weiterentwicklung und Neugestaltung <strong>de</strong>s Studienangebots steht <strong>zu</strong>r Zeit die Umstellung auf das Bachelor/Mastersystem im Vor<strong>de</strong>rgrund.<br />
Zusammen mit <strong>de</strong>r Hochbegabtenstiftung <strong>de</strong>r Kreissparkasse Köln bietet die Universität <strong>zu</strong> Köln seit <strong>de</strong>m Wintersemester 2000/2001 Schulen die Möglichkeit, entsprechend begabte<br />
Schüler <strong>de</strong>r Stufen 11 bis 13 (in beson<strong>de</strong>ren Fällen auch <strong>de</strong>r Klassen 8–10) an Vorlesungen und Übungen in <strong>de</strong>n Fächern Mathematik, Physik, Chemie und Informatik und in<br />
ausgewählten Fächern <strong>de</strong>r Philosophischen Fakultät teilnehmen <strong>zu</strong> lassen. Das Projekt hat sich als so erfolgreich erwiesen, dass es auch an <strong>de</strong>n meisten an<strong>de</strong>ren nordrhein-westfälischen<br />
Universitäten eingeführt wor<strong>de</strong>n ist.<br />
Internationalisierung<br />
Für die Internationalen Beziehungen <strong>de</strong>r Hochschule (Betreuung ausländischer Studieren<strong>de</strong>r und Gastwissenschaftler, Studienmöglichkeiten und Forschungsaufenthalte im Ausland,<br />
Hochschulpartnerschaften, internationales Marketing) sind auf universitärer Ebene das Aka<strong>de</strong>mische Auslandsamt und auf Ebene <strong>de</strong>r Fakultäten die Zentren für internationale<br />
Beziehungen <strong>zu</strong>ständig (zentral-<strong>de</strong>zentrales Organisationskonzept). Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Internationalisierung <strong>de</strong>r Hochschule kommt auch durch die 2004 erfolgte Einrichtung <strong>de</strong>r<br />
Position „Prorektor für Internationales und Öffentlichkeitsarbeit“ <strong>zu</strong>m Ausdruck. Das Amt wur<strong>de</strong> erstmals von Barbara Dauner-Lieb beklei<strong>de</strong>t.<br />
Seit Anfang 2007 (offizielle Einweihung im Mai 2007) betreibt die Universität <strong>zu</strong> Köln in Peking ein Büro. Das Büro ist beim DAAD im German Center angesie<strong>de</strong>lt und repräsentiert<br />
das Hochschulkonsortium China-NRW (www.china-nrw.<strong>de</strong>). Die Universität <strong>zu</strong> Köln hat vom Land NRW die Aufgabe <strong>de</strong>r Koordination <strong>de</strong>r aka<strong>de</strong>mischen Kontakte nach China<br />
übernommen. Das Büro soll es <strong>de</strong>n Mitglie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s Konsortiums erleichtern, in China Aktivitäten <strong>zu</strong> entfalten und Unterstüt<strong>zu</strong>ng vor Ort liefern. Die Universität <strong>zu</strong> Köln leitet dieses<br />
Konsortium.
Anzahl und Anteil ausländischer Studieren<strong>de</strong>r/Bildungsauslän<strong>de</strong>r<br />
Die Anzahl <strong>de</strong>r ausländischen Studieren<strong>de</strong>n lag im Wintersemester 2005/06 bei 5.216 (ohne Gaststu<strong>de</strong>nten und Studienkollegiaten). Dies entspricht einem Anteil von 11,0 % an <strong>de</strong>r<br />
Gesamtzahl <strong>de</strong>r Studieren<strong>de</strong>n. Der Anteil <strong>de</strong>r Bildungsauslän<strong>de</strong>rinnen und Bildungsauslän<strong>de</strong>r lag im Wintersemester 2005/06 bei ca. 60 %. Die Bildungsauslän<strong>de</strong>rinnen und<br />
Bildungsauslän<strong>de</strong>r stammten aus insgesamt 121 Nationen. Die größten Herkunftslän<strong>de</strong>r waren Bulgarien (10,9 %), Russland (8,8 %), Polen (7,9 %), China (6,3 %) und die Ukraine (6,1<br />
%).<br />
Hochschulpartnerschaften und Netzwerke<br />
Die Universität <strong>zu</strong> Köln unterhält auf Universitäts- und Fakultätsebene 16 offizielle Hochschulpartnerschaften. Neben <strong>de</strong>n offiziellen Hochschulpartnerschaften bestehen auf Ebene <strong>de</strong>r<br />
einzelnen Fakultäten und Fachbereiche bald 300 Kooperationen und Austauschbeziehungen mit renommierten Universitäten auf <strong>de</strong>r ganzen Welt; das Aka<strong>de</strong>mische Auslandsamt (AAA)<br />
organisiert darüber hinaus einen in <strong>de</strong>r Regel für alle Fächer offenen Studieren<strong>de</strong>naustausch mit circa 15 Hochschulen.<br />
Umfangreiche För<strong>de</strong>rmöglichkeiten bestehen jeweils durch das Erasmus-Programm <strong>de</strong>r EU, <strong>de</strong>n DAAD o<strong>de</strong>r Gebührenerlass <strong>de</strong>r Partnerhochschulen (vollständige Liste <strong>de</strong>r<br />
Partnerhochschulen im Internetangebot <strong>de</strong>r Universität). Im Jahr 2005 hat die Universität <strong>zu</strong> Köln die zentrale Vermittlung und Koordination <strong>de</strong>r Beziehungen <strong>de</strong>r nordrheinwestfälischen<br />
Hochschulen <strong>zu</strong> China übernommen.<br />
Auszeichnung für die Betreuung ausländischer Studieren<strong>de</strong>r<br />
Die Universität <strong>zu</strong> Köln wur<strong>de</strong> 2004 für ihr nach <strong>de</strong>m Vorbild <strong>de</strong>s Zentrums für Internationale Beziehungen an <strong>de</strong>r Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät an <strong>de</strong>r Universität<br />
etabliertes zentral-<strong>de</strong>zentrales Organisationskonzept mit <strong>de</strong>m Preis <strong>de</strong>s Auswärtigen Amtes für beson<strong>de</strong>re Verdienste um die Betreuung ausländischer Studieren<strong>de</strong>r ausgezeichnet.<br />
Humboldt Forschungspreis/AvH-Gastwissenschaftler<br />
Im Jahr 2004 wählten insgesamt zehn <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Humboldt-Forschungspreis <strong>de</strong>r Alexan<strong>de</strong>r von Humboldt-Stiftung ausgezeichneten „etablierten“ ausländischen Wissenschaftler die<br />
Universität <strong>zu</strong> Köln für Ihr Forschungsjahr. Von <strong>de</strong>n „jüngeren“ ausländischen Humboldt-Forschungsstipendiaten waren dies 32.<br />
Haushalt und Finanzen<br />
Die Haushaltsausgaben <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong> Köln betrugen im Jahr 2007 357,236 Mio. € (2006 344,445 Mio. €) (ohne Universitätsklinikum und Lan<strong>de</strong>szentralmittel). Davon entfielen<br />
204,2 Mio. € auf die Personalausgaben, 85 Mio. € auf die Sachausgaben und 67,9 Mio. € auf <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>r Investitionen.[2]<br />
Gleichstellung<br />
Die Universität wur<strong>de</strong> 2004 für ihre erfolgreiche Gleichstellungspolitik mit <strong>de</strong>m Total E-Quality-Prädikat ausgezeichnet. Mit <strong>de</strong>m Prädikat wer<strong>de</strong>n sowohl Unternehmen aus <strong>de</strong>r<br />
Wirtschaft als auch Hochschulen und Forschungseinrichtungen ausgezeichnet, die sich mit personal- und institutionspolitischen Maßnahmen um die Durchset<strong>zu</strong>ng von<br />
Chancengleichheit in ihren Einrichtungen bemühen und dabei auch Erfolge erzielen.<br />
Rankings<br />
Die Kölner Universität zählt regelmäßig <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n TOP 5 in Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und <strong>de</strong>n Rechtswissenschaften und unterhält Forschungskooperationen <strong>zu</strong><br />
mehreren Großforschungseinrichtungen. Im Ranking „Masters in Management“ (2007) <strong>de</strong>r Financial Times belegte die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät <strong>de</strong>n 33. Platz<br />
(Vj.: 17) unter <strong>de</strong>n 40 (Vj.: 32) führen<strong>de</strong>n europäischen Managementausbildungsstätten; die Community of European Management Schools CEMS, <strong>de</strong>m die Wirtschafts- und<br />
Sozialwissenschaftliche Fakultät als Gründungsmitglied angehört, belegte <strong>de</strong>n 2. Platz (Vj.: 2).
Nobelpreisträger<br />
• Kurt Al<strong>de</strong>r – Nobelpreis für Chemie, 1950<br />
• Peter Grünberg – Nobelpreis für Physik, 2007, arbeitete von 1992 bis 2004 an <strong>de</strong>r Universität und am Forschungszentrum Jülich<br />
Ehrenbürger<br />
Seit 1925 ernennt die Universität Persönlichkeiten, die sich um sie o<strong>de</strong>r um die Forschung beson<strong>de</strong>rs verdient gemacht haben, <strong>zu</strong> Ehrenbürgern <strong>de</strong>r Universität.<br />
Ehrenbürger seit 1925 sind:<br />
• Konrad A<strong>de</strong>nauer (1925)<br />
• Schwester Ignatia (geb. Gräfin Spee) (1925)<br />
• Paul von Hin<strong>de</strong>nburg (1926)<br />
• Christian Eckert (1926)<br />
• Friedrich Moritz (1935)<br />
• Balbino Giuliano (1938)<br />
• Anton Waldmann (1938)<br />
• Viktor Rolff (1938)<br />
• Heinrich Ritter von Srbik (1938)<br />
• Karl Haus (1950)<br />
• Robert Pferdmenges (1955)<br />
• Josef Kroll (1956)<br />
• Christine Teusch (1963)<br />
• Leopold von Wiese und Kaiserswaldau (1965)<br />
• Theo Burauen (1969)<br />
• Karl Carstens (1984)<br />
• Hermann Jahrreiß (1984)<br />
• Kurt Hansen (1988)<br />
Ehrensenatoren<br />
Neben <strong>de</strong>n Ehrenbürgern ernennt die Universität seit 1933 auch Ehrensenatoren. Bisher kam 44 Personen diese Ehre <strong>zu</strong>teil, darunter:<br />
• Eugen Schmalenbach (1953)<br />
• Ernst Schwering (1956)<br />
• Max A<strong>de</strong>nauer (1965)<br />
• Heinrich Brüning (1965)<br />
• Hermann Pün<strong>de</strong>r (1967)<br />
• Friedrich Carl Freiherr von Oppenheim (1975)<br />
• John van Nes Ziegler (1980)
• Alfred Freiherr von Oppenheim (2004)<br />
• Heinrich Haake (1934)<br />
Bekannte Professoren<br />
Die Hochschule beschäftigt <strong>zu</strong>r Zeit über 500 Professoren (davon über 60 Professorinnen). Bekannte Persönlichkeiten, die in Köln gelehrt haben o<strong>de</strong>r noch lehren, sind:<br />
• Klaus Adolphi (Biologie)<br />
• Kurt Al<strong>de</strong>r (Chemie), Nobelpreis Chemie 1950<br />
• Klaus Peter Berger, Bürgerliches Recht, Deutsches und Internationales Wirtschaftsrecht, Bankrecht; erster Rap-Professor<br />
• Günther Binding (Kunstgeschichte)<br />
• Günter Blamberger (Germanistik)<br />
• Roland Bulirsch (Mathematik)<br />
• Joachim Bumke (Altgermanistik)<br />
• Christoph Butterwegge (Politikwissenschaften)<br />
• Karl Carstens (Rechtswissenschaften)<br />
• Karl Otto Conrady (Germanistik)<br />
• Max Delbrück (Genetik)<br />
• Otto Depenheuer (Rechtswissenschaften)<br />
• Juergen B. Donges (Volkswirtschaftslehre)<br />
• Walther Dreher (Son<strong>de</strong>rpädagogik)<br />
• Johann Eekhoff (Volkswirtschaftslehre)<br />
• Norbert Finzsch (Geschichtswissenschaft)<br />
• Barbara Fornefeld (Son<strong>de</strong>rpädagogik)<br />
• Martin Göpfert (Biologie)<br />
• Peter Grünberg (Physik), Nobelpreis Physik 2007<br />
• Erich Gutenberg (Betriebswirtschaftslehre)<br />
• Hans Ludwig Hamburger (Mathematik)<br />
• Herbert Hax (Betriebswirtschaftslehre)<br />
• Martin Henssler (Rechtswissenschaft)<br />
• Andreas Hillgruber (Geschichtswissenschaft)<br />
• Hermann Jahrreiß (Rechtswissenschaften)<br />
• Gerhard Kegel (Rechtswissenschaften)<br />
• Hermann Kellenbenz (1913-1990), Wirtschaftshistoriker, 1960-1970 Lehrstuhl für Wirtschaftsgeschichte, Direktor <strong>de</strong>s Rheinisch-Westfälischen Wirtschaftsarchivs<br />
• René König (Soziologie)<br />
• Hans Kelsen (Rechtswissenschaft)<br />
• Johannes Kunisch (Geschichtswissenschaft)<br />
• Joachim Lang (Steuerrecht)<br />
• Karl Lauterbach (Gesundheitsökonomie)
• Karl-Heinz Lauterjung (Physik)<br />
• Erich Meuthen (Geschichtswissenschaft)<br />
• Alex Meyer (Rechtswissenschaften, insb. Luftrecht)<br />
• Peter Mittelstaedt (Physik)<br />
• Renate Möhrmann (Theater-, Film- und Fernsehwissenschaft)<br />
• Alfred Müller-Armack (Volkswirtschaftslehre)<br />
• Thomas Mussweiler (Psychologie)<br />
• Hans Carl Nipper<strong>de</strong>y (Rechtswissenschaften)<br />
• Axel Ockenfels (Volkswirtschaftslehre)<br />
• Ion N. Petrovici (Medizin)<br />
• Veronika Petrovici (Medizin)<br />
• Holger Pfaff (Medizinische Soziologie)<br />
• Helmuth Plessner (Philosophie)<br />
• Beatrice Primus (Germanistik)<br />
• Hans-Jürgen Sasse (Allgemeine Sprachwissenschaft)<br />
• Wilhelm Salber (Psychologie)<br />
• Werner Scheid (Neurologie)<br />
• Max Scheler (Philosophie und Soziologie)<br />
• Erwin K. Scheuch (Soziologie)<br />
• Theodor Schie<strong>de</strong>r (Geschichtswissenschaft)<br />
• Eugen Schmalenbach (Betriebswirtschaftslehre)<br />
• Hans Karl Schnei<strong>de</strong>r (Volkswirtschaftslehre)<br />
• Josef Schrud<strong>de</strong> (Medizin)<br />
• Frank Schulz-Nieswandt (Sozialpolitik)<br />
• Heinrich von Stackelberg (Volkswirtschaftslehre)<br />
• Klaus Stern (Rechtswissenschaften)<br />
• Joseph Straub (Botanik)<br />
• Klaus Tipke (Steuerrecht)<br />
• Gerhard Uhlenbruck (Medizin, Immunologie, Immun- und Sporttherapie) und Aphoristiker<br />
• Franziska Völckner (Marketing; jüngste habil. BWL-Professorin in Deutschland)<br />
• Thomas von Danwitz (Rechtswissenschaften)<br />
• Axel Weber (Volkswirtschaftslehre)<br />
• Andreas Wesch (Romanistik)<br />
• Carl Christian von Weizsäcker (Volkswirtschaftslehre)<br />
• Johannes Zittartz (Physik)<br />
• Michael Zeuske (Geschichtswissenschaft)
Bekannte Absolventen<br />
• Manuel Andrack (* 1965), Redakteur, Mo<strong>de</strong>rator und Autor<br />
• Gerhart Baum (* 1932), Rechtsanwalt und ehemaliger Bun<strong>de</strong>sinnenminister (FDP)<br />
• Mark Benecke (* 1970), Kriminalbiologe und Autor<br />
• Klaus vom Bruch (* 1952), Künstler<br />
• Wolfgang Bosbach (* 1952), <strong>de</strong>utscher Politiker (CDU)<br />
• Peter Grünberg (* 1939), Nobelpreis für Physik (2007)<br />
• Marion von Haaren (* 1957), Fernsehjournalistin<br />
• Britta Hei<strong>de</strong>mann (* 1982), Olympiasiegerin im Fechten<br />
• Jan Hofer (* 1952), Fernsehjournalist<br />
• Klaus Laepple (* 1939), Tourismusfunktionär<br />
• Hera Lind (* 1957), Schriftstellerin<br />
• Karolos Papoulias (* 1929), griechischer Staatspräsi<strong>de</strong>nt<br />
• Richard David Precht (* 1964), Philosoph, Schriftsteller und Publizist<br />
• Michael Radtke (* 1946), Journalist, Schriftsteller und Drehbuchautor<br />
• Fritz Schramma (* 1947), ehem. Oberbürgermeister von Köln<br />
• Hans Sennholz (1922–2007), <strong>de</strong>utscher Ökonom und US-Hochschullehrer, be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Vertreter <strong>de</strong>r Österreichischen Schule <strong>de</strong>r Volkswirtschaftslehre<br />
• Marietta Slomka (* 1969), Fernsehjournalistin<br />
• Ulrich Walter (* 1954), Astronaut und Professor für Raumfahrttechnik<br />
• Anne Will (* 1966), Fernsehjournalistin<br />
• Alfred Herrhausen (1930–1989), ehemaliger Vorstandssprecher <strong>de</strong>r Deutschen Bank<br />
• Wolfgang Grupp (* 1942), <strong>de</strong>utscher Unternehmer (Trigema)<br />
• Heinrich Freiherr von Stackelberg (1905–1946), <strong>de</strong>utscher Ökonom<br />
Grün<strong>de</strong>r<br />
• Mittelalterliche Universität (1388): Rat <strong>de</strong>r Reichsstadt Köln mit Genehmigung durch Papst Urban VI.[7]<br />
• Mo<strong>de</strong>rne Universität (1919): Rat <strong>de</strong>r Stadt Köln unter Konrad A<strong>de</strong>nauer mit Genehmigung durch die preußische Regierung<br />
Kunstwerke<br />
• Skulptur Albertus Magnus von Gerhard Marcks aus <strong>de</strong>m Jahre 1956, <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>m Albertus-Magnus-Platz vor <strong>de</strong>m Haupteingang. 1965 erfolgte ein Zweitguss für die<br />
Universität Bogota, ein 3. Abguss 1970 für die University of Texas in Houston, Texas, und schließlich auf Veranlassung von Tochter Brigitte Marcks-Geck – alle aus <strong>de</strong>r<br />
Werkstatt <strong>de</strong>r Kunstgießerei Schmäke, Düsseldorf – 1996 ein Abguss für die Friedrich-Schiller-Universität Jena, da Marcks lange Jahre enge Beziehungen <strong>zu</strong> Thüringen hatte.<br />
• Skulptur Hercules von Émile-Antoine Bour<strong>de</strong>lle, <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n im mittleren Innenhof <strong>de</strong>r WiSo-Fakultät.<br />
• Stele von Ulrich Rückriem, 2004, <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>m westlichen Teil <strong>de</strong>s Albertus-Magnus-Platzes, vor <strong>de</strong>m Philosophikum.<br />
• Porträt Max Scheler von Otto Dix, 1926<br />
• Backstein-Relief Hermes in <strong>de</strong>r Fassa<strong>de</strong> <strong>de</strong>s von Wilhelm Riphahn geplanten und gebauten Gebäu<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r WiSo-Fakultät, 1959
Museen und Sammlungen<br />
• GeoMuseum: Einziges naturkundliches Museum in Köln. Minerale, E<strong>de</strong>lsteine, Meteoriten, Fossilien etc. Geöffnet mittwochs 14–20 Uhr und je<strong>de</strong>n letzten Sonntag im Monat<br />
14–17 Uhr, Zülpicher Str. 49 b<br />
• Theaterwissenschaftliche Sammlung in Schloss Wahn: Bil<strong>de</strong>r und Texte <strong>zu</strong>m europäischen Theater vom 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt an, unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>r Nachlass von Karl Valentin.<br />
Besichtigung <strong>de</strong>r archivierten Materialien nur nach (begrün<strong>de</strong>ter) Voranmeldung. Bibliothek öffentlich. Burgstr. 2, Köln-Porz/Wahn.<br />
• Musikinstrumentensammlung <strong>de</strong>s Musikwissenschaftlichen Instituts: Über 80 Exponate aus Europa und Übersee. Besichtigung nach Vereinbarung.<br />
• Ägyptische Sammlung: Papyri, Ostraka (Schriftscherben) und Pergamente, Keramiken und Kleinplastiken. Besichtigung nach Vereinbarung, Meister-Ekkehart-Str. 7, Institut für<br />
Ägyptologie.<br />
• Prähistorische Sammlung (Studiensammlung): Artefakte aus sämtlichen Perio<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Ur- und Frühgeschichte auch von ausländischen Fundstätten, vom Faustkeil <strong>de</strong>s<br />
Nean<strong>de</strong>rtalers bis <strong>zu</strong>m Bronzeschwert und <strong>zu</strong> Eisenwaffen <strong>de</strong>s frühen Mittelalters. Besichtigung nach Vereinbarung, Weyertal 125, Institut für Ur- und Frühgeschichte.<br />
• Papyrussammlung <strong>de</strong>s Instituts für Altertumskun<strong>de</strong>: eine <strong>de</strong>r weltweit größten Sammlungen. Nach Vereinbarung sind Gruppenführungen möglich. Uni-Hauptgebäu<strong>de</strong>.<br />
• Barbarastollen: Unter <strong>de</strong>r Aula, Hauptgebäu<strong>de</strong>, wur<strong>de</strong> als Teil eines Museums für Han<strong>de</strong>l und Industrie 1932 ein Bergwerksstollen aufgebaut, <strong>de</strong>r nach Vereinbarung über das<br />
Institut für Arbeitsmedizin in Gruppen <strong>zu</strong> besichtigen ist.<br />
Literatur<br />
Universitätsgeschichte<br />
• Erich Meuthen: Kölner Universitätsgeschichte, Band I: Die alte Universität. Köln [u.a.]: Böhlau 1988. ISBN 3-412-06287-1.<br />
• Bernd Heimbüchel & Klaus Pabst: Kölner Universitätsgeschichte, Band II: Das 19. und 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Köln [u.a.]: Böhlau 1988. ISBN 3-412-01588-1.<br />
• Erich Meuthen (Hrsg.): Kölner Universitätsgeschichte, Band III: Die neue Universität: Daten und Fakten. Köln [u.a.]: Böhlau 1988. ISBN 3-412-01688-8.<br />
• Ernst Heinen: Bildnerhochschule und Wissenschaftsanspruch. Lehrerbildung in Köln 1946–1965 (Studien <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong> Köln Band 16). Böhlau, Köln [u.a.]<br />
2003. Rezension von Leo Haupts. In: Geschichte in Köln. Zeitschrift für Stadt- und Regionalgeschichte. Band 53. Dezember 2006. S. 212–214: Buchbesprechungen.<br />
• Willehad Paul Eckert: Kleine Geschichte <strong>de</strong>r Universität Köln, Bachem Köln 1961<br />
• Anna-Dorothee v. <strong>de</strong>n Brincken: Stadt und Hochschule: Papst Urban IV. bestätigt 1388 die Kölner Universitätsgründung, in: Quellen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Köln, Band I., S.<br />
307-312, Köln Bachem 1999<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ a b c uni-köln.<strong>de</strong>: http://www.xxx abgerufen am 23. Dezember 2009.<br />
2. ↑ a b c d uni-köln.<strong>de</strong>: Zahlen, Daten, Fakten (PDF-Datei, 32 kB; HTML-Seite).<br />
3. ↑ Gründungsurkun<strong>de</strong> in: v. <strong>de</strong>n Brincken, Stadt und Hochschule, Quellen <strong>de</strong>r Stadt Köln Bd. 1, S.308/309<br />
4. ↑ v. <strong>de</strong>n Brincken, a.a.O.<br />
5. ↑ Willehad Paul Eckert: Kleine Geschichte <strong>de</strong>r Universität Köln, Bachem Köln 1961, S. 35f.<br />
6. ↑ Eckert: Kleine Geschichte <strong>de</strong>r Universität Köln, a.a.O., S. 50ff.<br />
7. ↑ v. <strong>de</strong>n Brincken, a.a.O.<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Kurköln - Kurfürstentum Köln<br />
Kurköln (auch: Erzstift und Kurfürstentum Köln) war eines <strong>de</strong>r ursprünglich sieben Kurfürstentümer <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation. Es bil<strong>de</strong>te <strong>de</strong>n weltlichen<br />
Herrschaftsbereich <strong>de</strong>r Erzbischöfe von Köln und ist von <strong>de</strong>ren sehr viel größerem Erzbistum <strong>zu</strong> unterschei<strong>de</strong>n, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m mehrere Suffraganbistümer und weitere Gebiete gehörten, die nur<br />
<strong>de</strong>r geistlichen, nicht aber <strong>de</strong>r staatlichen Gewalt <strong>de</strong>s Erzbischofs unterstan<strong>de</strong>n.<br />
Das Kurfürstentum existierte von <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 10. Jahrhun<strong>de</strong>rts bis <strong>zu</strong>m Reichs<strong>de</strong>putationshauptschluss im Jahr 1803 und gehörte von 1512 an <strong>zu</strong>m Kurrheinischen Reichskreis. Seine<br />
Kerngebiete lagen links <strong>de</strong>s Rheins zwischen An<strong>de</strong>rnach und Rheinberg. Das nordöstlich gelegene Vest Recklinghausen bil<strong>de</strong>te eine kurkölnische Exklave. Ebenfalls <strong>zu</strong>m Kurfürstentum<br />
gehörte das Herzogtum Westfalen mit <strong>de</strong>m Schwerpunkt im Sauerland, das aber in erheblichem Maße Selbstverwaltungsrechte und an<strong>de</strong>re Privilegien bewahren konnte.<br />
Kurköln grenzte an die Herzogtümer Berg, Jülich, Gel<strong>de</strong>rn und Kleve. Seine Haupt- und Resi<strong>de</strong>nzstadt war seit 1597 Bonn. Weitere wichtige Verwaltungszentren waren Neuss,<br />
Ahrweiler und An<strong>de</strong>rnach.<br />
Geschichte<br />
Entstehung von Bistum und Erzstift<br />
Schon vor <strong>de</strong>m Jahr 313 war das römische Köln Sitz eines Bistums. Nach <strong>de</strong>r Eroberung durch die Franken um 450 wur<strong>de</strong> es <strong>zu</strong>m Erzbistum erhoben. Ihm unterstan<strong>de</strong>n die<br />
Suffraganbistümer Lüttich, Münster, Osnabrück und Min<strong>de</strong>n sowie bis 834 Hamburg-Bremen und bis 1559 Utrecht.<br />
Um die alten Römerstädte im Rheinland – darunter Bonn, Köln, Jülich, Neuss und Xanten – hatten die Erzbischöfe bereits früh weltliche Güter und Grundherrschaften erworben. Später<br />
kamen Besit<strong>zu</strong>ngen in Westfalen hin<strong>zu</strong>, mit Schwerpunkten um Soest, Me<strong>de</strong>bach und Attendorn. Viele alte Besit<strong>zu</strong>ngen wur<strong>de</strong>n für die Ausstattung von Klöstern und Stiften abgegeben<br />
o<strong>de</strong>r ging im 11. Jahrhun<strong>de</strong>rt nach ihrer Vergabe als Lehen verloren.<br />
Die allmähliche Herausbildung <strong>de</strong>r weltlichen Besitztümer und Rechte <strong>de</strong>s Erzbistums <strong>zu</strong>m Kurstaat hängt eng mit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>s ottonisch-salischen Reichskirchensystems <strong>zu</strong>sammen: Nach<br />
Aufstän<strong>de</strong>n mehrerer Herzöge, darunter zwei seiner eigenen Brü<strong>de</strong>r, übertrug Otto <strong>de</strong>r Große 953 seinem Bru<strong>de</strong>r Brun die Stadt und das Erzbistum Köln <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m Herzogtum<br />
Lothringen. Ein Teil dieses Herzogtums, ein etwa 25 Kilometer tiefer Streifen am linken Rheinufer, <strong>de</strong>r von Rolandseck im Sü<strong>de</strong>n bis Rheinberg im Nor<strong>de</strong>n reichte, blieb <strong>de</strong>n<br />
Nachfolgern Bruns als weltlicher Besitz, in <strong>de</strong>m sie die Lan<strong>de</strong>shoheit ausübten. Ihre Stellung als wichtige Stützen <strong>de</strong>s Reichs und <strong>de</strong>r Reichskirche nutzten sie, um sich gegenüber<br />
an<strong>de</strong>ren rheinischen und westfälischen Machthabern wie <strong>de</strong>n lothringischen Pfalzgrafen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Grafen von Werl <strong>zu</strong> behaupten.[1]<br />
Hohes Mittelalter
Nach <strong>de</strong>m Tod Heinrichs III. und als Folge <strong>de</strong>r Unsicherheit <strong>de</strong>s Investiturstreits begannen die Erzbischöfe einen weltlichen Herrschaftsbereich auf<strong>zu</strong>bauen und konkurrieren<strong>de</strong><br />
Interessen <strong>zu</strong>rück <strong>zu</strong> drängen. Unter Anno II. wur<strong>de</strong>n die eigentlichen Grundlagen <strong>de</strong>s späteren Kurstaates gelegt. In dieser Zeit wur<strong>de</strong>n die Macht <strong>de</strong>r Ezzonen beschnitten und ihnen<br />
Siegburg genommen. Erweitert wur<strong>de</strong> das Kerngebiet 1067 durch das Reichsgut um An<strong>de</strong>rnach, später um Deutz, Go<strong>de</strong>sberg, Amt Altenwied mit Linz am Rhein, und die Grafschaft<br />
Liedberg. Im Jahr 1075 kamen auch Aspel und Rees am rechten Nie<strong>de</strong>rrhein hin<strong>zu</strong>. Ansätze <strong>zu</strong> einer festeren kölnischen Herrschaft im südlichen Westfalen gehen auf die Zeit von<br />
Friedrich I. von Schwarzenburg <strong>zu</strong>rück, <strong>de</strong>m es gelang <strong>de</strong>n Grafen von Arnsberg erhebliche Rechte <strong>zu</strong> entreißen.<br />
Dieses Territorium wur<strong>de</strong> unter Erzbischof Philipp I. von Heinsberg noch einmal mehr stark vergrößert. Die Erzbischöfe stiegen in dieser Zeit <strong>zu</strong>r stärksten regionalen Macht auf.[1]<br />
Im Rheinland wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Erzbischöfen 1151 endgültig die ripuarische (rheinische) Herzogswür<strong>de</strong> verliehen, die sie <strong>zu</strong>r weiteren Bekräftigung ihrer Machtstellung nutzten.[2]Kaiser<br />
Friedrich I. Barbarossa verlieh <strong>de</strong>m Bischof 1180 mit <strong>de</strong>r Gelnhäuser Urkun<strong>de</strong> für seine Loyalität im Kampf gegen Herzog Heinrich <strong>de</strong>n Löwen das Herzogtum Westfalen und Engern.<br />
Da<strong>zu</strong> kam um 1230 das Vest Recklinghausen. Allerdings gelang es <strong>de</strong>n Kurfürsten von Köln nicht, die bei<strong>de</strong>n getrennten rheinischen und westfälischen Lan<strong>de</strong>steile <strong>zu</strong> einem<br />
geschlossenen Territorium <strong>zu</strong> vereinigen.<br />
Erzbischof Konrad von Hochsta<strong>de</strong>n erweiterte das Erzstift nach Sü<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>m er ihm die Besit<strong>zu</strong>ngen seiner eigenen Familie hin<strong>zu</strong>fügte, die mit ihm ausstarb. Unter ihm erreichte<br />
Kurköln seine größte Machtfülle. Da er sich früh gegen Kaiser Friedrich II. gestellt und auf die Seite <strong>de</strong>s Papstes geschlagen hatte, erlangte <strong>de</strong>r Erzbischof <strong>de</strong>ssen beson<strong>de</strong>res Vertrauen.<br />
Der erklärte ihn und seine Nachfolger <strong>zu</strong> apostolischen Legaten qua Amt. Hochsta<strong>de</strong>n galt als Königsmacher, eine Machtstellung, die seine Nachfolger jedoch nicht behaupten konnten.<br />
Im Limburger Erbfolgestreit unterlag Erzbischof Siegfried von Westerburg 1288 in <strong>de</strong>r Schlacht von Worringen einem Bündnis <strong>de</strong>s Herzogs von Brabant, <strong>de</strong>r Grafen von Jülich, Kleve<br />
und Berg sowie <strong>de</strong>r Bürgerschaft von Köln und verlor die Herrschaft über seine eigene Bischofsstadt. Köln selbst gehörte damit nicht mehr <strong>zu</strong>m Kurstaat, son<strong>de</strong>rn galt fortan als Freie<br />
Reichsstadt mit Sitz und Stimme im Reichstag. Schon Erzbischof Engelbert II. von Falkenburg hatte die Stadt Köln verlassen. Seine Nachfolger residierten von 1597 bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Kurstaats hauptsächlich in Bonn.<br />
Im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt war <strong>de</strong>r weltliche Herrschaftsbereich <strong>de</strong>s Erzbischofs zwar ein damals beachtliche Machtbereich, aber er war noch ein vorterritoriales Gebil<strong>de</strong>, ohne feste Grenzen. Es<br />
<strong>de</strong>finierte sich im Wesentlichen noch über die Ausübung herrschaftlicher Rechte. Der Beginn <strong>zu</strong>r Ausbildung einer festen Lan<strong>de</strong>sherrschaft setzte in <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 13.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts ein. Zu dieser Zeit kam erstmals auch die Bezeichnung Stift für das erzbischöfliche Herrschaftsgebiet auf. Von großer Be<strong>de</strong>utung für die Durchset<strong>zu</strong>ng einer territorialen<br />
Herrschaft waren die Städte und die Burgen <strong>de</strong>s Erzbischofs. Auch die verschie<strong>de</strong>nen Rheinzölle spielten für die Durchset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sherrschaft eine wichtige Rolle.[3]<br />
Spätes Mittelalter<br />
Im Jahr 1368 erwarb Kurköln die Grafschaft Arnsberg im Sauerland. Dieses Gebiet wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m territorialen Kern <strong>de</strong>s Herzogtums Westfalen. Die Stadt Arnsberg wur<strong>de</strong> Sitz <strong>de</strong>s<br />
Landdrosten als Vertreter <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sherren, (Neben-)Resi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>s Kurfürsten und Tagungsort <strong>de</strong>s Landtags für das Herzogtum. Massive Versuche auch das benachbarte Bistum<br />
Pa<strong>de</strong>rborn ein<strong>zu</strong>verleiben scheiterten.<br />
Im Rheinland reichte das Stift im späten Mittelalter von Rheinsberg im Nor<strong>de</strong>n bis nach An<strong>de</strong>rnach im Sü<strong>de</strong>n, von Nürburg im Westen bis nach Altenried im Osten. Unterteilt war es in<br />
das Oberstift nördlich von Köln und das Unterstift südlich von Köln.[4] 1314 erwarb <strong>de</strong>r Kurstuhl die Köln benachbarte Grafschaft Hülchrath, mit <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n rheinischen Gebieten die<br />
territoriale Lücke zwischen <strong>de</strong>m Ober- und <strong>de</strong>m Nie<strong>de</strong>rstift geschlossen wur<strong>de</strong>, und gleichfalls im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt das Land Linn bei Krefeld.<br />
Zur Zeit von Walram von Jülich fällt zwischen 1332 bis 1349 die systematische Einführung <strong>de</strong>r Ämterverfassung. Wilhelm von Gennep und Friedrich III. von Saarwer<strong>de</strong>n haben die<br />
Verwaltungsorganisation vollen<strong>de</strong>t. Auf lokaler Ebene wur<strong>de</strong>n Amtskellner <strong>zu</strong>ständig für die Einnahme <strong>de</strong>r Steuern eingesetzt. Richter und Vögte waren <strong>de</strong>n Amtmännern für <strong>de</strong>n<br />
Bereich <strong>de</strong>r Justiz beigeordnet.[4]<br />
Die überspannte Machtpolitik Erzbischof Dietrichs II. von Moers hatte nachhaltige Folgen. In <strong>de</strong>r Soester Feh<strong>de</strong> von 1444 bis 1449 verlor <strong>de</strong>r Kurstaat die Herrschaft über Soest und<br />
Xanten an die Grafschaft Kleve. Das Streben nach einem geschlossenen Territoriums und eine verfehlte Wirtschaftspolitik führten seit <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong>nehmend<br />
<strong>zu</strong>m Ruin und damit zeitweise <strong>zu</strong>r politische Handlungsunfähigkeit Kurkölns. Zwar gab es noch kleinere territoriale Erwerbungen, insgesamt aber war die territoriale Entwicklung seit<br />
Mitte <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts abgeschlossen. Kurköln bestand aus einem etwa 100 km langen und 25 km breiten Landstreifen am Rhein, <strong>de</strong>r das eigentliche Kurfürstentum bil<strong>de</strong>te, sowie
aus <strong>de</strong>m Herzogtum Westfalen und <strong>de</strong>m Vest Recklinghausen.<br />
Die hohe Verschuldung <strong>de</strong>s Erzstifts durch Dietrich von Moers führten da<strong>zu</strong>, dass die Landstän<strong>de</strong> im rheinischen und westfälischen Teil <strong>de</strong>s Kurstaates 1463 Erblan<strong>de</strong>svereinigungen<br />
erzwangen. Diese bil<strong>de</strong>ten eine <strong>de</strong>r zentralen Grundgesetze <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s bis <strong>zu</strong> seinem En<strong>de</strong>. Je<strong>de</strong>r neue Erzbischof hatte bei seiner Wahl die Bestimmungen <strong>zu</strong> beschwören. Sie schrieben<br />
unter an<strong>de</strong>rem die Beteiligung <strong>de</strong>s Domkapitels und <strong>de</strong>r übrigen Landstän<strong>de</strong> an zentralen politischen Entscheidungen, wie die Erklärung von Kriegen und die Bewilligung von Steuern<br />
fest.<br />
Als erster hat Ruprecht von <strong>de</strong>r Pfalz die Erblan<strong>de</strong>svereinigungen beschworen, sich bald aber nicht mehr dran gehalten. Als er das an das Domkapitel verpfän<strong>de</strong>te Zons besetzten ließ,<br />
beanspruchten die Stän<strong>de</strong> das in <strong>de</strong>r Erblan<strong>de</strong>svereinigung verbriefte Wi<strong>de</strong>rstandsrecht für sich und bestimmten Hermann von Hessen als Stiftsverweser. Bei<strong>de</strong> Seiten hatten Unterstützer<br />
innerhalb <strong>de</strong>s Staates und von außen. Die Hessen unterstützen Hermann, Karl <strong>de</strong>r Kühne stand auf Seiten von Ruprecht. Es kam <strong>zu</strong>r Kölner Stiftsfeh<strong>de</strong> in <strong>de</strong>ren Verlauf es <strong>zu</strong>r langen<br />
Belagerung von Neuss kam. Nach <strong>de</strong>r Gefangennahme durch hessische Truppen hat Rupprecht sein Amt aufgegeben.[5]<br />
Frühe Neuzeit<br />
Reformation und Gegenreformation<br />
Unter Hermann V. von Wied kam es in <strong>de</strong>n 1540er Jahren <strong>zu</strong>m Versuch im Kurstaat die Reformation ein<strong>zu</strong>führen (Kölner Reformation). Er traf dabei auf Wi<strong>de</strong>rstand insbeson<strong>de</strong>re aus<br />
Reihen <strong>de</strong>s Domkapitels und <strong>de</strong>r Kölner Universität, aber fand auch Unterstüt<strong>zu</strong>ng durch Grafen, Städte und Ritterschaft auf <strong>de</strong>m Landtag von 1543. In Städten wie Bonn, Neuss,<br />
Kempen und Kaiserwerth wur<strong>de</strong> die reformatorische Predigt eingeführt. Insbeson<strong>de</strong>re die Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r protestantischen Fürsten im Schmalkaldischen Krieg und damit die fehlen<strong>de</strong>n<br />
Unterstüt<strong>zu</strong>ng von außen führten <strong>zu</strong>m Scheitern und <strong>zu</strong>m Amtsverzicht Hermanns.<br />
Auch nach <strong>de</strong>m Scheitern von konnten sich im kurkölner Herrschaftsbereich Ansätze evangelischer Gemein<strong>de</strong>n halten. Adolf III. von Schaumburg versuchte mit mäßigen Erfolg <strong>de</strong>m<br />
durch Ansätze von Kirchenreformen (Provinzialsyno<strong>de</strong>, Visitiationen usw.) und Bekämpfung <strong>de</strong>s Protestantismus entgegen <strong>zu</strong> wirken. In Städten wie Bonn, Kempen und Neuss und<br />
einigen Unterherrschaften konnte sich evangelisches Leben gestützt auf die lokalen Herrschaftsträger sogar stabilisieren. Die folgen<strong>de</strong>n Kurfürsten taten wenig, um <strong>de</strong>n Protestantismus<br />
<strong>zu</strong>rück <strong>zu</strong> drängen. Unter Salentin von Isenburg kam es <strong>zu</strong> einer Visitation, die <strong>zu</strong>sätzlich <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n protestantisch gewor<strong>de</strong>nen Gemein<strong>de</strong>n und Herrschaft in 40 von 180 Pfarreien<br />
lutherische, Calvinistische o<strong>de</strong>r täuferische Spuren feststellte. Allerdings war nur eine kleine Min<strong>de</strong>rheit <strong>de</strong>r Pfarrer klar protestantisch.[6]<br />
Unter Gebhard I. von Waldburg kam es in <strong>de</strong>n 1580er Jahren noch einmal <strong>zu</strong> einem Versuch das Erzstift in eine weltliches Fürstentum um<strong>zu</strong>wan<strong>de</strong>ln und die Reformation ein<strong>zu</strong>führen.<br />
An seiner Stelle wur<strong>de</strong> Ernst von Bayern vom Domkapitel <strong>zu</strong>m neuen Erzbischof und Lan<strong>de</strong>sherren gewählt. Gebhardt leistete Wi<strong>de</strong>rstand und wur<strong>de</strong> im Kölnischen Krieg besiegt. Nach<br />
<strong>de</strong>m Sieg von Ernst von Bayern setzten sofort gegenreformatorische Maßnahmen ein. Nur in wenigen Gemein<strong>de</strong>n konnte sich die Reformation behaupten.[6]<br />
Seit Ernst von Bayern wur<strong>de</strong> das Kurfürstentum zwischen 1583 und 1761 durchgehend von Erzbischöfen aus <strong>de</strong>m bayerischen Haus Wittelsbach regiert. Dieses konnte so seinen<br />
politischen Einfluss im Nordwesten <strong>de</strong>s Reiches erweitern. Zu<strong>de</strong>m verfügte die Familie damit über einen Sitz im Kurfürstenkollegium. In kirchenpolitischer Hinsicht kam es im<br />
wesentlichen erst unter Ferdinand von Bayern <strong>zu</strong> kirchlichen Reformen. Er hat insbeson<strong>de</strong>re die Jesuiten, aber auch Kapuziner und an<strong>de</strong>re Or<strong>de</strong>n geför<strong>de</strong>rt. Seit 1584 war Köln einer<br />
päpstlichen Nuntiatur, die <strong>zu</strong> einem wichtigen Motor <strong>de</strong>r Gegenreform und Kirchenreform wur<strong>de</strong>.[7] Zur Zeit Ferdinands war Kurköln insbeson<strong>de</strong>re zwischen 1626 und 1631 eines <strong>de</strong>r<br />
Zentren <strong>de</strong>r Hexenverfolgung.[8]<br />
Entwicklung im 17./18. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Als Sekundogenitur <strong>de</strong>r Wittelsbacher unterstützte Kurköln in <strong>de</strong>r Regel die meist pro-französische und anti-habsburgische Politik <strong>de</strong>r Herzöge und Kurfürsten von Bayern. Insbeson<strong>de</strong>re<br />
Maximilian Heinrich von Bayern richtete seine Politik auf Frankreich und gegen das Reich aus. Er verbün<strong>de</strong>te sich 1671 mit Ludwig XVI. und nahm am Krieg gegen die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong><br />
teil. Dieses Politik führte <strong>zu</strong> einer starken Belastung <strong>de</strong>s Staates. Gleichzeitig trieb Max Heinrich auch die kirchliche Reformpolitik voran.<br />
In die Zeit <strong>de</strong>r wittelsbachischen Sekundogenitur fällt im Wesentlich auch die Mo<strong>de</strong>rnisierung <strong>de</strong>r staatlichen Spitze mit absolutistischen Ten<strong>de</strong>nzen. Erst unter Ferdinand von Bayern<br />
kam es unter Umgehung <strong>de</strong>r Erblan<strong>de</strong>svereinigung im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong>r Einführung eines ständigen Hofrates an <strong>de</strong>m auch das Domkapitel beteiligt wur<strong>de</strong>. Außer<strong>de</strong>m hat er einen
geheimen Rat gegrün<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r ausschließlich <strong>de</strong>m Kurfürsten verantwortlich war und sich <strong>zu</strong>m eigentlichen zentralen Regierungsgremium entwickelte.<br />
Außenpolitisch war das 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt von wechseln<strong>de</strong>n Bündnissen geprägt. Dabei spielten nicht <strong>zu</strong>letzt die Höhe <strong>de</strong>r Subsidien eine Rolle. In wirtschaftlicher Hinsicht, blieb die<br />
Entwicklung begrenzt. Dagegen entfalteten die Kurfürsten eine prächtige Hofhaltung. In die Zeit von Joseph Clemens von Bayern fiel im Rahmen <strong>de</strong>s pfälzischen Krieges die Zerstörung<br />
von Bonn. Er hat 1701 die Seiten gewechselt und sich mit Ludwig XVI. verbün<strong>de</strong>t. Vom Reich geächtet, musste er ins französische Exil gehen. Nach <strong>de</strong>r Rückkehr 1715 hat er <strong>de</strong>n<br />
Wie<strong>de</strong>raufbau Bonn und <strong>de</strong>r kurfürstlichen Schlösser planen lassen, erlebte aber nicht mehr <strong>de</strong>ren Vollendung. Sein Nachfolger Clemens August I. von Bayern hat oftmals die Bündnisse<br />
gewechselt. Er hat prachtvolle Schlösser und Gärten errichten lassen. Insgesamt aber hat er die Einkünfte auch für eine übertriebene Hofhaltung, für Jag<strong>de</strong>n verschwen<strong>de</strong>t. Mit<br />
Maximilian Friedrich von Königsegg-Rothenfels en<strong>de</strong>te die Zeit <strong>de</strong>r bayerischen Prinzen als Kurfürsten. Der neue Kurfürst hat eine energische Sparpolitik betrieben und 1777 die<br />
Aka<strong>de</strong>mie Bonn, seit 1784 Universität, gegrün<strong>de</strong>t. Unter Maximilian Franz von Österreich kam es im Sinn <strong>de</strong>r katholischen Aufklärung <strong>zu</strong> zahlreichen Reformen in fast allen<br />
Politikbereichen aber insbeson<strong>de</strong>re im Bildungswesen. Die Universität in Bonn wur<strong>de</strong> ausgebaut, die Schulbildung und Lehrerausbildung verbessert.[9]<br />
Das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Kurstaats<br />
Im Frie<strong>de</strong>n von Lunéville wur<strong>de</strong>n 1801 alle linksrheinischen Gebiete Kurkölns an das napoleonische Frankreich abgetreten. Die rechtsrheinischen Territorien wur<strong>de</strong>n als Folge <strong>de</strong>s<br />
Reichs<strong>de</strong>putationshauptschlusses 1803 säkularisiert und auf die Herzogtümer Nassau und Hessen-Darmstadt sowie auf die Grafschaft Wied-Runkel aufgeteilt. Damit en<strong>de</strong>te die<br />
Geschichte Kurkölns drei Jahre bevor auch das Reich 1806 <strong>zu</strong> bestehen aufhörte.<br />
Bis auf die nassauischen Gebiete fiel das gesamte Territorium <strong>de</strong>s früheren Kurstaats auf <strong>de</strong>m Wiener Kongress 1815 an Preußen. Sie gehörten <strong>zu</strong>nächst <strong>zu</strong>r Provinz Jülich-Kleve-Berg<br />
und ab 1822 <strong>zu</strong>r Rheinprovinz. Das ehemalige Herzogtum Westfalen und das Vest Recklinghausen gehörten dagegen <strong>zu</strong>r Provinz Westfalen. Seit 1946 gehören die Gebiete <strong>de</strong>s<br />
Kurfürstentums Köln <strong>zu</strong>m Teil <strong>zu</strong>m Bun<strong>de</strong>sland Nordrhein-Westfalen und <strong>zu</strong>m Teil <strong>zu</strong> Rheinland-Pfalz.<br />
Institutionen<br />
Kurfürst und Hofhaltung<br />
Bereits seit 1028 stand <strong>de</strong>m Erzbischof von Köln das Recht <strong>de</strong>r Königskrönung <strong>zu</strong>, da die damalige Krönungsstadt Aachen in seiner Erzdiözese lag. Seit 1031 war er <strong>zu</strong><strong>de</strong>m Erzkanzler<br />
für Reichsitalien. Zusammen mit <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n rheinischen Erzbischöfen von Trier und Mainz sowie mit <strong>de</strong>m Pfalzgrafen bei Rhein, <strong>de</strong>m Markgrafen von Bran<strong>de</strong>nburg, <strong>de</strong>m Herzog von<br />
Sachsen und <strong>de</strong>m König von Böhmen bil<strong>de</strong>ten sie das ursprünglich siebenköpfige Kurfürstenkollegium. Dieses hatte seit <strong>de</strong>m 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt das alleinige Recht <strong>zu</strong>r Wahl <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen<br />
Königs.<br />
Der Kölner Erzbischof wur<strong>de</strong> vom Domkapitel gewählt. Zur Erlangung aller bischöflichen und weltlichen Rechte bedurfte es aber <strong>de</strong>r päpstlichen Bestätigung und <strong>de</strong>r Belehnung mit<br />
<strong>de</strong>n weltlichen Regalien durch <strong>de</strong>n Kaiser. Insbeson<strong>de</strong>re seit <strong>de</strong>r Gol<strong>de</strong>nen Bulle Karl IV. von 1365 hatten die Kurfürsten be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Vorrechte gegenüber an<strong>de</strong>ren Fürsten. Darunter war<br />
auch die uneingeschränkte Gerichtshoheit. Mit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s dreißigjährigen Krieges hatten sie als Reichsfürsten das Recht äußere Bündnisse ein<strong>zu</strong>gehen, auch ihre inneren<br />
Unabhängigkeit vom Kaiser wur<strong>de</strong> noch einmal gestärkt. Im Inneren wur<strong>de</strong>n die lan<strong>de</strong>sherrlichen Rechte jedoch erheblich von <strong>de</strong>n Stän<strong>de</strong>n, insbeson<strong>de</strong>re vom Domkapitel,<br />
eingeschränkt. Bezeichnend war, dass <strong>de</strong>r Kurfürst für die Einberufung eines Landtages <strong>de</strong>r Zustimmung <strong>de</strong>s Domkapitels bedurfte, umgekehrt konnte dieses notfalls ohne Zustimmung<br />
<strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sherren eine solche Versammlung einberufen. Trotz Verbots durch Innozenz XII. im Jahr 1695 hatten die Erzbischöfe bei ihrer Wahl <strong>de</strong>m Domkapitel in einer Wahlkapitulation<br />
<strong>de</strong>ssen alten Vorrechten garantieren müssen. [10] Den Stän<strong>de</strong>n insgesamt musste er durch die Beschwörung <strong>de</strong>r Erblan<strong>de</strong>svereinigung von 1463 beziehungsweise 1590 Mitsprache in<br />
zentralen Bereichen wie <strong>de</strong>r Erklärung von Kriegen o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Erhebung von Steuern einräumen. Selbst grundlegen<strong>de</strong> Verän<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Religion etwa die Einführung <strong>de</strong>r Reformation<br />
bedurfte <strong>de</strong>r Zustimmung <strong>de</strong>r Stän<strong>de</strong>.<br />
Trotz dieser faktischen Machtbeschränkung existierte in <strong>de</strong>r frühen Neuzeit ein großer Hofstaat, <strong>de</strong>r unter Joseph Clemens von Bayern nach <strong>de</strong>m Vorbild absolutistischer Staaten<br />
insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>s französischen Hofes in Versailles umgestaltet wur<strong>de</strong>. Zur Zeit von Clemens August I. von Bayern erhielt er seine bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Kurstaates weitgehend gültige<br />
Gestalt. Gleichzeitig wur<strong>de</strong> die Hofhaltung von <strong>de</strong>n Regierungsbehör<strong>de</strong>n stärker geschie<strong>de</strong>n. An <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>s Hofes stand <strong>de</strong>r Obrist-Landhofmeister. Unter ihm gab es mehrere Stäbe.<br />
Die alten aus <strong>de</strong>m Mittelalter stammen<strong>de</strong>n Hofämter hatten nur noch repräsentative Funktionen und waren in hocha<strong>de</strong>ligen Familien erblich. Der Bonner Hof war im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>r
wohl prachtvollste in ganz West- und Nord<strong>de</strong>utschland. Allerdings stan<strong>de</strong>n die Kosten in keinem Verhältnis <strong>zu</strong>r wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit <strong>de</strong>s Staates. Die Kurfürsten waren<br />
nicht selten <strong>zu</strong>r Finanzierung auf Subsidien auswärtiger Mächte angewiesen, die dafür meist politische Gegenleistungen einfor<strong>de</strong>rn konnten. Unter Maximilian Friedrich von Königsegg-<br />
Rothenfels und Maximilian Franz von Österreich wur<strong>de</strong>n trotz <strong>de</strong>s Festhaltens an <strong>de</strong>r Grundstruktur <strong>de</strong>s Hofes zahlreiche Einsparungen vorgenommen.[11]<br />
Domkapitell<br />
Im Kurfürstentum Köln bil<strong>de</strong>te das Domkapitel als 1. Stand das höchste Leitungsgremium <strong>de</strong>s Bistums und <strong>de</strong>s Erzstifts unter <strong>de</strong>m Erzbischof. Nach <strong>de</strong>ssen Tod einen Nachfolger <strong>zu</strong><br />
wählen war seine wichtigste Befugnis. Bis <strong>zu</strong>m Ausgang <strong>de</strong>s Mittelalters bestand es aus 72 Mitglie<strong>de</strong>rn, von <strong>de</strong>nen jedoch nur 24 wahlberechtigte Kapitulare waren. Später sank ihre<br />
Zahl auf 24 wahlberechtigte Kanoniker und 24 Domizellare. Papst und Kaiser besaßen <strong>zu</strong><strong>de</strong>m noch ein Ehrenkanonikat, das ihnen eine Mitsprache bei <strong>de</strong>r Neubeset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s<br />
Bischofsamtes ermöglichte.<br />
Das Kapitel teilte sich in 16 Domgrafen (o<strong>de</strong>r Domherren) und 8 Priesterherren auf. Nur Domgrafen durften die Ämter <strong>de</strong>s Dompropstes, <strong>de</strong>s Dom<strong>de</strong>chanten, <strong>de</strong>s Vize<strong>de</strong>chanten, <strong>de</strong>s<br />
Chorbischofs, <strong>de</strong>s Scholasters, <strong>de</strong>s Diakonus senior und <strong>de</strong>s Diakonus junior beklei<strong>de</strong>n. Um in das Domkapitel aufgenommen <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n, mussten sie 16 regieren<strong>de</strong> adlige Vorfahren<br />
väterlicher- und mütterlicherseits aufweisen und die Subdiakonenweihe empfangen haben. Lediglich <strong>de</strong>r Dom<strong>de</strong>chant, <strong>de</strong>r das Kapitel leitete, musste die Priesterweihe erhalten haben.<br />
Da die meisten Domherren mehrere Kanonikate in unterschiedlichen Bistümern besaßen, residierten nur wenige tatsächlich in Köln. Im 17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt kamen <strong>zu</strong><strong>de</strong>m viele<br />
Domgrafen aus schwäbischen Familien, so dass das Kapitel von Landfrem<strong>de</strong>n beherrscht wur<strong>de</strong>.<br />
Seit 1218/19 stieg die Zahl <strong>de</strong>r ebenfalls wahlberechtigten Priesterherren auf 7, später auf 8 an. Neben <strong>de</strong>r Priesterweihe mussten sie spätestens seit <strong>de</strong>m 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt einen<br />
aka<strong>de</strong>mischen Grad in Theologie o<strong>de</strong>r Jurispru<strong>de</strong>nz vorweisen. Da sie für gewöhnlich alle an <strong>de</strong>r Domkirche residierten, waren sie <strong>de</strong>n Domgrafen an Zahl meist überlegen, so dass sie<br />
das eigentliche politische Willenszentrum <strong>de</strong>s Kapitels darstellten. Im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Domgrafen entstammten die Priesterherren stets <strong>de</strong>r Stadt Köln o<strong>de</strong>r ihrem Umland. Da mehrere<br />
Kanonikate <strong>de</strong>r Universität Köln inkorporiert wor<strong>de</strong>n waren, vergab sie diese <strong>zu</strong>r Besoldung an ihre Professoren.<br />
Das Domkapitel ergänzte sich im Wesentlichen durch Kooptation. Der Erzbischof hatte auf die Zusammenset<strong>zu</strong>ng kaum Einfluss. Bei allen Spannungen zwischen Kurfürst und<br />
Domkapitel beklei<strong>de</strong>ten die Domherren oft auch wichtige weltliche Ämter im Kurstaat.[10]<br />
Nach <strong>de</strong>r Säkularisation wur<strong>de</strong> das Domkapitel auf 16 Stellen und zwei Dignitäten - Dompropst und Dom<strong>de</strong>chant - beschränkt. Von diesen sind bis heute vier als nichtresidieren<strong>de</strong><br />
Domherren an <strong>de</strong>r Domkirche tätig.<br />
Premierminister<br />
Der "Premierminister" o<strong>de</strong>r "Erste Minister" war <strong>de</strong>r leiten<strong>de</strong> Minister Kurkölns. Das Amt wur<strong>de</strong> im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt geschaffen, da sich die Erzbischöfe meist nicht selbst um die Politik<br />
kümmerten. So war <strong>de</strong>r Premierminister <strong>de</strong>r eigentliche Regent. Erst unter <strong>de</strong>m <strong>de</strong>m letzten Kurfürsten, Maximilian Franz von Österreich, <strong>de</strong>r selbst die Regierungsgeschäfte wahrnahm,<br />
war das Amt nur noch ein nominelles. Der Premierminister wur<strong>de</strong> vom Erzbischof frei eingesetzt und beklei<strong>de</strong>te <strong>zu</strong>meist auch das oberste Amt am Hof, das <strong>de</strong>s Obristlandhofmeisters.<br />
• 1650–1682: Franz Egon Graf von Fürstenberg<br />
• 1682–1688: Wilhelm Egon Graf von Fürstenberg<br />
• 1688–1719: Johann Friedrich Karg von Bebenburg<br />
• 1723–1733: Ferdinand von Plettenberg<br />
• 1733–1750: Ferdinand Leopold von Hohenzollern-Sigmaringen<br />
• 1751–1755: Hermann Werner von <strong>de</strong>r Asseburg<br />
• 1756–1766: Franz Christoph Anton von Hohenzollern-Sigmaringen<br />
• 1766–1784: Caspar Anton von Bel<strong>de</strong>rbusch<br />
• 1784–1785: Carl Otto Ludwig Theodat von und <strong>zu</strong> Gymnich
Räte<br />
Wie in an<strong>de</strong>ren Län<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s Reiches, so oblag auch in Kurköln die eigentliche Lan<strong>de</strong>sverwaltung in <strong>de</strong>r frühen Neuzeit verschie<strong>de</strong>nen Rats-Kollegien. Da ihre Aufgabenverteilung nie<br />
ein<strong>de</strong>utig von einan<strong>de</strong>r abgegrenzt wur<strong>de</strong>, kam es immer wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> Überschneidungen und Streitigkeiten zwischen <strong>de</strong>n einzelnen Gremien. Deren Mitglie<strong>de</strong>r, die Räte, waren heutigen<br />
Staatssekretären vergleichbar. Man unterschied dabei zwischen wirklichen Räten, die sich tatsächlich mit <strong>de</strong>r Politik <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s befassten und <strong>de</strong>n "normalen" Räten, welche ihren Titel<br />
ehrenhalber trugen und oftmals gegen Bezahlung erhalten hatten. Die verschie<strong>de</strong>nen Kollegien waren:<br />
• das Geheime-Rats-Kollegium, das von einem Geheimen Ratskanzler und bei <strong>de</strong>ssen Abwesenheit vom ältesten Geheimrat geleitet wur<strong>de</strong>;<br />
• das Geistliche-Rats-Kollegium mit einer eigene Kanzlei, das von einem Präsi<strong>de</strong>nten geleitet wur<strong>de</strong> und <strong>de</strong>ssen Verwaltung ein Direktor vorstand;<br />
• das Hofrats-Kollegium, das aus zwei Verwaltungssträngen bestand, <strong>de</strong>nen bei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Hofratspräsi<strong>de</strong>nt vorstand. Während die Hofräte und die Hofratskanzlei durch einen<br />
Direktor geleitet wur<strong>de</strong>n, stand die Leitung <strong>de</strong>s Hohen Weltlichen Schöffengerichts <strong>zu</strong> Bonn <strong>de</strong>m dortigen Obervogt <strong>zu</strong>;<br />
• das Hofkammer-Rats-Kollegium, das ebenfalls zwei Stränge umfasste, <strong>de</strong>nen bei<strong>de</strong>n ein Präsi<strong>de</strong>nt vorstand. Während Hofkammerräte und Hofkammerkanzlei <strong>zu</strong>r <strong>de</strong>n Direktor<br />
<strong>de</strong>r Hofkammer geleitet wur<strong>de</strong>n, unterstand die "Münze" <strong>de</strong>m Landrentmeister;<br />
• das Kriegs-Rats-Kollegium. Unter einem Präsi<strong>de</strong>nten stehend, wur<strong>de</strong>n Kriegsräte und Kriegsratskanzlei durch einen Direktor geleitet.<br />
Der Landtag<br />
Bis <strong>zu</strong>r Auflösung <strong>de</strong>s Kurstaates bil<strong>de</strong>ten die 3 jährlichen Landtage im Erzstift, <strong>de</strong>m Herzogtum Westphalen und <strong>de</strong>m Vest Recklinghausen die Stän<strong>de</strong>vertretung. Sie waren von einan<strong>de</strong>r<br />
unabhängig und tagten jeweils für sich. Der wichtigste von ihnen war <strong>de</strong>r Landtag <strong>de</strong>s Erzstiftes, welcher für gewöhnlich im Bonner Minoritenkloster tagte. Er bewilligte <strong>de</strong>m Kurfürsten<br />
die Erhebung <strong>de</strong>r jeweiligen Steuern und wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Landstän<strong>de</strong>n von Westfalen und Recklinghausen als passiven Zuhörern besucht.<br />
Im ausgehen<strong>de</strong>n Mittelalter bil<strong>de</strong>ten sich im eigentlichen Erzstift vier Landstän<strong>de</strong>: Domkapitel, Grafen, Ritter und Städte.<br />
1. Stand: Das Domkapitel, welches 4 seiner Mitglie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Landtag entsandte.<br />
2. Stand: Die Inhaber eines Rittersitzes, welche seit wenigstens vier Generationen <strong>de</strong>m reichsunmittelbaren A<strong>de</strong>l angehörten. Sie wur<strong>de</strong>n auch Grafenstand genannt.<br />
3. Stand: Die Inhaber wenigstens einer <strong>de</strong>r 227 Rittersitze <strong>de</strong>s Erzstifts, wenn sie <strong>zu</strong>gleich ihren A<strong>de</strong>l nachweisen konnten. Der Besitz eines Rittersitzes ohne A<strong>de</strong>lsnachweis alleine<br />
reichte nicht aus.<br />
4. Stand: Er bestand, abgesehen von Deutz und Alpen, aus allen 18 Städten <strong>de</strong>s Erzstiftes. In ihm stellte An<strong>de</strong>rnach das Direktorium für das Oberstift und Neuss das Direktorium<br />
für das Nie<strong>de</strong>rstift. Während die Direktorialstädte drei Abgeordnete entsandten, konnten die Unter-Direktorialstädte Ahrweiler, Linz am Rhein, Rheinberg und Kempen lediglich<br />
zwei entsen<strong>de</strong>n.<br />
5. Grundsätzlich fand <strong>de</strong>r Landtag einmal im Jahr statt, <strong>zu</strong>meist in <strong>de</strong>r ersten Hälfte eines Jahres. Vor seiner Einberufung musste <strong>de</strong>r Kurfürst die Zustimmung <strong>de</strong>s Domkapitels<br />
einholen, was gewöhnlich vier Wochen vor <strong>de</strong>m Tagungstermin geschah.<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>r Tagung hörten alle Teilnehmer die Messe <strong>zu</strong>m Heiligen Geist. Mit <strong>de</strong>r anschließen<strong>de</strong>n Verlesung <strong>de</strong>r Landtagsproposition wur<strong>de</strong>n die Sit<strong>zu</strong>ngen formell eröffnet. Danach<br />
begaben sich die Teilnehmer, nach Stän<strong>de</strong>n getrennt, in ihre Sit<strong>zu</strong>ngszimmer.<br />
Während <strong>de</strong>r ersten Woche verhan<strong>de</strong>lte man vorrangig die Gravamina. Hierbei han<strong>de</strong>lte es sich überwiegend um Beschwer<strong>de</strong>n über Verlet<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Rechte <strong>de</strong>r Landstän<strong>de</strong> durch die<br />
kurfürstlichen Regierungsorgane. Zur zweiten Phase, <strong>de</strong>r Geldbewilligung, ging man erst über wenn <strong>de</strong>r Kurfürst Resolutionen erlassen hatte, die <strong>de</strong>n For<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Landstän<strong>de</strong><br />
entsprachen. Dies geschah nicht bei allen Stän<strong>de</strong>n gleichzeitig, da sie unabhängig voneinan<strong>de</strong>r berieten. Nach <strong>de</strong>r Frage <strong>de</strong>r Geldbewilligung behan<strong>de</strong>lte man Eingaben einzelner<br />
Untertanen.<br />
Bei <strong>de</strong>n Abstimmungen unter Domherren, Grafen und Rittern galt das Mehrheitsprinzip, bei <strong>de</strong>n Städten dagegen gab es erhebliche Unterschie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Gewichtung. Hier zählte die<br />
Stimme einer Direktorialstadt alleine schon soviel wie die Stimmen aller Unterstädte <strong>zu</strong>sammen.
Die Meinungsbildung <strong>de</strong>s Landtags erfolgte grundsätzlich von <strong>de</strong>n nie<strong>de</strong>ren <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n höheren Stän<strong>de</strong>n, also von <strong>de</strong>n Städten über die Ritter und Grafen bis <strong>zu</strong>m Domkapitel. Zunächst<br />
mussten sich die Städten mit <strong>de</strong>n Rittern, dann die Ritter mit <strong>de</strong>n Grafen und in einem letzten Schritt die Grafen mit <strong>de</strong>n Domherren auf eine gemeinsame Haltung einigen. Wich ein<br />
höherer Stand mit seiner Haltung in einer bestimmten Frage von <strong>de</strong>n vor ihm abstimmen<strong>de</strong>n Stän<strong>de</strong> ab, so mussten diese erneut verhan<strong>de</strong>ln. Das gesamte Proce<strong>de</strong>re begann noch einmal<br />
von neuem. Kam wie<strong>de</strong>r keine Einigung <strong>zu</strong>stan<strong>de</strong>, so teilte man <strong>de</strong>m nächsthöheren Stand bzw. <strong>de</strong>r kurfürstlichen Regierung die voneinan<strong>de</strong>r abweichen<strong>de</strong>n Voten mit.<br />
Das umständliche Verfahren stärkte die höheren Stän<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>r Durchset<strong>zu</strong>ng ihrer Interessen. Gleichzeitig sollte es aber gewährleisten, dass <strong>de</strong>r jeweils höhere Stand in seine<br />
Entscheidungen automatisch die <strong>de</strong>r unteren Stän<strong>de</strong> mit einfließen ließ. Dem lag die allgemein verbreitete staatsrechtliche Vorstellung <strong>zu</strong> Grun<strong>de</strong>, dass das Land <strong>de</strong>m Lan<strong>de</strong>sherrn<br />
"unavoce", also mit einer Stimme, gegenüber treten müsse.<br />
Während die Kurfürsten im Kerngebiet ihres Territoriums mit einem gewissen Erfolg die Mitbestimmungsrechte <strong>de</strong>r Landtage <strong>zu</strong>gunsten einer absolutistischen Herrschaftsauffassung <strong>zu</strong><br />
beschnei<strong>de</strong>n wussten, gelang ihnen dies in <strong>de</strong>n Nebenlän<strong>de</strong>rn insbeson<strong>de</strong>re im Herzogtum Westfalen nur in einem geringen Maße. Dort bewahrte sich <strong>de</strong>r Landtag bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s alten<br />
Reiches erheblichen Einfluss.<br />
Territorialverwaltung<br />
Ämter<br />
Ein Amt war ein fest umschriebener Bereich. Hier hatte <strong>de</strong>r Erzbischof die Hohe und Nie<strong>de</strong>re Gerichtsbarkeit. Von diesen Bereichen waren die in ihnen gelegenen Unterherrschaften und<br />
Herrlichkeiten ausgenommen. Die Größe <strong>de</strong>r Ämter war relativ unterschiedlich. Kleine Ämter bestan<strong>de</strong>n oft nur aus einer Stadt mit ihrem unmittelbaren Umland (Meckenheim, Rhens),<br />
einer Stadt mit einigen Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Umlan<strong>de</strong>s (Rheinbach, Zülpich, Deutz, Zons) o<strong>de</strong>r auch mehreren Landgemein<strong>de</strong>n (Go<strong>de</strong>sberg, Mehlem, Wolkenburg, Zeltingen, Alken,<br />
Königsdorf). Oftmals waren in einem Amt nicht alle Verwaltungsämter besetzt und manchmal noch nicht einmal das <strong>de</strong>s Amtmannes. Jener war oftmals <strong>zu</strong>gleich Amtmann eines<br />
an<strong>de</strong>ren, benachbarten Amtes. Es gab aber auch große Ämter wie Bonn, Altenwied, Kempen-Oedt, die stets einen vollständigen Beamtenstab besaßen.<br />
Für gewöhnlich stand an <strong>de</strong>r Spitze eines Amtes <strong>de</strong>r Amtmann, <strong>de</strong>r je<strong>de</strong>rzeit ablösbar war und bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Kurstaates stets aus <strong>de</strong>m Ministeriala<strong>de</strong>l genommen wur<strong>de</strong>. Oftmals<br />
schon <strong>zu</strong> frühen Zeiten in ihren Amtsgeschäften von Unteramtmänner vertreten, wur<strong>de</strong>n seit <strong>de</strong>m 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt an ihre Stelle reguläre Amtsverwalter berufen. Hierbei behielten die<br />
Amtmänner jedoch <strong>de</strong>n Titel eines solchen. Zu <strong>de</strong>n Aufgaben <strong>de</strong>s Amtmannes gehörte <strong>de</strong>r militärische Schutz <strong>de</strong>s ihm anvertrauten Amtes, <strong>de</strong>r Bewohner und <strong>de</strong>r hoheitlichen und<br />
nutzbaren Rechte <strong>de</strong>s Erzbischofs nach außen. Auch Rechtsfrie<strong>de</strong>n, Sicherheit und Ordnung nach innen waren ihm unterstellt. Mit einem festen Amtssitz versehen, erhielt für die Kosten<br />
seiner Amtsführung regelmäßige Einkünfte, die für gewöhnlich <strong>de</strong>n im Amt anfallen<strong>de</strong>n Einnahmen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sherren entnommen wur<strong>de</strong>n. In späteren Zeiten erhielt er auch ein festes<br />
Gehalt. Saß er im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt noch <strong>de</strong>m Gericht vor, so wur<strong>de</strong> das Amt eines Richters doch bald personell getrennt und nun durch die lan<strong>de</strong>sherrliche Richter, Schultheißen und<br />
Vögte versehen, welche jedoch häufig auch <strong>zu</strong>gleich Amtsverwalter o<strong>de</strong>r Kellner waren.<br />
Seit <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts fin<strong>de</strong>n wir auch das Amt <strong>de</strong>s Kellners. War er im Ursprung nur für <strong>de</strong>n Unterhalt <strong>de</strong>s Personals auf <strong>de</strong>n Amtsburgen <strong>zu</strong>ständig, so waren doch bald<br />
alle lan<strong>de</strong>sherrlichen Einkünfte seine Zuständigkeit. Im Ursprung auch oft durch schriftkundige Geistliche verwaltet, gelangte die tatsächliche Amtsführung seit <strong>de</strong>m 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
häufig in die Hän<strong>de</strong> eines treuhändlichen Verwalters.<br />
Unterherrschaften<br />
In <strong>de</strong>n Unterherrschaften wur<strong>de</strong> die Hohe und Nie<strong>de</strong>re Gerichtsbarkeit häufig durch einen Adligen, <strong>de</strong>r für gewöhnlich nicht in an<strong>de</strong>ren Territorien belehnt war, ausgeübt. Die<br />
Unterherrschaft war keinem Amt unterworfen, son<strong>de</strong>rn bil<strong>de</strong>te ein eigenständiges Lehnsgebil<strong>de</strong>. So konnte <strong>de</strong>r Erzbischof we<strong>de</strong>r Be<strong>de</strong> noch Schatz als lan<strong>de</strong>sherrliche Steuern einfor<strong>de</strong>rn<br />
und lediglich eine lockere Schutzfunktion geltend machen. Auch ständige juristische Kleinkriege führten nicht <strong>zu</strong>m erhofften Ziel einer vollen Lan<strong>de</strong>shoheit <strong>de</strong>s "Unterherren".<br />
Entsprechend griffen die lan<strong>de</strong>sherrlichen Verordnungen <strong>de</strong>s Erzbischofs, seine Edikte bezüglich Steuererhebungen, Jagdausübung, Gerichts-, Rechts-, Brüchten-, Polizei- und<br />
Taxenverordnungen auch hier.<br />
Herrlichkeiten
Bei <strong>de</strong>n Herrlichkeiten han<strong>de</strong>lte es sich um die 227 Rittersitze mit ihren Appertinenzien, <strong>de</strong>ren Inhaber <strong>zu</strong>meist die Nie<strong>de</strong>rgerichtsbarkeit besaßen. Sie waren von <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>, <strong>de</strong>m Schatz<br />
und <strong>de</strong>n Dienstpflichten gegenüber <strong>de</strong>m Erzbischof als Lan<strong>de</strong>sherrn ausgenommen.<br />
Städte<br />
Die Städte Kurkölns bil<strong>de</strong>ten Gebietskörperschaften, <strong>de</strong>nen durch Privilegien ein Recht auf eine weitgehend selbständige Erledigung ihrer Angelegenheiten <strong>zu</strong>gestan<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>. In <strong>de</strong>r<br />
Erblan<strong>de</strong>svereinigung von 1463 wur<strong>de</strong> als Städte genannt: Bonn, An<strong>de</strong>rnach, Neuss, Ahrweiler, Linz, Rheinberg, Kaiserswerth, Zons, Uerdingen, Kempen, Rheinbach, Zülpich und<br />
Lechenich.[2]<br />
Wappen<br />
Erzbistum und Kurstaat Köln hatten folgen<strong>de</strong>s Wappen: in Silber ein (häufig gestän<strong>de</strong>rtes) schwarzes Balkenkreuz. Es erscheint auch heute noch in einer Vielzahl aktueller Kreis- und<br />
Gemein<strong>de</strong>wappen auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>s ehemaligen Kurstaats und seiner Exklaven Westfalen und Vest Recklinghausen.<br />
Literatur<br />
• Kurköln (Lan<strong>de</strong>sarchiv und Gerichte), Herrschaften, Nie<strong>de</strong>rrheinisch-Westfälischer Kreis, Ergän<strong>zu</strong>ngen <strong>zu</strong> Band 1 (= Das Hauptstaatsarchiv Düsseldorf und seine Bestän<strong>de</strong>,<br />
Band 2), bearb. von Friedrich Wilhelm Oediger, Siegburg 2. Aufl. 1994 [1970].<br />
• Kurköln. Land unter <strong>de</strong>m Krummstab: Essays und Dokumente (= Veröffentlichungen <strong>de</strong>r staatlichen Archive <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Nordrhein-Westfalen, Reihe C: Quellen und<br />
Forschungen, Band 22; Schriftenreihe <strong>de</strong>s Kreises Viersen 35a), hrsg. von NRW-Hauptstaatsarchiv Düsseldorf / Kreisarchiv Wesel / Arbeitskreis nie<strong>de</strong>rrheinischer Archivare,<br />
Red. Klaus Flink, Kevelaer 1985.<br />
• Burkhardt, Stefan, Mit Stab und Schwert. Bil<strong>de</strong>r, Träger und Funktionen erzbischöflicher Herrschaft <strong>zu</strong>r Zeit Kaiser Friedrich Barbarossas. Die Erzbistümer Köln und Mainz im<br />
Vergleich (= Mittelalter-Forschungen 22), Ostfil<strong>de</strong>rn 2008.<br />
• Georg Droege: Verfassung und Wirtschaft in Kurköln unter Dietrich von Moers (1414-1463) (= Rheinisches Archiv 50), Bonn 1957.<br />
• Eduard Hegel: Das Erzbistum Köln zwischen Barock und Aufklärung. Vom Pfälzischen Krieg bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r französischen Zeit 1688–1814 (= Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums<br />
Köln 4), Köln 1979.<br />
• Eduard Hegel: Das Erzbistum Köln. Zwischen <strong>de</strong>r Restauration <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts und <strong>de</strong>r Restauration <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts. 1815–1962 (= Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln<br />
5), Köln 1987.<br />
• Wilhelm Janssen: Das Erzbistum Köln im späten Mittelalter. 1191–1515 (= Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln 2), 2 Halbbän<strong>de</strong>, Köln 1995/2003.<br />
• Hansgeorg Molitor: Das Erzbistum Köln im Zeitalter <strong>de</strong>r Glaubenskämpfe. 1515–1688 (= Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln 3), Köln 2008.<br />
• Wilhelm Neuss / Friedrich Wilhelm Oediger: Das Bistum Köln von <strong>de</strong>n Anfängen bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts (= Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln 1), Köln 1964 [1991].<br />
• Sabine Picot: Kurkölnische Territorialpolitik am Rhein unter Friedrich von Saarwer<strong>de</strong>n (1370-1414) (= Rheinisches Archiv 99), Bonn 1977.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ a b Köln I/1 In: Theologische Realenzyklopädie. Bd.19. Berlin, New York, 1990 S. 290<br />
2. ↑ a b Monika Storm: Das Herzogtum Westfalen, das Vest Recklinghausen und das rheinische Erzstift Köln. Kurköln in seinen Teilen. In: Harm Klueting (Hrsg.): Das Herzogtum<br />
Westfalen. Bd. 1. Das kurkölnische Westfalen von <strong>de</strong>n Anfängen kölnischer Herrschaft im südlichen Westfalen bis <strong>zu</strong> Säkularisation 1803. Münster 2009, ISBN 978-3-402-<br />
12827-5, S. 359<br />
3. ↑ Monika Storm: Das Herzogtum Westfalen, das Vest Recklinghausen und das rheinische Erzstift Köln. Kurköln in seinen Teilen. In: Harm Klueting (Hrsg.): Das Herzogtum<br />
Westfalen. Bd. 1. Das kurkölnische Westfalen von <strong>de</strong>n Anfängen kölnischer Herrschaft im südlichen Westfalen bis <strong>zu</strong> Säkularisation 1803. Münster 2009, ISBN 978-3-402-<br />
12827-5, S. 359 f.
4. ↑ a b Monika Storm: Das Herzogtum Westfalen, das Vest Recklinghausen und das rheinische Erzstift Köln. Kurköln in seinen Teilen. In: Harm Klueting (Hrsg.): Das Herzogtum<br />
Westfalen. Bd. 1. Das kurkölnische Westfalen von <strong>de</strong>n Anfängen kölnischer Herrschaft im südlichen Westfalen bis <strong>zu</strong> Säkularisation 1803. Münster 2009, ISBN 978-3-402-<br />
12827-5, S. 360<br />
5. ↑ Monika Storm: Das Herzogtum Westfalen, das Vest Recklinghausen und das rheinische Erzstift Köln. Kurköln in seinen Teilen. In: Harm Klueting (Hrsg.): Das Herzogtum<br />
Westfalen. Bd. 1. Das kurkölnische Westfalen von <strong>de</strong>n Anfängen kölnischer Herrschaft im südlichen Westfalen bis <strong>zu</strong> Säkularisation 1803. Münster 2009, ISBN 978-3-402-<br />
12827-5, S.350−352<br />
6. ↑ a b Hans Georg Molitor: Köln I/2 In: Theologische Realenzyklopädie. Bd.19. Berlin/New York, 1990 S. 297<br />
7. ↑ Hans Georg Molitor: Köln I/2 In: Theologische Realenzyklopädie. Band 19, Berlin/New York 1990, S. 298<br />
8. ↑ Gerhard Schormann: Der Krieg gegen die Hexen. Das Ausrottungsprogramm <strong>de</strong>r Kurfürsten von Köln. Göttingen, 1991.<br />
9. ↑ Hans Georg Molitor: Köln I/2 In: Theologische Realenzyklopädie. Band 19, Berlin/New York 1990, S. 298 f.<br />
10.↑ a b Rudolf Lill, Erwin Sandmann: Verfassung und Verwaltung <strong>de</strong>s Kurfürstentums und Erzbistums Köln im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt. In: Kurfürst Clemens August. Lan<strong>de</strong>sherr und<br />
Mäzen <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts. DuMont Schauberg, Köln 1961, S. 47, (Ausstellungskatalog, Schloss Augustusburg <strong>zu</strong> Brühl)<br />
11.↑ Rudolf Lill, Erwin Sandmann: Verfassung und Verwaltung <strong>de</strong>s Kurfürstentums und Erzbistums Köln im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt. In: Kurfürst Clemens August. Lan<strong>de</strong>sherr und Mäzen<br />
<strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts. DuMont Schauberg, Köln 1961, S. 48-50, (Ausstellungskatalog, Schloss Augustusburg <strong>zu</strong> Brühl)<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Kölner Domkapitel<br />
Das Hohe Dom-, Kathedral- und Metropolitankapitel <strong>zu</strong> Köln ist ein Kollegium von Geistlichen, das <strong>de</strong>n Bischof von Köln bei <strong>de</strong>r Leitung <strong>de</strong>r Diözese unterstützt.<br />
Ihm obliegt die Feier <strong>de</strong>r Liturgie im Dom; <strong>zu</strong><strong>de</strong>m ist es als eigenständige juristische Person unter <strong>de</strong>m Bischof mit <strong>de</strong>r Verwaltung <strong>de</strong>r Diözese betraut.<br />
Geschichte<br />
Die Ursprünge <strong>de</strong>s Kölner Domkapitels liegen weitgehend im Dunkeln. Es muss bereits vor 816 als festes Gremium bestan<strong>de</strong>n haben, da es in diesem Jahr eine Institutio clericorum<br />
anfertigen ließ. Demnach lebten die Kleriker <strong>de</strong>s Domkapitels nach <strong>de</strong>r Kanonikerregel <strong>de</strong>s Chro<strong>de</strong>gang von Metz.<br />
Die klösterliche Gemeinschaft besaß einen gemeinsamen Schlafsaal (Dormitorium), ein Refektorium (Speisesaal) und eine gemeinsame Bibliothek.<br />
Innerhalb <strong>de</strong>r Dom-Immunität, <strong>de</strong>m Lebensraum <strong>de</strong>r Kanoniker, gab es auch ein Hospital, einen Friedhof und zahlreiche Kapellen.<br />
Dem Betrieb <strong>de</strong>s "Domklosters" gehörten in <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 9. Jahrhun<strong>de</strong>rts über 100 Personen an, die Handwerker nicht mitgezählt. Alleine für die Domkirche gab es 23 Bedienstete, im<br />
Stift kamen da<strong>zu</strong> zwei Kellermeister, ein Küchenmeister, vier Köche, ein Bäcker, zwei Bedienstete für die Klei<strong>de</strong>rkammer, zwei Schlafsaalwärter (Sie machten <strong>de</strong>n jungen Kanonikern
die Betten), vier Türsteher und zahlreiche an<strong>de</strong>re. Selbst im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt gab es noch, obwohl <strong>de</strong>r Haushalt stark verkleinert war, 15 Laienpfrün<strong>de</strong>n.<br />
Noch 1244/46 gab es Ansätze eines gemeinsamen Lebens: in diesem Jahr wur<strong>de</strong> die Tischordnung geregelt und die 72 Kanoniker nach Rängen geordnet. So gab es unter ihnen 24<br />
Praelati in ecclesia und 20 einfache Pfrün<strong>de</strong>n. Aus ihnen entwickelten sich später die 24 Domherren und die 20 Domizellaren. Es gab keine Beför<strong>de</strong>rungen; man rückte mit <strong>de</strong>m To<strong>de</strong><br />
eines älteren auf.<br />
Je ein Kanonikat war <strong>de</strong>m Papst und <strong>de</strong>m Kaiser vorbehalten.<br />
1212/18 wur<strong>de</strong>n acht Priesterkanonikate eingerichtet; später reduzierte man ihre Zahl auf sieben. Bei ihnen han<strong>de</strong>lt es sich um die sogenannten Kardinalpriester, die seit 1049/52 allein<br />
das Recht hatten, an <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Hochaltären <strong>de</strong>r Domkirche mit Dalmatik, Sandalen und Mitra die Messe <strong>zu</strong> feiern.<br />
Bereits um das Jahr 1000 waren die Kanonikate <strong>de</strong>s Kölner Domes alleine <strong>de</strong>m Hocha<strong>de</strong>l <strong>de</strong>s Reiches vorbehalten. Lediglich die Priesterkanonikate konnten mit "Bürgerlichen" besetzt<br />
wer<strong>de</strong>n.<br />
Spätestens 1450 stand die endgültige Verfassung <strong>de</strong>s Kölner Domkapitels fest.<br />
Es bestand nun aus 24 Kapitularen und 20 (später 24) Anwärtern. Von <strong>de</strong>n Kapitularen mussten 16 <strong>de</strong>m Hocha<strong>de</strong>l <strong>de</strong>s Reiches angehören, weshalb sie auch Domgrafen genannt wur<strong>de</strong>n.<br />
Die acht weiteren Kanonikate sollten an Priester mit aka<strong>de</strong>mischem Grad vergeben wer<strong>de</strong>n. Die Domizellare, also Anwärter, gehörten ebenfalls <strong>de</strong>m Hocha<strong>de</strong>l an. Die Domgrafen<br />
mussten <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st die Weihe <strong>zu</strong>m Subdiakon besitzen. Höhere Weihen waren für sie nicht vorgeschrieben.<br />
Nach<strong>de</strong>m es 1346 <strong>zu</strong> einem Streit zwischen "Domgrafen" und Priesterherren gekommen war, in welchem die Domgrafen <strong>de</strong>n Priesterherren das volle Kanonikerdasein absprechen<br />
wollten, kam es innerhalb <strong>de</strong>s Kapitels <strong>zu</strong> keinem <strong>de</strong>rartigen Streit mehr und die Priesterherren wur<strong>de</strong>n als volle Kanoniker anerkannt.<br />
Wie in vielen Kanonikerstiften, so begann auch im Hochmittelalter die Emanzipation <strong>de</strong>r Kanoniker von <strong>de</strong>n Prälaten. In zwei Schritten, nämlich 1284 und 1373, wur<strong>de</strong> das Vermögen<br />
zwischen <strong>de</strong>m Dompropst und <strong>de</strong>m Domkapitel aufgeteilt.<br />
Wenn das Kapitel im Hochmittelalter die freie Wahl <strong>de</strong>s Dompropstes gegen <strong>de</strong>n Papst verteidigen konnte, so verlor sie doch zwei Kanonikate an die Universität Köln.<br />
Regelte das Kapitel seine Nachfolge im allgemeinen selbst, so wur<strong>de</strong>n die "Universitätspfrün<strong>de</strong>n", welche allesamt <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n acht Priesterkanonikaten gehörten, von <strong>de</strong>r Universität<br />
verliehen. Diese gelangten 1394 und 1437 an die Universität.<br />
Der Zerfall <strong>de</strong>r Vitacommunis (gemeinsames Leben) führte häufig <strong>zu</strong> einer mangelhaften Resi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>r Domherren, welche oftmals an verschie<strong>de</strong>nen Kirchen präbendiert waren (vgl.<br />
z.B. Oswald von Hohenzollern-Sigmaringen).<br />
Waren 1323 noch 15 Kanoniker (8 Domgrafen und 7 Priesterherren) anwesend, so sank ihre Zahl bis 1381 auf fünf Domgrafen und sieben Priesterherren. Letztere bil<strong>de</strong>ten in <strong>de</strong>n<br />
folgen<strong>de</strong>n Jahrhun<strong>de</strong>rten meist das stabilere Element <strong>de</strong>s Kapitels.<br />
Durch päpstliche Reservationen (ein mittelalterlicher Rechtsbegriff) ging <strong>de</strong>m Kapitel ab 1298/1304 das Bischofswahlrecht verloren, was es sich erst durch das Wiener Konkordat<br />
(1448/49) wie<strong>de</strong>r sichern konnte. Trotz<strong>de</strong>m konnte es im Koadjutorenvertrag von 1366 erstmals eine Wahlkapitulation vereinbaren. Dieser enthielt 15 Punkte, von <strong>de</strong>nen neun<br />
Vergünstigungen für das Kapitel und <strong>de</strong>n Klerus enthielt, sechs bezogen sich auf die Politik <strong>de</strong>s Erzstifts.<br />
Mit je<strong>de</strong>r Wahl wur<strong>de</strong> eine neue Wahlkapitulation erstellt. Doch alle hatten immer nur ein Ziel:die Vormachtstellung <strong>de</strong>s Domkapitels im Land <strong>zu</strong> stärken und <strong>de</strong>n Erzbischof an sich <strong>zu</strong><br />
bin<strong>de</strong>n.<br />
Hierbei ging es nicht nur um Eigeninteressen, son<strong>de</strong>rn auch um eine Absicherung <strong>de</strong>s Kur-Erzstifts.<br />
Nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Erzbischofs Dietrich II. von Moers (1463) setzte das Kapitel mit <strong>de</strong>n Landstän<strong>de</strong>n die Erblan<strong>de</strong>svereinigung durch, welche weitere Verpfändungen Kurkölnischer<br />
Territorien und eine <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Verschuldung <strong>de</strong>s Erzstifts verhin<strong>de</strong>rn sollte.
Gleichzeitig verpflichtete es sich, vor <strong>de</strong>r Wahl das Votum <strong>de</strong>r Landstän<strong>de</strong> ein<strong>zu</strong>holen.<br />
Als <strong>de</strong>ssen Nachfolger, Erzbischof Ruprecht von <strong>de</strong>r Pfalz, sich jedoch <strong>zu</strong>nehmend gegen die eigenen Landstän<strong>de</strong> wandte (er besetzte u. a. die an das Domkapitel verpfän<strong>de</strong>te Stadt<br />
Zons), verbün<strong>de</strong>te es sich mit diesen und versuchte seine Abset<strong>zu</strong>ng <strong>zu</strong> erwirken. Hierbei wandte es sich offen von seinem Erzbischof ab und wählte <strong>de</strong>n nachmaligen Erzbischof<br />
Hermann IV. von Hessen <strong>zu</strong>m Administrator. Diese (auch kriegerische) Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng ging unter <strong>de</strong>m Namen "Kölner Stiftsfeh<strong>de</strong>" in die Geschichte ein.<br />
Im Zeitalter <strong>de</strong>r Reformation bil<strong>de</strong>te das Domkapitel, gemeinsam mit <strong>de</strong>r Kölner Universität, <strong>de</strong>n Motor <strong>de</strong>s Katholizismus. Energisch trat es <strong>de</strong>n Protestantisierungs- und<br />
Reformierungsversuchen <strong>de</strong>r Erzbischöfe Hermann V. von Wied und Gebhard Truchseß von Waldburg entgegen. Beson<strong>de</strong>rs Johannes Gropper machte sich hierbei einen Namen.<br />
Kurz vor <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Erzbischofs Maximilian Heinrich von Bayern (1688) wählte das Domkapitel <strong>de</strong>n Dom<strong>de</strong>chanten und Bischof von Straßburg, Kardinal Wilhelm Egon von<br />
Fürstenberg, <strong>zu</strong>m Koadjutor <strong>de</strong>s Erzbischofs. Da <strong>de</strong>r Erzbischof jedoch noch vor <strong>de</strong>r Wahlbestätigung verstarb, kam es nun <strong>zu</strong>r Bischofswahl. Fürstenberg war ein enger Verbün<strong>de</strong>ter <strong>de</strong>s<br />
Königs von Frankreich und galt allgemein als "Reichsverräter".<br />
Obwohl Kaiser und Papst Joseph Clemens von Bayern als Kandidaten <strong>de</strong>n Vor<strong>zu</strong>g gaben und <strong>de</strong>r Kaiser bei einer Wahl Fürstenbergs die Verweigerung <strong>de</strong>r Regalien ankündigte, erlagen<br />
große Teile <strong>de</strong>s Kapitels <strong>de</strong>n französischen Bestechungsgel<strong>de</strong>rn und Druckmitteln (viele waren auch im französischen Straßburg bepfrün<strong>de</strong>t). Es kam <strong>zu</strong> einer Spaltung <strong>de</strong>s Kapitels und<br />
die Anhänger <strong>de</strong>s Kardinals schlossen sich mit diesem in Bonn ein. Als die Stadt militärisch genommen war, floh Fürstenberg mit <strong>de</strong>n Priesterherren Eschenbren<strong>de</strong>r und Quentel nach<br />
Straßburg. Die übrigen Domherren hatten sich bereits <strong>de</strong>m kaiserlichen Kandidaten angeschlossen. Die Einheit <strong>de</strong>s Kapitels war wie<strong>de</strong>r hergestellt.<br />
In seiner Endphase galt das alte Domkapitel als überaus konservativ und <strong>de</strong>r Aufklärung gegenüber als sehr <strong>zu</strong>geknöpft. So wur<strong>de</strong> es oftmals Zielscheibe "aufgeklärter" Kreise.<br />
Im Gegensatz <strong>zu</strong> vielen an<strong>de</strong>ren Kapiteln wur<strong>de</strong> das Kölner Domkapitel am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation nicht aufgehoben. 1795, noch vor <strong>de</strong>m Einrücken<br />
<strong>de</strong>r Franzosen in Köln, begab sich ein Großteil <strong>de</strong>s Kapitels nach Arnsberg. Einige Kanoniker ließ man jedoch in Köln <strong>zu</strong>rück, wo sie die Kapitelsrechte wahren sollten. Hierbei kam es<br />
<strong>zu</strong> Streitigkeiten. Obwohl die "Kölner" Kapitulare im Auftrag <strong>de</strong>s Kapitels in Köln verblieben waren, wur<strong>de</strong> ihnen das als mangeln<strong>de</strong> Resi<strong>de</strong>nz angerechnet und man verweigerte ihnen<br />
die Pfrün<strong>de</strong>zahlungen. Denn, so die Aussage, Resi<strong>de</strong>nzhalten könne man lediglich in Arnsberg. Nach einigen Querelen konnte <strong>de</strong>r Streit beigelegt wer<strong>de</strong>n.<br />
In Arnsberg wählte das Kapitel auch noch einen neuen Dom<strong>de</strong>chanten und feierte diese Wahl ausgiebig mit Empfängen und Konzert. Die Umstän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Zeit wur<strong>de</strong>n ignoriert. Als 1802<br />
Erzbischof Maximilian Franz von Österreich verstorben war, wählte man seinen Neffen Anton Viktor von Österreich <strong>zu</strong>m neuen Erzbischof. Dieser lehnte jedoch aufgrund <strong>de</strong>r<br />
politischen Lage ab und es blieb bei <strong>de</strong>r Wahl eines Kapitularvikars, <strong>de</strong>r bis <strong>zu</strong> seinem To<strong>de</strong> in Deutz (gegenüber <strong>de</strong>m Kölner Dom) residierte und <strong>de</strong>n rechtsrheinischen Rumpf <strong>de</strong>r<br />
Erzdiözese verwaltete. Eine Vereinigung <strong>de</strong>r Diözesen Köln und Münster, bei welcher das Kölner Domkapitel im Münsteraner Domkapitel aufgegangen wäre, lehnte man energisch ab.<br />
Da nicht nur die Kathedrale verloren gegangen war, son<strong>de</strong>rn auch die Einkünfte <strong>de</strong>s Kapitels, suchte je<strong>de</strong>r Kanoniker sein Glück nun auf eigene Faust, und das Kapitel zerfiel. Vakante<br />
Stellen wur<strong>de</strong>n nicht mehr besetzt und 1815 lebeten noch acht Domgrafen und vier Priesterherren in alle Win<strong>de</strong> zerstreut. Bereits 1798 hatte man die Dompropstei mangels Einkünfte<br />
nicht mehr besetzt.<br />
Als es 1820 <strong>zu</strong>r Wie<strong>de</strong>rerrichtung <strong>de</strong>s Kapitels kam und man <strong>de</strong>n noch leben<strong>de</strong>n Kapitularen eine Stelle im "neuen" Domkapitel anbot, lehnte je<strong>de</strong>r von ihnen ab.<br />
Nach<strong>de</strong>m die Bulle De salute animarum das Kapitel 1821 wie<strong>de</strong>rherstellte, gab es sich 1830 eigene Statuten. Neu war nun die Tatsache, dass die Domkirche eine Pfarrkirche war. Zu<br />
ihrer Seelsorge hatte das Kapitel einen Pfarrer <strong>zu</strong> bestellen, so wie es auch <strong>de</strong>n Pönitentiar o<strong>de</strong>r Bußkanoniker <strong>zu</strong> stellen hatte.<br />
Wie in <strong>de</strong>r alten Zeit war auch jetzt das Kapitel und nicht <strong>de</strong>r Erzbischof Hausherr <strong>de</strong>r Kathedrale. Auch jetzt galt, neben <strong>de</strong>r Tätigkeit in <strong>de</strong>r Bistumsverwaltung, <strong>de</strong>r Chordienst in <strong>de</strong>r<br />
Domkirche als Hauptaufgabe. Faktisch kam er jedoch in <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts fast gänzlich <strong>zu</strong>m Erliegen.<br />
Im Verlauf <strong>de</strong>r Kölner Wirren übernahm das Domkapitel die faktische Regierung <strong>de</strong>s Erzbistums.<br />
Diese begann mit <strong>de</strong>r Verhaftung <strong>de</strong>s Erzbischofs Clemens August von Droste <strong>zu</strong> Vischering im Jahre 1837 und en<strong>de</strong>te mit <strong>de</strong>r Ernennung Johannes von Geissels <strong>zu</strong>m Koadjutor im<br />
Jahre 1841. Hierbei hatte es sich jedoch äußerst ungeschickt verhalten. Denn die Übernahme geschah auf Weisung <strong>de</strong>r preußischen Regierung, die das Kapitel nach <strong>de</strong>r Verhaftung <strong>de</strong>s<br />
Erzbischofs <strong>zu</strong>r Wahl eines Kapitularvikars auffor<strong>de</strong>rte. Obwohl <strong>de</strong>r Erzstuhl besetzt war, verhielt sich das Kapitel wie bei einer Sedisvakanz. Ohne es wirklich gewollt <strong>zu</strong> haben, stan<strong>de</strong>n
die Domherren nun wie Verbün<strong>de</strong>te <strong>de</strong>s Preußischen Staates da.<br />
In eine unglückliche Lage geriet das Kapitel nach <strong>de</strong>m Tod von Kardinal Joseph Höffner (1987). Wie gewohnt sandte das Kapitel die Kandidatenliste nach Rom, wo sich nun<br />
Gewohnheitsrecht und die neuen Normen <strong>de</strong>s CIC von 1983 gegenüberstan<strong>de</strong>n. Da <strong>de</strong>r Papst diese Liste nach <strong>de</strong>m neuen Recht nur noch <strong>zu</strong> würdigen brauchte und das Kapitel davon<br />
ausging, dass er an die von ihnen genannten Namen gebun<strong>de</strong>n sei, kam es nun <strong>zu</strong> Verwicklungen. Denn auf <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>rückgesandten Dreierliste, Terna genannt, befand sich nun ein Name,<br />
welcher nicht auf <strong>de</strong>r Liste <strong>de</strong>s Kapitels befun<strong>de</strong>n hatte.<br />
Hierauf weigerte sich das Kapitel <strong>zu</strong>r Wahl <strong>zu</strong> schreiten und es kam <strong>zu</strong> einer Protestwelle <strong>de</strong>utscher Politiker und Theologen. Als Papst Johannes Paul II. jedoch auf sein Ansinnen<br />
bestand und eine Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Kölner Erzstuhls ohne Votum <strong>de</strong>s Kapitels in Aussicht stellte, gab das Kapitel nach. Für die Wahl musste jedoch noch <strong>de</strong>r übliche Wahlmodus abgeän<strong>de</strong>rt<br />
wer<strong>de</strong>n, so dass auch eine Wahl mit relativer Mehrheit möglich wer<strong>de</strong>n konnte. Schließlich wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r päpstliche Kandidat, Kardinal Joachim Meisner, mit sechs Ja-Stimmen und zehn<br />
Enthaltungen gewählt.<br />
Zum Weltjugendtag in Köln begrüßte Dompropst Norbert Feldhoff Papst Benedikt XVI. im Kölner Dom, wo dieser in <strong>de</strong>r für <strong>de</strong>n Papst reservierten Chorstalle Platz nahm.<br />
Dompropst<br />
Der erste Prälat <strong>de</strong>s Domkapitels war und ist <strong>de</strong>r Dompropst. Ursprünglich mit <strong>de</strong>r Verwaltung <strong>de</strong>s Vermögens und <strong>de</strong>r Reichung <strong>de</strong>r Stipendia beauftragt, kam es 1284 und 1373 <strong>zu</strong>r<br />
Teilung <strong>de</strong>s Kapitelsvermögens. Zukünftig hatte er sich aus <strong>de</strong>r Vermögensverwaltung heraus<strong>zu</strong>halten, wofür die Propstei jetzt über ein eigenes Vermögen verfügte. Zugleich als<br />
Archidiakon für die Stadt Köln <strong>zu</strong>ständig, konnte ihm das Kapitel auch nicht in diese Aufgabe hereinre<strong>de</strong>n.<br />
Generell galt <strong>de</strong>r Propst nicht als Kanoniker, weshalb er auch nicht <strong>zu</strong>m Besuch <strong>de</strong>r Kapitelssit<strong>zu</strong>ngen berechtigt war und nur auf Einladung erscheinen durfte. Dies hat sich in Köln<br />
jedoch nicht wirklich ausgewirkt, da das Kapitel die Wahl <strong>de</strong>s Dompropstes in Hän<strong>de</strong>n hielt und immer einen Kanoniker <strong>zu</strong>m Dompropst wählte. Die Vergabe <strong>de</strong>r meisten Eigenkirchen<br />
und Lehen konnte er behalten.<br />
Da die Säkularisation die Einkünfte <strong>de</strong>s Domkapitels stark beeinträchtigte, besetzte es das Amt seit 1798 nicht mehr und vermietete die Räumlichkeiten <strong>de</strong>r Dompropstei.<br />
Nach <strong>de</strong>r Säkularisation wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Dompropst erneut das Haupt <strong>de</strong>s Kapitels und <strong>de</strong>r Verwalter seiner Güter. Ursprünglich vom König von Preußen ernannt, wird er seit 1918 durch das<br />
Domkapitel gewählt.<br />
Von 1847 bis 1863 wur<strong>de</strong> die Stelle <strong>de</strong>s Dompropstes nicht besetzt, da sich <strong>de</strong>r Erzbischof gegen <strong>de</strong>n königlichen Kandidaten Nikolaus München sperrte.<br />
Zwar erhielt München letztendlich die Propstei, doch musste er einen hohen Preis dafür zahlen. Sein Nachfolger, Franz Carl Berlage, war im Kapitel gänzlich isoliert, weil er als<br />
strammer Parteigänger und Zuträger <strong>de</strong>r Regierung in Berlin galt.<br />
Der letzte Dompropst, <strong>de</strong>r durch die Regierung ernannt wor<strong>de</strong>n war, Arnold Mid<strong>de</strong>ndorf, gehörte überhaupt nicht <strong>de</strong>m Kölner Klerus an. Er war Militärpfarrer und bewarb sich um diese<br />
Stelle.<br />
Kardinal Johannes von Geissel erwirkte <strong>de</strong>m Dompropst 1851 die Pontifikalien.<br />
Dom<strong>de</strong>chant<br />
Der Dom<strong>de</strong>chant war und ist <strong>de</strong>r zweite Prälat <strong>de</strong>s Kölner Domes. Ursprünglich für die Zucht <strong>de</strong>r Kanoniker <strong>zu</strong>ständig, war er bereits im 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>r eigentliche Obere <strong>de</strong>s Stifts.<br />
Vor seinem Gericht hatten sich auch die Diener <strong>zu</strong> verantworten. Nach <strong>de</strong>m Ausschei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Dompropstes trat er an <strong>de</strong>n Kopf <strong>de</strong>s Kapitels.<br />
Seine Aufgabe war die Leitung <strong>de</strong>r Kapitelssit<strong>zu</strong>ngen und er musste, als einziger <strong>de</strong>r adligen Domherren, die Priesterweihe besitzen. Zugleich war <strong>de</strong>r Dom<strong>de</strong>chant Archidiakon für<br />
Neuss und die Kölner Pfarrkirche St. Maria Ablass. Er war es auch, <strong>de</strong>r die 25 Domvikarien vergab.<br />
Nach <strong>de</strong>r Säkularisation wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>m Erzbischof die Ernennung <strong>de</strong>s Dom<strong>de</strong>chant <strong>zu</strong>gesprochen. Er ist für die Liturgie am Kölner Dom <strong>zu</strong>ständig. Kardinal Johannes von Geissel erwirkte
<strong>de</strong>m Dom<strong>de</strong>chanten 1851 die Pontifikalien.<br />
Das Amt <strong>de</strong>s Dom<strong>de</strong>chants wur<strong>de</strong> seit 1821 häufig an einen Weihbischof <strong>de</strong>r Erzdiözese Köln vergeben.<br />
Weitere Prälaturen<br />
Nach <strong>de</strong>m Ausschei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Propstes, kannte die Ordnung von 1244/46 acht officia, welche <strong>de</strong>n adligen Domherren vorbehalten waren. Dies waren <strong>de</strong>r Dechant, <strong>de</strong>r Sub<strong>de</strong>chant, <strong>de</strong>r<br />
Chorbischof, <strong>de</strong>r Scholaster, <strong>de</strong>r Cellerarius, <strong>de</strong>r Cantor, sowie Portenarius maior und minor.<br />
Nach 1450 entfielen <strong>de</strong>r Cellerarius, <strong>de</strong>r Cantor und bei<strong>de</strong>n Portenarii und an ihre Stelle traten <strong>de</strong>r Thesaurar und <strong>de</strong>r Capellarius.<br />
Der Scholaster war ursprünglich <strong>de</strong>r Leiter <strong>de</strong>r Stiftsschule. Seinem Amt war die Propstei Hougar<strong>de</strong> (Hoxem) in Brabant inkorporiert. Seit 1176/79 nahm er nach <strong>de</strong>m Dechanten die<br />
erste Stelle ein. Die Beschlüsse <strong>de</strong>s Kapitels wur<strong>de</strong>n durch ihn verkün<strong>de</strong>t, weshalb man ihn auch als "<strong>de</strong>n Mund" <strong>de</strong>s Domkapitels bezeichnete.<br />
Der Chorbischof ist ein Amt, das es als Dignität so nur in <strong>de</strong>r Kölner Kirche gab.<br />
Er war ursprünglich <strong>de</strong>r Choraufseher und Singmeister. Es ist nicht <strong>zu</strong> verwechseln mit <strong>de</strong>m Chorbischof, einem Landbischof ohne festen Sitz in <strong>de</strong>r Frühkirche.<br />
Der Thesaurar war <strong>de</strong>r Verantwortliche für <strong>de</strong>n Kirchenschatz und die Sakristei; <strong>de</strong>ren Instandhaltung und das entsprechen<strong>de</strong> Personal, vom Sakristan bis <strong>zu</strong>m Glöckner, unterstan<strong>de</strong>n<br />
ihm.<br />
Die späteren "Prälaturen" <strong>de</strong>s Diaconus maior und <strong>de</strong>s Diaconus minor wur<strong>de</strong>n nicht vergeben, son<strong>de</strong>rn fielen automatischem ältesten und jüngsten adligen Diakon <strong>zu</strong>.<br />
Kanoniker<br />
Ursprünglich mit 72 Kanonikern bestückt, sank die Zahl <strong>de</strong>r Domherren im Hochmittelalter auf 24 ab, wo<strong>zu</strong> noch jeweils ein Kanonikat für Papst und Kaiser kam. 16 <strong>de</strong>r Domherren<br />
mussten <strong>de</strong>m Hocha<strong>de</strong>l <strong>de</strong>s Reiches, also <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st Reichsgrafen, angehören. Sie gehörten oftmals <strong>de</strong>nselben Familien an und kamen ab <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong>meist aus<br />
Süd<strong>de</strong>utschland. Der Volksmund bezeichnete sie als Domgrafen. Da sie häufig an mehreren Domkirchen bepfrün<strong>de</strong>t waren, waren sie häufig nicht anwesend, so dass sie in <strong>de</strong>n<br />
Kapitelssit<strong>zu</strong>ngen <strong>de</strong>n Priesterherren oftmals an Zahl unterlegen waren.<br />
Acht <strong>de</strong>r Domherren gehörten <strong>de</strong>m nie<strong>de</strong>ren A<strong>de</strong>l o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Bürgertum an. Um in das Kapitel aufgenommen <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n, benötigten sie die Priesterweihe und einen aka<strong>de</strong>mischen Grad.<br />
Zumeist aus Köln o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Kölner Umland stammend, kamen auch sie häufig aus <strong>de</strong>nselben Familien.<br />
Das Kapitel ergänzte sich selbst und vergab die freigewor<strong>de</strong>nen Kanonikate durch Wahl. Eine Ausnahme bil<strong>de</strong>ten lediglich die bei<strong>de</strong>n Universitätskanonikate <strong>de</strong>r Priesterherren, welche<br />
durch die Universität Köln besetzt wur<strong>de</strong>n.<br />
Die Einkommen <strong>de</strong>r einzelnen Kanoniker waren unterschiedlich. Bestan<strong>de</strong>n sie ursprünglich aus Naturalien und Geld, so wur<strong>de</strong>n später nur noch Gel<strong>de</strong>r gezahlt. Abwesenheit vom Dom<br />
wur<strong>de</strong> durch "Gehaltsab<strong>zu</strong>g" vergütet. Innerhalb <strong>de</strong>s Kapitels wur<strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>ne Dienste und Lehen <strong>zu</strong>geteilt, welche letztendlich das eigentliche Kanonikatseinkommen überschreiten<br />
konnten. So war es möglich, dass <strong>de</strong>r Priesterherr und Weihbischof Clemens August von Merle wesentlich höhere Gehälter bezog als die meisten Domgrafen. Johann Arnold von<br />
Schönheim hatte als Senior <strong>de</strong>s Kapitels <strong>de</strong>n Hof <strong>zu</strong> Rheydt inne, war Halter <strong>de</strong>r Obedienz Gladbach und an <strong>de</strong>r Obedienz Königshoven beteiligt, besaß das Ferculum auf <strong>de</strong>r Münz, war<br />
Buschherr und Deputierter ad fabricam, Amtsherr <strong>zu</strong> Worringen und Comissarius <strong>de</strong>r Kapelle B.M.V.<br />
In seiner Person vereinigte ein Kapitular also, neben seinem Kanonikat, eine Anzahl von Ämtern. Diese waren nicht nur reine Titel, son<strong>de</strong>rn auch mit tatsächlicher Arbeit verbun<strong>de</strong>n. Die<br />
Abwesenheit zahlreicher Kanoniker erhöhte also nicht nur <strong>de</strong>n Einfluss <strong>de</strong>r Anwesen<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn auch <strong>de</strong>ren Arbeitslast. Hier<strong>zu</strong> kamen die Gottesdienste, welche mehrere Stun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s<br />
Tages beanspruchten.<br />
Nach <strong>de</strong>r Säkularisation wur<strong>de</strong> das Domkapitel auf zwölf Mitglie<strong>de</strong>r beschränkt. Später kam eine Erhöhung auf 16 Mitglie<strong>de</strong>r. Hierbei unterschei<strong>de</strong>t man zwischen Residieren<strong>de</strong>n
Domherren und Nichtresidieren<strong>de</strong>n Domherren. Letztere tragen zwar die Kleidung <strong>de</strong>r Domherren und nehmen auch an <strong>de</strong>r Bischofswahl teil, sind jedoch nicht an <strong>de</strong>n Geschäften <strong>de</strong>s<br />
Kapitels beteiligt.<br />
Es han<strong>de</strong>lt sich bei ihnen <strong>zu</strong>meist um Dechanten und Professoren. Lediglich Dompropst Bernard Henrichs gelang <strong>de</strong>r Wechsel vom Nichtresidieren<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Residieren<strong>de</strong>n Domherren.<br />
Seit Mitte <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts gibt es <strong>zu</strong><strong>de</strong>m Ehrendomherren. Diese sind faktisch nur <strong>de</strong>m Namen nach Domherren <strong>zu</strong> Köln, auch wenn sie <strong>de</strong>ren Tracht tragen und <strong>de</strong>n Kapitelsstern<br />
erhalten.<br />
Sie besitzen we<strong>de</strong>r Mitspracherecht bei <strong>de</strong>r Güterverwaltung noch Wahlrecht <strong>de</strong>s Bischofs. Sie wer<strong>de</strong>n vom Domkapitel nominiert und vom Erzbischof ernannt. Hierbei han<strong>de</strong>lt es sich<br />
in <strong>de</strong>r Regel um verdiente Persönlichkeiten. Zu ihnen gehören u. a. <strong>de</strong>r emeritierte Erzbischof von New Orleans, Philip Matthew Hannan o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Bischof von Würzburg, Friedhelm<br />
Hofmann. Hannan war während <strong>de</strong>r amerikanischen Besat<strong>zu</strong>ng Pfarrer am Kölner Dom, Hofmann vor seiner Bischofsernennung langjähriger Domkapitular und Dompfarrer.<br />
Die Domherren <strong>de</strong>s neuen Kapitels wer<strong>de</strong>n durch <strong>de</strong>n Erzbischof von Köln ernannt.<br />
Dies ging ursprünglich im Wechsel zwischen <strong>de</strong>m Erzbischof und <strong>de</strong>m König von Preußen. Unliebsame Ernennungen <strong>de</strong>s Königs konnte <strong>de</strong>r Erzbischof hierbei durch eine<br />
Ernennungsverweigerung ausschließen. Dies ging dabei jedoch <strong>zu</strong> Lasten <strong>de</strong>s Kapitels und brachte teilweise jahrelange Vakanzen mit sich.<br />
Seit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sherrlichen Kirchenregiments 1918 ernennt <strong>de</strong>r Erzbischof alleine. Hierbei ist er jedoch nicht frei; vielmehr ernennt er im Wechsel, einmal nach Anhörung <strong>de</strong>s<br />
Kapitels und einmal auf Vorschlag <strong>de</strong>s Kapitels.<br />
Domizellare<br />
Am Kölner Dom gab es 24 Domizellarspräben<strong>de</strong>n. Sie gehörten nicht <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Kapitularen selbst, son<strong>de</strong>rn waren Anwärter auf die 16 adligen Domkanonikate. DEshalb mussten die<br />
Domizellare, wie auch die Domgrafen, <strong>de</strong>m Hocha<strong>de</strong>l angehören. Im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Domkanonikern wur<strong>de</strong>n die Domizellare nicht vom Kapitel gewählt. Sie wur<strong>de</strong>n vielmehr im<br />
Turnus von <strong>de</strong>n einzelnen adligen Domherren frei vergeben.<br />
Das Aufrücken eines Domizellars ins Kapitel geschah nicht automatisch. Vielmehr wählte das Kapitel, so dass es durchaus Beispiele von Domizellaren gibt, die niemals ins Kapitel und<br />
damit <strong>zu</strong> Domherren aufstiegen. Gleichzeitig sicherte <strong>de</strong>r Turnus <strong>de</strong>r Domherren <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen im Kapitel vertretenen A<strong>de</strong>lsfamilien einen gewissen dynastischen Einfluss und die<br />
Hoffnung, sich Kanonikate <strong>zu</strong> erhalten.<br />
Kleidung<br />
Wer die Domherren beim Gebet beobachtete, konnte leicht <strong>de</strong>n adligen Herren vom Priesterherren unterschei<strong>de</strong>n. Während die Domgrafen eine rote Soutane und eine rote Mozetta<br />
trugen, trugen die Priesterherren eine schwarze Soutane. Bei<strong>de</strong>n gemeinsam war <strong>de</strong>r Kapitelsstern, welcher an <strong>de</strong>n Stern <strong>de</strong>r heiligen drei Könige erinnert, <strong>de</strong>ren Gebeine bzw. Reliquien<br />
im Kölner Dom ruhen.<br />
Das Domkapitel nach <strong>de</strong>r Säkularisation erhielt für alle seine Kapitulare die schwarze Soutane und eine weiße, mit Spitzen besetzte Mozetta, wie auch <strong>de</strong>n Kapitelsstern. Jetzt jedoch<br />
nicht mehr am Coulant, son<strong>de</strong>rn an einer gol<strong>de</strong>nen Kette. 1851 erwirkte <strong>de</strong>r Kölner Erzbischof Johannes von Geissel seinem Kapitel das Recht einer violetten Soutane und einer violetten<br />
Mozetta. Im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Bischöfen befin<strong>de</strong>t sich an <strong>de</strong>r Mozetta <strong>de</strong>r Domherren eine kleine Kapuze.<br />
Außerhalb <strong>de</strong>s Domes tragen die Domherren ein schwarze Soutane mit violettem Saum und violetten Knöpfen. Hierauf wird ein violettes Zingulum und <strong>de</strong>r Kapitelsstern getragen.<br />
(Bsp.: Empfang <strong>zu</strong>r Amtseinführung von Kardinal Meisner im Maternushaus)<br />
Bischofswahlrecht<br />
In Köln lag bis <strong>zu</strong>r Wahl von 1239 o<strong>de</strong>r 1261 das Wahlrecht beim Priorenkolleg.
Dieses bestand aus <strong>de</strong>n höchsten Pröpsten und Äbten <strong>de</strong>s Erzbistums; <strong>zu</strong> ihnen gehörten auch <strong>de</strong>r Dompropst und <strong>de</strong>r Dom<strong>de</strong>chant.<br />
Nach<strong>de</strong>m das Kapitel 1274 endgültig das Priorenkolleg aus <strong>de</strong>r Verwaltung <strong>de</strong>s Erzbistums und <strong>de</strong>r Bischofswahl ausschalten konnte, musste es sein Wahlrecht gegen <strong>de</strong>n Papst<br />
verteidigen.<br />
Bereits die einmütige Wahl <strong>de</strong>s Erzbischofs Wigbold von Holte im Jahre 1298 wur<strong>de</strong> durch <strong>de</strong>n Papst kassiert. Seine Ernennung erhielt er erst, nach<strong>de</strong>m er auf alle ihm durch die Wahl<br />
<strong>zu</strong>stehen<strong>de</strong>n Rechte verzichtet hatte. Als die Stimmen bei <strong>de</strong>r Wahl von 1304 auf drei verschie<strong>de</strong>ne Kandidaten fielen und keine Einigung erzielt wer<strong>de</strong>n konnte, fiel <strong>de</strong>m Apostolischen<br />
Stuhl ohnehin die Ernennung <strong>zu</strong>.<br />
Bei <strong>de</strong>n kommen<strong>de</strong>n vier Erzbischofsernennungen hingegen kam das Kapitel nicht mehr <strong>zu</strong>m Zuge. Walram von Jülich, Wilhelm von Gennep, Adolf II. von <strong>de</strong>r Mark und Engelbert III.<br />
von <strong>de</strong>r Mark waren freie päpstliche Ernennungen.<br />
Erst dann konnte das Kapitel nach und nach sein Wahlrecht <strong>zu</strong>rückerobern. Als <strong>de</strong>r Papst sich auch im Jahre 1370 die Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Kölner Bischofsstuhls reserviert hatte, konnte man<br />
sich mit Friedrich III. von Saarwer<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st auf eine Postulation einigen, welche man <strong>de</strong>m Papst als Ernennungsvorschlag überreichte und die dieser auch umsetzte. Als man 1414<br />
Dietrich II. von Moers <strong>zu</strong>m Erzbischof wählte, beugte sich <strong>de</strong>r Papst <strong>de</strong>m Wunsch <strong>de</strong>s Kaisers und ernannte ihn.<br />
Erst das Wiener Konkordat (1448/49) sicherte <strong>de</strong>m Kapitel wie<strong>de</strong>r das uneingeschränkte Wahlrecht.<br />
Da <strong>de</strong>r Erzbischof <strong>zu</strong>gleich Kurfürst war und über einen eigenen Staat verfügte, war die Bischofswahl ein hochpolitischer Akt. Österreich, Frankreich, Preußen, die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>...<br />
versuchten stets Einfluss <strong>zu</strong> nehmen und einen genehmen Kandidaten durch<strong>zu</strong>drücken. Um dieses Ziel <strong>zu</strong> erreichen, investierten sie hohe Summen als Bestechungsgel<strong>de</strong>r in einzelne<br />
Kapitulare. Auch Herrschaften und Bistümer gingen hierbei über <strong>de</strong>n Tisch.<br />
Nach <strong>de</strong>r Säkularisation wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>m Domkapitel erneut das Bischofswahlrecht <strong>zu</strong>gestan<strong>de</strong>n. Nun musste es allerdings eine Liste von Namen an <strong>de</strong>n König von Preußen sen<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r mit<br />
regi minus die ihm politisch unangenehmen Personen aus <strong>de</strong>r Liste strich. Die verbliebenen, regi plus, wur<strong>de</strong>n nun an <strong>de</strong>n Apostolischen Stuhl gesandt, welcher eine Wahlliste von drei<br />
Personen an das Kapitel <strong>zu</strong>rück sandte. Schon bald kam es jedoch <strong>zu</strong> Problemen, da <strong>de</strong>r König so ausgiebig von seinem Recht Gebrauch machte, dass kaum ein Name auf <strong>de</strong>r Liste<br />
verblieb.<br />
Das Kapitel war hier auf die Hilfe <strong>de</strong>s Papstes angewiesen. (20. Jahrhun<strong>de</strong>rt)<br />
Kaum hatte sich das Problem gegeben, versuchte <strong>de</strong>r Apostolische Stuhl das Wahlrecht <strong>zu</strong> beseitigen. Nun war das Kapitel auf die Hilfe <strong>de</strong>s Staates angewiesen. Dies war vor allem 1919<br />
nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> von Kardinal Felix von Hartmann <strong>de</strong>r Fall. Das vehemente Bestehen <strong>de</strong>s Kapitels auf sein Wahlrecht und die ihm <strong>zu</strong>kommen<strong>de</strong> Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Staates ermöglichten<br />
eine Scheinwahl, welche <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Domkapiteln das Wahlrecht sicherte. (20. Jahrhun<strong>de</strong>rt)<br />
Bis heute sen<strong>de</strong>t das Domkapitel eine Liste von zehn Namen an <strong>de</strong>n Apostolischen Stuhl. Dieser ist jedoch <strong>zu</strong>r Zusammenstellung <strong>de</strong>r Dreierliste <strong>zu</strong>r Wahl nicht daran gebun<strong>de</strong>n, son<strong>de</strong>rn<br />
soll sie lediglich würdigen. Er könnte sie also gänzlich ignorieren.<br />
Vor <strong>de</strong>r Ernennung <strong>de</strong>s Erwählten fragt <strong>de</strong>r Apostolische Stuhl bei <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sregierungen von Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz bezüglich politischer Be<strong>de</strong>nken nach.<br />
Erstmals bei <strong>de</strong>r Wahl von 1987/89 tauchte ein Name auf <strong>de</strong>r Terna (Dreierliste <strong>de</strong>s Papstes) auf, welcher nicht auf <strong>de</strong>r Kapitelsliste gestan<strong>de</strong>n hatte.<br />
Bistumsverwaltung<br />
Viele <strong>de</strong>r Domherren gehörten bereits im Frühmittelalter <strong>zu</strong>m Beratergremium <strong>de</strong>s Erzbischofs und <strong>de</strong>s Kaisers. So konnte das Kapitel stets einen gewissen Einfluss auf die Diözese<br />
ausüben, welchen es systematisch absicherte. Bereits 1219 hatte es das Domkapitel erreicht, dass <strong>de</strong>r Erzbischof sich auf einen Capellarius aus <strong>de</strong>m Domkapitel verpflichtete. Dieser<br />
Verpflichtung folgte 1463 <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die Zusicherung <strong>de</strong>s Erzbischofs, dass <strong>de</strong>r Generalvikar künftig nur noch <strong>de</strong>m Domkapitel entnommen wer<strong>de</strong>. In späteren Jahren gelang es <strong>zu</strong><strong>de</strong>m auch<br />
die Ämter <strong>de</strong>s Offizials und <strong>de</strong>s Weihbischofs an das Kapitel <strong>zu</strong> bin<strong>de</strong>n. Besaß <strong>de</strong>r Erzbischof keine Weihen, so musste er einen Coadministrator in spiritualibus bestellen. Dieses war<br />
unter <strong>de</strong>n Erzbischöfen Joseph Clemens von Bayern und Clemens August I. von Bayern <strong>de</strong>r Fall. Bei<strong>de</strong> entnahmen diese <strong>de</strong>m Domkapitel.
Die Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s neuen Domkapitels sind primär in <strong>de</strong>r Bistumsverwaltung tätig. Neben <strong>de</strong>n Weihbischöfen, <strong>de</strong>m Generalvikar und <strong>de</strong>m Offizial stellen sie die Hauptabteilungsleiter<br />
<strong>de</strong>s Generalvikariates und <strong>zu</strong>meist auch <strong>de</strong>n Regens <strong>de</strong>s Kölner Priesterseminars.<br />
Lan<strong>de</strong>sverwaltung<br />
An <strong>de</strong>n im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt aufkommen<strong>de</strong>n landständischen Aktivitäten beteiligte sich auch das Kölner Domkapitel. So konnte <strong>de</strong>r Erzbischof seit Mitte <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts keine<br />
territorialherrschaftlichen Rechte mehr ohne Zustimmung <strong>de</strong>s Domkapitels ausüben, das nun als Mitherrscher galt. Der Einfluss auf die direkte Herrschaft wur<strong>de</strong> sogar noch dadurch<br />
verstärkt, dass man seit 1414 <strong>de</strong>n noch <strong>zu</strong> Erwählen<strong>de</strong>n eine Wahlkapitulation unterschreiben ließ. Durch diese war er an das Domkapitel gebun<strong>de</strong>n. Erst hiernach kam es <strong>zu</strong>r<br />
eigentlichen Wahl. Man kann von einer Reihenfolge sprechen: Vorwahl-Wahlkapitulation-Wahl. In <strong>de</strong>r Zwischenzeit wur<strong>de</strong>n Bistum und Land durch <strong>de</strong>n Kapitularvikar verwaltet, <strong>de</strong>n<br />
das Domkapitel wählte.<br />
Innerhalb <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sverwaltung waren die Domherren häufig in leiten<strong>de</strong>n Positionen <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n. So stellten sie verschie<strong>de</strong>ne Premierminister, Rats- und Gerichtspräsi<strong>de</strong>nten.<br />
Quellen<br />
• Eduard Hegel: Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln I. Köln 1972<br />
• Eduard Hegel: Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln II.1. Köln 1995<br />
• Eduard Hegel: Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln IV. Köln 1979<br />
• Eduard Hegel: Geschichte <strong>de</strong>s Erzbistums Köln V. Köln 1987<br />
• Norbert Trippen: Domkapitel und Erzbischofswahlen<br />
• Joh. Christian Nattermann: Das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s alten Kölner Domstifts. Köln 1948<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Danzig<br />
Danzig (polnisch Gdańsk, kaschubisch Gduńsk, latein Gedanum o<strong>de</strong>r Dantiscum) ist eine Hafen- und ehemalige Hansestadt in Polen. Sie liegt westlich <strong>de</strong>r Weichselmündung in <strong>de</strong>r<br />
historischen Landschaft Pommerellen und ist Hauptstadt <strong>de</strong>r Woiwodschaft Pommern. Die Stadt hat über 450.000 Einwohner und bil<strong>de</strong>t <strong>zu</strong>sammen mit Gdynia (Gdingen) und Sopot<br />
(Zoppot) die Dreistadt (polnisch Trójmiasto) mit mehr als 740.000 Einwohnern. Im gesamten städtisch geprägten Ballungsraum Danzig (polnisch Aglomeracja Gdańska) leben mehr als<br />
1,2 Millionen Menschen.<br />
Der Wahlspruch <strong>de</strong>r Stadt Danzig lautet: nec temere nec timi<strong>de</strong> (lat. we<strong>de</strong>r unbesonnen noch furchtsam).<br />
Geschichte
Antike und Völkerwan<strong>de</strong>rung<br />
Im Jahrhun<strong>de</strong>rt vor <strong>de</strong>r Zeitenwen<strong>de</strong> sie<strong>de</strong>lten sich an unterer Weichsel und Weichselmündung die Goten an. Die ihnen <strong>zu</strong>geschriebene Wielbark-Kultur zeigt eine Mischung von<br />
skandinavischen und an<strong>de</strong>ren Elementen. Claudius Ptolemaeus <strong>zu</strong>folge lebten an <strong>de</strong>r Danziger Bucht, die er „Venedische Bucht“ nannte, aber auch die „Venedi maiores“, möglicherweise<br />
Vene<strong>de</strong>r im weiteren Sinne. Als <strong>de</strong>r Geschichtsschreiber Jordanes im 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt in seiner „Getica“ die Geschichte <strong>de</strong>r Goten beschrieb, erwähnte er <strong>de</strong>n Ort „Gothiscandza“. Es ist<br />
jedoch umstritten, ob die damalige Siedlung mit <strong>de</strong>m Standort <strong>de</strong>s heutigen Danzig i<strong>de</strong>ntisch ist. Ab etwa 200 n. Chr. wan<strong>de</strong>rten die Goten nach Südosten ab. Die Wielbark-Kultur<br />
erlosch um 400 n. Chr. im Zuge <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung. Im 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt besie<strong>de</strong>lten Slawen die Küste westlich <strong>de</strong>r unteren Weichsel und nannten das Gebiet „po-morje“ (am Meer,<br />
Pommern).<br />
Östlich <strong>de</strong>r Weichsel dagegen lebten schon vor <strong>de</strong>r Zeitenwen<strong>de</strong> baltische Stämme. Tacitus nannte sie Aesti und lobte an ihnen ihren Fleiß im Ackerbau („nicht so faul wie die<br />
Germanen“) und ihr Interesse an <strong>de</strong>r Bernsteingewinnung. Wulfstan, <strong>de</strong>r im 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt im Auftrag Alfreds <strong>de</strong>s Großen von Haithabu nach Danzig und Truso reiste, berichtete, dass<br />
westlich <strong>de</strong>r Weichsel die „Vinodi“ wohnten, östlich die „Esthi“. Der Bernstein war im Altertum im Mittelmeerraum bis nach Ägypten und darüber hinaus sehr begehrt. Schon seit<br />
vorgeschichtlicher Zeit verband ein Han<strong>de</strong>lsweg, die so genannte Bernsteinstraße, das Weichsel<strong>de</strong>lta mit <strong>de</strong>r mediterranen Welt.<br />
Slawische Staaten<br />
Das Küstenland Pommern (slawisch po morze = am Meer), <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m Gydanzik gehörte, sah sich abwechselnd polnischen und dänischen Unterwerfungsversuchen ausgesetzt. 997 kam <strong>de</strong>r<br />
Prager Bischof Adalbert im Geleit von Soldaten <strong>de</strong>s polnischen Königs Bolesław Chrobry nach Danzig und taufte nach einer eintägigen Predigt viele Hei<strong>de</strong>n.[2] In seiner Chronik<br />
erwähnt Johannes Canaparius als erster „Gyddanzyc“, <strong>zu</strong><strong>de</strong>m schon als „urbs“, Stadt.[3]<br />
Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong>n die Sambori<strong>de</strong>n als Herrscherfamilie in Danzig urkundlich erwähnt. Ob sie von <strong>de</strong>n Piasten als Statthalter eingesetzt wor<strong>de</strong>n waren, wird<br />
diskutiert. Als sich im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>r größere westliche Teil Pommerns um Cammin, Wolgast und Stettin unter <strong>de</strong>m Geschlecht <strong>de</strong>r Greifen <strong>de</strong>m Heiligen Römischen Reich<br />
annäherte, nahm <strong>de</strong>r auf Deutsch Pommerellen genannte, aber eher <strong>de</strong>r heutigen Woiwodschaft Pomorze entsprechen<strong>de</strong>, östliche Lan<strong>de</strong>steil um Danzig daran nicht mehr teil.<br />
Herzog Sobieslaw grün<strong>de</strong>te um 1185 das Kloster Oliva. Es wur<strong>de</strong> durch Zisterzienser aus <strong>de</strong>m pommerschen Kloster Kolbatz besetzt. Es diente unter an<strong>de</strong>rem auch als Hauskloster und<br />
Grablege für die Herrscherfamilie.<br />
Erste Stadt 1224–1308<br />
Um 1224 verlieh <strong>de</strong>r ostpommersche Herzog Swantopolk II. (Zwantepolc <strong>de</strong> Danceke) das Lübische Recht an die <strong>de</strong>utsche Kaufmannssiedlung, die in <strong>de</strong>r Gegend <strong>de</strong>s heutigen Langen<br />
Marktes entstan<strong>de</strong>n war. Um 1295 verlieh <strong>de</strong>r polnische König Przemysław II. ihr das Mag<strong>de</strong>burger Recht.<br />
Deutscher Or<strong>de</strong>n 1308–1454<br />
Anfang <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts eskalierten Konflikte um Erbfolgerechte zwischen <strong>de</strong>n lokalen kaschubischen Fürsten von Pommern untereinan<strong>de</strong>r, sowie <strong>de</strong>m Markgrafen von<br />
Bran<strong>de</strong>nburg. Da<strong>zu</strong> kam die Beteiligung <strong>de</strong>s polnischen Königs, <strong>de</strong>r ab 1306 eine kleine Garnison in <strong>de</strong>r Hafenstadt stationierte, die sich in Dokumenten und auf <strong>de</strong>n Siegeln über 100<br />
Jahre lang als Dantzik(e) bezeichnete. Als die Bran<strong>de</strong>nburger im Sommer 1308 in die Stadt einrückten, wur<strong>de</strong> seitens <strong>de</strong>r „Königlichen in <strong>de</strong>r Burg“ und von Vertretern <strong>de</strong>r Stadt <strong>de</strong>r<br />
Deutsche Or<strong>de</strong>n um Hilfe gebeten, <strong>de</strong>r Jahrzehnte <strong>zu</strong>vor Mewe (Gniew) geerbt hatte und somit seither auch links <strong>de</strong>r Weichsel vertreten war. Die Deutschritter zogen als Alliierte <strong>de</strong>r<br />
königlich-polnischen Truppen im August in die Burg ein und verteidigten sie im September gegen die bran<strong>de</strong>nburgischen Truppen, <strong>de</strong>nen von <strong>de</strong>utschen Bürgern Danzigs die Stadttore<br />
geöffnet wor<strong>de</strong>n waren.[4] Es gab jedoch bald Streit um die Kostenfrage für diese Waffenhilfe, dies führte <strong>zu</strong>r Übernahme von Danzig durch <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n.<br />
Die weiteren Ereignisse wer<strong>de</strong>n, insbeson<strong>de</strong>re im Rahmen <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsch-polnischen Konflikte <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts, konträr dargestellt. Von polnischer Seite wur<strong>de</strong> und wird behauptet,<br />
dass die Ritter sich nun plötzlich gegen die Garnison wen<strong>de</strong>ten und es am 13. November <strong>zu</strong>m Massaker an <strong>de</strong>n wenigen Soldaten und zahllosen Zivilisten kam. Es ist von bis <strong>zu</strong> 10.000<br />
Opfern die Re<strong>de</strong>, die sowohl ethnisch als auch politisch als Polen bezeichnet wer<strong>de</strong>n.
Tatsache ist, dass <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n sich in <strong>de</strong>r Stadt und <strong>de</strong>r Umgebung (Pommerellen) festsetzte und dies im Vertrag von Soldin, in <strong>de</strong>m die Rechte <strong>de</strong>r Bran<strong>de</strong>nburger abgekauft wur<strong>de</strong>n,<br />
fixiert wur<strong>de</strong>. Das Königreich Polen wehrte sich dagegen mit juristischen Mitteln und übertriebenen Darstellungen bei Papst Clemens V., gera<strong>de</strong> in jenem Zeitraum, als dieser die<br />
Tempelritter bekämpfte. Der Or<strong>de</strong>n verlegte 1309 <strong>de</strong>swegen auch seinen Sitz von Venedig in die Or<strong>de</strong>nsburg Marienburg.<br />
In <strong>de</strong>r traditionell nach Selbstständigkeit streben<strong>de</strong>n Stadt gab es Opposition gegen die Herrschaft <strong>de</strong>r Kreuzritter, die mit Gewalt unterdrückt wur<strong>de</strong>, was wie<strong>de</strong>rum von jenen gerne<br />
übersehen wur<strong>de</strong>, die eine rein inner<strong>de</strong>utsche Einigkeit unterstreichen wollen. Hierbei stellten insbeson<strong>de</strong>re die <strong>de</strong>utschen Händler <strong>de</strong>r Hanse eine Konkurrenz <strong>zu</strong> Elbing dar, <strong>de</strong>r<br />
nahegelegenen Hafenstadt <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns, die jedoch damals durch Verlandung ihren direkten Zugang durch die Frische Nehrung <strong>zu</strong>r Ostsee verlor, was das plötzliche Interesse an Danzig<br />
erklären mag. Durch <strong>de</strong>n Konflikt mit <strong>de</strong>m Königreich Polen war <strong>zu</strong><strong>de</strong>m nun <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l entlang <strong>de</strong>r Weichsel beeinträchtigt, so dass die Danziger aus eigenem Interesse immer auch auf<br />
ein gutes Verhältnis <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Herrschern im Hinterland bedacht sein mussten.<br />
Zur Or<strong>de</strong>nszeit bestand Danzig aus vier o<strong>de</strong>r fünf Teilen:<br />
• Or<strong>de</strong>nsburg<br />
• Hakelwerk (erste Stadt mit Mag<strong>de</strong>burger Recht, wahrscheinlich bis En<strong>de</strong> 14 Jh.)<br />
• Rechtstadt (seit 1343) – stärkste <strong>de</strong>r Städte Danzigs, seit 1361 – Vollmitglied <strong>de</strong>r Hanse; mit zwei <strong>zu</strong>sätzlichen Teilen:<br />
• Speicherinsel<br />
• Alte Vorstadt<br />
• Altstadt (seit 1370) – großteils Stadt <strong>de</strong>r Handwerker<br />
• Neustadt („Junge Stadt Danzig“, 1380–1455) – gegrün<strong>de</strong>t vom Or<strong>de</strong>n gegen die Rechtstadt, nach <strong>de</strong>m Aufstand <strong>de</strong>r Bürger <strong>de</strong>r Rechtstadt von 1454 total zerstört.<br />
Nach <strong>de</strong>r Eroberung durch <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n stieg die Zuwan<strong>de</strong>rung Deutscher stark an, ausgelöst durch die wirtschaftliche Prosperität <strong>de</strong>r Hansestadt. 1343 verlieh <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt Kulmer<br />
Recht, 1361 wur<strong>de</strong> man Vollmitglied <strong>de</strong>r Hanse.<br />
Hansestadt<br />
Danzig war be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>s Mitglied <strong>de</strong>r Hanse und nahm seit 1361 an <strong>de</strong>n Hansetagen teil. Es blieb bis <strong>zu</strong>m letzten Hansetag im Jahr 1669 Teil <strong>de</strong>r Hanse, die jedoch ab En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 15.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts immer unbe<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r wur<strong>de</strong>. Zusammen mit Elbing und Thorn war Danzig die führen<strong>de</strong> preußische Hansestadt.<br />
Freie Stadt unter polnischer Oberhoheit 1454–1793<br />
Der weitere Verlauf <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt wird im Artikel über Pommerellen im Detail ausgeführt. Aus Un<strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>nheit über die Politik <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns nach <strong>de</strong>r Schlacht von Tannenberg<br />
(1410) stellte sich <strong>de</strong>r Preußische Bund 1454 unter <strong>de</strong>n Schutz <strong>de</strong>r polnischen Krone, was <strong>de</strong>n Dreizehnjährigen Krieg auslöste, in <strong>de</strong>m die Städte gegen die Burgen <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns kämpften<br />
bzw. diese wie in Thorn schleiften. Der polnische König hatte Schwierigkeiten, ein Heer für <strong>de</strong>n Krieg <strong>zu</strong>sammen<strong>zu</strong>bekommen, das bei <strong>de</strong>r einzigen offenen Schlacht von Konitz<br />
geschlagen wur<strong>de</strong>. Der Fortgang <strong>de</strong>s Krieges zwang jedoch <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n wirtschaftlich in die Knie.<br />
Im Zweiten Frie<strong>de</strong>n von Thorn verblieb 1466 <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n das spätere Ostpreußen, jedoch ohne die Marienburg, Elbing und das Ermland. Die westlichen Teile <strong>de</strong>s damaligen<br />
Preußens mit <strong>de</strong>m ehemaligen Herzogtum Pommerellen, Danzig, <strong>de</strong>m Kulmerland und Thorn wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>m König von Polen als Königliches Preußen unterstellt, wobei die<br />
Stadtrepubliken Danzig, Thorn und Elbing eine weitgehen<strong>de</strong> politische, wirtschaftliche und kulturelle Autonomie erhielten, die ihnen teilweise schon während <strong>de</strong>s Krieges garantiert<br />
wor<strong>de</strong>n waren. Da<strong>zu</strong> gehörte das sogenannte Große Privileg, das König Kasimir IV. 1457 <strong>de</strong>r Stadt Danzig verliehen hatte. [5]<br />
Im Jahr 1470 wur<strong>de</strong> die Peter von Danzig, ein ursprünglich französisches Schiff, als erster großer Kraweel <strong>de</strong>r Hanse für Kriegszwecke ausgerüstet.<br />
Ab 1522 begann in Danzig die Reformation mit <strong>de</strong>m evangelischen Prediger Jacob Hegge. Ab etwa 1534 sie<strong>de</strong>lten sich in und um Danzig auch aus <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n geflüchtete<br />
Mennoniten an [6].<br />
Die Union von Lublin von 1569 gefähr<strong>de</strong>t die Autonomie auch von Danzig. In zahlreichen Konflikten behauptete Danzig weiterhin Eigenständigkeit.[7] So wur<strong>de</strong> 1577 <strong>de</strong>m neuen
König Stefan Bathory die Huldigung verweigert, solange dieser nicht die Privilegien erneuert. Nach erfolglosen Belagerungen von Danzig willigte <strong>de</strong>r König ein.<br />
1612 kam es <strong>zu</strong>m Streit zwischen Lutheranern und Reformierten um <strong>de</strong>n Bau eines Hochaltars in <strong>de</strong>r Kirche <strong>zu</strong> Sankt Johann, <strong>de</strong>n die Reformierten, allen voran Pfarrer Jakob Adam,<br />
ablehnten.<br />
1615 führte <strong>de</strong>r Stadtsekretär Reinhold Kleinfeld in einem Streit <strong>de</strong>r Stadt Elbing mit <strong>de</strong>m ermländischen Bischof – <strong>de</strong>m Initiator <strong>de</strong>r Gegenreformation in Polen – <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m<br />
Bürgermeister und <strong>de</strong>m Ratsverwandten die Delegation Danzigs an. Hauptstreitpunkt war die For<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s Bischofs an die Evangelischen nach Herausgabe einer Kirche. Im letzten<br />
Moment wur<strong>de</strong> 1616 ein Krieg abgewen<strong>de</strong>t.<br />
1701 wur<strong>de</strong> in Danzig und Königsberg mit <strong>de</strong>n Arbeiten am Bernsteinzimmer begonnen.<br />
Königreich Preußen 1793–1807<br />
Im Rahmen <strong>de</strong>r Zweiten Polnischen Teilung kam Danzig 1793 <strong>zu</strong>m Königreich Preußen. Damit verlor es seinen eingeschränkten Autonomiestatus.<br />
Napoleonische Freie Stadt 1807–1813<br />
Im Preußisch-französischen Krieg kapitulierte Danzig im Mai 1807 nach dreimonatiger Belagerung. Infolge <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns von Tilsit hatte die Stadt formal <strong>de</strong>n Status einer „freien Stadt“,<br />
wur<strong>de</strong> aber von einem französischen Gouverneur regiert und musste 20 Millionen Francs Kriegssteuer aufbringen. Im November 1813 ergaben sich französische und polnische Truppen<br />
nach elfmonatiger Belagerung einem russisch-preußischen Heer, und Danzig kam durch <strong>de</strong>n Wiener Kongress wie<strong>de</strong>r an Preußen.<br />
Wie<strong>de</strong>r an Preußen 1815–1919<br />
In <strong>de</strong>r zwischen 1816 und 1823 sowie 1878 und 1919 bestehen<strong>de</strong>n Provinz Westpreußen war Danzig die Hauptstadt. Während <strong>de</strong>r Märzrevolution 1848 beteiligte sich Danzig an <strong>de</strong>n<br />
Wahlen <strong>zu</strong>r Frankfurter Nationalversammlung. 1848 waren im Danziger Hafen 104 Han<strong>de</strong>lsschiffe beheimatet.[8]<br />
1831 hatte die preußische Verwaltung erstmals eine Erhebung über die Muttersprache <strong>de</strong>r Einwohner <strong>de</strong>s Regierungsbezirks Danzig durchgeführt. Laut <strong>de</strong>r Erhebung waren im<br />
Regierungsbezirk Danzig, <strong>de</strong>r die Stadt Danzig und das Umland umfasste, 24 Prozent <strong>de</strong>r Bewohner polnisch- bzw. kaschubisch- und 76 Prozent <strong>de</strong>utschsprachig.<br />
1852 erhielt Danzig im Zuge <strong>de</strong>s Eisenbahnbaus Anschluss an die seit 1842 im Aufbau befindliche preußische Ostbahn Berlin–Königsberg. Der erste direkte Eisenbahnanschluss<br />
eröffnete via Berlin <strong>de</strong>n Zugang <strong>zu</strong>m mitteleuropäischen Eisenbahnnetz.<br />
In <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts erlebte Danzig einen wirtschaftlichen Aufschwung und wur<strong>de</strong> wie auch das nahegelegene Elbing <strong>zu</strong> einem Zentrum <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnen Schiffbaues<br />
(Schichau-Werke) und <strong>de</strong>r Industrialisierung in Westpreußen. Begleitet wur<strong>de</strong> die Industrialisierung durch einen beschleunigten Bevölkerungsanstieg.<br />
Freie Stadt Danzig 1920–1939<br />
Mit <strong>de</strong>m Vertrag von Versailles 1919 wur<strong>de</strong> Danzig mit seinen umliegen<strong>de</strong>n Gebieten vom Deutschen Reich getrennt und am 15. November 1920 <strong>zu</strong> einem unabhängigen Staat, <strong>de</strong>r<br />
Freien Stadt Danzig, erklärt. Dieser Staat stand allerdings unter Aufsicht <strong>de</strong>s Völkerbunds; polnische und britische Truppen gewährleisteten <strong>de</strong>n neuen Status <strong>de</strong>r Stadt. Da diese<br />
Entscheidung nicht von einer Volksabstimmung abhängig gemacht wur<strong>de</strong>, sahen das Deutsche Reich und die mehrheitlich <strong>de</strong>utschen Bewohner <strong>de</strong>r Stadt das vom US-Präsi<strong>de</strong>nten<br />
Wilson gefor<strong>de</strong>rte Selbstbestimmungsrecht <strong>de</strong>r Völker verletzt.<br />
Am 6. Dezember 1920 konstituierte sich <strong>de</strong>r erste Danziger Volkstag, <strong>de</strong>r aus freien Wahlen hervorgegangen war. Er bestand aus 120 Abgeordneten. Oberbürgermeister Heinrich Sahm<br />
wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Präsi<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>s Senats <strong>de</strong>r Freien Stadt Danzig gewählt. Die Parteien stellten die folgen<strong>de</strong>n Abgeordneten:<br />
• Deutschnationale Volkspartei: 34<br />
• Freie Wirtschaftliche Vereinigung: 12
• Deutsche Demokratische Partei: 10<br />
• Zentrumspartei: 17<br />
• Sozial<strong>de</strong>mokratische Partei: 19<br />
• Unabhängige Sozial<strong>de</strong>mokraten: 21<br />
• Polnische Partei: 7.<br />
1923 gaben im Rahmen einer Volkszählung 95 Prozent <strong>de</strong>r Bürger Deutsch und vier Prozent Polnisch bzw. Kaschubisch als Muttersprache an.<br />
• Ergebnis <strong>de</strong>r Volkszählung vom 1. November 1923<br />
•<br />
• Nationalität Gesamt Deutsch Deutsch und Polnisch und Russisch, Jiddisch Keine<br />
• Polnisch Kaschubisch Ukrainisch Angabe<br />
• Stadt Danzig 335.921 327.827 1.108 6.788 99 22 77<br />
• Landkreis Danzig 30.809 20.666 521 5.239 2.529 580 1.274<br />
• Gesamt 366.730 348.493 1.629 12.027 2.628 602 1.351<br />
• Prozent 100 % 95,03 % 0,44 % 3,28 % 0,72 % 0,16 % 0,37 %<br />
•<br />
Die Freie Stadt Danzig bestand damals aus <strong>de</strong>n Städten Danzig und Zoppot sowie <strong>de</strong>n kleinen Städten Tiegenhof, Neuteich, Oliva und Ohra, wobei Neuteich und Tiegenhof im Danziger<br />
Wer<strong>de</strong>r bzw. im Kreis Großes Wer<strong>de</strong>r lagen. Die polnische Min<strong>de</strong>rheit besaß eigene Schulen und ein Vereinswesen, wur<strong>de</strong> aber von <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bevölkerung <strong>de</strong>s Öfteren mit<br />
Missgunst betrachtet und diskriminiert; außer<strong>de</strong>m lebten in Danzig vor 1939 Kaschuben und Russen. Unter <strong>de</strong>n Einwohnern fan<strong>de</strong>n sich auch zahlreiche Ju<strong>de</strong>n, die nach 1939 enteignet<br />
und <strong>de</strong>portiert wur<strong>de</strong>n.<br />
Danzig hatte in <strong>de</strong>r Zwischenkriegszeit nach einem anfänglichen Wirtschaftsaufschwung erhebliche wirtschaftliche Probleme, bedingt durch die Zollgrenzen <strong>zu</strong>m Deutschen Reich, die<br />
globale Wirtschaftskrise und eine wenig entwickelte Industrie.<br />
Der Hafen und <strong>de</strong>r Zoll sowie die internationalen Eisenbahnverbindungen – jedoch nicht die Straßenbahn und Kleinbahnen im Freistaatgebiet – wur<strong>de</strong>n unter polnische Verwaltung<br />
gestellt. Die Republik Polen legte im Danziger Hafen (Westerplatte) ein Munitionslager an und stationierte dort ihr Militär. Des Weiteren war es <strong>de</strong>m polnischen Staat zwecks<br />
Verbindung <strong>de</strong>s Hafengebiets mit Polen erlaubt, eine Post- und Telegrafenverwaltung, das so genannte „Polnische Postamt“, im Hafengebiet ein<strong>zu</strong>richten.<br />
Die problematischen Verhältnisse, die Anlass für viele – unbeachtet gebliebene – Beschwer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Freien Stadt Danzig an <strong>de</strong>n Völkerbund waren, schufen unter <strong>de</strong>r Bevölkerung<br />
Ressentiments gegen Polen. Diese Stimmung wur<strong>de</strong> verstärkt durch die Zuwan<strong>de</strong>rer aus <strong>de</strong>n ehemals <strong>de</strong>utschen Gebieten um Posen, die unter Diskriminierungen <strong>zu</strong> lei<strong>de</strong>n hatten, wie<br />
sie dort nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ersten Weltkriegs von offizieller polnischer Seite wenn nicht geför<strong>de</strong>rt, so doch wohlwollend gedul<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n.<br />
Mitte 1933 kamen auch in Danzig die Nationalsozialisten (NSDAP) an die Macht, die sich aber wegen <strong>de</strong>r internationalen Kontrolle <strong>de</strong>s Gebietes bis 1936/37 mit Oppositionsparteien<br />
abfin<strong>de</strong>n mussten, die bei <strong>de</strong>n Volkstagswahlen von 1935 (trotz versuchter Wahlbeeinflussungen) eine Zwei-Drittel-Mehrheit <strong>de</strong>r Nationalsozialisten klar verhin<strong>de</strong>rn konnten. Während<br />
Hermann Rauschning 1933/34 als Senatspräsi<strong>de</strong>nt eine Annäherung <strong>zu</strong> Polen versuchte, blieb sein Nachfolger Arthur Greiser da<strong>zu</strong> auf Distanz und führte die Freie Stadt Danzig in<br />
<strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> (auch finanzielle) Abhängigkeit <strong>zu</strong>m Deutschen Reich. En<strong>de</strong> August 1939 erklärte sich <strong>de</strong>r Gauleiter Albert Forster selbst <strong>zu</strong>m Staatsoberhaupt und verfügte am 1.<br />
September 1939 völkerrechtswidrig, nach<strong>de</strong>m reichs<strong>de</strong>utsche Streitkräfte das polnische Munitions<strong>de</strong>pot auf <strong>de</strong>r Westerplatte angegriffen hatten, <strong>de</strong>n Anschluss Danzigs an das Deutsche<br />
Reich. Der <strong>de</strong>utsche Angriff auf die Westerplatte wird heute als Beginn <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges gesehen.
Zweiter Weltkrieg: Reichsgau Danzig-Westerpreußen 1939–1945<br />
In <strong>de</strong>n Zeiten <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges wur<strong>de</strong>n insbeson<strong>de</strong>re die Ju<strong>de</strong>n, aber auch die polnische Min<strong>de</strong>rheit in Danzig <strong>de</strong>portiert (Ju<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n bereits seit 1933 systematisch verfolgt<br />
und entrechtet), viele verloren ihr Leben. An<strong>de</strong>re wie<strong>de</strong>rum ließen sich auf <strong>de</strong>r sogenannten Volksliste als Deutsche eintragen und entgingen so <strong>de</strong>r Verfolgung durch<br />
Nationalitätswechsel. Da<strong>zu</strong> wur<strong>de</strong>n viele dieser Menschen in Konzentrationslager (wie das KZ Stutthof) <strong>de</strong>portiert und ermor<strong>de</strong>t.<br />
1941 befand sich in Danzig-Langfuhr die Flugzeugführerschule A/B 6. En<strong>de</strong> März 1945 wur<strong>de</strong> Danzig von <strong>de</strong>r Roten Armee im Zuge <strong>de</strong>r Schlacht um Ostpommern eingeschlossen und<br />
erobert. Durch die Kampfhandlungen sind große Teile <strong>de</strong>r Innenstadt (bestehend aus Rechtstadt, Altstadt, Vorstadt und Nie<strong>de</strong>rstadt) zerstört wor<strong>de</strong>n. Während und nach <strong>de</strong>m Einmarsch<br />
wur<strong>de</strong>n die noch erhaltenen Häuser <strong>de</strong>r Innenstadt von <strong>de</strong>n sowjetischen Soldaten geplün<strong>de</strong>rt und in Brand gesteckt. Insgesamt wur<strong>de</strong> ein sehr hoher Anteil <strong>de</strong>r Bebauung zerstört.<br />
Nachkriegszeit 1945–1990<br />
Bereits in <strong>de</strong>n ersten Nachkriegsmonaten wur<strong>de</strong>n die meisten in Danzig verbliebenen Deutschen von <strong>de</strong>n polnischen Behör<strong>de</strong>n vertrieben. Zurück blieb eine Min<strong>de</strong>rheit von etwa fünf<br />
Prozent <strong>de</strong>r ursprünglichen Stadtbevölkerung mit <strong>zu</strong>meist auch polnischen Vorfahren.<br />
Aufgrund <strong>de</strong>s Bierut-Dekretes wur<strong>de</strong> das Eigentum von Personen <strong>de</strong>utscher Nationalität und Herkunft enteignet. Straftaten, die gegen die <strong>de</strong>utsche Zivilbevölkerung begangen wur<strong>de</strong>n,<br />
wur<strong>de</strong>n juristisch nur bedingt verfolgt. Erst nach <strong>de</strong>r politischen Wen<strong>de</strong> in Polen wur<strong>de</strong> damit angefangen, diese Geschehnisse auf<strong>zu</strong>arbeiten.<br />
Die Danziger Rechtstadt sowie zahlreiche Bau<strong>de</strong>nkmäler <strong>de</strong>r Altstadt wur<strong>de</strong>n in Anlehnung an frühneuzeitliche Vorbil<strong>de</strong>r rekonstruiert.<br />
Zugleich wur<strong>de</strong>n, insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n Sechzigern, in <strong>de</strong>n Vorstädten wie Przymorze Trabantensiedlungen errichtet. Charakteristisch sind hier die sogenannten Wellenhäuser (Falowiecs)<br />
– Wohnblöcke von teilweise mehreren hun<strong>de</strong>rt Metern Länge in Plattenbauweise, die mäandrieren und so eine Assoziation <strong>zu</strong>m nahe gelegenen Meer hervorrufen sollen.<br />
Bereits 1970 legten Streiks in <strong>de</strong>n Danziger Werften <strong>de</strong>n Grundstein für die spätere Emanzipation <strong>de</strong>r polnischen Nation (siehe auch Aufstand vom Dezember 1970 in Polen).<br />
Anfang <strong>de</strong>r 1980er organisierte schließlich die Gewerkschaftsbewegung Solidarność unter Führung von Lech Wałęsa in <strong>de</strong>r Danziger Werft ihren Wi<strong>de</strong>rstand gegen die kommunistische<br />
Herrschaft in Polen.<br />
Gegenwart<br />
Mit <strong>de</strong>m Fall <strong>de</strong>s Eisernen Vorhanges verän<strong>de</strong>rte sich die Lage <strong>de</strong>r nationalen Min<strong>de</strong>rheiten in <strong>de</strong>r Republik Polen, auch die <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Min<strong>de</strong>rheit. In Danzig wur<strong>de</strong> im Jahre 1990<br />
<strong>de</strong>r Bund <strong>de</strong>r Deutschen Min<strong>de</strong>rheit gegrün<strong>de</strong>t (Mitglie<strong>de</strong>rstärke: 5512 Mitglie<strong>de</strong>r; Quelle: Bund <strong>de</strong>r Deutschen Min<strong>de</strong>rheit, Danzig, 2005).<br />
Günter Grass fasste im Roman Die Blechtrommel die Geschichte Danzigs lapidar so <strong>zu</strong>sammen (bevor er sie ausführlicher nachzeichnet):<br />
• Zuerst kamen die Rugier, dann kamen die Goten und Gepi<strong>de</strong>n, sodann die Kaschuben, von <strong>de</strong>nen Oskar in direkter Linie abstammt. Bald darauf schickten die Polen <strong>de</strong>n Adalbert<br />
von Prag. Der kam mit <strong>de</strong>m Kreuz und wur<strong>de</strong> von Kaschuben o<strong>de</strong>r Pruzzen mit <strong>de</strong>r Axt erschlagen.<br />
• Das geschah in einem Fischerdorf und das Dorf hieß Gyddanyzc. Aus Gydannyzc machte man Danczik, aus Danczik wur<strong>de</strong> Dantzig, das sich später Danzig schrieb, und heute<br />
heißt Danzig Gdańsk. (Die Blechtrommel, Luchterhand 1959, S. 379)<br />
Bevölkerung<br />
Einwohnerzahl<br />
• Jahr 1821 1831 1852 1861 1871 1880 1890 1900 1910 1929 1946 1970 2005<br />
• Einwohnerzahl [9] 55.395 54.660 61.349 72.280 87.968 108.551 120.338 140.563 170.337 256.403 118.000 365.600 458.053
Konfessionen<br />
Entwicklung zwischen 1815 und <strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg (nur Stadt, <strong>zu</strong>m Umland siehe Landkreis Danzig)[10]:<br />
• evangelisch katholisch jüdisch<br />
• Jahr absolut % absolut % absolut %<br />
• 1821 39.343 71,0 13.137 23,7 2.288 4,1<br />
• 1852 43.957 71,7 14.410 23,5 2.550 4,2<br />
• 1871 62.015 70,52 3.428 26,6 1.625 1,8<br />
• 1890 80.723 67,13 5.851 29,8 2.535 2,1<br />
• 1910 110.253 64,75 5.513 32,6 2.390 1,4<br />
Laut Staatshandbuch <strong>de</strong>s Jahres 1926 war das religiöse Bekenntnis in Danzig wie folgt verteilt:Datum evangelisch katholisch mosaisch an<strong>de</strong>re<br />
• Datum evangelisch katholisch mosaisch an<strong>de</strong>re<br />
•<br />
• 1.12.1910 207.324 112.692 2.717 7.519<br />
• 1.11.1923 218.137 130.174 7.282 11.137<br />
• 31.8.1924 222.818 140.797 9.239 11.141<br />
Bemerkenswert ist, dass von <strong>de</strong>n Danziger Ju<strong>de</strong>n am Stichtag 1. November 1923 nur 2500 die Danziger Staatsangehörigkeit besaßen.[11]<br />
Bildung<br />
In Danzig gibt es u. a. zehn Hochschulen mit rund 60.000 Stu<strong>de</strong>nten und jährlich ca. 10.000 Absolventen (Stand: 2001)wie<br />
• Universität Danzig (Uniwersytet Gdański) (33.000 Stu<strong>de</strong>nten)<br />
• Technische Universität Danzig (Politechnika Gdańska) (18.000 Stu<strong>de</strong>nten)<br />
• Danziger Medizinische Universität (Gdański Uniwersytet Medyczny)<br />
• Sporthochschule Danzig (Aka<strong>de</strong>mia Wychowania Fizycznego im. Jędrzeja Śnia<strong>de</strong>ckiego)<br />
• Musikaka<strong>de</strong>mie Danzig (Aka<strong>de</strong>mia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki)<br />
• Kunstaka<strong>de</strong>mie Danzig (Aka<strong>de</strong>mia Sztuk Pięknych)<br />
• Ateneum – Szkoła Wyższa<br />
• Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna<br />
• Gdańska Wyższa Szkoła Administracji<br />
• Wyższa Szkoła Bankowa<br />
• Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna<br />
• Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku
• Wyższa Szkoła Zarządzania sowie<br />
• Polnische Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Wissenschaften, Danzig ( regionale Abteilung ).<br />
Wappen<br />
Das Großwappen <strong>de</strong>r Stadt Danzig besteht aus einem von zwei gol<strong>de</strong>nen Löwen flankierten, gotischen Schild. Der rote Wappenschild enthält oben eine offene gol<strong>de</strong>ne Krone und<br />
darunter zwei gleicharmige, silberne (weiße) Kreuze. Zu Füßen <strong>de</strong>s Schil<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>r Schildhalter zeigt es in einer gol<strong>de</strong>nen Schleife die schwarz geschriebene Devise: nec temere nec<br />
timi<strong>de</strong> – we<strong>de</strong>r unbesonnen noch furchtsam.<br />
Wirtschaft<br />
Danzig ist seit <strong>de</strong>r Hansezeit als Han<strong>de</strong>lsstadt bekannt vor allem wegen <strong>de</strong>r günstigen Lage an <strong>de</strong>r Ostsee. Der Hafen spielt immer noch eine große Rolle für die polnische Wirtschaft mit<br />
23,3 Mio. t Frachtumschlag (2004). Die wichtigsten Industrien <strong>de</strong>r Stadt sind <strong>de</strong>r Schiffbau (z. B. die Firmen Gdansk Shipyard und Northern Shipyard SA), die petrochemische und<br />
chemische Industrie (z. B. die Grupa LOTOS SA) sowie neuerdings Hochtechnologien wie Elektronik (z. B. Intel o<strong>de</strong>r WS OY (Young Digital Poland), Telekommunikation und<br />
Informationstechnologie (z. B. Wirtualna Polska, Lido Technologies). Auch die pharmazeutische Industrie, die Lebensmittelindustrie (z. B. PepsiCo (USA), Dr. Oetker (Deutschland),<br />
Fazer OY (Finnland) und Baltic Malt/Weissheimer Malz (Deutschland)) und <strong>de</strong>r Kosmetiksektor gewinnen an Be<strong>de</strong>utung.<br />
Verkehr<br />
Danzig wird bis 2013 über die Autobahn A1 an Mittel- und Südpolen sowie die Slowakei und Tschechien angeschlossen.<br />
Die Stadt ist mit <strong>de</strong>r Eisenbahn direkt von Berlin, Kaliningrad (Königsberg) und <strong>de</strong>n wichtigsten polnischen Städten <strong>zu</strong> erreichen. Es gibt eine S-Bahn (SKM Szybka Kolej Miejska w<br />
Trójmieście), die Danzig mit Sopot (Zoppot), Gdynia (Gdingen) und Wejherowo verbin<strong>de</strong>t.<br />
Seit <strong>de</strong>m Beitritt Polens <strong>zu</strong>r EU wächst <strong>de</strong>r Danziger Flughafen stark und wird unter an<strong>de</strong>rem von <strong>de</strong>n Billigfluggesellschaften Ryanair und Wizzair angeflogen.<br />
Die Stadt ist <strong>zu</strong><strong>de</strong>m mit <strong>de</strong>r Fähre von Schwe<strong>de</strong>n (Karlskrona, Malmö und Nynäshamn) und Dänemark (Kopenhagen) <strong>zu</strong> erreichen.<br />
Der innerstädtische Verkehr wird durch Straßenbahnen und ein dichtes Busnetz bewältigt.<br />
Tourismus<br />
Danzig ist <strong>de</strong>r Startpunkt <strong>de</strong>s Radweges EuroVelo 9 (Ostee-Adria-Route o<strong>de</strong>r Bernsteinroute/ PL: Szlak bursztynowy), <strong>de</strong>r von Danzig durch Polen, Tschechien, Österreich und<br />
Slowenien nach Pula in Kroatien läuft. Die rund um die Ostsee führen<strong>de</strong> EuroVelo 10 (Ostsee-Radweg o<strong>de</strong>r Hanse-Route / PL: Obwód Hanzeatycki) läuft ebenfalls durch Danzig.<br />
Der Tourismus ist eine wichtige Einkommensquelle mit etwa 1,5 Mio. Touristen jährlich.<br />
Regelmäßige Veranstaltung: Im August fin<strong>de</strong>t in <strong>de</strong>r Altstadt <strong>de</strong>r Dominikanermarkt statt, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m auch zahlreiche Auswärtige anreisen.<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
• Krantor<br />
• Grünes Tor<br />
• Rechtstädtisches Rathaus<br />
• Marienkirche<br />
• Trinitatiskirche, Grabstätte von Anton Möller, „Der Maler von Danzig“
• Königliche Kapelle<br />
• Großes Zeughaus<br />
• Artushof<br />
• Neptunbrunnen<br />
• Große Mühle<br />
• Katharinenkirche<br />
• Altstädtisches Rathaus<br />
• Solidarność-Denkmal am Tor 2<br />
• Frauengasse Danzig: Sie gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n schönsten Straßen <strong>de</strong>r Stadt und verläuft von <strong>de</strong>r Marienkirche bis <strong>zu</strong>m mittelalterlichen Frauentor an <strong>de</strong>r Mottlau. Mit ihren schmalen<br />
und reich geschmückten Bürgerhäusern und <strong>de</strong>n Beischlägen ist sie ein Beispiel für die einstige Danziger Straßenbebauung.<br />
• Langer Markt<br />
• Langgasse<br />
• Langgassertor<br />
• Lange Brücke<br />
• Nationalmuseum (insbeson<strong>de</strong>re gotische Malerei und Plastik, Hans Memlings „Jüngstes Gericht“)<br />
• Schiffsmuseum mit <strong>de</strong>m Museumsschiff Soł<strong>de</strong>k<br />
• Lwi Dwór typisches Fachwerkhaus nie<strong>de</strong>rländischer Siedler <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
• Westerplatte-Denkmal<br />
Partnerstädte<br />
• Astana (Kasachstan)<br />
• Barcelona (Spanien)<br />
• Bremen (Deutschland)<br />
• Cleveland (Vereinigte Staaten)<br />
• Helsingør (Dänemark)<br />
• Kaliningrad (Russland)<br />
• Kalmar (Schwe<strong>de</strong>n)<br />
• Marseille (Frankreich)<br />
• Nizza (Frankreich) O<strong>de</strong>ssa (Ukraine)<br />
• Palermo (Italien)<br />
• Rotterdam (Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>)<br />
• Rouen (Frankreich)<br />
• Sankt Petersburg (Russland)<br />
• Sefton (Vereinigtes Königreich)<br />
• Shanghai (Volksrepublik China)<br />
• Turku (Finnland)<br />
• Vilnius (Litauen)
Persönlichkeiten<br />
Zu <strong>de</strong>n bekanntesten Persönlichkeiten von Danzig gehören Ludwig August Clericus, Daniel Gabriel Fahrenheit, Andreas Schlüter, Arthur Schopenhauer, Johannes Hevelius, Daniel<br />
Nikolaus Chodowiecki, Hugo Conwentz, Günter Grass, Rupert Neu<strong>de</strong>ck, Pawel Huelle, Lech Wałęsa, Dariusz Michalczewski, Tomasz Wałdoch, Andrzej Grubba und Donald Tusk.<br />
Verweise<br />
Bibliografie<br />
• Bibliographie <strong>zu</strong>r Geschichte Danzig bei LitDok Ostmitteleuropa / Her<strong>de</strong>r-Institut (Marburg)<br />
Literatur<br />
• Udo Arnold: Danzig. Warschau 1998<br />
• Frank Fischer: Danzig. Die zerbrochene Stadt, Propyläen Verlag, Berlin 2006<br />
• Fritz Krischen: Kunst und Geschichte, Danzig : [Techn. Hochschule], 1931<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ Główny Urząd Statystyczny, „LUDNOŚĆ – STAN I STRUKTURA W PRZEKROJU TERYTORIALNYM“, Stand vom 31. Dez. 2009 (WebCite)<br />
2. ↑ Heinrich Gottfried Philipp Gengler: Regesten und Urkun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Verdassungs- und Rechtsgeschichte <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Städte im Mittelalter, Erlangen 1863, S. 700 ff., online.<br />
3. ↑ Ipse vero (Adalbertus) adiit primo urbem Gyddanyzc, quam ducis (Poloniorum Bolizlavi) latissima regna dirimentum maris confinina tangunt. Kazimierz Lucyan Ignacy<br />
Römer: Beiträge <strong>zu</strong>r Beantwortung <strong>de</strong>r Frage nach <strong>de</strong>r Nationalität <strong>de</strong>s Nicolaus Copernicus, 1872, 212 Seiten<br />
4. ↑ Johannes Voigt: Geschichte Preußens von <strong>de</strong>n ältesten Zeiten bis <strong>zu</strong>m Untergange <strong>de</strong>r Herrschaft <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns. Vierter Band: Die Zeit von <strong>de</strong>r Unterwerfung<br />
Preußens 1283 bis <strong>zu</strong> Dieterichs von Altenburg Tod 1341, Königsberg 1830, S. 210–219, online.<br />
5. ↑ Danzig Museum: Aus <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Danzig<br />
6. ↑ Mennonitisches Lexikon, Band 1. 1913, S. 426.<br />
7. ↑ Antoni Walewski: Geschichte <strong>de</strong>r hl. Ligue und Leopolds I. vom Umschwung im ... S. 344<br />
8. ↑ Übersicht üb<strong>de</strong>r die Preußische Han<strong>de</strong>lsmarine (E. Wendt & Co., Hrsg.), Stettin 1848, S. 6-8.<br />
9. ↑ Für 1821, 1831, 1852, 1861, 1871, 1890, 1900, 1910: Leszek Belzyt: Sprachliche Min<strong>de</strong>rheiten im preußischen Staat 1815–1914. Marburg 1998. S.95;<br />
10.• für 1880 und 1929; http://www.xxx<br />
11. für 31. Dez. 2005; Główny Urząd Statystyczny; http://www.xxx<br />
12.↑ Leszek Belzyt: Sprachliche Min<strong>de</strong>rheiten im preußischen Staat 1815–1914. Marburg 1998. S. 95<br />
13.↑ Echt, Samuel: Die Geschichte <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n in Danzig, Verlag Rautenberg, Leer/Ostfriesland 1972.<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Danzig<br />
Dieser Artikel beschreibt die Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Danzig (polnisch Gdańsk).<br />
Vorgeschichte<br />
Polnische Wissenschaftler haben in komplexer Zusammenarbeit seit 1948 archäologische Untersuchungen <strong>zu</strong>r Vorgeschichte Danzigs durchgeführt. Grabungen am Rechtstädtischen<br />
Rathaus und am Neptunsbrunnen haben mehrere Schichten von aufeinan<strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n sehr frühen Siedlungsspuren gera<strong>de</strong> an jener Stelle aufge<strong>de</strong>ckt, wo innerhalb <strong>de</strong>r stark<br />
versumpften Mottlaunie<strong>de</strong>rung ein als Baugrund geeigneter Sandrücken vom Hagelsberg im Verlaufe <strong>de</strong>r heutigen Langgasse (pl. Długa) <strong>zu</strong>r Mottlau führt.<br />
• Die älteste Schicht könnte auf das 7. Jahrhun<strong>de</strong>rt datiert wer<strong>de</strong>n. Fragmente einer relativ starken Kulturschicht wer<strong>de</strong>n auf die zweite Hälfte <strong>de</strong>s 9. o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Anfang <strong>de</strong>s 10.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts datiert. Diese Siedlung war mit einem Erdwall mit Faschinenverstärkung umgeben. Die Bewohner trieben Ackerbau, Vieh<strong>zu</strong>cht und Fischfang und übten<br />
Handwerke aus, wie z. B. das Schmie<strong>de</strong>handwerk.<br />
• Hierauf folgt eine Siedlung <strong>de</strong>s 10. bis 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts, die ebenfalls durch eine starke Holz-Er<strong>de</strong>-Befestigung gesichert war, in <strong>de</strong>r sich aber keine Spuren von Tierdung fan<strong>de</strong>n.<br />
Sie war <strong>de</strong>mnach eine Siedlung <strong>de</strong>s Hafen-Han<strong>de</strong>lstyps und dürfte auch über einen Markt verfügt haben. Ihre räumliche Aus<strong>de</strong>hnung wird auf höchstens drei Hektar, ihre<br />
Einwohnerzahl auf höchstens 2.000 Bewohner geschätzt, doch das sind sehr hypothetische Annahmen. Demnach dürfte das älteste Siedlungsgebiet Danzigs auf <strong>de</strong>m Terrain <strong>de</strong>r<br />
späteren Rechtstadt gelegen haben.<br />
Viele Fragen bleiben noch offen. So die nach <strong>de</strong>m Verhältnis <strong>de</strong>r einzelnen Siedlungsschichten <strong>zu</strong>einan<strong>de</strong>r, aber auch die Frage, ob schon die ältesten aufge<strong>de</strong>ckten Siedlungen von<br />
Slawen bewohnt waren. Es ist <strong>zu</strong> be<strong>de</strong>nken, dass vor <strong>de</strong>m Eindringen <strong>de</strong>r Slawen Prußen auch westlich <strong>de</strong>r Weichsel bis hin <strong>zu</strong>r Persante sie<strong>de</strong>lten, wie aus vielen Orts- und<br />
Gewässernamen und <strong>de</strong>r Tatsache <strong>zu</strong> erschließen ist, dass die kaschubische Sprache Substratelemente aus <strong>de</strong>m Altpreußischen enthält. In geschichtlicher Zeit lebten noch Prußen in<br />
Danzig. In <strong>de</strong>r Danziger Gegend gab es noch geschlossene prußische Siedlungen. Im Jahre 997 wur<strong>de</strong>n Prußen in <strong>de</strong>r Danziger Gegend getauft, wie es aus <strong>de</strong>r Vita Sankt Adalbert von<br />
Prag <strong>zu</strong> ersehen ist. Obwohl die Küstengegend schon lange vorher besie<strong>de</strong>lt war, hat man das allgemein bekannte Datum benutzt um 1997 '1000 Jahre Polnisch Gdańsk' <strong>zu</strong> feiern, wobei<br />
die Kirche Polens nur 1000 Jahre Christentum feierte. Vielleicht ist <strong>de</strong>r Ort "Praust, pl Pruszcz", ein Hinweis auf seine prußischen Bewohner.<br />
Unter Swantopolk II., <strong>de</strong>r unter <strong>de</strong>r Oberhoheit <strong>de</strong>r Bran<strong>de</strong>nburger Markgrafen und <strong>de</strong>m Heiligen Römischen Reich regierte, wur<strong>de</strong> die <strong>de</strong>utschrechtliche Stadt Danzig mit Lübischem<br />
Recht gegrün<strong>de</strong>t. Als Mestwin II. 1271 die Bran<strong>de</strong>nburger Markgrafen um Unterstüt<strong>zu</strong>ng gegen seinen Bru<strong>de</strong>r Wartislaw bat, sprach er von <strong>de</strong>n "burgensibus <strong>Theut</strong>onicis fi<strong>de</strong>libus<br />
sepedicte civitatis Gedanensis, Prutenis quoque et nostris quibusdam specialiter fi<strong>de</strong>libus Pomeranis", also von <strong>de</strong>n treuen <strong>de</strong>utschen Bürgern <strong>de</strong>r oft genannten Stadt Danzig, aber auch<br />
von <strong>de</strong>n Prußen und <strong>de</strong>n beson<strong>de</strong>rs treuen Pomeranen (die also nicht in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Stadt lebten, son<strong>de</strong>rn auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r späteren Danziger Altstadt, in <strong>de</strong>r so genannten<br />
Grodstadt).<br />
Ausgrabungen auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Altstadt haben ergeben, dass an <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>r Mottlau in die Weichsel, vermutlich auf einer Insel, die durch zwei Mottlauarme gebil<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>,<br />
"eine Burg mit einer Burgsiedlung entstan<strong>de</strong>n ist, die ein politisch-administratives Zentrum und <strong>zu</strong>gleich einen wirtschaftlichen Mittelpunkt für Handwerk und Han<strong>de</strong>l bil<strong>de</strong>te"<br />
(Lingenberg, S. 269). Die Entstehung dieser Burgsiedlung wird für die Mitte <strong>de</strong>s 10., vielleicht schon für das 9. Jahrhun<strong>de</strong>rt angenommen. Polnische Forscher vermuten, dass sie im<br />
Zuge <strong>de</strong>r Eroberung Pommerns durch einen polnischen Fürsten gebaut wor<strong>de</strong>n sei. Dann wäre sie als Zwingburg gegenüber <strong>de</strong>r etwa 300 bis 400 Meter entfernt gelegenen vorgenannten<br />
Siedlung an<strong>zu</strong>sehen.
Mittelalter<br />
Die Stadt Danzig, über <strong>de</strong>ren Gründung keine Details bekannt sind[1], stand schon <strong>zu</strong> En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 10. Jahrhun<strong>de</strong>rts in Blüte und Ansehen und wur<strong>de</strong> damals die Hauptstadt von<br />
Pommerellen. 979 wur<strong>de</strong> Pommern durch <strong>de</strong>n polnischen Fürsten Mieszko I. erobert, <strong>de</strong>r eine Festung bei Danzig grün<strong>de</strong>te. Auf Betreiben <strong>de</strong>s polnischen Herzogs Bolesław I. Chrobry<br />
und seinen weitverbreiteten Eroberungszügen kam Bischof Adalbert von Prag nach Danzig und predigte 997 das Christentum bei <strong>de</strong>m baltischen Stamm <strong>de</strong>r Pruzzen. Als Polen um 1034<br />
im Chaos einer heidnischen Reaktion zerbrach, konnten sich die slawisch-pommerschen Stämme wie<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Zentralgewalt aus Gnesen befreien. Viele Eroberungszüge <strong>de</strong>r Polen<br />
gegen die Pommern und gegen die Prußen konnten im 11. und 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt abgewehrt wer<strong>de</strong>n. Um 1047 wur<strong>de</strong> Pommerellen mit Danzig Teil <strong>de</strong>s Piasten-Staates <strong>de</strong>s polnischen<br />
Herzogs Kasimir I. Sein Sohn König Bolesław II. verlor um 1060 die Kontrolle über Pommerellen wie<strong>de</strong>r und somit <strong>de</strong>n Zugang <strong>zu</strong>r Ostsee, welches unabhängig durch einheimische<br />
slawische Regenten bis 1116 regiert wur<strong>de</strong>. 1116 unterwarf <strong>de</strong>r polnische Herzog Bolesław III. Schiefmund ganz Pommerellen mit Danzig. Nach <strong>de</strong>m Tod von Bolesław brach in Polen<br />
<strong>de</strong>r Partikularismus aus, und Danzig wur<strong>de</strong> im Rahmen <strong>de</strong>r Senioratsverfassungsordnung <strong>de</strong>m Krakauer Seniorherzog unterstellt. Trotz <strong>de</strong>r Verfassung, die die Einheit Polens sichern<br />
sollte, zerbrach das Land in eine Vielzahl, zeitweilig einan<strong>de</strong>r bekriegen<strong>de</strong>r piastischer Herzogtümer. Um 1180 setzte <strong>de</strong>r polnische Seniorherzog Kasimir II. einen gewissen Sambor I.<br />
als Regenten in Danzig ein. Nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> Sambors übernahm sein Bru<strong>de</strong>r Mestwin I. (Mściwoj) das Danziger Land. Dessen Sohn und Nachfolger Swantopluk (Świętopełk) erreichte<br />
nach einem von ihm initiierten Mordanschlag auf <strong>de</strong>n polnischen Seniorherzog Leszek <strong>de</strong>n Weißen (Leszek Biały) um 1227 die volle politische Selbständigkeit. 1221 eroberte König<br />
Wal<strong>de</strong>mar II. von Dänemark Danzig, verlor es aber schon 1225 an <strong>de</strong>n Herzog Swantopluk.<br />
Ähnlich erging es auch seinem Sohn Mestwin II. mit <strong>de</strong>n gegen seinen Bru<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> Hilfe gerufenen Bran<strong>de</strong>nburgern, von <strong>de</strong>nen er 1271 seine Hauptstadt <strong>zu</strong>rückerobern musste. Kämpfe<br />
innerhalb <strong>de</strong>r Dynastie Sambori<strong>de</strong>n, wie auch die wachsen<strong>de</strong> Bedrohung seitens <strong>de</strong>r Mark Bran<strong>de</strong>nburg und <strong>de</strong>s Deutscher Or<strong>de</strong>n führten <strong>zu</strong> einem engeren Anschluss Pommerellens an<br />
Polen. Als Mestwin II. 1294 ohne männliche Erben starb, fiel Danzig, laut <strong>de</strong>m Vertrag von Kempen (Kępno) von 1282 an <strong>de</strong>n Herzog von Großpolen und König von Polen Przemysław<br />
II., nach <strong>de</strong>ssen Tod 1296 übernahm sein Erbe <strong>de</strong>r spätere König von Polen und Herzog von Kujawien Władysław Łokietek, <strong>de</strong>r aber um 1300 von <strong>de</strong>n Böhmen (Tschechen) Wenzel II.<br />
aus Polen vertrieben wur<strong>de</strong>. Nach <strong>de</strong>m Mord am letzten Vorsteher <strong>de</strong>r Przemysli<strong>de</strong>n Wenzel III. 1306 konnte Wladyslaw aus <strong>de</strong>m ungarischen Exil nach Polen <strong>zu</strong>rückkehren und sich<br />
wie<strong>de</strong>r in Teilen Polens und in Pommerellen durchsetzen.<br />
Übernahme durch <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n<br />
1308 rief Władysław Łokietek <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n gegen die Bran<strong>de</strong>nburger <strong>zu</strong> Hilfe, die Danzig belagerten. Einer <strong>de</strong>r Beweggrün<strong>de</strong> für die Belagerung war <strong>de</strong>r, dass die<br />
bran<strong>de</strong>nburgischen Askanier vom römisch-<strong>de</strong>utschen Kaiser Friedrich II. im Dezember 1231 in Ravenna mit Pommern und Pommerellen belehnt wor<strong>de</strong>n waren und dass sie nach <strong>de</strong>m<br />
Tod <strong>de</strong>s letzten pommerellischen Herzogs von dieser Belehnung, die noch am 8. Januar 1295 in Mühlhausen erneuert wor<strong>de</strong>n war, Gebrauch machen wollten. Den bran<strong>de</strong>nburgischen<br />
Truppen öffneten <strong>de</strong>utsche Bürger Danzigs die Stadttore. Da <strong>de</strong>r Deutsche Or<strong>de</strong>n bei <strong>de</strong>r Verteidigung <strong>de</strong>r Danziger Burg mithalf, konnte <strong>de</strong>r Markgraf von Bran<strong>de</strong>nburg die Burg jedoch<br />
nicht einnehmen. Er zog aus Danzig ab, ließ jedoch eine schwache bran<strong>de</strong>nburgische Besat<strong>zu</strong>ngstruppe <strong>zu</strong>rück. Als die Verteidiger <strong>de</strong>r Burg ihre militärische Überlegenheit erkannten,<br />
drangen sie in die Stadt ein und überwältigten die <strong>zu</strong>rückgelassenen bran<strong>de</strong>nburgischen Truppen. Der überwiegen<strong>de</strong> Teil wur<strong>de</strong> nie<strong>de</strong>rgemetzelt. Danziger Parteigänger, die <strong>de</strong>n<br />
bran<strong>de</strong>nburgischen Truppen bei <strong>de</strong>r Einnahme <strong>de</strong>r Stadt behilflich gewesen waren, wur<strong>de</strong>n hingerichtet.[2] Der Deutsche Or<strong>de</strong>n besetzte die Stadt und behielt sie - da die versprochene<br />
Entschädigung nicht ausgezahlt wor<strong>de</strong>n war - in seinem Besitz.<br />
Um <strong>de</strong>n Besitz Pommerellens mit Danzig rechtlich ab<strong>zu</strong>sichern, kaufte <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n im Vertrag von Soldin am 13. September 1309 <strong>de</strong>n Bran<strong>de</strong>nburgern alle ihre - polnischerseits allerdings<br />
angezweifelten - Besitztitel an Pommerellen ab, die sie seit 1269 (siehe auch Vertrag von Arnswal<strong>de</strong>) und aufgrund <strong>de</strong>r früher durch Kaiser Friedrich II. erfolgten Belehnung mit<br />
Pommerellen geltend machen konnten, für 10000 Mark Silber ab. Die Annexion Pommerellens durch die Ritter <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns führte <strong>zu</strong> einem langanhalten<strong>de</strong>n Rechtsstreit zwischen <strong>de</strong>m<br />
Königreich Polen und <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r 1343 durch einen Vergleich im Frie<strong>de</strong>nsvertrag von Kalisch been<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Danach herrschte zwischen <strong>de</strong>m Deutschor<strong>de</strong>nsstaat und<br />
<strong>de</strong>m Königreich Polen 66 Jahre lang Frie<strong>de</strong>n.<br />
Spätmittelalter: Hansezeit und Deutscher Or<strong>de</strong>n<br />
Bereits im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt gewann die Rechtsstadt eine immer stärkere Position in <strong>de</strong>r Hanse, am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts hatte sie ein Mitspracherecht bei <strong>de</strong>n<br />
Gerichtsangelegenheiten <strong>de</strong>s Kontors Peterhof in Nowgorod und in Pommerellen. Danzig wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Vorort <strong>de</strong>s preußischen Quartiers. Um 1350 trat sie <strong>de</strong>m Bund <strong>de</strong>r Hanse bei. Seit
1361 ist die Teilnahme am Hansetag belegt, bereits 1377 hatte Danzig eine ebenso be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Stellung innerhalb <strong>de</strong>s Hansebun<strong>de</strong>s wie Thorn und Elbing. An <strong>de</strong>n Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen<br />
<strong>de</strong>r Hanse mit Dänemark und Schwe<strong>de</strong>n nahm Danzig seit 1367 teil (siehe auch Kölner Konfö<strong>de</strong>ration).<br />
Zahlreich waren in <strong>de</strong>r Folgezeit die Spannungen und Streitigkeiten zwischen <strong>de</strong>r Stadt und <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n um <strong>de</strong>n freien Han<strong>de</strong>l und die Kontrolle über die Schifffahrt. 1343<br />
wur<strong>de</strong> an Stelle <strong>de</strong>s lübischen Rechtes das im Gebiet <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns gültige Kulmer Recht eingeführt. Der Polenkönig Kasimir III. erkannte im Vertrag von Kalisch 1343 die Herrschaft <strong>de</strong>s<br />
Deutschen Or<strong>de</strong>ns formell an, ohne jedoch die Rechtstitel an Danzig und Pommerellen preis<strong>zu</strong>geben.<br />
Der wachsen<strong>de</strong> Reichtum <strong>de</strong>r Stadt zeigte sich in <strong>de</strong>r starken Erweiterung <strong>de</strong>s Stadtareals, die auch wegen <strong>de</strong>r zahlreichen Einwan<strong>de</strong>rer notwendig wur<strong>de</strong> (Kaufleute und Handwerker, u.<br />
a. aus <strong>de</strong>n Hansestädten, aus Bran<strong>de</strong>nburg, Obersachsen und Thüringen). Auf <strong>de</strong>n Fundamenten <strong>de</strong>r alten Burganlage errichtete <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n um 1340 eine große Burg, die <strong>zu</strong>m Sitz <strong>de</strong>s<br />
Danziger Komturs wur<strong>de</strong>. Aus jener Zeit stammen viele be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Bauten, z. B. die Anlage <strong>de</strong>r Rechtstadt (1340), <strong>de</strong>r Jungstadt (1380) und <strong>de</strong>r Vorstadt (1393). Das Stadtgebiet <strong>de</strong>hnte<br />
sich nach Nor<strong>de</strong>n aus, wo die sogenannte Neustadt entstand (Pfarrkirche St. Johannes ca. 1349) und auch nach Sü<strong>de</strong>n, wo sich die sog. Vorstadt um die Schiffswerft entwickelte<br />
(Filialkirche St. Peter und Paul um 1400). Die Rechtsstadt hatte seit 1378 eine Ratsverfassung; am Langen Markt entstand 1380 das Rathaus, seit 1343 wur<strong>de</strong> die Marienkirche<br />
ausgebaut. Seit <strong>de</strong>r 2. Hälfte <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts führte die schnelle Entwicklung Danzigs wie<strong>de</strong>rholt <strong>zu</strong> Konflikten zwischen <strong>de</strong>m Patriziat, das <strong>de</strong>n Rat bil<strong>de</strong>te, und <strong>de</strong>n Handwerkern<br />
sowie <strong>de</strong>n neu <strong>zu</strong>gezogenen Kaufleuten (1363, 1378).<br />
Unter <strong>de</strong>m Hochmeister Konrad von Jungingen (1393-1407) erscheint Danzig <strong>zu</strong>erst kriegerisch tätig, in<strong>de</strong>m es für <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>nkönig Albrecht Stockholm besetzte und durch seinen<br />
Kampf mit <strong>de</strong>n seeräuberischen Vitalienbrü<strong>de</strong>rn auch mit Margarethe von Dänemark in einen Krieg verwickelt wur<strong>de</strong>. Als infolge <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage Ulrichs von Jungingen bei Tannenberg<br />
1410 die Macht <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns sank, benutzte Danzig diesen Umstand, um sich vom Or<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> lösen. Der Danziger Rat ging <strong>zu</strong>m polnischen König Władysław II. Jagiełło über.<br />
Es kam <strong>zu</strong> blutigen Repressalien gegen die Ratsherren, als <strong>de</strong>r Deutsche Or<strong>de</strong>n die Macht im Kern seines Territoriums im Erster Frie<strong>de</strong>n von Thorn in 1411 <strong>zu</strong>rückerlangte. In <strong>de</strong>r<br />
Folgezeit versuchte Danzig, sich finanziellen Leistungen an <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> entziehen. 1416 führten Unruhen in <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong>m Eingreifen <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>nsritter und <strong>zu</strong> einer verstärkten<br />
Abhängigkeit Danzigs vom Deutschen Or<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts.<br />
Die Politik <strong>de</strong>r Stadt Danzig gegenüber <strong>de</strong>r Hanse wur<strong>de</strong> teilweise durch <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n beeinflusst, <strong>de</strong>r sie <strong>zu</strong>r Neutralität im Krieg <strong>de</strong>r Hanse (1426-1435) gegen Erich von<br />
Pommern zwang; innerhalb <strong>de</strong>r Hanse aber betrieb Danzig immer mehr eine eigene Politik, unabhängig von <strong>de</strong>r Stadt Lübeck, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r ein gewisser Interessengegensatz bestand. Dieser<br />
äußerte sich in <strong>de</strong>r Zeit nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Utrecht darin, dass Danzig <strong>de</strong>r Politik <strong>de</strong>r Monopolisierung <strong>de</strong>s Ostseehan<strong>de</strong>ls <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r Städte <strong>de</strong>s Wendischen Viertels <strong>de</strong>r Hanse<br />
und damit insbeson<strong>de</strong>re Lübecks nicht mehr folgte und die mit diesen Städten bislang gemeinsam bekämpften Umlandfahrer, wie die englischen Merchant Adventurer, unterstütze.<br />
Danzig wur<strong>de</strong> Mitglied im sogenannten Preußischen Bund, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m sich 1440 die ständische Mitregierung for<strong>de</strong>rn<strong>de</strong>n Städte und Adligen in Preußen <strong>zu</strong>sammengeschlossen hatten. Als<br />
<strong>de</strong>r Preußische Bund <strong>de</strong>n polnischen König Kasimir IV. um Hilfe gegen <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n bat, brach zwischen <strong>de</strong>m Bund, Polen auf <strong>de</strong>r einen und <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Seite<br />
<strong>de</strong>r Dreizehnjährige Krieg aus: Am 6. März 1454 ging Danzig auf Antrag <strong>de</strong>r von Hans von Baysen angeführten Gesandtschaft <strong>de</strong>s Preußischen Bun<strong>de</strong>s mit <strong>de</strong>m seit 10. Februar 1454<br />
mit Elisabeth von Habsburg verheirateten König Kasimir IV. eine Schutzbeziehung ein; Diese Schutzbeziehung mün<strong>de</strong>te während <strong>de</strong>s von Danzig finanzierten Dreizehnjährigen Krieges<br />
gegen <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n 1457 mit <strong>de</strong>r Verleihung <strong>de</strong>s Großen Privilegs (Landgebiet, Hoheitsrechte und weitgehen<strong>de</strong> Autonomie) an Danzig. Im Zweiten Frie<strong>de</strong>n von Thorn von 1466 kam<br />
Danzig dauerhaft an das Königliche Preußen, das <strong>de</strong>r Krone Polens, d. h. <strong>de</strong>m König persönlich, unterstellt war. Danzig wur<strong>de</strong>n die bereits 1454, 1455 und 1457 verliehenen<br />
weitgehen<strong>de</strong>n Autonomierechte bestätigt und es durfte gemäß <strong>de</strong>m ihm erteilten Privilegium Casimirianum seine Ämter selbst besetzen, erhielt die vollständige Gerichtsbarkeit (nach<br />
eigenem Gesetzbuch, Danziger Willkür genannt), Befreiung von allen Zöllen und Abgaben und von <strong>de</strong>r Rechnungslegung über seine Einkünfte, das Münzrecht, das Recht, eigene<br />
Besat<strong>zu</strong>ng <strong>zu</strong> halten, und völlig freie Entscheidung über Krieg, Bündnisse und Frie<strong>de</strong>n. Die Oberhoheit <strong>de</strong>s Königs von Polen repräsentierte ein Mitglied <strong>de</strong>s Stadtrats, <strong>de</strong>n Burggrafen.<br />
Die Stadt hielt in Warschau ihren Sekretär und stimmte auf Reichstagen und bei Königswahlen mit. Die vier Stadtteile wur<strong>de</strong>n nun <strong>zu</strong> einem Ganzen vereinigt und <strong>de</strong>m rechtstädtischen<br />
Rat untergeordnet.<br />
Streitigkeiten mit <strong>de</strong>m König wegen Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Bistums Ermland führten <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m achtjährigen Pfaffenkrieg (1472-1480|80), in welchem sich zwar Danzigs Macht, aber auch die<br />
polnische Antipathie gegen diese Stadt bewährte.<br />
Reformation und Renaissance
Schon 1523 nahm Danzig die Reformation an, die jedoch nicht ohne heftige innere Kämpfe festen Fuß fassen konnte. Am ver<strong>de</strong>rblichsten für die Zukunft <strong>de</strong>r Stadt war die<br />
Durchstechung <strong>de</strong>r Großen Kampe, einer Flussinsel vor <strong>de</strong>r Spaltung <strong>de</strong>r Weichsel (in Weichsel und Nogat), seitens <strong>de</strong>r Elbinger und Marienburger, wodurch die Tiefe <strong>de</strong>s Fahrwassers<br />
im Verlauf eines Jahres um die Hälfte vermin<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>. Um etwa 1534 sie<strong>de</strong>lten sich in und um Danzig auch aus <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n geflüchtete Mennoniten an [3]. Im Jahr 1569<br />
entstand formell auch eine flämische Mennonitengemein<strong>de</strong>.<br />
Danzig ist als einzige Stadt (Stadtrepublik) in <strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r polnischen Krone <strong>de</strong>r während <strong>de</strong>r Union von Lublin von 1569 vom polnischen König Sigismund II. (Polen) aus <strong>de</strong>r<br />
bisherigen Personalunion zwischen <strong>de</strong>m Königlichen Preußen, Polen und Litauen beschlossenen Realunion - <strong>de</strong>r polnischen A<strong>de</strong>lsrepublik (Rzeczpospolita) - nicht beigetreten.<br />
Als 1575 Stephan Báthory <strong>zu</strong>m König von Polen gewählt wur<strong>de</strong>, wollte ihn Danzig nicht anerkennen und erklärte sich für Kaiser Maximilian II., welcher <strong>de</strong>r Stadt be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong><br />
Han<strong>de</strong>lsvorteile <strong>zu</strong>sichern ließ. Selbst nach <strong>de</strong>ssen Tod 1576 wollte Danzig <strong>de</strong>m König Stephan die Huldigung nur gegen be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Zugeständnisse leisten. Danzig wur<strong>de</strong> daher<br />
belagert, verteidigte sich aber 1577 so entschlossen, dass sich <strong>de</strong>r König mit einer Abbitte und <strong>de</strong>r Zahlung von 200.000 Gul<strong>de</strong>n begnügte.<br />
1656 belagerten die Schwe<strong>de</strong>n die Stadt <strong>zu</strong> Wasser und <strong>zu</strong> Lan<strong>de</strong>, wur<strong>de</strong>n aber durch Hilfstruppen <strong>de</strong>s Königs Johann II. Kasimir und durch eine holländische Flotte vertrieben, worauf<br />
die Hollän<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Großen Kurfürsten <strong>de</strong>n Elbinger Vertrag am 10. September über die Neutralität Danzigs vereinbarten, <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n allerdings nicht anerkannte. 1734 wur<strong>de</strong><br />
Danzig, weil es <strong>de</strong>n König Stanislaus I. Leszczyński aufgenommen hatte, von <strong>de</strong>n Russen und Sachsen unter Münnich belagert und trotz tapferer Gegenwehr nach mehrmonatlicher<br />
Einschließung durch ein Bombar<strong>de</strong>ment am 9. Juli <strong>zu</strong>r Kapitulation genötigt. Bald darauf entstan<strong>de</strong>n zwischen Magistrat und Bürgerschaft Streitigkeiten, die erst 1752 eine neue<br />
Gesetzgebung beilegte.<br />
Bei <strong>de</strong>r Ersten Teilung Polens 1772 behielt die Stadt zwar ihre Freiheit, aber da sie von preußischem Gebiet umschlossen und von starken Zöllen hart bedrückt war, nahmen <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l,<br />
<strong>de</strong>r Kunstfleiß und die Bevölkerung immer mehr ab. Bei <strong>de</strong>r Zweiten Teilung Polens 1793 kam die Stadt an Preußen.<br />
Koalitionskriege<br />
Das Jahr 1806 wur<strong>de</strong> aber für Danzig wie<strong>de</strong>r sehr ver<strong>de</strong>rblich. Schon vor <strong>de</strong>r Kriegserklärung wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hafen von <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n blockiert und von England auf die preußischen Schiffe<br />
ein Embargo gelegt. Nach <strong>de</strong>r verlorenen Schlacht bei Jena und Auerstädt wur<strong>de</strong> in Danzig die Aufrüstung <strong>zu</strong>m Wi<strong>de</strong>rstand mit Eifer betrieben. Die 21.700 Mann starke Besat<strong>zu</strong>ng<br />
genügend verproviantiert, die Nie<strong>de</strong>rung unter Wasser gesetzt und die Vorstädte <strong>zu</strong>m Teil <strong>de</strong>moliert. Schon Anfang März rückten die Franzosen unter Marschall François-Joseph<br />
Lefebvre vor die Stadt.[4]<br />
Trotz tapferer Verteidigung durch <strong>de</strong>n Gouverneur Kalckreuth setzten sich die Belagerer am 1. April auf <strong>de</strong>m Zigankenberg fest und nahmen in <strong>de</strong>r Nacht vom 12. auf <strong>de</strong>n 13. April auch<br />
die Kalkschanze an <strong>de</strong>r Weichsel. Sie wur<strong>de</strong> ihnen zwar wie<strong>de</strong>r entrissen, aber die Danziger sahen sich genötigt, dieses höchstwichtige Werk selbst <strong>zu</strong> zerstören. In <strong>de</strong>r Nacht vom 23.<br />
auf <strong>de</strong>n 24. April begann das Bombar<strong>de</strong>ment <strong>de</strong>r Stadt, das, nach<strong>de</strong>m Lefebvre am 25. April vergeblich <strong>zu</strong>r Übergabe aufgefor<strong>de</strong>rt hatte, mit Nachdruck fortgesetzt wur<strong>de</strong>. Der<br />
furchtbarste Angriff <strong>de</strong>r Belagerer am 21. Mai wur<strong>de</strong> noch einmal abgeschlagen, erschöpfte aber <strong>de</strong>n letzten Pulvervorrat. Als nun auch die Lebensmittel <strong>zu</strong>r Neige gingen, die Besat<strong>zu</strong>ng<br />
auf 7.000 Mann <strong>zu</strong>sammengeschmolzen war, dagegen die Streitmacht <strong>de</strong>s Fein<strong>de</strong>s durch die Ankunft <strong>de</strong>s Marschalls Edouard-Adolphe Mortier auf 60.000 Mann angewachsen war,<br />
kapitulierte die Stadt am 24. Mai.<br />
Die Besat<strong>zu</strong>ng verließ am 27. Mai, als auch Weichselmün<strong>de</strong> kapitulierte, die Festung mit Kriegsehren und <strong>de</strong>r Verpflichtung, ein Jahr lang nicht gegen Frankreich <strong>zu</strong> dienen. Den<br />
Einwohnern aber wur<strong>de</strong> eine Kriegssteuer von 20 Millionen Franc mit <strong>de</strong>r Bewilligung allmählicher Bezahlung auferlegt.<br />
Der Marschall Lefebvre erhielt <strong>de</strong>n Titel eines Herzogs von Danzig. Im Tilsiter Frie<strong>de</strong>n vom 9. Juli 1807 wur<strong>de</strong> Danzig als Freistaat mit einem Gebiet von 2 Lieues, die durch die<br />
willkürliche Erklärung Napoleons I. aus zwei <strong>de</strong>utsche Meilen im Umkreis ausge<strong>de</strong>hnt wur<strong>de</strong>n, unter Frankreichs, Preußens und Sachsens Schutz anerkannt, doch blieb fortwährend ein<br />
französischer Gouverneur in <strong>de</strong>r Garnison, und durch die Kontinentalsperre war <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l mit England zerstört. Beim Rück<strong>zu</strong>g aus Russland gelang es <strong>de</strong>n französischen und<br />
polnischen Truppen <strong>de</strong>s 10. französischen Armeekorps, sich in die Stadt <strong>zu</strong> retten.<br />
Da erschien gegen En<strong>de</strong> Januar 1813 ein aus 6.000 Kosaken bestehen<strong>de</strong>s russisches Einschließungskorps, welches jedoch bald durch ein Korps von 7.000 Mann Infanterie und 2.500<br />
Mann Kavallerie mit 60 Feldgeschützen unter <strong>de</strong>m Kommando <strong>de</strong>s Generalleutnants von Loewis abgelöst wur<strong>de</strong>.[5] Die elfmonatige Belagerung brachte wie<strong>de</strong>r schwere Not über die
Stadt. Die heftigsten Ausfälle und Angriffe fan<strong>de</strong>n am 4. Februar, 5. März, 27. April und, nach<strong>de</strong>m am 1. Juni das Belagerungsheer durch 8.000 Mann preußischer Landwehr unter <strong>de</strong>m<br />
Grafen Dohna verstärkt wor<strong>de</strong>n war, am 9. Juli statt. Nach <strong>de</strong>m Waffenstillstand vom 24. August übernahm <strong>de</strong>r Herzog Alexan<strong>de</strong>r von Württemberg <strong>de</strong>n Oberbefehl <strong>de</strong>r<br />
Belagerungsarmee und fügte am 28. und 29. August, 1., 7. und 17. September und 1. November <strong>de</strong>n Belagerten große Nachteile <strong>zu</strong>, während ein englisches Geschwa<strong>de</strong>r die Stadt von<br />
<strong>de</strong>r Seeseite her beschoss.<br />
Endlich kam am 17. November eine Kapitulation <strong>zu</strong>stan<strong>de</strong>, nach welcher die Garnison am 1. Januar 1814 mit <strong>de</strong>r Verpflichtung, ein Jahr lang nicht gegen die Verbün<strong>de</strong>ten <strong>zu</strong> dienen,<br />
nach Frankreich entlassen wer<strong>de</strong>n sollte. Diese Bedingungen erhielten jedoch die Genehmigung <strong>de</strong>s Kaisers Alexan<strong>de</strong>r I. nicht, und General Rapp musste auf die Bedingung eingehen,<br />
dass alle Franzosen nach Russland abgeführt wur<strong>de</strong>n.<br />
Nach <strong>de</strong>m Wiener Kongress: Einglie<strong>de</strong>rung in das mo<strong>de</strong>rne Preußen<br />
Mit <strong>de</strong>m 3. Februar 1814 kehrte Danzig unter Preußens Oberherrschaft <strong>zu</strong>rück; worauf die alte Verfassung wie<strong>de</strong>rhergestellt wur<strong>de</strong>. 1816 wur<strong>de</strong> Danzig <strong>de</strong>r Sitz <strong>de</strong>r Regierung <strong>de</strong>s<br />
Danziger Bezirks, <strong>de</strong>s Konsistoriums und <strong>de</strong>s Oberpräsidiums von Westpreußen. Rasch erfolgten nun, namentlich auf Veranlagung <strong>de</strong>s Oberpräsi<strong>de</strong>nten von Schön, zahlreiche und in alle<br />
Zweige tief eingreifen<strong>de</strong> Verbesserungen. Großen Scha<strong>de</strong>n erlitt die Stadt 1829 durch einen Durchbruch <strong>de</strong>r Weichsel 1831, durch die asiatische Cholera und durch einen Brand im Juni<br />
1858. Seit 1863 hat die städtische Verwaltung einen neuen, großartigen Aufschwung genommen, hervorgerufen durch die Amtstätigkeit <strong>de</strong>s Oberbürgermeisters v. Winter. Ihm verdankt<br />
die Stadt die Anlage einer Wasserleitung und die Kanalisation, die hier <strong>zu</strong>erst auf <strong>de</strong>m Kontinent gebaut wur<strong>de</strong>. Seit<strong>de</strong>m haben sich die Gesundheitsverhältnisse <strong>de</strong>r Stadt erheblich<br />
verbessert.<br />
Nach <strong>de</strong>r Teilung <strong>de</strong>r ehemaligen Provinz Preußen am 1. Juli 1878 ist Danzig Hauptstadt <strong>de</strong>r Provinz Westpreußen gewor<strong>de</strong>n. Im Jahr 1902 wur<strong>de</strong> das Dorf Zigankenberg eingemein<strong>de</strong>t.<br />
Freie Stadt Danzig<br />
Mit <strong>de</strong>m Vertrag von Versailles 1919 wur<strong>de</strong> Danzig mit seinen umliegen<strong>de</strong>n Gebieten vom Deutschen Reich getrennt und am 15. November 1920 <strong>zu</strong> einem unabhängigen Staat, <strong>de</strong>r<br />
Freien Stadt Danzig, erklärt. Dieser Staat stand allerdings unter Aufsicht <strong>de</strong>s Völkerbunds; polnische und englische Truppen gewährleisteten <strong>de</strong>n neuen Status <strong>de</strong>r Stadt. Da diese<br />
Entscheidung nicht von einer Volksabstimmung abhängig gemacht wur<strong>de</strong>, sahen das Deutsche Reich und die mehrheitlich <strong>de</strong>utschen Bewohner <strong>de</strong>r Stadt das vom US-Präsi<strong>de</strong>nten<br />
Wilson gefor<strong>de</strong>rte Selbstbestimmungsrecht <strong>de</strong>r Völker verletzt.<br />
Am 6. Dezember 1920 konstituierte sich <strong>de</strong>r erste Danziger Volkstag, <strong>de</strong>r aus freien Wahlen hervorgegangen war. Er bestand aus 120 Abgeordneten. Oberbürgermeister Heinrich Sahm<br />
wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Präsi<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>s Senats <strong>de</strong>r Freien Stadt Danzig gewählt. Die Parteien stellten die folgen<strong>de</strong>n Abgeordneten:<br />
• Deutschnationale Volkspartei: 34<br />
• Freie Wirtschaftliche Vereinigung: 12<br />
• Deutsche Demokratische Partei: 10<br />
• Zentrumspartei: 17<br />
• Sozial<strong>de</strong>mokratische Partei: 19<br />
• Unabhängige Sozial<strong>de</strong>mokraten: 21<br />
• Polnische Partei: 7.<br />
1923 gaben im Rahmen einer Volkszählung 95 Prozent <strong>de</strong>r Bürger Deutsch und vier Prozent Polnisch bzw. Kaschubisch als Muttersprache an. Entgegen <strong>de</strong>m Volkszählungsergebnis<br />
schätzte <strong>de</strong>r polnische Historiker Drzycimski <strong>de</strong>n Anteil polnischer Bürger an <strong>de</strong>r Danziger Gesamtbevölkerung im Jahr 1923 auf 16 Prozent.<br />
• Ergebnis <strong>de</strong>r Volkszählung vom 1. November 1923<br />
•<br />
• Nationalität Gesamt Deutsch Deutsch und Polnisch und Russisch, Jiddisch Keine
• Polnisch Kaschubisch Ukrainisch Angabe<br />
• Stadt Danzig 335.921 327.827 1.108 6.788 99 22 77<br />
• Landkreis Danzig 30.809 20.666 521 5.239 2.529 580 1.274<br />
• Gesamt 366.730 348.493 1.629 12.027 2.628 602 1,351<br />
• Prozent 100 % 95,03% 0,44 % 3,28 % 0,72 % 0,16 % 0,37 %<br />
Die Freie Stadt Danzig bestand damals aus <strong>de</strong>n Städten Danzig und Zoppot sowie <strong>de</strong>n kleinen Städten Tiegenhof, Neuteich, Oliva und Ohra, wobei Neuteich und Tiegenhof im Danziger<br />
Wer<strong>de</strong>r bzw. im Kreis Großes Wer<strong>de</strong>r lagen. Die polnische Min<strong>de</strong>rheit besaß eigene Schulen und ein Vereinswesen, wur<strong>de</strong> aber von <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bevölkerung <strong>de</strong>s Öfteren mit<br />
Missgunst betrachtet und diskriminiert; außer<strong>de</strong>m lebten in Danzig vor 1939 Kaschuben und Russen. Unter <strong>de</strong>n Einwohnern fan<strong>de</strong>n sich auch zahlreiche Ju<strong>de</strong>n, die nach 1939 <strong>zu</strong>m<br />
überwiegen<strong>de</strong>n Teil enteignet und <strong>de</strong>portiert wur<strong>de</strong>n.<br />
Danzig hatte in <strong>de</strong>r Zwischenkriegszeit nach einem anfänglichen Wirtschaftsaufschwung erhebliche wirtschaftliche Probleme, bedingt durch die Zollgrenzen <strong>zu</strong>m Deutschen Reich, die<br />
globale Wirtschaftskrise und eine wenig entwickelte Industrie.<br />
Der Hafen und <strong>de</strong>r Zoll sowie die internationalen Eisenbahnverbindungen – jedoch nicht die Straßenbahn und Kleinbahnen im Freistaatgebiet – wur<strong>de</strong>n unter polnische Verwaltung<br />
gestellt. Die Republik Polen legte im Danziger Hafen (Westerplatte) ein Munitionslager an und stationierte dort ihr Militär. Des Weiteren war es <strong>de</strong>m polnischen Staat zwecks<br />
Verbindung <strong>de</strong>s Hafengebiets mit Polen erlaubt, eine Post- und Telegrafenverwaltung, das so genannte „Polnische Postamt“, im Hafengebiet ein<strong>zu</strong>richten.<br />
Die problematischen Verhältnisse, die Anlass für viele – unbeachtet gebliebene – Beschwer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Freien Stadt Danzig an <strong>de</strong>n Völkerbund waren, schufen unter <strong>de</strong>r Bevölkerung<br />
Ressentiments gegen Polen.<br />
Mitte 1933 kamen daher auch in Danzig die Nationalsozialisten (NSDAP) an die Macht, die sich aber wegen <strong>de</strong>r internationalen Kontrolle <strong>de</strong>s Gebietes bis 1936/37 mit<br />
Oppositionsparteien abfin<strong>de</strong>n mussten, die bei <strong>de</strong>n Volkstagswahlen von 1935 (trotz versuchter Wahlbeeinflussungen) eine Zwei-Drittel-Mehrheit <strong>de</strong>r Nationalsozialisten klar verhin<strong>de</strong>rn<br />
konnten. Während Hermann Rauschning 1933/34 als Senatspräsi<strong>de</strong>nt eine Annäherung <strong>zu</strong> Polen versuchte, blieb sein Nachfolger Arthur Greiser da<strong>zu</strong> auf Distanz und führte die Freie<br />
Stadt Danzig in <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> (auch finanzielle) Abhängigkeit <strong>zu</strong>m Deutschen Reich. En<strong>de</strong> August 1939 erklärte sich <strong>de</strong>r Gauleiter Albert Forster selbst <strong>zu</strong>m Staatsoberhaupt und verfügte<br />
am 1. September 1939 völkerrechtswidrig, nach<strong>de</strong>m reichs<strong>de</strong>utsche Streitkräfte das polnische Munitions<strong>de</strong>pot auf <strong>de</strong>r Westerplatte angegriffen hatten, <strong>de</strong>n Anschluss Danzigs an das<br />
Deutsche Reich. Der <strong>de</strong>utsche Angriff auf die Westerplatte wird heute als Beginn <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges gesehen.<br />
Zweiter Weltkrieg<br />
In <strong>de</strong>n Zeiten <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges wur<strong>de</strong>n insbeson<strong>de</strong>re die Ju<strong>de</strong>n, aber auch die polnische Min<strong>de</strong>rheit in Danzig <strong>de</strong>portiert (Ju<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n bereits seit 1933 systematisch verfolgt<br />
und entrechtet), viele verloren ihr Leben. An<strong>de</strong>re wie<strong>de</strong>rum ließen sich auf <strong>de</strong>r sogenannten Volksliste als Deutsche eintragen und entgingen so <strong>de</strong>r Verfolgung durch<br />
Nationalitätswechsel. Da<strong>zu</strong> wur<strong>de</strong>n viele dieser Menschen in Konzentrationslager (wie das KZ Stutthof) <strong>de</strong>portiert und ermor<strong>de</strong>t.<br />
1941 befand sich in Danzig-Langfuhr die Flugzeugführerschule A/B 6. En<strong>de</strong> März 1945 wur<strong>de</strong> Danzig von <strong>de</strong>r Roten Armee im Zuge <strong>de</strong>r Schlacht um Ostpommern eingeschlossen und<br />
erobert. Durch die Kampfhandlungen sind große Teile <strong>de</strong>r Innenstadt (bestehend aus Rechtstadt, Altstadt, Vorstadt und Nie<strong>de</strong>rstadt) zerstört wor<strong>de</strong>n. Während und nach <strong>de</strong>m Einmarsch<br />
wur<strong>de</strong>n die noch erhaltenen Häuser <strong>de</strong>r Innenstadt von <strong>de</strong>n sowjetischen Soldaten geplün<strong>de</strong>rt und in Brand gesteckt. Insgesamt wur<strong>de</strong> ein sehr hoher Anteil <strong>de</strong>r Bebauung zerstört.<br />
Bereits in <strong>de</strong>n ersten Nachkriegsmonaten wur<strong>de</strong>n die meisten in Danzig verbliebenen Deutschen von <strong>de</strong>n sowjetischen Besatzern und polnischen Behör<strong>de</strong>n vertrieben. Zurück blieb eine<br />
Min<strong>de</strong>rheit von etwa fünf Prozent <strong>de</strong>r ursprünglichen Stadtbevölkerung mit <strong>zu</strong>meist auch polnischen Vorfahren. Die Vertreibung wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n polnischen Behör<strong>de</strong>n gedul<strong>de</strong>t und nicht<br />
wie oft fälschlicherweise angenommen "systematisch" vorbereitet. Als Folge <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs und <strong>de</strong>s Bierut-Dekretes wur<strong>de</strong> das Eigentum von Personen <strong>de</strong>utscher Nationalität<br />
und Herkunft enteignet. Straftaten, die gegen die <strong>de</strong>utsche Zivilbevölkerung begangen wur<strong>de</strong>n hat man juristisch nur bedingt verfolgt. Aufgrund <strong>de</strong>s Lei<strong>de</strong>ns <strong>de</strong>r polnischen Bevölkerung<br />
während <strong>de</strong>s Krieges und <strong>de</strong>r Nachkriegsjahre wur<strong>de</strong>n diese Geschehnisse nie richtig aufgearbeitet.
Nachkriegszeit – Polen<br />
Die Danziger Rechtstadt sowie zahlreiche Bau<strong>de</strong>nkmäler <strong>de</strong>r Altstadt wur<strong>de</strong>n in Anlehnung an frühneuzeitliche Vorbil<strong>de</strong>r rekonstruiert.<br />
Zugleich wur<strong>de</strong>n insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n Sechzigern, in <strong>de</strong>n Vorstädten wie Przymorze Trabantensiedlungen errichtet. Charakteristisch sind hier die sogenannten Wellenhäuser -<br />
Wohnblöcke von teilweise mehreren hun<strong>de</strong>rt Metern Länge in Plattenbauweise, die mäandrieren und so eine Assoziation <strong>zu</strong>m nahe gelegenen Meer hervorrufen sollen.<br />
Anfang <strong>de</strong>r 1980er begann die Gewerkschaftsbewegung Solidarność unter Führung von Lech Wałęsa in <strong>de</strong>r Danziger Werft ihren Wi<strong>de</strong>rstand gegen die kommunistische Herrschaft in<br />
Polen.<br />
Gegenwart<br />
Mit <strong>de</strong>m Fall <strong>de</strong>s Eisernen Vorhanges verän<strong>de</strong>rte sich die Lage <strong>de</strong>r nationalen Min<strong>de</strong>rheiten in <strong>de</strong>r Republik Polen, auch die <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Min<strong>de</strong>rheit. In Danzig wur<strong>de</strong> im Jahre 1990<br />
<strong>de</strong>r Bund <strong>de</strong>r Deutschen Min<strong>de</strong>rheit gegrün<strong>de</strong>t (Mitglie<strong>de</strong>rstärke: 5.512 Mitglie<strong>de</strong>r; Quelle: Bund <strong>de</strong>r Deutschen Min<strong>de</strong>rheit, Danzig, 2005). Bald darauf begannen jüngere polnische<br />
Danziger, die bislang versteckten Spuren <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Danzig <strong>zu</strong> ent<strong>de</strong>cken; diese Suche nach lokaler I<strong>de</strong>ntität ist auch heute noch im Gange. Zu <strong>de</strong>n wichtigsten Personen dieses<br />
I<strong>de</strong>ntitätsdiskurses zählen <strong>de</strong>r liberale Politiker Donald Tusk sowie die Schriftsteller Paweł Huelle und Stefan Chwin.<br />
Günter Grass fasste im Roman Die Blechtrommel die Geschichte Danzigs lapidar so <strong>zu</strong>sammen (bevor er sie ausführlicher nachzeichnet):<br />
• Zuerst kamen die Rugier, dann kamen die Goten und Gepi<strong>de</strong>n, sodann die Kaschuben, von <strong>de</strong>nen Oskar in direkter Linie abstammt. Bald darauf schickten die Polen <strong>de</strong>n Adalbert<br />
von Prag. Der kam mit <strong>de</strong>m Kreuz und wur<strong>de</strong> von Kaschuben o<strong>de</strong>r Pruzzen mit <strong>de</strong>r Axt erschlagen.<br />
• Das geschah in einem Fischerdorf und das Dorf hieß Gyddanyzc. Aus Gydannyzc machte man Danczik, aus Danczik wur<strong>de</strong> Dantzig, das sich später Danzig schrieb, und heute<br />
heißt Danzig Gdańsk. (Die Blechtrommel, Luchterhand 1959, S. 379)<br />
Verweise<br />
Literatur<br />
Quellen<br />
• Daniel Gralath: Versuch einer Geschichte Danzigs aus <strong>zu</strong>verlässigen Quellen und Handschriften. Hartung, Königsberg 1789. Erster Band, 545 Seiten (Volltext).<br />
• Scriptores Rerum Prussicarum - Die Geschichtsquellen <strong>de</strong>r Preußischen Vorzeit bis <strong>zu</strong>m Untergange <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>nsherrschaft (Theodor Hirsch, Max Töppen und Ernst Strehlke,<br />
Hrsg.), 5 Bän<strong>de</strong>, Minerva GmBH, Frankfurt /Main 1965 (Nachdruck <strong>de</strong>r Ausgabe von 1861 - 1872).<br />
• Goswin von Bre<strong>de</strong>rlow: Geschichte <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>ls und <strong>de</strong>r gewerblichen Kultur <strong>de</strong>r Ostsse-Reiche im Mittelalter bis <strong>zu</strong>m Schlusse <strong>de</strong>s sechzehnten Jahrhun<strong>de</strong>rts mit beson<strong>de</strong>rem<br />
Be<strong>zu</strong>g auf Danzig als Quartiersstadt <strong>de</strong>s Hansebun<strong>de</strong>s, und <strong>de</strong>r sich in dieser Zeit entwickeln<strong>de</strong>n inneren Staatsverhältnisse Preußens. Berlin 1820, 379 Seiten (Volltext).<br />
Einzeldarstellungen<br />
• Werner Neugebauer: Neue polnische Forschungen <strong>zu</strong>r Vor- und Frühgeschichte Westpreußens, Westpreußen Jahrbuch 1953, Leer/Ostfriesland<br />
• Andrzej Zbierski: Początki Gdańska w świetle najnowszych badań (Die Anfänge Danzigs im Lichte <strong>de</strong>r neuesten Forschungen). In: Gdańsk, jego dzieje i kultura, Warschau<br />
1969, S. 11–27<br />
• Wilhelm Brauer: Prußische Siedlungen westlich <strong>de</strong>r Weichsel, J. G. Her<strong>de</strong>r-Bibliothek Siegerland e.V., Siegen 1983<br />
• Heinz Lingenberg: Die Anfänge <strong>de</strong>s Klosters Oliva und die Entstehung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Stadt Danzig, Klett-Cotta, Stuttgart 1982, ISBN 3-12-914900-7<br />
• Edmund Ciéslak/Czeslaw Biernat: History of Gdansk, Wydawnictwo Morskie, Gdansk 1988.
• Paul Simson: Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Danzig bis 1626, 3B<strong>de</strong>., Scientia Verlag Aalen 1967. ND 1913 - 1918<br />
• Erich Keyser: Danzigs Geschichte, 2. Aufl., Verlag A. W. Kasemann, Danzig 1928.<br />
• Gotthilf Löschin: Beiträge <strong>zu</strong>r Geschichte Danzigs und seiner Umgebungen. Meistens aus alten Manuscripten und selten gewor<strong>de</strong>nen Druckschriften gesammelt, Verlag Harro v.<br />
Hirschheydt, Hannover-Döhren 1977. ND 1837.<br />
• Frank Fischer: Danzig. Die zerbrochene Stadt, Propyläen Verlag, Berlin 2006.<br />
• Hans Georg Siegler: Danzig. Chronik eines Jahrtausends, Droste Verlag, Düsseldorf 1991.<br />
• Löschin, Gustav: Geschichte Danzigs, 2B<strong>de</strong>., Danziger Verlagsgesellschaft,Klausdorf/Schwentine, o. J. ND 1822/1823.<br />
• Szermer, Bohdan: Gdansk - Vergangenheit und Gegenwart, Verlag Interpress, Warschau 1971.<br />
• Hirsch, Theodor: Han<strong>de</strong>ls- und Gewerbegeschichte Danzigs unter <strong>de</strong>r Herrschaft <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns, S. Hirzel, Leipzig 1858.<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ Heinrich Gottfried Philipp Gengler: Regesten und Urkun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Verfassungs- und Rechtsgeschichte <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Städte im Mittelalter, Erlangen 1863, S. 700-725..<br />
2. ↑ Johannes Voigt: Geschichte Preußens von <strong>de</strong>r ältesten Zeit bis <strong>zu</strong>m Untergange <strong>de</strong>r Herrschaft <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns. Vierter Band: Die Zeit von <strong>de</strong>r Unterwerfung <strong>de</strong>r<br />
Preußen 1283 bis <strong>zu</strong> Dieterichs von Altenburg Tod 1341, Königsberg 1830, S. 215.<br />
3. ↑ Mennonitisches Lexikon, Band 1. 1913, S. 426.<br />
4. ↑ Vergleiche z. B. Johann Karl Plümicke: Skizzierte Geschichte <strong>de</strong>r Belagerung von Danzig durch die Franzosen im Jahr 1807, Berlin 1817, 277 Seiten.<br />
5. ↑ Vergleiche z. B. Johann Karl Plümicke: Skizzierte Geschichte <strong>de</strong>r russisch-preußischen Blocka<strong>de</strong> und Belagerung von Danzig im Jahr 1813, Berlin 1817, 211 Seiten.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Riga<br />
Riga (lettisch Rīga) ist die Hauptstadt Lettlands und mit 709.145 Einwohnern größte Stadt <strong>de</strong>s Baltikums. Mit über 882.000 Einwohnern in <strong>de</strong>r Agglomeration ist Riga <strong>zu</strong><strong>de</strong>m <strong>de</strong>r größte<br />
Ballungsraum in <strong>de</strong>n drei baltischen Staaten. Die Stadt (7 m über NN) liegt an <strong>de</strong>r Düna (lettisch: Daugava), nicht weit von <strong>de</strong>r Rigaischen Bucht. Die Bevölkerungszahl ist seit <strong>de</strong>r<br />
Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>r Unabhängigkeit <strong>de</strong>r Republik Lettland 1991 um rund 180.000 <strong>zu</strong>rückgegangen, da viele <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Jahrzehnten <strong>zu</strong>vor dort angesie<strong>de</strong>lten Russen abgewan<strong>de</strong>rt sind,<br />
aber auch wegen <strong>de</strong>s Geburten<strong>de</strong>fizits. Riga ist politisches, wirtschaftliches und kulturelles Zentrum <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Die alte Hansestadt ist berühmt für ihre Jugendstilbauten und ihre<br />
großzügige Anlage sowie für die gut erhaltene Innenstadt.<br />
Geografie<br />
Klima
Das Klima ist feucht-kontinental mit warmen, feuchten Sommern und schneereichen Wintern. Temperaturen bis −20 °C sind keine Seltenheit.<br />
Stadtglie<strong>de</strong>rung<br />
• Riga ist in drei Rajons (rajon) und drei Vororte (priekšpilsēta) geglie<strong>de</strong>rt und umfasst zahlreiche Stadtteile:<br />
• Centra rajons (3 km²): Centrs, Vecpilsēta<br />
• Kurzemes rajons (79 km²): Āgenskalns, Bol<strong>de</strong>rāja, Daugavgrīva, Dzirciems, Iļģuciems, Imanta, Kleisti, Ķīpsala, Rītabuļļi, Spilve, Voleri, Zasulauks<br />
• Zemgales priekšpilsēta (41 km²): Āgenskalns, Atgāzene, Beberbeķi, Bieriņi, Bišumuiža, Katlakalns, Mūkupurvs, Pleskodāle, Salas, Šampēteris, Torņakalns, Ziepniekkalns,<br />
Zolitū<strong>de</strong><br />
• Ziemeļu rajons (77 km²): Čiekurkalns, Jaunciems, Kundziņsala, Mangaļsala, Mežaparks, Mīlgrāvis, Pētersala-Andrejsala, Sarkandaugava, Trīsciems, Vecāķi, Vecdaugava,<br />
Vecmīlgrāvis<br />
• Vidzemes priekšpilsēta (57 km²): Berģi, Brasa, Brekši, Bukulti, Dreiliņi, Jugla, Mežciems, Purvciems, Skanste, Suži, Teika<br />
• Latgales priekšpilsēta (50 km²): Avotu iela, Dārzciems, Dārziņi, Grīziņkalns, Ķengarags, Maskavas forštate, Pļavnieki, Rumbula, Šķirotava<br />
Nachbarschaft<br />
Das Stadtgebiet Rigas grenzt im Nor<strong>de</strong>n an die Ostsee, im Osten an die Gemein<strong>de</strong>n (novads) Carnikava, Garkalne und Stopiņi, im Sü<strong>de</strong>n an Salaspils, Ķekava und Olaine und im Westen<br />
an Mārupe, Babīte sowie die Stadt Jūrmala.<br />
Geschichte<br />
Gründung<br />
Nach 1150 kamen gotländische Kaufleute regelmäßig <strong>zu</strong>m Han<strong>de</strong>l an <strong>de</strong>n Unterlauf <strong>de</strong>r Düna (lettisch: Daugava) am Flüsschen Rīdzene (<strong>de</strong>utsch: Riege, daher auch <strong>de</strong>r Name Rīga), <strong>de</strong>r<br />
hier in die Düna mün<strong>de</strong>te und später <strong>zu</strong>geschüttet wur<strong>de</strong>. Nur anhand <strong>de</strong>s heutigen Verlaufs bestimmter Straßen ist die Lage dieses Flusses nachvollziehbar. Mehrfach gingen<br />
Missionsbewegungen vom späteren Gründungsort Rigas aus, die jedoch bis <strong>zu</strong>r Stadtgründung fehlschlugen. Vor allem im letzten Viertel <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts gelangten <strong>zu</strong>nehmend<br />
<strong>de</strong>utsche Kaufleute nach Livland, <strong>zu</strong>nächst allerdings war <strong>de</strong>r Semgallerhafen am Unterlauf <strong>de</strong>r Aa (lettisch: Lielupe), etwa 50 km westlich Rigas, ein wichtiger Han<strong>de</strong>lsplatz. Er wur<strong>de</strong><br />
auf päpstlichen Beschluss hin 1200 geschlossen, um Riga als einzigen Han<strong>de</strong>lsplatz <strong>zu</strong> etablieren. Die im Jahre 1201 von Bischof Albert von Buxhoeve<strong>de</strong>n aus Bremen gegrün<strong>de</strong>te Stadt<br />
Riga war die Hauptstadt von Livland (lateinisch: Livonia). Riga war vor allem Sitz <strong>de</strong>r Erzbischöfe von Riga, aber auch eine immer be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Han<strong>de</strong>lsstadt, die <strong>de</strong>r Hanse<br />
angehörte. Insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n ersten Jahrzehnten ihres Bestehens wuchs Riga mit beachtlicher Geschwindigkeit, so dass die bebaute Fläche innerhalb von weniger als 30 Jahren um<br />
etwa das 5- bis 6-fache gewachsen war. Seit 1211 gewannen die Bürger <strong>de</strong>r Stadt, insbeson<strong>de</strong>re die Kaufleute, die sich nach <strong>de</strong>r Unterwerfung <strong>de</strong>r umliegen<strong>de</strong>n Völkerschaften<br />
ansie<strong>de</strong>lten, an Einfluss; 1225 konnten die Bürger ihren Stadtvogt (bisher vom Bischof eingesetzt) selbst wählen. Der Rigaer Rat ist 1225 <strong>zu</strong>m ersten Male urkundlich erwähnt und<br />
bestand wahrscheinlich seit etwa 1222/23.<br />
Riga unter <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n<br />
Im Rahmen <strong>de</strong>r Ostkolonisation versuchten die Bischöfe vor allem Deutsche im heidnischen Gebiet an<strong>zu</strong>sie<strong>de</strong>ln. Militärisch wur<strong>de</strong>n sie dabei vor allem von Ritteror<strong>de</strong>n unterstützt,<br />
<strong>zu</strong>nächst von <strong>de</strong>m Schwertbrü<strong>de</strong>ror<strong>de</strong>n und nach <strong>de</strong>ssen Nie<strong>de</strong>rgang von <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Schwertbrü<strong>de</strong>ror<strong>de</strong>n eingeglie<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>. Insbeson<strong>de</strong>re nach <strong>de</strong>r Vertreibung<br />
<strong>de</strong>r Kreuzfahrer aus Palästina begann sich <strong>de</strong>r Deutsche Or<strong>de</strong>n verstärkt um die Osteuropäischen Gebiete <strong>zu</strong> kümmern, vor allem Preußen, aber auch Livland. Der Deutsche Or<strong>de</strong>n war<br />
eine organisatorisch eigenständige, machtvolle kirchliche Organisation, die bald als neuer Machtfaktor <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Erzbischöfen von Riga in Konkurrenz trat. Geleitet wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r livländische<br />
Zweig <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns von einem Landmeister, <strong>de</strong>r direkt <strong>de</strong>m Hochmeister (= Oberster Or<strong>de</strong>nsherr) unterstand.<br />
Die zahlreichen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen <strong>de</strong>n Erzbischöfen von Riga und <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n sowohl mit Waffengewalt als auch mittels Prozessen vor <strong>de</strong>m Papst
ausgefochten. Die Bischöfe versuchten auch, Schutz bei nahen Staaten <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n (wie z.B. Dänemark) aber auch beim Deutschen Kaiser. Seit <strong>de</strong>r Schlacht bei Neuermühlen 1492<br />
erkannte <strong>de</strong>r Erzbischof von Riga <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n als die Schutzmacht Livlands (1492–1561) an und beteiligte sich auch mit einem eigenen Heereskontingent an <strong>de</strong>r Schlacht am<br />
Smolinasee 1502.<br />
Von <strong>de</strong>r Reformation bis <strong>zu</strong>r russischen Provinz<br />
Im Jahre 1522 schloss sich Riga <strong>de</strong>r Reformation an, womit die Macht <strong>de</strong>r Erzbischöfe ihrem En<strong>de</strong> entgegenging. Letzter Erzbischof von Riga war Wilhelm von Bran<strong>de</strong>nburg. Nach<br />
seiner Abdankung im Jahre 1561 kam die Stadt unter <strong>de</strong>n Einfluss von Polen-Litauen, doch Versuche <strong>zu</strong>r Gegenreformation in Riga und <strong>de</strong>m südlichen Livland scheiterten: 1621 wur<strong>de</strong>n<br />
Riga und die Festung Dünamün<strong>de</strong> (Daugavgriva) durch <strong>de</strong>n schwedischen König Gustav II. Adolf erobert, <strong>de</strong>r sich in <strong>de</strong>n Dreißigjährigen Krieg vor allem auch <strong>de</strong>shalb einschaltete, um<br />
die Ausbreitung <strong>de</strong>s lutheranischen Protestantismus <strong>zu</strong> för<strong>de</strong>rn. Im russisch-schwedischen Krieg 1656–1658 hielt Riga einer russischen Belagerung stand und blieb bis Anfang <strong>de</strong>s 18.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts die zweitgrößte Stadt im schwedischen Herrschaftsbereich. In dieser Zeit genoss die Stadt weitgehen<strong>de</strong> Selbstverwaltung. Am 4. Juli 1710 ergab sich im Laufe <strong>de</strong>s Großen<br />
Nordischen Krieges die Stadt nach längerer Belagerung <strong>de</strong>n Truppen <strong>de</strong>s russischen Generals Boris Petrowitsch Scheremetew.[1] Der Aufstieg von Russland als Großmacht in <strong>de</strong>r<br />
Ostseeregion wur<strong>de</strong> durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Nystad im Jahre 1721 besiegelt. Riga wur<strong>de</strong> an das Zarenreich angeschlossen und war ab 1796 Hauptstadt <strong>de</strong>s Gouvernements Livland (siehe<br />
Ostseegouvernements). Bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong> Riga schrittweise <strong>zu</strong> einem <strong>de</strong>r wichtigsten Häfen Russlands ausgebaut, die Bevölkerungszahl <strong>de</strong>r Stadt verzehnfachte<br />
sich zwischen 1850 und 1900. Trotz russischer Herrschaft blieb sowohl die Stadtkultur als auch <strong>de</strong>r Großgrundbesitz bis ins 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt vom Einfluss <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Oberschicht im<br />
Lan<strong>de</strong> geprägt. Bis 1891 war die offizielle Amtssprache Deutsch, dann wur<strong>de</strong> Russisch Amtssprache.<br />
Weltkriege und Besat<strong>zu</strong>ng<br />
1913 gaben etwa 40 % <strong>de</strong>r Einwohner an, Letten <strong>zu</strong> sein, knapp 20 % Russen bzw. Altgläubige, etwa 13 % Deutsch-Balten, etwa 7 % <strong>de</strong>r Einwohner waren Ju<strong>de</strong>n. Außer<strong>de</strong>m gab es eine<br />
nennenswerte polnische bzw. litauische Min<strong>de</strong>rheit.<br />
Noch 1881 sah das Bild ganz an<strong>de</strong>rs aus. Gut 30 % <strong>de</strong>r Einwohner gaben an, <strong>de</strong>utschbaltisch <strong>zu</strong> sein, etwa 33 % waren Letten, 19 % waren Russen bzw. Altgläubige, 8,5 % Ju<strong>de</strong>n.<br />
Der Aufstieg Rigas wur<strong>de</strong> durch <strong>de</strong>n Ersten Weltkrieg jäh unterbrochen. Die Stadt lag an <strong>de</strong>r Frontlinie und <strong>zu</strong>r Sicherstellung <strong>de</strong>r Kriegswirtschaft wur<strong>de</strong>n 200.000 Einwohner (Arbeiter<br />
mit ihren Familien) für Rüstungszwecke nach Zentralrussland evakuiert.<br />
Nach <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Beset<strong>zu</strong>ng 1917/18 gelang es <strong>de</strong>n Letten, am 18. November 1918 eine unabhängige Republik aus<strong>zu</strong>rufen. Die Rote Armee konnte <strong>de</strong>n Anspruch <strong>de</strong>r Sowjetunion<br />
gegen das von Deutsch-Balten unterstützte unabhängige Lettland nicht durchsetzen und musste sich aus <strong>de</strong>m Baltikum <strong>zu</strong>rückziehen.<br />
Riga wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Hauptstadt Lettlands, am 18. März 1921 wur<strong>de</strong> hier <strong>de</strong>r polnisch-sowjetische Frie<strong>de</strong>nsvertrag unterschrieben. Es folgt eine erneute Blütezeit in <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Eine ungenügen<strong>de</strong> Min<strong>de</strong>rheitsgesetzgebung verhin<strong>de</strong>rte, dass sich im neuen lettischen Staat Letten, Deutsche, Russen und Ju<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> einer Gesellschaft unter lettischer Fahne vereinigten.<br />
Gegen Anfang <strong>de</strong>r 1930er Jahre ging diese Blütezeit langsam <strong>zu</strong> En<strong>de</strong>. 1938 hatte Riga noch ca. 385.000 Einwohner. Mit <strong>de</strong>r Machtergreifung <strong>de</strong>r Nationalsozialisten in Deutschland<br />
wur<strong>de</strong> Lettland nicht nur von <strong>de</strong>n neu aufkeimen<strong>de</strong>n hegemonialen Strömungen <strong>de</strong>r Sowjetunion bedroht, die eine Anglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>s ehemals russischen Territoriums for<strong>de</strong>rten. Im<br />
Hitler-Stalin-Pakt vom August 1939 vereinbarten die bei<strong>de</strong>n Diktaturen, das Baltikum und damit auch Lettland <strong>de</strong>r sowjetischen Einflusssphäre <strong>zu</strong><strong>zu</strong>weisen. Im Herbst 1939 wur<strong>de</strong>n die<br />
Deutsch-Balten vereinbarungsgemäß in <strong>de</strong>n vom Deutschen Reich eroberten Warthegau umgesie<strong>de</strong>lt. Am 17. Juni 1940 rollten sowjetische Panzer durch Rigas Straßen und besetzten die<br />
Stadt, die nun Hauptstadt <strong>de</strong>r Lettischen Sowjetrepublik wur<strong>de</strong>.<br />
Nach <strong>de</strong>m Angriff auf die Sowjetunion 1941 eroberten <strong>de</strong>utsche Truppen das Gebiet um Riga. In <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Beset<strong>zu</strong>ng von 1941 bis 1944 war Riga <strong>de</strong>r Verwaltungssitz <strong>de</strong>s<br />
Generalkommissars für <strong>de</strong>n Generalbezirk Lettland Otto-Heinrich Drechsler. Auch das Reichskommissariat Ostland (<strong>zu</strong>nächst in Kaunas) mit seinen Dienststellen.<br />
Die jüdische Bevölkerung, 1933 ca. 44.000 Menschen, wur<strong>de</strong> im Rigaer Ghetto interniert (ab 21. Juli 1941), ermor<strong>de</strong>t o<strong>de</strong>r in an<strong>de</strong>re Konzentrationslager <strong>de</strong>portiert. Weitere Gefangene<br />
gab es in<br />
• <strong>de</strong>m sog. Arbeits- und Erziehungslager Salaspils
• Rigaer Kriegsgefangenen-Stammlager 350<br />
• <strong>de</strong>ssen Zweiglager Stalag 350/Z<br />
• <strong>de</strong>m KZ Riga-Kaiserwald, im ehemaligen Villenvorort Mežaparks-Kaiserwald (ab März 1943 bis Sept. 1944)<br />
• Außenstellen dieses KZ´s in Riga am Balastdamm (18. August 1943 bis 7. August 1944), in <strong>de</strong>n Dünawerken (18. August 1943 bis 1. Juli 1944), im<br />
Heereskraftfahrzeugpark (18. August 1943 bis 6. August 1944), in <strong>de</strong>r Hirtenstraße (31. Januar 1944 bis 6. August 1944), weitere ab <strong>de</strong>m 18. August 1943 eingerichtete<br />
Außenstellen in Riga Lenta, Riga Mühlgraben, Riga Stras<strong>de</strong>nhof in <strong>de</strong>r Widzemer Chaussee und bei <strong>de</strong>r Rigaer Reichsbahn. Außenstelle in Riga Spilwe ab <strong>de</strong>m 5. Juli<br />
1943, in Riga Stras<strong>de</strong>nhof in <strong>de</strong>r Widzemer Chaussee von <strong>de</strong>r AEG bereits ab <strong>de</strong>m 1. August 1943 und ab <strong>de</strong>m 1. Juni 1944 in <strong>de</strong>r dortigen Ano<strong>de</strong>nwerkstatt.<br />
• <strong>de</strong>m KZ Jungfernhof im Dorf Jumpravmuiza, nahe <strong>de</strong>r Bahnstation Skirotava (3. Dezember 1941 bis März 1942; überwiegend eine Zwischenstation vor <strong>de</strong>r Ermordung durch<br />
Massenerschießungen, vor allem im Rumbula-Wald)<br />
Während <strong>de</strong>r kriegerischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen um die Rückeroberung <strong>de</strong>r Stadt durch die Rote Armee 1944 wur<strong>de</strong> die Altstadt Rigas (lettisch: Vecrīga) schwer beschädigt. Lettland<br />
wur<strong>de</strong> erneut von <strong>de</strong>r Sowjetunion okkupiert und Riga die Hauptstadt <strong>de</strong>r Lettischen Sozialistischen Sowjetrepublik.<br />
In Riga bestan<strong>de</strong>n die drei sowjetischen Kriegsgefangenenlager 277, 317 und 350 für <strong>de</strong>utsche Kriegsgefangene <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs.[2] Schwer Erkrankte wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n<br />
Kriegsgefangenenhospitälern 3338 und 4379 versorgt.<br />
Ermutigt durch Perestroika und Glasnost erklärte die Saeima, das Lettische Parlament, 1990 die Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>r Unabhängigkeit von <strong>de</strong>r Sowjetunion. Daraufhin ließ <strong>de</strong>r damalige<br />
Generalsekretär <strong>de</strong>s Zentralkomitees <strong>de</strong>r KPdSU und Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r Sowjetunion, Michail Gorbatschow, das Parlamentsgebäu<strong>de</strong> in Riga zeitweilig durch sowjetische Militäreinheiten<br />
besetzen. Am 21. August 1991 erkannten sowohl die Sowjetunion als auch im gleichen Jahr <strong>de</strong>r russische Präsi<strong>de</strong>nt Boris Jelzin die Unabhängigkeit Lettlands an. Riga wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r<br />
Hauptstadt eines souveränen lettischen Staates.<br />
Bevölkerung<br />
Bevölkerungsentwicklung<br />
Riga ist die bevölkerungsreichste Stadt <strong>de</strong>s Baltikums, die Bevölkerung ist aber seit 1990 stark <strong>zu</strong>rückgegangen und fällt weiter. Der Rückgang resultiert <strong>zu</strong>m Einen aus <strong>de</strong>r<br />
Auswan<strong>de</strong>rung von Russen, Weißrussen und Ukrainern in <strong>de</strong>n ersten Jahren nach <strong>de</strong>r Unabhängigkeit sowie aus <strong>de</strong>r Übersiedlung von Angehörigen aller Volksgruppen nach<br />
Großbritannien und Irland in <strong>de</strong>n letzten Jahren, <strong>zu</strong>m An<strong>de</strong>ren aus niedrigen Geburtenraten. Wenn sich diese Entwicklung nicht umkehrt, könnte sich die Einwohnerzahl bis 2050<br />
halbieren.<br />
Zum 1. Januar 2010 betrug die Einwohnerzahl 709.145, die sich wie folgt auf die Stadtbezirke verteilten:[3]<br />
• Centra rajons 24.547<br />
• Kurzemes rajons 133.505<br />
• Latgales priekšpilsēta 193.287<br />
• Vidzemes priekšpilsēta 172.064<br />
• Zemgales priekšpilsēta 105.090<br />
• Ziemeļu rajons 80.652<br />
Einwohnerzahlen seit 1767:Jahr Einwohner:<br />
• Jahr Einwohner Jahr Einwohner Jahr Einwohner Jahr Einwohner Jahr Einwohner<br />
• 1767 19.500 1941 335.200 1990 909.135 2000 764.329 2010 709.145
• 1800 29.500 1945 228.200 1991 900.455 2001 756.627<br />
• 1840 60.000 1950 482.300 1992 889.741 2002 747.157<br />
• 1867 102.590 1955 566.900 1993 863.657 2003 739.232<br />
• 1881 169.329 1959 580.400 1994 843.552 2004 735.241<br />
• 1897 255.879 1965 665.200 1995 824.988 2005 731.762<br />
• 1913 472.068 1970 731.800 1996 810.172 2006 727.578<br />
• 1920 185.100 1975 795.600 1997 797.947 2007 722.485<br />
• 1930 377.900 1979 835.500 1998 786.612 2008 719.613<br />
• 1940 353.800 1987 900.300 1999 776.008 2009 715.978<br />
Sprachen<br />
Die Zusammenset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Rigaer Einwohner nach ihrer Mutter- bzw. Umgangssprache ergibt sich aus nachstehen<strong>de</strong>r Tabelle für die Jahre 1867 bis 1913[4]<br />
• Sprache 1867 1881 1897 1913<br />
• <strong>de</strong>utsch 43.980 (42,9%) 66.775 (39,4%) 65.332 (25,5%) 78.656 (16,7%)<br />
• lettisch 24.199 (23,6%) 49.974 (29,5%) 106.541 (41,6%) 187.135 (39,6%)<br />
• russisch 25.772 (25,1%) 31.976 (18,9%) 43.338 (16,9%) 99.985 (21,2%)<br />
• jiddisch 5.254 (5,1%) 14.222 (8,4%) 16.521 (6,5%) 21.231 (4,5%)<br />
• estnisch 872 (0,9%) 1.565 (0,9%) 3.532 (1,4%) 6.721 (1,4%)<br />
• polnisch ... ... 12.869 (5,0%) 35.621 (7,5%)<br />
• litauisch ... ... 5.853 (2,3%) 25.824 (5,5%)<br />
• sonstige* 2.513 ( 2,4%) 4.048 (2,4%) 1.772 (0,7%) 16.895 (3,6%)<br />
• ohne Angabe ... 769 (0,5%) 130 (0,1%) ...<br />
• Gesamt 102.590 (100%) 169.329 (100%) 255.879 (100%) 472.068 (100%)<br />
*Die Angabe für 1881 enthält hier auch die polnisch und litauisch sprechen<strong>de</strong>n Einwohner<br />
Nach Zahlen von 2009 beträgt <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r Letten an <strong>de</strong>r Stadtbevölkerung mit 42,3 % eine knappe Mehrheit, 41,3 % sind Russen, 4,3 % Weißrussen, 3,9 % Ukrainer, 2,0 % Polen und<br />
6,2 % Angehörige an<strong>de</strong>rer Volksgruppen.<br />
Politik und Verwaltung<br />
Die Stadt ist Sitz <strong>de</strong>s Präsi<strong>de</strong>nten, <strong>de</strong>s Parlamentes (Saeima), <strong>de</strong>r Ministerien, <strong>de</strong>s Obersten Gerichtshofes (Latvijas Republikas Augstākā tiesa) sowie zahlreicher diplomatischer<br />
Vertretungen.<br />
Die Stadtverwaltung hat ihren Sitz im Rathaus am Rathausplatz (Ratslaukums) in <strong>de</strong>r Altstadt. Der Stadtrat hat 60 MItglie<strong>de</strong>r, die alle vier Jahre neu gewählt wer<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>n<br />
Ratsvorsitzen<strong>de</strong>n und damit <strong>de</strong>s Bürgermeisters aus ihren Reihen wählen. Mit Nils Ušakovs wur<strong>de</strong> 2009 erstmals ein ethnischer Russe <strong>zu</strong>m Bürgermeister gewählt. Das Ratspräsidium<br />
besteht aus Mitglie<strong>de</strong>rn aller Ratsfraktionen und <strong>de</strong>m Bürgermeister. Öffentliche Sit<strong>zu</strong>ngen fin<strong>de</strong>n meist einmal im Monat statt.
Vier Fraktionen sind im Stadtrat vertreten: Pilsoniskā savienība (PS), Saskaņas centrs (SC), Jaunais laiks (JL) sowie die christ<strong>de</strong>mokratisch-liberale Koalition Latvijas Pirmā<br />
partija/Latvijas Ceļš (LPP/LC).<br />
Symbole<br />
Das Rigaer Wappen wur<strong>de</strong> am 31. Oktober 1925 angenommen und zeigt einen silbernen Schild mit offenen Toren und zwei Türmen über <strong>de</strong>m sich zwei gekreuzte schwarze Schlüssel<br />
sowie ein gol<strong>de</strong>nes Kreuz und eine Krone befin<strong>de</strong>n. Der Schild wird eingerahmt durch zwei Löwen. Die Flagge von 1937 zeigt das Wappen auf zwei horizontalen, hellblau-weißen<br />
Streifen.<br />
Partnerstädte<br />
Die erste Partnerschaft Rigas wur<strong>de</strong> 1964 mit <strong>de</strong>r finnischen Stadt Pori geschlossen, <strong>de</strong>r 1973 eine Partnerschaft mit <strong>de</strong>m französischen Calais folgte, die bis 1993 durch einen regen<br />
Austausch geprägt war. Erste außereuropäische Partnerstadt ist seit 1973 das japanische Kobe 1974. Mit Rostock 1974 und Bremen 1985 wur<strong>de</strong>n zwei ehemalige <strong>de</strong>utsche Hansestädte<br />
Partner Rigas. Die Partnerschaftsabkommen mit bei<strong>de</strong>n Städten wur<strong>de</strong>n 1991 erneuert. Aalborg (Dänemark) Florenz (Italien) Slough (Vereinigtes Königreich).<br />
Aalborg (Dänemark)<br />
• Almaty (Kasachstan)<br />
• Amsterdam (Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>)<br />
• Astana (Kasachstan)<br />
• Kobe (Japan)<br />
• Vilnius (Litauen)<br />
• Guam (Guam)<br />
• Rostock (Deutschland)<br />
• Sankt Petersburg (Russland)<br />
• Provi<strong>de</strong>nce (USA, Rho<strong>de</strong> Island)<br />
• Warschau (Polen)<br />
• Florenz (Italien)<br />
• Alicante (Spanien)<br />
• Cairns (Australien, Queensland)<br />
• Kiew (Ukraine)<br />
• Bremen (Deutschland)<br />
• Tallinn (Estland)<br />
• Peking (Volksrepublik China)<br />
• Dallas (USA, Texas)<br />
• Santiago <strong>de</strong> Chile (Chile)<br />
• Suzhou (China)<br />
• Slough (Vereinigtes Königreich)<br />
• Calais (Frankreich)<br />
• Dunkerque (Frankreich)
• Bor<strong>de</strong>aux (Frankreich)<br />
• Moskau (Russland)<br />
• Minsk (Weißrussland)<br />
• Pori (Finnland)<br />
• Stockholm (Schwe<strong>de</strong>n)<br />
• Taipeh (Republik China)<br />
• Norrköping (Schwe<strong>de</strong>n)<br />
Stadtbild und Architektur<br />
Die Innenstadt Rigas wur<strong>de</strong> 1997 <strong>zu</strong>r Liste <strong>de</strong>s UNESCO-Weltkulturerbe hin<strong>zu</strong>gefügt, wegen <strong>de</strong>s „außergewöhnlichen universellen Wertes“ aufgrund <strong>de</strong>r weltweit einzigartigen Qualität<br />
und Quantität <strong>de</strong>r Jugendstilarchitektur bei relativ intakt gebliebenem historischen Stadtgefüge und wegen <strong>de</strong>r Holzarchitektur aus <strong>de</strong>m 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt.[5]<br />
Durch die Pläne für die weitere städtebauliche Entwicklung am linken Dünaufer, beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r Insel Ķīpsala, besteht die Gefahr, dass Riga auf die Rote Liste <strong>de</strong>s gefähr<strong>de</strong>ten Welterbes<br />
gesetzt wird. Konkret sehen die Experten von UNESCO und ICOMOS durch die Errichtung von Hochhäusern die visuelle Integrität <strong>de</strong>s Stadtbil<strong>de</strong>s gefähr<strong>de</strong>t. Die Stadtverwaltung<br />
wur<strong>de</strong> aufgefor<strong>de</strong>rt, die Pläne <strong>zu</strong> überarbeiten. Allgemein wird anerkannt, dass sich Verwaltung, Management und Konservierung <strong>de</strong>r Welterbestätte verbessern.[6]<br />
Das städtebauliche Muster Rigas umfasst <strong>de</strong>n mittelalterlichen Kern, einen Halbkreis von Boulevards um die Altstadt herum und die Neustadt mit ihren regelmäßig angelegten<br />
Straßenzügen. Alle Bereiche konnten sich ihre Authentizität und <strong>de</strong>n architektonischen Charakter erhalten.[6]<br />
Altstadt<br />
Die Altstadt (Vecrīga) ist das historische und geographische Zentrum Rigas am rechten Ufer <strong>de</strong>r Düna gelegen und hat sich ihren Festungscharakter trotz <strong>de</strong>r Schleifung <strong>de</strong>r<br />
Befestigungsanlagen und Wälle zwischen 1857 und 1863 bewahren können. Die nach <strong>de</strong>m Abriss <strong>de</strong>r Stadtmauer entstan<strong>de</strong>nen Freiflächen wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> einem Stadtpark mit Stadtkanal<br />
(Pilsētas kanāls) umgestaltet, <strong>de</strong>r heute die Altstadt von <strong>de</strong>r Neustadt trennt.<br />
Zentrum <strong>de</strong>r Altstadt ist <strong>de</strong>r Marktplatz (heute Rātslaukums) an <strong>de</strong>m sich das Rathaus (Rīgas rātsnams) sowie das Schwarzhäupterhaus (Melngalvju nams) befin<strong>de</strong>n. Letzteres wur<strong>de</strong><br />
1999 wie<strong>de</strong>rerrichtet, nach<strong>de</strong>m es im Krieg zerstört und die Ruine anschließend von <strong>de</strong>n Sowjets gesprengt wor<strong>de</strong>n war. Der gotische Ursprungsbau mit <strong>de</strong>r Fassa<strong>de</strong> im Stil <strong>de</strong>r<br />
nie<strong>de</strong>rländischen Renaissance stammte von 1334 und diente ab 1477 <strong>de</strong>r kaufmännischen Vereinigung <strong>de</strong>r Schwarzhäupter als Versammlungsort. Auf <strong>de</strong>m Platz vor <strong>de</strong>m Gebäu<strong>de</strong> steht<br />
eine Rolandstatue.<br />
Den Grundstein <strong>de</strong>s Doms (Rīgas Doms) ließ 1211 Bischof Albrecht von Buxthoeven legen. Die Mittelschiffe wur<strong>de</strong>n im 14. und 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt angebaut. Nach mehrfachen<br />
Zerstörungen beträgt die Höhe <strong>de</strong>s Turmes seit 1776 90 Meter, die Höhe <strong>de</strong>s um 1590 erbauten Holzturmes hatte 140 Meter betragen. Die En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts erbaute Orgel zählt<br />
<strong>zu</strong> <strong>de</strong>n größten und besten Orgeln <strong>de</strong>r Welt. Die Türme <strong>de</strong>r 1209 erstmals erwähnten Petrikirche (Rīgas Svētā Pētera baznīca) wur<strong>de</strong>n mehrfach zerstört, <strong>zu</strong>letzt im Zweiten Weltkrieg.<br />
Die 1225 erstmals erwähnte Jakobskirche (Rīgas Svētā Jēkaba katedrāle) mit ihrem 80 Meter hohen Turm ist die katholische Kathedrale Rigas. Sie wur<strong>de</strong> 1582 vom polnischen König<br />
gekauft und <strong>de</strong>n Jesuiten übergeben.<br />
Im Rigaer Schloss (Rīgas pils) befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Sitz <strong>de</strong>s Staatspräsi<strong>de</strong>nten. Es wur<strong>de</strong> ab 1330 als Festung für <strong>de</strong>n Schwertbrü<strong>de</strong>ror<strong>de</strong>n errichtet.<br />
In einem 1867 im Stile eines florentinischen Palastes errichteten Bau befin<strong>de</strong>t sich seit <strong>de</strong>r Unabhängigkeit die Saeima, das Parlaments Lettlands. Mit <strong>de</strong>m Pulverturm (Pulvertornis) von<br />
1650 existiert noch ein Überrest <strong>de</strong>r ehemaligen Stadtbefestigung. Weitere historische Denkmäler sind das 1852 geschaffenen Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Rigaer Börse, <strong>de</strong>r Konventhof (Konventa<br />
sēta) mit Ursprüngen im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt, das zwischen <strong>de</strong>m 15. und 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt errichtete Gebäu<strong>de</strong>ensemble <strong>de</strong>r Drei Brü<strong>de</strong>r, das Schwe<strong>de</strong>ntor (Zviedru vārti) die Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Kleinen (Mazā Ģil<strong>de</strong>) und Großen Gil<strong>de</strong> (Lielā Ģil<strong>de</strong>), das Mentzendorffhaus (Mencendorfa nams) von 1695 o<strong>de</strong>r das Dannensternhaus (Dannenšterna nams).<br />
Zwischen Alt- und Neustadt befin<strong>de</strong>t sich seit 1935 das von Kārlis Zāle geschaffene Freiheits<strong>de</strong>nkmal (Brīvības piemineklis) mit einer weiblichen Allegorie <strong>de</strong>r Freiheit auf <strong>de</strong>m 19
Meter hohen Obelisk und Flachreliefs an <strong>de</strong>n Seiten, die historische Ereignisse darstellen.<br />
Neustadt und Vorstädte<br />
In <strong>de</strong>r Neustadt befin<strong>de</strong>n sich zahlreiche Gebäu<strong>de</strong> mit Jugendstilfassa<strong>de</strong>n, beson<strong>de</strong>rs in <strong>de</strong>n Straßen Elizabetes iela und Alberta iela mit vielen Arbeiten Michail Eisensteins. Um die<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rtwen<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n im Grüngürtel um die Altstadt zahlreiche repräsentative Gebäu<strong>de</strong> errichtet, darunter die Nationaloper, das Nationaltheater, das Kunstmuseum, die neugotische<br />
Lettische Kunstaka<strong>de</strong>mie (Latvijas Mākslas akadēmija) von 1905 sowie die Universität. Zwischen 1876 und 1884 entstand die Orthodoxe Kathedrale (Rīgas Kristus Piedzimšanas<br />
pareizticīgo katedrāle) im neubyzantinischen Stil.<br />
Im südlich gelegenen Stadtteil Maskavas forštate (Moskauer Vorstadt) befin<strong>de</strong>n sich die ehemaligen Zeppelin-Hallen <strong>de</strong>s Zentralmarkt (Rīgas Centrāltirgus), <strong>de</strong>r im stalinistischen<br />
Zuckerbäckerstil 1958 erbaute Kultur- und Wissenschaftspalast (Zinātņu akadēmijas augstceltne), die aus Holz im klassizistischen Stil erbaute protestantische Jesuskirche (Jē<strong>zu</strong>s<br />
Evaņģēliski luteriskā baznīca) sowie die Ruinen <strong>de</strong>r Synagoge nahe <strong>de</strong>m ehemaligen Ghetto.<br />
Die Gartenstadt Mežaparks ist ein Villenvorort, <strong>de</strong>r Anfang <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts in <strong>de</strong>n Wäl<strong>de</strong>rn nördlich <strong>de</strong>r Stadt gebaut wur<strong>de</strong>.<br />
Auf <strong>de</strong>r Düna-Insel Zaķusala (Hasenholm) steht <strong>de</strong>r Fernsehturm (Rīgas radio un televīzijas tornis), <strong>de</strong>r mit 368,5 Meter <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n höchsten Bauwerken Europas zählt. Pārdaugava<br />
(<strong>de</strong>utsch: Überdüna) bezeichnet das Stadtgebiet am linken Dünaufer. Es war über lange Zeit geprägt von ein- bis zweistöckigen Holzhäusern, von <strong>de</strong>nen einige erhalten sind.<br />
Parks<br />
In <strong>de</strong>r Innenstadt befin<strong>de</strong>n sich <strong>de</strong>r Wöhrmannsche Garten (Vērmanes dārzs), die älteste öffentliche Parkanlage <strong>de</strong>r Stadt, die 1814 unter <strong>de</strong>m Namen Anna-Wöhrmann-Park angelegt<br />
wur<strong>de</strong>. Vorher hatten sich an <strong>de</strong>ssen Stelle Holzhäuser befun<strong>de</strong>n, die vor <strong>de</strong>r befürchteten Stadtbelagerung durch Napoleon vorsorglich angezün<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n waren. Entlang <strong>de</strong>s<br />
Wassergrabens an <strong>de</strong>r ehemaligen Stadtbefestigung befin<strong>de</strong>t sich ein etwa drei Kilometer langer Park (Kanālmalas apstādījumi). Gegenüber <strong>de</strong>m Jugendstilviertel befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r<br />
Kronvalda-Park (Kronvalda parks) entstand auf <strong>de</strong>m ehemaligen Gelän<strong>de</strong>, das <strong>de</strong>m Deutschen Schützenverein von Zar Alexan<strong>de</strong>r II. geschenkt wur<strong>de</strong>. Die Anlagen <strong>de</strong>r Esplanā<strong>de</strong> liegen<br />
bei <strong>de</strong>r orthodoxen Kathedrale und umfassen im nördlichen Teil einen Markt.<br />
Mit einer Fläche von 37 Hektar ist <strong>de</strong>r Uzvaras-Park <strong>de</strong>r Größte <strong>de</strong>r Stadt. Er beherbergt das 79 Meter hohe sowjetische Freiheits<strong>de</strong>nkmal von 1985.<br />
Der Rigaer Zoo (Rīgas Zooloģiskais dārzs) umfasst über 3000 Tiere. In Mezaparks befin<strong>de</strong>n sich mehrere Waldfriedhöfe, darunter <strong>de</strong>r Brü<strong>de</strong>rfriedhof, ein Soldatenfriedhof, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n<br />
Charakter eines Parks hat.<br />
Wirtschaft und Infrastruktur<br />
Wirtschaft<br />
Die Region Riga ist die wirtschaftlich stärkste Region und das Zentrum industrieller Produktion <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. 60 % <strong>de</strong>r lettischen Unternehmen operieren in Riga, mehr als 50 % <strong>de</strong>r<br />
Arbeitnehmer sind in <strong>de</strong>r Region aktiv. Vor allem die Lebensmittelindustrie, aber auch Holz- und Textilindustrie, chemische und pharmazeutische Industrie sind be<strong>de</strong>utend. Riga zieht<br />
<strong>zu</strong>nehmend ausländische Investitionen an und entwickelt sich <strong>zu</strong> einem be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Standort von Gewerbeausstellungen im baltischen Raum.[7]<br />
Fast alle <strong>de</strong>r umsatzstärksten Unternehmen Lettlands haben ihren Sitz in Riga, darunter <strong>de</strong>n auf IT-Produkte spezialisierten Großhändler ELKO Grupa, die Han<strong>de</strong>lskette Rimi Latvia, <strong>de</strong>n<br />
staatlichen Stromversorger Latvenergo, <strong>de</strong>r Erdgasmonopolist Latvijas Gāze, die Eisenbahngesellschaft Latvijas Dzelzceļš, das staatliche Postunternehmen Latvijas Pasts und Latvia<br />
Statoil, <strong>de</strong>r Ableger <strong>de</strong>r norwegischen Erdölgesellschaft sowie Mazeiku Nafta tirdzniecibas nams, <strong>de</strong>r Mobilfunkanbieter Latvijas Mobilais Telefons (LMT) und die Fluggesellschaft<br />
airBaltic. Die Börse Riga (NASDAQ OMX Riga) ist die einzige Wertpapierbörse <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s.<br />
Der Tourismus ist ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r wirtschaftlicher Faktor für die Stadt, 90 % <strong>de</strong>r Touristen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s wählen Riga als Reiseziel.
Verkehr<br />
Riga besitzt eine wichtige Funktion als internationaler Verkehrsknotenpunkt im Ostseeraum (Verkehrsströme zwischen Skandinavien und Osteuropa, von Mitteleuropa nach Finnland<br />
über die Europastraße 67 („Via Baltica“) sowie innerhalb <strong>de</strong>s Baltikums). So befin<strong>de</strong>t sich hier <strong>de</strong>r mit Abstand wichtigste Bahnhof (Rīgas dzelzceļa stacija) <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s mit<br />
Verbindungen nach Moskau und St. Petersburg in Russland, Minsk in Weißrussland und Kaunas und Vilnius in Litauen (Rail Baltica). Daneben befin<strong>de</strong>t sich ein Busbahnhof (Rīgas<br />
Starptautiskā autoosta) mit Fernbusverbindungen in alle Nachbarlän<strong>de</strong>r und viele Län<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r EU.<br />
Der Flughafen Riga (Starptautiskā lidosta "Rīga") ist <strong>de</strong>r größte <strong>de</strong>s Baltikums und bietet Flüge <strong>zu</strong> 82 Zielen. Da mit 4 Millionen Fluggästen 2009 die Kapazität von 2,5 Millionen<br />
überschritten wur<strong>de</strong>, wird die Erweiterung geplant. Für 92 Millionen Euro will airBaltic ein neues Terminal bauen.[8]<br />
Ein Fährterminal (Rīgas Pasažieru termināls) bietet Verbindungen vor allem nach Skandinavien, aber auch nach Nord<strong>de</strong>utschland.<br />
Die Straßen Lettlands sind sternförmig auf Riga ausgerichtet. Südlich <strong>de</strong>r Innenstadt wur<strong>de</strong> ein neue Dünabrücke (Dienvidu tilts) für eine Umgehungsstraße erbaut und 2008 eröffnet.[9]<br />
Die Zubringerstraßen sollen 2012 für <strong>de</strong>n Verkehr freigegeben wer<strong>de</strong>n.[10] Als Nordumfahrung (Ziemeļu koridors) ist eine 27–30 Kilometer lange Autobahn geplant, <strong>de</strong>ren Baubeginn<br />
für 2012 o<strong>de</strong>r 2013 geplant ist und die bis 2018 fertiggestellt wer<strong>de</strong>n soll. Es han<strong>de</strong>lt sich dabei um das größte Infrastrukturvorhaben in Riga <strong>de</strong>r letzten Jahrzehnte.[11]<br />
Das städtische Nahverkehrsunternehmen Rīgas Satiksme verfügt über ein S-Bahn-ähnliches System von Vorortzügen sowie ein sehr gut ausgebautes Straßenbahnnetz (252 Wagen, neun<br />
Linien). Ergänzt wird das Schienennetz durch <strong>de</strong>n Oberleitungsbus Riga (etwa 330 Wagen, 20 Linien) sowie diverse Omnibuslinien (etwa 460 Wagen, 53 Linien).<br />
Medien<br />
Riga ist Zentrum <strong>de</strong>r wichtigsten Medien <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radioanstalten Latvijas Televīzija (LTV) und Latvijas Radio mit ihren zahlreichen<br />
Programmen haben ebenso ihren Sitz in Riga wie die privaten Fernsehsen<strong>de</strong>r LNT, TV3 Latvia und <strong>de</strong>n russischsprachigen Sen<strong>de</strong>r PBK Latvia. Mit TV5 Rīga besteht ein nur <strong>de</strong>r Stadt<br />
gewidmeter Kanal. Nach <strong>de</strong>r Unabhängigkeit entstan<strong>de</strong>n private Rundfunkstationen wie Radio Skonto, European Hit Radio o<strong>de</strong>r Radio SWH. Täglich erscheinen<strong>de</strong> Zeitungen sind<br />
Diena und Latvijas Avīze. The Baltic Times ist eine englischsprachige Wochenzeitung für die drei baltischen Staaten mit Sitz in Riga. Mit Rīgas Apriņķa Avīze besteht eine regelmäßig<br />
erscheinen<strong>de</strong> Regionalzeitung für Riga und das Umland.<br />
Bildung<br />
In Riga hat die Lettische Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Wissenschaften (Latvijas Zinātņu akadēmija) ihren Sitz. Sie verfügt über ein Kernforschungszentrum in Salaspils südöstlich von Riga.<br />
Mit <strong>de</strong>r Unabhängigkeit 1919 wur<strong>de</strong> die Universität Lettlands (Latvijas Universitāte) gegrün<strong>de</strong>t, die auf das 1862 gegrün<strong>de</strong>ten Rigaischen Polytechnikum <strong>zu</strong>rückgeht. Sie ist mit etwa<br />
23.800 Stu<strong>de</strong>nten in 13 Fakultäten die größte Universität <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Die 1958 gegrün<strong>de</strong>te Technische Universität Riga (Rīgas Tehniskā universitāte) hat 16.900 Stu<strong>de</strong>nten. Seit 2002 hat<br />
die Stradina-Universität Riga (Rīgas Stradiņa universitāte) <strong>de</strong>n Status als Universität inne. Von 1990 an existierte die Institution als Lettische Medizinische Aka<strong>de</strong>mie (Latvijas<br />
Medicīnas akadēmiju), die auf <strong>de</strong>r medizinischen Fakultät <strong>de</strong>r Universität Lettlands von 1919 grün<strong>de</strong>te.<br />
Seit 1998 besteht die Riga Graduate School of Law als unabhängige Institution innerhalb <strong>de</strong>r Universität Lettlands, die Stockholm School of Economics in Riga ist eine Tochter <strong>de</strong>r<br />
Institution in Stockholm. Weiter existieren ein Konservatorium, zahlreiche weitere Hochschulen sowie ein Goethe-Institut.<br />
Kultur<br />
2010 wur<strong>de</strong> Riga <strong>zu</strong>r Kulturhauptstadt Europas 2014 ernannt.[12] Infrastrukturelle Projekte in diesem Zusammenhang sind <strong>de</strong>r Bau <strong>de</strong>r von Gunnar Birkerts entworfenen Lettischen<br />
Nationalbibliothek (Latvijas Nacionālās bibliotēkas) am Dünaufer gegenüber <strong>de</strong>r Altstadt, einer Konzerthalle (Koncert zale) als Heimstätte unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>s Lettischen Nationalen<br />
Sinfonieorchesters und die Errichtung <strong>de</strong>s Museums für Zeitgenössische Kunst (Laikmetīgās mākslas muzejs) in einem ehemaligen Kraftwerksgebäu<strong>de</strong> in Andrejsala.[13] Trotz einer<br />
Budgetkür<strong>zu</strong>ng um 30 % in Folge <strong>de</strong>r lettischen Wirtschaftskrise 2009 ist <strong>de</strong>r Bürgermeister optimistisch, dass Riga 2014 ein erfolgreiches Programm bieten kann.[14]
Theater<br />
Die Lettische Nationaloper (Latvijas Nacionālā opera) befin<strong>de</strong>t sich seit <strong>de</strong>r ersten Aufführung im Januar 1919 im neoklassizistischen Gebäu<strong>de</strong> (1860–1863), das als Deutsches Theater<br />
konzipiert war. Das Repertoire umfasst Opernklassiker, bekannt ist auch die seit 1922 existieren<strong>de</strong> Ballettkompanie. Eines <strong>de</strong>r größten Theater <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s ist das Lettische<br />
Nationaltheater, das 1919 gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Das Rigaer Russische Theater (Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris) ist das älteste professionelle Dramatheater <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s; 1883 war die<br />
erste Spielzeit <strong>de</strong>s Theaters, <strong>de</strong>ssen Repertoire russische und ausländische Stücke umfasst. Das 1920 eröffnete Daile-Theater (Dailes teātris) präsentiert regelmäßig mo<strong>de</strong>rne ausländische<br />
Stücke. Mit seinen Aufführungen richtet sich das 1944 gegrün<strong>de</strong>te Lettische Staatspuppentheater (Izmainīt Latvijas Valsts Leļļu teātris) vor allem an Kin<strong>de</strong>r. Nach <strong>de</strong>r Unabhängigkeit<br />
entstand 1992 das Neue Rigaer Theater (Jaunais Rīgas teātris).<br />
Museen<br />
Das Lettische Okkupationsmuseum (Latvijas Okupācijas muzejs) befin<strong>de</strong>t sich in einem Bau aus <strong>de</strong>n 1970er-Kahren und widmet sich <strong>de</strong>r Zeit, als Lettland unter <strong>de</strong>utscher und<br />
sowjetischer Besat<strong>zu</strong>ng stand (1940–1991). Im Museum für Ausländische Kunst (Ārzemju mākslas muzejs) befin<strong>de</strong>t sich die größte Sammlung europäischer Kunst vom 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
bis <strong>zu</strong>r Gegenwart in Lettland. Das Lettische Nationale Kunstmuseum (Latvijas Nacionālais mākslas muzejs) ist lettischer Kunst gewidmet. Im Pulverturm befin<strong>de</strong>t sich das Lettische<br />
Kriegsmuseum (Latvijas Kara muzejs) für Militär- und Kriegsgeschichte. Das Museum <strong>de</strong>r lettischen Ju<strong>de</strong>n (Muzejs Ebreji Latvijā) zeigt die Geschichte <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n Rigas vom 18.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt bis 1941 und das Lettische Geschichtsmuseum (Latvijas Vēstures muzejs) im Rigaer Schloss widmet sich <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sgeschichte von <strong>de</strong>r Steinzeit bis in die Gegenwart.<br />
Weiter bestehen ein Lettische Naturgeschichtsmuseum (Latvijas Dabas muzejs) und ein Rigaer Motormuseum (Rīgas Motormuzejs) mit historischen Fahrzeugen. Das Stadtgeschichts-<br />
und Navigationsmuseum (Rīgas vēstures un kuģniecības muzejs) ist eines <strong>de</strong>r ältesten Museen Europas.<br />
Musik<br />
Im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt begann die Blüte europäischer Musik in Riga, das sich <strong>zu</strong>m damaligen be<strong>de</strong>utendsten Musikzentrum <strong>de</strong>s Baltikums entwickelte. Es kam <strong>zu</strong>r Gründung <strong>de</strong>r Rigaer<br />
Musikgesellschaft (1760) und privaten Orchestern wie <strong>de</strong>m von Baron Otto Hermann von Vietinghoff, aus <strong>de</strong>m sich das Orchester <strong>de</strong>r 1782 gegrün<strong>de</strong>ten Oper bil<strong>de</strong>te. In Riga tätig<br />
waren unter an<strong>de</strong>rem Johann Valentin Me<strong>de</strong>r, Johann Gottfried Müthel und Georg Michael Telemann.[15] Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt existierten mit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kunstmusik und <strong>de</strong>m von <strong>de</strong>n<br />
weitgehend rechtlosen Letten weiterentwickelten folkloristischem Liedgut zwei musikalische Traditionen parallel. Von 1837 bis 1839 arbeitete Richard Wagner als Kapellmeister an <strong>de</strong>r<br />
Oper, die <strong>zu</strong> dieser Zeit internationales Niveau erreichte. Leo Blech dirigierte zeitweilig in <strong>de</strong>r Oper.<br />
Klassische Konzerte fin<strong>de</strong>n unter an<strong>de</strong>rem im Schwarzhäupterhaus und in <strong>de</strong>r Großen Gil<strong>de</strong> statt.<br />
Die staatliche Lettische Musikaka<strong>de</strong>mie Jāzeps Vītols wur<strong>de</strong> 1919 als Konservatorium gegrün<strong>de</strong>t und hat etwa 500 Stu<strong>de</strong>nten.<br />
1993 fand in Riga das erste Nationale Sängerfest im unabhängigen Lettland statt; die Tradition <strong>de</strong>r baltischen Sängerfeste ist sehr alt, in Lettland fand das erste bereits 1873 statt. 2003<br />
wur<strong>de</strong>n die Sängerfeste aller drei baltischen Staaten <strong>de</strong>r UNESCO-Liste <strong>de</strong>r „Meisterwerke <strong>de</strong>s mündlichen und immateriellen Erbes <strong>de</strong>r Menschheit“ hin<strong>zu</strong>gefügt. Das XXIV. Nationale<br />
Sängerfest fand 2008 in Riga statt. Ein beson<strong>de</strong>rer Höhepunkt sind die „Kriege <strong>de</strong>r Lie<strong>de</strong>r“, in <strong>de</strong>nen die besten Chöre <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s gegeneinan<strong>de</strong>r antreten.[16]<br />
2003 fand in Riga <strong>de</strong>r Eurovision Song Contest statt.<br />
Sport<br />
Für die Eishockey-Weltmeisterschaft 2006 wur<strong>de</strong> die maximal 14.500 Zuschauer fassen<strong>de</strong> Arēna Rīga erbaut, die für Eishockey, Basketball und Konzerte benutzt wird. Sie dient als<br />
Heimspielort <strong>de</strong>s in <strong>de</strong>r russischen KHL spielen<strong>de</strong>n Vereins Dinamo Riga. Erfolgreichster Fußballverein <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s mit 14 Meisterschaftstiteln ist Skonto Riga mit <strong>de</strong>m im Jahr 2000<br />
eröffneten und 10.000 Zuschauer fassen<strong>de</strong>n Skonto-Stadion (Skonto stadions). Weitere Erstligavereine sind JFK Olimps Riga (Spielort Daugava-Stadion/Daugavas stadions) und FK<br />
Jaunība Riga. Mit 18 Titelgewinnen in <strong>de</strong>r FIBA EuroLeague Women ist TTT Riga einer <strong>de</strong>r erfolgreichsten Vereine im europäischen Frauenbasketball. Erfolgreicher<br />
Herrenbasketballverein sind die BK Barons/LMT (Lettischer Meister 2008) und VEF Riga. Die Skonto Arena (6.500 Zuschauer) wur<strong>de</strong> 1999 eröffnet und wird von <strong>de</strong>r
Basketballmannschaft von Skonto Riga benutzt. Bis 2009 bestand <strong>de</strong>r auch international erfolgreiche Eishockeyverein HK Riga 2000, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r inbox.lv ledus halle spielte.<br />
Regelmäßige Veranstaltungen<br />
Seit 1991 fin<strong>de</strong>t jährlich <strong>de</strong>r Riga-Marathon (Rīgas maratons) statt. 1998 wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m ersten Mal das jährlich im Sommer stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Rigaer Opernfestival (Rīgas Operas<br />
festivāls)organisiert.<br />
• Balletfestival<br />
• Theaterfestival Baltischer Frühling<br />
Kulinarische Spezialitäten<br />
Eine Rigaer Spezialität ist <strong>de</strong>r bittere, schwarze Schnaps Rīgas Melnais balzams, <strong>de</strong>r 1752 erfun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> und aus 24 Zutaten besteht. Er wird pur o<strong>de</strong>r in Kaffee getrunken und gilt als<br />
lettisches Nationalgetränk. Daneben ist Riga bekannt für Schokola<strong>de</strong> und Pralinen.<br />
Persönlichkeiten<br />
• Alexan<strong>de</strong>r Faltin, (1819–1899), <strong>de</strong>utscher Rigaer Ratsherr, Grün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Baltischen Monatsschrift, Initiator <strong>de</strong>r Riga-Dünaburgischen Eisenbahn<br />
• Johann Gottfried von Her<strong>de</strong>r, (1744–1803), <strong>de</strong>utscher Dichter, lebte mehrere Jahre in Riga<br />
• Carl Gustav Jochmann (1789–1830), <strong>de</strong>utscher Publizist<br />
• Wilhelm Ostwald (1853–1932), Physikochemiker, Nobelpreisträger 1909, in Riga geboren<br />
Literatur<br />
• Johann Heinrich Liebeskind: 'Rückerinnerungen von einer Reise' (mit ausführlicher Abhandlung über Riga; 1795). Neuausgabe als e-Buch, 2009 (Manfred Raether, Hsg.)<br />
Bibliographien<br />
• LitDok Ostmitteleuropa (Her<strong>de</strong>r-Institut Marburg)<br />
Monographien<br />
• Andrej Angrick, Peter Klein: Die „Endlösung“ in Riga. Ausbeutung und Vernichtung 1941-1943. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2006, ISBN 3-534-19149-8,<br />
(Veröffentlichungen <strong>de</strong>r Forschungsstelle Ludwigsburg <strong>de</strong>r Universität Stuttgart 6), (Gesamtdarstellung).<br />
• Friedrich Benninghoven: Rigas Entstehung und <strong>de</strong>r frühhansische Kaufmann. Velme<strong>de</strong>, Hamburg 1961, (Nord- und osteuropäische Geschichtsstudien 3).<br />
• Ulrike von Hirschhausen: Die Grenzen <strong>de</strong>r Gemeinsamkeit. Deutsche, Letten, Russen und Ju<strong>de</strong>n in Riga 1860-1914. Van<strong>de</strong>nhoeck & Ruprecht, Göttingen 2006, ISBN 3-525-<br />
35153-4, (Kritische Studien <strong>zu</strong>r Geschichtswissenschaft 172), (Zugleich: Göttingen, Univ., Habil.-Schr., 2005).<br />
• Ilgvars Misans, Horst Wernicke (Hrsg.): Riga und <strong>de</strong>r Ostseeraum. Von <strong>de</strong>r Gründung 1201 bis in die Frühe Neuzeit. Her<strong>de</strong>r-Institut, Marburg 2005, ISBN 3-87969-319-6,<br />
(Tagungen <strong>zu</strong>r Ostmitteleuropa-Forschung 22).<br />
• Erwin Oberlän<strong>de</strong>r, Kristine Wohlfart: Riga. Portrait einer Vielvölkerstadt am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zarenreiches 1857-1914. Schöningh Verlag, Pa<strong>de</strong>rborn 2004, ISBN 3-506-71738-3.<br />
• Andreas Fülberth: Tallinn – Riga – Kaunas. Ihr Ausbau <strong>zu</strong> mo<strong>de</strong>rnen Hauptstädten 1920–1940. Böhlau, Köln/Weimar 2005, ISBN 3-412-12004-9.<br />
Einzelnachweise
1. ↑ [1], abgefragt am 9. Januar 2010<br />
2. ↑ Maschke, Erich (Hrsg.): Zur Geschichte <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kriegsgefangenen <strong>de</strong>s zweiten Weltkrieges. Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld 1962–1977.<br />
3. ↑ Pilsonības un migrācijas lietu pārval<strong>de</strong> (Abgerufen am 5. April 2010)<br />
4. ↑ Rīga 1860-1917, Rīga, Zinātne 1978<br />
5. ↑ UNESCO-Welterbeliste (Abgerufen am 29. Mai 2010)<br />
6. ↑ a b UNESCO/ICOMOS-Mission 2008 (Abgerufen am 14. März 2010)<br />
7. ↑ EUROSTAT (Abgerufen am 28. März 2010)<br />
8. ↑ The Baltic Course, 4. März 2010 (Abgerufen am 28. März 2010)<br />
9. ↑ The Baltic Course, 17. November 2008 (Abgerufen am 5. April 2010)<br />
10.↑ Riga City Council (Abgerufen am 5. April 2010)<br />
11.↑ Projektsite (Abgerufen am 5. April 2010)<br />
12.↑ Pressemeldung <strong>de</strong>r Europäischen Union, 15. September 2009 (Abgerufen am 14. März 2010)<br />
13.↑ Riga 2014 (Abgerufen am 14. März 2010)<br />
14.↑ euobserver.com, 29. März 2010 (Abgerufen am 5. April 2010)<br />
15.↑ In: Musik und Migration in Ostmitteleuropa. Ol<strong>de</strong>nbourg, 2005<br />
16.↑ Annika Müller: Kleines Volk mit großer Stimme. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung, 5. August 2008<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Reval - Tallinn<br />
Tallinn (amtlich bis <strong>zu</strong>m 24. Februar 1918 Reval, ein im <strong>de</strong>utschsprachigen Raum auch danach noch gebräuchlicher Name; an<strong>de</strong>re ältere Namen: russisch Ревель = Rewel und vormals<br />
Колывань = Kolywan, dänisch Lyndanisse, schwedisch Lindanäs) ist die Hauptstadt von Estland. Sie liegt am Finnischen Meerbusen <strong>de</strong>r Ostsee, etwa 80 Kilometer südlich von<br />
Helsinki.<br />
Der Name Tallinn, <strong>de</strong>n die Stadt seit <strong>de</strong>r Eroberung durch <strong>de</strong>n dänischen König Wal<strong>de</strong>mar 1219 im Estnischen trägt, wird üblicherweise von „Taani-linn(a)“ (Dänische Stadt o<strong>de</strong>r<br />
Dänische Burg, lateinisch: Castrum Danorum) abgeleitet.<br />
Geografie<br />
Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Die Passage ,,Klima” wur<strong>de</strong> aus Grün<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Übersichtlichkeit gestrichen.
Stadtglie<strong>de</strong>rung<br />
Tallinn unterteilt sich in die Distrikte Haabersti, Kesklinn, Kristiine, Lasnamäe, Mustamäe, Nõmme, Pirita und Põhja-Tallinn sowie 84 Stadtteile.<br />
• Haabersti: Astangu, Haabersti, Kakumäe, Mäeküla, Mustjõe, Õismäe, Pikaliiva, Rocca al Mare, Tiskre, Väike-Õismäe, Veskimetsa, Vismeistri<br />
• Kesklinn: Aegna, Juhkentali, Kadriorg, Kassisaba, Keldrimäe, Kitseküla, Kompassi, Luite, Maakri, Mõigu, Raua, Sadama, Sibulaküla, Südalinn, Tatari, Tõnismäe, Torupilli,<br />
Ülemistejärve, Uus Maailm, Vanalinn, Veerenni<br />
• Kristiine: Järve, Lilleküla, Tondi<br />
• Lasnamäe: Katleri, Kurepõllu, Kuristiku, Laagna, Loopealse, Mustakivi, Pae, Paevälja, Priisle, Seli, Sikupilli, Sõjamäe, Tondiraba, Ülemiste, Uuslinn, Väo<br />
• Mustamäe: Kadaka, Mustamäe, Sääse, Siili<br />
• Nõmme: Hiiu, Kivimäe, Laagri, Liiva, Männiku, Nõmme, Pääsküla, Rahumäe, Raudalu, Vana-Mustamäe<br />
• Pirita: Iru, Kloostrimetsa, Kose, Laiaküla, Lepiku, Maarjamäe, Mähe, Merivälja, Pirita<br />
• Põhja-Tallinn: Kalamaja, Karjamaa, Kelmiküla, Kopli, Merimetsa, Paljassaare, Pelgulinn, Pelguranna, Sitsi<br />
Nachbarschaft<br />
Tallinn grenzt im Nordosten an Viimsi, im Osten an Jõelähtme, im Südosten an Rae, im Sü<strong>de</strong>n an Saku, im Südwesten an Vasalemma und im Westen an Harku.<br />
Geschichte<br />
Die Ursprünge Revals[1] gehen auf eine hölzerne Burg (auf <strong>de</strong>m heutigen Domberg) und einen vermuteten estnischen Han<strong>de</strong>lsplatz <strong>zu</strong>rück, die Mitte <strong>de</strong>s 11. Jahrhun<strong>de</strong>rts gebaut<br />
wur<strong>de</strong>n. Gleichzeitig wur<strong>de</strong> in dieser Zeit <strong>de</strong>r Hafen Tallinns angelegt. Der Name Reval rührt vom estnischen Namen <strong>de</strong>s historischen Landkreises her, <strong>de</strong>ssen Zentrum die Stadt war,<br />
und wur<strong>de</strong> für die Burg und die spätere Stadt erst von Dänen und Deutschen geprägt (estn. auch Rävälä, nach Heinrich von Lettland Revele, nach <strong>de</strong>m Wal<strong>de</strong>mar-Erdbuch Revælæ).<br />
Dänische Herrschaft<br />
Im Jahre 1219 eroberte <strong>de</strong>r dänische König Wal<strong>de</strong>mar II. die alte estnische Burg (Schlacht von Lyndanisse) auf <strong>de</strong>m Domberg, errichtete sie neu und begann mit <strong>de</strong>m Bau einer<br />
Domkirche für <strong>de</strong>n von Dänemark um 1167 im Zuge seiner Missionierung ernannten Bischof <strong>de</strong>r Esten, Suffragan <strong>de</strong>s Erzbischofs von Lund. Dänemark konnte die Burg jedoch nicht<br />
lange gegen die aufständischen Esten und die vordringen<strong>de</strong>n Deutschen halten. 1227 eroberte <strong>de</strong>r Schwertbrü<strong>de</strong>ror<strong>de</strong>n Reval mit päpstlicher Genehmigung und erhielt die Burg und<br />
einen Großteil <strong>de</strong>s heutigen Estland <strong>zu</strong>r Verwaltung aus <strong>de</strong>r Hand <strong>de</strong>s päpstlichen Statthalters in Estland.<br />
Wahrscheinlich um seine Stellung gegen die ländlichen Vasallen <strong>zu</strong> stärken, ließ <strong>de</strong>r Schwertbrü<strong>de</strong>ror<strong>de</strong>n im Jahre 1230 aus Gotland 200 westfälische und nie<strong>de</strong>rsächsische Kaufleute<br />
anwerben, die sich, mit Zollfreiheit und Land belehnt, unterhalb <strong>de</strong>r Burg ansie<strong>de</strong>lten. Obwohl eine Gründungsurkun<strong>de</strong> nicht überliefert ist, ist hierin wohl die eigentliche Gründung<br />
einer Stadt Reval <strong>zu</strong> sehen.<br />
Als <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n es ablehnte, seine Lehnsherrschaften und die Burg drei Jahre später wie<strong>de</strong>r an <strong>de</strong>n päpstlichen Legaten <strong>zu</strong> übergeben, machte <strong>de</strong>r dänische König seine Ansprüche auf<br />
Reval und Estland wie<strong>de</strong>r geltend. Nach einer vernichten<strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns gegen ein litauisches Heer im Jahre 1236 strebte <strong>de</strong>r Schwertbrü<strong>de</strong>ror<strong>de</strong>n die Vereinigung mit <strong>de</strong>m<br />
Deutschen Or<strong>de</strong>n an, die <strong>de</strong>r Papst nur gegen die Herausgabe Revals genehmigte. So ging <strong>de</strong>r Schwertbrü<strong>de</strong>ror<strong>de</strong>n 1237 in <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n über und Reval fiel 1238 an Dänemark.<br />
In diesem Zusammenhang wur<strong>de</strong> Reval <strong>zu</strong>m ersten Mal als civitas (Bürgerschaft, Stadt) erwähnt.<br />
Unter <strong>de</strong>r erneuten dänischen Herrschaft bis <strong>zu</strong>m Jahre 1346 gewann die Stadt rasch an Größe und wirtschaftlicher Be<strong>de</strong>utung. Im Jahre 1248 erhielt sie vom dänischen König das<br />
lübische Stadtrecht, das bis 1865 galt. Das Lübecker Stadtrecht galt allerdings nicht auf <strong>de</strong>m Domberg. Mit <strong>de</strong>r gleichen Urkun<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n die ersten Ratsherren ernannt. Die Stadt erhielt<br />
nach und nach umfangreiche Privilegien, die sie vom Lan<strong>de</strong>sherrn weitestgehend unabhängig machten. Die Amtssprache in Tallinn war bis 1889 Deutsch.
Obwohl Reval unter (<strong>zu</strong>nehmend lockerer) dänischer Herrschaft stand, behielt die Stadt eine <strong>de</strong>utsche Oberschicht, und da diese fast ausschließlich aus Kaufleuten bestand, war ein<br />
baldiger enger Kontakt <strong>zu</strong>r Hanse nicht verwun<strong>de</strong>rlich. Dass sich Reval als <strong>de</strong>r Hanse <strong>zu</strong>gehörig betrachtete, ist bereits für 1252 belegbar und fin<strong>de</strong>t spätestens 1285 ausdrückliche<br />
Erwähnung. Von wirtschaftlicher Be<strong>de</strong>utung war die dänische Entscheidung von 1294, allen <strong>de</strong>utschen Kaufleuten <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>lsweg nach Nowgorod über Reval und Narwa <strong>zu</strong> gestatten.<br />
Damit konnte Reval <strong>zu</strong> einem Knotenpunkt <strong>de</strong>s hansischen Ostseehan<strong>de</strong>ls wer<strong>de</strong>n.<br />
Reval und <strong>de</strong>r Deutsche Or<strong>de</strong>n<br />
Nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rschlagung eines großen Estenaufstan<strong>de</strong>s mit <strong>de</strong>r Hilfe <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns entließ <strong>de</strong>r dänische König 1346 seine estländischen Vasallen aus ihrem Treueid und<br />
verkaufte seine Rechte an Nord-Estland <strong>de</strong>m Deutschen Or<strong>de</strong>n. Reval, das sich im Jahr vor <strong>de</strong>m Verkauf alle bestehen<strong>de</strong>n und einige neue Privilegien durch <strong>de</strong>n dänischen König hatte<br />
bestätigen lassen, bekam nun durch <strong>de</strong>n neuen Lan<strong>de</strong>sherrn sämtliche Privilegien <strong>zu</strong>gesichert und konnte so seine rechtliche und autonome Stellung während <strong>de</strong>s Wechsels noch<br />
ausbauen.<br />
Reval, Teil <strong>de</strong>s „Livländischen Drittels“ <strong>de</strong>r Hanse, erhielt 1346 <strong>zu</strong>sammen mit Riga und Pernau das Stapelrecht, das alle mit Russland Han<strong>de</strong>l treiben<strong>de</strong>n Kaufleute da<strong>zu</strong> verpflichtete,<br />
eine <strong>de</strong>r drei Städte an<strong>zu</strong>laufen und für einen Zeitraum von drei bis acht Tagen ihre Waren auf <strong>de</strong>m Markt an<strong>zu</strong>bieten. Mehrere exklusive Han<strong>de</strong>lsrechte für die Revaler Kaufleute<br />
been<strong>de</strong>ten <strong>de</strong>n bis dahin für je<strong>de</strong>n offenen Freihan<strong>de</strong>l in <strong>de</strong>r Stadt. Die bisher wichtigste Han<strong>de</strong>lsstadt <strong>de</strong>r Ostsee, Wisby, konnte sich von <strong>de</strong>r Plün<strong>de</strong>rung durch <strong>de</strong>n dänischen König<br />
1361 und in <strong>de</strong>n darauf folgen<strong>de</strong>n Kriegsjahren nicht wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> ihrer vorherigen Vormachtstellung erholen, und als <strong>zu</strong>r Jahrhun<strong>de</strong>rtwen<strong>de</strong> auch die Vitalienbrü<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>r Ostsee<br />
verbannt wer<strong>de</strong>n konnten, war Reval die wichtigste Stadt <strong>de</strong>s hansischen Osthan<strong>de</strong>ls.<br />
Der Russlandhan<strong>de</strong>l blieb allerdings nicht immer ungetrübt. Nach mehreren unsicheren Jahren brach 1471 <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l mit Nowgorod durch Angriffe <strong>de</strong>r Moskauer ganz ab, und 1478<br />
wur<strong>de</strong> das bis dahin unabhängige Fürstentum von <strong>de</strong>n Moskauern endgültig erobert. Das Großfürstentum Moskau führte auch Krieg gegen Livland, mit <strong>de</strong>m es nun eine gemeinsame<br />
Grenze besaß. Der Einfall <strong>de</strong>r Moskauer Russen in Livland 1481 brachte <strong>de</strong>r von Flüchtlingen überfüllten Stadt einen schweren Pestausbruch. Weitere schwere Seuchenjahre <strong>de</strong>r Stadt<br />
waren 1464, 1495/96 und 1519/20. Nach einer kurzen Frie<strong>de</strong>nsperio<strong>de</strong>, in <strong>de</strong>r das Nowgoro<strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lskontor wie<strong>de</strong>r eröffnet und erneut geschlossen wur<strong>de</strong>, folgte 1501–1503 ein<br />
erfolgreicher Kriegs<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns gegen Moskau, an <strong>de</strong>n sich ein bis 1558 dauern<strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong> anschloss.<br />
Die Kriege mit <strong>de</strong>n Moskauer Russen brachten für Livland und Reval schwere Verluste an Wirtschaft und Bevölkerung. Erst 1514 gelang die erneute Errichtung einer Han<strong>de</strong>lsbeziehung<br />
<strong>de</strong>r livländischen Städte Reval und Dorpat mit Nowgorod, die <strong>zu</strong> einer neueren wirtschaftlichen Blüte bis in die 1550-er Jahre führte. Im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt hat die Stadt ca. 6000-7000<br />
Einwohner.<br />
Die Reformation erreichte Reval 1523/24. Ihren endgültigen Durchbruch erlebte sie, als sich im Juli 1524 Vertreter <strong>de</strong>r livländischen Städte und Ritter im Revaler Rathaus versammelten<br />
und beschlossen, bei <strong>de</strong>r protestantischen Lehre <strong>zu</strong> bleiben und sie mit allen Mitteln <strong>zu</strong> verteidigen. Im September <strong>de</strong>s gleichen Jahres kam es <strong>zu</strong> einem Bil<strong>de</strong>rsturm, <strong>de</strong>m die Ausstattung<br />
dreier Kirchen <strong>zu</strong>m Opfer fiel. Die Verluste blieben dabei verhältnismäßig gering, da <strong>de</strong>r Rat bereits am nächsten Tag die öffentliche Ordnung wie<strong>de</strong>r herstellen konnte und für die<br />
Rückerstattung <strong>de</strong>r geraubten Kunstschätze sorgte. Insgesamt lässt sich sagen, dass die Reformation in Livland und auch in Reval unblutig erfolgte. Am 9. September 1525 wur<strong>de</strong> die<br />
neue Lehre in Reval durch <strong>de</strong>r Erlass einer lutherischen Kirchenordnung seitens <strong>de</strong>s Rates und <strong>de</strong>r Gil<strong>de</strong>n „amtlich“.<br />
Schutzmacht Schwe<strong>de</strong>n und russische Herrschaft<br />
Die restliche Zeit <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>nsherrschaft war von inneren und äußeren Streitigkeiten geprägt, bis Moskau bei seinem Einfall 1558–1561 <strong>de</strong>n Deutschen Or<strong>de</strong>n in Livland besiegte. Reval<br />
wandte sich an Schwe<strong>de</strong>n als Schutzmacht, womit eine bis <strong>zu</strong>m Großen Nordischen Krieg 1710 anhalten<strong>de</strong> schwedische Herrschaft in <strong>de</strong>r Stadt begann.<br />
1549 erhielt die Olaikirche einen gotischen Turm mit <strong>de</strong>r <strong>zu</strong> dieser Zeit außergewöhnlichen Höhe von 159 Meter; bis <strong>zu</strong>m Brand von 1629 blieb er das höchste Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Welt. Heute<br />
ist er nach einem Wie<strong>de</strong>raufbau im 19. Jh. nur noch 123,7 Meter hoch.<br />
1561 wur<strong>de</strong> die Stadt in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Livländischen Krieges schwedisch. Die Schwe<strong>de</strong>n reduzierten nach und nach die Vorrechte <strong>de</strong>r Deutschen, jedoch nicht in <strong>de</strong>m Ausmaß, wie es die<br />
Esten im Hinblick auf <strong>de</strong>n Status <strong>de</strong>r Bauern in Schwe<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>nächst erhofften.
• 1631 – Gründung <strong>de</strong>s ersten Gymnasiums<br />
• 1684 – vernichten<strong>de</strong>r Brand auf <strong>de</strong>m Domberg<br />
• 1710 – Pestepi<strong>de</strong>mie, Tallinn hatte danach noch 2.000 Einwohner<br />
Infolge <strong>de</strong>s Großen Nordischen Krieges fiel Reval 1710 an Russland. Peter <strong>de</strong>r Große setzte die alten <strong>de</strong>utschen Ratsgeschlechter wie<strong>de</strong>r vollständig in ihre ursprünglichen Positionen, in<br />
<strong>de</strong>n nächsten zwei Jahrhun<strong>de</strong>rten wur<strong>de</strong>n die Rechte <strong>de</strong>r Stadtregierung dann schrittweise reduziert.<br />
Republik Estland 1918–1940<br />
Am 14. Februar 1918 wird die selbständige Republik Estland ausgerufen; die Stadt, die nun Tallinn hieß, wird schließlich Hauptstadt <strong>de</strong>s unabhängigen Estlands. Die eigentliche<br />
Unabhängigkeit wur<strong>de</strong> im Freiheitskrieg (1918–1920) erkämpft und durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>nsvertrag mit <strong>de</strong>m sowjetischen Russland gekrönt.<br />
Sowjetrepublik und Zweiter Weltkrieg<br />
Ein geheimes Zusatzprotokoll <strong>zu</strong>m <strong>de</strong>utsch-sowjetischen Nichtangriffspakt (im August 1939) machte <strong>de</strong>n Weg für die Eroberung Estlands durch die Sowjetunion frei. Die<br />
<strong>de</strong>utschbaltische Bevölkerung wur<strong>de</strong> vom Tallinner Hafen aus auf Befehl Hitlers in <strong>de</strong>n neu geschaffenen Reichsgau Wartheland umgesie<strong>de</strong>lt. Nach <strong>de</strong>r sowjetischen Okkupation im Juni<br />
1940 wur<strong>de</strong> die Estnische Sozialistische Sowjetrepublik ausgerufen, <strong>de</strong>ren Hauptstadt Tallinn blieb. Es begannen die ersten Deportationen <strong>de</strong>r estnischen Bevölkerung – insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r<br />
politischen und kulturellen Elite – nach Sibirien und Nordrussland. In <strong>de</strong>n sowjetischen Terrorwellen nach 1940 und dann wie<strong>de</strong>r ab 1944/45 wur<strong>de</strong> insgesamt je<strong>de</strong>r fünfzehnte Este<br />
ermor<strong>de</strong>t und je<strong>de</strong>r siebzehnte <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st für zehn Jahre nach Sibirien verschleppt (Frankfurter Allgemeine, 14. Mai 2007).<br />
1941 besetzte die <strong>de</strong>utsche Wehrmacht Tallinn, wodurch die Stadt und das Land von einer Willkürherrschaft in die nächste geriet. Hitler verfolgte das Ziel, Estland <strong>de</strong>m Deutschen Reich<br />
an<strong>zu</strong>glie<strong>de</strong>rn. Die von <strong>de</strong>n Esten erhoffte Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>r Unabhängigkeit erfolgte nicht. Dennoch beteiligten sich viele junge Esten am Vormarsch <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Wehrmacht nach<br />
Osten und nahmen auch an Vernichtungsaktionen teil. Die <strong>de</strong>utsche Besat<strong>zu</strong>ngsmacht ließ die jüdische Bevölkerung Tallinns und Estlands nahe<strong>zu</strong> gänzlich ermor<strong>de</strong>n.<br />
Am 9. März 1944 erfolgte ein schwerer sowjetischer Luftangriff. Es wur<strong>de</strong>n 11 % <strong>de</strong>r Altstadt zerstört und 600 Tote gezählt. Während <strong>de</strong>s Krieges blieb <strong>de</strong>r Charakter <strong>de</strong>r Altstadt trotz<br />
<strong>de</strong>r Bombardierungen durch die sowjetische Luftwaffe gegen die in und um Tallinn stationierten <strong>de</strong>utschen Truppen erhalten. Die Wehrmacht wur<strong>de</strong> bis En<strong>de</strong> 1944 von <strong>de</strong>r Sowjetarmee<br />
im Zuge <strong>de</strong>r Baltischen Operation aus Tallinn und Estland <strong>zu</strong>rückgedrängt und die sowjetische Herrschaft wie<strong>de</strong>rhergestellt. In <strong>de</strong>r Stadt bestand das Kriegsgefangenenlager 286 für<br />
<strong>de</strong>utsche Kriegsgefangene <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs.[2]<br />
Republik Estland ab 1991<br />
Nach 51 Jahren wur<strong>de</strong> Tallinn am 20. August 1991, <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Moskauer Putsches, erneut <strong>zu</strong>r Hauptstadt eines unabhängigen Estlands. Infolge <strong>de</strong>s immensen Wirtschaftswachstums<br />
und <strong>de</strong>s in manchen Schichten stark gestiegenen Wohlstan<strong>de</strong>s sind rund um Tallinn innerhalb weniger Jahre riesige Neubaugebiete entstan<strong>de</strong>n. So wur<strong>de</strong>n beispielsweise im südlich von<br />
Tallinn gelegenen Gebiet Peetri auf einem ehemaligen Moor Ein- und Mehrfamilienhäuser gebaut. Vor allem junge Familien, die in <strong>de</strong>n letzten Jahren von <strong>de</strong>r wirtschaftlichen<br />
Entwicklung profitiert haben, lassen sich hier nie<strong>de</strong>r. Es entsteht ein starker Kontrast <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n großen Siedlungen im sozialistischen Stil. Die Preise für Appartements in <strong>de</strong>n<br />
Neubaugebieten sind teilweise bereits auf westlichem Niveau.<br />
En<strong>de</strong> April 2007 kam es in Tallinn durch Krawalle und Plün<strong>de</strong>rungen hauptsächlich russischstämmiger Jugendlicher <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n stärksten Unruhen seit <strong>de</strong>m Zerfall <strong>de</strong>r Sowjetunion. Grund<br />
dafür war die von estnischen Behör<strong>de</strong>n nach längerer vorheriger Ankündigung am 27. April 2007 veranlasste Umset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Bronze-Soldaten von Tallinn von seinem ursprünglichen<br />
Standort im Stadtzentrum auf einen Militärfriedhof. Die Esten verbin<strong>de</strong>n dieses Denkmal eher mit <strong>de</strong>r sowjetischen Besat<strong>zu</strong>ngszeit als mit <strong>de</strong>r Befreiung von <strong>de</strong>r nazi<strong>de</strong>utschen<br />
Beset<strong>zu</strong>ng im Zweiten Weltkrieg, <strong>de</strong>r das Denkmal gewidmet ist (und die es für Russen und die russische Min<strong>de</strong>rheit in Estland symbolisiert). Infolge <strong>de</strong>s Denkmalstreits kam es <strong>zu</strong> einer<br />
schweren Krise in <strong>de</strong>n Beziehungen zwischen Estland und Russland, welches sich vehement gegen die Umset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Statue wandte.<br />
Historische Stadttopographie
Der Domberg und die Unterstadt waren bis 1877 sowohl in Verwaltung wie auch Rechtsprechung zwei autonome Städte. [3]<br />
Der Domberg, auf welchem <strong>de</strong>r Bischof, <strong>de</strong>r Vertreter <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sherrn, <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns, und die Vertretung <strong>de</strong>r Ritterschaft saßen, ist bis heute Zentrum <strong>de</strong>r Staatsgewalt. Hier<br />
haben das Parlament <strong>de</strong>r Republik Estland (Riigikogu) und die Regierung ihren Sitz. Der Domberg erhebt sich 48 m über <strong>de</strong>r Unterstadt.<br />
Die Unterstadt ist, geschichtlich gesehen, die eigentliche Stadt Reval. Hier lebte <strong>de</strong>r Großteil <strong>de</strong>r Stadtbevölkerung, Handwerker und Kaufleute. Die Stadt war <strong>de</strong>m Lan<strong>de</strong>sherrn<br />
gegenüber unabhängig. Es waren lediglich geringe jährliche Zahlungen an Zins und Pacht an <strong>de</strong>n Or<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> leisten, und im Falle eines feierlichen Ein<strong>zu</strong>ges in die Stadt musste sie <strong>de</strong>m<br />
Lan<strong>de</strong>sherrn huldigen. In Rechtsfragen wandte sich die Stadt an Lübeck.<br />
Bischof<br />
Der Bischof war allein geistlicher Hirte und kein Lan<strong>de</strong>sherr. Seine Besitz bestand aus Tafelgütern in <strong>de</strong>r Diözese. Mit <strong>de</strong>m Verlust seines Episkopalrechts an die Stadt Reval durch das<br />
lübische Stadtrecht war er dieser gegenüber auch seiner geistlichen Machtstellung beraubt. Der Bischof von Reval war auch während <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>nszeit Suffragan <strong>de</strong>s Erzbischofs von<br />
Lund, welcher in dieser Zeit jedoch keinen Einfluss auf die Bischofswahl hatte. Das Domkapitel war mit vier Domherren ausgesprochen klein und als Einkünfte stan<strong>de</strong>n ihm lediglich<br />
fromme Stiftungen und einige Dörfer in <strong>de</strong>r Revaler Umgebung <strong>zu</strong>r Verfügung. Auf <strong>de</strong>m Domberg befand sich neben <strong>de</strong>m Dom, <strong>de</strong>r Vertretung <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns und <strong>de</strong>m Sitz <strong>de</strong>r<br />
v. a. harrisch-wierischen Ritterschaft nur noch eine kleine Bevölkerung von Handwerkern und Dienern.<br />
Einwohnerschaft<br />
Die Unterstadt nahm für ihre verhältnismäßig kleine Fläche (an ihrer längsten Nord-Süd-Achse maß die Stadt etwa 1 Kilometer, in <strong>de</strong>r Breite weniger als 700 Meter) eine recht große<br />
Anzahl an Menschen auf. Es sind aus <strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>nszeit keine Einwohnerzahlen für die ganze Stadt vorhan<strong>de</strong>n, aber für die Unterstadt existiert eine Schossliste von 1538, welche rund 800<br />
Personen umfasst, was im Vergleich <strong>zu</strong> späteren Einwohnerlisten und nach vorsichtiger Spekulation wohl eine Bevölkerungszahl von etwa 5000 Einwohnern annehmen lässt. Für die<br />
Domstadt steht das „Wackenbuch“ von 1575 <strong>zu</strong>r Verfügung, mit <strong>de</strong>ssen Hilfe sich etwa 1000 Personen (<strong>zu</strong>sammen mit Dom, Or<strong>de</strong>nsschloss und anwesen<strong>de</strong>n Vasallen) vermuten lassen.<br />
Die Vorstädte wer<strong>de</strong>n nach ihrer Größe in <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts auf etwa 700 Bewohner geschätzt, was für die gesamte Stadt Reval <strong>zu</strong> dieser Zeit eine Bevölkerungszahl<br />
von etwa 6700 Einwohnern ergibt.<br />
Frühere Schät<strong>zu</strong>ngen dürften noch ungenauer sein. Eine Schossliste von 1372 führt rund 650 Schosspflichtige auf. Wenn man sich die Vereinfachung erlaubt und die spätere<br />
Bevölkerungsschät<strong>zu</strong>ng für dieses Jahr anteilig herunterrechnet, dann ergäbe dies <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Domstadt eine Bevölkerung von vielleicht knapp 5000 Einwohnern (die Vorstädte<br />
existierten <strong>zu</strong> dieser Zeit noch nicht). Damit gehörte Reval <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n mittelgroßen europäischen Städten, weitab von Großstädten mit etwa 40.000 Einwohnern wie Köln, Wien und Prag<br />
o<strong>de</strong>r mit 20.000 Einwohnern wie Lübeck, Nürnberg, Bremen o<strong>de</strong>r Danzig. In seiner Bevölkerungszahl vergleichbar war Reval eher mit Städten wie Göttingen, Hil<strong>de</strong>sheim o<strong>de</strong>r<br />
Stockholm, wobei die Zahlen durch Konjunktur, Kriege und Seuchen auch stark schwanken konnten.<br />
Die meisten Revaler Bürger waren <strong>de</strong>utsch und kamen, sofern sie nicht in Reval geboren wur<strong>de</strong>n, aus <strong>de</strong>m Reich. Während <strong>de</strong>s ganzen Mittelalters bil<strong>de</strong>te Lübeck die Durchgangsstation<br />
und gelegentlich auch die Heimatstadt für kommen<strong>de</strong> Revaler Neubürger. Die Fernhan<strong>de</strong>l treiben<strong>de</strong>n Kaufleute bil<strong>de</strong>ten, über die Hansestädte verteilt, ein dichtes soziales Netz, häufig<br />
auch durch Verwandtschaft, sodass es nicht verwun<strong>de</strong>rlich ist, wenn sich eine Familie gleichzeitig in Reval, Lübeck und an<strong>de</strong>ren Hansestädten befand. Eine Untersuchung <strong>de</strong>r in Revaler<br />
Bürgernamen <strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts vorkommen<strong>de</strong>n Ortsbezeichnungen ergab, dass sich etwa die Hälfte aller Ortsnamen im rheinisch-westfälischen Raum wie<strong>de</strong>rfin<strong>de</strong>n lassen, die an<strong>de</strong>re<br />
Hälfte setzt sich hauptsächlich aus <strong>de</strong>m gesamten nord<strong>de</strong>utschen Raum <strong>zu</strong>sammen.<br />
Soziale Zusammenset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Bevölkerung<br />
Das soziale Leben <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> neben <strong>de</strong>r Verwandtschaft o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Nachbarschaft <strong>zu</strong> einem wesentlichen Teil durch die Berufsgruppen, die Zünfte und die drei Gil<strong>de</strong>n, die Kin<strong>de</strong>r-<br />
o<strong>de</strong>r Großen Gil<strong>de</strong>, die Kanuitgil<strong>de</strong> und die Olaigil<strong>de</strong>, bestimmt, wobei mit <strong>de</strong>r Geselligkeit innerhalb dieser Genossenschaften eine halb berufliche, halb private Sphäre geschaffen<br />
wur<strong>de</strong>. Die Gil<strong>de</strong>n waren als kirchliche Korporationen gegrün<strong>de</strong>t, vereinigten aber bald die angesehenen Berufe und Zünfte und hatten wichtige soziale Funktionen. In ihnen wur<strong>de</strong>n<br />
Beerdigungen und Hochzeiten ihrer Mitglie<strong>de</strong>r gemeinsam begangen, man veranstaltete gesellige Mahlzeiten und Tanzfeste, legte Regeln für gutes Benehmen fest (bei Verstoß gingen
genau angegebene Geldstrafen in die Gil<strong>de</strong>nkasse) und half sich gegenseitig in Unglücksfällen. Die Gil<strong>de</strong>n unterhielten eigene Altäre und so genannte Tafelgil<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Speisung <strong>de</strong>r<br />
Armen.<br />
Ein strenges soziales Unterscheidungsmerkmal bil<strong>de</strong>te die Nationalität (Abstammung bzw. Herkunftsland). Die Stadt setzte sich im Wesentlichen aus drei Nationalitäten <strong>zu</strong>sammen, aus<br />
Deutschen, Schwe<strong>de</strong>n und Esten (die sog. Un<strong>de</strong>utschen), und die Schossliste von 1538 ergibt folgen<strong>de</strong>s Bild: Etwa ein Fünftel <strong>de</strong>r schosspflichtigen Bevölkerung scheint schwedisch<br />
gewesen <strong>zu</strong> sein, jeweils zwei Fünftel <strong>de</strong>utsch und estnisch. Von ihrer sozialen Rangordnung her dürfte die gesamte Oberschicht und mehr als die Hälfte <strong>de</strong>r Mittelschicht aus Deutschen<br />
bestan<strong>de</strong>n haben. Der Rest <strong>de</strong>r Mittelschicht setzt sich <strong>zu</strong> etwa einem Viertel aus Schwe<strong>de</strong>n und einem Fünftel aus Esten <strong>zu</strong>sammen. Die Unterschicht bestand <strong>zu</strong> drei Vierteln aus Esten<br />
und, von vereinzelten Deutschen abgesehen, aus Schwe<strong>de</strong>n. Die sozialen Schichtungen richteten sich in diesem Fall nach <strong>de</strong>r Schosszahlung und <strong>de</strong>r Wohnsituation.<br />
Nur sehr vorsichtig lässt sich die nationale Zusammenset<strong>zu</strong>ng auf <strong>de</strong>m Domberg beurteilen, da die Hauptquelle, das Wackenbuch von 1575, aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r schwedischen Herrschaft<br />
stammt. Mit <strong>de</strong>m Wechsel <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sherrn wird auch ein Wechsel in <strong>de</strong>r Zusammenset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Bevölkerung <strong>de</strong>r Domstadt, <strong>de</strong>s Sitzes <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sherrn, einhergegangen sein, <strong>zu</strong>mal bei<br />
<strong>de</strong>n im Wackenbuch aufgeführten vielen schwedischen Namen nicht aus<strong>zu</strong>schließen ist, dass die schwedischen Schreiber <strong>de</strong>utsche Namen schlicht in schwedischer Form<br />
nie<strong>de</strong>rschrieben. Für die Or<strong>de</strong>nszeit kann <strong>de</strong>nnoch angenommen wer<strong>de</strong>n, dass sich die Oberschicht nahe<strong>zu</strong> komplett aus Deutschen, die Unterschicht größtenteils aus Esten<br />
<strong>zu</strong>sammensetzte.<br />
Kirchspiele<br />
Die zwei Kirchspiele <strong>de</strong>r Unterstadt entsprechen zwei verschie<strong>de</strong>nen städtischen Keimzellen. Zum einen ist <strong>de</strong>r südliche Stadtteil charakterisiert durch <strong>de</strong>n Alten Markt und die von ihm<br />
sternförmig ausgehen<strong>de</strong>n Straßen. Hier bestand auf <strong>de</strong>r Höhe <strong>de</strong>s Verbindungsweges <strong>zu</strong>m Domberg vermutlich bereits ein estnischer Han<strong>de</strong>lsplatz, <strong>de</strong>r in seiner Infrastruktur von <strong>de</strong>n 200<br />
gerufenen <strong>de</strong>utschen Kaufleuten übernommen wur<strong>de</strong>. Die für diesen Stadtteil <strong>zu</strong>ständige Pfarrkirche, St. Nikolai, wird 1316 erstmals urkundlich erwähnt, geht aber wahrscheinlich auf<br />
die zweite Hälfte <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong>rück und ist mit Sicherheit eine Gründung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kaufleute. Wie in vielen an<strong>de</strong>ren Hansestädten ist sie <strong>de</strong>m Heiligen Nikolaus, <strong>de</strong>m<br />
Patron <strong>de</strong>r Seefahrer, gewidmet.<br />
Zum an<strong>de</strong>ren ist <strong>de</strong>r lang gezogene nördliche Stadtteil durch die Langstraße bestimmt, die Hauptverbindungsstraße zwischen Hafen und Domberg, an <strong>de</strong>r sich vor allem schwedische und<br />
russische Kaufleute nie<strong>de</strong>rließen. Die dortige, weit im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt befindliche Pfarrkirche ist St. Olai, erstmals erwähnt 1267, als die dänische Königin Margrete I. ihr<br />
Parochialrecht über die Kirche <strong>de</strong>m Revaler Zisterzienserinnenkloster <strong>zu</strong> St. Michael überlässt. Wie weit <strong>de</strong>r Ursprung dieser Kirche in die Vergangenheit <strong>zu</strong>rückreicht, ist unbekannt, es<br />
kann aber angenommen wer<strong>de</strong>n, dass sie entwe<strong>de</strong>r eine Gründung <strong>de</strong>s dänischen Königs o<strong>de</strong>r schwedischer Kaufleute ist, die wahrscheinlich schon vor <strong>de</strong>r Stadtgründung hier einen<br />
Han<strong>de</strong>lsplatz besaßen. Benannt ist sie nach <strong>de</strong>m heiliggesprochenen norwegischen König Olav. Nach <strong>de</strong>m großen Stadtbrand 1433, <strong>de</strong>r das Mönchskloster St. Olai, die Münze und einen<br />
Teil <strong>de</strong>s Marktplatzes verwüstete, ging die Kirche in <strong>de</strong>n Besitz <strong>de</strong>r Stadt über. Dass <strong>de</strong>r nördliche Stadtteil eine ursprünglich von Frem<strong>de</strong>n besie<strong>de</strong>lte Gemein<strong>de</strong> war, zeigt auch die<br />
russische Kirche, die unweit von St. Olai stand. Bei<strong>de</strong> Stadtteile wur<strong>de</strong>n 1265 auf Befehl <strong>de</strong>r dänischen Königin Margrete I. <strong>zu</strong>sammengefügt und mit einer Stadtmauer umgeben.<br />
Klöster und Kapellen<br />
Innerhalb <strong>de</strong>r Stadtmauer befin<strong>de</strong>n sich zwei Klöster: eines <strong>de</strong>r Dominikaner und eines <strong>de</strong>r Zisterzienserinnen. Das Dominikanerkloster <strong>zu</strong> St. Katharina entstand wahrscheinlich <strong>zu</strong>erst<br />
1229 auf <strong>de</strong>m Domberg, wur<strong>de</strong> aber 1246 in <strong>de</strong>r Stadt neu begrün<strong>de</strong>t und unterhielt enge Verbindungen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n skandinavischen Dominikanern. Es erfreute sich Zeit seines Bestehens bei<br />
<strong>de</strong>n Bürgern großer Beliebtheit, was sich in starkem materiellem Wachstum durch Schenkungen und Stiftungen äußerte. Die Dominikaner kamen durch ihre Predigertätigkeit immer<br />
wie<strong>de</strong>r in Konflikt mit <strong>de</strong>m Bischof und <strong>zu</strong>r Reformation in schwere Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit <strong>de</strong>r Stadt, welche 1523 mit <strong>de</strong>r Ausweisung <strong>de</strong>r Mönche aus <strong>de</strong>r Stadt en<strong>de</strong>ten.<br />
Das Zisterzienserinnenkloster wur<strong>de</strong> wahrscheinlich 1249 vom dänischen König gegrün<strong>de</strong>t. Die Kirche war St. Michael geweiht und gehörte <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Klosteranlage erst mit<br />
einer Erweiterung <strong>de</strong>r Stadtmauer <strong>zu</strong>r inneren Stadtstruktur. Das Kloster war vom dänischen Königshaus sehr reich mit Privilegien ausgestattet, erwarb schon früh große Liegenschaften<br />
und nahm größtenteils unverheiratete Töchter <strong>de</strong>s A<strong>de</strong>ls auf, wodurch sich seine relativ schlechten Beziehungen <strong>zu</strong>r bürgerlichen Stadtbevölkerung erklären. Nach <strong>de</strong>r Reformation<br />
wur<strong>de</strong> es in eine weibliche Erziehungsanstalt umgewan<strong>de</strong>lt.<br />
Neben <strong>de</strong>n ansässigen Klöstern hatten einige auswärtige Klöster Höfe in Reval. Der Hof <strong>de</strong>r Zisterziensermönche Dünamün<strong>de</strong> (später Padis) wird zwar erst 1280 erwähnt, existierte aber
wohl schon seit <strong>de</strong>r ersten Dänenherrschaft. Direkt daneben lag <strong>de</strong>r Hof <strong>de</strong>r gotländischen Zisterzienser aus Roma, und diesem gegenüber lag <strong>de</strong>r Hof <strong>de</strong>r Zisterzienser aus Falkenau bei<br />
Dorpat auf einem Grundstück, das ihnen 1259 geschenkt wur<strong>de</strong>.<br />
1316 wird erstmals die <strong>zu</strong> St. Olai gehörige Heilig-Geist-Kapelle erwähnt, die schon früh <strong>de</strong>n Rang einer fast eigenständigen Kirche hatte und vor allem von <strong>de</strong>n städtischen<br />
Un<strong>de</strong>utschen besucht wur<strong>de</strong>. Zu ihr gehörte das nach römischem Muster erbaute Heilig-Geist-Spital für Alte und Kranke. Weit älter war das Johannisspital, das 1237 erstmals erwähnt<br />
wur<strong>de</strong>. Es wur<strong>de</strong> als Leprosium errichtet und nach <strong>de</strong>m Verschwin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Aussatzes als Siechenhaus weitergeführt.<br />
Außerhalb <strong>de</strong>r Stadtmauer, vor <strong>de</strong>r Schmie<strong>de</strong>pforte, befand sich die mit einem Kirchhof versehene Barbarakapelle, die <strong>zu</strong> St. Nikolai gehörte und <strong>de</strong>ren Errichtung auf die erste Hälfte<br />
<strong>de</strong>s 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts geschätzt wird. Die Kapelle existiert heute nicht mehr, vermutlich wur<strong>de</strong> sie bereits 1570/71 bei <strong>de</strong>r russischen Belagerung zerstört. Ebenfalls außerhalb, in <strong>de</strong>r<br />
Nähe <strong>de</strong>s Hafens, vor <strong>de</strong>r großen Strandpforte, befand sich die für Schiffer und Reisen<strong>de</strong> erbaute Gertru<strong>de</strong>nkapelle. Ihr Bau wur<strong>de</strong> 1438 gestattet, 1570 jedoch wur<strong>de</strong> sie bei einem Brand<br />
zerstört. Auf <strong>de</strong>m Tönnisberg (Antoniusberg) stand die Antoniuskapelle, <strong>de</strong>ren ursprünglicher Zweck nicht mehr rekonstruierbar ist.<br />
Der 1407 begonnene Bau <strong>de</strong>s Augustinerklosters St. Brigitten <strong>zu</strong> Marienthal war spätestens <strong>zu</strong> seiner Weihe 1436 been<strong>de</strong>t, wobei <strong>de</strong>m Kloster bereits 1411 die Augustinerregel gegeben<br />
wur<strong>de</strong> und 1412 das Tochterkloster Marienwohl<strong>de</strong> bei Lübeck gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Grün<strong>de</strong>r waren drei Revaler Kaufleute, die später in <strong>de</strong>n Konvent eintraten. Das Kloster befand sich in<br />
<strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r Küste, vier Kilometer nordöstlich <strong>de</strong>r Stadt, an <strong>de</strong>r Grenze <strong>zu</strong>r Stadtmark und wur<strong>de</strong> 1435 das erste Mal in einem Revaler Testament bedacht. Es diente <strong>de</strong>r Aufnahme von<br />
Personen bei<strong>de</strong>rlei Geschlechts, jedoch überwogen die Frauen, meistenteils Bürgertöchter, die meist auch die Äbtissin stellten. Das Kloster wur<strong>de</strong> während zweier russischer<br />
Belagerungen, 1575 und 1577, zerstört.<br />
Bevölkerung<br />
• Bevölkerungsentwicklung<br />
• Jahr Einwohnerzahl<br />
• 16.Jh. 6–7.000<br />
• 1710 2.000<br />
• 1870 ca. 31.000<br />
• 1934 137.792<br />
• 1945 127.000<br />
• 1959 281.714<br />
• 1970 369.583<br />
• 1979 441.800<br />
• 1989 499.421<br />
• 2003 386.000<br />
• 2005 401.694<br />
• 2007 396.200<br />
2007: 37 Prozent <strong>de</strong>r Bevölkerung sind ethnische Russen.<br />
Religion<br />
Tallinn ist Sitz <strong>de</strong>s Konsistoriums und <strong>de</strong>s Erzbischofs <strong>de</strong>r Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche und Sitz <strong>de</strong>r römisch-katholischen Apostolischen Administratur Estland. Der<br />
Großteil <strong>de</strong>r Esten ist heute konfessionslos.
Politik und Verwaltung<br />
Hauptstadt<br />
Tallinn ist die Hauptstadt <strong>de</strong>r Republik Estland. In <strong>de</strong>r Stadt haben <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>nt, die Regierung, das Parlament (Riigikogu), <strong>de</strong>r Staatsgerichtshof (Riigikohus), die Ministerien sowie<br />
zahlreiche diplomatische Vertretungen ihren Sitz.<br />
Verwaltung<br />
Alle vier Jahre wer<strong>de</strong>n die Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Tallinner Stadtrates gewählt. Die letzten Wahlen <strong>de</strong>r 79 Ratsmitglie<strong>de</strong>r fan<strong>de</strong>n am 18. Oktober 2009 statt. Zu <strong>de</strong>n Aufgaben <strong>de</strong>s unter <strong>de</strong>m<br />
Vorsitz von Toomas Vitsut stehen<strong>de</strong>n Stadtrates gehört unter an<strong>de</strong>rem die Wahl <strong>de</strong>s Bürgermeisters.[4] Dieses Amt hat seit April 2007 Edgar Savisaar inne.<br />
Mit 44 Ratsmitglie<strong>de</strong>rn verfügt die Estnische Zentrumspartei (Eesti Keskerakond) über die absolute Mehrheit. 14 Mitglie<strong>de</strong>r stellt die liberale Estnische Reformpartei (Eesti<br />
Reformierakond), 13 die konservative Isamaa ja Res Publica Liit und die sozial<strong>de</strong>mokratische Sotsiaal<strong>de</strong>mokraatlik Erakond acht Abgeordnete.[5]<br />
Die Talliner Stadtregierung ist das ausführen<strong>de</strong> Organ und umfasst neben <strong>de</strong>m Bürgermeister sieben Vizebürgermeister.[6]<br />
Symbole<br />
Die Flagge Tallinns zeigt jeweils drei horizontale blaue und weiße Streifen. Auf <strong>de</strong>m Wappen <strong>de</strong>r Stadt sind unter an<strong>de</strong>rem drei Löwen <strong>zu</strong> sehen, die eines <strong>de</strong>r ältesten estnischen<br />
Symbole darstellen und seit <strong>de</strong>m 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt Verwendung fin<strong>de</strong>n.<br />
Stadtbild und Architektur<br />
Die Tallinner Altstadt wur<strong>de</strong> 1997 <strong>zu</strong>r Liste <strong>de</strong>s UNESCO-Weltkulturerbe hin<strong>zu</strong>gefügt als „außergewöhnlich vollständiges und gut erhaltenes Beispiel einer mittelalterlichen<br />
nor<strong>de</strong>uropäischen Han<strong>de</strong>lsstadt“.[7]<br />
Unterstadt<br />
Das Zentrum bil<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Rathausplatz (estn.: Raekoja plats), <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>m 1322 erstmals erwähnten, aber schon im 13. Jh. errichteten gotischen Rathaus und an<strong>de</strong>ren stattlichen Gebäu<strong>de</strong>n<br />
umschlossen wird. Von <strong>de</strong>r öffentlich <strong>zu</strong>gänglichen Aussichtsplattform <strong>de</strong>s Rathauses bietet sich ein hervorragen<strong>de</strong>r Blick über Stadt, Hafen und Meerbusen. Das Wahrzeichen Tallinns –<br />
die Figur <strong>de</strong>s Stadtknechts „Alter Thomas“ (estn.: Vana Toomas) – schmückt seit 1530 die Turmspitze. Die bei<strong>de</strong>n Wasserspeier in Drachengestalt sind aus <strong>de</strong>m 17. Jh.<br />
Gegenüber befin<strong>de</strong>t sich die Ratsapotheke (estn.: Raeapteek). Sie wur<strong>de</strong> 1422 erstmals urkundlich erwähnt und ist damit eine <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n ältesten noch tätigen Apotheken Europas (die<br />
an<strong>de</strong>re ist in Dubrovnik). Nach Umbauten im 16. Jh. mietete die aus Ungarn stammen<strong>de</strong> Familie Johann Burchart die Apotheke und führte sie über 300 Jahre.<br />
Die Stadtmauer ist eine <strong>de</strong>r wichtigsten Sehenswürdigkeiten <strong>de</strong>r Stadt. Im Mittelalter war Tallinn eine <strong>de</strong>r am besten befestigten Städte an <strong>de</strong>r Ostsee. Mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r Befestigungen<br />
wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 13. Jh. begonnen und dauerte die folgen<strong>de</strong>n 300 Jahre an. Da die Waffen ständig schlagkräftiger wur<strong>de</strong>n, musste fortwährend nachgebessert wer<strong>de</strong>n. Die<br />
fertige Mauer war schließlich 2,35 km lang, 13–16 m hoch und 2–3 m dick und hatte über 40 Türme. Heute stehen noch 1,85 km Mauer und 26 Türme. Die Lehmpforte war eines <strong>de</strong>r<br />
Haupttore <strong>de</strong>s mittelalterlichen Tallinn, das mehrfach umgebaut wur<strong>de</strong>. Von ihm ist heute nur noch das Vortor erhalten. Die Stadtmauer hatte im Mittelalter sechs Tore (Pforten), alle<br />
hatten ein bis zwei Vortore, Hängebrücken über <strong>de</strong>n Wallgraben und Fallgitter. Die Große Strandpforte mit <strong>de</strong>r „Dicken Margarethe“. Als die Große Strandpforte gebaut wur<strong>de</strong>, stand sie<br />
so nah am Ufer, dass bei Sturm die Wellen ans Tor schwappten. Erhalten ist das Vortor mit <strong>de</strong>m Kanonenturm Dicke Margarete, <strong>de</strong>ssen Durchmesser 25 m beträgt. Heute beherbergt er<br />
das estnische Seefahrtsmuseum, das einen Überblick über die Geschichte <strong>de</strong>r Seefahrt und Fischerei gibt.<br />
Sehenswert ist <strong>de</strong>r Kiek in <strong>de</strong> Kök, ein ehemaliger Kanonenturm aus <strong>de</strong>m 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt, <strong>de</strong>r seinerzeit <strong>de</strong>r stärkste Kanonenturm <strong>de</strong>s Baltikums war.<br />
Die St.Nikolaikirche (estn.: Niguliste kirik), eine spätgotische Steinkirche, entstammt <strong>de</strong>m Anfang <strong>de</strong>s 13. Jh.. Nennenswert sind <strong>de</strong>r Hauptaltar vom Lübecker Meister Hermen Ro<strong>de</strong> aus
<strong>de</strong>m Jahre 1481 und das Fragment <strong>de</strong>s Totentanzes vom Lübecker Meister Bernt Notke. Sie ist ein Beispiel <strong>de</strong>r im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt verbreiteten „Kaufmannskirchen“ (<strong>de</strong>r Dachstuhl <strong>de</strong>r<br />
Kirche diente als Warenlager). Zu<strong>de</strong>m diente sie als Wehrkirche. Ab <strong>de</strong>m 15. Jh. wur<strong>de</strong> sie <strong>zu</strong>r Basilika umgebaut. Sie überstand als einzige Kirche <strong>de</strong>n Bil<strong>de</strong>rsturm <strong>de</strong>r<br />
Reformationszeit, weil, wie es heißt, <strong>de</strong>r Kirchenvorsteher die Türschlösser mit Blei ausgießen ließ. Nach schwerer Zerstörung durch einen Bombenangriff im Jahre 1944 ist die Kirche<br />
heute Museum und Konzertsaal.<br />
Die Heiligengeistkirche (estn.: Pühavaimu kirik), im 14. Jh. als Kapelle <strong>zu</strong>m Heiligengeist-Armenspital hin<strong>zu</strong> gebaut mit zwei Funktionen: Kirche <strong>de</strong>s Armenhauses und Ratskapelle. Sie<br />
besitzt einen spätmittelalterlichen Flügelaltar <strong>de</strong>s Lübecker Meisters Hermen Ro<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>m 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt, und eine Uhr aus <strong>de</strong>m 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt, angefertigt vom Meister Christian<br />
Ackermann.<br />
Die Olaikirche (estn.: Oleviste kirik), benannt nach <strong>de</strong>m norwegischen König Olaf II., <strong>de</strong>r die Christianisierung Nor<strong>de</strong>uropas betrieb, wur<strong>de</strong> im 13. Jh. erstmals urkundlich erwähnt. Der<br />
Turm kann bestiegen wer<strong>de</strong>n und bietet eine hervorragen<strong>de</strong> Aussicht über die gesamte Stadt.<br />
Das Haus <strong>de</strong>r Schwarzenhäupterbru<strong>de</strong>rschaft: Diese Bru<strong>de</strong>rschaft gab es nur in Alt-Livland (Estland und Lettland), sie war einzigartig in Europa. Sie vereinte unverheiratete<br />
<strong>de</strong>utschstämmige Kaufleute. Nach <strong>de</strong>r Aufnahme in die Gil<strong>de</strong> führte <strong>de</strong>ren Karriere die erfolgreichsten in <strong>de</strong>n Rat <strong>de</strong>r Stadt. Der Name kommt von ihrem Schutzheiligen, <strong>de</strong>m<br />
frühchristlichen Märtyrer Mauritius. Die Bru<strong>de</strong>rschaft bestand von ca. 1400 bis 1940 in Tallinn und ist seit<strong>de</strong>m in Deutschland weiter aktiv. Die Fassa<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Hauses ist im Stile <strong>de</strong>r<br />
Nie<strong>de</strong>rländischen Renaissance <strong>de</strong>s 16. Jh. gehalten. Auf Höhe <strong>de</strong>s Erdgeschosses befin<strong>de</strong>n sich die Wappen <strong>de</strong>r Hansekontore Brügge, Nowgorod, London und Bergen. Die russischen<br />
Zaren Peter <strong>de</strong>r Große, Paul und Alexan<strong>de</strong>r I. waren Ehrenmitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Bru<strong>de</strong>rschaft und haben dieses Haus besucht.<br />
Am nördlichen Rand <strong>de</strong>r Altstadt von Tallinn steht neben <strong>de</strong>m Wehrturm „Dicke Margarete“ die am 28. September 1996, exakt zwei Jahre nach <strong>de</strong>m Unglück, von Bildhauer Villu<br />
Jaanisoo aus Stahl und schwarzem Granit fertiggestellte Skulptur Katkenud liin (Unterbrochene Linie). Sie ist <strong>de</strong>m Ge<strong>de</strong>nken an <strong>de</strong>n Untergang <strong>de</strong>s Fährschiffs „Estonia“ gewidmet, <strong>de</strong>r<br />
aufgrund einer ungenügend geschlossenen La<strong>de</strong>klappe erfolgte und hun<strong>de</strong>rte Menschen das Leben gekostet hat. Eine „Wasserstraße“ führt in einem weiten Bogen von einer Anhöhe <strong>zu</strong><br />
einem Abgrund und bricht darüber ab. Weit jenseits <strong>de</strong>r Bruchstelle setzt sich <strong>de</strong>r Bogen fort, und die „Wasserstraße“ stürzt in das Erdreich hinein. Unter <strong>de</strong>r unteren Abbruchstelle ruht<br />
eine schwarze Granitplatte, auf <strong>de</strong>r die Namen <strong>de</strong>r Ertrunkenen verzeichnet sind. Die Angehörigen legen hier und auf <strong>de</strong>m darüber stehen<strong>de</strong>n Bogen Blumen, Kränze und Windlichter<br />
nie<strong>de</strong>r.<br />
Domberg<br />
Von <strong>de</strong>r mittelalterlichen Burg auf <strong>de</strong>m Domberg (estn. Toompea loss) sind nur noch die nördliche und westliche Mauer sowie drei Türme erhalten, darunter <strong>de</strong>r Lange Hermann (estn.:<br />
Pikk Hermann), gebaut im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt. Im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> er noch einmal um 10m auf 50 m erhöht. Im Mittelalter wur<strong>de</strong> er unter an<strong>de</strong>rem als Gefängnis genutzt. Nach <strong>de</strong>r<br />
Loslösung vom Zarenreich im Jahr 1918 wur<strong>de</strong> am Turm erstmals die blau-schwarz-weiße Fahne gehisst, die 1940 im Zuge <strong>de</strong>r sowjetischen Okkupation durch eine rote ersetzt wur<strong>de</strong>.<br />
1989 wur<strong>de</strong> die estnische Flagge dort wie<strong>de</strong>r aufgezogen und das geschieht heute täglich bei Sonnenaufgang; geht die Sonne unter, wird sie wie<strong>de</strong>r eingeholt.<br />
Daneben befin<strong>de</strong>t sich das repräsentative Schloss, <strong>de</strong>ssen wesentliche Umbauten im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt von <strong>de</strong>r russischen Zarin Katharina II. veranlasst wur<strong>de</strong>n. Heute ist es Sitz von<br />
Parlament und Regierung.<br />
Die Domkirche liegt am Kirchplatz, an <strong>de</strong>m sich acht historische Straßen kreuzen, sie ist <strong>de</strong>r Heiligen Jungfrau Maria gewidmet. Mit <strong>de</strong>m Bau wur<strong>de</strong> im 13. Jh. begonnen, sie ist somit<br />
eine <strong>de</strong>r ältesten Kirchen <strong>de</strong>r Stadt. Später im 14. Jh. wur<strong>de</strong> sie nach <strong>de</strong>m Vorbild <strong>de</strong>r gotländischen Kirchen in eine dreischiffige Basilika im gotischen Stil umgebaut. Die Tallinner<br />
Gotik ist die so genannte Kalksteingotik. Im Brand 1684 trug die Kirche schwere Schä<strong>de</strong>n davon. Der Großteil <strong>de</strong>r Einrichtung wur<strong>de</strong> vernichtet. Das neue Interieur ist barock. 107<br />
Wappenepitaphe estländischer Adliger sind erhalten, ebenso viele Grab<strong>de</strong>nkmäler bekannter Persönlichkeiten: von Pontus <strong>de</strong> la Gardie, <strong>de</strong>m Heerführer <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n im Livländischen<br />
Krieg, von <strong>de</strong>m bekannten Admiral, <strong>de</strong>m Weltumsegler und Ent<strong>de</strong>cker Adam Johann von Krusenstern; von <strong>de</strong>m schottischen Admiral Samuel Greigh, <strong>de</strong>r für Katharina II. viele Siege<br />
errang und an<strong>de</strong>re mehr. Es gibt zwei Familienlogen aus <strong>de</strong>m 18. Jh., eine <strong>de</strong>r Familie von Patkul und eine <strong>de</strong>r Familie von Manteuffel. Die vorhan<strong>de</strong>ne La<strong>de</strong>gast-Orgel wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r<br />
Werkstatt <strong>de</strong>s Berliner Meisters Sauer perfektioniert. Die Domkirche ist heute eine lutherische Kirche mit einer 600-köpfigen Gemein<strong>de</strong>.<br />
Die russisch-orthodoxe Alexan<strong>de</strong>r-Newski-Kathedrale (estn.: Aleksan<strong>de</strong>r Nevski katedraal) mit ihren weithin sichtbaren Zwiebeltürmen, 1894–1900 als Sinnbild <strong>de</strong>r Russifizierung<br />
Estlands erbaut. Daher konnte sich die estnische Bevölkerung längere Zeit kaum über dieses dominate „frem<strong>de</strong>“ Bauwerk freuen, inzwischen ist sie ein weiterer touristischer
Anziehungspunkt in <strong>de</strong>r Altstadt.<br />
Neustadt und Vororte<br />
Am Stadtrand befin<strong>de</strong>t sich das Schloss Katharinental (estn. Kadriorg). Revals <strong>de</strong>utscher Friedhof Ziegelskoppel (estn. Kopli) auf <strong>de</strong>r gleichnamigen Halbinsel nördlich <strong>de</strong>r Altstadt,<br />
Schauplatz einiger Erzählungen von Werner Bergengruen und <strong>de</strong>r Friedhof <strong>de</strong>r Grauen, also <strong>de</strong>r estnischen Bevölkerung auf <strong>de</strong>r Fischermai sind keine Sehenswürdigkeiten mehr. Bei<strong>de</strong><br />
wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n 1960er Jahren in Parks umgewan<strong>de</strong>lt. Umfassungsmauern und Baumreihen lassen die frühere Nut<strong>zu</strong>ng noch erkennen, alle Grabsteine sind aber entfernt wor<strong>de</strong>n. Während<br />
in <strong>de</strong>r Fischermai (Kalamaia) eine Inschrift an <strong>de</strong>m kürzlich restaurierten Eingangstor <strong>de</strong>s Friedhofes wie<strong>de</strong>r an die frühere Nut<strong>zu</strong>ng erinnert, lässt sich <strong>de</strong>r Friedhof von Ziegelskoppel<br />
nur durch einen Vergleich alter und neuer Stadtpläne ausfindig machen.<br />
Im Stadtteil Pirita nordöstlich <strong>de</strong>s Stadtzentrums gibt es einen Jachthafen sowie einen ausge<strong>de</strong>hnten Sandstrand, <strong>de</strong>r von einem Kiefernwald begrenzt wird. An warmen Sommertagen<br />
herrscht dort Partystimmung und <strong>de</strong>r Strand ist <strong>de</strong>swegen oft sehr voll. Bei Joggern und Inlineskatern ist vor allem die Promena<strong>de</strong> zwischen Pirita und <strong>de</strong>r Stadtmitte beliebt. Hier steht<br />
auch die eindrucksvolle Ruine <strong>de</strong>r Zisterzienser-Abtei St. Brigitten, ein heute dachloses Kirchenschiff vom Ausmaß einer Hauptstadt-Kathedrale, zerstört durch russische Truppen im 16.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt. Nebengebäu<strong>de</strong> sind noch als Mauerreste <strong>zu</strong> erkennen.<br />
Eine idyllische Abwechslung bietet dagegen die <strong>de</strong>m Festland vorgelagerte Insel Naissaar in <strong>de</strong>r Tallinner Bucht.<br />
Den besten Ausblick auf die Stadt und bei guten Sichtverhältnissen sogar bis <strong>zu</strong>r finnischen Küste bietet <strong>de</strong>r Fernsehturm (estn. Teletorn) mit seiner Aussichtsplattform und einem<br />
Restaurant, das <strong>de</strong>rzeit allerdings wegen Sicherheitsmängeln geschlossen ist.<br />
Wirtschaft und Infrastruktur<br />
Wirtschaft<br />
Tallinn ist die wirtschaftsstärkste Stadt in Estland. Ca. 60% <strong>de</strong>s estnischen BIP stammen aus Unternehmen in Tallinn. Infolge <strong>de</strong>r Auflösung <strong>de</strong>r UdSSR ging Russland als wichtigster<br />
Han<strong>de</strong>lspartner verloren. In <strong>de</strong>r darauf folgen<strong>de</strong>n Privatisierung richtete man die Wirtschaft nach skandinavischem Vorbild ein. Die niedrige Steuerlast und das liberale Wirtschaftsumfeld<br />
machen es für Unternehmen aktraktiv in Tallinn an<strong>zu</strong>sie<strong>de</strong>ln. So fin<strong>de</strong>t man in Tallinn Unternehmen wie Nokia, Philips o<strong>de</strong>r Ericsson. In Tallinn befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r größte Bankensektor in<br />
<strong>de</strong>n baltischen Staaten. Viele nor<strong>de</strong>uropäische Banken sind hier aufgrund <strong>de</strong>r gut ausgebil<strong>de</strong>ten Arbeitskräfte und <strong>de</strong>r umfangreich ausgebauten Telekommunikationsstrukur ansässig. Zu<br />
nennen sind hier die SEB, Swedbank, Nor<strong>de</strong>a o<strong>de</strong>r Sampo.<br />
Ziele für die Zukunft sind <strong>de</strong>r Ausbau <strong>de</strong>r Bildung- und Forschungsstätten und <strong>de</strong>r Infrastruktur. Außer<strong>de</strong>m soll die Stadtattraktivität steigen. Das Stadtbild ist heute noch stark von <strong>de</strong>n<br />
sowjetischen Einflüssen geprägt.<br />
Verkehr<br />
Tallinn ist ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Ostsee-Fährhafen (Verbindungen nach Rostock, Helsinki, Stockholm, Åland und Sankt Petersburg). Der internationale Flughafen Tallinn-Lennart Meri ist nur<br />
vier Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.<br />
Tallinn liegt an <strong>de</strong>r Europastraße 67 („Via Baltica“) und ist Estlands wichtigster Knotenpunkt <strong>de</strong>s Straßenverkehrs. Das Eisenbahnnetz Estlands in russischer Breitspur ist beschei<strong>de</strong>n; im<br />
internationalen Personenfernverkehr gibt es nur je eine Verbindung nach Moskau und St. Petersburg. Der Verkehr in die an<strong>de</strong>ren Städte Estlands und das benachbarte Lettland wird<br />
größtenteils mit Linienbussen abgewickelt. Projektiert ist <strong>de</strong>r Bau <strong>de</strong>r Hochgeschwindigkeitsbahn Rail Baltica.<br />
Die Stadt selbst ist durch <strong>de</strong>n öffentlichen Stadtverkehr mit vier Straßenbahnlinien, <strong>de</strong>m Oberleitungsbus Tallinn (acht Linien) sowie mehreren Buslinien gut erschlossen. Das nur 39 km<br />
lange Straßenbahnnetz ist eines <strong>de</strong>r wenigen europäischen Schienennetze mit Kapspur (1067 mm).
Bildung<br />
Die 1938 gegrün<strong>de</strong>te Estnische Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Wissenschaften (Eesti Teaduste Aka<strong>de</strong>emia) befin<strong>de</strong>t sich in Tallinn.<br />
In <strong>de</strong>r Stadt befin<strong>de</strong>n sich unter an<strong>de</strong>rem folgen<strong>de</strong> Bildungseinrichtungen:<br />
• Universität Tallinn (TLÜ)<br />
• Technische Universität Tallinn (TTÜ)<br />
• Universität Tartu Rechtsinstitut <strong>de</strong>r Universitas Tartuensis<br />
• Estnische Marineaka<strong>de</strong>mie<br />
• Estnische Musikaka<strong>de</strong>mie<br />
• Estnische Nationalbibliothek (RR)<br />
• Estnische Kunstaka<strong>de</strong>mie<br />
• Estnische Verteidigungsaka<strong>de</strong>mie<br />
• Estnisches Theologisches Institut <strong>de</strong>r Estnischen Evangelisch-Lutherischen Kirche<br />
• Estonian Business School (EBS)<br />
• Deutsches Goethe-Institut Tallinn<br />
• International University Au<strong>de</strong>ntes (IUA)<br />
• Baltic Film and Media School (BFS)<br />
Kultur<br />
Tallinn wur<strong>de</strong> im November 2007 neben <strong>de</strong>m finnischen Turku <strong>zu</strong> einer <strong>de</strong>r Kulturhauptstädte Europas 2011 ernannt.[8] Unter <strong>de</strong>m Motto „Geschichten von <strong>de</strong>r Meeresküste“ wer<strong>de</strong>n<br />
2011 zahlreiche kulturelle Veranstaltungen und Festivals stattfin<strong>de</strong>n, darunter die „Tallinner Meerestage“, die die Stadt wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Meer näherbringen sollen. Etwa ein Dutzend<br />
architektonischer Installationen sollen im Stadtraum errichtet wer<strong>de</strong>n.[9]<br />
Theater<br />
Die Nationaloper Estonia (Raahvusooper Estonia) hat ihren Sitz in einem 1947 eröffneten Gebäu<strong>de</strong>, das als Nachfolger <strong>de</strong>s im Krieg zerstörten Originalbaus von 1913 durch die<br />
Architekten Alar Kotli und Edgar Johan Kuusik entworfen wur<strong>de</strong>. Theateraufführungen gibt es im Tallinna Linnateater, das 1965 als Repertoiretheater gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong> und über sieben<br />
Bühnen in einem mittelalterlichen Gebäu<strong>de</strong>komplex sowie eine Außenbühne verfügt.[10] Das Estnische Russische Theater (Eesti Vene Teater) hieß von seiner Gründung 1948 bis 2005<br />
Nationales Russisches Schauspielhaus (Riikliku Vene Draamateater). Außer<strong>de</strong>m besteht das Estnische Schauspielhaus (Eesti Draamateater).<br />
Museen<br />
Das Estnische Kunstmuseum (Eesti Kunstimuuseum) ist das größte Kunstmuseum <strong>de</strong>r baltischen Staaten und besteht aus mehreren einzelnen Museen, darunter <strong>de</strong>n Sammlungen im vom<br />
finnischen Architekten Pekka Vapaavuori errichteten Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s KUMU (Kumu kunstimuuseum) im Stadtteil Kadriorg. Es wur<strong>de</strong> 2006 eröffnet und hat eine Ausstellungsfläche von<br />
24.000 Quadratmetern, auf <strong>de</strong>nen neben Mo<strong>de</strong>rner Kunst auch estnische Malerei ab <strong>de</strong>m achtzehnten Jahrhun<strong>de</strong>rt ausgestellt wird. Das Museum wur<strong>de</strong> 2008 mit <strong>de</strong>m European Museum<br />
of the Year Award als „Europäisches Museum <strong>de</strong>s Jahres“ ausgezeichnet. [11] Das Kadriorg-Kunstmuseum (Kadrioru kunstimuuseum) zeigt westeuropäische und russische Malerei und<br />
Skulpturen vom 16. bis 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt, darunter im <strong>zu</strong>gehörigen Mikkel-Museum (Mikkeli muuseum) die Sammlung Johannes Mikkels. Das Niguliste-Museum (Niguliste muuseum)<br />
befin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Nikolaikirche (Niguliste kirik) und ist mittelalterlicher Kunst gewidmet. Weiter zeigen das Adamson-Eric-Museum (Adamson-Ericu muuseum) Werke <strong>de</strong>s Künstlers<br />
Adamson-Eric und das Kristjan-Raud-Hausmuseum (Kristjan Raua majamuuseum) Arbeiten Kristjan Rauds.
Musik<br />
Tallinn ist Sitz <strong>de</strong>s Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, <strong>de</strong>s Nationalen Symphonieorchesters Estlands. Der Eurovision Song Contest 2002 fand in Tallinn statt, nach<strong>de</strong>m Tanel Padar, Dave<br />
Benton und 2XL mit einem gemeinsamen Titel bei <strong>de</strong>r Ausgabe 2001 für Estland gewonnen hatten.<br />
Sport<br />
Während <strong>de</strong>r Olympischen Spiele 1980 in Moskau wur<strong>de</strong>n die Segelwettbewerbe vor Tallinn ausgetragen. Einige Einrichtungen, wie die Linnahall, das olympische Hotel, die Post und<br />
auch das Segelsportzentrum im Stadtteil Pirita wur<strong>de</strong>n für dieses Ereignis gebaut.<br />
Zu <strong>de</strong>n ehemaligen olympischen Anlagen in Pirita (zehn Busminuten vom Stadtzentrum Tallinn) gehört <strong>de</strong>r Jachthafen mit guter Infrastruktur für Fahrtensegler.<br />
Zu <strong>de</strong>n erfolgreichsten Fußballvereinen nach <strong>de</strong>r Unabhängigkeit zählen FC Flora Tallinn und FC Levadia Tallinn. Flora spielt in <strong>de</strong>r 2001 eröffneten, 9.692 Zuschauer fassen<strong>de</strong>n A. Le<br />
Coq Arena, die auch <strong>de</strong>r Nationalmannschaft als Heimspielstätte dient. Levadias Kadrioru staadion wur<strong>de</strong> 1926 eröffnet und fasst 4.750 Zuschauer. Größtes Stadion ist das 1956 erbaute<br />
Kalevi Keskstaadion mit 12.000 Plätzen.<br />
Die 2001 eröffnete Saku Suurhall ist eine auch für Sportveranstaltungen genutzte Halle mit 10.000 Plätzen.<br />
Regelmäßige Veranstaltungen<br />
Im Februar fin<strong>de</strong>n Tage <strong>de</strong>r Barockmusik statt, im April das Jazzfestival Jazzkaar, im Juni Altstadt- und Johannisfest und ein Tanzfestival im August statt. Das FIlmfestival <strong>de</strong>r<br />
Schwarzen Nächte wird im November und Dezember ausgetragen.<br />
Kulinarische Spezialitäten und Gastronomie<br />
Die Altstadt von Tallinn bietet viele Restaurants wie auch Biergärten an. Im Sommer kann man in <strong>de</strong>n verkehrsfreien Gassen draußen essen.<br />
Literatur<br />
Bibliographien<br />
• LitDok Ostmitteleuropa (Her<strong>de</strong>r-Institut Marburg)<br />
• Wissenschaftliche und literarische Werke<br />
• Andreas Fülberth: Tallinn – Riga – Kaunas. Ihr Ausbau <strong>zu</strong> mo<strong>de</strong>rnen Hauptstädten 1920–1940. Böhlau, Köln/Weimar 2005, ISBN 3-412-12004-9.<br />
• Werner Bergengruen: Der Tod von Reval. Hamburg 1939, Arche, Zürich 2003, ISBN 3-7160-2324-8.<br />
• Jaan Kross: Das Leben <strong>de</strong>s Balthasar Rüssow. Roman. DTV, München 1990, 1999, ISBN 3-423-12563-2.<br />
• Paul Johansen/Heinz von <strong>zu</strong>r Mühlen: Deutsch und Un<strong>de</strong>utsch im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reval (= Ostmitteleuropa in Vergangenheit und Gegenwart 15),<br />
Böhlau, Köln/Wien 1973, ISBN 3-412-96172-8.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Zur Geschichte Revals bis <strong>zu</strong>r Reformation im folgen<strong>de</strong>n vgl. NOTTBECK, EUGEN VON / NEUMANN, WILHELM: Geschichte und Kunst<strong>de</strong>nkmäler <strong>de</strong>r Stadt Reval, Bd.<br />
1: Die Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Reval, Reval 1904, Nachdruck Hannover 1973, S. 1-60; JOHANSEN, PAUL / MÜHLEN, HEINZ VON ZUR: Deutsch und Un<strong>de</strong>utsch im<br />
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reval, Köln-Wien 1973, S. 28-85; MÜHLEN, HEINZ VON ZUR: Siedlungskontinuität und Rechtslage <strong>de</strong>r Esten in Reval von <strong>de</strong>r<br />
vor<strong>de</strong>utschen Zeit bis <strong>zu</strong>m Spätmittelalter, in: Zeitschrift für Ostforschung ZfO 18 (1969), S. 630-647.
2. ↑ Maschke, Erich (Hrsg.): Zur Geschichte <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kriegsgefangenen <strong>de</strong>s zweiten Weltkrieges. Verlag Ernst und Werner Gieseking, Bielefeld 1962–1977.<br />
3. ↑ Zur Stadttopographie im folgen<strong>de</strong>n vgl. NOTTBECK, EUGEN VON / NEUMANN, WILHELM: Geschichte und Kunst<strong>de</strong>nkmäler <strong>de</strong>r Stadt Reval, Bd. 2: Die<br />
Kunst<strong>de</strong>nkmäler <strong>de</strong>r Stadt, Reval 1904, Nachdruck Hannover 1973, S. 60–100; JOHANSEN, PAUL / MÜHLEN, HEINZ VON ZUR: Deutsch und Un<strong>de</strong>utsch im<br />
mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Reval, Köln-Wien 1973, S.56–125; <strong>zu</strong>r Kirchenstruktur <strong>zu</strong>sätzlich VÖÖBUS, ARTHUR: Studies in the History of the Estonian People<br />
with Reference to the Aspects of social Conditions, in particular, the Religions and spiritual Life and the educational Pursuit, Bd. 1, Stockholm 1969.<br />
4. ↑ Tallinner Stadtrat (Abgerufen am 1. Juni 2010)<br />
5. ↑ balticbusinessnews.com, 27. Oktober 2009 (Abgerufen am 1. Juni 2010)<br />
6. ↑ Talliner Stadtverwaltung (Abgerufen am 1. Juni 2010)<br />
7. ↑ UNESCO-Welterbeliste (Abgerufen am 29. Mai 2010)<br />
8. ↑ Pressemeldung <strong>de</strong>r Europäischen Union, 15. November 2007 (Abgerufen am 1. Mai 2010)<br />
9. ↑ Tallinn 2011 (PDF-Datei; 1,9 MB) (Abgerufen am 1. Mai 2010)<br />
10.↑ Tallinner Stadttheater (Abgerufen am 2. Mai 2010)<br />
11.↑ Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19. Mai 2008<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Berlin-Kölln - Berlin-Cölln - Cölln<br />
Das auf einer Spreeinsel gelegene Cölln war eine <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Städte, die im Spätmittelalter <strong>zu</strong>r Doppelstadt Berlin-Cölln <strong>zu</strong>sammenwuchsen. Aus <strong>de</strong>r Doppelstadt Berlin-Cölln<br />
entwickelte sich die heutige Stadt Berlin.<br />
Bewohner und Wirtschaft<br />
Ortsmittelpunkt von Cölln war <strong>de</strong>r Petriplatz mit <strong>de</strong>r durch <strong>de</strong>n Krieg beschädigten und 1964 abgetragenen Petrikirche an <strong>de</strong>r Gertrau<strong>de</strong>nstraße und das Cöllnische Rathaus an <strong>de</strong>r<br />
Brü<strong>de</strong>rstraße. Die Kirche war nach Petrus, <strong>de</strong>m Apostel <strong>de</strong>r Fischer (Lukas 5, 3–10), benannt wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn viele Bewohner Cöllns lebten überwiegend vom Fischfang. Im 18.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt war ein Regiment <strong>zu</strong> Fuß bei <strong>de</strong>n Bewohnern einquartiert (1806: No. 26). Die Verbreiterung und Vertiefung <strong>de</strong>r Spree vor <strong>de</strong>r Mühlendammfurt bot reiche Fischgrün<strong>de</strong>. Auf<br />
<strong>de</strong>r östlichen Seite <strong>de</strong>r Spree in Berlin wohnten die Kauf- und Fuhrleute. Der Transport von Waren über <strong>de</strong>n Mühlendamm, <strong>de</strong>n einzigen natürlichen Spreeübergang in <strong>de</strong>r Umgebung auf<br />
<strong>de</strong>r Verbindung zwischen Frankfurt (O<strong>de</strong>r) und Mag<strong>de</strong>burg, brachte Han<strong>de</strong>lszölle ein. Auf Berliner Seite war die Nikolaikirche <strong>de</strong>r Ortsmittelpunkt. Nikolaus ist <strong>de</strong>r Heilige <strong>de</strong>r<br />
Kaufleute. Der Mühlendamm staute das Wasser, das die Mühlen antrieb. Die durch ihre Fuhr- und Kaufgeschäfte reicheren Berliner konnten sich bald <strong>de</strong>n Bau einer zweiten Kirche, <strong>de</strong>r<br />
Marienkirche, leisten.<br />
Geschichte
1237 wur<strong>de</strong> Cölln erstmals urkundlich erwähnt, sieben Jahre vor <strong>de</strong>r ersten urkundlichen Erwähnung Berlins, mit <strong>de</strong>m es sich 1307 <strong>zu</strong>r Doppelstadt Berlin-Cölln mit einer gemeinsamen<br />
Verwaltung vereinigte. Die bei<strong>de</strong>n Orte waren durch <strong>de</strong>n Mühlendamm miteinan<strong>de</strong>r verbun<strong>de</strong>n. Im gemeinsamen Magistrat waren die Berliner durch mehr Stimmen vertreten. Der<br />
Magistrat baute die Lange Brücke, die heutige Rathausbrücke. Die gemeinsame Politik <strong>de</strong>r Doppelstadt führte 1308 <strong>zu</strong> einem ersten Bündnis mit an<strong>de</strong>ren Städten in <strong>de</strong>r Mark, darunter<br />
Frankfurt (O<strong>de</strong>r), Bran<strong>de</strong>nburg an <strong>de</strong>r Havel und Salzwe<strong>de</strong>l, <strong>zu</strong>r Wahrung ihrer Rechte gegenüber <strong>de</strong>m Lan<strong>de</strong>sherrn und <strong>zu</strong>r Abwehr äußerer Gefahren.<br />
1442 wur<strong>de</strong> die gemeinsame Stadtverwaltung von Berlin und Cölln durch Kurfürst Friedrich II. <strong>zu</strong>r Durchset<strong>zu</strong>ng eigener Machtansprüche wie<strong>de</strong>r aufgehoben. Darüber hinaus wur<strong>de</strong><br />
Cölln gezwungen, <strong>de</strong>m Kurfürsten für die Errichtung einer Burg das Gebiet ab<strong>zu</strong>treten, auf <strong>de</strong>m später das Berliner Stadtschloss entstand.<br />
Von 1658 bis 1683 ließ <strong>de</strong>r Kurfürst Friedrich Wilhelm von Bran<strong>de</strong>nburg Cölln und Berlin mit Festungswerken nach Plänen von Johann Gregor Memhardt versehen, die weitgehend<br />
entlang <strong>de</strong>r alten Stadtmauer von Berlin und Cölln angelegt wur<strong>de</strong>n. Nur an einigen Stellen wur<strong>de</strong>n die Stadttore nach außen verlegt. Teile <strong>de</strong>s Festungswerkes, insbeson<strong>de</strong>re die<br />
Bastionen, sind noch heute im Straßengrundriss <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> erkennen, beispielsweise am Hausvogteiplatz. Im Rahmen <strong>de</strong>s Festungsbaus entstand am Südufer <strong>de</strong>s Spreekanals, noch<br />
innerhalb <strong>de</strong>r neuen Festungsmauer, die Cöllnische Vorstadt Neu-Cölln.<br />
1710 wur<strong>de</strong>n die Städte Berlin, Cölln, Friedrichswer<strong>de</strong>r, Dorotheenstadt und Friedrichstadt <strong>zu</strong>r königlichen Haupt- und Resi<strong>de</strong>nzstadt Berlin vereinigt. Zunehmend stan<strong>de</strong>n nun die<br />
Festungsmauern <strong>de</strong>r städtischen Entwicklung im Wege, so dass diese ab 1734 geschleift wur<strong>de</strong>n, damit Berlin mit seinen Vorstädten <strong>zu</strong>sammenwachsen konnte. Die ganze Stadt wur<strong>de</strong><br />
durch die Akzisemauer umgeben, von <strong>de</strong>ren Verlauf heute noch Bezeichnungen von Straßen und Plätzen, insbeson<strong>de</strong>re nach ehemaligen Stadttoren, zeugen.<br />
Im Mittelalter hatte Cölln rund 1.400 Einwohner. Als Berliner Stadtteil umfasste Cölln die gesamte Spreeinsel und erreichte 1871 seine höchste Bevölkerungszahl mit 16.554<br />
Einwohnern. 1910 betrug die Einwohnerzahl noch 6.895.[1] 1920 ging Cölln im neugebil<strong>de</strong>ten Berliner Bezirk Mitte auf. Im Zweiten Weltkrieg erlitt Cölln schwerste Zerstörungen und<br />
ist heute nicht mehr als historischer Ortsteil erkennbar. Der Name Cölln o<strong>de</strong>r Alt-Cölln wird im allgemeinen Sprachgebrauch nicht mehr als Ortsbezeichnung verwen<strong>de</strong>t.<br />
Historische Orte und Gebäu<strong>de</strong><br />
• Berliner Stadtschloss<br />
• Schloßplatz<br />
• Lustgarten<br />
• Berliner Dom<br />
• Museumsinsel mit<br />
• Bo<strong>de</strong>-Museum<br />
• Alter Nationalgalerie<br />
• Pergamonmuseum<br />
• Neuem Museum<br />
• Altem Museum<br />
• Palast <strong>de</strong>r Republik<br />
• Staatsratsgebäu<strong>de</strong><br />
• Alter Marstall<br />
• Petrikirche<br />
• Petriplatz<br />
• Brü<strong>de</strong>rstraße<br />
• Nicolaihaus<br />
• Sperlingsgasse
• Fischerinsel<br />
Literatur<br />
• Ernst Fidicin: Die Gründung Berlins, Berlin 1840, (streng quellengenau, kritisiert Klö<strong>de</strong>n als <strong>zu</strong> spekulativ)<br />
• Verein für die Geschichte Berlins (Hrg.): Projekt Alt-Cölln – Mitteilungen <strong>de</strong>s Vereins für die Geschichte Berlins, 105. Jahrgang, Heft 2, Berlin 2009<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Friedrich Ley<strong>de</strong>n: Gross-Berlin. Geographie <strong>de</strong>r Weltstadt. Hirt, Breslau 1933 (darin: Entwicklung <strong>de</strong>r Bevölkerungszahl in <strong>de</strong>n historischen Stadtteilen von Alt-Berlin, S.<br />
206)<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Alt-Berlin<br />
Als Alt-Berlin wird heute das Gebiet <strong>de</strong>r historischen Stadt Berlin bezeichnet, die im Spätmittelalter mit <strong>de</strong>r benachbarten Stadt Cölln <strong>zu</strong> einer Doppelstadt <strong>zu</strong>sammenwuchs. Aus <strong>de</strong>r<br />
Doppelstadt Berlin-Cölln entwickelte sich das heutige Berlin.<br />
Lage<br />
Das Gebiet <strong>de</strong>s historischen Alt-Berlin liegt zwischen <strong>de</strong>r Spree und <strong>de</strong>m gemauerten Stadtbahnviadukt, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n 1880er-Jahren auf <strong>de</strong>m Verlauf <strong>de</strong>r ehemaligen Stadtbefestigung<br />
errichtet wur<strong>de</strong>. Die benachbarten historischen Stadtteile sind Cölln und Neu-Cölln auf <strong>de</strong>m gegenüberliegen<strong>de</strong>n Spreeufer sowie die drei historischen Vorstädte Alt-Berlins, die<br />
Spandauer Vorstadt, die Königsstadt, und die Stralauer Vorstadt.<br />
Geschichte<br />
Der Name Berlin geht vermutlich auf die altslawische Bezeichnung berl für „Sumpf“ <strong>zu</strong>rück, vergleichbar mit <strong>de</strong>m tschechischen Bažina, so<strong>zu</strong>sagen: Bažina w Barija („Der Sumpf <strong>de</strong>r<br />
Bären“), die <strong>zu</strong> dieser Zeit hier noch beheimatet waren. Von <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rsorben rund um Cottbus und Lübben wird Berlin heute noch Barliń genannt.<br />
Die auf <strong>de</strong>r Spreeinsel gelegene Stadt Cölln wur<strong>de</strong> 1237 erstmals urkundlich erwähnt, 1244 folgte dann die Erwähnung Berlins, das sich auf <strong>de</strong>m nördlichen Ufer <strong>de</strong>r Spree befand. Die<br />
bei<strong>de</strong>n Städte bekamen 1307 einen gemeinsamen Magistrat. Im Jahre 1442 wur<strong>de</strong> die gemeinsame Stadtverwaltung von Berlin und Kölln durch Kurfürst Friedrich II. wie<strong>de</strong>r aufgehoben.<br />
Die fünf Städte Berlin, Cölln, Friedrichswer<strong>de</strong>r, Dorotheenstadt und Friedrichstadt wur<strong>de</strong>n 1710 endgültig <strong>zu</strong>r Königlichen Haupt- und Resi<strong>de</strong>nzstadt Berlin vereinigt.<br />
Bei <strong>de</strong>r Bildung von Groß-Berlin im Jahre 1920 wur<strong>de</strong> Alt-Berlin in <strong>de</strong>n neugebil<strong>de</strong>ten Bezirk Mitte eingeglie<strong>de</strong>rt. Nach schweren Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong> Alt-Berlin<br />
völlig umgestaltet und erhielt unter weitgehen<strong>de</strong>r Aufgabe <strong>de</strong>s historischen Stadtgrundrisses und nach <strong>de</strong>m Abriss <strong>de</strong>r verbliebenen Bausubstanz in <strong>de</strong>n 1960er- und 1970er-Jahren ein
völlig neues Aussehen. Neben vielgeschossigen Wohn- und Geschäftshäusern wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Berliner Fernsehturm errichtet. In <strong>de</strong>n 1980er-Jahren kam das in teilweise historisieren<strong>de</strong>r<br />
Bauform wie<strong>de</strong>rerrichtete Nikolaiviertel hin<strong>zu</strong>.<br />
Im Mittelalter hatte Alt-Berlin ca. 2600 Einwohner. Die Einwohnerzahl stieg auf 18.300 im Jahre 1747 und 35.000 im Jahre 1834. Bei <strong>de</strong>r Volkszählung von 1910 wur<strong>de</strong>n noch 10.844<br />
Einwohner festgestellt.[1]<br />
Stadtbild<br />
Außer <strong>de</strong>m Roten Rathaus und <strong>de</strong>r St. Marienkirche erinnert in <strong>de</strong>m vom Berliner Fernsehturm dominierten zentralen Bereich Alt-Berlins nichts mehr daran, dass man sich im<br />
historischen Stadtkern von Berlin befin<strong>de</strong>t. Der bis <strong>zu</strong>m Zweiten Weltkrieg eng bebaute Stadtraum zwischen <strong>de</strong>r Spandauer Straße und <strong>de</strong>r Stadtbahn ist nun als weiträumiger<br />
Fußgängerbereich mit einzelnen Baumgruppen, Blumenrabatten, einer Springbrunnenanlage am Fuße <strong>de</strong>s Fernsehturms sowie <strong>de</strong>m hier wie<strong>de</strong>r aufgestellten Neptunbrunnen gestaltet.<br />
Westlich <strong>de</strong>r Spandauer Straße schließen sich das parkartige Marx-Engels-Forum sowie das Nikolaiviertel mit <strong>de</strong>r Nikolaikirche an. Ansonsten wird das Terrain weitgehend durch<br />
vielgeschossige Wohn- und Geschäftshäuser in funktionaler Architektur <strong>de</strong>r 1960er-Jahre geprägt, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>nen nach 1990 weitere Neubauten hin<strong>zu</strong> kamen. In <strong>de</strong>n Randbereichen sind<br />
einzelne historische Gebäu<strong>de</strong>, wie das <strong>de</strong>s Landgerichts Berlin, das Alte Stadthaus am Molkenmarkt, die Heilig-Geist-Kapelle, die Ruine <strong>de</strong>r Franziskanerklosterkirche und die barocke<br />
Parochialkirche als isolierte Solitäre erhalten. In <strong>de</strong>r Littenstraße ist noch ein Rest <strong>de</strong>r alten Stadtmauer erhalten.<br />
Planungen und Aktuelles<br />
Das vom ehemaligen Stadtbaudirektor Hans Stimmann im Auftrag <strong>de</strong>r Senatsverwaltung für Stadtentwicklung erarbeitete Planwerk Innenstadt sieht unter <strong>de</strong>r Prämisse „Die Innenstadt<br />
als Wohnort“ die Wie<strong>de</strong>rherstellung von Teilbereichen <strong>de</strong>r innerstädtischen Stadtstruktur vor. Insbeson<strong>de</strong>re sollen die Straßen und Plätze wie<strong>de</strong>r erlebbar wer<strong>de</strong>n und die durch<br />
Verkehrsschneisen <strong>de</strong>r 1960er-Jahre zerschnittenen Stadträume neu verbin<strong>de</strong>n. In Alt-Berlin soll <strong>de</strong>r Molkenmarkt durch eine angrenzen<strong>de</strong> Bebauung wie<strong>de</strong>r eingefasst wer<strong>de</strong>n. Da<strong>zu</strong><br />
soll die Straßenführung geän<strong>de</strong>rt und durch eine dichtere Bebauung schmaler gestaltet wer<strong>de</strong>n.[2] Insbeson<strong>de</strong>re die Verkehrsplanung und die Neubauten vor <strong>de</strong>m bisher<br />
platzdominieren<strong>de</strong>m Alten Stadthaus sind dabei umstritten. Die geplante Straßenbahn soll, von <strong>de</strong>r Leipziger Straße kommend, hier Richtung Spandauer Straße abbiegen.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Friedrich Ley<strong>de</strong>n: Groß-Berlin. Geographie <strong>de</strong>r Weltstadt. Hirt, Breslau 1933 (darin: Entwicklung <strong>de</strong>r Bevölkerungszahl in <strong>de</strong>n historischen Stadtteilen von Alt-Berlin, S. 206)<br />
2. ↑ Verkehrsplanung Molkenmarkt. Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, 2003, abgerufen am 1. Juli 2008.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Geschichte Berlins<br />
Die Geschichte Berlins beginnt nicht erst mit <strong>de</strong>r ersten urkundlichen Erwähnung, son<strong>de</strong>rn bereits mit <strong>de</strong>r Vor- und Frühgeschichte <strong>de</strong>s Berliner Raumes. Zeugnisse dieser frühen Phase<br />
<strong>de</strong>r Besiedlung sind vor allem im Museum für Vor- und Frühgeschichte sowie als lebensechte Nachbildung im Museumsdorf Düppel <strong>zu</strong> sehen. Hier wer<strong>de</strong>n auch mittelalterliche
handwerkliche Techniken vorgeführt.<br />
Ursprünge<br />
Ausklang <strong>de</strong>r Weichseleiszeit<br />
Fun<strong>de</strong> von Feuersteinen und bearbeiteten Knochen lassen auf eine Besiedlung <strong>de</strong>s Berliner Raums seit etwa 60.000 v. Chr. schließen. Zu dieser Zeit waren weite Teile Nord- und<br />
Ost<strong>de</strong>utschlands von <strong>de</strong>n Vergletscherungen <strong>de</strong>r letzten Eiszeit be<strong>de</strong>ckt, die ungefähr von 110.000 bis 8.000 v. Chr. dauerte. Im Baruther Urstromtal, rund 75 Kilometer südlich Berlins,<br />
erreichte das Inlan<strong>de</strong>is vor ca. 20.000 Jahren seine maximale südliche Aus<strong>de</strong>hnung. Seit rund 19.000 Jahren ist <strong>de</strong>r Berliner Raum, <strong>de</strong>ssen Nie<strong>de</strong>rung <strong>zu</strong>m Jungmoränenland <strong>de</strong>r<br />
Weichseleiszeit zählt, wie<strong>de</strong>r eisfrei. Vor rund 18.000 Jahren bil<strong>de</strong>ten die abfließen<strong>de</strong>n Schmelzwasser das Berliner Urstromtal als Teil <strong>de</strong>r Frankfurter Staffel aus, das wie alle<br />
Urstromtäler im Untergrund aus mächtigen Schmelzwassersan<strong>de</strong>n besteht. Die Spree nutzte das Urstromtal für ihren Lauf, im unteren Spreetal bil<strong>de</strong>te sich stellenweise eine Tundra<br />
heraus. Westlich dominierten feuchte Nie<strong>de</strong>rungen und Moorgebiete das Erscheinungsbild <strong>de</strong>s Tals.<br />
Die Plateaus Barnim und Teltow bil<strong>de</strong>ten sich parallel <strong>zu</strong>m späteren Lauf <strong>de</strong>r Spree. Mit <strong>de</strong>m Rückgang <strong>de</strong>s Eises wur<strong>de</strong> Standwild wie Rehe, Hirsche, Elche und Wildschweine sesshaft<br />
und verdrängte die Rentiere. In <strong>de</strong>r Folge begannen die Menschen, die von <strong>de</strong>r Jagd lebten, feste Siedlungen <strong>zu</strong> errichten. Im 9. Jahrtausend v. Chr. sie<strong>de</strong>lten an <strong>de</strong>r Spree, Dahme und<br />
Bäke Jäger und Fischer, die Pfeilspitzen, Schaber und Feuersteinbeile hinterließen. Aus <strong>de</strong>m 7. Jahrtausend v. Chr. stammt eine Maske, die wahrscheinlich als Jagdzauber diente.<br />
Germanen, Slawen und Gründung <strong>de</strong>r Mark Bran<strong>de</strong>nburg<br />
Im 4. Jahrtausend v. Chr. bil<strong>de</strong>ten sich Kulturen mit Ackerbau und Vieh<strong>zu</strong>cht, die handgefertigte Keramiken und Vorratsspeicher benutzten. Seit <strong>de</strong>m 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt v. Chr. sie<strong>de</strong>lten sich<br />
verstärkt Germanen an: in historischen Quellen tauchten für sie die Stammesbezeichnungen Semnonen (Teilstamm <strong>de</strong>r Sweben) und Burgun<strong>de</strong>n auf.<br />
Im 4. und 5. Jahrhun<strong>de</strong>rt n. Chr. verließen große Teile <strong>de</strong>r germanischen Stämme das Gebiet um Havel und Spree und wan<strong>de</strong>rn Richtung Oberrhein nach Schwaben. Im Berliner Raum<br />
nahm daher die Besiedlungsdichte ab, er blieb aber von germanischen Restgruppen besie<strong>de</strong>lt. Ab <strong>de</strong>m 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt strömten Slawenstämme in die Lausitzer Gegend und um das Jahr<br />
720 auch in <strong>de</strong>n Berliner Raum. Sie übernahmen alte germanische Standorte und ließen sich ferner in bisher unbesie<strong>de</strong>lten Landstrichen nie<strong>de</strong>r.<br />
Die slawische Zeit ging 1157 mit <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>r Mark Bran<strong>de</strong>nburg durch Albrecht <strong>de</strong>n Bären <strong>zu</strong> En<strong>de</strong>, nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Askanier die Slawen – nach mehreren gescheiterten <strong>de</strong>utschen<br />
Versuchen in <strong>de</strong>n Jahrhun<strong>de</strong>rten <strong>zu</strong>vor – mit <strong>de</strong>m Fürsten Jaczo (Jaxa von Köpenick?) an <strong>de</strong>r Spitze entschei<strong>de</strong>nd schlagen konnte. Die Gründung <strong>de</strong>r ersten Dörfer im Bereich <strong>de</strong>r<br />
heutigen Großstadt Berlin (Groß-Berlin) fiel in <strong>de</strong>n anschließen<strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sausbau <strong>de</strong>r askanischen Markgrafen im Teltow, <strong>de</strong>r durch eine geschickte Siedlungspolitik und eine kluge<br />
Einbeziehung <strong>de</strong>r international agieren<strong>de</strong>n geistlichen Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Zisterzienser (Kloster Lehnin) [1] und <strong>de</strong>r Tempelritter (Komturhof Tempelhof) gekennzeichnet war.<br />
Berlin entsteht<br />
Auf <strong>de</strong>n trockenen Flächen <strong>de</strong>s sumpfigen Urstromtals zwischen <strong>de</strong>m Teltow und <strong>de</strong>m Barnim wur<strong>de</strong> eine Furt über die Spree besie<strong>de</strong>lt. Auf <strong>de</strong>r rechten Uferseite entstand Alt-Berlin,<br />
auf einer Spreeinsel Cölln. Um diese Zeit wur<strong>de</strong>n auch die Siedlungen auf <strong>de</strong>m späteren Stadtgebiet von Berlin erstmals urkundlich erwähnt: 1197 Spandau, 1209 Köpenick, 1237 Cölln<br />
und schließlich 1244 Berlin, davon waren Spandau und Köpenick bereits ältere slawische Gründungen. Die Urkun<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>n frühesten Erwähnungen Cöllns vom 28. Oktober 1237 und<br />
Berlins vom 26. Januar 1244 befin<strong>de</strong>n sich im Domstiftsarchiv in Bran<strong>de</strong>nburg an <strong>de</strong>r Havel. Zu beachten ist dabei, dass <strong>de</strong>r Bran<strong>de</strong>nburger Vertrag vom 28. Oktober 1237, <strong>de</strong>n u. a. <strong>de</strong>r<br />
Pfarrer Symeon <strong>de</strong> Colonia bezeugt, nur in einer <strong>zu</strong> Merseburg am 28. Februar 1238 ausgestellten Urkun<strong>de</strong> überliefert ist. 1244 erscheint <strong>de</strong>rselbe Symeon dann als Propst von Berlin.<br />
Spandau erhielt 1232 das Stadtrecht, Berlin bekam ebenfalls um diese Zeit das Stadtrecht. 1307 wur<strong>de</strong>n dann Berlin und Cölln <strong>zu</strong>sammengeschlossen. Die Doppelstadt Berlin-Cölln<br />
konnte sich wirtschaftlich insbeson<strong>de</strong>re durch das von <strong>de</strong>n gemeinsam regieren<strong>de</strong>n Markgrafen Otto III. und Johann I. ausgestellte Privileg <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage gegenüber <strong>de</strong>n Städten<br />
Spandau und Köpenick durchsetzen.<br />
Jüngere Forschungen haben ergeben, dass Cölln und Berlin sehr wahrscheinlich bereits im letzten Drittel <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n; für Cölln ist es inzwischen aufgrund<br />
zahlreicher Baumringdatierungen (Dendrochronologie) erwiesen. Archäologische Untersuchungen 1997–1999 stießen in <strong>de</strong>r Breiten Straße 28 (Alt-Cölln) auf einen um 1200<br />
wie<strong>de</strong>rverwen<strong>de</strong>ten Balken, <strong>de</strong>r mit Hilfe <strong>de</strong>r Baumringanalyse auf „um/nach 1171“ datiert wer<strong>de</strong>n konnte.[2] Im Jahre 2007 wur<strong>de</strong> bei Ausgrabungen auf <strong>de</strong>m Cöllner Petrikirchplatz in
einem Erdkeller ein Eichenbalken gefun<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>ssen Analyse ergab, dass <strong>de</strong>r Baum um das Jahr 1212 gefällt wor<strong>de</strong>n war.[3] 1997 und 2008 wur<strong>de</strong>n im Bereich <strong>de</strong>s Schlossplatzes unter<br />
<strong>de</strong>n Fundamenten <strong>de</strong>s 1747 abgerissenen Dominikanerklosters Siedlungsreste gefun<strong>de</strong>n. Das jüngste Datum hat ein Holzrest von 1198 (Waldkante); <strong>de</strong>r gesamte Befund trägt<br />
Brandspuren. Dieser Siedlungsteil ist also offenbar nach 1198 nach einer Brandzerstörung aufgegeben wor<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn er wur<strong>de</strong> spätestens <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 13.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts von <strong>de</strong>r ersten Cöllner Stadtmauer überbaut.[4]<br />
Die Entwicklung und die gezielte Privilegierung <strong>de</strong>s Ausbaus <strong>de</strong>r Doppelstadt durch die bei<strong>de</strong>n Markgrafen seit <strong>de</strong>n 1230er-Jahren hing eng mit <strong>de</strong>r Aufsiedlung <strong>de</strong>r Hochflächen Teltow<br />
und Barnim <strong>zu</strong>sammen, ausführlich geschil<strong>de</strong>rt in <strong>de</strong>r Märkischen Fürstenchronik. Die askanischen Siedlungen auf <strong>de</strong>m nordwestlichen Teltow waren durch die sperrriegelartig<br />
gegrün<strong>de</strong>ten Templerdörfer um <strong>de</strong>n Komturhof Tempelhof strategisch gegen die Wettinische Herrschaft auf <strong>de</strong>m Teltow mit Mittenwal<strong>de</strong> und Köpenick sowie <strong>de</strong>m sehr wahrscheinlich<br />
geplanten wettinischen Aufbau einer Herrschaft um Hönow (u. a. mit Hellersdorf) gesichert. Die Grenze zwischen <strong>de</strong>r askanischen Mark und <strong>de</strong>n wettinischen Besit<strong>zu</strong>ngen verlief <strong>zu</strong><br />
dieser Zeit in Nord-Süd-Richtung mitten durch das heutige Berliner Stadtgebiet. Die Behauptung eines dazwischen liegen<strong>de</strong>n Streifens <strong>de</strong>r Erzbischöfe von Mag<strong>de</strong>burg wird<br />
überwiegend bestritten.[5] Die Spannungen mit <strong>de</strong>n Wettinern entschie<strong>de</strong>n sich im Teltow-Krieg zwischen 1239 und 1245 <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r Askanier, <strong>de</strong>r ihnen endgültig <strong>de</strong>n gesamten<br />
Teltow und Barnim (abgesehen von Rü<strong>de</strong>rsdorf) und damit das gesamte heutige Stadtgebiet einbrachte.<br />
Mark Bran<strong>de</strong>nburg von <strong>de</strong>n Wittelsbachern bis <strong>zu</strong>m Edikt von Potsdam<br />
Nach <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>r märkischen Askanier 1320 übertrug <strong>de</strong>r Wittelsbacher Kaiser Ludwig IV., ein Onkel <strong>de</strong>s letzten Askaniers Heinrichs II., 1323 die Mark Bran<strong>de</strong>nburg seinem<br />
ältesten Sohn Ludwig <strong>de</strong>m Bran<strong>de</strong>nburger. Von Anfang an war die wittelsbachische Regierung über Bran<strong>de</strong>nburg von starken Spannungen geprägt. 1325 erschlugen und verbrannten die<br />
Berliner und Cöllner Bürger Propst Nikolaus von Bernau, <strong>de</strong>r als Parteigänger <strong>de</strong>s Papstes gegen <strong>de</strong>n Kaiser auftrat, daraufhin verhängte <strong>de</strong>r Papst über Berlin das Interdikt.<br />
1380 gab es einen Großbrand in Berlin. Dabei wur<strong>de</strong>n unter an<strong>de</strong>rem das Rathaus und fast alle Kirchen zerstört.<br />
1415 wur<strong>de</strong> Friedrich I. Kurfürst <strong>de</strong>r Mark Bran<strong>de</strong>nburg und blieb dies bis 1440. Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Familie Hohenzollern regierten bis 1918 in Berlin, erst als Markgrafen von Bran<strong>de</strong>nburg,<br />
dann als Könige in und von Preußen und schließlich als Deutsche Kaiser. Die Einwohner Berlins haben diese Verän<strong>de</strong>rung nicht immer begrüßt. 1448 revoltierten sie im „Berliner<br />
Unwillen“ gegen <strong>de</strong>n Schlossneubau <strong>de</strong>s Kurfürsten Friedrich II. Eisenzahn. Dieser Protest war jedoch nicht von Erfolg gekrönt und die Bevölkerung büßte viele ihrer politischen und<br />
ökonomischen Freiheiten ein. 1451 wur<strong>de</strong> Berlin dann Resi<strong>de</strong>nzstadt <strong>de</strong>r bran<strong>de</strong>nburgischen Markgrafen und Kurfürsten.<br />
Als Berlin Wohnsitz <strong>de</strong>r Hohenzollern wur<strong>de</strong>, musste es seinen Status als Hansestadt aufgeben. Die ökonomischen Aktivitäten verlagerten sich vom Han<strong>de</strong>l auf die Produktion von<br />
Luxuswaren für <strong>de</strong>n Hofa<strong>de</strong>l. Die Bevölkerungszahl stieg im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt auf über zehntausend an.<br />
1510 wur<strong>de</strong>n 100 Ju<strong>de</strong>n beschuldigt, Hostien gestohlen und entweiht <strong>zu</strong> haben. 38 von ihnen wur<strong>de</strong>n verbrannt, zwei wur<strong>de</strong>n – nach<strong>de</strong>m sie <strong>zu</strong>m Christentum konvertiert waren –<br />
geköpft, alle an<strong>de</strong>ren Berliner Ju<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n ausgewiesen. Nach<strong>de</strong>m ihre Unschuld nach 30 Jahren nachgewiesen wer<strong>de</strong>n konnte, durften Ju<strong>de</strong>n – nach Zahlung einer Gebühr – wie<strong>de</strong>r<br />
nach Berlin sie<strong>de</strong>ln, wur<strong>de</strong>n jedoch 1573 erneut, diesmal für hun<strong>de</strong>rt Jahre, vertrieben.<br />
1539 führte Joachim II., Kurfürst von Bran<strong>de</strong>nburg und Herzog von Preußen, die Reformation in Bran<strong>de</strong>nburg ein und beschlagnahmte im Rahmen <strong>de</strong>r Säkularisierung Besit<strong>zu</strong>ngen <strong>de</strong>r<br />
Kirche. Das so erworbene Geld benutzte er für seine Großprojekte wie <strong>de</strong>n Bau einer Straße, <strong>de</strong>s Kurfürstendamms, zwischen seinem Jagdschloss im Grunewald und seinem Palast, <strong>de</strong>m<br />
Berliner Stadtschloss. 1567 entwickelte sich aus einem geplanten Schauspiel <strong>de</strong>r dreitägige Knüppelkrieg zwischen Berlin und Spandau, bei <strong>de</strong>m sich die Spandauer nicht mit <strong>de</strong>r<br />
Nie<strong>de</strong>rlage im Schauspiel abfin<strong>de</strong>n wollten und letztendlich die Berliner verprügelten.<br />
In <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts hatte <strong>de</strong>r Dreißigjährige Krieg für Berlin schlimme Folgen: Ein Drittel <strong>de</strong>r Häuser wur<strong>de</strong> beschädigt, die Bevölkerung halbierte sich. Friedrich<br />
Wilhelm, bekannt als <strong>de</strong>r Große Kurfürst, übernahm 1640 die Regierungsgeschäfte von seinem Vater. Er startete eine Politik <strong>de</strong>r Immigration und <strong>de</strong>r religiösen Toleranz. Es entstan<strong>de</strong>n<br />
mehrere Stadterweiterungen, und es wur<strong>de</strong>n die Vorstädte Friedrichswer<strong>de</strong>r, Dorotheenstadt und Friedrichstadt gegrün<strong>de</strong>t. 1671 wur<strong>de</strong> 50 aus Österreich vertriebenen jüdischen Familien<br />
ein Zuhause gegeben. Mit <strong>de</strong>m Edikt von Potsdam 1685 lud Friedrich Wilhelm die französischen Hugenotten nach Bran<strong>de</strong>nburg ein. Über 15.000 Franzosen kamen, von <strong>de</strong>nen sich<br />
6.000 in Berlin nie<strong>de</strong>rließen. Um 1700 waren 20 Prozent <strong>de</strong>r Berliner Einwohner Franzosen, und ihr kultureller Einfluss war groß. Viele Einwan<strong>de</strong>rer kamen außer<strong>de</strong>m aus Böhmen,<br />
Polen und Salzburg. Friedrich Wilhelm baute außer<strong>de</strong>m eine Berufsarmee auf.
Das Preußische Königreich<br />
1701 krönte Friedrich III. sich selbst <strong>zu</strong> Friedrich I. König in Preußen (nicht von Preußen, da er nicht das gesamte Preußen besaß). Friedrich I. war in erster Linie um das Repräsentative<br />
seines Staats bemüht. Er ließ das heutige Schloss Charlottenburg westlich <strong>de</strong>r Stadt bauen, und auch das Berliner Schloss wur<strong>de</strong> bis 1707 <strong>zu</strong> einer Prunkresi<strong>de</strong>nz erweitert. Auf Erlass<br />
Friedrich I. vom 18. Januar 1709 wur<strong>de</strong>n die fünf bis dahin unabhängigen Städte Berlin, Cölln, Friedrichswer<strong>de</strong>r, Dorotheenstadt und Friedrichstadt per 1. Januar 1710 <strong>zu</strong>r Königlichen<br />
Haupt- und Resi<strong>de</strong>nzstadt Berlin vereinigt. Schon bald darauf entstan<strong>de</strong>n vor <strong>de</strong>n Toren <strong>de</strong>r Stadt neue Vorstädte.<br />
Friedrichs Sohn, Friedrich Wilhelm I., König in Preußen, ab 1713 an <strong>de</strong>r Macht, war ein sparsamer Mann, <strong>de</strong>r Preußen <strong>zu</strong> einer be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Militärmacht aufbaute. 1709 hatte Berlin<br />
55.000 Einwohner, von <strong>de</strong>nen 5.000 in <strong>de</strong>r Armee dienten, 1755 waren es bereits 100.000 Einwohner bei 26.000 Soldaten. Außer<strong>de</strong>m ließ Friedrich Wilhelm eine hölzerne Mauer mit 14<br />
Toren um die Stadt errichten, die als Akzisemauer bekannt wur<strong>de</strong>.<br />
1740 kam Friedrich II., bekannt als Friedrich <strong>de</strong>r Große, an die Macht. Friedrich II. wur<strong>de</strong> auch <strong>de</strong>r Philosoph auf <strong>de</strong>m Thron genannt, da er unter an<strong>de</strong>rem mit Voltaire korrespondierte.<br />
Unter ihm wur<strong>de</strong> die Stadt <strong>zu</strong>m Zentrum <strong>de</strong>r Aufklärung. Der bekannteste Berliner Philosoph <strong>de</strong>r Zeit war Moses Men<strong>de</strong>lssohn. Unter <strong>de</strong>r Regierung seines Nachfolgers Friedrich<br />
Wilhelm II. folgte die Stagnation. Friedrich Wilhelm II. war ein Gegner <strong>de</strong>r Aufklärung, praktizierte Zensur und setzte auf Repressalien. Unter ihm wur<strong>de</strong> die Stadtmauer in Stein neu<br />
errichtet. En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts gab er ein neues Bran<strong>de</strong>nburger Tor in Auftrag – das bekannte heutige Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt.<br />
1806 nahmen die Franzosen Berlin ein. Am 27. Oktober 1806 ritt Napoléon Bonaparte vom Schloss Charlottenburg her kommend durch das Bran<strong>de</strong>nburger Tor. Als Reaktion auf <strong>de</strong>n<br />
offensichtlichen Zusammenbruch <strong>de</strong>s altpreußischen Militärstaats nach <strong>de</strong>r Schlacht von Jena und Auerstedt hielten allmählich <strong>de</strong>mokratische Reformen Ein<strong>zu</strong>g. Durch Erlass <strong>de</strong>r<br />
Preußischen Städteordnung am 19. November 1808 bekam (auch) Berlin eine Selbstverwaltung. Im Dezember 1808 rückten die letzten französischen Besat<strong>zu</strong>ngstruppen ab. Vom 18. bis<br />
22. April 1809 fan<strong>de</strong>n die ersten Wahlen <strong>zu</strong>r Berliner Stadtverordnetenversammlung statt, durch die die schon vorhan<strong>de</strong>ne Institution <strong>de</strong>s Magistrats eine parlamentarische Grundlage<br />
erhielt. Es waren allerdings nur gut situierte, männliche Bürger stimmberechtigt. Am 1. Mai 1809 wur<strong>de</strong> als erster Oberbürgermeister Leopold von Gerlach gewählt. 1810 wur<strong>de</strong> die<br />
Berliner Universität (heute Humboldt-Universität <strong>zu</strong> Berlin) gegrün<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>ren erster Rektor <strong>de</strong>r Philosoph Johann Gottlieb Fichte wur<strong>de</strong>. Zwischen 1810 und 1811 erschien auch Berlins<br />
erste Tageszeitung, die von Heinrich von Kleist herausgegebenen Berliner Abendblätter. Seit 1812 galt für die Ju<strong>de</strong>n Berufsfreiheit. Die Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Franzosen 1814 be<strong>de</strong>utete auch<br />
ein En<strong>de</strong> weiterer Reformen.<br />
In <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts setzte die Industrielle Revolution ein, und die Einwohnerzahl <strong>de</strong>r Stadt wuchs rasch von 200.000 auf 400.000 an, womit Berlin nach London,<br />
Paris und Sankt Petersburg <strong>zu</strong>r viertgrößten Stadt Europas wur<strong>de</strong>. Die erste Eisenbahn in Preußen, die Berlin-Potsdamer Eisenbahn, nahm 1838 ihren Betrieb auf. Der Potsdamer<br />
Bahnhof setzt <strong>de</strong>n Beginn <strong>de</strong>r sich schnell entwickeln<strong>de</strong>n Eisenbahnstadt Berlin.<br />
Wie in an<strong>de</strong>ren europäischen Städten war 1848 in Berlin ein Jahr <strong>de</strong>r Revolution. Friedrich Wilhelm IV. konnte die Revolution, bei <strong>de</strong>r es in Berlin <strong>zu</strong>m sogenannten<br />
„Barrika<strong>de</strong>naufstand“ kam, jedoch nie<strong>de</strong>rwerfen. Allerdings kam es auch danach weiterhin <strong>zu</strong> Unruhen. So wur<strong>de</strong> am 14. Juni 1848 das Zeughaus gestürmt und geplün<strong>de</strong>rt. In <strong>de</strong>r Folge<br />
wur<strong>de</strong> die Selbstverwaltung <strong>de</strong>r Stadt wie<strong>de</strong>r eingeschränkt, in<strong>de</strong>m die Einkommensgrenze, die <strong>zu</strong>r Teilnahme an Wahlen berechtigte, angehoben wur<strong>de</strong>. Dies führte da<strong>zu</strong>, dass nur noch<br />
fünf Prozent <strong>de</strong>r Bevölkerung wahlberechtigt war. Dieses System blieb bis 1918 in Kraft.<br />
1861 wur<strong>de</strong> Wilhelm I. neuer König. Zu Beginn seiner Regentschaft gab es Hoffnung auf eine Liberalisierung. Wilhelm I. ernannte liberale Minister und ließ auch das Rote Rathaus<br />
erbauen. 1861 wur<strong>de</strong> das Stadtgebiet durch die Eingemeindung von Wedding und Moabit sowie Tempelhofer und Schöneberger Vorstadt erweitert.<br />
Das weiterhin rapi<strong>de</strong> Bevölkerungswachstum <strong>de</strong>r Stadt führte in dieser Zeit <strong>zu</strong> großen Problemen. 1862 trat <strong>de</strong>shalb <strong>de</strong>r Hobrecht-Plan in Kraft, <strong>de</strong>r die Bebauung von Berlin und seines<br />
Umlan<strong>de</strong>s in geordnete Bahnen lenken sollte. Der Bau von Wasserversorgung und Kanalisation unter maßgeblicher Beteiligung von Rudolf Virchow schuf wesentliche Vorausset<strong>zu</strong>ngen<br />
für die mo<strong>de</strong>rne Stadt.<br />
Das Kaiserreich<br />
Unter <strong>de</strong>r Führung Preußens kam es nach En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Deutsch-Französischen Kriegs <strong>zu</strong>r Klein<strong>de</strong>utschen Lösung; 1871 wur<strong>de</strong> das Deutsche Reich gegrün<strong>de</strong>t, Wilhelm I. wur<strong>de</strong> Kaiser,
Otto von Bismarck Reichskanzler und Berlin <strong>zu</strong>r Hauptstadt <strong>de</strong>s Reichs.<br />
Berlin war inzwischen <strong>zu</strong> einer Industriestadt mit 800.000 Einwohnern angewachsen. Mit diesem Wachstum konnte die Infrastruktur jedoch nicht mithalten. 1873 begann man endlich<br />
mit <strong>de</strong>m Bau einer Kanalisation, <strong>de</strong>r 1893 abgeschlossen war. Auf <strong>de</strong>n ökonomischen Boom <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong>rzeit folgte <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong>rkrach, eine Wirtschaftskrise in <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>r<br />
1870er-Jahre. Die Stadtentwicklung blieb nach wie vor ein strittiges Thema. Am 1. Januar 1876 erhielt die Stadt Berlin per Vertrag vom Staat die Brücken und Straßen. 1882 beschränkte<br />
das sogenannte Kreuzbergerkenntnis die Baupolizei auf das Abwen<strong>de</strong>n von Gefahren, untersagte ihr jedoch die Einflussnahme in ästhetischen Aspekten.<br />
1884 begann <strong>de</strong>r Bau <strong>de</strong>s Reichstagsgebäu<strong>de</strong>s, das zehn Jahre später am 5. Dezember 1894 fertiggestellt wur<strong>de</strong>.<br />
1896 begann <strong>zu</strong>r Bewältigung <strong>de</strong>s stark angewachsenen Verkehrs die Konstruktion <strong>de</strong>r U-Bahn und <strong>de</strong>r Vorortstrecken <strong>de</strong>r Eisenbahn. In <strong>de</strong>n Siedlungen um das Stadtzentrum herum<br />
(Kreuzberg, Prenzlauer Berg, Friedrichshain und Wedding) im sogenannten Wilhelminischen Ring wur<strong>de</strong>n Mietskasernen errichtet, um billigen Wohnraum für Arbeiter <strong>zu</strong> schaffen. Im<br />
Südwesten <strong>de</strong>r Stadt entstan<strong>de</strong>n ab 1850 großzügige und weit ausge<strong>de</strong>hnte Villenkolonien für das wohlhaben<strong>de</strong> Bürgertum, weitere Villenviertel folgten im Westen gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts. Zwischen 1904 und 1908 beschäftigte sich die 51-teilige Buchreihe „Großstadt-Dokumente“ ausführlich mit Berlin. Eines <strong>de</strong>r Hauptthemen <strong>de</strong>s aufwändigsten<br />
Stadtforschungsprojektes im <strong>de</strong>utschsprachigen Raum dieser Zeit war <strong>de</strong>r Vergleich <strong>de</strong>s häufig als „mo<strong>de</strong>rne Retortenstadt“ betrachteten Berlins mit <strong>de</strong>m als traditions- und kulturreicher<br />
gelten<strong>de</strong>n Wien.[6] 1909 eröffnet in Johannisthal <strong>de</strong>r erste Motorflugplatz Deutschlands. Zur Koordinierung infrastruktureller Maßnahmen im rasant wachsen<strong>de</strong>n Berliner Raum bil<strong>de</strong>te<br />
sich 1911 <strong>de</strong>r Zweckverband Groß-Berlin, aus <strong>de</strong>m 1920 <strong>de</strong>r Zusammenschluss <strong>zu</strong> Groß-Berlin hervorging; bleiben<strong>de</strong> Leistung <strong>de</strong>s Verban<strong>de</strong>s ist <strong>de</strong>r Abschluss <strong>de</strong>s Dauerwaldvertrages.<br />
Der Erste Weltkrieg führte <strong>zu</strong> Hunger in Berlin. Im Winter 1916/1917 waren 150.000 Menschen auf Hungerhilfe angewiesen, und Streiks brachen aus. Als 1918 <strong>de</strong>r Krieg en<strong>de</strong>te, dankte<br />
Wilhelm II. ab. Der Sozial<strong>de</strong>mokrat Philipp Schei<strong>de</strong>mann und <strong>de</strong>r Kommunist Karl Liebknecht riefen bei<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>r Novemberrevolution die Republik aus. In <strong>de</strong>n nächsten Monaten<br />
fan<strong>de</strong>n in Berlin zahlreiche Straßenkämpfe zwischen <strong>de</strong>n unterschiedlichen Fraktionen statt.<br />
Die Weimarer Republik<br />
Im späten Dezember 1918 wur<strong>de</strong> die Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) in Berlin gegrün<strong>de</strong>t. Im Januar 1919 versuchte sie im Spartakusaufstand, die Macht an sich <strong>zu</strong> reißen.<br />
Die Revolte scheiterte, und am 15. Januar 1919 töteten rechtsgerichtete Truppen Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht. Im März 1920 versuchte Wolfgang Kapp, Grün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
rechtsgerichteten Deutschen Vaterlandspartei, die Regierung <strong>zu</strong> stürzen. Die Berliner Garnisonstruppen schlugen sich auf seine Seite, und die Regierungsgebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n besetzt. (Die<br />
Regierung <strong>de</strong>r Weimarer Republik hatte Berlin bereits verlassen.) Durch einen Generalstreik konnte <strong>de</strong>r Putsch jedoch verhin<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n. Am 1. Oktober 1920 wur<strong>de</strong> Groß-Berlin durch<br />
das Gesetz über die Bildung einer neuen Stadtgemein<strong>de</strong> gegrün<strong>de</strong>t. Dabei wur<strong>de</strong> Alt-Berlin mit sieben weiteren Städten, nämlich (Charlottenburg, Köpenick, Lichtenberg, Neukölln,<br />
Schöneberg, Spandau und Wilmersdorf), 59 Landgemein<strong>de</strong>n und 27 Gutsbezirken <strong>zu</strong> einer Gemein<strong>de</strong> verschmolzen. Groß-Berlin hatte damals 3.804.048 Einwohner.<br />
1922 wur<strong>de</strong> Außenminister Walther Rathenau in Berlin ermor<strong>de</strong>t. Die Stadt war schockiert: eine halbe Million Menschen kamen <strong>zu</strong> seiner Beerdigung.<br />
Die ökonomische Situation war schlecht. Deutschland hatte durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>nsvertrag von Versailles hohe Reparationen <strong>zu</strong> zahlen. Die Regierung versuchte dieses Problem <strong>zu</strong> lösen,<br />
in<strong>de</strong>m sie mehr Geld druckte. Zusammen mit <strong>de</strong>r schwierigen Wirtschaftslage führte dies 1923 <strong>zu</strong> einer Hyperinflation, unter <strong>de</strong>r beson<strong>de</strong>rs Arbeiter, Angestellte und Rentner <strong>zu</strong> lei<strong>de</strong>n<br />
hatten. Ab 1924 besserte sich die Situation durch neue Vereinbarungen mit <strong>de</strong>n Alliierten, amerikanische Hilfe und eine bessere Finanzpolitik. Die Hochzeit Berlins, die sogenannten<br />
„Gol<strong>de</strong>nen Zwanziger“ begannen. Berlin wur<strong>de</strong> in dieser Zeit <strong>zu</strong>r größten Industriestadt Europas. Personen wie <strong>de</strong>r Architekt Walter Gropius, <strong>de</strong>r Physiker Albert Einstein, <strong>de</strong>r Maler<br />
George Grosz, Schriftsteller wie Arnold Zweig, Bertolt Brecht und Kurt Tucholsky und Schauspieler und Regisseure wie Marlene Dietrich, Friedrich Wilhelm Murnau und Fritz Lang<br />
machten Berlin <strong>zu</strong>m kulturellen Zentrum Europas. Das Nachtleben dieser Zeit hat seinen bekanntesten Nie<strong>de</strong>rschlag in <strong>de</strong>m Film Cabaret gefun<strong>de</strong>n.<br />
1924 eröffnete <strong>de</strong>r Flughafen Tempelhof. Im gleichen Jahr fand auch die erste Funkausstellung auf <strong>de</strong>m Messegelän<strong>de</strong> statt. Berlin war <strong>de</strong>r zweitgrößte Binnenhafen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Die ab<br />
1924 nach und nach elektrifizierten Berliner Stadt-, Ring- und Vorortbahnen wur<strong>de</strong>n 1930 unter <strong>de</strong>m Namen S-Bahn <strong>zu</strong>sammengefasst. Diese Infrastruktur wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Versorgung <strong>de</strong>r<br />
über vier Millionen Berliner benötigt. 1926 wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Auftakt <strong>de</strong>r dritten Funkausstellung <strong>de</strong>r Berliner Funkturm eingeweiht. Zwischen 1930 und 1933 führte <strong>de</strong>r Verein für<br />
Raumschiffahrt, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m auch <strong>de</strong>r spätere Ingenieur Wernher von Braun gehörte, auf <strong>de</strong>m Raketenflugplatz Berlin in Tegel erste Versuche mit Flüssigkeitsraketen durch.<br />
Die kurze Zeit <strong>de</strong>s Aufschwungs en<strong>de</strong>te im Jahr 1929 mit <strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise. In diesem Jahr gewann Adolf Hitlers NSDAP ihre ersten Sitze im Parlament <strong>de</strong>r Stadt. Am 20. Juli
1932 wur<strong>de</strong> die preußische Regierung unter Otto Braun in Berlin durch einen Militärputsch, <strong>de</strong>n sogenannten „Preußenschlag“ abgesetzt. Die Republik näherte sich ihrem<br />
Zusammenbruch unter <strong>de</strong>m Einfluss extremistischer Kräfte von links und rechts. Am 30. Januar 1933 wur<strong>de</strong> Hitler <strong>zu</strong>m Reichskanzler ernannt.<br />
Das Dritte Reich<br />
Während <strong>de</strong>r gesamten Zeit <strong>de</strong>r Weimarer Republik war Berlin Hochburg <strong>de</strong>r Sozial<strong>de</strong>mokraten gewesen; bis 1933 waren alle Versuche <strong>de</strong>r NSDAP erfolglos, in <strong>de</strong>r Reichshauptstadt<br />
Fuß <strong>zu</strong> fassen.<br />
Am 27. Februar 1933 brannte <strong>de</strong>r Reichstag. Dies wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r NSDAP genutzt, um die Grundrechte <strong>de</strong>r Weimarer Verfassung faktisch außer Kraft <strong>zu</strong> setzen.<br />
Um 1933 lebten etwa 160.000 Ju<strong>de</strong>n in Berlin: ein Drittel aller <strong>de</strong>utschen Ju<strong>de</strong>n, vier Prozent <strong>de</strong>r Bevölkerung <strong>de</strong>r Stadt. Ein Drittel davon waren arme Immigranten aus Osteuropa, die<br />
hauptsächlich im Scheunenviertel nahe <strong>de</strong>m Alexan<strong>de</strong>rplatz lebten. Die Ju<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n von Anfang an vom Nazi-Regime verfolgt. Im März mussten alle jüdischen Ärzte das Krankenhaus<br />
Charité verlassen. In <strong>de</strong>r ersten Aprilwoche inszenierten die Nazimachthaber <strong>de</strong>n sogenannten „Ju<strong>de</strong>nboykott“, bei <strong>de</strong>m die übrige Bevölkerung vom Einkaufen in jüdischen Lä<strong>de</strong>n<br />
abgehalten wer<strong>de</strong>n sollte.<br />
1936 wur<strong>de</strong>n in Berlin die Olympischen Sommerspiele abgehalten. Die Nationalsozialisten nutzten die bereits vor 1933 an Berlin vergebenen Spiele <strong>zu</strong>r Propaganda. Um die<br />
Selbstinszenierung als normaler Staat in <strong>de</strong>r internationalen Öffentlichkeit nicht <strong>zu</strong> gefähr<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong> die ansonsten für je<strong>de</strong>n wahrnehmbare Diskriminierung und Verfolgung <strong>de</strong>r<br />
jüdischen Bevölkerung reduziert. So wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Beispiel die Schil<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>r Aufschrift „Für Ju<strong>de</strong>n verboten“ zeitweise entfernt. 1937 folgten dann im Rahmen <strong>de</strong>r 700-Jahr-Feiern<br />
Berlins weitere Propagandaveranstaltungen <strong>de</strong>r Nationalsozialisten.<br />
In diese Zeit fallen auch die Planungen <strong>de</strong>r Nationalsozialisten, Berlin <strong>zu</strong>r Welthauptstadt Germania aus<strong>zu</strong>bauen. Die Pläne <strong>de</strong>s Architekten Albert Speer sahen gigantische Zentralachsen<br />
in Berlin vor, an <strong>de</strong>nen Monumentalbauten stehen sollten. Während die meisten Projekte nicht verwirklicht wur<strong>de</strong>n, sind in Berlin Reste dieser Architektur noch heute <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n.<br />
Vom 9. bis 10. November 1938 brannten infolge <strong>de</strong>r Reichspogromnacht die Synagogen, jüdische Geschäfte und Wohnungen wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>moliert, viele Ju<strong>de</strong>n verhaftet. Um 1939 lebten<br />
noch rund 75.000 Ju<strong>de</strong>n in Berlin. Am 18. Oktober 1941 ging vom Bahnhof Grunewald <strong>de</strong>r erste von insgesamt 63 Transporten mit Ju<strong>de</strong>n ins damalige Litzmannstadt ab. Der Holocaust<br />
begann. 50.000 Ju<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n in die Konzentrationslager verschleppt, wo die meisten ermor<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n. Von historischer Be<strong>de</strong>utung ist in diesem Zusammenhang auch die 1942 im<br />
Ortsteil Wannsee abgehaltene Wannseekonferenz, auf <strong>de</strong>r unter Leitung <strong>de</strong>s Chefs <strong>de</strong>s Reichssicherheitshauptamts Reinhard Heydrich die gesamtstaatliche Koordination <strong>de</strong>s Holocaust<br />
beschlossen wur<strong>de</strong>. Über 1200 Ju<strong>de</strong>n überlebten in Berlin, in<strong>de</strong>m sie sich versteckten.<br />
30 Kilometer nordwestlich von Berlin, nahe Oranienburg, befand sich das Konzentrationslager Sachsenhausen, wo hauptsächlich politische Gegner und sowjetische Kriegsgefangene<br />
inhaftiert waren. Zehntausen<strong>de</strong> starben dort. Sachsenhausen hatte Unterlager in <strong>de</strong>r Nähe von Industriebetrieben, in <strong>de</strong>nen die Gefangenen arbeiten mussten. Viele dieser Lager befan<strong>de</strong>n<br />
sich in Berlin.<br />
1939 begann <strong>de</strong>r Zweite Weltkrieg, von <strong>de</strong>m Berlin anfangs wenig betroffen war. Die ersten britischen Fliegerangriffe auf Berlin fan<strong>de</strong>n bereits 1940 statt, da sich die Stadt jedoch fast<br />
außerhalb <strong>de</strong>r Reichweite <strong>de</strong>r Bomber befand, waren die ersten Schä<strong>de</strong>n noch relativ gering. Mit <strong>de</strong>m Eintritt <strong>de</strong>r USA in <strong>de</strong>n Krieg nahmen die Schä<strong>de</strong>n jedoch größere Ausmaße an.<br />
Während die Briten weiterhin nachts Berlin ansteuerten, flogen die Amerikaner tagsüber, sodass das Bombar<strong>de</strong>ment quasi rund um die Uhr stattfand. Allein am 18. März 1945 griffen<br />
1.250 amerikanische Bomber die Stadt an. Infolge <strong>de</strong>r Bombar<strong>de</strong>ments starben schät<strong>zu</strong>ngsweise 20.000 Berliner, mehr als 1,5 Millionen wur<strong>de</strong>n obdachlos. Teile <strong>de</strong>r Innenstadt wur<strong>de</strong>n<br />
komplett zerstört. Die äußeren Bezirke erlitten geringere Beschädigungen. Im Schnitt waren ein Fünftel (50 % in <strong>de</strong>r Innenstadt) <strong>de</strong>r Berliner Gebäu<strong>de</strong> zerstört.<br />
Zerstörung von Berliner Gebäu<strong>de</strong>n im Zweiten Weltkrieg:<br />
• Grad <strong>de</strong>r Zerstörung Prozent Verlust <strong>de</strong>s Bauwertes<br />
•<br />
• total 11,6 100 %<br />
• schwer 8,3 75 %
• wie<strong>de</strong>rherstellbar 9,7 30 %<br />
• leicht (bewohnbar) 69,4 10 %<br />
Auch die Verkehrsinfrastruktur war größtenteils zerstört; die Versorgungslage war bis nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Krieges katastrophal. Insgesamt fielen 450.000 Tonnen Bomben auf Berlin. Ab<br />
<strong>de</strong>m 21. April 1945 eroberten sowjetische und polnische Verbän<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Schlacht um Berlin die Stadt. Hitler tötete sich am 30. April 1945 im Führerbunker unter <strong>de</strong>r Reichskanzlei. Am<br />
2. Mai kapitulierte die Stadt vor <strong>de</strong>r Roten Armee, die nach letzten Straßenkämpfen in die Stadt einmarschierte.<br />
Nach <strong>de</strong>m Kriegsen<strong>de</strong> lag Berlin in Schutt und Asche: 28,5 Quadratkilometer <strong>de</strong>s Stadtgebiets lagen in Trümmern, 600.000 Wohnungen waren total zerstört, 100.000 beschädigt, je<strong>de</strong>s<br />
zweite Kaufhaus war eine Ruine. Eine Million Einwohner Berlins waren seit Kriegsbeginn 1939 gefallen, gefangen o<strong>de</strong>r geflohen.<br />
Die geteilte Stadt<br />
Auf <strong>de</strong>r Konferenz von Jalta vom 2. bis 11. Februar 1945 beschlossen die Alliierten, Deutschland in vier Besat<strong>zu</strong>ngszonen und Berlin in vier Sektoren auf<strong>zu</strong>teilen, von <strong>de</strong>nen je<strong>de</strong>r von<br />
einem <strong>de</strong>r Alliierten, Großbritannien, Frankreich, <strong>de</strong>n USA und <strong>de</strong>r Sowjetunion, kontrolliert wur<strong>de</strong>. Da<strong>zu</strong> zogen sich die sowjetische Streitkräfte im Sommer 1945 aus <strong>de</strong>n Westsektoren<br />
<strong>zu</strong>rück, die sie nach <strong>de</strong>r Schlacht um Berlin bis dahin besetzt hatten. Noch im Mai hatte die sowjetische Stadtkommandantur einen ersten Magistrat unter Arthur Werner und eine auf<br />
KPD-Mitglie<strong>de</strong>r gestützte Stadtverwaltung eingesetzt. Trotz <strong>de</strong>r Sektorenaufteilung wur<strong>de</strong> Berlin weiter von einer gemeinsamen alliierten Kommandantur verwaltet. Schon bald gab es<br />
sich verschärfen<strong>de</strong> politische Konflikte zwischen <strong>de</strong>n Westalliierten und <strong>de</strong>r Sowjetunion.<br />
Am 20. Oktober 1946 fand die erste Wahl <strong>zu</strong>r Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin in allen vier Besat<strong>zu</strong>ngszonen gemeinsam statt und en<strong>de</strong>te mit einem <strong>de</strong>utlichen Sieg <strong>de</strong>r<br />
SPD vor CDU und SED. Es folgten <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen in <strong>de</strong>r Verwaltung und in <strong>de</strong>r Stadtverordnetenversammlung.<br />
Am 5. Dezember 1948 sollte eine erneute gemeinsame Wahl <strong>zu</strong>r Stadtverordnetenversammlung von Groß-Berlin stattfin<strong>de</strong>n, die jedoch nur in West-Berlin durchgeführt wer<strong>de</strong>n konnte,<br />
weil die sowjetische Besat<strong>zu</strong>ngsmacht sie in ihrem Sektor verboten hatten. Vielmehr hatte die SED-Fraktion am 30. November 1948 eine „Stadtverordnetenversammlung“ unter<br />
Teilnahme von hun<strong>de</strong>rten angeblicher Abordnungen <strong>de</strong>r Ost-Berliner Betriebe durchgeführt, auf <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r rechtmäßig gewählte Magistrat für abgesetzt erklärt wur<strong>de</strong> und Friedrich Ebert<br />
(<strong>de</strong>r Sohn <strong>de</strong>s ehemaligen Reichspräsi<strong>de</strong>nten) <strong>zu</strong>m Oberbürgermeister „gewählt“ wur<strong>de</strong>.<br />
Berlin-Blocka<strong>de</strong> und Luftbrücke<br />
Im Juni 1948 blockierten sowjetische Truppen sämtliche Straßen- und Schienenverbindungen durch die sowjetische Zone Richtung West-Berlin, in <strong>de</strong>r Hoffnung, wie<strong>de</strong>r die<br />
wirtschaftliche Kontrolle über die gesamte Stadt <strong>zu</strong> erlangen. Der in Ost-Berlin residieren<strong>de</strong> Magistrat von Groß-Berlin verteilte an alle West-Berliner Lebensmittelkarten, die jedoch<br />
<strong>zu</strong>meist nicht in Anspruch genommen wur<strong>de</strong>n. Die Blocka<strong>de</strong> war mehr symbolischer Art und behin<strong>de</strong>rte ausschließlich <strong>de</strong>n Gütertransport aus West<strong>de</strong>utschland. Die West-Berliner<br />
jedoch fühlten sich in Anbetracht <strong>de</strong>r politischen Verhältnisse um sie herum stärker <strong>de</strong>m west<strong>de</strong>utschen Wirtschaftsraum <strong>zu</strong>gehörig und verzichteten auf <strong>de</strong>n Warenverkehr mit <strong>de</strong>n<br />
östlichen Stadtbezirken und <strong>de</strong>m Umland.<br />
Die Regierung <strong>de</strong>r Vereinigten Staaten reagierte, in<strong>de</strong>m sie die Luftbrücke einrichtete, bei <strong>de</strong>r Nahrung, Heizstoffe und an<strong>de</strong>re Versorgungsgüter in die Stadt eingeflogen wur<strong>de</strong>n. Die<br />
Luftbrücke blieb bis September 1949 bestehen, obwohl die Blocka<strong>de</strong> am 12. Mai 1949 aufgehoben wur<strong>de</strong>. Als Teil <strong>de</strong>s Projektes erweiterten Ingenieure <strong>de</strong>r US-Armee <strong>de</strong>n Flughafen<br />
Tempelhof. Da die Piloten gelegentlich Süßigkeiten für Kin<strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>r Landung aus <strong>de</strong>m Fenster warfen, wur<strong>de</strong>n die Flugzeuge von <strong>de</strong>n Berlinern Rosinenbomber genannt. Pakete mit<br />
Süßigkeiten wur<strong>de</strong>n auch über Ost-Berlin abgeworfen.<br />
Das Ziel <strong>de</strong>r Sowjetunion, West-Berlin wirtschaftlich mit seinem Umland <strong>zu</strong> verzahnen und eine dauerhafte wirtschaftliche Loslösung <strong>zu</strong> verhin<strong>de</strong>rn, misslang gründlich. Mehr noch:<br />
Die West-Berliner Bevölkerung fühlte sich nach <strong>de</strong>r Blocka<strong>de</strong> politisch und wirtschaftlich noch stärker <strong>zu</strong> West<strong>de</strong>utschland <strong>zu</strong>gehörig, als jemals <strong>zu</strong>vor. Nach <strong>de</strong>r wirtschaftlichen<br />
Teilung war die politische Teilung somit nicht mehr auf<strong>zu</strong>halten.<br />
Berlin und die bei<strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Staate
Als am 23. Mai 1949 die Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland in <strong>de</strong>n drei westlichen Besat<strong>zu</strong>ngszonen gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>, listete Artikel 23 <strong>de</strong>s Grundgesetzes auch Groß-Berlin als Bun<strong>de</strong>sland<br />
mit auf. Ähnlich verhielt es sich mit <strong>de</strong>r am 7. Oktober 1949 gegrün<strong>de</strong>ten DDR. Die damalige Fassung <strong>de</strong>r Verfassung <strong>de</strong>r DDR beschreibt Deutschland als „unteilbare Republik“ in <strong>de</strong>r<br />
es nur eine <strong>de</strong>utsche Staatsangehörigkeit gäbe und <strong>de</strong>ren Hauptstadt Berlin sei. Gemeint war zweifellos das gesamte Groß-Berlin, das nach DDR-Sichtweise auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r<br />
sowjetischen Besat<strong>zu</strong>ngszone lag und <strong>de</strong>ren westliche Sektoren nur von <strong>de</strong>n Westalliierten verwaltet wur<strong>de</strong>n. Somit beanspruchten bei<strong>de</strong> neu gegrün<strong>de</strong>ten Staaten Groß-Berlin komplett,<br />
ohne jedoch vor <strong>de</strong>m 3. Oktober 1990 jemals vollständige Verfügungsgewalt gehabt <strong>zu</strong> haben.<br />
1950 trat in West-Berlin einseitig die Verfassung von Berlin in Kraft. Gemäß Artikel 2, Absatz 1 <strong>de</strong>r Verfassung von Berlin war Berlin auch vor 1990 ein Land <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik<br />
Deutschland – also <strong>de</strong>m <strong>zu</strong> diesem Zeitpunkt als West<strong>de</strong>utschland politisch bezeichneten Teil Deutschlands – dieser Artikel konnte jedoch keine Wirkung entfalten, da er von <strong>de</strong>n in<br />
Berlin maßgeblichen Alliierten <strong>zu</strong>rückgestellt war. Am 3. Dezember 1950 folgte die erste Wahl <strong>zu</strong>m Abgeordnetenhaus von Berlin, das seinerseits <strong>de</strong>n Senat von Berlin wählte.<br />
Der Aufstand vom 17. Juni in <strong>de</strong>r DDR<br />
Am 17. Juni 1953 begann eine Demonstration von anfänglich 60 Bauarbeitern, die später als Volksaufstand bekannt wur<strong>de</strong>. Am Beginn war es nur Protest über eine kürzlich von <strong>de</strong>r<br />
DDR-Regierung beschlossene Arbeitsnormerhöhung. Ihren Ausgang nahm die Demonstration an <strong>de</strong>r im Bau befindlichen Stalinallee (heute Karl-Marx-Allee). Als insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>r<br />
RIAS von <strong>de</strong>r Demonstration berichtete, solidarisierten sich viele Ost-Berliner mit <strong>de</strong>m Protest<strong>zu</strong>g und reihten sich ein. Unterstüt<strong>zu</strong>ng erhielten die Ost-Berliner, die <strong>zu</strong>m Potsdamer<br />
Platz zogen, auch von Berlinern aus <strong>de</strong>n Westbezirken. Auch in einigen Provinzen <strong>de</strong>r DDR kam es infolge <strong>de</strong>r Aufstän<strong>de</strong> in Ost-Berlin <strong>zu</strong> Arbeitsnie<strong>de</strong>rlegungen und Demonstrationen.<br />
Als <strong>de</strong>r Aufstand außer Kontrolle <strong>zu</strong> geraten drohte, rief die Regierung <strong>de</strong>r DDR sowjetische Truppen <strong>zu</strong> Hilfe. In <strong>de</strong>r Folge kam es <strong>zu</strong> Straßenkämpfen, bei <strong>de</strong>nen auf kaum bewaffnete<br />
Arbeiter scharf geschossen wur<strong>de</strong>. Während <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rschlagung <strong>de</strong>s Aufstan<strong>de</strong>s wur<strong>de</strong>n min<strong>de</strong>stens 153 Personen getötet. Die Beteiligung von West-Berliner Arbeitern, die<br />
Berichterstattung <strong>de</strong>s RIAS, Angriffe auf Volkspolizisten und das Nie<strong>de</strong>rbrennen <strong>de</strong>s Columbushauses nutzte die DDR-Regierung, um diesen Aufstand als konterrevolutionär und von<br />
West-Berlin gesteuert <strong>zu</strong> bezeichnen. Die unbeliebten Normerhöhungen wur<strong>de</strong>n aber <strong>de</strong>nnoch <strong>zu</strong>rückgenommen und Kampfgruppen aus politisch beson<strong>de</strong>rs linientreuen Bürgern<br />
gegrün<strong>de</strong>t, um <strong>zu</strong>künftige Aufstän<strong>de</strong> ohne sowjetische Soldaten nie<strong>de</strong>rschlagen <strong>zu</strong> können.<br />
Mauerbau<br />
Am 13. August 1961 begann die ost<strong>de</strong>utsche Regierung mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r Berliner Mauer, die die Trennung Berlins endgültig festigte. Der Plan <strong>zu</strong>m Bau <strong>de</strong>r Mauer in Berlin war ein<br />
Staatsgeheimnis <strong>de</strong>r DDR-Regierung. Die Mauer sollte die Immigration <strong>de</strong>r ost<strong>de</strong>utschen Bevölkerung in <strong>de</strong>n Westen verhin<strong>de</strong>rn, da die DDR wirtschaftlich und personell aus<strong>zu</strong>bluten<br />
drohte (sogenannte „Abstimmung mit <strong>de</strong>n Füßen“).<br />
Als die ersten Steinblöcke in <strong>de</strong>n frühen Morgenstun<strong>de</strong>n am Potsdamer Platz gelegt wur<strong>de</strong>n, stan<strong>de</strong>n amerikanische Truppen mit scharfer Munition bereit, schauten <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>r Mauer<br />
jedoch nur <strong>zu</strong>. Zwar wur<strong>de</strong>n die Westalliierten durch Gewährsleute über die Planung „drastischer Maßnahmen“ <strong>zu</strong>r Abriegelung von West-Berlin informiert, vom konkreten Zeitpunkt<br />
und Ausmaß <strong>de</strong>r Absperrung gaben sie sich öffentlich überrascht. Da ihre Zugangsrechte nach West-Berlin nicht beschnitten wur<strong>de</strong>n, griffen sie nicht militärisch ein.<br />
1963 besuchte US-Präsi<strong>de</strong>nt Kennedy Berlin. Vor <strong>de</strong>m Rathaus Schöneberg hielt er eine Re<strong>de</strong> über die Mauer, in <strong>de</strong>r er die historischen Worte sprach: „Ich bin ein Berliner“. Dies<br />
be<strong>de</strong>utete <strong>de</strong>n Berlinern in <strong>de</strong>r <strong>de</strong>mokratischen Insel inmitten <strong>de</strong>r DDR viel, war jedoch in Anbetracht <strong>de</strong>r amerikanischen Akzeptanz beim Bau <strong>de</strong>r Mauer teilweise Symbolik. Für die<br />
Westalliierten und die DDR be<strong>de</strong>utete <strong>de</strong>r Mauerbau eine politische und militärische Stabilisierung, <strong>de</strong>r Status quo von West-Berlin wur<strong>de</strong> im wahrsten Sinne <strong>de</strong>s Wortes zementiert - die<br />
Sowjetunion gab ihre im Chruschtschow-Ultimatum noch 1958 formulierte For<strong>de</strong>rung nach einer entmilitarisierten, „freien“ Stadt West-Berlin auf.<br />
1971 sicherte das Viermächteabkommen über Berlin die Erreichbarkeit West-Berlins und been<strong>de</strong>te die wirtschaftliche Bedrohung durch Schließung <strong>de</strong>r Zufahrtsrouten. Ferner<br />
bekräftigten alle vier Mächte die gemeinsame Verantwortung für ganz Berlin und stellten klar, dass West-Berlin kein Bestandteil <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik sei und nicht von ihr regiert wer<strong>de</strong>n<br />
dürfe. Während die Sowjetunion <strong>de</strong>n Vier-Mächte-Status jedoch nur auf West-Berlin bezog, unterstrichen die Westalliierten 1975 in einer Note an die Vereinten Nationen ihre Auffassung<br />
vom Viermächte-Status über Gesamt-Berlin.<br />
Stadtentwicklung und Berlinpolitik
Der Westteil <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik massiv subventioniert, auch um mit <strong>de</strong>m „Schaufenster <strong>de</strong>s Westens“ propagandistische Wirkung in <strong>de</strong>r DDR <strong>zu</strong> entfalten.<br />
Unternehmen erhielten massive Investitions<strong>zu</strong>schüsse. Die so genannte „Zitterprämie“, ein sechsprozentiger Lohnaufschlag, sollte <strong>de</strong>n fortgesetzten Arbeitskräftemangel lin<strong>de</strong>rn. Auch<br />
in Ost-Berlin wur<strong>de</strong>n rund 50 % <strong>de</strong>s städtischen Haushalts aus <strong>de</strong>r Staatskasse <strong>de</strong>r DDR finanziert.<br />
Der Kurfürstendamm im Westen und <strong>de</strong>r Alexan<strong>de</strong>rplatz im Osten wur<strong>de</strong>n jeweils als neue repräsentative Zentren ausgebaut. Mit <strong>de</strong>r Freien Universität Berlin wur<strong>de</strong> im Westteil 1948<br />
eine eigene Universität gegrün<strong>de</strong>t. Weitere be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Bauprojekte im Westen waren unter an<strong>de</strong>rem die Kongresshalle, die anlässlich <strong>de</strong>r Internationalen Bauausstellung Interbau 1957<br />
entstan<strong>de</strong>ne Mustersiedlung Südliches Hansaviertel, das nach seinem Architekten benannte Corbusierhaus, die Stadtautobahn, die Berliner Philharmonie, die von Ludwig Mies van <strong>de</strong>r<br />
Rohe stammen<strong>de</strong> Neue Nationalgalerie, das Europa-Center-Berlin, das Internationale Congress Centrum (ICC), das neue Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Deutschen Oper o<strong>de</strong>r die Staatsbibliothek<br />
Preußischer Kulturbesitz (heute Staatsbibliothek <strong>zu</strong> Berlin, Haus Potsdamer Straße) nach Plänen <strong>de</strong>s Architekten Hans Scharoun. Parallel da<strong>zu</strong> sind historische Gebäu<strong>de</strong> aufwendig<br />
restauriert wor<strong>de</strong>n, so z. B. <strong>de</strong>r Martin-Gropius-Bau o<strong>de</strong>r anlässlich <strong>de</strong>r 750-Jahr-Feier 1987 <strong>de</strong>r Hamburger Bahnhof. Den Wohnungsbau kennzeichneten seit <strong>de</strong>n 1960er-Jahren mehrere<br />
Großwohnraumsiedlungen wie die Gropiusstadt in Neukölln, das Märkische Viertel in Reinickendorf o<strong>de</strong>r das Falkenhagener Feld in Spandau.<br />
Im Osten begann in <strong>de</strong>n 1970er-Jahren ein groß angelegtes Wohnungsbauprogramm, in <strong>de</strong>m ganze Stadtteile neu angelegt wur<strong>de</strong>n, nach<strong>de</strong>m schon in <strong>de</strong>n 1960er-Jahren insbeson<strong>de</strong>re am<br />
Alexan<strong>de</strong>rplatz repräsentative Neubauten errichtet wor<strong>de</strong>n waren (Kongresshalle, Haus <strong>de</strong>s Lehrers) einschließlich <strong>de</strong>s Fernsehturms. 1984 wur<strong>de</strong> Schinkels Schauspielhaus als<br />
Konzerthaus Berlin völlig renoviert wie<strong>de</strong>r eröffnet.<br />
Die „68er“ im Westteil<br />
Ab 1968 wur<strong>de</strong> West-Berlin Zentrum <strong>de</strong>r Stu<strong>de</strong>ntenrevolten, die von <strong>de</strong>r Freien Universität ausging, und die ihr Zentrum im Stadtteil Charlottenburg hatte. Ein weiterer Brennpunkt war<br />
die Zentrale <strong>de</strong>r Springer-Verlage in <strong>de</strong>r Kreuzberger Kochstraße. Es ging hier um einen gesellschaftlichen Konflikt, <strong>de</strong>r die Bevölkerung spaltete. Stu<strong>de</strong>nten und Polizei stan<strong>de</strong>n sich oft<br />
gewalttätig gegenüber.<br />
Ein Moment, <strong>de</strong>r die Stu<strong>de</strong>ntenbewegung aufrüttelte und aktivierte war <strong>de</strong>r 2. Juni 1967, als <strong>de</strong>r pazifistische Stu<strong>de</strong>nt Benno Ohnesorg in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r Deutschen Oper bei einer<br />
Demonstration gegen <strong>de</strong>n Besuch <strong>de</strong>s Schahs von Iran von <strong>de</strong>m Polizisten Karl-Heinz Kurras erschossen wur<strong>de</strong>.<br />
Terroranschläge im Westteil<br />
Ab Anfang <strong>de</strong>r 1970er-Jahre entwickelte sich in West-Berlin eine Terroristenszene. Neben Personen aus <strong>de</strong>r Rote Armee Fraktion war in West-Berlin auch die Bewegung 2. Juni aktiv,<br />
die sich nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong>sdatum von Benno Ohnesorg benannt hatte. Am 10. November 1974 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kammergerichtspräsi<strong>de</strong>nt Günter von Drenkmann ermor<strong>de</strong>t und 1975 dann <strong>de</strong>r<br />
Vorsitzen<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Berliner CDU, Peter Lorenz, von Terroristen entführt.<br />
Hausbesetzerszene<br />
Als Reaktion auf <strong>de</strong>n Wohnungsmangel bei gleichzeitigem spekulationsbedingtem Leerstand entwickelte sich im östlichen Teil Kreuzbergs, <strong>de</strong>m alten Postbezirk SO 36, En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
1970er-Jahre eine vergleichsweise große und aktive Hausbesetzerbewegung. Im Juli 1981 erreichte die Anzahl <strong>de</strong>r besetzen Häuser in Berlin mit 165 ihren Höhepunkt. Von diesen<br />
Beset<strong>zu</strong>ngen wur<strong>de</strong>n 78 bis <strong>zu</strong>m November 1984 durch <strong>de</strong>n Abschluss von Miet-, Kauf- o<strong>de</strong>r Pachtverträgen legalisiert, die Restlichen wur<strong>de</strong>n geräumt.[7] Bereits im Dezember 1980<br />
war es in Folge einer versuchten Beset<strong>zu</strong>ng <strong>zu</strong> schweren Zusammenstößen zwischen Hausbesetzern und <strong>de</strong>r Polizei gekommen. (siehe: Schlacht am Fraenkelufer) Bei einer<br />
Demonstration gegen die Räumung von acht besetzten Häusern starb in <strong>de</strong>r Potsdamer Straße <strong>de</strong>r Demonstrant und Hausbesetzer Klaus-Jürgen Rattay, <strong>de</strong>r in Folge eines Polizeieinsatzes<br />
unter einen Bus <strong>de</strong>r BVG geraten war.<br />
Eine neue Hausbesetzerbewegung entwickelte sich erst wie<strong>de</strong>r im Rahmen <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> 1989 in <strong>de</strong>n Ost-Berliner Stadtteilen Friedrichshain und Prenzlauer Berg. Diese war insbeson<strong>de</strong>re<br />
durch das passive Verhalten <strong>de</strong>r Ost-Berliner Volkspolizei begünstigt. Dies än<strong>de</strong>rte sich allerdings nach<strong>de</strong>m im Juli 1990 <strong>de</strong>r Ost-Berliner Magistrat unter <strong>de</strong>n Einfluss <strong>de</strong>s Senats von<br />
West-Berlin geraten war. In <strong>de</strong>r Folge kam es <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n schweren Straßenschlachten bei <strong>de</strong>r Räumung <strong>de</strong>r Mainzer Straße. Viele <strong>de</strong>r Beset<strong>zu</strong>ngen wur<strong>de</strong>n ähnlich wie bei <strong>de</strong>r ersten<br />
Beset<strong>zu</strong>ngswelle legalisiert. Die letzten besetzen Häuser, die im Rahmen <strong>de</strong>r Berliner Linie toleriert wor<strong>de</strong>n waren, ließ <strong>de</strong>r Berliner Innensenator Jörg Schönbohm zwischen 1996 und
1998 räumen.<br />
750-Jahr-Feier<br />
Zwischen 1982 und 1986 wur<strong>de</strong>n in Vorbereitung auf die umfangreichen 750-Jahr-Feiern von 1987 in bei<strong>de</strong>n Teilen <strong>de</strong>r Stadt zahlreiche Verschönerungen vorgenommen. Beispielsweise<br />
wur<strong>de</strong>n in West-Berlin <strong>de</strong>r Breitscheidplatz und <strong>de</strong>r Rathenauplatz neu gestaltet. Im Ostteil wur<strong>de</strong> das Nikolaiviertel mit historischen Versatzstücken als „neue“ Altstadt gebaut. In Ost<br />
und West wur<strong>de</strong>n auch die S- und U-Bahnhöfe im Innenstadtbereich saniert.<br />
Die Jubiläumsfeier wur<strong>de</strong> auch durch Briefmarkenausgaben im Westteil (Deutsche Bun<strong>de</strong>spost Berlin) und im Osten (Deutsche Post) gewürdigt. Im Westen erschien ein Block mit vier<br />
Marken sowie eine Einzelmarke. Im Osten acht Einzelmarken mit vier Motiven, sowie ein Block mit einer Marke.<br />
Öffnung <strong>de</strong>r Mauer<br />
Bei <strong>de</strong>n Feierlichkeiten <strong>zu</strong>m vierzigsten Jahrestag <strong>de</strong>r DDR in Ost-Berlin im Oktober 1989 hielt Ehrengast Michail Gorbatschow eine Re<strong>de</strong>, in <strong>de</strong>r er an<strong>de</strong>utete, dass er eine restriktive<br />
Politik <strong>de</strong>r DDR-Regierung in Be<strong>zu</strong>g auf die Flüchtlinge, die <strong>zu</strong> diesem Zeitpunkt über die Grenzen von Ungarn und <strong>de</strong>r Tschechoslowakei flüchteten, nicht <strong>zu</strong>lassen wür<strong>de</strong>. Am 9.<br />
November ließen die Grenztruppen am Übergang Bornholmer Straße nach einer missverstan<strong>de</strong>nen Äußerung <strong>de</strong>s Politbüromitglie<strong>de</strong>s Günter Schabowski auf einer Pressekonferenz die<br />
dort warten<strong>de</strong> Menge passieren. Die Grenztruppen nahmen an, dass das Politbüro eine Grenzöffnung beschlossen hatte, obwohl eigentlich keine feste Entscheidung getroffen wor<strong>de</strong>n<br />
war. Die DDR-Führung war nach <strong>de</strong>m Rücktritt <strong>de</strong>s Parteichefs Erich Honecker im Oktober durcheinan<strong>de</strong>r geraten.<br />
Viele Berliner erklommen die Mauer und tanzten auf <strong>de</strong>r Mauer am Bran<strong>de</strong>nburger Tor. Diesmal rollten keine sowjetischen Panzer durch Berlin. Die Mauer wur<strong>de</strong> nicht mehr<br />
geschlossen und wur<strong>de</strong> bald darauf abgerissen, wobei viele Berliner als sogenannte „Mauerspechte“ mit Hammer und Meißel Teile <strong>de</strong>r Mauer als Souvenirs abschlugen.<br />
Der Ost-Berliner Oberbürgermeister Tino Schwierzina und <strong>de</strong>r West-Berliner Regieren<strong>de</strong> Bürgermeister Walter Momper arbeiteten fortan in enger Absprache, um die große Menge an<br />
Aufgaben, die die bevorstehen<strong>de</strong> Wie<strong>de</strong>rvereinigung <strong>de</strong>r Stadthälften aufwarf, in Angriff <strong>zu</strong> nehmen. Das Bürgermeistergespann wur<strong>de</strong> scherzhaft in <strong>de</strong>n Medien als „Schwierzomper“<br />
o<strong>de</strong>r „Mompzina“ verballhornt, die bei<strong>de</strong>n Stadtregierungen Senat (West) und Magistrat (Ost) wur<strong>de</strong>n von Walter Momper bald als "Magi-Senat" tituliert.<br />
Jüngere Stadtgeschichte<br />
Laut Einigungsvertrag wur<strong>de</strong> Berlin mit <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvereinigung am 3. Oktober 1990 <strong>zu</strong>r Hauptstadt Deutschlands. Mit <strong>de</strong>r Zustimmung <strong>zu</strong>m Einigungsvertrag verzichteten die Alliierten<br />
auf ihre Kontrolle über Berlin, wodurch <strong>de</strong>r umstrittene rechtliche Status Berlins geklärt und damit die sogenannte Berlin-Frage gelöst war. Am 2. Dezember 1990 fan<strong>de</strong>n die ersten<br />
Wahlen <strong>zu</strong>m Abgeordnetenhaus <strong>de</strong>s wie<strong>de</strong>rvereinigten Berlins statt. Der Sitz von Bun<strong>de</strong>stag und Bun<strong>de</strong>sregierung war allerdings immer noch Bonn. Erst nach einer kontroversen – auch<br />
von <strong>de</strong>r Öffentlichkeit geführten – Debatte beschloss <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>stag am 20. Juni 1991, dass die Hauptstadt Berlin auch Parlaments- und Regierungssitz wur<strong>de</strong> (Hauptstadtbeschluss).<br />
Als erstes Verfassungsorgan <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland verlegte <strong>zu</strong>m 1. Januar 1994 <strong>de</strong>r damalige Bun<strong>de</strong>spräsi<strong>de</strong>nt Richard von Weizsäcker seinen Dienstsitz nach Berlin.<br />
1996 scheiterte eine Volksabstimmung <strong>zu</strong>r Zusammenlegung <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>slän<strong>de</strong>r Berlin und Bran<strong>de</strong>nburg am Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r Bran<strong>de</strong>nburger Wähler.<br />
Am 7. September 1999 nahm <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>stag und am 29. September 2000 <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srat seine Arbeit in Berlin auf.<br />
Seit <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvereinigung bereiten <strong>de</strong>r Wegfall <strong>de</strong>r meisten staatlichen Subventionen und seit 1997 <strong>zu</strong>sätzlich <strong>de</strong>r Berliner Bankenskandal <strong>de</strong>r Stadt und <strong>de</strong>m Land Berlin enorme<br />
finanzielle und fiskalische Probleme, die die Handlungsfähigkeit <strong>de</strong>r Stadtverwaltung einschränken. Berlin klagt <strong>de</strong>rzeit beim Bun<strong>de</strong>sverfassungsgericht wegen einer „extremen<br />
Haushaltsnotlage“, um eine Bun<strong>de</strong>sergän<strong>zu</strong>ngs<strong>zu</strong>weisung von 35 Milliar<strong>de</strong>n Euro <strong>zu</strong>m Schul<strong>de</strong>nabbau <strong>zu</strong> erhalten. Dies führte 2001 <strong>zu</strong> einem erfolgreichen Misstrauensvotum gegen <strong>de</strong>n<br />
Regieren<strong>de</strong>n Bürgermeister Eberhard Diepgen. Nachfolger wur<strong>de</strong> Klaus Wowereit mit einem Senat aus SPD und <strong>de</strong>n Grünen und <strong>de</strong>r Tolerierung durch die PDS. Nach einer Neuwahl<br />
<strong>de</strong>s Abgeordnetenhauses am 21. Oktober 2001 wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m Scheitern <strong>de</strong>r Verhandlungen für eine Ampelkoalition ein Senat mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng einer Rot-Roten Koalition gebil<strong>de</strong>t.<br />
Literatur
• Bernd Stöver: Geschichte Berlins. München: C.H. Beck Wissen 2010, ISBN 9783406600678.<br />
• Michael Schwibbe, Huth P. et al: ZEIT REISE – 1200 Jahre Leben in Berlin. Berlin: Zeitreise Verlagsgesellschaft 2008, ISBN 978-3-00-024613-5<br />
• Christoph Wunnicke: Wan<strong>de</strong>l, Stagnation, Aufbruch. Ost-Berlin im Jahr 1988, Berlin 2008, ISBN 978-3-934085-27-5<br />
• Gerd Heinrich: Kulturatlas Berlin – Ein Stadtschicksal in Karten und Texten, Berlin 2007, ISBN 978-3-000-21714-2<br />
• Angela M. Arnold, Gabriele von Griesheim: Trümmer, Bahnen und Bezirke. Ausführliche Darstellung <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Zerstörungen Berlins nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg, auch<br />
bezirksbezogen und <strong>de</strong>r Berlin-Blocka<strong>de</strong>. Eigenverlag 2002, ISBN 3-00-009839-9<br />
• Wolfgang Ribbe (Hrsg.): Geschichte Berlins (Veröffentlichungen <strong>de</strong>r Historischen Kommission <strong>zu</strong> Berlin), 2 B<strong>de</strong>., München 1987, 3. erweiterte und aktualisierte Auflage, Berlin<br />
2002; Standardwerk anlässlich <strong>de</strong>s 750-Jahre-Jubiläums<br />
• Wolfgang Fritze: Gründungsstadt Berlin. Die Anfänge von Berlin-Cölln als Forschungsproblem. Bearb, hrsg. von Winfried Schich, Berlin 2000.<br />
• Ingo Materna und Wolfgang Ribbe: Geschichte in Daten. Berlin München 1997<br />
• Autorenkollektiv: Chronik Berlin. Chronik Verlag, Gütersloh München 1997, ISBN 3-577-14444-0<br />
• Ernst Engelberg: Das Wilhelminische Berlin, Berlin 1997, Einleitung <strong>zu</strong>m gleichnamigen Buch, hrsg. von Ruth Glatzer<br />
• Adriaan von Müller: Unter <strong>de</strong>m Pflaster Berlins, Ein archäologischer Streif<strong>zu</strong>g. Argon Verlag 1995<br />
• Geschichte <strong>de</strong>r Berliner Verwaltungsbezirke, hrsg. von Wolfgang Ribbe, Bd. 1ff., 1987ff.<br />
• Adriaan von Müller: Die Archäologie Berlins. Gustav Lübbe Verlag, 1986<br />
• Felix Escher: Berlin und sein Umland. Zur Genese <strong>de</strong>r Berliner Stadtlandschaft bis <strong>zu</strong>m Beginn <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Einzelveröffentlichungen <strong>de</strong>r Historischen Kommission <strong>zu</strong><br />
Berlin, Bd. 47, Berlin 1985<br />
• Harald Brost, Laurenz Demps: Berlin wird Weltstadt. Edition Leipzig, 1981<br />
• Adriaan von Müller: Jahrtausen<strong>de</strong> unter <strong>de</strong>m Pflaster von Berlin. Edition Praeger, 1973<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Der heutige südliche Berliner Ortsteil Zehlendorf, ferner das seinerzeit von Zehlendorf getrennte slawische Slatdorp mit <strong>de</strong>m Slatsee (Schlachtensee) gehörten vorübergehend<br />
<strong>zu</strong>m Klosterbesitz Lehnin.<br />
2. ↑ Michael Hofmann/Frank Römer(Hrsg.): Vom Stabbohlenhaus <strong>zu</strong>m Haus <strong>de</strong>r Wirtschaft. Ausgrabungen in Alt-Cölln, Breite Str. 21–29 (= Beiträge <strong>zu</strong>r Denkmalpflege in<br />
Berlin, H. 14), Berlin 1999.<br />
3. ↑ „Deutschland: Berlin älter als bisher angenommen“ bei Wikinews<br />
4. ↑ Zu 1997: Dressler, Torsten: Grabungen am Schlossplatz. In: Archäologie in Berlin und Bran<strong>de</strong>nburg 1997, Stuttgart 1998, S. 82–85, <strong>zu</strong> 2008 ist in Vorbereitung <strong>de</strong>r<br />
Grabungsbericht von Michael Malliaris in: Archäologie in Berlin und Bran<strong>de</strong>nburg 2008.<br />
5. ↑ Ulrich Waack: Die frühen Herrschaftsverhältnisse im Berliner Raum. Eine neue Zwischenbilanz <strong>de</strong>r Diskussion um die „Mag<strong>de</strong>burg-Hypothese“. In: Jahrbuch für<br />
bran<strong>de</strong>nburgische Lan<strong>de</strong>sgeschichte 54 (2005) S. 7–38.<br />
6. ↑ Teil <strong>de</strong>r Schriftenreihe <strong>de</strong>r Forschungsgruppe „Metropolenforschung“, Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung<br />
7. ↑ Volker Rekittke & Klaus Martin Becker: Politische Aktionen gegen Wohnungsnot und Umstrukturierung und die HausbesetzerInnenbewegung in Düsseldorf von 1972 bis<br />
heute. 1.4.1 Häuserkämpfe in Berlin 1979–81, 17. November 1995<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Flan<strong>de</strong>rn<br />
Flan<strong>de</strong>rn (ndl.: Vlaan<strong>de</strong>ren, frz.: la Flandre o<strong>de</strong>r les Flandres) o<strong>de</strong>r die Flämische Region (ndl.: „Vlaams Gewest”, frz.: Région flaman<strong>de</strong>) bezeichnet <strong>de</strong>n nördlichen Teil Belgiens mit<br />
seinen nie<strong>de</strong>rländischsprachigen Flamen. Die flämische Region in Belgien hat eine Fläche von etwa 13.522 km² und zählt etwa 6 Mio. Einwohner. Die Institutionen <strong>de</strong>r Flämischen<br />
Region wur<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Flämischen Gemeinschaft <strong>zu</strong>sammengelegt und haben ihren Sitz in <strong>de</strong>r Hauptstadt Brüssel, die <strong>zu</strong>m Zuständigkeitsbereich <strong>de</strong>r belgischen (nie<strong>de</strong>rländischfranzösischen)<br />
Gemeinschaft gehört. Die Flämische Region besteht aus <strong>de</strong>n Provinzen Antwerpen, Ostflan<strong>de</strong>rn, Flämisch-Brabant, Limburg und Westflan<strong>de</strong>rn.<br />
Bevölkerung<br />
Amtssprache in Flan<strong>de</strong>rn und allgemein gebräuchliche Schriftsprache ist die nie<strong>de</strong>rländische Standardsprache. Gesprochen wer<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m großen Teil nie<strong>de</strong>rländische Dialekte, die sich in<br />
Ostflämisch, Westflämisch, Brabantisch und Limburgisch unterteilen lassen, und an<strong>de</strong>re flämische Sprachvarianten.<br />
Vor allem in <strong>de</strong>n flämischen Gemein<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Umgebung von Brüssel gibt es viele Bewohner mit Französisch als Muttersprache, <strong>de</strong>nen in einem Teil dieser Gemein<strong>de</strong>n das gesetzliche<br />
Recht <strong>zu</strong>m Gebrauch ihrer Muttersprache im Umgang auch mit <strong>de</strong>n flämischen Behör<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>gestan<strong>de</strong>n wird.<br />
Städte<br />
Wichtige flämische Städte sind Antwerpen, Brügge, Gent, Löwen, Mecheln, Kortrijk und Osten<strong>de</strong>.<br />
Geschichte<br />
Die heutige belgische Region Flan<strong>de</strong>rn umfasst Teile <strong>de</strong>r historischen Territorien Grafschaft Flan<strong>de</strong>rn, Herzogtum Brabant und Herzogtum Limburg.<br />
Die Grafschaft Flan<strong>de</strong>rn reichte im Mittelalter bis weit in das heutige Frankreich hinein (Duinkerke / Dunkerque / Dünkirchen; Rijsel / Lille). Die Region um Dünkirchen gehört zwar<br />
<strong>zu</strong>m traditionellen nie<strong>de</strong>rländischen Sprachgebiet, jedoch wur<strong>de</strong> seit <strong>de</strong>r Französischen Revolution Französisch als einzige Amts- und Schulsprache <strong>de</strong>n Bewohnern verordnet, so dass<br />
die nie<strong>de</strong>rländische Muttersprache in einem andauern<strong>de</strong>n Sprachprozess <strong>zu</strong>nehmend verdrängt wur<strong>de</strong>. An<strong>de</strong>re Gebiete <strong>de</strong>s heutigen Französisch-Flan<strong>de</strong>rns sind hingegen von alters her<br />
von einer französischsprachigen Bevölkerung (Waals-Vlaan<strong>de</strong>ren) bewohnt.<br />
Nach <strong>de</strong>m Tod <strong>de</strong>s letzten burgundischen Herrschers Karl <strong>de</strong>r Kühne in <strong>de</strong>r Schlacht bei Nancy 1477 wur<strong>de</strong>n seine Besit<strong>zu</strong>ngen zwischen <strong>de</strong>m habsburgischen Erzherzog Maximilian<br />
von Österreich, <strong>de</strong>m späteren Kaiser Maximilian I. und König Ludwig XI. von Frankreich aufgeteilt. Flan<strong>de</strong>rn kam dabei unter die Herrschaft <strong>de</strong>r Habsburger und wur<strong>de</strong> Teil <strong>de</strong>s<br />
Heiligen Römischen Reichs. Nach <strong>de</strong>m Tod Karls V. wur<strong>de</strong>n die gesamten ehemaligen burgundischen Besit<strong>zu</strong>ngen einschließlich Flan<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n spanischen Habsburgern <strong>zu</strong>gesprochen.<br />
Diese versuchten mit Gewalt, <strong>de</strong>n sich ausbreiten<strong>de</strong>n Protestantismus <strong>zu</strong> unterdrücken. Deswegen, und auch wegen <strong>de</strong>r Einschränkung <strong>de</strong>r alten Freiheiten kam es <strong>zu</strong>m Aufstand <strong>de</strong>r<br />
nie<strong>de</strong>rländischen Provinzen gegen Spanien. Die Provinzen <strong>de</strong>r Utrechter Union sagten sich 1579 von Spanien los und konnten ihre Unabhängigkeit im sogenannten Achtzigjährigen<br />
Krieg erkämpfen. Im Westfälischen Frie<strong>de</strong>n 1648 wur<strong>de</strong> die Unabhängigkeit <strong>de</strong>r (nördlichen) Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> international bestätigt, während Flan<strong>de</strong>rn mit <strong>de</strong>n südlichen Provinzen unter<br />
spanischer Herrschaft verblieb. In <strong>de</strong>n Kriegen mit Ludwig XIV. von Frankreich musste Spanien südliche Teile seiner Besit<strong>zu</strong>ngen an Frankreich abtreten (u. a. das Artois) und es bil<strong>de</strong>te<br />
sich in etwa <strong>de</strong>r heutige Grenzverlauf zwischen Belgien und Frankreich heraus. Nach <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>r spanischen Habsburger und <strong>de</strong>m Spanischen Erbfolgekrieg kam Flan<strong>de</strong>rn mit<br />
<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren ehemals spanischen Provinzen im Frie<strong>de</strong>n von Utrecht 1713 unter österreichisch-habsburgische Herrschaft und verblieb dort, bis es im Rahmen <strong>de</strong>r Französischen<br />
Revolutionskriege 1794 von Frankreich erobert wur<strong>de</strong>. Auf <strong>de</strong>m Wiener Kongress 1815 wur<strong>de</strong> das Vereinigte Königreich <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> geschaffen, das das heutige Belgien und die<br />
Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> umfasste. In <strong>de</strong>r Belgischen Revolution von 1830 spaltete sich <strong>de</strong>r Südteil jedoch ab und das Königreich Belgien wur<strong>de</strong> gegrün<strong>de</strong>t. Seit<strong>de</strong>m teilt Flan<strong>de</strong>rn die Geschichte<br />
Belgiens.
Im Ersten Weltkrieg verlief die <strong>de</strong>utsch-französisch/britische Front vier Jahre lang quer durch Flan<strong>de</strong>rn. Es war Schauplatz großer Schlachten (Erste, Zweite und Dritte<br />
Flan<strong>de</strong>rnschlacht). Der Stellungskrieg <strong>de</strong>r Armeen im eigentlich neutralen Belgien zerstörte viele Dörfer und Städte dieser Region. Die Namen einiger kleiner flandrischer Ortschaften<br />
rufen noch Erinnerungen an das große Sterben hervor: Ypern, Passendale, Langemark. In zahlreichen Orten erinnern Denkmale und Soldatenfriedhöfe an <strong>de</strong>n Schrecken.<br />
Seit <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg entwickelte sich in Flan<strong>de</strong>rn eine <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Wirtschaftskraft und auch ein Selbstbewusstsein gegenüber <strong>de</strong>m früher dominieren<strong>de</strong>n wallonischen<br />
Lan<strong>de</strong>steil. Teilweise äußert sich dies in Sezessionsbestrebungen, die politisch durch die Partei Vlaams Belang artikuliert wer<strong>de</strong>n.<br />
Religion<br />
Während Flan<strong>de</strong>rn von 1482 bis <strong>zu</strong>m ersten Koalitionskrieg 1794 praktisch unter dauerhafter habsburgischer und damit katholischer Vorherrschaft stand, sagten sich die nördlicher<br />
gelegenen und <strong>zu</strong>m Protestantismus sich bekennen<strong>de</strong>n nie<strong>de</strong>rländischen Provinzen von Habsburg los und grün<strong>de</strong>ten 1581 die Republik <strong>de</strong>r Sieben Vereinigten Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>, einen<br />
Vorläufer <strong>de</strong>s heutigen nie<strong>de</strong>rländischen Staates. Bis heute sind Flamen überwiegend katholisch, die Nie<strong>de</strong>rlän<strong>de</strong>r hingegen überwiegend protestantisch, so dass zwischen <strong>de</strong>n<br />
Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>m nördlichen Teil Belgiens zwar keine Sprachgrenze, jedoch eine konfessionelle Grenze verläuft.<br />
Wirtschaft<br />
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt erfasste die industrielle Revolution, begünstigt durch erhebliche Kohlevorkommen, vor allem die südliche Nachbarregion Wallonie, während sich in Flan<strong>de</strong>rn nur<br />
Gent <strong>zu</strong> einem Industriezentrum entwickeln konnte. An<strong>de</strong>rs als <strong>de</strong>r von Kohle- und Stahlindustrie geprägte Sü<strong>de</strong>n Belgiens zog Gent jedoch in erster Linie textilverarbeiten<strong>de</strong><br />
Unternehmen an. Insgesamt profitierte Flan<strong>de</strong>rn traditionell stark von Han<strong>de</strong>l und Seefahrt, jedoch sehr viel weniger von <strong>de</strong>r beginnen<strong>de</strong>n Industrialisierung als die Wallonie und wur<strong>de</strong><br />
wirtschaftlich <strong>zu</strong>nehmend abgehängt.<br />
Mit <strong>de</strong>m Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>r wallonischen Schwerindustrie entwickelte sich Flan<strong>de</strong>rn in <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong>m wirtschaftlich führen<strong>de</strong>n Teil Belgiens. Während die<br />
Wallonie sich heute mit <strong>de</strong>n zahlreichen Problemen eines wirtschaftlichen Strukturwan<strong>de</strong>ls konfrontiert sieht, profitiert Flan<strong>de</strong>rn von einem starken Dienstleistungssektor und<br />
insbeson<strong>de</strong>re von <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Antwerpener Hafens.<br />
Im Vergleich <strong>zu</strong>m Bruttoinlandsprodukt <strong>de</strong>r EU, ausgedrückt in Kaufkraftstandards, erreicht Ostflan<strong>de</strong>rn 105,3 % und Westflan<strong>de</strong>rn 110,7 % <strong>de</strong>s Durchschnitts <strong>de</strong>r EU-27 (2006).[3]<br />
Quellen<br />
1. ↑ Bevölkerung nach Gemein<strong>de</strong>n am 1. Januar 2008 (XLS)<br />
2. ↑ Bevölkerung nach Gemein<strong>de</strong>n am 1. Januar 2008 (XLS)<br />
3. ↑ Eurostat Jahrbuch <strong>de</strong>r Regionen 2009: Kapitel 4: Bruttoinlandsprodukt (PDF; 5,4 MB) und (XLS; 134 KB); ISSN 1830-9690 (Registrierung bei Eurostat ist erfor<strong>de</strong>rlich).<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Grafschaft Flan<strong>de</strong>rn<br />
Die Grafschaft Flan<strong>de</strong>rn (nie<strong>de</strong>rländisch: Vlaan<strong>de</strong>ren, französisch: Flandre) ist ein historisches Territorium auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r heutigen Staaten Belgien, Frankreich und <strong>de</strong>n<br />
Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n. Bis 1477 war die Lehnshoheit geteilt: Der größere Teil gehörte <strong>zu</strong> Frankreich, <strong>de</strong>r kleinere Teil rechts <strong>de</strong>r Schel<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Heiligen Römischen Reich (daher auch:<br />
„Reichsflan<strong>de</strong>rn“). Im Hochmittelalter entwickelte Flan<strong>de</strong>rn – getrieben vor allem von seinen Städten Lille, Douai, Ypern, Gent und Brügge – eine unvergleichliche wirtschaftliche<br />
Prosperität. Wachstumsfaktoren sind vor allem die Wollindustrie und <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l. Dies bil<strong>de</strong>te <strong>de</strong>n Hintergrund für eine Blütezeit <strong>de</strong>r gotischen Kunst – in <strong>de</strong>r Schel<strong>de</strong>gotik konnten sich<br />
die von Frankreich kommen<strong>de</strong>n gotischen Architekturprinzipien bereits früh durchsetzen.<br />
Altertum und Frühmittelalter<br />
Flan<strong>de</strong>rn war in ältester Zeit von belgischen Stämmen, Morinern, Atrebaten und Menapiern, bewohnt und gehörte nach <strong>de</strong>ren Unterwerfung durch Caesar <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r römischen Provinz<br />
Belgica secunda. Nach<strong>de</strong>m das Land unter die Herrschaft <strong>de</strong>r Franken gekommen war, bil<strong>de</strong>te die Lys, ein Nebenfluss <strong>de</strong>r Schel<strong>de</strong>, die Grenze zwischen Neustrien und Austrasien, und<br />
nach <strong>de</strong>r Teilung von Verdun im Jahr 843 kam <strong>de</strong>r nördliche und südwestliche Teil Flan<strong>de</strong>rns, obschon vor<strong>zu</strong>gsweise nie<strong>de</strong>rländischsprachig, <strong>zu</strong> Frankreich, <strong>de</strong>r südöstliche aber,<br />
obschon vor<strong>zu</strong>gsweise picardischsprachig, <strong>zu</strong>m Heiligen Römischen Reich.<br />
Entstehung <strong>de</strong>r Grafschaft Flan<strong>de</strong>rn<br />
Der Name Flan<strong>de</strong>rn kommt seit <strong>de</strong>m 7. Jahrhun<strong>de</strong>rt vor und umfasste ursprünglich nur das Gebiet von Brügge und Sluis (municipium flandrense), <strong>de</strong>ssen Grafen <strong>de</strong>n Namen Flan<strong>de</strong>rn<br />
gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 9. Jahrhun<strong>de</strong>rts auch über <strong>de</strong>n nordfranzösischen Küstenstrich, <strong>de</strong>n sie als Mark <strong>zu</strong>r Beschüt<strong>zu</strong>ng gegen die Normannen erhielten, und später auch über einige<br />
angrenzen<strong>de</strong> <strong>de</strong>utsche Besit<strong>zu</strong>ngen aus<strong>de</strong>hnten. Der erste jener Markgrafen war Balduin I., Eisenarm, ein französischer Ritter aus Laon, <strong>de</strong>r die Tochter Kaiser Karls <strong>de</strong>s Kahlen, Judith,<br />
entführte, aber <strong>de</strong>nnoch 862 von ihm jene neugeschaffene Mark als Lehen erhielt und so <strong>de</strong>n Grund <strong>zu</strong>r Größe seines Hauses legte. Er starb 879.<br />
10. bis 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Der Sohn Balduins I., Balduin II., <strong>de</strong>r Kahle (879–918), befestigte Brügge, Ypern und Saint-Omer gegen die Normannen.<br />
Dessen Sohn Arnulf I. (918–966) bestimmte seinen Sohn Balduin III. (<strong>de</strong>r die ersten Webereien in Flan<strong>de</strong>rn einführte) und nach <strong>de</strong>ssen Tod seinen Enkel Arnulf II. (gestorben 989) <strong>zu</strong>m<br />
Mitregenten. Des letzteren Sohn Balduin IV., Schönbart (989–1036), riss 1006 Valenciennes, eine Stadt <strong>de</strong>s heiligen römischen Reiches, an sich, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>shalb von Kaiser Heinrich II.<br />
bekriegt, erhielt aber durch Vertrag 1007 Valenciennes, Stadt und Burggrafschaft Gent, Walcheren und die zeeländischen Inseln (das sogenannte Reichsflan<strong>de</strong>rn) von Kaiser Heinrich II.<br />
<strong>zu</strong> Lehen.<br />
Sein Sohn Balduin V., <strong>de</strong>r Fromme (1036–1067), führte zwischen 1045–1056 mehrere Kriege gegen Kaiser Heinrich III., welcher <strong>de</strong>r Machterweiterung <strong>de</strong>r Markgrafen Einhalt gebieten<br />
wollte. Balduin behauptete sich jedoch, besiegte die Friesen und vermehrte seine Besit<strong>zu</strong>ngen durch Erwerb <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>m Herzogtum Nie<strong>de</strong>rlothringen gehörigen Gebiete zwischen <strong>de</strong>r<br />
Schel<strong>de</strong> und Den<strong>de</strong>r (die Markgrafschaft Ename, später Grafschaft Aalst genannt), Tournais und <strong>de</strong>r Hoheit über das Reichsbistum Cambrai, <strong>de</strong>m die Grafschaft Flan<strong>de</strong>rn bis <strong>zu</strong>r<br />
Gründung <strong>de</strong>s neuen Bistums Arras in kirchlicher Hinsicht unterstellt war. Wegen seiner Rebellion gegen <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Kaiser verlor er aber die Markgrafschaft Valenciennes 1045,<br />
seit<strong>de</strong>m Teil <strong>de</strong>r Grafschaft Hennegau.<br />
Nach seinem Tod erhielt sein jüngerer Sohn, Robert I., <strong>de</strong>r Friese, die Län<strong>de</strong>r an <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>s Rheins und <strong>de</strong>r Waal und die seeländischen Inseln, während das französische Lehen<br />
(das Hauptland Flan<strong>de</strong>rn) an <strong>de</strong>n Erstgeborenen, Balduin VI., <strong>de</strong>n Guten (1067–1070), fielen.<br />
Nach <strong>de</strong>ssen frühen Tod kam es <strong>zu</strong> längeren Kämpfen um die Erbfolge zwischen Balduins Witwe Richil<strong>de</strong> von Egisheim, Gräfin von Hennegau, und Robert <strong>de</strong>m Friesen, die damit<br />
en<strong>de</strong>ten, dass Robert Flan<strong>de</strong>rn erhielt, <strong>de</strong>r Sohn Balduins VI., Balduin (I.), sich in <strong>de</strong>n Hennegau <strong>zu</strong>rückzog, während ein Teil von Friesland an Gottfried von Lothringen kam.<br />
Roberts I. Sohn und Nachfolger Robert II. (1093–1111) beteiligte sich am ersten Kreuz<strong>zu</strong>g und führte zahlreiche Kämpfe mit seinen Nachbarn und mit <strong>de</strong>m Kaiser. Sein Sohn Balduin<br />
VII., mit <strong>de</strong>m Beil (o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Strenge), so genannt wegen <strong>de</strong>r Strenge, mit <strong>de</strong>r er Landfrie<strong>de</strong>nsbrecher bestrafte, starb 1119 kin<strong>de</strong>rlos und hinterließ das Land seinem Vetter, <strong>de</strong>m dänischen
Prinzen Karl I., <strong>de</strong>m Guten, <strong>de</strong>ssen Mutter eine Tochter Roberts I. war, <strong>de</strong>r jedoch wegen seiner Strenge in Handhabung <strong>de</strong>r Gesetze 1127 <strong>zu</strong> Brügge ermor<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>.<br />
Der von <strong>de</strong>n Stän<strong>de</strong>n auf Betreiben Ludwigs VI. von Frankreich <strong>zu</strong>m Grafen berufene Sohn Roberts von <strong>de</strong>r Normandie, Wilhelm Clito, machte sich durch Willkür verhasst und verlor<br />
im Kampf gegen <strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Stän<strong>de</strong>n berufenen Landgrafen Dietrich von Elsass, Seitenspross <strong>de</strong>s alten flandrischen Hauses, Sohn Gertruds, <strong>de</strong>r Tochter Roberts <strong>de</strong>s Friesen, 1129 das<br />
Leben, worauf Dietrich das Elsass seinem jüngeren Bru<strong>de</strong>r, Simeon, überließ, von Flan<strong>de</strong>rn Besitz nahm und einen Krieg gegen Hennegau führte. Er starb 1168. Der Mannesstamm<br />
erlosch schon mit seinem Sohn Philipp, <strong>de</strong>r Vermandois gewann, dagegen später Artois 1180 als Mitgift seiner Nichte Isabella von Hennegau König Philipp August von Frankreich<br />
überließ. Philipp, <strong>de</strong>r sich um die materielle Wohlfahrt von Flan<strong>de</strong>rn in Be<strong>zu</strong>g auf Han<strong>de</strong>l und Industrie Verdienste erworben hatte, starb 1191 vor St. Jean d’Acre an <strong>de</strong>r Pest. Durch die<br />
Vermählung seiner Schwester und Erbin Margarete mit Balduin VIII. (gestorben 1195) von <strong>de</strong>r hennegauischen Linie <strong>de</strong>r alten flandrischen Grafen wur<strong>de</strong>n Flan<strong>de</strong>rn und Hennegau<br />
wie<strong>de</strong>r vereinigt.<br />
Ihr Sohn Balduin IX., <strong>de</strong>r Stifter <strong>de</strong>s Lateinischen Kaiserreichs <strong>zu</strong> Konstantinopel, hinterließ 1205 zwei Erbtöchter, von <strong>de</strong>nen die ältere, Johanna, Flan<strong>de</strong>rn, die jüngere, Margarete,<br />
genannt die Schwarze, die Grafschaft Hennegau erhielt.<br />
Fast das ganze Jahrhun<strong>de</strong>rt hindurch dauerten Erb- und Thronstreitigkeiten, in die sich die Könige von Frankreich in eigennütziger Absicht einmischten (Flämischer Erbfolgekrieg).<br />
Nach Margaretes Tod im Jahr 1279 erhielt ihr Sohn Johann Hennegau, <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re, Guido von Dampierre, Flan<strong>de</strong>rn. Letzterer verband sich 1291 mit Adolf von Nassau (römisch<strong>de</strong>utscher<br />
König seit 1292) und mit England gegen Philipp IV. <strong>de</strong>n Schönen von Frankreich; doch vermittelte Papst Bonifatius VIII. 1295 <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n. König Philipp IV. von Frankreich<br />
fiel jedoch 1297 abermals in Flan<strong>de</strong>rn ein, eroberte <strong>de</strong>n größten Teil <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s, das er als französisches Lehen in Anspruch nahm, und nahm Guido und <strong>de</strong>ssen Sohn Robert gefangen.<br />
Als Philipp IV. danach durch seinen Statthalter Jacques <strong>de</strong> Châtillon die Freiheiten <strong>de</strong>r Flamen unterdrückte, erhoben sich diese unter <strong>de</strong>m Vorsteher <strong>de</strong>r Wollweber von Brügge, Pieter <strong>de</strong><br />
Coninck (Pierre le Roi), vernichteten die französisch gesinnte Partei <strong>de</strong>r Leliaerts und besiegten das überlegene französische Heer in <strong>de</strong>r Sporenschlacht bei Kortrijk (Courtrai) am 11.<br />
Juli 1302. Sie wur<strong>de</strong>n dann zwar am 18. August 1304 bei Mons-en-Puelle zwischen Lille und Douai geschlagen, erlangten aber gleichwohl einen Frie<strong>de</strong>n, wonach Guido gegen<br />
Abtretung einiger Städte nach Flan<strong>de</strong>rn <strong>zu</strong>rückkehren sollte. Da <strong>de</strong>rselbe aber schon 1305 starb, folgte ihm sein Sohn Robert.<br />
Dessen Enkel und Nachfolger Ludwig II. (1322–1346), <strong>zu</strong>gleich Herr von Nevers und Rethel, und somit <strong>de</strong>r mächtigste unter allen Grafen von Flan<strong>de</strong>rn, gab 1336 durch seine Härte<br />
gegen die nach größerer Freiheit streben<strong>de</strong>n reichen und industriellen Städte Veranlassung <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m allgemeinen Bürgeraufstand, <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r kühne Genter Brauer Jakob van Artevel<strong>de</strong> mit<br />
englischer Unterstüt<strong>zu</strong>ng leitete. Zugleich wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hass dadurch gesteigert, dass <strong>de</strong>r Graf und <strong>de</strong>r A<strong>de</strong>l sich an Frankreich, die Städte an England anschließen wollten. Aus seinem<br />
Land vertrieben, suchte Ludwig II. Hilfe bei Frankreich, konnte aber erst nach Artevel<strong>de</strong>s Tod (1345) <strong>zu</strong>rückkehren und fiel 1346 in <strong>de</strong>r Schlacht von Crécy. Unter seinem leichtsinnigen<br />
Sohn Ludwig III., genannt von Maele, empörten sich die Städte, namentlich Gent und Brügge, die reichsten und mächtigsten, von neuem. Ludwig III. belagerte vergebens Gent, schlug<br />
aber 1382 die Genter bei Roosebeke, wo auch <strong>de</strong>ren Führer Philipp van Artevel<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r Sohn Jakobs, fiel. Mit englischer Hilfe trugen jedoch die Städter bei Dünkirchen einen Sieg über<br />
Ludwig III. davon, und 1384 kam durch Frankreichs Vermittlung ein Frie<strong>de</strong> <strong>zu</strong>stan<strong>de</strong>.<br />
Burgundische und habsburgische Herrschaft<br />
Ludwig III. starb 1384 als <strong>de</strong>r letzte Graf von Flan<strong>de</strong>rn aus <strong>de</strong>m Haus Dampierre. Durch die Vermählung seiner Erbtochter Margarete mit Philipp <strong>de</strong>m Kühnen aus <strong>de</strong>m Haus Burgund<br />
wur<strong>de</strong> das Land 1385 mit Burgund vereinigt und teilte seit<strong>de</strong>m die Schicksale dieses Reichs (siehe Burgundische Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>). Als nach <strong>de</strong>m Tod Karls <strong>de</strong>s Kühnen von Burgund <strong>de</strong>ssen<br />
Län<strong>de</strong>r 1477 durch seine Erbtochter Maria von Burgund als Gemahlin <strong>de</strong>s habsburger Thronfolgers und nachmaligen Kaisers Maximilian an das Haus Habsburg fielen, suchte die<br />
französische Krone vergeblich ihre alte Lehnshoheit über Flan<strong>de</strong>rn geltend <strong>zu</strong> machen. Im Frie<strong>de</strong>n von Madrid 1526 musste Frankreich auf seine Oberlehnshoheit über Flan<strong>de</strong>rn<br />
verzichten. Bei <strong>de</strong>r Kreiseinteilung <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Reiches wur<strong>de</strong> Flan<strong>de</strong>rn fortan <strong>de</strong>m burgundischen Kreis <strong>zu</strong>geordnet.<br />
Nach<strong>de</strong>m dieser dann jedoch an König Philipp II. und damit an die spanische Linie <strong>de</strong>s Hauses Habsburg gekommen war, erlitt er be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Schmälerungen. Die Generalstaaten<br />
behaupteten im Westfälischen Frie<strong>de</strong>n 1648 das so genannte Holländisch-Flan<strong>de</strong>rn (Staatsflan<strong>de</strong>rn, das als Zeeuws Vlaan<strong>de</strong>ren heute noch <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n gehört), wogegen<br />
Ludwig XIV. von Frankreich durch <strong>de</strong>n Pyrenäenfrie<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>n Ersten Aachener, <strong>de</strong>n Nimwegener und <strong>de</strong>n Utrechter Frie<strong>de</strong>n beträchtliche Teile von Flan<strong>de</strong>rn gewinnen konnte (unter<br />
an<strong>de</strong>rem Dünkirchen, Lille, Douai, Valenciennes und Cambrai). Gemäß <strong>de</strong>s Utrechter und <strong>de</strong>s Rastatter Frie<strong>de</strong>nsschlusses fielen die Reste <strong>de</strong>r Spanischen Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r an das<br />
Haus Österreich (Österreichische Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>).
Neuere Geschichte<br />
1794 wur<strong>de</strong> ganz Flan<strong>de</strong>rn wie die übrigen österreichischen Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> <strong>de</strong>r französischen Republik und später <strong>de</strong>m napoleonischen Kaiserreich einverleibt und bil<strong>de</strong>te die<br />
Départements Lys (die jetzige Provinz Westflan<strong>de</strong>rn) und Escault (die Provinz Ostflan<strong>de</strong>rn). Der Wiener Kongress teilte die bei<strong>de</strong>n Provinzen 1815 <strong>de</strong>m neugebil<strong>de</strong>ten Königreich <strong>de</strong>r<br />
Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> <strong>zu</strong>. Nach <strong>de</strong>r Belgischen Revolution von 1830 kamen Ost- und Westflan<strong>de</strong>rn an das neu konstituierte Königreich Belgien. Im Ersten Weltkrieg 1914-1918 verlief die<br />
<strong>de</strong>utsch-französisch/britische Front quer durch Flan<strong>de</strong>rn. Durch <strong>de</strong>n Stellungskrieg wur<strong>de</strong>n viele Dörfer und Städte, unter an<strong>de</strong>rem Passendale und Ypern, dieser Region <strong>de</strong>s eigentlich<br />
neutralen Belgien zerstört. Heute gehören bei<strong>de</strong> Provinzen <strong>zu</strong>r belgischen Region Flan<strong>de</strong>rn, die französisch gewor<strong>de</strong>nen Teile <strong>zu</strong>r Region Nord-Pas <strong>de</strong> Calais.<br />
Literatur<br />
• Heinrich Sproemberg: Die Entstehung <strong>de</strong>r Grafschaft Flan<strong>de</strong>rn. Teil 1: Die ursprüngliche Grafschaft Flan<strong>de</strong>rn (864-892), Berlin 1935 (= Historische Studien. 282)<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
La Rochelle<br />
La Rochelle ist eine westfranzösische Hafenstadt und Hauptstadt <strong>de</strong>s Départements Charente-Maritime Region Poitou-Charentes mit 76.848 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2007). Sie ist<br />
auch die Partnerstadt von Lübeck.<br />
Geographie<br />
La Rochelle liegt am Atlantik im Golf von Biscaya, gegenüber <strong>de</strong>r Île <strong>de</strong> Ré und ist ein wichtiges Schifffahrts-, Han<strong>de</strong>ls- und Frem<strong>de</strong>nverkehrszentrum. Die Entfernung <strong>zu</strong> Nantes im<br />
Nor<strong>de</strong>n beträgt ungefähr 150 km, <strong>zu</strong> Bor<strong>de</strong>aux im Sü<strong>de</strong>n 190 km und <strong>zu</strong> Paris im Nordosten 470 km.<br />
Geschichte<br />
Ursprünge<br />
Im Gebiet um La Rochelle sie<strong>de</strong>lten in <strong>de</strong>r Antike die Santones, ein Stamm <strong>de</strong>r Gallier, von <strong>de</strong>nen die Gegend nahe Saintes, die Saintonge, ihren Namen erhielt. Die Besat<strong>zu</strong>ngsmacht<br />
<strong>de</strong>r Römer entwickelten entlang <strong>de</strong>r Atlantikküste <strong>de</strong>n dort bislang unbekannten Anbau und die Erzeugung von Wein und die Herstellung von Salz. Sie belieferten damit ihr ganzes<br />
Reich. Zeugnisse dieser Epoche sind archäologische Ausgrabungen römischer Villen in Saint- Eloi und in Les Minimes, ferner die von Salzgärten mit Salinen.<br />
Der Name La Rochelle heißt übersetzt „Kleiner Felsen“, bezogen auf ein erhöhtes Kalkfelsplateau im Gebiet <strong>de</strong>r heutigen Stadt, auf <strong>de</strong>m sich im Zuge <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung (En<strong>de</strong> 4. bis<br />
Mitte 6. Jahrhun<strong>de</strong>rt) von <strong>de</strong>r Donau kommen<strong>de</strong> Alanen nie<strong>de</strong>rließen und dauerhaft ansie<strong>de</strong>lten. An sie erinnert heute noch <strong>de</strong>r Name <strong>de</strong>r Landschaft Aunis im Hinterland von La<br />
Rochelle.
Entwicklung <strong>zu</strong>m größten Hafen am Atlantik<br />
Die Gründung <strong>de</strong>r Stadt muss für das 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt angenommen wer<strong>de</strong>n.<br />
Relativ späte erste schriftliche Überlieferungen über die Zeit um 1140 sprechen von einer Zuwan<strong>de</strong>rung von Colliberts, einer Gruppe entflohener Sklaven, die sich <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlassung <strong>de</strong>r<br />
Alanen anschlossen und <strong>de</strong>ren Entwicklung mit vorantrieben.<br />
Zu ihnen stießen noch die kosmopolitischen Templer, <strong>de</strong>ren Routen im 12. und 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt auch nach La Rochelle führten. Unter ihrer Mitwirkung wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hafen <strong>zu</strong>m größten <strong>de</strong>r<br />
Atlantikküste ausgebaut. Noch heute gibt es eine Straße Rue <strong>de</strong>s Templiers, die nach <strong>de</strong>n Templern benannt ist. (Die Rue du Temple und Cour du Temple weisen dagegen auf reformierte<br />
Kirchen hin, die auf Französisch temple heißen).<br />
1137 machte Wilhelm X., Herzog von Aquitanien, <strong>de</strong>n Hafen <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> einem freien Hafen. Für die spätere blühen<strong>de</strong> Geschichte <strong>de</strong>r Stadt zeichnete Eleonore von Aquitanien<br />
verantwortlich. Sie verlieh La Rochelle 1199 das freie Stadtrecht, verbun<strong>de</strong>n mit einer bürgerlichen Selbstverwaltung und eigener Gerichtsbarkeit. Damals wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m ersten Mal in <strong>de</strong>r<br />
französischen Geschichte für La Rochelle ein Bürgermeister benannt, und zwar Guillaume <strong>de</strong> Montmirail. In <strong>de</strong>ssen Folge wur<strong>de</strong> je<strong>de</strong>s Jahr ein neuer Bürgermeister gewählt, aus <strong>de</strong>n<br />
Reihen <strong>de</strong>r mächtigsten Familien <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Im Jahr 1224 wur<strong>de</strong> die Stadt von König Ludwig VIII. belagert und unterwarf sich anschließend.<br />
Während <strong>de</strong>s Hun<strong>de</strong>rtjährigen Krieges fand bei La Rochelle am 22. Juni 1372 eine Seeschlacht statt, zwischen einer kastilisch-französischen und einer englischen Flotte. Die Spanier und<br />
Franzosen hatten 60 Schiffe und die Englän<strong>de</strong>r nur 40 unter ihrem Kommando. Sie verfügten auch über <strong>de</strong>utlich mehr Personal als die Englän<strong>de</strong>r. Die Franzosen und die Spanier<br />
besiegten damals entschei<strong>de</strong>nd die Englän<strong>de</strong>r. Damit fiel die Kontrolle über <strong>de</strong>n Kanal <strong>zu</strong>m ersten Mal in die Hän<strong>de</strong> Frankreichs, seit <strong>de</strong>r Schlacht von 1340 von Sluys.<br />
Bis <strong>zu</strong>m 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt behielt La Rochelle <strong>de</strong>n größten Hafen Frankreichs an <strong>de</strong>r atlantischen Küste. Gehan<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong> hauptsächlich mit Wein und Salz.<br />
In Zeiten <strong>de</strong>r Religionskriege<br />
Während <strong>de</strong>r Renaissance nahm La Rochelle die I<strong>de</strong>en <strong>de</strong>r Reformation offen auf und hatte bereits vor 1540 zahlreiche Anhänger. Die Toleranz untereinan<strong>de</strong>r ließ am Anfang einen<br />
gemeinsamen Gebrauch <strong>de</strong>r katholischen Kirchengebäu<strong>de</strong> <strong>zu</strong>.<br />
Von 1562 bis 1598 überzogen das Land die Verwüstungen <strong>de</strong>r Religionskriege. 1565 wur<strong>de</strong>n in La Rochelle dreißig katholische Priester erdrosselt und von <strong>de</strong>r Tour <strong>de</strong> la Lanterne ins<br />
Meer gestoßen, was <strong>de</strong>n offenen Kampf auslöste. Nicht lange danach wur<strong>de</strong> es <strong>zu</strong>r Hauptstadt <strong>de</strong>s Protestantismus in Frankreich.<br />
Der große Gegenschlag <strong>de</strong>r katholischen Liga begann mit <strong>de</strong>m „Massaker <strong>de</strong>r Bartholomäusnacht“ am 24. August 1572, mit <strong>de</strong>r Hinrichtung von Hugenottenanführern in Paris und <strong>de</strong>n<br />
sich anschließen<strong>de</strong>n furchtbaren Gemetzeln, die auf ganz Frankreich übergriffen.<br />
1573 erfolgte die Belagerung <strong>de</strong>s Hugenottenzentrums durch die königlich- katholisch Armee, unter <strong>de</strong>m Befehl <strong>de</strong>s Herzogs von Anjou, <strong>de</strong>m späteren Heinrich III. Trotz sechsmonatiger<br />
intensiver Belagerung, unter Verwendung mo<strong>de</strong>rnster Kriegstechniken auf bei<strong>de</strong>n Seiten, hielten die Protestanten durch, und die Angreifer mussten ergebnislos aufgeben. Immerhin<br />
hatten 20.000 Mann auf <strong>de</strong>r katholischen Seite ihr Leben gelassen. Vom Misserfolg gezwungen, musste die Krone <strong>de</strong>n Hugenotten von La Rochelle noch 1573 die ungehin<strong>de</strong>rte<br />
Ausübung ihrer Religion gestatten.<br />
Mit <strong>de</strong>m Edikt von Nantes been<strong>de</strong>te Heinrich IV. 1598 die Religionskriege.<br />
Erneute Belagerung von La Rochelle 1627–1628<br />
Etwa 55 Jahre später geriet die Stadt wie<strong>de</strong>r in Konflikte mit Ludwig XIII., <strong>de</strong>ssen königliche Armee La Rochelle am 10. September 1627 erneut belagerte. Die Stadt hatte sich mit <strong>de</strong>n<br />
Englän<strong>de</strong>rn verbün<strong>de</strong>t, die bereits die Insel Ré besetzt hatten. In <strong>de</strong>n Kämpfen stan<strong>de</strong>n sich zwei gleichermaßen sture Köpfe gegenüber, einerseits Kardinal Richelieu, Angehöriger <strong>de</strong>s<br />
absolutistischen Königtums und an<strong>de</strong>rerseits Jean Guiton (1585–1654), ein fanatischer Admiral und neuer Bürgermeister von La Rochelle.
Die Blocka<strong>de</strong> durch die Königlichen erfolgte nicht nur von Land, son<strong>de</strong>rn auch von <strong>de</strong>r Seeseite, auf <strong>de</strong>r im Wasser ein riesiger 12 km langer Damm aufgeschüttet wur<strong>de</strong>, in <strong>de</strong>n lange<br />
angespitzte Holzbalken in Richtung Stadt eingerammt waren. Soldaten <strong>de</strong>r Artillerie besetzten <strong>de</strong>n Damm. Die Versorgung und Verstärkung vom Meer aus, etwa von <strong>de</strong>n Englän<strong>de</strong>rn,<br />
war damit abgeschnitten. Der Bürgermeister konnte die hungern<strong>de</strong> Bevölkerung <strong>de</strong>r Stadt über mehr als ein Jahr <strong>zu</strong>m Durchhalten bewegen.<br />
Als die Wachen auf <strong>de</strong>n Mauern vor Hunger tot umfielen, musste Guiton kapitulieren. Am 30. Oktober 1628 zog Richelieu und sein Heer in die Stadt ein, nach zwei Tagen gefolgt von<br />
König Ludwig XIII. In <strong>de</strong>n Häusern fan<strong>de</strong>n sie unzählige Leichen. Von <strong>de</strong>n 28.000 ursprünglich eingeschlossenen Einwohnern hatten nur 5.000 überlebt, so auch Jean Guiton, <strong>de</strong>r später<br />
in königliche Dienste eintrat.<br />
Exodus <strong>de</strong>r Hugenotten und die Kolonialzeit<br />
Nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Hugenotten von La Rochelle 1628 ging ihre Verfolgung im ganzen Land unerbittlich weiter, die mit <strong>de</strong>r Rücknahme <strong>de</strong>s Edikt von Nantes durch Ludwig XIV.<br />
ihren Höhepunkt erreichte. Viele Hugenotten flohen, wan<strong>de</strong>rten aus und grün<strong>de</strong>ten 1689 in Nordamerika die Stadt New Rochelle.<br />
In <strong>de</strong>r Kolonialzeit spielte La Rochelle im „atlantischen Dreieckshan<strong>de</strong>l“ zwischen Afrika, Neufrankreich (Kanada und die Antillen) und <strong>de</strong>m Kernland Frankreich eine wichtige Rolle.<br />
La Rochelle blieb weiterhin einer <strong>de</strong>r größten Häfen Frankreichs. Dafür war vor allem <strong>de</strong>r aufgekommene Sklavenhan<strong>de</strong>l und die Entwicklung <strong>de</strong>r überseeischen Beziehungen<br />
verantwortlich. Die beschädigten Wehranlagen wur<strong>de</strong>n durch <strong>de</strong>n be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Festungsarchitekten Vauban wie<strong>de</strong>rhergestellt und mo<strong>de</strong>rnisiert.<br />
19. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
1864 war <strong>de</strong>r Hafen von La Rochelle, im Bereich <strong>de</strong>s „Bassin <strong>de</strong>r Flotten“, hinter <strong>de</strong>n Schleusen, <strong>de</strong>r Standort für Tauchexperimente <strong>de</strong>s ersten mechanisch betriebenen U-Boots <strong>de</strong>r<br />
Welt, genannt Plongeur. Es wur<strong>de</strong> kommandiert von Marie-Joseph Camille Doré, geboren in La Rochelle.<br />
Zweiter Weltkrieg<br />
Im April 1941 begann die Organisation Todt im fünf Kilometer entfernten La Rochelle-La Pallice einen U-Boot-Bunker <strong>zu</strong> errichten, welcher noch heute <strong>zu</strong> besichtigen ist.<br />
Die Stadt La Rochelle sowie die Hafenanlagen La Pallice blieben bis <strong>zu</strong>m Tag <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Gesamtkapitulation am 9. Mai 1945 in <strong>de</strong>utscher Hand. Im Rahmen eines<br />
Stillhalteabkommens zwischen <strong>de</strong>m <strong>de</strong>utschen Festungskommandanten Vizeadmiral Ernst Schirlitz und <strong>de</strong>m französischen Unterhändler Capitaine <strong>de</strong> Fregate Hubert Meyer wur<strong>de</strong><br />
vereinbart, auf eine befohlene Zerstörung <strong>de</strong>r Stadt- und Hafenanlagen <strong>zu</strong> verzichten, sofern die alliierten Truppen die in La Rochelle eingekesselten Deutschen nicht angreifen wür<strong>de</strong>n.<br />
Die sogenannte Konvention von La Rochelle führte letztlich da<strong>zu</strong>, dass Stadt- und Hafenanlagen von La Rochelle am 9. Mai 1945 unversehrt übergeben wer<strong>de</strong>n konnten, während<br />
an<strong>de</strong>re Atlantikstädte wie z.B. Royan noch kurz vor Kriegsen<strong>de</strong> im April völlig zerstört wur<strong>de</strong>n.<br />
Heute<br />
Auch wenn heute in La Rochelle die internationale Schifffahrt kaum noch eine Rolle spielt, so ist er jedoch immer noch einer <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Fischereihäfen <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Seine<br />
Kapazität erreicht die vierte Stelle in Frankreich. Beim Umschlag von Han<strong>de</strong>lsgütern, mit einem Bruttovolumen von etwa sechs Millionen Tonnen jährlich, nimmt er <strong>de</strong>n achten Rang<br />
unter <strong>de</strong>n französischen Häfen ein.<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
Der alte Hafen<br />
Das Hafenbecken <strong>de</strong>s Vieux Port ist das Zentrum <strong>de</strong>r Altstadt, und wird eingefasst von <strong>de</strong>n Uferstraßen, im Nor<strong>de</strong>n vom Quai Duperre und im Westen von <strong>de</strong>r Cours <strong>de</strong>s Dames. Im<br />
Winkel <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Straßen erhebt sich die Statue <strong>de</strong>s Admiral Duperre, 1775 in La Rochelle geboren, und Kommandant <strong>de</strong>r französischen Flotte bei <strong>de</strong>r Einnahme von Algier im Jahr<br />
1830. Auf <strong>de</strong>r Esplana<strong>de</strong> Cour <strong>de</strong>s Dames wur<strong>de</strong>n früher Sardinen verkauft und von <strong>de</strong>n Fischern ihre Netze geflickt.
Tour St.-Nicolas<br />
Der leicht geneigte zwischen 1317 und 1345 errichtete Turm weist die Merkmale einer Festung auf, und bil<strong>de</strong>t <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m gegenüberliegen<strong>de</strong>n Tour <strong>de</strong> la Chaine das<br />
Wahrzeichen von La Rochelle. Er hat einen fünfeckigen Grundriss und ist 42 m hoch. An Stelle <strong>de</strong>r fünf Ecken gibt es drei im Grundriss halbrun<strong>de</strong> Türme und einen rechteckigen und<br />
einen quadratischen höheren Turmanbau, eine Art Donjon. Alle Seiten sind mit Schießscharten und kleinen Fenstern ausgestattet. Der Turm diente lange als Gefängnis. Eine weit<br />
ausla<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Zugangstreppe mit seitlichen Mauern, als Strebewerke ausgebil<strong>de</strong>t, vom Bo<strong>de</strong>n bis <strong>zu</strong>r Höhe <strong>de</strong>r Treppenbrüstung reichend, erschließt <strong>de</strong>n Hauptsaal, <strong>de</strong>r von einem<br />
eleganten oktogonalen Kreuzrippengewölbe über<strong>de</strong>ckt wird. Die ins dicke Mauerwerk <strong>de</strong>r Turmwän<strong>de</strong> eingearbeiteten Treppen führen in <strong>de</strong>n darüber liegen<strong>de</strong>n zweiten Saal, von dort<br />
weiter <strong>zu</strong> noch an<strong>de</strong>ren Räumen. Einer davon ist als Kapelle ausgestattet. Darüber liegt die erste mit Zinnen umschlossenen Dachterrasse und etwas aufwärts die zweite und höchste<br />
Terrasse auf <strong>de</strong>m Turmanbau, die von Brustwehren mit Schießscharten und Pecherkern eingeschlossen wird.<br />
Tour <strong>de</strong> la Chaine<br />
Der Name dieses Turms kommt von <strong>de</strong>r großen Kette (frz.Chaine), die über Nacht mit <strong>de</strong>m Tour St.-Nicolas verbun<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>, <strong>zu</strong>r Blockierung <strong>de</strong>r Hafen<strong>zu</strong>fahrt. Am Fuß <strong>de</strong>s Turms<br />
gibt es davon noch einen Rest. Der im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt erbaute Turm war überwiegend ein Pulvermagazin. Er wur<strong>de</strong> im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt teilweise abgetragen. Sein ursprünglicher<br />
Turmanbau, <strong>de</strong>r in die Hafeneinfahrt hineinragte, wur<strong>de</strong> abgerissen um diese <strong>zu</strong> erweitern. Die vom Tour <strong>de</strong> la Chaine in Richtung Tour <strong>de</strong> la Lanterne verlaufen<strong>de</strong> Befestigungsmauer,<br />
die sich im Mittelalter direkt aus <strong>de</strong>m Meer erhob, ist die einzige, die von Richelieu nicht zerstört wur<strong>de</strong>. Er dachte daran, dass sie ihm <strong>zu</strong>m Schutz gegen die Angriffe <strong>de</strong>r Englän<strong>de</strong>r<br />
dienen konnte.<br />
Tour <strong>de</strong> la Lanterne<br />
Sein Name <strong>de</strong>utet auf seine Nut<strong>zu</strong>ng als Leuchtturm. Er wur<strong>de</strong> erst im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt errichtet. Die an seinem Fuß anschließen<strong>de</strong>n sechs Meter dicken Festungsmauern kontrastieren <strong>zu</strong><br />
<strong>de</strong>r Eleganz <strong>de</strong>s oktogonalen Turmhelms, <strong>de</strong>ssen Rippen mit „Krabben“ verziert sind. Dort oben gibt es die Laterne, die als Leuchtfeuer gedient hat. In <strong>de</strong>r oberen Turmspitze sind noch<br />
vier Räume übereinan<strong>de</strong>r angeordnet, auf <strong>de</strong>ren Wän<strong>de</strong> zahlreiche Graffiti <strong>de</strong>r dort inhaftierten erhalten sind (17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt). Im unteren Teil <strong>de</strong>s Turms befand sich <strong>de</strong>r Saal<br />
<strong>de</strong>r Wachen. Von einem vorspringen<strong>de</strong>n Balkon erkennt man bei Ebbe die Fundamente <strong>de</strong>s von Richelieu errichteten Damms, in Höhe von Fort Louis, hinter <strong>de</strong>r Promena<strong>de</strong>.<br />
Die Altstadt<br />
Die Altstadt besitzt einen regelmäßigen Grundriss mit rechtwinklig <strong>zu</strong>einan<strong>de</strong>r verlaufen<strong>de</strong>n Straßen, und hat die Charakteristik einer alten Han<strong>de</strong>ls- und Geschäftsstadt konserviert. Die<br />
sie heute noch in Teilen umschließen<strong>de</strong>n Wehrmauern und Außenwerke (o<strong>de</strong>r Ravelins) verraten die Handschrift von Vauban. Das Geschäftsviertel umschließt im Wesentlichen das<br />
Rathaus. Viele Arka<strong>de</strong>ngänge und überdachte Passagen bieten bei je<strong>de</strong>m Wetter <strong>de</strong>n flanieren<strong>de</strong>n Passanten Schutz. Die ältesten Häuser bestehen aus Fachwerkkonstruktionen <strong>de</strong>ren<br />
Holzstän<strong>de</strong>r und –riegel oft mit Schieferplatten geschützt sind.<br />
Porte <strong>de</strong> la Grosse Horloge<br />
Der Eingang <strong>zu</strong>r Altstadt von <strong>de</strong>r Hafenseite aus bil<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Uhrenturm mit Tordurchlass. Die <strong>de</strong>n im Grundriss rechteckigen Turm in ganzer Höhe flankieren<strong>de</strong>n Rundtürme wer<strong>de</strong>n von<br />
Seetrophäen verziert. Der gotische Torturm erhielt im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt nachträglich einen Aufbau, aus einem Glockenstuhl, auf bei<strong>de</strong>n Seiten mit großen Uhrzifferblättern bestückt, und<br />
von einer Kuppel und einer Laterne gekrönt.<br />
Hôtel <strong>de</strong> Ville<br />
Wie sehr oft in Ortschaften mit protestantischer Geschichte, ist auch in La Rochelle nicht ein Sakralbau, son<strong>de</strong>rn ein Profangebäu<strong>de</strong>, hier das Rathaus, <strong>de</strong>r beson<strong>de</strong>re Glanzpunkt <strong>de</strong>s<br />
Stadtzentrums, und <strong>de</strong>ssen be<strong>de</strong>utendstes Bauwerk. Bevor man das Rathausgebäu<strong>de</strong>, das um die Wen<strong>de</strong> vom 15. <strong>zu</strong>. 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt erbaut wor<strong>de</strong>n ist, betrachten kann, muss man<br />
<strong>zu</strong>nächst eine Barrika<strong>de</strong> überwin<strong>de</strong>n, aus einer eher schlichten gotischen Festungsmauer, mit Wehrgang und auskragen<strong>de</strong>n Pecherkern, auf <strong>de</strong>r linken rechtwinkligen Mauerecke<br />
<strong>zu</strong>sätzlich mit einem Belfried bewehrt. Sie umschließt einen geräumigen rechteckigen Innenhof, <strong>de</strong>r über zwei gotisch gestalteten Tore betreten wer<strong>de</strong>n kann, das kleinere für Fußgänger,
das größere für Fuhrwerke. Der schlanke, zylindrische Eckturm beginnt erst in Höhe <strong>de</strong>r Mauerkrone und überragt das Rathaus weit, mit einem sich nach oben bis <strong>zu</strong>r Spitze<br />
verjüngen<strong>de</strong>n Turmhelm mit einer offenen Glockenstube. Im Hof erhebt sich die Hauptfassa<strong>de</strong> <strong>de</strong>s prächtigen Renaissancepalastes. Die Bauarbeiten erstreckten sich von <strong>de</strong>r<br />
Grundsteinlegung 1544 bis <strong>zu</strong>m Beginn <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Der Einfluss <strong>de</strong>r italienischen Renaissance ist unverkennbar. Das Erdgeschoss wird hofseitig von einer Arka<strong>de</strong>ngalerie mit<br />
kannelierten Säulen begrenzt. Im ersten Obergeschoss kann man <strong>de</strong>n ehemalige Arbeitsraum <strong>de</strong>s Bürgermeisters Jean Guiton (sh. Geschichte) besuchen.<br />
Weitere Sehenswürdigkeiten <strong>de</strong>r Altstadt<br />
• Hôtel <strong>de</strong> la Bourse: 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt, Sitz <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lskammer, mit Arka<strong>de</strong>ninnenhof<br />
• Rue du Palais: Hauptstraße mit Arka<strong>de</strong>n und öffentlichen Gebäu<strong>de</strong>n<br />
• Rue Chaudrier: einer <strong>de</strong>r Verteidiger von La Rochelle; schönes altes Fachwerkhaus. In <strong>de</strong>r Nr. 54 befin<strong>de</strong>t sich das Café <strong>de</strong> la Paix, eine <strong>de</strong>r ältesten und schönsten Brasserien<br />
Frankreichs (Monument historique!).<br />
• Maison Henri II.: 1555 für Huges <strong>de</strong> Pontard erbaut<br />
• Gran<strong>de</strong> Rue <strong>de</strong>s Merciers: Arka<strong>de</strong>n und Häuser <strong>de</strong>s 16. und 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts, in mittelalterlichem Charakter, viele Fachwerkhäuser,<br />
• Palais <strong>de</strong> Justice: 1789 fertiggestellt, Renaissance<br />
• Cathedrale St.-Louis: teilweise über <strong>de</strong>n Fundamenten <strong>de</strong>r Kirche St.-Barthélemy erbaut<br />
• Rue <strong>de</strong> Minage: beidseitig von Arka<strong>de</strong>n gesäumt, sehr alte Häuser<br />
• Place du Marché: zwei Häuser aus <strong>de</strong>m 15. und 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Museen <strong>de</strong>r Altstadt<br />
• Musée d’Histoire naturelle: Naturkun<strong>de</strong>museum, ehemaliger Wohnsitz <strong>de</strong>s Gouverneurs<br />
• Musée du Nouveau Mon<strong>de</strong>: im Hôtel Fleuriau, Han<strong>de</strong>l zwischen La Rochelle und Amerika seit <strong>de</strong>r Renaissance<br />
• Musée d’Orbigny Bernon: Geschichte von La Rochelle<br />
• Musée <strong>de</strong>s Beaux-Arts: Kunstmuseum im bischöflichen Palast<br />
La Ville en Bois<br />
Die „Stadt aus Holz“ ist ein Viertel südlich <strong>de</strong>s Vorhafens gegenüber <strong>de</strong>m Tour <strong>de</strong> Lanterne, mit einigen Museen.<br />
• Neptunéa: Musée maritime: Seefahrtsmuseum<br />
• Musée à Flot: kleine Flotte Schiffe verschie<strong>de</strong>ner Größe mit <strong>de</strong>m Wetterschiff Franc I<br />
• Musée <strong>de</strong>s Automates: elektronische Roboter<br />
Port <strong>de</strong>s Minimes<br />
Der Port <strong>de</strong>s Minimes ist <strong>de</strong>r größte Jachthafen <strong>de</strong>r Atlantikküste mit über 3200 Liegeplätzen für Kielboote, mit drei Tiefwasserbecken.<br />
Aquarium<br />
La Rochelle besitzt ein großes Aquarium, eines <strong>de</strong>r schönsten Europas. Es verfügt über 65 Becken.<br />
Wirtschaft
Schiffbau, Fisch- und chemische Industrie sind die wichtigsten Industriezweige <strong>de</strong>r Stadt. Weiterhin ist <strong>de</strong>r Tourismus eine wichtige Stütze <strong>de</strong>r Wirtschaft.<br />
Klima<br />
Mittlere Temperatur von 5 °C im Januar, etwa 7 mm Regen.<br />
Mittlere Temperatur von 24 °C im Juli, etwa 4 mm Regen.<br />
Mittlere Sonnenscheindauer: 91 h im Januar, 302 h im Juli.<br />
Maritimes Klima.<br />
Verkehr<br />
La Rochelle ist an das System <strong>de</strong>r französischen Staatsbahn SNCF angeschlossen. Es gibt tägliche Verbindungen nach Montparnasse (ungefähr drei Stun<strong>de</strong>n) und Bor<strong>de</strong>aux, aber auch<br />
regionale Verbindungen in die näher liegen<strong>de</strong>n Städte.<br />
Der Busverkehr wird in La Rochelle von <strong>de</strong>r RTCR in einem sehr gut ausgebautem Netz von Buslinien durchgeführt. Auch eine Verbindung auf die Ile <strong>de</strong> Ré ist vorhan<strong>de</strong>n.<br />
Am Stadtrand gibt es einen Park & Ri<strong>de</strong>-Parkplatz, von <strong>de</strong>m aus man in <strong>de</strong>n Sommermonaten gratis ins Zentrum gelangt. Es gibt dort auch eine Servicestation für Wohnmobile<br />
(Wasserversorgung und Abwasserentsorgung).<br />
Der Flughafen La Rochelle (Aéroport <strong>de</strong> La Rochelle – île <strong>de</strong> Ré) liegt 2,5 km nordwestlich <strong>de</strong>s Stadtzentrums.<br />
Sport<br />
Bekanntester Sportverein <strong>de</strong>r Stadt ist Atlantique Sta<strong>de</strong> Rochelais, <strong>de</strong>r Rugby Union spielt und in <strong>de</strong>r höchsten Liga TOP 14 vertreten ist.<br />
Filmstadt La Rochelle<br />
• Anfang <strong>de</strong>r 1980er Jahre diente <strong>de</strong>r Hafen von La Pallice als Drehort für <strong>de</strong>n Film Das Boot von Wolfgang Petersen.<br />
• Ebenfalls <strong>zu</strong>r selben Zeit wie für Das Boot wur<strong>de</strong> im Hafen von La Pallice für <strong>de</strong>n erste Teil <strong>de</strong>r Indiana-Jones-Trilogie von Steven Spielberg gedreht.<br />
• 1980 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Film Der ungeratene Sohn von Regisseur Clau<strong>de</strong> Sautet mit Patrick Dewaere und Brigitte Fossey gedreht.<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
• François <strong>de</strong> Beauharnais, Generalmajor<br />
• Jacques Nicolas Billaud-Varenne, Revolutionär; Haupturheber <strong>de</strong>r Septembermassaker<br />
• Aimé Bonpland, Naturforscher<br />
• William Adolphe Bouguereau, Maler<br />
• Jean-Loup Jacques Marie Chrétien, französischer Raumfahrer, Kampf- und Testpilot<br />
• Victor Guy Duperré, Admiral<br />
• Jean-Baptiste Élissal<strong>de</strong>, Rugby-Union-Nationalspieler<br />
• René Antoine Ferchault <strong>de</strong> Réaumur, Wissenschaftler<br />
• Eugène Fromentin, Schriftsteller, Kunstkritiker und Maler<br />
• Louis Rattuit <strong>de</strong> Souches, kaiserlicher Feldherr
• Melissa Lauren, Pornodarstellerin<br />
Städtepartnerschaften<br />
La Rochelle unterhält freundschaftliche Beziehungen mit folgen<strong>de</strong>n sechs Gemein<strong>de</strong>n:[1]<br />
• New Rochelle, USA (seit 1910)<br />
• Lübeck, Deutschland (seit 1951)<br />
• Akkon, Israel (seit 1972)<br />
• Petrosawodsk, Russland (seit 1973)<br />
• Essaouira, Marokko (seit 1999)<br />
• Figueiró <strong>de</strong> Santiago, Portugal (seit 2003)<br />
Quellen, Literatur<br />
• Michelin-Reiseführer ATLANTIKKÜSTE Poitou Vendée Charentes Pyrenäen. 2. Auflage 1998<br />
• Thorsten Droste: POITOU, Westfrankreich zwischen Poitiers und Angoulême – die Atlantikküste von <strong>de</strong>r Loire bis <strong>zu</strong>r Giron<strong>de</strong>. DUMONT Kunst-Reiseführer, Köln 1999<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Homepage von La Rochelle, Abschnitt Jumelage (abgerufen am 1. April 2010)<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Belagerung von La Rochelle (1573)<br />
Die Belagerung von La Rochelle, angeordnet von König Karl IX. und befehligt vom Herzog von Anjou, <strong>de</strong>m späteren König Heinrich III., begann am 11. Februar 1573 und en<strong>de</strong>te am<br />
26. Juni <strong>de</strong>s gleichen Jahres.<br />
Die Bartholomäusnacht hatte <strong>de</strong>n Protestanten einen schweren Schlag versetzt. Der König und seine Mutter Katharina von Medici wollten das auf <strong>de</strong>r Gegenseite nun herrschen<strong>de</strong> Chaos<br />
nutzen, um sie endgültig unter ihre Autorität <strong>zu</strong> zwingen. Ihr Ziel war La Rochelle, die Stadt an <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>s französischen Protestantismus, <strong>de</strong>ren Fall einen Dominoeffekt bei <strong>de</strong>n<br />
an<strong>de</strong>ren protestantischen Städten erzeugen wür<strong>de</strong>. Der König hoffte, durch Verhandlungen <strong>zu</strong>m Ergebnis <strong>zu</strong> kommen, doch die Protestanten verweigerten die Unterwerfung, so dass die<br />
Belagerung beschlossen wur<strong>de</strong>.<br />
Der Herzog von Anjou wur<strong>de</strong> außer von seinem Bru<strong>de</strong>r François-Hercule noch von Heinrich von Navarra, <strong>de</strong>m späteren König Heinrich IV., und Henri I. <strong>de</strong> Bourbon, prince <strong>de</strong> Condé<br />
begleitet, die bei<strong>de</strong> gera<strong>de</strong> erst <strong>zu</strong>m Katholizismus konvertiert waren. Anjou kommandierte eine Armee von 5000 Infanteristen und 1000 Kavalleristen, darunter <strong>de</strong>r gesamte katholische<br />
A<strong>de</strong>l <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s: <strong>de</strong>r Großmeister <strong>de</strong>r Artillerie Armand <strong>de</strong> Gontaut-Biron, die Oberhäupter <strong>de</strong>r katholischen Partei, Luigi Gonzaga, Henri I. <strong>de</strong> Lorraine, duc <strong>de</strong> Guise, Charles II. <strong>de</strong><br />
Lorraine, duc <strong>de</strong> Mayenne, Clau<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lorraine, duc d’Aumale, Blaise <strong>de</strong> Montesquiou, seigneur <strong>de</strong> Montluc, aber auch Artus <strong>de</strong> Cossé-Brissac, Marschall von Frankreich, Henri <strong>de</strong> la
Tour d'Auvergne, Villequier, Pierre <strong>de</strong> Bour<strong>de</strong>ille, seigneur <strong>de</strong> Brantôme, Albert <strong>de</strong> Gondi, duc <strong>de</strong> Retz und Filippo Strozzi.<br />
La Rochelle hingegen war ohne tatsächlichen Militärbefehlshaber. François <strong>de</strong> La Noue arbeitete sowohl auf Rechnung <strong>de</strong>r Protestanten als auch <strong>de</strong>s Königs. Die Stadt war in <strong>de</strong>n<br />
Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Bürger, die etwa 1300 Soldaten unter Waffen hatten. Englische Schiffe versorgten sie mit Nachschub, während Königin Elisabeth I. mit Frankreich verbün<strong>de</strong>t war und<br />
offiziell die englischen Hilfslieferungen für La Rochelle verurteilte, sie aber tatsächlich unterstützte. Die Englän<strong>de</strong>r konnten ungehin<strong>de</strong>rt die Ree<strong>de</strong> anlaufen, entla<strong>de</strong>n und wie<strong>de</strong>r<br />
wegsegeln. Die Versuche, die Lücke <strong>zu</strong><strong>zu</strong>schütten, scheiterten. Am 19. April gelang es jedoch, eine englische Flotte unter <strong>de</strong>m Kommando von Montgomery durch einen Kanonenhagel<br />
<strong>zu</strong>r Umkehr <strong>zu</strong> zwingen.<br />
An Land wur<strong>de</strong>n von Februar bis Juni acht große Sturmangriffe auf die Mauern gestartet, Himmelfahrtskommandos, da kaum einer unverletzt von diesen Attacken <strong>zu</strong>rückkehrte. Der<br />
Herzog von Anjou war mehrmals unter <strong>de</strong>n Verletzten, Clau<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lorraine fiel am 3. März. Am 26. März starben 150 Belagerer bei einer vorzeitigen Explosion eines Geschosses, das<br />
über die Mauern geworfen wer<strong>de</strong>n sollte. Der Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r Protestanten, das Scheitern <strong>de</strong>r Sturmangriffe und Schwierigkeiten mit <strong>de</strong>m Proviant brachten die Belagerer <strong>zu</strong>r<br />
Verzweiflung. Intrigen kamen im königlichen Lager auf, mit François-Hercule an <strong>de</strong>r Spitze. Am 23. Mai kamen 6000 Truppen Schweizer Verstärkung an, aber <strong>de</strong>r Generalangriff drei<br />
Tage später scheiterte ebenfalls. Am 28. Mai erfuhr Heinrich III. von seiner Wahl <strong>zu</strong>m König von Polen.<br />
Die Belagerung wur<strong>de</strong> am 26. Juni aufgegeben, ein Frie<strong>de</strong>nsvertrag am 6. Juli unterzeichnet.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Belagerung von La Rochelle (1627–1628)<br />
Die Belagerung von La Rochelle durch Truppen <strong>de</strong>s französischen Königs Ludwig XIII. begann am 4. August 1627 und en<strong>de</strong>te am 28. Oktober 1628 mit <strong>de</strong>r Kapitulation <strong>de</strong>r von<br />
Hugenotten bewohnten Stadt.<br />
Hintergrund<br />
Im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt strahlte die Reformation in Form einer calvinistisch geprägten Glaubenslehre auch auf Frankreich aus. Vor allem im Südwesten <strong>de</strong>s französischen Königreichs<br />
nahmen viele Menschen <strong>de</strong>n neuen Glauben an und wur<strong>de</strong>n fortan als „Huguenots“ (Hugenotten) bezeichnet. Mehrere französische A<strong>de</strong>lsgeschlechter konvertierten <strong>zu</strong>m<br />
Protestantismus, wodurch sich die Konflikte mit <strong>de</strong>r Krone verschärften. 1562 brach <strong>de</strong>r erste <strong>de</strong>r insgesamt acht Hugenottenkriege aus, in <strong>de</strong>nen auch La Rochelle umkämpft war.<br />
Die am Golf von Biscaya gelegene Stadt La Rochelle war einer <strong>de</strong>r wichtigsten Stützpunkte <strong>de</strong>r Hugenotten. Der venezianische Ingenieur Scipione Vergano ließ 1569 die<br />
mittelalterlichen Mauern <strong>de</strong>r Stadt mit zeitgemäßen Bastionen und Wällen ausbauen, wodurch La Rochelle <strong>zu</strong> einer <strong>de</strong>r stärksten Festungen <strong>de</strong>r Hugenotten wur<strong>de</strong>. Am 11. Februar 1573<br />
begann ein Heer unter König Karl IX. mit <strong>de</strong>r Belagerung von La Rochelle, die am 6. Juli <strong>de</strong>sselben Jahres durch Verhandlungen been<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n konnte. Die königlichen Truppen hatten<br />
34.000 Kanonenkugeln auf die Stadt abgefeuert und acht erfolglose Sturmangriffe unternommen. Insgesamt wur<strong>de</strong>n über 20.000 Belagerer getötet o<strong>de</strong>r verwun<strong>de</strong>t. Seit<strong>de</strong>m galt La<br />
Rochelle als nahe<strong>zu</strong> uneinnehmbar.<br />
Unter König Heinrich IV. fan<strong>de</strong>n die Kriege ein En<strong>de</strong>. Heinrich IV. war selbst ein Hugenotte, nahm aber 1593 <strong>de</strong>n katholischen Glauben an. Mit <strong>de</strong>m Edikt von Nantes (1598) garantierte
er <strong>de</strong>n Hugenotten politische und religiöse Privilegien und gestand ihnen mehrere Sicherheitsplätze <strong>zu</strong>, in <strong>de</strong>nen sie auf Staatskosten eigene Garnisonen unterhalten durften. Nach<br />
Heinrichs Ermordung 1610 wur<strong>de</strong> sein Sohn als Ludwig XIII. <strong>zu</strong>m französischen König gekrönt. Ludwigs absolutistische Bestrebungen richteten sich unter an<strong>de</strong>rem gegen die<br />
Son<strong>de</strong>rrechte <strong>de</strong>r Hugenotten, was <strong>de</strong>ren Wi<strong>de</strong>rstand provozierte. 1621 erhoben sich die Hugenotten, woraufhin Ludwig XIII. einen Feld<strong>zu</strong>g gegen sie unternahm. Dabei scheiterte er an<br />
<strong>de</strong>r Eroberung von Montauban und Montpellier und musste am 10. Oktober 1622 das Edikt von Nantes bestätigen. Die Befestigungsanlagen von La Rochelle und Montauban durften<br />
beibehalten wer<strong>de</strong>n.<br />
1624 wur<strong>de</strong> Kardinal Richelieu <strong>zu</strong>m neuen leiten<strong>de</strong>n Minister unter Ludwig XIII. ernannt. Richelieu trat für die vollständige Beseitigung <strong>de</strong>r politischen Son<strong>de</strong>rrechte <strong>de</strong>r Hugenotten<br />
ein und übte dabei einen großen Einfluss auf König Ludwig aus. Ludwig verschärfte seine gegen die Hugenotten gerichtete Politik, was erneut <strong>zu</strong> Erhebungen führte. Unter Benjamin <strong>de</strong><br />
Rohan stellten die Hugenotten im Januar 1625 Truppen in <strong>de</strong>r Provinz Poitou auf. Diese besetzten die Île <strong>de</strong> Ré westlich von La Rochelle und setzten von dort aus nach Oléron über, wo<br />
sie die königliche Garnison besiegten. Benjamins älterer Bru<strong>de</strong>r Henri II. <strong>de</strong> Rohan hatte während<strong>de</strong>ssen mit <strong>de</strong>r Aushebung von Truppen in Languedoc begonnen. In dieser Situation<br />
richteten die Hugenotten For<strong>de</strong>rungen an <strong>de</strong>n König. Ludwig XIII. erklärte sich <strong>zu</strong> einer Bestätigung <strong>de</strong>s Edikts von Nantes bereit, verlangte aber im Gegen<strong>zu</strong>g die Beschränkung <strong>de</strong>r<br />
Befestigungsanlagen von La Rochelle auf die mittelalterliche Mauer und die Einset<strong>zu</strong>ng eines königlichen Verwalters als oberste Autorität in <strong>de</strong>r Stadt. Die Rohans lehnten dies ab und<br />
ersuchten ausländische Unterstüt<strong>zu</strong>ng.<br />
Benjamin <strong>de</strong> Rohan begab sich in das protestantische England, um dort militärische Hilfe <strong>zu</strong> erbitten. Er nahm Kontakt <strong>zu</strong>m Duke of Buckingham George Villiers auf, <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m<br />
englischen König Karl I. befreun<strong>de</strong>t war. Villiers ließ eine Flotte mit 5000 Soldaten bemannen und begab sich mit Benjamin nach La Rochelle. Als sie am 25. Juli 1627 vor <strong>de</strong>r Stadt<br />
eintrafen, entschie<strong>de</strong>n sich Villiers <strong>zu</strong>nächst für einen Angriff auf die Insel Ré, die bereits von königlichen Truppen besetzt wor<strong>de</strong>n war. Die englischen Soldaten gingen im Osten <strong>de</strong>r<br />
Insel an Land und schlugen einen Angriff <strong>de</strong>r Franzosen <strong>zu</strong>rück, welche sich daraufhin in die Forts <strong>de</strong> la Prée in <strong>de</strong>r Gemeine von La Flotte und Saint-Martin <strong>zu</strong>rückzogen. Villiers ließ<br />
das Fort belagern, während unter <strong>de</strong>n Bewohnern von La Rochelle Uneinigkeit darüber herrschte, wie man sich gegenüber <strong>de</strong>n Englän<strong>de</strong>rn verhalten solle.<br />
Verlauf<br />
Am 4. August traf ein königliches Heer mit einer Stärke von 11.000 Mann unter <strong>de</strong>m Befehl <strong>de</strong>s Herzogs von Angoulême vor La Rochelle ein. Angoulême legte <strong>de</strong>n Bewohnern <strong>de</strong>r<br />
Stadt die Kapitulation nahe, was bei diesen heftige Diskussionen auslöste. Die königlichen Truppen verhielten sich <strong>zu</strong>nächst friedlich, doch gingen sie am 10. September da<strong>zu</strong> über, das<br />
westlich von La Rochelle befindliche Fort St. Louis aus<strong>zu</strong>bauen. Die Hugenotten betrachteten dies als Provokation und nahmen das Fort unter Geschützfeuer. Die königlichen Truppen<br />
erwi<strong>de</strong>rten das Feuer. Angoulême ließ nun einen Ring aus Feldbefestigungen um die Stadt errichten und stellte seine Soldaten auf einen langwierigen Belagerungskampf ein. In La<br />
Rochelle war je<strong>de</strong>r männliche Erwachsene <strong>zu</strong>r Verteidigung <strong>de</strong>r Stadt aufgerufen. Bürgermeister Jean Guiton und Benjamin <strong>de</strong> Rohan übernahmen <strong>de</strong>n Oberbefehl.<br />
Am 7. Oktober gelang es <strong>de</strong>n Mannschaften von 46 königlichen Transportschiffen, auf <strong>de</strong>r Île <strong>de</strong> Ré an Land <strong>zu</strong> gehen und die Besat<strong>zu</strong>ng vom Fort St. Martin mit Lebensmitteln und<br />
Munition <strong>zu</strong> versorgen. Der Gouverneur <strong>de</strong>r Insel und Oberbefehlshaber <strong>de</strong>r französischen Truppen, Jean <strong>de</strong> Saint-Bonnet, Marquis <strong>de</strong> Toiras hatte es bereits in Betracht gezogen, wegen<br />
Nahrungsmangel <strong>zu</strong> kapitulieren. Am 12. Oktober traf Ludwig XIII. mit neuen Truppen vor La Rochelle ein. Das königliche Heer war nun auf eine Stärke von über 20.000 Soldaten<br />
angewachsen. Am 7. November befahl Villiers einen Sturmangriff auf das Fort St. Martin, <strong>de</strong>r lediglich <strong>zu</strong>r Eroberung <strong>de</strong>s äußeren Walles führte. Villiers plante daraufhin <strong>de</strong>n Rück<strong>zu</strong>g<br />
nach England, doch setzten in <strong>de</strong>r Nacht auf <strong>de</strong>n 8. Oktober 4.000 französische Soldaten auf die Île <strong>de</strong> Ré über und griffen die Englän<strong>de</strong>r am Morgen an. Die Besat<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Forts nutzte<br />
dies <strong>zu</strong> einem Ausfall gegen Villiers' Truppen, unter <strong>de</strong>nen ein Blutbad angerichtet wur<strong>de</strong>. Villiers gehörte <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n wenigen, <strong>de</strong>nen die Flucht auf ein Schiff gelang.<br />
Während <strong>de</strong>s Winters ließ Ludwig XIII. weitere Verbän<strong>de</strong> heranziehen, bis das Belagerungsheer im Januar 1628 über 30.000 Soldaten umfasste. Obwohl seit Beginn <strong>de</strong>r Belagerung<br />
bereits mehrere Monate vergangen waren, verfügten die Verteidiger von La Rochelle über ausreichend Nahrung und Munition, da sie über <strong>de</strong>n Seeweg von englischen Schiffen mit<br />
Nachschub versorgt wur<strong>de</strong>n. Die Belagerer begannen <strong>de</strong>shalb in <strong>de</strong>r Bucht von La Rochelle mit <strong>de</strong>m Bau eines Deiches, mit <strong>de</strong>m die Stadt vollständig von <strong>de</strong>r Außenwelt abgeschnitten<br />
wer<strong>de</strong>n sollte. Auf <strong>de</strong>m Deich wur<strong>de</strong>n Kanonen postiert, die man gegen die feindlichen Schiffe einsetzte. Von einem Überläufer erfuhr man auf königlicher Seite, dass ein unbewachter<br />
Zugang in die Stadt führe. Kardinal Richelieu brach in <strong>de</strong>r Nacht auf <strong>de</strong>n 13. März mit 5.000 Soldaten auf, um La Rochelle auf diesem Wege <strong>zu</strong> erstürmen. Seine Kundschafter verirrten<br />
sich jedoch in <strong>de</strong>r Sumpflandschaft nördlich <strong>de</strong>r Stadt, und ent<strong>de</strong>ckten erst am Morgen <strong>de</strong>n ungeschützten Zugang. Die Hugenotten wur<strong>de</strong>n durch die Präsenz zahlreicher Gegner<br />
alarmiert und schlossen die Lücke in ihren Befestigungsanlagen.<br />
Die Seeblocka<strong>de</strong> zeigte bereits im Frühjahr 1628 Wirkung. In La Rochelle brach eine Hungersnot aus, <strong>de</strong>r täglich mehrere Hun<strong>de</strong>rt Menschen <strong>zu</strong>m Opfer fielen. Die Zahl <strong>de</strong>r Überläufer
vergrößerte sich, während auf Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Stadtrats Anschläge unternommen wur<strong>de</strong>n. An manchen Tagen wur<strong>de</strong> über die Hälfte einer Kompanie tot aufgefun<strong>de</strong>n, welche die<br />
Nachtwache auf einem Wall übernommen hatte. Selbst Gras und Schuhsohlen wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Hugenotten verzehrt. Mit <strong>de</strong>m Eintreffen eines Entsatzheeres unter Henri <strong>de</strong> Rohan<br />
konnten die Einwohner <strong>de</strong>r Stadt nicht mehr rechnen. Bis <strong>zu</strong>m 12. Oktober trafen mehrere englische Flotten vor <strong>de</strong>r Stadt ein, die ausnahmslos von <strong>de</strong>n Truppen <strong>de</strong>s Königs abgewiesen<br />
wur<strong>de</strong>n. Am 27. Oktober eröffnete Bürgermeister Jean Guiton Verhandlungen mit <strong>de</strong>n Belagerern. Die Stadt kapitulierte am nächsten Tag, <strong>de</strong>m 28. Oktober.[1] Ludwig XIII. und<br />
Richelieu marschierten am 30. Oktober mit ihren Truppen in die Stadt ein. Guiton wur<strong>de</strong> aus Frankreich verbannt, während Benjamin <strong>de</strong> Rohan die Flucht nach England gelang.<br />
Resultat<br />
Etwa drei Viertel <strong>de</strong>r Einwohner von La Rochelle waren verhungert. Ludwig XIII. hatte für die Belagerung die enorme Summe von 40 Millionen Livre aufgewen<strong>de</strong>t. Die<br />
Befestigungsanlagen von La Rochelle wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r Einnahme <strong>de</strong>r Stadt geschleift. Durch die Auflösung sämtlicher Sicherheitsplätze fielen die Hugenotten als militärischer<br />
Machtfaktor weg, doch wur<strong>de</strong>n ihre bisherigen religiösen Freiheiten 1629 im Gna<strong>de</strong>nedikt von Alès bestätigt. Dadurch wur<strong>de</strong> die innenpolitische Situation stabilisiert, so dass sich die<br />
französische Krone auf eine vor allem gegen Habsburg gerichtete Machtpolitik konzentrieren konnte. Unter Ludwig XIV. wur<strong>de</strong>n 1685 mit <strong>de</strong>m Edikt von Fontainebleau die religiösen<br />
Freiheiten <strong>de</strong>r Hugenotten beseitigt. Mehrere Hun<strong>de</strong>rttausend Hugenotten flohen aus Frankreich.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Hugenotten. In: Meyers Konversations-Lexikon. 4. Auflage. Bd. 8, Bibliographisches Institut, Leipzig 1885–1892, S. 770.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Lissabon<br />
Lissabon (port. Lisboa) ist die Hauptstadt und die größte Stadt Portugals sowie <strong>de</strong>s gleichnamigen Regierungsbezirkes und liegt an einer Bucht <strong>de</strong>r Flussmündung <strong>de</strong>s Tejo im äußersten<br />
Südwesten Europas an <strong>de</strong>r Atlantikküste <strong>de</strong>r Iberischen Halbinsel.<br />
Der Han<strong>de</strong>lshafen an <strong>de</strong>r Tejo-Bucht wur<strong>de</strong> vor <strong>de</strong>r römischen Herrschaft Alis Ubbo genannt. Lissabon erhielt <strong>zu</strong> Zeiten Julius Caesars unter <strong>de</strong>m Namen Felicitas Julia römische<br />
Stadtrechte. Nach <strong>de</strong>r Verlegung <strong>de</strong>s Königssitzes von Coimbra wur<strong>de</strong> die Stadt im Jahre 1256 unter König Afonso III. <strong>zu</strong>r Hauptstadt <strong>de</strong>s Königsreichs. Um 1500 erlebte Lissabon einen<br />
brillanten Aufstieg <strong>zu</strong> einer <strong>de</strong>r glanzvollsten Han<strong>de</strong>ls- und Hafenstädte <strong>de</strong>r damaligen Zeit. Ein großes Erdbeben besiegelte im Jahr 1755 <strong>de</strong>n angefangenen wirtschaftlichen Nie<strong>de</strong>rgang<br />
<strong>de</strong>r Stadt.<br />
Als größte Stadt Portugals mit <strong>de</strong>m wichtigsten Hafen, <strong>de</strong>m Regierungssitz, <strong>de</strong>n obersten Staats- und Regierungsbehör<strong>de</strong>n, mehreren Universitäten und <strong>de</strong>r Aka<strong>de</strong>mie <strong>de</strong>r Wissenschaften<br />
ist Lissabon heute das politische, wirtschaftliche und kulturelle Zentrum <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s.<br />
Lissabon ist Sitz einiger Agenturen <strong>de</strong>r Europäischen Union, darunter <strong>de</strong>r Europäischen Beobachtungsstelle für Drogen und Drogensucht und <strong>de</strong>r Europäischen Agentur für die<br />
Sicherheit <strong>de</strong>s Seeverkehrs. Auch die Gemeinschaft <strong>de</strong>r portugiesischsprachigen Län<strong>de</strong>r (CPLP) hat ihren Hauptsitz in Lissabon.
Geographie<br />
Das Stadtgebiet von Lissabon entspricht auch <strong>de</strong>m Kreis und umfasst 84,7 km² Fläche mit 499.700 Einwohnern (Stand 2007)[1]. Im Ein<strong>zu</strong>gsgebiet <strong>de</strong>r Stadt, genannte Gran<strong>de</strong> Área<br />
Metropolitana <strong>de</strong> Lisboa, leben jedoch mit 2.808.414 (Stand 2007)[2] Einwohnern mehr als 25 % <strong>de</strong>r portugiesischen Bevölkerung. Lissabons Metropolitangebiet erstreckt sich über<br />
Gran<strong>de</strong> Lisboa, in <strong>de</strong>r nördlichen Bank <strong>de</strong>s Tejos, und Península <strong>de</strong> Setúbal im Sü<strong>de</strong>n.<br />
Geographische Lage<br />
Lissabon befin<strong>de</strong>t sich auf <strong>de</strong>r Iberischen Halbinsel. Die Stadt liegt an einer Bucht am nördlichen Ufer <strong>de</strong>r Flussmündung <strong>de</strong>s Tejos im äußersten Südwesten Europas an <strong>de</strong>r<br />
Atlantikküste. Der sich kurz vor seiner Mündung ausbreiten<strong>de</strong> Tejo verengt sich auf <strong>de</strong>n letzten Kilometern bis <strong>zu</strong>m Atlantik. Dort zieht sich die Stadt am Ufer entlang. Vom Ufer aus<br />
steigt sie stufenförmig an mehreren Hügeln empor. In Lissabon gibt es hohe Hügel und tiefe Taleinschnitte. Die höchste Erhebung im Stadtgebiet erreicht 226 Meter. Die Stadt hat sich<br />
lange Zeit nur am Tejo entlang entfaltet. Seit <strong>de</strong>m 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt breitet sich die Hauptstadt beständig lan<strong>de</strong>inwärts aus.<br />
Geologie<br />
Die Stadt liegt auf sieben Hügeln, die kleineren Anhöhen nicht mitgerechnet. Im Atlantik auf <strong>de</strong>r Höhe von Cádiz verläuft in ost-westlicher Richtung eine tektonische Verwerfung, die so<br />
genannte Gloria-Blattverschiebung. Zwei weitere tektonische Beson<strong>de</strong>rheiten, die Gorringe-Bank und die Marquês-<strong>de</strong>-Pombal-Verwerfung, liegen auf Höhe <strong>de</strong>r portugiesischen<br />
Südküste. Erdbeben sind eine Folge <strong>de</strong>s Zusammenstoßens <strong>de</strong>r nordwärts driften<strong>de</strong>n afrikanischen Platte mit <strong>de</strong>r iberischen Halbinsel (eurasischen Platte).[3] Des Weiteren <strong>de</strong>uten<br />
zahlreiche aktive Schlammvulkane im Golf von Cadiz auf fortwähren<strong>de</strong> seismische Aktivitäten in <strong>de</strong>r Region hin. Aufgrund <strong>de</strong>r vergangenen Erdbeben wur<strong>de</strong>n 2004 am Meeresbo<strong>de</strong>n<br />
Beobachtungspunkte angelegt. Sie sollen Temperatur- und Druckschwankungen messen, die auf Spannungen in <strong>de</strong>r Erdkruste hin<strong>de</strong>uten, die sich in einem Erdbeben entla<strong>de</strong>n können.<br />
Klima<br />
Die Klimaklassifikation nach Lauer und Frankenberg (1987) ordnet das Klima Portugals <strong>de</strong>m maritimen und semihumi<strong>de</strong>n Klima <strong>de</strong>r subtropischen Klimazone <strong>zu</strong>. Aufgrund seiner Lage<br />
direkt am Atlantik wird es vom Temperaturverhalten <strong>de</strong>s Meeres geprägt: Nicht <strong>zu</strong> heiße Sommer und verhältnismäßig mil<strong>de</strong> Winter. Die Temperaturen fallen nur selten unter 0 °C. Noch<br />
seltener sind Schneefälle <strong>zu</strong> verzeichnen.<br />
Die Monate mit <strong>de</strong>n höchsten Nie<strong>de</strong>rschlagswerten sind Oktober bis März. Entschei<strong>de</strong>nd ist die Lage am kühlen Kanarenstrom, <strong>de</strong>r in südlicher Richtung an <strong>de</strong>r Küste Portugals<br />
entlangstreicht. Er bewirkt in <strong>de</strong>r warmen Jahreszeit häufig Küstennebel. Im Winter liegt Lissabon im Einflussbereich atlantischer Tiefausläufer, die im Küstenbereich viel Regen<br />
bringen. Das jährliche Nie<strong>de</strong>rschlagsmittel beträgt 656 mm.<br />
Etymologie<br />
Es gibt unterschiedliche Erklärung <strong>zu</strong>r Namensentstehung. Lissabon wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Goten und Römern Olissipona bzw. Olisibona genannt[5] Die Volksetymologie sieht darin einen<br />
Zusammenhang mit <strong>de</strong>m Hel<strong>de</strong>n Odysseus.[6] Unter Julius Caesars hieß <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>r Provinz Lusitania gehören<strong>de</strong> Ort Felicitas Julia. An<strong>de</strong>re leiten <strong>de</strong>n Namen Lissabon von <strong>de</strong>m<br />
phönizischen Alis ubbo ab.[7] Eine weitere Theorie erklärt die Namenschöpfung mit <strong>de</strong>n vorrömischen Namen <strong>de</strong>s Flusses Tejo, „Lisse“ o<strong>de</strong>r „Lucio“.<br />
Stadtglie<strong>de</strong>rung<br />
Lissabon ist in 53 Stadtgemein<strong>de</strong>n (freguesias) aufgeglie<strong>de</strong>rt, die wie<strong>de</strong>rum aus administrativen Grün<strong>de</strong>n vier Bezirken (bairros) <strong>zu</strong>geordnet sind:<br />
• Ajuda (2. Bairro)<br />
• Alcântara (2. Bairro)<br />
• Alto do Pina (4. Bairro)
• Alvala<strong>de</strong> (3. Bairro)<br />
• Ameixoeira (3. Bairro)<br />
• Anjos (1. Bairro)<br />
• Beato (4. Bairro)<br />
• Benfica (3. Bairro)<br />
• Campo Gran<strong>de</strong> (3. Bairro)<br />
• Campoli<strong>de</strong> (3. Bairro)<br />
• Carni<strong>de</strong> (3. Bairro)<br />
• Castelo (1. Bairro)<br />
• Charneca (3. Bairro)<br />
• Coração <strong>de</strong> Jesus (1. Bairro)<br />
• Encarnação (1. Bairro)<br />
• Graça (1. Bairro)<br />
• Lapa (2. Bairro)<br />
• Lumiar (3. Bairro)<br />
• Madalena (1. Bairro)<br />
• Mártires (1. Bairro)<br />
• Marvila (4. Bairro)<br />
• Mercês (1. Bairro)<br />
• Nossa Senhora <strong>de</strong> Fátima (3. Bairro)<br />
• Pena (1. Bairro)<br />
• Penha <strong>de</strong> França (4. Bairro)<br />
• Prazeres (2. Bairro)<br />
• Sacramento (1. Bairro)<br />
• Santa Catarina (1. Bairro)<br />
• Santa Engrácia (1. Bairro)<br />
• Santa Isabel (2. Bairro)<br />
• Santa Justa (1. Bairro)<br />
• Santa Maria <strong>de</strong> Belém (2. Bairro)<br />
• Santa Maria dos Olivais (4. Bairro)<br />
• Santiago (1. Bairro)<br />
• Santo Con<strong>de</strong>stável (2. Bairro)<br />
• Santo Estêvão (1. Bairro)<br />
• Santos-o-Velho (2. Bairro)<br />
• São Cristóvão e São Lourenço (1. Bairro)<br />
• São Domingos <strong>de</strong> Benfica (3. Bairro)<br />
• São Francisco Xavier (2. Bairro)<br />
• São João (4. Bairro)
• São João <strong>de</strong> Brito (3. Bairro)<br />
• São João <strong>de</strong> Deus (4. Bairro)<br />
• São Jorge <strong>de</strong> Arroios (4. Bairro)<br />
• São José (1. Bairro)<br />
• São Mame<strong>de</strong> (1. Bairro)<br />
• São Miguel (1. Bairro)<br />
• São Nicolau (1. Bairro)<br />
• São Paulo (1. Bairro)<br />
• São Sebastião da Pedreira (3. Bairro)<br />
• São Vicente <strong>de</strong> Fora (1. Bairro)<br />
• Sé (1. Bairro)<br />
• Socorro (1. Bairro)<br />
Geschichte<br />
Die Stadt wur<strong>de</strong> in ihrer Geschichte mehrfach von Erdbeben, Feuersbrünsten und Epi<strong>de</strong>mien heimgesucht.<br />
Anfänge bis <strong>zu</strong>r Rückeroberung <strong>de</strong>r Stadt<br />
Die Phönizier grün<strong>de</strong>ten ab 1200 v. Chr. in Portugal Kolonien. Diese und die Karthager sollen <strong>de</strong>n Platz Alis Ubbo (dt. fröhliche Meeresbucht bzw. lustiger Meeresbusen) als einzigen<br />
großen Naturhafen an <strong>de</strong>r iberischen Atlantikküste genutzt haben, archäologisch wur<strong>de</strong> dies bisher nicht bewiesen, hingegen wur<strong>de</strong>n griechische Siedlungsspuren gefun<strong>de</strong>n. Nach Plinius<br />
<strong>de</strong>m Älteren war Lissabon eine Gründung von Odysseus.<br />
Unter römischer Herrschaft ab 205 v. Chr. hieß die Stadt <strong>zu</strong>nächst Olisipo. Julius Caesar gelang es im Keltiberischen Krieg ab 60 v. Chr. von Lissabon aus, <strong>de</strong>n letzten Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r<br />
portugiesischen Stämme <strong>zu</strong> brechen. Unter Caesar erhielt die Ortschaft 48 v. Chr. die römischen Stadtrechte und war nachfolgend als Felicitas Julia ein größerer Ort in <strong>de</strong>r Provinz<br />
Lusitania. Nach <strong>de</strong>m Zerfall <strong>de</strong>s römischen Reiches kamen ab 400 n. Chr. germanische Stämme aus <strong>de</strong>m Nor<strong>de</strong>n auf die Iberische Halbinsel.[8] Während <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rungszeit<br />
versuchten Alanen, Vandalen und Westgoten Lissabon <strong>zu</strong> besetzen. Im Jahr 585 n. Chr. begann die Herrschaft <strong>de</strong>r Westgoten in <strong>de</strong>r Stadt. Diese erneuerten wahrscheinlich die bereits<br />
vorhan<strong>de</strong>ne römische Festungsmauer.<br />
719 wur<strong>de</strong> Lissabon von Mauren erobert und später Teil <strong>de</strong>s Emirats von Córdoba. Danach erlebte die Stadt ihren ersten Aufschwung. Alfons II. siegte bei Lugo im Kampf gegen die<br />
Mauren, drang bis <strong>zu</strong>m Tajo vor und eroberte 798 für kurze Zeit die Stadt.[9] Lissabon fiel jedoch danach wie<strong>de</strong>r an die Mauren. Es entstand das Kalifat von Córdoba. Im Jahr 955<br />
sandte Ordonho III <strong>de</strong> Leão im Kampf gegen die Muslime seine Armee bis nach Lissabon.[10]<br />
1093 bekam Graf Raymond von Armous, ein jüngerer Sohn <strong>de</strong>s Herzogs Wilhelm I. von Burgund die Herrschaft in Galicien übertragen. Von dort aus unternahm er Feldzüge gegen die<br />
Mauren. Dabei gelang ihm sogar, vorübergehend in Lissabon ein<strong>zu</strong>ziehen, nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r muslimische König von Badajoz, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m Lissabon gehörte, sich König Alfons unterworfen hatte.<br />
[11]<br />
Beim Regierungsantritt von König Dom Alfonso Henriques wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s noch von Mauren gehalten. Im Jahr 1147 gelang die Belagerung von Lissabon (reconquista dt.<br />
Rückeroberung) durch die Christen. Die erfolgreiche Belagerung <strong>de</strong>r Stadt durch ein Kreuzritterheer <strong>de</strong>s Zweiten Kreuz<strong>zu</strong>gs sicherte <strong>de</strong>m König die Grundlage für die Herrschaft über<br />
das gesamte Land. Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts erblickte <strong>de</strong>r heilige Antonius von Padua, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>weilen auch Antonius von Lissabon genannt wird, in Lissabon das Licht <strong>de</strong>r Welt.<br />
Hauptstadt <strong>de</strong>s Königsreichs bis <strong>zu</strong>r spanischen Beset<strong>zu</strong>ng
Afonso III. verlegte 1256 <strong>de</strong>n Königssitz von Coimbra nach Lissabon. Die Stadt wur<strong>de</strong> damit <strong>zu</strong>r Hauptstadt <strong>de</strong>s Königsreichs. 1344 erschütterte ein Erdbeben die Stadt.[12] Die große<br />
Pest, <strong>de</strong>r von September 1348 bis Anfang 1349 wahrscheinlich mehr als ein Drittel <strong>de</strong>r Bevölkerung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s <strong>zu</strong>m Opfer fielen, <strong>de</strong>zimierte auch radikal die Bevölkerung <strong>de</strong>r<br />
portugiesischen Hauptstadt.<br />
Ferdinand I. ließ nach seiner Thronbesteigung 1367 eine Stadtmauer errichten. Die Bauarbeiten an <strong>de</strong>r Ringmauer waren um 1370 abgeschlossen. Im Frie<strong>de</strong>n von Alcoutim verpflichtete<br />
sich Ferdinand I. unter an<strong>de</strong>rem eine Tochter Heinrich II. <strong>zu</strong> heiraten. Er verliebte sich dann aber in die portugiesische Adlige, Leonore Teles <strong>de</strong> Menezes, und heiratete diese anstatt <strong>de</strong>r<br />
kastilischen Prinzessin. Verärgert über <strong>de</strong>n Vertragsbruch griff Heinrich II daraufhin Portugal an und plün<strong>de</strong>rte im Jahr 1373 Lissabon. Zehn Jahre später war Lissabon Schauplatz <strong>de</strong>r<br />
ersten bürgerlichen Revolution in Europa. Nach <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> Ferdinands I. übernahm <strong>zu</strong>nächst <strong>de</strong>ssen Witwe, Leonore Teles <strong>de</strong> Menezes, <strong>zu</strong>sammen mit ihrem Liebhaber für sechs Wochen<br />
die Macht. Daraus erwachsen<strong>de</strong> Spannungen und Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mün<strong>de</strong>ten schließlich in die Krise bzw. Revolution von 1383. In Lissabon kam es <strong>zu</strong> einem Aufstand <strong>de</strong>r<br />
Handwerkerzünfte. Gestützt auf große Teile <strong>de</strong>s nie<strong>de</strong>ren A<strong>de</strong>ls und auf das Bürgertum von Porto und Lissabon stellte sich <strong>de</strong>r spätere König Johann I. an die Spitze <strong>de</strong>s Aufstan<strong>de</strong>s,<br />
tötete eigenhändig Leonores Liebhaber und zwang Lenore ins Exil nach Kastilien.<br />
Unter <strong>de</strong>r Herrschaft Manuels I. entwickelte sich Lissabon <strong>zu</strong> einem führen<strong>de</strong>n Zentrum <strong>de</strong>s Welthan<strong>de</strong>ls. Am 9. September 1499 wur<strong>de</strong> Vasco da Gama nach seiner ersten Indienreise<br />
ein triumphaler Empfang bereitet. 1503 kam es in Lissabon <strong>zu</strong>r Gründung <strong>de</strong>r Casa da Índia, <strong>de</strong>ren Tätigkeit die Basis <strong>de</strong>r portugiesische Wirtschafts- und Han<strong>de</strong>lspolitik in <strong>de</strong>n<br />
folgen<strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Jahrhun<strong>de</strong>rten bil<strong>de</strong>te. Beson<strong>de</strong>rs in Lissabon wuchsen Han<strong>de</strong>l und Gewerbe, was nicht unwesentlich <strong>de</strong>r Ausbeutung <strong>de</strong>r portugiesischen Kolonien in Afrika, Asien<br />
und Südamerika <strong>zu</strong> verdanken war. Bereits um 1500 sprach man von einer ersten Blüte Lissabons, die bis Mitte <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts andauerte. Der Lissaboner Hafen war in <strong>de</strong>r<br />
damaligen Zeit einer <strong>de</strong>r größten <strong>de</strong>r Er<strong>de</strong>.<br />
1506 kam es <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Herrschaft Manuel I. in <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> einem Pogrom gegen die getauften Ju<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r hohe Opfer for<strong>de</strong>rte, die Han<strong>de</strong>ls- und Finanzbeziehungen <strong>de</strong>r Stadt<br />
nachhaltig schädigte und eine Auswan<strong>de</strong>rungswelle in Gang setzte.[13] Die erste Volkszählung in Portugal wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Zeit von 1527 bis 1532 durchgeführt. Lissabon zählte 13.010<br />
Haushalte bzw. zwischen 50.000 und 65.000 Einwohner.[14] Die Stadt hatte sich <strong>zu</strong> einer europäischen Metropole entwickelt. 1531 wur<strong>de</strong> sie jedoch erneut von einem Erdbeben<br />
erschüttert. Dabei kam eine unbekannte Zahl von Einwohnern ums Leben. Die Schätzzahlen liegen zwischen 1.000 bis 30.000 Menschen.[15]<br />
1536 wur<strong>de</strong> unter Johann III. die Inquisition eingeführt. Vier Jahre später fan<strong>de</strong>n in Lissabon die ersten öffentlichen Vollstreckungen von Urteilen statt.[16] 1569 for<strong>de</strong>rte eine<br />
Pestepi<strong>de</strong>mie in Lissabon und Umgebung 60.000 Menschenleben.<br />
Von <strong>de</strong>r spanischen Beset<strong>zu</strong>ng bis <strong>zu</strong>m großen Erdbeben<br />
In einem Portugalfeld<strong>zu</strong>g nahm 1580 <strong>de</strong>r Herzog von Alba Lissabon in Besitz. Zwei Jahre später verstarb er in Lissabon als Portugiesischer Generalgouverneur. Vom Tag <strong>de</strong>r Eroberung<br />
blieb Lissabon für die folgen<strong>de</strong>n 60 Jahre von <strong>de</strong>n Spaniern besetzt. Am 28. Mai 1588 liefen die ersten Schiffe <strong>de</strong>r Spanischen Armada gegen England aus Lissabon aus. Der Aufbruch<br />
<strong>de</strong>r Kriegsflotte mit 130 Schiffen zog sich bis <strong>zu</strong>m 30. Mai hin. Die Schiffe waren mit etwa 27.000 Soldaten bemannt und mit über 2600 Kanonen bestückt.<br />
Am 1. Dezember 1640 schlossen sich mehrere portugiesische Adlige <strong>zu</strong>m Aufstand gegen die spanische Regierung <strong>zu</strong>sammen. Frankreich, <strong>de</strong>r große Wi<strong>de</strong>rsacher <strong>de</strong>r Habsburger und<br />
damit Spaniens, sah darin eine Chance, die Spanier <strong>zu</strong> schwächen und ermunterte <strong>de</strong>n Herzog von Braganza <strong>zu</strong>m Aufstand. In einem Handstreich wur<strong>de</strong> die spanische Statthalterin, die<br />
Herzogin von Mantua, in Lissabon gestürzt und das Oberhaupt <strong>de</strong>r Familie Braganza, Herzog Johann II. am 15. Dezember 1640 als Johann IV. <strong>zu</strong>m König von Portugal ausgerufen. 1668<br />
been<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r Vertrag von Lissabon <strong>de</strong>n Spanisch-Portugiesischen Krieg.<br />
1696 leiteten Gold- und spätere Diamantenfun<strong>de</strong> in Brasilien eine zweite Blüte <strong>de</strong>r portugiesischen Hauptstadt ein. Am 27. Dezember 1703 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Methuenvertrag zwischen England<br />
und Portugal in Lissabon geschlossen. Das Abkommen band Portugal wirtschaftlich noch stärker an England.[17]<br />
Am 1. November 1755 wur<strong>de</strong> Lissabon durch ein starkes Erdbeben <strong>zu</strong> zwei Dritteln zerstört. Nach heutigen Schät<strong>zu</strong>ngen hatte es die Stärke 8,7 bis 9,0. Zeitgenössische Quellen geben<br />
allein für Lissabon bis <strong>zu</strong> 60.000 To<strong>de</strong>sopfer an. Die Erschütterungen waren in ganz Europa und Nordafrika <strong>zu</strong> spüren. Planmäßig wie<strong>de</strong>raufgebaut wur<strong>de</strong> die Stadt von <strong>de</strong>m Markgrafen<br />
von Pombal. Beson<strong>de</strong>rs typisch für diesen Wie<strong>de</strong>raufbau ist die Baixa, die Unterstadt, mit ihren rechtwinklig angelegten Straßen im Bereich um die Rua Augusta. Neben <strong>de</strong>n physischen<br />
Schä<strong>de</strong>n, die das Erdbeben anrichtete, erschütterte es auch die aufklärerischen und theistischen Denkrichtungen vieler Philosophen, welche die Ursache dieser Naturkatastrophe nicht
erkannten und ihren Optimismus aufgaben. Voltaire schrieb als Reaktion auf das Beben sein Poème sur le désastre <strong>de</strong> Lisbonne (1756).<br />
Lissabon erhielt im Jahr 1780 seine erste Straßenbeleuchtung mit Öllaternen.[18] Das erste Postamt <strong>de</strong>r Stadt eröffnet 1800. Im Jahr 1807 kam es <strong>zu</strong>r Beset<strong>zu</strong>ng Portugals durch<br />
französische Truppen. Die Königsfamilie mitsamt <strong>de</strong>m Hofstaat floh <strong>de</strong>shalb nach Brasilien. En<strong>de</strong> November 1807 verließen 36 Schiffe mit rund 15.000 Personen und <strong>de</strong>r Aristokratie<br />
<strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s <strong>de</strong>n Lissabonner Hafen. Prinzregent Johann VI. erreichte im März 1808 Brasilien. Rio <strong>de</strong> Janeiro wur<strong>de</strong> danach neuer Regierungssitz.[19]<br />
In <strong>de</strong>r Stadt brach 1811 Typhus aus. 1833 folgte dann Cholera. Daran starben innerhalb von 9 Monaten 13.522 Menschen.[20] Im Miguelistenkrieg wur<strong>de</strong> das von König Michael<br />
besetzte Lissabon am 24. Juli 1833 von Truppen Peter I. eingenommen.[21] Während <strong>de</strong>r Septemberrevolution trafen am 9. September 1836 setembristische Abgeordnete aus Porto, an<br />
ihrer Spitze Manuel da Silva Passos, in <strong>de</strong>r portugiesischen Hauptstadt ein. Sie wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Bevölkerung Lissabons triumphal empfangen.<br />
Im Jahre 1849 wur<strong>de</strong>n die ersten Straßenlaternen mit Gas beleuchtet. Zwei Jahre später eröffnete die Eisenbahnlinie Lissabon–Carregado. Der Vertrag von Lissabon beschloss am 20.<br />
April 1859 die Aufteilung und <strong>de</strong>n Austausch portugiesischer und nie<strong>de</strong>rländischer Besit<strong>zu</strong>ngen auf <strong>de</strong>m Solor- und Timorarchipel zwischen Portugal und <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n. 1873<br />
erfolgte die Inbetriebnahme <strong>de</strong>r Pfer<strong>de</strong>bahn, genannt „O Americano“. Die ersten elektrischen Straßenlaternen wur<strong>de</strong>n 1878 angeschlossen. Der Rossio-Bahnhof eröffnete offiziell am 11.<br />
Juni 1890.<br />
Von <strong>de</strong>r Ersten Portugiesischen Republik bis <strong>zu</strong>r Gegenwart<br />
Am 5. Oktober 1910 wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>m Balkon <strong>de</strong>s Rathauses die Erste Portugiesische Republik ausgerufen. König Emanuel II. floh daraufhin ins Exil nach England. Damit en<strong>de</strong>te die 771jährige<br />
Geschichte <strong>de</strong>r portugiesischen Monarchie. Am 19. Oktober 1921 wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Lissabonner Blutnacht bei einem Aufstand <strong>de</strong>r Republikanischen Gar<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Regierungschef<br />
António Joaquim Granjo und eine Reihe an<strong>de</strong>rer Politiker getötet. Ein Militärputsch been<strong>de</strong>t im Jahr 1926 die Erste Portugiesische Republik. Acht Jahre später kam <strong>de</strong>r Ministerpräsi<strong>de</strong>nt<br />
und Diktator von Portugal António <strong>de</strong> Oliveira Salazar an die Macht. Er verkün<strong>de</strong>te <strong>de</strong>n Estado Novo, <strong>de</strong>n „Neuen Staat“, eine konservativ-autoritäre Diktatur. In <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Estado<br />
Novo, von 1926 bis 1974, wuchs die Stadt weiter. Sie wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong> Lasten <strong>de</strong>s restlichen Lan<strong>de</strong>s ausgebaut.<br />
Die Cristo-Rei Statue in Almada, die sich mit ausgebreiteten Armen <strong>de</strong>r Stadt Lissabon <strong>zu</strong>wen<strong>de</strong>t, wur<strong>de</strong> nach rund zehnjähriger Bautätigkeit am 17. Mai 1959 eingeweiht. Im Dezember<br />
1959 eröffnet die erste Metro-Linie in Lissabon. 1966 wur<strong>de</strong> eine Hängebrücke über <strong>de</strong>n Tejo nach Almada fertig gestellt, die <strong>de</strong>r Gol<strong>de</strong>n-Gate-Brücke in San Francisco gleicht. Vor <strong>de</strong>r<br />
Nelkenrevolution noch nach António <strong>de</strong> Oliveira Salazar benannt, heißt sie nun Ponte 25 <strong>de</strong> Abril (dt. Brücke <strong>de</strong>s 25. April).<br />
En<strong>de</strong> April 1974 war Lissabon das Zentrum <strong>de</strong>r Nelkenrevolution. Mit <strong>de</strong>r Beendigung <strong>de</strong>s Kolonialkriegs in Afrika 1975 kam es <strong>zu</strong> einer Fluchtwelle aus Angola und Mosambik<br />
insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n Großraum von Lissabon. 2005 lebten noch rund 100.000 Schwarzafrikaner im Umfeld <strong>de</strong>r Metropole.[22] Ein Großbrand im Altstadtviertels Chiado zerstört 1988<br />
diverse Gebäu<strong>de</strong>. Im Jahr 1995 wur<strong>de</strong> Lissabon Kulturhauptstadt Europas. Zwei Jahre später verabschie<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r Europarat und die UNESCO in Lissabon eine neue gemeinsame<br />
allgemeine Hochschulkonvention die sogenannte „Lissabon-Konvention“.[23] 1998 wur<strong>de</strong> die insgesamt über 17 Kilometer lange Autobahn-Brücke Ponte Vasco da Gama über <strong>de</strong>n Tejo<br />
anlässlich <strong>de</strong>r Weltausstellung Expo 98 fertig gestellt.<br />
Im März 2000 verabschie<strong>de</strong>ten die europäischen Staats- und Regierungschefs auf einem Son<strong>de</strong>rgipfel die Lissabon-Strategie. Die Strategie hat das Ziel die EU bis 2010 <strong>zu</strong>m<br />
wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensgestützten Wirtschaftsraum <strong>de</strong>r Welt <strong>zu</strong> machen. Am 13. Dezember 2007 wur<strong>de</strong> unter portugiesischer Ratspräsi<strong>de</strong>ntschaft <strong>de</strong>r Vertrag<br />
von Lissabon (auch EU-Grundlagenvertrag genannt) zwischen <strong>de</strong>n 27 Mitgliedstaaten <strong>de</strong>r Europäischen Union unterzeichnet.<br />
Bevölkerung<br />
Einwohnerentwicklung<br />
Die Bevölkerung <strong>de</strong>r eigentlichen Stadt beträgt 499.700, und die Einwohnerzahl für das Metropolitangebiet Lissabons beträgt 2.800.000 gemäß <strong>de</strong>m Instituto Nacional <strong>de</strong> Estatística (dt.<br />
Nationales Institut für Statistiken). Die Bevölkerungsdichte <strong>de</strong>r Stadt selbst beträgt 6.658 Einwohner pro km². Im Jahr 2007 waren 13 % <strong>de</strong>r Bevölkerung unter 15 Jahre alt und 24 %<br />
über 65 Jahre. Der nationale Durchschnitt lag bei <strong>de</strong>n Personen über 65 Jahren bei 17%. Frauen stellen mit 54 % mehr als die Hälfte <strong>de</strong>r Einwohner.[24]
In <strong>de</strong>n letzten Jahren hat Lissabon einen dramatischen Bevölkerungsrückgang erlebt. Trotz <strong>de</strong>s Zu<strong>zu</strong>gs von 53.000 Menschen zwischen 1996 und 2001 verließen im Jahr 2001 für je<strong>de</strong>n<br />
neu nach Lissabon <strong>zu</strong>gezogenen Bewohner zwei weitere die Stadt. Die Zuzügler sind vorrangig Familien, die dank ihrer finanziellen Mittel für die hohen Wohnraumkosten aufkommen<br />
können, vor allem junge Leute und Vertreter <strong>de</strong>s Mittelstan<strong>de</strong>s sind weggezogen. Der Ten<strong>de</strong>nz <strong>zu</strong>r Suburbanisierung, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> beobachten ist, wird durch die sukzessive<br />
Verlagerung von Wohnraum in das Großstadtgebiet von Lissabon ausgeglichen, so dass Mobilitäts- und Transportprobleme jetzt ein kritischer Faktor im Alltag <strong>de</strong>r Stadt und im Hinblick<br />
auf die Lebensqualität ihrer Bürger gewor<strong>de</strong>n sind.[25]<br />
Einwohnerentwicklung von Lissabon (1801–2007)<br />
• Jahr Einwohner<br />
• 1801 203.999<br />
• 1849 174.668<br />
• 1900 350.919<br />
• 1930 591.939<br />
• 1960 801.155<br />
• 1981 807.937<br />
• 1991 663.394<br />
• 2001 564.657<br />
• 2004 529.485<br />
• 2005 519.795<br />
• 2006 509.751<br />
• 2007 499.700<br />
Religion<br />
Die überwiegen<strong>de</strong> Mehrheit <strong>de</strong>r Lissaboner bekennt sich <strong>zu</strong>m römisch-katholischen Glauben. Das erste Bistum Lissabon wur<strong>de</strong> bereits im 4. Jahrhun<strong>de</strong>rt gegrün<strong>de</strong>t. Als die Stadt von<br />
<strong>de</strong>n Mauren erobert wur<strong>de</strong>, existierte es als <strong>zu</strong>m Teil vakantes Titularbistum <strong>de</strong>r römisch-katholischen Kirche weiter. Daneben gibt es Hinweise auf namentlich nicht bekannte<br />
mozarabische Bischöfe von Lissabon. Nach <strong>de</strong>r Zurückeroberung durch Alfons I. lebte es als römisch-katholisches Bistum unter seinem Bischof, <strong>de</strong>m Normannen Gilbert von Hastings<br />
(Bischof von 1147 bis 1166), wie<strong>de</strong>r auf. Das Patriarchat von Lissabon wur<strong>de</strong> im Jahr 1716 errichtet.<br />
Bürgermeister<br />
Im Mai 2007 waren vorgezogene Kommunalwahlen nötig, weil <strong>de</strong>r damalige Lissabonner Bürgermeister Carmona Rodrigues aufgrund einer Korruptionsaffäre <strong>zu</strong>rücktreten musste. In<br />
<strong>de</strong>r Wahl am 15. Juli 2007 wählten die Lissabonner António Luís Santos da Costa[28]mit einer einfachen Mehrheit von 29,54 Prozent <strong>zu</strong>m Bürgermeister <strong>de</strong>r portugiesischen Hauptstadt.<br />
Die Wahlbeteiligung lag bei 37,39 Prozent.<br />
Wappen<br />
Den Wappenschild von Lissabon ziert ein Segelschiff mit zwei Raben. Die Abbildung bezieht sich auf eine Legen<strong>de</strong>. Angeblich wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Leichnam <strong>de</strong>s Stadtheiligen Vicente <strong>de</strong><br />
Saragoça in einem führerlosen Boot begleitet von zwei Raben an <strong>de</strong>r Algarveküste, am Cabo <strong>de</strong> São Vicente, angetrieben. Von diesem Ort wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Leichnam nach Lissabon gebracht<br />
und dort beigesetzt.[29] Oberhalb <strong>de</strong>s Schil<strong>de</strong>s befin<strong>de</strong>t sich eine Burg. Das Bauwerk wird mit fünf Türmen dargestellt. Umrahmt wird das Schild von einer Kette und einem Band. Der
Wahlspruch in <strong>de</strong>m Band lautet: MUI NOBRE E SEMPRE LEAL CIDADE DE LISBOA (dt. Sehr e<strong>de</strong>l und stets treuergebene Stadt Lissabon).<br />
Partnerstädte<br />
Lissabon unterhält Städtepartnerschaften mit folgen<strong>de</strong>n Städten[30]:<br />
• Bissau, Guinea-Bissau<br />
• Brasília, Brasilien<br />
• Budapest, Ungarn<br />
• Cacheu, Guinea-Bissau<br />
• Dili, Osttimor<br />
• Guimarães, Portugal<br />
• Luanda, Angola<br />
• Macao, China<br />
• Madrid, Spanien<br />
• Maputo, Mosambik<br />
• Malakka, Malaysia<br />
• Montreal, Kanada<br />
• Paris, Frankreich<br />
• Praia, Kap Ver<strong>de</strong><br />
• Rabat, Marokko<br />
• Rio <strong>de</strong> Janeiro, Brasilien<br />
• Salvador da Bahia, Brasilien<br />
• São Paulo, Brasilien<br />
• São Tomé, São Tomé und Príncipe<br />
• Zagreb, Kroatien<br />
• Tunis, Tunesien<br />
Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
Stadtbild<br />
Das heutige Stadtbild von Lissabon geht vornehmlich auf Baumaßnahmen ab <strong>de</strong>m 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong>rück. Das Zentrum von Lissabon ist die Baixa. Die Altstadt besticht durch ihre<br />
Fliesenfassa<strong>de</strong>n und mittelalterlichen, engen Gassen. In <strong>de</strong>n Innenstadtvierteln prägen auch Bausubstanzprobleme das Stadtbild. 1994 wur<strong>de</strong> die Gesamtzahl <strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong> in Lissabon<br />
mit 62.041 angegeben. Davon stammten 30,73 % <strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Zeit vor 1919 und 21,37 % aus <strong>de</strong>r Zeit zwischen 1919 und 1945. Nach Erhebungen <strong>de</strong>s Zentrums für territoriale<br />
Studien <strong>de</strong>r Stadt Lissabon aus <strong>de</strong>m Jahr 1992 fielen die veranschlagten Renovierungskosten <strong>de</strong>s bestehen<strong>de</strong>n Wohnraums mit einem Drittel auf die Gebäu<strong>de</strong> zwischen 1850 und 1930.<br />
[31]<br />
UNESCO-Welterbe<br />
Im Jahre 1983 wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Torre <strong>de</strong> Belém und das Mosteiro dos Jerónimos von <strong>de</strong>r Unesco <strong>zu</strong>m Weltkulturerbe erklärt.[32] Der Torre <strong>de</strong> Belém, <strong>de</strong>r im gleichnamigen Stadtteil an <strong>de</strong>r
Tejomündung liegt, ist eines <strong>de</strong>r bekanntesten Wahrzeichen Lissabons. Der Wachturm wur<strong>de</strong> während <strong>de</strong>r napoleonischen Invasion zerstört und 1846 rekonstruiert. Neben <strong>de</strong>m<br />
nahegelegenen Mosteiro dos Jerónimos gehört er <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n wenigen herausragen<strong>de</strong>n Bauwerken <strong>de</strong>s „manuelinischen Stils“, die das Erdbeben von Lissabon überstan<strong>de</strong>n haben. Das<br />
Mosteiro dos Jerónimos (dt. Hieronymus-Kloster) liegt im Stadtteil Belém. Neben <strong>de</strong>n Königsgräbern befin<strong>de</strong>t sich hier auch die Grabstätte <strong>de</strong>s bekannten Seefahrers Vasco da Gama.<br />
Das Kloster gilt als be<strong>de</strong>utendster Bau <strong>de</strong>r Manuelinik, einer portugiesischen Variante <strong>de</strong>r Spätgotik, die auch einige Elemente <strong>de</strong>r Renaissance enthält.<br />
Bauwerke<br />
Zu <strong>de</strong>n sehenswerten Bauwerken Lissabons gehört das Kloster São Vicente <strong>de</strong> Fora. Es wur<strong>de</strong> 1147 als Augustinerkloster von Alfons I. außerhalb <strong>de</strong>r Stadtmauern gegrün<strong>de</strong>t und <strong>de</strong>m<br />
heiligen Vinzenz von Saragossa gewidmet. Unter Philipp II. erhielten die Kirche und das Kloster das heutige Aussehen. In <strong>de</strong>r Kirche wur<strong>de</strong>n viele Familienmitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
portugiesischen Königsfamilie aus <strong>de</strong>m Haus Braganza begraben.<br />
Das Castelo <strong>de</strong> São Jorge, eine Festungsanlage mit integrierter Burgruine, wur<strong>de</strong> jahrhun<strong>de</strong>rtelang als Königsburg genutzt. In einem Turm <strong>de</strong>r Burg, <strong>de</strong>m Torre do Tombo, befand sich<br />
die königliche Urkun<strong>de</strong>nsammlung. Die Burg wur<strong>de</strong> 1755 beim großen Erdbeben weitgehend zerstört. Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten ist die Anlage wie<strong>de</strong>r in einem guten<br />
Zustand.<br />
Die Hauptkirche <strong>de</strong>r Stadt Lissabon und die Kathedrale <strong>de</strong>s Patriarchats von Lissabon ist die Catedral Sé Patriarcal. Die Bauarbeiten an <strong>de</strong>r älteste Kirche <strong>de</strong>r Stadt begannen im Jahr<br />
1147. Ein Erdbeben beschädigte 1344 das Bauwerk. Im Jahr 1380 wur<strong>de</strong> die westliche Fassa<strong>de</strong> im Stil <strong>de</strong>r Romanik errichtet.<br />
Im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt errichtete man die große Barockkirche Igreja <strong>de</strong> Santa Engrácia (dt. Kirche <strong>de</strong>r heiligen Engrácia). Die Kirche konnte erst im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt vollen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n. Sie<br />
wur<strong>de</strong> nie als Gotteshaus genutzt und dient heute als Panteão Nacional (dt. Nationales Pantheon). Im <strong>de</strong>m Bauwerk wur<strong>de</strong>n einige Staatspräsi<strong>de</strong>nten und Schriftsteller begraben. Zu<strong>de</strong>m<br />
befin<strong>de</strong>n sich dort noch einige Kenotaphen für „Hel<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r portugiesischen Geschichte“.<br />
Das Convento do Carmo ist ein in <strong>de</strong>n Jahren 1389 bis 1423 von Nuno Álvares Pereira errichtetes Kloster <strong>de</strong>s Karmeliter-Or<strong>de</strong>ns. Die Karmeliter-Kirche galt als ein Prachtexemplar <strong>de</strong>r<br />
Lissabonner Gotik. Durch das Erdbeben von 1755 wur<strong>de</strong> das Kloster stark zerstört. Heute sind nur noch die Ruinen <strong>zu</strong> besichtigen.<br />
Das Aqueduto das Águas Livres hat eine Länge von 19 km und erstreckt sich von Queluz über Caneças bis <strong>zu</strong>m Mãe d'Água das Amoreiras.[33] Dieser Aquädukt gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n weltweit<br />
größten Bauten dieser Art. Am imposantesten ist das Aquädukt im Alcântara-Tal. Die Bogenbrücke hat eine Gesamtlänge von 941 m. Gestützt wird die 66 m hohe Brücke von 109<br />
Bögen.[34]<br />
Der Elevador <strong>de</strong> Santa Justa, auch Elevador do Carmo genannt, ist ein 45 Meter hoher Personenauf<strong>zu</strong>g, <strong>de</strong>r im Stadtzentrum von Lissabon <strong>de</strong>n Stadtteil Baixa mit <strong>de</strong>m höhergelegenen<br />
Stadtteil Chiado verbin<strong>de</strong>t. Im allgemeinen Sprachgebrauch wer<strong>de</strong>n manchmal auch die drei straßenbahnähnlichen Lissabonner Standseilbahnen fälschlicherweise Elevador genannt.<br />
Der Palácio <strong>de</strong> São Bento war anfangs ein Benediktiner-Kloster. Es wur<strong>de</strong> im Jahre 1598 errichtet. Die Benediktiner-Mönche lebten bis <strong>zu</strong>m Jahre 1820 in <strong>de</strong>m Kloster. 1834 zog das<br />
portugiesische Parlament in das Bauwerk ein. Im hinteren Teil <strong>de</strong>s Gebäu<strong>de</strong>s befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Sitz <strong>de</strong>s Premierministers.<br />
Der portugiesische Außenminister ist im Palácio das Necessida<strong>de</strong>s <strong>de</strong>m ehemaligen königlichen Palast aus <strong>de</strong>m 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt untergebracht. Der Palast wur<strong>de</strong> unter <strong>de</strong>r Regentschaft<br />
Königin Maria II. <strong>zu</strong>r offiziellen Resi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>r königlichen Familie. Nach <strong>de</strong>r Ausrufung <strong>de</strong>r Republik am 5. Oktober 1910 wur<strong>de</strong> das Bauwerk <strong>zu</strong>m Sitz <strong>de</strong>s Außenministeriums<br />
bestimmt.<br />
António José Dias da Silva, ein portugiesische Architekt, entwarf die Praça <strong>de</strong> Touros do Campo Pequeno (dt. Stierkampfarena) am Campo Pequeno. Die Arena wur<strong>de</strong> zwischen 1890<br />
und 1892 errichtet, nach<strong>de</strong>m die ehemalige Lissabonner Stierkampfarena am Campo <strong>de</strong> Santana, die zwischen 1831 und 1891 in Funktion war, abgerissen wur<strong>de</strong>.<br />
Das Ent<strong>de</strong>cker<strong>de</strong>nkmal Padrão dos Descobrimentos steht im Stadtteil Bélem am Ufer <strong>de</strong>s Flusses Tejo. Es wur<strong>de</strong> 1960 unter <strong>de</strong>m Salazar-Regime erstellt, genau 500 Jahre nach <strong>de</strong>m<br />
To<strong>de</strong> von Heinrich <strong>de</strong>m Seefahrer und soll die alten Zeiten <strong>de</strong>r Seefahrernation Portugal glorifizieren. Dargestellt ist <strong>de</strong>r Bug einer Karavelle auf <strong>de</strong>m, angeführt von Heinrich <strong>de</strong>m<br />
Seefahrer, weitere be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Personen aus <strong>de</strong>m Zeitalter <strong>de</strong>r Ent<strong>de</strong>ckungen dargestellt sind. Der 54 Meter hohe Turm, seitlich mit stilisierten Segeln versehen, versinnbildlicht <strong>de</strong>n Mast<br />
<strong>de</strong>r Karavelle.
Der Torre Vasco da Gama ist ein 145 Meter hoher Aussichtsturm in Stahlfachwerkbauweise, <strong>de</strong>r 1998 für die Weltausstellung erbaut wur<strong>de</strong>. Nach Plänen <strong>de</strong>s portugiesischen Architekten<br />
Nuno Leónidas soll <strong>de</strong>r Vasco-da-Gama-Turm in ein Luxushotel mit 178 Zimmern in 20 Stockwerken umgewan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n. Der Umbau da<strong>zu</strong> hat im Oktober 2007 begonnen. In <strong>de</strong>m<br />
Bereich <strong>de</strong>s ehemalige Ausstellungsgelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Expo 98 steht ebenfalls das Oceanário <strong>de</strong> Lisboa. Es ist das zweitgrößte Ozeanarium weltweit und befin<strong>de</strong>t sich dort im Park <strong>de</strong>r<br />
Nationen.<br />
Expo 98<br />
Die Weltausstellung Expo 98 fand vom 22. Mai bis <strong>zu</strong>m 30. September 1998 in Lissabon statt. Sie war die erste in Portugal und die zweite auf <strong>de</strong>r Iberischen Halbinsel und stand unter<br />
<strong>de</strong>m Motto „Os oceanos: um património para o futuro“, <strong>zu</strong> Deutsch „Die Ozeane: Ein Erbe für die Zukunft“. An <strong>de</strong>r Expo nahmen 143 Län<strong>de</strong>r und 14 internationale Organisationen teil.<br />
Während <strong>de</strong>r 132 Öffnungstagen besuchten 10,12 Millionen Menschen die 340 Hektar[35]große Weltausstellung. Heute wird das populäre Ausstellungsgelän<strong>de</strong> unter <strong>de</strong>m Namen Parque<br />
das Nações vermarktet.[36]<br />
Parks<br />
Der Parque Florestal <strong>de</strong> Monsanto ist <strong>de</strong>r größte Park Lissabons. Er liegt im Westen <strong>de</strong>r Stadt und umfasst 800 Hektar. Angelegt wur<strong>de</strong> er erst in <strong>de</strong>n 1930er Jahren.[37] Der größte Park<br />
in <strong>de</strong>r Innenstadt ist dagegen <strong>de</strong>r Parque Eduardo VII. Er befin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Stadtgemein<strong>de</strong> São Sebastião da Pedreira. Namensgeber <strong>de</strong>s Parks war <strong>de</strong>r britische König Eduard VII., <strong>de</strong>r<br />
1903 Portugal besuchte. Drittgrößter Park <strong>de</strong>r Stadt ist <strong>de</strong>r Jardim da Estrela aus <strong>de</strong>m Jahr 1852. Er befin<strong>de</strong>t sich gegenüber <strong>de</strong>r Basilika da Estrela. Offiziell heißt er heute Jardim Guerra<br />
Junqueiro, im Volksmund wird er aber weiter Jardim da Estrela genannt.[38] Der Jardim do Campo Gran<strong>de</strong>, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>utsch „Garten <strong>de</strong>s großen Fel<strong>de</strong>s“, ist ein über 12,5 Hektar großer Park<br />
in <strong>de</strong>r Stadtgemein<strong>de</strong> Campo Gran<strong>de</strong>.<br />
Straßen, Orte<br />
Die Avenida da Liberda<strong>de</strong> ist eine am Vorbild <strong>de</strong>r Pariser Avenue <strong>de</strong>s Champs-Elysées orientierte Prachtstraße in Lissabon. Sie verbin<strong>de</strong>t die nach <strong>de</strong>m Erdbeben von 1755 angelegte<br />
Baixa (Unterstadt) mit <strong>de</strong>n höher gelegenen Stadtvierteln im Nor<strong>de</strong>n und fand ab Beginn <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts in <strong>de</strong>n Avenidas Novas ihre Fortset<strong>zu</strong>ng. Ein erstes Teilstück <strong>de</strong>r Avenida<br />
wur<strong>de</strong> 1882 <strong>zu</strong>m 100. Jahrestag <strong>de</strong>s To<strong>de</strong>stages <strong>de</strong>s Marques <strong>de</strong> Pombal und <strong>de</strong>s ihm gewidmeten Rundplatzes eingeweiht.<br />
Mit Miradouro bezeichnet man im Portugiesischen allgemeinen einen Aussichtspunkt. Die Miradouros zählen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n schönsten Plätzen <strong>de</strong>r Stadt. Diese liegen auf <strong>de</strong>n Erhebungen<br />
ringsum und geben einen wun<strong>de</strong>rvollen Blick auf die Altstadt o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Tejo frei.<br />
Das Bairro Alto (Oberstadt) ist ein Stadtteil von Lissabon, <strong>de</strong>r sich oberhalb <strong>de</strong>s Geschäftsviertels Baixa befin<strong>de</strong>t. Es ist vor allem wegen seines Nachtlebens bekannt. Zu <strong>de</strong>n ältesten<br />
und bekanntesten Cafés <strong>de</strong>r Stadt gehört das A Brasileira. Das Café im Chiado-Viertel wur<strong>de</strong> am 19. November 1905 von Adriano Telles gegrün<strong>de</strong>t. Es war ein beliebter Treffpunkt von<br />
Intellektuellen. Dort verkehrten unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>r portugiesischen Dichter Fernando Pessoa und Schriftsteller <strong>de</strong>r Aquilino Ribeiro. Seit 1988 steht vor <strong>de</strong>m Café ein Bronzestatue<br />
Pessoas.[39]<br />
Museen<br />
In Lissabon gibt es zahlreiche Museen. Das Museu Nacional <strong>de</strong> Arte Antiga (dt. Nationalmuseum für alte Kunst) gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n be<strong>de</strong>utendsten Kunstmuseen Portugals. Ein be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r<br />
Schwerpunkt <strong>de</strong>r Sammlung sind Werke portugiesischer Künstler. Es besitzt unter an<strong>de</strong>rem Werke von Hieronymus Bosch, Albrecht Dürer, Pieter Brueghel <strong>de</strong>r Jüngere, Piero <strong>de</strong>lla<br />
Francesca, Hans Holbein <strong>de</strong>r Ältere und Raffael. Zwischen 1964 und 1969 entstand das Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Museu Calouste Gulbenkian. Die Dauerausstellung <strong>de</strong>s Museums umfasst ein<br />
breites Spektrum an Kunstobjekten aus allen Epochen.1984 wur<strong>de</strong> es um das Museum für Mo<strong>de</strong>rne Kunst erweitert. Zu <strong>de</strong>n wohl bekanntesten Exponaten <strong>de</strong>s Museums zählen die<br />
Werke von Rembrandt ("Portrait eines alten Mannes"), Monet ("Stillleben mit Melone") und Manet ("Die Seifenblasen"). Im Stadtteil Belém liegt das Museu da Marinha (dt.<br />
Marinemuseum). Es befin<strong>de</strong>t sich in einem Teil <strong>de</strong>s Westflügels vom Mosteiro dos Jerónimos, <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m Museu Nacional <strong>de</strong> Arqueologia. Das Museu <strong>de</strong> Etnologia (dt.<br />
ethnologische Museum) besitzt Artefakte aus <strong>de</strong>r ganzen Welt. Größtenteils stammen sie aus <strong>de</strong>n ehemaligen Kolonien. 1904 wur<strong>de</strong> das Museu Nacional dos Coches (dt.<br />
Kutschenmuseum) auf Initiative von Königin Amalia eröffnet. Es beherbergt eine beträchtliche Kutschensammlung. Die älteste ausgestellte Kutsche stammt von <strong>de</strong>m spanischen Philipp
II. aus <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt.[40] Das von <strong>de</strong>m Industriellen und Kunstsammler José Berardo im Jahr 2007 eröffnete Museu Colecção Berardo ist im Centro Cultural <strong>de</strong> Belém<br />
untergebracht. Der Kunstsammler hat <strong>de</strong>m Museum eine beachtliche Sammlung mo<strong>de</strong>rner und zeitgenössische Kunst <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts aus Europa und Übersee <strong>zu</strong>r Verfügung<br />
gestellt.<br />
Theater<br />
1854 gab es in Lissabon sechs Theater. Aktuell gibt es neben <strong>de</strong>n staatlichen Theatern einige unabhängige Festspielhäuser, die ein reiches Aufführungsprogramm bieten. Das Teatro<br />
Nacional Dona Maria II (dt. Nationaltheater Dona Maria) ist das älteste Theater von Lissabon und liegt am Lissabonner Rossio Platz. Das Teatro Aberto befin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Nähe von<br />
<strong>de</strong>r Praça <strong>de</strong> Espanha. Das Klassische Theater Teatro da Trinda<strong>de</strong> fin<strong>de</strong>t man im Stadtteil Chiado. Dort befin<strong>de</strong>t sich ebenfalls die Lissaboner Oper Teatro Nacional <strong>de</strong> São Carlos. Direkt<br />
neben <strong>de</strong>r Oper liegt das städtische Theater Teatro Municipal <strong>de</strong> São Luis. In <strong>de</strong>m Teatro Politeama, im Stil <strong>de</strong>r 20er Jahre, kommen überwiegend Erfolgsmusicals <strong>zu</strong>r Aufführung. Die<br />
Balletttruppe Companhia Nacional <strong>de</strong> Bailado CBN zog nach <strong>de</strong>r Expo in das Teatro Camões ein. Dort gastieren auch an<strong>de</strong>re Ballettensembels.[41] Weitere Theater sind das das Teatro<br />
da Cornucópia, das Teatro da Comuna, das Teatro Municipal Maria Matos, das Teatro Taborda, das Teatro Tívoli, das Teatro São Luiz und das Teatro Villaret sowie das Teatro Vasco<br />
Santana.<br />
Musik<br />
Eine <strong>de</strong>r traditionellen Musikarten in Lissabon ist <strong>de</strong>r Fado, meist mit wehmütiger Grundstimmung gesungen und von einer normalen und einer portugiesischen Gitarre (Guitarra)<br />
begleitet. Fado wird für Touristen abendlich in Kneipen <strong>de</strong>r Stadtviertel Bairro Alto und Alfama dargeboten. Mit <strong>de</strong>m Fado verbin<strong>de</strong>t sich zweifelsfrei <strong>de</strong>r Name <strong>de</strong>r populärsten Fado-<br />
Sängerin Portugals, Amália Rodrigues. Als würdige Nachfolgerin <strong>de</strong>r 1999 verstorbenen Künstlerin gilt <strong>de</strong>rzeit für viele Portugiesen die Sängerin Mariza. Seinen Ursprung hat <strong>de</strong>r Fado<br />
in <strong>de</strong>n Armenvierteln von Lissabon, wo er <strong>zu</strong>nächst in <strong>de</strong>n anrüchigen Kneipen im Stadtteil Mouraria auftauchte. Ob er sich ursprünglich aus <strong>de</strong>n Gesängen <strong>de</strong>r portugiesischen Seeleute<br />
entwickelte, o<strong>de</strong>r aus brasilianischen Musikrichtungen wie Lundum o<strong>de</strong>r Modinha entstand, ist aus heutiger Sicht nicht mehr fest<strong>zu</strong>stellen.<br />
Regelmäßige Veranstaltungen<br />
Seit 1984 treffen sich Jazz-Freun<strong>de</strong> jährlich beim internationalen Jazzfestival Jazz em Agosto <strong>de</strong>r Gulbenkian-Stiftung in <strong>de</strong>r portugiesischen Hauptstadt. Das Rockmusik-Festival Rock<br />
in Rio fand 2006 und 2008 in Lissabon statt. Folgen<strong>de</strong> portugiesischen Filmfestivals fin<strong>de</strong>n je<strong>de</strong>s Jahr in Lissabon statt:<br />
• DocLisboa – Internationales Dokumentarfilmfestival<br />
• Festival <strong>de</strong>s schwulen und lesbischen Kinos (Festival <strong>de</strong> Cinema Gay e Lésbico <strong>de</strong> Lisboa)<br />
• IndieLisboa – Internationales Festival über In<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt Kino (Festival internacional <strong>de</strong> cinema in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nte)<br />
Naherholung<br />
Die traditionsreichen Seebä<strong>de</strong>r Cascais und Estoril liegen in <strong>de</strong>r Umgebung von Lissabon. Estoril gilt als Rück<strong>zu</strong>gsort <strong>de</strong>r reichen Oberschicht Lissabons und liegt am Rand <strong>de</strong>r<br />
Estremadura. Berühmt wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ort wegen seines Casinos. Bei Estoril befin<strong>de</strong>t sich auch das Autódromo, eine Rennstrecke, auf <strong>de</strong>r jährlich <strong>de</strong>r Große Preis von Portugal für<br />
Motorrä<strong>de</strong>r ausgetragen wird. Die Nachbarstadt Cascais liegt an einer sandigen Bucht <strong>de</strong>s Atlantiks, etwa 25 Kilometer westlich von Lissabon. Ab 1870 verbrachte die königliche<br />
Familie regelmäßig <strong>de</strong>n Sommer in Cascais, wodurch <strong>de</strong>r Ort auch <strong>de</strong>n A<strong>de</strong>l und gehobene Bürgerschichten anzog. Der Ort verfügt über einen Yachthafen mit etwa 600 Liegeplätzen.<br />
Das Naturreservat Serra da Arrábida in <strong>de</strong>r Region Lisboa e Vale do Tejo erstreckt sich westlich von Setúbal an <strong>de</strong>r vom Meer abgewandten Küsten. Dort gibt es eine Reihe von seltenen<br />
Pflanzen und Tieren. Der Naturpark erstreckt sich mit einer Fläche von 10821 ha auf einem bis <strong>zu</strong> 8 km breitem und 22 km langem Streifen entlang <strong>de</strong>r Küste. Seine Begren<strong>zu</strong>ng bil<strong>de</strong>n<br />
die Städte und Dörfer Sesimbra und Santana im Westen, Azeitão und Quinta do Anjo im Nor<strong>de</strong>n sowie Palmela und Setúbal im Osten.<br />
Kulinarische Spezialitäten<br />
In <strong>de</strong>n zahllosen Gaststätten und Restaurants und Lokalitäten wer<strong>de</strong>n Speisen aus internationaler und einheimischer Küche serviert. Es gibt jedoch nur wenige originären Lissabonner
Spezialitäten, die nicht auch an<strong>de</strong>rswo angeboten wer<strong>de</strong>n. Die Portugiesische Küche basiert auf <strong>de</strong>ftigen und traditionell <strong>zu</strong>bereitete Gerichte unter Verwendung von Fleisch, Fisch,<br />
Gemüse, Reis, Bohnen und Kartoffeln. Der Stockfisch ist Spezialität und Nationalgericht Portugals. Unzählige Rezepte gibt es auch für <strong>de</strong>n gesalzenen und getrockneten Kabeljau.<br />
Beliebt sind ebenfalls Sardinen, gegrillt als Sardinhas assadas, außer<strong>de</strong>m Tintenfische, Langusten, Krebse, Tunfisch, Schwertfisch, Aal, Garnelen und weitere Meerestiere. Typisch ist<br />
auch Ameijoas na cataplana, ein Muscheleintopf mit Schweinefleisch, Speck und Zwiebeln. Neben Rindfleisch wird in Portugal häufig auch Ziegenfleisch (Cabrito) und Lammfleisch<br />
(Borrego) gegessen. International bekannt ist <strong>de</strong>r portugiesische Portwein, ein Likörwein, <strong>de</strong>r vor allem <strong>zu</strong> Desserts getrunken wird. Zu <strong>de</strong>n Spezialitäten gehört ferner das Pastel <strong>de</strong> Nata<br />
o<strong>de</strong>r Pastel <strong>de</strong> Belém. Das Puddingtörtchen – bestehend aus Kuchen- o<strong>de</strong>r Blätterteig, gefüllt mit cremigem Vanillepudding und bestäubt mit Zimt und Pu<strong>de</strong>r<strong>zu</strong>cker – wur<strong>de</strong> vermutlich<br />
bereits vor <strong>de</strong>m 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt von Mönchen <strong>de</strong>s Hieronymus-Kloster in <strong>de</strong>m Lissabonner Stadtteil Belém hergestellt. Nach <strong>de</strong>r Säkularisierung <strong>de</strong>r Klöster beschlossen die Mönche im<br />
Jahr 1837, Delikatessen <strong>zu</strong> produzieren, welche an die Lissabonner verkauft wer<strong>de</strong>n sollten. Heute besuchen viele Einheimische und Touristen die große Caféterie <strong>de</strong>r dortigen Fabrik,<br />
um die Pastéis <strong>zu</strong> erwerben. Das Originalrezept kennen nur wenige Pâtissier.[42]<br />
Sport<br />
Lissabon besitzt diverse sportliche Einrichtungen. Das Estádio da Luz und das José-Alvala<strong>de</strong>-Stadion sind die größten Stadien in <strong>de</strong>r Stadt. Lissabon war im Laufe ihrer Geschichte<br />
immer wie<strong>de</strong>r Austragungsort von Welt- und Europameisterschaften.<br />
Welt-, Europa- und nationale Meisterschaften<br />
In Lissabon fan<strong>de</strong>n die Fechtweltmeisterschaft 1947, die Junioren-Fußballweltmeisterschaft 1991, die Kurzbahneuropameisterschaften 1999, die Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaft<br />
2001, die UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 2001, die Fechtweltmeisterschaft 2002, die Handball-Weltmeisterschaft <strong>de</strong>r Herren 2003 sowie die Fußball-Europameisterschaft 2004 statt.<br />
In <strong>de</strong>r Zeit von 1938 bis 1945 fand <strong>de</strong>r Portugiesische Fußballpokal jährlich in Lissabon statt. Die Portugiesischen Meisterschaften im Badminton wer<strong>de</strong>n seit 1956 in <strong>de</strong>r Hauptstadt<br />
ausgetragen.<br />
Fußball<br />
Der Lissabonner Fußballclub Sporting Clube <strong>de</strong> Portugal (dt. Sporting Lissabon) war <strong>de</strong>r Gewinner <strong>de</strong>s Europapokals <strong>de</strong>r Pokalsieger 1964. Die Fußballmannschaft von Sporting trägt<br />
ihre Heimspiele im José-Alvala<strong>de</strong>-Stadion aus. Das Stadion mit 52.000 Plätzen war Austragungsort <strong>de</strong>r Fußball-Europameisterschaft 2004. Das von <strong>de</strong>r UEFA mit fünf Sternen<br />
ausgezeichnete Stadion liegt direkt neben <strong>de</strong>r alten Anlage.<br />
Der Fußballclub Sport Lisboa e Benfica (dt. Benfica Lissabon) ist mit 165.000 Mitglie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r größte Verein <strong>de</strong>r Welt nach <strong>de</strong>n Mitglie<strong>de</strong>rzahlen. Der Austragungsort <strong>de</strong>r Heimspiele ist<br />
das Estádio da Luz. Das Stadion mit einem Fassungsvermögen von 65.000 Zuschauerplätzen war <strong>de</strong>r Austragungsort <strong>de</strong>s Finales <strong>de</strong>r Europameisterschaft 2004. Für das Turnier wur<strong>de</strong><br />
das Stadion komplett neu gebaut. Es war Austragungsort von drei Gruppenspielen, einem Viertelfinale und <strong>de</strong>m Endspiel <strong>de</strong>r Fußball-Europameisterschaft 2004.<br />
Das Estádio do Restelo ist das Fußballstadion <strong>de</strong>s Clubs Belenenses Lissabon und befin<strong>de</strong>t sich im Stadtteil Belém. Das Stadion wur<strong>de</strong> offiziell am 23. September 1956 eingeweiht und<br />
fasst rund 32.500 Zuschauer.<br />
Sonstige Sportarten<br />
In <strong>de</strong>r Basketball-Liga UZO spielen die Lissabonner Vereine SL Benfica und União Lisboa. Der Lissabon-Halbmarathon (pt. Meia Maratona <strong>de</strong> Lisboa) ist einer <strong>de</strong>r größten und<br />
sportlich be<strong>de</strong>utendsten Halbmarathons weltweit. Er fin<strong>de</strong>t seit 1991 in Lissabon statt, in <strong>de</strong>r Regel im März. Der erste Transeuropalauf fand vom 19. April bis 21. Juni 2003 statt und<br />
führte in 64 Tagesetappen ohne Ruhetag von Lissabon nach Moskau. En<strong>de</strong> Dezember 2005 begann die bekannte Rallye Dakar (vormals Paris-Dakar) <strong>zu</strong>m ersten mal in <strong>de</strong>r Hauptstadt<br />
Portugals.<br />
Wirtschaft und Infrastruktur
Wirtschaft<br />
Der Raum Lissabon ist das wohlhabendste Gebiet in Portugal, <strong>de</strong>ssen Bruttoinlandsprodukt über <strong>de</strong>m europäischen Durchschnitt liegt (Lissabon erzeugt 45 % <strong>de</strong>s portugiesischen BIP).<br />
Im Großraum Lissabon sind 1.300.500 Menschen erwerbstätig. Die Arbeitslosenquote in <strong>de</strong>r Stadt lag im Jahr 2004 bei 8 %.[43] Lissabons Wirtschaft beruht in erster Linie auf <strong>de</strong>r<br />
Dienstleistungsindustrie. Der Lissabonner Seehafen hat als Schnittstellen <strong>de</strong>s Land-, und Seeverkehrs, als maritimes Dienstleistungszentrum und als Industriestandort eine große<br />
wirtschaftliche Be<strong>de</strong>utung. In <strong>de</strong>r Lissabonner Metropolregion ist beson<strong>de</strong>rs das Südufer <strong>de</strong>s Tejo stark industrialisiert. 7 <strong>de</strong>r 10 größten börsennotierten Unternehmen in Portugal haben<br />
ihren Sitz in Lissabon. Da<strong>zu</strong> gehören unter an<strong>de</strong>rem die Unternehmen Energias <strong>de</strong> Portugal, Portugal Telecom und Jerónimo Martins. Die Lissabonner Börse ist mit <strong>de</strong>n Börsen in<br />
Amsterdam, Brüssel und Paris Teil <strong>de</strong>r „Mehrlän<strong>de</strong>rbörse“ Euronext.<br />
Straßenverkehr<br />
Durch die Lage am Tejo war Lissabon lange Zeit vom Sü<strong>de</strong>n aus nur durch Fährverkehr direkt aus <strong>zu</strong> erreichen. Die erste Brücke wur<strong>de</strong> 1951 nördlich <strong>de</strong>r Stadt an einem Flussengpunkt<br />
in Vila Franca <strong>de</strong> Xira im Nor<strong>de</strong>n gebaut. Die Ponte 25 <strong>de</strong> Abril (1013 m Spannweite und 2287 m Länge) wur<strong>de</strong> 1966 fertiggestellt und verband erstmals Lissabon mit Almada auf <strong>de</strong>r<br />
Tejo-Südseite. Seit 1999 besteht unterhalb <strong>de</strong>r Autofahrbahn auch eine Eisenbahnverbindung. Die A2 führt dann weiter ins östliche Lan<strong>de</strong>sinnere bzw. nach Madrid/Spanien. Mit <strong>de</strong>r<br />
Ponte Vasco da Gama, einer <strong>de</strong>r längsten Schrägseilbrücken <strong>de</strong>r Welt und <strong>de</strong>r längsten Brücke in Europa, gibt es seit 1998 eine direkte Autobahnverbindung (A12/IP1) über die Bucht<br />
zwischen Moscavi<strong>de</strong>/Sacavém auf <strong>de</strong>r rechten und Montijo/Alcochete, bzw. Setúbal mit seinen Industrien auf <strong>de</strong>r linken Seite <strong>de</strong>s Tejo.<br />
Nördlich geht mit <strong>de</strong>r Autobahn A8 eine Verbindung nach Leiria und die A1 führt an <strong>de</strong>r Küste entlang bis nach Porto, <strong>de</strong>m zweitwichtigsten Zentrum <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s.<br />
Flughafen<br />
Der Internationale Flughafen Lissabon-Portela liegt 6 km nördlich vom Zentrum und in <strong>de</strong>r Verlängerung <strong>de</strong>r Autobahn A12. Seit geraumer Zeit wird über die Lage eines neuen<br />
Flughafens in Lissabon diskutiert. Am 10. Januar 2008 verkün<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r Premier José Sócrates, dass dieser auf <strong>de</strong>m Militärgelän<strong>de</strong> Campo <strong>de</strong> Tiro Alcochete nördlich von Alcochete<br />
entstehen soll. Die portugiesischen Fluggesellschaften TAP Portugal, White Airways, Portugália Airlines und EuroAtlantic Airways haben ihren Sitz in Lissabon.<br />
ÖPNV<br />
Der ÖPNV wird hauptsächlich von <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Unternehmen Carris (Companhia dos Carris <strong>de</strong> Ferro <strong>de</strong> Lisboa) und <strong>de</strong>r Metropolitano <strong>de</strong> Lisboa übernommen. Die Carris bedient über<br />
100 Buslinien und nicht <strong>zu</strong>letzt mehrere Straßenbahnen. Der Verkehr wird teilweise mit historischen Wagen (pt. Eléctricos) unternommen. Zu<strong>de</strong>m betreibt sie in <strong>de</strong>r Stadt vier<br />
Elevadores (dt. Aufzüge), drei Standseilbahnen und einen senkrecht fahren<strong>de</strong>n Auf<strong>zu</strong>g, <strong>de</strong>n Elevador <strong>de</strong> Santa Justa. Die drei Standseilbahnen wur<strong>de</strong>n gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
gebaut, als in Lissabon damit begonnen wur<strong>de</strong>, die seit 1873 verkehren<strong>de</strong> Pfer<strong>de</strong>straßenbahn ab 1890 durch Kabelstraßenbahnen und später durch elektrische Straßenbahnen <strong>zu</strong> ersetzen.<br />
Die Metro Lissabon umfasst vier Linien, die teilweise über das Stadtgebiet hinaus führen. Das inzwischen 38 Kilometer lange U-Bahnnetz wird kontinuierlich ausgebaut.<br />
Schiene<br />
Die portugiesische Hauptstadt ist, neben Porto, <strong>de</strong>r Hauptknotenpunkt <strong>de</strong>s portugiesischen Schienennetzes. Vier Eisenbahnstrecken laufen auf Lissabon <strong>zu</strong>, die, verbun<strong>de</strong>n durch die<br />
Ringstrecke Linha <strong>de</strong> Cintura, an verschie<strong>de</strong>nen Bahnhöfen im Lissabonner Stadtgebiet en<strong>de</strong>n. Der wichtigste Bahnhof ist <strong>de</strong>r Bahnhof Santa Apolónia an <strong>de</strong>r Linha do Norte, dort en<strong>de</strong>n<br />
alle internationalen Züge aus Spanien und Frankreich sowie <strong>de</strong>r Großteil <strong>de</strong>r nationalen Hochgeschwindigkeitszüge Alfa Pendular. Des Weiteren liegt im Nordosten Lissabons <strong>de</strong>r<br />
Bahnhof Oriente, <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>künftig, mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s normalspurigen Hochgeschwindigkeitsnetzes RAVE, <strong>zu</strong>m neuen Hauptbahnhof <strong>de</strong>r Stadt avancieren soll. Für <strong>de</strong>n Vorortverkehr<br />
verbleiben unter an<strong>de</strong>rem noch die bei<strong>de</strong>n Kopfbahnhöfe Cais do Sodré (Strecke nach Cascais) und Rossio (Strecke nach Sintra) sowie die an <strong>de</strong>r Linha <strong>de</strong> Cintura gelegenen Bahnhöfe<br />
Sete Rios und Entrecampos. Hier beginnt auch die Linie auf die Südseite <strong>de</strong>s Tejo nach Setúbal, die vom privaten Eisenbahnunternehmen Fertagus betrieben wird.[44]<br />
Fährverkehr
Es existieren mehrere Fährverbindungen über <strong>de</strong>n Tejo nach Barreiro, Cacilhas, Montijo, Porto Brandão, Seixal und Trafaria. Ablegestellen auf <strong>de</strong>r rechten Tejoseite sind: Belem, Cais do<br />
Sodré und Terreiro do Paço. Betreiber aller Linien ist inzwischen die Transtejo & Soflusa, Markenzeichen sind die blau-weißen Katamaranfähren, die mit 30 Knoten die Überfahrt auf<br />
<strong>de</strong>m Tejo auf ein Drittel verkürzt haben.<br />
Hafen<br />
Der Lissabonner Hafen zieht sich auf einer Länge von über 10 km an <strong>de</strong>r Uferlinie <strong>de</strong>r Stadt entlang. Außer<strong>de</strong>m gibt es noch zahlreiche Anlagen auf <strong>de</strong>r Tejo-Südseite in Trafaria, Porto<br />
Brandão, Almada, Seixal, Barreiro und Montijo, die <strong>zu</strong>m Porto <strong>de</strong> Lisboa gehören und von <strong>de</strong>r Hafenverwaltung APL betrieben wer<strong>de</strong>n, auch wenn sie außerhalb <strong>de</strong>s eigentlichen<br />
Stadtgebiets liegen. Diese Anlagen haben sich auf Getrei<strong>de</strong> und Öl spezialisiert. Auf <strong>de</strong>r Nordseite im Stadtgebiet Lissabons wer<strong>de</strong>n dagegen vor allem Container umgeschlagen. Hier<br />
gibt es auch direkte Anschlüsse an das Zugnetz in Alcântara und Santa Apolónia, wo die bei<strong>de</strong>n großen Containerterminals <strong>de</strong>r Stadt liegen. Die größten und tiefsten Docks liegen dabei<br />
in Alcântara. Insgesamt umschließen die Docks <strong>de</strong>s Lissabonner Hafens eine Wasserfläche von 430.000 m². Kreuzfahrtschiffe legen häufig in Lissabon an, um einen Stopp auf <strong>de</strong>m Weg<br />
von Nor<strong>de</strong>uropa ins Mittelmeer, auf die Kanaren o<strong>de</strong>r nach Südamerika <strong>zu</strong> machen. Für sie gibt es drei Anleger an <strong>de</strong>r Gare Marítima <strong>de</strong> Alcântara, <strong>de</strong>r Rocha do Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Óbidos sowie<br />
in Santa Apolónia. Für Privat-Yachten stehen vier Anlegestellen mit <strong>de</strong>r Doca <strong>de</strong> Alcântara, Doca <strong>de</strong> Santo Amaro und <strong>de</strong>r Doca <strong>de</strong> Belém e Doca do Bom Sucesso <strong>zu</strong>r Verfügung.<br />
Insgesamt haben hier etwa 1.100 Schiffe Platz.[45]<br />
Bildung und Wissenschaft<br />
Lissabon ist neben Coimbra die wichtigste Universitätsstadt in Portugal und hat mehrere Universitäten. Die Universität Lissabon wur<strong>de</strong> 1288 gegrün<strong>de</strong>t und 1290 vom Papst bestätigt.<br />
[46] Sie gehört <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n ältesten Universitäten in Europa, wur<strong>de</strong> aber erst nach mehr als 400-jähriger Pause 1911 neu gegrün<strong>de</strong>t, in<strong>de</strong>m medizinische und pharmazeutische Einrichtungen,<br />
eine polytechnische Hochschule und literaturwissenschaftliche Institute umorganisiert wur<strong>de</strong>n. Als größte Klinik gehört das Universitätskrankenhaus Hospital <strong>de</strong> Santa Maria mit 1500<br />
Betten <strong>zu</strong> ihr. Seit 1991 befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Torre do Tombo (portugiesisches Nationalarchiv) in einem mo<strong>de</strong>rnen Gebäu<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>m Campus <strong>de</strong>r Universität. Die Sternwarte Lissabon (pt.<br />
Observatório Astronómico <strong>de</strong> Lisboa) wur<strong>de</strong> 1992 <strong>de</strong>r Universität Lissabon angeschlossen und im Jahr 1995 in die naturwissenschaftliche Fakultät integriert. Eine <strong>de</strong>r größten<br />
Universitäten Portugals ist die 1931 gegrün<strong>de</strong>te Technische Universität Lissabon mit über 20.000 Stu<strong>de</strong>nten und sieben Fakultäten. Die 1973 gegrün<strong>de</strong>te Neue Universität Lissabon als<br />
dritte staatliche Universität ist mittlerweile auf über 14.000 Stu<strong>de</strong>nten gewachsen und bietet ein klassisches Lehrspektrum an. Eine Privat-Universität <strong>de</strong>r katholischen Kirche ist die<br />
1968 gegrün<strong>de</strong>te Katholische Universität Portugal. Die Universität Lusíada Lissabon von 1986 und die Internationale Universität Lissabon von 1984 sowie die Atlantik-Universität<br />
Lissabon, die Autonome Universität Lissabon, die Universität Lusófona Lissabon und die Mo<strong>de</strong>rne Universität Lissabon sind Privat-Universitäten. Die Deutsche Schule Lissabon ist die<br />
älteste <strong>de</strong>utsche Schule <strong>de</strong>r Iberischen Halbinsel und die zweitälteste aller <strong>de</strong>utschen Auslandsschulen. Sie wur<strong>de</strong> 1848 von einem evangelischen Pfarrer <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Gemein<strong>de</strong> in<br />
Lissabon ins Leben gerufen. Die Schule musste während <strong>de</strong>s Ersten Weltkriegs im Jahre 1916 zwangsweise schließen. Ihrer Wie<strong>de</strong>reröffnung erfolgte 1922. Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten<br />
Weltkriegs en<strong>de</strong>te erneut <strong>de</strong>r Schulbetrieb. Dieser wur<strong>de</strong> nach Neueröffnung am 20. Oktober 1952 wie<strong>de</strong>r aufgenommen.[47]<br />
Persönlichkeiten<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
Lissabon war Geburtsort zahlreicher bekannter Persönlichkeiten. Da<strong>zu</strong> gehören <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r Europäischen Kommission Durão Barroso, <strong>de</strong>r ehemalige Ministerpräsi<strong>de</strong>nt und<br />
Staatspräsi<strong>de</strong>nt Mário Soares, <strong>de</strong>r Franziskaner Antonius von Padua, <strong>de</strong>r Afrikaforscher und Gouverneur von Angola Hernandogildo Augusto <strong>de</strong> Brito Capello sowie Papst Johannes<br />
XXI.<br />
Literatur<br />
• Johannes Beck: Lissabon, Erlangen 2009, ISBN 978-3-89953-459-7.<br />
• Johannes Beck: Lissabon und Umgebung, Erlangen 2009, ISBN 978-3-89953-458-0.<br />
• Walther L. Bernecker, Horst Pietschmann: Geschichte Portugals – Vom Spätmittelalter bis <strong>zu</strong>r Gegenwart, C. H. Beck, 2001, ISBN 3-406-44756-2.
• Claus-Günter Frank: Lissabon – Ent<strong>de</strong>ckungen in Portugals Metropole. Tübingen 2005, ISBN 3-937667-68-7.<br />
• Horst Günther: Das Erdbeben von Lissabon und die Erschütterung <strong>de</strong>s aufgeklärten Europa, Fischer, Frankfurt, 2005, ISBN 3-596-16854-6.<br />
• Lydia Hohenberger, Jürgen Strohmaier: Lissabon, DuMont, 2005, ISBN 3-7701-6063-0.<br />
• Annette Hüller, Lissabon, Marco Polo, 2008, ISBN 3-8297-0475-5.<br />
• Gerhard Lauer, Thorsten Unger: Das Erdbeben von Lissabon und <strong>de</strong>r Katastrophendiskurs im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt, Wallstein, 2008, ISBN 3-8353-0267-1.<br />
• Susanne Lipps, Heidrun Reinhard: Lissabon, Polyglott-Verlag, 2009, ISBN 978-3-493-55908-8.<br />
• Sara Lier: Immigranten in Lissabon, Vdm Verlag Dr. Müller, 2008, ISBN 3-8364-7226-0.<br />
• Eva Missler: Lissabon, Bae<strong>de</strong>ker, 2005, ISBN 3-8297-1058-5.<br />
• A. H. <strong>de</strong> Oliveira Marques: Geschichte Portugals und <strong>de</strong>s portugiesischen Weltreichs, Stuttgart: Kröner, 2001, 713 S., ISBN 3-520-38501-5.<br />
• José Saramago: Geschichte <strong>de</strong>r Belagerung von Lissabon, Rowohlt, Reinbek, 1992, ISBN 3-498-06249-2.<br />
• Sabine Scholl: Lissabon, Artemis & Winkler, 2009, ISBN 3-538-07281-7.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Statistical Yearbook of the Lisboa Region – 2007, S. 31 (PDF)<br />
2. ↑ Statistical Yearbook of the Lisboa Region – 2007, S. 61 (PDF)<br />
3. ↑ Uni Bremen angerufen am 23. Juni 2009<br />
4. ↑ xxx abgerufen am 6. Juni 2009<br />
5. ↑ Johann Jakob Egli: Nomina geographica – Sprach- und Sacherklärung von 42000 geographischen Namen aller Erdräume, S. 544, Georg Olms Verlag, 1973, ISBN 3-487-<br />
04571-0.<br />
6. ↑ Hugo Kastner: Von Aachen bis Zypern – Geografische Namen und ihre Herkunft, S. 186, Schlütersche, 2007, ISBN 3-89994-124-1.<br />
7. ↑ Meyers Konversations-Lexikon: Lissabon, 1888.<br />
8. ↑ Eva Missler: Lissabon, S. 25.<br />
9. ↑ Mittelalter-genealogie.<strong>de</strong>, Alfons 2 abgerufen am 6. Juni 2009<br />
10.↑ Portugal-Info.net abgerufen am 6. Juni 2009<br />
11.↑ Walther L. Bernecker, Horst Pietschmann: Geschichte Portugals – Vom Spätmittelalter bis <strong>zu</strong>r Gegenwart, S. 10, 11.<br />
12.↑ Looking for Earthquake Sources in the Lisbon Area, 13th European Meeting of Environmental and Engineering Geophysics, Istanbul, Turkey, 3.–5. September 2007 (PDF)<br />
13.↑ Walther L. Bernecker, Horst Pietschmann: Geschichte Portugals – Vom Spätmittelalter bis <strong>zu</strong>r Gegenwart, S. 36.<br />
14.↑ A. H. <strong>de</strong> Oliveira Marques: Geschichte Portugals, S. 105 f.<br />
15.↑ Eva Missler: Lissabon, S. 28.<br />
16.↑ Eva Missler: Lissabon, S. 29.<br />
17.↑ Josef Kulischer: Allgemeine Wirtschaftsgeschichte <strong>de</strong>s Mittelalters und <strong>de</strong>r Neuzeit, S. 221, Ol<strong>de</strong>nbourg, 6. Auflage, 1988, ISBN 978-3-486-41976-4.<br />
18.↑ Julius von Minutoli: Portugal und seine Colonien, S. 240.<br />
19.↑ Walther L. Bernecker, Horst Pietschmann: Geschichte Portugals – Vom Spätmittelalter bis <strong>zu</strong>r Gegenwart, S. 72.<br />
20.↑ Julius von Minutoli: Portugal und seine Colonien, S. 305.<br />
21.↑ Walther L. Bernecker, Horst Pietschmann: Geschichte Portugals – Vom Spätmittelalter bis <strong>zu</strong>r Gegenwart, S. 83.<br />
22.↑ Heidrun Reinhard: Lissabon, S. 14, Polyglott, 2005, ISBN 3-493-56908-4.
23.↑ Hochschule Darmstadt abgerufen am 6. Juni 2009<br />
24.↑ Diário <strong>de</strong> Notícias 2007 abgerufen am 9. Juli 2009<br />
25.↑ Bericht <strong>zu</strong>m Fallstudiengebiet Lissabon, Gebiet Ameixoeira-Galinheiras, TU-Dres<strong>de</strong>n, 2006 (PDF) abgerufen am 6. Juni 2009<br />
26.↑ Wolfgang Ismayr: Die politischen Systeme Westeuropas, S. 809, VS Verlag, 2009, ISBN 3-531-16464-3.<br />
27.↑ Markttest.com abgerufen am 22. Juni 2009<br />
28.↑ Cm-lisboa.pt Bürgermeister und Stadtrat abgerufen am 6. Juni 2009<br />
29.↑ Eva Missler: Lissabon, S. 21.<br />
30.↑ Cm-lisboa.pt – Homepage von Lissabon (pt) abgerufen am 6. Juni 2009<br />
31.↑ Anja Bothe: Vergleich <strong>de</strong>s portugiesischen und <strong>de</strong>utschen Bauplanungs- und Sanierungsrechts im Hinblick auf die Zielset<strong>zu</strong>ng einer sozial ausgeglichenen<br />
Wohnraumversorgung- Erfahrungen in <strong>de</strong>n Metropolen Lissabon und Berlin, S. 227.LIT Verlag, 2004, ISBN 3-8258-7144-4.<br />
32.↑ xxx abgerufen am 29. Juni 2009<br />
33.↑ Eva Missler: Lissabon, S. 154.<br />
34.↑ Structurae.<strong>de</strong> abgerufen am 19. Juni 2009<br />
35.↑ Lydia Hohenberger, Jürgen Strohmaier: Lissabon, S. 132.<br />
36.↑ Portaldasnacoes.pt (engl.) abgerufen am 6. Juni 2009<br />
37.↑ Johannes Beck: Lissabon und Umgebung, S. 319, Michael Müller Verlag, 2009, ISBN 978-3-89953-458-0.<br />
38.↑ Johannes Beck: Lissabon, S. 175, Michael Müller Verlag, 2009, ISBN 978-3-89953-459-7.<br />
39.↑ A Brasileira abgerufen am 7. Juli 2009 (pt.)<br />
40.↑ museudoscoches-ipmuseus.pt abgerufen am 1. Juli 2009<br />
41.↑ Annette Hüller, Lissabon, S. 78.<br />
42.↑ Pasteis<strong>de</strong>belem.pt abgerufen am 5. Juli 2009<br />
43.↑ Lissabon.org abgerufen am 6. Juni 2009<br />
44.↑ Johannes Beck: Lissabon und Umgebung, S. 122–124, Michael Müller Verlag, 2009, ISBN 978-3-89953-458-0.<br />
45.↑ Lissabon-Umgebung.<strong>de</strong> abgerufen am 17. September 2009<br />
46.↑ Walter Rüegg, Asa Briggs: Geschichte <strong>de</strong>r Universität in Europa – Mittelalter, S. 64, C. H. Beck, 1993, ISBN 978-3-406-36952-0.<br />
47.↑ Deutsche Schule Lissabon abgerufen am 19. Juni 2009<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Laredo (Spanien)<br />
Laredo ist eine Stadt in Spanien. Sie hat 12.591 Einwohner (Stand: 1. Januar 2009) und eine Fläche von 13 km².<br />
Laredo liegt an wohl einer <strong>de</strong>r schönsten Buchten in Kantabrien. Laredo ist 44 km von Santan<strong>de</strong>r und 52 km von Bilbao entfernt und ist durch seine günstige Lage ein wichtiger<br />
touristischer Anziehungspunkt für viele Spanier, Madrilenen, aber auch Basken.<br />
Die Strandpromena<strong>de</strong> von Laredo umfasst 4 km und ist <strong>de</strong>r längste Strand von Kantabrien und wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Ban<strong>de</strong>ra A<strong>zu</strong>l, <strong>de</strong>r blauen Flagge ausgezeichnet, welches beste<br />
Wasserqualität und Sauberkeit <strong>de</strong>s Stran<strong>de</strong>s belegt.<br />
Laredo besitzt eine sehr eindrucksvolle historische Altstadt aus <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt.<br />
Das wichtigste Fest <strong>de</strong>s Jahres ist die Batalla <strong>de</strong> Flores im August. Ein Um<strong>zu</strong>g von mit Blumen geschmückten Wagen, <strong>de</strong>r fast an einen Karnevalsum<strong>zu</strong>g erinnert.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Population Figures referring to 01/01/2009. Bevölkerungsstatistiken <strong>de</strong>s Instituto Nacional <strong>de</strong> Estadística.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Bermeo - Berméo<br />
Bermeo ist eine Stadt mit 16.932 Einwohnern (2005) im spanischen Baskenland.<br />
Sie liegt direkt an <strong>de</strong>r Atlantikküste, etwa 25 km nordöstlich von Bilbao, in <strong>de</strong>r nordspanischen Provinz Bizkaia.<br />
Der Küstenort verfügt über einen wichtigen Fischereihafen.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Asturien<br />
Asturien (spanisch Asturias bzw. offiziell Principado <strong>de</strong> Asturias, d. h. Fürstentum Asturien, asturisch Asturies bzw. Principáu d'Asturies) ist eine Autonome Gemeinschaft im<br />
Nordwesten Spaniens. Das Territorium <strong>de</strong>r Autonomen Gemeinschaft ist i<strong>de</strong>ntisch mit <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Provinz Asturien (früher Provinz Oviedo). Die Hauptstadt ist Oviedo mit 224.005<br />
Einwohnern (Stand: 1. Januar 2009).<br />
Geographie<br />
Asturien erstreckt sich zwischen <strong>de</strong>m Kantabrischen Meer im Nor<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>m Kantabrischen Gebirge im Sü<strong>de</strong>n. Politisch grenzt es im Westen an Galicien, im Sü<strong>de</strong>n an Kastilien-León<br />
und im Osten an Kantabrien. Die Küste nennt sich Costa Ver<strong>de</strong>; hier befin<strong>de</strong>n sich einige <strong>de</strong>r schönsten Strän<strong>de</strong> Spaniens.<br />
In <strong>de</strong>r ganzen Region herrscht ozeanisches Klima, das sich stark vom heißen und trockenen Klima in Zentral- und Südspanien unterschei<strong>de</strong>t. Das Landschaftsbild Asturiens ist daher von<br />
wesentlich mehr Grün bestimmt (España Ver<strong>de</strong>, das „grüne Spanien“). Das Kantabrische Gebirge wirkt dabei als Klimaschei<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m zentralspanischen Tafelland.<br />
Bevölkerung<br />
Die Bevölkerung konzentriert sich in <strong>de</strong>n Tälern <strong>de</strong>s zentralen Lan<strong>de</strong>steiles sowie an <strong>de</strong>r Küste mit ihren urbanen Zentren Gijón und Avilés, während die Mittel- und<br />
Hochgebirgsregionen nur dünn besie<strong>de</strong>lt sind.<br />
Sprachen<br />
Neben <strong>de</strong>r Amtssprache Spanisch wird in Asturien auch das Asturische sowie in <strong>de</strong>n westlichen Randgebieten längs <strong>de</strong>r Grenze <strong>zu</strong> Galicien das Galicische gesprochen.<br />
Städte<br />
Die größten Städte Asturiens sind die Hafenstadt Gijón (asturisch Xixón) mit 277.554 Einwohnern, die Hauptstadt Oviedo (asturisch Uviéu) mit 224.005 Einwohnern und die<br />
Industriestadt Avilés mit 84.242 Einwohnern.<br />
Größte Gemein<strong>de</strong>n<br />
• Gemein<strong>de</strong> Einwohner[2]<br />
• (1. Januar 2009)<br />
•<br />
• Gijón 277.554<br />
• Oviedo 224.005<br />
• Avilés 84.242<br />
• •Siero 51.181<br />
• Langreo 45.565<br />
• Mieres 44.070<br />
• Castrillón 22.894
• San Martin <strong>de</strong>l Rey Aurelio 18.729<br />
• Corvera <strong>de</strong> Asturias 15.955<br />
• Cangas <strong>de</strong>l Narcea 14.589<br />
• Llanes 14.013<br />
• Navia 9.190<br />
• Riba<strong>de</strong>sella 6.296<br />
Geschichte<br />
In <strong>de</strong>r Region gibt es Höhlen mit steinzeitlichen Malereien, vor allem Tierdarstellungen, die mehr als 15.000 Jahre alt sind. Es wur<strong>de</strong>n etwa 700 Dolmen gefun<strong>de</strong>n. Die meisten haben<br />
die Jahrtausen<strong>de</strong> nicht unversehrt überstan<strong>de</strong>n, obwohl sie von Mámoas be<strong>de</strong>ckt waren.<br />
Die ersten festen Siedlungen wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Iberern <strong>zu</strong>gerechnet. Die Region bot Bo<strong>de</strong>nschätze, insbeson<strong>de</strong>re Gold, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>ren För<strong>de</strong>rung von <strong>de</strong>r so genannten Castrokultur umwallte Orte<br />
gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n. Diese waren über lange Zeit (>1000 Jahre) bevölkert und wer<strong>de</strong>n heute ausgegraben.<br />
Etwa 800 v. Chr. wur<strong>de</strong> die Region von keltischen Stämmen besie<strong>de</strong>lt. Diese errichteten befestigte Siedlungen wie das Castro <strong>de</strong> Coaña. Sie dürften ihren Lebensunterhalt unter an<strong>de</strong>rem<br />
auch als Hirten bestritten haben.<br />
Ca. 25–19 v. Chr. wur<strong>de</strong> die Region ins Römische Reich eingeglie<strong>de</strong>rt. Doch die Asturer waren ebenso wie an<strong>de</strong>re einheimische Völker rebellisch, was als Grund für die relative späte<br />
Integration in <strong>de</strong>n römischen Herrschaftsbereich angesehen wer<strong>de</strong>n kann. Nach <strong>de</strong>ssen Zerfall wur<strong>de</strong> Asturien im 5. Jahrhun<strong>de</strong>rt Teil <strong>de</strong>s Westgotenreichs. Nach <strong>de</strong>r Eroberung <strong>de</strong>r<br />
Iberischen Halbinsel durch die Muslime (711-719) begann von Asturien aus <strong>de</strong>r Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r Christen, <strong>de</strong>n <strong>de</strong>r vornehme Gote Pelayo (Pelagius) († 737) organisierte. Er wur<strong>de</strong> von<br />
seinen Anhängern <strong>zu</strong>m König (o<strong>de</strong>r Fürsten) gewählt und soll im Jahr 722 eine Streitmacht <strong>de</strong>s für die Region <strong>zu</strong>ständigen muslimischen Statthalters in <strong>de</strong>r legendären Schlacht von<br />
Covadonga besiegt haben. Dieser Erfolg wird als <strong>de</strong>r Ausgangspunkt <strong>de</strong>r Reconquista betrachtet. Aus Pelayos Machtbereich entstand das Königreich Asturien, das infolge <strong>de</strong>r Expansion<br />
Richtung Sü<strong>de</strong>n 924 Teil <strong>de</strong>s Königreiches León wur<strong>de</strong>. 1230 wur<strong>de</strong> es mit Kastilien vereinigt. Der spanische Thronfolger trägt seit 1388 <strong>de</strong>n Titel „Fürst von Asturien“ (Príncipe <strong>de</strong><br />
Asturias).<br />
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> Asturien <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m Baskenland Zentrum <strong>de</strong>r Industrialisierung Spaniens (v. a. Bergbau und Schwerindustrie). Es war auch eine <strong>de</strong>r<br />
Ursprungsregionen <strong>de</strong>r spanischen Arbeiterbewegung.<br />
Im Oktober 1934 fand in <strong>de</strong>n Bergbaugebieten Asturiens die „revolución <strong>de</strong> octubre“ (Oktoberrevolution) o<strong>de</strong>r „revolución minera“ (Bergarbeiterrevolution) statt, die von <strong>de</strong>n Truppen<br />
<strong>de</strong>r damals von rechten Parteien dominierten Regierung <strong>de</strong>r Republik nie<strong>de</strong>rgeschlagen wur<strong>de</strong>. Die Leitung <strong>de</strong>r Militäraktion gegen die streiken<strong>de</strong>n Bergarbeiter hatte <strong>de</strong>r spätere<br />
Diktator Franco, <strong>de</strong>r zwei Jahre später <strong>de</strong>n Bürgerkrieg lostreten sollte.<br />
Im Spanischen Bürgerkrieg war Asturien ein Zentrum <strong>de</strong>s republikanischen Wi<strong>de</strong>rstan<strong>de</strong>s. Es war jedoch geographisch vom Hauptteil <strong>de</strong>r republikanischen Zone isoliert und konnte im<br />
Sommer 1937 von Francos Truppen erobert wer<strong>de</strong>n.<br />
Ihr heutiges Autonomiestatut erhielt die Region am 11. Januar 1982.<br />
Politische Glie<strong>de</strong>rung<br />
Asturien glie<strong>de</strong>rt sich administrativ in 78 Concejos (dt. Räte, Städte und Gemein<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m Muster <strong>de</strong>r Municipios im übrigen Spanien), die nach <strong>de</strong>m Autonomiestatut <strong>zu</strong> Comarcas<br />
(entspricht in etwa Regierungsbezirken o<strong>de</strong>r Landkreisen) <strong>zu</strong>sammengefasst wer<strong>de</strong>n können, was aber bisher nicht vollständig geschehen ist. Vom Standpunkt <strong>de</strong>r Judikative aus gesehen<br />
sind die 78 Concejos in 18 Gerichtsbezirke unterteilt.
Wirtschaft<br />
Asturien ist eine <strong>de</strong>r Industrieregionen Spaniens, insbeson<strong>de</strong>re aufgrund <strong>de</strong>s vorherrschen<strong>de</strong>n Bergbaus und <strong>de</strong>r Schwerindustrie. Da diese Branchen eher <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n schrumpfen<strong>de</strong>n gehören,<br />
befin<strong>de</strong>t sich Asturien seit <strong>de</strong>n 1970er Jahren in einem Strukturwan<strong>de</strong>l. In <strong>de</strong>n letzten vier Jahrzehnten lag die Wirtschaftswachstumsrate Asturiens hinter <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rer spanischer Gebiete<br />
<strong>zu</strong>rück.<br />
Die Landwirtschaft spielt in Asturien eine größere Rolle, da aufgrund <strong>de</strong>s feuchten Klimas und mäßiger Temperaturen Agrarprodukte produziert wer<strong>de</strong>n können, die in an<strong>de</strong>ren Regionen<br />
Spaniens nur mit höherem Aufwand angebaut wer<strong>de</strong>n können. Daneben gibt es (hauptsächlich inländischen) Tourismus.<br />
Das Bruttoinlandsprodukt <strong>de</strong>r Region erreichte im Jahr 2006 gemessen in Kaufkraftstandards 94% <strong>de</strong>s Durchschnitts <strong>de</strong>r Europäischen Union (EU-27).[3]<br />
Industrie<br />
Die traditionell vorherrschen<strong>de</strong>n Industriezweige Asturiens waren Steinkohlen- und Erzbergbau. Da die weitere För<strong>de</strong>rung von Rohstoffen mit mehr Aufwand verbun<strong>de</strong>n ist und die<br />
geför<strong>de</strong>rten Rohstoffe aufgrund von billiger Konkurrenz aus <strong>de</strong>m Ausland unrentabler gewor<strong>de</strong>n sind, nimmt <strong>de</strong>r Bergbau seit <strong>de</strong>n 1990er Jahren kontinuierlich ab. Zwischen Gijón und<br />
Avilés gibt es Schwerindustrie, wobei die Betriebe nicht <strong>zu</strong>letzt als Folge <strong>de</strong>s rückläufigen Bergbaus von einer Schließungswelle betroffen sind.<br />
Die Regionalregierung versucht, durch die gezielte Ansiedlung mo<strong>de</strong>rner Unternehmen eine Wirtschaftskrise ab<strong>zu</strong>wen<strong>de</strong>n, wodurch eine abnehmen<strong>de</strong> Zahl von Arbeitsplätzen allerdings<br />
nicht auf<strong>zu</strong>halten ist. Gera<strong>de</strong> ehemalige Bergleute haben große Schwierigkeiten, in <strong>de</strong>r Region wie<strong>de</strong>r Arbeit <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n. Die Medien berichten von einer realen Arbeitslosenquote<br />
zwischen 30% und 40%.<br />
Landwirtschaft<br />
Asturien ist die Milchkammer Spaniens; von <strong>de</strong>r Küste bis <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Picos <strong>de</strong> Europa wer<strong>de</strong>n vor allem Milchkühe gehalten. Ein durchschnittlicher Milchviehbetrieb hat 10 bis 15<br />
Milchkühe, Großbetriebe sind in <strong>de</strong>m hügeligen und kleinstrukturierten Gebieten selten. Ackerbau wird vornehmlich als Maisanbau <strong>zu</strong>r Silierung und Winterfütterung <strong>de</strong>r Kühe<br />
betrieben. Getrei<strong>de</strong>anbau fin<strong>de</strong>t kaum statt, ebenso wenig gibt es nennenswerten Weinbau. Eine Spezialität Asturiens ist <strong>de</strong>r Sidra, ein preisgünstiger Apfelwein.<br />
In Asturien fin<strong>de</strong>n sich überall noch traditionelle quadratischen Hórreos, das sind Getrei<strong>de</strong>-, Obst- und Kartoffelspeicher, die <strong>zu</strong>m Schutz gegen Nagetiere auf Pfählen stehen. Die<br />
meisten Hórreos sind aus Holz gebaut. Im Westen Asturiens gibt es allerdings auch längliche Speicher aus Steinmaterialien.<br />
Der Wald besteht heute <strong>zu</strong>m Großteil aus Eukalyptus-Monokulturen. Das schnellwachsen<strong>de</strong> und hochwertige Holz hat <strong>de</strong>n Nachteil, dass <strong>de</strong>r Waldbo<strong>de</strong>n ausgelaugt wird. Zu<strong>de</strong>m steigt<br />
bei <strong>de</strong>m stark ölhaltigen Eukalyptusholz die Gefahr von Waldbrän<strong>de</strong>n sehr stark.<br />
Quellen<br />
• ↑ Quelle: http://www.xxx<br />
• ↑ Population Figures referring to 01/01/2009. Bevölkerungsstatistiken <strong>de</strong>s Instituto Nacional <strong>de</strong> Estadística.<br />
• ↑ http://www.xxx<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Honfleur<br />
Honfleur ist eine Hafenstadt mit 8163 Einwohnern (Stand 1. Januar 2007) im Département Calvados, Basse-Normandie, Frankreich. Sie liegt an <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>r Seine in <strong>de</strong>n<br />
Ärmelkanal.<br />
Geschichte<br />
Die Stadt, die schon im 11. Jahrhun<strong>de</strong>rt urkundlich erwähnt wird, war jahrhun<strong>de</strong>rtelang ein relativ unbe<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Hafen im Vergleich mit Harfleur auf <strong>de</strong>m an<strong>de</strong>ren Ufer <strong>de</strong>r<br />
Seinemündung. Mit <strong>de</strong>r Zeit hat sich das Städtchen mit seinen pittoresken, schmalen und sechs Stockwerke hohen Häusern und <strong>de</strong>r Lieutenance (<strong>de</strong>m Rest einer Befestigungsanlage) am<br />
Vieux Bassin (Altes Hafenbecken) aus <strong>de</strong>m 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong> einem <strong>de</strong>r reizvollsten Orte <strong>de</strong>r Normandie und vielbesuchten touristischen Anziehungspunkt entwickelt.<br />
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> Honfleur <strong>zu</strong>m Zentrum künstlerischer Aktivitäten. Eugène Boudin, <strong>de</strong>r Maler <strong>de</strong>r Küstenlandschaften, wur<strong>de</strong> 1814 hier geboren. Das Musée Eugène Boudin ist<br />
ihm gewidmet und dokumentiert die malerische Atmosphäre <strong>de</strong>r Stadt und <strong>de</strong>r Seine-Mündung. Maler wie Courbet, Sisley, Jongkind, Clau<strong>de</strong> Monet, Pissarro, Renoir und Cézanne<br />
kamen nach Honfleur und trafen sich oft in <strong>de</strong>r Ferme St-Siméon, einem Bauernhof, <strong>de</strong>r als eine <strong>de</strong>r Geburtsstätten <strong>de</strong>s Impressionismus gilt und heute ein stilvolles Hotel ist.<br />
Sehenswürdigkeiten<br />
Auch heute noch stehen die Maler am Kai von Honfleur, und in <strong>de</strong>n Greniers à Sel, zwei Lagerhäusern, die 1670 östlich <strong>de</strong>s Vieux Bassin in l’Enclos, <strong>de</strong>r im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt errichteten<br />
Verteidigungsanlage <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong>m Zweck <strong>de</strong>r Salzlagerung erbaut wur<strong>de</strong>n, wer<strong>de</strong>n Ausstellungen zeitgenössischer Künstler organisiert.<br />
Auch <strong>de</strong>r Komponist Erik Satie ist ein Kind <strong>de</strong>r Stadt. Von seiner Musik kann man sich in Les Maisons Satie inspirieren lassen.<br />
Ein Meisterwerk <strong>de</strong>r Ingenieurbaukunst ist die 1995 eingeweihte Pont <strong>de</strong> Normandie, die Honfleur und Le Havre (Dpt. Seine-Maritime) verbin<strong>de</strong>t, eine <strong>de</strong>r längsten Brücken Europas.<br />
Persönlichkeiten<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
• Alphonse Allais (1854-1905), Schriftsteller und Humorist<br />
• Ernest Henri Besnier (1831-1909), Dermatologe und ärztlicher Direktor <strong>de</strong>s Hôpital St. Louis in Paris<br />
• Eugène Boudin (1824-1898), französischer Maler, Vorreiter <strong>de</strong>s Impressionismus<br />
• Erik Satie (1866-1925), französischer Komponist und Pianist.<br />
Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben<br />
• Charles Bau<strong>de</strong>laire (1821-1867), Schriftsteller, wohnte 1859 sechs Monate lang in Honfleur und schrieb dort La danse macabre (Totentanz), La chevelure (das Haar), und Chant
d'automne (Herbstgesang).[1]<br />
Partnerstädte<br />
Die englische Partnerstadt von Honfleur ist Sandwich in Kent. Seit <strong>de</strong>m 16. Juni 2006 besteht eine Städtepartnerschaft mit Wörth am Main.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Yves Lecouturier: Célèbres <strong>de</strong> Normandie. Orep Editions, 2007, ISBN 978-2-915762-13-6, S. 11. (französisch)<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Setúbal<br />
(Weitergeleitet von Setubal)<br />
Setúbal ist eine Stadt in Portugal. Sie liegt auf <strong>de</strong>r Halbinsel Península <strong>de</strong> Setúbal und gehört landschaftlich <strong>zu</strong> Estremadura.<br />
Geschichte<br />
Die ersten Siedler dieser Küstenregion waren Kelten und von Sü<strong>de</strong>n kommen<strong>de</strong> Phönizier, die wahrscheinlich mit Booten aus ihren Gebieten hierher kamen. Zeugen <strong>de</strong>r keltischen<br />
Besie<strong>de</strong>lung dieser Zeit sind in <strong>de</strong>r ganzen Gegend verstreute Kult- und Grabstätten. Unter <strong>de</strong>n Römern (von 100 v. Chr bis 400 n. Chr.) gab es starke Aktivitäten <strong>de</strong>r Fischverarbeitung<br />
im Bereich Setúbal. Dies zeigen insbeson<strong>de</strong>re die Ausgrabungen <strong>de</strong>r römischen Siedlung Cetóbriga auf <strong>de</strong>r gegenüberliegen<strong>de</strong>n Halbinsel Troia, wo es noch gut erhaltene Hafenanlagen<br />
und Fischverarbeitungsstätten <strong>zu</strong> besichtigen gibt. Nach <strong>de</strong>n Römern kamen um 410 n. Chr. die Germanen in das Gebiet <strong>de</strong>s heutigen Portugals gefolgt von <strong>de</strong>n Westgoten um 600 n.<br />
Chr. Troia nahm in dieser Zeit an Be<strong>de</strong>utung ab, weil sich die Dünen dort ständig über <strong>de</strong>n Ort legten. An<strong>de</strong>re Orte <strong>de</strong>r Umgebung, wie Azeitão, wegen <strong>de</strong>r hohen Fruchtbarkeit o<strong>de</strong>r<br />
Alcácer do Sal, wegen <strong>de</strong>s geschützt liegen<strong>de</strong>n Hafens, nahmen unter <strong>de</strong>n Arabern an Be<strong>de</strong>utung <strong>zu</strong>.<br />
Um das Jahr 700 herum wur<strong>de</strong>n große Teile <strong>de</strong>r iberischen Halbinsel durch die Mauren erobert, die im Bereich von Setúbal bis ins 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt hinein herrschten. Einige<br />
Grundmauern <strong>de</strong>r Altstadt gehen auf diese Zeit <strong>zu</strong>rück. Nach <strong>de</strong>r Rückeroberung <strong>de</strong>s Gebiets durch die Christen und <strong>de</strong>r Ausrufung <strong>de</strong>s portugiesischen Königreichs, wur<strong>de</strong> in Palmela<br />
<strong>de</strong>r Or<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Schwertes von Santiago eingerichtet. Auch Setúbal erhielt sein erstes Stadtrecht in einer „Carta Foral“ von D. Paio Peres, <strong>de</strong>m Abt <strong>de</strong>s Or<strong>de</strong>ns aus Palmela. Die Stadt<br />
Setúbal selbst wur<strong>de</strong> 1227 unter König Alfons II. mit Hilfe eines Kreuzfahrerheeres <strong>de</strong>s Fünften Kreuz<strong>zu</strong>gs, das auf <strong>de</strong>m Weg nach Palästina in Portugal überwinterte, erobert.<br />
1343 begann man damit, Setúbal mit einer geschlossenen Stadtmauer <strong>zu</strong> umgeben, von <strong>de</strong>r noch heute Reste übrig geblieben sind, die das große Erdbeben von 1755 überstan<strong>de</strong>n haben.<br />
Mehr und mehr entwickelte sich Setúbal <strong>zu</strong> einem wichtigen portugiesischen Hafen, von <strong>de</strong>m unter an<strong>de</strong>rem viele <strong>de</strong>r portugiesischen Ent<strong>de</strong>ckungsreisen ausgingen. Die Ent<strong>de</strong>ckungen<br />
brachten <strong>de</strong>r Stadt großen Reichtum unter <strong>de</strong>m König D. Afonso V und später unter Heinrich <strong>de</strong>m Seefahrer. Im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt konstruierten die Franziskaner <strong>de</strong>n Convento <strong>de</strong> Jesus in<br />
Setúbal, womit die Stadt auch <strong>zu</strong> einem kirchlichen Zentrum heranwuchs. Ab 1487 wur<strong>de</strong> eine Wasserleitung nach Setúbal durch König D. João II hergestellt, die <strong>zu</strong> weiterem
Anwachsen <strong>de</strong>r Stadtbevölkerung führte. Im Jahr 1522 ließ <strong>de</strong>r damalige König D. Filipe II das Fort S. Filipe bauen, welches noch heute existiert.<br />
Auch in dieser Zeit begann man damit <strong>de</strong>n Muskateller in <strong>de</strong>m mittelmeerähnlichen Klima von Setúbals Umgebung hauptsächlich auf Kalkbo<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> pflanzen. Das ausgeglichene Klima<br />
und die reizvolle Landschaft lockten <strong>de</strong>n Lissabonner A<strong>de</strong>l an, <strong>de</strong>r hier im 16., 17. und 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt seine Paläste und Landhäuser bauen ließ. Mittlerweile hatte sich Lissabon über<br />
<strong>de</strong>n Tejo gestreckt, und bis heute kriechen die Vororte entlang <strong>de</strong>r Schnellstraße immer weiter in Richtung Setúbal.<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong> S. Francisco Xavier <strong>zu</strong>m Schutzheiligen <strong>de</strong>r Stadt gewählt. 1755 vernichtete das große Erdbeben mit Tsunami viele Häuser in Setúbal und <strong>de</strong>r<br />
gesamten tiefer liegen<strong>de</strong>n Umgebung. Setúbal bekam das Stadtrecht im Jahre 1860. Das 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt brachte Setúbal weitere Aus<strong>de</strong>hnung und machte es <strong>zu</strong> einem industriellen<br />
Zentrum <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Auch die 1863 fertig gestellte Eisenbahnverbindung zwischen Barreiro und Setúbal trug weiter <strong>zu</strong>r Industrialisierung bei.<br />
1926 wur<strong>de</strong> Setúbal <strong>zu</strong>r Distrikthauptstadt ernannt und 1975 <strong>zu</strong>m Sitz <strong>de</strong>r Diözese.<br />
Seit 1995 fin<strong>de</strong>t hier das 1985 gegrün<strong>de</strong>te internationale Filmfestival Festróia statt.<br />
• Bevölkerungsentwicklung in Setúbal (1801–2004)<br />
•<br />
• 1801 1849 1900 1930 1960 1981 1991 2001 2004 2008<br />
• 15442 15060 35990 50456 56344 98366 103634 113934 120117 124555<br />
Historische Bauwerke<br />
• Burg von São Filipe<br />
• Fort von Santiago do Outão<br />
• Fort von Albarquel<br />
• Convento <strong>de</strong> Jesus<br />
Naturreservat Serra da Arrábida<br />
Die Serra da Arrábida erstreckt sich westlich von Setúbal an <strong>de</strong>r vom Meer abgewandten Küsten. Es gibt hier eine Reihe von seltenen Pflanzen und Tieren, die teilweise nur dort<br />
vorkommen. Deshalb wur<strong>de</strong> das Gebiet unter Schutz gestellt. Der Naturpark erstreckt sich mit einer Fläche von 10821 ha auf einem bis <strong>zu</strong> 8 km breitem und 22 km langem Streifen<br />
entlang <strong>de</strong>r Küste. Seine Begren<strong>zu</strong>ng bil<strong>de</strong>n die Städte und Dörfer Sesimbra und Santana im Westen, Azeitão und Quinta do Anjo im Nor<strong>de</strong>n sowie Palmela und Setúbal im Osten. Nach<br />
<strong>de</strong>r landschaftlichen Glie<strong>de</strong>rung gehört das Gebiet <strong>zu</strong>r Estremadura. Heute ist es in <strong>de</strong>n Verwaltungsbezirk <strong>de</strong>s Distrikts Setúbal eingeglie<strong>de</strong>rt und nimmt Teile <strong>de</strong>r Bezirke Setúbal,<br />
Palmela und Sesimbra ein. Allerdings haben verheeren<strong>de</strong> Waldbrän<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n letzten Jahren <strong>de</strong>n Bestand <strong>de</strong>r Waldfläche stark <strong>de</strong>zimiert.Diese wer<strong>de</strong>n oft mit Brandstiftung und<br />
Bo<strong>de</strong>nspekulation in Verbindung gebracht.<br />
Allgemein gültige Definitionen und Einheitlichkeit <strong>de</strong>r Schutzbegriffe wie Naturpark, Naturschutzgebiet, etc. gibt es in Portugal nicht. Für je<strong>de</strong>s Schutzgebiet sind die jeweiligen<br />
Vorschriften einzeln festgelegt. Das Gebiet <strong>de</strong>s Parque Natural da Arrábida wur<strong>de</strong> in verschie<strong>de</strong>ne Schutzzonen aufgeteilt. Den stärksten Schutz genießen die Reservas Integrais (ähnlich<br />
einem <strong>de</strong>utschen Naturschutzgebiet). Hier sind keinerlei menschliche Aktivitäten gedul<strong>de</strong>t, das Betreten ist nur mit Genehmigung <strong>de</strong>r Parkverwaltung <strong>zu</strong> wissenschaftlichen Zwecken<br />
gestattet. Es gibt drei Reservas Integrais, die die großen Waldgebiete umfassen (Mata do Solitário, Mata Coberta, Mata do Vidal).<br />
Einen geringeren Schutzstatus haben die Reservas Naturais Parciais. Da<strong>zu</strong> gehören Gebiete, die aufgrund ihrer Vegetation (Reserva Botânica), <strong>de</strong>r Geologie (Reserva Geológica) o<strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>r Fauna (Reserva Zoológica) beson<strong>de</strong>rs geschützt wer<strong>de</strong>n. Diese Gebiete umfassen weitgehend die restlichen Flächen <strong>de</strong>r Serra da Arrábida und <strong>de</strong>r Serra do Risco. In diesen Gebieten<br />
ist jegliche Zerstörung und Beeinträchtigung von Tieren, Pflanzen, Bö<strong>de</strong>n, Gesteinsformationen o<strong>de</strong>r kulturhistorischen Bauten ebenso untersagt wie landwirtschaftliche,<br />
forstwirtschaftliche o<strong>de</strong>r industrielle Nut<strong>zu</strong>ng. Ausgenommen sind u. a. „unverzichtbare Arbeiten“, unter die wohl die Zementfabrik Secil bei Outão mit ausge<strong>de</strong>hnten Steinbrüchen und
die großen Steinbruchanlagen bei Pedreiras (Serra do Risco) fallen.<br />
Verwaltung<br />
Setúbal ist Sitz eines gleichnamigen Kreises. Die Nachbarkreise sind (im Uhrzeigersinn im Nor<strong>de</strong>n beginnend): Palmela, Sesimbra, Alcácer do Sal, Grândola sowie <strong>de</strong>r Atlantische<br />
Ozean. Setúbal fungiert ebenfalls als Distrikthauptstadt, die <strong>de</strong>n Verwaltungssitz und Gerichtsstand für die o. g. Kreise stellt.<br />
Die folgen<strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n (freguesias) liegen im Kreis Setúbal:<br />
• Gâmbia - Pontes - Alto da Guerra<br />
• Nossa Senhora da Anunciada (Setúbal)<br />
• Sado<br />
• Santa Maria da Graça (Setúbal)<br />
• São Julião (Setúbal)<br />
• São Lourenço<br />
• São Sebastião (Setúbal)<br />
• São Simão<br />
Partnerstädte<br />
Setúbal unterhält Städtepartnerschaften mit folgen<strong>de</strong>n Städten:<br />
• Beauvais (Frankreich)<br />
• Leiria (Portugal)<br />
• Debrecen (Ungarn)<br />
• Pau (Frankreich)<br />
• Porto Seguro (Brasilien)<br />
• Tor<strong>de</strong>sillas (Spanien)<br />
• Safi (Marokko)<br />
• Quelimane (Mozambique)<br />
Kooperationen<br />
Setúbal unterhält Kooperationen mit folgen<strong>de</strong>n Städten:<br />
• Bobigny[1] (Frankreich)<br />
• Tarrafal[1] (Kapverdische Inseln)<br />
• Frohnleiten[2] (Österreich)<br />
• Jastrzębie Zdrój[2] (Polen)<br />
• Landsberg am Lech[2] (Deutschland)<br />
• Gioia <strong>de</strong>l Colle[2] (Italien)<br />
• Šiauliai[2] (Litauen)
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
• José Mourinho (* 1963), Fußballtrainer<br />
• Luísa Rosa <strong>de</strong> Aguiar Todi, Opern-Sängerin<br />
• Manoel Maria <strong>de</strong> Barbosa du Bocage (1765–1805), be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r portugiesischer Dichter <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
• Teresa Villa-Lobos (Künstlername Sabrina; * 1983), Sängerin<br />
• Nuno Frechaut (* 1977), portugiesischer Fußballspieler<br />
• Luís Buchinho, Mo<strong>de</strong><strong>de</strong>signer<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ a b [1], portugiesisch, auf mun-setubal.pt, aufgerufen am 19. April 2010<br />
2. ↑ a b c d e Schulprojekt Comenius auf schlossbergschule.<strong>de</strong>, aufgerufen am 18. April 2010<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Kastilien<br />
Kastilien (spanisch Castilla) ist eine auf <strong>de</strong>r zentralen Hochebene Spaniens gelegene Landschaft, <strong>de</strong>ren Bezeichnung auf das gleichnamige mittelalterliche Königreich <strong>zu</strong>rückgeht.<br />
Sie umfasst die heutigen Autonomen Regionen Castilla-La Mancha, Madrid und <strong>de</strong>n größten Teil von Castilla y León. Das kastilische Schei<strong>de</strong>gebirge unmittelbar nördlich von Madrid<br />
teilt die Landschaft in das nördliche Altkastilien und das südliche Neukastilien, das auch die Mancha (von arabisch ةرشنملا al-manschara, „flaches Land“') umfasst. Da Kastilien heute<br />
aber keine eigene politische o<strong>de</strong>r Verwaltungs-Einheit mehr darstellt, ist <strong>de</strong>r genaue territoriale Umfang nicht trennscharf ab<strong>zu</strong>grenzen.<br />
Nach dieser Landschaft wird die spanische Sprache vor allem <strong>zu</strong>r Abgren<strong>zu</strong>ng von <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren in Spanien gesprochenen Sprachen häufig als castellano (Kastilisch) bezeichnet.<br />
Begriffsgeschichte<br />
Der Begriff hat seinen Ursprung in <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 9. Jahrhun<strong>de</strong>rts im Osten <strong>de</strong>s Königreichs León begrün<strong>de</strong>ten Grafschaft Kastilien. Zunächst han<strong>de</strong>lte es sich um ein relativ kleines<br />
Gebiet am Oberlauf <strong>de</strong>s Ebro. Vor allem im Zuge <strong>de</strong>r Reconquista vergrößerte sich die Grafschaft bis <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 11. Jahrhun<strong>de</strong>rts stetig. Gleichzeitig löste sie sich immer mehr vom<br />
Königreich León und war ab ca. 950 praktisch von diesem unabhängig.<br />
1037 erobert Graf Ferdinand von Kastilien das Königreich León und wird <strong>zu</strong> <strong>de</strong>ssen König gekrönt, womit León und Kastilien wie<strong>de</strong>r vereint wur<strong>de</strong>n. Für die kurzen Zeiträume 1065-<br />
1072 und 1175-1230 war Kastilien, jetzt aber als Königreich Kastilien, wie<strong>de</strong>r vom Königreich León getrennt, bevor 1230 die nunmehr endgültige Vereinigung <strong>zu</strong> Kastilien-León<br />
erfolgte. Dieses Reich wird häufig als "Krone von Kastilien" o<strong>de</strong>r einfach Kastilien bezeichnet (ähnlich wie umgangssprachlich von Holland o<strong>de</strong>r England gere<strong>de</strong>t wird, obwohl die
Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r das Vereinigte Königreich gemeint sind). Es erwirbt im weiteren Verlauf <strong>de</strong>r Reconquista umfangreiche Gebiete und umfasst bei <strong>de</strong>ren Abschluss (1492) <strong>de</strong>n Nor<strong>de</strong>n,<br />
die Mitte und <strong>de</strong>n Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Iberischen Halbinsel. Im Westen grenzt es an Portugal und im Osten an die Gebiete <strong>de</strong>r Krone von Aragón und Navarra.<br />
Auch nach <strong>de</strong>r Einigung Spaniens durch die Katholischen Könige behalten die Reichsteile <strong>de</strong>r Krone von Kastilien, <strong>de</strong>r Krone von Aragón und Navarra ihre eigenen Rechtsordnungen<br />
und Institutionen. Zunächst han<strong>de</strong>lt es sich um eine reine Personalunion. Erst Anfang <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts verwan<strong>de</strong>ln die Bourbonen Spanien in einen Zentralstaat und erstrecken das<br />
kastilische Rechts- und Verwaltungssystem weitgehend auch auf die an<strong>de</strong>ren Reichsteile.<br />
1833 wur<strong>de</strong> Spanien in Provinzen geglie<strong>de</strong>rt (diese Provinzeinteilung besteht heute noch weitestgehend unverän<strong>de</strong>rt fort). Dabei wur<strong>de</strong>n die Provinzen <strong>zu</strong> "historischen Regionen"<br />
<strong>zu</strong>sammengefasst. Zwei von diesen führten die Bezeichnung Kastilien im Namen:<br />
• Altkastilien (Castilla la Vieja): Santan<strong>de</strong>r (heute: Kantabrien), Valladolid, Palencia, Burgos, Logroño (heute: La Rioja), Ávila, Segovia, Soria<br />
• Neukastilien (Castilla la Nueva): Madrid, Guadalajara, Toledo, Ciudad Real, Cuenca<br />
Allerdings hatten die "historischen Regionen" keinerlei eigene Kompetenzen o<strong>de</strong>r Institutionen, sie dienten allein <strong>de</strong>r begrifflichen Zusammenfassung verschie<strong>de</strong>ner Provinzen.<br />
Bei dieser Glie<strong>de</strong>rung bleibt es bis 1975, wobei während <strong>de</strong>r Franco-Diktatur (1936/39-1975) Regionalisierungsbestrebungen rigi<strong>de</strong> unterdrückt wur<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r Phase <strong>de</strong>s Übergangs <strong>zu</strong>r<br />
Demokratie (transición) war daher auch das Thema <strong>de</strong>r Regionalisierung eine <strong>de</strong>r drängendsten und am meisten umstrittenen Fragen. Bei <strong>de</strong>r Beratung <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>künftigen Verfassung<br />
verständigte man sich hier<strong>zu</strong> auf einen Minimalkompromiss, <strong>de</strong>r lediglich einen sehr weiten Rahmen für die spätere Bildung "Autonomer Gemeinschaften" (auf Grundlage <strong>de</strong>r<br />
bestehen<strong>de</strong>n Provinzen) und <strong>de</strong>ren Kompetenzen vorsah.<br />
Das Ergebnis <strong>de</strong>s Konstituierungsprozesses <strong>de</strong>r Autonomen Gemeinschaften in <strong>de</strong>n kastilischen Gebieten ergab folgen<strong>de</strong>s Bild:<br />
• Die Randprovinzen Santan<strong>de</strong>r und Logroño, die <strong>zu</strong>r "historischen Region" Altkastilien gehört hatten, bil<strong>de</strong>ten als Kantabrien bzw. La Rioja eigene uniprovinziale Autonome<br />
Gemeinschaften.<br />
• Die restlichen Provinzen Altkastiliens bil<strong>de</strong>ten gemeinsam mit <strong>de</strong>n Provinzen <strong>de</strong>r "historischen Region" León (León, Zamora, Salamanca) die Autonome Gemeinschaft<br />
Kastilien-León (Castilla y León).<br />
• Die Provinz Madrid, die historisch und geographisch <strong>zu</strong> Neukastilien <strong>zu</strong> zählen ist, bil<strong>de</strong>te ebenfalls eine eigene uniprovinziale Autonome Gemeinschaft.<br />
• Die restlichen Provinzien <strong>de</strong>r "historischen Region" Neukastilien bil<strong>de</strong>ten <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Provinz Albacete die Autonome Gemeinschaft Kastilien-La Mancha.<br />
Spätestens seit 1833 besteht damit Kastilien als eigene politische bzw. Verwaltungs-Einheit nicht mehr. Kastilien ist daher heute nur noch die Bezeichnung für eine Landschaft, <strong>de</strong>ren<br />
territoriale Aus<strong>de</strong>hnung je nach Sichtweise unterschiedlich <strong>de</strong>finiert wird, was insbeson<strong>de</strong>re für folgen<strong>de</strong> Gebiete gilt:<br />
• Die heutigen Autonomen Gemeinschaften Kantabrien und La Rioja waren historisch Teile <strong>de</strong>s Königreichs Kastilien. Geographisch liegen sie allerdings jenseits <strong>de</strong>r die Meseta<br />
umgeben<strong>de</strong>n Randgebirge (Kantabrien am Atlantik, La Rioja im Ebrobecken).<br />
• Die Provinzen León, Zamora und Salamanca (vereinzelt <strong>zu</strong>sätzlich auch Valladolid und Palencia) wer<strong>de</strong>n teilweise als eine von Kastilien <strong>zu</strong> unterschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Landschaft León<br />
angesehen. Aus historischer Sicht spricht dafür, dass diese Gebiete immer <strong>zu</strong>m Königreich León (bzw. <strong>zu</strong>m Teilkönigreich León innerhalb <strong>de</strong>r Krone Kastilien) und nie <strong>zu</strong>m<br />
eigentlichen Königreich Kastilien gehörten, und auch <strong>de</strong>r südliche Teil <strong>de</strong>s ehemaligen Königreichs León, die Extremadura, begrifflich nicht unter "Kastilien" gefasst wird.<br />
Landschaftlich allerdings gehen Kastilien und León in <strong>de</strong>r nördlichen Meseta ununterscheidbar ineinan<strong>de</strong>r über.<br />
• Bis <strong>zu</strong>r Errichtung <strong>de</strong>r Provinz Albacete im Jahre 1833 hatte ihr Gebiet jeweils etwa <strong>zu</strong>r Hälfte <strong>zu</strong>m Teilkönigreich Toledo (Neukastilien) und <strong>zu</strong>m Teilkönigreich Murcia gehört.<br />
1833 war sie <strong>de</strong>r "historischen Region" Murcia <strong>zu</strong>geordnet wor<strong>de</strong>n. Heute gehört sie <strong>de</strong>r Autonomen Gemeinschaft Kastilien-La Mancha an.<br />
Geschichte<br />
Kastilien, das Gebiet <strong>de</strong>s oberen Ebro, hieß bis um 800 Bardulien (nach <strong>de</strong>m Stamm <strong>de</strong>r dort leben<strong>de</strong>n Bardulier). Der Name Kastilien ist erstmals in einer lateinischen Urkun<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>m<br />
Jahr 800 bezeugt, wo von einer Kirche in territorio Castelle („im Burgenland“) die Re<strong>de</strong> ist. Diesen Namen verdankte die Region <strong>de</strong>n vielen Kastellen (lateinisch castella, spanisch
castillos), die dort <strong>zu</strong>m Schutz vor Angriffen <strong>de</strong>r Araber errichtet wor<strong>de</strong>n waren. Das Land wur<strong>de</strong> im 8. und 9. Jahrhun<strong>de</strong>rt von <strong>de</strong>n Königen von Asturien und später <strong>de</strong>ssen<br />
Nachfolgereich León im Kampf gegen die Araber erobert. Sie ließen es durch einheimische Grafen verwalten. Die Grafen von Burgos erhoben sich um 925 gegen <strong>de</strong>n König von León<br />
und bauten das Gebiet <strong>zu</strong> einer selbständigen Herrschaft aus, <strong>zu</strong>nächst als Bündnispartner <strong>de</strong>s Kalifen von Córdoba.<br />
Ferdinand González wird im 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt als erster Graf von Kastilien. Durch Aufstän<strong>de</strong> gegen die Könige Ramiro II. (931-950), Ordoño III. (950-957) und Sancho I. (957-966)<br />
suchte er die Unabhängigkeit seines Lan<strong>de</strong>s von León <strong>zu</strong> erreichen, obwohl vergeblich.<br />
Sein Sohn García Fernan<strong>de</strong>z herrschte auch bis <strong>zu</strong>m Jahr 1000 fast selbstständig. Dessen Sohn und Nachfolger Sancho hinterließ die Herrschaft seinem Sohn, <strong>de</strong>m Grafen García und<br />
nach <strong>de</strong>ssen Ermordung 1026 ging sie auf Sanchos Schwiegersohn, <strong>de</strong>n König Sancho Mayor von Navarra über, bei <strong>de</strong>ssen Tod im Jahr 1035 sein Sohn Ferdinand Kastilien erbte.<br />
Dieser besiegte am Río Carrión 1037 seinen Schwager, <strong>de</strong>n König Bermudo III. von León, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Schlacht fiel und vereinigte hierauf ganz León mit seiner bisherigen Herrschaft <strong>zu</strong>m<br />
Königreich Kastilien, das unter Ferdinands Fürsorge und verständiger Regierung immer mehr <strong>zu</strong> Glück und Macht emporstieg. Er schlug in <strong>de</strong>r Schlacht von Atapuerta 1054 einen<br />
Angriff seines neidischen Bru<strong>de</strong>rs Garcias von Navarra <strong>zu</strong>rück; vereinigte das navarresische Gebiet auf <strong>de</strong>m rechten Ebroufer mit Kastilien und erweiterte durch glückliche Kämpfe mit<br />
<strong>de</strong>n Arabern die Grenzen seines Reichs beträchtlich nach Sü<strong>de</strong>n.<br />
Bei seinem To<strong>de</strong> 1067 teilte er sein Reich unter seine drei Söhne, von <strong>de</strong>nen Sancho II. Kastilien, Alfons León und Asturien sowie García Galicien erhielt. In<strong>de</strong>s Sancho II. (1067-1072)<br />
vertrieb seine Brü<strong>de</strong>r; nach feigem Meuchelmord (nicht bewiesen) bemächtigte sich sein Bru<strong>de</strong>r Alfons VI. (1072-1109) <strong>de</strong>s Reichs und teilte sich 1076 mit Aragonien in das Königreich<br />
Navarra. Er regierte mit Weisheit und Kraft und führte siegreiche Kriege gegen die Mauren im Zuge <strong>de</strong>r Reconquista (Rückeroberung). In <strong>de</strong>r unglücklichen Schlacht bei Ucles verlor er<br />
1080 seinen einzigen Sohn Sancho. Unter ihm wur<strong>de</strong> das römisch-hierarchische Kirchensystem auch in Kastilien begrün<strong>de</strong>t.<br />
Seine Tochter Urraca (1109–1126 Königin v. León-Castilla) war Thronfolgerin. Sie vermählte sich auf Wunsch <strong>de</strong>s Vaters mit Alfons I. von Aragonien, doch gereichte die Vereinigung<br />
bei<strong>de</strong>r Reiche <strong>zu</strong> einem Königreich Hispanien keinem <strong>zu</strong>m Segen. Nach einem blutigen Bürgerkrieg, aus <strong>de</strong>m Portugal 1139 als unabhängige Nation hervortritt, trennten sich die<br />
Königreiche wie<strong>de</strong>r. Dank <strong>de</strong>r Hilfe <strong>de</strong>s kastilischen A<strong>de</strong>ls konnte die „Königin von Spanien“, Urraca, ihrem Sohn Alfons VII. Raimun<strong>de</strong>z das Königreich erhalten.<br />
Kastilien mit León und Galicien wur<strong>de</strong> das Gebiet Alfons VII. (1127-1157), welcher <strong>de</strong>n Titel eines „Kaisers von Spanien“ annahm und tapfer gegen die Araber focht. Unter seinen<br />
Söhnen und Nachfolgern wur<strong>de</strong> das kastilische Reich zerrissen, in<strong>de</strong>m León, Galicien, Asturien und Navarra sich unabhängig machten.<br />
In Kastilien folgte auf Alfons VII. Alfons VIII., <strong>de</strong>r Edle (1157-1214). Dieser hinterließ die Krone seinem elfjährigen Sohn Heinrich I., <strong>de</strong>r jedoch schon 1217 tödlich verunglückte.<br />
Nun brachen wie<strong>de</strong>r heftige Bürgerkriege aus, bis 1230 durch einen Vertrag Ferdinand III., Sohn von Heinrichs Schwester Berengaria und <strong>de</strong>m König Alfons IX. von León, als König<br />
von Kastilien und León anerkannt und dabei festgesetzt wur<strong>de</strong>, dass bei<strong>de</strong> Staaten in Zukunft ein einziges, unteilbares Reich bil<strong>de</strong>n, die Erbfolge auf <strong>de</strong>n ältesten Sohn und in<br />
Ermangelung männlicher Erben auf die weibliche Linie übergehen sollte. Ferdinand III., <strong>de</strong>r Heilige (1230-1252), war ein ebenso weiser Regent wie tapferer Feldherr; er eroberte 1236<br />
Córdoba, 1248 Sevilla und brachte das Land bis <strong>zu</strong>r Südküste unter kastilische Herrschaft, ja sogar Granada in Lehnsabhängigkeit von Kastilien.<br />
Ihm folgte 1252-1284 sein ältester Sohn, Alfons X., <strong>de</strong>r Weise, <strong>de</strong>r mit großer Freigebigkeit Künste und Wissenschaften unterstützte. Er bedrückte aber das Land mit neuen Steuern und<br />
erregte dadurch, dass er die Söhne seines erstgeborenen Sohns Ferdinand vom Thron ausschloss und seinen zweiten Sohn Sancho <strong>zu</strong>m Nachfolger bestimmte, einen Thronstreit, an <strong>de</strong>m<br />
sich namentlich Frankreich beteiligte und <strong>de</strong>r Kastiliens Macht be<strong>de</strong>utend schwächte, das Volk verwil<strong>de</strong>rte und <strong>de</strong>n A<strong>de</strong>l <strong>zu</strong> Trotz und Überhebung verleitete. Unter Sancho IV. (1284-<br />
1295) brach bereits eine Empörung <strong>de</strong>r mächtigen E<strong>de</strong>lleute aus. Gegen <strong>de</strong>n min<strong>de</strong>rjährigen Ferdinand IV. (1295-1312), <strong>de</strong>ssen legitime Geburt angezweifelt wur<strong>de</strong>, erhoben sich<br />
mehrere Präten<strong>de</strong>nten und auch die Nachbarreiche suchten sich auf Kosten Kastiliens <strong>zu</strong> vergrößern; aber seine Mutter María <strong>de</strong> Molina, welche die Regentschaft führte, wusste diese<br />
Gefahren durch Weisheit und Standhaftigkeit <strong>zu</strong> überwin<strong>de</strong>n. Neue Streitigkeiten brachen aus, als nach Ferdinands plötzlichem To<strong>de</strong> die Krone an <strong>de</strong>ssen zweijährigen Sohn Alfons XI.<br />
(1312-1350) fiel; das Reich wur<strong>de</strong> durch diese inneren Kämpfe völlig zerrüttet.<br />
Erst 1335 gelang es Alfons, durch Grausamkeit und Hinterlist, <strong>de</strong>r Empörungen Herr <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n und durch die Bewilligung <strong>de</strong>r Alcavala (einer Steuer) eine unabhängige Stellung <strong>zu</strong><br />
gewinnen. Er eroberte darauf 1344 Algeciras und starb bei <strong>de</strong>r Belagerung von Gibraltar 1350.<br />
Ihm folgte Peter <strong>de</strong>r Grausame (1350-1369), <strong>de</strong>r durch seine Greueltaten eine Erhebung seines Halbbru<strong>de</strong>rs Heinrich von Trastámara veranlasste und 1369 von diesem bei Montiel
geschlagen und getötet wur<strong>de</strong>.<br />
Heinrich II. (1369-1379) behauptete <strong>de</strong>n Thron gegen Peters Schwiegersohn Johann von Lancaster (John of Gaunt) und erwarb Vizcaya.<br />
Sein Sohn Johann I. (1379–1390) führte Krieg mit Portugal und England um <strong>de</strong>n Besitz seines Throns, einigte sich aber 1387 im Vertrag von Bayonne mit <strong>de</strong>m Haus Lancaster und 1389<br />
mit Portugal. Ihm folgte <strong>de</strong>r elfjährige Heinrich III. (1390–1406), <strong>de</strong>ssen Min<strong>de</strong>rjährigkeit Streitigkeiten über die Reichsverwaltung veranlasste, die das Land furchtbar zerrütteten. Da<br />
erklärte sich <strong>de</strong>r junge 14-jährige König 1393 für mündig, vermählte sich mit Katharine von Lancaster und führte die Regierung selbst und dies mit großer Energie. Unter ihm wur<strong>de</strong>n<br />
1402 die Kanarischen Inseln neuent<strong>de</strong>ckt.<br />
Durch die Heirat von Isabella I. von Kastilien und Fernando II. von Aragón, <strong>de</strong>r Katholischen Könige, im Jahr 1469 wur<strong>de</strong> Kastilien mit Aragon in Personalunion vereinigt, was <strong>de</strong>n<br />
spanischen Einigungsprozess weiter vorantrieb. Bei<strong>de</strong> Reich wur<strong>de</strong>n aber weiterhin getrennt voneinan<strong>de</strong>r verwaltet, so war ausschließlich Isabella berechtigt in kastilischen<br />
Angelegenheiten <strong>zu</strong> urteilen. Erst als Karl I. (ab 1519 als Karl V. auch römisch-<strong>de</strong>utscher Kaiser) 1516 von seines Großvater Ferdinand die Krone Aragon erbte wur<strong>de</strong>n die bei<strong>de</strong>n<br />
Reiche auch politisch vereint. In wirtschaftlicher Hinsicht stan<strong>de</strong>n die Königreiche aber weiter Rücken an Rücken: Aragón war mehr auf das Mittelmeer ausgerichtet, während für<br />
Kastilien bereits <strong>de</strong>r Atlantische Ozean eine größere Be<strong>de</strong>utung besaß. Die Ent<strong>de</strong>ckung und Eroberung Amerikas ab 1492 erfolgte daher im Namen <strong>de</strong>r Krone von Kastilien - theoretisch<br />
waren die Untertanen <strong>de</strong>r Krone von Aragón in Spanisch-Amerika Auslän<strong>de</strong>r.<br />
Herrscher von Kastilien<br />
Grafen von Kastilien (Haus Kastilien)<br />
• Paterna, Señora <strong>de</strong> Castilla; ∞ 842 Ramiro I., König von Asturien (Haus Kantabrien)<br />
• Rodrigo, † 873, wohl <strong>de</strong>ren Sohn, 852/872 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla<br />
• Diego Rodríguez Porcelos, † 885, <strong>de</strong>ssen Sohn, 873 bis wohl 885 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla<br />
• Nuño Núñez el <strong>de</strong> Castrojeriz, 899/900 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla, wohl ein Schwager von Diego Rodríguez (Haus Kastilien)<br />
• Gonzalo Téllez, † vor 929, 903 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla, wohl Schwager von Gonzalo Fernán<strong>de</strong>z (siehe unten)<br />
• Gonzalo Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Lara, † 932, Schwiegersohn und Neffe von Nuño Núñez el <strong>de</strong> Castrojeriz, † 932, 910 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla<br />
• Nuño Núñez el <strong>de</strong> Roa, Sohn von Nuño Núñez el <strong>de</strong> Castrojeriz, 914/915 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla<br />
• Gonzalo Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Lara, † 932, 916 (erneut) Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla<br />
• Fernando Ansúrez, 916/920 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla, Schwiegersohn von Munio Fernán<strong>de</strong>z (siehe unten)<br />
• Fernando Diaz, † wohl 923, Sohn von Diego Rodríguez, 917/923 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla<br />
• Munio Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Amaya, † nach 932, <strong>de</strong>sse Bru<strong>de</strong>r, 921/927 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla(um 925 spalten sich die Grafen vom Königreich León ab)<br />
• Gonzalo Fernán<strong>de</strong>z <strong>de</strong> Lara, † 932, 930/932 erneut Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla<br />
• Fernando Ansúrez, 927/930 (erneut) Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla<br />
• Fernán González, Sohn von Gonzalo Fernán<strong>de</strong>z, 929 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Lara, 932/970 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla<br />
• García Fernán<strong>de</strong>z, † 995, <strong>de</strong>ssen Sohn, 970/995 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla<br />
• Sancho García, † 1017, <strong>de</strong>ssen Sohn, 995/1017 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla<br />
• García II. Sánchez, † ermor<strong>de</strong>t 1029, <strong>de</strong>ssen Sohn, 1026/29 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla<br />
• Nach seiner Ermordung fällt Kastilien an <strong>de</strong>n Ehemann seiner Schwester Munia Mayor<br />
• Sancho el Mayor, † 1035, König von Navarra, Graf von Kastilien (Haus Jiménez)<br />
• Ferdinand (Fernando) I., † 1065, <strong>de</strong>ssen Sohn, 1029/35 Con<strong>de</strong> <strong>de</strong> Castilla, 1035/65 König von Kastilien, 1037/65 König von León
Könige von Kastilien<br />
Haus Jiménez<br />
• Name Herrschaftsbeginn Herrschaftsen<strong>de</strong> Anmerkung<br />
• Ferdinand I., <strong>de</strong>r Große 4. September 1037 27. Dezember 1065 erster König von Kastilien, <strong>zu</strong><strong>de</strong>m König von León<br />
• Sancho II., <strong>de</strong>r Starke 27. Dezember 1065 6. Oktober 1072 Sohn von Ferdinand I., ab 12. Januar 1072 auch König von León<br />
• Alfons VI., <strong>de</strong>r Tapfere 6. Oktober 1072 30. Juni 1109 Sohn von Ferdinand I., Bru<strong>de</strong>r von Sancho II., <strong>zu</strong><strong>de</strong>m König von León<br />
• Urraca 30. Juni 1109 8. März 1126 Tochter von Ferdinand I., <strong>zu</strong><strong>de</strong>m Königin von León<br />
Haus Burgund-Ivrea<br />
• Name Herrschaftsbeginn Herrschaftsen<strong>de</strong> Anmerkung<br />
• Alfons VII., <strong>de</strong>r Kaiser 10. März 1126 21. August 1157 Sohn von Urraca, <strong>zu</strong><strong>de</strong>m König von León<br />
• Sancho III., <strong>de</strong>r Ersehnte 21. August 1157 31. August 1158 Sohn von Alfons VII.<br />
• Alfons VIII., <strong>de</strong>r Edle 31. August 1158 6. Oktober 1214 Sohn von Sancho III.<br />
• Heinrich I. 6. Oktober 1214 6. Juni 1217 Sohn von Alfons VIII.<br />
• Berenguela die Große 6. Juni 1217 30. August 1217 Tochter von Alfons VIII., freiwillige Abdankung<br />
• Ferdinand III., <strong>de</strong>r Heilige 30. August 1217 30. Mai 1252 Sohn von Bernguela, seit 1230 König von León<br />
Könige von Kastilien und León<br />
• Name Herrschaftsbeginn Herrschaftsen<strong>de</strong> Anmerkung<br />
• Ferdinand III., <strong>de</strong>r Heilige 30. August 1217 30. Mai 1252 Sohn von Bernguela, seit 1230 König von León<br />
• Alfons X., <strong>de</strong>r Weise 30. Mai 1252 4. April 1284 Sohn von Ferdinand III., <strong>zu</strong><strong>de</strong>m römischer König<br />
• Sancho IV., <strong>de</strong>r Tapfere 4. April 1284 25. April 1295 Sohn von Alfons X.<br />
• Ferdinand IV., <strong>de</strong>r Gerufene 25. April 1295 7. September 1312 Sohn von Sancho IV.<br />
• Alfons XI., <strong>de</strong>r Rächer 7. September 1312 26. März 1350 Sohn von Ferdinand IV.<br />
• Peter I., <strong>de</strong>r Grausame 26. März 1350 23. März 1369 Sohn von Alfons XI.<br />
Haus Trastámara<br />
• Name Herrschaftsbeginn Herrschaftsen<strong>de</strong> Anmerkung<br />
• Heinrich II., <strong>de</strong>r Bastard 12. März 1369 29. Mai 1379 unehelicher Sohn von Alfons XI.<br />
• Johann I. 29. Mai 1379 9. Oktober 1390 Sohn von Heinrich II.<br />
• Heinrich III., <strong>de</strong>r Kränkliche 9. Oktober 1390 25. Oktober 1406 Sohn von Johann I.<br />
• Johann II. 25. Oktober 1406 21. Juli 1454 Sohn von Heinrich III.<br />
• Heinrich IV., <strong>de</strong>r Impotente 21. Juli 1454 14. Dezember 1474 Sohn von Johann II.
Zitat<br />
• Isabella I., die Katholische 14. Dezember 1474 26. November 1504 Tochter von Johann II. herrschte <strong>zu</strong>sammen mit ihrem Ehemann Ferdinand V.; war <strong>zu</strong>gleich Königin von Aragonien<br />
• Ferdinand V., <strong>de</strong>r Katholische 14. Dezember 1474 26. November 1504 herrschte <strong>zu</strong>sammen mit seiner Ehefrau Isabella I.; war <strong>zu</strong>gleich König von Aragonien<br />
• Johanna I., die Wahnsinnige 26. November 1504 12. April 1555 Tochter von Isabella I. und Ferdinand V. regierte bis 1506 mit ihrem Ehemann Phillip I.; danach Amtsunfähigkeit; ab 1516 auch Königin von Aragonien<br />
• Phillip I., <strong>de</strong>r Schöne 26. November 1504 25. September 1506 regierte bis 1506 mit seiner Ehefrau Johanna I.<br />
• Ferdinand V., <strong>de</strong>r Katholische 25. September 1506 23. Januar 1516 Vater von Johanna I., hatte die Regentschaft für seine Tochter inne<br />
• Karl I. 23. Januar 1516 16. Januar 1556 Sohn von Johanna I. und Phillip I. regierte <strong>zu</strong>sammen bzw. mit seiner amtsunfähgen Mutter; war gleichzeitig König von Aragonien<br />
Kastilien hat Spanien gemacht, und Kastilien vernichtet es. - José Ortega y Gasset (Aufbau und Zerfall Spaniens, 1921)<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Brügge<br />
Brügge (nie<strong>de</strong>rl.: Brugge, franz.: Bruges) ist die Hauptstadt und mit etwa 117.000 Einwohnern die größte Stadt <strong>de</strong>r Provinz Westflan<strong>de</strong>rn in Belgien. Außer<strong>de</strong>m ist Brügge Bischofssitz<br />
<strong>de</strong>r katholischen Kirche für das Bistum Brügge.<br />
Der mittelalterliche Stadtkern wur<strong>de</strong> im Jahr 2000 von <strong>de</strong>r UNESCO <strong>zu</strong>m Weltkulturerbe erklärt. Im Jahr 2002 war Brügge Europäische Kulturhauptstadt.<br />
Brügge beherbergt das renommierte Europakolleg (College of Europe) und verfügt über einen wichtigen Seehafen im Teilort Zeebrügge.<br />
Toponomastik<br />
Woher <strong>de</strong>r Name Brugge (Brügge) stammt, ist nicht exakt bekannt. Möglicherweise ist es eine Verballhornung <strong>de</strong>s keltischen Namens für <strong>de</strong>n inzwischen kanalisierten Fluss Reie, <strong>de</strong>r<br />
durch Brügge strömte und in <strong>de</strong>r Nordsee mün<strong>de</strong>te. Reie stammt vom keltischen Wort Rogia, das „Heiliges Wasser“ be<strong>de</strong>utet; die Kelten sahen Flüsse und Brunnen als göttliche Wesen<br />
an. Durch Evolution könnte <strong>de</strong>r Name <strong>de</strong>s Flusses Rogia o<strong>de</strong>r Ryggia <strong>zu</strong>m Namen <strong>de</strong>r Stadt gewor<strong>de</strong>n sein, Bryggia.<br />
Er ist auch möglich, dass es in späteren Jahrhun<strong>de</strong>rten eine Kontamination mit <strong>de</strong>m altnordischen Wort bryggja gegeben hat, das „Landungsbrücke“ o<strong>de</strong>r „Kai“ be<strong>de</strong>utet. Seit <strong>de</strong>m Jahre<br />
800 gab es auf Grund <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>ls über die Nordsee und wegen <strong>de</strong>r Invasionen <strong>de</strong>r Normannen viele Kontakte mit Skandinavien. Die Bezeichnung Brugge zeigt Ähnlichkeit mit<br />
Bryggen, <strong>de</strong>m historische Hafen von Bergen, <strong>de</strong>r genau wie Brügge seit <strong>de</strong>m 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong> einer wichtigen Stadt <strong>de</strong>r Hanse gewor<strong>de</strong>n war.<br />
Weniger wahrscheinlich ist ein Ursprung aus <strong>de</strong>m Wort brug (Brücke). Sprachwissenschaftlich hätte <strong>de</strong>r Name dann eher Brigge lauten müssen (<strong>zu</strong>m Vergleich mit <strong>de</strong>m Englischen<br />
bridge, <strong>de</strong>m Altenglischen brycg, <strong>de</strong>m Friesischen brigge o<strong>de</strong>r bregge und <strong>de</strong>m Gallischen briva). Ein Ursprung aus <strong>de</strong>m Wort burcht (Burg) scheint auch unwahrscheinlich; <strong>zu</strong>m<br />
Vergleich mit Ou<strong>de</strong>nburg und Aar<strong>de</strong>nburg, die wie Brügge auf einem wichtigem Han<strong>de</strong>lsweg lagen und aus einer römischen Siedlung entstan<strong>de</strong>n sind.[1]
Geschichte<br />
Bereits im 2. und 3. Jahrhun<strong>de</strong>rt befand sich auf <strong>de</strong>m Grundgebiet von Brügge eine gallo-römische Siedlung. Die Bewohner dieser Siedlung waren nicht nur Landwirte, son<strong>de</strong>rn auch<br />
Händler, die Kontakte mit England und mit <strong>de</strong>m Rest von Gallien unterhielten. In <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 9. Jahrhun<strong>de</strong>rts baute Balduin Eisenarm die Festung am heutigen Burgplatz aus, <strong>zu</strong>m<br />
Schutz vor Angriffen <strong>de</strong>r Normannen. Brügge erhielt 1128 das Stadtrecht.<br />
Zur Zeit <strong>de</strong>r Hanse<br />
1134 riss eine Sturmflut eine Fahrrinne in die Meeresbucht Zwin, so dass die Stadt danach direkten Zugang <strong>zu</strong>r Nordsee hatte. Brügge konnte am internationalen Han<strong>de</strong>l partizipieren,<br />
<strong>de</strong>r die Wollproduzenten Englands mit <strong>de</strong>n Weinproduzenten <strong>de</strong>r Gascogne und <strong>de</strong>n flandrischen Tuchmachern verband.<br />
Die Stadt erhielt 1200 das Recht, einen eigenen jährlichen Markt ab<strong>zu</strong>halten. Bald kamen auch Händler vom Rhein und, als die Hanse <strong>zu</strong> expandieren begann, auch Kaufleute aus<br />
Lübeck und Hamburg in die Stadt. 1253 wur<strong>de</strong>n ihnen von Gräfin Margarete von Flan<strong>de</strong>rn spezielle Privilegien wie niedrigere Zölle <strong>zu</strong>gesichert. Die Hanse errichtete in Brügge – neben<br />
<strong>de</strong>m Stalhof in London und <strong>de</strong>r Bryggen in Bergen – eines von drei Kontoren an <strong>de</strong>r Nordsee, wobei Brügge als messeähnlicher Standort die größten Umsätze erzielte und so die Hanse<br />
mit Märkten außerhalb ihres eigenen Gebiets verband. Das Zentrum dieses Kontors, das Haus <strong>de</strong>r Osterlinge, ist in Resten noch vorhan<strong>de</strong>n.<br />
Im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt gehörten neben <strong>de</strong>r Hanse Händler aus Genua, Venedig und Florenz ebenso wie aus Süd<strong>de</strong>utschland, Kastilien, Portugal o<strong>de</strong>r Schottland <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n regelmäßigen<br />
Besuchern <strong>de</strong>r Stadt. Im Haus <strong>de</strong>r Kaufmannsfamilie Van <strong>de</strong>r Beurse entstand das erste „Börsengebäu<strong>de</strong>“; die Bezeichnung Börse soll auf diesen Familiennamen <strong>zu</strong>rückgehen. 1302<br />
stärkt <strong>de</strong>r für Flan<strong>de</strong>rn positive Ausgang <strong>de</strong>r Sporenschlacht das bürgerliche Selbstverständnis <strong>de</strong>r Städte Flan<strong>de</strong>rns, auch in Brügge.<br />
Der 1337 ausbrechen<strong>de</strong> und bis 1457 andauern<strong>de</strong> Hun<strong>de</strong>rtjährige Krieg hatte aus <strong>de</strong>r Sicht Flan<strong>de</strong>rns vor allem einen wirtschaftlichen Hintergrund: <strong>de</strong>n Kampf <strong>de</strong>r großen Mächte um die<br />
Tuchindustrie Flan<strong>de</strong>rns rund um <strong>de</strong>n Weltmarkt in Brügge.<br />
Ab <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> Brügge von burgundischen Herzögen regiert, die die Stadt kulturell, architektonisch und wirtschaftlich <strong>zu</strong> hoher Blüte brachten. Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Mittelalters<br />
war Brügge die reichste Stadt Nor<strong>de</strong>uropas. Zum En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts versan<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r Zwin und schnitt <strong>de</strong>r Stadt damit <strong>de</strong>n direkten Zugang <strong>zu</strong>m Meer ab, woraufhin sich auch <strong>de</strong>r<br />
burgundische Hof aus <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong>rückzog. Kaiser Maximilian I. beschränkte die Rechte <strong>de</strong>r Stadt, die führen<strong>de</strong> Position <strong>de</strong>r Stadt in Flan<strong>de</strong>rn wur<strong>de</strong> an Antwerpen abgegeben.<br />
Die Stadt verarmte und kam von 1524 bis 1713 unter spanische Herrschaft. Die Hugenottenkriege trugen weiter <strong>zu</strong>m Verfall bei. In <strong>de</strong>r Stadt herrschte über Jahrhun<strong>de</strong>rte Stillstand;<br />
nacheinan<strong>de</strong>r herrschten hier das Kaiserhaus Habsburg (1713 bis 1795), Frankreich (1795 bis 1815) und die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> (bis 1830) über Brügge. Danach wur<strong>de</strong> Flan<strong>de</strong>rn und damit<br />
Brügge ein Teil <strong>de</strong>s neuen Königreiches Belgien. An <strong>de</strong>r im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt aufkommen<strong>de</strong>n Industrialisierung hatte die Stadt praktisch keinen Anteil.<br />
Erst gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts erhielt Brügge einige Aufmerksamkeit als Kulturstadt, als <strong>de</strong>r Schriftsteller Georges Ro<strong>de</strong>nbach die Stadt in seinem Roman Bruges la Morte<br />
beschrieb. Als 1907 ein Anschluss an <strong>de</strong>n Seehafen Zeebrügge geschaffen wur<strong>de</strong>, erhielt Brügge neue wirtschaftliche Perspektiven. Seit 1949 beherbergt Brügge das Europakolleg<br />
(College of Europe) als renommierte Europa-Hochschule, 1960 wur<strong>de</strong> die Stadt mit <strong>de</strong>m Europapreis für ihre hervorragen<strong>de</strong>n Bemühungen um <strong>de</strong>n europäischen Integrationsgedanken<br />
ausgezeichnet. Heute profitiert Brügge von <strong>de</strong>m jahrhun<strong>de</strong>rtelangen Stillstand, da <strong>de</strong>r mittelalterliche Stadtkern unverbaut erhalten geblieben ist und die Grundlage für <strong>de</strong>n Tourismus<br />
bil<strong>de</strong>t.<br />
Stadtteile<br />
• Innenstadt Brügge, Sint-Pieters und Sint-Jozef (I)<br />
• Koolkerke (II)<br />
• Sint-Andries (III)<br />
• Sint-Michiels (IV)
• Assebroek (V)<br />
• Sint-Kruis (VI)<br />
• Dudzele (VII)<br />
• Lissewege, Zeebrügge und Zwankendamme (VIII)<br />
Tourismus und Sehenswürdigkeiten<br />
Die mittelalterliche Altstadt, die von Wallanlagen, auf <strong>de</strong>nen sich Windmühlen befin<strong>de</strong>n, und Kanälen umgeben ist, ist sehr gut erhalten, da sie nie durch Kriege o<strong>de</strong>r großflächige<br />
Brän<strong>de</strong> zerstört wur<strong>de</strong>. Die Stadt ist sowohl auf gepflasterten Straßen als auch per Bootstour erkundbar.<br />
Die Kanäle, die die Stadt durchziehen, nennen die Einheimischen Reien, nach <strong>de</strong>m im Mittelalter vollständig kanalisierten Flüsschen Reie. Sie dienten <strong>de</strong>m Warentransport <strong>zu</strong>m Zwin.<br />
Einige <strong>de</strong>r Sehenswürdigkeiten sind:<br />
• Sint-Salvator-Kathedrale<br />
• Liebfrauenkirche mit <strong>de</strong>r Madonna von Michelangelo<br />
• Beginenhof<br />
• Tuchhallen und Belfried<br />
• Rathaus<br />
• Heilig-Blut-Basilika<br />
• Altes Sankt-Jans-Spital, das erste städtische Krankenhaus <strong>de</strong>r Neuzeit<br />
• Die vier übriggeblieben alten Stadttore: Gentpoort, Kruispoort, Sme<strong>de</strong>npoort und Ezelpoort<br />
• Marktplatz (Grote Markt)<br />
Kunst und Kultur<br />
Museen<br />
Die städtische Museen in Brügge sind unterteilt in die Kategorien „Schöne Künste“ (vom 15. bis <strong>zu</strong>m 21. Jahrhun<strong>de</strong>rt), „Bruggemuseum“ (Sammelname für elf historische Museen) und<br />
„Hospitaalmuseum“ (Hospitalmuseen).<br />
Die drei Museen <strong>de</strong>r Schönen Künste sind das Groeningemuseum (mit <strong>de</strong>r Kollektion <strong>de</strong>r flämischen Primitiven und Gemäl<strong>de</strong>n und Skulpturen <strong>de</strong>r Renaissance, <strong>de</strong>s Barock, <strong>de</strong>s<br />
Klassizismus und <strong>de</strong>s Expressionismus), das Arentshaus und Forum+ (im Concertgebouw), eine Plattform <strong>de</strong>r zeitgenössischen Kunst.<br />
Bruggemuseum enthält das Archäologie-Museum, <strong>de</strong>n Gentpoort, <strong>de</strong>n Belfried, das Rathaus, das Brügger Freiamt, das Gruuthusemuseum, die Liebfrauenkirche, das Heimatmuseum, die<br />
Koelewei-Mühle, die Sint-Janshuis-Mühle und das Guido-Gezelle-Museum.<br />
Die zwei Hospitalmuseen sind das Alte Sankt-Jans-Spital mit <strong>de</strong>m Memling in Sint-Jan - Hospital Museum (unter an<strong>de</strong>rem mit Werken von Hans Memling) und „Unserer Lieben Frau<br />
<strong>zu</strong>r Potterie“.<br />
Privatmuseen in Brügge sind das Beginenhaus, das Brauereimuseum, das Diamantmuseum, das Schokola<strong>de</strong>nmuseum Choco-Story, das Englische Kloster, das Pommes-Frites-Museum,<br />
die Heilig-Blut-Basilika, <strong>de</strong>r Hof Bla<strong>de</strong>lin, die Jerusalemskirche, das Lampenmuseum Lumina Domestica, Museum-Gallery Xpo: Salvador Dalí, das Spitzenzentrum, die St.-Georgs-<br />
Schützengil<strong>de</strong>, die St.-Sebastian-Schützengil<strong>de</strong>, die St.-Salvator-Kathedrale, die St.-Trudo-Abtei, die Sternwarte Beisbroek und das Kloster Ter Doest in Lissewege.
Theater und Konzertsäle<br />
Brügge hat verschie<strong>de</strong>ne Theater und Konzertsäle. Die wichtigsten sind das für Brügge 2002 – Europäische Kulturhauptstadt neugebaute Concertgebouw („Konzertgebäu<strong>de</strong>“), die<br />
Stadsschouwburg, Biekorf, De Dijk, De Werf, <strong>de</strong>r Magdalenazaal, Het Entrepot und <strong>de</strong>r Joseph Ryelandtzaal.<br />
Kinos<br />
Die drei Kinos in Brügge sind Cinema Lumière für nicht-kommerzielle Filme, Cinema Liberty, ein kleines kommerzielles Kino, und das große Komplex von Kinepolis in Sint-Michiels.<br />
Verkehr, Wirtschaft und Bildung<br />
Verkehr<br />
Hafen<br />
• Brügge ist durch die Autobahnen A10/E 40 Brüssel-Osten<strong>de</strong>, A18/E 40 Brügge-Frankreich, A10/E 403 Brügge-Doornik und N49/E 34 Antwerpen-Brügge/Zeebrügge/Knokke-<br />
Heist erschlossen.<br />
• Der Hauptbahnhof von Brügge liegt an <strong>de</strong>n Eisenbahnlinien Brüssel-Osten<strong>de</strong> (Strecke 50A), Brügge-Kortrijk (Strecke 66) und Brügge-Blankenberge (Strecke 51); weitere<br />
Strecken führen nördlich nach Zeebrügge (Strecke 51A) und nordöstlich nach Knokke-Heist (Strecke 51B). Zwischen 1863 und 1959 gab es auch eine weitere Verbindung<br />
(Strecke 58) nach Eeklo. Rund um die Uhr gibt es unter an<strong>de</strong>rem mehrere IC-Verbindungen in an<strong>de</strong>re wichtige Städte Belgiens. Der Hauptbahnhof ist auch ein Stopp für <strong>de</strong>n<br />
Thalys Paris-Brüssel-Osten<strong>de</strong>.<br />
• Mit Gent, Osten<strong>de</strong> und Sluis ist es über <strong>de</strong>n Kanal Gent-Brügge, Brügge-Osten<strong>de</strong> und Brügge-Sluis verbun<strong>de</strong>n, und mit Zeebrügge, an <strong>de</strong>r Nordsee, über <strong>de</strong>m 12 km langen, für<br />
Seeschiffe befahrbaren Bou<strong>de</strong>wijnkanal.<br />
• Der nächstgelegene Flughafen ist <strong>de</strong>r Internationale Flughafen Osten<strong>de</strong>-Brügge in Osten<strong>de</strong>, ungefähr 25 km vom Zentrum von Brügge.<br />
• Der öffentliche Stadtverkehr in Brügge besteht aus einem umfangreichen Busnetz. Betreiber ist die Gesellschaft De Lijn.<br />
Der Hafen von Brügge-Zeebrügge gilt als einer <strong>de</strong>r mo<strong>de</strong>rnsten und wichtigsten in Europa. Seine Hauptvorteile sind seine geographische Lage an <strong>de</strong>r Nordsee mit <strong>de</strong>r Straße von Dover,<br />
die Nähe <strong>zu</strong> England und sein Zugang mit großen Wassertiefen.<br />
Bildung<br />
In Brügge befin<strong>de</strong>t sich unter an<strong>de</strong>rem das renommierte Europakolleg, ein unabhängiges postgraduales Hochschulinstitut für europäische Studien.<br />
Sport<br />
Fußball<br />
Erste Division:<br />
• FC Brügge<br />
• Cercle Brügge<br />
Bei<strong>de</strong> spielen im Jan-Brey<strong>de</strong>l-Stadion (30.000 Sitzplätze) in Sint-Andries. Jedoch gibt es Pläne ein neues Stadion mit 45.000 Sitzplätzen <strong>zu</strong> bauen in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r Kreu<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r<br />
Europastraßen E40 und E403.
Im Jahr 2000 war Brügge eine <strong>de</strong>r acht Gastgeberstädte <strong>de</strong>r Fußball-Europameisterschaft.<br />
Fahrradrennen<br />
In Brügge befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Startpunkt für die Flan<strong>de</strong>rn-Rundfahrt.<br />
Brügge in <strong>de</strong>n Medien<br />
Film und Fernsehen<br />
Filme, die (überwiegend) in Brügge spielen (Auswahl):<br />
• Geschichte einer Nonne, Regie Fred Zinnemann, USA, 1959<br />
• Herz aus Schokola<strong>de</strong>, Regie Oliver Dommenget, Deutschland, 2008<br />
• Brügge sehen… und sterben?, Regie Martin McDonagh, Irland, Vereinigtes Königreich, 2008<br />
• Aspe (Fernsehserie), belgische Krimiserie, seit 2004<br />
Literatur<br />
• Georges Ro<strong>de</strong>nbach: Das tote Brügge, Reclam, Ditzingen 1986, ISBN 3-15-005194-0.<br />
• Die Kriminalromane <strong>de</strong>s belgischen Schriftstellers Pieter Aspe, die in Brügge spielen.<br />
Persönlichkeiten<br />
Söhne und Töchter <strong>de</strong>r Stadt<br />
• Pieter Aspe, Kriminalschriftsteller<br />
• Pierre Basin, Sänger<br />
• Arsène Becuwe, Komponist und Dirigent<br />
• Arnold von Bruck, österreichischer Komponist<br />
• Peter Candid, Maler und Grafiker<br />
• Eugène Charles Catalan, Mathematiker<br />
• Hugo Claus, Schriftsteller<br />
• Albert Van Coile, Fußballspieler<br />
• Jean Cordier, Priester, Sänger, Botschafter <strong>de</strong>r Medicis in Brügge<br />
• Octave Delepierre, Schriftsteller<br />
• Paul Devaux, Politiker<br />
• Edgar Everaert, Fußballspieler und Grün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Club Unión<br />
• Guido Gezelle, Dichter <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
• Franciscus Gomarus, reformierter Theologe<br />
• Eugène Goossens, Dirigent<br />
• Jens Keukeleire, Radrennfahrer
• Nicolas Lombaerts, Fußballspieler<br />
• Henri Milne Edwards, französischer Naturforscher<br />
• Joseph-Denis O<strong>de</strong>vaere, Maler<br />
• Tony Parker, französischer Basketballspieler<br />
• Philipp I. (Kastilien), erster spanischer König aus <strong>de</strong>m Hause Habsburg<br />
• Joseph Ryelandt, Komponist und Direktor <strong>de</strong>s Konservatoriums<br />
• Simon Stevin, nie<strong>de</strong>rländisch-belgischer Mathematiker, Physiker und Ingenieur<br />
• James Vanlandschoot, Radrennfahrer<br />
Persönlichkeiten, die vor Ort gewirkt haben<br />
• Gilles Binchois, Komponist, Dichter und Kleriker<br />
• Antoine Busnoys, französischer Komponist, Sänger, Dichter und Kleriker<br />
• William Caxton, <strong>de</strong>r erste englische Buchdrucker<br />
• Petrus Christus, nie<strong>de</strong>rländischer Maler<br />
• Gerard David, altnie<strong>de</strong>rländischer Maler<br />
• Guy Duijck, belgischer Komponist, Professor und Dirigent<br />
• Franky Van Der Elst, Fußballspieler<br />
• Jan van Eyck, Vertreter <strong>de</strong>r altnie<strong>de</strong>rländischen Malerei<br />
• Gilles Joye, Theologe, Dichter, Sänger und Komponist<br />
• Hans Memling, <strong>de</strong>utscher Maler <strong>de</strong>r nie<strong>de</strong>rländischen Schule<br />
• Jacob Obrecht, flämischer Komponist und Sänger sowie Kleriker <strong>de</strong>r Renaissance<br />
• Werner Quintens, belgischer römisch-katholischer Priester<br />
• Jacek Saryusz-Wolski, 1997 bis 1999 Vizerektor <strong>de</strong>s Europakollegs in Brügge<br />
• Guy Thys, belgischer Fußballtrainer<br />
• Johan Van<strong>de</strong>walle, Orientalist<br />
• Hil<strong>de</strong>brand Veckinchusen, Kaufmann <strong>de</strong>r Hansezeit<br />
• Gaspar van Weerbeke, Komponist und Sänger<br />
• Joseph H. H. Weiler, Professor für Internationales Recht und Europarecht am Europakolleg in Brügge<br />
Städtepartnerschaften<br />
• Burgos (Spanien), 2007<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ Brugge, stad met vele gezichten - Andries Van <strong>de</strong>n Abeele
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Hansekontor in Brügge<br />
Das Hansekontor in Brügge war das wirtschaftlich be<strong>de</strong>utsamste <strong>de</strong>r vier Kontore <strong>de</strong>r Hanse. Das Kontor führte ein Siegel mit <strong>de</strong>m doppelköpfigen Reichsadler, das ihm im Jahr 1486<br />
von Kaiser Friedrich III. verliehen wor<strong>de</strong>n war. Das Hansekontor in Brügge war eine völkerrechtlich anerkannte Interessenvertretung <strong>de</strong>r Hanse. Sie hatte eine eigene Jurisdiktion. Die in<br />
Brügge tätigen Kaufleute aus Hansestädten waren Zwangsmitglie<strong>de</strong>r. Das Hansekontor in Brügge hatte die Stellung einer auswärtigen Han<strong>de</strong>lskammer <strong>de</strong>r Hanse in Brügge mit<br />
konsularischen Befugnissen.<br />
Geschichte<br />
Entstehungsvorausset<strong>zu</strong>ngen<br />
Die Hanse etablierte han<strong>de</strong>lspolitisch die als juristische Person rechtlich selbstständigen Kontore an einigen wichtigen Han<strong>de</strong>lsplätzen im Ausland, an <strong>de</strong>nen dort erworbene<br />
Han<strong>de</strong>lsprivilegien und die Interessen <strong>de</strong>r dort tätigen Hansekaufleute <strong>de</strong>s beson<strong>de</strong>ren Schutzes bedurften. Die Stadt Brügge war um 1200 Messeplatz gewor<strong>de</strong>n und lag im Zentrum <strong>de</strong>r<br />
flandrischen Tuchherstellung. Aufgrund einer Sturmflut im Jahr 1134 hatte sie durch <strong>de</strong>n Zwin in Verbindung mit <strong>de</strong>m Reie einen Zugang <strong>zu</strong>r Nordsee erhalten, <strong>de</strong>r sie und ihren 1180<br />
gegrün<strong>de</strong>ten Vorhafen im Städtchen Damme für die Koggen von <strong>de</strong>r Nordsee her erreichbar machte. In <strong>de</strong>n Jahren 1252 und 1253 privilegierte Gräfin Margarete II. von Flan<strong>de</strong>rn nach<br />
Verhandlungen mit <strong>de</strong>m Lübecker Ratsherren Hermann Hoyer und <strong>de</strong>m Hamburger Ratsherrn Jordan die <strong>de</strong>utschen Kaufleute aus Lübeck, Hamburg, Aachen, Köln, Dortmund, Münster<br />
und Soest. Der Schnittpunkt <strong>de</strong>s internationalen Han<strong>de</strong>ls und die Messe in Brügge machten das Kontor in Brügge <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m wirtschaftlich wichtigsten <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kaufleute. Diese<br />
wur<strong>de</strong>n hier Osterlinge genannt, weil sie alle aus Städten kamen, die östlich von Brügge und Flan<strong>de</strong>rn lagen. Brügge bot seewärts die Verbindung <strong>zu</strong> London mit <strong>de</strong>m Stalhof als<br />
weiterem Kontor, aber auch <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l mit Frankreichs Sü<strong>de</strong>n (Baiensalz, Wein) und <strong>de</strong>r Iberischen Halbinsel. Landseitig war die Verbindung <strong>zu</strong>m ober<strong>de</strong>utschen Han<strong>de</strong>l mit <strong>de</strong>n<br />
Städten Süd<strong>de</strong>utschlands und Oberitaliens (Südfrüchte als Trockenfrüchte, Gewürze) gegeben. Die Kaufleute <strong>de</strong>r Hansestädte Westfalens und <strong>de</strong>s Rheinlan<strong>de</strong>s, mit <strong>de</strong>n Städten <strong>de</strong>s<br />
wendischen Quartiers <strong>de</strong>r Hanse an <strong>de</strong>r südlichen Ostseeküste aus <strong>de</strong>r Ostsiedlung oft familiär eng verbun<strong>de</strong>n, lagen im direkten Hinterland dieses flandrischen Messeplatzes.<br />
Die Han<strong>de</strong>lssperre von 1280<br />
Bereits in <strong>de</strong>n Jahren 1280-82 galt es im Spannungsverhältnis zwischen <strong>de</strong>m Grafen Guido I. von Flan<strong>de</strong>rn und <strong>de</strong>r Stadt Brügge taktierend die Privilegien <strong>zu</strong> bewahren und nach<br />
Möglichkeit aus<strong>zu</strong>weiten. Die Stadt Brügge schränkte über Behin<strong>de</strong>rungen und Schikanen nicht nur die <strong>de</strong>utschen Kaufleute, son<strong>de</strong>rn auch die aus Südfrankreich und Spanien<br />
kommen<strong>de</strong>n in ihren Handlungsspielräumen ein, in Verkennung ihrer wirtschaftlichen Be<strong>de</strong>utung für <strong>de</strong>n Standort.<br />
Nach schriftlicher Rückversicherung bei <strong>de</strong>n hauptsächlich betroffenen Städten beschloss daher <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt Lübeck <strong>zu</strong> han<strong>de</strong>ln und entsandte <strong>de</strong>n Ratsherrn Johann van Doway<br />
nach Flan<strong>de</strong>rn und Brügge. Die Stadt Brügge und ihr sog. Stapel wur<strong>de</strong>n mit einem Han<strong>de</strong>lsboykott belegt. Das Kontor verlegte seinen Sitz 1280 von Brügge nach Aar<strong>de</strong>nburg. Die<br />
Folgen waren für Brügge <strong>de</strong>saströs, und 1282 konnte das Kontor schließlich nach Bestätigung <strong>de</strong>r alten Privilegien nach Brügge <strong>zu</strong>rückkehren.<br />
Johann van Doway als einer <strong>de</strong>r frühen Außenpolitiker <strong>de</strong>r Hansestädte setzte damit vor Ort erfolgreich die in <strong>de</strong>n nächsten Jahrhun<strong>de</strong>rten noch perfektionierten Mittel hansischer<br />
Han<strong>de</strong>lspolitik ein: <strong>zu</strong>nächst Verhandlung mit allererster Priorität und <strong>de</strong>m Druckmittel <strong>de</strong>s Boykotts, dann Wirtschaftsblocka<strong>de</strong> und <strong>zu</strong>letzt <strong>de</strong>n Seekrieg als Kaperkrieg. Damit<br />
unterschie<strong>de</strong>n sich die Han<strong>de</strong>lskriege <strong>de</strong>r Hanse auch in ihren Mitteln <strong>de</strong>utlich von <strong>de</strong>nen <strong>de</strong>r Territorialfürsten, da sie nicht auf Landgewinn, son<strong>de</strong>rn ausschließlich um geldwerte
Privilegien und Kompensationen geführt wur<strong>de</strong>n. Frem<strong>de</strong>s Territorium wur<strong>de</strong> hingegen ausschließlich nur „in Pfand genommen", um Kompensationen <strong>zu</strong> sichern, die nicht sofort<br />
geleistet wer<strong>de</strong>n konnten.<br />
Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Flan<strong>de</strong>rnhan<strong>de</strong>ls wird auch dadurch unterstrichen, dass <strong>de</strong>r Lübecker Ratskanzler Albert von Bar<strong>de</strong>wik 1299 die Vorschriften <strong>de</strong>s Lübecker Seerechts für die<br />
Flan<strong>de</strong>rnfahrt geson<strong>de</strong>rt schriftlich nie<strong>de</strong>rlegte.<br />
Der zweite Flan<strong>de</strong>rnboykott<br />
Der zweite Boykott Flan<strong>de</strong>rns durch die Hanse erfolgte in <strong>de</strong>n Jahren 1358-60 unter <strong>de</strong>r Leitung <strong>de</strong>s Lübecker Ratsherrn Bernhard Ol<strong>de</strong>nborch und führte <strong>zu</strong>m gleichen Ergebnis; die<br />
Privilegien wur<strong>de</strong>n erneut gesichert und die Hanse für die entgangenen Gewinne entschädigt. Diplomatisch hatten die Hanseaten sich 1358 von Herzog Albrecht I. von Bayern, <strong>de</strong>r<br />
<strong>zu</strong>gleich Graf von Holland war, neue Privilegien für <strong>de</strong>n Stapelplatz Dordrecht erteilen lassen. Das reichte, um 1360 die Geschäfte in Brügge in gewohnter Weise fortsetzen <strong>zu</strong> können,<br />
nach<strong>de</strong>m die alten Privilegien dort (nach <strong>de</strong>m Urteil <strong>de</strong>r Hansesyndici) durch Graf Ludwig II. von Flan<strong>de</strong>rn rechtsfest bestätigt wor<strong>de</strong>n waren.<br />
Die Han<strong>de</strong>lssperren <strong>de</strong>s Jahres 1388<br />
Ein dritter Flan<strong>de</strong>rnboykott <strong>de</strong>r Stadt Brügge wur<strong>de</strong> vom Hansetag <strong>de</strong>s Jahres 1388 (zeitgleich mit weiteren Han<strong>de</strong>lssperren gegen England und Russland) beschlossen, nach<strong>de</strong>m ein<br />
Aus<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>s Kontors <strong>zu</strong>vor 1378 von <strong>de</strong>n örtlichen Behör<strong>de</strong>n verhin<strong>de</strong>rt, die <strong>de</strong>utschen Kaufleute eingekerkert und ihre Han<strong>de</strong>lsware beschlagnahmt wur<strong>de</strong>. Dieser Boykott war nicht so<br />
unmittelbar effektiv wie die bei<strong>de</strong>n vorangegangenen. In Flan<strong>de</strong>rn waren Weberaufstän<strong>de</strong> ausgebrochen, Philipp van Artevel<strong>de</strong> hatte im nachbarlichen Gent die Macht übernommen und<br />
die politischen Verhältnisse in <strong>de</strong>r Grafschaft Flan<strong>de</strong>rn konnten erst 1382 in <strong>de</strong>r Schlacht bei Roosebeke wie<strong>de</strong>r stabilisiert wer<strong>de</strong>n. Gleichzeitig fehlte im Hansischen Lager <strong>de</strong>r Rückhalt<br />
<strong>de</strong>r preußischen Städte und die Hochmeister <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns Winrich von Knipro<strong>de</strong> und Konrad Zöllner von Rotenstein hielten offen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Stadt Brügge und Flan<strong>de</strong>rn und damit<br />
gegen die sog. Wendischen Städte um Lübeck (siehe unten), was die interne Meinungsfindung und die diplomatischen Verhandlungen <strong>de</strong>s Lübecker Bürgermeisters Simon Swerting mit<br />
<strong>de</strong>n Flamen erschwerte. Die Verhandlungen mit Philipp <strong>de</strong>m Kühnen nach Beginn <strong>de</strong>s Boykotts zogen sich vier Jahre hin, bis dieser die Privilegien erneut bestätigte und eine Einigung<br />
über die Höhe <strong>de</strong>r an die Hanse <strong>zu</strong> zahlen<strong>de</strong>n Abfindung erzielt wer<strong>de</strong>n konnte. Mit Zahlung <strong>de</strong>r ersten Abfindungsrate kehrte das Kontor 1392 von Dordrecht nach Brügge <strong>zu</strong>rück. Die<br />
Diplomatie <strong>de</strong>r Hanse hatte ein letztes Mal über die Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong> gesiegt.<br />
Nie<strong>de</strong>rgang Brügges im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Nach längerer Zeit <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>ns, wenn auch nicht ohne Beschwer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r hanseatischen Kaufleute, spitzten sich die Verhältnisse nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Arras (1435) wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>. Im Hafen<br />
von Sluis am Zwin wur<strong>de</strong>n etwa 80 Deutsche von <strong>de</strong>r einheimischen Bevölkerung erschlagen. Bereits 1425 hatte man wegen <strong>de</strong>r Erfolglosigkeit einer diplomatischen Mission <strong>de</strong>s<br />
Lübecker Bürgermeisters Jordan Pleskow einen erneuten Aus<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>s Kontors geplant, aber wegen <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit Dänemark davon Abstand genommen. Die Mordtat<br />
führte 1436 <strong>zu</strong>r umgehen<strong>de</strong>n Verlegung <strong>de</strong>s Kontors nach Antwerpen, die <strong>zu</strong> einem vierten, bis 1438 andauern<strong>de</strong>n Boykott führte. Er wur<strong>de</strong> erst durch eine Scha<strong>de</strong>nsersatzzahlung von<br />
8000 Pfund Groschen abgebrochen. Mit <strong>de</strong>m Haus <strong>de</strong>r Osterlinge erwarb das Hansekontor in Brügge erst im Jahr 1442 ein Gebäu<strong>de</strong> in Brügge, dieses wur<strong>de</strong> im Jahr 1478 durch einen<br />
geräumigeren Neubau am Osterlingenplein ersetzt. Es blieb jedoch weiterhin bei <strong>de</strong>n Versammlungen im Karmeliterkloster, <strong>de</strong>ssen Kirche die Kirche <strong>de</strong>r hansischen Kaufleute in Brügge<br />
war. Dort wur<strong>de</strong>n 1474 auch die Urkun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Frie<strong>de</strong>nsvertrages von Utrecht zwischen Hanse und England durch <strong>de</strong>n Ältermann Johann Durkop getauscht[1].<br />
Mit <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>n Versandung <strong>de</strong>s See<strong>zu</strong>gangs Zwin im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt sank die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Stadt Brügge als Han<strong>de</strong>lsplatz. Nun beschloss <strong>de</strong>r Hansetag 1442 - wohl auch gegen<br />
die mit <strong>de</strong>n Umlandfahrern im Ostseeraum aufkommen<strong>de</strong>n englische Konkurrenz -, dass nur in Brügge erworbene Tuche gehan<strong>de</strong>lt wer<strong>de</strong>n durften. Aber bereits 1486 wur<strong>de</strong> die Zahl <strong>de</strong>r<br />
Ältermänner <strong>de</strong>s Brügger Kontors reduziert, und 1520 wur<strong>de</strong> das Kontor an die sandfreie Schel<strong>de</strong> nach Antwerpen verlegt, wo Mitte <strong>de</strong>s Jahrhun<strong>de</strong>rts unter <strong>de</strong>m Syndikus Heinrich<br />
Su<strong>de</strong>rmann durch <strong>de</strong>n Architekten Cornelis Floris II. noch einmal ein großes Haus <strong>de</strong>r Osterlinge errichtet wur<strong>de</strong>. Das hielt <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>s Kontors in dieser unruhigen Zeit aber<br />
nicht auf.<br />
Strukturelle Unterschie<strong>de</strong> <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren drei Kontoren<br />
Im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren drei Kontoren <strong>de</strong>r Hanse, <strong>de</strong>m Peterhof in Nowgorod, <strong>de</strong>r Tyske Bryggen in Bergen und <strong>de</strong>m Stalhof in London wohnten und arbeiteten die Hansekaufleute
in Brüggen nicht von <strong>de</strong>r ortsansässigen Bevölkerung Brügges isoliert in einem eigenen umfrie<strong>de</strong>ten Bezirk, son<strong>de</strong>rn in sozialem Kontakt mit <strong>de</strong>n Bürgern <strong>de</strong>r Stadt. Zwar hatte 1252 <strong>de</strong>r<br />
Wunsch <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kaufleute nach Errichtung einer eigenen umfrie<strong>de</strong>ten Siedlung Neudamme unweit Dammes am Zwin bestan<strong>de</strong>n, diese exterritoriale Lösung war jedoch von<br />
Gräfin Margarete abgelehnt wor<strong>de</strong>n. Brügge war jedoch <strong>de</strong>r einzige Kontorsitz, an <strong>de</strong>m auch <strong>de</strong>r Grun<strong>de</strong>rwerb o<strong>de</strong>r die Pacht von Häusern in <strong>de</strong>r Stadt für einzelne ausländische<br />
Kaufleute statthaft war. Insofern hatte das Kontor in Brügge (im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n drei an<strong>de</strong>ren) <strong>zu</strong>nächst kein eigenes Gebäu<strong>de</strong>. Es nutzte für seine Versammlungen traditionell <strong>de</strong>n<br />
Remter <strong>de</strong>s Karmeliterklosters <strong>de</strong>r Stadt. Dies wird auch damit erklärt, das die große Anzahl <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Kaufleute in <strong>de</strong>r Stadt, die zeitweilig 1.000 überstieg, die Unterbringung in<br />
einem abgeschlossenen Komplex schlichtweg unmöglich machte.<br />
Insofern war auch die Kontorordnung zwar <strong>de</strong>r in allen an<strong>de</strong>ren Kontoren <strong>de</strong>m Grun<strong>de</strong> nach ähnlich. Auch in Brügge wur<strong>de</strong> das Kontor durch gewählte Älterleute vertreten. Aber es<br />
bestand kein Anlass <strong>zu</strong> <strong>de</strong>rart rigi<strong>de</strong>n Regelungen, wie sie in Nowgorod für <strong>de</strong>n Peterhof in <strong>de</strong>r sog. Nowgoro<strong>de</strong>r Schra nie<strong>de</strong>rgelegt wur<strong>de</strong>n. Die schriftliche Fassung erfolgte, soweit<br />
überliefert, auch wesentlich später[2].<br />
In Anbetracht <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>lsplatzes Brügge für so gut wie alle Städte <strong>de</strong>r Hanse trat in Brügge eine beson<strong>de</strong>re Rivalität <strong>de</strong>r Hansestädte um Einfluss auf die Leitung <strong>de</strong>r<br />
Angelegenheiten <strong>de</strong>s Kontors auf. Hieraus resultiert die vom Kontor Brügge ausgehen<strong>de</strong> spätere Aufteilung <strong>de</strong>r Hanse <strong>zu</strong>nächst in Drittel, später in Quartiere („Wendisches Viertel“), in<br />
<strong>de</strong>nen die Interessen bestimmter Städtegruppen „gebün<strong>de</strong>lt“ wur<strong>de</strong>n.<br />
Eines hatten jedoch alle Kontore gemeinsam, das Grundproblem <strong>de</strong>s auf ausbedungenen Privilegien beruhen<strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>ls <strong>de</strong>r Hanse insgesamt: Die Privilegien mussten sowohl gegen<br />
<strong>de</strong>n ortsansässigen Han<strong>de</strong>l wie die sich entwickeln<strong>de</strong>n internationalen Märkte verteidigt wer<strong>de</strong>n. In dieser Verteidigung erworbener Rechte waren die Kontore selbst nur die Speerspitze<br />
vor Ort und auf <strong>de</strong>n Rückhalt und die Einigkeit bei <strong>de</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng gemeinsamer Interessen <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Hanse selbst nur lose <strong>zu</strong>sammengeschlossenen Hansestädte angewiesen.<br />
Hansekaufleute in Brügge<br />
Die Ausbildung eines Hansekaufmannes bedingte in jungen Jahren Auslandsreisen und längere Auslandsaufenthalte in <strong>de</strong>n Kontoren und Faktoreien <strong>de</strong>r Hanse. Der mehrjährige<br />
Aufenthalt im größten Kontor Brügge bot Karrierechancen: wer hier <strong>zu</strong>m Ältermann <strong>de</strong>s Kontors gewählt wur<strong>de</strong> und sich als solcher bewährte, stieg auch später bei Rückkehr in seine<br />
Heimatstadt meist an <strong>de</strong>ren Spitze als Ratsherr und Bürgermeister auf. Als gutes Beispiel mag in diesem Zusammenhang <strong>de</strong>r Lübecker Bürgermeister Hinrich Castorp gelten.<br />
Das Leben und Wirtschaften <strong>de</strong>r Hansekaufleute in Brügge wird <strong>de</strong>utlich anhand <strong>de</strong>s fast vollständigen Briefwechsels <strong>de</strong>s Hil<strong>de</strong>brand Veckinchusen (1370-1426) in <strong>de</strong>r Edition von<br />
Wilhelm Stieda[3], einer <strong>de</strong>r wichtigsten Quellen <strong>zu</strong>r Beurteilung und Erforschung hansischer Wirtschaftsgeschichte <strong>de</strong>s Spätmittelalters, gleichzeitig ein gut dokumentiertes Beispiel für<br />
das nahe beieinan<strong>de</strong>rliegen von Aufstieg und Fall eines Kaufmannsschicksals jener Zeit.<br />
Akten und Archiv <strong>de</strong>s Kontors<br />
Das Aktenarchiv samt <strong>de</strong>n Abschriften <strong>de</strong>r Hanserezesse <strong>de</strong>s Brügger Kontors wur<strong>de</strong> 1594 von Antwerpen nach Köln als nächst gelegener Hansestadt verbracht und befin<strong>de</strong>t sich heute<br />
im Historischen Archiv <strong>de</strong>r Stadt Köln.[4]<br />
Anmerkungen<br />
1. ↑ Schubert: Die Kontore, S.23<br />
2. ↑ Abdruck <strong>de</strong>r Neufestset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Statuten (1374) bei Philippe Dollinger: Die Hanse im Quellenanhang<br />
3. ↑ Hil<strong>de</strong>brand Veckinchusen, Briefwechsel eines <strong>de</strong>utschen Kaufmanns im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt, Leipzig 1921<br />
4. ↑ Joachim Deeters: Hansische Rezesse. Eine quellenkundliche Untersuchung anhand <strong>de</strong>r Überlieferung im Historischen Archiv <strong>de</strong>r Stadt Köln. in: Hammel-Kiesow (Hrsg.): Das<br />
Gedächtnis <strong>de</strong>r Hansestadt Lübeck, Lübeck, Schmidt-Römhild 2005, S.427-446 (429ff) -mit Bestandssignaturen im Anhang- ISBN 3-7950-5555-5<br />
Literatur
• Albert von Bar<strong>de</strong>wik: Specinem juris publici Lubecensis, quo pacta conventa et privilegia, quibus Lubecae per omnem propemodum Europam circa inhumanum jus naufragii<br />
(Stran<strong>de</strong>s Recht) est prospectum, ex authenticis recensuit ... qui etiam mantissae loco Jus maritimum Lubecense antiquissimum / Ab Alberto <strong>de</strong> Bar<strong>de</strong>wic a. 1299 compositum ex<br />
membranis edidit Jo. Carolus Henricus Dreyer (Hrsg.), Bützow ohne Jahresangabe<br />
• Philippe Dollinger: Die Hanse, Stuttgart 1998, ISBN 3-520-37105-7<br />
• Ernst Schubert: Novgorod, Brügge, Bergen und London: Die Kontore <strong>de</strong>r Hanse in Concilium medii aevi 5, 2002 (S.1-50), auch als pdf [1]<br />
• Mike Burkhardt: Die Ordnungen <strong>de</strong>r vier Hansekontore Bergen, Brügge, London und Novgorod, in: Graßmann, Antjekathrin (Hg.), Das Hansische Kontor <strong>zu</strong> Bergen und die<br />
Lübecker Bergenfahrer. International Workshop Lübeck 2003 (= Veröffentlichungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Hansestadt Lübeck. Herausgegeben vom Archiv <strong>de</strong>r Hansestadt, Reihe<br />
B, Band 41), Lübeck 2005, S. 58-77.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Herzogtum Schleswig<br />
Das Herzogtum Schleswig (dänisch: Hertugdømmet Slesvig) existierte bis 1864. Hauptstadt war die Stadt Schleswig. Vorläufer <strong>de</strong>s Herzogtums war im frühen Mittelalter das Jarltum<br />
Südjütland (Søn<strong>de</strong>rjylland).<br />
Geografie<br />
Die Fläche <strong>de</strong>s historischen Herzogtums Schleswig umfasste rund 9.200 km². Im Sü<strong>de</strong>n waren Ei<strong>de</strong>r und Levensau die Grenze <strong>zu</strong> Dithmarschen und Holstein; die Insel Fehmarn gehörte<br />
<strong>zu</strong> Schleswig. Die Ei<strong>de</strong>r-Grenze wur<strong>de</strong> bereits im 11. Jahrhun<strong>de</strong>rt von Adam von Bremen erwähnt. Im Nor<strong>de</strong>n bil<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r Kongeå (<strong>de</strong>utsch Königsau) die Grenze <strong>zu</strong>m übrigen Jütland.<br />
Im Westen befin<strong>de</strong>t sich die Nordsee, im Osten die Ostsee.<br />
Das Gebiet <strong>de</strong>s Herzogtums in <strong>de</strong>n Grenzen von 1864 teilt sich heute auf in <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>steil Schleswig auf <strong>de</strong>utscher Seite, bestehend aus <strong>de</strong>n Kreisen Nordfriesland, Schleswig-<br />
Flensburg, <strong>de</strong>m Nordteil <strong>de</strong>s Kreises Rendsburg-Eckernför<strong>de</strong> und <strong>de</strong>r Stadt Flensburg sowie Nordschleswig auf dänischer Seite, das bis 31. Dezember 2006 <strong>de</strong>ckungsgleich mit <strong>de</strong>m<br />
Søn<strong>de</strong>rjyllands Amt war, jetzt aber in <strong>de</strong>r Region Syddanmark aufgegangen ist.<br />
Bis 1864 gehörten <strong>de</strong>m Herzogtum noch sieben Kirchspiele südlich von Kolding, ein zwischen Königsau und Ribe (<strong>de</strong>utsch: Ripen) gelegener Landstrich und die Insel Ærø an. Nach <strong>de</strong>r<br />
Übergabe Schleswigs an Preußen gelangten diese ausschließlich dänisch bevölkerten Gebiete im Tausch gegen die königlich dänischen Enklaven an <strong>de</strong>r Westküste Schleswigs an das<br />
Königreich Dänemark. Im 13. und 14. Jahrhun<strong>de</strong>rts gehörten <strong>de</strong>n schleswigschen Herzögen auch Langeland sowie Gebiete auf <strong>de</strong>m südlichen Fünen.<br />
Siedlungsgeschichte und Bevölkerung<br />
Das Gebiet Schleswigs war <strong>zu</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rungszeit vor allem von westgermanischen Angeln besie<strong>de</strong>lt. Nach<strong>de</strong>m große Teile <strong>de</strong>r Angeln <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n in Nørrejylland<br />
sie<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n germanischen Jüten[1] und <strong>de</strong>n südlich Schleswigs sie<strong>de</strong>ln<strong>de</strong>n Sachsen im 4. und 5. Jahrhun<strong>de</strong>rt (insbeson<strong>de</strong>re wohl um das Jahr 350)[2] <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Britischen Inseln<br />
auswan<strong>de</strong>rten, drangen von <strong>de</strong>n Inseln zwischen Schwe<strong>de</strong>n und Jütland nordgermanische Dänen, <strong>de</strong>ren ursprüngliche Heimat wahrscheinlich Schonen (im heutigen Südschwe<strong>de</strong>n) war,
in das nun bevölkerungsarme Nordjütland ein und vermischten sich mit <strong>de</strong>n Resten <strong>de</strong>r Jüten und Angeln. Etwa zeitgleich mit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r dänischen Einwan<strong>de</strong>rung sie<strong>de</strong>lten ab <strong>de</strong>m<br />
8. Jahrhun<strong>de</strong>rt Friesen an <strong>de</strong>r Westküste, um sich <strong>de</strong>r Expansion <strong>de</strong>s Frankenreiches <strong>zu</strong> entziehen. Der Landstrich zwischen <strong>de</strong>n Linien Eckernför<strong>de</strong>–Treene und Ei<strong>de</strong>r–Levensau war<br />
damals kaum besie<strong>de</strong>lt, von dichtem Wald be<strong>de</strong>ckt und wur<strong>de</strong> erst im hohen Mittelalter von aus Sü<strong>de</strong>n kommen<strong>de</strong>n sächsischen Kolonisten besie<strong>de</strong>lt .[3] Im späten Mittelalter holten die<br />
Schleswiger Herzöge holländische, flämische und westfälische Kolonisten ins Land Quelle?, im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt im Rahmen <strong>de</strong>r Kolonisation <strong>de</strong>r Moor- und Hei<strong>de</strong>landschaft <strong>de</strong>r<br />
schleswigschen Geest Kolonisten aus Württemberg, Schwaben, Hessen und <strong>de</strong>r Pfalz.<br />
Heute leben in bei<strong>de</strong>n Teilen Schleswigs – im dänischen Nor<strong>de</strong>n und im <strong>de</strong>utschen Sü<strong>de</strong>n – Min<strong>de</strong>rheiten <strong>de</strong>r jeweils an<strong>de</strong>ren Seite, <strong>de</strong>ren Rechte durch die „Bonn-Kopenhagener<br />
Erklärungen“ von 1955 geregelt wer<strong>de</strong>n: Über die Zugehörigkeit kann je<strong>de</strong>r Einwohner selbst frei entschei<strong>de</strong>n.<br />
Sprachen<br />
Im Hochmittelalter war die Sprache Schleswigs bis an die Schlei und die Eckernför<strong>de</strong>r Bucht nach <strong>de</strong>r Einwan<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Dänen <strong>zu</strong>nächst das Alt- bzw. Mitteldänische bzw. Südjütisch<br />
(dialektal: Synnejysk, dänisch Søn<strong>de</strong>rjysk), das aus Verschmel<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Jütischen mit <strong>de</strong>m Dänischen hervorgegangen war Quelle?, seit <strong>de</strong>m 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt verbreitete sich dann<br />
<strong>zu</strong>nehmend Mittelnie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch, <strong>zu</strong>erst vor allem in <strong>de</strong>n Städten und dann in <strong>de</strong>r adligen Oberschicht, in <strong>de</strong>n darauffolgen<strong>de</strong>n Jahrhun<strong>de</strong>rten auch in <strong>de</strong>n ländlichen Gebieten. Im frühen<br />
19. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> Nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch schließlich Umgangssprache in Angeln, in <strong>de</strong>n 1930er Jahren auch in fast allen <strong>de</strong>r letzten wenigen dänisch-südjütischen Sprachinseln <strong>de</strong>r<br />
Schleswigschen Geest (z.B. das Viöler Dänisch), sodass das südliche Schleswig ungefähr bis <strong>zu</strong>r heutigen Grenze nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch- (als Schleswigsch) bzw. <strong>de</strong>utschsprachig gewor<strong>de</strong>n war.<br />
Hoch<strong>de</strong>utsch hatte sich im Sü<strong>de</strong>n Schleswigs vor allem seit <strong>de</strong>r Reformation im Zuge <strong>de</strong>r Verwendung <strong>de</strong>r Lutherbibel langsam ausgebreitet. In <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts verdrängte<br />
es das Nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsche als Kirchen- und Schulsprache, während Søn<strong>de</strong>rjysk, Nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch und Nordfriesisch weiterhin die Sprache <strong>de</strong>s Volks blieben. Die Bevölkerung im ländlichen<br />
Raum <strong>de</strong>s heutigen Nordschleswig sprach auch im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt noch weitgehend Südjütisch, während die Städte auch Nordschleswigs bis <strong>zu</strong>m 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt mehrheitlich<br />
<strong>de</strong>utschsprachig gewor<strong>de</strong>n waren. Nach <strong>de</strong>r Grenzziehung von 1920 ging hier Südjütisch <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>s Reichsdänischen (Hochdänisch) <strong>zu</strong>rück, ein Prozess, <strong>de</strong>r sich nach <strong>de</strong>m Zweiten<br />
Weltkrieg beschleunigte.<br />
Heute gibt es auf bei<strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Grenze nationale Min<strong>de</strong>rheiten. Bei<strong>de</strong> Min<strong>de</strong>rheiten pflegen ihre Sprache mit einem Netz von Kin<strong>de</strong>rgärten und Schulen, die <strong>zu</strong> von jeweils bei<strong>de</strong>n<br />
nationalen Bildungssystemen anerkannten Abschlüssen führen. Auf <strong>de</strong>utscher Seite leben über 10.000 dänische Muttersprachler,[4] die überwiegend die Variante Sydslesvigdansk<br />
sprechen, auf dänischer Seite etwa 15.000–25.000 <strong>de</strong>utsche Muttersprachler Quelle?. Ein kleiner Teil von ihnen spricht auch noch das Nordschleswiger Platt <strong>de</strong>s Schleswigsch. Für die<br />
Zugehörigkeit <strong>zu</strong>r <strong>de</strong>utschen bzw. dänischen Min<strong>de</strong>rheit spielt die Sprache seit 1955 <strong>zu</strong>min<strong>de</strong>st formal keine Rolle, entschei<strong>de</strong>nd ist die Selbst<strong>zu</strong>ordnung.<br />
Der Dänische Schulverein für Südschleswig trägt zwei Gymnasien in Flensburg und Schleswig, ein Schülerwohnheim in Flensburg sowie 47 weitere Schulen mit <strong>zu</strong>sammen 5.612<br />
Schülern (Stand 2007)[5] und 55 Kin<strong>de</strong>rgärten, die 2000 von etwa 1.800 Kin<strong>de</strong>rn besucht wur<strong>de</strong>n. In allen Institutionen wird mit Ausnahme <strong>de</strong>s Faches Deutsch ausschließlich auf<br />
Dänisch unterrichtet. Die Dänische Zentralbibliothek für Südschleswig betreibt fünf dänische Bibliotheken.<br />
Zur Pflege <strong>de</strong>utscher Sprache und Kultur betreibt <strong>de</strong>r Schul- und Sprachverein für Nordschleswig ein Gymnasium in Apenra<strong>de</strong>, 15 weitere allgemeinbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Schulen mit <strong>zu</strong>sammen<br />
1.350 Schülern und 24 Kin<strong>de</strong>rgärten mit 600 Kin<strong>de</strong>rn. In allen Bildungseinrichtungen wird ausschließlich auf Deutsch unterrichtet. Der Verband Deutscher Büchereien in Nordschleswig<br />
betreibt fünf <strong>de</strong>utsche Bibliotheken.<br />
An <strong>de</strong>r Westküste Schleswigs wur<strong>de</strong> seit <strong>de</strong>m 8. Jahrhun<strong>de</strong>rt Nordfriesisch gesprochen. Seit <strong>de</strong>m 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt setzte sich jedoch Nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch auf Ei<strong>de</strong>rstedt, Nordstrand, Pellworm<br />
und <strong>de</strong>n Halligen durch und verbreitete sich <strong>zu</strong>nehmend auf <strong>de</strong>m friesischen Festland. Heute beherrschen noch etwa 10.000 Nordfriesen Friesisch, vor allem auf <strong>de</strong>n Inseln Amrum,<br />
Föhr, Sylt und Helgoland sowie in <strong>de</strong>r Gegend von Risum-Lindholm.<br />
Geschichte<br />
Übersicht<br />
Das Jarltum Schleswig bil<strong>de</strong>te sich im Hochmittelalter innerhalb Dänemarks als Lehen heraus. Im 12. und 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt nahmen die Jarle nach <strong>de</strong>utschem Vorbild <strong>de</strong>n Herzogtitel an
und behaupteten <strong>zu</strong>nehmend ihre Autonomie gegenüber <strong>de</strong>m dänischen Königshaus. Nach <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>s Abelgeschlechts im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt gelang es <strong>de</strong>n Schauenburgern, die<br />
erbliche Belehnung mit <strong>de</strong>m Herzogtum Schleswig <strong>zu</strong> erhalten. Die dynastische Verflechtung zwischen <strong>de</strong>m Herzogtum Schleswig, <strong>de</strong>r Grafschaft Holstein und <strong>de</strong>m Königreich<br />
Dänemark sollte von da an 500 Jahre lang die Geschichte bestimmen.<br />
Entstehung <strong>de</strong>s Herzogtums<br />
Nach <strong>de</strong>r Unterwerfung <strong>de</strong>r Sachsen durch Karl <strong>de</strong>n Großen wur<strong>de</strong>n das Frankenreich und Dänemark <strong>zu</strong> Nachbarn. Karl <strong>de</strong>r Große und <strong>de</strong>r Dänenkönig Gudfred vereinbarten 808 als<br />
Grenze die Ei<strong>de</strong>r, die daraufhin über ein Jahrhun<strong>de</strong>rt unangetastet festlag.<br />
Unter <strong>de</strong>n Kolonisationsbestrebungen <strong>de</strong>s sächsischen Königs Heinrich I. wur<strong>de</strong> 934 das Gebiet zwischen Ei<strong>de</strong>r und Schlei mit <strong>de</strong>r Stadt Schleswig erobert und diente <strong>de</strong>n Kaisern <strong>de</strong>s<br />
Heiligen Römischen Reichs Otto I., Otto II., Otto III., Heinrich II. und Konrad II. unter <strong>de</strong>m Namen Mark Schleswig (auch Dänische Mark) als Grenzmark.<br />
Nach<strong>de</strong>m Kaiser Konrad II. bei seiner Heirat mit <strong>de</strong>r Tochter Knuts <strong>de</strong>s Großen von England, Dänemark, Schottland und Norwegen diesem Teile von Nord<strong>de</strong>utschland überlassen hatte,<br />
fiel 1025 die Mark Schleswig wie<strong>de</strong>r an Dänemark und die Ei<strong>de</strong>rgrenze wur<strong>de</strong> erneut <strong>zu</strong>r Grenze zwischen <strong>de</strong>m Heiligen Römischen Reich und Dänemark.<br />
Die Könige von Dänemark setzten auf ihrer Seite <strong>de</strong>r Grenze Statthalter ein, die <strong>zu</strong>nächst <strong>de</strong>n Titel Jarl führten. Dieses Amt wur<strong>de</strong> vor<strong>zu</strong>gsweise an Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Königsfamilie<br />
vergeben. Der letzte Jarl Schleswigs, <strong>de</strong>r sich nach <strong>de</strong>utschem Vorbild Herzog nannte, war von 1119 bis 1130 Knud Laward. Der Schleswiger Herzog und Königssohn Abel ließ 1250<br />
seinen Bru<strong>de</strong>r Erik IV. ermor<strong>de</strong>n und wur<strong>de</strong> an <strong>de</strong>ssen Statt selber König von Dänemark. Unter seinen Söhnen spaltete sich die herzogliche Dynastie vom dänischen Königshaus ab.<br />
Dynastische Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen<br />
Die Schauenburger Grafen, die seit <strong>de</strong>m frühen 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt mit <strong>de</strong>m <strong>zu</strong>m Heiligen Römischen Reich gehören<strong>de</strong>n benachbarten Holstein belehnt waren, unterstützten die<br />
Selbständigkeitsbestrebungen Schleswigs. Graf Gerhard III. von Holstein nötigte 1326 Wal<strong>de</strong>mar III. von Dänemark <strong>zu</strong>r Constitutio Val<strong>de</strong>mariana, die eine gemeinsame Regierung von<br />
Dänemark und Schleswig verbot. Nach <strong>de</strong>m Aussterben <strong>de</strong>s Schleswiger Herzogsgeschlechts 1386 erzwangen die Schauenburger ihre erbliche Belehnung mit <strong>de</strong>m Herzogtum Schleswig<br />
durch das dänische Königshaus und <strong>de</strong>r holsteinische A<strong>de</strong>l begann verstärkt, Besitz in Schleswig <strong>zu</strong> erwerben und die Kolonisierung voran<strong>zu</strong>treiben.<br />
Als das Schauenburger Geschlecht 1459 mit <strong>de</strong>m Tod Adolfs VIII. ausstarb, war <strong>de</strong>m A<strong>de</strong>l in bei<strong>de</strong>n Territorien daran gelegen, dass in bei<strong>de</strong>n Gebieten weiterhin <strong>de</strong>rselbe Herrscher<br />
regieren solle. Darum wählten sie König Christian I. von Dänemark, Norwegen und Schwe<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>m Hause Ol<strong>de</strong>nburg, einen Neffen Adolfs VIII., <strong>zu</strong>m Lan<strong>de</strong>sherrn. Im Vertrag von<br />
Ripen (Ribe) 1460 – <strong>de</strong>r Wahlkapitulation Christians I. – stand unter an<strong>de</strong>rem, dass se bliwen tosamen<strong>de</strong> up ewig unge<strong>de</strong>lt. Obwohl dieser weit hinten in <strong>de</strong>r Urkun<strong>de</strong> stehen<strong>de</strong> Paragraf<br />
im zeitgenössischen Kontext nichts mit einer territorialen Unteilbarkeit <strong>zu</strong> tun hat,[6] wur<strong>de</strong> op ewig unge<strong>de</strong>elt das Leitmotto <strong>de</strong>r schleswig-holsteinischen Bewegung <strong>de</strong>s 19.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt, die eine Loslösung vom dänischen Gesamtstaat anstrebte.<br />
Zerteilungen ab 1544<br />
1544 wur<strong>de</strong>n die Herzogtümer Schleswig und Holstein in drei Gebiete geteilt, die in etwa gleiche Steuerkraft hatten. Diese hingen jeweils räumlich nicht <strong>zu</strong>sammen. Eines dieser<br />
Gebiete, als königlich dänischer Anteil bezeichnet, gehörte Christian III., <strong>de</strong>m König von Dänemark und Norwegen. Dessen zwei Halbbrü<strong>de</strong>r, Johann II., Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Nebenlinie<br />
Schleswig-Holstein-Ha<strong>de</strong>rsleben, und Adolf I., Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Nebenlinie Schleswig-Holstein-Gottorf, erhielten jeweils eines <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren bei<strong>de</strong>n Gebiete.<br />
Als 1580 Johann II. starb und mit ihm die Nebenlinie Schleswig-Holstein-Ha<strong>de</strong>rsleben en<strong>de</strong>te, wur<strong>de</strong> das ihm 1544 <strong>zu</strong>geteilte Gebiet <strong>zu</strong>r Hälfte <strong>de</strong>m König <strong>zu</strong>geschlagen und <strong>zu</strong>r<br />
an<strong>de</strong>ren Hälfte seinem Bru<strong>de</strong>r Adolf I.<br />
Im Jahr 1564 kam es <strong>zu</strong> einer weiteren Lan<strong>de</strong>steilung, <strong>de</strong>nn König Friedrich II. von Dänemark, <strong>de</strong>r Sohn Christians III., trat seinem Bru<strong>de</strong>r Johann (genannt „Johann <strong>de</strong>r Jüngere“, <strong>de</strong>r<br />
das Schloss Glücksburg 1582-87 errichten ließ) ein Drittel seines Anteils an Schlössern, Ämtern und Städten ab, eine "Subdivision", wodurch Johann <strong>de</strong>r Jüngere Son<strong>de</strong>rburg, Arroe,<br />
Plön und Ahrensbök erhielt. Nach <strong>de</strong>m Tod seines Sohnes Alexan<strong>de</strong>r (1622–1627) teilte sich diese Son<strong>de</strong>rburger Linie <strong>de</strong>s Hauses Ol<strong>de</strong>nburg einerseits in die Linie <strong>de</strong>s Erstgeborenen<br />
(Ernst Günther, 1627–1689), <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>m Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s herzoglichen Hauses Schleswig-Holstein-Son<strong>de</strong>rburg-Augustenburg wur<strong>de</strong>; Nachfahre dieses Ernst Günther war beispielsweise <strong>de</strong>r
in <strong>de</strong>r Zeit von 1863 bis 1866 beson<strong>de</strong>rs bekannt gewor<strong>de</strong>ne Herzog Friedrich (Christian August) von Augustenburg (1829–1888) (genannt „Friedrich VIII.“). An<strong>de</strong>rerseits entstand<br />
durch die Erbteilung von 1627 die jüngere Linie <strong>de</strong>s „Hauses Son<strong>de</strong>rburg“ unter ihrem Begrün<strong>de</strong>r Herzog August Philip (1627–1675), die <strong>de</strong>n Namen Schleswig-Holstein-Son<strong>de</strong>rburg-<br />
Beck (später: Son<strong>de</strong>rburg-Glücksburg) trug.<br />
Um mehr Unabhängigkeit von <strong>de</strong>r Krone <strong>zu</strong> gewinnen, suchte die herzogliche Linie Gottorf die Allianz <strong>zu</strong> Schwe<strong>de</strong>n. Im Großen Nordischen Krieg besetzte daraufhin Dänemark 1713<br />
<strong>de</strong>n herzoglichen Anteil Schleswigs. Von da an war Schleswig wie<strong>de</strong>r vereinigt in königlich dänischer Hand. Im Frie<strong>de</strong>n von Fre<strong>de</strong>riksborg wur<strong>de</strong> die Annexion 1720 als rechtmäßig<br />
bestätigt und 1721 erfolgte auf Schloss Gottorf die Huldigung <strong>de</strong>s dänischen Königs durch <strong>de</strong>n Ritterstand. Zu einer Einigung <strong>de</strong>s Herzogtums Holstein kam es erst 1773, als die<br />
herzogliche Linie nach Erlangung <strong>de</strong>s russischen Zarenthrons <strong>zu</strong>gunsten Dänemarks auf ihre holsteinischen Herrschaftsrechte verzichtete.<br />
Nationale Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen<br />
Mit Aufkommen <strong>de</strong>r nationalen Bewegungen entstand <strong>zu</strong>m einen die Bestrebung <strong>de</strong>s dänischen Bevölkerungsteils, das selbständige Herzogtum Schleswig vollständig in das dänische<br />
Königreich <strong>zu</strong> integrieren und Holstein an Deutschland ab<strong>zu</strong>treten, <strong>zu</strong>m an<strong>de</strong>ren die Bestrebung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Bevölkerungsmehrheit in Schleswig-Holstein, die in eine<br />
Nationalbewegung mün<strong>de</strong>te, <strong>zu</strong>r Vereinigung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Herzogtümer innerhalb eines <strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>sstaates und somit <strong>de</strong>r Loslösung von <strong>de</strong>r dänischen Krone. Einige Schleswig-<br />
Holsteiner for<strong>de</strong>rten auch, die Augustenburger Linie wie<strong>de</strong>r als Herzöge ein<strong>zu</strong>setzen.<br />
Erste Gedanken, Schleswig anhand einer Sprachgrenze <strong>zu</strong> teilen, wur<strong>de</strong>n schon 1830 entwickelt, doch hatte <strong>de</strong>r Teilungsgedanke auf keiner Seite einen größeren Rückhalt, da sich die<br />
Mehrheit gesinnungsübergreifend als Schleswiger sah. Schleswig war zweimal Anlass für Konflikte im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt: 1848 protestierten die <strong>de</strong>utschen Liberalen gegen das<br />
Einbeziehen Schleswigs in eine gesamtdänische Verfassung, da Schleswig staatsrechtlich nicht <strong>zu</strong>m Königreich Dänemark gehörte, und for<strong>de</strong>rten darüber hinaus die Aufnahme<br />
Schleswigs in <strong>de</strong>n Deutschen Bund bzw. in einen geplanten Deutschen Nationalstaat, während die dänischen Liberalen die Integration <strong>de</strong>s Herzogtums ins Königreich Dänemark<br />
for<strong>de</strong>rten (Ei<strong>de</strong>rdänen). Nach<strong>de</strong>m sich die <strong>de</strong>n aufständischen Schleswig-Holsteinischen Truppen <strong>zu</strong>r Hilfe geeilten Truppen <strong>de</strong>s Deutschen Bun<strong>de</strong>s unter Führung Preußens auf<br />
internationalen Druck hin aus Jütland <strong>zu</strong>rückgezogen hatten, unterlagen die Schleswig-Holsteiner 1851 <strong>de</strong>n Dänen. In <strong>de</strong>r Folgezeit verschärfte die dänische Krone ihre Politik <strong>de</strong>r<br />
Danisierung (u. a. Sprachreskripte für Mittelschleswig), so dass <strong>de</strong>r Wunsch <strong>de</strong>r mehrheitlich <strong>de</strong>utschgesinnten Schleswiger[7] nach einer Loslösung von Dänemark weiter virulent war.<br />
1864–1867 – Von Dänemark <strong>zu</strong> Preußen<br />
Als das Königreich Dänemark schließlich in seiner Novemberverfassung das Londoner Protokoll brach, kam es <strong>zu</strong>m Deutsch-Dänischen Krieg von 1864 zwischen Dänemark und <strong>de</strong>n<br />
Verbün<strong>de</strong>ten Preußen und Österreich. Im Wiener Frie<strong>de</strong>n musste Dänemark am 30. Oktober 1864 Schleswig, Holstein und Lauenburg an Preußen und Österreich abtreten, die es<br />
<strong>zu</strong>nächst gemeinsam als Kondominium verwalteten. Die gemeinsame Verwaltung en<strong>de</strong>te faktisch mit <strong>de</strong>r Gasteiner Konvention 1865. Nach <strong>de</strong>m Deutschen Krieg 1866 fielen Schleswig<br />
und Holstein endgültig an Preußen; mit Lauenburg war Preußen bereits seit 1865 in Personalunion vereint. 1867 erfolgte die Vereinigung <strong>zu</strong>r preußischen Provinz Schleswig-Holstein,<br />
<strong>de</strong>r 1876 auch Lauenburg als Kreis Herzogtum Lauenburg einverleibt wur<strong>de</strong>.<br />
Der Prager Frie<strong>de</strong>n von 1866 enthielt auf Intervention Napoleon III. in Artikel 5 einen Volksabstimmungsvorbehalt für das nördliche Schleswig. Die faktisch Dänemark begünstigen<strong>de</strong><br />
Klausel wur<strong>de</strong> allerdings von Preußen und Österreich 1878 einvernehmlich annulliert. Im Optantenvertrag von 1907 erkannte schließlich auch Dänemark die Grenze von 1864 <strong>de</strong> facto<br />
an.<br />
In <strong>de</strong>r dänischgesinnten Bevölkerung Nordschleswigs blieb <strong>de</strong>r Wunsch nach einem Anschluss an Dänemark stets lebendig, wobei allmählich auch einstige Gegner einer Teilung <strong>de</strong>s<br />
Herzogtums diese notfalls für opportun hielten. In <strong>de</strong>n 1880er Jahre begann sich die dänische Min<strong>de</strong>rheit in Schleswig <strong>zu</strong> organisieren. 1901 for<strong>de</strong>rte <strong>de</strong>r dänische Historiker H. V.<br />
Clausen die Abtretung <strong>de</strong>s nördlichen Schleswigs an Dänemark. Die von ihm vorgeschlagene Teilungslinie, die sogenannte Clausen-Linie, verlief nördlich von Ton<strong>de</strong>rn gen Flensburg,<br />
ließ die Zugehörigkeit <strong>de</strong>r Stadt selbst allerdings offen. Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Ersten Weltkrieges, zwei Wochen nach <strong>de</strong>m Waffenstillstandsangebot <strong>de</strong>s Deutschen Reiches, for<strong>de</strong>rte Hans<br />
Peter Hanssen, seit 1896 Abgeordneter <strong>de</strong>s preußischen Landtags und seit 1905 <strong>de</strong>s Reichstags, erfolglos im <strong>de</strong>utschen Reichstag die Wie<strong>de</strong>raufnahme und Anwendung <strong>de</strong>r 1878<br />
annullierten Abstimmungsklausel.<br />
1918–1920 – Teilung Schleswigs
Im Ersten Weltkrieg war Dänemark neutral. Als sich schon vor <strong>de</strong>m Waffenstillstand vom 11. November 1918 abzeichnete, dass <strong>de</strong>nnoch die dänischen For<strong>de</strong>rungen in <strong>de</strong>n<br />
Frie<strong>de</strong>nsvertrag eingehen wür<strong>de</strong>n, organisierte sich auch <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utsche Bevölkerungsteil.<br />
Aufgrund <strong>de</strong>s Drucks <strong>de</strong>r Entente wur<strong>de</strong>n im Versailler Vertrag Volksabstimmungen in Schleswig vorgesehen, die Anfang 1920 unter <strong>de</strong>r Regie <strong>de</strong>r CIS (Commission Internationale <strong>de</strong><br />
Surveillance du Plébiscite Slesvig), die in dieser Zeit auch kommissarisch das Hoheitsrecht über Schleswig ausübte, im nördlichen und mittleren Teil durchgeführt wur<strong>de</strong>n. Die<br />
Kommission bestand aus <strong>de</strong>m Franzosen Paul Clau<strong>de</strong>l, <strong>de</strong>m Englän<strong>de</strong>r Charles Marling, und – auf Wunsch <strong>de</strong>r Alliierten – je einem Vertreter <strong>de</strong>r im Ersten Weltkrieg neutralen Län<strong>de</strong>r<br />
Schwe<strong>de</strong>n und Norwegen. Berater <strong>de</strong>r CIS waren für Dänemark H. P. Hanssen, <strong>de</strong>r inzwischen dänischer Ministerpräsi<strong>de</strong>nt war, und für Deutschland Emilio Böhme. Dabei konnte die<br />
Ziehung <strong>de</strong>r Grenzen für die Abstimmungszonen sowie die Festlegung jeweils unterschiedlicher Abstimmungsmodalitäten für die Zonen (en bloc im Nor<strong>de</strong>n, gemein<strong>de</strong>weise in Sü<strong>de</strong>n)<br />
von Dänemark durchgesetzt wer<strong>de</strong>n. Auf Wunsch dänischer Nationalisten, die Schleswig bis <strong>zu</strong>r Ei<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> gewinnen hofften, wur<strong>de</strong> zeitweise sogar eine dritte Abstimmungszone<br />
bestimmt, doch rückte die damalige sozialliberal-sozial<strong>de</strong>mokratische Mehrheit im dänischen Folketing von dieser For<strong>de</strong>rung aber wie<strong>de</strong>r ab.<br />
In <strong>de</strong>r nördlichen Abstimmungszone I (Nordschleswig) wur<strong>de</strong> am 10. Januar abgestimmt. Hier gab es bei 91,5 % Wahlbeteiligung rund 75.000 Stimmen (74,2 %) für Dänemark und<br />
25.000 Stimmen (25,8 %) für Deutschland. Die En Bloc-Abstimmung führte da<strong>zu</strong>, dass neben <strong>de</strong>n mehrheitlich für Deutschland votieren<strong>de</strong>n Städten Apenra<strong>de</strong> (dänisch: Åbenrå) und<br />
Son<strong>de</strong>rburg (dänisch: Søn<strong>de</strong>rborg) in einem ansonsten geschlossen mehrheitlich dänisch stimmen<strong>de</strong>n Umland auch die Stadt Ton<strong>de</strong>rn (dänisch: Tøn<strong>de</strong>r), <strong>de</strong>r Flecken Tingleff (dänisch:<br />
Tinglev) und <strong>de</strong>r sie umgeben<strong>de</strong> Landstrich, allesamt mit zwischen 77 % und 88 % mehrheitlich für <strong>de</strong>n Verbleib bei Deutschland stimmend, an Dänemark fielen.<br />
In Zone II (Mittelschleswig) wur<strong>de</strong> am 24. Februar gemein<strong>de</strong>weise abgestimmt. Bei 90,75% Wahlbeteiligung gab es 52.000 Stimmen (80,2 %) für Deutschland und 13.000 Stimmen<br />
(19,8%) für Dänemark, dabei kam es in lediglich drei Gemein<strong>de</strong>n auf Föhr <strong>zu</strong> einer dänischen Mehrheit, so dass Mittelschleswig geschlossen bei Deutschland verblieb.<br />
Schon am 11. Januar, <strong>de</strong>m Tag nach <strong>de</strong>r Abstimmung in Zone I, wur<strong>de</strong> vom <strong>de</strong>utschen Sachverständigen Johannes Tiedje eine etwas weiter nördlich verlaufen<strong>de</strong> Grenze, die sog. Tiedje-<br />
Linie vorgeschlagen, die <strong>zu</strong> in etwa gleich großen Min<strong>de</strong>rheiten bei<strong>de</strong>rseits <strong>de</strong>r Grenze geführt hätte.<br />
Die endgültige Entscheidung über <strong>de</strong>n Grenzverlauf fiel im Mai 1920 in Paris. Die Siegermächte und Dänemark lehnten <strong>de</strong>n Gegenvorschlag Tiedjes ab, so dass die Clausen-Linie <strong>zu</strong>r<br />
bis heute gültigen Grenze zwischen Deutschland und Dänemark wur<strong>de</strong>. Das nunmehr verkleinerte Schleswig blieb Teil <strong>de</strong>r preußischen Provinz Schleswig-Holstein und gehört seit 1946<br />
<strong>zu</strong>m <strong>de</strong>utschen Land Schleswig-Holstein.<br />
Literatur<br />
• Robert Bohn: Geschichte Schleswig-Holsteins. München 2006 (Verlag C.H. Beck), ISBN 3-406-50891-X<br />
• Troels Fink: Geschichte <strong>de</strong>s schleswigschen Grenzlan<strong>de</strong>s. Munksgaard, København 1958.<br />
• Reimer Hansen: Was be<strong>de</strong>utet „op ewig unge<strong>de</strong>elt“? Das Ripener Privileg von 1460 im <strong>de</strong>utsch-dänischen Nationalkonflikt <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts. In: Grenzfrie<strong>de</strong>nshefte 4, 1996,<br />
S. 215–232. ISSN 1867-1853<br />
• Paul von He<strong>de</strong>mann-Heespen: Die Herzogtümer Schleswig-Holstein und die Neuzeit, Walter G. Mühlau, Kiel 1926 (<strong>zu</strong>m Thema „Augustenburg“ S. 712-733, Kap. 95 und 96)<br />
• Carsten Jahnke: „dat se bliven ewich tosamen<strong>de</strong> unge<strong>de</strong>lt“. Neue Überlegungen <strong>zu</strong> einem alten Schlagwort. In: ZSHG, Bd. 128, 2003, ISBN 3-529-02328-0<br />
• Jörg Johannsen-Reichert (geb. Johannsen): Der Erbfolgestreit um die Herzogtümer Schleswig und Holstein im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt – Eine Untersuchung <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n<br />
Sukzessionsansprüchen <strong>de</strong>r Herzöge von Son<strong>de</strong>rburg-Augustenburg auf Schleswig und Holstein. Shaker, Aachen 1999, ISBN 978-3-8265-4724-9<br />
• Ulrich Lange (Hrsg.): Geschichte Schleswig-Holsteins.Wachholtz, Neumünster 2003, ISBN 3-529-02440-6<br />
• Ulrich Lange, Henrik Becker-Christensen (Hrsg.): Geschichte Schleswigs. Vom frühen Mittelalter bis 1920. Institut for Grænseregionsforskning, Aabenraa 1998, ISBN 87-<br />
90163-74-5<br />
• Lorenz Rerup: Slesvig og Holsten efter 1830. Politikens Danmarkshistorie, København 1982.<br />
• Gerret L. Schlaber: Hertugdømmet Slesvigs forvaltning. Administrative strukturer og retspleje mellem Ej<strong>de</strong>ren og Kongeåen ca. 1460-1864. Studieaf<strong>de</strong>lingen ved Dansk<br />
Centralbibliotek for Sydslesvig, Flensborg 2007, ISBN 978-87-89178-65-3<br />
• Hans Schultz Hansen u. a.: Søn<strong>de</strong>rjyllands Historie. Bd. 1. Historisk Samfund for Søn<strong>de</strong>rjylland. Aabenraa 2008, ISBN 978-87-7406-109-0
• Horst Windmann: Schleswig als Territorium. Grundzüge <strong>de</strong>r Verfassungsentwicklung im Herzogtum Schleswig von <strong>de</strong>n Anfängen bis <strong>zu</strong>m Aussterben <strong>de</strong>s Abelschen Hauses<br />
1375. Wachholtz, Neumünster 1954.<br />
• Jann Markus Witt, Heiko Vosgerau (Hrsg.): Schleswig-Holstein von <strong>de</strong>n Ursprüngen bis <strong>zu</strong>r Gegenwart. Eine Lan<strong>de</strong>sgeschichte. Convent, Hamburg 2002, ISBN 3-934613-39-X<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Meyers Neues Lexikon (Mannheim 1979) und Meyers Enzyklopädisches Lexikon (Mannheim 1975) <strong>de</strong>finierten die Jüten noch als nordgermanisch, während <strong>de</strong>r Atlas <strong>zu</strong>r<br />
Universalgeschichte von Ol<strong>de</strong>nbourg/Westermann die Jüten als westgermanisch beschreibt; <strong>de</strong>r Brockhaus (Mannheim 2006), die Encyclopædia Britannica (Chicago 2005), das<br />
Du<strong>de</strong>n-Lexikon (1980) und das dtv-Lexikon (München 1971) beschreiben die Jüten allgemeiner als germanischen Stamm in Jütland<br />
2. ↑ Gesellschaft für schleswig-holsteinische Geschichte über Angelsachsen. Geschichte-s-h.<strong>de</strong>. Abgerufen am 5. Juni 2010.<br />
3. ↑ Henning Unverhau: Untersuchungen <strong>zu</strong>r historischen Entwicklung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s zwischen Schlei und Ei<strong>de</strong>r im Mittelalter, Neumünster 1990<br />
4. ↑ Dänisches Kulturinstitut Bonn. Dankultur.<strong>de</strong>. Abgerufen am 5. Juni 2010.<br />
5. ↑ Dänischer Schulverein für Südschleswig. Skoleforeningen.org. Abgerufen am 5. Juni 2010.<br />
6. ↑ Vgl. Jahnke 2003<br />
7. ↑ Universität Hannover (PDF). Abgerufen am 5. Juni 2010.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Lübeck<br />
Die Hansestadt Lübeck[2] (platt<strong>de</strong>utsch: Lübeck, Lübeek, dänisch: Lybæk; Adjektiv: lübsch, lübisch, seit spätestens <strong>de</strong>m 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt auch lübeckisch) ist eine kreisfreie Stadt im<br />
Nor<strong>de</strong>n Deutschlands und im Südosten Schleswig-Holsteins an <strong>de</strong>r Ostsee (Lübecker Bucht). Sie hat nach <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>shauptstadt Kiel die meisten Einwohner und ist eines <strong>de</strong>r vier<br />
Oberzentren <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Flächenmäßig ist sie die größte Stadt in Schleswig-Holstein. Die mittelalterliche Lübecker Altstadt ist Teil <strong>de</strong>s UNESCO-Welterbes. Die nächstgelegenen<br />
großen Städte sind Hamburg etwa 65 Kilometer südwestlich, Kiel etwa 78 Kilometer nordwestlich und Schwerin etwa 68 Kilometer südöstlich. Lübeck grenzt unmittelbar an die<br />
Europäische Metropolregion Hamburg an. Lübeck wird auch „Stadt <strong>de</strong>r Sieben Türme“ und „Tor <strong>zu</strong>m Nor<strong>de</strong>n“ genannt.<br />
Die Stadt liegt in <strong>de</strong>r Nord<strong>de</strong>utschen Tiefebene an <strong>de</strong>r unteren Trave, einem schiffbaren Fluss, <strong>de</strong>r etwa 17 Kilometer von <strong>de</strong>r Altstadt entfernt im Stadtteil Travemün<strong>de</strong> in die Ostsee<br />
mün<strong>de</strong>t. Die Altstadt liegt auf einem Hügel, <strong>de</strong>r einen Wer<strong>de</strong>r zwischen <strong>de</strong>n Wasserläufen <strong>de</strong>r Trave und <strong>de</strong>r Wakenitz bil<strong>de</strong>t. Ferner durchzieht <strong>de</strong>r Elbe-Lübeck-Kanal das Stadtgebiet<br />
von Krummesse bis <strong>zu</strong>r Trave. Die umgeben<strong>de</strong> Landschaft gehört <strong>zu</strong>m Ostholsteiner Hügelland und ist geprägt von <strong>de</strong>r Weichseleiszeit (Pleistozän). Die geografische Lage an <strong>de</strong>r Trave,<br />
die kurz vor Travemün<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Baltischen Höhenrücken durchbricht, begünstigte die Entwicklung <strong>de</strong>r Stadt als Ostseehafen und begrün<strong>de</strong>te ihren rasanten Aufstieg <strong>zu</strong>m nor<strong>de</strong>uropäischen<br />
Machtzentrum <strong>de</strong>s Mittelalters.<br />
Stadtglie<strong>de</strong>rung
Das Stadtgebiet Lübecks ist seit <strong>de</strong>r Neustrukturierung durch Bürgerschaftsbeschluss vom 28. September 1972 amtlich in zehn Stadtteile eingeteilt. Diese wie<strong>de</strong>rum sind in insgesamt 35<br />
Stadtbezirke geglie<strong>de</strong>rt. Die zehn Stadtteile mit ihren amtlichen Nummern und <strong>de</strong>n Einwohnerzahlen <strong>de</strong>r Stadtteile:<br />
• 01 Innenstadt (etwa 12.000 Einwohner)<br />
• 02 St. Jürgen (etwa 40.000 Einwohner)<br />
• 03 Moisling (etwa 10.000 Einwohner)<br />
• 04 Buntekuh (etwa 10.000 Einwohner)<br />
• 05 St. Lorenz-Süd (etwa 12.000 Einwohner)<br />
• 06 St. Lorenz-Nord (etwa 40.000 Einwohner)<br />
• 07 St. Gertrud (etwa 40.000 Einwohner)<br />
• 08 Schlutup (etwa 6.000 Einwohner)<br />
• 09 Kücknitz (etwa 20.000 Einwohner)<br />
• 10 Travemün<strong>de</strong> (etwa 15.000 Einwohner)<br />
An<strong>de</strong>re Bezeichnungen von Stadtteilen wie Hochschulstadtteil, Ringstedtensiedlung, E<strong>de</strong>lsteinsiedlung o<strong>de</strong>r Planetensiedlung entsprechen nicht <strong>de</strong>r Verwaltungsglie<strong>de</strong>rung.<br />
Die Lübecker Stadtteile haben im Laufe <strong>de</strong>r Zeit jeweils ihr eigenes Bild entwickeln können.<br />
01: Die Innenstadt ist das touristische Kernstück Lübecks, <strong>de</strong>r älteste und flächenmäßig kleinste Stadtteil. Die Innenstadt liegt hauptsächlich auf <strong>de</strong>r Altstadtinsel zwischen Trave und<br />
Wakenitz, die in etwa eine Aus<strong>de</strong>hnung von zwei Kilometer von Nord nach Süd und einen Kilometer von West nach Ost hat. Einige wesentliche Gebäu<strong>de</strong>, die <strong>zu</strong>r Innenstadt gerechnet<br />
wer<strong>de</strong>n, liegen auf umliegen<strong>de</strong>n kleineren Inseln, wie etwa das Holstentor, das am Fuß <strong>de</strong>r so genannten Wallhalbinsel liegt. Um die Innenstadt <strong>zu</strong> verlassen, muss jeweils eine Brücke<br />
im alten Befestigungsgürtel um die Stadt (Wallanlagen) überquert wer<strong>de</strong>n. Die Neustädte schließen sich nicht wie in <strong>de</strong>n meisten an<strong>de</strong>ren Städten unmittelbar an die mittelalterliche<br />
Altstadt an. Die nördliche Wallhalbinsel, auf <strong>de</strong>r sich <strong>zu</strong>rzeit die Media Docks und einige Lagerhallen <strong>de</strong>s Hafens befin<strong>de</strong>n, soll in <strong>de</strong>n nächsten Jahren <strong>zu</strong> einer Hafen City ähnlich <strong>de</strong>m<br />
Projekt in Hamburg ausgebaut wer<strong>de</strong>n.<br />
05/06: Westlich <strong>de</strong>s Holstentors liegen die bei<strong>de</strong>n Vorstädte St. Lorenz-Nord und St. Lorenz-Süd, die durch die Bahnstrecke getrennt wer<strong>de</strong>n. Namengebend ist die Kirche St. Lorenz am<br />
Steinra<strong>de</strong>r Weg, die auf die Kapelle eines Pestfriedhofs aus <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong>rückgeht. Hier wur<strong>de</strong> Mitte bis En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts eine Vorstadt für die Unter- und<br />
Mittelschicht errichtet, in <strong>de</strong>r sich schon bald eine entwickelte Arbeiterkultur etablierte. In <strong>de</strong>r Meierstraße in St. Lorenz-Süd wur<strong>de</strong> 1913 Willy Brandt geboren. An <strong>de</strong>r Lutherkirche in<br />
St. Lorenz-Süd arbeitete Karl Friedrich Stellbrink, einer <strong>de</strong>r Lübecker Märtyrer im Nationalsozialismus. Auch heute dominieren Geschosswohnungen und Industriebetriebe (Drägerwerk)<br />
die bei<strong>de</strong>n Stadtteile. Es gibt nur wenige Grünanlagen.<br />
03/04: Jenseits <strong>de</strong>r Bahngleise in St. Lorenz-Süd folgen dann die bei<strong>de</strong>n Stadtteile Buntekuh und Moisling, die durch Wohnblocks aus <strong>de</strong>n 1960er Jahren geprägt sind. In Buntekuh<br />
befin<strong>de</strong>n sich ebenfalls weitläufige Gewerbegebiete entlang <strong>de</strong>r A 1. Moisling blickt im Unterschied <strong>zu</strong> Buntekuh auf eine jahrhun<strong>de</strong>rtealte Geschichte <strong>zu</strong>rück. Bereits im 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
gab es hier eine damals noch <strong>zu</strong> Dänemark gehören<strong>de</strong> Siedlung, die vor allem von Ju<strong>de</strong>n bewohnt war. Auch heute fin<strong>de</strong>t sich hier noch ein jüdischer Friedhof. Der Stadtteil Buntekuh<br />
verdankt seinen Namen einem bäuerlichen Gut, das hier bis En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1950er Jahre existierte. Das Gut wie<strong>de</strong>rum wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>r Hansekogge „Bunte Kuh“ benannt, die 1401 <strong>de</strong>n Angriff<br />
auf <strong>de</strong>n Seeräuber Klaus Störtebeker führte.<br />
02: Im Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Altstadt und auf <strong>de</strong>r Wakenitzhalbinsel auch <strong>de</strong>n östlichen Altstadtrand umfassend liegt <strong>de</strong>r mit Abstand flächengrößte Stadtteil St. Jürgen, <strong>de</strong>r im nördlichen Teil durch<br />
grün<strong>de</strong>rzeitliche Villenviertel, dann südlich <strong>de</strong>s St.-Jürgen-Rings eher durch Wohnblocks <strong>de</strong>r 1950er bis 1970er Jahre geprägt ist. Im Sü<strong>de</strong>n läuft St. Jürgen mit einem breiten Grüngürtel<br />
voller Fel<strong>de</strong>r und Wiesen in die lauenburgische Landschaft aus. Im Osten wird <strong>de</strong>r Stadtteil von <strong>de</strong>r Wakenitz begrenzt, wo in <strong>de</strong>n Auen aufgrund <strong>de</strong>r ehemaligen <strong>de</strong>utsch-<strong>de</strong>utschen<br />
Grenze ein reichhaltiges Naturschutzgebiet entstan<strong>de</strong>n ist. In St. Jürgen liegen die bei<strong>de</strong>n größten Hochschulen Lübecks, die Universität und die Fachhochschule. St. Jürgen war<br />
ursprünglich eine Vorstadt mit Gärtnereien und Wei<strong>de</strong>n. Heute sind nur noch vier Gärtnereien vorhan<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nn die Grünflächen wur<strong>de</strong>n größtenteils bebaut. Wichtigste Neubauprojekte<br />
sind <strong>de</strong>r Hochschulstadtteil, <strong>de</strong>r als gemischtes Wohn- und Geschäftsviertel angelegt wur<strong>de</strong>, und das Neubaugebiet Bornkamp.
Im äußersten Sü<strong>de</strong>n Lübecks schließen sich mehrere dörfliche Stadtteile an wie Vorra<strong>de</strong>, Bei<strong>de</strong>ndorf, Wulfsdorf und Blankensee mit <strong>de</strong>m Flughafen, die noch <strong>zu</strong>m Gebiet von St. Jürgen<br />
gehören. Außergewöhnlich ist <strong>de</strong>r Grenzverlauf im Dorf Krummesse. Hier gehören die alten Bauernhöfe mit ihren Hufen abwechselnd <strong>zu</strong> Lübeck und <strong>zu</strong>m Herzogtum Lauenburg, so<br />
dass die territoriale Zugehörigkeit einem Flickenteppich ähnelt.<br />
07: St. Gertrud im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Altstadt ist ebenso wie St. Jürgen direkt in Altstadtnähe durch klassizistische Sommerhäuser und Grün<strong>de</strong>rzeitvillen rund um <strong>de</strong>n Stadtpark und die<br />
Wakenitz geprägt. Weiter im Osten folgen mo<strong>de</strong>rnere Wohnviertel für alle sozialen Schichten. An <strong>de</strong>r Trave fin<strong>de</strong>t sich das sehenswerte Fischerdorf Gothmund mit einigen reetge<strong>de</strong>ckten<br />
Fischerkaten. Hier liegt auch <strong>de</strong>r Lübecker Stadtwald Lauerholz, in <strong>de</strong>m sich die Grenze <strong>zu</strong>r ehemaligen DDR nachvollziehen lässt.<br />
08: Jenseits <strong>de</strong>s Stadtwal<strong>de</strong>s Lauerholz liegt <strong>de</strong>r kleine Stadtteil Schlutup, <strong>de</strong>r durch seinen an <strong>de</strong>r Trave gelegenen Fischereihafen geprägt ist. Er wan<strong>de</strong>lt sich <strong>zu</strong> einem mo<strong>de</strong>rnen<br />
Papierumschlaghafen. In Schlutup befand sich vor <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> <strong>de</strong>r nördlichste Grenzübergang zwischen <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik und <strong>de</strong>r DDR: die Transitstrecke nach Rostock und Sassnitz<br />
im Zuge <strong>de</strong>r B 105.<br />
09: Nördlich <strong>de</strong>r Trave liegt Kücknitz, das alte Industrieviertel von Lübeck. Hier wur<strong>de</strong> bis in die 80er Jahre bei <strong>de</strong>n Metallhüttenwerken Roheisen sowie Koks, Zement und Kupfer<br />
hergestellt. Daran erinnert noch das Museum für Arbeiterkultur in <strong>de</strong>r Geschichtswerkstatt Herrenwyk. In Kücknitz liegt ein wichtiger Teil <strong>de</strong>s Lübecker Hafens, <strong>de</strong>r unter an<strong>de</strong>rem aus<br />
einem neu erbauten Containerterminal besteht. Die Flen<strong>de</strong>rwerft, die traditionsreiche Werft <strong>de</strong>s Stadtteils, mel<strong>de</strong>te im Jahr 2002 Insolvenz an. Seit 2006 befin<strong>de</strong>t sich auf <strong>de</strong>m<br />
ehemaligen Werftgelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Seeland Kai <strong>de</strong>r Lübecker Hafengesellschaft sowie ein Fährterminal <strong>de</strong>r Lehmann-Gruppe.<br />
10: An <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>r Trave liegt schließlich Travemün<strong>de</strong>, das bereits im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt von Lübeck erworben wur<strong>de</strong> und seit 1801 als Seebad anerkannt ist. Hier lockt ein breiter<br />
Sandstrand sowohl am eigentlichen Ortskern als auch auf <strong>de</strong>r Priwallhalbinsel, die <strong>zu</strong> Vor-Wen<strong>de</strong>-Zeiten nur per Fähre erreicht wer<strong>de</strong>n konnte, weil sie am En<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r DDR begrenzt<br />
wur<strong>de</strong>. Südlich <strong>de</strong>r Priwallhalbinsel, <strong>de</strong>r Ostsee abgewandt, liegt die Pötenitzer Wiek, eine große Bucht <strong>de</strong>r Trave, die aufgrund ihrer Grenznähe als artenreiches Gebiet konserviert<br />
wer<strong>de</strong>n konnte. In Travemün<strong>de</strong> liegt <strong>de</strong>r Skandinavienkai, <strong>de</strong>r größte Ostseefährhafen Deutschlands. Von dort fahren Fähren in viele Ostseehäfen wie Trelleborg, Helsinki und Klaipėda.<br />
Nachbargemein<strong>de</strong>n<br />
Folgen<strong>de</strong> Gemein<strong>de</strong>n, die mit Ausnahme von drei Gemein<strong>de</strong>n, die in Mecklenburg-Vorpommern liegen, alle <strong>zu</strong> Schleswig-Holstein gehören, grenzen an die Stadt Lübeck:<br />
• Landkreis Nordwestmecklenburg in Mecklenburg-Vorpommern: Stadt Dassow (Ortsteil Pötenitz), Selmsdorf und Lü<strong>de</strong>rsdorf (alle Amt Schönberger Land)<br />
• Kreis Herzogtum Lauenburg: Groß Grönau und Groß Sarau (bei<strong>de</strong> Amt Lauenburgische Seen), Klempau, Krummesse, Ron<strong>de</strong>shagen und Bliestorf (alle Amt Berkenthin) sowie<br />
Groß Schenkenberg (Amt San<strong>de</strong>sneben)<br />
• Kreis Stormarn: Klein Wesenberg, Wesenberg, Hamberge, Ba<strong>de</strong>ndorf, Heilshoop und Mönkhagen (alle Amt Nordstormarn)<br />
• Kreis Ostholstein: Stockelsdorf (amtsfreie Gemein<strong>de</strong>), Bad Schwartau (amtsfreie Stadt) sowie Ratekau und Timmendorfer Strand (bei<strong>de</strong>s amtsfreie Gemein<strong>de</strong>n)<br />
Die Kreise Herzogtum Lauenburg und Stormarn gehören bereits <strong>zu</strong>r Europäischen Metropolregion Hamburg. Lübeck als Oberzentrum bil<strong>de</strong>t aus Sicht <strong>de</strong>r Raumordnung mit<br />
Stockelsdorf, Bad Schwartau, Ratekau und Groß Grönau eine Agglomeration, auch in <strong>de</strong>n mecklenburgischen Nachbargemein<strong>de</strong>n entwickelt sich durch das För<strong>de</strong>rgefälle ein<br />
Speckgürtel. Mit <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Krummesse bestehen in Deutschland einmalige, bizarre Grenzverhältnisse; die Gemein<strong>de</strong> Krummesse hat hierdurch bedingt die längste Gemein<strong>de</strong>grenze<br />
Deutschlands bezogen auf ihr Gemein<strong>de</strong>gebiet. In <strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Agglomeration wohnen in etwa weitere 70.000 Einwohner, so dass <strong>de</strong>r Ballungsraum Lübeck etwa 283.000<br />
Einwohner hat.<br />
Geschichte<br />
Frühe Geschichte<br />
Der etwa <strong>zu</strong>r Zeit Karls <strong>de</strong>s Großen (748–814) von Slawen gegrün<strong>de</strong>te Ort Liubice („die Liebliche“) gilt als Namensgeber <strong>de</strong>s heutigen Lübeck. Seit <strong>de</strong>m 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt war Liubice<br />
neben Ol<strong>de</strong>nburg in Holstein die wichtigste Siedlung <strong>de</strong>r Abodriten. Wahrscheinlich war Liubice bereits in dieser Zeit burgartig befestigt. Nach <strong>de</strong>r <strong>de</strong>ndrochronologisch auf das Jahr 819<br />
bestimmten Gründung <strong>de</strong>r Burg [4] wur<strong>de</strong> Liubice erstmals um das Jahr 1076 von Adam von Bremen [5] erwähnt. In <strong>de</strong>r heutigen Lage auf <strong>de</strong>m Hügel Buku, wur<strong>de</strong> die Stadt Lübeck
1143 durch Adolf II., Graf von Schauenburg und Holstein als erste <strong>de</strong>utsche Hafenstadt an <strong>de</strong>r Ostsee neu gegrün<strong>de</strong>t, nach<strong>de</strong>m sie 1127 nie<strong>de</strong>rgebrannt wor<strong>de</strong>n war. 1150 wur<strong>de</strong> von<br />
Heinrich das Bistum Ol<strong>de</strong>nburg nach Lübeck verlegt.<br />
Die Zeit <strong>de</strong>r Hanse<br />
1160 erhielt Lübeck das Soester Stadtrecht. Dieser Zeitpunkt wird heute von Historikern als <strong>de</strong>r Beginn <strong>de</strong>r Kaufmannshanse (im Gegensatz <strong>zu</strong>r späteren Städtehanse) angesehen.<br />
Wichtigstes Argument für diese Position stellt dabei das Artlenburger Privileg von 1161 dar, in <strong>de</strong>m Lübecker Kaufleute <strong>de</strong>n bisher im Ostseehan<strong>de</strong>l dominieren<strong>de</strong>n gotländischen<br />
Kaufleuten rechtlich gleichgestellt wer<strong>de</strong>n sollten. Kurz darauf erlangte Lübeck im Juni 1226 von Kaiser Friedrich II. mit <strong>de</strong>m Reichsfreiheitsbrief die Reichsfreiheit, wur<strong>de</strong> also<br />
reichsunmittelbare Stadt.<br />
Nach<strong>de</strong>m 1361 Wisby, <strong>de</strong>r erste Hauptort <strong>de</strong>r Hanse, vom dänischen König Wal<strong>de</strong>mar IV. Atterdag erobert wor<strong>de</strong>n war, wur<strong>de</strong> Lübeck <strong>zu</strong>m neuen Hauptort <strong>de</strong>r Hanse (auch Königin <strong>de</strong>r<br />
Hanse genannt), die sich im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong>r Städtehanse gewan<strong>de</strong>lt hatte. Lübeck entwickelte sich in Folge <strong>zu</strong>r zeitweise wichtigsten Han<strong>de</strong>lsstadt im nördlichen Europa. Es entstand<br />
<strong>de</strong>r Verband <strong>de</strong>r wendischen Städte unter Lübecks Führung. Kaiser Ludwig <strong>de</strong>r Bayer verlieh Lübeck 1340 das Goldmünzrecht. 1356 fand <strong>de</strong>r erste allgemeine Hansetag in Lübeck statt.<br />
Mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Stralsund erreichte Lübeck <strong>de</strong>n Höhepunkt seiner Macht im Ostseeraum. Im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt war Lübeck neben Köln und Mag<strong>de</strong>burg eine <strong>de</strong>r größten Städte <strong>de</strong>s<br />
Reiches.<br />
Lübecks Rolle als führen<strong>de</strong> Han<strong>de</strong>lsmacht in <strong>de</strong>r Ostsee wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n ersten Jahrzehnten <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong>nehmend durch nie<strong>de</strong>rländische Kaufleute gefähr<strong>de</strong>t, die unter<br />
Umgehung <strong>de</strong>r Lübecker Stapels direkt die Städte im östlichen Teil <strong>de</strong>r Ostsee ansteuerten. Nach<strong>de</strong>m Friedrich I. nicht bereit war, Lübeck als Lohn für seine Hilfe bei <strong>de</strong>r<br />
Gefangennahme Christian II. 1532 die Sundschlösser <strong>zu</strong> überlassen, versuchte Jürgen Wullenwever mit militärischen Mitteln, die alte Vormachtstellung im Ostseeraum<br />
wie<strong>de</strong>rher<strong>zu</strong>stellen und die Grafenfeh<strong>de</strong> <strong>zu</strong> Gunsten Lübecks <strong>zu</strong> beeinflussen. Zur Finanzierung seiner militärischen Abenteuer ließ er unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>n Kirchenschatz einschmelzen.<br />
Doch er scheiterte dramatisch, musste 1535 die Stadt verlassen, wur<strong>de</strong> vom Erzbischof von Bremen gefangen genommen und 1537 hingerichtet. Damit war Lübecks Zeit als „Königin<br />
<strong>de</strong>r Hanse“ endgültig vorüber. Und auch die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Hanse schwand.<br />
Im Dreißigjährigen Krieg gelang es Lübeck, neutral <strong>zu</strong> bleiben. 1629 wur<strong>de</strong> hier <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong> von Lübeck zwischen <strong>de</strong>n kaiserlichen Truppen und König Christian IV. von Dänemark<br />
geschlossen. Im Zuge <strong>de</strong>r Vorbereitungen für einen umfassen<strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>nskongress während <strong>de</strong>r Verhandlungen über die Hamburger Präliminarien 1641 waren auch die bei<strong>de</strong>n Städte<br />
Hamburg und Lübeck als Kongressorte im Gespräch. An <strong>de</strong>n Verhandlungen und <strong>de</strong>m Abschluss <strong>de</strong>s Westfälischen Frie<strong>de</strong>ns waren die Hansestädte durch <strong>de</strong>n späteren Lübecker<br />
Bürgermeister David Gloxin vertreten. Der letzte Hansetag fand 1669 in Lübeck statt. Die drei Städte Lübeck, Hamburg und Bremen wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> Sachwaltern <strong>de</strong>r Hanse und ihres<br />
Restvermögens eingesetzt.<br />
Der Siebenjährige Krieg verlief dank <strong>de</strong>r diplomatischen Beziehungen <strong>de</strong>s Lübecker Stadtkommandanten Graf Chasot ohne größeren Scha<strong>de</strong>n für die Stadt. Mit <strong>de</strong>m<br />
Reichs<strong>de</strong>putationshauptschluss 1803 blieb Lübeck noch reichsunmittelbare Stadt, um dann mit Fortfall <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches 1806 ein souveräner <strong>de</strong>utscher Staat <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n.<br />
Von 1811 bis 1813 fand sich Lübeck in Folge <strong>de</strong>r für Blücher vernichten<strong>de</strong>n Schlacht bei Lübeck wi<strong>de</strong>r Willen vorübergehend als Teil <strong>de</strong>s französischen Kaiserreiches wie<strong>de</strong>r.<br />
1815 wur<strong>de</strong> Lübeck auf <strong>de</strong>m Wiener Kongress als Freie und Hansestadt Lübeck völkerrechtlich souveränes Mitglied <strong>de</strong>s Deutschen Bun<strong>de</strong>s. Gesandtschaften und Konsulate wur<strong>de</strong>n<br />
<strong>zu</strong>meist gemeinsam mit <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Schwesterstädten Bremen und Hamburg in wichtigen Haupt- und Hafenstädten unterhalten. Die hanseatischen Ministerresi<strong>de</strong>nten wie Vincent<br />
Rumpff in Paris o<strong>de</strong>r James Colquhoun in London, <strong>zu</strong>gleich auch <strong>de</strong>r letzte hanseatische Stalhofmeister verhan<strong>de</strong>lten die völkerrechtlichen Verträge mit <strong>de</strong>n wichtigsten<br />
Han<strong>de</strong>lspartnern. Das Postwesen betrieb je<strong>de</strong> Stadt für sich. Die Stadt wur<strong>de</strong> durch ihre Erneuerungsbewegung Jung-Lübeck und <strong>de</strong>n Germanistentag <strong>de</strong>s Jahres 1847 <strong>zu</strong> einem<br />
wichtigen Symbolort <strong>de</strong>s Vormärz, überstand aber aufgrund <strong>de</strong>r weitvorangeschrittenen Vorbereitung einer neuen Verfassung das Revolutionsjahr 1848 ohne größere Unruhen.<br />
Neuzeit und Mo<strong>de</strong>rne<br />
Lübeck trat 1866 <strong>de</strong>m Nord<strong>de</strong>utschen Bund sowie 1868 <strong>de</strong>m Zollverein bei und wur<strong>de</strong> 1871 Gliedstaat <strong>de</strong>s Deutschen Reiches; damit en<strong>de</strong>t die seit 1806 bestehen<strong>de</strong> völkerrechtliche<br />
Souveränität Lübecks. Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts setzte die Industrialisierung ein. Die Bevölkerungszahl wuchs rapi<strong>de</strong> und die Vorstädte breiteten sich mit Aufhebung <strong>de</strong>r<br />
Torsperre im Jahr 1864 aus. 1895 wur<strong>de</strong> die Deutsch-Nordische Han<strong>de</strong>ls- und Industrie-Ausstellung in Lübeck abgehalten, für die Bürger <strong>de</strong>s kleinen Stadtstaates „ihre Weltausstellung“.
Anno 1897 bekam die Stadt ihr Infanterie-Regiment „Lübeck“ (3. Hanseatisches) Nr. 162. Im ersten Weltkrieg wur<strong>de</strong> es u. a. in <strong>de</strong>r Schlacht an <strong>de</strong>r Somme, <strong>de</strong>r Siegfriedstellung und<br />
<strong>de</strong>r Frühjahrsoffensive von 1918 eingesetzt.<br />
Der Zusammenbruch <strong>de</strong>s Kaiserreichs 1918 führte in Lübeck zwar als nächster Stadt nach Kiel <strong>zu</strong> einem Matrosenaufstand, jedoch in Lübeck als einzigem Staat <strong>de</strong>s Deutschen Reiches<br />
nicht <strong>zu</strong> revolutionären Verwerfungen durch die Novemberrevolution. Bürgermeister Emil Ferdinand Fehling und alle Senatoren blieben im Amt, aber bereits im gleichen Jahr kam es <strong>zu</strong><br />
einem neuen, zeitgemäßen Wahlrecht <strong>de</strong>s Staates und im Mai 1920 <strong>zu</strong> einer neuen, ersten <strong>de</strong>mokratischen Verfassung im mo<strong>de</strong>rnen Sinne.<br />
Hitler hat nie in Lübeck gesprochen. Die SPD hatte sämtliche Versammlungsräume in <strong>de</strong>r Stadt für <strong>de</strong>n Zeitraum <strong>de</strong>s geplanten Wahlkampfauftrittes, geplant war die Veranstaltung in<br />
Lübeck für <strong>de</strong>n 6. November 1932, angemietet. Da die Partei in die Waldhalle nach Bad Schwartau auswich, unterbrach ein SPD-Mann die Strom<strong>zu</strong>fuhr und die Partei war gezwungen,<br />
ihre Veranstaltung im Dunkeln ab<strong>zu</strong>halten. Der Groll bewegte Adolf Hitler dann da<strong>zu</strong>, dass die Freie und Hansestadt Lübeck als Vergeltung 1937 ihre Eigenstaatlichkeit verlor. Diese<br />
Legen<strong>de</strong> wird bei touristischen Führungen in <strong>de</strong>r Stadt erzählt. Um eine möglichst große Menge <strong>zu</strong> erreichen, fan<strong>de</strong>n die Veranstaltungen <strong>de</strong>r NSDAP jedoch unter freiem Himmel statt.<br />
Der Lübecker Marktplatz war, bedingt durch Brunnen, Baumreihe und Kaak, <strong>de</strong>r NSDAP <strong>zu</strong> klein, <strong>de</strong>r Alternativort, <strong>de</strong>r Buniamshof lag ihr <strong>zu</strong> weit abseits, ergo fiel die Wahl auf <strong>de</strong>n<br />
Sportplatz <strong>de</strong>s Riesebuschs in Bad Schwartau, wo die Veranstaltung am 26. Oktober 1932 stattfand.[6][7] Des Weiteren ist <strong>zu</strong> be<strong>de</strong>nken, dass die NSDAP <strong>zu</strong> jenem Zeitpunkt bereits die<br />
zweitstärkste Fraktion (nach <strong>de</strong>r SPD) im Lübecker Senat stellte.[8]<br />
Im März 1933 setzte die NSDAP in Lübeck die Gleichschaltung verbun<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m Rücktritt <strong>de</strong>s SPD-Bürgermeisters Paul Löwigt und <strong>de</strong>n weiteren sozial<strong>de</strong>mokratischen Senatoren<br />
durch und die <strong>de</strong>mokratischen Verfassungsprinzipien außer Kraft; Friedrich Hil<strong>de</strong>brandt, <strong>de</strong>r Reichsstatthalter für Mecklenburg und Lübeck, ernannte <strong>zu</strong>m 30. Mai seinen Stellvertreter,<br />
Otto-Heinrich Drechsler, <strong>zu</strong>m Bürgermeister. Die Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Nationalsozialisten mit <strong>de</strong>n <strong>de</strong>mokratischen Parteien führte <strong>zu</strong>r Verhaftung von Julius Leber am 1. Februar<br />
1933. Herbert Frahm (alias Willy Brandt) konnte sich <strong>de</strong>r Verfolgung nur durch seine Flucht nach Skandinavien entziehen. Durch das Groß-Hamburg-Gesetz verlor Lübeck 1937 seine<br />
711 Jahre alte territoriale Eigenständigkeit und wur<strong>de</strong> Teil <strong>de</strong>r preußischen Provinz Schleswig-Holstein.[9] In <strong>de</strong>r Nacht <strong>zu</strong>m Palmsonntag vom 28. März auf <strong>de</strong>n 29. März 1942 erfolgte<br />
<strong>de</strong>r Luftangriff auf Lübeck. Lübeck wur<strong>de</strong> damit <strong>zu</strong>r ersten <strong>de</strong>utschen Großstadt, die im Rahmen <strong>de</strong>r kurz <strong>zu</strong>vor erlassenen britischen Area Bombing Directive bombardiert wur<strong>de</strong>. Das<br />
Zielgebiet bil<strong>de</strong>te die dichtbewohnte mittelalterliche Altstadt. Bei <strong>de</strong>r Bombardierung wur<strong>de</strong>n insgesamt 320 Menschen getötet und 1.044 Gebäu<strong>de</strong> zerstört o<strong>de</strong>r beschädigt, unter ihnen<br />
die Marienkirche, die Petrikirche und <strong>de</strong>r Dom. Britische Truppen besetzten am 2. Mai 1945 Lübeck. Die Zerstörung Lübecks wur<strong>de</strong> durch <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Generalmajor Kurt Lottner<br />
vermie<strong>de</strong>n, in<strong>de</strong>m er die bereits angebrachten Sprengsätze an <strong>de</strong>n Brücken und Kaimauern entfernen ließ.[10]<br />
Nach 1945 vergrößerte sich Lübecks Einwohnerzahl durch Zu<strong>zu</strong>g von Flüchtlingen aus <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Ostgebieten erheblich. Es wur<strong>de</strong> Bestandteil <strong>de</strong>s von <strong>de</strong>n Alliierten gebil<strong>de</strong>ten<br />
Bun<strong>de</strong>slan<strong>de</strong>s Schleswig-Holstein, genoss aber im kulturpolitischen Bereich wie in <strong>de</strong>r Denkmalpflege einen Ausnahmestatus kommunaler Zuständigkeit. Die <strong>de</strong>utsche Teilung trennte<br />
Lübeck zwar vom mecklenburgischen Teil seines Hinterlan<strong>de</strong>s, verschaffte aber an<strong>de</strong>rerseits seinem Fährhafen Travemün<strong>de</strong> eine bevor<strong>zu</strong>gte Stellung im Fährverkehr zwischen<br />
Westeuropa und <strong>de</strong>n Ostseelän<strong>de</strong>rn Schwe<strong>de</strong>n und Finnland. Seit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Wie<strong>de</strong>rvereinigung ist Lübeck wie<strong>de</strong>r Oberzentrum auch für das westliche Mecklenburg.<br />
Am 18. Januar 1996 starben bei einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in <strong>de</strong>r Hafenstraße zehn Menschen, 30 wur<strong>de</strong>n schwer, 20 leicht verletzt. Die Tat konnte bis heute<br />
nicht aufgeklärt wer<strong>de</strong>n.<br />
Bevölkerung<br />
Einwohnerentwicklung<br />
Im Jahre 1911 überschritt die Einwohnerzahl <strong>de</strong>r Stadt die Grenze von 100.000, wodurch sie <strong>zu</strong>r Großstadt wur<strong>de</strong>. Bis 1945 verdoppelte sich diese Zahl auf 219.000. Im Jahre 1968<br />
erreichte die Bevölkerungszahl <strong>de</strong>r Stadt mit 243.121 ihren historischen Höchststand. Zukunftsforscher sagen für die weitere Entwicklung bis 2020 einen Einwohnerverlust von circa<br />
fünf bis sechs Prozent voraus. Im Gegensatz da<strong>zu</strong> gab es <strong>zu</strong>m Jahresen<strong>de</strong> 2008 einen Anstieg <strong>de</strong>r Zahl <strong>de</strong>r Einwohner auf 213.385.[11]<br />
Religionen<br />
Mission
Mit <strong>de</strong>m Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>r Stadt verlegte Heinrich <strong>de</strong>r Löwe 1160 <strong>de</strong>n Bischofssitz aus Ol<strong>de</strong>nburg (Holstein) hierher und stiftete <strong>de</strong>n Dom als Bischofskirche. Die persönliche Resi<strong>de</strong>nz<br />
<strong>de</strong>s Bischofs blieb in Eutin, das dadurch später <strong>zu</strong>m Zentrum <strong>de</strong>s Fürstbistums Lübeck wur<strong>de</strong>.<br />
Reformation und Lutheraner<br />
Ab 1524 hielt die Reformation Ein<strong>zu</strong>g in <strong>de</strong>r Stadt (erste evangelische Predigt), und 1530/31 führte <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt eine neue Kirchenordnung von Johannes Bugenhagen ein. Danach<br />
war Lübeck über viele Jahre eine protestantische Stadt, die sich 1577 bei Abfassung <strong>de</strong>r Konkordienformel aktiv für <strong>de</strong>n orthodoxen Lutherismus, veröffentlicht 1580 im<br />
Konkordienbuch, entschied, was <strong>zu</strong> einer Abgren<strong>zu</strong>ng von <strong>de</strong>n umliegen<strong>de</strong>n Gebieten Holsteins führen und großen Einfluss auf die weitere Entwicklung <strong>de</strong>s Geisteslebens in <strong>de</strong>r Stadt<br />
haben sollte. Als Freie Reichsstadt hatte in Lübeck <strong>de</strong>r Senat das lan<strong>de</strong>sherrliche Kirchenregiment inne und konnte die kirchlichen Angelegenheiten selbst regeln. Die Verwaltung <strong>de</strong>r<br />
Evangelisch-Lutherischen Kirche in Lübeck erfolgte durch das Konsistorium, das jedoch eher ein kirchliches Gericht als eine Behör<strong>de</strong> war, sowie durch das Geistliche Ministerium, an<br />
<strong>de</strong>ssen Spitze bis 1796 ein Superinten<strong>de</strong>nt, dann ein Senior stand. 1921 erhielt die Lan<strong>de</strong>skirche eine neue Verfassung. 1933 fan<strong>de</strong>n in Lübeck Kirchenwahlen statt, die eine Mehrheit für<br />
die faschistischen Deutschen Christen erbrachte. Eine Opposition mit <strong>de</strong>m Ansatz eines Kirchenkampfes formierte sich erst im Laufe <strong>de</strong>s Jahres 1934. Diese Anhänger <strong>de</strong>r Bekennen<strong>de</strong>n<br />
Kirche um Axel Werner Kühl erkannten <strong>de</strong>n neugewählten Bischof Erwin Balzer nicht an. 1937 wur<strong>de</strong> zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n wi<strong>de</strong>rstreiten<strong>de</strong>n Bekenntnissen ein Kompromiss erzielt, <strong>de</strong>r<br />
je<strong>de</strong>r Seite die Koexistenz bis <strong>zu</strong>m Kriegsen<strong>de</strong> ermöglichte. 1948 wur<strong>de</strong> die Lübecker Kirche Gründungsmitglied <strong>de</strong>r EKD. 1977 schloss sie sich <strong>de</strong>r Nor<strong>de</strong>lbischen Evangelisch-<br />
Lutherischen Kirche an und wur<strong>de</strong> Sitz <strong>de</strong>s Sprengels Holstein-Lübeck dieser neuen Lan<strong>de</strong>skirche. Die Kirchengemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt gehören <strong>zu</strong>m Kirchenkreis Lübeck. Mit Elisabeth<br />
Haseloff erhielt Lübeck 1958 die erste Pastorin Deutschlands; Bärbel Wartenberg-Potter wur<strong>de</strong> 2001 dritte Bischöfin in Deutschland.<br />
Evangelische Freikirchen<br />
Bereits 1532 sie<strong>de</strong>lten sich in Lübeck Täufer an, die im 16. und 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt eine mennonitische Gemein<strong>de</strong> (Vereenigte vlaamse Doopsgesin<strong>de</strong> Gemejnte tot Lübeck) bil<strong>de</strong>ten. Die<br />
Gemein<strong>de</strong> bestand <strong>zu</strong> Beginn vor allem aus nie<strong>de</strong>rländischen Glaubensflüchtlingen. Auch Menno Simons hatte mit <strong>de</strong>r Mennokate eine letzte Wirkungsstätte in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r Stadt<br />
gefun<strong>de</strong>n. Die Mennonitengemein<strong>de</strong> konnte jedoch nicht offen in Erscheinung treten, da sie nicht vom Rat <strong>de</strong>r Stadt toleriert wur<strong>de</strong>,[12] außer<strong>de</strong>m war ihr das Begräbnis in Lübeck<br />
verboten, sie bestattete ihre Toten auf <strong>de</strong>r Südseite <strong>de</strong>s außerhalb <strong>de</strong>r Hansestadt befindlichen Friedhofes in Hamberge.[13] Nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg gab es wie<strong>de</strong>r Mennoniten in<br />
Lübeck, die sich 1950 <strong>zu</strong> einer neuen Gemein<strong>de</strong> <strong>zu</strong>sammen schlossen. Die Gemein<strong>de</strong> ist heute <strong>de</strong>r Arbeitsgemeinschaft Mennonitischer Gemein<strong>de</strong>n angeschlossen.<br />
Ab etwa 1849 fin<strong>de</strong>n sich in Lübeck Baptisten, die jedoch erst 1921 eine eigene Gemein<strong>de</strong> grün<strong>de</strong>ten. Inzwischen existieren vier Gemein<strong>de</strong>n mit insgesamt 500 Mitglie<strong>de</strong>rn. Die<br />
Gemein<strong>de</strong>n sind <strong>de</strong>m Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemein<strong>de</strong>n angeschlossen. Die Straße vor <strong>de</strong>r baptistischen Frie<strong>de</strong>nskirche wur<strong>de</strong> 1992 in Erinnerung an die ersten Lübecker<br />
Täufer in Täuferstraße umbenannt.[14] Die Methodisten begannen 1929 mit <strong>de</strong>r Mission in Lübeck und besitzen heute zwei Kirchengebäu<strong>de</strong> im Stadtgebiet.[15]<br />
Inzwischen gibt es auch eine Reihe weiterer evangelischer Freikirchen wie die Freie evangelische Gemein<strong>de</strong>, die Heilsarmee, die Siebenten-Tags-Adventisten o<strong>de</strong>r pfingstlerische<br />
Gemein<strong>de</strong>n wie die Agape-, Arche-, Ecclesia- o<strong>de</strong>r Salem-Gemein<strong>de</strong>. Diese sind <strong>de</strong>m Bund Freikirchlicher Pfingstgemein<strong>de</strong>n (Agape und Ecclesia), <strong>de</strong>m Mülheimer Verband (Arche)<br />
o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Gottes (Salem) angeschlossen.<br />
Evangelisch Reformierte<br />
1666 entstand in Lübeck eine reformierte Gemein<strong>de</strong>; hin<strong>zu</strong> kam 1689 eine französisch-reformierte Gemein<strong>de</strong>, die sich aus <strong>zu</strong>gewan<strong>de</strong>rten Hugenotten rekrutierte. Bei<strong>de</strong> Gemein<strong>de</strong>n<br />
vereinigten sich 1781 <strong>zu</strong>r „Evangelisch-Reformierten Kirchengemein<strong>de</strong> Lübeck“, welche 1926 <strong>de</strong>r Evangelisch-reformierten Lan<strong>de</strong>skirche <strong>de</strong>r Provinz Hannover beitrat. Das be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong><br />
klassizistische Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Reformierten Kirche in <strong>de</strong>r Königstraße wur<strong>de</strong> 1826 in Betrieb genommen.<br />
Katholiken nach <strong>de</strong>r Reformation<br />
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt zogen auch wie<strong>de</strong>r Katholiken in die Stadt. 1849 erhielten sie eine erste Rechtsordnung und 1888 wur<strong>de</strong> die erste katholische Kirche Lübecks, die Herz-Jesu-Kirche –<br />
heute Propsteikirche Herz-Jesu – gebaut. Weitere katholische Gemein<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt gegrün<strong>de</strong>t. Sie gehörten <strong>zu</strong>nächst <strong>zu</strong>m „Apostolischen Vikariat <strong>de</strong>r Nordischen<br />
Missionen“ und ab 1930 aufgrund <strong>de</strong>s Preußischen Konkordates von 1929 <strong>zu</strong>m Bistum Osnabrück. Aus <strong>de</strong>n nördlichen Gebieten dieses Bistums entstand 1993 das neue Erzbistum
Hamburg, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m die Stadt Lübeck nunmehr gehört. Offiziell errichtet wur<strong>de</strong> das Erzbistum Hamburg allerdings erst am 7. Januar 1995. Die Pfarrgemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt Lübeck gehören<br />
innerhalb <strong>de</strong>r Erzdiözese Hamburg <strong>zu</strong>m Dekanat Lübeck.<br />
Ju<strong>de</strong>n in Moisling und Lübeck<br />
Die ersten jüdischen Familien, die sich 1656 im Dorf Moisling – außerhalb <strong>de</strong>r Lübecker Landwehr gelegen – nie<strong>de</strong>rließen, waren vor <strong>de</strong>n Pogromen <strong>de</strong>s ukrainischen<br />
Kosakenaufstan<strong>de</strong>s (1648–1657) unter Hetman Bohdan Chmelnyzkyj aus <strong>de</strong>m multinationalen Großreich Polen-Litauen geflohen. Der Eigentümer von Dorf und Gut Moisling, <strong>de</strong>r<br />
Lübecker Bürgermeister Gotthard von Höveln (1603–1671), <strong>de</strong>r die aschkenasischen Ju<strong>de</strong>n aus ökonomischen Erwägungen ansie<strong>de</strong>lte, stieß damit auf starken Wi<strong>de</strong>rstand bei Rat und<br />
Bürgerschaft, die bis dahin eine jüdische Ansiedlung sowohl im Lübecker Stadt- als auch Landgebiet verhin<strong>de</strong>rt hatten.<br />
Nach einer Eskalation <strong>de</strong>s Streits unterstellte von Höveln sein Dorf 1667 königlich-dänischer Territorialhoheit. Der Erbe, sein Schwiegersohn von Wicke<strong>de</strong>, erlangte 1686 und 1697 auf<br />
Grund königlicher Konzessionen das Nie<strong>de</strong>rlassungsrecht für Ju<strong>de</strong>n in Moisling und <strong>de</strong>ren unbeschränkte Han<strong>de</strong>ls- und Verkehrsfreiheit im dänischen Gesamtstaat. Doch die<br />
holsteinischen Landju<strong>de</strong>n bedurften, um <strong>de</strong>n täglichen Lebensunterhalt <strong>zu</strong> bestreiten, für ihre Han<strong>de</strong>lstätigkeit <strong>de</strong>s Lübecker Marktes. Der aber blieb ihnen bis 1852 weitgehend<br />
verschlossen.<br />
Zwischen 1702 und 1762 gehörte das Dorf gottorfischen beziehungsweise dänischen Eigentümern. Die autonome jüdische Zivil- und Zeremonialgerichtsbarkeit <strong>de</strong>s Unterrabbinats<br />
Moisling stand <strong>de</strong>m Altonaer Oberrabbiner <strong>zu</strong>. 1762 wur<strong>de</strong> das Dorf lübeckisches Privateigentum, so dass die Stadt ihre antijüdische Politik kontinuierlich durch<strong>zu</strong>setzen vermochte. Per<br />
Staatsvertrag zwischen Dänemark und Lübeck gelangte 1806 die Lan<strong>de</strong>shoheit über Moisling an die Reichsstadt, wodurch die nunmehr 300 rechtlosen Landju<strong>de</strong>n Lübecker<br />
Staatsangehörige wur<strong>de</strong>n; <strong>de</strong>ren ungeregelter Rechtsstatus blieb bis 1848 unverän<strong>de</strong>rt.<br />
Die in <strong>de</strong>r napoleonischen Phase (1811–1813) oktroyierte bürgerliche Gleichstellung <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n hatte <strong>zu</strong>r Folge, dass die Hälfte <strong>de</strong>r Moislinger jüdischen Gemein<strong>de</strong> nach Lübeck zog, wo<br />
1812 erstmals eine Synagoge eingeweiht wur<strong>de</strong>. 1814, nach <strong>de</strong>m Fall Napoleons und <strong>de</strong>m Rück<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r französischen Truppen, wi<strong>de</strong>rrief <strong>de</strong>r Senat die Gleichstellung. Nach jahrelangen<br />
gerichtlichen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen wur<strong>de</strong>n die Ju<strong>de</strong>n 1824 aus <strong>de</strong>m Stadtgebiet vertrieben und kehrten nach Moisling <strong>zu</strong>rück.<br />
Im abseitigen Moislinger Zwangsghetto ernährten sich die kontinuierlich verarmen<strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n hauptsächlich vom Hausierhan<strong>de</strong>l in benachbarten Territorien. Die traditionell gesetzestreue<br />
Moislinger Gemein<strong>de</strong> stellte 1825 einen altfrommen polnischen Rabbiner auf Lebenszeit an, konnte 1827 eine neue Synagoge weihen und 1837 eine Elementarschule einrichten. In <strong>de</strong>r<br />
internen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng um die Reform <strong>de</strong>s Ju<strong>de</strong>ntums obsiegten die Traditionalisten. Das Recht, sich in Lübeck nie<strong>de</strong>r<strong>zu</strong>lassen, erlangten die Ju<strong>de</strong>n 1848 im Laufe <strong>de</strong>r<br />
Märzrevolution. Die ökonomisch-soziale Emanzipation bekräftigte abschließend und unwi<strong>de</strong>rrufen ein 1852 verkün<strong>de</strong>tes Gesetz, ebenso wie die Zulässigkeit einer interkonfessionellen<br />
Eheschließung (Mischehe).[16] Nach<strong>de</strong>m 1850 eine Synagoge eröffnet wor<strong>de</strong>n war, wur<strong>de</strong> 1880 während <strong>de</strong>s Rabbinats von Salomon Carlebach (1845–1919) eine weitere, neu erbaute<br />
Synagoge in <strong>de</strong>r Lübecker St.-Annen-Straße fertiggestellt. Carlebach begrün<strong>de</strong>te die Rabbinerdynastie Carlebach, die in Deutschland, Großbritannien, <strong>de</strong>n USA und Israel vertreten ist.<br />
Die jüdische Bevölkerung in Lübeck stieg von 522 im Jahre 1857 auf 700 im Jahre 1913 und sank nach <strong>de</strong>r nationalsozialistischen Machtergreifung bis 1937 auf 250. Die letzten 85<br />
Ju<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n 1941-42 ins Ghetto Riga <strong>de</strong>portiert. Nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong> kurzfristig eine neue Gemein<strong>de</strong> gegrün<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>ren Mitglie<strong>de</strong>ranzahl sich 1948 auf 250 Personen<br />
belief, bis 1952 jedoch wie<strong>de</strong>r auf 30 sank. Seit <strong>de</strong>n Neunzigerjahren sind zahlreiche jüdische Kontingentflüchtlinge aus <strong>de</strong>r ehemaligen Sowjetunion hin<strong>zu</strong>gekommen.<br />
Sonstige Religionsgemeinschaften<br />
• Neuapostolische Kirche: Seit <strong>de</strong>m Jahr 1901 ist die Neuapostolische Kirche in Lübeck ansässig.<br />
• Orthodoxe Kirchen: Es bestehen eine russisch-orthodoxe und eine griechisch-orthodoxe Gemein<strong>de</strong>, bei<strong>de</strong> nutzten lange Jahre die Katharinenkirche für ihre Gottesdienste. Eine<br />
Seitenkapelle <strong>de</strong>r Kirche ist <strong>de</strong>m Heiligen Prokop von Lübeck geweiht.<br />
• Islam: Der Islam ist insbeson<strong>de</strong>re aufgrund <strong>de</strong>r zahlreichen türkischen Mitbürger in all seinen Facetten mit lebendigen Gemein<strong>de</strong>n und zahlreichen Bethäusern vertreten.<br />
Lübecker Märtyrer<br />
Von beson<strong>de</strong>rer Be<strong>de</strong>utung für die Ökumene in Lübeck ist das Ge<strong>de</strong>nken an die Lübecker Märtyrer. Die drei katholischen Priester Johannes Prassek, Hermann Lange und Eduard Müller
sowie <strong>de</strong>r evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink wur<strong>de</strong>n 1942 verhaftet, vom nationalsozialistischen Volksgerichtshof 1943 wegen „Rundfunkverbrechen, lan<strong>de</strong>sverräterischer<br />
Feindbegünstigung und Zerset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Wehrkraft“ <strong>zu</strong>m To<strong>de</strong> verurteilt und am 10. November 1943 in Hamburg durch Enthaupten hingerichtet.<br />
Friedhöfe<br />
• Ehrenfriedhof<br />
• Vorwerker Friedhof (1906) von Erwin Barth<br />
Politik<br />
Bürgermeister<br />
Die Leitung <strong>de</strong>r Stadt Lübeck oblag über Jahrhun<strong>de</strong>rte <strong>de</strong>m Rat <strong>de</strong>r Stadt mit <strong>de</strong>m o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Bürgermeistern an <strong>de</strong>r Spitze. Anfang <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Rat mit Senat<br />
bezeichnet. Dieser hatte 16 Senatoren und vier Bürgermeister, wobei die bei<strong>de</strong>n ältesten sich im Vorsitz jährlich ablösten. Ab 1848 gab es nur noch zwei Bürgermeister. Sie waren<br />
lediglich Vorsitzen<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Senats, nicht aber „Staatsoberhaupt“ <strong>de</strong>r Freien Hansestadt Lübeck. Neben <strong>de</strong>m Senat gab es die „Bürgerschaft“ als „Parlament“. 1933 wur<strong>de</strong> die Bürgerschaft<br />
aufgelöst und <strong>de</strong>r Senat verkleinert. Vorsitzen<strong>de</strong>r war fortan <strong>de</strong>r „Oberbürgermeister“.<br />
Am 1. April 1937 wur<strong>de</strong> Lübeck im Zuge <strong>de</strong>s Groß-Hamburg-Gesetzes in die preußische Provinz Schleswig-Holstein eingeglie<strong>de</strong>rt, verlor damit seine staatliche Unabhängigkeit, also<br />
seine territoriale Souveränität. 1956 lehnte das Bun<strong>de</strong>sverfassungsgericht eine Beschwer<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Vaterstädtischen Vereinigung Lübeck, die einen Volksentscheid über die Wie<strong>de</strong>rerlangung<br />
<strong>de</strong>r Souveränität erreichen wollte, im sogenannten Lübeck-Urteil ab.<br />
Nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong> Schleswig-Holstein Teil <strong>de</strong>r britischen Besat<strong>zu</strong>ngszone. Die Militärregierung führte 1946 eine zweigleisige Verwaltungsspitze ein. Danach gab es<br />
<strong>zu</strong>nächst einen Bürgermeister als Vorsitzen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r „Bürgerschaft“ und daneben einen Oberstadtdirektor als Leiter <strong>de</strong>r Verwaltung. Auf die erst seit 1933 geführte Amtsbezeichnung<br />
Oberbürgermeister für <strong>de</strong>n Vorsitzen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Bürgerschaft wur<strong>de</strong> verzichtet, weil <strong>de</strong>r Titel Bürgermeister in Lübeck eine lange Tradition hat. Die schleswig-holsteinische<br />
Gemein<strong>de</strong>ordnung von 1950 übertrug <strong>de</strong>n Titel „Bürgermeister“ <strong>de</strong>m Leiter <strong>de</strong>r Verwaltung und führte für <strong>de</strong>n Vorsitzen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Bürgerschaft wie bei allen größeren Städten Schleswig-<br />
Holsteins die neue Bezeichnung Stadtpräsi<strong>de</strong>nt ein. Lübecker Bürgermeister ist seit 2000 Bernd Saxe von <strong>de</strong>r SPD; Stadtpräsi<strong>de</strong>ntin ist seit 2008 Gabriele Schopenhauer von <strong>de</strong>r SPD.<br />
Bei <strong>de</strong>r Bürgermeisterwahl (amtliches En<strong>de</strong>rgebnis in Klammern) am 4. September 2005 traf Sozial<strong>de</strong>mokrat Bernd Saxe (47,2 %) auf vier konkurrieren<strong>de</strong> Herausfor<strong>de</strong>rer. Der<br />
Herausfor<strong>de</strong>rer <strong>de</strong>r CDU war Michael Koch (24,0 %). Zu<strong>de</strong>m stellten sich noch Susanne Hilbrecht von Bündnis 90/Die Grünen (4,6 %) sowie die parteilosen Bewerber Gabriele Meißel<br />
(3,7 %) und Raimund Mildner (20,5 %) <strong>zu</strong>r Wahl. Da im ersten Wahlgang eine absolute Mehrheit <strong>de</strong>r abgegebenen Stimmen nötig ist, um die Wahl <strong>zu</strong> gewinnen, traten am 18.<br />
September 2005 Bernd Saxe und Michael Koch <strong>zu</strong>r Stichwahl um das Amt <strong>de</strong>s Bürgermeisters an. Aus dieser ging <strong>de</strong>r Amtsinhaber Bernd Saxe mit 62 % <strong>de</strong>r Stimmen als Sieger hervor.<br />
Bürgerschaft<br />
Im Mai 2008 wur<strong>de</strong> die Bürgerschaft im Rahmen <strong>de</strong>r Kommunalwahlen Schleswig-Holstein 2008 neu gewählt. Die CDU und die SPD mussten herbe Verluste verkraften, die SPD wur<strong>de</strong><br />
jedoch nach <strong>de</strong>m Debakel von 2003 wie<strong>de</strong>r stärkste Fraktion. Drittstärkste Kraft wur<strong>de</strong> Die Linke, gefolgt von <strong>de</strong>n Grünen, <strong>de</strong>r Bürgerinitiative Bürger für Lübeck, <strong>de</strong>r FDP und <strong>de</strong>r<br />
alternativen Wählerliste BUNT. Aufgrund von Überhangmandaten <strong>de</strong>r SPD und Ausgleichsmandaten hat die Bürgerschaft 60 Mitglie<strong>de</strong>r in sechs Fraktionen und <strong>zu</strong>sätzlich eine<br />
fraktionslose Abgeordnete.<br />
Wappen<br />
Blasonierung: „In Gold ein rot bewehrter schwarzer Doppeladler mit einem von Silber und Rot geteilten Brustschild. Im großen Wappen halten zwei gol<strong>de</strong>ne Löwen <strong>de</strong>n Schild; auf<br />
diesem ein Helm mit einköpfigem schwarzem Adler als Zier und silbern-roten Decken.“[17]<br />
Das Lübecker Wappen stammt aus <strong>de</strong>m Jahre 1450 und ist damit das älteste Stadtwappen Schleswig-Holsteins. Bei <strong>de</strong>m Doppeladler han<strong>de</strong>lt es sich um <strong>de</strong>n „Reichsadler“ als Symbol
<strong>de</strong>r ehemaligen Reichsfreiheit <strong>de</strong>r Stadt Lübeck, welche die Stadt bis 1937 genoss, als sie durch das Groß-Hamburg-Gesetz <strong>de</strong>r preußischen Provinz Schleswig-Holstein eingeglie<strong>de</strong>rt<br />
wur<strong>de</strong>.<br />
Flagge<br />
Blasonierung: „Von Weiß und Rot geteilt. Im weißen Feld unmittelbar neben <strong>de</strong>r Stange ein schwarzer, rotbewehrter Doppeladler mit weiß-rot geteiltem Herzschild auf <strong>de</strong>r Brust.“[17]<br />
Die Stadtfarben sind wie bei allen Hanseflaggen Weiß-Rot.<br />
Städtepartnerschaften<br />
• Kotka (Finnland), seit 1969<br />
• Wismar (Deutschland, Mecklenburg-Vorpommern), seit 1987<br />
• La Rochelle (Frankreich), seit 1988, Freundschaftsvertrag bereits seit 1980<br />
• Klaipėda/Memel (Litauen), seit 1990<br />
• Visby (Schwe<strong>de</strong>n), seit 1999<br />
Freundschafts- und Kooperationsverträge bestehen mit:<br />
• Venedig (Italien), seit 1979<br />
• Kawasaki (Japan), seit 1992<br />
• Bergen (Norwegen), seit 1996<br />
• Shaoxing (China), seit 2003<br />
Darüber hinaus unterhält Lübeck freundschaftliche Beziehungen mit mehr als 100 an<strong>de</strong>ren europäischen Städten, die regelmäßig an <strong>de</strong>n Hansetagen <strong>de</strong>r Neuzeit teilnehmen.<br />
Wirtschaft und Infrastruktur<br />
Hafen<br />
Der Lübecker Hafen ist <strong>de</strong>r größte <strong>de</strong>utsche Ostseehafen. Er verbin<strong>de</strong>t Lübeck mit Skandinavien, Russland und <strong>de</strong>m Baltikum. Zahlreiche Fährlinien verbin<strong>de</strong>n die Lübecker Häfen mit<br />
<strong>de</strong>m gesamten Ostseeraum. Im Jahr 2007 wur<strong>de</strong> 32,6 Millionen Tonnen Waren umgeschlagen und über 350.000 Passagiere abgefertigt.<br />
Der Skandinavienkai im Stadtteil Travemün<strong>de</strong> ist mit etwa 100 regelmäßigen Abfahrten pro Woche <strong>de</strong>r größte Fährhafen Deutschlands: Passagiere und Fracht wer<strong>de</strong>n von hier aus nach<br />
Schwe<strong>de</strong>n, Finnland und ins Baltikum beför<strong>de</strong>rt.<br />
Der Nordlandkai ist Umschlaghafen für Papier, Trailer, Container und Neufahrzeuge. Die Ree<strong>de</strong>reien Finnlines und Transfennica sind stark am Nordlandkai vertreten. Die Translumi-<br />
Line unterhält Verbindungen nach Kemi und Oulu (Finnland) und transportiert überwiegend SECU-Boxen, die wetterunabhängiges Löschen und La<strong>de</strong>n von Papiererzeugnissen<br />
ermöglichen. Gelegentlich machen am ATR-Getrei<strong>de</strong>silo größere Überseeschiffe fest, die Getrei<strong>de</strong> für Fernost o<strong>de</strong>r Südostasien la<strong>de</strong>n.<br />
Der „Konstinkai“ war Hauskai <strong>de</strong>r Transfennica-Ree<strong>de</strong>rei, die rollen<strong>de</strong> Ladung und Papier von/<strong>zu</strong> finnischen Häfen beför<strong>de</strong>rt. Nach einer Umstrukturierung wird <strong>de</strong>r stadtnahe Terminal<br />
jetzt wie<strong>de</strong>r für Papier- und Hol<strong>zu</strong>mschlag genutzt. Außer<strong>de</strong>m gibt es zwei Abfahrten pro Woche nach Russland.<br />
Der Seelandkai ist neuer „Hauskai“ <strong>de</strong>r Transfennica-Ree<strong>de</strong>rei. Er wur<strong>de</strong> 2006 in Betrieb genommen und verfügt unter an<strong>de</strong>rem über zwei Containerbrücken.<br />
Seit 1994 in Betrieb ist <strong>de</strong>r Schlutupkai, an <strong>de</strong>m hauptsächlich Papier und Zellulose aus Schwe<strong>de</strong>n angelan<strong>de</strong>t wird.
Unmittelbar südlich vom Konstinkai ist <strong>de</strong>r Burgtorkai, <strong>de</strong>r früher als Kreuzfahrtterminal diente. Durch die neue Travequerung Nordtangente können große Schiffe <strong>de</strong>n Burgtorkai nicht<br />
mehr anlaufen.<br />
In privater Hand sind die Lehmannkais I–III <strong>de</strong>r Lübecker Firma Hans Lehmann KG, die Anfang 2004 das Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r ehemaligen Flen<strong>de</strong>r-Werft da<strong>zu</strong> gekauft hat, um drei o<strong>de</strong>r vier<br />
RoRo-Anleger <strong>zu</strong> bauen. Sie will mit <strong>de</strong>m Partner DFDS weitere Fährlinien in <strong>de</strong>n russischen und baltischen Raum akquirieren. Ein ähnliches Ziel verfolgt die städtische Lübecker<br />
Hafengesellschaft (LHG) mit <strong>de</strong>n Flächen am danebenliegen<strong>de</strong>n Seelandkai. Zwischen Seelandkai und Lehmannkai I betrieb die Hamburger Hafen und Logistik AG (HHLA) durch ihre<br />
damalige Tochter Combisped bis Sommer 2009 das mo<strong>de</strong>rne Containerterminal-Lübeck (CTL) mit Containerbrücken <strong>zu</strong>r Bahn-Verladung in Richtung <strong>de</strong>r Containerterminals im<br />
Hamburger Hafen. Zum 1.Mai 2010 übernimmt das Gelän<strong>de</strong> ebenfalls die Hans Lehmann KG, die <strong>de</strong>n Terminal <strong>zu</strong>künftig als CTL Cargo-Terminal Lehmann betreiben will. Die<br />
Containerbrücken wer<strong>de</strong>n <strong>de</strong>mnächst abgebaut, da Lehmann diese nicht mit übernommen hat.<br />
Am Ostpreußenkai vor <strong>de</strong>r Travemün<strong>de</strong>r Hafenpromena<strong>de</strong> „Vor<strong>de</strong>rreihe“ legen Kreuzfahrtschiffe und Großsegler an.<br />
Die stadtnahen Häfen Hansekai und Rod<strong>de</strong>nkoppelkai wer<strong>de</strong>n heut<strong>zu</strong>tage kaum noch für die gewerbliche Seeschifffahrt genutzt. Am Rod<strong>de</strong>nkoppelkai legt mehrmals monatlich ein<br />
Holztransporter an, <strong>de</strong>r Hansekai dient allenfalls Binnenschiffen o<strong>de</strong>r Kurzzeit-Aufliegern als Liegeplatz.<br />
Elbe-Lübeck-Kanal<br />
Der Elbe-Lübeck-Kanal ist für Lübecks Hafenwirtschaft nur von untergeordneter Be<strong>de</strong>utung, weil er seit Jahrzehnten nicht mo<strong>de</strong>rnisiert wur<strong>de</strong>, so dass er wohl noch für <strong>de</strong>n<br />
Freizeitverkehr, nicht aber mehr für heutigen Frachtverkehr attraktiv ist.<br />
Museumshafen Lübeck<br />
Direkt vor <strong>de</strong>r Lübecker Altstadt im eigentlichen Hansahafen an <strong>de</strong>r Untertrave ist <strong>de</strong>r Museumshafen Lübeck beheimatet. Viele alte Lastensegler <strong>de</strong>r Ostsee haben hier ihre Liegeplätze<br />
und sind im Museumshafen <strong>zu</strong> Lübeck e.V. organisiert. Da viele Schiffe noch seetüchtig sind und regelmäßig auslaufen, ist <strong>de</strong>r Hafen im Winter besser als im Sommer gefüllt.<br />
Der Lübecker Hafen beherbergt <strong>zu</strong><strong>de</strong>m weitere traditionelle Schiffe wie das Feuerschiff Fehmarnbelt, die Kraweel Lisa von Lübeck und <strong>de</strong>n Gaffelschoner Krik Vig.<br />
Unternehmen<br />
Früher in Lübeck ansässige Schwerindustrie ist nahe<strong>zu</strong> verschwun<strong>de</strong>n. Von 1905 bis 1981 bestand in Lübeck ein großes Hüttenwerk, das Hochofenwerk Lübeck. Auch <strong>de</strong>r einst<br />
be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Schiffbau (Flen<strong>de</strong>r-Werke, Orenstein & Koppel) wur<strong>de</strong> ein Opfer <strong>de</strong>s Strukturwan<strong>de</strong>ls. Im Spezialmaschinenbau ist die Firma Nordischer Maschinenbau Rud. Baa<strong>de</strong>r als<br />
Hersteller von Fischverarbeitungsmaschinen bekannt.<br />
In Lübeck haben einige Branchen eine beson<strong>de</strong>re Tradition, so die Medizintechnik, begünstigt auch durch die Universität <strong>zu</strong> Lübeck. Größter Arbeitgeber in diesem Bereich ist die<br />
Drägerwerk AG, von <strong>de</strong>r unter an<strong>de</strong>rem Narkose- und Atemschutzgeräte hergestellt wer<strong>de</strong>n. Ein weiteres be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>s medizintechnisches Unternehmen ist Euroimmun, ein Hersteller<br />
von Laborkits <strong>zu</strong>r Antikörperdiagnostik.<br />
Größter Arbeitgeber mit Sitz in Lübeck ist die Bockholdt Gruppe mit mehr als 4300 Arbeitnehmern. Bockholdt ist einer <strong>de</strong>r großen <strong>de</strong>utschen Systemdienstleister in <strong>de</strong>n Bereichen<br />
Gebäu<strong>de</strong>service und Industrieservice.<br />
Eine an<strong>de</strong>re wichtige Branche ist die Lebensmittelindustrie, so <strong>zu</strong>m Beispiel Nie<strong>de</strong>regger, <strong>de</strong>r bekannteste Hersteller von Lübecker Marzipan, außer<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Suppenhersteller Campbell's<br />
Germany, <strong>de</strong>r die Erasco-Gruppe übernommen hat, und <strong>de</strong>r größte <strong>de</strong>utsche Fischkonservenhersteller Hawesta. Im Bereich <strong>de</strong>s Hafens hat sich <strong>de</strong>r Cerealienhersteller H. & J. Brüggen<br />
nie<strong>de</strong>rgelassen. Nur knapp außerhalb <strong>de</strong>r Stadtgrenze befin<strong>de</strong>n sich die Schwartauer Werke, auf <strong>de</strong>ren Marmela<strong>de</strong>ngläsern die Lübecker Kirchtürme abgebil<strong>de</strong>t sind. Die Konditorei<br />
Junge ist unter ihrem Label Stadtbäckerei Junge bekannt.<br />
Lübecker Bier wur<strong>de</strong> seit <strong>de</strong>m 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt vornehmlich in <strong>de</strong>n Ostseeraum exportiert. Die größte Brauerei war die Brauerei Lück, die 1988 geschlossen wur<strong>de</strong>.
Weitere in <strong>de</strong>r Stadt ansässige Unternehmen sind die Firmengruppe Possehl, die in verschie<strong>de</strong>nen Branchen tätig ist, die Lübecker Hafengesellschaft, die Lübecker Nachrichten und die<br />
Greater Union Filmpalast GmbH. Außer<strong>de</strong>m erwähnenswert sind die Firmen Schmidt-Römhild (Deutschlands ältestes Verlagshaus seit 1579) sowie Carl Tesdorpf, Deutschlands ältestes<br />
Weinhan<strong>de</strong>lshaus seit 1678, bei<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Mengstraße in <strong>de</strong>r Altstadt ansässig. Der Schöning-Verlag ist <strong>de</strong>r Marktführer für Ansichtskarten in Deutschland. Der Finanzdienstleister Dr.<br />
Klein & Co. AG, ursprünglich ein Vermittler von Kommunalfinanzierungen ist Marktführer in <strong>de</strong>r Vermittlung von Immobilienfinanzierungen an <strong>de</strong>n Endverbraucher und die NEUE<br />
LÜBECKER e.G., Nord<strong>de</strong>utschlands größte Wohnungsbaugenossenschaft, vermietet Wohnungen sowohl in Lübeck als auch überregional.<br />
Wirtschaftsför<strong>de</strong>rung<br />
Die Wirtschaftsför<strong>de</strong>rung hat in Lübeck hanseatische Tradition und wird teilweise kommunal sowie auf Lan<strong>de</strong>sebene aber auch privatwirtschaftlich gelenkt. Dieser Dualismus ist für<br />
Existenzgrün<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>nen mehrere Grün<strong>de</strong>rzentren <strong>zu</strong>r Auswahl und im Wettbewerb untereinan<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>r Verfügung stehen von Vorteil. Technologiezentren bestehen in Herrenwyk, <strong>de</strong>n<br />
Media Docks, im Haus <strong>de</strong>r Kaufmannschaft und im neuen Hochschulstadtteil. Das unmittelbare Umland Lübecks in Mecklenburg im För<strong>de</strong>rgebiet bietet vor <strong>de</strong>m Hintergrund <strong>de</strong>r<br />
exzellenten Infrastruktur die weitere konkurrieren<strong>de</strong> Möglichkeit interessanter Kombinationen von Lebensqualität und För<strong>de</strong>rmitteln. Das För<strong>de</strong>rgefälle zwischen <strong>de</strong>n Kommunen <strong>de</strong>r<br />
Region führt politisch allerdings <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r einen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Missstimmung. Richtungweisend ist das erste Län<strong>de</strong>rgrenzen überschreiten<strong>de</strong> För<strong>de</strong>rprogramm Region Aktiv Lübecker<br />
Bucht.<br />
Einzelhan<strong>de</strong>l<br />
Von überregionaler Be<strong>de</strong>utung ist die Innenstadt, wo sich das Gros <strong>de</strong>r Lübecker Einzelhändler angesie<strong>de</strong>lt hat.<br />
Die Fußgängerzone erstreckt sich hauptsächlich über die Breite Straße zwischen Pfaffenstraße und Markt mit einigen sie kreuzen<strong>de</strong>n Rippenstraßen.[18] Der Einkaufsbereich für<br />
Fußgänger erweitert sich durch <strong>de</strong>n angrenzen<strong>de</strong>n Markt, <strong>de</strong>r lange Zeit fast eine kommerzielle Brache an zentraler Stelle war. Hier wur<strong>de</strong> Anfang 2005 ein Neubau mit einem großen<br />
Mo<strong>de</strong>kaufhaus eröffnet, <strong>de</strong>r architektonisch umstritten war. Auch am Übergang von <strong>de</strong>r Breiten Straße <strong>zu</strong>r Sandstraße erweitert die König Passage <strong>de</strong>n Einkaufsbereich für Fußgänger.<br />
Sie ist eine relativ gut ausgestattete La<strong>de</strong>npassage.<br />
Neben <strong>de</strong>r Breiten Straße haben sich in <strong>de</strong>r parallel verlaufen<strong>de</strong>n Königstraße sowie in <strong>de</strong>r Verlängerung <strong>de</strong>r Breiten Straße, <strong>de</strong>r Sandstraße, die meisten Einzelhändler nie<strong>de</strong>rgelassen. An<br />
dieser Stelle fin<strong>de</strong>n sich auch Kaufhäuser und größere Mo<strong>de</strong>geschäfte. An <strong>de</strong>r Stelle <strong>de</strong>s ehemaligen Kaufhauses Haer<strong>de</strong>r, das 2007 abgebrochen wur<strong>de</strong>, entstand in kurzer Bauzeit das<br />
Einkaufszentrum Haer<strong>de</strong>r-Center, das im Oktober 2008 eröffnet wur<strong>de</strong>.<br />
Weitere Geschäftsstraßen in <strong>de</strong>r Innenstadt sind die Holstenstraße, die Wahmstraße, die Mühlenstraße, die Große Burgstraße und die Untertrave. Beson<strong>de</strong>rs hervor<strong>zu</strong>heben sind aber die<br />
Verlängerungen <strong>de</strong>r Fußgängerzone in <strong>de</strong>r Fleischhauer- und noch mehr in <strong>de</strong>r Hüxstraße. In diesen Seitenstraßen befin<strong>de</strong>t sich ein einzigartiges Ensemble kleiner Lä<strong>de</strong>n, Restaurants<br />
und Galerien, hauptsächlich in mittelalterlichen Giebelhäusern. Ein innenstadtnahes Gewerbegebiet befin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Kanalstraße.<br />
Derzeit besitzt Lübeck mehrere Einkaufszentren. Der Citti-Park in Buntekuh ist das größte davon in unmittelbarer Nähe <strong>zu</strong>r A 1. Neu entstan<strong>de</strong>n sind das Mönkhof Karree im<br />
Hochschulstadtteil, die Lin<strong>de</strong>n-Arca<strong>de</strong>n direkt neben <strong>de</strong>m Hauptbahnhof sowie das Haer<strong>de</strong>r-Center im Zentrum.<br />
Klassische Gewerbegebiete gibt es ebenfalls in Buntekuh/St. Lorenz nahe <strong>de</strong>r A 1 (Gewerbegebiete Herrenholz, Grapengießerstraße, Roggenhorst), in St. Jürgen nahe <strong>de</strong>r A 20<br />
(Gewerbegebiet Geniner Straße) und in St. Gertrud (Gewerbegebiet Gleisdreieck, Glashüttenweg/An <strong>de</strong>r Hülshorst).<br />
Auf <strong>de</strong>m <strong>de</strong>rzeitigen Villeroy&Boch-Firmengelän<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Autobahnausfahrt Lübeck-Dänischburg entsteht bis <strong>zu</strong>m Jahre 2012 ein Wohn-Fachmarktzentrum mit insgesamt 60.000 m²<br />
Verkaufsfläche. Hier soll ein IKEA-Möbelhaus, ein Einkaufszentrum mit überwiegend skandinavischen Marken, ein Outlet-Store von Villeroy&Boch sowie ein Baumarkt entstehen.<br />
Verkehr<br />
Straßenanbindung<br />
Durch das westliche Stadtgebiet führt die Bun<strong>de</strong>sautobahn 1 Hamburg–Fehmarn, die als so genannte „Vogelfluglinie“ und E 47 weiter über <strong>de</strong>n Fehmarnbelt (Fähre) nach Kopenhagen
und über die Öresundverbindung nach Malmö in Schwe<strong>de</strong>n führt, also ein Bin<strong>de</strong>glied zwischen <strong>de</strong>r Metropolregion Hamburg und <strong>de</strong>r Öresundregion darstellt. An dieser Autobahn<br />
befin<strong>de</strong>n sich die Abfahrten Lübeck-Moisling und Lübeck-Zentrum. Im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt zweigt beim Autobahndreieck Bad Schwartau die Stadtautobahn A 226 in Richtung Lübeck-<br />
Travemün<strong>de</strong> und Fährhafen Skandinavienkai ab.<br />
Seit 2001 ist <strong>de</strong>r Lübecker Sü<strong>de</strong>n über die Anschlussstelle Lübeck-Genin an die Ostseeautobahn A 20 angeschlossen. Die neue Anschlussstelle Lübeck-Süd für <strong>de</strong>n Flughafen Lübeck-<br />
Blankensee wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r neuen B 207 erstellt und verkürzt die Anfahrt von außerhalb erheblich. Die A 20 ist seit <strong>de</strong>m 7. Dezember 2005 von Lübeck durch Mecklenburg-Vorpommern<br />
bis <strong>zu</strong>r polnischen Grenze bei Pomellen durchgängig befahrbar. Durch die neue Autobahnumgehung im Zuge <strong>de</strong>r A 20 ist für Lübeck eine erhebliche Entlastung <strong>de</strong>s Stadtzentrums wie<br />
<strong>de</strong>r B 75/B 104 im Bereich Siems/Schlutup/Selmsdorf eingetreten. Im Westen Lübecks soll die A 20 einmal nördlich und westlich um Hamburg herum führen und nördlich von<br />
Rotenburg an die A 1 (Bremen–Hamburg) angeschlossen wer<strong>de</strong>n. Die A 20 wird dann bei Bad Segeberg die A 21 nach Kiel kreuzen, so dass irgendwann einmal auch die bei<strong>de</strong>n größten<br />
Städte <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s durch eine Autobahn auf kurzem Wege verbun<strong>de</strong>n sein wer<strong>de</strong>n. Nach Beendigung <strong>de</strong>r Bauarbeiten am Autobahnkreuz Lübeck in Richtung Bad Segeberg wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
15,7 km lange Straßenabschnitt zwischen Lübeck und Geschendorf am 28. Juli 2009 in Betrieb genommen und führt <strong>zu</strong> weiteren Entlastungen im westlichen Stadtgebiet und in<br />
Stockelsdorf. Weitere wichtige Maßnahmen im Bereich <strong>de</strong>r Verkehrsinfrastruktur sind <strong>de</strong>r mautpflichtige Herrentunnel (Eröffnet am 26. August 2005) und die neue Travequerung <strong>de</strong>r<br />
Eric-Warburg-Brücke im Zuge <strong>de</strong>r Nordtangente sowie die Kreisstraße K 13 zwischen Lübeck und Stockelsdorf.<br />
Eisenbahn<br />
In Lübeck betreibt die Deutsche Bahn folgen<strong>de</strong> Bahnhöfe und Haltepunkte:<br />
• Lübeck Hauptbahnhof<br />
• Lübeck-St. Jürgen<br />
• Lübeck-Kücknitz<br />
• Lübeck-Travemün<strong>de</strong> Skandinavienkai<br />
• Lübeck-Travemün<strong>de</strong> Hafen<br />
• Lübeck-Travemün<strong>de</strong> Strand<br />
• Lübeck Flughafen<br />
Die Einrichtung <strong>de</strong>s folgen<strong>de</strong>n Haltepunktes befin<strong>de</strong>t sich im Planungsstadium[19]:<br />
• Lübeck-Hochschulstadtteil (Baubeginn 2011)[20]<br />
Von Seiten <strong>de</strong>r Politik und Presse wur<strong>de</strong> mehrfach gefor<strong>de</strong>rt, auf <strong>de</strong>n Lübecker Bahngleisen eine S-Bahn ein<strong>zu</strong>richten. Dies wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r aktuellen Streckenausschreibung für das<br />
Bahnnetz Ost als Option festgehalten. Ein Gutachten macht <strong>de</strong>n Einstieg in das S-Bahn-System von <strong>de</strong>n Passagierzahlen <strong>de</strong>s Flughafens Blankensee abhängig. Der Haltepunkt Lübeck-<br />
Flughafen wur<strong>de</strong> hierfür bereits mit Bauvorleistungen errichtet.<br />
Der Lübecker Hauptbahnhof ist seit <strong>de</strong>m 1. Oktober 2008 an das elektrische Streckennetz <strong>de</strong>r Deutschen Bahn angebun<strong>de</strong>n; das seit Jahren bestehen<strong>de</strong> Elektrifizierungsprojekt wur<strong>de</strong>,<br />
nach mehreren Investitionsstopps – nicht <strong>zu</strong>letzt wegen <strong>de</strong>s Maut<strong>de</strong>sasters, nun fertig gestellt. Die offizielle Eröffnung <strong>de</strong>r Elektrifizierung fand am 14. Dezember 2008 statt.<br />
Fern<strong>zu</strong>gverbindungen bestehen auf <strong>de</strong>r Vogelfluglinie Richtung Kopenhagen durch die Danske Statsbaner (DSB). Bis vor einigen Jahren bestehen<strong>de</strong> Fernverbindungen in östliche<br />
Richtungen wur<strong>de</strong>n eingestellt o<strong>de</strong>r wer<strong>de</strong>n nunmehr an Lübeck vorbei geführt. Seit <strong>de</strong>m Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2007 ist Lübeck an das <strong>de</strong>utsche ICE-Netz angeschlossen:<br />
spezielle Diesel-ICE bin<strong>de</strong>n Lübeck dabei über Hamburg nach Berlin an, in an<strong>de</strong>rer Richtung fahren sie auf <strong>de</strong>r Vogelfluglinie bis Kopenhagen. Diese Verbindung wird <strong>de</strong>n Eurocity<br />
langfristig ersetzen. Außer<strong>de</strong>m fährt je<strong>de</strong>n Freitag ein durchgehen<strong>de</strong>r Intercity nach Passau über Köln und Frankfurt am Main, während <strong>de</strong>r Sommermonate auch an <strong>de</strong>n Wochenen<strong>de</strong>n,<br />
dann aber nur bis Frankfurt. Weitere Fernverbindungen nach Abschluss <strong>de</strong>r Elektrifizierungsarbeiten wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r DB-Führung bereits in Aussicht gestellt. So verkehrt seit Dezember<br />
2008 täglich ein ICE-Paar zwischen Lübeck und München über Hannover, Kassel und Würzburg.<br />
Regionalzüge <strong>de</strong>r DB Regio fahren nach Hamburg, Lüneburg (auch Halt in Lübeck Flughafen), Bad Kleinen (auch Halt in Lübeck-Sankt Jürgen), Kiel, Neustadt in Holstein, Puttgar<strong>de</strong>n
und Lübeck-Travemün<strong>de</strong> Strand (mit Halt in Lübeck-Kücknitz, Lübeck-Travemün<strong>de</strong> Skandinavienkai und Lübeck-Travemün<strong>de</strong> Hafen). Für Fahrten an die Westküste Schleswig-<br />
Holsteins ist Umsteigen in Hamburg bzw. Kiel notwendig, was meist mit längeren Wartezeiten verbun<strong>de</strong>n ist. Die Strecke Hamburg–Lübeck ist in Schleswig-Holstein die Strecke mit <strong>de</strong>r<br />
höchsten Frequenz; die öffentliche Ausschreibung wur<strong>de</strong> durch die nun beschlossene Elektrifizierung auf Eis gelegt. Die schnellste und auch durchgehen<strong>de</strong> Verbindung zwischen<br />
Hamburg und Travemün<strong>de</strong> bestand vor <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg durch die Lübeck-Büchener Eisenbahn und später die Reichsbahn.<br />
Auf <strong>de</strong>r Strecke von Lübeck nach Hamburg wur<strong>de</strong>n Diesellokomotiven <strong>de</strong>r Baureihe 218, seit Sommer 2006 in Kombination mit Doppelstockwagen, genutzt. Diese Diesellokomotiven<br />
wer<strong>de</strong>n nun durch E-Loks ersetzt. Auf an<strong>de</strong>ren Strecken fahren u.a. Dieseltriebwagen <strong>de</strong>r Baureihe 628.<br />
Von 1945 bis 1990 war Lübeck Grenzbahnhof <strong>zu</strong>r SBZ bzw. DDR. Täglich fuhren ein bis zwei Interzonenzüge Richtung Bad Kleinen–Rostock.<br />
Öffentlicher Personennahverkehr<br />
Die Straßenbahn Lübeck wur<strong>de</strong> 1959 stillgelegt. Eine Reaktivierung als Stadtbahn ist immer wie<strong>de</strong>r im Gespräch. Beson<strong>de</strong>rs die Grünen setzten sich hierfür ein, da das System „Bus“<br />
aufgrund <strong>de</strong>r sehr starken Auslastung nicht mehr erweiterbar sei. Im städtischen Haushalt für das Jahr 2010 sind 120.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie <strong>zu</strong>r Einführung einer<br />
Stadtbahn eingeplant.[21] Von vielen Anwohnern wird bemängelt, dass die <strong>de</strong>rzeit eingesetzten Busse nicht unbedingt in ihrer Dimension <strong>de</strong>m Weltkulturerbe angepasst sind. Auch ist<br />
<strong>zu</strong>nehmend umstritten, ob wirklich je<strong>de</strong> Buslinie als Durchmesserlinie quer durch die mittelalterliche Altstadt geführt wer<strong>de</strong>n muss o<strong>de</strong>r ob nicht Ringlinien um die Altstadt herum<br />
sinnvoller seien. Hauptbetreiber ist die Stadtverkehr Lübeck GmbH (SL).<br />
Es gilt daher in Lübeck und einigen umliegen<strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n weiterhin <strong>de</strong>r Tarif <strong>de</strong>r Tarifgemeinschaft Lübeck (TGL), die von <strong>de</strong>r SL, <strong>de</strong>r Deutsche Bahn AG und <strong>de</strong>r Lübeck-<br />
Travemün<strong>de</strong>r Verkehrsgesellschaft mbH (LVG) geschlossen wur<strong>de</strong>. Zum Gebiet <strong>de</strong>r TGL gehören neben Buslinien <strong>de</strong>r SL und LVG auch alle Bahnhöfe beziehungsweise -halte im<br />
Lübecker Stadtgebiet.<br />
Auf <strong>de</strong>m Linienplan <strong>de</strong>s Stadtverkehr wer<strong>de</strong>n die Buslinien, die die Altstadt durchfahren, <strong>zu</strong>r besseren Orientierung farblich gekennzeichnet. Die grünen Linien (2, 6, 7, 9, 16, 17, 19)<br />
fahren vom Holstentorplatz über <strong>de</strong>n Kohlmarkt <strong>zu</strong>r Stadthalle (Mühlentor). Die blauen Linien (1, 11, 21, 31, 34) nehmen vom Holstentorplatz <strong>de</strong>n Weg über die Königstraße <strong>zu</strong>m<br />
Gustav-Radbruch-Platz am Burgtor (in <strong>de</strong>r Gegenrichtung über die Beckergrube und <strong>de</strong>n Schüsselbu<strong>de</strong>n). Die roten Linien (nur noch 4, 32) durchqueren die Altstadt von Nord nach Süd<br />
vom Gustav-Radbruch-Platz bis <strong>zu</strong>r Stadthalle. Die gelben Linien (3, 12) nehmen schließlich <strong>de</strong>n Weg über die Beckergrube <strong>zu</strong>m Holstentorplatz. Die restlichen Linien (5, 10, 30, 40)<br />
fahren auf unterschiedlichen Wegen durch die Altstadt.<br />
Die überwiegend signalroten Busse <strong>de</strong>r Lübeck-Travemün<strong>de</strong>r Verkehrsgesellschaft (LVG) verbin<strong>de</strong>n ZOB und Altstadt mit <strong>de</strong>n nördlichen Stadtteilen Kücknitz (Linie 31, 32, 34) und<br />
Travemün<strong>de</strong> (Linie 30 und 40 bis Strandbahnhof). Der Einsatz <strong>de</strong>r populären Doppel<strong>de</strong>ckerbusse wur<strong>de</strong> jedoch am 31. Dezember 2007 been<strong>de</strong>t, da die Fahrzeuge <strong>zu</strong> alt waren und neue<br />
Fahrzeuge für die Fahrt durch das Burgtor <strong>zu</strong> hoch sind.<br />
Der Busbetrieb Dahmetal bedient mit ihren Buslinien 902 die Strecke Lübeck–Großhansdorf, 906 Lübeck–Ahrensburg, 907 Lübeck–Ron<strong>de</strong>shagen und 930 Kronsfor<strong>de</strong>–Klempau.<br />
Lübeck ist in das von <strong>de</strong>r Autokraft GmbH betriebene schleswig-holsteinische Regionalbus-Liniennetz eingebun<strong>de</strong>n.<br />
In Travemün<strong>de</strong> fährt die Priwallfähre – außerhalb <strong>de</strong>r Tarifgemeinschaft – zwischen <strong>de</strong>r Stadt und <strong>de</strong>r Halbinsel Priwall.<br />
Flughafen<br />
Lübeck verfügt im Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Stadtgebiets über <strong>de</strong>n Regionalflughafen Lübeck-Blankensee. Der Flughafen wird seit 2000 von <strong>de</strong>r irischen Fluggesellschaft Ryanair als Flughafen<br />
„Hamburg-Lübeck“ angeflogen und verbin<strong>de</strong>t die Region seit<strong>de</strong>m mit London-Stansted. Inzwischen bietet Ryanair weitere Flüge nach Bergamo, Stockholm-Skavsta, Pisa, Dublin,<br />
Palma <strong>de</strong> Mallorca und Girona bei Barcelona. Die erste inner<strong>de</strong>utsche Verbindung besteht seit Herbst 2008 mit <strong>de</strong>m Flughafen Frankfurt-Hahn. Angekündigt sind <strong>zu</strong><strong>de</strong>m Flüge nach<br />
Alghero (Sardinien) und Alicante. Zu<strong>de</strong>m ist seit 2006 die osteuropäische Billigfluglinie Wizz Air mit Flügen nach Danzig in Blankensee vertreten. Der Lübecker Flughafen ist neben<br />
<strong>de</strong>m Flughafen Sylt <strong>de</strong>r einzigen Verkehrsflughafen in Schleswig-Holstein und wird auch <strong>de</strong>shalb von <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sregierung beim weiteren Ausbau unterstützt.
Energie<br />
Die örtliche Energieversorgung mit Elektrizität aber auch die Gasversorgung in <strong>de</strong>r Stadt liegt in Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadtwerke Lübeck GmbH. Das Kraftwerk Siems sollte von <strong>de</strong>r E.ON nach<br />
<strong>de</strong>m Abriss eigentlich neu errichtet wer<strong>de</strong>n, die E.ON hat sich an diese Versprechungen und Zusagen jedoch nicht gehalten. Lübeck ist Ausgangspunkt <strong>de</strong>s langen Hochspannungs-<br />
Seekabels „Baltic Cable“, einer 450-kV-HVDC-Leitung nach Schwe<strong>de</strong>n.<br />
Siehe auch: Gasversorgung Lübeck, Stromversorgung Lübeck<br />
Kommunikation<br />
Die teilprivatisierte Stadtwerke Lübeck GmbH bietet örtlich mit Trave-DSL einen Internet<strong>zu</strong>gang an (als eines <strong>de</strong>r wenigen Unternehmen in Deutschland im Line-Sharing-Verfahren, d.<br />
h. ggf. auch ohne <strong>zu</strong>sätzlichen Telefonanschluss). Als weitere regionale Anbieter treten Hansenet und Versatel (ehemalige KomTel) auf. Anschlüsse von Arcor sind auch möglich. In<br />
wenigen Bereichen Lübecks ist DSL <strong>de</strong>rzeit nicht verfügbar. Kabel Deutschland bietet in <strong>de</strong>r Hansestadt Internet über <strong>de</strong>n Kabelanschluss an. Ferner installiert die Telekom <strong>de</strong>rzeit ein<br />
VDSL-Netz.<br />
Lübecker Erfindungen<br />
• Lübecker Hütchen<br />
• Lübecker Marzipan<br />
Medien<br />
Als Tageszeitung erscheinen in Lübeck die Lübecker Nachrichten in gedruckter und Online-Ausgabe sowie die Online-Tageszeitung HL-live.<strong>de</strong>. Der Ostsee-Verlag, eine Tochterfirma<br />
<strong>de</strong>r Lübecker Nachrichten GmbH, gibt zweimal wöchentlich das Anzeigenblatt Wochenspiegel heraus. Die Lübecker Stadtzeitung erscheint einmal wöchentlich und wird kostenlos an<br />
alle Haushalte ausgegeben. Herausgeberin ist die Hansestadt Lübeck. Redaktion, Verlag und Druck liegt in Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Linus Wittich Druck + Verlag Lübeck GmbH. In <strong>de</strong>r Stadtzeitung<br />
erschienen die Amtlichen Bekanntmachungen <strong>de</strong>r Stadt.[22]<br />
Be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Zeitung in Lübeck war bis 1933 <strong>de</strong>r 1894 gegrün<strong>de</strong>te sozial<strong>de</strong>mokratische Lübecker Volksbote, <strong>de</strong>ssen Chefredakteur von 1921 bis 1933 Julius Leber war. Für die Zeitung<br />
schrieb Willy Brandt als Schüler. Zwischen 1942 und 1945 erschien die NSDAP-Zeitung Lübecker Zeitung. Die nach En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs von <strong>de</strong>r britischen<br />
Besat<strong>zu</strong>ngsregierung gegrün<strong>de</strong>te Lübecker Post sowie die sozial<strong>de</strong>mokratische Tageszeitung Lübecker Freie Presse und ihr Nachfolger Lübecker Morgen stellten ihr Erscheinen ein.<br />
Auch die in Lübeck herausgegebene Nordwoche, eine Wochenzeitung für Schleswig-Holstein, existiert nicht mehr.<br />
Der Sen<strong>de</strong>r Offener Kanal Lübeck hat sein Studio in einem mit <strong>de</strong>r Musik- und Kunstschule geteilten Gebäu<strong>de</strong> („Alte Post“) in <strong>de</strong>r Kanalstraße.<br />
Die Stadt ist Sitz eines Regionalstudios <strong>de</strong>s NDR, das Beiträge für die Hörfunkwellen und das Fernsehprogramm produziert.<br />
Neben <strong>de</strong>n Programmen <strong>de</strong>s NDR und <strong>de</strong>s Offenen Kanals sind auch <strong>de</strong>r Deutschlandfunk und Deutschlandradio Kultur sowie die privaten Rundfunkveranstalter R.SH, <strong>de</strong>lta radio,<br />
Radio NORA und Klassik Radio, ferner auch alle lan<strong>de</strong>sweiten Sen<strong>de</strong>r aus Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Nie<strong>de</strong>rsachsen <strong>zu</strong> empfangen.<br />
Öffentliche Einrichtungen<br />
Folgen<strong>de</strong> Behör<strong>de</strong>n beziehungsweise Körperschaften haben ihren Sitz in Lübeck:<br />
• Handwerkskammer Lübeck<br />
• IHK <strong>zu</strong> Lübeck<br />
• Wasser- und Schifffahrtsamt Lübeck
• Deutsche Rentenversicherung Nord<br />
• BKK Hansestadt Lübeck<br />
• Landgericht Lübeck im Gerichtshaus<br />
• Amtsgericht Lübeck<br />
• Sozialgericht Lübeck<br />
• Arbeitsgericht Lübeck<br />
• Finanzamt<br />
• Amt für ländliche Räume<br />
• eine Filiale <strong>de</strong>r Deutschen Bun<strong>de</strong>sbank, ehemals Lan<strong>de</strong>szentralbank (Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Stand 2010)<br />
• Lan<strong>de</strong>samt für soziale Dienste, ehemals Versorgungsamt<br />
Bildung und Wissenschaft<br />
Hochschulen<br />
In Lübeck gibt es vier staatliche Hochschulen. Die Universität <strong>zu</strong> Lübeck (UZL), damals noch Medizinische Hochschule <strong>zu</strong> Lübeck, wur<strong>de</strong> 1973 als Nachfolgerin <strong>de</strong>r II. Medizinischen<br />
Fakultät gegrün<strong>de</strong>t, welche seit 1964 eine Fakultät <strong>de</strong>r Universität Kiel war. Anfang <strong>de</strong>r 1980er Jahre wur<strong>de</strong> das Vorklinikum eröffnet, seit<strong>de</strong>m ist ein vollständiges Studium <strong>de</strong>r Medizin<br />
in Lübeck möglich. 1993 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Studiengang Informatik eingerichtet, inzwischen gibt es noch die Bachelor-/Masterstudiengänge Molecular Life Science, Mathematik in Medizin<br />
und Lebenswissenschaften - Computational Life Science und seit <strong>de</strong>m Wintersemester 2007 Medizinische Ingenieurwissenschaft sowie <strong>de</strong>n in Kooperation mit <strong>de</strong>r International School<br />
of New Media angebotenen Masterstudiengang Digital Media. Im Rahmen <strong>de</strong>r Exzellenzinitiative <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sregierung wur<strong>de</strong> 2007 die Graduate School for Computing in Medicine and<br />
Life Sciences gegrün<strong>de</strong>t. Diese Graduiertenschule bil<strong>de</strong>t Doktoran<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Informatik in <strong>de</strong>r Medizin und in <strong>de</strong>n Lebenswissenschaften aus. Die Lan<strong>de</strong>sregierung<br />
Schlesig-Holsteins will <strong>de</strong>n Medizinstudiengang <strong>zu</strong>m 1. Okober 2011 einstellen. Das Vorhaben stößt auf Wi<strong>de</strong>rstand in Politik, Wissenschaft und Organisationen.[23][24][25]<br />
Der Campus <strong>de</strong>r Universität liegt mit <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Fachhochschule im Stadtteil St. Jürgen.<br />
Die Fachhochschule Lübeck (FHL) wur<strong>de</strong> 1969 als Staatliche Fachhochschule für Technik und Seefahrt durch Zusammenschluss mehrerer Vorgängereinrichtungen gegrün<strong>de</strong>t. Hier<br />
wer<strong>de</strong>n heut<strong>zu</strong>tage hauptsächlich Studiengänge aus <strong>de</strong>m Bereich Technik, Ingenieurwesen und angewandte Naturwissenschaften angeboten. In Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>r Universität<br />
wer<strong>de</strong>n hier beispielsweise auch Medizintechniker ausgebil<strong>de</strong>t.<br />
Die Musikhochschule Lübeck entstand 1973 aus einem bereits 1891 gegrün<strong>de</strong>ten privaten Konservatorium. Als einzige <strong>de</strong>r Lübecker Hochschulen befin<strong>de</strong>t sie sich im Bereich <strong>de</strong>r<br />
Innenstadt. Die Musikhochschule hat in vielen Län<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Welt einen ausgezeichneten Ruf, so dass Stu<strong>de</strong>nten aus über 30 Nationen <strong>de</strong>r Welt hier studieren.<br />
Die Fachhochschule <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s für öffentliche Verwaltung – Fachbereich Bun<strong>de</strong>spolizei wur<strong>de</strong> 1978 gegrün<strong>de</strong>t. Der Hauptsitz dieser Fachhochschule befin<strong>de</strong>t sich in Brühl<br />
(Rheinland).<br />
Als privaten Hochschule ist noch die International School of New Media (ISNM) in <strong>de</strong>n Media Docks am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Wallhalbinsel untergebracht. Diese ehemaligen Kaianlagen wur<strong>de</strong>n<br />
außer für die Unterbringung <strong>de</strong>r ISNM auch für Firmengründungen <strong>de</strong>s Neuen Marktes restauriert. Sie bieten einen hervorragen<strong>de</strong>n Ausblick auf die Altstadt.<br />
Schulen<br />
In Lübeck bestehen drei Integrierte Gesamtschulen: die Geschwister-Prenski-Gesamtschule am Burgtor, die Baltic-Gesamtschule in Lübeck-Buntekuh und die Willy-Brandt-Schule-<br />
Schlutup. Mehrere <strong>de</strong>r Lübecker Gymnasien befin<strong>de</strong>n sich direkt in <strong>de</strong>r Innenstadt. In zwei umgebauten Klöstern befin<strong>de</strong>n sich das Katharineum <strong>zu</strong> Lübeck mit Schwerpunkt im<br />
altsprachlichen Bereich sowie das Johanneum <strong>zu</strong> Lübeck als Gymnasium mit Musikzweig; ebenfalls im Bereich <strong>de</strong>r Altstadt liegen die Ernestinenschule und die Oberschule <strong>zu</strong>m Dom,
die bis Anfang <strong>de</strong>r 1980er Jahre als reine Mädchen- beziehungsweise Jungenschule konzipiert waren. Die Hanse-Schule für Wirtschaft und Verwaltung ist ein Berufsbildungszentrum in<br />
<strong>de</strong>r Innenstadt. Weitere, nicht in <strong>de</strong>r Innenstadt liegen<strong>de</strong> Gymnasien sind die Friedrich-List-Schule (ein Fachgymnasium mit wirtschaftlichem Zweig), die Thomas-Mann-Schule, ein<br />
neusprachliches Gymnasium und Europaschule, das Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium, das Trave-Gymnasium im Stadtteil Kücknitz und das Fachgymnasium (Technischer Zweig) in<br />
<strong>de</strong>r Gewerbeschule III. Die Dorothea-Schlözer-Schule umfasst neben <strong>de</strong>m Fachgymnasium die Fachschule für Sozialpädagogik auch Ausbildungsgänge für Pflegeberufe und<br />
Hauswirtschaft.Darüber hinaus gibt es einige Fachschulen, Berufsschulen (die im Jahr 2005 als Emil-Possehl-Schule <strong>zu</strong>sammengefasst wur<strong>de</strong>n), Berufsfachschulen,<br />
Berufsvorbereitungsschulen und eine Freie Waldorfschule. Außer<strong>de</strong>m befin<strong>de</strong>t sich neben <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Fachhochschule die Aka<strong>de</strong>mie für Hörgeräteakustik.<br />
Sonstige Bildungseinrichtungen<br />
In Lübeck besteht seit 1999 <strong>de</strong>r Verbund Weiterbildung in Lübeck, in <strong>de</strong>m sich auf freiwilliger Basis Einrichtungen <strong>de</strong>r beruflichen, allgemeinen und politischen Bildung<br />
<strong>zu</strong>sammengeschlossen haben. Mit über 70 Einrichtungen ist es das größte regionale Weiterbildungsnetzwerk in Schleswig-Holstein. Mo<strong>de</strong>riert von <strong>de</strong>r neutralen Wirtschaftsför<strong>de</strong>rung<br />
LÜBECK GmbH informiert <strong>de</strong>r Verbund neutral und objektiv Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen über die Weiterbildungsmöglichkeiten in <strong>de</strong>r Region. Neben <strong>de</strong>n weiter unten<br />
genannten Theatern und Museen besteht noch die Volkshochschule Lübeck. Die Volkshochschule hat zwei eigene Standorte, einen in <strong>de</strong>r Innenstadt und einen in Sankt-Lorenz-Nord und<br />
nutzt für die zahlreichen Kurse auch Räume in an<strong>de</strong>ren öffentlichen Schulen. Die Sternwarte Lübeck bietet öffentliche Himmelsbeobachtungen und astronomische Vorträge an. Die<br />
Stadtbibliothek ist gleichzeitig öffentliche Bücherei und wissenschaftliche Bibliothek. Sie bietet in ihren Räumen in <strong>de</strong>r Hun<strong>de</strong>straße sowie in einigen Außenstellen ein reichhaltiges<br />
Angebot an Fachbüchern und Trivialliteratur und hat in ihren Archiven auch einige Schätze. Die städtischen Urkun<strong>de</strong>nsammlungen seit <strong>de</strong>m Mittelalter und viele Dokumente <strong>de</strong>r<br />
Hansezeit verwahrt das Archiv <strong>de</strong>r Hansestadt Lübeck. Die Werkkunstschule Lübeck ist eine Schule für Kommunikations<strong>de</strong>sign. Die Wirtschaftsaka<strong>de</strong>mie Schleswig-Holstein ist mit<br />
einer Nie<strong>de</strong>rlassung vertreten.<br />
Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
Weltkulturerbe Lübecker Altstadt<br />
Am 14. Dezember 1987 wur<strong>de</strong>n die erhaltenen Teile <strong>de</strong>s mittelalterlichen Stadtkerns auf <strong>de</strong>r Altstadtinsel von <strong>de</strong>r UNESCO <strong>zu</strong>m Weltkulturerbe erklärt. Damit wur<strong>de</strong> erstmals in<br />
Nor<strong>de</strong>uropa eine ganze Altstadt als Weltkulturerbe anerkannt. Ausschlaggebend waren dabei <strong>de</strong>r exemplarische Charakter <strong>de</strong>r Altstadt für die mittelalterliche Stadtentwicklung im<br />
Ostseeraum, die markante Stadtsilhouette mit <strong>de</strong>n sieben Türmen <strong>de</strong>r fünf Hauptkirchen und die geschlossen erhaltene vorindustrielle Bausubstanz. Hin<strong>zu</strong> kam als weitere<br />
schützenswerte Beson<strong>de</strong>rheit <strong>de</strong>r für die archäologische Erforschung <strong>de</strong>s mittelalterlichen Städtewesens außeror<strong>de</strong>ntlich ergiebige Untergrund.<br />
Der von <strong>de</strong>r UNESCO geschützte Bereich bezieht die wichtigsten Bauwerke Lübecks ein: <strong>de</strong>n Baukomplex <strong>de</strong>s Rathauses, das Burgkloster, <strong>de</strong>n Koberg – ein vollständig erhaltenes<br />
Viertel <strong>de</strong>s späten 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt – mit Jakobikirche, Heiligen-Geist-Hospital und <strong>de</strong>n Baublöcken zwischen Glockengießer- und Aegidienstraße, das Viertel <strong>de</strong>r Patrizierhäuser <strong>de</strong>s 15.<br />
und 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt zwischen Petrikirche und Dom, das Holstentor und die Salzspeicher am linken Traveufer.<br />
Lübeck bewarb sich um <strong>de</strong>n Titel „Europäische Kulturhauptstadt 2010“, schied jedoch in <strong>de</strong>r Vorrun<strong>de</strong> aus. 2008 bewarb sich Lübeck als Stadt <strong>de</strong>r Wissenschaft im Wettbewerb mit<br />
Konstanz und Ol<strong>de</strong>nburg.<br />
Musik<br />
Die Lübecker Altstadt-Kirchen sind mit ihrer Vielfalt an barocken wie mo<strong>de</strong>rnen Orgeln für Konzerte gut geeignet, sie haben seit <strong>de</strong>r Nord<strong>de</strong>utschen Orgelschule <strong>de</strong>n Ruf als Musikstadt<br />
maßgeblich begrün<strong>de</strong>t. Die Abendmusiken sind seit <strong>de</strong>r Zeit Dietrich Buxtehu<strong>de</strong>s legendär. Im Sommer macht das in Lübeck ansässige Schleswig-Holstein Musik Festival in ganz<br />
Schleswig-Holstein auch Dorfkirchen, Gutshäuser und -scheunen <strong>zu</strong> Konzertsälen. Weitere Konzerthallen und Veranstaltungsräume sind die mo<strong>de</strong>rne Musik- und Kongresshalle Lübeck,<br />
kurz MuK genannt, das Kolosseum <strong>de</strong>r Gesellschaft <strong>zu</strong>r Beför<strong>de</strong>rung gemeinnütziger Tätigkeit, die Konzertsäle <strong>de</strong>r Musikhochschule Lübeck einschließlich <strong>de</strong>r Holstentorhalle, das<br />
treibsand und das VeB, in <strong>de</strong>r Alternative Lübeck, kurz „Walli“ genannt, das Ri<strong>de</strong>r's Café in Buntekuh, <strong>de</strong>r Werkhof und die Schuppen 6 und 9.<br />
Theater
Das Theater Lübeck ist in einem Jugendstil-Gebäu<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Beckergrube untergebracht und wur<strong>de</strong> Mitte <strong>de</strong>r 1990er Jahre renoviert. Im Großen Haus fin<strong>de</strong>n hauptsächlich<br />
Operndarbietungen statt, unterstützt von <strong>de</strong>n Lübecker Philharmonikern. Hier haben Hermann Abendroth, Wilhelm Furtwängler und Christoph von Dohnányi <strong>de</strong>n Ausgangspunkt ihrer<br />
Karrieren gelegt. In <strong>de</strong>n Kammerspielen wer<strong>de</strong>n Dramen und Komödien sämtlicher Stilrichtungen dargeboten. Im Bereich Kin<strong>de</strong>roper kooperiert das Theater mit <strong>de</strong>r Taschenoper<br />
Lübeck.[26]. Daneben gibt es eine für die Größe <strong>de</strong>r Stadt bemerkenswerte Anzahl unabhängiger Theater, unter <strong>de</strong>nen beson<strong>de</strong>rs das Lübecker Marionetten-Theater Fritz Fey, das theater<br />
combinale, das theater partout, das Volks- und Komödientheater Geisler, das THEATER Haus Lübeck, das Theaterschiff Lübeck, das Lübecker Unterwassermarionettentheater und das<br />
ULKNUDEL e. V. sowie die Lübecker Sommeroperette als jährlich stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Open-Air-Veranstaltungsreihe hervor<strong>zu</strong>heben sind.<br />
Kino<br />
Lübeck ist Stammsitz <strong>de</strong>r Cinestar-Kinos, die mit <strong>de</strong>n Lichtspielen Hoffnung in <strong>de</strong>r Hüxtertorallee die Basis ihres Konzerns legten. Dieses traditionsreiche Kino steht nach einem Brand<br />
En<strong>de</strong> Dezember 2004 noch vor <strong>de</strong>r notwendigen Renovierung und galt bis dahin als das schönste Kino Lübecks. Das Kino ist im September 2009 als Veranstaltungssaal unter <strong>de</strong>m<br />
Namen "Eventhaus Hoffnung" wie<strong>de</strong>reröffnet wor<strong>de</strong>n. Mitte <strong>de</strong>r 1990er Jahre wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Stadthalle nach <strong>de</strong>m Vorbild <strong>de</strong>r Multiplex-Kinos ein Kinopalast mit sieben Sälen<br />
eingerichtet, nach<strong>de</strong>m Cinestar bereits in einigen ost<strong>de</strong>utschen Städten solche Kinos erbauen ließ. Hier laufen heute vor allem Filme <strong>de</strong>s Mainstream-Kinos. 2005 und 2007 wur<strong>de</strong> die<br />
Stadthalle renoviert und unter an<strong>de</strong>rem auch neu bestuhlt. Es gibt nur noch ein weiteres kommerzielles Kino, das ebenfalls <strong>zu</strong>r Cinestar-Gruppe gehört: das Filmhaus. Nach einer<br />
Renovierung zeigt es jetzt hauptsächlich anspruchsvollere Filme und Lesungen.<br />
Das Kommunale Kino in <strong>de</strong>r Mengstraße, ein kleiner Vorführungsraum mit einem kleinen, ausgewählten Filmangebot, das auch selten Gezeigtes ab<strong>de</strong>ckt und dafür schon mit mehreren<br />
Preisen ausgezeichnet wur<strong>de</strong>, ist das einzige Kino, das nicht <strong>de</strong>r Cinestar-Gruppe gehört. Seit Sommer 2007 führt <strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rkreis Kommunales Kino Lübeck e. V. die Geschäfte <strong>de</strong>s<br />
ehemals städtischen Kinos.<br />
Je<strong>de</strong>s Jahr im Herbst steht Lübeck im Zeichen <strong>de</strong>r Nordischen Filmtage. Auf diesem Filmfestival wer<strong>de</strong>n an fünf Tagen Filme aus Skandinavien, <strong>de</strong>m Baltikum und Schleswig-Holstein<br />
gezeigt. Spielort ist vor allem die Stadthalle, während an diesen Tagen das Mainstream-Kino im Filmhaus läuft.<br />
Museen<br />
Für viele Interessengebiete kann man Lübecks reichhaltige Museen besichtigen. Im St. Annen-Museum mit <strong>de</strong>r neuen Kunsthalle St. Annen befin<strong>de</strong>t sich eine großartige Sammlung<br />
mittelalterlicher Sakralkunst. Weitere Kunstsammlungen sind im Behnhaus und Drägerhaus mit einem international be<strong>de</strong>utsamen Schwerpunkt für die Nazarenische Kunst und sowie im<br />
Kulturforum Burgkloster. Die Stadtgeschichte Lübecks wird im Holstentor-Museum dargestellt. In <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Doms befin<strong>de</strong>n sich das Museum für Natur und Umwelt sowie die im<br />
mittelalterlichen Zeughaus gelegene Völkerkun<strong>de</strong>sammlung, welche 2007 aus Geldmangel geschlossen wur<strong>de</strong>. Ebenfalls in <strong>de</strong>r Altstadt kann man das Lübecker Theaterfigurenmuseum<br />
am Kolk besichtigen, Literaturinteressierten sind das Bud<strong>de</strong>nbrookhaus und das Günter-Grass-Haus <strong>zu</strong> empfehlen. Als Ge<strong>de</strong>nkstätte für <strong>de</strong>n in Lübeck geborenen<br />
Frie<strong>de</strong>nsnobelpreisträger Willy Brandt wur<strong>de</strong> 2007 das Willy-Brandt-Haus Lübeck eröffnet. Im Marzipansalon im Café Nie<strong>de</strong>regger kann man alles über das „weiße Gold“ erfahren.<br />
Außerhalb <strong>de</strong>r Altstadt gibt es die Geschichtswerkstatt Herrenwyk in Kücknitz. Am 12. Juli 2005 öffnete im Burgkloster das Lübecker Museum für Archäologie. Die Leitung <strong>de</strong>r<br />
städtischen Museen obliegt seit <strong>de</strong>m 1. Januar 2006 <strong>de</strong>r Kulturstiftung Hansestadt Lübeck.<br />
Als maritime Stadt verfügt Lübeck darüber hinaus über <strong>de</strong>n Museumshafen Lübeck am nordwestlichen Altstadt-Ufer.<br />
An die Geschichte <strong>de</strong>r Stadt während <strong>de</strong>r Teilung Deutschlands erinnert die Grenz-Dokumentationsstätte Lübeck-Schlutup. Sie befin<strong>de</strong>t sich in einem ehemaligen Zollhaus <strong>de</strong>s bis 1989<br />
nördlichsten Grenzübergangs <strong>zu</strong>r DDR im Stadtteil Schlutup. Eine weitere Ausstellung über die ehemalige inner<strong>de</strong>utsche Grenze befin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>spolizeiaka<strong>de</strong>mie.<br />
Literatur<br />
Lübeck sieht einen <strong>de</strong>utlichen Schwerpunkt <strong>de</strong>s kulturellen Lebens in <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng mit <strong>de</strong>r dort geschaffenen Literatur <strong>de</strong>r Brü<strong>de</strong>r Thomas Mann und Heinrich Mann, die als<br />
Zentrum das Bud<strong>de</strong>nbrookhaus in <strong>de</strong>r Mengstraße neben <strong>de</strong>r Lübecker Marienkirche gefun<strong>de</strong>n hat. Es ist benannt nach Thomas Manns Roman Bud<strong>de</strong>nbrooks, <strong>de</strong>r in Lübeck spielt.<br />
Dieser Gesellschaftsroman behan<strong>de</strong>lt <strong>de</strong>n Verfall einer reichen Kaufmannsfamilie; Thomas Mann erhielt für dieses Buch <strong>de</strong>n Nobelpreis für Literatur. Die Hansestadt verleiht alle drei
Jahre <strong>de</strong>n Thomas-Mann-Preis. Weitere berühmte Autoren aus Lübeck sind Emanuel Geibel, Gustav Falke, Otto Anthes und Erich Mühsam. Günter Grass, ebenfalls<br />
Literaturnobelpreisträger, lebte lange in Lübeck. Heute wohnt er in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r Stadt. In Lübeck selbst befin<strong>de</strong>t sich das Günter-Grass-Haus mit <strong>de</strong>m überwiegen<strong>de</strong>n Teil seiner<br />
literarischen und künstlerischen Originalwerke. Lübeck ist Sitz <strong>de</strong>r Erich-Mühsam-Gesellschaft, die <strong>de</strong>n Erich-Mühsam-Preis verleiht. Die Schriftsteller Theodor Storm und Werner<br />
Bergengruen waren Schüler <strong>de</strong>s Katharineums.<br />
Ludwig Ewers´ 1926 erschienener umfangreicher Lübeck-Roman Die Großvaterstadt[27] wur<strong>de</strong> einst viel gelesen. Seine Protagonisten leben in <strong>de</strong>rselben Zeit wie die Bud<strong>de</strong>nbrooks,<br />
allerdings auf einer an<strong>de</strong>ren sozialen Ebene. Es wer<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Teil die gleichen Ereignisse berichtet, wie beispielsweise das Ereignis in <strong>de</strong>r Königsstraße – Senator Bud<strong>de</strong>nbrook im Haus,<br />
Kaufmann Normann draußen. Der dritte Lübeck-Roman <strong>zu</strong> jener Zeit ist <strong>de</strong>r, im Vergleich <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m Ewers' o<strong>de</strong>r Manns, komplett fiktive Roman Ida Boy-Eds Ein königlicher Kaufmann.<br />
Zuvor war Lübeck durch das Werk Ein Ruf von <strong>de</strong>r Trave[28] <strong>de</strong>s <strong>zu</strong> jener Zeit in München leben<strong>de</strong>n Lübeckers Emanuel Geibel Ort einer Romanhandlung gewor<strong>de</strong>n.<br />
Josef Maria Stachelmann, ein Historiker und Protagonist in Christian v. Ditfurths <strong>de</strong>rzeit fünf Kriminalromanen, ist in <strong>de</strong>r Lübecker Altstadt an <strong>de</strong>m einzig fiktivem Ort <strong>de</strong>r Stadt seit<br />
2004 ansässig.<br />
Bauwerke<br />
Das Weltkulturerbe auf <strong>de</strong>r Altstadtinsel besteht aus weit über tausend Gebäu<strong>de</strong>n, die als Denkmäler in die Denkmalliste eingetragen sind. Insofern kann hier nur ein Ausschnitt <strong>de</strong>r<br />
wichtigsten erwähnt wer<strong>de</strong>n. Das Weltkulturerbe ist jedoch die Gesamtheit <strong>de</strong>s erhaltenen Teils <strong>de</strong>r mittelalterlichen Stadt.<br />
Die sieben Türme<br />
Das Bild <strong>de</strong>r Altstadt wird geprägt durch die sieben Kirchtürme (daher die Bezeichnung „Stadt <strong>de</strong>r sieben Türme“), die <strong>de</strong>n fünf großen Altstadtkirchen <strong>zu</strong><strong>zu</strong>ordnen sind. In <strong>de</strong>r<br />
westlichen Stadtsilhouette, mit <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>ntlich als Logo geworben wird, sind dies die in Nord-Süd-Reihenfolge (das heißt von links nach rechts) gezählten Türme von:<br />
• Jakobikirche im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Altstadt<br />
• Marienkirche mit zwei Westtürmen im Zentrum rückseitig <strong>de</strong>s Rathauses<br />
• Petrikirche in Sichtweite <strong>de</strong>s Holstentores nahe <strong>de</strong>r West<strong>zu</strong>fahrt <strong>zu</strong>r Altstadt<br />
• Aegidienkirche<br />
• Dom mit zwei Westtürmen im südlichen Altstadtabschluss<br />
Der noch romanisch begrün<strong>de</strong>te Dom ist in Lübeck nur die zweitgrößte mittelalterliche Kirche, hat jedoch mit 130 Metern die größte Länge. Er befin<strong>de</strong>t sich eher abgelegen am<br />
südlichen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Altstadtinsel in einer ruhigen Umgebung, die noch die alte Domfreiheit erahnen lässt. In <strong>de</strong>r Lage <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Kirchen <strong>zu</strong>einan<strong>de</strong>r spiegelt sich <strong>de</strong>r Konflikt zwischen<br />
<strong>de</strong>r Lübecker Bürgerschaft und <strong>de</strong>m Lübecker Bischof wi<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r da<strong>zu</strong> führte, dass die Lübecker Bischöfe ihre Resi<strong>de</strong>nz nach Eutin verlegten. Im Unterschied <strong>zu</strong>r Marienkirche ist <strong>de</strong>r<br />
Dom seit <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rherstellung im Inneren eher nüchtern weiß gestaltet. Hier kann man aber beispielsweise das Triumphkreuz <strong>de</strong>s berühmten Holzschnitzers Bernt Notke bewun<strong>de</strong>rn.<br />
Ganz in <strong>de</strong>r Nähe, in <strong>de</strong>r Para<strong>de</strong>, befin<strong>de</strong>t sich die Propsteikirche Herz Jesu, welche 1891 erbaut wur<strong>de</strong>.<br />
Die 100 Meter lange gotische Marienkirche war die Hauptpfarrkirche <strong>de</strong>s Rates und <strong>de</strong>r Bürgerschaft. Sie steht in prominenter Lage in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>s Marktes direkt hinter <strong>de</strong>m Rathaus.<br />
Die Marienkirche ist heute die drittgrößte Kirche Deutschlands und gilt als Mutterkirche <strong>de</strong>r Backsteingotik. Sie beeindruckt nicht nur durch ihre äußere, son<strong>de</strong>rn auch durch ihre innere<br />
Größe. Auch wenn im Zweiten Weltkrieg wesentliche Kunstschätze im Inneren zerstört wur<strong>de</strong>n, wirkt sie heute doch beson<strong>de</strong>rs durch das fast 40 Meter hohe Mittelschiff mit<br />
reichhaltigen Deckenmalereien eindrucksvoll.<br />
Wie auch Dom und Marienkirche, so wur<strong>de</strong> auch die Petrikirche im Zweiten Weltkrieg erheblich zerstört und erst als letzte wie<strong>de</strong>r aufgebaut. Ebenfalls in Sichtweite <strong>de</strong>s Marktes<br />
gelegen, war sie früher die Stammkirche <strong>de</strong>r Fischer und Binnenschiffer. Heute hat sie keine eigene Gemein<strong>de</strong> mehr und wird als Ausstellungs- und Veranstaltungsraum genutzt. Unter<br />
an<strong>de</strong>rem ist sie seit 2004 Universitätskirche und wird von <strong>de</strong>n Lübecker Hochschulen für Feierlichkeiten verwen<strong>de</strong>t. Auf ihrem Turm befin<strong>de</strong>t sich eine Aussichtsplattform, von <strong>de</strong>r man<br />
bei schönem Wetter bis nach Travemün<strong>de</strong> und tief ins Mecklenburgische sehen kann. Die Jakobikirche liegt am an<strong>de</strong>ren großen Platz Lübecks, <strong>de</strong>m Koberg. Die Kirche war die
Stammkirche <strong>de</strong>r Seeschiffer und liegt gegenüber <strong>de</strong>r berühmten Schiffergesellschaft, <strong>de</strong>m Zunfthaus <strong>de</strong>r Kapitäne und heute bekanntesten Restaurant Lübecks mit vielen<br />
Schiffsmo<strong>de</strong>llen an <strong>de</strong>r Decke. Ihr Turm besticht durch die vier kugeligen Verzierungen an <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s Turmhelms. Die Jakobikirche wur<strong>de</strong> im Krieg nicht zerstört und bietet daher<br />
heute noch das über die Jahrhun<strong>de</strong>rt gewachsene Erscheinungsbild. In einer Seitenkapelle steht ein Rettungsboot <strong>de</strong>s 1957 gesunkenen Segelschulschiffes Pamir.<br />
Die Aegidienkirche ist die kleinste <strong>de</strong>r fünf großen Altstadtkirchen und die einzige im Ostteil <strong>de</strong>r Altstadt, <strong>de</strong>m Wohnviertel <strong>de</strong>r Handwerker und kleinen Leute. Auch sie wur<strong>de</strong> im Krieg<br />
nicht zerstört. Ihr Innenraum konnte daher sein Erscheinungsbild erhalten.<br />
Weitere Sakralbauten<br />
Die Katharinenkirche ist eine ehemalige Franziskaner-Klosterkirche <strong>de</strong>s Katharinenklosters. Sie hat keinen Turm und trägt daher nicht <strong>zu</strong>m klassischen Stadtpanorama bei. Ihr Inneres ist<br />
aber <strong>de</strong>nnoch überaus sehenswert und gilt als ein Höhepunkt backsteingotischer Architektur. Sie schließt direkt an das Gymnasium Katharineum an und wird heute als Ausstellungsraum<br />
genutzt. In ihrer Westfassa<strong>de</strong> fin<strong>de</strong>n sich Nischen-Figuren <strong>de</strong>r Bildhauer Ernst Barlach und Gerhard Marcks.<br />
Weitere Sakralbauten <strong>de</strong>s Mittelalters sind das Burgkloster und das St.-Annen-Kloster. Das Burgkloster, ein ehemaliges Dominikaner-Kloster, wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Dank für <strong>de</strong>n Sieg gegen<br />
Dänemark in <strong>de</strong>r Schlacht bei Bornhöved (1227) gegrün<strong>de</strong>t. Doch von seinem mittelalterlichen Bau sind nur wenige Überreste erhalten geblieben, die durch ein neugotisches Gebäu<strong>de</strong><br />
aus <strong>de</strong>m späten 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt ergänzt wor<strong>de</strong>n. Dieser Gebäu<strong>de</strong>komplex hat im Laufe <strong>de</strong>r Zeit unterschiedliche Aufgaben gehabt, war beispielsweise <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus<br />
Gerichtsgebäu<strong>de</strong> und somit Schauplatz einiger Prozesse gegen Regimegegner. Heute befin<strong>de</strong>t sich hier unter an<strong>de</strong>rem ein archäologisches Museum.<br />
Das St.-Annen-Kloster in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r Aegidienkirche beherbergt heute ein umfangreiches Museum mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten. So fin<strong>de</strong>n sich be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> sakrale<br />
Kunstwerke wie eine <strong>de</strong>r größten Sammlungen mittelalterlicher Flügelaltäre und Statuen, dann ein Überblick über Lübecker und Hanseatische Wohnkultur vom Mittelalter bis ins frühe<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rt, schließlich im neuen Anbau, <strong>de</strong>r Lübecker Kunsthalle St. Annen, eine Sammlung zeitgenössischer Kunst.<br />
Am Koberg liegt gegenüber <strong>de</strong>r Jakobikirche das Heiligen-Geist-Hospital. Dieses Gebäu<strong>de</strong> ist ein gutes Beispiel für die Formen <strong>de</strong>r Wohltätigkeit in <strong>de</strong>r mittelalterlichen Gesellschaft.<br />
Um auch <strong>de</strong>n Armen, Kranken und Alten einen Platz <strong>zu</strong> bieten, ließen wohlhaben<strong>de</strong> Bürger dieses Gebäu<strong>de</strong> errichten und stifteten regelmäßig für ihren Unterhalt. Bis in die 1970er Jahre<br />
hinein wur<strong>de</strong> die große Halle mit <strong>de</strong>n heute noch <strong>zu</strong> besichtigen<strong>de</strong>n, im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt errichteten Kabäuschen mit je etwa 3 Quadratmeter Wohnfläche als Altenheim verwen<strong>de</strong>t. Um<br />
die Weihnachtszeit fin<strong>de</strong>t hier einer <strong>de</strong>r bekanntesten Weihnachtsmärkte Nord<strong>de</strong>utschlands statt. Unweit <strong>de</strong>s Heiligen-Geist-Hospitals befin<strong>de</strong>t sich die turmlose und im Stil <strong>de</strong>s<br />
Klassizismus konzipierte Reformierte Kirche.<br />
Rathaus<br />
Direkt neben <strong>de</strong>r Marienkirche befin<strong>de</strong>t sich von jeher das Herz <strong>de</strong>r Stadt, <strong>de</strong>r Markt mit <strong>de</strong>m Rathaus. Das Rathaus ist im Unterschied <strong>zu</strong> an<strong>de</strong>ren be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Rathäusern nicht in<br />
einem Stil erbaut, son<strong>de</strong>rn man sieht auch heute noch <strong>de</strong>utlich, dass es seit <strong>de</strong>m 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt immer wie<strong>de</strong>r ergänzt wur<strong>de</strong>. Hier fin<strong>de</strong>n sich heute Baustile von <strong>de</strong>r Gotik über die<br />
Renaissance bis hin <strong>zu</strong>r Mo<strong>de</strong>rne <strong>de</strong>r 1950er-Jahre. Dem Rathaus schließt sich entlang <strong>de</strong>r Breiten Straße das von <strong>de</strong>r Backsteinrenaissance überformte Kanzleigebäu<strong>de</strong> an, <strong>de</strong>ssen<br />
Arka<strong>de</strong>n 2005 renoviert und geöffnet wur<strong>de</strong>n, um die Fußgängerzone <strong>de</strong>r Breiten Straße auch durch Geschäfte auf dieser Seite attraktiver <strong>zu</strong> gestalten. Der Rest <strong>de</strong>s Lübecker Marktes<br />
wur<strong>de</strong> im II. Weltkrieg zerstört. Die Gestaltung <strong>de</strong>s Marktes ist seit<strong>de</strong>m bis <strong>zu</strong>letzt immer wie<strong>de</strong>r Punkt lebhafter Diskussionen gewesen. Der Kaak, <strong>de</strong>r mittelalterliche Pranger, <strong>de</strong>ssen<br />
Untergeschoss Butterverkaufsstän<strong>de</strong> enthielten, wur<strong>de</strong> 1952 abgebrochen und 1986/1987 unter Verwendung gotischer Bauteile verän<strong>de</strong>rt wie<strong>de</strong>rerrichtet.<br />
Stadttore<br />
Lübeck hatte bis ins 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt noch vier Toranlagen; heute fin<strong>de</strong>t man nur noch zwei Überreste von ihnen. Das Holstentor ist als Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt sicher <strong>de</strong>utschlandweit am<br />
berühmtesten. Es wird aber schon seit langem vom Verkehr nur noch umfahren und steht auf einem kleinen, parkähnlichen Platz. Im Inneren befin<strong>de</strong>t sich ein Museum <strong>zu</strong>r<br />
Stadtgeschichte. Das an<strong>de</strong>re erhaltene Stadttor ist das Burgtor. Es ist in die Überreste <strong>de</strong>r Befestigungsanlagen am nördlichen Stadtrand integriert und muss auch heute noch von je<strong>de</strong>m<br />
durchfahren o<strong>de</strong>r -laufen wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r sich <strong>de</strong>r Altstadt von Nor<strong>de</strong>n her nähert. Es geht direkt über in <strong>de</strong>n Gebäu<strong>de</strong>komplex <strong>de</strong>s Burgklosters. Das Mühlentor unweit <strong>de</strong>r heutigen<br />
Mühlentor-Brücke über <strong>de</strong>n Elbe-Lübeck-Kanal und das Hüxtertor wur<strong>de</strong>n abgerissen, bevor das Geschichtsbewusstsein in Lübeck durchgriff.
Museen und Bürgerhäuser<br />
Einige be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Bürgerhäuser in <strong>de</strong>r Innenstadt wer<strong>de</strong>n heut<strong>zu</strong>tage als Museen verwen<strong>de</strong>t. So bietet das klassizistische Ensemble aus Behnhaus und Drägerhaus in <strong>de</strong>r oberen<br />
Königstraße heute Raum für ein Kunstmuseum. Im Bud<strong>de</strong>nbrookhaus befin<strong>de</strong>t sich heute das Heinrich-und-Thomas-Mann-Zentrum. In <strong>de</strong>r Glockengießerstraße fin<strong>de</strong>t man seit einigen<br />
Jahren schließlich das Günter-Grass-Zentrum.<br />
Die Kaufmannschaft <strong>zu</strong> Lübeck besitzt im Haus <strong>de</strong>r Kaufmannschaft zwei <strong>de</strong>r schönsten und be<strong>de</strong>utsamsten geschnitzten Inneneinrichtungen <strong>de</strong>r Renaissance. Ihr gehört auch das<br />
Schabbelhaus in <strong>de</strong>r Mengstraße, das als Restaurant <strong>zu</strong>gänglich ist.<br />
Am Koberg befin<strong>de</strong>t sich neben sehr gut erhaltenen, meist klassizistischen Gebäu<strong>de</strong>n das 1535 errichtete Versammlungshaus <strong>de</strong>r Schiffergesellschaft, in <strong>de</strong>ssen originaler<br />
Inneneinrichtung sich heute ein Restaurant befin<strong>de</strong>t.<br />
Die spätromanische Löwen-Apotheke in <strong>de</strong>r Königstraße gilt als <strong>de</strong>r älteste Profanbau Lübecks.<br />
Ein unter Denkmalschutz stehen<strong>de</strong>s ehemaliges Kontorhaus ist <strong>de</strong>r expressionistische Han<strong>de</strong>lshof aus <strong>de</strong>m Jahr 1924 am Bahnhofsvorplatz.<br />
Gänge und Höfe<br />
Die Gänge und Höfe, für die Lübeck bekannt ist, sind eher aus Platznot in <strong>de</strong>n Hinterhöfen <strong>de</strong>r Wohnhäuser entstan<strong>de</strong>ne Wohnquartiere, die früher für die Ärmsten <strong>de</strong>r Armen errichtet<br />
wur<strong>de</strong>n, heute aber begehrter Wohnraum sind. Die größten und schönsten Höfe sind sicherlich <strong>de</strong>r Füchtingshof und <strong>de</strong>r Glandorpshof in <strong>de</strong>r Glockengießerstraße. Es gibt in <strong>de</strong>r<br />
Lübecker Altstadt circa 85 kleine Gänge.<br />
Vorstädte<br />
Wer mehrere Tage in Lübeck verbringt, sollte sich neben <strong>de</strong>r Altstadt auch die Vorstädte ruhig genauer anschauen. Jenseits <strong>de</strong>r idyllischen Wallanlagen fin<strong>de</strong>n sich in St. Gertrud und St.<br />
Jürgen sehenswerte Villenviertel mit klassizistischen und aus <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong>rzeit stammen<strong>de</strong>n Villen. Beson<strong>de</strong>rs hervorstechend sind hier die Eschenburg-Villa in St. Gertrud an <strong>de</strong>r<br />
Travemün<strong>de</strong>r Allee und die Lin<strong>de</strong>sche Villa <strong>de</strong>s dänischen Architekten Lillie in St. Jürgen an <strong>de</strong>r Ratzeburger Allee, die heute als Stan<strong>de</strong>samt genutzt wird. Nur wenige Meter von <strong>de</strong>r<br />
Lin<strong>de</strong>-Villa befin<strong>de</strong>t sich außer<strong>de</strong>m die St. Jürgen-Kapelle aus <strong>de</strong>m 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt als Zeichen dafür, dass auch schon vor <strong>de</strong>r Industrialisierung außerhalb <strong>de</strong>r Lübecker Stadtmauern<br />
gesie<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>. An <strong>de</strong>r Wakenitz in St. Jürgen liegt auch die Lübecker Wasserkunst mit <strong>de</strong>n neugotischen Wasserturm. In St. Gertrud befin<strong>de</strong>t sich außer<strong>de</strong>m das Fischerdorf Gothmund<br />
am Ufer <strong>de</strong>r Trave, ebenfalls ein beliebtes Ausflugsziel, das durch sein geschlossenes Ensemble von Reetdachhäusern besticht.<br />
Travemün<strong>de</strong><br />
Fast 20 Kilometer von <strong>de</strong>r Innenstadt schließlich ist das Ostsee-Bad Travemün<strong>de</strong> <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n, das drittälteste Seebad Deutschlands. Hier kann man die Altstadt mit ihren kleinen Häusern<br />
besichtigen, die Vor<strong>de</strong>rreihe mit <strong>de</strong>n Wohnhäusern <strong>de</strong>r Kapitänswitwen, die Bä<strong>de</strong>rarchitektur vergangener Jahrhun<strong>de</strong>rte bewun<strong>de</strong>rn (Casino, Kurhaus) o<strong>de</strong>r hinterfragen (Maritim-Hotel).<br />
Zu<strong>de</strong>m befin<strong>de</strong>t sich in Travemün<strong>de</strong> <strong>de</strong>r älteste Leuchtturm Deutschlands, <strong>de</strong>r nicht mehr in Betrieb ist, aber besichtigt wer<strong>de</strong>n kann.<br />
Denkmale und Skulpturen im öffentlichen Raum<br />
Lübeck hat eine Vielzahl be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Stand<strong>de</strong>nkmale und Skulpturen im öffentlichen Raum. Da<strong>zu</strong> gehören die Löwen von Christian Daniel Rauch vor <strong>de</strong>m Holstentor, Löwen von Fritz<br />
Behn auf <strong>de</strong>r Burgtorbrücke am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Burgfelds sowie die Replik <strong>de</strong>s Braunschweiger Löwen am Dom.<br />
Zu einer Reihe weiterer Werke Behns im Stadtgebiet gehören die Antilope vor <strong>de</strong>m Holstentor sowie <strong>de</strong>r Panter im Schulgarten an <strong>de</strong>r Wakenitz. Die Bürgergärten sind ein kleiner<br />
Skulpturengarten in <strong>de</strong>r Altstadt zwischen Heiligen-Geist-Hospital und Behnhaus.<br />
An <strong>de</strong>r Fassa<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Katharinenkirche ist die Gemeinschaft <strong>de</strong>r Heiligen von Ernst Barlach und Gerhard Marcks angebracht. Eine Gruppe von Allegorien von Dietrich Jürgen Boy steht
auf <strong>de</strong>r Puppenbrücke vor <strong>de</strong>m Holstentor. Am Koberg befin<strong>de</strong>t sich zwischen <strong>de</strong>m Heiligen-Geist-Hospital und <strong>de</strong>r Jakobikirche das Geibel-Denkmal von Hermann Volz. Aus <strong>de</strong>n<br />
1990er Jahren stammt die Gruppe von sechs Offenen Stelen aus Eiche von Jan Jastram, die als Leihgabe <strong>de</strong>r Possehl-Stiftung vor <strong>de</strong>m Gerichtshaus aufgestellt wur<strong>de</strong>.<br />
Als Exponate <strong>de</strong>r documenta 9 in Kassel wur<strong>de</strong> die Gruppe von Tonskulpturen Frem<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Bildhauers Thomas Schütte bekannt. Einige dieser Skulpturen befin<strong>de</strong>n sich jetzt als Possehl-<br />
Stiftung auf <strong>de</strong>m Dach <strong>de</strong>r Musik- und Kongresshalle.<br />
In <strong>de</strong>r Grünanlage am Lin<strong>de</strong>nplatz ist Kaiser Wilhelm I. nach einem Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>s Bildhauers Louis Tuaillon <strong>zu</strong> Pfer<strong>de</strong> dargestellt. Es war das letzte Reiterstandbild, das <strong>de</strong>m Kaiser in<br />
Deutschland errichtet wur<strong>de</strong>. Ihm gegenüber steht das Standbild <strong>de</strong>s ehemaligen Reichskanzlers Otto von Bismarck von Emil Hundrieser.<br />
Am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Burgfelds steht auf einer Grünfläche <strong>de</strong>r Nachguss <strong>de</strong>r Mädchengruppe von Karl Geiser, die <strong>de</strong>r Lübecker Ehrenbürger Rodolfo Groth stiftete. Sie war ursprünglich für<br />
<strong>de</strong>n Markt im Zentrum gedacht.<br />
Der Stadtteil Moisling verfügt mit <strong>de</strong>r E<strong>de</strong>lstahl-Wandplastik am Haus für alle von Günter Ferdinand Ris über eine Arbeit eines documenta-Teilnehmers.<br />
Hauptartikel <strong>zu</strong>r Kunst im Öffentlichen Raum sind Erinnerungs- und Denkmale in Lübeck und Skulpturen und Objekte in Lübeck.<br />
Lübecker Stiftungskultur<br />
Seit <strong>de</strong>m Mittelalter hat das Stiften in Lübeck Tradition. Ursprünglich wollten sich begüterte Kaufleute so ihr Seelenheil sichern. Das Heiligen-Geist-Hospital ist heute wohl die älteste<br />
bestehen<strong>de</strong> Stiftung in Lübeck. Viele <strong>de</strong>r Lübecker Gänge und Höfe beruhen auf Stiftungen Lübecker Kaufleute. Ohne das Engagement <strong>de</strong>r in Lübeck ansässigen großen und kleinen<br />
Stiftungen wäre das reichhaltige Kulturleben <strong>de</strong>r Stadt nicht <strong>de</strong>nkbar und <strong>de</strong>r Erhalt <strong>de</strong>s Kulturerbes nicht darstellbar. Die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck betreut die Lübecker<br />
Museumslandschaft. Lübecks älteste Bürgerinitiative, die<br />
• Gesellschaft <strong>zu</strong>r Beför<strong>de</strong>rung gemeinnütziger Tätigkeit<br />
ist auch Treuhän<strong>de</strong>rin für eine Vielzahl kleinerer Stiftungen.<br />
Weitere wichtige gemeinnützige Stiftungen in Lübeck sind die<br />
• Parcham’sche Stiftung,<br />
• Possehl-Stiftung,<br />
• Dräger-Stiftung,<br />
• Gemeinnützige Sparkassenstiftung <strong>zu</strong> Lübeck und die<br />
• Edith-Fröhnert-Stiftung.<br />
Lübeck ist bis heute die Stadt mit <strong>de</strong>r größten „Stiftungsdichte“ Schleswig-Holsteins.[29]<br />
Tourismus, Freizeit und Erholung<br />
Tourismus<br />
Lübeck kennt im Bereich <strong>de</strong>r Altstadt <strong>de</strong>n Städtetourismus, <strong>de</strong>r sich in <strong>de</strong>n letzten Jahren bedingt durch die Entwicklung <strong>de</strong>s Flughafens mit seinen preiswerten innereuropäischen<br />
Linienverbindungen im bun<strong>de</strong>sweiten Trend überdurchschnittlich entwickelt hat. Zielgruppen im Ausland sind die Ostsee-Anrainerstaaten, Italien und England. In diesem Bereich ist<br />
Lübeck <strong>de</strong>r wichtigste Faktor im Tourismus in Schleswig-Holstein. Daneben bietet das Seebad Travemün<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Lübecker Bucht alle Möglichkeiten eines mo<strong>de</strong>rnen Ostseeba<strong>de</strong>s.<br />
Neben <strong>de</strong>n Stadtführungen bieten Ausflugsboote auch eine Umrundung <strong>de</strong>r Altstadtinsel an. Eine Beson<strong>de</strong>rheit sind Stadtführungen in <strong>de</strong>n Abendstun<strong>de</strong>n, geführt von einem<br />
Nachtwächter.
Freizeit und Erholung im Stadtgebiet<br />
Wasser, Grünflächen und ausge<strong>de</strong>hnte Wäl<strong>de</strong>r bestimmen das Stadtgebiet Lübecks, das <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n größten kommunalen Waldbesitzern Deutschlands gehört. Die Gewässer von Trave,<br />
Wakenitz und Elbe-Lübeck-Kanal sind landseitig von Wan<strong>de</strong>rwegen erschlossen und größtenteils mit <strong>de</strong>n großzügigen und ausge<strong>de</strong>hnten Parkanlagen verbun<strong>de</strong>n. Mit <strong>de</strong>m Freibad an<br />
<strong>de</strong>r Falkenwiese von 1899 am Westufer <strong>de</strong>r Wakenitz hat die Stadt Lübeck ein unter Denkmalschutz stehen<strong>de</strong>s Flussschwimmbad. Auf <strong>de</strong>r Trave verkehren Ausflugsschiffe zwischen<br />
Lübeck und Travemün<strong>de</strong> und auf <strong>de</strong>r Wakenitz bis nach Rothenhusen mit Anschlussmöglichkeit über <strong>de</strong>n Ratzeburger See nach Ratzeburg in <strong>de</strong>n Naturpark Lauenburgische Seen<br />
(östlich <strong>de</strong>s Sees: Biosphärenreservat Schaalsee). Die Stadtwäl<strong>de</strong>r wie das Lauerholz und die Naturschutzgebiete an Wakenitz und Trave (Lagune im Schellbruch, Dummersdorfer Ufer<br />
mit <strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nkmal <strong>de</strong>r mittelalterlichen Burg an <strong>de</strong>r Stülper Huk) in unmittelbarer Nähe <strong>zu</strong>m Stadtgebiet wie das Nebeneinan<strong>de</strong>r von Seebad und mittelalterlichem Weltkulturerbe<br />
im gemeinsamen Geist hanseatischer Tradition machen einen wichtigen Teil <strong>de</strong>r Lebensqualitäten und <strong>de</strong>s Freizeitwertes <strong>de</strong>r Stadt aus. Der Travelauf mit <strong>de</strong>n anliegen<strong>de</strong>n<br />
Naturschutzgebieten wur<strong>de</strong> als FFH-Gebiet an die Europäische Union gemel<strong>de</strong>t.<br />
Insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>n Wäl<strong>de</strong>rn in und um Lübeck fin<strong>de</strong>n sich etliche Hünengräber aus <strong>de</strong>r Steinzeit, unter an<strong>de</strong>rem im Stadtgebiet in <strong>de</strong>n Forsten von Blankensee und Waldhusen. Durch<br />
<strong>de</strong>n Wald von Waldhusen führt als Rundweg ein archäologischer Wan<strong>de</strong>rweg.[30] Bei Pöppendorf ist eine <strong>de</strong>r größten und besterhaltenen Burganlagen aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong>n <strong>zu</strong><br />
besichtigen. Diese Ringburg ist eine slawische Fluchtburg und hat einen Durchmesser von rund 100 Metern bei einer äußeren Wallhöhe von 8 bis 12 Metern.<br />
Freizeit und Erholung in <strong>de</strong>r näheren Umgebung <strong>de</strong>r Stadt<br />
Auch die nähere Umgebung <strong>de</strong>r Stadt bietet eine Vielzahl von Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten: neben <strong>de</strong>n Seebä<strong>de</strong>rn an <strong>de</strong>r Lübecker Bucht die Seen und Wäl<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Holsteinischen Schweiz um die Resi<strong>de</strong>nzstadt Eutin (mit <strong>de</strong>n Carl Maria von Weber-Festspielen auf <strong>de</strong>r Freilichtbühne im Schlosspark direkt am Eutiner See), <strong>de</strong>n Klützer Winkel und<br />
die Hansestadt Wismar auf <strong>de</strong>r Mecklenburger Seite <strong>de</strong>r Lübecker Bucht, <strong>de</strong>n Naturpark Lauenburgische Seen mit <strong>de</strong>r Inselstadt Ratzeburg und <strong>de</strong>r Stadt Mölln an <strong>de</strong>r Alten Salzstraße,<br />
und nicht <strong>zu</strong>letzt <strong>de</strong>n Sachsenwald.<br />
Im Rahmen <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>smo<strong>de</strong>llprogramms „Regionen Aktiv – Land gestaltet Zukunft“ hat <strong>de</strong>r Bereich Umwelt <strong>de</strong>r Hansestadt Lübeck gemeinsam mit <strong>de</strong>r „Regionalpartnerschaft<br />
Lübecker Bucht e. V.“ <strong>de</strong>n Erholungsführer „Lübeck Natürlich! Naturnahe Erholung in <strong>de</strong>r Region Lübeck“ herausgegeben. Aufgrund <strong>de</strong>s Erfolges <strong>de</strong>r ersten Auflage 2004/2005 wur<strong>de</strong><br />
jetzt eine zweite Ausgabe 2006/2007 mit neuen Themenschwerpunkten und Ausflugszielen verausgabt.[31]<br />
Auch die Städte <strong>de</strong>s Umlands bieten eigene Attraktionen, wie <strong>zu</strong>m Beispiel Bad Segeberg mit <strong>de</strong>n Karl-May-Festspielen. Größter Freizeitpark ist <strong>de</strong>r Hansa-Park in Sierksdorf.<br />
Regelmäßige Veranstaltungen<br />
• Januar: Kringelhöge<br />
• Februar/Dezember: Marzipan-Show im Lübecker Marzipan-Speicher<br />
• Februar: HanseBike<br />
• Mai: Han<strong>de</strong>l und Hanse<br />
• Mai: Lübecker Ru<strong>de</strong>rregatta an <strong>de</strong>r Wakenitz<br />
• Juli: Drachenbootrennen auf <strong>de</strong>m Kanal<br />
• Juli: Lübecker Volks- und Erinnerungsfest, auf <strong>de</strong>m Volksfestplatz (Lübeck)<br />
• Juli: Travemün<strong>de</strong>r Woche<br />
• Juli: Sommerfest <strong>de</strong>r Hüxstraße (wechseln<strong>de</strong> Län<strong>de</strong>rschwerpunkte)<br />
• Juli/August: Schleswig-Holstein Musik Festival<br />
• Juli-September: Sand World (2003–2007)<br />
• August: Duckstein Festival, früher Traveuferfest
• August: Christopher Street Day<br />
• September: alle zwei Jahre Altstadtfest<br />
• November: Nordische Filmtage Lübeck<br />
• Dezember: Ice World (2003–2006)<br />
• Dezember: Lübecker Weihnachtsmarkt<br />
• Dezember: Mittelaltermarkt<br />
• Dezember: Eisarsch-Regatta<br />
Bräuche<br />
• Mai: In <strong>de</strong>r Nacht <strong>zu</strong>m ersten Mai fin<strong>de</strong>t gegen Mitternacht das alljährliche Mai-Singen unter <strong>de</strong>n Arka<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Rathauses statt. Junge und alte Sänger begrüßen dabei mitten in<br />
<strong>de</strong>r Nacht <strong>de</strong>n Mai mit <strong>de</strong>m Lied Der Mai ist gekommen <strong>de</strong>s Lübecker Dichters Emanuel Geibel, das von Justus Wilhelm Lyra vertont wur<strong>de</strong>. Die Veranstaltung ist nicht<br />
organisiert und wird nicht kommerziell ausgenutzt. Es han<strong>de</strong>lt sich eher um eine – vielleicht auch lokalpatriotische – Zusammenkunft Lübecker Familien. Der Initiator war nach<br />
<strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg Otto Anthes mit seinem „Eulen“-Tisch.[32]<br />
Kulinarische Spezialitäten<br />
Beinahe schon weltweite Berühmtheit hat das Lübecker Marzipan, das seit <strong>de</strong>m späten Mittelalter in Lübeck hergestellt wird. Bekannte aktuelle Hersteller sind Nie<strong>de</strong>regger, <strong>de</strong>r<br />
Lübecker Marzipan-Speicher und Erasmi & Carstens. Eine ebenso süße Leckerei ist <strong>de</strong>r Plettenpudding, <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Bud<strong>de</strong>nbrooks Erwähnung fin<strong>de</strong>t: eine aus mehreren Schichten<br />
bestehen<strong>de</strong> Süßspeise. In <strong>de</strong>n Bud<strong>de</strong>nbrooks fin<strong>de</strong>t auch <strong>de</strong>r Lübecker National Erwähnung: ein <strong>de</strong>ftiger Gemüseeintopf mit Spargel, Möhren und Rindfleisch. Der Lübecker National ist<br />
ein typisches Beispiel dafür, dass die Lübecker Küche in ihren regionalen, nord<strong>de</strong>utschen Eigenarten mehr einer frugalen Variante <strong>de</strong>r Hamburger entspricht als <strong>de</strong>r Schleswig-Holsteiner<br />
Küche. Beim Lübecker Rotspon han<strong>de</strong>lt es sich um Rotwein, <strong>de</strong>r früher auf Fahrten nach Bor<strong>de</strong>aux als Ballast auf <strong>de</strong>m Rückweg mitgeführt wur<strong>de</strong>, bis man merkte, dass durch die<br />
Lagerung im Meeresklima <strong>de</strong>r Wein eine beson<strong>de</strong>re Note erhielt. Analog da<strong>zu</strong> gibt es heute auch <strong>de</strong>n Wittspon, <strong>de</strong>r aus Weißwein hergestellt wird. Traditionelle Weinhändler in Lübeck<br />
sind Carl Tesdorpf und von Melle, hier kann man auch <strong>de</strong>n Rotspon erwerben, <strong>de</strong>n es ähnlich wie an<strong>de</strong>ren Rotwein in unterschiedlichen Qualitätsstufen gibt.<br />
Eines von drei Sternerestaurants in Lübeck ist das Restaurant Wullenwever von Roy Petermann; die bei<strong>de</strong>n weiteren sind Hotelrestaurants in Travemün<strong>de</strong>.<br />
Vereine<br />
Der 1919 gegrün<strong>de</strong>te VfB Lübeck ist <strong>de</strong>r bekannteste Sportverein <strong>de</strong>r Stadt. Seine erste Herren-Fußballmannschaft spielt <strong>zu</strong>rzeit in <strong>de</strong>r Regionalliga Nord. Sein Heimstadion ist das<br />
Stadion an <strong>de</strong>r Lohmühle. Größter Erfolg war <strong>de</strong>r zweimalige Ein<strong>zu</strong>g in die Zweite Fußballbun<strong>de</strong>sliga 1996 beziehungsweise 2003, sowie das Erreichen <strong>de</strong>s Halbfinales im DFB-Pokal<br />
in <strong>de</strong>r Saison 2003/04. Die erste Fußballmannschaft <strong>de</strong>s FC Phönix Lübeck spielte in <strong>de</strong>n 1960er Jahren in <strong>de</strong>r höchsten Spielklasse. Zu <strong>de</strong>n größeren Sportvereinen gehört auch <strong>de</strong>r TSV<br />
Siems. Der Lübecker Schachverein von 1873 war von 2001 bis 2003 Deutscher Meister und 2001 und 2002 Deutscher Pokalsieger. Neben <strong>de</strong>r Waldjugend gibt es auch mehrere<br />
Pfadfin<strong>de</strong>rgruppen, darunter <strong>de</strong>r Bund freier Pfadfin<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Stamm <strong>de</strong>r Freibeuter und <strong>de</strong>r Bund <strong>de</strong>r Pfadfin<strong>de</strong>rinnen und Pfadfin<strong>de</strong>r e. V.. Mit <strong>de</strong>n Lübeck Cougars ist die<br />
Hansestadt auch in <strong>de</strong>r GFL 2, <strong>de</strong>r zweiten Bun<strong>de</strong>sliga im American Football, vertreten.<br />
Literatur<br />
• Heinrich Christian Zietz: Ansichten <strong>de</strong>r freien Hansestadt Lübeck und ihrer Umgebungen. Mit 16 Kupfern. Friedrich Wilmans, Frankfurt M 1822, Weiland, Lübeck 1978 (Repr.).<br />
• Otto Grautoff: Lübeck. Stätten <strong>de</strong>r Kultur. Bd 9. Klinkhardt & Biermann, Leipzig 1908.<br />
• Fritz Endres (Hrsg.): Geschichte <strong>de</strong>r freien und Hansestadt Lübeck. Otto Quitzow, Lübeck 1926, Weidlich, Frankfurt M 1981 (Repr.), ISBN 3-8035-1120-8<br />
• Erich Keyser (Hrsg.): Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte. Bd 1. Nordost<strong>de</strong>utschland. Im Auftrag <strong>de</strong>r Konferenz <strong>de</strong>r lan<strong>de</strong>sgeschichtlichen Kommissionen<br />
Deutschlands mit <strong>de</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Deutschen Gemein<strong>de</strong>tages. Kohlhammer, Stuttgart 1939.
• Abram Enns: Kunst und Bürgertum – Die kontroversen zwanziger Jahre in Lübeck. Christians – Weiland, Hamburg – Lübeck 1978, ISBN 3-7672-0571-8<br />
• Lübeck 1226 – Reichsfreiheit und frühe Stadt. Scheffler, Lübeck 1976.<br />
• Gerhard Schnei<strong>de</strong>r: Gefährdung und Verlust <strong>de</strong>r Eigenstaatlichkeit <strong>de</strong>r Freien und Hansestadt Lübeck und seine Folgen. Schmidt-Römhild, Lübeck 1986, ISBN 3-7950-0452-7<br />
• Antjekathrin Graßmann (Hrsg.): Lübeckische Geschichte. Schmidt-Römhild, Lübeck 1989, ISBN 3-7950-3203-2<br />
• Ernst Deecke: Lübische Geschichten und Sagen. Schmidt-Römhild, Lübeck 1973<br />
• Peter Guttkuhn: Kleine <strong>de</strong>utsch-jüdische Geschichte in Lübeck. Von <strong>de</strong>n Anfängen bis <strong>zu</strong>r Gegenwart. Lübeck 2004. ISBN 978-3-7950-7005-2<br />
• Heinz Stoob: Stadtmappe Lübeck. in: Deutscher Städteatlas. Bd 3. Teilband 6. Acta Collegii Historiae Urbanae Societatis Historicorum Internationalis. Serie C. Im Auftrag <strong>de</strong>s<br />
Kuratoriums für vergleichen<strong>de</strong> Städtegeschichte e. V. und mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Deutschen Forschungsgemeinschaft, hrsg. von Heinz Stoob, Wilfried Ehbrecht, Jürgen Lafrenz<br />
und Peter Johannek. Dortmund-Altenbeken 1984, ISBN 3-89115-006-7<br />
• Lübeck-Lexikon. Die Hansestadt von A bis Z. Hrsg. von Antjekathrin Graßmann. Schmidt-Römhild, Lübeck 2006, ISBN 3-7950-7777-X<br />
• Manfred Finke: UNESCO-Weltkulturerbe Altstadt von Lübeck. Stadt<strong>de</strong>nkmal <strong>de</strong>r Hansezeit. Wachholtz-Verlag, Neumünster 2006, ISBN 978-3-529-01335-5.<br />
• Stefanie Rüther: Prestige und Herrschaft. Zur Repräsentation <strong>de</strong>r Lübecker Ratsherren in Mittelalter und Früher Neuzeit (Norm und Struktur 16). Böhlau, Köln (u. a.) 2003.<br />
• Uwe Albrecht (Hrsg.): Corpus <strong>de</strong>r mittelalterlichen Holzskulptur und Tafelmalerei in Schleswig-Holstein. Band 2: Hansestadt Lübeck. Die Kirchen <strong>de</strong>r Stadt, Verlag Ludwig,<br />
Kiel 2009, ISBN 978-3-933598-76-9<br />
• Verein für Lübeckische Geschichte und Alterthumskun<strong>de</strong> (Hrsg.): Siegel <strong>de</strong>s Mittelalters. 5.–10. Heft (Siegel <strong>de</strong>s Mittelalters aus <strong>de</strong>n Archiven <strong>de</strong>r Stadt Lübeck, Volumes 5-10<br />
in <strong>de</strong>r Google Buchsuche).<br />
Anmerkungen<br />
1. ↑ Statistikamt Nord: Bevölkerung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n in Schleswig-Holstein am 31. Dezember 2008 (PDF-Datei; 539 kB) (Hilfe da<strong>zu</strong>)<br />
2. ↑ Der Name ist slawischen Ursprungs und wur<strong>de</strong> im Verlauf <strong>de</strong>r Jahrhun<strong>de</strong>rte umge<strong>de</strong>utet und umgeformt (siehe da<strong>zu</strong> im Einzelnen Wolfgang Laur: Historisches<br />
Ortsnamenlexikon von Schleswig-Holstein, 2. Aufl., Neumünster 1992, S. 437). Auf mittelalterliche Namensformen geht die regionale Aussprache mit langem geschlossenen e<br />
<strong>zu</strong>rück, also, vgl. Dehnungs-c; neueren Ursprungs ist die bühnen<strong>de</strong>utsche Aussprache.<br />
3. ↑ Geoklima 2.1<br />
4. ↑ Antjekathrin Graßmann: Lübeckische Geschichte. Schmidt-Römhild, Lübeck 1997. ISBN 3-7950-3215-6<br />
5. ↑ Adam von Bremen: la:Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Hahn, Hannover 1993. ISBN 3-7752-5288-6<br />
6. ↑ Gerhard Schnei<strong>de</strong>r: Gefährdung und Verlust <strong>de</strong>r Eigenstaatlichkeit <strong>de</strong>r Freien und Hansestadt Lübeck und seine Folgen; Veröffentlichungen <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Hansestadt<br />
Lübeck, Reihe B Band 14,Verlag Schmidt-Römhild, 1986, ISBN 3-7950-0452-7<br />
7. ↑ Manfred Bannow-Lindtke: bad Schwartau unterm Hakenkreuz; Albers & Range, Bad Schwartau 1993<br />
8. ↑ Lübeckisches Adressbuch, Verlag Max Schmidt<br />
9. ↑ Gerhard Schnei<strong>de</strong>r: Gefährdung und Verlust <strong>de</strong>r Eigenstaatlichkeit <strong>de</strong>r freien und Hansestadt Lübeck und seine Folgen, Verlag Schmidt-Römhild <strong>zu</strong> Lübeck 1986, ISBN 3-<br />
7950-0452-7<br />
10.↑ 1945: Wie Lübeck <strong>de</strong>m Endkampf entging. In: Lübecker Nachrichten vom 8. Mai 2010, S. 3.<br />
11.↑ Statistik Hansestadt Lübeck (pdf)<br />
12.↑ Dr. Robert Dollinger: Geschichte <strong>de</strong>r Mennoniten in Schleswig-Holstein, Hamburg und Lübeck. In: Quellen und Forschungen <strong>zu</strong>r Geschichte Schleswig-Holsteins, Band 17,<br />
Neumünster 1930<br />
13.↑ Dr. Werner Neugebauer: Schönes Holstein, Lübeck 1967, Seite 97<br />
14.↑ EFG Lübeck, Geschichte
15.↑ Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in Lübeck über die Lübecker Methodisten<br />
16.↑ Peter Guttkuhn: Kleine <strong>de</strong>utsch-jüdische Geschichte in Lübeck. Schmidt-Römhild, Lübeck 2004. ISBN 3-7950-7005-8<br />
17.↑ a b Kommunale Wappenrolle Schleswig-Holstein : kreisfreie Stadt Lübeck. Lan<strong>de</strong>sarchiv Schleswig-Holstein, abgerufen am 27. April 2010.<br />
18.↑ Josephine von Zastrow: Wird die Hüxstraße <strong>zu</strong>r Fußgängerzone? In: Lübecker Nachrichten vom 18. Dezember 2008, S. 15<br />
19.↑ Lan<strong>de</strong>sweiter Nahverkehrsplan für <strong>de</strong>n Schienenpersonennahverkehr in Schleswig-Holstein (pdf, 10 MB)<br />
20.↑ http://www.xxx<br />
21.↑ http://www.xxx<br />
22.↑ Lübecker Stadtzeitung<br />
23.↑ Quirin Schiermeier: German states wield the axe. In naturenews [1]<br />
24.↑ Frank Pergan<strong>de</strong>: Die Angst, eine Zukunftsbranche <strong>zu</strong> verlieren In: FAZ.Net vom 24. Juni 2010<br />
25.↑ Lübeck-kämpft.<strong>de</strong><br />
26.↑ Taschenoper Lübeck<br />
27.↑ Ludwig Ewers: Die Großvaterstadt (1926); Dräger Druck, 3. Auflage, 1980, ISBN 978-3-925402-09-8<br />
28.↑ Emanuel Geibel: Ein Ruf von <strong>de</strong>r Trave (1844)<br />
29.↑ Städteranking 2009<br />
30.↑ Rad- und Wan<strong>de</strong>rkarte Dassow-Travemün<strong>de</strong>. Verlag Grünes Herz, Ilmenau/Thüringen, 3. aktualisierte Auflage 2006<br />
31.↑ Ursula Kühn: Lübeck Natürlich. Lübeck 2004<br />
32.↑ Bernd Gatermann und Peter Guttkuhn: „Zur Eule“. Erinnerungen an eine Lübecker Künstlerkneipe. In: Der Wagen. 1986, S. 176–183. ISSN 0933-484 X.<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Geschichte <strong>de</strong>r Hansestadt Lübeck<br />
Chronologische Übersicht<br />
• 819 Erste slawische Burganlage von Alt-Lübeck am Zusammenfluss von Trave und Schwartau.<br />
• 1072 Der Name „Liubice“ wird in <strong>de</strong>r Chronik <strong>de</strong>s Geschichtsschreibers Adam von Bremen genannt.<br />
• 1138 Zerstörung Alt-Lübecks, innerslawische Machtkämpfe.<br />
• 1143 Graf Adolf II. von Schauenburg grün<strong>de</strong>t die <strong>de</strong>utsche Stadt Lübeck auf <strong>de</strong>r Halbinsel zwischen Trave und Wakenitz als beschei<strong>de</strong>ne kaufmännische Siedlung neben einer
slawischen Nie<strong>de</strong>rlassung.<br />
• 1159 Graf Adolf II. überläßt <strong>de</strong>n Hügel Buku (heutige Lübecker Innenstadt) Herzog Heinrich <strong>de</strong>m Löwen, <strong>de</strong>r Lübeck dort ein zweites Mal entstehen lässt.<br />
• 1226 Die nord<strong>de</strong>utschen Fürsten und Städte können die dänische Vorherrschaft abschütteln, Kaiser Friedrich II. erteilt Lübeck das Reichsfreiheitsprivileg. Lübeck wird Freie<br />
Reichstadt, soll auf ewig <strong>de</strong>m Reichsoberhaupt unterstehen. Die Bestimmung bleibt 711 Jahre, bis 1937, in Kraft.<br />
• 1227 Nord<strong>de</strong>utsche Fürsten und Städte, darunter Lübeck, besiegen in <strong>de</strong>r Schlacht bei Bornhöved <strong>de</strong>n Fürsten Wal<strong>de</strong>mar endgültig. Zum Dank wird in Lübeck das<br />
Dominikanerkloster an <strong>de</strong>r Stelle <strong>de</strong>r ehemaligen königlichen Burg gegrün<strong>de</strong>t (Burgkloster).<br />
• 1358 Erster Hansetag in Lübeck. Der Ausdruck „Städte von <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Hanse“ wird erstmals urkundlich belegt. Die Hanse als Organisationsform ist allmählich, nicht durch<br />
einen Gründungsakt, entstan<strong>de</strong>n.<br />
• 1367–1370 Zweiter siegreicher Krieg gegen König Wal<strong>de</strong>mar, abgeschlossen durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Stralsund und Sicherung <strong>de</strong>r hansischen Privilegien und<br />
Wirtschaftsinteressen im Nor<strong>de</strong>n.<br />
• 1563–1570 Nordischer siebenjähriger Krieg (Lübeck mit Dänemark gegen Schwe<strong>de</strong>n), letzter ehrenvoller, aber erfolgloser Seekrieg <strong>de</strong>r Stadt, been<strong>de</strong>t durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von<br />
Stettin<br />
• 1669 Neun Städte <strong>de</strong>r Hanse treten in Lübeck <strong>zu</strong>m letzten Mal <strong>zu</strong>sammen. Lübeck, Hamburg und Bremen bleiben bis ins 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt als Freie und Hansestädte die Erben.<br />
• 1810 Gewaltsame Anglie<strong>de</strong>rung an das französische Reich, Lübecker Franzosenzeit<br />
• 1813 Übergabe <strong>de</strong>r Stadt an Kronprinz Bernadotte aus Schwe<strong>de</strong>n (Alliierter)<br />
• 1815 Lübeck wird Mitglied <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>s.<br />
• 1866 Eintritt in <strong>de</strong>n Nord<strong>de</strong>utschen Bund.<br />
• 1871 Die Freie und Hansestadt Lübeck wird Gliedstaat <strong>de</strong>s Reiches.<br />
• 1897 Im Zuge <strong>de</strong>r Heeresververmehrung erhält Lübeck sein eigenes, das 3. Hanseatische, Regiment<br />
• 1911 Lübeck wird Großstadt<br />
• 1933 Abset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Senates, Abschaffung <strong>de</strong>r Bürgerschaft, Regierung durch Bevollmächtigten <strong>de</strong>r NSDAP. Gemeinsamer „Reichsstatthalter“ für Lübeck und Mecklenburg mit<br />
Sitz in Schwerin.<br />
• 1937 Abschaffung <strong>de</strong>r Reichsfreiheit Lübecks, Einglie<strong>de</strong>rung in die preußische Provinz Schleswig-Holstein.<br />
• 1942 Am 28. März wer<strong>de</strong>n große Teile <strong>de</strong>r Altstadt durch Bomben vernichtet.<br />
• 1945 Lübeck wird kampflos von britischen Truppen besetzt.<br />
• 1987 Die UNESCO erklärt Lübeck <strong>zu</strong>m Weltkulturerbe – das erste Kultur<strong>de</strong>nkmal dieser Art in <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik.<br />
• 1993 Lübeck feiert 850 Jahre Hansestadt Lübeck<br />
Die Geschichte Lübecks lässt sich bis 700 n. Chr. <strong>zu</strong>rückverfolgen, als die Siedlung Liubice gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Das Mittelalter war geprägt von <strong>de</strong>r Hanse.<br />
Von einer ersten Besiedlung nach <strong>de</strong>r Weichseleiszeit kün<strong>de</strong>n heute noch zahlreiche Hünengräber <strong>de</strong>r Jungsteinzeit im Stadtgebiet und <strong>de</strong>r näheren Umgebung wie das Pöppendorfer<br />
Großsteingrab im Waldhusener Forst und das Großsteingrab Blankensee.<br />
Frühe Besiedlung und Herkunft <strong>de</strong>s Stadtnamens<br />
Im Osten Holsteins begann die slawische Besie<strong>de</strong>lung ab zirka 700 nach Christus, nach<strong>de</strong>m vorherige germanische Bewohner nach Westen abgewan<strong>de</strong>rt waren. Der etwa <strong>zu</strong>r Zeit Karls<br />
<strong>de</strong>s Großen (748–814) entstan<strong>de</strong>ne Ort Liubice („die Liebliche“ [1]) lag nördlich <strong>de</strong>r Lübecker Altstadtinsel zwischen <strong>de</strong>r heutigen Teerhofinsel und <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>r Schwartau in die<br />
Trave. Als wichtiges Bo<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nkmal wur<strong>de</strong> er durch eingehen<strong>de</strong> Ausgrabungen untersucht. In diese Zeit gehört auch <strong>de</strong>r Pöppendorfer Ringwall. Seit <strong>de</strong>m 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt war Liubice<br />
neben Ol<strong>de</strong>nburg in Holstein (Starigard) die wichtigste Siedlung <strong>de</strong>r Abodriten. Das in <strong>de</strong>r Mecklenburg und Liubice sesshafte Geschlecht <strong>de</strong>r Nakoni<strong>de</strong>n lag mit <strong>de</strong>n Liutizen in<br />
ständigen kriegerischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen. Wahrscheinlich war Liubice bereits in dieser Zeit burgartig befestigt. Nach <strong>de</strong>r <strong>de</strong>ndrochronologisch auf das Jahr 819 bestimmten<br />
Gründung <strong>de</strong>r Burg [2] wur<strong>de</strong> Liubice erstmals um das Jahr 1076 von Adam von Bremen [3] erwähnt, <strong>de</strong>r auch von <strong>de</strong>r Steinigung <strong>de</strong>s Ansverus im Jahr 1066 bei Einhaus berichtet. Im
Jahr 1093 übernahm <strong>de</strong>r christliche Nakoni<strong>de</strong> Heinrich die Herrschaft über die Abodriten und machte Liubice <strong>zu</strong> seiner Resi<strong>de</strong>nz. Nach seinem Tod im Jahr 1127 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ort von <strong>de</strong>n<br />
Ranen nie<strong>de</strong>rgebrannt.<br />
Deutsche Kolonisation und Lübecker Burg<br />
In <strong>de</strong>r heutigen Lage auf <strong>de</strong>m Hügel Buku, Standort einer ehemaligen wendischen Burg zwischen Trave und Wakenitz, wur<strong>de</strong> die Stadt Lübeck 1143 durch Adolf II., Graf von<br />
Schauenburg und Holstein als erste <strong>de</strong>utsche Hafenstadt an <strong>de</strong>r Ostsee neu gegrün<strong>de</strong>t. Er legte hier die erste für Lübeck dokumentarisch aufgeführte Burg, einen Holz-Er<strong>de</strong>-Wall, an,<br />
welche 1147 von Helmold von Bosau [4] erwähnt wur<strong>de</strong>. Mittels Grabungen aus <strong>de</strong>r Neuzeit konnte ein Brunnen für die Zeit um 1155 bestimmt wer<strong>de</strong>n. Die Burganlage musste Adolf<br />
1158 an Heinrich <strong>de</strong>n Löwen abtreten, als er durch seine Einmischung in die dänischen Thronstreitigkeiten <strong>de</strong>ssen Un<strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>nheit erregt hatte. 1150 verlegte Heinrich das Bistum<br />
Ol<strong>de</strong>nburg nach Lübeck an die Marienkirche. Nach Heinrichs Sturz wur<strong>de</strong> die Burg von 1181 bis 1189 kaiserlich, anschließend bis 1192 dann wie<strong>de</strong>r herzoglich-sächsisch. Für <strong>de</strong>n<br />
kurzen Zeitraum von 1192 bis 1201 ist sie wie<strong>de</strong>r in gräflich-holsteinischem Besitz gewesen und wur<strong>de</strong> 1217 von König Wal<strong>de</strong>mar II von Dänemark übernommen. Nach <strong>de</strong>ssen<br />
Nie<strong>de</strong>rlage in <strong>de</strong>r Schlacht bei Bornhöved (1227) wur<strong>de</strong> an ihrer Stelle das Burgkloster errichtet, in das Dominikanermönche einzogen.[5][6].<br />
Die Zeit <strong>de</strong>r Hanse bis <strong>zu</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Stralsund<br />
Anfänge<br />
Nach einem Brand 1157 wur<strong>de</strong> Lübeck von Heinrich <strong>de</strong>m Löwen wie<strong>de</strong>raufgebaut, <strong>de</strong>r hierfür seine Stadt Bardowick aufgab. 1160 erhielt Lübeck das Soester Stadtrecht. Dieser<br />
Zeitpunkt wird heute von Historikern [7] als <strong>de</strong>r Beginn <strong>de</strong>r Kaufmannshanse (im Gegensatz <strong>zu</strong>r späteren Städtehanse) angesehen. Wichtigstes Argument für diese Position stellt dabei<br />
das Artlenburger Privileg von 1161 dar, in <strong>de</strong>m Lübecker Kaufleute <strong>de</strong>n bisher im Ostseehan<strong>de</strong>l dominieren<strong>de</strong>n gotländischen Kaufleuten rechtlich gleichgestellt wer<strong>de</strong>n sollten. In<br />
dieser Zeit begann durch Helmold von Bosau und seinen Nachfolger Arnold von Lübeck [8] mit <strong>de</strong>r Chronica Slavorum die umfassen<strong>de</strong> schriftliche Überlieferung <strong>de</strong>s Zeitgeschehens in<br />
Nordost<strong>de</strong>utschland.[9] Das Barbarossa-Privileg von 1188 sicherte <strong>de</strong>r Neugründung <strong>de</strong>n territorialen Bestand und die Han<strong>de</strong>lsmöglichkeiten.<br />
Die <strong>de</strong>r Stadt von Heinrich <strong>de</strong>m Löwen mitgegebene Ratsverfassung beruhte auf einem Stadtrat von 24 Ratsherren, <strong>de</strong>r sich aus <strong>de</strong>n Zusammenschlüssen <strong>de</strong>r Kaufleute selbst durch<br />
Zuwahl ergänzte und aus seiner Mitte bis <strong>zu</strong> vier Bürgermeister wählte. So konnten nur die wirtschaftlich stärksten Kaufmannsfamilien in <strong>de</strong>n Rat gelangen, es durfte allerdings nur<br />
jeweils ein Mitglied einer Familie im Rat sein, nie zwei gleichzeitig. Dieses Mo<strong>de</strong>ll <strong>de</strong>r Verfassung blieb bis <strong>zu</strong>m 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt weitgehend erhalten. Damit war die Grundlage für <strong>de</strong>n<br />
ausschließlich an <strong>de</strong>n Interessen <strong>de</strong>r Fernhan<strong>de</strong>lskaufleute ausgerichteten rasanten Aufstieg Lübecks <strong>zu</strong>r Han<strong>de</strong>lsmacht in Nor<strong>de</strong>uropa von <strong>de</strong>r inneren Struktur gelegt. Um 1200 nahm<br />
<strong>de</strong>r Hafen und die Schifffahrt weiter Aufschwung: Lübeck wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Auswan<strong>de</strong>rungshafen für die Ostkolonisation <strong>de</strong>s Deutschen Or<strong>de</strong>ns in Livland, die unter <strong>de</strong>m Hochmeister<br />
Hermann von Salza ihren Höhepunkt erreichte (Gol<strong>de</strong>ne Bulle von Rimini vom März 1226).<br />
Kurz darauf erlangte Lübeck im Juni 1226 von Kaiser Friedrich II. mit <strong>de</strong>m Reichsfreiheitsbrief die Reichsfreiheit und wur<strong>de</strong> reichsunmittelbare Stadt. Die Stadt nahm durch ihre<br />
günstige geografische Lage und <strong>de</strong>n neuen Schiffstyp Hansekogge, die ein Vielfaches an Frachtgut im Vergleich <strong>zu</strong> früheren Schiffstypen beför<strong>de</strong>rn konnte, rasch Aufschwung. Die<br />
Bedrohung <strong>de</strong>r Eigenständigkeit durch die dänische Machtaus<strong>de</strong>hnung unter Wal<strong>de</strong>mar II. wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Schlacht bei Bornhöved erfolgreich abgewehrt. In <strong>de</strong>r Folge <strong>de</strong>s Einfalls <strong>de</strong>s<br />
lüneburgischen Herzogs Otto (1301) ging die Stadt da<strong>zu</strong> über eine Landwehr <strong>zu</strong> errichten.<br />
Lübeck als Königin <strong>de</strong>r Hanse<br />
Nach<strong>de</strong>m 1361 Wisby, <strong>de</strong>r erste Hauptort <strong>de</strong>r Hanse, vom dänischen König Wal<strong>de</strong>mar IV. Atterdag erobert wor<strong>de</strong>n war, wur<strong>de</strong> Lübeck <strong>zu</strong>m neuen Hauptort <strong>de</strong>r Hanse (auch Königin <strong>de</strong>r<br />
Hanse genannt), die sich im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong>r Städtehanse gewan<strong>de</strong>lt hatte. Lübeck entwickelte sich in Folge <strong>zu</strong>r zeitweise wichtigsten Han<strong>de</strong>lsstadt im nördlichen Europa. Es entstand<br />
<strong>de</strong>r Verband <strong>de</strong>r wendischen Städte unter Lübecks Führung. Kaiser Ludwig <strong>de</strong>r Bayer verlieh Lübeck 1340 das Goldmünzrecht. 1356 fand <strong>de</strong>r erste allgemeine Hansetag in Lübeck statt.<br />
Die ständigen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit Dänemark unter König Wal<strong>de</strong>mar IV. führten nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Hanseatischen Flotte unter <strong>de</strong>m Befehl <strong>de</strong>s Lübecker Bürgermeisters<br />
Johann Wittenborg im Öresund <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m für die Hansestädte ungünstigen Frie<strong>de</strong>n von Vordingborg (1365) und im Jahr 1367 <strong>zu</strong>r Bildung <strong>de</strong>r Kölner Konfö<strong>de</strong>ration. 1369 fiel jedoch die<br />
dänische Festung Helsingborg nach <strong>de</strong>r hansischen Belagerung unter Bruno von Warendorp. Mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Stralsund erreichte Lübeck <strong>de</strong>n Höhepunkt seiner Macht im
Ostseeraum.<br />
Durch die Gründung <strong>de</strong>s Wendischen Münzvereins 1379 wur<strong>de</strong> die lübische Mark <strong>zu</strong>r Leitwährung im Ostseehan<strong>de</strong>l. Kaiser Karl IV. besuchte als erster römisch-<strong>de</strong>utscher König seit<br />
Friedrich I. 1375 die Stadt.<br />
1380 kam es um <strong>zu</strong> inneren Unruhen, <strong>de</strong>n sogenannten Knochenhaueraufstän<strong>de</strong>n. Die vom Rat ausgeschlossenen Handwerker und kleinen Kaufleute, die durch immer wie<strong>de</strong>r erhöhte<br />
Steuern und finanzielle Einbußen <strong>de</strong>n kostspieligen Krieg gegen Dänemark mitgetragen hatten, for<strong>de</strong>rten unter <strong>de</strong>r Führung <strong>de</strong>r Knochenhauer mehr Freiheiten für die Ämter und<br />
Mitspracherecht im Rat. Nach einer Macht<strong>de</strong>monstration <strong>de</strong>s Rats kam es <strong>zu</strong> einem Kompromiss, <strong>de</strong>r jedoch nicht lange hielt: 1384 nutzte Hinrik Paternostermaker, ein mit seinen<br />
Geschäften un<strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>ner Kaufmann, <strong>de</strong>n nach wie vor gären<strong>de</strong>n Unmut in <strong>de</strong>n Ämtern <strong>zu</strong> einer Verschwörung gegen <strong>de</strong>n Rat. Der Anschlag wur<strong>de</strong> verraten und blutig<br />
nie<strong>de</strong>rgeschlagen.<br />
Im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt war Lübeck neben Köln und Mag<strong>de</strong>burg eine <strong>de</strong>r größten Städte <strong>de</strong>s Reiches. Das Lübecker Stadtrecht (lübisches Recht), welches aus <strong>de</strong>m Soester Stadtrecht<br />
hervorgegangen war, galt in vielen Hansestädten, vor allem im Ostseeraum, und <strong>de</strong>r Lübecker Rat war als Oberhof Appellationsinstanz für alle Hansestädte <strong>de</strong>s Lübecker Rechtskreises.<br />
Hamburg und Lübeck arbeiteten eng <strong>zu</strong>sammen: Während Hamburg insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n Nordseeraum und Westeuropa ab<strong>de</strong>ckte, orientierte sich <strong>de</strong>r Seeverkehr Lübecks nach<br />
Skandinavien und in <strong>de</strong>n Ostseeraum vom Bergener Kontor Bryggen bis nach Nowgorod (Peterhof). Politisch ist <strong>de</strong>r Einfluss Lübecks auch im Hansekontor in Brügge und im Londoner<br />
Stalhof von herausragen<strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung für die Entwicklung <strong>de</strong>s hansischen Han<strong>de</strong>ls gewesen. Der Han<strong>de</strong>lsverkehr zwischen <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Hansestädten wur<strong>de</strong> vorwiegend über Land,<br />
beispielsweise über die Alte Salzstraße, durchgeführt, aber auch per Binnenschiff durch <strong>de</strong>n Stecknitz-Kanal, über <strong>de</strong>n auch das Salz aus Lüneburg, eines <strong>de</strong>r wichtigsten Exportgüter<br />
Lübecks in Richtung Nor<strong>de</strong>n und Osten, transportiert wur<strong>de</strong>. Das Salz wur<strong>de</strong> im Ostseeraum benötigt, um Fisch <strong>zu</strong> konservieren. Der Hering war im Mittelalter im Binnenland eine<br />
beliebte Fastenspeise.<br />
Zum Schutz <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lsinteressen <strong>de</strong>r Hanse und <strong>zu</strong>m Schutz gegen Seeräuber wie die Vitalienbrü<strong>de</strong>r, statteten lübecker Kaufleute eine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Anzahl Orlogschiffe (Kriegsschiffe)<br />
aus.<br />
Die Hansezeit nach <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Stralsund bis <strong>zu</strong>r Reformation<br />
Auch <strong>de</strong>r Beginn <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts war von 1408–1415 durch innere Unruhen geprägt. In <strong>de</strong>ren Verlauf kam es <strong>zu</strong>r zeitweisen Abset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Rates. So geriet Lübeck 1410<br />
vorübergehend in Reichsacht. Durch die Chroniken dieser Zeit aufgezeichnet durch die Lesemeister Detmar und Hermann Korner besteht <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n Urkun<strong>de</strong>nsammlungen für<br />
diese Zeit bereits eine herausragen<strong>de</strong> Quellenlage und Geschichtsschreibung.<br />
Der Vertrag von Perleberg führte 1420 unter Mithilfe Hamburgs <strong>zu</strong> einer Beordnung <strong>de</strong>s Verhältnisses <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Herzögen von Sachsen-Lauenburg. Fortan wur<strong>de</strong>n Bergedorf und die<br />
Vierlan<strong>de</strong> bis ins 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt gemeinsam verwaltet.<br />
Die Einführung <strong>de</strong>s Sundzolls 1429 für die Durchfahrt durch <strong>de</strong>n Öresund durch König Erik VII. führte <strong>zu</strong> einer erneuten Eskalation zwischen <strong>de</strong>n Hansestädten und Dänemark, die 1435<br />
mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Vordingborg mit einer Bestätigung <strong>de</strong>r Privilegien <strong>de</strong>r Hanse beigelegt wur<strong>de</strong>. Gleichwohl mussten die Hansestädte schon bald mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Kopenhagen -<br />
das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hansisch-nie<strong>de</strong>rländische Krieg - die aufkommen<strong>de</strong> nie<strong>de</strong>rländische Konkurrenz in <strong>de</strong>r Ostsee hinnehmen.<br />
Die ständigen Einschränkungen <strong>de</strong>r Privilegien <strong>de</strong>r Hanse am Londoner Stalhof führen 1470 <strong>zu</strong>r Kriegserklärung <strong>de</strong>r wendischen und preußischen Städte <strong>de</strong>r Hanse gegen England. Der<br />
Seekrieg wird als Kaperkrieg geführt und für die Hanse durch <strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>n von Utrecht (1474) durch <strong>de</strong>n Bürgermeister Hinrich Castorp erfolgreich abgeschlossen.<br />
Der Ostseehan<strong>de</strong>l <strong>de</strong>r Lübecker in dieser Zeit wur<strong>de</strong> nicht nur von Salz, Heringen aus Schonen und Stockfisch aus Nordnorwegen geprägt. Nor<strong>de</strong>uropa wur<strong>de</strong> von hier aus mit Waren <strong>de</strong>s<br />
täglichen Bedarfs versorgt. Auch Kunstgegenstän<strong>de</strong> wie die Werke <strong>de</strong>s Malers und Bildhauers Bernt Notke und <strong>de</strong>ssen Zeitgenossen Hermen Ro<strong>de</strong> fin<strong>de</strong>n sich, ebenso wie in Lübeck<br />
hergestellte Flügelaltäre im gesamten Ostseeraum.<br />
Die Han<strong>de</strong>lsbeziehungen <strong>de</strong>r Hanse för<strong>de</strong>rten auch <strong>de</strong>n Absatz von Büchern. Mit <strong>de</strong>m Aufkommen <strong>de</strong>s Buchdrucks wur<strong>de</strong> Lübeck En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts durch Drucker wie Lucas<br />
Brandis und seinen Bru<strong>de</strong>r Matthäus, Johann Snell, Bartholomäus Ghotan (<strong>de</strong>r 1488 mit <strong>de</strong>m Missale Aboense das erste für Finnland gedruckte Buch herstellte), Steffen Arn<strong>de</strong>s
(Nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsche Bibel, 1494) und später Johann Balhorn <strong>zu</strong>m Druck- und Buchvertriebszentrum <strong>de</strong>s Ostseeraums. Die von Hans van Ghetelen 1498 herausgegebene nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsche<br />
Überset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Reynke <strong>de</strong> vos (Reineke <strong>de</strong>r Fuchs) war in Deutschland und Skandinavien <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Zeit nach heutiger Diktion ein trivialer Bestseller. In Deutschland übertraf Lübeck im<br />
Markt für Druckerzeugnisse in mittelnie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utscher Sprache die Stadt Köln, da diese durch <strong>de</strong>n prägen<strong>de</strong>n Katholizismus <strong>de</strong>n Markt nicht in <strong>de</strong>r gefor<strong>de</strong>rten Art und Weise bedienen<br />
konnte.[10]<br />
1500 wur<strong>de</strong> Lübeck Teil <strong>de</strong>s Nie<strong>de</strong>rsächsischen Reichskreises.<br />
Die Feh<strong>de</strong>n mit Dänemark nahmen nach 1509 aufgrund <strong>de</strong>r Hegemonialpolitik <strong>de</strong>s dänischen Königs Christian II. wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>, wur<strong>de</strong>n aber <strong>zu</strong>nächst im Frie<strong>de</strong>n von Malmö (1512) durch<br />
<strong>de</strong>n Bürgermeister Thomas von Wicke<strong>de</strong> beigelegt. Sie lo<strong>de</strong>rten jedoch bald wie<strong>de</strong>r auf. Lübeck verhalf Gustav I. Wasa 1523 auf <strong>de</strong>n schwedischen Thron, König Christian II. wur<strong>de</strong><br />
unter Mitwirkung <strong>de</strong>s Bürgermeisters von Wicke<strong>de</strong> abgesetzt und Friedrich I. <strong>zu</strong>m neuen König von Dänemark gekrönt; im Gegen<strong>zu</strong>g wur<strong>de</strong> die Insel Bornholm von 1525 an für fünfzig<br />
Jahre lübisch. Für Dänemark en<strong>de</strong>te hiermit die Zeit <strong>de</strong>r Kalmarer Union.<br />
Die Zeit von etwa 1522 bis 1530 war geprägt durch das Vordringen <strong>de</strong>r Reformation. 1531 berief <strong>de</strong>r Rat Johannes Bugenhagen, um das Gemeinwesen (Kirche, Schule, Sozialfürsorge)<br />
im reformatorischen Sinn neu <strong>zu</strong> ordnen. Seine Der Keyserliken Stadt Lübeck christlike Or<strong>de</strong>ninge erschien im Mai 1531; En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Jahres zwang <strong>de</strong>r Rat das Domkapitel in einem<br />
Vertrag <strong>zu</strong>m Verzicht auf das Kirchenvermögen in <strong>de</strong>r Stadt. Erster Superinten<strong>de</strong>nt und Rektor <strong>de</strong>r neu gegrün<strong>de</strong>ten Lateinschule Katharineum wur<strong>de</strong> Hermann Bonnus.<br />
Im selben Jahr führte <strong>de</strong>r Eintritt Lübecks in <strong>de</strong>n Schmalkaldischen Bund da<strong>zu</strong>, dass die katholischen Bürgermeister Nikolaus Brömse und Hermann Plönnies die Stadt verließen. In <strong>de</strong>n<br />
darauf folgen<strong>de</strong>n Unruhen gelang es Jürgen Wullenwever, <strong>de</strong>n Rat mit seinen Anhängern <strong>zu</strong> besetzen. Nach seinem Scheitern und Brömses Rückkehr trat Lübeck wie<strong>de</strong>r aus <strong>de</strong>m Bund<br />
aus.<br />
Lübecks Rolle als führen<strong>de</strong> Han<strong>de</strong>lsmacht in <strong>de</strong>r Ostsee wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n ersten Jahrzehnten <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong>nehmend durch nie<strong>de</strong>rländische Kaufleute gefähr<strong>de</strong>t, die unter<br />
Umgehung <strong>de</strong>r Lübecker Stapels direkt die Städte im östlichen Teil <strong>de</strong>r Ostsee ansteuerten. Nach<strong>de</strong>m Friedrich I. nicht bereit war, Lübeck als Lohn für seine Hilfe bei <strong>de</strong>r<br />
Gefangennahme Christian II. 1532 die Sundschlösser <strong>zu</strong> überlassen, versuchte Jürgen Wullenwever mit militärischen Mitteln, die alte Vormachtstellung im Ostseeraum<br />
wie<strong>de</strong>rher<strong>zu</strong>stellen und die Grafenfeh<strong>de</strong> <strong>zu</strong> Gunsten Lübecks <strong>zu</strong> beeinflussen. Zur Finanzierung seiner militärischen Abenteuer ließ er unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>n Kirchenschatz einschmelzen.<br />
Doch er scheiterte dramatisch, musste 1535 die Stadt verlassen, wur<strong>de</strong> vom Erzbischof von Bremen gefangen genommen und 1537 hingerichtet. Damit war Lübecks Zeit als „Königin<br />
<strong>de</strong>r Hanse“ endgültig vorüber. Und auch die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Hanse schwand.<br />
In kultureller Hinsicht führte die Reformation <strong>zu</strong> einem Abbruch <strong>de</strong>r künstlerischen Produktivität <strong>de</strong>r Stadt, da die Auftraggeber für sakrale Kunstwerke <strong>de</strong>m Zeitgeist entsprechend<br />
fehlten. Allein <strong>de</strong>r Terrakottabildhauer Statius von Düren, <strong>de</strong>r Maler Hans Kemmer und die Familie <strong>de</strong>s Bildschnitzer Tönnies Evers d. Ä. bereicherten noch die Renaissance in<br />
Nord<strong>de</strong>utschland. Ihnen folgen als Künstler <strong>de</strong>r Übergangszeit <strong>de</strong>r Bildschnitzer Tönnies Evers d. J. und <strong>de</strong>r Maler Johannes Willinges nach.<br />
Nordische Kriege, Dreißigjähriger Krieg und Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>r Hanse<br />
Im Zuge <strong>de</strong>s Dreikronenkrieges zwischen Dänemark und Schwe<strong>de</strong>n, bei <strong>de</strong>m die Hansestädte <strong>de</strong>n dänischen König unterstützten, erreichte Lübeck als einzige Macht seine Kriegsziele,<br />
da <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong>n von Stettin von 1570 <strong>de</strong>r Stadt die Narva-Fahrt garantierte. Allerdings offenbarte sich auch die von nun an eingeschränkte Machtposition <strong>de</strong>r Stadtstaaten im Verhältnis <strong>zu</strong><br />
<strong>de</strong>n Flächenstaaten.<br />
1615 erhielt Lübeck mit <strong>de</strong>r Lübecker Stadtbefestigung ein mo<strong>de</strong>rnes Befestigungsanlagensystem nach nie<strong>de</strong>rländischer Manier. Die Anlagen wur<strong>de</strong>n von Johann von Ryswyck und<br />
Johan van Valckenburgh entworfen, <strong>de</strong>r auch für die Befestigungen von Hamburg, Bremen und Ulm verantwortlich war. Im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m ungefähr gleichzeitig entstehen<strong>de</strong>n<br />
Hamburger Bastionsring sowie <strong>de</strong>n Anlagen in Braunschweig und Bremen verzichtete man in Lübeck im Hinblick auf die topografische Situation <strong>de</strong>r Stadt auf eine vollständige<br />
Umwallung <strong>de</strong>r Stadt. Die Fertigstellung erfolgte ab 1634 durch <strong>de</strong>n nie<strong>de</strong>rländischen Festungsbauer Johann von Brüssel.<br />
Im Dreißigjährigen Krieg gelang es Lübeck, neutral <strong>zu</strong> bleiben. 1629 wur<strong>de</strong> hier <strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong> von Lübeck zwischen <strong>de</strong>n kaiserlichen Truppen und König Christian IV. von Dänemark<br />
geschlossen. Im Zuge <strong>de</strong>r Vorbereitungen für einen umfassen<strong>de</strong>n Frie<strong>de</strong>nskongress während <strong>de</strong>r Verhandlungen über die Hamburger Präliminarien 1641 waren auch die bei<strong>de</strong>n Städte<br />
Hamburg und Lübeck als Kongressorte im Gespräch. An <strong>de</strong>n Verhandlungen und <strong>de</strong>m Abschluss <strong>de</strong>s Westfälischen Frie<strong>de</strong>ns waren die Hansestädte durch <strong>de</strong>n späteren Lübecker
Bürgermeister David Gloxin vertreten.<br />
Wirtschaftlich profitierte die Stadt <strong>zu</strong> Anfang <strong>de</strong>s Krieges <strong>zu</strong>nächst durch ihre offen kaiserliche Haltung, so dass noch Wallenstein bei seinem Zug gegen Dänemark die finanziellen<br />
Transaktionen über Lübeck abwickeln ließ. Mit <strong>de</strong>m Kriegseintritt Schwe<strong>de</strong>ns übernahm <strong>zu</strong>nehmend Hamburg die Abwicklung <strong>de</strong>r notwendigen Finanzaktionen und wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m<br />
wichtigsten Umschlagsplatz für Waffen, Salpeter und an<strong>de</strong>re kriegsnotwendige Materialien im Nor<strong>de</strong>n.<br />
Wenn Lübeck auch nicht unmittelbar von <strong>de</strong>n Kriegsereignissen betroffen war, so führte die gleichzeitig stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Umorientierung <strong>de</strong>r europäischen Han<strong>de</strong>lsströme nach Westen und<br />
das <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong> Eindringen nie<strong>de</strong>rländischer Schiffe in die Ostsee <strong>zu</strong> einem erheblichen Be<strong>de</strong>utungsverlust für <strong>de</strong>n Lübecker Fernhan<strong>de</strong>l. Dies vermochte auch <strong>de</strong>r ab 1665 verstärkt<br />
aufgenommene, aber durchaus risikoreiche Walfang nicht <strong>zu</strong> än<strong>de</strong>rn.<br />
Der letzte Hansetag fand 1669 in Lübeck statt. Die drei Städte Lübeck, Hamburg und Bremen wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> Sachwaltern <strong>de</strong>r Hanse und ihres Restvermögens eingesetzt.<br />
Auch innenpolitisch steht das Jahr 1669 für einen Umbruch. Mit <strong>de</strong>r Kassarezess genannten Verfassungsreform räumten die Patrizierfamilien <strong>de</strong>m Bürgertum <strong>de</strong>r Stadt wi<strong>de</strong>rwillig<br />
erweiterte Mitspracherechte, insbeson<strong>de</strong>re bei <strong>de</strong>r Kasse, <strong>de</strong>m Finanzhaushalt, ein. Der Kassarezess war die einzige wesentliche Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Verfassung von <strong>de</strong>n Anfängen <strong>de</strong>r Stadt<br />
bis <strong>zu</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Gleichwohl verfiel die Stadt – ob <strong>de</strong>s gewonnenen status quo – in eine orthodox-konservative Denkweise, die bis <strong>zu</strong>m 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt anhielt.<br />
In diese Zeit vor <strong>de</strong>r Aufklärung fällt das Wirken <strong>de</strong>s voraufklärerischen Polyhistors und Hauptpastors an St. Marien Jacob von Melle. In dieser Zeit importiert <strong>de</strong>r Kaufmann Thomas<br />
Fre<strong>de</strong>nhagen die Bildhauerkunst eines Thomas Quellinus aus <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n. Lübecker Künstler wie die Gebrü<strong>de</strong>r Kneller hingegen verlassen die Stadt, die ihnen mit ihrem geistigen<br />
Klima nicht genügend Entwicklungsmöglichkeiten bietet.<br />
Von <strong>de</strong>r Aufklärung <strong>zu</strong>r Mo<strong>de</strong>rne<br />
Der Siebenjährige Krieg verlief dank <strong>de</strong>r diplomatischen Beziehungen <strong>de</strong>s Lübecker Stadtkommandanten Graf Chasot ohne größeren Scha<strong>de</strong>n für die Stadt. Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt entstan<strong>de</strong>n auch in Lübeck aufgeklärte Salons wie um Deutschlands erste promovierte Philosophin Dorothea Schlözer, die mit <strong>de</strong>m Ratsherrn und späteren Bürgermeister<br />
Mattheus Rod<strong>de</strong> verheiratet war. In Lübeck wirkte um dieser Zeit <strong>de</strong>r Maler Johann Jacob Tischbein. Vor <strong>de</strong>n Toren <strong>de</strong>r Stadt entstand mit <strong>de</strong>r Stockelsdorfer Fayencemanufaktur eine<br />
über die Grenzen Nord<strong>de</strong>utschlands hinaus anerkannte Werkstatt. Der bürgerliche Geist <strong>de</strong>r Zeit führte <strong>zu</strong>r Gründung <strong>de</strong>r Gesellschaft <strong>zu</strong>r Beför<strong>de</strong>rung gemeinnütziger Tätigkeit, die<br />
seither einen nicht <strong>zu</strong> unterschätzen<strong>de</strong>n Einfluss auf das kulturelle Leben <strong>de</strong>r Stadt nimmt.<br />
Lübeck unter französischer Herrschaft<br />
Mit <strong>de</strong>m Reichs<strong>de</strong>putationshauptschluss 1803 blieb Lübeck noch reichsunmittelbare Stadt, um dann mit Fortfall <strong>de</strong>s Heiligen Römischen Reiches 1806 ein souveräner <strong>de</strong>utscher Staat <strong>zu</strong><br />
wer<strong>de</strong>n. Allerdings erfolgte am 6. November 1806 in Folge <strong>de</strong>r für Blücher vernichten<strong>de</strong>n Schlacht bei Lübeck im Rahmen <strong>de</strong>s vierten Koalitionskrieges die Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r neutralen<br />
Stadt durch die Truppen Napoleons unter Bernadotte verbun<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l lähmen<strong>de</strong>n Durchset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Kontinentalsperre. Von 1811 bis 1813 fand sich Lübeck wi<strong>de</strong>r Willen<br />
vorübergehend als Teil <strong>de</strong>s französischen Kaiserreiches wie<strong>de</strong>r; es wur<strong>de</strong> bonne ville <strong>de</strong> l'Empire français und Arrondissement im Département <strong>de</strong>s Bouches <strong>de</strong> l'Elbe; die Stadt wur<strong>de</strong><br />
zeitweilig von einem Maire und einem Munizipalrat regiert.<br />
Die wirtschaftlichen Folgen <strong>de</strong>r Ausblutung durch die Besat<strong>zu</strong>ng waren für die Stadt bis <strong>zu</strong>r Mitte <strong>de</strong>s Jahrhun<strong>de</strong>rts spürbar. Ab 1829 gab es auf Initiative von Karl von Schlözer und<br />
finanziert durch Ludwig Stieglitz eine regelmäßige Dampfschiffahrtslinie nach St. Petersburg.<br />
Deutscher Bund<br />
1815 wur<strong>de</strong> Lübeck auf <strong>de</strong>m Wiener Kongress als Freie und Hansestadt Lübeck völkerrechtlich souveränes Mitglied <strong>de</strong>s Deutschen Bun<strong>de</strong>s. Gesandtschaften und Konsulate wur<strong>de</strong>n<br />
<strong>zu</strong>meist gemeinsam mit <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Schwesterstädten Bremen und Hamburg in wichtigen Haupt- und Hafenstädten unterhalten. Die hanseatischen Ministerresi<strong>de</strong>nten wie Vincent<br />
Rumpff in Paris o<strong>de</strong>r James Colquhoun in London, <strong>zu</strong>gleich auch <strong>de</strong>r letzte hanseatische Stalhofmeister verhan<strong>de</strong>lten die völkerrechtlichen Verträge mit <strong>de</strong>n wichtigsten<br />
Han<strong>de</strong>lspartnern. Das Postwesen betrieb je<strong>de</strong> Stadt für sich.
Der Kunsthistoriker Karl Friedrich von Rumohr bewirkte mit seiner Veröffentlichung Altertümer <strong>de</strong>s transalbingischen Sachsen 1813 <strong>de</strong>n Anstoß <strong>zu</strong>m Erhalt <strong>de</strong>r Lübecker Denkmäler<br />
und Kulturgüter. Seine Gedanken wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>m Zeichenlehrer Carl Julius Mil<strong>de</strong> in Lübeck tatkräftig umgesetzt und bil<strong>de</strong>n heute <strong>de</strong>n Grundbestand <strong>de</strong>r Museen für Kulturgeschichte<br />
<strong>de</strong>r Hansestadt.<br />
1835 stiftete <strong>de</strong>r Senat die Medaille Bene Merenti für herausragen<strong>de</strong> Dienste um und in Lübeck. Sie ist bis heute die be<strong>de</strong>utendste Auszeichnung <strong>de</strong>r Hansestadt. Die Stadt wur<strong>de</strong> durch<br />
ihre Erneuerungsbewegung Jung-Lübeck und <strong>de</strong>n Germanistentag <strong>de</strong>s Jahres 1847 <strong>zu</strong> einem wichtigen Symbolort <strong>de</strong>s Vormärz, überstand aber aufgrund <strong>de</strong>r weitvorangeschrittenen<br />
Vorbereitung einer neuen Verfassung das Revolutionsjahr 1848 ohne größere Unruhen.<br />
In <strong>de</strong>r Frankfurter Nationalversammlung 1848 wur<strong>de</strong> Lübeck durch <strong>de</strong>n Abgeordneten Ernst Deecke vertreten.<br />
Nord<strong>de</strong>utscher Bund und Deutsches Kaiserreich<br />
Lübeck trat 1866 <strong>de</strong>m Nord<strong>de</strong>utschen Bund sowie 1868 <strong>de</strong>m Zollverein bei und wur<strong>de</strong> 1871 Gliedstaat <strong>de</strong>s Deutschen Reiches; damit en<strong>de</strong>t die seit 1806 bestehen<strong>de</strong> völkerrechtliche<br />
Souveränität Lübecks. Gegen En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts setzte die Industrialisierung ein. Die Bevölkerungszahl wuchs rapi<strong>de</strong> und die Vorstädte breiteten sich mit Aufhebung <strong>de</strong>r<br />
Torsperre im Jahr 1864 aus.<br />
1895 wur<strong>de</strong> die Deutsch-Nordische Han<strong>de</strong>ls- und Industrie-Ausstellung in Lübeck abgehalten, für die Bürger <strong>de</strong>s kleinen Stadtstaates „ihre Weltausstellung“.<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Der Zusammenbruch <strong>de</strong>s Kaiserreichs 1918 führte in Lübeck zwar als nächster Stadt nach Kiel <strong>zu</strong> einem Matrosenaufstand, jedoch in Lübeck als einzigem Staat <strong>de</strong>s Deutschen Reiches<br />
nicht <strong>zu</strong> revolutionären Verwerfungen durch die Novemberrevolution. Bürgermeister Emil Ferdinand Fehling und alle Senatoren blieben im Amt, aber bereits im gleichen Jahr kam es <strong>zu</strong><br />
einem neuen, zeitgemäßen Wahlrecht <strong>de</strong>s Staates und im Mai 1920 <strong>zu</strong> einer neuen, ersten <strong>de</strong>mokratischen Verfassung im mo<strong>de</strong>rnen Sinne. Die Gemeinsamkeit <strong>de</strong>r Hanse en<strong>de</strong>te in<br />
diesem Jahr insofern, als die Freien Städte nunmehr keine gemeinsame, son<strong>de</strong>rn fortan jeweils eigenständige Vertretungen beim Reich unterhielten. Ansonsten wur<strong>de</strong> Lübeck von <strong>de</strong>n<br />
Unruhen <strong>de</strong>r frühen Weimarer Republik kaum betroffen. Wie vielerorts in Deutschland nahmen in <strong>de</strong>n 20er Jahren auch in Lübeck Kunst und Kultur einen Aufschwung auch wenn die<br />
bemerkenswerte Kunstsammlung <strong>de</strong>s Lübecker Mäzens Max Lin<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Inflation <strong>zu</strong>m Opfer fiel. Der Museumsdirektor Carl Georg Heise för<strong>de</strong>rte viele Künstler wie Asmus Jessen, Hans<br />
Peters, Leopold Thieme, Karl Gatermann d.Ä. und Erich Dummer. Der Grafiker Alfred Mahlau än<strong>de</strong>rte <strong>de</strong>n Außenauftritt <strong>de</strong>r Stadt prägend und gestaltete Marken wie Nie<strong>de</strong>regger und<br />
Schwartauer Werke.[11] 1926 feierte die Stadt mit einem großen Fest und einem großen kostümierten Festum<strong>zu</strong>g die 700-jährige Wie<strong>de</strong>rkehr <strong>de</strong>r Reichsfreiheit.<br />
Im Bereich <strong>de</strong>s Schulwesens gehörte Lübeck unter <strong>de</strong>m Direktor <strong>de</strong>r Oberschule <strong>zu</strong>m Dom und späteren Lan<strong>de</strong>sschulrat Sebald Schwarz bis <strong>zu</strong>r Gleichschaltung 1933 <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n<br />
fortschrittlichen Län<strong>de</strong>rn im Deutschen Reich.<br />
Nach <strong>de</strong>m folgenschweren Lübecker Impfunglück 1930 erregte <strong>de</strong>r anschließen<strong>de</strong> Calmette-Prozess international Aufsehen und schrieb im Ergebnis Rechtsgeschichte.<br />
Im März 1933 setzte die NSDAP in Lübeck die Gleichschaltung verbun<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m Rücktritt <strong>de</strong>s SPD-Bürgermeisters Paul Löwigt und <strong>de</strong>n weiteren sozial<strong>de</strong>mokratischen Senatoren<br />
durch und die <strong>de</strong>mokratischen Verfassungsprinzipien außer Kraft; Friedrich Hil<strong>de</strong>brandt, <strong>de</strong>r Reichsstatthalter für Mecklenburg und Lübeck, ernannte <strong>zu</strong>m 30. Mai seinen Stellvertreter,<br />
Otto-Heinrich Drechsler, <strong>zu</strong>m Bürgermeister. Die Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Nationalsozialisten mit <strong>de</strong>n <strong>de</strong>mokratischen Parteien führte <strong>zu</strong>r Verhaftung von Julius Leber am 1. Februar<br />
1933. Herbert Frahm (Willy Brandt) konnte sich <strong>de</strong>r Verfolgung nur durch seine Flucht nach Skandinavien entziehen.<br />
Die Lübecker Bücherverbrennung fand am 26. Mai 1933 auf <strong>de</strong>m Buniamshof statt.[12]<br />
Durch das Groß-Hamburg-Gesetz verlor Lübeck 1937 seine 711 Jahre alte territoriale Eigenständigkeit und wur<strong>de</strong> Teil <strong>de</strong>r preußischen Provinz Schleswig-Holstein.[13] Vorangegangen<br />
war ein Tauziehen zwischen <strong>de</strong>m nationalsozialistischen Gauleiter von Schleswig-Holstein (Hinrich Lohse) und <strong>de</strong>m von Mecklenburg (Friedrich Hil<strong>de</strong>brandt), <strong>de</strong>m Lübeck von 1933<br />
bis 1937 unterstellt war. Die Vaterstädtische Vereinigung Lübeck von 1949 versuchte nach Kriegsen<strong>de</strong> ein Volksbegehren über die Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>r Unabhängigkeit Lübecks <strong>zu</strong><br />
initiieren, welches jedoch vom Bun<strong>de</strong>sinnenminister abgelehnt wur<strong>de</strong>. In <strong>de</strong>r gegen die Ablehnung erhobenen Beschwer<strong>de</strong> vor <strong>de</strong>m Bun<strong>de</strong>sverfassungsgericht unterlag <strong>de</strong>r Verein im
Lübeck-Urteil 1956 endgültig.<br />
Im September 1941 wur<strong>de</strong>n 605 Insassen <strong>de</strong>r Heilanstalt Strecknitz auf Veranlassung <strong>de</strong>r Nationalsozialisten abgeholt und ermor<strong>de</strong>t (Aktion T4).<br />
Von <strong>de</strong>n in Lübeck leben<strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n waren bis 1939 über die Hälfte ausgewan<strong>de</strong>rt o<strong>de</strong>r auf Binnenwan<strong>de</strong>rung gegangen, die 203 verbliebenen wur<strong>de</strong>n teils am 6. Dezember 1941 mit<br />
einem Transport von 90 Personen in das Konzentrationslager Jungfernhof bei Riga verbracht, die letzten Transporte gingen 1942/43 in das Ghetto Theresienstadt. Nur drei Personen<br />
überlebten Deportation und Lager.<br />
„In <strong>de</strong>r Nacht <strong>zu</strong>m Palmsonntag“ vom 28. März auf <strong>de</strong>n 29. März 1942 erfolgte <strong>de</strong>r Luftangriff auf Lübeck. Lübeck wur<strong>de</strong> damit <strong>zu</strong>r ersten <strong>de</strong>utschen Großstadt, die im Rahmen <strong>de</strong>r<br />
kurz <strong>zu</strong>vor erlassenen britischen Area Bombing Directive angegriffen wur<strong>de</strong>. Das Zielgebiet bil<strong>de</strong>te die dichtbewohnte mittelalterliche Altstadt. Bei <strong>de</strong>m Angriff wur<strong>de</strong>n insgesamt 320<br />
Menschen getötet und 1.044 Gebäu<strong>de</strong> zerstört o<strong>de</strong>r beschädigt, unter ihnen die Marienkirche, die Petrikirche und <strong>de</strong>r Dom.<br />
Der Schweizer Diplomat und Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s Internationalen Komitees vom Roten Kreuz Carl Jacob Burckhardt erreichte 1944, dass <strong>de</strong>r Lübecker Hafen <strong>zu</strong>m Umschlaghafen für Schiffe<br />
<strong>de</strong>s Roten Kreuzes wur<strong>de</strong> und die Stadt somit vor weiteren Bombardierungen geschützt wer<strong>de</strong>n konnte. Hierfür wur<strong>de</strong> ihm die Ehrenbürgerschaft <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong>teil. Außer<strong>de</strong>m trägt das<br />
1957 neu gegrün<strong>de</strong>te naturwissenschaftliche und neusprachliche Carl-Jacob-Burckhardt-Gymnasium in <strong>de</strong>r Ziegelstraße seinen Namen.<br />
Am 23. April 1945 traf Heinrich Himmler in Lübeck <strong>de</strong>n schwedischen Grafen Folke Bernadotte, <strong>de</strong>m er ein Waffenstillstandsangebot unterbreitet. Präsi<strong>de</strong>nt Harry S. Truman lehnte das<br />
Angebot ab. Die British Army besetzte Lübeck am 2. Mai 1945 fast kampflos, 42 Deutsche kamen ums Leben, weil die Briten eine Gegenwehr vermuteten, die nicht gegeben war.<br />
Am 3. Mai 1945 ereignete sich in <strong>de</strong>r Lübecker Bucht ein beson<strong>de</strong>rs tragisches Schiffsunglück, als alliierte Flieger drei Schiffe, darunter die Cap Arcona versenkten, auf <strong>de</strong>nen die SS<br />
KZ-Häftlinge eingepfercht hatte. Etwa 7.000 bis 8.000 Menschen kamen dabei ums Leben.<br />
Weltweites Aufsehen erregte im September 1947 die Internierung <strong>de</strong>r Emigranten <strong>de</strong>r Exodus durch die Britische Regierung in einem Lager in Pöppendorf.<br />
Nach 1945 vergrößerte sich Lübecks Einwohnerzahl durch Zu<strong>zu</strong>g von Flüchtlingen aus <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Ostgebieten erheblich. Es wur<strong>de</strong> Bestandteil <strong>de</strong>s von <strong>de</strong>n Alliierten gebil<strong>de</strong>ten<br />
Bun<strong>de</strong>slan<strong>de</strong>s Schleswig-Holstein, genoss aber im kulturpolitischen Bereich wie in <strong>de</strong>r Denkmalpflege einen Ausnahmestatus kommunaler Zuständigkeit. Bis 1989 blieb Lübeck<br />
Grenzstadt an <strong>de</strong>r inner<strong>de</strong>utschen Grenze mit einer gesamten Grenzlänge von etwa 44 Kilometer. In Schlutup befand sich dabei <strong>de</strong>r nördlichste inner<strong>de</strong>utsche Grenzübergang. Relikte <strong>de</strong>s<br />
Kalten Krieges fin<strong>de</strong>n sich als vorbereitete Sperren (hier Stecksperren) bei <strong>de</strong>r Possehlbrücke o<strong>de</strong>r am Burgtorteller. Die <strong>de</strong>utsche Teilung trennte Lübeck zwar vom mecklenburgischen<br />
Teil seines Hinterlan<strong>de</strong>s, verschaffte aber an<strong>de</strong>rerseits seinem Fährhafen Travemün<strong>de</strong> eine bevor<strong>zu</strong>gte Stellung im Fährverkehr zwischen Westeuropa und <strong>de</strong>n Ostseelän<strong>de</strong>rn Schwe<strong>de</strong>n<br />
und Finnland. Seit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Wie<strong>de</strong>rvereinigung ist Lübeck wie<strong>de</strong>r Oberzentrum auch für das westliche Mecklenburg.<br />
Am 18. Januar 1996 starben bei einem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in <strong>de</strong>r Hafenstraße zehn Menschen, 30 wer<strong>de</strong>n schwer, 20 leicht verletzt. Die Tat konnte bis heute<br />
nicht aufgeklärt wer<strong>de</strong>n.<br />
Eingemeindungen und Gebietsän<strong>de</strong>rungen<br />
Wie die meisten ehemaligen Freien Reichsstädte konnte auch Lübeck im Laufe <strong>de</strong>r Geschichte neben <strong>de</strong>m eigentlichen Stadtgebiet umliegen<strong>de</strong> Dörfer und Städte (etwa Travemün<strong>de</strong> im<br />
Jahre 1329) erwerben. Das Staatsgebiet <strong>de</strong>r Freien Reichsstadt Lübeck bestand daher bis 1937 aus <strong>de</strong>m eigentlichen Stadtgebiet und <strong>de</strong>m so genannten Landgebiet, also einer Vielzahl<br />
von Landgemein<strong>de</strong>n, die <strong>zu</strong>m Teil auch als Exklave außerhalb <strong>de</strong>s sonst geschlossenen Gebiets lagen. Die Gemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Landgebiets hatten eine eigene Verwaltung beziehungsweise<br />
die Bewohner dieser Orte <strong>de</strong>s Landgebietes <strong>de</strong>s Lübschen Staates (<strong>de</strong>s Nie<strong>de</strong>rstadtgebietes unter Verwaltung <strong>de</strong>s Nie<strong>de</strong>rstadtprokurators) hatten an<strong>de</strong>re Rechte als die <strong>de</strong>r eigentlichen<br />
Stadt. Auch die Gerichtsbarkeit war eine an<strong>de</strong>re, nämlich die <strong>de</strong>s Nie<strong>de</strong>rgerichts, das in <strong>de</strong>r Gerichtslaube auf <strong>de</strong>m Koberg Recht sprach. Das Landgebiet war in folgen<strong>de</strong> Teilgebiete<br />
eingeteilt: „Vor <strong>de</strong>m Burgtor“, „Vor <strong>de</strong>m Holstentor“, „Vor <strong>de</strong>m Mühlentor“ und „Gebiet außerhalb <strong>de</strong>r Landwehr (inklusive Exklaven)“. Für das Bewaffnungswesen war das gesamte<br />
Staatsgebiet Lübecks in fünf Bezirke eingeteilt: Holstentor-, Mühlentor-, Burgtor-, Ritzerauer und Travemün<strong>de</strong>r Bezirk. 1804 vergrößerte sich das Landgebiet erheblich, als <strong>de</strong>r Senat<br />
durch einen Vergleich mit <strong>de</strong>m Herzog von Ol<strong>de</strong>nburg das durch <strong>de</strong>n Reichs<strong>de</strong>putationshauptschluss säkularisierte Stiftsland <strong>de</strong>s Domkapitels und <strong>de</strong>n Landbesitz <strong>de</strong>s St.<br />
Johannisklosters aufteilte. In <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts setzten sich für die Vorstädte, also die Gebiete vor <strong>de</strong>n Stadttoren, eigene Bezeichnungen durch: St. Jürgen, St. Gertrud, St.<br />
Lorenz. 1861 wur<strong>de</strong>n die Grenzen <strong>de</strong>r Vorstädte offiziell festgelegt. Später wur<strong>de</strong>n die Vorstädte um Gebiete <strong>de</strong>r angrenzen<strong>de</strong>n Landgemein<strong>de</strong>n vergrößert. Die erste größere
Eingemeindung wur<strong>de</strong> 1913 vollzogen, als Travemün<strong>de</strong> und 11 Landgemein<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>r Stadt Lübeck vereinigt wur<strong>de</strong>n. Das Stadtgebiet umfasste danach <strong>zu</strong>nächst noch zwei getrennte<br />
Teile. Dazwischen lagen mehrere Landgemein<strong>de</strong>n. 1935 wur<strong>de</strong>n jedoch bei<strong>de</strong> Teile <strong>de</strong>s Stadtgebiets durch die Einglie<strong>de</strong>rung weiterer Landgemein<strong>de</strong>n geschlossen. Die Landgemein<strong>de</strong>n<br />
außerhalb <strong>de</strong>s geschlossenen Gebiets (Exklaven) blieben <strong>zu</strong>nächst noch bei Lübeck. Sie wur<strong>de</strong>n 1937 mit <strong>de</strong>m Groß-Hamburg-Gesetz, als die Stadt Teil <strong>de</strong>r Provinz Schleswig-Holstein<br />
wur<strong>de</strong>, vollständig von Lübeck abgetrennt und <strong>de</strong>n benachbarten Landkreisen <strong>zu</strong>geordnet.<br />
Im Einzelnen wur<strong>de</strong>n die Landgemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s Staates Lübeck wie folgt in die Stadt Lübeck eingeglie<strong>de</strong>rt:<br />
• 1903: ein Teil <strong>de</strong>r Landgemein<strong>de</strong> Vorwerk<br />
• am 1. April 1913: (die eingeglie<strong>de</strong>rten Gemein<strong>de</strong>n waren danach „Vorstädte“)<br />
• Stadt Travemün<strong>de</strong> und Landgemein<strong>de</strong> Gneversdorf: Sie bil<strong>de</strong>ten fortan <strong>de</strong>n Stadtteil Kurort und Seebad Travemün<strong>de</strong><br />
• Landgemein<strong>de</strong> Siems: Sie bil<strong>de</strong>te mit <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Trave von <strong>de</strong>r Mündung <strong>de</strong>r Schwartau abwärts bis <strong>zu</strong>m Durchstich bei <strong>de</strong>r Herrenfähre <strong>de</strong>n Stadtteil Siems-<br />
Dänischburg<br />
• Landgemein<strong>de</strong>n Kücknitz (<strong>zu</strong>m Teil, <strong>de</strong>r Rest kam <strong>zu</strong>r Landgemein<strong>de</strong> Pöppendorf) und Herrenwyk sowie kleinere umliegen<strong>de</strong> Gebiete: Sie bil<strong>de</strong>ten <strong>de</strong>n Stadtteil<br />
Kücknitz-Herrenwyk<br />
• Landgemein<strong>de</strong>n Krempelsdorf, Vorwerk, Moisling und Genin: Sie wur<strong>de</strong>n jeweils eigenständige Stadtteile<br />
• Landgemein<strong>de</strong> Schlutup: Sie bil<strong>de</strong>te mit umliegen<strong>de</strong>n Gebieten <strong>de</strong>n Stadtteil Schlutup.<br />
• Landgemein<strong>de</strong>n Gothmund und Israelsdorf (<strong>zu</strong>m Teil, <strong>de</strong>r Rest kam <strong>zu</strong>r Landgemein<strong>de</strong> Wesloe): Sie gehörten fortan <strong>zu</strong>r Vorstadt St. Gertrud<br />
• am 12. September 1921: Landgemein<strong>de</strong>n Schönböcken und Wesloe<br />
• am 1. April 1927: Landgemein<strong>de</strong> Strecknitz (nördlicher Teil)<br />
• am 12. März 1932: Rest <strong>de</strong>r Landgemein<strong>de</strong> Strecknitz (sie wur<strong>de</strong> Teil von St. Jürgen)<br />
• am 1. Mai 1935: die eingeglie<strong>de</strong>rten Landgemein<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n danach <strong>zu</strong> äußeren Vorstädten<br />
• Landgemein<strong>de</strong>n: Bei<strong>de</strong>ndorf, Blankensee, Brodten, Dummersdorf, Ivendorf, Kronsfor<strong>de</strong>, Krummesse, Moorgarten, Nie<strong>de</strong>rbüssau, Niendorf, Oberbüssau, Pöppendorf,<br />
Reecke, Rönnau, Teutendorf, Vorra<strong>de</strong> und Wulfsdorf.<br />
Literatur<br />
• Fritz Endres (Hrsg.): Geschichte <strong>de</strong>r freien und Hansestadt Lübeck. Otto Quitzow, Lübeck 1926, Weidlich, Frankfurt M 1981 (Repr.), ISBN 3-8035-1120-8<br />
• Erich Keyser (Hrsg.): Deutsches Städtebuch. Handbuch städtischer Geschichte. Bd 1. Nordost<strong>de</strong>utschland. Im Auftrag <strong>de</strong>r Konferenz <strong>de</strong>r lan<strong>de</strong>sgeschichtlichen Kommissionen<br />
Deutschlands mit <strong>de</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Deutschen Gemein<strong>de</strong>tages. Kohlhammer, Stuttgart 1939.<br />
• Abram Enns: Kunst und Bürgertum – Die kontroversen zwanziger Jahre in Lübeck. Christians – Weiland, Hamburg – Lübeck 1978, ISBN 3-7672-0571-8<br />
• Lübeck 1226 – Reichsfreiheit und frühe Stadt. Scheffler, Lübeck 1976.<br />
• Gerhard Schnei<strong>de</strong>r: Gefährdung und Verlust <strong>de</strong>r Eigenstaatlichkeit <strong>de</strong>r Freien und Hansestadt Lübeck und seine Folgen. Schmidt-Römhild, Lübeck 1986, ISBN 3-7950-0452-7<br />
• Antjekathrin Graßmann (Hrsg.): Lübeckische Geschichte. Schmidt-Römhild, Lübeck 1989, 4. Aufl. 2008. ISBN 978-3-7950-1280-9<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Die zweite Silbe „-beck“ hat hier also nichts mit <strong>de</strong>r sonst in Nord<strong>de</strong>utschland üblichen Herkunft „bäke“ = „Bach“ <strong>zu</strong> tun.<br />
2. ↑ Antjekathrin Graßmann: Lübeckische Geschichte. Schmidt-Römhild, Lübeck 1997. ISBN 3-7950-3215-6<br />
3. ↑ Adam von Bremen: la:Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum. Hahn, Hannover 1993. ISBN 3-7752-5288-6<br />
4. ↑ Helmold von Bosau: Chronica Slavorum. Neu übertragen und erläutert von Heinz Stoob. In: Ausgewählte Quellen <strong>zu</strong>r <strong>de</strong>utschen Geschichte <strong>de</strong>s Mittelalters. Wiss.<br />
Buchgesellschaft, Darmstadt 19.1963. ISSN 0067-0650
5. ↑ C.-H. Seebach: 800 Jahre Burgen, Schlösser und Herrenhäuser in Schleswig-Holstein. Karl Wachholtz Verlag, Neumünster 1988. ISBN 3-529-02675-1<br />
6. ↑ G. P. Fehring: Die Burg in Lübeck. in: Lübecker Schriften für Archäologie und Kulturgeschichte. Habelt, Bonn 6.1982. ISSN 0721-3735<br />
7. ↑ Für alle: Philippe Dollinger: Die Hanse. Kröner, Stuttgart 1998. ISBN 3-520-37105-7<br />
8. ↑ Arnold von Lübeck: Chronica Slavorum. Neu übertragen und erläutert von Heinz Stoob. In: Ausgewählte Quellen <strong>zu</strong>r <strong>de</strong>utschen Geschichte <strong>de</strong>s Mittelalters. Wiss.<br />
Buchgesellschaft, Darmstadt 19.1963. ISSN 0067-0650<br />
9. ↑ Quellenausschnitte <strong>zu</strong>r ma. Geschichte Lübecks<br />
10.↑ Philippe Dollinger: Die Hanse. ebda.<br />
11.↑ Abraham B. Enns: Kunst und Bürgertum. Weiland, Lübeck 1978. ISBN 3-7672-0571-8<br />
12.↑ Schaufenster-Ausstellung in <strong>de</strong>r Hüxstraße in Lübeck<br />
13.↑ Gerhard Schnei<strong>de</strong>r: Gefährdung und Verlust <strong>de</strong>r Eigenstaatlichkeit <strong>de</strong>r freien und Hansestadt Lübeck und seine Folgen, Verlag Schmidt-Römhild <strong>zu</strong> Lübeck 1986, ISBN 3-<br />
7950-0452-7<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Lübecker Wappen<br />
Die Hansestadt Lübeck führte lange zwei verschie<strong>de</strong>ne Wappen, die sich auch als Doppelwappen fin<strong>de</strong>n: Eines mit <strong>de</strong>m Reichsadler als Symbol <strong>de</strong>r Reichsfreiheit (welche die Stadt von<br />
1226 bis 1937 genoss) und eines mit <strong>de</strong>n hanseatischen Farben Silber über Rot geteilt, <strong>de</strong>n sogenannten lübischen Schild.[1]<br />
Entstehung<br />
Die Herkunft <strong>de</strong>s lübischen Schil<strong>de</strong>s ist nicht sicher belegt; wahrscheinlich ist aber, dass dies von <strong>de</strong>r Hanseflagge abgeleitet ist, wie das erste Mal auf einem Schiffssiegel aus <strong>de</strong>m Jahr<br />
1230 belegt ist. Die wehen<strong>de</strong> Fahne am Mast, so wird angenommen, stellt bereits die Farben Rot und Weiß dar.<br />
Dies ist gleichzeitig auch <strong>de</strong>r älteste Hinweis auf ein eigenes Hoheitszeichen <strong>de</strong>r Stadt. Der Reichsadler tritt etwas später auf. Erste Belege sind Münzen vom Anfang <strong>de</strong>s 14.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts. Die Farben <strong>de</strong>s Schil<strong>de</strong>s kommen mit großer Wahrscheinlichkeit nicht von <strong>de</strong>n Grafen von Holstein, son<strong>de</strong>rn vom Reichswappen. Schließlich fin<strong>de</strong>n sie sich gemeinsam<br />
auf Dokumenten.<br />
Wappen <strong>de</strong>r Freien Reichsstadt<br />
Um 1450 schließlich wur<strong>de</strong>n dann die bei<strong>de</strong>n Wappen <strong>zu</strong>sammengeführt. Der Reichsadler trug darauf das Hansewappen als Brustschild. Von <strong>de</strong>n heute geführten ist es damit das älteste<br />
Wappen Schleswig-Holsteins.
Das Wappen im Kaiserreich Frankreich<br />
Das Lübecker Wappen <strong>de</strong>r Jahre 1811 bis 1813 führte die Stadt Lübeck während ihrer Zugehörigkeit <strong>zu</strong>m Kaiserreich Frankreich. Nach <strong>de</strong>r Einglie<strong>de</strong>rung Lübecks in das Kaiserreich<br />
Frankreich am 1. Januar 1811 erhielt die Stadt ein neues Wappen, welches das bisherige Lübecker Wappen ersetzen und die nunmehrige Stellung Lübecks als Gemeinwesen innerhalb<br />
<strong>de</strong>s französischen Staates unterstreichen sollte. In diesem Wappen, entworfen vom Conseil du Sceau, lag <strong>de</strong>r traditionelle weiß-rote Wappenschild auf einem Paar schwarzer Adlerflügel,<br />
die eine rudimentäre Übernahme <strong>de</strong>s bisherigen Lübecker Doppeladlers darstellten. Die Kombination aus Flügeln und Wappen lag auf einem silbernen (weißen) Schild.<br />
Da Lübeck <strong>zu</strong>gleich mit seiner Einglie<strong>de</strong>rung nach Frankreich <strong>de</strong>n Status einer Bonne Ville <strong>de</strong> l’Empire, also einer nominell bevor<strong>zu</strong>gten Stadt <strong>de</strong>s Reiches, erhalten hatte, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>m<br />
Schild ein Element hin<strong>zu</strong>gefügt, das für sämtliche Bonnes Villes verpflichtend war: Ein rotes Schildhaupt, in <strong>de</strong>m sich drei gol<strong>de</strong>ne kaiserliche Bienen befan<strong>de</strong>n.<br />
Das Wappen wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Lübeck durch einen am 13. Juni 1811 von Napoléon Bonaparte unterzeichneten Wappenbrief verliehen und von <strong>de</strong>r Stadt bis 1813 geführt. Nach <strong>de</strong>r Befreiung<br />
von <strong>de</strong>r französischen Herrschaft und <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>r Eigenständigkeit als Stadtstaat wur<strong>de</strong> das traditionelle Wappen wie<strong>de</strong>r eingeführt.<br />
Wappen <strong>de</strong>r Stadtgemein<strong>de</strong><br />
Das Groß-Hamburg-Gesetz von 1937 been<strong>de</strong>te die Reichsfreiheit <strong>de</strong>r Stadt, in<strong>de</strong>m es sie <strong>de</strong>m Land Preußen einglie<strong>de</strong>rte und sie so ein Teil von Schleswig-Holsteins wur<strong>de</strong>. Es gestattete<br />
aber gleichzeitig auch, das alte Wappen weiter <strong>zu</strong> führen.<br />
Literatur<br />
• Antjekathrin Graßmann (Hrsg.): Lübeckische Geschichte. Schmidt-Römhild, 1989.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Als Abbildung z. B. auf <strong>de</strong>m Stich von Matthäus Merian: Lübeck 1641 Abgebil<strong>de</strong>t sind sie außer<strong>de</strong>m Lübecker Rathaus und am Holstentor.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Rostock<br />
Die Hansestadt Rostock ist eine nord<strong>de</strong>utsche Stadt an <strong>de</strong>r Ostsee. Die kreisfreie Stadt erhielt im Jahr 1218 das Lübische Stadtrecht.<br />
Rostock zieht sich etwa 20 Kilometer am Lauf <strong>de</strong>r Warnow bis <strong>zu</strong>r Ostsee entlang. Der größte bebaute Teil Rostocks befin<strong>de</strong>t sich auf <strong>de</strong>r westlichen Seite <strong>de</strong>r Warnow. Der östliche Teil<br />
<strong>de</strong>r Stadt wird durch Gewerbestandorte und das Waldgebiet <strong>de</strong>r Rostocker Hei<strong>de</strong> geprägt.<br />
Rostock hat heute etwa 200.000 Einwohner und ist von Einwohnerzahl und Fläche die größte Stadt <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Mecklenburg-Vorpommern. Rostock hat einen für Passagierverkehr und<br />
Güterumschlag wichtigen Ostseehafen und einen <strong>de</strong>r größten Kreuzfahrthäfen Deutschlands. Kulturell wie wirtschaftlich gilt es als die wichtigste Stadt im Land. Geprägt ist es durch die
Lage am Meer, <strong>de</strong>n Hafen, die Hanse und <strong>de</strong>ren Backsteingotik sowie die Universität Rostock, die 1419 gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>.<br />
Rostock liegt im Lan<strong>de</strong>steil Mecklenburg und gehörte bis 1918 <strong>zu</strong>m Großherzogtum, dann <strong>zu</strong>m Freistaat Mecklenburg-Schwerin. Die Stadt ist eines <strong>de</strong>r vier Oberzentren <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s.<br />
Wirtschaftlich dominiert neben Schiffbau und Schifffahrt, <strong>de</strong>m Tourismus und Servicesektor <strong>de</strong>utlich die Universität als größter Arbeitgeber <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Geografie<br />
Rostock liegt ziemlich genau in <strong>de</strong>r nördlichen Mitte Mecklenburg-Vorpommerns. Das Stadtgebiet erstreckt sich bei<strong>de</strong>rseits <strong>de</strong>s Unterlaufs <strong>de</strong>r Warnow, die als Unterwarnow vom<br />
Rostocker Stadtzentrum bis <strong>zu</strong>r etwa 16 km entfernten Küste schiffbar ist. Vor <strong>de</strong>r Mündung in die Ostsee beim Ortsteil Warnemün<strong>de</strong> weitet sich die Unterwarnow in Richtung Osten<br />
<strong>zu</strong>m Breitling aus. Hier befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Rostocker Seehafen. Der Südosten und das westliche Warnowufer, die von fruchtbaren Grundmoränenflächen be<strong>de</strong>ckt wer<strong>de</strong>n, sind dicht<br />
besie<strong>de</strong>lt, während <strong>de</strong>r Nordosten durch ländliche Ortsteile und <strong>de</strong>n ca. 6000 ha großen Küstenwald Rostocker Hei<strong>de</strong> geprägt wird.<br />
Rostocks größte Aus<strong>de</strong>hnung von Nord nach Süd beträgt 21,6 km und von Ost nach West 19,4 km. Die Länge <strong>de</strong>r Stadtgrenze (ohne Küste) beträgt 97,9 km. Rostocks Küste selbst hat<br />
eine Länge von 18,5 km. Die Warnow im Stadtgebiet erstreckt sich über 16 km weit. Der höchste Punkt in <strong>de</strong>r Stadt mit etwa 49 m ü. NN liegt im Ortsteil Biestow (Biestow-Ausbau,<br />
Friedrichshöhe), <strong>de</strong>r niedrigste mit etwa 1,5 m unter NN im Ortsteil Warnemün<strong>de</strong> (Diedrichshäger Moor).<br />
Die Geografie <strong>de</strong>r Altstadt, aber auch die <strong>de</strong>r Gegend um Warnemün<strong>de</strong> haben sich im Laufe <strong>de</strong>r Zeit sichtbar verän<strong>de</strong>rt. Wo heute Am Stran<strong>de</strong> eine Hauptverkehrsstraße verläuft, war<br />
früher wirklich Strand, und lange Brücken führten in das schiffbare Wasser. Um die Stadt verlief außer<strong>de</strong>m lange ein Wassergraben <strong>zu</strong>m Schutz, <strong>de</strong>r – nutzlos gewor<strong>de</strong>n – im Zuge <strong>de</strong>r<br />
Entfestigung und <strong>de</strong>s Ausbaus <strong>de</strong>s Stadthafens korrigiert wur<strong>de</strong>. (Auf alten Fotos und Abbildungen sind noch die heute nicht mehr vorhan<strong>de</strong>nen Brücken vor <strong>de</strong>m Petritor und vor <strong>de</strong>m<br />
Kröpeliner Tor <strong>zu</strong> sehen.) Dabei wur<strong>de</strong> neben <strong>de</strong>m Fischer-Hafen <strong>de</strong>r Haedge-Hafen mit <strong>de</strong>m Kohlenkai – heute Haedge-Halbinsel – gebaut.<br />
Darüber hinaus ist auch <strong>de</strong>r Abfluss <strong>de</strong>r Warnow in Warnemün<strong>de</strong> verän<strong>de</strong>rt wor<strong>de</strong>n. War es früher <strong>de</strong>r Alte Strom, ist es heute <strong>de</strong>r Neue Strom, <strong>de</strong>r auch <strong>de</strong>utlich ausgebaut wur<strong>de</strong>. Auch<br />
<strong>de</strong>r Breitling wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Anlage großer Hafenbecken verän<strong>de</strong>rt.<br />
Klima<br />
Die durchschnittliche Lufttemperatur beträgt 8,4 °C, im Jahresmittel fallen 591 mm Nie<strong>de</strong>rschlag.<br />
Geschichte<br />
Namensgeschichte<br />
Die Kyzziner, welche <strong>zu</strong>m slawischen Stammesverband <strong>de</strong>r Wilzen gehörten und bereits um 600 dort Siedlungen gehabt haben müssen, nannten in ihrer Sprache das Auseinan<strong>de</strong>rfließen<br />
<strong>de</strong>r Warnow rastokŭ und gaben <strong>de</strong>r Stadt somit ihren Namen.[3] Dieser altpolabische Name lässt sich übersetzen in auseinan<strong>de</strong>r für roz und Fluss für tok, also <strong>de</strong>r Fluss, <strong>de</strong>r auseinan<strong>de</strong>r<br />
fließt o<strong>de</strong>r sich hier gabelt.[4]<br />
Der Name <strong>de</strong>r Stadt hat sich im Laufe <strong>de</strong>r Jahrhun<strong>de</strong>rte nur leicht verän<strong>de</strong>rt, darauf lässt sich unter an<strong>de</strong>rem aus historischen Texten schließen. Auf relevante Unterschie<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r<br />
Aussprache lässt sich aus diesen jedoch nicht sicher schließen. Um 1165 wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>erst Rozstoc erwähnt. Die Burg wur<strong>de</strong> 1171 Urbs Rozstoc, das Castrum 1182 Rostoch genannt. Weitere<br />
Varianten fin<strong>de</strong>n sich seit 1189: Rotstoc und Rotstoch, 1218 folgte Rozstoc, dann 1219 Roztoc und ab 1240 Rostok. Um 1366 hieß es schließlich Roztock. Dort wo die Warnow, früher<br />
Varnowa, welche durch die Stadt fließt, in die Ostsee mün<strong>de</strong>t, liegt folgerichtig Warnemün<strong>de</strong>. Varna bzw. varn be<strong>de</strong>utet Krähe, bzw. Rabe.<br />
Mittelalter<br />
Die Geschichte um die Gründung Rostocks und die Geschichte um die Gründung <strong>de</strong>s mecklenburgischen Herrschergeschlechts gingen miteinan<strong>de</strong>r einher und bedingten einan<strong>de</strong>r. Schon<br />
lange vor <strong>de</strong>r Neugründung <strong>de</strong>r Stadt Rostock sie<strong>de</strong>lten Stämme, bereits seit ca. 600 die <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m ‚sagenhaften‘ Volk <strong>de</strong>r Wilzen gehören<strong>de</strong>n Kessiner in <strong>de</strong>m Gebiet um die Warnow. In<br />
<strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Stadtgründung fan<strong>de</strong>n Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen vor allem zwischen <strong>de</strong>m Reich <strong>de</strong>r Sachsen und <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Abodriten statt, auch die Dänen waren in diesen Konflikt stark
involviert. 1159–1185 fan<strong>de</strong>n so regelmäßig Flottenzüge <strong>de</strong>s dänischen Königs Wal<strong>de</strong>mar I., <strong>de</strong>m Sohn Knud Lavards (1096–1131), gegen die Wen<strong>de</strong>n statt, welche die süddänischen<br />
Inseln bedrohten. Als erster wirklicher Beleg Rostocks gilt aber <strong>de</strong>r Bericht <strong>de</strong>s Saxo Grammaticus in <strong>de</strong>ssen 16-bändiger Geschichte Dänemarks, <strong>de</strong>n Taten <strong>de</strong>r Dänen (gesta danorum).<br />
1161, so berichtete er, zerstörten die mit <strong>de</strong>n Sachsen verbün<strong>de</strong>ten Dänen unter Wal<strong>de</strong>mar I. die slawische Fürstenburg Rostock (urbs roztoc). Nach dieser Zerstörung wur<strong>de</strong> die Siedlung<br />
mit einem Han<strong>de</strong>lswik wie<strong>de</strong>r aufgebaut. Noch im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt hatten sich Handwerker und Kaufleute dort nie<strong>de</strong>rgelassen. Ein früher Beleg ist 1189 die Existenz einer Burg, eines<br />
Marktes und einer St.-Clemens-Kirche mit <strong>de</strong>utschem Priester.<br />
Um 1200, als die Siedlung in <strong>de</strong>n Warnownie<strong>de</strong>rungen <strong>zu</strong> klein gewor<strong>de</strong>n war, wur<strong>de</strong> auf einer Anhöhe auf <strong>de</strong>r benachbarten, gegenüberliegen<strong>de</strong>n Seite <strong>de</strong>r Warnow, Rostocks ältester<br />
Stadtkern neu und nach Lübischem Vorbild gegrün<strong>de</strong>t. Der Alte Markt entstand damals um die Petrikirche herum und so existierten zwei erste Rostocker Siedlungen nebeneinan<strong>de</strong>r.<br />
Rostock wur<strong>de</strong> schnell <strong>zu</strong>m eigentlichen Kernstück Mecklenburgs. 1214 rang Wal<strong>de</strong>mar II. Kaiser Friedrich II. die Lehnshoheit über das Land ab. 1218 dann ist die Siedlung um die<br />
Petrikirche erstmals schriftlich bezeugt: In einer ersten überlieferten Urkun<strong>de</strong> vom 24. Juni 1218 bestätigt Heinrich Borwin I., <strong>de</strong>r Fürst von Mecklenburg und Herr über Rostock, das<br />
Lübische Stadtrecht. Um die historisch gewachsene Eigenständigkeit Rostocks gegenüber <strong>de</strong>n mecklenburgischen Fürsten <strong>zu</strong> betonen und nach<strong>zu</strong>weisen, wur<strong>de</strong> dieses Datum über die<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rte und <strong>zu</strong>weilen bis heute als <strong>de</strong>r eigentliche Geburtstag <strong>de</strong>r Stadt im Bewusstsein verfestigt.[5] Darauf bil<strong>de</strong>ten sich die bei<strong>de</strong>n weiteren Teilstädte in Rostock. In <strong>de</strong>r<br />
Mittelstadt am Neuen Markt wur<strong>de</strong> 1230 mit <strong>de</strong>m ersten Bau <strong>de</strong>r Marienkirche begonnen, wo 1232 die zweite Siedlung (später Mittelstadt) bezeugt ist, von 1252 existiert ein erster<br />
Beleg <strong>de</strong>r Neustadt um die heute zerstörte Jakobikirche. Um 1240 bzw. 1256 kamen die Bettelor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Franziskaner bzw. <strong>de</strong>r Dominikaner in die Stadt (sie erbauten Katharinenkonvent<br />
bzw. Johanniskonvent).[6]<br />
1251 erhielt Rostock vom dänischen König Abel die gleichen Han<strong>de</strong>lsprivilegien wie <strong>zu</strong>vor schon Lübeck und 1252, die dritte Rostocker Teilstadt war wahrscheinlich schon gegrün<strong>de</strong>t,<br />
wur<strong>de</strong> die Stadtrechtbestätigung von 1218 wie<strong>de</strong>rholt, in <strong>de</strong>r nun auch die Zollfreiheit in <strong>de</strong>r Herrschaft Rostock bestätigt wur<strong>de</strong>, was die Grundlage bil<strong>de</strong>te für die städtische<br />
Machtstellung.<br />
Als sich 1257 die Ratsherren <strong>de</strong>r Städte Lübeck, Rostock und Wismar über wirtschaftliche und politische Fragen berieten, bestand Rostock noch aus diesen drei voneinan<strong>de</strong>r getrennten<br />
Teilstädten, die sich erst 1265 vereinigten. Darauf wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Neue Markt <strong>zu</strong>m Zentrum <strong>de</strong>r Stadt und <strong>zu</strong>m Schutz eine Stadtmauer gebaut, die ca. 1 km² umschloss, ein Gebiet, das bis in<br />
das 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt nicht nach außen wuchs.<br />
Die hanseatische Tradition <strong>de</strong>r Stadt ist bis heute <strong>de</strong>utlich spürbar. In bewusster Anlehnung daran trägt Rostock seit 1990 auch wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Titel Hansestadt. Begonnen hatte sie damit, als<br />
1283 Lübeck, Wismar, Rostock, Stralsund, Greifswald, Stettin, Demmin, Anklam und einige Fürsten das Rostocker Landfrie<strong>de</strong>nsbündnis schlossen und somit das Wendische Quartier<br />
begrün<strong>de</strong>ten. Vierzig Jahre später, 1323, wur<strong>de</strong> von Rostock das kleine Fischerdorf Warnemün<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Dänen abgekauft. 1325 erwarb die Stadt mit <strong>de</strong>m Münzrecht das Recht, eine eigene<br />
Münze, die Mark Rostocker Pfennige, <strong>zu</strong> prägen. Darüber hinaus erwarb Rostock 1358 die volle Gerichtsbarkeit. So wur<strong>de</strong> Rostock <strong>zu</strong> einem <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Hanse,<br />
<strong>de</strong>r Hafen war längst <strong>de</strong>r wichtigste <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Zeichen <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Stadt war vor allem, dass 1419 mit <strong>de</strong>r Universität Rostock eine <strong>de</strong>r ältesten Universitäten Nor<strong>de</strong>uropas<br />
gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Von Papst Martin V. wur<strong>de</strong> die Gründung einer theologischen Fakultät aber noch untersagt.<br />
War Rostock auch bis <strong>zu</strong>m letzten Hansetag 1669 Mitglied <strong>de</strong>r Hanse, begann mit <strong>de</strong>m Erstarken <strong>de</strong>r lan<strong>de</strong>sfürstlichen Macht über die Städte auch ihr En<strong>de</strong>. An Rostock ist das sehr<br />
<strong>de</strong>utlich <strong>zu</strong> sehen. 1484 erklärte Papst Innozenz VIII. die Jakobikirche in einer Bulle <strong>zu</strong>m Domstift. Dass sich die Rostocker <strong>zu</strong>nächst dagegen verwahrten, führte <strong>zu</strong> einer von 1486 bis<br />
1491 andauern<strong>de</strong>n Domfeh<strong>de</strong>, nach <strong>de</strong>r die Schweriner Herzöge Buße for<strong>de</strong>rten und höhere Abgaben sowie Soldaten für das mecklenburgische Heer verlangten.<br />
Darüber hinaus wur<strong>de</strong> Rostock vom Bischof von Ratzeburg 1487 mit <strong>de</strong>m Kirchenbann belegt, was be<strong>de</strong>utete, dass die Universität die Stadt verlassen musste. Erst 1488 erlaubte <strong>de</strong>r<br />
Papst die Rückkehr.<br />
Nach<strong>de</strong>m um 1520 die reformatorischen Lehren Martin Luthers nach Rostock kamen, setzte sich die Reformation relativ schnell durch. Schon im April 1531 entschied <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt<br />
über die Verbindlichkeit <strong>de</strong>r reformatorischen Lehre in Gottesdiensten.<br />
1565 kam es <strong>zu</strong> weiteren Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit Schwerin, die weitgehen<strong>de</strong> Folgen hatten. Unter an<strong>de</strong>rem ging es dabei um die Einführung einer Bierakzise <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>r Herzöge.<br />
Johann Albrecht I. zog mit 500 Reitern gegen die Stadt, nach<strong>de</strong>m Rostock ihm <strong>de</strong>n formalen Huldigungseid verweigerte und ließ die Stadtmauer schleifen um eine Festung bauen <strong>zu</strong><br />
lassen. Erst <strong>de</strong>r Erste Rostocker Erbvertrag vom 21. September 1573, in <strong>de</strong>m <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sfürsten die Erbherrschaft über die Stadt für Jahrhun<strong>de</strong>rte garantiert wur<strong>de</strong>, Rostock sich also auf
lange Zeit band, und sie außer<strong>de</strong>m als höchste Richter anerkannt wur<strong>de</strong>n, been<strong>de</strong>te <strong>de</strong>n Konflikt. Die Bürger schleiften im folgen<strong>de</strong>n Frühjahr die Festung. Von 1575 bis 1577 erfolgte<br />
dann <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>r Stadtmauer, sowie <strong>de</strong>s Lagebuschturms und <strong>de</strong>s Steintors im Stil <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rländischen Renaissance. Die Inschrift sit intra te concordia et publica felicitas, die<br />
noch heute auf <strong>de</strong>m Tor <strong>zu</strong> lesen ist, bezieht sich direkt auf <strong>de</strong>n Konflikt mit <strong>de</strong>m Herzog. 1584 kam es schließlich <strong>zu</strong>m Zweiten Rostocker Erbvertrag, <strong>de</strong>r eine weitere Abgabe früherer<br />
Privilegien nach sich zog. Mit <strong>de</strong>n Erbverträgen wur<strong>de</strong> gleichzeitig die Hoffnung Rostocks darauf <strong>zu</strong>nichtegemacht, wie Lübeck bereits 1226, die Reichsunmittelbarkeit <strong>zu</strong> erlangen.<br />
16. bis 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Während <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges (1618–1648), <strong>de</strong>r das endgültige En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hanse herbeiführte, litt Rostock stark unter <strong>de</strong>n ständig wechseln<strong>de</strong>n Beset<strong>zu</strong>ngen und Plün<strong>de</strong>rungen.<br />
Im Zentrum langfristiger Konflikte stand dabei <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>nzoll, <strong>de</strong>r in Warnemün<strong>de</strong> vom Schwe<strong>de</strong>nkönig Gustaf Adolf erhoben wur<strong>de</strong>. Wallenstein war es, <strong>de</strong>r Rostock befestigte, um<br />
von dort aus die Eroberung Pommerns <strong>zu</strong> unternehmen, verlor die Stadt aber 1631 an die Schwe<strong>de</strong>n. Erst nach En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges, 1648, zogen diese sich aus<br />
Warnemün<strong>de</strong> <strong>zu</strong>rück, bezogen aber noch bis 1654 <strong>de</strong>n Zoll. Rostock war in dieser Zeit völlig verarmt.<br />
Waren die Konflikte mit Schwe<strong>de</strong>n nicht genug, sorgte spätestens <strong>de</strong>r Brand am 11. August 1677 dafür, dass ein Drittel <strong>de</strong>r Stadt vernichtet wur<strong>de</strong>, also etwa 700 von <strong>zu</strong>vor 2000<br />
Häusern, und Rostock völlig in die politische und wirtschaftliche Be<strong>de</strong>utungslosigkeit geriet. Die Einwohnerzahl sank so in <strong>de</strong>r Zeit von 1594 bis 1677 von einst 14.800 auf 5000 ab.<br />
Das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges be<strong>de</strong>utete für Rostock nicht das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s andauern<strong>de</strong>n Verfalls von Macht und Stärke. Der Nordische Krieg und <strong>de</strong>r Siebenjährige Krieg<br />
zeichneten die Stadt weiter. Darüber hinaus nutzten die Fürsten die Schwäche Rostocks aus und sicherten in dieser Zeit langfristig mit <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sherrlichen Erbverträgen von 1755 und<br />
1788 ihre Macht.<br />
Erst En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts begann langsam <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>raufstieg <strong>de</strong>r Hansestadt. Allerdings wur<strong>de</strong> Mecklenburg 1806 von <strong>de</strong>n Franzosen besetzt, Rostock musste sich <strong>de</strong>n<br />
Bedingungen <strong>de</strong>r Kontinentalsperre beugen und Rostocker Bürger mussten in <strong>de</strong>r napoleonischen Armee dienen. Ein an<strong>de</strong>rer Rostocker allerdings, Gebhard Leberecht von Blücher,<br />
kämpfte während <strong>de</strong>r Befreiungskriege auf <strong>de</strong>r Seite <strong>de</strong>r Allianz und war entschei<strong>de</strong>nd an <strong>de</strong>r Schlacht bei Waterloo beteiligt, in <strong>de</strong>r Napoleon geschlagen wer<strong>de</strong>n konnte.<br />
19. Jahrhun<strong>de</strong>rt und Grün<strong>de</strong>rzeit<br />
Das 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt brachte dann <strong>de</strong>r Stadt mit <strong>de</strong>r umfassen<strong>de</strong>n Industrialisierung neuen Reichtum, was sich in vielen Gebäu<strong>de</strong>n und Anlagen dieser Zeit heute noch <strong>de</strong>utlich zeigt. Um<br />
1830 begannen die Rostocker auch außerhalb <strong>de</strong>r Stadtmauergrenzen <strong>zu</strong> bauen. Villen- und Arbeiterviertel entstan<strong>de</strong>n. Um die gleiche Zeit entwickelte sich auch Warnemün<strong>de</strong> <strong>zu</strong> einem<br />
<strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Seekurorte in Deutschland.<br />
1852 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r erste <strong>de</strong>utsche Schraubendampfer fertiggestellt, und 1870 erhielt die Universität ihr heutiges Hauptgebäu<strong>de</strong>. 1850 wur<strong>de</strong> die Schiffswerft und Maschinenfabrik von<br />
Wilhelm Zeltz und Albrecht Tischbein gegrün<strong>de</strong>t, aus <strong>de</strong>r 1890 als erster industrieller Großbetrieb Mecklenburgs die Actien-Gesellschaft „Neptun“ Schiffswerft und Maschinenfabrik in<br />
Rostock hervorging. Die Bevölkerungszahl stieg in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahrzehnten um fast 80.000 auf 121.000 Einwohner. Auch Industrien wie die Chemischen Fabriken <strong>de</strong>s Friedrich Witte<br />
sowie Landmaschinenbau, Bauwesen und die Entwicklung Rostocks <strong>zu</strong>m Verwaltungs- und Bankenstandort trugen da<strong>zu</strong> bei, <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> einem seit langem ungekannten Aufstieg <strong>zu</strong><br />
verhelfen.<br />
Seit 1868 nach <strong>de</strong>m Beitritt Mecklenburg-Schwerins <strong>zu</strong>m Nord<strong>de</strong>utschen Bund durften sich wie<strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Stadt nie<strong>de</strong>rlassen. Schnell bil<strong>de</strong>te sich eine jüdische Gemein<strong>de</strong>, die sich<br />
1870 einen Friedhof am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Alten Friedhofs, <strong>de</strong>m heutigen Lin<strong>de</strong>npark, einrichtete.<br />
Die schnelle Industrialisierung brachte aber nicht nur Gutes. Spätestens mit <strong>de</strong>m Ersten Weltkrieg kam es <strong>zu</strong> viel Armut unter <strong>de</strong>n Arbeitern, die sich in Unruhen äußerten und in <strong>de</strong>r<br />
For<strong>de</strong>rung nach einem En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Krieges sowie <strong>de</strong>r Beseitigung <strong>de</strong>r halbfeudalen Verhältnisse in Mecklenburg. So waren es vor allem die Rostocker, die für die Demokratisierung und<br />
<strong>de</strong>n Sturz <strong>de</strong>s Großherzogs im Land verantwortlich waren. Die erste <strong>de</strong>mokratische Verfassung Rostocks war es schließlich, welche <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sherrlichen Erbvergleich von 1788, <strong>de</strong>r die<br />
Stadt über Jahrhun<strong>de</strong>rte an einer freien Entwicklung hin<strong>de</strong>rte, außer Kraft setzte.<br />
Neuere Geschichte
Im Jahre 1902 weihte die Jüdische Gemein<strong>de</strong> für die etwa 280 Mitglie<strong>de</strong>r eine Synagoge in <strong>de</strong>r Augustenstraße 101 ein.<br />
In <strong>de</strong>n 1920er Jahren sie<strong>de</strong>lte sich mit <strong>de</strong>m Flugzeugbau eine neue Industrie an: in Warnemün<strong>de</strong> entstan<strong>de</strong>n 1921 die Arado Flugzeugwerke; im Jahr darauf die Heinkel-Werke. In<br />
Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>m Ingenieur Hans Joachim Pabst von Ohain entwickelte Ernst Heinkel mit <strong>de</strong>r He 178 das weltweit erste Strahlflugzeug, das am 27. August 1939 vom<br />
Werksflughafen Rostock-Marienehe aus seinen Jungfernflug machte.<br />
In <strong>de</strong>r Vorbereitung <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs wur<strong>de</strong> Rostock als Industriestandort in die allgemeine Aufrüstung eingebun<strong>de</strong>n. Bei <strong>de</strong>n großen Firmen waren später mehrere Tausend<br />
Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene o<strong>de</strong>r sogenannte „Ostarbeiter" verpflichtet.<br />
Wie in an<strong>de</strong>ren Städten <strong>de</strong>s Deutschen Reiches kam es auch in Rostock in <strong>de</strong>r Nacht vom 9. <strong>zu</strong>m 10. November 1938 <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n antisemitischen Ausschreitungen <strong>de</strong>r Reichspogromnacht, in<br />
<strong>de</strong>ren Verlauf die Rostocker Synagoge von <strong>de</strong>n Nationalsozialisten nie<strong>de</strong>rgebrannt wur<strong>de</strong>. Schon vorher waren unter <strong>de</strong>m Druck viele Ju<strong>de</strong>n ausgewan<strong>de</strong>rt, einige hatten Selbstmord<br />
begangen wie <strong>de</strong>r Zahnmediziner Prof. Hans Moral. Jüdischer Besitz wur<strong>de</strong> „arisiert“. Im Holocaust wur<strong>de</strong>n auch aus Rostock Menschen <strong>de</strong>portiert und getötet, die meisten im Juli und<br />
November 1942. Seit 2001 erinnern Ge<strong>de</strong>nkplatten, so genannte Stolpersteine an jüdische Opfer <strong>de</strong>r Shoa.<br />
Der Heinkel-Flugzeugbau wur<strong>de</strong> ab 1932 <strong>zu</strong>m größten Industriebetrieb Mecklenburgs und <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>n Arado-Werken und <strong>de</strong>r Neptunwerft waren Rostock und Warnemün<strong>de</strong><br />
Zentren <strong>de</strong>r Rüstungsindustrie <strong>de</strong>s Deutschen Reiches. Diese Entwicklung hatte allerdings auch <strong>zu</strong>r Folge, dass im Zweiten Weltkrieg die Stadt <strong>zu</strong> einem bevor<strong>zu</strong>gten Ziel von<br />
Luftangriffen <strong>de</strong>r britischen Royal Air Force (RAF) und <strong>de</strong>n amerikanischen United States Army Air Forces (USAAF) wur<strong>de</strong>.<br />
En<strong>de</strong> April 1942 wur<strong>de</strong> Rostock – nach <strong>de</strong>m Luftangriff auf Lübeck – Ziel <strong>de</strong>s zweiten britischen Flächenbombar<strong>de</strong>ments auf eine <strong>de</strong>utsche Großstadt. Vom 23. bis <strong>zu</strong>m 27. April flog<br />
die RAF jeweils nachts mit insgesamt 460 Bombern schwere Angriffe gegen die Arado- und Heinkelwerke sowie beson<strong>de</strong>rs gegen das Stadtzentrum (75 % <strong>de</strong>r Bombenlast). Neben<br />
Sprengbomben warfen sie auch massenhaft Brandbomben. „Die Brandbombe erwies sich in Rostock als das fürchterlichste Mittel <strong>de</strong>r Stadtzerstörung“.[7] Mehr als die Hälfte <strong>de</strong>r<br />
historischen Bausubstanz wur<strong>de</strong> vernichtet, das alte Rostock existierte <strong>zu</strong> großen Teilen nicht mehr. En<strong>de</strong> 1942 war Rostock eine <strong>de</strong>r am schwersten zerstörten Städte im Deutschen<br />
Reich. Reichsstatthalter Hil<strong>de</strong>brandt erklärte in <strong>de</strong>r Zeit vom 25. April bis <strong>zu</strong>m 4. Juni 1942 für das Gebiet <strong>de</strong>r Seestadt Rostock und die angrenzen<strong>de</strong>n Kreise <strong>de</strong>n Ausnahme<strong>zu</strong>stand.<br />
30.000 bis 40.000 Menschen waren obdachlos gewor<strong>de</strong>n, 135.000 bis 150.000 aus Rostock geflohen. Die Zahl <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sopfer lag bei 200.[7][8] Nach <strong>de</strong>r Intensität <strong>de</strong>r Angriffe<br />
wahrscheinlicher ist die Zahl von 617 Bombenopfern.[9]<br />
Zum En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Krieges waren von vormals 10.535 Wohnhäusern in <strong>de</strong>r Stadt 2611 vollständig zerstört, weitere 6735 beschädigt. Insgesamt wur<strong>de</strong>n von 1941 bis 1945 von <strong>de</strong>r RAF 990 t<br />
und von <strong>de</strong>n USAAF 1950 t Bomben auf Rostock und Warnemün<strong>de</strong> abgeworfen. Für die Amerikaner hatten die Flugzeugwerke Priorität. [10]<br />
Kurz vor En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkriegs Rostock besetzte die Rote Armee nahe<strong>zu</strong> kampflos am 1. Mai 1945 Rostock, nicht <strong>zu</strong>letzt weil sich die Führung <strong>de</strong>r örtlichen NSDAP <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m<br />
Zeitpunkt bereits auf <strong>de</strong>r Flucht befand. Die weitgehend zerstörten Flugzeugwerke fielen als Reparationen an die Sowjetunion. Die Neptun-Werft wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r aufgebaut und in<br />
Warnemün<strong>de</strong> entstand 1945/46 die Warnowwerft. Bei<strong>de</strong> Werften führten anfangs fast ausschließlich Reparationsaufträge durch.<br />
Durch Kriegsheimkehrer und <strong>de</strong>n Zustrom Vertriebener stieg die Einwohnerzahl bis 1950 wie<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>n Vorkriegsstand. Rostock gehörte <strong>zu</strong>r Sowjetischen Besat<strong>zu</strong>ngszone und seit<br />
1949 <strong>zu</strong>r DDR.<br />
Zu <strong>de</strong>n Opfern <strong>de</strong>r diktatorischen Politik <strong>de</strong>r sowjetischen Besat<strong>zu</strong>ngsmacht und <strong>de</strong>r SED gehörte <strong>de</strong>r Stu<strong>de</strong>nt Arno Esch, <strong>de</strong>r als führen<strong>de</strong>r Funktionär in <strong>de</strong>r LDP Opposition betrieb und<br />
1949 verhaftet wur<strong>de</strong>. Sowjetische Gerichte verurteilten ihn <strong>zu</strong>m To<strong>de</strong>, die Hinrichtung erfolgte 1951 in Moskau.<br />
Der Aufstand <strong>de</strong>s 17. Juni 1953 löste auf <strong>de</strong>r Rostocker Werft Streiks und weitergehen<strong>de</strong> politische For<strong>de</strong>rungen aus. Sowjetische Truppen und Volkspolizei dämmten die Bewegung<br />
gewaltsam ein. Seit 1959 residierte die Bezirksdienststelle <strong>de</strong>r Stasi, die größte aller 15 Bezirke und <strong>zu</strong>ständig für die ganze Ostseeküste, in einem großen Komplex in <strong>de</strong>r August-Bebel-<br />
Straße. Dort wur<strong>de</strong>n bis 1989 mehr als 4800 Menschen inhaftiert, die meisten aus politischen Grün<strong>de</strong>n.[11]<br />
Nach <strong>de</strong>m Krieg begann <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>r zerstörten Stadt. Viele Gebäu<strong>de</strong> – wie das Stadttheater – waren nicht mehr <strong>zu</strong> retten; an<strong>de</strong>re, wie die Jakobikirche o<strong>de</strong>r das Petritor, hätten<br />
durchaus gerettet wer<strong>de</strong>n können.<br />
1952 wur<strong>de</strong> Rostock durch die Verwaltungsreform Bezirksstadt <strong>de</strong>s gleichnamigen Bezirks (siehe: Bezirk Rostock). Die Stadt entwickelte sich <strong>zu</strong>m Schiffbau- und Schifffahrtszentrum
<strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s und erlangte auch hierdurch eine wachsen<strong>de</strong> Be<strong>de</strong>utung innerhalb <strong>de</strong>r DDR. Neben <strong>de</strong>n Werften entstan<strong>de</strong>n 1949 das Dieselmotorenwerk, 1950 das spätere Fischkombinat<br />
und 1952 die Deutsche Seeree<strong>de</strong>rei Rostock (DSR). Infolge <strong>de</strong>s Krieges und <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Teilung verfügte die DDR über keinen be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Seehafen. So entstand zwischen 1957 und<br />
1960 <strong>de</strong>r Überseehafen Rostock. Auch die Hochschullandschaft folgte <strong>de</strong>r maritimen Ausrichtung.<br />
Der wirtschaftliche Aufschwung ließ viele Menschen aus an<strong>de</strong>ren Teilen <strong>de</strong>r DDR nach Rostock strömen. Bis 1988 wuchs die Stadt auf über 250.000 Einwohner. Es entstan<strong>de</strong>n um das<br />
Zentrum von Rostock zwischen 1960 bis 1989 die folgen<strong>de</strong>n Großwohnsiedlungen meist in Plattenbauweise: Dierkow (7.530 Wohnungen), Evershagen (8.732 Wohnungen), Groß Klein<br />
(8.200 Wohnungen), Lichtenhagen (6.925 Wohnungen), Lütten Klein (10.631 Wohnungen), Reutershagen (9.772 Wohnungen), Schmarl (4.908 Wohnungen), Südstadt (7.917<br />
Wohnungen) und Toitenwinkel (6.549 Wohnungen).<br />
Die politische Wen<strong>de</strong> 1989 ermöglichte auch in Rostock große Verän<strong>de</strong>rungen. Im Frühherbst 1989 versammelten sich mehr und mehr Bürger <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n bald wöchentlich<br />
stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Donnerstags-Demonstrationen. Der Rostocker Pastor Joachim Gauck leitete die Mahngottesdienste in <strong>de</strong>r St. Marienkirche, an die sich die Demonstrationen anschlossen.<br />
Mit <strong>de</strong>m Beitritt <strong>de</strong>r DDR <strong>zu</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland 1990 erlebte die Stadt wichtige Verän<strong>de</strong>rungen. Am <strong>de</strong>utlichsten war jedoch <strong>zu</strong>nächst ein Bevölkerungsrückgang um<br />
ungefähr 50.000 Einwohner durch Abwan<strong>de</strong>rung in an<strong>de</strong>re Teile Deutschlands, Geburtenrückgang und Umzüge in <strong>de</strong>n Speckgürtel um die Stadt. Diese Ten<strong>de</strong>nz kam erst 15 Jahre später<br />
<strong>zu</strong>m Stillstand. Gleichzeitig verloren viele Menschen in <strong>de</strong>r Stadt, wie in <strong>de</strong>r ganzen Region, ihre Arbeitsplätze, neue konnten aufgrund fehlen<strong>de</strong>r wirtschaftlicher Strukturen nicht<br />
schnell genug entstehen. Dennoch blieb Rostock das wichtigste wirtschaftliche Zentrum Mecklenburg-Vorpommerns.<br />
Ab 1991 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r historische Stadtkern u. a. im Rahmen <strong>de</strong>r Städtebauför<strong>de</strong>rung gründlich saniert. Gebäu<strong>de</strong>, die vor <strong>de</strong>m Verfall stan<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong>n gerettet, ein behutsamer Rückbau und<br />
Stadtumbau in <strong>de</strong>n Plattenbaugebieten wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>sammen mit Verbesserungen <strong>de</strong>s Wohnumfelds begonnen, um einem Leerstand von Wohnungen entgegen<strong>zu</strong>wirken. Die Infrastruktur<br />
wur<strong>de</strong> erneuert und als ein sichtbares Zeichen für <strong>de</strong>n Neuanfang erhielt St. Petri seinen neu errichteten Turmhelm, <strong>de</strong>r teilweise aus Spen<strong>de</strong>ngel<strong>de</strong>rn finanziert wor<strong>de</strong>n ist.<br />
Ein gesellschaftlicher Tiefpunkt waren im August 1992 auslän<strong>de</strong>rfeindliche Übergriffe im Stadtteil Lichtenhagen, welche das Bild <strong>de</strong>r Stadt noch Jahre danach in <strong>de</strong>r Öffentlichkeit<br />
prägten. Eine Antwort von Rostocker Einwohnern darauf war die Gründung <strong>de</strong>r bis heute sehr aktiven Initiative „Bunt statt Braun“.<br />
Rostock richtete 2003 die Internationale Gartenschau (IGA) aus. Im selben Jahr wur<strong>de</strong> auch <strong>de</strong>r Warnowtunnel eröffnet. Die gemeinsame Bewerbung mit Leipzig um die Austragung <strong>de</strong>r<br />
Olympischen Sommerspiele 2012 aber misslang schon in <strong>de</strong>r internationalen Vorauswahl durch das IOC am 18. Mai 2004. Zu einer stärkeren I<strong>de</strong>ntifizierung mit <strong>de</strong>r Stadt tragen auch<br />
bis heute weitere umfangreiche Renovierungen <strong>de</strong>r historischen Bausubstanz in Rostock bei und nicht <strong>zu</strong>letzt Veranstaltungen wie die Hanse Sail.<br />
Diese Jahre sind neben einer gewissen wirtschaftlichen Konsolidierung allerdings ebenso geprägt von emotionalen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit <strong>de</strong>r Politik <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s um<br />
Kür<strong>zu</strong>ngen <strong>de</strong>r Finanzierung vor allem im Bildungswesen sowie in <strong>de</strong>r Kultur. Die Universität ist so beispielsweise gezwungen, die traditionelle juristische Fakultät <strong>zu</strong> schließen.<br />
Rostock selbst ist verschul<strong>de</strong>t und kämpft um seine Verwaltungsautonomie. Daher wer<strong>de</strong>n einige umfangreiche strukturelle Reformen in <strong>de</strong>r Stadt, aber auch <strong>de</strong>r Verwaltung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s<br />
Mecklenburg-Vorpommern unternommen, die <strong>zu</strong> mehr Effizienz führen sollen. Mit <strong>de</strong>r geplanten Kreisreform Mecklenburg-Vorpommern 2011 soll Rostock seine Kreisfreiheit behalten,<br />
wobei <strong>de</strong>r umliegen<strong>de</strong> Landkreis Bad Doberan mit <strong>de</strong>m Landkreis Güstrow <strong>zu</strong>m neuen Landkreis Mittleres Mecklenburg vereinigt wird.<br />
In <strong>de</strong>n Blickpunkt <strong>de</strong>r internationalen Öffentlichkeit geriet Rostock Anfang Juni 2007 mit <strong>de</strong>m Weltwirtschaftsgipfel <strong>de</strong>r G8 im nordwestlich gelegenen Seebad Heiligendamm. Ein<br />
großer Teil <strong>de</strong>r Begleitveranstaltungen fand in Rostock statt, so <strong>de</strong>r Alternativgipfel und zahlreiche Demonstrationen. Am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>r internationalen Demonstration am 2. Juni kam es <strong>zu</strong><br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen <strong>de</strong>r Polizei und Globalisierungskritikern, bei <strong>de</strong>nen nach offiziellen Angaben rund 1.000 Personen verletzt wur<strong>de</strong>n, vorwiegend durch Steinwürfe und<br />
<strong>de</strong>n Einsatz von Wasserwerfern.[12]<br />
Gesellschaft und Politik<br />
Stadtverwaltung und Bürgermeister<br />
An <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>r Stadt stand seit <strong>de</strong>m 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>r Rat mit <strong>zu</strong>nächst 10, später 24 Ratsherren. Den Vorsitz hatte <strong>de</strong>r Proconsules beziehungsweise Bürgermeister. Im 19.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt gab es sogar 3 Bürgermeister. Ab 1925 tragen die Bürgermeister <strong>de</strong>n Titel Oberbürgermeister (Liste <strong>de</strong>r Rostocker Bürgermeister). Dieser wur<strong>de</strong> über Jahrhun<strong>de</strong>rte vom Rat
<strong>de</strong>r Stadt gewählt. Seit 2002 wird er direkt vom Volk gewählt.<br />
Als Vertretung <strong>de</strong>r Bürger gibt es eine Stadtvertretung, die in Rostock die Bezeichnung Bürgerschaft trägt (in an<strong>de</strong>ren Städten heißt dieses Gremium auch Gemein<strong>de</strong>rat,<br />
Stadtverordnetenversammlung o<strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt). Die Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Bürgerschaft wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Bürgern <strong>de</strong>r Stadt auf 5 Jahre gewählt. Nach <strong>de</strong>m Wegfall <strong>de</strong>r Fünf-Prozent-Hür<strong>de</strong><br />
<strong>zu</strong>r Kommunalwahl am 13. Juni 2004 wur<strong>de</strong>n die Mehrheitsverhältnisse in <strong>de</strong>r Rostocker Bürgerschaft unübersichtlich. Die Bürgerschaft besteht <strong>de</strong>rzeit aus 53 Abgeordneten; nach <strong>de</strong>r<br />
Bürgerschaftswahl 2009 stellt Die Linke 13, die SPD 10, die CDU 9, Bündnis 90/Die Grünen 5, die FDP und FÜR Rostock – pro OB jeweils 4, <strong>de</strong>r Rostocker Bund 3, die NPD 2 und<br />
sonstige 3 (AUFBRUCH 09, GRAUE und SAV). Vorsitzen<strong>de</strong>r ist <strong>de</strong>r Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r Bürgerschaft. Dieses <strong>zu</strong>sätzliche repräsentative Amt in <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> 1990 neben <strong>de</strong>m Amt <strong>de</strong>s<br />
Oberbürgermeisters durch das „Gesetz über die Selbstverwaltung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n und Landkreise in <strong>de</strong>r DDR“ durch die damalige Volkskammer <strong>de</strong>r DDR eingeführt. Es wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>nächst<br />
hauptamtlich wahrgenommen. Seit <strong>de</strong>r Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Kommunalverfassung 1994 wird es nur noch ehrenamtlich ausgeführt. Der Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r Bürgerschaft leitet die Sit<strong>zu</strong>ngen, bereitet<br />
diese vor und vertritt die Bürgerschaft nach außen. Er repräsentiert <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m Oberbürgermeister die Stadt.<br />
Zum Oberbürgermeister <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock wur<strong>de</strong> am 27. Februar 2005 Roland Methling (parteilos) im ersten Wahlgang mit absoluter Mehrheit gewählt.<br />
Wappen, Flagge und Logo<br />
Rostock führte in seiner Geschichte drei verschie<strong>de</strong>ne Wappen. Das Signum, Secretum und Sigillum. Das Signum, welches seit 1367 als Siegelstempel nachweisbar ist, entstand <strong>zu</strong>letzt<br />
und ist bis heute das Wappen <strong>de</strong>r Hansestadt.<br />
Das Wappen wur<strong>de</strong> am 10. April 1858 von Friedrich Franz II., Großherzog von Mecklenburg-Schwerin festgelegt und unter <strong>de</strong>r Nr. 9 <strong>de</strong>r Wappenrolle von Mecklenburg-Vorpommern<br />
registriert.<br />
Blasonierung: „Geteilt; oben in Blau ein schreiten<strong>de</strong>r, rot ge<strong>zu</strong>ngter gol<strong>de</strong>ner Greif; unten geteilt von Silber über Rot.“<br />
Das Wappen wur<strong>de</strong> 1939 von <strong>de</strong>m Berliner Prof. Hans Schweitzer neu gezeichnet.<br />
In Blau ein schreiten<strong>de</strong>r gol<strong>de</strong>ner Greif ist das herrschaftliche Zeichen <strong>de</strong>r Rostocker Fürsten. Darunter Silber und Rot sind die Farben <strong>de</strong>r Hanse.<br />
Die Stadtflagge besteht aus drei waagerechten Streifen. Der obere Streifen zeigt die Farbe Blau. Er nimmt die Hälfte <strong>de</strong>r Flaggenhöhe ein und ist mit einem <strong>zu</strong>m Liek gewen<strong>de</strong>ten,<br />
schreiten<strong>de</strong>n gol<strong>de</strong>nen (gelben) Greifen mit aufgeworfenem Schweif und ausgeschlagener roter Zunge belegt. Der mittlere Streifen zeigt die Farbe Silber (Weiß), <strong>de</strong>r untere Streifen die<br />
Farbe Rot. Die bei<strong>de</strong>n unteren Streifen nehmen je ein Viertel <strong>de</strong>r Höhe ein. Die Höhe <strong>de</strong>s Flaggentuchs verhält sich <strong>zu</strong>r Länge wie 3:5.<br />
Im Laufe <strong>de</strong>r Geschichte hat sich die Stadtflagge mehrmals verän<strong>de</strong>rt. In <strong>de</strong>r heutigen Form wur<strong>de</strong> sie <strong>zu</strong>letzt in <strong>de</strong>r Hauptsat<strong>zu</strong>ng von 1991 vom Rat <strong>de</strong>r Stadt festgelegt. Der Greif ist<br />
ein typisches Wappentier für die wendische Region, mit Greifswald wur<strong>de</strong> selbst eine Stadt nach ihm benannt. Der Greif ist das Schutztier. Mit seinen Krallen hält es Fein<strong>de</strong> fern. Das<br />
Wappen ist in Rostock nicht nur auf Flaggen, Häusern und Haltestellen <strong>zu</strong> sehen, son<strong>de</strong>rn auch auf Kanal<strong>de</strong>ckeln, Gartenzäunen, Brücken sowie an Schiffen und Restaurants.<br />
Stadtglie<strong>de</strong>rung<br />
Das Stadtgebiet Rostocks ist in 31 Ortsteile geglie<strong>de</strong>rt. Mehrere Ortsteile sind insgesamt in acht Ortsamtsbereiche <strong>zu</strong>sammen gefasst, für die jeweils ein Ortsamt <strong>zu</strong>ständig ist. Hier<br />
wer<strong>de</strong>n Einwohnerangelegenheiten (z. B. Meldungen) bearbeitet.<br />
Alle Ortsteile <strong>de</strong>r Stadt sind <strong>zu</strong> insgesamt 19 Ortsteilvertretungen <strong>zu</strong>sammen gefasst. Diese Gremien heißen Ortsbeiräte und wer<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Bürgerschaft <strong>de</strong>r Stadt Rostock nach je<strong>de</strong>r<br />
Kommunalwahl neu bestimmt. Ihre Mitglie<strong>de</strong>rzahl schwankt je nach Größe ihres Zuständigkeitsbereichs zwischen 9 und 13. Die Ortsbeiräte sind <strong>zu</strong> wichtigen Angelegenheiten in ihren<br />
Ortsteilen <strong>zu</strong> hören und sind vor allem beratend tätig. Eine endgültige Entscheidungskompetenz hat jedoch nur die Bürgerschaft <strong>de</strong>r Gesamtstadt.<br />
Rostocker Ortsämter und Stadtteile im Detail
Die 8 Ortsamtsbereiche mit ihren <strong>zu</strong>gehörigen Orts- und Stadtteilen<br />
Ortsamt Stadtteile/Ortsteile<br />
1. Seebad Warnemün<strong>de</strong>, Diedrichshagen, Markgrafenhei<strong>de</strong> (Waldsiedlung), Hohe Düne (An <strong>de</strong>r See, Yachthafen), Hinrichshagen (Erich-Weinert-Siedlung, Wallensteinslager),<br />
Wiethagen (Meyers Hausstelle), Torfbrücke<br />
2. Lichtenhagen (Klein Lichtenhagen, Ostseewelle, Möhlenkamp, Siedlung Grabower Str.), Groß Klein (Lütten Klein-Dorf, Dänenberg, Groß Klein-Dorf)<br />
3. Lütten Klein<br />
4. Evershagen (Evershagen-Süd, Evershagen-Dorf, Obstplantage, Schutow), Schmarl (Marienehe, Schmarl-Dorf)<br />
5. Reutershagen (Reutershagen I, Reutershagen II, Komponistenviertel, Vorwe<strong>de</strong>n, Schutow), Hansaviertel, Gartenstadt<br />
6. Kröpeliner-Tor-Vorstadt (Bramow), Stadtmitte (Steintor-Vorstadt, Nördliche Altstadt, Östliche Altstadt), Brinckmansdorf (Alt Bartelsdorf, Riekdahl, Osthafen, Weißes Kreuz,<br />
Wal<strong>de</strong>slust, Kassebohm)<br />
7. Südstadt, Biestow<br />
8. Dierkow-Neu (Dierkower Höhe), Dierkow-Ost, Dierkow-West, Toitenwinkel, Gehlsdorf (Langenort), Hinrichsdorf, Krummendorf (Ol<strong>de</strong>ndorf, Warnowran<strong>de</strong>), Nienhagen, Peez,<br />
Stuthof, Jürgeshof<br />
Nachbargemein<strong>de</strong>n<br />
In <strong>de</strong>m Bereich, in <strong>de</strong>m die Hansestadt nicht an die Ostsee grenzt, ist sie vollständig vom Landkreis Bad Doberan umgeben. Seit <strong>de</strong>n 1990er Jahren ist so durch neu entstan<strong>de</strong>ne<br />
Siedlungen und Gewerbegebiete eine Agglomeration entstan<strong>de</strong>n, also ein Gebiet, das administratorisch nicht <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Stadt selbst zählt, jedoch geografisch.<br />
Bei <strong>de</strong>n Nachbargemein<strong>de</strong>n Rostocks han<strong>de</strong>lt es sich um die folgen<strong>de</strong>n: im Nordosten die amtsfreie Gemein<strong>de</strong> Graal-Müritz, im Osten das Amt Rostocker Hei<strong>de</strong> (mit <strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n<br />
Gelbensan<strong>de</strong>, Rövershagen, Mönchhagen und Bentwisch), im Südosten das Amt Carbäk (mit Bro<strong>de</strong>rstorf und Roggentin), im Sü<strong>de</strong>n die amtsfreie Gemein<strong>de</strong> Dummerstorf. Im Sü<strong>de</strong>n bis<br />
in <strong>de</strong>n Nordwesten grenzt Rostock an das Amt Warnow-West (mit <strong>de</strong>n Gemein<strong>de</strong>n Papendorf, Kritzmow, Lambrechtshagen, sowie Elmenhorst/Lichtenhagen), unterbrochen nur von<br />
einer kurzen Angren<strong>zu</strong>ng an das Amt Bad Doberan-Land mit <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Admannshagen-Bargeshagen.<br />
Eingemeindungen<br />
Nach <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>r Stadt und <strong>de</strong>r Vereinigung <strong>de</strong>r Stadtteile erwarb Rostock im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt die große Rostocker Hei<strong>de</strong> sowie einige nahe gelegene Dörfer und Gutsstellen<br />
(Bartelsdorf, Bentwisch, Bro<strong>de</strong>rstorf, Kassebohm, Kessin, Rövershagen, Riekdahl, Stuthof, Willershagen und Gragetopshof).<br />
Die meisten dieser Orte wur<strong>de</strong>n jedoch später wie<strong>de</strong>r als eigenständige Gemein<strong>de</strong>n geführt und erst im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Stadtgebiet Rostocks angeschlossen (vergleiche<br />
unten: Rostocker Eingemeindungen im Detail). Im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt erwarb die Stadt das Dorf Warnemün<strong>de</strong> und erhielt so <strong>de</strong>n Zugang <strong>zu</strong>m Meer. Bis in das 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt hinein war<br />
Warnemün<strong>de</strong> eine Rostocker Exklave. Ein geschlossenes Stadtgebiet besteht seit 1934.<br />
Man kann somit drei Stufen <strong>de</strong>r Stadtentwicklung festhalten: Die erste im 13. und 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt, die zweite nach <strong>de</strong>r Industrialisierung, also seit <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts<br />
und die dritte nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg (siehe Grafik).<br />
• Rostocker Eingemeindungen im Detail<br />
• Die Stufen <strong>de</strong>r Eingemeindungen von Orten in die Hansestadt Rostock<br />
Jahr Orte<br />
• 25. März 1252 Rostocker Hei<strong>de</strong>
• 1323 Warnemün<strong>de</strong>1<br />
• 1. Januar 1913 Dierkow<br />
• 14. Juli 1919 Barnstorf, Bartelsdorf, Bramow, Brinckmansdorf, Dalwitzhof, Damerow, Kassebohm, Riekdahl<br />
• 9. Dezember 1924 Hinrichshagen, Markgrafenhei<strong>de</strong>, Meyers Hausstelle, Schnatermann, Torfbrücke, Waldhaus, Wiethagen<br />
• 1. April 1930 Kloster <strong>zu</strong>m Heiligen Kreuz<br />
• 8. März 1934 Diedrichshagen, Gehlsdorf, Groß Klein, Lütten Klein, Marienehe, Schmarl, Schutow<br />
• 1. Juli 1950 Biestow, Evershagen, Krummendorf, Peez, Petersdorf, Stuthof, Toitenwinkel<br />
• 1. Januar 1960 Hinrichsdorf, Nienhagen<br />
• 10. September 1978 Jürgeshof<br />
1 Bereits 1264 wur<strong>de</strong> ein „Rostocker Warnemün<strong>de</strong>“, ein Seehafen beim heutigen Hohe Düne, <strong>de</strong>m städtischen Recht unterstellt.<br />
Neuglie<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Landkreise<br />
Gemäß einer Entscheidung <strong>de</strong>s Landtags von Mecklenburg-Vorpommern vom 5. April 2006 sollte es ab <strong>de</strong>m 1. Oktober 2009 einen Großkreis Mittleres Mecklenburg-Rostock mit <strong>de</strong>r<br />
Kreisstadt Rostock geben.[13] Dieser Großkreis sollte die bisherigen Landkreise Bad Doberan und Güstrow sowie die bisher kreisfreie Stadt Rostock umfassen. Nach <strong>de</strong>m Urteil <strong>de</strong>s<br />
Lan<strong>de</strong>sverfassungsgerichtes vom 26. Juli 2007 kann das Reformgesetz in <strong>de</strong>r bisher geplanten Form als mit <strong>de</strong>r Verfassung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s unvereinbar nicht umgesetzt wer<strong>de</strong>n.[14]<br />
Einwohnerentwicklung<br />
Da Rostock lange Zeit nicht über seine Grenzen hinauswuchs, blieb die Einwohnerzahl vom Mittelalter bis in das 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt konstant bei maximal 11.000–14.000 Personen. Erst<br />
mit <strong>de</strong>r Industrialisierung begann diese schnell <strong>zu</strong> wachsen und überschritt bereits 1935 die Grenze von 100.000, wodurch Rostock <strong>zu</strong>r Großstadt wur<strong>de</strong>. Bis 1940 stieg die<br />
Bevölkerungszahl dann auf 129.500. Auf Grund <strong>de</strong>r Ereignisse um <strong>de</strong>n Zweiten Weltkrieg sank diese bis Mai 1945 um etwa die Hälfte auf 68.928, stieg dann aber schnell an mit <strong>de</strong>r<br />
Zuwan<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>utscher Vertriebener aus <strong>de</strong>n Ostprovinzen.<br />
Im Jahre 1971 wur<strong>de</strong> die Grenze von 200.000 Einwohnern überschritten. 1988 erreichte die Bevölkerungszahl mit rund 254.000 ihren historischen Höchststand. Seit <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r<br />
DDR verlor die Stadt wegen hoher Arbeitslosigkeit, <strong>de</strong>s Weg<strong>zu</strong>gs vieler Einwohner in das Umland und <strong>de</strong>s Geburtenrückgangs 22 Prozent ihrer Bewohner (55.000 Personen). Am 30.<br />
Juni 2007 betrug die „Amtliche Einwohnerzahl“ für Rostock nach Fortschreibung <strong>de</strong>s Statistischen Lan<strong>de</strong>samtes Mecklenburg-Vorpommern 199.751 (nur Hauptwohnsitze und nach<br />
Abgleich mit <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Lan<strong>de</strong>sämtern). Am 31. Dezember 2007 ist die Bevölkerung Rostocks mit 200.413 Menschen erstmals wie<strong>de</strong>r auf über 200.000 angestiegen.<br />
Religionen<br />
Hei<strong>de</strong>ntum und Christianisierung<br />
Waren die Wen<strong>de</strong>n noch „Hei<strong>de</strong>n“, die sich gegen die gewaltsame Christianisierung wehrten, wur<strong>de</strong> das Christentum unter <strong>de</strong>m politischen Einfluss von Heinrich <strong>de</strong>m Löwen spätestens<br />
mit Pribislaw in Mecklenburg und somit auch <strong>de</strong>r Region um Rostock eingeführt.<br />
Das Verhältnis von Stadt und Kirche war nicht frei von Spannungen und Differenzen. So führte ein Kirchenbann <strong>de</strong>s Papstes gegenüber <strong>de</strong>r Universität <strong>zu</strong>m kurzzeitigen Aus<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r<br />
Universität aus <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Reformation
Nach<strong>de</strong>m 1525 vom Kaplan <strong>de</strong>r Petrikirche, Joachim Slüter, ein nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsches Gesangbuch mit lutherischen Lie<strong>de</strong>rn für „werkleute“ herausgegeben wur<strong>de</strong>, begann in Rostock die<br />
lutherische Reformation, die Slüter bis 1531 durchsetzte. Nach<strong>de</strong>m er 1532 starb, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Prozess von seinem Nachfolger, Johann Ol<strong>de</strong>ndorp, fortgesetzt. Zeitgleich setzte sich die<br />
Reformation auch in <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Hansestädten durch, die <strong>zu</strong>m bürgerlichen Zentrum dieser Konfession wur<strong>de</strong>n. Spätestens 1534 wur<strong>de</strong> darauf <strong>de</strong>r Katholizismus stark unterdrückt und<br />
die Katholiken als „Papisten“ beschimpft. Rostock bekam einen eigenen Superinten<strong>de</strong>nten und ein eigenes Geistliches Ministerium.<br />
In <strong>de</strong>r Folgezeit blieb <strong>de</strong>r evangelische Glaube die vorherrschen<strong>de</strong> Religion in <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt zogen dann wie<strong>de</strong>r Katholiken in die Stadt. Sie grün<strong>de</strong>ten 1872 die erste Pfarrgemein<strong>de</strong> seit <strong>de</strong>r Reformation. Seit 1909 gab es erstmals auch wie<strong>de</strong>r eine katholische<br />
Kirche in Rostock, die Christuskirche am Schrö<strong>de</strong>rplatz. Die Gemein<strong>de</strong> gehörte – wie ganz Mecklenburg – <strong>zu</strong>nächst <strong>zu</strong>m Apostolischen Vikariat <strong>de</strong>r Nordischen Missionen, <strong>de</strong>ssen<br />
Jurisdiktion dauernd mit <strong>de</strong>m Bischofsstuhle <strong>zu</strong> Osnabrück verbun<strong>de</strong>n war. 1930 wur<strong>de</strong> das Gebiet offiziell Teil <strong>de</strong>s Bistums Osnabrück (Dekanat Mecklenburg). 1941 wur<strong>de</strong> das<br />
Dekanat Mecklenburg in einen westlichen, einen mittleren und einen östlichen Konferenzbezirk aufgeteilt. Durch die Grenzziehung nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong> es immer<br />
schwieriger für <strong>de</strong>n Osnabrücker Bischof, seine Amtsgeschäfte in Mecklenburg wahr<strong>zu</strong>nehmen. So entstand 1946 das Bischöfliche Kommissariat Schwerin, aus <strong>de</strong>m 1973 das<br />
Bischöfliche Amt Schwerin mit einem Weihbischof als „residieren<strong>de</strong>n Bischof“ hervorging. Im Jahre 1971 wur<strong>de</strong> die Christuskirche trotz Protest gesprengt. Ein Neubau im Häktweg<br />
wur<strong>de</strong> als Ersatz errichtet.<br />
Religion heute<br />
Heute gehören die evangelisch-lutherischen Kirchengemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Propsteien Rostock-Nord, Rostock-Ost und Rostock-Süd innerhalb <strong>de</strong>s Kirchenkreises Rostock <strong>de</strong>r<br />
Evangelisch-Lutherischen Lan<strong>de</strong>skirche Mecklenburgs.<br />
Seit 1995 gehören die Rostocker Katholiken <strong>zu</strong>m neugegrün<strong>de</strong>ten Erzbistum Hamburg. Die Pfarrgemein<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt Rostock sind Teil <strong>de</strong>s Dekanats Rostock <strong>de</strong>s Erzbischöflichen<br />
Amtes Schwerin innerhalb <strong>de</strong>s Erzbistums.<br />
Es gibt in Rostock Freikirchen, darunter zwei Evangelisch-Freikirchliche Gemein<strong>de</strong>n (Baptisten und Brü<strong>de</strong>rgemein<strong>de</strong>), die Evangelisch-methodistische Kirche St. Michaelis, eine<br />
Gemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Gemeinschaft <strong>de</strong>r Siebenten-Tags-Adventisten, das „Christliche Zentrum“ (Bund Freikirchlicher Pfingstgemein<strong>de</strong>n) und das charismatische „Gospelzentrum“. Ferner gibt<br />
es die Lan<strong>de</strong>skirchliche Gemeinschaft und die Christengemeinschaft. Die Neuapostolische Kirche ist mit zwei Gemein<strong>de</strong>n vertreten. Die Gemein<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r größeren Mitglie<strong>de</strong>rzahl<br />
befin<strong>de</strong>t sich seit 1965 in <strong>de</strong>r Kröpeliner-Tor-Vorstadt. Die an<strong>de</strong>re Gemein<strong>de</strong> befin<strong>de</strong>t sich in Warnemün<strong>de</strong> im Wiesenweg. Die Russisch-Orthodoxe Kirche ist mit <strong>de</strong>r Kirchengemein<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>r Seligen Xenia von St. Petersburg vertreten. Die Gemein<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Berliner Diözese befin<strong>de</strong>t sich seit 2000 in <strong>de</strong>r Thünenstraße.<br />
Heute gibt es wie<strong>de</strong>r eine Jüdische Gemein<strong>de</strong> in Rostock. Diese hat über 700 Mitglie<strong>de</strong>r[15] und ist seit kurzem auch in Besitz eines neuen Gemein<strong>de</strong>zentrums mit Synagoge. Betreut<br />
wird die Gemein<strong>de</strong> durch <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>srabbiner William Wolff.<br />
In Rostock leben einige hun<strong>de</strong>rt Muslime. Es gibt eine Moschee in <strong>de</strong>r Erich-Schlesinger-Straße, <strong>de</strong>ren Trägerverein <strong>de</strong>r Islamische Bund in Rostock e. V. ist.<br />
Vor allem durch die antikirchliche Haltung <strong>de</strong>r DDR-Regierung in <strong>de</strong>n Jahrzehnten zwischen zweitem Weltkrieg und <strong>de</strong>utscher Wie<strong>de</strong>rvereinigung ist heute die Mehrheit <strong>de</strong>r Rostocker<br />
konfessionslos.<br />
Städtepartnerschaften<br />
Rostock unterhält innerhalb <strong>de</strong>r Europäischen Union Städtepartnerschaften mit Stettin in Polen seit 1957, Turku in Finnland seit 1959, Warna in Bulgarien seit 1966, Dünkirchen in<br />
Frankreich seit 1960, Riga in Lettland seit 1961, Bremen in Deutschland seit 1987, Antwerpen in Belgien seit 1963, Århus in Dänemark seit 1964 und Göteborg in Schwe<strong>de</strong>n seit 1965.<br />
Außerhalb <strong>de</strong>r Europäischen Union gibt es Städtepartnerschaften mit Bergen in Norwegen seit 1965, Raleigh in <strong>de</strong>n USA seit 2001, Rijeka in Kroatien seit 1966 und Dalian in <strong>de</strong>r<br />
Volksrepublik China seit 1988.<br />
Rostock ist Teil <strong>de</strong>r internationalen Städtegemeinschaft Neue Hanse und Mitglied im Konvent <strong>de</strong>r Bürgermeister/innen.
Wirtschaft und Infrastruktur<br />
In <strong>de</strong>r Hansestadt sowie <strong>de</strong>r nächsten Umgebung angesie<strong>de</strong>lt sind, abgesehen von vielen kleineren Unternehmen, die Universität Rostock, Werftindustrie, Ree<strong>de</strong>reien, Biotechnologie,<br />
Nahrungsmittelindustrie und IT- und Softwareunternehmen.<br />
Verkehr<br />
Hafen<br />
Der Überseehafen ist – gemessen am jährlichen Güterumschlag – nach <strong>de</strong>m in Lübeck <strong>de</strong>r zweitgrößte <strong>de</strong>utsche Ostseehafen. Beim Passagierverkehr ist dieser Hafen<br />
Verkehrsknotenpunkt für Reisen nach Gedser (Dänemark), Trelleborg (Schwe<strong>de</strong>n), Ventspils (Lettland) und nach Finnland, Estland und Russland. Nach Puttgar<strong>de</strong>n ist Rostock <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>utsche Ostseehafen mit <strong>de</strong>r zweithöchsten Zahl an Reisen<strong>de</strong>n (ca. 2 Mio. Passagiere).<br />
Nach Kriegsen<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Stadt befindliche stark zerstörte Hafen in mehrjähriger Arbeit wie<strong>de</strong>r instand gesetzt. Das Wirtschaftswachstum <strong>de</strong>r DDR und <strong>de</strong>r Aufbau einer großen<br />
staatlichen Han<strong>de</strong>lsflotte erfor<strong>de</strong>rten <strong>de</strong>n Bau eines neuen, leistungsfähigen Hochseehafens, <strong>de</strong>r außerhalb <strong>de</strong>r bebauten Stadt am Breitling 1960 in Betrieb genommen wur<strong>de</strong>. Da<strong>zu</strong><br />
wur<strong>de</strong> in Warnemün<strong>de</strong> ein neuer Zugang <strong>zu</strong>r Ostsee gebaggert. Um an die Bedürfnisse <strong>de</strong>r DDR- und Ostblock-Wirtschaft angepasst <strong>zu</strong> sein, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Überseehafen ständig aus- und<br />
umgebaut und erreichte 1989 mit über zwanzig Millionen Tonnen Umschlag – überwiegend Massenschüttgütern – sein bis dahin bestes Ergebnis.<br />
Mit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Einheit begann <strong>de</strong>r mühevolle Weg, <strong>de</strong>n ausschließlich auf DDR-Bedürfnisse ausgelegten Hafen so um<strong>zu</strong>gestalten, dass er einen akzeptablen Platz im Ensemble <strong>de</strong>r<br />
<strong>de</strong>utschen Häfen fin<strong>de</strong>n konnte. In <strong>de</strong>n vergangenen 15 Jahren hat <strong>de</strong>r Überseehafen sein Erscheinungsbild und sein Leistungsangebot <strong>de</strong>shalb stark verän<strong>de</strong>rt. Aufgrund <strong>de</strong>s mo<strong>de</strong>rnen<br />
Ölhafens, <strong>de</strong>r Anlagen für <strong>de</strong>n Getrei<strong>de</strong>-, Kohle-, Düngemittel- und Zementumschlag und <strong>de</strong>s Terminals für <strong>de</strong>n Export von Zucker, Holz, Schrott und Stückgütern ist er nach wie vor ein<br />
universaler Umschlagplatz.<br />
Rostock ist aktuell <strong>de</strong>r größte <strong>de</strong>utsche Kreuzfahrthafen, bedingt vor allem durch <strong>de</strong>n guten Anschluss an <strong>de</strong>n Raum Berlin als Touristenziel und das 2005 eröffnete mo<strong>de</strong>rne „Cruise<br />
Center“ in Warnemün<strong>de</strong>.<br />
Öffentlicher Personennahverkehr<br />
1881 begann in Rostock die Geschichte <strong>de</strong>s öffentlichen Nahverkehrs. Die erste Pfer<strong>de</strong>bahn mit Waggons auf Schienen, die von <strong>de</strong>r Mecklenburgischen Straßen-Eisenbahn Actien<br />
Gesellschaft betrieben wur<strong>de</strong>, ging in Betrieb. Bereits <strong>zu</strong> Anfang gab es drei verschie<strong>de</strong>ne Linien. Ab 1904 nahm die erste elektrische Straßenbahn unter <strong>de</strong>r Rostocker Straßenbahn AG<br />
ihren Betrieb auf. 1951 wird die RSAG <strong>zu</strong>m VEB Nahverkehr Rostock, 39 Jahre später wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>r RSAG umbenannt.<br />
Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) wird unter an<strong>de</strong>rem durch die S-Bahn Rostock <strong>de</strong>r Deutschen Bahn sowie durch Straßenbahnen und Omnibusse <strong>de</strong>r Rostocker<br />
Straßenbahn AG (RSAG) bedient. Rostock hat sechs Straßenbahnlinien, 22 Stadtbuslinien und zwei Nachtbuslinien. Daneben gibt es zwei Fährlinien über die Warnow und<br />
Regionalbuslinien in das Umland. Sie wer<strong>de</strong>n innerhalb <strong>de</strong>s Verkehrsverbun<strong>de</strong>s Warnow (VVW) angeboten, <strong>de</strong>r 1997 gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>.<br />
Seit 2006 gab es Planungen, durch eine Verknüpfung von Schienenstrecken <strong>de</strong>r Straßenbahn, Regionalbahn und S-Bahn ein Stadtbahnsystem her<strong>zu</strong>stellen. Kritiker befürchten hohe<br />
finanzielle Risiken für die Stadt und haben Zweifel an <strong>de</strong>r Wirtschaftlichkeit und Sinnhaftigkeit. Deshalb sprach sich Oberbürgermeister Roland Methling im November 2007 gegen<br />
dieses Konzept aus.[16]<br />
Eisenbahn<br />
Der größte und wichtigste Bahnhof <strong>de</strong>r Stadt ist <strong>de</strong>r Rostocker Hauptbahnhof. Weitere Bahnhöfe sind <strong>de</strong>r Bahnhof Warnemün<strong>de</strong>, sowie <strong>de</strong>r Bahnhof Seehafen Nord.<br />
Im Fernverkehr ist Rostock seit Juni 2007 per ICE (Rostock–Berlin–München) erreichbar. Intercity-Züge verbin<strong>de</strong>n Rostock mit Hamburg und West<strong>de</strong>utschland, <strong>de</strong>r einmal täglich<br />
verkehren<strong>de</strong> InterConnex mit Berlin und Leipzig. Die mehrere Jahre bestehen<strong>de</strong> Nacht<strong>zu</strong>g-Verbindung nach München bzw. Köln und Dortmund wur<strong>de</strong> im Oktober 2007 eingestellt. Im
Regionalverkehr ist Rostock mit acht Linien gut an die umliegen<strong>de</strong>n Städte angebun<strong>de</strong>n.<br />
Straßen<br />
Rostock liegt an <strong>de</strong>n Autobahnen 19 (Rostock – Autobahndreieck Wittstock (Dosse) – Berlin) und 20 (Stettin–Stralsund–Rostock–Lübeck), die sich im Autobahnkreuz Rostock kreuzen,<br />
und <strong>de</strong>n Bun<strong>de</strong>sstraßen 103, 105 und 110. Die Autobahnen und die Bun<strong>de</strong>sstraßen 103 und 105 bil<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m Warnowtunnel einen Schnellstraßenring in und um Rostock.<br />
Der Warnowtunnel wur<strong>de</strong> 2003 als Verbindung <strong>de</strong>r westlich und östlich <strong>de</strong>r Unterwarnow gelegenen Stadtteile zwischen Schmarl und Ol<strong>de</strong>ndorf eröffnet. An seinem östlichen En<strong>de</strong><br />
beginnt die A 19, das Westen<strong>de</strong> ist mit <strong>de</strong>r Schnellstraße vom Rostocker Zentrum nach Warnemün<strong>de</strong> verbun<strong>de</strong>n. Der Tunnel ist <strong>de</strong>r erste privat finanzierte und mautpflichtige<br />
Straßentunnel Deutschlands. Ging man in <strong>de</strong>n Planungen <strong>zu</strong>nächst von 22.000 Durchfahrten pro Tag aus, hat sich die Verkehrsbelegung heute bei rund 12.000 Durchfahrten eingepegelt.<br />
Damit konnten sich die Erwartungen bisher bei weitem nicht erfüllen. Als Konsequenz daraus wur<strong>de</strong> das Finanzierungsmo<strong>de</strong>ll nachträglich angepasst.<br />
Von 1998 bis 2007 wur<strong>de</strong> auch das innerstädtische Straßennetz mit <strong>de</strong>m Neu- und Ausbau <strong>de</strong>r Arnold-Bernhard-Straße und <strong>de</strong>r August-Bebel-Straße sowie <strong>de</strong>r Verbindung vom<br />
Schrö<strong>de</strong>rplatz <strong>zu</strong>m Warnowufer grundlegend neu gestaltet. Parallel da<strong>zu</strong> wur<strong>de</strong>n die früher verkehrsreichen Plätze Neuer Markt und Doberaner Platz für <strong>de</strong>n Autoverkehr gesperrt.<br />
Flugverkehr<br />
Etwa 25 km südöstlich befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Flughafen Rostock-Laage. Air Berlin bietet Linienflüge nach Mallorca und Rhodos an. Germanwings bedient die Strecke Köln/Bonn–Rostock<br />
und Stuttgart-Rostock. Zur Sommersaison fliegt außer<strong>de</strong>m die Luft<strong>hansa</strong> nach München. Die German Sky Airlines fliegen via Frankfurt a. M. nach Antalya, einen Direktflug gibt es bei<br />
Sun Express. Die Helvetic Airways fliegen Zürich an. Ein weiteres beliebtes Reiseziel ist Kreta, erreichbar mit <strong>de</strong>r Viking Hellas. Weitere Charterflieger bin<strong>de</strong>n Rostock an verschie<strong>de</strong>ne<br />
Ziele in Europa an.<br />
Ansässige Unternehmen<br />
Traditionell ist Rostock Han<strong>de</strong>ls- und Industriestadt. Der Schiffbau und die Fischverarbeitung Rostocks verloren nach <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rvereinigung an Be<strong>de</strong>utung, zahlreiche Beschäftigte<br />
verloren ihre Arbeit. Die Rostocker Werften (Neptun-Werft, Warnow-Werft) blieben erhalten und weitere Industriebetriebe wur<strong>de</strong>n angesie<strong>de</strong>lt (Liebherr, Caterpillar) an<strong>de</strong>re neu<br />
gegrün<strong>de</strong>t (Nor<strong>de</strong>x, DOT Dünnschicht-Oberflächen-Technik, EADS RST Rostock-System-Technik GmbH ).<br />
Von überregionaler Be<strong>de</strong>utung sind auch die DSR-Gruppe und die <strong>de</strong>utsch-dänische Fährree<strong>de</strong>rei Scandlines, die ihren <strong>de</strong>utschen Unternehmenssitz in Rostock hat. Zu <strong>de</strong>n ansässigen<br />
Ree<strong>de</strong>reien zählt auch die Kreuzfahrtree<strong>de</strong>rei AIDA Cruises.[17] AIDA Cruises ist mit <strong>de</strong>r AIDA-Flotte größter Arbeitgeber im Tourismusbereich in <strong>de</strong>r Hansestadt.<br />
Ein ebenfalls überregional bekanntes Unternehmen ist die Rostocker Brauerei GmbH, die die mit <strong>de</strong>r DLG-Goldmedaille-2006 ausgezeichneten Biermarke Rostocker Pilsener braut und<br />
bun<strong>de</strong>sweit vermarktet.<br />
Heute gewinnt <strong>de</strong>r Dienstleistungssektor in <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong>nehmend an Be<strong>de</strong>utung. Vor allem sind das Callcenter, die sich wegen <strong>de</strong>r dialektarmen, hoch<strong>de</strong>utschen Sprache und <strong>de</strong>s guten<br />
Angebots von Arbeitskräften ansie<strong>de</strong>ln.<br />
Der größte Arbeitgeber <strong>de</strong>r Stadt ist heute die Rostocker Universität.<br />
Medien<br />
Das erste periodisch erscheinen<strong>de</strong> Nachrichtenblatt in Rostock, <strong>de</strong>r Aus<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r Neuesten Zeitungen erschien ab 1711. 1846 wur<strong>de</strong> daraus die Rostocker Zeitung, die Zeitung <strong>de</strong>s<br />
liberalen Bürgertums <strong>de</strong>r Stadt. Lange auflagenstärkste Zeitung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s war <strong>de</strong>r 1881 gegrün<strong>de</strong>te Rostocker Anzeiger.<br />
Im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt spiegelten die Zeitungen vorwiegend die politischen Gruppen wi<strong>de</strong>r. In <strong>de</strong>r ersten Hälfte <strong>de</strong>s Jahrhun<strong>de</strong>rts fin<strong>de</strong>t sich im linken politischen Spektrum die<br />
sozial<strong>de</strong>mokratische Mecklenburgische Volkszeitung und die kommunistische Volkswacht, im rechten die völkische Mecklenburger Warte und <strong>de</strong>r nationalsozialistische Nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsche<br />
Beobachter. Zur Zeit <strong>de</strong>r DDR wur<strong>de</strong> die Medienlandschaft vom Staat bestimmt und so erschien als Organ <strong>de</strong>r SED die Volkszeitung, die ab 1946 Lan<strong>de</strong>szeitung und dann 1953 Ostsee-
Zeitung heißen sollte. Für die CDU erschien <strong>de</strong>r Demokrat, für die LDPD die Nord<strong>de</strong>utsche Zeitung, und für die NDPD die Nord<strong>de</strong>utschen Neuesten Nachrichten<br />
In Rostock erscheinen heute als Tageszeitung die Ostsee-Zeitung (OZ), die Nord<strong>de</strong>utsche Neueste Nachrichten (NNN) sowie das Boulevardblatt Bild in <strong>de</strong>r Regionalausgabe<br />
Mecklenburg-Vorpommerns. Des Weiteren erscheinen diverse Anzeigenblätter, wie <strong>de</strong>r Hanse-Anzeiger, <strong>de</strong>r Rostocker Blitz, <strong>de</strong>r Warnow-Kurier, die NNNplus und <strong>de</strong>r Rostocker<br />
Sonntag. Als Monatspublikationen erscheinen regelmäßig das 0381-Stadt & Kulturmagazin, die Szene, das Stadt- und Szenemagazin Piste, <strong>de</strong>r o.k. Ostseekalen<strong>de</strong>r und HRO Live.<br />
Die Stadt ist Sitz eines Regionalstudios <strong>de</strong>s NDR, das Beiträge für <strong>de</strong>n Hörfunk und das Fernsehprogramm produziert.<br />
In <strong>de</strong>r Hansestadt sind die Deutsche Presse-Agentur GmbH dpa und die ddp-Nachrichtenagentur ansässig.<br />
Rostock bietet <strong>de</strong>n Fernseh<strong>zu</strong>schauern zwei regionale Fernsehsen<strong>de</strong>r. Zum einen <strong>de</strong>n Privatsen<strong>de</strong>r mit Vi<strong>de</strong>otext tv.rostock und <strong>de</strong>n Bürgerfernsehsen<strong>de</strong>r rok-tv (Rostocker Offener<br />
Kanal).<br />
Im Sommer 2005 ging Radio Lohro, ein nicht kommerzielles Stadtradio für die Region Rostock, auf Sendung. Ebenfalls aus <strong>de</strong>r Hansestadt sen<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r lan<strong>de</strong>sweite Privatsen<strong>de</strong>r<br />
Ostseewelle. Der ebenfalls private Radiosen<strong>de</strong>r Antenne MV besaß über zehn Jahre in Rostock ein Regionalstudio, das im Frühjahr 2007 aus Kostengrün<strong>de</strong>n geschlossen wur<strong>de</strong>.<br />
Wichtigster Sen<strong>de</strong>rstandort ist <strong>de</strong>r Fernmel<strong>de</strong>turm Rostock.<br />
Rostocker Zeitungen im Detail<br />
Auswahl von Zeitungen, die in Rostock erschienen[18]<br />
• Zeitung Erscheinungszeitraum<br />
• Etwas von gelehrten Rostockschen Sachen 1737–1748<br />
• Rostocksche Nachrichten und Anzeigen 1752–1850<br />
• Aus<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r Neuesten Zeitungen 1762–1845<br />
• Gemeinnützige Aufsätze 1765–1799<br />
• Rostocker Zeitung 1846–1920<br />
• Rostocker Anzeiger 1881–1945<br />
• Warnemün<strong>de</strong>r Ba<strong>de</strong>anzeiger 1894–1938<br />
• Warnemün<strong>de</strong>r Zeitung 1907–1940 (lückenhaft)<br />
• Mecklenburgische Volkszeitung 1910–1933, 1990<br />
• Mecklenburger Warte 1907–1933<br />
• Volkswacht, Welttribüne, Arbeiterzeitung 1921–1925 (lückenhaft)<br />
• Rostocker Nachrichten 1930–1932<br />
• Nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utscher Beobachter 1933–1945<br />
• Völkischer Beobachter 1935–1942<br />
• Volkszeitung, Lan<strong>de</strong>szeitung, Ostsee-Zeitung ab 1945<br />
• Demokrat 1947–1991<br />
• Nord<strong>de</strong>utsche Zeitung 1947–1991<br />
• Nord<strong>de</strong>utsche Neueste Nachrichten ab 1953<br />
• Kulturspiegel ab 1953 (lückenhaft)
• Plattform 1989–1990<br />
• Bürgerrat 1989–1990<br />
•<br />
Öffentliche Einrichtungen<br />
Rostock war nie die politische Hauptstadt <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s. Trotz<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong> es häufig wegen seiner politischen und wirtschaftlichen Be<strong>de</strong>utsamkeit als diese bezeichnet. Noch heute zeigt<br />
sich das <strong>zu</strong>m Beispiel an <strong>de</strong>n Institutionen und Einrichtungen sowie Körperschaften <strong>de</strong>s öffentlichen Rechts, die ihren Sitz in Rostock haben. Da<strong>zu</strong> zählen: Landgericht Rostock,<br />
Oberlan<strong>de</strong>sgericht Rostock, Arbeitsgericht Rostock, Lan<strong>de</strong>sarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern, Sozialgericht Rostock, Bun<strong>de</strong>samt für Seeschifffahrt und Hydrographie (Rostock<br />
hat einen <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Sitze dieses Amtes; <strong>de</strong>r weitere gleichberechtigte Sitz befin<strong>de</strong>t sich in Hamburg), Max-Planck-Institut für <strong>de</strong>mografische Forschung, Leibniz-Institut für<br />
Ostseeforschung, Marineamt, Stützpunkt Hohe Düne mit Schnellbootflottille, Korvettengeschwa<strong>de</strong>r und Sportför<strong>de</strong>rgruppe <strong>de</strong>r Deutschen Marine, Bun<strong>de</strong>spolizeiamt Rostock,<br />
Ärztekammer Mecklenburg-Vorpommern, Handwerkskammer Ostmecklenburg-Vorpommern, IHK Rostock, Oberfinanzdirektion <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s, eine Filiale <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>sbank,<br />
Bun<strong>de</strong>sforschungsamt für Fischerei, Bun<strong>de</strong>svermögensamt Rostock, Wasserschutzpolizeidirektion Mecklenburg-Vorpommern, Lan<strong>de</strong>samt für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit<br />
und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern, Lan<strong>de</strong>samt für Straßenbau und Verkehr Mecklenburg-Vorpommern, Lan<strong>de</strong>sgesundheitsamt Mecklenburg-Vorpommern, Lan<strong>de</strong>sinstitut für<br />
Schule und Ausbildung Mecklenburg-Vorpommern, Lan<strong>de</strong>sprüfungsamt für Bautechnik Mecklenburg-Vorpommern, Lan<strong>de</strong>sversorgungsamt Mecklenburg-Vorpommern,<br />
Lehrerprüfungsamt Mecklenburg-Vorpommern, Staatliches Amt für Umwelt und Natur Rostock, Staatliches Schulamt Rostock, Amt für Raumordnung und Lan<strong>de</strong>splanung Mittleres<br />
Mecklenburg und schließlich <strong>de</strong>r Deutsche Wetterdienst.<br />
Bildung und Forschung<br />
Universität Rostock<br />
Die mit Abstand größte und wichtigste Bildungseinrichtung <strong>de</strong>r Stadt ist die Universität Rostock: Gegrün<strong>de</strong>t 1419 gehört sie nach <strong>de</strong>r Universität von St Andrews in Schottland (1413) <strong>zu</strong><br />
<strong>de</strong>n ältesten Universitäten Nor<strong>de</strong>uropas, und nach Prag (1348), Hei<strong>de</strong>lberg (1386), Köln (1388), Erfurt (1392) und Leipzig (1409) <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n ältesten <strong>de</strong>utschen Universitäten.[19] Die seit<br />
ihrer Gründung ununterbrochene Lehrtätigkeit macht die Rostocker Universität sogar <strong>zu</strong>r drittältesten <strong>de</strong>utschen Hochschule. Die Gründungsfakultäten sind die juristische, die<br />
philosophische und die medizinische Fakultät, Theologie gehörte noch nicht da<strong>zu</strong>. Diese wur<strong>de</strong> erst im Jahre 1432 gestiftet und vervollständigte so die Universität. Nach kurzer Zeit<br />
erhielt sie <strong>de</strong>n Beinamen „Leuchte <strong>de</strong>s Nor<strong>de</strong>ns“. Die einzelnen Fakultäten und Institutionen sind in <strong>de</strong>n letzten Jahren auf vier Standorte konzentriert wor<strong>de</strong>n. Nach<strong>de</strong>m 1950 auf<br />
Betreiben <strong>de</strong>r SED-Regierung die Juristische Fakultät geschlossen wor<strong>de</strong>n war, konnte sie im Herbst 1989 neu eröffnet wer<strong>de</strong>n. Mittlerweile besteht die Hochschule aus neun Fakultäten:<br />
Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät, Informations- und Elektrotechnische Fakultät, Juristische Fakultät, Medizinische Fakultät, Mathematisch-Naturwissenschaftliche Fakultät,<br />
Maschinenbau- Schiffstechnische Fakultät, Philosophische Fakultät, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät sowie die Theologische Fakultät. Die Universität Rostock ist mit<br />
ca. 14.700 Stu<strong>de</strong>nten (WS 2009/10) die größte Hochschule Mecklenburg-Vorpommerns.<br />
Hochschule für Musik und Theater<br />
Diese erst 1994 gegrün<strong>de</strong>te Hochschule ist eine <strong>de</strong>r jüngsten ihrer Art in ganz Deutschland. Sie fühlt sich stark mit entsprechen<strong>de</strong>n Einrichtungen in Vilnius, Riga und Tallinn verbun<strong>de</strong>n<br />
und kooperiert auch mit <strong>de</strong>n Hochschulen in Krakau, Danzig und Posen. Es gibt einige Zusammenarbeit mit <strong>de</strong>r staatlichen Universität Rostock, beispielsweise in Form von<br />
gemeinsamen Kursen für Stu<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>r Uni Rostock und <strong>de</strong>r HMT. Gemeinsam mit <strong>de</strong>r Otto-Falckenberg Schule München und <strong>de</strong>r Ernst-Busch Schule Berlin gehört sie <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n drei<br />
besten staatlichen Schauspielschulen Deutschlands und genießt einen erstklassigen Ruf. Im Jahre 2001 erhielt sie einen beachtenswerten Neubau auf <strong>de</strong>n Ruinen <strong>de</strong>s vormaligen<br />
Katharinenstifts.<br />
Hochschule Wismar
Der Fachbereich Seefahrt <strong>de</strong>r Hochschule Wismar mit seinem mo<strong>de</strong>rnen Maritimen Simulationszentrum ist in Warnemün<strong>de</strong> ansässig.<br />
Sonstige Bildungs- und Forschungseinrichtungen<br />
Weitere Bildungseinrichtungen Rostocks sind das Max-Planck-Institut für <strong>de</strong>mografische Forschung, als Institute <strong>de</strong>r Fraunhofer-Gesellschaft: das Institut für Graphische<br />
Datenverarbeitung, sowie das Institut für Produktionstechnik und Automatisierung Stuttgart, Außenstelle Rostock. Außer<strong>de</strong>m <strong>zu</strong> nennen ist <strong>de</strong>r Forschungsverbund Mecklenburg-<br />
Vorpommern e. V. (Staatlich anerkannte Einrichtung <strong>de</strong>r Weiterbildung in Rostock-Warnemün<strong>de</strong>) und das Leibniz-Institut für Katalyse, das am 1. Januar 2006 aus <strong>de</strong>m<br />
Zusammenschluss <strong>de</strong>s Instituts für Organische Katalyseforschung und <strong>de</strong>s Instituts für Angewandte Chemie Berlin-Adlershof hervorgegangen ist.<br />
In Rostock gibt es ein umfassen<strong>de</strong>s Angebot an allgemeinbil<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n und beruflichen Schulen. Hier<strong>zu</strong> zählen insgesamt 23 Grundschulen, 6 regionale Schulen, 8 Gesamtschulen, 11<br />
Gymnasien, 10 För<strong>de</strong>rschulen, 6 Berufsschulen und 7 sonstige Schulen und Nebenstellen, wo<strong>zu</strong> z. B. eine Kunstschule, eine Sternwarte und eine Zooschule zählen. Rostock hat vier<br />
umfangreich ausgestattete Bibliotheken mit hohen Nutzer- und Ausleihzahlen.<br />
Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
Musikausbildung<br />
Artikel: HMT Rostock<br />
Für die musikalische Ausbildung von Kin<strong>de</strong>rn und Jugendlichen gibt es das Konservatorium und die Freie Musikschule Carl Orff. Hier fin<strong>de</strong>t Unterricht von <strong>de</strong>r musikalischen<br />
Früherziehung bis <strong>zu</strong>m Einzel- und Ensembleunterricht <strong>de</strong>r verschie<strong>de</strong>nsten Instrumente, Gesang und Tanz statt. Daneben existieren weitere, private Musikschulen. An <strong>de</strong>r Hochschule<br />
für Musik und Theater studieren ca. 500 Stu<strong>de</strong>nten. In <strong>de</strong>r Hochschule ist <strong>de</strong>r Kammerchor Ars’ Nova <strong>zu</strong> Hause.<br />
Klassische Musik<br />
Das wichtigste Orchester <strong>de</strong>r Stadt ist die Nord<strong>de</strong>utsche Philharmonie am Volkstheater Rostock. Neben <strong>de</strong>r Mitwirkung an <strong>de</strong>n musikalischen Oper-, Operetten-, Musical- und<br />
Ballettaufführungen wer<strong>de</strong>n auch die regelmäßig stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Philharmonischen Konzerte gut besucht. Am Volkstheater ist auch die Rostocker Singaka<strong>de</strong>mie, eine aus Berufssängern<br />
und Laien bestehen<strong>de</strong> Chorvereinigung tätig.<br />
Tragen<strong>de</strong> Säulen <strong>de</strong>r Aufführungen von klassischer Musik in Rostock sind die Kantoreien <strong>de</strong>r St.-Johannis-Kirche, <strong>de</strong>r Marienkirche und <strong>de</strong>r Kirche Warnemün<strong>de</strong>. Die verschie<strong>de</strong>nen<br />
Chöre dieser Kantoreien bestreiten neben <strong>de</strong>r musikalischen Begleitung <strong>de</strong>r Gottesdienste eine rege Konzerttätigkeit mit Aufführungen von Kantaten, Motetten und Oratorien teilweise in<br />
Begleitung international namhafter Solisten und Orchester.<br />
Die Hochschule für Musik und Theater mit ihren Stu<strong>de</strong>nten bereichert die klassische Konzertszene in Rostock. Seit 1991 fin<strong>de</strong>n im ganzen Land jährlich im Sommer die Festspiele<br />
Mecklenburg-Vorpommern als ein Festival klassischer Musik statt. Zu <strong>de</strong>n Spielorten in Rostock gehört auch die alte Schiffbauhalle <strong>de</strong>r Neptun-Werft.<br />
Jazz<br />
Mit <strong>de</strong>r Pasternack Big Band ist in Rostock eine <strong>de</strong>r wenigen noch existieren<strong>de</strong>n Bigbands in Nord<strong>de</strong>utschland beheimatet. Es gibt weiterhin kleinere aktive und ambitionierte Jazz-<br />
Ensembles und Bands, wie Swing for Fun, The Marching Saints, die Breitling-Stompers, Ipanema und Fritzings Dixie Crew, die unterschiedliche Genres und Stilistiken bedienen und<br />
sich harmonisch in die Jazz-Szene Nord<strong>de</strong>utschlands einfügen. Die Reihe Jazzdiskurs stellt regelmäßig bekannte und unbekannte Formationen und Solisten aus allen Stilrichtungen <strong>de</strong>s<br />
Jazz vor, im Bogarts Jazz Club (ansässig in <strong>de</strong>r Kneipe und Kleinkunstbühne "Ursprung") gibt es Blues und Rock, Dixieland, Bebop o<strong>de</strong>r Mo<strong>de</strong>rn Jazz mit Infos über Interpreten,<br />
Komponisten, Arrangeure und das Musikgeschäft. Der Jazzclub Rostock e. V. wirkt auf eine Entwicklung <strong>de</strong>r Jazzmusik in Rostock und Umgebung hin. Da<strong>zu</strong> wird Jazz im öffentlichen<br />
Bewusstsein geför<strong>de</strong>rt und Jazzinteressierten ein Forum gegeben. Jährlich fin<strong>de</strong>t in Rostock ein fünftägiger Jazz-Workshop für traditionellen Jazz, Mainstream, mo<strong>de</strong>rnen Jazz,
zeitgenössischen Jazz und Blues statt.<br />
Literatur<br />
Das Literaturhaus Rostock, das vom gemeinnützigen Trägerverein Literaturför<strong>de</strong>rkreis Kuhtor e. V. geführt wird, bietet Literatur- und Kulturinteressierten ein weitgefächertes Programm<br />
an Veranstaltungen im kulturellen Bereich. Neben <strong>de</strong>m Literaturhaus Leipzig ist es das einzige ost<strong>de</strong>utsche Literaturhaus im Netzwerk <strong>de</strong>utschsprachiger Literaturhäuser (Deutschland,<br />
Österreich, Schweiz).<br />
Einen Einblick in die Hinterlassenschaft <strong>de</strong>s Rostocker Schriftstellers Walter Kempowski gibt das Kempowski-Archiv-Rostock. Es ist geplant eine Sammlung von Archivgegenstän<strong>de</strong>n<br />
dauerhaft aus<strong>zu</strong>stellen und somit <strong>de</strong>r Öffentlichkeit <strong>zu</strong>gänglich <strong>zu</strong> machen.<br />
Dem Autoren, Dramatiker, Maler und Filmemacher Peter Weiss und seinem Wirken in <strong>de</strong>r Hansestadt trägt das Peter-Weiss-Haus Rechnung. Nahe<strong>zu</strong> alle Weiss-Stücke erlebten Ihre<br />
ost<strong>de</strong>utsche Erstaufführung am Volkstheater Rostock unter Hanns Anselm Perten. Weiss formulierte selbst, das Rostocker Theater wäre für ihn das, was für Brecht das Berliner Ensemble<br />
gewesen sei. Mit Sitz im unter Denkmalschutz stehen<strong>de</strong>n ehemaligen Haus <strong>de</strong>r Deutsch-Sowjetischen Freundschaft beherbergt das Haus u. a. das Literaturhaus Rostock und eine<br />
Forschungs-Mediathek über Werk und Wirkung <strong>de</strong>s Universalkünstlers in <strong>de</strong>n Genres Film, Ton und Literatur. Das Haus richtet jährlich die Peter-Weiss-Woche aus und arbeitet unter<br />
an<strong>de</strong>rem mit <strong>de</strong>r Internationalen Peter Weiss-Gesellschaft <strong>zu</strong>sammen.<br />
Am 26. Februar 2010 wur<strong>de</strong> in Rostock auf Initiative zahlreicher Wissenschaftler <strong>de</strong>r Johnson-Forschung mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Universität und <strong>de</strong>r Stadt Rostock die Uwe-Johnson-<br />
Gesellschaft gegrün<strong>de</strong>t.<br />
Theater<br />
Die Theaterkultur <strong>de</strong>r Stadt reicht weit in die Vergangenheit. Der nachweislich älteste gedruckte Theaterzettel Deutschlands von 1520 stammt aus Rostock. Bei diesem han<strong>de</strong>lt es sich um<br />
eine Ankündigung für das Fest <strong>zu</strong> Ehren <strong>de</strong>r Me<strong>de</strong>lidinge Marie, welches in Rostock immer an <strong>de</strong>m Sonntag nach <strong>de</strong>m 15. Juli (im Jahre 1520 war es <strong>de</strong>mnach <strong>de</strong>r 22. Juli) gefeiert<br />
wur<strong>de</strong>.<br />
Dabei waren es bis in das 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt hinein vornehmlich wan<strong>de</strong>rn<strong>de</strong> Schauspielergruppen, die sich <strong>de</strong>r Rostocker Bürger annahmen. Die Spielorte wechselten vom mittelalterlichen<br />
Marktplatz über das Ballhaus im 17. <strong>zu</strong>m Comödienhaus im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt, ehe 1786 das alte Stadttheater entstand, welches durch einen Brand 1880 zerstört wur<strong>de</strong>. Es konnte jedoch<br />
schon 1895 ein größeres, schöneres Theater südöstlich <strong>de</strong>s Steintors eingeweiht wer<strong>de</strong>n. H. Seeling hatte es als monumentalen neobarocken Putzbau mit mehreren Rängen im<br />
Zuschauerraum errichtet. Noch 1938 wur<strong>de</strong> es umgestaltet. Dann war diesem Gebäu<strong>de</strong> kein langes Leben mehr beschie<strong>de</strong>n, es wur<strong>de</strong> im April 1942 bei <strong>de</strong>n britischen Luftangriffen auf<br />
Rostock zerstört. An seiner Stelle wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Neubaukomplex "Ostsee-Druck" errichtet. Schon lange wird über einen Theater-Neubau diskutiert. In <strong>de</strong>n 1970er Jahren sollte einer am<br />
Schrö<strong>de</strong>rplatz entstehen, über <strong>de</strong>n Wallgraben reichen und die Teufelskuhle dabei als Freilichtbühne einbeziehen. Ein Großes Haus sollte dann 1000, ein Kleines 400 Plätze haben, über<br />
<strong>de</strong>ren Auslastbarkeit damals bereits spekuliert wur<strong>de</strong>. Die Pläne wur<strong>de</strong>n gestrichen, da solch ein Bau nicht finanzierbar war. Also erhielt das vorhan<strong>de</strong>ne Provisorium einen einfachen<br />
Anbau für ein Theatercafé (bald Ballettsaal) und die Eingangshalle; Zuschauerraum und Foyer konnten dadurch ebenfalls erweitert wer<strong>de</strong>n. Bereits 1954 wur<strong>de</strong> in einem ehemaligen<br />
Hotel in <strong>de</strong>r Eselföterstraße das Kleine Haus mit 193 Plätzen geschaffen, 1960 das Intime Theater am Glatten Aal (67 Plätze), 1965 das Theater für Prozesse im ehemaligen Haus <strong>de</strong>r<br />
Armee, 1968 in Warnemün<strong>de</strong> die Kleine Komödie (94 Plätze). Später wur<strong>de</strong> dann in <strong>de</strong>r Kunsthalle das Studio 74 eingerichtet und in einer Baracke das Theater am Kehrwie<strong>de</strong>r (bald<br />
Probehaus <strong>de</strong>r Philharmonie). In <strong>de</strong>r zweiten Etage <strong>de</strong>s Großen Hauses entstand das Ateliertheater. Aber auch Freilufttheater entstan<strong>de</strong>n: Im Garten <strong>de</strong>s Klosters <strong>zu</strong>m Heiligen Kreuz und<br />
die Sommerbühne am Meer im Kurhausgarten Warnemün<strong>de</strong>.[20]<br />
Die Rostocker Theatergeschichte hat von Persönlichkeiten wie Conrad Ekhof, Schönemann, Hagen und Hanns Anselm Perten gelebt, die Rostock <strong>zu</strong> seinem kulturellen Höhepunkt im<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rt führten und <strong>zu</strong>m „Bayreuth <strong>de</strong>s Nor<strong>de</strong>ns“ machten, da beson<strong>de</strong>rs die Aufführung von Wagner-Opern gepflegt wur<strong>de</strong>. Trotz wachsen<strong>de</strong>m finanziellen und politischen<br />
Druck ist das Theater noch mit einem kompletten Tanztheater-, Musiktheater- und Schauspielensemble ausgestattet. Spielstätten sind heute das Große Haus (Doberaner Straße 134/135),<br />
das Theater im Stadthafen (Warnowufer 65) und die Kleine Komödie Warnemün<strong>de</strong> (Rostocker Str. 8). Integraler Bestandteil <strong>de</strong>s Volkstheaters ist darüber hinaus die Nord<strong>de</strong>utsche<br />
Philharmonie Rostock. Das A-Orchester ist <strong>de</strong>r größte Klangkörper <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Mecklenburg-Vorpommern. Regelmäßige fin<strong>de</strong>n Konzerte nicht nur im Großen Haus, son<strong>de</strong>rn auch im
Barocksaal und <strong>de</strong>r Nikolaikirche statt.<br />
Neben <strong>de</strong>m städtischen Volkstheater bereichert auch die 1991 gegrün<strong>de</strong>te freie Compagnie <strong>de</strong> Comédie in <strong>de</strong>r Bühne 602 (Warnowufer 55) die Rostocker Theaterlandschaft mit Musical,<br />
Schauspiel, Komödie, Konzerten und Märchen. In je<strong>de</strong>r Spielzeit wer<strong>de</strong>n durch das kleine Team, das durch die Hansestadt Rostock, das Ministerium für Bildung, Wissenschaft und<br />
Kultur MV, das Arbeitsamt Rostock und das Sozialministerium MV geför<strong>de</strong>rt wird, bis <strong>zu</strong> sieben Neuproduktionen aufgeführt.<br />
Seit fast 90 Jahren gibt es die Nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsche Bühne Rostock, die in <strong>de</strong>r Bühne 602 und im Theater im Stadthafen mit regelmäßig zwei Premieren pro Spielzeit auftritt.<br />
Das jüdische Theater Mechaje ist seit 1997/1998 Bestandteil <strong>de</strong>r Rostocker Theaterlebens.<br />
Museen<br />
Die Museumslandschaft Rostocks ist nicht sehr reich, dafür gibt es aber einige interessante Höhepunkte. So die Kunsthalle Rostock, in <strong>de</strong>r im vorigen Jahr eine Ausstellung mit Werken<br />
von Christo und Jeanne-Clau<strong>de</strong> <strong>zu</strong> sehen war, die Kulturhistorischen Museen im Kloster <strong>zu</strong>m Heiligen Kreuz und <strong>de</strong>m Kröpeliner Tor mit einer Dauerausstellung <strong>zu</strong>r Rostocker<br />
Stadtbefestigung und Societät Rostock maritim e. V. (ehemals Schiffbaumuseum). Ein darüber hinaus wichtiges Museum ist die Dokumentations- und Ge<strong>de</strong>nkstätte <strong>de</strong>r<br />
Bun<strong>de</strong>sbeauftragten für die Unterlagen <strong>de</strong>s Staatssicherheitsdienstes <strong>de</strong>r ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Auch sehr interessant sind das Heimatmuseum Warnemün<strong>de</strong>,<br />
das Schiffbau- und Schifffahrtsmuseum auf <strong>de</strong>m Traditionsschiff in Rostock-Schmarl, auf <strong>de</strong>m neben <strong>de</strong>r Schiffbaugeschichte auch maritime Spezialthemen <strong>zu</strong> besichtigen sind und das<br />
<strong>de</strong>pot12, die verkehrsgeschichtliche Ausstellung <strong>de</strong>r RSAG und <strong>de</strong>r Rostocker Nahverkehrsfreun<strong>de</strong>.<br />
Der Eintritt für einige Rostocker Museen ist frei. Diese nehmen freiwillige Eintrittsspen<strong>de</strong>n entgegen.[21]<br />
Bauwerke<br />
Rostocks Altstadt wird von gotischen Backsteingebäu<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Hanse geprägt. Da<strong>zu</strong> zählt die alte Rostocker Stadtbefestigung, von <strong>de</strong>r heute noch Teile erhalten sind, vor<br />
allem im Sü<strong>de</strong>n mit Wieckhäusern und einem Stück <strong>de</strong>s Walls, <strong>de</strong>r durch Wallenstein <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Kriegs errichtet wur<strong>de</strong>. Weiter östlich in <strong>de</strong>r Mauer zwischen Steintor,<br />
<strong>de</strong>m einstigen Haupttor und <strong>de</strong>m Kuhtor, <strong>de</strong>m ältesten Gebäu<strong>de</strong> Rostocks überhaupt, steht <strong>de</strong>r Lagebuschturm als letzter von vier Wehrtürmen. Im Osten <strong>de</strong>r Altstadt befin<strong>de</strong>t sich ein<br />
langes Stück Mauer in <strong>de</strong>r Nähe <strong>de</strong>r Petrikirche, im Nordwesten steht darüber hinaus noch ein Teil <strong>de</strong>r Fischerbastion mit einigen historischen Kanonen. Viele Tore, die in die Mauer<br />
integriert waren, existieren heute nicht mehr. Die meisten abgerissenen Tore wur<strong>de</strong>n im Zuge <strong>de</strong>r Entfestigung <strong>de</strong>r Stadt im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt abgetragen, das im Zweiten Weltkrieg<br />
ausgebrannte Petritor wur<strong>de</strong> als Verkehrshin<strong>de</strong>rnis 1960 nie<strong>de</strong>rgelegt. Aber wichtige Tore, wie das Steintor, Kröpeliner Tor und Mönchentor sind noch immer <strong>zu</strong> sehen und wur<strong>de</strong>n<br />
vollständig saniert.<br />
Innerhalb <strong>de</strong>r Stadtmauern befin<strong>de</strong>n sich drei von einstmals vier monumentalen Stadtkirchen und eine Klosterkirche, mit <strong>de</strong>ren Bau im 13. Jh. begonnen wur<strong>de</strong>: Die größte ist die<br />
gotische Marienkirche im Stadtzentrum, daneben fin<strong>de</strong>t man in <strong>de</strong>r sogenannten Östlichen Altstadt die frühgotische Nikolaikirche sowie die St. Petri-Kirche am Alten Markt, <strong>de</strong>ren<br />
Umgebung die Keimzelle Rostocks darstellt. Ferner ist die Klosterkirche <strong>de</strong>s Klosters <strong>zu</strong>m Heiligen Kreuz im westlichen Stadtzentrum erwähnenswert. Außerhalb <strong>de</strong>r Stadtmauern<br />
befin<strong>de</strong>n sich die Heiligen-Geist-Kirche in <strong>de</strong>r Kröpeliner-Tor-Vorstadt und die Evangelische Kirche in Warnemün<strong>de</strong>.<br />
Be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Profanbauten sind das gotische Rostocker Rathaus aus <strong>de</strong>m 13. und 14. Jh. mit einer nachträglich angefügten, barocken Fassa<strong>de</strong> von 1727, das Hausbaumhaus (spätgotisches<br />
Kaufmannshaus), das Stan<strong>de</strong>samt und Stadtarchiv, das Ratschow-Haus (heute Stadtbibliothek), das Krahnstöverhaus in <strong>de</strong>r Großen Wasserstraße und das neugotische Stän<strong>de</strong>haus. Auch<br />
fin<strong>de</strong>t man insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>r Kröpeliner Straße zahlreiche im Kern mittelalterliche und in <strong>de</strong>r Fassa<strong>de</strong> barock o<strong>de</strong>r klassizistisch überformte Bürgerhäuser, die heute <strong>zu</strong>meist als<br />
Geschäftshäuser dienen. Ebenso erwähnenswert ist <strong>de</strong>r Leuchtturm in Warnemün<strong>de</strong>, welcher als das Wahrzeichen dieses Stadtteils gilt. Ein an<strong>de</strong>res interessantes Gebäu<strong>de</strong> ist das<br />
Universitäts-Hauptgebäu<strong>de</strong> am Universitätsplatz, aber auch zahlreiche Speicher, wie <strong>de</strong>r Wittespeicher o<strong>de</strong>r die Speicher auf <strong>de</strong>r Speicherhalbinsel im Stadthafen.<br />
Zu <strong>de</strong>n zahlreichen Bauten aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Industrialisierung zählt <strong>de</strong>r <strong>de</strong>nkmalgeschützte Wasserturm von 1903.<br />
In <strong>de</strong>n 1920er und 1930er Jahren entstan<strong>de</strong>n als be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Einzelbauwerke <strong>de</strong>s Neuen Bauens das Kurhaus Warnemün<strong>de</strong> und das Lyzeum mit Oberlyzeum, das heutige Innerstädtische<br />
Gymnasium. Die Architekten waren Walter Butzek und Gustav Wilhelm Berringer. Das Lyzeum erhielt auf Druck <strong>de</strong>r Nationalsozialisten ein „zeitgemäßes“ Steildach. Mit <strong>de</strong>r
Rekonstruktion 2008 wur<strong>de</strong> die Schule wie<strong>de</strong>r entsprechend ihrer ursprünglich geplanten Form mit einem Flachdach versehen.<br />
Von 1953 bis 1959 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m beson<strong>de</strong>ren Wohlwollen Walter Ulbrichts unter Leitung <strong>de</strong>s jungen Chefarchitekten <strong>de</strong>r Stadt Joachim Näther die Lange Straße als Magistrale neu<br />
aufgebaut, die eins <strong>de</strong>r Wahrzeichen Rostocks gewor<strong>de</strong>n ist.<br />
Zwischen 1966 und 1972 wur<strong>de</strong>n von Ulrich Müther mit verschie<strong>de</strong>nen Rostocker Architekten stadtbildprägen<strong>de</strong> Hyparschalen – Bauwerke errichtet. Das bekannteste ist <strong>de</strong>r Teepott in<br />
Warnemün<strong>de</strong>, weiterhin das Kosmos in <strong>de</strong>r Südstadt, die Mehrzweckhalle in Lütten Klein und <strong>de</strong>r Neubau <strong>de</strong>r katholischen Kirche am Borenweg. Weitere Experimentalbauten Müthers<br />
entstan<strong>de</strong>n für die Ostseemesse auf <strong>de</strong>m Messegelän<strong>de</strong> Schutow. Hier ist eine ehemalige Messehalle erhalten geblieben.<br />
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1990er Jahre entstand unter Leitung von Gerkan, Marg und Partner hinter <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong>rzeitfassa<strong>de</strong> <strong>de</strong>s ehemaligen Hotels „Rostocker Hof“ eine <strong>de</strong>r innerstädtischen<br />
Einkaufspassagen in Rostock. Das gleiche Architekturbüro zeichnete auch für das städtebauliche Konzept und die Bauten <strong>de</strong>r IGA 2003, unter an<strong>de</strong>ren mit <strong>de</strong>r Messehalle und <strong>de</strong>m<br />
Messeturm, verantwortlich. Ein weiteres international tätiges Architektenteam, das Büro <strong>de</strong>s dänischen Architekten Henning Larsen entwarf die sachlich-mo<strong>de</strong>rne Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Max-<br />
Planck-Instituts am Stadthafen, das 2001 fertiggestellt wur<strong>de</strong>, und <strong>de</strong>r Universitätsbibliothek in <strong>de</strong>r Südstadt (2004). 2005 entstand im Stadtzentrum <strong>de</strong>r postmo<strong>de</strong>rne Bau <strong>de</strong>r Deutschen<br />
Med vom <strong>de</strong>utsch-amerikanischen Architekten Helmut Jahn.<br />
Verlorene Bauwerke<br />
1566 war es ein politischer Streit mit Herzog Johann Albrecht I., <strong>de</strong>r <strong>zu</strong> einem Abriss <strong>de</strong>s Steintors und <strong>de</strong>r Stadtmauer bis <strong>zu</strong>m Kuhtor führte. Aus <strong>de</strong>n Steinen ließ er sich eine<br />
Befestigung vor <strong>de</strong>r Stadt bauen. 1575-77 allerdings wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r Einigung das Tor, jetzt im nie<strong>de</strong>rländischen Renaissancestil, sowie die Mauer aus <strong>de</strong>n Steinen <strong>de</strong>r geschleiften<br />
Festung wie<strong>de</strong>r aufgebaut. 1677 war es ein großer Brand, <strong>de</strong>r ein Drittel <strong>de</strong>r Stadt vernichtete. Aber auch Stürme trugen <strong>zu</strong> einer Vernichtung von wichtigem Baugut bei, wie 1718, als<br />
vor allem die historische gotische Ratslaube am Rathaus <strong>zu</strong>sammenbrach. Zu sehen ist sie noch auf <strong>de</strong>r Vicke-Schorler-Rolle. Ersetzt wur<strong>de</strong> sie dann später durch einen einfachen<br />
barocken Vorbau <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts, <strong>de</strong>r die alte gotische Schauwand aus <strong>de</strong>m 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt fast vollständig be<strong>de</strong>ckt.<br />
In <strong>de</strong>r öffentlichen Wahrnehmung fast vergessen ist <strong>de</strong>r Zwinger, <strong>de</strong>r als Wehrturm vor <strong>de</strong>m Steintor stand. Dieser wur<strong>de</strong> 1849 von preußischen Pionieren wegen angeblicher<br />
Baufälligkeit gesprengt.<br />
1938 wur<strong>de</strong> die Synagoge von Rostock zerstört.<br />
Rostock verlor viele wichtige historische Bauten durch die Bombardierungen im Zweiten Weltkrieg. Vernichtet o<strong>de</strong>r schwer beschädigt wur<strong>de</strong>n monumentale Sakralbauten, Teile <strong>de</strong>r<br />
Befestigungsanlagen, Tortürme, Platzbebauungen (Neuer Markt, Am Schild, Alter Markt, Hopfenmarkt) und ganze Straßenzüge mit stadtbildprägen<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>nkmalgeschützten,<br />
mittelalterlichen und barocken Giebelhäusern, das neogotische Hauptpostamt, Medizinische Institutsgebäu<strong>de</strong> im Stil <strong>de</strong>r Neorenaissance, das neobarocke Stadttheater und eine Reihe von<br />
Schulgebäu<strong>de</strong>n, darunter die klassizistische Friedrich-Franz-Schule von 1844.[22] 40 Prozent <strong>de</strong>s Wohnraumes in Rostock ging durch die Bombenangriffe verloren.<br />
Auch nach <strong>de</strong>m Krieg wur<strong>de</strong> keine Rücksicht auf die historische Bausubstanz genommen. Die Jakobikirche, 1942 schwer getroffen, wur<strong>de</strong> 1960 endgültig abgerissen. Heute erinnert<br />
eine Grünanlage an <strong>de</strong>n Ort, an <strong>de</strong>m sie gestan<strong>de</strong>n hat. In <strong>de</strong>n Bo<strong>de</strong>n gelassene Markierungen zeigen unter an<strong>de</strong>rem die Stelle <strong>de</strong>r alten Portale. Ebenfalls wur<strong>de</strong> das im Krieg lediglich<br />
teilweise zerstörte Rostocker Stadttheater am Steintor abgerissen. An <strong>de</strong>ssen Stelle kam ein funktionales Gebäu<strong>de</strong>, Sitz von Ostseedruck und Ostsee-Zeitung. Des Weiteren wur<strong>de</strong>n nach<br />
<strong>de</strong>m Krieg die neogotischen Anbauten am Kröpeliner Tor, die um 1840 errichtet wor<strong>de</strong>n waren, obgleich unbeschädigt, abgerissen.<br />
Das Petritor und die Petrikirche wur<strong>de</strong>n ebenfalls im Zweiten Weltkrieg von Bomben getroffen (am 27. April 1942). Während die Kirche erhalten blieb und ihr nach <strong>de</strong>r<br />
Wie<strong>de</strong>rvereinigung 1994 ein neuer Turmhelm aufgesetzt wur<strong>de</strong>, wur<strong>de</strong>n das Petritor und Teile <strong>de</strong>r Stadtmauer am 27. Mai 1960 vollständig abgerissen. Ein Verein bemüht sich heute<br />
darum, die Mittel für <strong>de</strong>n Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>s Tores <strong>zu</strong> beschaffen. Ebenfalls im Krieg zerstört wur<strong>de</strong> die Nikolaikirche, die aber ab 1974 und verstärkt nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> rekonstruiert<br />
wur<strong>de</strong>.<br />
Einige größere Wun<strong>de</strong>n hinterließen auch die Versuche, Rostock <strong>zu</strong> einer sozialistischen Großstadt aus<strong>zu</strong>bauen. Zum einen wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n 1950er Jahren die Lange Straße verbreitert und<br />
die noch erhaltene Bausubstanz durch Neubauten ersetzt. Der Verlängerung <strong>de</strong>r Langen Straße fiel <strong>de</strong>r Stadtmauerabschnitt zwischen Kröpeliner Tor und Fischerbastion <strong>zu</strong>m Opfer.
En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1960er Jahre entstand <strong>de</strong>r Plan, die Südstadt über eine Tangente mit <strong>de</strong>r Innenstadt und darüber hinaus über eine Brücke über die Warnow mit Gehlsdorf <strong>zu</strong> verbin<strong>de</strong>n. Dieses<br />
Konzept wur<strong>de</strong> nur teilweise realisiert, z. B. mit <strong>de</strong>m Südring bis Höhe Schrö<strong>de</strong>rplatz und <strong>de</strong>n Hochhäusern am Vögenteichplatz. Den vorbereiten<strong>de</strong>n Maßnahmen fiel 1971 auch die<br />
neugotische, katholische Christuskirche auf <strong>de</strong>m Schrö<strong>de</strong>rplatz <strong>zu</strong>m Opfer.<br />
Die Rostocker Sieben<br />
Die Zahl Sieben spielte im Rostocker Stadtbild eine große Rolle. Es gibt sieben Wahrzeichen <strong>de</strong>r Stadt, die Rostocker Kennewohrn:<br />
• nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch<br />
• Söben Toern to Sint Marien Kark,<br />
• Söben Straten bi <strong>de</strong>n groten Mark,<br />
• Söben Doern, so da gaen to Lan<strong>de</strong>,<br />
• Söben Kopmannsbrüggen bi <strong>de</strong>m Stran<strong>de</strong>,<br />
• Söben Toern, so up dat Rathus stan,<br />
• Söben Klocken, so dakliken slan,<br />
• Söben Linnenböm up <strong>de</strong>n Rosengoern:<br />
• Dat syn <strong>de</strong> Rostocker Kennewohrn.<br />
• hoch<strong>de</strong>utsch<br />
• Sieben Türme <strong>de</strong>r St. Marien Kirche,<br />
• Sieben Straßen bei <strong>de</strong>m großen Markt,<br />
• Sieben Tore, die in das Land führen,<br />
• Sieben Kaufmannsbrücken bei <strong>de</strong>m Strand,<br />
• Sieben Türme, die auf <strong>de</strong>m Rathaus stehen,<br />
• Sieben Glocken [<strong>de</strong>r 7 Kirchen], die <strong>zu</strong>gleich schlagen,<br />
• Sieben Lin<strong>de</strong>nbäume im Rosengarten:<br />
• Das sind die Rostocker Wahrzeichen.<br />
1596 ist dieses Gedicht das erste Mal in <strong>de</strong>r Chronik <strong>de</strong>s Peter Lin<strong>de</strong>berg erschienen und wur<strong>de</strong> seit <strong>de</strong>m in verschie<strong>de</strong>nen Fassungen, selbst von John Brinckman, überliefert. Obwohl<br />
heute mit Ausnahme <strong>de</strong>r sieben Türme auf <strong>de</strong>m Rathaus keines <strong>de</strong>r Kennewohrn mehr vollständig erhalten ist, muss davon ausgegangen wer<strong>de</strong>n, dass das Gedicht mit einem großen Maß<br />
dichterischer Freiheit entstan<strong>de</strong>n ist. So waren es <strong>zu</strong>m Beispiel zwölf Kaufmannsbrücken am Stran<strong>de</strong> und acht Straßen, die vom Markt führten.<br />
Der Rosengarten <strong>de</strong>s Gedichts ist ein an<strong>de</strong>rer als <strong>de</strong>r heutige Rosengarten, <strong>de</strong>r zwischen Steintor und Wallanlagen entlang <strong>de</strong>r Wallstraße <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n ist. Dieser Rosengarten wur<strong>de</strong> erst<br />
1868 eingerichtet.<br />
Veranstaltungen<br />
Viele regelmäßige Veranstaltungen fin<strong>de</strong>n in Rostock statt. Neben <strong>de</strong>m größten Weihnachtsmarkt in Nord<strong>de</strong>utschland wird auch je<strong>de</strong>s Jahr die Hanse-Sail als Höhepunkt <strong>de</strong>r<br />
Veranstaltungen ausgerichtet. Diese steht auch in <strong>de</strong>r Tradition <strong>de</strong>r Internationalen Ostseewoche, <strong>de</strong>ren Hauptveranstalter Rostock von 1958 bis 1975 war.<br />
Im Januar fin<strong>de</strong>t <strong>de</strong>r Kabarettistenwettbewerb <strong>de</strong>r Rostocker Koggenzieher statt, dann ab En<strong>de</strong> März bis in <strong>de</strong>n Juni <strong>de</strong>r Bücherfrühling an <strong>de</strong>r Warnow, <strong>de</strong>r viele Lesungen und<br />
Ausstellungen bietet, seit April 2004 außer<strong>de</strong>m die halbjährlich stattfin<strong>de</strong>n<strong>de</strong> Literaturshow Prosanova im MAU Club, im April und Oktober ist Rostocker Kulturwoche, dann im<br />
Mai/Juni <strong>zu</strong> Pfingsten <strong>de</strong>r traditionelle Rostocker Pfingstmarkt. Auch im Mai: Das Stadtteilfest <strong>de</strong>r Kröpeliner-Tor-Vorstadt Blaumachen und das Kurzfilmfestival FiSh. Im Juni ist
Ostseejazz-Festival, im Juli dann <strong>de</strong>r Rostocker Sommer mit Musik, Folklore, Literatur und am Strand die Veranstaltungsreihe Sommer <strong>de</strong>r Kulturen, darüber hinaus auch Warnemün<strong>de</strong>r<br />
Woche und <strong>de</strong>r Rostocker Christopher Street Day (die größte Schwulen- und Lesbenpara<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s). Die Hanse Sail ist im August in Rostock, im September fin<strong>de</strong>n schließlich das<br />
Boulevardfest und das Rostocker Hafenfest statt, bevor das Veranstaltungsjahr mit <strong>de</strong>m Rostocker Weihnachtsmarkt im November/Dezember und <strong>de</strong>n großen Silvesterfeuerwerken im<br />
Stadthafen und Warnemün<strong>de</strong> en<strong>de</strong>t.<br />
Im Jahr 2018 wird Rostock voraussichtlich <strong>de</strong>n Hansetag <strong>de</strong>r Neuen Hanse ausrichten. Ein Thema dafür steht noch nicht fest.<br />
Sonstige Sehenswürdigkeiten<br />
Weitere Sehenswürdigkeiten, für die ein Besuch <strong>de</strong>r Stadt lohnt, sind <strong>de</strong>r Botanische Garten <strong>de</strong>r Universität, das Messegelän<strong>de</strong> und <strong>de</strong>r Messepark <strong>de</strong>r ehemaligen IGA, die Rostocker<br />
Hei<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Gespensterwald, aber nicht <strong>zu</strong>letzt auch <strong>de</strong>r Rostocker Zoo.<br />
Im Stadtteil Warnemün<strong>de</strong> bietet sich neben <strong>de</strong>m Strand an Interessantem vor allem die lange Westmole, <strong>de</strong>r Teepott, <strong>de</strong>r Leuchtturm und die Straße Am Strom. Im Heimatmuseum in <strong>de</strong>r<br />
Alexandrinenstraße ist die Geschichte <strong>de</strong>r Fischerei und Seefahrt dargestellt.<br />
Sport<br />
Der Fußball-Club Hansa Rostock gehört – bildlich gesprochen – <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n sportlichen Leuchttürmen <strong>de</strong>r Stadt und <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Mecklenburg-Vorpommern. Immer wie<strong>de</strong>r schaffte <strong>de</strong>r F.C.<br />
Hansa Rostock in <strong>de</strong>r Vergangenheit <strong>de</strong>n Wie<strong>de</strong>raufstieg aus <strong>de</strong>r zweiten in die erste Bun<strong>de</strong>sliga, <strong>zu</strong>letzt in <strong>de</strong>r Saison 2006/07, konnte 2008 die Erstklassigkeit allerdings nicht in die<br />
nächste Saison tragen. In <strong>de</strong>r Saison 2009/10 stieg Hansa aus <strong>de</strong>r 2. Liga in die 3. Liga ab.<br />
Der Handball-Club HC Empor Rostock wur<strong>de</strong> zehn Mal DDR-Meister und 1982 Europameister für Vereinsmannschaften. Der Club zählt <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n traditionsreichsten Handballvereinen in<br />
Deutschland. Die Männer-Mannschaft um Trainer Lars Rabenhorst spielt in <strong>de</strong>r 2. Bun<strong>de</strong>sliga Nord. Bei <strong>de</strong>n Damen spielt das Team <strong>de</strong>r Rostock Dolphins in <strong>de</strong>r Saison 2008/2009 nach<br />
einjähriger Abstinenz ebenfalls wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r 2. Bun<strong>de</strong>sliga Nord. Der SV Pädagogik Rostock spielt in <strong>de</strong>r Oberliga Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Die Hockeyherren <strong>de</strong>r HSG Uni Rostock sind in <strong>de</strong>r Saison 2008/2009 Lan<strong>de</strong>smeister Mecklenburg-Vorpommerns gewor<strong>de</strong>n und kämpften am 14. März 2009 und 15. März 2009 um<br />
<strong>de</strong>n Aufstieg in die Regionalliga Ost.<br />
Die Ringer <strong>de</strong>r Kampfgemeinschaft PSV Rostock/SV Warnemün<strong>de</strong> ringen bereits mehrere Jahre in <strong>de</strong>r Nordstaffel, die Inline-Hockey-Männer <strong>de</strong>r Rostocker Nasenbären haben <strong>de</strong>n<br />
Aufstieg 2007 geschafft, genauso wie die Judo-Frauen <strong>de</strong>s PSV Rostock. Des Weiteren ist mit <strong>de</strong>m TSC Rostock 1957 <strong>de</strong>r beste Tauchsportclub Deutschlands in <strong>de</strong>r Hansestadt <strong>zu</strong><br />
Hause.<br />
Neben <strong>de</strong>n Empor-Handballern sind drei weitere Zweitliga-Teams in Rostock aktiv: die Volleyball-Männer <strong>de</strong>s SV Warnemün<strong>de</strong>, die Wasserball-Männer <strong>de</strong>r HSG Warnemün<strong>de</strong> und die<br />
Unterwasserrugbyspieler UWR 071 Rostock.<br />
Ein Zuschauermagnet sind auch die Begegnungen <strong>de</strong>r „Piranhas“ <strong>de</strong>s Rostocker Eishockey-Clubs. Die Mannschaft ist nach <strong>de</strong>r Saison 2006/2007 in die Oberliga aufgestiegen. Auf<br />
immer größeres Interesse stoßen die Partien <strong>de</strong>r Männer vom EBC Rostock im Basketball, die in <strong>de</strong>r Saison 2009/2010 erstmals die Spielklasse <strong>de</strong>r 1.Regionalliga Nord halten konnten.<br />
Neben <strong>de</strong>n Rostock Griffins im Football o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Dierkower Elche im Rugby eine weitere interessante Sportart in <strong>de</strong>r Hansestadt. Mit <strong>de</strong>r Mannschaft „Endzonis“ hat eine neue Sportart,<br />
das Ultimate Frisbee erfolgreich in Rostock Ein<strong>zu</strong>g gehalten. Der 1. LAV Rostock ist <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendste Leichtathletikverein <strong>de</strong>r Stadt und einer <strong>de</strong>r wichtigsten in Nord<strong>de</strong>utschland.<br />
Zahlreiche erfolgreiche Sportler waren o<strong>de</strong>r sind beim 1. LAV aktiv, <strong>zu</strong>m Beispiel die Marathon-Europameisterin 2006 Ulrike Maisch.<br />
Rostock ist auch ein Zentrum für Schwimmer und Wasserspringer. Bei <strong>de</strong>n Schwimmern konnten vor allem im Langstreckenbereich bereits zahlreiche Erfolge erschwommen wer<strong>de</strong>n,<br />
wie <strong>zu</strong>letzt von Britta Kamrau-Corestein, die 2007 in Melbourne erneut einen Weltmeistertitel auf <strong>de</strong>r 25-km-Distanz gewann.<br />
Neben <strong>de</strong>n klassischen Sportarten bietet sich Rostock wegen seiner exponierten Lage auch sehr für Segeln o<strong>de</strong>r Ru<strong>de</strong>rn an und gilt als das beste Segelrevier <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Ostseeküste.
Ehrungen<br />
Die Hansestadt vergibt an Persönlichkeiten, die sich um die Stadt verdient gemacht haben, seit 1990 folgen<strong>de</strong> Ehrungen[23]:<br />
• die Verleihung <strong>de</strong>s Ehrenbürgerrechtes (Liste <strong>de</strong>r Ehrenbürger von Rostock)<br />
• die Eintragung in das Ehrenbuch <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock,<br />
• <strong>de</strong>n Kulturpreis <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock,<br />
• <strong>de</strong>n Unternehmerpreis <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock,<br />
• <strong>de</strong>n Umweltpreis <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock „Joe Duty“[24] und<br />
• <strong>de</strong>n Sozialpreis <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock.<br />
Literatur<br />
• Hans Bernitt: Zur Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Rostock. Rostock 1956.<br />
• Friedrich Barnewitz: Geschichte <strong>de</strong>s Hafenorts Warnemün<strong>de</strong>. Go<strong>de</strong>wind Verlag, 2005, ISBN 978-3-938347-08-9. (Bearbeitete Neuauflage <strong>de</strong>r Originalausgabe von 1925)<br />
• Beiträge <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Rostock.<br />
• Hrsg. v. Verein für Rostocks Altertümer. Band 1–22. Rostock 1895–1941.<br />
• Neue Folge. Hrsg. v. Stadtarchiv Rostock und <strong>de</strong>m Kulturhistorischen Museum <strong>de</strong>r Stadt Rostock. Heft 1–9. Rostock 1981–1989.<br />
• Hrsg. v. Verein für Rostocker Geschichte e. V.<br />
• Timon Hoppe: Rostock. Urbane Kulturlandschaft. BoD, 2008, ISBN 978-3-8370-1994-0.<br />
• Karl Friedrich Olechnowitz: Rostock von <strong>de</strong>r Stadtrechtsbestätigung im Jahre 1218 bis <strong>zu</strong>r bürgerlich-<strong>de</strong>mokratischen Revolution von 1848/1849. Rostock 1968.<br />
• Saxo Grammaticus: Gesta Danorum. Mythen und Legen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s berühmten mittelalterlichen Geschichtsschreibers Saxo Grammaticus. Übersetzt, nacherzählt und kommentiert<br />
von Hans-Jürgen Hube. Marix, Wiesba<strong>de</strong>n 2004, ISBN 3-937715-41-X.<br />
• Saxo Grammaticus: Gesta Danorum. Lateinischer Volltext auf <strong>de</strong>r Website <strong>de</strong>r dänischen Königlichen Bibliothek<br />
• Karsten Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. Rostock 2002, ISBN 3-929544-68-7.<br />
• Horst Witt: Rostock. Leipzig 1973.<br />
• Horst Witt (Hrsg.): Die wahrhaftige ›Abcontrafactur‹ <strong>de</strong>r See- und Hansestadt Rostock <strong>de</strong>s Krämers Vicke Schorler. Rostock 1989, ISBN 3-356-00175-2.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Mecklenburg-Vorpommern Statistisches Amt - Bevölkerungsentwicklung <strong>de</strong>r Kreise und Gemein<strong>de</strong>n 2009 (PDF; 522 KB) (Hilfe da<strong>zu</strong>)<br />
2. ↑ DWD: Mittelwerte <strong>de</strong>r Perio<strong>de</strong> 1961 bis 1990<br />
3. ↑ Paul Kühnel: Die slavischen Ortsnamen in Meklenburg. In: Jahrbücher <strong>de</strong>s Vereins für Mecklenburgische Geschichte und Altertumskun<strong>de</strong>. Band 46, 1881, S. 122<br />
4. ↑ Ernst Eichler und Werner Mühlmer: Die Namen <strong>de</strong>r Städte in Mecklenburg-Vorpommern. Ingo Koch Verlag, Rostock 2002, ISBN 3-935319-23-1<br />
5. ↑ Vgl. u. a.: Paul Meyer: Die Rostocker Stadtverfassung bis <strong>zu</strong>r Ausbildung <strong>de</strong>r bürgerlichen Selbstverwaltung (um 1325). Dissertation. Schwerin i. M. 1929, S. 5 ff.<br />
6. ↑ Vgl. Ingo Ulpts: Die Bettelor<strong>de</strong>n in Mecklenburg (Saxonia Franciscana 6) Werl 1995, S. 34–43, 80–86.<br />
7. ↑ a b Olaf Groehler: Bombenkrieg gegen Deutschland. Aka<strong>de</strong>mie-Verlag, Berlin 1990. ISBN 3-05-000612-9. S. 48–59<br />
8. ↑ Vgl. Karsten Schrö<strong>de</strong>r und Ingo Koch (Hg.): Rostocker Chronik: Ein Streif<strong>zu</strong>g durch das 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt in Bil<strong>de</strong>rn und zeitgenössischen Pressestimmen. Rostock 1999, S.<br />
178.<br />
9. ↑ H.-W. Bohl:Bomben auf Rostock. Konrad-Reich-Verlag. ISBN 3-86167-071-2
10.↑ Olaf Groehler: Bombenkrieg gegen Deutschland. Aka<strong>de</strong>mie-Verlag, Berlin 1990. ISBN 3-05-000612-9. S. 59 und 449<br />
11.↑ Anne Kaminsky (Hg.): Orte <strong>de</strong>s Erinnerns. Ge<strong>de</strong>nkzeichen, Ge<strong>de</strong>nkstätten und Museen <strong>zu</strong>r Diktatur in SBZ und DDR. Bonn 2007, S. 263–266<br />
12.↑ Fotogalerien: Rostocker-Zeitung.<strong>de</strong>, FAZ.net<br />
13.↑ Vgl.: Karte <strong>de</strong>r ursprünglich für 2009 geplanten Kreisgebietsreform<br />
14.↑ Urteil <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>sverfassungsgerichtes vom 26. Juli 2007<br />
15.↑ Zentralrat <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n in Deutschland<br />
16.↑ Rostocker Stadtbahn Meldung MVregio<br />
17.↑ „Am Hauptsitz von AIDA Cruises in Rostock sind die Abteilungen Operations, Newbuildings, Marketing, Sales sowie Administration, Finance und Human Resources<br />
angesie<strong>de</strong>lt.“ Quelle: [1]. AIDA Cruises (bis 2004 Seetours) ist ein Unternehmen <strong>de</strong>r Carnival Corporation&PLC und firmiert als Tochter <strong>de</strong>r italienischen Ree<strong>de</strong>rei Costa<br />
Crociere S.p.A (Quellen: [2], [3], [4])<br />
18.↑ Webseite <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Zeitungen in Rostock<br />
19.↑ Walter Leisering (Hrsg.): Putzger Historischer Weltatlas. 101. Auflage, Berlin 1990, S. 54.<br />
20.↑ Dr. Robert Rosentreter: Zur Geschichte <strong>de</strong>r Rostocker Theaterbau-Visionen: Verhin<strong>de</strong>rter Palast am Wall. In: Hanse ANZEIGER. 31. Januar 2007, S. 2.<br />
21.↑ Städtische Museen und museale Einrichtungen: Webseite <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock<br />
22.↑ Arno Krause: Rostock (Stadtkreis Rostock). In: Götz Eckardt (Hrsg.): Schicksale <strong>de</strong>utscher Bau<strong>de</strong>nkmale im zweiten Weltkrieg. Henschel-Verlag, Berlin 1978. Band 1, S. 57–<br />
75<br />
23.↑ Die Listen <strong>de</strong>r geehrten Persönlichkeiten befin<strong>de</strong>n sich auf <strong>de</strong>r Webseite <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock<br />
24.↑ Flyer Umweltpreis »Joe Duty« <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Geschichte Rostocks<br />
Die Geschichte Rostocks ist stark von <strong>de</strong>r geografischen Lage <strong>de</strong>r Stadt an <strong>de</strong>r Unterwarnow nahe <strong>de</strong>r Mündung in die Ostsee geprägt. Um 1165 als Rozstoc erstmals erwähnt, war<br />
bereits früher dort ein slawischer Han<strong>de</strong>lsplatz in ein überregionales Seehan<strong>de</strong>lsnetz eingebun<strong>de</strong>n. Ab <strong>de</strong>m späten 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt entwickelte sich eine <strong>de</strong>utsche Siedlung, <strong>de</strong>r 1218 das<br />
lübische Stadtrecht bestätigt wur<strong>de</strong> und die rasch wuchs, so dass bald drei selbstständige Teilstädte existierten, die sich in <strong>de</strong>n Jahren 1262 bis 1265 vereinigten. Rostock wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m<br />
Zentrum <strong>de</strong>r Herrschaft Rostock und war seit Mitte <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts Mitglied <strong>de</strong>r Hanse. Während <strong>de</strong>r Blüte <strong>de</strong>r Hansestadt, die ihren Höhepunkt im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt erreichte,<br />
wur<strong>de</strong>n repräsentative Profan- und Kirchenbauten im Stil <strong>de</strong>r Backsteingotik errichtet und 1419 die Universität gegrün<strong>de</strong>t. Als mecklenburgische Lan<strong>de</strong>sstadt, <strong>de</strong>r nie <strong>de</strong>r Schritt <strong>zu</strong>r<br />
Freien Stadt gelang, ist die Geschichte Rostocks von einem ständigen Gegen- und Miteinan<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>n mecklenburgischen Herzögen geprägt. Dabei stan<strong>de</strong>n vor allem die<br />
wirtschaftlichen Interessen <strong>de</strong>r Stadt <strong>de</strong>n politischen und militärischen <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sherren gegenüber. 1531 führte <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt offiziell die Reformation ein.
Mit <strong>de</strong>m Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>r Hanse, <strong>de</strong>m Dreißigjährigen Krieg und einem Stadtbrand im Jahre 1677 sank Rostock in die Rolle einer Provinzstadt <strong>zu</strong>rück, blieb jedoch das geistige und<br />
wirtschaftliche Zentrum Mecklenburgs. Die Industrialisierung setzte in Rostock relativ spät ein. In <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus wur<strong>de</strong>n Rostock und Warnemün<strong>de</strong> ab Mitte <strong>de</strong>r<br />
1930er Jahre mit <strong>de</strong>n Heinkel- und Arado Flugzeugwerken <strong>zu</strong> Zentren <strong>de</strong>r Rüstungsindustrie und in dieser Folge auch erste Ziele <strong>de</strong>s Luftkriegs im Zweiten Weltkrieg, <strong>de</strong>r die Stadt<br />
schwer in Mitlei<strong>de</strong>nschaft zog. In <strong>de</strong>r DDR war Rostock Bezirksstadt und wur<strong>de</strong> systematisch ausgebaut. Seit <strong>de</strong>r Deutschen Wie<strong>de</strong>rvereinigung ist Rostock mit über 200.000<br />
Einwohnern größte Stadt <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>slan<strong>de</strong>s Mecklenburg-Vorpommern und als eines <strong>de</strong>r vier Oberzentren <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s mehr als doppelt so groß wie die Lan<strong>de</strong>shauptstadt Schwerin.<br />
Mittelalter<br />
Vorgeschichte<br />
Die Vorgeschichte Mecklenburgs ist bis <strong>zu</strong>r Mitte <strong>de</strong>s ersten Jahrtausends unserer Zeit durch germanische Besiedlung geprägt. Im Zuge <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung wan<strong>de</strong>rten etwa ab <strong>de</strong>m 6.<br />
und 7. Jahrhun<strong>de</strong>rt slawische Stämme in <strong>de</strong>n südlichen Ostseeraum, das Gebiet um die Unterwarnow bevölkerten die Kessiner. Rechts <strong>de</strong>r Warnow, zwischen <strong>de</strong>m heutigen Dierkow und<br />
Gehlsdorf, sind ab <strong>de</strong>m 8. Jahrhun<strong>de</strong>rt Handwerker- und Han<strong>de</strong>lsplätze archäologisch belegt. Neben zahlreichen Fun<strong>de</strong>n handwerklicher Erzeugnisse hat man Reste von Block- und<br />
Flechtwerkhäusern gefun<strong>de</strong>n, die bis <strong>zu</strong> acht Metern lang und ähnlich breit waren.[1] Aus Skandinavien sowie <strong>de</strong>m fränkischen Raum und <strong>de</strong>r Eifel stammen<strong>de</strong> Gegenstän<strong>de</strong> beweisen,<br />
dass die Dierkower Siedlung ein (See-)Han<strong>de</strong>lsort von überregionaler Be<strong>de</strong>utung gewesen sein muss.[2]<br />
Slawische Fürstenburg und Heinrich <strong>de</strong>r Löwe<br />
Spätestens im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt existierte in <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>s rechten Warnowufers eine slawische Fürstenburg <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>m Stamm <strong>de</strong>r Liutizen gehören<strong>de</strong>n Kessiner mit einer<br />
frühstädtischen Marksiedlung. Noch in Quellen <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong> dieser Handwerker- und Han<strong>de</strong>lsplatz als Wendische Wik bezeichnet.<br />
Die wohl früheste überlieferte Erwähnung Rostocks fin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r isländischen Knýtlinga-Saga, in <strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Landung Knuts <strong>de</strong>s Großen (994/995–1035) bei Raudstokk berichtet<br />
wird, womit allerdings auch die O<strong>de</strong>rmündung gemeint sein könnte. Als erster sicherer Beleg Rostocks gilt die Chronik Gesta Danorum <strong>de</strong>s Dänen Saxo Grammaticus (um 1200).[3]<br />
An<strong>de</strong>re frühe Chroniken sind die Slawenchroniken von Helmold von Bosau (um 1170) und von Arnold von Lübeck (um 1210).<br />
Saxo Grammaticus berichtet, wie 1160 <strong>de</strong>r Abodritenfürst Niklot im Abwehrkampf gegen <strong>de</strong>n Sachsenherzog Heinrich <strong>de</strong>n Löwen südlich von Rostock bei <strong>de</strong>r Burg Werle fiel. Niklots<br />
Söhne Pribislaw und Wertislaw wur<strong>de</strong>n zeitweise aus <strong>de</strong>m Abodritenland vertrieben. Im folgen<strong>de</strong>n Jahr zerstörte <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>n Sachsen verbün<strong>de</strong>te dänische König Wal<strong>de</strong>mar I. die<br />
slawische Fürstenburg Rostock (urbs roztoc).<br />
1167 unterwarf sich Pribislaw Heinrich <strong>de</strong>m Löwen und wur<strong>de</strong> daraufhin von ihm mit einem großen Teil Westmecklenburgs belehnt, jedoch ohne die Grafschaft Schwerin. So konnte er<br />
einen beträchtlichen Teil <strong>de</strong>r Herrschaft seines Vaters <strong>zu</strong>rück erlangen und errichtete um 1170 die Burgen Mecklenburg, Ilow und Rostock neu. Allmählich entwickelte sich Rostock <strong>zu</strong><br />
einem zweiten Schwerpunkt <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Mecklenburg neben <strong>de</strong>r nahegelegenen Burg Kessin. Nach einer gemeinsamen Pilgerfahrt von Heinrich und Pribislaw 1172 nach Jerusalem<br />
vermählte Heinrich eine seiner Töchter mit Pribislaws Sohn Borwin I. (1178–1227). Während Pribislaw seine Herrschaft durch ein hohes Maß an Weitsicht sicherte, entwickelte sich<br />
später zwischen seinem Sohn Borwin I. und Nikolaus I., <strong>de</strong>m Sohn Wertislaws, ein Konflikt um die Herrschaftsnachfolge, die bis <strong>zu</strong>m offenen Krieg führte. Ein Siegel aus dieser Zeit<br />
zeigt Nikolaus als Fürsten von Rostock (nicolaus <strong>de</strong> roztoc), als reiten<strong>de</strong>n Krieger mit Schwert.<br />
Deutsche Siedlung und Stadtwerdung<br />
Nach<strong>de</strong>m 1160/61 die Fürstenburg Rostock zerstört wor<strong>de</strong>n war, wur<strong>de</strong>n die Burg und ein Handwerkerwiek wahrscheinlich rechts <strong>de</strong>r Warnow wie<strong>de</strong>r aufgebaut. Noch im 12.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt hatten sich aber auch auf <strong>de</strong>m hochgelegenen linken Warnowufer Handwerker und Kaufleute nie<strong>de</strong>rgelassen, darunter Holsteiner, Sachsen, Westfalen, Dänen und Slawen.<br />
Diese Siedlung auf <strong>de</strong>m Hügel um die spätere Petrikirche und <strong>de</strong>n Alten Markt bil<strong>de</strong>te <strong>de</strong>n Ausgangspunkt <strong>de</strong>r Stadtwerdung Rostocks. Die erste urkundliche Erwähnung Rostocks<br />
stammt aus <strong>de</strong>m Jahr 1189, als Nikolaus <strong>de</strong>n Mönchen <strong>de</strong>s 1186 gegrün<strong>de</strong>ten Klosters Doberan Zollfreiheit auf <strong>de</strong>m Rostocker Markt gewährte. Die Erwähnung einer Clemens-Kirche<br />
mit <strong>de</strong>utschem Priester weist dabei auf die Christianisierung <strong>de</strong>r Siedlung hin.[5]<br />
Nach <strong>de</strong>r Bestätigung <strong>de</strong>s lübischen Stadtrechts durch Heinrich Borwin I. vom 24. Juni 1218 folgte eine Erweiterung <strong>de</strong>r Siedlung nach Sü<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>r Nikolaikirche als Mittelpunkt.
1232 wird die Marienkirche erstmals urkundlich als Pfarrkirche einer selbstständigen Siedlung erwähnt,[6] die sich westlich, jenseits eines Warnow<strong>zu</strong>flusses („Grube“), an die ältere<br />
Stadt anschloss und über einen eigenen Markt und ein Rathaus verfügte. Nach einer neuerlichen Aus<strong>de</strong>hnung in Richtung Westen über die „Faule Grube“ als weitere natürliche<br />
Begren<strong>zu</strong>ng entstand um 1252 die Neustadt als vierte eigenständige Siedlung, <strong>de</strong>ren Mittelpunkt die Jakobikirche war. In <strong>de</strong>n Jahren 1262 bis 1265 vereinigten sich schließlich die<br />
Stadtzellen. Der mittlere Siedlungskern wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Verwaltungszentrum <strong>de</strong>r Stadt, in <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Stadtrat und das Gericht ihren Sitz hatten und das Rathaus nach Lübecker Vorbild erbaut<br />
wur<strong>de</strong>.<br />
Während die „Wendische Wyk“ ihren Nie<strong>de</strong>rgang erlebte und Fürst Nikolaus das Kind seinen Besitz rechts <strong>de</strong>r Warnow 1286 an die Stadt verkaufte, die an <strong>de</strong>r aufgelassenen Burgstelle<br />
eine Ziegelei einrichtete,[7] wuchs <strong>de</strong>r städtische Bereich auf <strong>de</strong>r linken Warnowseite bis <strong>zu</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts so rasant an, dass <strong>de</strong>r beanspruchte Raum bis in das frühe 19.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt nicht mehr erweitert wer<strong>de</strong>n musste. Auch die bei<strong>de</strong>n Stadtbrän<strong>de</strong> von 1250 und 1265 konnten diesen Aufschwung nicht bremsen. Gestärkt wur<strong>de</strong> die Stellung Rostocks<br />
durch <strong>de</strong>n Erwerb von Rechten, wie das Fischereirecht auf <strong>de</strong>r Unterwarnow, und <strong>de</strong>n Kauf <strong>de</strong>r Rostocker Hei<strong>de</strong>, die als riesiger Stadtforst <strong>de</strong>n enormen Holzbedarf <strong>de</strong>ckte und Platz für<br />
die umfängliche Schweinemast Rostocks bot.<br />
Gleichzeitig entwickelte sich die Stadt <strong>zu</strong>m Zentrum <strong>de</strong>r Herrschaft Rostock. Die Straßennamen „Amberg“ an <strong>de</strong>r Petrikirche und „Burgwall“ bei <strong>de</strong>r Marienkirche scheinen darauf<br />
hin<strong>zu</strong>weisen, dass befestigte lan<strong>de</strong>sherrliche Höfe in <strong>de</strong>r Stadt angelegt wur<strong>de</strong>n. Die dänische Lehnshoheit über Mecklenburg, die Wal<strong>de</strong>mar II. 1214 Kaiser Friedrich II. abgerungen<br />
hatte, en<strong>de</strong>te 1227 nach <strong>de</strong>r Schlacht bei Bornhöved und <strong>de</strong>m Tod Heinrich Borwins II. 1229 wur<strong>de</strong> das Land durch die mecklenburgische Hauptlan<strong>de</strong>steilung unter <strong>de</strong>ssen Söhnen<br />
aufgeteilt und Heinrich Borwin III. wur<strong>de</strong> Territorialherr über die Herrschaft Rostock.<br />
Der rasche Aufstieg Rostocks <strong>zu</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Stadt Mecklenburgs ging im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt mit <strong>de</strong>m Schwin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>s- und Stadtherrschaft <strong>de</strong>r Herren von Rostock einher,<br />
während gleichzeitig im Deutschen Reich die Macht <strong>de</strong>s Königs <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Interregnums 1254–1273 auf einem Tiefpunkt angelangt war. Der Vogt verlor <strong>zu</strong>nehmend an Einfluss<br />
gegenüber <strong>de</strong>m Stadtrat, <strong>de</strong>r aus einem exklusiven Kreis ratsfähiger Geschlechter <strong>de</strong>r wohlhaben<strong>de</strong>n Kaufmannschaft gebil<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Ab 1289 sind Bürgermeister nachweisbar.<br />
Während die Burgwälle <strong>de</strong>r lan<strong>de</strong>sherrlichen Burgen in und um Rostock abgetragen wur<strong>de</strong>n, errichtete Rostock eine sieben Meter hohe und bis <strong>zu</strong> einem Meter breite steinerne<br />
Stadtmauer, die eine Fläche von ungefähr 1 km² umschloss. In drei Metern Höhe konnten, falls erfor<strong>de</strong>rlich, hölzerne Wehrgänge angelegt wer<strong>de</strong>n. Zur Stadtbefestigung gehörten 22<br />
Stadttore, von <strong>de</strong>nen heute noch das Steintor, das Kröpeliner Tor, das Mönchentor und das Kuhtor existieren. Wie sehr Rostock auf <strong>de</strong>n Seehan<strong>de</strong>l ausgerichtet war, ist daran <strong>zu</strong><br />
erkennen, dass mehr als die Hälfte <strong>de</strong>r Stadttore auf die Hafenanlagen an <strong>de</strong>r Unterwarnow führte.<br />
Hansestadt<br />
Mit <strong>de</strong>m Erwerb <strong>de</strong>s Seehafens bei Warnemün<strong>de</strong> (Hohe Düne) 1264 und <strong>de</strong>r Hundsburg bei Schmarl 1278 erlangte Rostock <strong>de</strong>n angestrebten freien Zugang <strong>zu</strong>r zwölf Kilometer<br />
entfernten Ostsee. Bereits 1251 hatte Rostock vom dänischen König Abel die gleichen Han<strong>de</strong>lsprivilegien wie <strong>zu</strong>vor schon Lübeck erhalten, und noch bevor sich die drei Siedlungen <strong>zu</strong><br />
einer Stadt vereinigt hatten, schloss Rostock 1259 ein Bündnis mit <strong>de</strong>n Ratsherren <strong>de</strong>r Städte Lübeck und Wismar. Der Rostocker Landfrie<strong>de</strong>n 1283 zwischen Lübeck, Wismar, Rostock,<br />
Stralsund, Greifswald, Stettin, Demmin und Anklam gegen einige Fürsten, wie <strong>de</strong>n Markgrafen von Bran<strong>de</strong>nburg, markiert <strong>de</strong>n Beginn <strong>de</strong>s Wendischen Quartiers innerhalb <strong>de</strong>r Hanse.<br />
1323 hatten die Bemühungen, das Städtchen (oppidum) Warnemün<strong>de</strong> ganz <strong>zu</strong> erwerben, endlich Erfolg. 1325 erhielt die Stadt das Münzrecht von Heinrich II. und wur<strong>de</strong> zeitweilig<br />
Mitglied <strong>de</strong>s Wendischen Münzvereins. Darüber hinaus erlangte Rostock 1358 die volle Gerichtsbarkeit. Damit stand Rostock an <strong>de</strong>r Schwelle <strong>zu</strong>r freien Stadt, <strong>de</strong>r letzte Schritt da<strong>zu</strong><br />
sollte jedoch nie gelingen. Die Hansestadt war auf <strong>de</strong>m Gipfel ihrer Autonomie und ihrer sowohl wirtschaftlichen als auch kulturellen Blüte angelangt, <strong>zu</strong>mal die innerstädtischen<br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen <strong>de</strong>n Erhebungen von 1314 und 1408 ruhten und die Herzöge von Mecklenburg dieser Zeit För<strong>de</strong>rer <strong>de</strong>r Stadt waren. Mit etwa 14 000 Einwohnern um<br />
1410 wur<strong>de</strong> Rostock in Nord<strong>de</strong>utschland nur von Lübeck, Hamburg und Bremen übertroffen.[8]<br />
Von erheblicher Be<strong>de</strong>utung für <strong>de</strong>n hanseatischen Han<strong>de</strong>l Rostocks waren die Rigafahrer und <strong>de</strong>r Heringshan<strong>de</strong>l <strong>de</strong>r Schonenfahrer auf <strong>de</strong>r Schonischen Messe auf <strong>de</strong>r Halbinsel Skanör-<br />
Falsterbo in Schonen, wo Rostock eine eigene Vitte unterhielt. Hinsichtlich <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>ls mit Norwegen konzentrierten sich die Rostocker Wieckfahrer im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Lübecker<br />
Bergenfahrern weniger auf das Kontor Bryggen in Bergen, als vielmehr auf die Kontrolle <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlassungen (Faktoreien) in Oslo und Tønsberg. Große Be<strong>de</strong>utung hatte daneben<br />
anfangs die Gotlandfahrt nach Visby, weniger ausgeprägt waren dagegen die Verbindungen <strong>zu</strong>m Hansekontor in Brügge und <strong>de</strong>m Londoner Stalhof im Westen sowie <strong>de</strong>m Peterhof in<br />
Nowgorod im Osten. Das einzige eigene Produkt, das Rostock in beträchtlichem Umfang ausführte, war Bier.
An allen be<strong>de</strong>utsamen Unternehmungen <strong>de</strong>r Hanse, wie <strong>de</strong>m ersten und zweiten Krieg mit Dänemark, war Rostock maßgeblich beteiligt. Mitunter han<strong>de</strong>lte die Stadt aber auch gegen die<br />
Politik <strong>de</strong>r Hanse, etwa als sie nach 1376 aus Gefolgschaftspflicht gegen das mecklenburgische Herzogshaus gemeinsam mit Wismar die Vitalienbrü<strong>de</strong>r im Kaperkrieg gegen Dänemark<br />
unterstütze. 1390 öffneten die bei<strong>de</strong>n mecklenburgischen Hansestädte sogar die eigenen Häfen für „alle, die das Reich Dänemark schädigen wollen“.[9] 1393 schreckten die „Rostocker<br />
und Wismarer Vitalienbrü<strong>de</strong>r“, offensichtlich unter <strong>de</strong>r Führung mecklenburgischer Adliger, nicht einmal davor <strong>zu</strong>rück, die norwegische Stadt Bergen <strong>zu</strong> überfallen, scheinen dabei aber<br />
das Hansekontor verschont <strong>zu</strong> haben.[10]<br />
Unter <strong>de</strong>n wendischen Städten, <strong>de</strong>m Kern <strong>de</strong>r Hanse, nahm Rostock neben Stralsund die Rolle <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Stadt hinter Lübeck ein. Häufig fan<strong>de</strong>n Hansetage an <strong>de</strong>r Warnow statt,<br />
und Rostocker Ratsherren übernahmen oft wichtige diplomatische Missionen für die Hanse. Beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r langjährige Bürgermeister Arnold Kröpelin († um 1394) tat sich hier hervor.<br />
Wenngleich Rostock <strong>de</strong>s Öfteren zwischen <strong>de</strong>n Interessen <strong>de</strong>r Hanse und Rücksichtnahme auf <strong>de</strong>n mecklenburgischen Fürsten lavieren musste, nahm die Stadt bis <strong>zu</strong>m letzten Hansetag<br />
1669 eine führen<strong>de</strong> Rolle in <strong>de</strong>m Städtebündnis ein.<br />
Krisen, Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen und Unruhen<br />
Seit En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts führte die soziale Ausdifferenzierung <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> Krisen und Machtkämpfen zwischen <strong>de</strong>n Patrizierfamilien und <strong>de</strong>r übrigen Stadtbevölkerung. Im 15.<br />
und 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt kam es wie<strong>de</strong>rholt <strong>zu</strong> Unruhen und Aufstän<strong>de</strong>n gegen <strong>de</strong>n Stadtrat. Wie<strong>de</strong>rkehren<strong>de</strong> For<strong>de</strong>rungen waren die Zusammenfassung <strong>de</strong>r For<strong>de</strong>rungen und Rechte <strong>de</strong>r<br />
Bürgerschaft in „Bürgerbriefen“ und Einfluss <strong>de</strong>r Handwerker auf die Zusammenset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Rates. Die erste gedruckte Rostocker Stadtchronik von Peter Lin<strong>de</strong>nberg berichtete En<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts von sechs großen „Tumulten“. Die Schwäche <strong>de</strong>r Herren von Rostock weckte <strong>zu</strong><strong>de</strong>m das Interesse <strong>de</strong>r benachbarten Fürsten an <strong>de</strong>r blühen<strong>de</strong>n Stadt.<br />
Zu ersten innerstädtischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen, in <strong>de</strong>ren Folge die üblicherweise lebenslang amtieren<strong>de</strong>n Ratsherren abgesetzt und durch neue aus <strong>de</strong>m gleichen Kreis ratsfähiger<br />
Familien ersetzt wur<strong>de</strong>n, kam es 1286/87. Schwerer waren die Aufstän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bürgerschaft gegen <strong>de</strong>n Rat zwischen 1298 und 1314. Durch Kriegshandlungen <strong>de</strong>s letzten Herrn von<br />
Rostock, Nikolaus, genannt „das Kind“, gegen <strong>de</strong>n Markgrafen von Bran<strong>de</strong>nburg und an<strong>de</strong>re Fürsten wur<strong>de</strong> auch die Stadt in Mitlei<strong>de</strong>nschaft gezogen, in <strong>de</strong>r die aufgebrachte<br />
Bürgerschaft einige Ratsherren vertrieb. Nikolaus sah sich nunmehr gezwungen, sein Land unter <strong>de</strong>n Schutz und die Lehensherrschaft <strong>de</strong>s Königs Erich von Dänemark <strong>zu</strong> stellen. Die<br />
Stadt verweigerte sich jedoch <strong>de</strong>m König, <strong>de</strong>r die Machtprobe durch Sperrung <strong>de</strong>r Ostsee<strong>zu</strong>fahrt für sich <strong>zu</strong> entschei<strong>de</strong>n versuchte. Die Rostocker erstürmten eine Doppelturmanlage in<br />
Warnemün<strong>de</strong>, verbrannten diese und errichteten – unter an<strong>de</strong>rem mit Steinen <strong>de</strong>s dafür abgerissenen Turms <strong>de</strong>r Petrikirche – selbst einen gewaltigen Turm, <strong>de</strong>r 1312 nach langer<br />
Belagerung wie<strong>de</strong>rum fiel. Als <strong>de</strong>r Stadtrat <strong>zu</strong> kapitulieren bereit war, brach ein von <strong>de</strong>n Handwerkern ausgelöster Aufstand los. Einige Ratsherren wur<strong>de</strong>n getötet, an<strong>de</strong>re verbannt. In<br />
dieser Situation gelang Heinrich II., <strong>de</strong>m „Löwen von Mecklenburg“ 1314 die Einnahme Rostocks. Noch im gleichen Jahr starb Nikolaus das Kind, und die Herrschaft Rostock fiel als<br />
dänisches Lehen an Heinrich. Nach <strong>de</strong>m Tod sowohl König Erichs als auch <strong>de</strong>s Markgrafen Wal<strong>de</strong>mar von Bran<strong>de</strong>nburgs vereinigten er und sein Sohn Albrecht II. das Land<br />
Mecklenburg allmählich wie<strong>de</strong>r und för<strong>de</strong>rten Rostock als ihre wichtigste Stadt.<br />
Nach weiteren Aufstän<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Jahren 1408/16 und 1427/39 kam es 1487 bis 1491 <strong>zu</strong>r „Rostocker Domfeh<strong>de</strong>“. Anlass war die Einrichtung eines gemeinhin als „Dom“ bezeichneten<br />
Kollegiatstiftes an <strong>de</strong>r Jakobikirche, mit <strong>de</strong>r Herzog Magnus II. die Finanzierung <strong>de</strong>r Universität und seine Machtposition innerhalb <strong>de</strong>r Stadt sichern wollte. Am Tag <strong>de</strong>r Weihe <strong>de</strong>s<br />
Stifts, <strong>de</strong>m 12. Januar 1487, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r eben eingesetzte Stiftspropst Thomas Ro<strong>de</strong> auf offener Straße brutal umgebracht, die anwesen<strong>de</strong>n Fürsten mussten aus <strong>de</strong>r Stadt fliehen. Erst 1491<br />
en<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r von Handwerkern getragene Aufstand mit <strong>de</strong>r Hinrichtung <strong>de</strong>s Anführers Hans Runge und drei weiterer Aufständischer.<br />
Universität und Wissenschaft<br />
Sichtbares Zeichen <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung Rostocks war 1419 die Gründung <strong>de</strong>r Universität – <strong>de</strong>r ältesten Universität Nor<strong>de</strong>uropas. Damit hatte Rostock im gesamten Hanseraum für zwei<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rte eine führen<strong>de</strong> Rolle in <strong>de</strong>r Wissenschaft erlangt. Sowohl die Lan<strong>de</strong>sherren Johann IV. bzw. Heinrich IV., die gemeinsam mit <strong>de</strong>m Bischof von Schwerin Papst Martin V. um<br />
die Genehmigung einer Universitätsgründung ersuchten, als auch <strong>de</strong>r Stadtrat, <strong>de</strong>r die finanzielle Grundlage bereitstellte, verfolgten mit <strong>de</strong>r Gründung das Ziel, ihre jeweilige<br />
Machtposition <strong>zu</strong> festigen, waren aber auf gegenseitige Unterstüt<strong>zu</strong>ng angewiesen. Wie <strong>zu</strong> dieser Zeit üblich, wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>nächst nur die Artistenfakultät, Jura und Medizin eingerichtet.<br />
1433 folgte mit <strong>de</strong>r Theologie die angesehenste <strong>de</strong>r klassischen Vier Fakultäten. Nach <strong>de</strong>r Verhängung von Bann und Interdikt über die Stadt verließ die Universität von 1437 bis 1443<br />
Rostock in Richtung Greifswald, wo 1456 offiziell eine eigene Universität gegrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>. Spätere Spannungen zwischen Stadt bzw. Lan<strong>de</strong>sherren und Universität hatten zwei weitere<br />
Auszüge 1487 nach Wismar und Lübeck und 1760 nach Bützow <strong>zu</strong>r Folge.[11]
Bereits 1476 wur<strong>de</strong> eine erste Buchdruckerei von <strong>de</strong>n Brü<strong>de</strong>rn vom Gemeinsamen Leben im Michaeliskloster gegrün<strong>de</strong>t. Zur Blüte kam das Druckwesen unter Ludwig Dietz, <strong>de</strong>r unter<br />
an<strong>de</strong>rem 1518 eine nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsche Ausgabe <strong>de</strong>s Narrenschiffs von Sebastian Brant herausbrachte.<br />
An allen vier Pfarrkirchen gab es Schulen, von <strong>de</strong>nen die Lateinschule <strong>de</strong>r Marienkirche die be<strong>de</strong>utendste war. Seit 1260 ist eine Apotheke in Rostock nachweisbar. Die Marienkirche<br />
verfügte 1379 über die berühmte Astronomische Uhr, <strong>de</strong>ren Werk noch heute funktioniert.<br />
Kirchen und Klöster<br />
Als Kirche <strong>de</strong>r Mittelstadt entwickelte sich St. Marien <strong>zu</strong>r Haupt- und Ratskirche Rostocks, <strong>de</strong>ren Kirchenpatronat jedoch beim Lan<strong>de</strong>sherrn lag. Der für Rostock <strong>zu</strong>ständige Bischof<br />
hatte seinen Sitz in Schwerin. Neben <strong>de</strong>n vier Pfarrkirchen gab es verschie<strong>de</strong>ne Klöster in Rostock: Um 1240 bzw. 1256 waren die Bettelor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Franziskaner und <strong>de</strong>r Dominikaner in<br />
die Stadt gekommen und hatten das Katharinen- und das Johanniskloster erbaut.[12] 1283 starb die dänische Königin Margarete Sambiria im Zisterzienserkloster <strong>zu</strong>m Heiligen Kreuz,<br />
<strong>de</strong>ssen Stiftung man ihr <strong>zu</strong>schrieb. Darüber hinaus entstan<strong>de</strong>n das Heilig-Geist- und das St.-Georg-Hospital als Stiftungen. Sowohl die Klöster als auch die Hospitäler verfügten als<br />
mächtige Grundherrschaft über zahlreiche Dörfer im Umland.<br />
Im 14. und 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt kamen das sogenannte Michaeliskloster <strong>de</strong>r Brü<strong>de</strong>r vom gemeinsamen Leben, das Kartäuserkloster Marienehe außerhalb <strong>de</strong>r Stadt, das Gertru<strong>de</strong>nhospital vor<br />
<strong>de</strong>m Kröpeliner Tor sowie einige an<strong>de</strong>re Stiftungen hin<strong>zu</strong>.<br />
In geringer Zahl sind seit <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts Ju<strong>de</strong>n in Rostock nachweisbar. In <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Schwarzen To<strong>de</strong>s um 1350 wur<strong>de</strong>n diese nach angeblichen<br />
Brunnenvergiftungen aus <strong>de</strong>r Stadt vertrieben.<br />
Frühe Neuzeit<br />
Reformation<br />
Die Reformation ging in Rostock von <strong>de</strong>r Petrikirche in <strong>de</strong>r ärmlichen östlichen Altstadt aus, an <strong>de</strong>r Joachim Slüter seit 1523 als Kaplan wirkte. Von hier setzten sich die Lehren Martin<br />
Luthers vergleichsweise langsam durch, da die Altkirche mit <strong>de</strong>m Rat, <strong>de</strong>r Universität, <strong>de</strong>m Kollegiatstift von St. Jakobi, <strong>de</strong>m Dominikanerkloster St. Johanni und <strong>de</strong>m Herzog von<br />
Mecklenburg-Güstrow, Albrecht VII. starke Gegenkräfte mobilisieren konnte. Lan<strong>de</strong>sherrliche Unterstüt<strong>zu</strong>ng erhielt Slüter dagegen von Albrechts Bru<strong>de</strong>r Heinrich V., <strong>de</strong>m Herzog von<br />
Mecklenburg-Schwerin. Slüter hielt seine Predigten in nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utscher Sprache und zog solche Massen an, dass er unter freiem Himmel predigen musste, weil <strong>de</strong>r Kirchenraum die<br />
Zuhörer nicht mehr fasste. Auch ein 1525 bei Ludwig Dietz erschienenes Gesangbuch hatte er in <strong>de</strong>r Volkssprache verfasst. Neben Slüter wirkten <strong>de</strong>r Stadtsyndikus und<br />
Universitätsprofessor Johann Ol<strong>de</strong>ndorp und während eines kurzen Aufenthalts Ulrich von Hutten entschei<strong>de</strong>nd an <strong>de</strong>r Durchset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Reformation mit.<br />
Überraschend än<strong>de</strong>rte <strong>de</strong>r Rat jedoch im April 1531 seine Haltung und erklärte die reformatorische Lehre in allen vier Hauptpfarrkirchen für verbindlich. Bereits ein Jahr später verstarb<br />
Slüter. Sein früher Tod schürte <strong>de</strong>n Verdacht, von Papisten ermor<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> sein. Auch nach <strong>de</strong>r Ratsordnung von 1531 blieben die Universität sowie die Klöster <strong>zu</strong>m Heiligen Kreuz,<br />
St. Johanni und die Kartause in Marienehe <strong>de</strong>r alten Lehre treu. Erst im Juni 1549 setzte Johann Albrecht I. auf <strong>de</strong>m Sternberger Landtag <strong>de</strong>n lutherischen Glauben für alle Landstän<strong>de</strong><br />
durch und löste 1552 fast sämtliche mecklenburgischen Klöster auf. In Rostock wi<strong>de</strong>rsetzte sich das Nonnenkloster <strong>zu</strong>m Heiligen Kreuz noch lange <strong>de</strong>r Reformation, bis es <strong>zu</strong>m<br />
Damenstift <strong>de</strong>r stadtbürgerlichen Oberschicht umgewan<strong>de</strong>lt wur<strong>de</strong>. Die Kartause Marienehe wur<strong>de</strong> 1552 gewaltsam aufgehoben.<br />
Die 1534 vom Rat aufgelöste Schule <strong>de</strong>r Brü<strong>de</strong>r vom Gemeinsamen Leben im Michaeliskloster war ein Jahr später auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s lutherischen Glaubens wie<strong>de</strong>r erlaubt wor<strong>de</strong>n. 1580<br />
wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Räumen <strong>de</strong>s Johannisklosters die Große Stadtschule eingerichtet, die unter <strong>de</strong>r Leitung von Nathan Chyträus aufblühte.<br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen um die bürgerliche Repräsentation<br />
Während <strong>de</strong>r Grafenfeh<strong>de</strong> 1534 kam es in verschie<strong>de</strong>nen Hansestädten, so auch in Rostock, erneut <strong>zu</strong> Unruhen. Wie 1427/28 wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>r antirätlichen Opposition ein Bürgerrat<br />
eingerichtet, <strong>de</strong>r sich aus 64 Kaufleuten und Handwerkern <strong>zu</strong>sammensetzte und vom Stadtrat anerkannt wer<strong>de</strong>n musste. Als <strong>de</strong>r Krieg 1535 mit einer Nie<strong>de</strong>rlage gegen Dänemark<br />
en<strong>de</strong>te, wur<strong>de</strong>n die alten Verhältnisse ohne nennenswerte Gegenwehr wie<strong>de</strong>r hergestellt, in Zukunft sollte <strong>de</strong>r Rat sich aber in allen strittigen Fällen Bürgerausschüssen gegenüber sehen.
Das Verhältnis zwischen <strong>de</strong>r Stadt und <strong>de</strong>n mecklenburgischen Herzögen war seit <strong>de</strong>r Grafenfeh<strong>de</strong> <strong>zu</strong>nehmend gestört, da die Ambitionen Albrechts VII. auf die dänische Krone mit <strong>de</strong>r<br />
Nie<strong>de</strong>rlage katastrophal geen<strong>de</strong>t und das Land hoch verschul<strong>de</strong>t hatten. Bereits 1523 hatten sich die Landstän<strong>de</strong> <strong>zu</strong>sammengeschlossen und traten <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sherren selbstbewusst<br />
gegenüber. Dabei nahm Rostock als finanzstärkste Stadt <strong>de</strong>s Herzogtums mit ihrem riesigen Grundbesitz im Umland eine führen<strong>de</strong> Rolle in <strong>de</strong>r Landständischen Union ein. Beson<strong>de</strong>rs<br />
die Universität war häufig Gegenstand <strong>de</strong>r Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ng zwischen Stadt und Lan<strong>de</strong>sherrn.<br />
1562 bis 1565 wur<strong>de</strong> ein Sechzigerrat <strong>de</strong>m Stadtrat gleichberechtigt <strong>zu</strong>r Seite gestellt und trotzte diesem erneut einen Bürgerbrief ab. Am 28. Oktober 1565 hielt <strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Rat<br />
verbün<strong>de</strong>te Johann Albrecht I. mit bewaffneten Kräften Ein<strong>zu</strong>g in Rostock, nach<strong>de</strong>m die Stadt ihm <strong>de</strong>n formalen Huldigungseid verweigert hatte. Er löste die Sechziger auf und<br />
vernichtete <strong>de</strong>n Bürgerbrief. Anfang 1566 marschierte auch sein <strong>zu</strong>vor mit <strong>de</strong>m Sechzigerrat verbün<strong>de</strong>ter Bru<strong>de</strong>r Ulrich ein. Die bei<strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sherren einigten sich, rissen das Steintor<br />
und die südliche Stadtmauer nie<strong>de</strong>r und errichteten im heutigen Rosengarten eine Festung vor <strong>de</strong>r Stadt. Erst mit <strong>de</strong>n Rostocker Erbvertägen von 1573 (Erster Rostocker Erbvertrag) und<br />
1584 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r schwelen<strong>de</strong> Konflikt zwischen Stadt und Lan<strong>de</strong>sherrn beigelegt. Rostock erkannte insbeson<strong>de</strong>re hinsichtlich <strong>de</strong>r Gerichtsbarkeit und <strong>de</strong>r Steuerzahlung die<br />
lan<strong>de</strong>sherrliche Oberhoheit <strong>de</strong>s Herzogs an. Rostocks Bemühungen, die Reichsunmittelbarkeit <strong>zu</strong> erlangen, waren damit endgültig gescheitert, das Steintor konnte jedoch wie<strong>de</strong>r<br />
aufgebaut und die herzogliche Festung geschleift wer<strong>de</strong>n.<br />
1583/84 wur<strong>de</strong> neben <strong>de</strong>m weiterhin von ratsfähigen Patriziern gestellten Rat ein neuer Bürgerausschuss eingerichtet, das Hun<strong>de</strong>rtmännerkollegium, das sich aus 40 Brauherren, 20<br />
weiteren Kaufleuten und 40 Handwerkern <strong>zu</strong>sammensetzte. Als Hauptausschuss <strong>de</strong>r Hun<strong>de</strong>rtmänner wur<strong>de</strong> En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts ein Sechzehnerrat eingeführt. Nach mehreren<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rten voller Unruhen war mit <strong>de</strong>m Hun<strong>de</strong>rtmännerkollegium erstmals langfristig eine innere Befriedung <strong>de</strong>r Stadt erreicht. An<strong>de</strong>rs als bei früheren Bürgerausschüssen gelang es<br />
<strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sherren kaum noch, <strong>de</strong>n Rat und das Kollegium gegeneinan<strong>de</strong>r aus<strong>zu</strong>spielen, wenngleich die Zusammenarbeit bei<strong>de</strong>r Gremien nicht immer spannungsfrei verlief.<br />
Spätblüte <strong>de</strong>s hansischen Rostock um 1600<br />
Rund 14 000 Einwohner, gut 800 Giebelhäuser und etwa 250 bis 300 Brauhäuser waren En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts Ausdruck eines Wohlstands, <strong>de</strong>r selbst die mittelalterliche Blütezeit<br />
übertraf.[13] Zahlreiche mecklenburgische A<strong>de</strong>lsfamilien hatten Resi<strong>de</strong>nzen in Rostock o<strong>de</strong>r wohnten ganz in <strong>de</strong>r Stadt und wur<strong>de</strong>n mitunter Ratsherren und sogar Bürgermeister.<br />
Rostock, <strong>de</strong>ssen Wirtschaft völlig vom Seehan<strong>de</strong>l und <strong>de</strong>m Brauwesen bestimmt war, zog zahlreiche Zuzügler aus ganz Nord<strong>de</strong>utschland an. Beson<strong>de</strong>rs angesehen waren die<br />
Universitätsprofessoren, <strong>zu</strong>nehmen<strong>de</strong>n Einfluss erlangten aber auch diejenigen Bürger, die an <strong>de</strong>r Universität studiert hatten. Beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r juristisch ausgebil<strong>de</strong>te Stadtsyndikus spielte<br />
neben <strong>de</strong>m Bürgermeister eine immer größere Rolle.<br />
Ärmere Bevölkerungsteile lebten in über 1000, meist in Fachwerkbauweise o<strong>de</strong>r als Bretterverschläge errichteten Bu<strong>de</strong>n, die unterste soziale Schicht in ebenso vielen Kellern.[14] Auch<br />
zwischen <strong>de</strong>n Stadtteilen gab es ein soziales Gefälle: In <strong>de</strong>r Mittelstadt war die Dichte <strong>de</strong>r Steinhäuser am größten, gefolgt von <strong>de</strong>r Neustadt, in <strong>de</strong>r Altstadt existierten die meisten<br />
Bu<strong>de</strong>n. Innerhalb <strong>de</strong>r Teilstädte waren wie<strong>de</strong>rum die Marktplätze die bevor<strong>zu</strong>gten Wohngegen<strong>de</strong>n, während an <strong>de</strong>r Peripherie die ärmeren Schichten wohnten.<br />
Das geistige und politische Zentrum bil<strong>de</strong>te die Achse zwischen Rathaus und Neuem Markt sowie <strong>de</strong>r Universität am Hopfenmarkt, die durch die Blutstraße miteinan<strong>de</strong>r verbun<strong>de</strong>n<br />
waren. Die Marien- und die Jakobikirche lagen jeweils unweit <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Märkte.<br />
Dreißigjähriger Krieg<br />
Während <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges (1618–1648), <strong>de</strong>r unwi<strong>de</strong>rruflich das En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hanse herbeiführte, wur<strong>de</strong> Rostock besetzt, litt aber weit weniger als an<strong>de</strong>re mecklenburgische<br />
Städte und beson<strong>de</strong>rs die Dörfer. Zunächst war Mecklenburg kaum vom Krieg betroffen und mehr mit neuen Streitigkeiten <strong>de</strong>s herzoglichen Brü<strong>de</strong>rpaares Adolf Friedrich I. und Johann<br />
Albrecht II. beschäftigt, die 1621 <strong>zu</strong>r zweiten mecklenburgischen Hauptlan<strong>de</strong>steilung in die Herzogtümer Schwerin und Güstrow führten. Mit <strong>de</strong>m Kriegseintritt Dänemarks griff <strong>de</strong>r<br />
Krieg jedoch auf Nord<strong>de</strong>utschland über, und da Rostocks Bierexport vor allem nach Skandinavien ging, war die Stadt beson<strong>de</strong>rs betroffen. 1627 erreichten die Kriegshandlungen<br />
Mecklenburg, so dass Rostock seine Neutralität nicht länger bewahren konnte. Bis 1628 vermochte sich die reiche Stadt, die ab 1624 durch <strong>de</strong>n nie<strong>de</strong>rländischen Festungsbaumeister<br />
Johan van Valckenburgh aufgefestet wor<strong>de</strong>n war, noch mit <strong>de</strong>r enormen Summe von 140.000 Reichstalern von kaiserlichen Beset<strong>zu</strong>ngen freikaufen, doch als Wallenstein nach <strong>de</strong>r<br />
Abset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Herzöge im Januar für seine Verdienste von Kaiser Ferdinand II. das Herzogtum Mecklenburg und das Bistum Schwerin sowie <strong>de</strong>n Titel „General <strong>de</strong>s Baltischen<br />
und ozeanischen Meeres“ erhielt, zwang er Rostock durch das bewährte Mittel einer Blocka<strong>de</strong> Warnemün<strong>de</strong>s in die Knie.
Wie schon früher bei drohen<strong>de</strong>n Kriegshandlungen zeigte sich <strong>de</strong>r Rat relativ schnell bereit ein<strong>zu</strong>lenken, während die seit 1625 <strong>zu</strong>r militärischen Verteidigung in 13 Fahnen organisierte<br />
Bürgerschaft <strong>zu</strong>m Wi<strong>de</strong>rstand entschlossen war. Schließlich gelang es <strong>de</strong>m Rat, relativ glimpfliche Kapitulationsbedingungen aus<strong>zu</strong>han<strong>de</strong>ln.[15] Rostock wur<strong>de</strong> von einem 1000 Mann<br />
starken Heer besetzt und <strong>zu</strong>r Garnisonsstadt Wallensteins, in Warnemün<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> eine Schanze angelegt, um <strong>de</strong>n Hafen behaupten <strong>zu</strong> können. Damit war ganz Mecklenburg in<br />
Wallensteins Hand, und es brachen vorübergehend ruhige Zeiten für die Stadt an. Da Wallenstein bemüht war, negative Kriegsauswirkungen von seinem Herzogtum möglichst<br />
fern<strong>zu</strong>halten, konnte Rostock sogar von <strong>de</strong>r neuen Situation profitieren. Als Gustav II. Adolf von Schwe<strong>de</strong>n im Juli 1630 in Pommern lan<strong>de</strong>te, spitzte sich die Lage auch in Rostock <strong>zu</strong>.<br />
Zur Katastrophe wäre es beinahe gekommen, als <strong>de</strong>r Jurist Jacob Vahrmeyer am 1. Februar 1631 <strong>de</strong>n kaiserlichen Stadtkommandanten ermor<strong>de</strong>te, doch <strong>de</strong>m Theologieprofessor und<br />
Rektor <strong>de</strong>r Universität Johann Quistorp gelang es, durch diplomatisches Geschick die Rache <strong>de</strong>s Militärs ab<strong>zu</strong>wen<strong>de</strong>n.<br />
Am 16. Oktober 1631 en<strong>de</strong>te die kaiserliche Belagerung für Rostock und die „Schwe<strong>de</strong>nzeit“ begann. Gustav Adolf setzte die angestammten mecklenburgischen Herzöge wie<strong>de</strong>r ein. Für<br />
Rostock blieb auch dieser Machtwechsel ohne größere Folgen, so erlebte etwa die Universität trotz <strong>de</strong>r unruhigen Zeiten eine Blüte. Waren das Land und die Dörfer Mecklenburgs<br />
Gewalt und Plün<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Soldateska wehrlos ausgesetzt, boten die Rostocker Stadtmauern vielen Flüchtlingen Schutz. Der Seehan<strong>de</strong>l Rostocks ging allerdings drastisch <strong>zu</strong>rück. Am<br />
schwersten traf die Stadt ein von <strong>de</strong>n mecklenburgischen Herzögen <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>gebilligter Zoll vor Warnemün<strong>de</strong>.<br />
Einen Wen<strong>de</strong>punkt markierte die vernichten<strong>de</strong> Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Schlacht bei Nördlingen. Die Kaiserlichen errangen immer mehr Siege, und am 30. Mai 1635 kam es <strong>zu</strong>m<br />
Frie<strong>de</strong>n von Prag. Mecklenburg konnte sich in <strong>de</strong>r Folge aus <strong>de</strong>m Bündnis lösen, was in <strong>de</strong>n Jahren von 1635 bis 1638 eine Verschlechterung <strong>de</strong>r Lage in Rostock darstellte.<br />
Verhandlungen über <strong>de</strong>n Warnemün<strong>de</strong>r Zoll wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>nächst ausgesetzt, dann aber wur<strong>de</strong> er verdoppelt, um so weitere Zahlungen von Rostock <strong>zu</strong> erzwingen. 1637/38 mussten die<br />
Schwe<strong>de</strong>n in Mecklenburg vor <strong>de</strong>m kaiserlichen General Matthias Gallas in Richtung Pommern <strong>zu</strong>rückweichen. Die Rostocker ersuchten sowohl diesen Feldherrn als auch <strong>de</strong>n Kaiser,<br />
<strong>de</strong>r Rostock unter seinen Schutz nahm, um die Eroberung <strong>de</strong>r Schanze und die Übergabe <strong>zu</strong>r Demolierung. Sie wur<strong>de</strong> am 11. März 1638 von <strong>de</strong>n Sachsen unter Graf Vitzthum, <strong>de</strong>r dabei<br />
sein Leben verlor, eingenommen. Die Lage für Rostock hatte sich dabei aber nur weiter verschlechtert. Nach<strong>de</strong>m die Schwe<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Ort Warnemün<strong>de</strong> verloren hatten, erhoben sie ihren<br />
Zoll von Schiffen aus, die vor Warnemün<strong>de</strong> lagen. In <strong>de</strong>r Schanze residierte nun <strong>de</strong>r kaiserliche Kommandant und verlangte dort eine eigene Abgabe. Erst als die Dänen unter Christian<br />
IV. eingriffen, eigene Schiffe vor die Warnowmündung legten und so je<strong>de</strong> Zolleinnahme verhin<strong>de</strong>rten, mussten die Schwe<strong>de</strong>n abziehen und war <strong>de</strong>r Zoll somit vorübergehend<br />
aufgehoben.<br />
Schwedische Versuche, die Schanze <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>erobern, konnten in <strong>de</strong>r Nacht vom 20. auf <strong>de</strong>n 21. Oktober 1638 von <strong>de</strong>n Kaiserlichen abgewehrt wer<strong>de</strong>n. Die Rostocker begannen die<br />
Schanze <strong>zu</strong> schleifen, um ein Festsetzen <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>n in Zukunft <strong>zu</strong> erschweren, doch diese zogen am 26. Oktober wie<strong>de</strong>r in die Schanze ein. Sie wur<strong>de</strong> instand gesetzt und verstärkt,<br />
<strong>de</strong>r Zoll in alter Höhe wie<strong>de</strong>r aufgenommen.[16] Erst mit <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges zogen sich die Schwe<strong>de</strong>n 1648 auch aus Warnemün<strong>de</strong> <strong>zu</strong>rück, erhoben aber weiterhin<br />
Zoll.<br />
Nie<strong>de</strong>rgang und <strong>de</strong>r Stadtbrand von 1677<br />
Im Vergleich mit <strong>de</strong>n an Schwe<strong>de</strong>n gefallenen Städten Stralsund, Wismar und Greifswald hatte Rostock nach <strong>de</strong>m Westfälischen Frie<strong>de</strong>n 1648 schlechtere Verbindungen für <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l<br />
mit Skandinavien. Der Schwe<strong>de</strong>nzoll, Satisfaktionszahlungen Mecklenburgs an die schwedische Krone und <strong>de</strong>r Zusammenbruch <strong>de</strong>s hansischen Han<strong>de</strong>lsnetzes – <strong>de</strong>r Hansetag von 1669<br />
war <strong>de</strong>r letzte <strong>de</strong>s alten Han<strong>de</strong>lsbündnisses – hatten Rostock treffen, aber nicht ruinieren können.<br />
In diese Phase <strong>de</strong>r Stagnation fiel eine plötzliche Katastrophe mit Langzeitwirkung: Am 11. August 1677 brach von einem Backhaus in <strong>de</strong>r Altstadt ausgehend ein verheeren<strong>de</strong>r<br />
Stadtbrand aus, <strong>de</strong>r, von ungünstigen Win<strong>de</strong>n ausgeweitet, zwei Tage anhielt, bis es endlich <strong>zu</strong> regnen begann. Fast die gesamte Altstadt und ein beträchtlicher Teil <strong>de</strong>r nördlichen<br />
Mittelstadt fielen <strong>de</strong>n Flammen <strong>zu</strong>m Opfer. Insgesamt war ein Drittel sämtlicher Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt zerstört wor<strong>de</strong>n – etwa 700 Häuser und Bu<strong>de</strong>n.[17] Beson<strong>de</strong>rs schwer wog, dass das<br />
Zentrum <strong>de</strong>s Rostocker Brauwesens in <strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Hafen führen<strong>de</strong>n Straßen zerstört wor<strong>de</strong>n war. Die Zahl <strong>de</strong>r Brauhäuser sank von knapp 200 auf unter 100, die Einwohnerzahl, die En<strong>de</strong><br />
<strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts 14 000 betragen hatte, ging auf 5000 <strong>zu</strong>rück.[18]<br />
Nordischer Krieg und Siebenjähriger Krieg<br />
Der Große Nordische Krieg 1700–1721 brachte eine weitere Verschlechterung <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lsverbindungen mit sich und führte <strong>zu</strong> Plün<strong>de</strong>rungen durch dänische und schwedische Truppen.<br />
Auch <strong>de</strong>r Siebenjährige Krieg zeichnete die Stadt, die von 1758 bis 1762 bran<strong>de</strong>nburgisch besetzt war. Darüber hinaus nutzten die absolutistischen Fürsten die Schwäche Rostocks aus
und sicherten sich in dieser Zeit langfristig mit <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sherrlichen Erbverträgen von 1755 und 1788 ihre Macht. Seit 1702 zeitweise Resi<strong>de</strong>nz <strong>de</strong>r Herzöge, war Rostock endgültig <strong>zu</strong><br />
einer mecklenburgischen Landstadt gewor<strong>de</strong>n.<br />
Die Universität versank im 18. Jahrhun<strong>de</strong>rt in die Be<strong>de</strong>utungslosigkeit und hatte <strong>zu</strong><strong>de</strong>m noch mit einer von 1760 bis 1789 bestehen<strong>de</strong>n herzoglichen Universität im benachbarten Bützow<br />
<strong>zu</strong> konkurrieren, die Friedrich von Mecklenburg-Schwerin dort gegrün<strong>de</strong>t hatte.<br />
Erst En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts begann langsam <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>raufstieg Rostocks. Der Seehan<strong>de</strong>l blühte mit Getrei<strong>de</strong>transporten wie<strong>de</strong>r auf. Vor allem trug da<strong>zu</strong> die Blocka<strong>de</strong><br />
Großbritanniens durch das revolutionäre Frankreich bei, da sich die Rostocker damit <strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r französischen Konkurrenz verlassenen britischen Markt erschließen konnten. Im<br />
Stadtbild wur<strong>de</strong>n endlich die letzten Baulücken geschlossen, die seit <strong>de</strong>m Stadtbrand als Brachen leergestan<strong>de</strong>n hatten. Auch kulturell blühte Rostock wie<strong>de</strong>r auf: 1786 wur<strong>de</strong> ein<br />
Theaterbau errichtet, seit 1711 erschien die Rostocker Zeitung, und seit 1784 wirkte die aufklärerische „Societät“.<br />
Trotz <strong>de</strong>s Aufschwungs kam es in <strong>de</strong>n 1790er Jahren <strong>zu</strong> einer Reihe von Unruhen durch die Handwerker, ausgelöst vor allem durch Teuerungen bei Lebensmitteln. Die bekannteste<br />
dieser Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit Plün<strong>de</strong>rungen und Zerstörungen im Oktober 1800 wur<strong>de</strong> als „Rostocker Butterkrieg“ bekannt.<br />
19. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Franzosenzeit und Befreiungskriege<br />
Bei<strong>de</strong> mecklenburgischen Herzogtümer nahmen <strong>zu</strong>nächst nicht an <strong>de</strong>n Koalitionskriegen gegen Frankreich teil, son<strong>de</strong>rn zahlten lediglich Kontingentsersatzzahlungen an Preußen. Nach<br />
<strong>de</strong>r Schlacht bei Jena und Auerstedt zogen erst flüchten<strong>de</strong> preußische Soldaten, dann die französische Armee plün<strong>de</strong>rnd und zerstörend durch das Land. Am 29. November 1806 wur<strong>de</strong><br />
Mecklenburg von <strong>de</strong>m französischen General Michaud besetzt, Rostock musste Einquartierungen, Erniedrigungen, Restriktionen und Kontributionszahlungen über sich ergehen lassen.<br />
Beson<strong>de</strong>rs die Kontinentalsperre gegen England traf die Seehan<strong>de</strong>lsstadt hart. Erst als Mecklenburg am 22. März 1808 <strong>de</strong>m Rheinbund beitrat räumten die französischen<br />
Besat<strong>zu</strong>ngstruppen das Herzogtum und Rostocks Seehan<strong>de</strong>l erfuhr eine Wie<strong>de</strong>rbelebung, wenn er auch weitgehend auf <strong>de</strong>n Ostseeraum beschränkt blieb. Schon am 17. August 1810<br />
kehrten die Franzosen jedoch nach Rostock <strong>zu</strong>rück und mit ihnen die Einschränkungen <strong>de</strong>s öffentlichen und privaten Lebens <strong>de</strong>r Rostocker Bürger. Als die französische Armee 1812 <strong>zu</strong>m<br />
Russlandfeld<strong>zu</strong>g aufbrach, führte sie ein Kontingent von etwa 2.000 mecklenburgischen Soldaten mit sich. Nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlage <strong>de</strong>r Gran<strong>de</strong> Armée in Russland verließen am 26. März<br />
1813 die letzten Soldaten <strong>de</strong>r französischen Garnison Rostock.<br />
Als erste <strong>de</strong>utsche Staaten verließen die bei<strong>de</strong>n mecklenburgischen Herzogtümer am 25. März 1813 <strong>de</strong>n Rheinbund und riefen ihre Untertanen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Waffen. Mehrere hun<strong>de</strong>rt<br />
Rostocker Bürger nahmen in <strong>de</strong>r regulären mecklenburgischen Armee o<strong>de</strong>r in Freikorps an <strong>de</strong>n Befreiungskriegen teil. Zu <strong>de</strong>n herausragen<strong>de</strong>n Persönlichkeiten <strong>de</strong>r Befreiungskriege<br />
gehörte <strong>de</strong>r in Toitenwinkel geborene preußische Generalfeldmarschall Blücher, <strong>de</strong>r entschei<strong>de</strong>nd an <strong>de</strong>r Schlacht von Waterloo beteiligt war, in <strong>de</strong>r Napoleon geschlagen wer<strong>de</strong>n konnte.<br />
Bie<strong>de</strong>rmeier, Vormärz, 1848er-Revolution und Restauration<br />
Im 18. und 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt kam Rostock in <strong>de</strong>n Ruf einer soli<strong>de</strong>n aber behäbigen Provinzstadt, in <strong>de</strong>r neue Entwicklungen langsam und mit Verzögerungen eintraten. Das Bürgertum<br />
gestaltete das gesellschaftliche Leben <strong>zu</strong>nehmend selbstbewusst und grün<strong>de</strong>te nach <strong>de</strong>m „Geselligkeitsverein“ (Societät, 1784) die „Philharmonische Gesellschaft“ (1819) und <strong>de</strong>n<br />
„Rostocker Kunstverein“ (1841), die Turnbewegung erhielt 1827 einen Platz an <strong>de</strong>r Wallstraße. Zum bürgerlichen Selbstbewusstsein trug – neben ihrem wirtschaftlichen Erfolg – auch<br />
die Einführung <strong>de</strong>r allgemeinen Schulpflicht 1845 und <strong>de</strong>r Ausbau <strong>de</strong>s Bildungswesens bei.<br />
Die mecklenburgische bürgerlich-liberale Opposition <strong>de</strong>r Märzrevolution gegen <strong>de</strong>n politisch von adligen Gutsbesitzern dominierten Stän<strong>de</strong>staat sammelte sich um die Redaktion <strong>de</strong>r<br />
Mecklenburgischen Blätter, die von Anfang 1847 bis <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s Jahres 1848 vom Universitätsprofessor Karl Türk in Rostock herausgegeben wur<strong>de</strong>n. Daneben war die 1711<br />
gegrün<strong>de</strong>te Rostocker Zeitung Sprachrohr <strong>de</strong>r Liberalen. In <strong>de</strong>n untersten Schichten <strong>de</strong>r Gesellschaft führten Verelendung, Arbeitslosigkeit und Missernten <strong>zu</strong> einer unruhigen Stimmung,<br />
die in Rostock – an<strong>de</strong>rs als in an<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>utschen Städten – von <strong>de</strong>m im November 1848 gegrün<strong>de</strong>ten Arbeiterverein jedoch nicht radikalisiert wur<strong>de</strong>.<br />
Am 9. März 1848 diskutierten eintausend Rostocker Bürger im Hotel „Sonne“ am Neuen Markt die liberalen For<strong>de</strong>rungen nach einer Demokratisierung <strong>de</strong>s bestehen<strong>de</strong>n politischen und<br />
wirtschaftlichen Systems und verabschie<strong>de</strong>ten eine Petition, die sechs Tage später in schärferer Form wie<strong>de</strong>rholt wur<strong>de</strong>. Am 2. April wur<strong>de</strong> das Rostocker Reformkomitee in Güstrow
von 173 Delegierten aller mecklenburgischen Reformvereine <strong>zu</strong> ihrem Zentralkomitee bestimmt. Am 26. April trat auf Druck <strong>de</strong>r revolutionären Kräfte ein außeror<strong>de</strong>ntlicher Landtag in<br />
Schwerin <strong>zu</strong>sammen, <strong>de</strong>r Wahlen für <strong>de</strong>n 3. Oktober durchsetzte. 14 Rostocker Abgeordnete nahmen am 31. Oktober an <strong>de</strong>r konstituieren<strong>de</strong>n Sit<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s neuen Landtags teil.<br />
Abgeordneter für Rostock in <strong>de</strong>r Frankfurter Nationalversammlung war Johann Friedrich Martin Kierulff. Auch innerhalb <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> das alte Ratssystem <strong>de</strong>mokratisch reformiert.<br />
Bei <strong>de</strong>n Ratswahlen am 29. Januar 1849 erzielten vier Handwerker die besten Ergebnisse, erst dahinter folgten Advokaten und Kaufleute. Unter <strong>de</strong>n 48 Abgeordneten <strong>de</strong>r<br />
Stadtverordnetenversammlung befan<strong>de</strong>n sich erstmals auch drei Handwerksgesellen und zwei Arbeiter. Nach 30 Monaten setzte <strong>de</strong>r Großherzog von Mecklenburg-Schwerin jedoch das<br />
alte Hun<strong>de</strong>rtmännergremium wie<strong>de</strong>r ein, die Lan<strong>de</strong>sverfassung wur<strong>de</strong> abgeschafft, gegen die Presse mit Zensur und Ausweisung kritischer Redakteure vorgegangen. Im Frühjahr 1853<br />
wur<strong>de</strong>n schließlich 14 Rostocker Demokraten wegen Hochverrats <strong>zu</strong> langen Zuchthausstrafen verurteilt, darunter Karl Türk, Julius und Moritz Wiggers. Bis 1918 galten die politischen<br />
Verhältnisse in Mecklenburg als die Rückständigsten in ganz Deutschland.<br />
Industrialisierung<br />
Der Seehan<strong>de</strong>l Rostocks wuchs im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt stetig an und blieb die wirtschaftliche Triebfe<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Stadt. Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts verfügte Rostock über die größte Han<strong>de</strong>lsflotte<br />
im Ostseeraum, <strong>de</strong>ren Schiffe <strong>zu</strong>meist in heimischen Werften gebaut wur<strong>de</strong>n. Das Ausfuhrvolumen <strong>de</strong>s Getrei<strong>de</strong>han<strong>de</strong>ls erreichte 1845 erstmals 50.000 Tonnen.[19]<br />
Die <strong>de</strong>nnoch leeren Stadtkassen entschie<strong>de</strong>n über <strong>de</strong>n Abriss zahlreicher alter Gebäu<strong>de</strong>komplexe: So gab <strong>de</strong>r Rat in <strong>de</strong>n ersten Jahrzehnten <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts unter an<strong>de</strong>rem die<br />
mächtige fünfschiffige Kirche <strong>de</strong>s Heiligen-Geist-Hospitals und das ehemalige Dominikanerkloster St. Johannis <strong>zu</strong>m Abriss frei. Seit 1830 begann Rostock erstmals über das Gebiet <strong>de</strong>r<br />
mittelalterlichen Stadtmauergrenzen hinaus<strong>zu</strong>wachsen, <strong>de</strong>shalb wur<strong>de</strong>n auch große Teile <strong>de</strong>r Stadtbefestigung abgetragen. Die Wälle und Gräben aus <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>s Dreißigjährigen<br />
Krieges wur<strong>de</strong>n eingeebnet und <strong>zu</strong>r Wallstraße. Fast alle Straßen wur<strong>de</strong>n gepflastert und mit Bürgersteigen versehen, außerhalb <strong>de</strong>r Stadt Chausseen als Überlandstraßen ausgebaut.<br />
Anschluss an das <strong>de</strong>utsche Eisenbahnnetz erhielt Rostock 1850 mit <strong>de</strong>r Verbindung nach Bützow-Kleinen, 1859 war dann über Güstrow und Neubran<strong>de</strong>nburg die Verbindung an die<br />
Strecke Stralsund-Neubran<strong>de</strong>nburg-Berlin hergestellt und seit 1870 führte eine Strecke von Hamburg nach Stettin. Die positiven Impulse wur<strong>de</strong>n jedoch <strong>de</strong>utlich von <strong>de</strong>n Einbußen<br />
überlagert, die <strong>de</strong>r Rostocker Hafen durch die Schiene <strong>zu</strong> verzeichnen hatte.<br />
Der Zunftzwang hemmte bis 1869 die Effektivität <strong>de</strong>r Wirtschaft erheblich. Vor allem die Tabak- und Zigarrenhäuser <strong>de</strong>r Stadt entwickelten im Manufaktur- o<strong>de</strong>r Verlagssystem Ansätze<br />
industrieller Produktion, erfolgreich waren darüber hinaus beson<strong>de</strong>rs die Brennereien wie Krahnstöver, Lorenz o<strong>de</strong>r Lehment. Erst die zweite Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts brachte <strong>de</strong>r<br />
Stadt mit <strong>de</strong>r Gewerbefreiheit und <strong>de</strong>r umfassen<strong>de</strong>n Industrialisierung einen neuen Reichtum. Der erste <strong>de</strong>utsche Schraubendampfer wur<strong>de</strong> 1852 auf <strong>de</strong>r Schiffswerft und<br />
Maschinenfabrik von Wilhelm Zeltz und Albrecht Tischbein fertiggestellt. Aus <strong>de</strong>m Unternehmen entstand 1890 als erster industrieller Großbetrieb Mecklenburgs die Actien-<br />
Gesellschaft „Neptun“ Schiffswerft und Maschinenfabrik in Rostock[20], die heutige Neptun Werft GmbH. An<strong>de</strong>re wachsen<strong>de</strong> Wirtschaftszweige waren die chemische Industrie, vor<br />
allem die Fabriken <strong>de</strong>s Friedrich Witte, <strong>de</strong>r Landmaschinenbau sowie das Bauwesen und Dienstleistungsunternehmen.<br />
Warnemün<strong>de</strong> entwickelte sich in <strong>de</strong>n ersten Jahrzehnten <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong> einem <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Seekurorte in Deutschland. 1834 wur<strong>de</strong>n dort die ersten Bä<strong>de</strong>r errichtet, die für<br />
Damen und Herren noch getrennt waren. Dieser Bä<strong>de</strong>rstandort entwickelte sich vor allem durch die günstigen Verkehrsverbindungen mit <strong>de</strong>m Zug nach Berlin und <strong>de</strong>r Fähre nach<br />
Gedser weiter.<br />
Kaiserreich<br />
Die bei<strong>de</strong>n mecklenburgischen Großherzogtümer waren am 21. August 1866 <strong>de</strong>m Nord<strong>de</strong>utschen Bund beigetreten und 1869 wur<strong>de</strong> Mecklenburg Mitglied <strong>de</strong>s Deutschen Zollvereins.<br />
Als letzte <strong>de</strong>utsche Städte hatten Rostock und Wismar 1864 das Münzrecht aufgegeben. Auch das Rostocker Bürgerrecht hörte auf <strong>zu</strong> existieren und erstmals seit 1350 konnten sich<br />
wie<strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Stadt ansie<strong>de</strong>ln. Mit <strong>de</strong>r Reichsgründung 1871 begann auch in Rostock <strong>de</strong>r dynamische Entwicklungsprozess <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong>rzeit, allerdings blieb Rostock in seiner<br />
Entwicklung hinter <strong>de</strong>n meisten <strong>de</strong>utschen Städten vergleichbarer Größe <strong>zu</strong>rück.<br />
Die Industrialisierung sorgte dafür, dass Rostock um etwa 1.000 Einwohner pro Jahr wuchs. Hatte die Stadt 1806 noch 12.756 Einwohner, waren es 1900 54.713,[21] so dass die Stadt in<br />
westliche Richtung um das Arbeiterviertel Kröpeliner-Tor-Vorstadt und südlich um das Villenviertel <strong>de</strong>r Steintor-Vorstadt erweitert wur<strong>de</strong>. Bebauungspläne lagen für die bis dahin wild<br />
wachsen<strong>de</strong>n Vorstädte erst seit <strong>de</strong>n späten 1880er Jahren vor. Mit <strong>de</strong>r Heiligen-Geist-Kirche in <strong>de</strong>r westlichen Vorstadt entstand in <strong>de</strong>n Jahren 1905 bis 1908 <strong>de</strong>r erste Rostocker
Kirchenbau seit <strong>de</strong>m Mittelalter. Die rasante Wirtschafts- und Einwohnerentwicklung zwang in allen Bereichen <strong>zu</strong>r umfassen<strong>de</strong>n Mo<strong>de</strong>rnisierung <strong>de</strong>r Infrastruktur <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Politisch blieb die Wahl <strong>de</strong>s Rates auf eine relativ kleine Gruppe von Bürgern beschränkt. Das Reichstagsmandat <strong>de</strong>s Wahlbezirks Rostock/Bad Doberan fiel regelmäßig wechselnd an<br />
Vertreter <strong>de</strong>r Nationalliberalen Partei (NLP) und <strong>de</strong>r Deutschen Fortschrittspartei. Unter <strong>de</strong>r Arbeiterschaft war 1872 eine Ortsgruppe <strong>de</strong>s Allgemeinen Deutschen Arbeitervereins<br />
gegrün<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n und die Sozial<strong>de</strong>mokratie gewann <strong>zu</strong>nehmend an politischem Gewicht. 1890 wur<strong>de</strong> erstmals <strong>de</strong>r 1. Mai gefeiert und 1898-1906 sowie ab 1912 hatte Joseph Herzfeld<br />
das Reichstagsmandat für <strong>de</strong>n fünften mecklenburgischen Wahlkreis inne. Seit 1892 verfügte die SPD mit <strong>de</strong>r Mecklenburgischen Volkszeitung über eine eigene Zeitung. Die Rostocker<br />
Zeitung blieb die Stimme <strong>de</strong>r Liberalen, <strong>de</strong>r Rostocker Anzeiger war seit 1881 die Zeitung <strong>de</strong>r bürgerlichen Kreise und bestimmte bald die Medienlandschaft Mecklenburgs.<br />
Massenhaft entstan<strong>de</strong>n Vereine, die auf nahe<strong>zu</strong> allen Fel<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>s öffentlichen Lebens aktiv waren. Um kulturelle Angelegenheiten bemühten sich beson<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r Rostocker Kunstverein<br />
von 1841 und <strong>de</strong>r Verein für Rostocker Altertümer von 1883. In großer Zahl wur<strong>de</strong>n Gesangs- und Sportvereine gegrün<strong>de</strong>t. Von öffentlicher Seite wur<strong>de</strong> das Kulturleben maßgeblich<br />
durch das Theater geprägt, das auch Musiktheater und Orchester einschloss.<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Erster Weltkrieg und Novemberrevolution<br />
Während <strong>de</strong>s Ersten Weltkriegs gingen Rohstoffe und Lebensmittel <strong>zu</strong> einem großen Teil an die Front, so dass mit je<strong>de</strong>m Monat Not und Entbehrungen <strong>zu</strong>nahmen, Krankheiten wie<br />
Typhus waren die Folge <strong>de</strong>s Mangels. Der gesamte Landstrich nördlich <strong>de</strong>r Bahnstrecke Wismar-Rostock-Ribnitz wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m militärischen Son<strong>de</strong>rgebiet erklärt, so dass auch das<br />
Betreten Warnemün<strong>de</strong>s nur noch mit einem speziellen Ausweis möglich war. Ab 1917 kam es trotz drastischer Strafandrohungen <strong>zu</strong> Unruhen und Streiks. Im November wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r<br />
politisierten Atmosphäre innerhalb nur weniger Tage Ortsgruppen <strong>de</strong>r Deutschen Vaterlandspartei, <strong>de</strong>s Liberalen Vereins, <strong>de</strong>r Fortschrittlichen Volkspartei, aus <strong>de</strong>r ein Jahr später die sehr<br />
einflussreiche Deutsche Demokratische Partei hervorging, und die Unabhängige Sozial<strong>de</strong>mokratische Partei Deutschlands (USPD), von <strong>de</strong>r sich später die Kommunistische Partei<br />
Deutschlands abspaltete, mit <strong>zu</strong>m Teil mehreren hun<strong>de</strong>rt Mitglie<strong>de</strong>rn, gegrün<strong>de</strong>t. Am 30. Januar 1918 fand im Gewerkschaftshaus „Philharmonie“ eine Frauenkundgebung für <strong>de</strong>n<br />
Frie<strong>de</strong>n statt.<br />
Zwei Tage nach<strong>de</strong>m Marineeinheiten am 3. November 1918 in Kiel Kriegsschiffe in ihre Gewalt gebracht hatten, liefen Torpedoboote mit roter Flagge und Kieler Matrosen an Bord in<br />
Warnemün<strong>de</strong> ein. Schon einen Tag später grün<strong>de</strong>ten 1.500 Matrosen, Infanteristen und Landsturmleute einen Soldatenrat, <strong>de</strong>m sich die Arbeiter <strong>de</strong>r Neptunwerft, <strong>de</strong>r Munitionsfabrik<br />
Dolberg und an<strong>de</strong>rer Betriebe solidarisch erklärten und am 7. November einen Arbeiterrat bil<strong>de</strong>ten. Am 14. November dankte <strong>de</strong>r mecklenburgische Großherzog ab, auf <strong>de</strong>n öffentlichen<br />
Gebäu<strong>de</strong>n Rostocks wehten nun rote Fahnen. In Mecklenburg dominierte klar die reformerische Richtung <strong>de</strong>r SPD, die eine parlamentarische Demokratie anstrebte und Gewalt ablehnte.<br />
Radikale Kräfte <strong>de</strong>r USPD und <strong>de</strong>s Spartakusbun<strong>de</strong>s, die die Novemberrevolution mit Räterepublik und Klassenkampf fortsetzen wollten, konnten sich dagegen nicht durchsetzen.<br />
En<strong>de</strong> Dezember 1918 fan<strong>de</strong>n Kommunalwahlen sowie Wahlen <strong>zu</strong>m Verfassungsgeben<strong>de</strong>n Landtag und <strong>zu</strong>r Weimarer Nationalversammlung statt. Auch für die Stadt wur<strong>de</strong> – erstmals in<br />
allgemeiner, gleicher und geheimer Wahl sowie mit aktivem und passivem Frauenstimmrecht – eine verfassungsgeben<strong>de</strong> Versammlung gewählt. Stärkste Kraft <strong>de</strong>r Bürgervertretung<br />
wur<strong>de</strong> die SPD mit 31 Mandaten vor <strong>de</strong>r DDP (23), <strong>de</strong>r DVP (10) und <strong>de</strong>r USDP (2). Mit <strong>de</strong>n Umwäl<strong>zu</strong>ngen im Deutschen Reich und im neuen Freistaat Mecklenburg verloren die<br />
Städte endgültig ihre politische Souveränität.<br />
Weimarer Republik<br />
Die Zeit <strong>de</strong>r Weimarer Republik war auch in Rostock von wirtschaftlichen Krisen, Massenarbeitslosigkeit, Inflation und einer Zersplitterung <strong>de</strong>r politischen Parteien geprägt,<br />
Demonstrationen und Streiks waren an <strong>de</strong>r Tagesordnung. Impulse für die Wirtschaft konnte vor allem <strong>de</strong>r Flugzeugbau in Warnemün<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Anfang <strong>de</strong>r 1920er Jahre<br />
gegrün<strong>de</strong>ten Unternehmen von Heinkel und Arado geben. Mit <strong>de</strong>m Flugplatz Hohe Düne, <strong>de</strong>r als Seeflug GmbH getarnten Pilotenausbildungsstätte <strong>de</strong>r Marine, einer privaten<br />
Fliegerschule und einer Nachtpost-Fluglinie von Junkers & Co. war <strong>de</strong>r Ort <strong>zu</strong>m Zentrum <strong>de</strong>r Flugzeugindustrie gewor<strong>de</strong>n.<br />
Wichtigstes Industrieunternehmen blieb die Neptun-Werft. Die Zahl <strong>de</strong>r Rostocker Dampfer erreichte 1921 mit 18 Schiffen ihren Tiefstand.[22] 1933 arbeiteten 51,75 % <strong>de</strong>r<br />
Berufstätigen im Bereich Han<strong>de</strong>l und Verkehr.[23] Die Verarbeiten<strong>de</strong> Industrie und <strong>de</strong>r Hafen stellten sich ganz auf <strong>de</strong>n Export von Landwirtschaftserzeugnissen ein.
Um <strong>de</strong>r allgemeinen Wohnungsnot <strong>zu</strong> begegnen, wur<strong>de</strong> die Kröpeliner-Tor-Vorstadt erweitert und vor <strong>de</strong>n Toren <strong>de</strong>r Stadt entstan<strong>de</strong>n fünf neue Siedlungen: Die Gartenstadt, Stadtwei<strong>de</strong>,<br />
Reutershagen, Brinckmansdorf und <strong>de</strong>r Ausbau <strong>de</strong>s Industriegebietes Bramow mit Wohnhäusern. Um 1928 wur<strong>de</strong>n mit <strong>de</strong>m Hansaviertel und an<strong>de</strong>ren Vierteln weitere Wohnsiedlungen<br />
erschlossen.<br />
Dem Kapp-Putsch 1920, <strong>de</strong>r in Mecklenburg von Generalmajor Paul von Lettow-Vorbeck geleitet wur<strong>de</strong>, waren die Arbeiterparteien mit einer Arbeiterwehr und Generalstreik begegnet.<br />
Unterstützt wur<strong>de</strong>n sie dabei von <strong>de</strong>r DDP. Etwa ab <strong>de</strong>m Krisenjahr 1923 radikalisierte sich sowohl das linke wie das rechte politische Spektrum. Seit Dezember 1922 war die<br />
Deutschvölkische Freiheitspartei <strong>zu</strong>m Sammelbecken rechtsradikaler Kräfte in Mecklenburg gewor<strong>de</strong>n, die in Rostock das Parteiblatt Mecklenburger Warte herausgab.<br />
Getarnt als Nationalsozialistische Vereinigung entstand am 5. März 1924 in Rostock die erste Ortsgruppe <strong>de</strong>r NSDAP Mecklenburgs. Aus wahltaktischen Grün<strong>de</strong>n schlossen sie sich<br />
<strong>zu</strong>nächst <strong>de</strong>r DVFrP an, seit Anfang 1925 erfolgte dann <strong>de</strong>r Aufbau einer eigenständigen Parteiorganisation. Im November 1930 zog die NSDAP mit 16 Abgeordneten als zweitstärkste<br />
Fraktion nach <strong>de</strong>r SPD in die Bürgervertretung ein. Im Januar <strong>de</strong>s darauffolgen<strong>de</strong>n Jahres konnten die Nationalsozialisten einen ersten und im Oktober bereits einen zweiten Stadtrat in<br />
<strong>de</strong>n Rat wählen lassen. Bei <strong>de</strong>n Landtagswahlen im Juni 1932 entfielen in Rostock 40,33 % <strong>de</strong>r abgegebenen Stimmen auf die Nationalsozialisten. Die Kreisleitung sorgte für<br />
entsprechen<strong>de</strong> Propaganda, <strong>de</strong>ren Höhepunkte zwei Wahlveranstaltungen mit Adolf Hitler als Redner darstellten. In <strong>de</strong>r Folgezeit verstärkte sich aggressiv und <strong>de</strong>monstrativ die Präsenz<br />
<strong>de</strong>r Nationalsozialisten auf Rostocks Straßen. Kurz darauf kamen erste Verhaftungen und Hausdurchsuchungen da<strong>zu</strong>, um aktiv politische Gegner ein<strong>zu</strong>schüchtern. Beson<strong>de</strong>rs aus <strong>de</strong>n<br />
Reihen <strong>de</strong>r SA kam es <strong>zu</strong> Ausschreitungen und willkürlichen Übergriffen jenseits aller gesetzlichen Grundlagen.<br />
Zeit <strong>de</strong>s Nationalsozialismus<br />
Am Vorabend <strong>de</strong>r Reichstagswahl 1933 wur<strong>de</strong>n 21 Rostocker Kommunisten in „Schutzhaft“ genommen. Zwar durften alle Parteien <strong>zu</strong>r Wahl antreten, doch schränkten Presseverbot,<br />
Hausdurchsuchungen sowie Demonstrations- und Kundgebungsverbote <strong>de</strong>n Wahlkampf <strong>de</strong>r Linksgruppierungen erheblich ein. Die NSDAP wur<strong>de</strong> in Rostock mit 35,5 % stärkste Partei,<br />
jedoch erst im Verband mit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschnationalen Kampffront Schwarz-Weiß-Rot (20,3 %) meinte eine Mehrheit von rund 56 % <strong>de</strong>r Rostocker Wähler sich mit <strong>de</strong>m<br />
nationalsozialistisch-konservativen Kabinett unter Hitler arrangieren <strong>zu</strong> können. Bei dieser letzten, schon nicht mehr freien Wahl, konnte die SPD mit 30,8 % ihr Ergebnis vom<br />
November halten, die KPD erzielte 8,7 % <strong>de</strong>r Stimmen.<br />
Mit <strong>de</strong>r Gleichschaltung <strong>de</strong>r Län<strong>de</strong>r mit <strong>de</strong>m Reich wur<strong>de</strong>n sämtliche KPD-Mandate aufgehoben und die Stadtverordnetenversammlung auf <strong>de</strong>r Grundlage <strong>de</strong>r jüngsten<br />
Reichstagswahlergebnisse neu <strong>zu</strong>sammengesetzt. Da einige bürgerliche Parteien die Wahlinszenierung über die Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>gewiesenen Mandate boykottierten und die DVP und <strong>de</strong>r<br />
Christlich-Soziale Volksdienst ihre Mandate auf die NSDAP übertrugen, setzte sich <strong>de</strong>r neue Stadtrat aus 15 Abgeordneten <strong>de</strong>r NSDAP, 12 <strong>de</strong>r SPD und 8 <strong>de</strong>r Kampffront Schwarz-<br />
Weiß-Rot <strong>zu</strong>sammen.<br />
Auf Grund <strong>de</strong>s Gesetzes <strong>zu</strong>r Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>s Berufsbeamtentums wur<strong>de</strong>n 31 Ämter mit politisch <strong>zu</strong>verlässigen Personen neu besetzt. Beson<strong>de</strong>rs betroffen war die Feuerwehr, aus<br />
<strong>de</strong>ren Dienst 14 Sympathisanten <strong>de</strong>r SPD o<strong>de</strong>r KPD entfernt wur<strong>de</strong>n. Aus <strong>de</strong>m Polizeidienst wur<strong>de</strong>n fünf Beamte entlassen. Da es <strong>de</strong>r NSDAP an geeigneten Verwaltungsfachleuten<br />
mangelte, erhöhte sich die Zahl <strong>de</strong>r Betroffenen bis November 1939 nur auf 39. Aus <strong>de</strong>m gleichen Grund konnte <strong>de</strong>r konservative Oberbürgermeister Dr. Robert Grabow <strong>zu</strong>nächst nicht<br />
ersetzt wer<strong>de</strong>n, bis Walter Volgmann im April 1935 sein Amt übernahm. Gleichzeitig beseitigte die Deutsche Gemein<strong>de</strong>ordnung die Stadtverordnetenversammlung als kommunales<br />
Entscheidungsorgan.<br />
Am 16. März wur<strong>de</strong>n alle sozial<strong>de</strong>mokratischen Verbän<strong>de</strong> Mecklenburgs sowie diesen nahestehen<strong>de</strong> Einrichtungen und Vereine verboten, vier Tage später mehrere Funktionäre verhaftet.<br />
Inhaftierungen prominenter Gewerkschaftsführer folgten am 2. Mai. Nach <strong>de</strong>m reichsweiten Verbot <strong>de</strong>r SPD am 22. Juni 1933 bestand <strong>de</strong>r Stadtrat ausschließlich aus<br />
Nationalsozialisten. Die <strong>de</strong>utschlandweit organisierte Bücherverbrennung <strong>de</strong>r Werke bürgerlich-humanistischer, marxistischer und jüdischer Autoren am 10. Mai 1933 fand in Rostock<br />
auf <strong>de</strong>m Vögenteichplatz statt. Vor <strong>de</strong>r Universität stand ein sogenannter Schandpfahl, an <strong>de</strong>m Stu<strong>de</strong>nten Beispiele angeblich zersetzen<strong>de</strong>r Literatur angeschlagen hatten.<br />
Der Auftakt <strong>zu</strong>m „Ju<strong>de</strong>nboykott“ erfolgte in Rostock bereits am 30. März 1933 mit <strong>de</strong>r Postierung von SA-Leuten vor jüdischen Geschäften und setzte sich am Folgetag mit einer<br />
Großkundgebung auf <strong>de</strong>r Reiferbahn fort. Der Boykott von insgesamt 57 Rostocker Geschäften, Arztpraxen und Anwaltskanzleien wur<strong>de</strong> mit Einschüchterung und Gewalt durchgesetzt.<br />
Im Jahre 1938 erreichte die Ju<strong>de</strong>nverfolgung eine neue Dimension. Maßnahmen wie erhöhte Steuerfor<strong>de</strong>rungen und Löschung aus <strong>de</strong>m Han<strong>de</strong>lsregister, zwangen jüdische<br />
Geschäftsinhaber <strong>zu</strong>r Aufgabe ihrer Unternehmen. Die Verdrängung jüdischer Unternehmen fand Mitte 1939 ihren Abschluss. In Rostock wur<strong>de</strong>n im Rahmen <strong>de</strong>r „Polenaktion“ am 28.
Oktober 1938 insgesamt 37 Ju<strong>de</strong>n verhaftet und nach Polen abgeschoben. Im Zuge <strong>de</strong>s von <strong>de</strong>n Nationalsozialisten entfesselten Pogroms brannte am 10. November 1938 die Synagoge<br />
in <strong>de</strong>r Augustenstraße. Dem Brandanschlag folgte unmittelbar eine Welle <strong>de</strong>r Gewalt. SA- und SS-Trupps besetzten Häuser, Wohnungen und Geschäfte, zerstörten<br />
Einrichtungsgegenstän<strong>de</strong> und tyrannisierten jüdische Bürger. 64 von <strong>de</strong>r Gestapo verhaftete Ju<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n in die Strafanstalt Altstrelitz eingewiesen, wo sie erschwerten<br />
Haftbedingungen ausgesetzt waren. Die Auswan<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r restlichen Ju<strong>de</strong>n unterstützte <strong>de</strong>r Vorsitzen<strong>de</strong> <strong>de</strong>r jüdischen Gemein<strong>de</strong> Arnold Bernhard mit <strong>de</strong>n Erträgen aus <strong>de</strong>m<br />
Zwangsverkauf <strong>de</strong>s Synagogengrundstücks.<br />
Bis En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r 1930er Jahre stabilisierten sich die Lebensverhältnisse. Die militärische Aufrüstung brachte Rostock und Warnemün<strong>de</strong> als wichtigen Standorten <strong>de</strong>r Rüstungsindustrie einen<br />
<strong>de</strong>utlichen wirtschaftlichen Aufschwung. Das am 3. Dezember 1934 eingeweihte und ursprünglich für 2.100 Arbeitskräfte geplante Stammwerk <strong>de</strong>r Firma Heinkel beschäftigte 1941<br />
etwa 15.000 Arbeiter und Angestellte, die Zahl <strong>de</strong>r Beschäftigten im Flugzeugwerk Arado in Warnemün<strong>de</strong> war von 100 im Jahr 1933 auf 3.500 in <strong>de</strong>n Jahren 1937/38 angewachsen.[24]<br />
Die Neptunwerft, die 1933 lediglich 90 Arbeitskräfte beschäftigte und kurz vor <strong>de</strong>m Ruin gestan<strong>de</strong>n hatte, bot 1938 wie<strong>de</strong>r 1.800 Arbeitsplätze.[25]<br />
1935 hatte Rostock erstmals 100.000 Einwohner und konnte sich damit Großstadt nennen, im Mai 1939 lag die Einwohnerzahl bereits bei 121.192.[26] Um auf diesen enormen Zuwachs<br />
<strong>zu</strong> reagieren, för<strong>de</strong>rte die Stadt insbeson<strong>de</strong>re mit Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen <strong>de</strong>n Wohnungs- und Straßenbau. Die Stadterweiterung erfolgte in erster Linie Richtung Westen, wo<br />
auch die Heinkel-Werke angesie<strong>de</strong>lt waren. Außerhalb <strong>de</strong>r Stadt entstan<strong>de</strong>n die Siedlungen Dierkow und Reutershagen.<br />
Zweiter Weltkrieg<br />
Der durch Rekrutierungen verursachte Personalmangel in <strong>de</strong>n Rüstungsbetrieben wur<strong>de</strong> durch Dienstverpflichtungen <strong>de</strong>r einheimischen Bevölkerung und durch ausländische<br />
Zwangsarbeiter und Kriegsgefangene kompensiert, von <strong>de</strong>nen im Oktober 1943 etwa 14.500 unter katastrophalen Bedingungen in 19 Lagern lebten. Noch schlimmer waren die<br />
Verhältnisse für rund 2.000 Häftlinge aus <strong>de</strong>m Konzentrationslager Ravensbrück, die in <strong>de</strong>n Heinkel-Werken <strong>zu</strong>m Einsatz kamen. [27]<br />
Als Zentrum <strong>de</strong>r Rüstungsindustrie <strong>de</strong>s Dritten Reichs wur<strong>de</strong> Rostock schon 1940 Ziel von Luftangriffen <strong>de</strong>r Royal Air Force. Beson<strong>de</strong>rs schwere Flächenbombar<strong>de</strong>ments mit<br />
Brandbomben im Rahmen <strong>de</strong>r Area bombing directive trafen die Stadt in <strong>de</strong>n Nächten vom 23. auf <strong>de</strong>n 24. und vom 26. auf <strong>de</strong>n 27. April 1942, bei <strong>de</strong>nen gleichermaßen die<br />
Rüstungsbetriebe und die Innenstadt das Ziel waren. Die Heinkel- und die Arado-Werke sowie eine U-Boot-Werft wur<strong>de</strong>n schwer getroffen. In <strong>de</strong>r mittelalterlichen Innenstadt brannten<br />
die Nikolaikirche, die Jakobikirche und die Petrikirche mit nahe<strong>zu</strong> <strong>de</strong>r gesamten Ausstattung <strong>de</strong>r drei Gotteshäuser aus. Desgleichen blieben vom Steintor, <strong>de</strong>m Kuhtor und <strong>de</strong>m Petritor<br />
lediglich die Umfassungsmauern erhalten. An administrativen Gebäu<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n u. a. das Landratsamt, das Amts- und das Oberlan<strong>de</strong>sgericht, das Post- und Telegrafenamt, das<br />
Stadttheater, ferner zwei Klinken, acht Schulen sowie Versorgungseinrichtungen wie das Gas- und Wasserwerk zerstört bzw. schwer beschädigt. Ganze Straßenzüge, insbeson<strong>de</strong>re<br />
nördlich und nordöstlich <strong>de</strong>s Neuen Marktes bis <strong>zu</strong>r Grubenstraße, aber auch an vielen an<strong>de</strong>ren Ecken <strong>de</strong>r Innenstadt, wur<strong>de</strong>n ausgelöscht. [28] Allein bei <strong>de</strong>n vier Angriffen im April<br />
1942 kamen 221 Menschen ums Leben, 30.000–40.000 wur<strong>de</strong>n obdachlos.[29] Zu diesem Zeitpunkt war Rostock die am schwersten zerstörte Stadt Deutschlands. Beson<strong>de</strong>rs betroffen<br />
war die historische Innenstadt. Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Krieges waren hier von <strong>de</strong>n 10.535 Wohnhäusern 2.611 vollständig zerstört, weitere 6.735 beschädigt.[30] Das waren 47,7 % <strong>de</strong>r<br />
Wohnungen und 42,2 % <strong>de</strong>r wirtschaftlich genutzten Gebäu<strong>de</strong>.<br />
Gegen Regime- und Kriegsgegner wur<strong>de</strong> mit äußerster Härte vorgegangen: Allein 1942 en<strong>de</strong>ten von 78 Son<strong>de</strong>rgerichtsverfahren 19 mit <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe. Ebenso verfiel <strong>de</strong>r To<strong>de</strong>sstrafe,<br />
wer sich nach herrenlosen Gegenstän<strong>de</strong>n bückte, also "plün<strong>de</strong>rte". Von <strong>de</strong>n bei Kriegsbeginn noch 70 in Rostock leben<strong>de</strong>n Ju<strong>de</strong>n, die jetzt keine Möglichkeit mehr hatten, Deutschland<br />
<strong>zu</strong> verlassen, überlebten nur 14. Die meisten waren 1942 und 1943 in die Konzentrationslager Auschwitz und Theresienstadt <strong>de</strong>portiert und dort ermor<strong>de</strong>t wor<strong>de</strong>n.<br />
Im Frühjahr 1945 wur<strong>de</strong> Rostock von fliehen<strong>de</strong>n Wehrmachtsangehörigen und westwärts ziehen<strong>de</strong>n Flüchtlingstrecks überflutet und am 1. Mai 1945 durch die Rote Armee nahe<strong>zu</strong><br />
kampflos besetzt. Zuvor flohen auch viele Rostocker, etliche NSDAP-Funktionäre begingen Selbstmord, darunter Oberbürgermeister Volgmann, sein Stellvertreter Dr. Grabow, NS-<br />
Kreisleiter Dettmann und <strong>de</strong>r Polizeichef Dr. Sommer.<br />
DDR<br />
Bei Kriegsen<strong>de</strong> waren nur noch 69.000 Menschen in Rostock verblieben. Durch Kriegsheimkehrer und <strong>de</strong>n Zustrom Vertriebener, von <strong>de</strong>nen Rostock in <strong>de</strong>n ersten Jahren nach <strong>de</strong>m<br />
Krieg 33.000 aufnahm, stieg die Einwohnerzahl bis 1950 jedoch wie<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>n Vorkriegsstand.[31] Die Überreste <strong>de</strong>r weitgehend zerstörten Flugzeugwerke fielen als Reparationen an
die Sowjetunion. Die Neptun-Werft wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r aufgebaut und in Warnemün<strong>de</strong> entstand 1945/46 die Warnowwerft. Bei<strong>de</strong> Werften führten anfangs fast ausschließlich<br />
Reparationsaufträge durch. Viele Gebäu<strong>de</strong>, darunter das Stadttheater, waren nach <strong>de</strong>n Kriegszerstörungen nicht mehr <strong>zu</strong> retten, an<strong>de</strong>re, wie die Jakobikirche und das Petritor, wur<strong>de</strong>n aus<br />
i<strong>de</strong>ologischen o<strong>de</strong>r städteplanerischen Motiven abgerissen. 1949 begann man mit <strong>de</strong>m Wie<strong>de</strong>raufbau <strong>de</strong>s nahe<strong>zu</strong> vollständig zerstörten Stadtgebiets zwischen Marienkirche und<br />
Grubenstraße, wobei die historischen Straßenzüge nur teilweise rekonstruiert wur<strong>de</strong>n.<br />
Mit <strong>de</strong>r Langen Straße in <strong>de</strong>r Innenstadt und einem Neubaugebiet in Reutershagen im Stil <strong>de</strong>s sozialistischen Klassizismus wur<strong>de</strong>n ab 1953 die ersten Prestigeprojekte <strong>de</strong>s<br />
Wie<strong>de</strong>raufbaus in Angriff genommen.<br />
Bei <strong>de</strong>r ersten freien Wahl in <strong>de</strong>r Sowjetischen Besat<strong>zu</strong>ngszone, <strong>de</strong>r Kommunalwahl am 15. September 1946, erhielt die SED 48,87 %, die LDPD 27,7 %, die CDU 20,5 % und <strong>de</strong>r<br />
Frauenausschuss 1,98 % <strong>de</strong>r Stimmen. Wie wenig kommunale Selbstverwaltung gegenüber <strong>de</strong>r beherrschen<strong>de</strong>n Stellung <strong>de</strong>r sowjetischen Militäradministration und <strong>de</strong>n<br />
Machtansprüchen <strong>de</strong>r Kommunisten möglich war, zeigt die Verhaftung <strong>de</strong>s Rostocker Oberbürgermeisters Albert Schulz, <strong>de</strong>r zwar <strong>de</strong>r SED angehörte, aber <strong>de</strong>r SPD entstammte und die<br />
Zwangsvereinigung mit <strong>de</strong>r KPD ablehnte. I<strong>de</strong>ologische und ökonomische Repressionen wie die Einrichtung <strong>de</strong>r Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) o<strong>de</strong>r die<br />
beson<strong>de</strong>rs Warnemün<strong>de</strong> treffen<strong>de</strong> Aktion Rose sowie die massenhafte Flucht in <strong>de</strong>n Westen führten <strong>zu</strong> Un<strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>nheit, die auch in Rostock am 17. Juni 1953 in Streiks und<br />
Demonstrationen <strong>de</strong>r Arbeiter mün<strong>de</strong>te.<br />
Seit 1952 war Rostock durch die Verwaltungsreform Bezirksstadt. Die Stadt wur<strong>de</strong> systematisch aufgewertet, etwa mit <strong>de</strong>r ab 1955 ausgerichteten Ostseewoche, die nach <strong>de</strong>r Leipziger<br />
Messe die wichtigste Großveranstaltung <strong>de</strong>r DDR mit internationalem Akzent wur<strong>de</strong>. Um auch im Fußball erstklassig <strong>zu</strong> sein, wur<strong>de</strong> 1954 kurzerhand aus <strong>de</strong>m kleinen sächsischen Ort<br />
Lauter <strong>de</strong>r dortige Erstligaverein an die Warnow <strong>de</strong>legiert und dort <strong>zu</strong>m heutigen Fußballbun<strong>de</strong>sligisten Hansa Rostock.<br />
In <strong>de</strong>n Folgejahren entwickelte sich die Stadt <strong>zu</strong>m Schiffbau- und Schifffahrtszentrum <strong>de</strong>r DDR und erlangte nicht <strong>zu</strong>letzt dadurch eine wachsen<strong>de</strong> Be<strong>de</strong>utung innerhalb <strong>de</strong>r DDR. Neben<br />
<strong>de</strong>n Werften entstan<strong>de</strong>n 1949 das Dieselmotorenwerk, 1950 das spätere Fischkombinat und 1952 die Deutsche Seeree<strong>de</strong>rei Rostock (DSR). Infolge <strong>de</strong>s Krieges und <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen<br />
Teilung verfügte die DDR <strong>zu</strong>nächst über keinen be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Seehafen und musste auf Hamburg und Stettin ausweichen. So entstand zwischen 1957 und 1960 <strong>de</strong>r Überseehafen<br />
Rostock. Auch die Hochschullandschaft folgte <strong>de</strong>r maritimen Ausrichtung: Die Universität eröffnete 1951 einen Fachbereich für Schiffbau, später eine Technische Fakultät. Die<br />
Ingenieurschule für Schiffbautechnik Warnemün<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Seefahrtschule Wustrow <strong>zu</strong>sammengeschlossen.<br />
Der wirtschaftliche Aufschwung ließ viele Zuwan<strong>de</strong>rer nach Rostock strömen. Bis 1988 wuchs die Stadt auf über 250.000 Einwohner an. Auf <strong>de</strong>r grünen Wiese entstan<strong>de</strong>n im<br />
Nordwesten, im Nordosten und im Sü<strong>de</strong>n immer mehr <strong>de</strong>r neuen Stadtteile in industrieller Plattenbauweise. Zuerst baute man auf Arealen, die planerisch bereits in <strong>de</strong>n 1930er Jahren für<br />
<strong>de</strong>n Wohnungsbau vorgesehen waren. In <strong>de</strong>n Jahren von 1959 bis 1965 entstan<strong>de</strong>n so die Ortsteile Reutershagen mit 9.772 Wohnungen und die Südstadt mit 7.917 Wohnungen. Danach<br />
folgte eine Ausweisung von Baugebieten, die nicht mehr direkt an das innere Stadtgebiet angrenzten. Im Nordwesten, zwischen <strong>de</strong>m bebauten Stadtgebiet Rostocks und Warnemün<strong>de</strong>,<br />
entstan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Jahren 1965 bis 1974 die Großwohnsiedlungen Lütten Klein mit 10.631 Wohnungen und Evershagen mit 8.732 Wohnungen), es folgten 1974 bis 1976 Lichtenhagen<br />
mit 6.925 Wohnungen, 1976 bis 1979 Schmarl mit 4.908 Wohnungen und Groß Klein mit 8.200 Wohnungen in <strong>de</strong>n Jahren 1979 bis 1983. Um <strong>de</strong>n Schwerpunkt <strong>de</strong>r Stadtentwicklung<br />
mehr in die Mitte Rostocks <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>führen, wur<strong>de</strong>n die nächsten Gebiete im Nordosten <strong>de</strong>r Stadt geplant. Von 1983 bis 1989 entstan<strong>de</strong>n so die Siedlungen Dierkow mit 7.530<br />
Wohnungen und Toitenwinkel mit 6.549 Wohnungen. Insgesamt wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r industriellen Bauweise 54.000 Wohnungen gebaut, in <strong>de</strong>r mehr als die Hälfte aller Rostocker<br />
lebten. [32] [33]<br />
Jedoch konnte die Entwicklung <strong>de</strong>r Infrastruktur und von Freizeit- und Einkaufsmöglichkeiten kaum mithalten. Außer<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong>n viele Altbauten in <strong>de</strong>r Innenstadt <strong>de</strong>m Verfall<br />
preisgegeben. Die nördliche Altstadt, wo die Kriegsschä<strong>de</strong>n nur dürftig repariert wor<strong>de</strong>n waren, wur<strong>de</strong> Anfang <strong>de</strong>r 1980er Jahre nahe<strong>zu</strong> komplett abgerissen und einige Jahre später<br />
durch Plattenbauten ersetzt. Immerhin wur<strong>de</strong>n dabei Elemente nord<strong>de</strong>utscher Giebelbauweise berücksichtigt.[34]<br />
Un<strong>zu</strong>reichen<strong>de</strong> Investitionen führten, wie vielerorts in <strong>de</strong>r DDR, auch in Rostock <strong>zu</strong> einer sichtbaren Stagnation <strong>de</strong>r Wirtschaft und <strong>zu</strong> Versorgungslücken. Fehlen<strong>de</strong> politische Freiheiten<br />
und Einflussmöglichkeiten ließen die Un<strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>nheit weiter wachsen. Dennoch erreichten die 1989 aufkeimen<strong>de</strong>n Demonstrationen – im Gegensatz <strong>zu</strong>m Sü<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Republik – erst<br />
relativ spät eine größere Öffentlichkeit. Während <strong>de</strong>r Umbruchszeit 1989 waren die Rostocker Kirchen Anlaufstellen oppositioneller Kräfte, die sich in <strong>de</strong>r Marienkirche <strong>zu</strong><br />
Mahngottesdiensten unter <strong>de</strong>r Leitung von Pastor Joachim Gauck versammelten. Die erste Donnerstags<strong>de</strong>monstration fand am 19. Oktober statt. En<strong>de</strong> November wur<strong>de</strong> dann auch in<br />
Rostock ein Run<strong>de</strong>r Tisch gebil<strong>de</strong>t, um aktiv <strong>de</strong>n politischen Umbruch mit<strong>zu</strong>gestalten.
Deutsche Einheit<br />
Mit <strong>de</strong>r politischen Wen<strong>de</strong> 1989 und <strong>de</strong>r Deutschen Wie<strong>de</strong>rvereinigung 1990 erlebte die Stadt wichtige Verän<strong>de</strong>rungen. Am <strong>de</strong>utlichsten war jedoch <strong>zu</strong>nächst ein starker<br />
Bevölkerungsrückgang um ungefähr 50.000 Einwohner, <strong>de</strong>r erst knapp 15 Jahre später <strong>zu</strong>m Stillstand kam. Gleichzeitig verloren viele Menschen, wie in <strong>de</strong>r ganzen Region,<br />
Arbeitsplätze und neue konnten aufgrund fehlen<strong>de</strong>r wirtschaftlicher Strukturen nicht schnell genug entstehen.<br />
Als ein Tiefpunkt dieser Zeit müssen die auslän<strong>de</strong>rfeindlichen Ausschreitungen von Lichtenhagen im August 1992 gewertet wer<strong>de</strong>n, die das Bild <strong>de</strong>r Stadt noch Jahre danach in <strong>de</strong>r<br />
Öffentlichkeit prägten. Eine gesellschaftliche Antwort Rostocks darauf war die Initiative „Bunt statt Braun“.<br />
Seit 1990 wur<strong>de</strong> und wird viel an <strong>de</strong>r Stadt gebaut: Der Historische Stadtkern wur<strong>de</strong> unter an<strong>de</strong>rm aus Mitteln <strong>de</strong>r Städtebauför<strong>de</strong>rung und <strong>de</strong>m Programm <strong>zu</strong>m Städtbaulichen<br />
Denkmalschutz gründlich saniert. Gebäu<strong>de</strong>, die vor <strong>de</strong>m Verfall stan<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong>n gerettet. Die Infrastruktur wur<strong>de</strong> erneuert und als ein wichtiges, sichtbares Zeichen für <strong>de</strong>n Neuanfang<br />
erhielt St. Petri seinen neu errichteten Turmhelm, <strong>de</strong>r mit Städtebauför<strong>de</strong>rungsmitteln, Mitteln <strong>de</strong>r Kirche und aus Spen<strong>de</strong>ngel<strong>de</strong>rn vieler Rostocker Bürger finanziert wor<strong>de</strong>n ist. Ein<br />
behutsamer Umbau und Rückbau in <strong>de</strong>n Plattenbaugebieten (vor allem in <strong>de</strong>n Ortsteilen Dierkow, Toitenwinkel, Evershagen, Groß-Klein und Schmarl) wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>sammen mit<br />
Verbesserungen <strong>de</strong>s Wohnumfelds im Rahmen <strong>de</strong>r Programme „Aufwertung“, „Stadtumbau-Ost“ und „Die Soziale Stadt“ durchgeführt, um unter an<strong>de</strong>rem einem Leerstand von<br />
Wohnungen entgegen<strong>zu</strong>wirken.<br />
Die 1990er Jahre waren von einer wirtschaftlichen Konsolidierung, aber auch von emotionalen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit <strong>de</strong>r Politik <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>s um Kür<strong>zu</strong>ngen <strong>de</strong>r<br />
Finanzierung vor allem im Bildungswesen und in <strong>de</strong>r Kultur geprägt. So war die Universität gezwungen, traditionsreiche Fakultäten <strong>zu</strong> schließen. Die Stadt ist hoch verschul<strong>de</strong>t und<br />
kämpft um ihre Verwaltungsautonomie. Daher wur<strong>de</strong>n einige umfangreiche strukturelle Reformen in <strong>de</strong>r Stadt, aber auch <strong>de</strong>r Verwaltung <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Mecklenburg-Vorpommern<br />
unternommen, die <strong>zu</strong> mehr Effizienz führen sollen. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen.<br />
Eine wichtige Rolle für die stärkere I<strong>de</strong>ntifizierung <strong>de</strong>r Bevölkerung mit ihrer Stadt hat die maritime Großveranstaltung Hanse Sail. Als be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>s Segelrevier wur<strong>de</strong> Warnemün<strong>de</strong><br />
durch die gemeinsame Bewerbung mit Leipzig um die Austragung <strong>de</strong>r Olympischen Sommerspiele 2012 aufgewertet, auch wenn die Kandidatur misslang. 2003 richtete Rostock die<br />
Internationale Gartenschau (IGA) aus.<br />
In <strong>de</strong>n Blickpunkt <strong>de</strong>r internationalen Öffentlichkeit geriet Rostock Anfang Juni 2007 mit <strong>de</strong>m Weltwirtschaftsgipfel <strong>de</strong>r G8 im westlich gelegenen Seebad Heiligendamm. Ein großer<br />
Teil <strong>de</strong>r Begleitveranstaltungen fand in Rostock statt, so <strong>de</strong>r Alternativgipfel und zahlreiche Demonstrationen. Am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Auftakt<strong>de</strong>monstration am 2. Juni kam es <strong>zu</strong><br />
Ausschreitungen radikaler Autonomer <strong>de</strong>s Schwarzen Blocks, bei <strong>de</strong>nen nach offiziellen Angaben rund 1.000 Personen verletzt wur<strong>de</strong>n, vorwiegend durch Steinwürfe und <strong>de</strong>n Einsatz<br />
von Wasserwerfern.[35]<br />
Literatur<br />
• Karsten Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. Eine Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Rostock von ihren Ursprüngen bis <strong>zu</strong>m Jahr 1990. Rostock,<br />
Ingo Koch Verlag, 2003, ISBN 3-929544-68-7<br />
• Lan<strong>de</strong>skundlich-historisches Lexikon Mecklenburg-Vorpommern. Herausgegeben von <strong>de</strong>r Geschichtswerkstatt Rostock e.V.; Redaktion: Thomas Gallien. Rostock, Hinstorff,<br />
2007, ISBN 3-356-01092-1<br />
• Ernst Münch, Ralf Mulsow: Das alte Rostock und seine Straßen. Rostock, Redieck & Scha<strong>de</strong> 2006. ISBN 3-934116-57-4<br />
• Ernst Münch, Wolf Karge, Hartmut Schmied: Die Geschichte Mecklenburgs. Rostock, Hinstorff, 2004, ISBN 3-356-01039-5<br />
• Helge bei <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>n, Ro<strong>de</strong>rich Schmidt: Handbuch <strong>de</strong>r historischen Stätten Deutschlands, Band 12: Mecklenburg, Pommern.Stuttgart, Kröner, 1996, ISBN 978-3-520-31501-4<br />
• Meklenburgisches Urkun<strong>de</strong>nbuch. Herausgegeben von <strong>de</strong>m Verein für Meklenburgische Geschichte und Alterthumskun<strong>de</strong>. 24 Bän<strong>de</strong>. Schwerin u.a. 1863–1913.<br />
(Nachtragsbän<strong>de</strong> 1936 und 1977)<br />
• Walter Kempowski: Deutsche Chronik. Neun Romane, 1971–1984. [In <strong>de</strong>n autobiografisch geprägten Romanen verarbeitete Kempowski die Rostocker Stadtgeschichte <strong>de</strong>s 19.<br />
und vor allem <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts literarisch.]
• Frank Betker: "Einsicht in die Notwendigkeit!". Kommunale Stadtplanung in <strong>de</strong>r DDR und nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> (1945-1994), Beiträge <strong>zu</strong>r Stadtgeschichte und<br />
Urbanisierungsforschung Bd. 3, Stuttgart 2005 (mit Fallstudie Rostock und Halle/Saale). ISBN 3-515-08734-6<br />
Fußnoten<br />
1. ↑ Dieter Warnke: Rostock – Petribleiche. Eine slawische Fürstenburg <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts. In: Archäologie <strong>de</strong>s Mittelalters und Bauforschung im Hanseraum, hrsg. v. Manfred<br />
Gläser. Rostock, Konrad Reich Verlag 1993 (Schriften <strong>de</strong>s Kulturhistorischen Museums in Rostock), S. 155–160.<br />
2. ↑ Dörte Bluhm: Rostock – Meine Stadt. Rostock, WIRO 2005, S. 2ff.<br />
3. ↑ Vgl. Saxo Grammaticus: Gesta Danorum. Mythen und Legen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s berühmten mittelalterlichen Geschichtsschreibers Saxo Grammaticus. Übersetzt, nacherzählt und<br />
kommentiert von Hans-Jürgen Hube. Wiesba<strong>de</strong>n: Marix-Verlag 2004. ISBN 3-937715-41-X. Siehe auch: Gesta Danorum im lateinischen Volltext auf <strong>de</strong>r Homepage <strong>de</strong>r<br />
dänischen Königlichen Bibliothek<br />
4. ↑ A.F.Lorenz wies später darauf hin, es sei unwahrscheinlich, dass es <strong>zu</strong>m Beispiel eine dreifache Erweiterung <strong>de</strong>r Grenze <strong>de</strong>r Mittelstadt gegeben hat und auch, dass Koßfel<strong>de</strong>r-<br />
und Krämerstraße durch die Stadtgrenze geschnitten wur<strong>de</strong>n (Vgl. Zur Geschichte <strong>de</strong>r Rostocker Stadtbefestigung. In: Beiträge <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Rostock, Bd. 20, 1935)<br />
5. ↑ K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 14f.<br />
6. ↑ G. Baier, Die Marienkirche <strong>zu</strong> Rostock. Berlin, Union-Verlag 1988, S. 2.<br />
7. ↑ Ortwin Pelc: Rostock um 1200. Von <strong>de</strong>r slawischen Burg <strong>zu</strong>r <strong>de</strong>utschen Stadt. In: Rostock im Ostseeraum in Mittelalter und früher Neuzeit. Universität Rostock, Fachbereich<br />
Geschichte. Rostock 1994, S. 21. ISBN 3-86009-093-3.<br />
8. ↑ Vgl. Handbuch <strong>de</strong>r historischen Stätten Deutschlands. Mecklenburg, Pommern. S. 99.<br />
9. ↑ Matthias Puhle: Die Vitalienbrü<strong>de</strong>r. Frankfurt a. M./New York, ²1994, S. 36f.<br />
10.↑ Matthias Puhle: Die Vitalienbrü<strong>de</strong>r. Frankfurt a. M./New York, ²1994, S. 52ff.<br />
11.↑ Vgl. u.a.: Schrö<strong>de</strong>r, Karsten: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. Kap.: Eine Universität <strong>de</strong>r Hanse, S. 47f. Rostock: Konrad Reich 2001. ISBN<br />
3-86167-102-6<br />
12.↑ Vgl. Ulpts, Ingo: Die Bettelor<strong>de</strong>n in Mecklenburg (Saxonia Franciscana 6) Werl 1995, 34-43/80-86.<br />
13.↑ K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 80f.<br />
14.↑ K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 81.<br />
15.↑ Kapitulation <strong>de</strong>r Stadt Rostock vor Wallenstein. Rostock 1628.<br />
16.↑ Vgl.: Alexan<strong>de</strong>r Pries: Der schwedische Zoll in Warnemün<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Jahren 1632–1654. Inaugural-Dissertation. Wismar 1914.<br />
17.↑ Zahlen nach K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 94f.<br />
18.↑ Handbuch <strong>de</strong>r historischen Stätten Deutschlands. Mecklenburg, Pommern. S. 102.<br />
19.↑ Angaben nach K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 119f.<br />
20.↑ Neptun-Aktie von 1927<br />
21.↑ Vgl. Einwohnerentwicklung von Rostock (mit Angabe <strong>de</strong>r Quellen).<br />
22.↑ K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 181.<br />
23.↑ K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 190.<br />
24.↑ K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 223f.<br />
25.↑ K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 225.<br />
26.↑ Vgl. Einwohnerentwicklung von Rostock (mit Angabe <strong>de</strong>r Quellen).
27.↑ Angaben nach K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 248.<br />
28.↑ Campaign Diary <strong>de</strong>s Royal Airforce Bomber Command (Auflistung <strong>de</strong>r eingesetzten und verlorenen Flugzeuge sowie Darstellung <strong>de</strong>r geplanten und erreichten Ziele): April<br />
1942 und Mai 1942<br />
29.↑ Angaben nach K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 249.<br />
30.↑ Angaben nach K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 255.<br />
31.↑ K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 255ff.<br />
32.↑ K. Schrö<strong>de</strong>r: In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen. S. 291<br />
33.↑ Zur Organisationen und <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Institutionen <strong>de</strong>r Stadtplanung in Rostock von 1945 bis <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n ersten Jahren nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> vgl. das Fallbeispiel Rostock in: Frank Betker:<br />
"Einsicht in die Notwendigkeit!" Kommunale Stadtplanung in <strong>de</strong>r DDR und nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> (1945-1994), Stuttgart 2005, vor allem die Teile III, IV und V<br />
34.↑ Zur Stadtplanung für die Nördliche Altstadt, <strong>zu</strong>m Bau <strong>de</strong>s Fünfgiebelhauses am Uni-Platz sowie <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Konflikten um die Stadterneuerung in <strong>de</strong>n 80er Jahren in Rostock und<br />
Halle/Saale siehe Frank Betker: "Einsicht in die Notwendigkeit!" Kommunale Stadtplanung in <strong>de</strong>r DDR und nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> (1945-1994), Stuttgart 2005, S. 311-340<br />
35.↑ Fotogalerien: www.xxx, www.xxx<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Universität Rostock<br />
Die Universität Rostock wur<strong>de</strong> 1419 gegrün<strong>de</strong>t. Sie ist die drittälteste Hochschule auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland und die älteste Universität im Ostseeraum. Im<br />
Wintersemester 2009/10 sind etwa 15.138 Stu<strong>de</strong>nten immatrikuliert und 301 Professorenstellen vorhan<strong>de</strong>n. Die Mehrheit <strong>de</strong>r 70 Studiengänge in zehn Fakultäten wird mit Master- und<br />
Bachelorabschlüssen angeboten. Im Jahr 2009 kamen 59,3% <strong>de</strong>r Studieren<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Uni Rostock aus <strong>de</strong>m Bun<strong>de</strong>sland Mecklenburg-Vorpommern.[3]<br />
Geschichte<br />
Entstehung<br />
Die Universität Rostock wur<strong>de</strong> 1419 von <strong>de</strong>n Herzögen Johann IV. und Albrecht V. von Mecklenburg und <strong>de</strong>m Rat <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock als erste Universität in Nord<strong>de</strong>utschland und<br />
<strong>de</strong>m gesamten Ostseeraum gegrün<strong>de</strong>t, <strong>zu</strong>nächst ohne theologische Fakultät, aber mit päpstlicher Bulle (Gründungsurkun<strong>de</strong> von Papst Martin V. vom 13. Februar 1419). Die feierliche<br />
Eröffnung <strong>de</strong>r Universitas Rostochiensis war am 12. November 1419. Wegen häretischer Strömungen blieb die Universität aber bis 1433 ohne die übliche theologische Fakultät.
Anfangs bestand sie daher aus einer juristischen und einer medizinischen Fakultät sowie <strong>de</strong>r Facultas artium (heute die philosophische Fakultät), 1433 kam nunmehr eine theologische<br />
Fakultät hin<strong>zu</strong>.<br />
Frühe Neuzeit<br />
Im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt war die Universität Rostock mit 400 bis 500 Stu<strong>de</strong>nten beson<strong>de</strong>rs aus Holland, Skandinavien und <strong>de</strong>m Baltikum eine <strong>de</strong>r größten Universitäten in Deutschland.<br />
Infolge politischer Wirren musste die Universität auf kirchlichen Druck und unter <strong>de</strong>r Vorgabe eines Interdikts durch das Basler Konzil im Jahre 1437 nach Greifswald umziehen. Dieser<br />
Status dauerte bis 1443 an, obwohl bereits 1440 das Interdikt aufgehoben wor<strong>de</strong>n war. 1487 bis 1488 (nach an<strong>de</strong>ren Aussagen bis 1492) befand sich <strong>de</strong>r Sitz <strong>de</strong>r Universität in <strong>de</strong>r<br />
Hansestadt Lübeck.<br />
Einige Zeit später als die Stadt Rostock wur<strong>de</strong> die Universität 1542 protestantisch. 1760 wur<strong>de</strong> sie in eine rätliche Universität in Rostock und eine fürstliche Universität in Bützow geteilt<br />
und 1789 wie<strong>de</strong>rvereinigt. Humanismus und Luthertum waren bestimmend für die Universität, die in Folge <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges <strong>zu</strong> einer Hochschule für Lan<strong>de</strong>skin<strong>de</strong>r<br />
verkümmerte.<br />
Beim Universitätsjubiläum im Jahre 1600 wur<strong>de</strong> die Theaterkomödie Cornelius Relegatus (lat. “<strong>de</strong>r von <strong>de</strong>r Universität verwiesene Cornelius”), auch „<strong>de</strong>r verbummelte Cornelius“, von<br />
Albert Wichgreve (um 1575-1619) uraufgeführt, die auf satirische Weise die unrühmliche Laufbahn eines gescheiterten Stu<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts schil<strong>de</strong>rt und für lange Zeit die<br />
Ansichten <strong>de</strong>r Öffentlichkeit vom Leben eines Bummelstu<strong>de</strong>nten prägte. Gleichzeitig ist das Stück ein Dokument <strong>de</strong>r aka<strong>de</strong>mischen Sitten und Gebräuche <strong>de</strong>s ausgehen<strong>de</strong>n 16.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rts. Das Stück erzielte einen enormen Publikumserfolg mit außergewöhnlicher Langzeitwirkung.<br />
Eine <strong>de</strong>r wichtigsten Einrichtungen für die Stu<strong>de</strong>nten und Mitarbeiter ist die bereits 1569 gegrün<strong>de</strong>te Universitätsbibliothek, die aus drei Bereichsbibliotheken, 10 Fachbibliotheken, <strong>de</strong>m<br />
Universitätsarchiv, <strong>de</strong>r Kustodie und <strong>de</strong>m Patent- und Normenzentrum besteht. Sie hat heute einen Bestand von rund 2,2 Mio. Bän<strong>de</strong>n. Sie besitzt außer<strong>de</strong>m einen umfangreichen<br />
Altbestand, <strong>de</strong>r auch ca. 2.800 Handschriften und Autographen, 650 Inkunabeln und 14 Nachlässe enthält.<br />
Die Universität Rinteln, die Universität Rostock und die Universität Wittenberg („Leucorea“) waren führen<strong>de</strong> gutachterliche Universitäten während <strong>de</strong>r Hexenprozesse. Die Spruchpraxis<br />
an <strong>de</strong>n allgemeinen <strong>de</strong>utschen juristischen Fakultäten war recht unterschiedlich. Die juristischen Fakultäten <strong>de</strong>r Universitäten Helmstedt („Aca<strong>de</strong>mia Julia“) und Rinteln galten als<br />
„hardliner“ in Sachen Hexenverfolgung.<br />
19. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Nach<strong>de</strong>m die Universität 1827 durch Vertrag von <strong>de</strong>r Stadt auf das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin übergegangen war, wur<strong>de</strong> En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts durch einen großzügigen<br />
Ausbau wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Anschluss an die an<strong>de</strong>ren <strong>de</strong>utschen Universitäten erreicht. Das Hauptgebäu<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> 1866 bis 1870 vom Schweriner Hofbaurat Hermann Willebrand im Stil <strong>de</strong>r<br />
Neorenaissance entworfen.<br />
Die erste aka<strong>de</strong>mische Einrichtung, die sich in Deutschland mit Germanistik befasste, ist das 1858 in Rostock gegrün<strong>de</strong>te „Deutsch-Philologische Seminar“ (heute Institut für<br />
Germanistik).<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Die Universität blieb jedoch zahlenmäßig eine kleine Hochschule mit 1700 Stu<strong>de</strong>nten im Jahre 1930.<br />
Anlässlich <strong>de</strong>r Fünfhun<strong>de</strong>rtjahrfeier <strong>de</strong>r Universität Rostock am 12. November 1919 erhielten Albert Einstein und Max Planck die Ehrendoktorwür<strong>de</strong>. Die Universität ehrte die<br />
"gewaltige Arbeit seines Geistes, durch die er die Begriffe von Raum und Zeit, von Schwerkraft und Materie von Grund aus erneuert hat" und ernannte ihn "ehrenhalber <strong>zu</strong>m Doktor <strong>de</strong>r<br />
Medizin". Da das Physikalische Institut das Kontingent an Ehrenpromotionen <strong>zu</strong>r Fünfhun<strong>de</strong>rtjahrfeier bereits ausgeschöpft hatte, erfolgte die Ehrung durch die Medizinische Fakultät.<br />
Die einzige in Deutschland an Einstein verliehene Ehrendoktorwür<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> ihm auch während <strong>de</strong>r NS-Zeit nicht aberkannt.[4]
Durch die nationalsozialistische Herrschaft ab 1933 verloren mehrere Gelehrte ihre Stellung: David Katz, Hans Moral u.a.<br />
Nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong> die Universität am 24. Februar 1946 wie<strong>de</strong>reröffnet. Bis Juli 1963 hatte die Hochschule auch eine Arbeiter- und Bauernfakultät „Ernst Thälmann“.<br />
Die juristische Fakultät bestand nur von 1946 bis 1951. 1950 wur<strong>de</strong> eine landwirtschaftliche Fakultät eröffnet, 1951 ein Fachbereich für Schiffbau, <strong>de</strong>r ab 1963 Technische Fakultät hieß.<br />
Damit erweiterte sie als erste klassische Universität in Deutschland ihr Profil um eine technische Fakultät. 1952 wur<strong>de</strong> eine Fakultät für Luftfahrtwesen gegrün<strong>de</strong>t, die jedoch ein Jahr<br />
später nach Dres<strong>de</strong>n verlegt wur<strong>de</strong>. 1963 kam noch eine Ingenieurökonomische Fakultät hin<strong>zu</strong>. Für das ab 1951 obligatorische marxistisch-leninistische Grundlagenstudium <strong>de</strong>r<br />
Stu<strong>de</strong>nten aller Fachrichtungen, später auch <strong>de</strong>r wissenschaftlichen Mitarbeiter, gab es ein "Gesellschaftswissenschaftliches Institut", das 1960 in Institut für Marxismus-Leninismus<br />
umbenannt und 1969 <strong>zu</strong>r "Sektion für Marxismus-Leninismus" umstrukturiert wur<strong>de</strong>.<br />
1976 wur<strong>de</strong> die Universität Rostock „Universitas Rostochiensis“ in „Wilhelm-Pieck-Universität“ umbenannt. 1990 wur<strong>de</strong> die Rückbenennung vorgenommen.<br />
Im Jahre 1970 wur<strong>de</strong> das älteste <strong>de</strong>utsche Stu<strong>de</strong>ntenkabarett ROhrSTOCK in Rostock gegrün<strong>de</strong>t, welches bis heute existiert.<br />
Seit 1992 wer<strong>de</strong>n an <strong>de</strong>r Universität Rostock auch aufbauen<strong>de</strong> Fernstudiengänge angeboten. Diese wer<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Umgestaltung im Rahmen <strong>de</strong>s Bologna-Prozesses im<br />
Zentrum für Qualitätssicherung organisiert. Zur Verbesserung von Lehre und Forschung ist die Universität am Verbund Nord<strong>de</strong>utscher Universitäten beteiligt.<br />
Die Universität heute<br />
Forschung<br />
Mit <strong>de</strong>r Gründung einer Interdisziplinären Fakultät im Oktober 2007 will sich die Universität Rostock <strong>zu</strong>künftig in Forschung und Lehre drei interdisziplinären Profillinien <strong>zu</strong>wen<strong>de</strong>n:<br />
Die Profillinie Science and Technology of Life, Light and Matter verbin<strong>de</strong>t Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie Medizin; neue Materialien und <strong>de</strong>ren Interaktion mit Licht spielen<br />
dabei eine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Rolle.<br />
Maritime Systems setzt sich insbeson<strong>de</strong>re mit Küstensystemen auseinan<strong>de</strong>r, die land- und wasserseitig im Mittelpunkt <strong>de</strong>s Interesses stehen. Aspekte <strong>de</strong>r Agrar- und<br />
Umweltwissenschaften sowie <strong>de</strong>r Natur- und Ingenieurwissenschaften wer<strong>de</strong>n darin einfließen.<br />
Aging Science and Humanities beschäftigt sich mit <strong>de</strong>n Themen <strong>de</strong>r älter wer<strong>de</strong>n<strong>de</strong>n Gesellschaft; dabei wer<strong>de</strong>n soziale und medizinische Aspekte sowie biologische Ursachen<br />
untersucht.<br />
Die Interdisziplinäre Fakultät ist zentrale Schnittstelle für die Wissenschaftler aller an<strong>de</strong>ren neun Fakultäten. An ihr sind die Profillinien in sogenannten „Departments“ organisiert sind<br />
und können von <strong>de</strong>n verschie<strong>de</strong>nen fachlichen Zweigen gemeinsam untersucht und bearbeitet wer<strong>de</strong>n.<br />
Studiengänge<br />
Derzeit gibt es an <strong>de</strong>r Rostocker Universität 70 Studienrichtungen. Die Studiengänge Human- und Zahnmedizin, Rechtswissenschaften sowie Lehramt schließen mit <strong>de</strong>m Staatsexamen<br />
ab. Anwärter <strong>de</strong>s Lehramtes können zwischen 20 Unterrichtsfächern für vier verschie<strong>de</strong>ne Schultypen wählen. Die Mehrheit <strong>de</strong>r weiteren Studiengänge wird bereits mit Master- und<br />
Bachelorabschlüssen angeboten. Kontinuierlich sind neue Umstellungen in Planung: Zum Wintersemester 2007/08 wur<strong>de</strong> u. a. <strong>de</strong>r Bachelorstudiengang Mathematik eingeführt, ab 2008<br />
soll <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong> Masterstudiengang folgen. An einigen Fakultäten, beispielsweise <strong>de</strong>r Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Fakultät für Informatik und<br />
Elektrotechnik, sind bereits alle Studiengänge umgestellt. Im Bereich <strong>de</strong>r auf ein internationales Klientel ausgerichteten Studiengänge gibt es <strong>de</strong>rzeit einen englischsprachigen Master-<br />
Studiengang an <strong>de</strong>r Fakultät für Informatik und Elektrotechnik: Computational Engineering.<br />
Daneben bietet die Universität Rostock drei Fernstudiengänge mit Masterabschluss an: Umweltschutz, Umwelt und Bildung sowie Medien und Bildung.<br />
Die Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät verfügt mit ihrem Studiengang Agrarökologie über <strong>de</strong>n ersten <strong>de</strong>utschen Studiengang, welcher auf die Gestaltung, Nut<strong>zu</strong>ng und
Entwicklung <strong>de</strong>s ländlichen Raumes als Ganzes orientiert ist.<br />
An <strong>de</strong>r Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät ist <strong>de</strong>r Studiengang <strong>zu</strong>r Atmosphärenphysik und physikalischer Ozeanographie ein bun<strong>de</strong>sweites Unikat.<br />
Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät bietet einen Studienabschluss in Demographie über ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal: nur in Rostock kann man einen<br />
Diplom- o<strong>de</strong>r Masterabschluss in diesem Fach erlangen. [5]<br />
Weiterbildung<br />
Seit 1991 bietet die Universität Rostock für Berufstätige Weiterbildungsangebote auf Hochschulniveau an. Interessierte können aus einem breiten Angebot praxisnaher Weiterbildung<br />
wählen: von drei berufsbegleiten<strong>de</strong>n Masterstudiengängen bis hin <strong>zu</strong> über 43 mehrmonatigen Weiterbildungskursen mit Zertifikatsabschluss.[6]<br />
Berufsbegleiten<strong>de</strong> Masterstudiengänge:<br />
• Umweltschutz (M.Sc.) – 4 Semester, berufsbegleitend, akkreditiert bis 2011<br />
• Umwelt & Bildung (M.A.) – 4 Semester, berufsbegleitend, akkreditiert bis 2011<br />
• Medien & Bildung (M.A.) – 4 Semester, berufsbegleitend, akkreditiert bis 2011<br />
Zertifikatskurse aus folgen<strong>de</strong>n Wissensbereichen:<br />
• Marketing & Management<br />
• Kommunikation<br />
• Medienbildung<br />
• Umweltbildung<br />
• Umweltschutz<br />
Mediengestütztes Juniorstudium<br />
Die Universität Rostock bietet für Schüler <strong>de</strong>r gymnasialen Oberstufe die Möglichkeit an, ein Frühstudium (Juniorstudium) in unterschiedlichsten Fächern <strong>zu</strong> absolvieren. Während<br />
klassische Ansätze <strong>zu</strong>m Juniorstudium häufig zeitlich mit <strong>de</strong>m Schulunterricht kollidieren, wird für das Angebot <strong>de</strong>r Universität Rostock ein Blen<strong>de</strong>d Learning Konzept (E-Learning)<br />
genutzt.<br />
Die Rolle für die Rostocker Wirtschaft<br />
2006 wur<strong>de</strong>n über 700 Wissenschaftlerstellen aus Drittmitteln für Forschungsprojekte o<strong>de</strong>r Graduiertenkollegs finanziert. Daneben gingen bisher mehrere hun<strong>de</strong>rt<br />
Unternehmensgründungen aus <strong>de</strong>n Fakultäten hervor. In <strong>de</strong>n vergangenen Jahren wur<strong>de</strong>n etwa 90 Erfindungsmeldungen und 19 internationale Patentanmeldungen eingereicht. Die<br />
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften unterstützen in Forschung und Lehre beson<strong>de</strong>rs kleine und mittlere Unternehmen in <strong>de</strong>n Bereichen Tourismus und Logistik. Die bun<strong>de</strong>sweit<br />
einmaligen ökologisch ausgerichteten Agrar- und Umweltwissenschaften fokussieren auf Produktivität und Entwicklungsfähigkeit <strong>de</strong>s ländlichen Raums.<br />
Weitere Angebote<br />
Die Universitätsbibliothek ist die größte Bibliothek Mecklenburg-Vorpommerns. 2007 wur<strong>de</strong> die Mensa bun<strong>de</strong>sweit erneut als zweitbeste ausgezeichnete. Die Hauptmensa wur<strong>de</strong> 1999<br />
neu errichtet. 2003 gewann sie <strong>de</strong>n Mensawettbewerb <strong>de</strong>r Zeitschrift UNICUM[7], 2006 wur<strong>de</strong> sie <strong>zu</strong>m zweiten Mal bun<strong>de</strong>sweit Zweiter[8]. Der mit 150 Kursen vertretene<br />
Hochschulsport wur<strong>de</strong> 2006 in einer Studie <strong>de</strong>s Centrums für Hochschulentwicklung <strong>de</strong>utschlandweit in <strong>de</strong>r Spitzengruppe bewertet.
Fakultäten und Einrichtungen<br />
Heute bieten die zehn Fakultäten <strong>de</strong>r Universität Rostock Mitarbeitern und Stu<strong>de</strong>nten ein breites Fächerspektrum und ermöglichen <strong>de</strong>n Wissenschaftlern gleichzeitig <strong>de</strong>n Zugang <strong>zu</strong><br />
vielen Forschungsthemen:<br />
• Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät<br />
• Fakultät für Informatik und Elektrotechnik<br />
• Fakultät für Maschinenbau und Schiffstechnik<br />
• Juristische Fakultät<br />
• Mathematisch Naturwissenschaftliche Fakultät<br />
• Medizinische Fakultät und Universitätsklinikum<br />
• Philosophische Fakultät<br />
• Theologische Fakultät<br />
• Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät<br />
• Interdisziplinäre Fakultät<br />
Zentrale Einrichtungen:<br />
• Zentrum für Qualitätssicherung in Studium und Weiterbildung (ZQS)<br />
• Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung (ZLB)<br />
Darüber hinaus haben sich in und um Rostock zahlreiche Forschungsinstitute angesie<strong>de</strong>lt, unter an<strong>de</strong>rem:<br />
• Leibniz-Institut für Katalyse (An-Institut)<br />
• Leibniz-Institut für Ostseeforschung in Warnemün<strong>de</strong> (An-Institut)<br />
• Leibniz-Institut für Atmosphärenphysik in Kühlungsborn (An-Institut)<br />
• Forschungsinstitut für die Biologie landwirtschaftlicher Nutztiere in Dummerstorf bei Rostock<br />
• Max-Planck-Institut für <strong>de</strong>mografische Forschung<br />
• Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD)<br />
Partner-Universitäten<br />
Die Universität Rostock kooperiert <strong>de</strong>rzeit mit 52 Hochschulen in 25 Län<strong>de</strong>rn. Ein Schwerpunkt <strong>de</strong>r internationalen Zusammenarbeit ist <strong>de</strong>r Ostseeraum mit <strong>de</strong>n skandinavischen<br />
Län<strong>de</strong>rn, Russland, Polen und <strong>de</strong>n baltischen Staaten. Im Rahmen <strong>de</strong>s Erasmus-Programms kooperiert die Universität Rostock mit 175 Hochschulen in <strong>de</strong>n 27 EU-Län<strong>de</strong>rn, Norwegen,<br />
Liechtenstein, Island und <strong>de</strong>r Türkei. Die Kooperation mit Partnereinrichtungen im Ausland erfolgt sowohl auf <strong>de</strong>r Basis gemeinsamer Forschungsvorhaben, als auch auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r<br />
Lehre. So sind nicht nur <strong>de</strong>r Stu<strong>de</strong>ntenaustausch, Gastlehrtätigkeit, die gemeinsame Betreuung von Diploman<strong>de</strong>n und Doktoran<strong>de</strong>n, von Projektarbeiten und Praktika Bestandteil <strong>de</strong>r<br />
Partnerschaften, son<strong>de</strong>rn auch die Diskussion konzeptioneller und organisatorischer Fragen <strong>de</strong>r Studienreform im Rahmen <strong>de</strong>s Bologna-Prozesses sowie <strong>de</strong>r fachliche Austausch bei <strong>de</strong>r<br />
Lehrplangestaltung und in Vorbereitung <strong>de</strong>r Einführung neuer und <strong>zu</strong>künftig auch gemeinsamer Studiengänge.<br />
Bekannte Persönlichkeiten<br />
• Konrad Gesselen (1409-1459), Astronom, Mathematiker, Pfarrer, lehrte in Rostock und Thorn<br />
• Ulrich von Hutten (1488-1523), Humanist, verfasste 1509 in Rostock sein erstes be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>s Werk (Zwei Bücher Klagelie<strong>de</strong>r gegen Vater und Sohn Lötz)
• Levinus Battus (?-1591), Mediziner<br />
• David Chyträus (1530-1600), Theologe, Bildungspolitiker und Historiker, ab 1561 Professor <strong>de</strong>r Theologie<br />
• Tycho Brahe (1546-1601), Astronom und Astrologe, studierte in Rostock<br />
• Axel Oxenstierna (1583-1654), Schwedischer Kanzler, studierte 1599 in Rostock<br />
• Joachim Jungius (1587-1657), Mathematiker, Physiker und Philosoph, Professor für Mathematik in Rostock von 1624 bis 1628<br />
• Johann Christopher Jauch (1669-1725), Superinten<strong>de</strong>nt <strong>zu</strong> Lüneburg, Dichter barocker Gedichte und Liedtexte<br />
• Oluf Gerhard Tychsen (1734-1815), Orientalist, Mitbegrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r arabischen Paläographie, ab 1789 Oberbibliothekar<br />
• Samuel Gottlieb Vogel (1750-1837) Arzt, Professor für Medizin in Rostock seit 1789, Initiator <strong>de</strong>s ersten <strong>de</strong>utschen Seeba<strong>de</strong>s in Heiligendamm<br />
• Franz Christian Lorenz Karsten (1751-1829), Ökonom und Agrarwissenschaftler<br />
• Heinrich Friedrich Link (1767-1850), Naturwissenschaftler, Professor <strong>de</strong>r Chemie, Zoologie und Botanik von 1792 bis 1811<br />
• Leopold von Plessen (1769-1837), Diplomat, Minister, Geheimeraths- und Regierungspräsi<strong>de</strong>nt (1836) Mecklenburg-Schwerins,[9] be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r Vertreter <strong>de</strong>r Min<strong>de</strong>rmächtigen<br />
auf <strong>de</strong>m Wiener Kongress, Verleihung <strong>de</strong>r jur. Ehrendoktorwür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Universität Rostock anlässlich <strong>de</strong>r 400-Jahr Feier 1819<br />
• Johann Heinrich von Thünen (1783-1850), Wirtschaftswissenschaftler und Sozialreformer, Verleihung <strong>de</strong>r phil. Ehrendoktorwür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Universität Rostock 1830[10]<br />
• Ferdinand Kämmerer (1784–1841) Jurist, ab 1816 or<strong>de</strong>ntlicher Professor<br />
• Carl Friedrich von Both (1789-1875), Jurist und von 1836 bis 1870 Vizekanzler <strong>de</strong>r Universität Rostock<br />
• Fritz Reuter (1810-1874), nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utscher Schriftsteller, Verleihung <strong>de</strong>r Ehrendoktorwür<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Universität Rostock 1863, Aufnahme <strong>de</strong>s Jura-Studiums an <strong>de</strong>r Universität<br />
Rostock 1831<br />
• John Brinckman (1814-1870), nie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utscher Schriftsteller, Jura-Studium an <strong>de</strong>r Universität Rostock 1834 bis 1838<br />
• Heinrich Schliemann (1822-1890), Archäologe, Promotion in Rostock <strong>zu</strong>m Dr. phil. 1869; Namenspatron <strong>de</strong>s Heinrich-Schliemann-Instituts für Altertumswissenschaften in <strong>de</strong>r<br />
Philosophischen Fakultät<br />
• August Zillmer (1831-1893) Versicherungsmathematiker, promovierte an <strong>de</strong>r Universität Rostock<br />
• Rudolf Berlin (1833-97), Mediziner, Professor für Augenheilkun<strong>de</strong>, Dekan und Rektor<br />
• Hermann Roesler (1834-1894) Ökonom und Jurist, 1861-1878 Professor für Staatswissenschaft, anschließend Berater <strong>de</strong>r japanischen Regierung bei <strong>de</strong>r Reform <strong>de</strong>s<br />
Rechtssystems nach europäischen Vorbil<strong>de</strong>rn<br />
• Adolf von Wilbrandt (1837-1911), <strong>de</strong>utscher Schriftsteller und Direktor <strong>de</strong>s Wiener Burgtheaters (1881-1887).<br />
• Albrecht Kossel (1853-1927), Mediziner und Physiologe, promovierte 1878 an <strong>de</strong>r Universität Rostock, späterer Nobelpreisträger für Physiologie o<strong>de</strong>r Medizin (1910)<br />
• Oscar Langendorff (1853-1908), Physiologe, or<strong>de</strong>ntlicher Professor und Direktor <strong>de</strong>s Physiologischen Instituts von 1892 bis 1908<br />
• Eugen Geinitz (1854-1925), Geologe und Mineraloge, Professor für Mineralogie und Geologie und Direktor <strong>de</strong>s Mineralogisch-geologischen Institutes<br />
• Richard Wossidlo (1859-1939), Ethnologe, Studium <strong>de</strong>r Klassischen Philologie an <strong>de</strong>r Universität Rostock<br />
• Rudolf Steiner (1861-1925), Begrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Anthroposophie, Promotion <strong>zu</strong>m Dr. phil. in Rostock 1891<br />
• Felix Genzmer (1878-1959), Jurist und Skandinavist, Übersetzer <strong>de</strong>r Lie<strong>de</strong>r-Edda, or<strong>de</strong>ntlicher Professor für Öffentliches Recht von 1920 bis 1922<br />
• Gustav Mie (1868-1957), Physiker, Physik-Studium an <strong>de</strong>r Universität Rostock 1886 bis 1889<br />
• Moritz Schlick (1882-1936), Philosoph, Habilitation 1911, Dozententätigkeit von 1911 bis 1921, später Initiator <strong>de</strong>s Wiener Kreises; Moritz-Schlick-Forschungsstelle am Institut<br />
für Philosophie in <strong>de</strong>r Philosophischen Fakultät<br />
• Viktor Schilling (1883-1960), Arzt, Mitbegrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Hämatologie, Klinikleiter <strong>de</strong>s Universitätsklinikums<br />
• David Katz (1884-1953), Psychologe, 1919-1933 erst ao., dann o. Professor, wegen seiner jüdischen Herkunft von <strong>de</strong>n Nationalsozialisten in <strong>de</strong>n Ruhestand versetzt; gemeinsam<br />
mit seiner Frau Namenspatron <strong>de</strong>s Instituts für Pädagogische Psychologie Rosa und David Katz in <strong>de</strong>r Philosophischen Fakultät<br />
• Hans Moral (1885-1933), ab 1920 erst außeror<strong>de</strong>ntlicher, dann or<strong>de</strong>ntlicher Professor <strong>de</strong>r Zahnmedizin von internationaler Be<strong>de</strong>utung, nahm sich nach <strong>de</strong>r Entlassung auf Grund
seiner jüdischen Abstammung das Leben; Ge<strong>de</strong>nktafel im Foyer <strong>de</strong>s Hauptgebäu<strong>de</strong>s<br />
• Karl von Frisch (1886-1980), Zoologe, späterer Nobelpreisträger für Physiologie o<strong>de</strong>r Medizin (1973), ord. Professor für Zoologie von 1921 bis 1923<br />
• Otto Stern (1888-1969), Physiker, Professor für Experimentalphysik von 1921 bis 1923, Nobelpreis für Physik 1943<br />
• Erich Kästner (1899-1974), Schriftsteller, Germanistik-Studium an <strong>de</strong>r Universität Rostock 1921<br />
• Kurt von Fritz (1900–1985), klassischer Philologe, Professor für Gräzistik von 1933 bis 1935<br />
• Walter Hallstein (1901-1982), Politiker und Jurist, Professor für Privat- und Gesellschaftsrecht von 1930 bis 1941, später Staatssekretär im Bun<strong>de</strong>skanzleramt und im<br />
Auswärtigen Amt sowie Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r Kommission <strong>de</strong>r Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft<br />
• Pascual Jordan (1902-1980), Physiker, Mitbegrün<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Quantenmechanik, außeror<strong>de</strong>ntlicher, später or<strong>de</strong>ntlicher Professor für Physik von 1929 bis 1944<br />
• Eugen Gerstenmaier (1906-1986), ev. Theologe und Politiker, Mitglied <strong>de</strong>s Kreisauer Kreises, später Präsi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>s Deutschen Bun<strong>de</strong>stages, Promotion an <strong>de</strong>r Theologischen<br />
Fakultät 1935<br />
• Fritz Mertsch (1906-1971), Statistiker, studierte und promovierte <strong>zu</strong>m Dr. rer. pol.<br />
• Ernst Augustin (*1927), Schriftsteller, Medizin-Studium an <strong>de</strong>r Universität Rostock 1947 bis 1950<br />
• Arno Esch (1928-1951), Stu<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>r Rechtswissenschaft, aktives Mitglied <strong>de</strong>r LDP, als erklärter Gegner <strong>de</strong>s Kommunismus <strong>zu</strong>m To<strong>de</strong> verurteilt; Ge<strong>de</strong>nktafel im Foyer <strong>de</strong>s<br />
Hauptgebäu<strong>de</strong>s<br />
• Walter Kempowski (1929-2007), Schriftsteller, Honorarprofessor für Neuere Literatur- und Kulturgeschichte (nach 2003)<br />
• Heino Falcke (*1929), ev. Theologe, als Propst von Erfurt profilierter kritischer Kirchenvertreter in <strong>de</strong>r DDR; Promotion und Habilitation an <strong>de</strong>r Theologischen Fakultät<br />
• Hans Apel (*1932), Politiker, ehem. Bun<strong>de</strong>sminister <strong>de</strong>r Finanzen, später <strong>de</strong>r Verteidigung, seit 1993 Honorarprofessor für Finanzpolitik an <strong>de</strong>r Wirtschafts- und<br />
Sozialwissenschaftlichen Fakultät<br />
• Uwe Johnson (1934-1984), Schriftsteller, Germanistik-Studium an <strong>de</strong>r Universität Rostock 1952 bis 1956<br />
• Joachim Gauck (*1940), Pfarrer, ehem. Bun<strong>de</strong>sbeauftragter für die Unterlagen <strong>de</strong>s Staatssicherheitsdienstes <strong>de</strong>r DDR, Theologiestudium in Rostock, Ehrendoktor <strong>de</strong>r<br />
Theologischen Fakultät<br />
• Rainer Ortleb (*1944), Informatiker und Politiker, 1984 Dozent, ab 1989 Professor für Informationsverarbeitungssysteme, 1991-1994 Bun<strong>de</strong>sminister für Bildung und<br />
Wissenschaft<br />
Literatur<br />
• Beiträge <strong>zu</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Wilhelm-Pieck-Universität Rostock Rostock 1981ff.<br />
• Geschichtliche Bibliographie von Mecklenburg von W. Heeß, Rostock 1944<br />
• Die Universität Rostock im 15. und 16. Jh. von Otto Krabbe, Rostock 1854, Nachdruck Aalen 1970<br />
• Die Matrikel <strong>de</strong>r Universität Rostock 1419-1789 von Ernst Schäfer, Adolph Hofmeister (Hrsg.), 7 B<strong>de</strong>, Rostock 1889-1922<br />
• Die Fünfhun<strong>de</strong>rtjahrfeier <strong>de</strong>r Universität Rostock 1419-1919 von Gustav Herbig und Hermann Reincke-Bloch, Rostock 1920<br />
• Geschichte <strong>de</strong>r Universität Rostock 1419-1969 (Festschrift <strong>zu</strong>r Fünfhun<strong>de</strong>rtfünfzig-Jahr-Feier), 2 B<strong>de</strong>., Rostock 1969<br />
• Universität Rostock von Paul Kretschmann, Köln-Wien 1969<br />
• Mögen viele Lehrmeinungen um die eine Wahrheit ringen. 575 Jahre Universität Rostock. Rostock 1994.<br />
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Personal an Hochschulen in MV 2008, Seite 6 (PDF)<br />
2. ↑ UniRostock in Zahlen (PDF)
3. ↑ Zahlen und Fakten <strong>de</strong>r Uni Rostock (2009)<br />
4. ↑ Rostock erinnert an Albert Einsteins Ehrendoktor - Die Welt<br />
5. ↑ Universität Rostock - Hochschulinformationsportal Mecklenburg-Vorpommern<br />
6. ↑ Weiterbildungsprogramm - Universität Rostock<br />
7. ↑ Die besten Mensen 2003 - xxx<br />
8. ↑ Die besten Mensen 2006 - xxx<br />
9. ↑ A. Bartsch "Jahresbericht <strong>de</strong>s Vereins für meklenburgische Geschichte und Alterthumskun<strong>de</strong>", Schwerin 1836, Seite 59,<br />
10.↑ Thünengesellschaft e. V.<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Rostocker Stadtbrand von 1677<br />
Der Rostocker Stadtbrand o<strong>de</strong>r auch Große Stadtbrand <strong>de</strong>s Jahres 1677 war eine Feuerkatastrophe, durch welche rund ein Drittel <strong>de</strong>r mittelalterlichen Bausubstanz insbeson<strong>de</strong>re im<br />
Osten und Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s historischen Stadtkerns <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock vernichtet wur<strong>de</strong>. Dieser Stadtbrand war neben <strong>de</strong>n britischen Luftangriffen En<strong>de</strong> April 1942 eine <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n<br />
Katastrophen <strong>de</strong>r Rostocker Stadtgeschichte, die das ursprüngliche Stadtbild Rostocks als spätmittelalterlicher Kaufmannstadt für immer verän<strong>de</strong>rten.<br />
Verlauf<br />
Stadtbrän<strong>de</strong> traten in <strong>de</strong>r Gründungsphase <strong>de</strong>r Stadt im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt, also <strong>de</strong>r <strong>zu</strong>nächst nacheinan<strong>de</strong>r und unabhängig voneinan<strong>de</strong>r verlaufen<strong>de</strong>n Entwicklung <strong>de</strong>r drei Teilstädte Alt-,<br />
Mittel- und Neustadt, gehäuft auf, da die ersten Häuser reetge<strong>de</strong>ckte Holzbauten waren. Als viele Nachfolgebauten aus Stein ausgeführt wur<strong>de</strong>n, sank das Feuerrisiko. Dennoch bestand<br />
im mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Rostock stets eine große Brandgefahr. Grün<strong>de</strong> dafür waren die enge Bebauung und die schmalen Gassen, da die Stadtmauer Grenzen <strong>de</strong>r<br />
Besiedlung gesetzt hatte. Ferner befan<strong>de</strong>n sich in <strong>de</strong>n Speichern und Lagern <strong>de</strong>r Stadt große Mengen brennbarer Waren, <strong>zu</strong>m Beispiel Getrei<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r Holz. Außer<strong>de</strong>m mussten zahlreiche<br />
Gewerbe wie die Schmie<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r die Backhäuser mit Feuer hantieren. Daher hatte bereits die Feuerordnung als Teil <strong>de</strong>r Rostocker Polizeiordnung vom April 1576, neben Angehörigen<br />
an<strong>de</strong>rer Gewerbe, insbeson<strong>de</strong>re <strong>de</strong>n Bäckern eingeschärft, morgens und abends auf Feuer und Licht sorgfältig <strong>zu</strong> achten.<br />
Am Sonnabend <strong>de</strong>m 11. August 1677 brach bei <strong>de</strong>m Bäcker Joachim Schulze in <strong>de</strong>r Altschmie<strong>de</strong>straße, Ecke Große Goldstraße, ein Feuer aus, das schnell auf die Nachbargebäu<strong>de</strong><br />
übergriff. Geför<strong>de</strong>rt durch einen trocken-heißen Südostwind breitete sich das Feuer in Nordwestrichtung aus, sodass bald nahe<strong>zu</strong> das gesamte Stadtgebiet zwischen Petri- und<br />
Nikolaikirche in Flammen stand. Die bei<strong>de</strong>n Gotteshäuser wur<strong>de</strong>n zwar von <strong>de</strong>m Inferno verschont, die Klosterkirche <strong>de</strong>s ehemaligen Katharinenklosters hingegen wur<strong>de</strong> zerstört.
Da die Altstadt, das Gebiet zwischen <strong>de</strong>r Grube, <strong>de</strong>r heutigen Grubenstraße und <strong>de</strong>r östlichen Stadtmauer, allseits von Wasser umgeben war, hoffte man, dass sich das Feuer auf dieses<br />
Stadtgebiet beschränken wür<strong>de</strong>. Allerdings griff es über die Brücken, die die Grube überspannten, auf die nördliche Mittelstadt über. Dort wur<strong>de</strong>n das Stadtgebiet nördlich <strong>de</strong>s<br />
Vogelsangs und östlich <strong>de</strong>s Rathauses schwer verwüstet.<br />
Das Feuer konnte erst am Folgetag, <strong>de</strong>m 12. August, unter Kontrolle gebracht und so die Gefahr für Marienkirche und Rathaus abgewen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n. Einsetzen<strong>de</strong>r Regen half, die letzten<br />
Brandnester <strong>zu</strong> löschen. Bis dahin hatte sich <strong>de</strong>r Brand bis <strong>zu</strong>m Wokrentertor ausbreiten können.<br />
Die Kun<strong>de</strong> über <strong>de</strong>n Brand hat sich in ganz Europa verbreitet.<br />
Schä<strong>de</strong>n<br />
Von 2000 registrierten Häusern gingen durch das Feuer ca. 700 verloren, <strong>de</strong>r größte Teil in <strong>de</strong>r Alt- und nördlichen Mittelstadt. Hin<strong>zu</strong> kam eine große Anzahl von Wohnkellern, welche<br />
<strong>de</strong>n ärmeren Stadtbewohnern, insbeson<strong>de</strong>re in <strong>de</strong>r weniger begüterten Altstadt, als Obdach dienten. In <strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Stadthafen führen<strong>de</strong>n Straßen <strong>de</strong>r nördlichen Mittelstadt wur<strong>de</strong>n<br />
wertvolle gotische Giebelhäuser, die <strong>zu</strong>meist als Brauhäuser dienten, vernichtet. Dadurch wur<strong>de</strong> auch das Brauwesen, welches ein Rückgrat <strong>de</strong>r Rostocker Wirtschaft darstellte, schwer<br />
getroffen.<br />
Einordnung in die Stadtgeschichte<br />
Der Große Stadtbrand markiert das endgültige En<strong>de</strong> Rostocks als selbstbewusste Kaufmannstadt im Verbund <strong>de</strong>r Hanse, <strong>de</strong>ren letzter Hansetag 1669 in Lübeck stattfand. Der Stadtbrand<br />
war das offensichtliche Zeichen <strong>de</strong>s Nie<strong>de</strong>rgangs <strong>de</strong>r Stadt, welcher durch <strong>de</strong>n Be<strong>de</strong>utungsverlust als Han<strong>de</strong>lsplatz und die Wirren <strong>de</strong>s Dreißigjährigen Krieges eintrat. Zu<strong>de</strong>m geriet die<br />
Stadt mehr und mehr unter die Kontrolle <strong>de</strong>r mecklenburgischen Lan<strong>de</strong>sherrschaft und <strong>de</strong>s Königreichs Schwe<strong>de</strong>n. Die Bevölkerung sank von 15.000 Menschen im Jahr 1600 auf nur<br />
noch 5.000. Wegen <strong>de</strong>s allgemeinen wirtschaftlichen Nie<strong>de</strong>rgangs wur<strong>de</strong>n die brachliegen<strong>de</strong>n Grundstücke erst in einem sehr langen Zeitraum, teilweise bis <strong>zu</strong> 100 Jahre, wie<strong>de</strong>r mit<br />
Häusern bebaut, nunmehr im Stil <strong>de</strong>s Barock. Wegen dieses Stadtbran<strong>de</strong>s und <strong>de</strong>r noch verheeren<strong>de</strong>ren Bombenangriffe im Zweiten Weltkrieg hat sich in Rostock, verglichen mit<br />
Lübeck, Wismar o<strong>de</strong>r Stralsund, nur relativ wenig mittelalterliche Bausubstanz erhalten.<br />
Literatur<br />
• Hans Bernitt: Zur Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Rostock, Hinstorff Verlag Rostock 1956, Nachdruck 2001 ISBN 3-935171-40-4<br />
• Karsten Schrö<strong>de</strong>r (Hrsg.): In <strong>de</strong>inen Mauern herrsche Eintracht und allgemeines Wohlergehen, Ingo Koch Verlag, Rostock 2003 ISBN 3-929544-68-7<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Rostocker Wappen<br />
Die Hansestadt Rostock hatte in seiner Geschichte je drei verschie<strong>de</strong>ne Wappen. Das heutige Wappen stammt als Siegel aus <strong>de</strong>m Jahr 1367. Das Wappen in seiner heutigen Form wur<strong>de</strong><br />
allerdings erst am 10. April 1858 durch Großherzog Friedrich Franz II. ein<strong>de</strong>utig festgelegt. Bis <strong>zu</strong> <strong>de</strong>m Zeitpunkt hatten lange verschie<strong>de</strong>ne Wappen, welche von <strong>de</strong>n Siegeln entlehnt<br />
wor<strong>de</strong>n waren, miteinan<strong>de</strong>r konkurriert.
Sigillum, Signum, Secretum<br />
Rostock führte in seiner Geschichte drei Wappen: Das Sigillum, das Signum und das Secretum. Ersteres war seit 1257 das Stadtsiegel Rostocks und zeigt einen gekrönten Stierkopf,<br />
später das Wappen Mecklenburgs. Das Secretum, das Wappen, welches nur <strong>de</strong>n Greifen zeigt, ist erstmals 1307 belegt. Diesen Namen hat es aufgrund seiner sicheren Aufbewahrung.<br />
Das heute gültige Wappen,[1] das Signum, ist 1367 als Siegelstempel entstan<strong>de</strong>n.[2]<br />
Rostock hatte sich <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Zeit gegen Übergriffe <strong>de</strong>s dänischen Königs Wal<strong>de</strong>mar IV. Atterdag und <strong>de</strong>m mit ihm verbün<strong>de</strong>ten König Norwegens <strong>zu</strong> wehren. Nach<strong>de</strong>m am 19. November<br />
1367 die Kölner Konfö<strong>de</strong>ration und damit auch ein Kriegsbündnis begrün<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>, musste die Finanzierung <strong>de</strong>s Krieges gesichert wer<strong>de</strong>n. Die Konfö<strong>de</strong>rierten einigten sich auf ein<br />
Pfundgeld, eine Steuer also auf die Schiffe und <strong>de</strong>ren Waren. Um diese Hafenabgabe <strong>zu</strong> quittieren, schufen die Rostocker jenes Siegel. In <strong>de</strong>m Krieg im folgen<strong>de</strong>n Jahr wur<strong>de</strong> Dänemark<br />
vernichtend geschlagen.<br />
Die Gestaltung <strong>de</strong>s Wappens ist eine Zusammenführung zweier einst eigenständigen heraldischen Symbole. Rot und Silber im Rostocker Wappen sind die Farben <strong>de</strong>r Hanse. Der gol<strong>de</strong>ne<br />
Greif auf blauem Grund stammt von <strong>de</strong>m Wappen <strong>de</strong>r Fürsten über <strong>de</strong>m Land Rostock. Noch heute fin<strong>de</strong>t er sich darum in dieser Form in <strong>de</strong>n Wappen einiger Städte <strong>de</strong>r Region, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r<br />
heute <strong>de</strong>r Landkreis Bad Doberan und Teile <strong>de</strong>s Landkreises Nordvorpommern gehören und die von <strong>de</strong>n Rostocker Fürsten früh auch als das Rostocker Land bezeichnet wur<strong>de</strong>n.<br />
Das Signum fin<strong>de</strong>t sich in verschie<strong>de</strong>nen Formen. So <strong>zu</strong>m Beispiel gleich in einer Quelle in drei Varianten, nämlich <strong>de</strong>r Vicke-Schorler-Rolle. Ein Wappen ohne Greif, also nur <strong>de</strong>r<br />
Teilung in rot-weiß-blau (als großes Wappen neben Sigillum und Secretum), dann einer Version, welche <strong>de</strong>r heute bekannten gleicht (auf <strong>de</strong>m Rathaus) und letztlich einer dritten, sehr<br />
unüblichen, auf seiner Darstellung <strong>de</strong>s Steintors, in <strong>de</strong>r rot und weiß nicht horizontal, son<strong>de</strong>rn vertikal angeordnet sind. Die Gestaltung <strong>de</strong>s Signums erinnert außer<strong>de</strong>m an die Aufteilung<br />
<strong>de</strong>r Rostocker Hanseflagge, welche die Han<strong>de</strong>lsschiffe <strong>de</strong>r Stadt führen durften.<br />
Der Rostocker Greif<br />
Der Greif diente seit <strong>de</strong>m als mythisches Schutztier <strong>de</strong>r Stadt. Eine Verwandtschaft mit <strong>de</strong>m roten Pommerngreif ist nicht belegt. Er geht, wie erwähnt, auf das Wappentier <strong>de</strong>r Fürsten<br />
von Rostock <strong>zu</strong>rück und fin<strong>de</strong>t sich in verschie<strong>de</strong>nen Darstellungen. Ist er allein auf <strong>de</strong>m Wappen, wie viele Gebäu<strong>de</strong> ihn wie<strong>de</strong>rgeben, üblicherweise aufgerichtet und steigend, auf<br />
einem o<strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Hinterbeinen stehend. Auf <strong>de</strong>m Signum über rot und weiß aus gestalterischen Grün<strong>de</strong>n auf drei o<strong>de</strong>r vier Beinen stehend. Die ausgestreckten Krallen sind symbolisch<br />
<strong>zu</strong> <strong>de</strong>uten als Drohgeste, bzw. Wehrhaftigkeit. Auf Gebäu<strong>de</strong>n ist <strong>de</strong>r Rostocker Greif außer<strong>de</strong>m als Schildträger <strong>zu</strong> sehen.<br />
Anmerkungen<br />
1. ↑ Die Beschreibung <strong>de</strong>s offiziellen Wappens fin<strong>de</strong>t sich in <strong>de</strong>r Hauptsat<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock in Art. 1 Abs. 2, worin es heißt: »Das Stadtwappen ist ein geteilter Schild;<br />
oben in Blau ein schreiten<strong>de</strong>r gol<strong>de</strong>ner Greif mit aufgeworfenem Schweif und ausgeschlagener roter Zunge; unten von Silber über Rot geteilt«. Quelle: rostock.<strong>de</strong><br />
2. ↑ Abb. von 1598 mit <strong>de</strong>n drei Wappen auch hier und hier, außer<strong>de</strong>m auf <strong>de</strong>r Schorler-Rolle<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.
Rostocker Flaggen<br />
Die Hansestadt Rostock hatte in ihrer Geschichte drei verschie<strong>de</strong>ne offizielle Stadtflaggen. Die heutige Flagge aus <strong>de</strong>m Jahr 1936 ist eine Nachahmung <strong>de</strong>s Wappenmotivs. Darüber<br />
hinaus führte es <strong>zu</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Hanse auch ein eigenes (rot-weiß-rotes) Hansebanner auf seinen Schiffen.<br />
In ihrer heutigen Gestalt als Entsprechung <strong>de</strong>s Rostocker Wappens wur<strong>de</strong> die Rostocker Stadtflagge erst 1936 eingeführt und 1946 nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg, sowie 1991 nach <strong>de</strong>r<br />
Deutschen Wie<strong>de</strong>rvereinigung, bestätigt.<br />
Die Geschichte <strong>de</strong>r Rostocker Flagge<br />
Obgleich Rostock we<strong>de</strong>r freie Reichsstadt, noch von Mecklenburg unabhängig war, führten die Han<strong>de</strong>lsschiffe <strong>de</strong>r Stadt spätestens seit <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Hanse eine eigene Flagge. Dieses<br />
Recht ging vermutlich einher mit <strong>de</strong>m Privileg <strong>de</strong>s freien Zugangs <strong>zu</strong>r See, welches bei <strong>de</strong>n Fürsten erwirkt wer<strong>de</strong>n konnte.<br />
Der erste erhaltene Beleg für eine eigene Rostocker Flagge geht <strong>zu</strong>rück auf das Jahr 1418. Auf <strong>de</strong>r Website <strong>de</strong>r Hansestadt wird erläutert: „Damals wur<strong>de</strong>n Ausgaben für 44 Ellen roter,<br />
blauer und weißer Leinwand <strong>zu</strong>r Herstellung einer Flagge für eine Snike, ein hansisches Han<strong>de</strong>lsschiff, bei <strong>de</strong>n Pfundzollherren abgerechnet.“[1] Die Gestalt dieser Flagge, also vor<br />
allem die Folge <strong>de</strong>r Farben, so wird vermutet, geschah in Anlehnung an das Rostocker Wappen. Daher ist interessant, dass gera<strong>de</strong> für das Symbol <strong>de</strong>r Rostocker Schiffe die gleiche<br />
Gewichtung <strong>de</strong>s hanseatischen und <strong>de</strong>s fürstlichen Teils in <strong>de</strong>r Breite <strong>de</strong>r Streifen wohl aufgegeben wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>gunsten gleichbreiter Streifen, Rot-Silber damit also noch immer unter <strong>de</strong>m<br />
fürstlichen Blau, doch in seinem Gewicht selbstbewusst darüber stand.<br />
Unwahrscheinlich ist darüber hinaus, dass Rostock eine eigene Flagge vor <strong>de</strong>m Jahr 1323 führte, als es Warnemün<strong>de</strong> erwarb und sich so erst <strong>de</strong>n Zugang <strong>zu</strong>r Ostsee dauerhaft sicherte.<br />
Die Rostocker Tricolore wird in <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts auch <strong>zu</strong>r Seeflagge Mecklenburgs. Schon vorher nutzte auch Bad Doberan sie als seine Stadtflagge.<br />
Spätestens 1737 erscheint eine neue Flagge in Rostock mit einem roten Greifen, steigend o<strong>de</strong>r schreitend, auf gelbem Grund. Berichtet wird aber auch von einem weißen Greifen auf<br />
rotem Grund. 1803 beschließt <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt diese in <strong>de</strong>r Variante <strong>de</strong>s schwarzen Greifen auf gelbem Grund <strong>zu</strong>r Flagge <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> machen. Es heißt, um die Verwechselung mit<br />
französischen Schiffen Napoleons <strong>zu</strong> vermei<strong>de</strong>n, die in dieser Zeit von <strong>de</strong>ssen Gegnern gejagt wor<strong>de</strong>n sind.<br />
In Kombination mit <strong>de</strong>r neuen Stadtflagge wird die Mecklenburgische Seeflagge dann um 1834 von Rostocker Schiffen benutzt.<br />
Rostocker Flaggen heute<br />
Erhalten hat sich die gol<strong>de</strong>ne Flagge mit schwarzem Greifen nur in <strong>de</strong>n Vereinsstan<strong>de</strong>rn einiger Segelclubs Rostocks. Zu nennen sind da <strong>de</strong>r Mecklenburgische Yachtclub e. V.,[2] <strong>de</strong>r<br />
Rostocker Yachtclub e. V.,[3] sowie <strong>de</strong>r Aka<strong>de</strong>mische Segler-Verein <strong>zu</strong> Rostock e. V.[4]<br />
Die alte Rostocker Tricolore fin<strong>de</strong>t sich als Zitat wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>r Flagge <strong>de</strong>r Hanse Sail.<br />
Obwohl das Wappen in <strong>de</strong>r ganzen Stadt präsent ist, ist die eigentliche Stadtflagge dort kaum <strong>zu</strong> fin<strong>de</strong>n – lediglich vor einigen Hotels, an manchen Schiffen und in Kleingärten. Auch das<br />
Rathaus flaggt nicht mit ihr.<br />
Flaggen im Sport<br />
Literatur<br />
• Znamierowski, Alfred: Flaggen-Enzyklopädie: Nationalflaggen, Banner, Standarten. Bielefeld 2001. ISBN 3768812510, S. 13, 19, 21.<br />
Einzelnachweise
1. ↑ Wappen, Flagge und Logo; auf <strong>de</strong>r Webseite <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock<br />
2. ↑ xxx.<strong>de</strong> – Mecklenburgischer Yachtclub e. V.<br />
3. ↑ xxx.<strong>de</strong> – Rostocker Yachtclub e. V.<br />
4. ↑ xxx.<strong>de</strong> – Aka<strong>de</strong>mischer Segler-Verein <strong>zu</strong> Rostock e. V.<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Hafen Rostock<br />
Der Hafen Rostock (international auch Rostock Port) ist einer <strong>de</strong>r größten <strong>de</strong>utschen Häfen an <strong>de</strong>r Ostsee, er liegt an <strong>de</strong>r Unterwarnow auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Stadt Rostock. Eigentümer <strong>de</strong>r<br />
Hafeninfrastruktur ist die Hafen-Entwicklungsgesellschaft Rostock mbH, ein Gemeinschaftsunternehmen <strong>de</strong>s Bun<strong>de</strong>slan<strong>de</strong>s Mecklenburg-Vorpommern und <strong>de</strong>r Hansestadt Rostock. Der<br />
Hafenbetrieb wird durch die Seehafen Rostock Umschlagsgesellschaft mbH, die sich in privatem Besitz befin<strong>de</strong>t, und weitere Unternehmen durchgeführt.<br />
Zum Hafen Rostock gehören <strong>de</strong>r Überseehafen und <strong>de</strong>r Kreuzfahrthafen in Warnemün<strong>de</strong>.<br />
Hafenanlagen<br />
Am Ostufer <strong>de</strong>r Unterwarnow und am Südufer <strong>de</strong>s Breitlings befin<strong>de</strong>n sich die ausge<strong>de</strong>hnten Anlagen <strong>de</strong>s Rostocker Überseehafens. Der Hafen verfügt über drei Hafenbecken, die<br />
Warnowpier mit <strong>de</strong>m Fährterminal, von <strong>de</strong>m Fährschiffe nach Dänemark (Gedser), Schwe<strong>de</strong>n (Trelleborg), Finnland (Helsinki; Hanko), Estland (Tallinn) und Lettland (Ventspils)<br />
verkehren und einen Ölsteg für Tankschiffe. Insgesamt stehen 47 Liegeplätze unterschiedlicher Abmessungen <strong>zu</strong>r Verfügung. Hier können Schiffe mit bis <strong>zu</strong> 250 m Länge, 40 m Breite<br />
und 13,0 m Tiefgang anlegen. Es gibt einen eigenen Hafenbahnhof und einen direkten Autobahnanschluss an die A 19. Mit <strong>de</strong>r PCK Raffinerie in Schwedt und <strong>de</strong>m mittel<strong>de</strong>utschen<br />
Chemiestandort Böhlen ist <strong>de</strong>r Hafen durch Pipelines verbun<strong>de</strong>n.<br />
Am Neuen Strom / Seekanal in Warnemün<strong>de</strong> befin<strong>de</strong>t sich <strong>de</strong>r Passagierkai mit <strong>de</strong>m Kreuzfahrthafen Warnemün<strong>de</strong> Cruise Port. Dieser Hafen bietet acht Liegeplätze unterschiedlicher<br />
Größe und kann von Kreuzfahrtschiffen bis <strong>zu</strong> einer Länge von 355 m und einem Tiefgang von 8,53 m angelaufen wer<strong>de</strong>n.<br />
Der Stadthafen, <strong>de</strong>r in früheren Jahrhun<strong>de</strong>rten <strong>de</strong>r Haupthafen Rostocks war, spielt heute für <strong>de</strong>n Hafenumschlag keine Rolle mehr, er wird hauptsächlich von Ausflugsschiffen, <strong>de</strong>r<br />
Sportschifffahrt (City-Bootshafen Rostock und Museumshafen im Haedgehafen) und vom lokalen Schiffsverkehr genutzt. Den Stadthafen können Schiffe bis 6,4 m Tiefgang anlaufen.<br />
Auf <strong>de</strong>r Silohalbinsel <strong>de</strong>s Stadthafens befin<strong>de</strong>t sich die Unternehmenszentrale <strong>de</strong>r Deutschen Seeree<strong>de</strong>rei.<br />
Im Stadtteil Marienehe liegt <strong>de</strong>r Rostocker Fracht- und Fischereihafen, <strong>de</strong>r von Schiffen bis 180 m Länge und 8,0 m Tiefgang angelaufen wer<strong>de</strong>n kann.
Am Südufer <strong>de</strong>s Breitlings ist <strong>de</strong>r Werkshafen (Chemiehafen) von Yara International gelegen, <strong>de</strong>r von Tankern bis 8,45 m Tiefgang genutzt wer<strong>de</strong>n kann. Von dort verläuft eine Pipeline<br />
<strong>zu</strong>m YARA-Werk Rostock.<br />
Am Westufer <strong>de</strong>r Unterwarnow befin<strong>de</strong>n sich zwischen Marienehe und Groß Klein die Hafenanlagen Müsingkai (max. 5,8 m Tiefgang, Schüttgutumschlag), MAB-Kai (max. 5,79 m<br />
Tiefgang, Schrottumschlag) und Maritimes Gewerbegebiet Groß Klein (max. 6,4 m Tiefgang).<br />
In Warnemün<strong>de</strong> gibt es die Werfthäfen <strong>de</strong>r Neptun- und Aker Warnowwerft sowie <strong>de</strong>n traditionellen Hafen <strong>de</strong>r Kutterfischer im Alten Strom.<br />
Am Anleger Schmarl liegt das Traditionsschiff Typ Frie<strong>de</strong>n. Dieses Schiff ist Heimstatt <strong>de</strong>s Rostocker Schiffbau- und Schiffahrtsmuseums und selbst größtes Ausstellungsstück. Als MS<br />
Dres<strong>de</strong>n 1956/57 auf <strong>de</strong>r Warnowwerft Warnemün<strong>de</strong> gebaut, gehörte es <strong>zu</strong>r ersten Serie von 10.000 tdw-Schiffen, die in <strong>de</strong>r DDR auf Kiel gelegt wur<strong>de</strong>n. Das Typschiff dieser Serie war<br />
das MS Frie<strong>de</strong>n. Zum Museum gehören neben <strong>de</strong>m Traditionsschiff <strong>de</strong>r Dampfschlepper Saturn, das Betonschiff Capella und <strong>de</strong>r Schwimmkran Langer Heinrich.<br />
Geschichte<br />
Die Geschichte <strong>de</strong>s Rostocker Hafens reicht bis ins Mittelalter <strong>zu</strong>rück, vor allem <strong>zu</strong> Zeiten <strong>de</strong>r Hanse war <strong>de</strong>r Hafen ein wichtiger Drehpunkt <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>ls mit Skandinavien und <strong>de</strong>m<br />
Baltikum. Der Hafen verlor mit <strong>de</strong>m Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>r Hanse an Be<strong>de</strong>utung. Die mit <strong>de</strong>r Ent<strong>de</strong>ckung Amerikas und <strong>de</strong>s Seewegs nach Indien verbun<strong>de</strong>ne Verlagerung <strong>de</strong>s (Welt)-Han<strong>de</strong>ls<br />
auf <strong>de</strong>n Bereich <strong>de</strong>s Mittelmeers und <strong>de</strong>s Atlantik führte <strong>zu</strong>m Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>s Hafens. Nach einer kurzen Blüte bedingt durch Getrei<strong>de</strong>exporte Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts hatte er nur<br />
noch lokale Be<strong>de</strong>utung.<br />
An <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> vom 19. <strong>zu</strong>m 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt setzte ein beschei<strong>de</strong>ner Hafenausbau ein. Unter <strong>de</strong>r Fe<strong>de</strong>rführung <strong>de</strong>s Stadt- und Hafenbaudirektors Kerner wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Hafen nach Westen<br />
erweitert, <strong>de</strong>r Kohlenkai und <strong>de</strong>r Haedgehafen gebaut. Der Hafen erhielt <strong>de</strong>n ersten mo<strong>de</strong>rnen Hafenkran und Kranbrücken für <strong>de</strong>n Kohleumschlag. Gleichzeitig wur<strong>de</strong> im Zuge <strong>de</strong>s<br />
Aufbaus <strong>de</strong>r Fährverbindung von Warnemün<strong>de</strong> nach Gedser die Zufahrt <strong>zu</strong>m Rostocker Hafen erheblich verbessert. In Warnemün<strong>de</strong> entstand <strong>de</strong>r Neue Strom als breitere und vor allem<br />
besser befahrbare Einfahrt <strong>zu</strong>m Rostocker Hafen. Die Fahrwasser im Hafen wur<strong>de</strong>n auf 4,1 m bis 6,7 m vertieft, so dass die damals in <strong>de</strong>r Ostseefahrt üblichen Schiffe <strong>de</strong>n Hafen nun<br />
problemlos anlaufen konnten. In <strong>de</strong>n Jahren bis <strong>zu</strong>m Ersten Weltkrieg entstan<strong>de</strong>n westlich <strong>de</strong>s Haedgehafens die Kaianlagen an <strong>de</strong>r Eschenbrücke und am Kehrwie<strong>de</strong>r. Das Neue Land<br />
im Osten <strong>de</strong>s Hafens wur<strong>de</strong> als Ausbaugebiet für <strong>de</strong>n Holzhafen vorgesehen und auf <strong>de</strong>m östlichen Ufer <strong>de</strong>r Unterwarnow das Erweiterungsgebiet Osthafen vorbereitet. Der<br />
Kriegsausbruch im August 1914 been<strong>de</strong>te <strong>zu</strong>nächst alle Erweiterungpläne.<br />
In <strong>de</strong>n Jahren vor <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg brachte <strong>de</strong>r Aufbau <strong>de</strong>r Flugzeugindustrie auch <strong>de</strong>m Hafen einen, wenn auch kleinen Aufschwung. Im Zuge <strong>de</strong>s Reichsspeicherprogramms <strong>de</strong>r<br />
NS-Regierung wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n 1930er Jahren mo<strong>de</strong>rne Getrei<strong>de</strong>silos und eine neue Ölmühle auf <strong>de</strong>r Silohalbinsel gebaut. Während <strong>de</strong>s Krieges wur<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>n Luftangriffen <strong>de</strong>r Alliierten,<br />
die primär <strong>de</strong>r Flugzeugindustrie und <strong>de</strong>n Wohngebieten <strong>de</strong>r Stadt Rostock galten, auch <strong>de</strong>r Hafen getroffen und beschädigt.<br />
Durch die Teilung Deutschlands ergab sich die Notwendigkeit, an <strong>de</strong>r Ostseeküste <strong>de</strong>r DDR einen Hochseehafen <strong>zu</strong> bauen. Nach Prüfung mehrerer Varianten fiel die Entscheidung für<br />
<strong>de</strong>n Überseehafen Rostock. Der neue Hafen wur<strong>de</strong> am 30. April 1960 eröffnet und vom VEB Seehafen Rostock betrieben. Der Hafen wur<strong>de</strong> Heimathafen <strong>de</strong>r Schiffe <strong>de</strong>r Deutschen<br />
Seeree<strong>de</strong>rei (DSR) und konnte bis <strong>zu</strong>m Jahr 1989 ein stetiges Umschlagwachstum vorwiegend durch Massenschüttgüter verzeichnen.<br />
Mit <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Einheit war eine Neupositionierung <strong>de</strong>s Hafens erfor<strong>de</strong>rlich. Es erfolgte <strong>de</strong>r Ausbau <strong>de</strong>s Fährschiffverkehrs, <strong>zu</strong>nächst vor allem über die kurze Verbindung nach<br />
Gedser, Dänemark – später dann auch <strong>zu</strong>nehmend mit Verbindungen nach Trelleborg, Schwe<strong>de</strong>n und Hanko, Finnland sowie ins Baltikum. Gewisse Be<strong>de</strong>utung erhielten auch die<br />
sogenannten RoRo-Verkehre (Roll-on/Roll-off). Zunehmend wichtig ist darüber hinaus <strong>de</strong>r kombinierte Ladungsverkehr, hier wird ein KLV-Terminal betrieben mit Zugverbindungen<br />
nach Verona, Basel und Duisburg. Rasant an Be<strong>de</strong>utung nahm in <strong>de</strong>n letzten Jahren die Kreuzschifffahrt <strong>zu</strong>, die vor<strong>zu</strong>gsweise am Kreuzschifffahrtsterminal Warnemün<strong>de</strong> Cruise Center<br />
in Warnemün<strong>de</strong> abgewickelt wird. Dieses wur<strong>de</strong> 2005 neu eröffnet. Seit<strong>de</strong>m laufen jährlich regelmäßig über 100 Kreuzfahrtschiffe <strong>de</strong>n Warnemün<strong>de</strong>r und Rostocker Hafen an.<br />
Wirtschaft
Die Zahl <strong>de</strong>r Fährpassagiere lag im Jahr 2009 bei 2,1 Mio. (2008 2,4 Mio.).<br />
• Der Güterumschlag 1989 bis 2009 in Millionen Tonnen<br />
•<br />
• Jahr 1989 1991 1993 1995 1997 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
• Flüssiggut 3,5 2,6 2,9 3,0 4,3 3,1 3,3 2,2 2,5 2,5 2,9 4,0 4,7 4,0<br />
• Schüttgut 11,0 3,9 5,6 7,8 6,4 6,5 6,7 6,4 5,4 5,8 6,0 5,0 5,9 5,4<br />
• Stückgut 6,3 1,3 1,7 1,5 1,2 0,9 0,7 0,7 0,6 0,7 1,0 1,1 0,6 0,4<br />
• Fähr-Güter 0,0 0,0 1,6 5,0 6,5 9,1 10,5 11,2 12,0 12,8 13,9 15,1 13,7 10,2<br />
• RoRo-Güter 0,0 0,3 0,3 0,5 0,6 0,9 1,0 1,1 1,3 1,1 1,4 1,3 2,3 1,5<br />
• Gesamt 20,8 8,1 12,1 17,8 19,0 20,5 22,2 21,6 21,8 22,9 25,2 26,5 27,2 21,5<br />
Im Hafengebiet haben sich auch Industrieunternehmen angesie<strong>de</strong>lt. Auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>s Überseehafens befin<strong>de</strong>n sich u. a. ein Werk <strong>de</strong>s Kranherstellers Liebherr und eine Mälzerei von<br />
Malteurop Deutschland. 2008 hat ein Großrohrwerk einer Tochterfirma <strong>de</strong>r Erndtebrücker Eisenwerke (EEW) die Produktion aufgenommen.<br />
Literatur<br />
• 50 Jahre Seehafen Rostock – 20 Jahre Fährverkehr. In: Schiff & Hafen, Heft 5/2010, S. 39. Seehafen-Verlag, Hamburg 2010, ISSN 0938-1643<br />
• Ralf Witthohn: Rostock: Viel mehr als Berlins Kreuzlinerport. In: Deutsche Seeschifffahrt Heft 5/2010, S. 24–27. Storck-Verlag, Hamburg 2010, ISSN 0948-9002<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Stralsund<br />
Die Hansestadt Stralsund ist eine kreisfreie Stadt in Mecklenburg-Vorpommern im Nor<strong>de</strong>n Deutschlands. Die Stadt liegt am Strelasund, einer Meerenge <strong>de</strong>r Ostsee, und wird auf Grund<br />
ihrer Lage als Tor <strong>zu</strong>r Insel Rügen bezeichnet. Gemeinsam mit Greifswald bil<strong>de</strong>t Stralsund eines <strong>de</strong>r vier Oberzentren <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Mecklenburg-Vorpommern.<br />
1234 erhielt Stralsund das Stadtrecht. Die Altstadt gehört seit 2002 mit <strong>de</strong>m Titel Historische Altstädte Stralsund und Wismar <strong>zu</strong>m UNESCO-Welterbe.<br />
Geografie<br />
Geografische Lage
Die Stadt Stralsund liegt im Nordosten <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>steils Vorpommern <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Lan<strong>de</strong>s Mecklenburg-Vorpommern im Nor<strong>de</strong>n Deutschlands. Koordinaten: 54° 18′ N, 13° 5′ O.<br />
Klima<br />
Der Jahresnie<strong>de</strong>rschlag liegt bei 656 mm und ist damit vergleichsweise niedrig, da er in das untere Drittel <strong>de</strong>r in Deutschland erfassten Werte fällt. An 31 % <strong>de</strong>r Messstationen <strong>de</strong>s<br />
Deutschen Wetterdienstes wer<strong>de</strong>n niedrigere Werte registriert. Der trockenste Monat ist <strong>de</strong>r Februar, die meisten Nie<strong>de</strong>rschläge fallen im Juli: In diesem Monat fallen 2,1 mal mehr<br />
Nie<strong>de</strong>rschläge als im Februar. Die Nie<strong>de</strong>rschläge variieren mäßig. An 40 % <strong>de</strong>r Messstationen wer<strong>de</strong>n niedrigere jahreszeitliche Schwankungen registriert.<br />
Landschaften, Berge, Flüsse<br />
Die Stadt liegt am Strelasund, einer Meerenge <strong>de</strong>r Ostsee. Die geographische Nähe <strong>zu</strong>r Insel Rügen, <strong>de</strong>ren einzige feste Verbindung <strong>zu</strong>m Festland, die Strelasundquerung, zwischen<br />
Stralsund und <strong>de</strong>m Ort Altefähr verläuft, brachte Stralsund die Bezeichnung Tor <strong>zu</strong>r Insel Rügen ein. Stralsund liegt nahe <strong>de</strong>m Nationalpark Vorpommersche Bod<strong>de</strong>nlandschaft.<br />
Zum Stadtgebiet Stralsunds gehören ein Stadtwald und drei Stadtteiche (Knieperteich, Frankenteich und Moorteich). Die drei Teiche und <strong>de</strong>r Strelasund verleihen <strong>de</strong>r Altstadt, <strong>de</strong>m<br />
ursprünglichen Siedlungsgebiet und historischen Zentrum <strong>de</strong>r Stadt, eine geschützte Insellage.<br />
Die höchste Erhebung <strong>de</strong>r Stadt ist <strong>de</strong>r Galgenberg am westlichen Ortseingang.<br />
Stadtglie<strong>de</strong>rung<br />
Das Stadtgebiet umfasst 38,97 km², was Stralsund mit 58.027 Einwohnern (Stand: 2007) <strong>zu</strong> einer <strong>de</strong>r dichtbesie<strong>de</strong>ltsten Städte Mecklenburg-Vorpommerns macht (1489 Einwohner je<br />
km²). Ausgehend vom heutigen Stadtkern, <strong>de</strong>r Altstadt, wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r Aufhebung <strong>de</strong>s Festungscharakters <strong>de</strong>r Stadt im Jahr 1869 die umliegen<strong>de</strong>n Gegen<strong>de</strong>n besie<strong>de</strong>lt.<br />
Das Gebiet <strong>de</strong>r Hansestadt Stralsund glie<strong>de</strong>rt sich in folgen<strong>de</strong> Stadtgebiete und Stadtteile:<br />
• Nr. Stadtgebiet Stadtteil Einwohner<br />
• (Stand: 2008[2])<br />
• 01 Altstadt 4.844<br />
• 011 Altstadt Altstadt 4.668<br />
• 012 Altstadt Hafeninsel 24<br />
• 013 Altstadt Bastionengürtel 152<br />
• 02 Knieper 26.184<br />
• 021 Knieper Kniepervorstadt 6.071<br />
• 022 Knieper Knieper Nord 6.977<br />
• 023 Knieper Knieper West 13.136<br />
• 03 Tribseer 9.418<br />
• 031 Tribseer Tribseer Vorstadt 4.939<br />
• 032 Tribseer Tribseer Siedlung 3.557<br />
• 033 Tribseer Tribseer Wiesen 827<br />
• 034 Tribseer Schrammsche Mühle 95<br />
• 04 Franken 5.869
• 041 Franken Frankenvorstadt 4.642<br />
• 042 Franken Dänholm 123<br />
• 043 Franken Franken Mitte 338<br />
• 044 Franken Frankensiedlung 766<br />
• 05 Süd 3.854<br />
• 051 Süd An<strong>de</strong>rshof 1.345<br />
• 052 Süd Devin 619<br />
• 053 Süd Voig<strong>de</strong>hagen 90<br />
• 06 Lüssower Berg 234<br />
• 07 Langendorfer Berg 290<br />
• 08 Grünhufe 6.388<br />
• 081 Grünhufe Stadtkoppel 292<br />
• 082 Grünhufe Vogelsang 2.545<br />
• 083 Grünhufe Grünthal-Viermorgen 3.471<br />
• 084 Grünhufe Freienlan<strong>de</strong> 80<br />
Die Stadt besitzt <strong>zu</strong><strong>de</strong>m Län<strong>de</strong>reien in <strong>de</strong>r näheren Umgebung sowie auf <strong>de</strong>n Inseln Rügen, Hid<strong>de</strong>nsee und Ummanz.<br />
Nachbargemein<strong>de</strong>n<br />
Größere Städte in <strong>de</strong>r näheren Umgebung sind Greifswald und Rostock. In <strong>de</strong>r näheren Umgebung Stralsunds befin<strong>de</strong>n sich <strong>zu</strong><strong>de</strong>m die Städte Barth und Ribnitz-Damgarten.<br />
Viele <strong>de</strong>r kleineren Dörfer im Umkreis, wie Prohn o<strong>de</strong>r Negast, sind nach 1990 durch Zu<strong>zu</strong>g von Stralsun<strong>de</strong>rn o<strong>de</strong>r in Stralsund Arbeiten<strong>de</strong>n stark gewachsen.<br />
Geschichte<br />
Stadtgeschichte<br />
Stralsund erhielt nach <strong>de</strong>r Besiedlung im Zuge <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Ostkolonisation im Jahre 1234 vom rügenschen Fürsten Wizlaw I. das Stadtrecht nach Rostocker bzw. Lübecker Vorbild.<br />
Die Gegend war von Slawen besie<strong>de</strong>lt gewesen, was auch ihren slawischen Namensbestandteil Stral erklärt (stral be<strong>de</strong>utet Pfeil- bzw. Speerspitze, -sund steht in germanischen Sprachen<br />
für eine trennen<strong>de</strong> Enge und meint hier <strong>de</strong>n Strelasund).<br />
Stralsund wur<strong>de</strong> vorwiegend durch Siedler aus Westfalen schnell <strong>zu</strong> einer be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>lsstadt im Ostseeraum. Die Stadt gehörte nach <strong>de</strong>m Erlöschen <strong>de</strong>s Fürstentums Rügen 1325<br />
<strong>zu</strong> Pommern-Wolgast. Sie war im 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt nach Lübeck die be<strong>de</strong>utendste Hansestadt im südlichen Ostseeraum. Zahlreiche kriegerische Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mit <strong>de</strong>n Herrschern<br />
von Dänemark gipfelten 1370 im Frie<strong>de</strong>n von Stralsund.<br />
Nach <strong>de</strong>m Nie<strong>de</strong>rgang <strong>de</strong>r Hanse nahm Stralsunds Be<strong>de</strong>utung ab. Die Stadt lebte jedoch weiterhin vorwiegend vom Fernhan<strong>de</strong>l und Nahhan<strong>de</strong>l sowie vom Schiffbau.<br />
Bereits 1525 traten die Bürger Stralsunds mehrheitlich <strong>zu</strong>m evangelischen Glauben über. Die Stadt war damit Schrittmacher <strong>de</strong>r Reformation in Nord<strong>de</strong>utschland.<br />
Im Dreißigjährigen Krieg wi<strong>de</strong>rstand Stralsund mit Hilfe von Schwe<strong>de</strong>n und Dänemark <strong>de</strong>r Belagerung durch Wallensteins Truppen; es folgte eine fast 200-jährige Zeit <strong>de</strong>r<br />
Zugehörigkeit <strong>zu</strong>m Königreich Schwe<strong>de</strong>n als Teil von Schwedisch-Pommern.
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt kam Stralsund <strong>zu</strong> Preußen und war Sitz eines Regierungsbezirks.<br />
Im Zweiten Weltkrieg wur<strong>de</strong> die Stadt beim Bombenangriff auf Stralsund am 6. Oktober 1944 von <strong>de</strong>n Alliierten mit 146 "Fliegen<strong>de</strong>n Festungen" vom Typ B 17, <strong>de</strong>r über 800 zivile<br />
Opfer for<strong>de</strong>rte, stark zerstört o<strong>de</strong>r beschädigt. 8000 Wohnungen wur<strong>de</strong>n vernichtet o<strong>de</strong>r beschädigt. Viele wertvolle Bau<strong>de</strong>nkmale gingen verloren.[3]<br />
Am 1. Mai 1945 rückte die Rote Armee in Stralsund nahe<strong>zu</strong> kampflos ein. Stralsund wur<strong>de</strong> Teil <strong>de</strong>r sowjetischen Besat<strong>zu</strong>ngszone Deutschlands.<br />
Während <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Deutschen Demokratischen Republik (DDR) wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Stadt zahlreiche Plattenbausiedlungen errichtet, <strong>de</strong>r historische Altstadtkern allerdings verkam.<br />
Wirtschaftlich lebte die Stadt vor allem vom Schiffbau auf <strong>de</strong>r Volkswerft, die Schiffe für die Sowjetunion teilweise im Zehntagesrhythmus fertigstellte.<br />
Nach <strong>de</strong>r politischen Wen<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> 1990 Stralsund Mo<strong>de</strong>llstadt <strong>de</strong>r Städtebauför<strong>de</strong>rung in <strong>de</strong>n neuen Län<strong>de</strong>rn. Der Historische Stadtkern mit <strong>de</strong>m Altstadthafen wur<strong>de</strong> mit Hilfe <strong>de</strong>r<br />
Programme <strong>zu</strong>r Städtebauför<strong>de</strong>rung und <strong>zu</strong>m Städtebaulichen Denkmalschutz danach gründlich saniert. Auch das Wohnumfeld <strong>de</strong>r Plattenbausiedlungen Grünhufe und Knieper wur<strong>de</strong><br />
im Rahmen <strong>de</strong>r Programme „Aufwertung“, „Stadtumbau-Ost“ und „Die Soziale Stadt“ verbessert und ein Wohnungsrückbau eingeleitet.<br />
Seit <strong>de</strong>m Jahr 2002 ist Stralsunds Altstadt <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>r Wismars UNESCO-Weltkulturerbe mit <strong>de</strong>m Namen Historische Altstädte Stralsund und Wismar.<br />
Wirtschaftlich gab es nach <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> große Herausfor<strong>de</strong>rungen, die in <strong>de</strong>r strukturschwachen Region erhebliche Probleme verursachen, die noch nicht bewältigt wer<strong>de</strong>n konnten.<br />
Im Zuge einer Kreisreform im Jahr 2011 sollen Stralsund sowie die Landkreise Rügen und Nordvorpommern Teile eines neuen Landkreises Nordvorpommern mit Verwaltungssitz in<br />
Stralsund wer<strong>de</strong>n. [4]<br />
Straßennamen und ihre Be<strong>de</strong>utung<br />
Die Stralsun<strong>de</strong>r Straßennamen spiegeln vielfache historische Ereignisse wi<strong>de</strong>r.<br />
Stralsun<strong>de</strong>r Stadtbefestigungen<br />
Stralsund besaß bis 1871 <strong>de</strong>n Status einer Festung, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Stadt über viele Kriege verhalf. Neben zehn Stadttoren, von <strong>de</strong>nen nur zwei (Kniepertor und Kütertor) erhalten sind, wur<strong>de</strong>n<br />
auch die Stadtteiche und Dämme angelegt.<br />
Gesellschaft und Politik<br />
Wappen und Flagge<br />
Das Wappen Stralsunds wur<strong>de</strong> am 9. September 1938 durch <strong>de</strong>n Oberpräsi<strong>de</strong>nten in Stettin verliehen und unter <strong>de</strong>r Nr. 67 <strong>de</strong>r Wappenrolle von Mecklenburg-Vorpommern registriert.<br />
Blasonierung: „In Rot ein aufrecht gestellter silberner Pfeil, bestehend aus Schafthülle und <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Flügeln, mit einem silbernen Tatzenkreuz darüber.“ [6] Das „sprechen<strong>de</strong>“<br />
Stadtwappen <strong>de</strong>r Hansestadt Stralsund symbolisiert <strong>de</strong>n Namensbestandteil „stral“ <strong>de</strong>r Stadt am Sund, <strong>de</strong>r im Slawischen „Pfeil“ bzw. „Spitze“ be<strong>de</strong>utet. Der Pfeil wur<strong>de</strong> auch in <strong>de</strong>n<br />
Stadtsiegeln verwen<strong>de</strong>t.<br />
Die Stadtflagge zeigt auf rotem Grund einen aufrecht gestellten silbernen (weißen) Pfeil, bestehend aus Schafttülle und <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Flügeln, mit einem silbernen (weißen) Tatzenkreuz<br />
darüber. [7]<br />
Religionen<br />
Das Gebiet <strong>de</strong>r heutigen Stadt Stralsund war nach <strong>de</strong>m Weg<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r Germanen in <strong>de</strong>r Zeit <strong>de</strong>r Völkerwan<strong>de</strong>rung <strong>zu</strong>nächst von slawischen Siedlern bewohnt. Nach <strong>de</strong>m Sieg <strong>de</strong>r Dänen<br />
über die slawischen Fürsten auf Rügen im Jahr 1168 begann die Christianisierung, wobei überwiegend christliche Siedler aus Westfalen in das Gebiet Stralsunds kamen. Im 13.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt kamen auch Ju<strong>de</strong>n nach Stralsund. Die Reformation machte Stralsund Mitte <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong> einer überwiegend evangelischen Stadt.
Nach <strong>de</strong>m Zweiten Weltkrieg gehörte Stralsund <strong>zu</strong>m sozialistischen Einflussbereich, die Erziehung in <strong>de</strong>n Schulen geschah streng kirchfern. Zwischen 1949 und 1989 ging <strong>de</strong>r Anteil <strong>de</strong>r<br />
Protestanten an <strong>de</strong>r Stadtbevölkerung von etwa 90 % auf etwa 20 % <strong>zu</strong>rück. Heute gehören etwa 75 % <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Bevölkerung keiner Religionsgemeinschaft an.<br />
Die mitglie<strong>de</strong>rstärkste kirchliche Gemein<strong>de</strong> stellt die Evangelische Kirche dar (ca. 15 %). Der Kirchenkreis Stralsund <strong>de</strong>r Pommerschen Evangelischen Kirche ist einer von vier<br />
Kirchenkreisen in <strong>de</strong>r evangelischen Lan<strong>de</strong>skirche Vorpommerns. Etwa 4 % <strong>de</strong>r Bewohner bekennen sich <strong>zu</strong>m Katholizismus. Daneben existieren noch Gemein<strong>de</strong>n kleinerer christlicher<br />
Gruppen, wie die <strong>de</strong>r Neuapostolischen Kirche, Adventisten, <strong>de</strong>r Evangelisch-Freikirchlichen Gemein<strong>de</strong> (Baptisten) und die <strong>de</strong>r Evangelisch-methodistischen Kirche.<br />
Im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong>n die Ju<strong>de</strong>n aus Pommern und Mecklenburg ausgewiesen. 1757 erlaubte <strong>de</strong>r schwedische König wie<strong>de</strong>r die Ansiedlung von Ju<strong>de</strong>n; diese begannen 1786 mit<br />
<strong>de</strong>m Bau einer Synagoge, die am 30. März 1787 geweiht wur<strong>de</strong>. Jüdische Kaufleute brachten mo<strong>de</strong>rne Han<strong>de</strong>lsi<strong>de</strong>en in die Stadt: Am 15. April 1852 errichteten die Gebrü<strong>de</strong>r Wertheim<br />
ihr „Manufactur-Mo<strong>de</strong>waren-Geschäft“ und bauten 1875 das erste Wertheim-Kaufhaus in Stralsund. Leonhard Tietz eröffnete am 14. August 1879 einen kleinen La<strong>de</strong>n und begrün<strong>de</strong>te<br />
damit <strong>de</strong>n später als „Kaufhof“ bekannten Konzern. Während sich 1933 noch 134 Personen <strong>zu</strong>m Ju<strong>de</strong>ntum bekannten, waren es 1939 nur noch 62. Nur zwei <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Terror <strong>de</strong>r<br />
Nationalsozialisten überleben<strong>de</strong>n Stralsun<strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n kamen <strong>zu</strong>rück nach Stralsund.<br />
Eingemeindungen<br />
In <strong>de</strong>n 1920er Jahren brauchte Stralsund neues Land. Auch die Belegungsgrenze <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Friedhöfe war erreicht; geplant war unter an<strong>de</strong>rem <strong>de</strong>r Bau eines Zentralfriedhofes.<br />
Nach <strong>de</strong>r Verabschiedung <strong>de</strong>s preußischen „Gesetzes über die Regelung verschie<strong>de</strong>ner Punkte <strong>de</strong>s Gemein<strong>de</strong>verfassungsrechts“ 1927, das auch die Auflösung <strong>de</strong>r Gutsbezirke vorsah,<br />
stellte Stralsund <strong>de</strong>n Antrag auf Eingemeindung von Klein Kedingshagen, Groß Kedingshagen, Grünthal, Grünhufe, Freienlan<strong>de</strong>, An<strong>de</strong>rshof, Lüssow, Langendorf (mit Borgwallsee und<br />
Pütter See), Groß Lü<strong>de</strong>rshagen, Neu Lü<strong>de</strong>rshagen, Wendorf, Zitterpennigshagen, Voig<strong>de</strong>hagen, Försterhof, Teschenhagen, Devin und <strong>de</strong>r Stadtkoppel. Zu<strong>de</strong>m sollte <strong>de</strong>r Ort Altefähr auf<br />
Rügen eingemein<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n; <strong>de</strong>r dortige Strand und Park gehörten <strong>de</strong>r Stadt Stralsund bereits. Dieser Antrag, in <strong>de</strong>m es um eine Fläche von 3538 Hektar ging, wur<strong>de</strong> nur teilweise<br />
positiv beschie<strong>de</strong>n. Durch Beschluss <strong>de</strong>s Regierungspräsi<strong>de</strong>nten vom 21. September 1928 wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt Stralsund letztlich „<strong>de</strong>r ganze Gutsbezirk Voig<strong>de</strong>hagen in einer Größe von<br />
297,85 Hektar mit etwa 93 Einwohnern, <strong>de</strong>r ganze Gutsbezirk Devin in einer Größe von 479,87 Hektar mit etwa 230 Einwohnern, <strong>de</strong>r nördliche Teil <strong>de</strong>s Gutsbezirkes An<strong>de</strong>rshof in einer<br />
Größe von etwa 264,74 Hektar mit etwa 150 Einwohnern, <strong>de</strong>r ganze Gutsbezirk Grünhufe in einer Größe von 405,61 Hektar mit etwa 157 Einwohnern“ <strong>zu</strong>geordnet.<br />
Bestandteil <strong>de</strong>s Gutsbezirkes Grünhufe waren die Gehöfte Stadtkoppel und Garbo<strong>de</strong>nhagen und die Güter Grünthal und Freienlan<strong>de</strong>. Zu<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Stadt noch Teile <strong>de</strong>r Güter<br />
Langendorf, Lüssow und Klein Kordshagen <strong>zu</strong>geordnet.<br />
Die neu <strong>zu</strong>geordnete Fläche von 1.781,69 Hektar brachte annähernd eine Verdoppelung <strong>de</strong>s Stadtgebietes. Die Übergabe erfolgte am 22. Oktober 1928 im Stralsun<strong>de</strong>r Rathaus.<br />
Einwohnerentwicklung<br />
Im Jahre 1989 erreichte die Bevölkerungszahl <strong>de</strong>r Stadt Stralsund mit über 75.000 ihren Höchststand. Seit<strong>de</strong>m ist die Einwohnerzahl wie<strong>de</strong>r gesunken. Seit <strong>de</strong>r politischen Wen<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r<br />
DDR 1989/1990 hat die Stadt bis 2008 etwa 15.000 Einwohner verloren.<br />
Die folgen<strong>de</strong> Übersicht zeigt die Einwohnerzahlen nach <strong>de</strong>m jeweiligen Gebietsstand. Bis 1833 han<strong>de</strong>lt es sich meist um Schät<strong>zu</strong>ngen, danach um Volkszählungsergebnisse (¹) o<strong>de</strong>r<br />
amtliche Fortschreibungen <strong>de</strong>r jeweiligen Statistischen Ämter beziehungsweise <strong>de</strong>r Stadtverwaltung selbst. Die Angaben beziehen sich ab 1843 auf die „Ortsanwesen<strong>de</strong> Bevölkerung“,<br />
ab 1925 auf die Wohnbevölkerung und seit 1966 auf die „Bevölkerung am Ort <strong>de</strong>r Hauptwohnung“. Vor 1843 wur<strong>de</strong> die Einwohnerzahl nach uneinheitlichen Erhebungsverfahren<br />
ermittelt.<br />
• Jahr/Datum Einwohner<br />
• 1600 12.500<br />
• 1677 8.489
• 1760 8.153<br />
• 1782 10.606<br />
• 1800 11.191<br />
• 1816 14.096<br />
• 1826 14.745<br />
• 03.12.1849[8] 17.600<br />
• 03.12.1861[8] 21.900<br />
• 03.12.1864[8] 26.700<br />
• 03.12.1867[8] 27.600<br />
• 01.12.1871[8] 26.700<br />
• 01.12.1875[8] 27.765<br />
• 01.12.1880[8] 29.481<br />
• 01.12.1885[8] 28.984<br />
• 01.12.1890[8] 27.814<br />
• 02.12.1895[8] 30.100<br />
• 01.12.1900[8] 31.076<br />
• 01.12.1905[8] 31.809<br />
• 01.12.1910[8] 33.988<br />
• 01.12.1916[8] 31.412<br />
• 05.12.1917[8] 30.715<br />
• 08.10.1919[8] 38.185<br />
• 16.06.1925[8] 39.404<br />
• 16.06.1933[8] 43.630<br />
• 17.05.1939[8] 52.978<br />
• 01.12.1945[8] 43.763<br />
• 29.10.1946[8] 50.389<br />
• 31.08.1950[8] 58.303<br />
• 31.12.1955 65.275<br />
• 31.12.1960 65.758<br />
• 31.12.1964[8] 67.851<br />
• 01.01.1971[8] 71.489<br />
• 31.12.1975 72.109<br />
• 31.12.1981[8] 74.421
• 31.12.1985 75.480<br />
• 31.12.1988 75.498<br />
• 31.12.1990 72.780<br />
• 31.12.1995 65.977<br />
• 31.12.2000 60.663<br />
• 31.12.2005 58.708<br />
• 31.12.2006 57.613<br />
• 31.12.2007 58.027<br />
• 31.12.2008 57.866<br />
Städtepartnerschaften<br />
Mit <strong>de</strong>r französischen Stadt Boulogne-sur-Mer und <strong>de</strong>m finnischen Pori wur<strong>de</strong>n 1963 bzw. 1964 Städtefreundschaften begrün<strong>de</strong>t. 1969 wur<strong>de</strong>n Beziehungen <strong>zu</strong>r lettischen Stadt<br />
Ventspils aufgenommen. Später kamen Kiel in Schleswig-Holstein und Stargard Szczeciński in Polen (seit 1987), sowie Malmö in Schwe<strong>de</strong>n (seit 1991), Svendborg in Dänemark (seit<br />
1992) und Trelleborg in Schwe<strong>de</strong>n (seit 2000) hin<strong>zu</strong>. Die Städtepartnerschaft <strong>zu</strong> Boulogne-sur-Mer besteht nicht mehr.<br />
Zu<strong>de</strong>m ist die Stadt innerhalb <strong>de</strong>r „Hanse <strong>de</strong>r Neuzeit“ aktiv tätig; Vertreter <strong>de</strong>r Stadt nehmen an <strong>de</strong>n Hansetagen <strong>de</strong>r Neuzeit teil.<br />
Kultur und Sehenswürdigkeiten<br />
Bauwerke und Denkmäler<br />
Die Innenstadt Stralsunds ist durch einen Reichtum an historischer Bausubstanz gekennzeichnet. Seit 1990 wur<strong>de</strong> mit privatem und öffentlichem Kapitals sowie durch die Unterstüt<strong>zu</strong>ng<br />
von Stiftungen große Teile <strong>de</strong>r historischen Altstadt saniert. In Folge <strong>de</strong>r Geringschät<strong>zu</strong>ng historischer Bausubstanz in <strong>de</strong>r DDR waren viele Häuser vom Verfall bedroht, konnten jedoch<br />
gerettet wer<strong>de</strong>n. Insbeson<strong>de</strong>re die Altstadt bietet eine reiche historische Gebäu<strong>de</strong>vielfalt, mit u.a. vielen Kaufmannshäusern, <strong>de</strong>n alten Kirchen, Gassen und Plätzen. Von mehr als 800<br />
<strong>de</strong>nkmalgeschützten Häusern in Stralsund stehen mehr als 500 als Einzel<strong>de</strong>nkmal in <strong>de</strong>r Altstadt. Aufgrund ihrer historischen und architektonischen Be<strong>de</strong>utsamkeit wur<strong>de</strong> die Stralsun<strong>de</strong>r<br />
Altstadt im Jahr 2002 gemeinsam mit <strong>de</strong>r Altstadt Wismars unter <strong>de</strong>m Titel Historische Altstädte Stralsund und Wismar in die UNESCO-Weltkulturerbeliste aufgenommen.<br />
Das komplette Ensemble <strong>de</strong>s Alten Marktes bietet mit <strong>de</strong>r Nikolaikirche, <strong>de</strong>m imposanten Stralsun<strong>de</strong>r Rathaus als einem <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Profanbauten <strong>de</strong>r nord<strong>de</strong>utschen<br />
Backsteingotik, <strong>de</strong>m Artushof, <strong>de</strong>m Wulflamhaus, <strong>de</strong>m Commandantenhus, <strong>de</strong>m Gewerkschaftshaus und einem neueren Plattenbau einen Überblick über die architektonische Geschichte<br />
<strong>de</strong>r Stadt. Die oft mit hohem finanziellen Engagement aufwändig sanierten Bürgerhäuser mit ihren typischen Giebeln prägen das Bild in <strong>de</strong>n Altstadtstraßen. Das ehemalige Schwedische<br />
Regierungspalais beherbergt heute das Bauamt <strong>de</strong>r Stadt. Das Museumshaus in <strong>de</strong>r Mönchstraße wur<strong>de</strong> mit Mitteln <strong>de</strong>r Deutschen Stiftung Denkmalschutz saniert und bietet seither als<br />
eines von Nor<strong>de</strong>uropas be<strong>de</strong>utendsten original erhaltenen Bürgerhäusern <strong>de</strong>r Hansezeit das Erleben und Begreifen <strong>de</strong>r Geschichte von sieben Jahrhun<strong>de</strong>rten.<br />
Drei große mittelalterliche Bauten <strong>de</strong>r Backsteingotik, die Marienkirche, Nikolaikirche und Jakobikirche, zeugen von <strong>de</strong>r mittelalterlichen Be<strong>de</strong>utung Stralsunds. Heute wird die<br />
Jakobikirche ausschließlich als Kulturkirche genutzt, die bei<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren am Alten Markt bzw. Neuen Markt gelegenen Kirchen wer<strong>de</strong>n weiterhin für Gottesdienste genutzt. Vom Turm<br />
<strong>de</strong>r Marienkirche am Neuen Markt bietet sich ein guter Panoramablick. Im Johanniskloster befin<strong>de</strong>t sich das Stadtarchiv Stralsund, auch fin<strong>de</strong>n dort regelmäßig Kulturveranstaltungen<br />
statt, wie z. B. Open-air-Theateraufführungen. Zu <strong>de</strong>n jüngeren Sakralbauten zählen die Auferstehungskirche, Dreifaltigkeitskirche, Frie<strong>de</strong>nskirche und die Lutherkirche.<br />
Am Stadthafen legen die Fährschiffe nach Hid<strong>de</strong>nsee und Altefähr an sowie <strong>zu</strong> Hafenrundfahrten. In <strong>de</strong>n Sommermonaten ist <strong>de</strong>r Hafen Liegeplatz für Flusskreuzfahrtschiffe. Es gibt
mehrere Yachthäfen und Marinas im altstadtnahen Bereich. Die Nordmole lädt <strong>zu</strong>m Spaziergang entlang von hun<strong>de</strong>rten Yachten ein. Architektonisch bil<strong>de</strong>n das Lotsenhaus und die<br />
Hafenspeicher sowie die Silhouette <strong>de</strong>r Altstadt einen ansprechen<strong>de</strong>n Kontrast <strong>zu</strong>r Aussicht auf die Inseln Rügen und Hid<strong>de</strong>nsee. Mit <strong>de</strong>r Bark „Gorch Fock“ liegt eine weitere<br />
touristische Sehenswürdigkeit im Hafen, nahe <strong>de</strong>m ehemaligen Frachter Ursula B., <strong>de</strong>r im Sommer vom Theater Vorpommern für Open-Air-Aufführungen genutzt wird.<br />
Von <strong>de</strong>n Stralsun<strong>de</strong>r Stadttoren sind nur noch das Kniepertor und das Kütertor erhalten. Im Heilgeisthospital wur<strong>de</strong>n einst Arme und Kranke untergebracht. Heute sind alle Wohnungen<br />
und Häuser saniert, und das Areal lädt <strong>zu</strong> einem Spaziergang ein.<br />
Siehe: Liste <strong>de</strong>r Denkmale und Ge<strong>de</strong>nkstätten in Stralsund.<br />
Parks und Gewässer<br />
Die Stralsun<strong>de</strong>r Altstadt ist <strong>zu</strong>m einen vom Strelasund und <strong>zu</strong>m an<strong>de</strong>ren von verschie<strong>de</strong>nen Teichen umgeben, sodass sie nahe<strong>zu</strong> rundum von Wasser begrenzt wird.<br />
Während die Altstadt Stralsunds aus geschichtlich bedingten Grün<strong>de</strong>n wenig Grün aufweist, wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>r Entfestung im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt einige Anlagen <strong>zu</strong>r Naherholung angelegt.<br />
Ein Beispiel ist die entlang <strong>de</strong>s Strelasund-Ufers führen<strong>de</strong> Sundpromena<strong>de</strong>. Auch die Stralsun<strong>de</strong>r Friedhöfe wur<strong>de</strong>n im 20. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>zu</strong> Anlagen mit parkähnlichem Charakter<br />
umgestaltet.<br />
In <strong>de</strong>r Brunnenaue wur<strong>de</strong> einst Heilwasser geför<strong>de</strong>rt.<br />
Kulturelle Einrichtungen<br />
Das Deutsche Meeresmuseum im ehemaligen Katharinenkloster ist Nord<strong>de</strong>utschlands meistbesuchtes Museum und bietet Einblicke in die Welt <strong>de</strong>s Wassers und seiner Bewohner. Eine<br />
Ergän<strong>zu</strong>ng stellt das Ozeaneum im Hafen dar, das im Juli 2008 eröffnet wur<strong>de</strong>. Weitere Außenstellen <strong>de</strong>s Hauses sind das Nautineum auf <strong>de</strong>m Dänholm und das Natureum Darßer Ort.<br />
Das Kulturhistorische Museum, das älteste Museum in Mecklenburg-Vorpommern, zeigt Ausstellungen aus <strong>de</strong>r Geschichte Pommerns etc. Die Hauptsammlung ist, wie auch das<br />
Meeresmuseum, im ehemaligen Katharinenkloster untergebracht. Unter <strong>de</strong>n Exponaten befin<strong>de</strong>n sich <strong>de</strong>r berühmte Hid<strong>de</strong>nseer Goldschmuck und ein bei Stolp aufgefun<strong>de</strong>nes Bernstein-<br />
Amulett in Gestalt einer Stier-Skulptur, <strong>de</strong>ssen Alter auf vier- bis fünftausend Jahre geschätzt wird. Außenstellen <strong>de</strong>s Museums sind das auf <strong>de</strong>m Dänholm gelegene Marinemuseum mit<br />
Informationen rund um die militärische Nut<strong>zu</strong>ng und Be<strong>de</strong>utung Stralsunds, das Museumshaus und <strong>de</strong>r Museumsspeicher. Der Dänholm gilt als „Wiege <strong>de</strong>r preußischen bzw. <strong>de</strong>utschen<br />
Marine“.<br />
Die Ausstellung "Stralsund blind verstehen" ermöglicht einen virtuellen Stadtrundgang durch die Hansestadt in völliger Dunkelheit. Der Besucher erlebt einen begrenzten Seitenwechsel<br />
in die Welt blin<strong>de</strong>r Menschen.<br />
Das bis 1995 eigenständige Stralsun<strong>de</strong>r Theater bil<strong>de</strong>t seit<strong>de</strong>m <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m Theater Greifswalds und Putbus' das Theater Vorpommern. Das Stralsun<strong>de</strong>r Haus <strong>de</strong>s Theaters bietet<br />
Aufführungen aus allen Genres. Die Stralsun<strong>de</strong>r Sängerin Caró veröffentlichte einige Alben mit Popmusik.<br />
Vom Frühjahr bis in <strong>de</strong>n Herbst wer<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Kulturkirche St. Jakobi Werke von Frie<strong>de</strong>nsreich Hun<strong>de</strong>rtwasser gezeigt.<br />
Veranstaltungen<br />
• Wallensteintage: Je<strong>de</strong>n Sommer fin<strong>de</strong>n die Wallensteintage statt, ein mittelalterliches Spektakel <strong>zu</strong> Ehren <strong>de</strong>r Abwehr <strong>de</strong>r Wallenstein'schen Belagerung Stralsunds 1628.<br />
• Stralsund ist einer <strong>de</strong>r Spielorte <strong>de</strong>r Festspiele Mecklenburg-Vorpommern.<br />
• Sundschwimmen: Von Altefähr (Insel Rügen) nach Stralsund über 2,3 Kilometer wird dabei <strong>de</strong>r Strelasund von bis <strong>zu</strong> 1000 Teilnehmern durchschwommen.<br />
• Mittwochsregatta auf <strong>de</strong>m Strelasund: Während <strong>de</strong>r Segelsaison wöchentliche Segelregatta mit Yardstick-Wertung. Start an <strong>de</strong>r Nordmole bei Hafeneinfahrt.<br />
• Das Brauereihoffest ist eine Open-Air-Veranstaltung <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Brauerei mit bis <strong>zu</strong> 15.000 Besuchern.<br />
• Das Sundstock-Open-Air fin<strong>de</strong>t auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Campus <strong>de</strong>r Fachhochschule Stralsund statt.
• Stralsun<strong>de</strong>r Weihnachtsmarkt<br />
• Der Rügenbrückenlauf mit Marathon führt die Teilnehmer alljährlich im Oktober über die Rügenbrücke.<br />
• Das seit 1970 jährlich ausgetragene lan<strong>de</strong>sweite Boxturnier um <strong>de</strong>n Ostseepokal (Boxen) gilt als das größte und be<strong>de</strong>utendste Nachwuchsturnier <strong>de</strong>r Altersklassen 13/14.<br />
Kulinarische Spezialitäten<br />
Der Kaufmann und Fischhändler Karl Wiechmann erfand in Stralsund eine Art von sauer eingelegtem Hering, <strong>de</strong>n er <strong>zu</strong> Ehren und mit ausdrücklicher Genehmigung <strong>de</strong>s damaligen<br />
Kanzlers Bismarckhering nannte. Das Originalrezept besitzt <strong>de</strong>r Fischhändler Henry Rasmus, <strong>de</strong>r in seinem Restaurant seit <strong>de</strong>m Jahr 2003 wie<strong>de</strong>r Original-Bismarckhering anbietet.<br />
Die Biere <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Brauerei erzielen auf <strong>de</strong>r Internationalen Grünen Woche in Berlin regelmäßig Spitzenplatzierungen.<br />
Öffentliche Einrichtungen<br />
Allgemein<br />
Stralsund ist Sitz eines Amtsgerichtes und <strong>de</strong>s Landgerichtes.<br />
Die Schifferbrü<strong>de</strong>r richteten im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt die Schiffer-Compagnie ein, Vorläufer von Sozialversicherung und Gewerkschaft in einem.<br />
Die Deutsche Marine unterhält in Parow die Marinetechnikschule.<br />
Die Deutsche Rentenversicherung Bund errichtete 1999 (damals noch als Bun<strong>de</strong>sversicherungsanstalt für Angestellte (BfA)) eine Dienststelle mit heute (Stand: Oktober 2006) ca. 1450<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und gehört damit <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n größten Arbeitgebern <strong>de</strong>r Region.<br />
Schulen<br />
Es gibt in Stralsund sieben Grundschulen, zwei För<strong>de</strong>rschulen (Astrid Lindgren und Lambert Steinwich), die vier Regionale Schulen Adolph Diesterweg, Hermann Burmeister, Marie<br />
Curie und Schulzentrum am Sund, eine Integrierte Gesamtschule IGS-Grünthal, eine Berufliche Schule und zwei Gymnasien.<br />
Die zwei Gymnasien <strong>de</strong>r Stadt sind das Hansa-Gymnasium Stralsund und das Goethe-Gymnasium als gymnasialer Teil <strong>de</strong>s „Schulzentrum am Sund“.<br />
Das Fachgymnasium <strong>de</strong>r Beruflichen Schule <strong>de</strong>r Hansestadt und die IGS-Grünthal führen auch <strong>zu</strong>r Allgemeinen Hochschulreife.<br />
Die Stadt Stralsund unterhält ebenfalls eine Volkshochschule und eine 1952 gegrün<strong>de</strong>te Musikschule.<br />
Hochschulen<br />
In Stralsund befin<strong>de</strong>t sich die 1991 gegrün<strong>de</strong>te Fachhochschule Stralsund mit etwa 2.500 Stu<strong>de</strong>nten. Die FH Stralsund ist eine Campus-Hochschule und befin<strong>de</strong>t sich im Nor<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r<br />
Stadt. Auf <strong>de</strong>m Dänholm existiert eine Außenstelle <strong>de</strong>r Fachschule Lübeck.<br />
Sport<br />
Auf sportlichem Gebiet besitzt Stralsund eine lange und erfolgreiche Gewichthebertradition. Die Sportler <strong>de</strong>s jetzigen TSV 1860 Stralsund (früher: BSG Motor Stralsund) errangen bei<br />
vielen nationalen (<strong>zu</strong>letzt Deutscher Meister 2005) und internationalen Wettkämpfen Titel und Medaillen, be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Gewichtheber sind u. a. Jürgen Heuser und Andreas Behm.<br />
Die erste Männer-Mannschaft <strong>de</strong>s Stralsun<strong>de</strong>r Handballvereins (HV) spielte in <strong>de</strong>r Saison 2003/2004 und 2008/2009 in <strong>de</strong>r ersten Handball-Bun<strong>de</strong>sliga.<br />
Nach starken Zeiten <strong>de</strong>r Fußballmannschaft <strong>de</strong>s ASG Vorwärts Stralsund in <strong>de</strong>n 1960er bis 1980er Jahren in <strong>de</strong>r ersten und zweiten DDR-Liga, stieg <strong>de</strong>r Nachfolger, <strong>de</strong>r FC Pommern
Stralsund, in <strong>de</strong>r Saison 2005/2006 aus <strong>de</strong>r Verbandsliga Mecklenburg-Vorpommern in die Lan<strong>de</strong>sliga ab.<br />
Erfolgreich sind auch die Sportler <strong>de</strong>s MC Nordstern Stralsund, die in <strong>de</strong>r Speedway-Bun<strong>de</strong>sliga fahren. Heimstätte ist das Paul-Greif<strong>zu</strong>-Stadion (Stralsund).<br />
Die Volleyballerinnen <strong>de</strong>s 1. VC Stralsund nehmen in <strong>de</strong>r Saison 2008/2009 am Spielbetrieb <strong>de</strong>r 2. Bun<strong>de</strong>sliga teil.<br />
Auf <strong>de</strong>m Flugplatz Stralsund treffen sich die Piloten von Segel- und Motorflugzeugen, Hubschrauber und Mo<strong>de</strong>llflugzeugen. Der Deutsche Meister von 2006 im Hubschrauberfliegen<br />
kommt aus Stralsund.<br />
An <strong>de</strong>r Sundpromena<strong>de</strong> ist das "Bootshaus", auf <strong>de</strong>m Vereinsgelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Stralsun<strong>de</strong>r Kanu Club (SKC) und <strong>de</strong>s Stralsun<strong>de</strong>r Ru<strong>de</strong>r Club (SRC).<br />
Wirtschaft und Verkehr<br />
Industrie und Gewerbe<br />
Stralsund hat durch seine Nähe <strong>zu</strong>r Ostseeinsel Rügen und seine historische Altstadt <strong>de</strong>n Tourismus als wichtigen Wirtschaftsfaktor. Dieser bil<strong>de</strong>t die Grundlage u. a. für zahlreiche<br />
Gaststätten und Beherbergungen, Museen, ein großes Freizeitbad, Yachtcenter, Fährbetrieb und vieles mehr.<br />
Neben <strong>de</strong>m Tourismus existiert in Stralsund als wichtigster Industriebetrieb die Volkswerft, eine traditionsreiche Vertreterin <strong>de</strong>s Schiffbaus, in <strong>de</strong>ren Umfeld sich diverse<br />
Metallbauunternehmen, darunter Ostseestaal, sowie kleinere Bootswerften angesie<strong>de</strong>lt haben.<br />
Im Stralsun<strong>de</strong>r Hafen wer<strong>de</strong>n vor allem Stück- und Schüttgut umgeschlagen, wie z. B. Salz.<br />
Die Pommersche Volksbank hat ihren Sitz in Stralsund. In 26 Filialen wer<strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>n auf Rügen und in Vorpommern betreut. Die Unternehmensgruppe Nordmann erwarb 1991 die<br />
Stralsun<strong>de</strong>r Brauerei und richtete in Stralsund auch ihren Sitz ein.<br />
Medien<br />
In Stralsund erscheint die Ostsee-Zeitung (OZ) mit einer eigenständigen Lokalausgabe („Stralsun<strong>de</strong>r Zeitung“).<br />
Daneben existieren kostenlose Anzeigenblätter wie „Ostseeanzeiger Stralsund“ (gehört <strong>zu</strong>r OZ), „Stralsun<strong>de</strong>r Blitz“ (gehört <strong>zu</strong>m Blitz-Verlag) und „Zeitung am Strelasund“.<br />
Der öffentlich-rechtliche Rundfunk <strong>de</strong>s NDR sowie Privatsen<strong>de</strong>r wie Antenne MV und Ostseewelle sind per Antenne <strong>zu</strong> empfangen. Hauptsen<strong>de</strong>r für die Region ist <strong>de</strong>r Telekom-Mast in<br />
Garz auf Rügen. Außer<strong>de</strong>m läuft <strong>de</strong>rzeit das Lizenzierungsverfahren für einen lokalen Radiosen<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>r Frequenz 98,9 MHz sen<strong>de</strong>n soll.<br />
Fernsehen für die Region bieten das dritte Programm <strong>de</strong>s NDR-Fernsehens sowie das private Programm FAS – Fernsehen am Strelasund <strong>de</strong>s Kabelbetreibers.<br />
Verkehr<br />
Das be<strong>de</strong>utendste Verkehrsbauwerk bei Stralsund ist seit 2007 die als Hochbrücke errichtete neue Rügenbrücke über <strong>de</strong>n Strelasund, die <strong>de</strong>n alten Rügendamm entlasten soll. Stralsund<br />
hat einen Zubringer <strong>zu</strong>r Bun<strong>de</strong>sautobahn 20 und liegt an <strong>de</strong>n Bun<strong>de</strong>sstraßen B105 aus Richtung Rostock bzw. Greifswald/Neubran<strong>de</strong>nburg, B194 aus Richtung Grimmen und B96 aus<br />
Richtung Bergen auf Rügen.<br />
Per Bahn ist Stralsund über <strong>de</strong>n Bahnhof Stralsund sowie <strong>de</strong>n Bahnhof Stralsund-Rügendamm und <strong>de</strong>n Halt Stralsund-Grünhufe aus Richtung Berlin (über Prenzlau o<strong>de</strong>r<br />
Neubran<strong>de</strong>nburg) und Rostock (und über Rostock aus Hamburg) erreichbar. Weiterhin existiert eine Bahnlinie nach Bergen, Sassnitz und Binz auf <strong>de</strong>r Insel Rügen.<br />
Stralsund hat einen Stadthafen und mehrere Yachthäfen und wird von Yachten, Fluss- und Seekreuzfahrtschiffen angefahren. Ebenfalls besteht ein Seehafen für Frachtschiffe. Im Jahr<br />
2006 wur<strong>de</strong>n mehr als 1.000.000 Tonnen Güter umgeschlagen. Die nächstgelegenen Flughäfen sind <strong>de</strong>r Ostseeflughafen Stralsund-Barth, <strong>de</strong>r Flughafen Rostock-Laage und <strong>de</strong>r
Flugplatz Stralsund (direkt nördlich von Stralsund).<br />
Die Nahverkehr Stralsund GmbH bedient mit Bussen das Stadtgebiet und die nähere Umgebung. Bis 1966 verkehrten auch noch Straßenbahnen.<br />
Der Radwan<strong>de</strong>rweg entlang <strong>de</strong>r Deutschen Alleenstraße und <strong>de</strong>r Ostseeküsten-Radweg verlaufen an Stralsund vorbei<br />
Persönlichkeiten<br />
Ehrenbürger<br />
Menschen, die Beson<strong>de</strong>res für die Stadt geleistet haben, wird in Stralsund für die Dauer <strong>de</strong>r Lebenszeit die Ehrenbürgerschaft verliehen.<br />
Zu einer Auflistung von Ehrenbürgerinnen und Ehrenbürgern <strong>de</strong>r Hansestadt Stralsund siehe die Liste <strong>de</strong>r Ehrenbürger von Stralsund.<br />
Beispielhaft seien hier erwähnt:<br />
• Gottfried Kiesow (* 1931) – Mitglied <strong>de</strong>r Deutschen Stiftung Denkmalschutz<br />
• Käthe Rieck (1902–2004) – ehemalige Leiterin <strong>de</strong>s Meeresmuseums<br />
• Hartmut Olejnik (* 1930) – ehemaliger Direktor <strong>de</strong>s Stralsun<strong>de</strong>r Tierparks<br />
• Erich Kliefert (1893–1994) – Maler<br />
• Herbert Ewe (1921–2006) – Direktor <strong>de</strong>s Stralsun<strong>de</strong>r Stadtarchives<br />
• Otto Scholz (1916-2010) – Arzt<br />
Weitere be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Persönlichkeiten <strong>de</strong>r Stadt<br />
Zu einer Aufzählung von Menschen, die mit Stralsund in Verbindung stehen – sei es, dass sie in Stralsund geboren wor<strong>de</strong>n sind und berühmt wur<strong>de</strong>n, sei es, dass sie als Freun<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
Stadt Be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>s geschaffen haben –, siehe die Liste Stralsun<strong>de</strong>r Persönlichkeiten.<br />
Literatur, Quellen<br />
• Stralsundische Chroniken (Gottlieb Ch. F. Mohnike und Ernst Heinrich Zober, Hrsg.), Band 1: Johann Berckmanns Stralsundische Chronik und noch vorhan<strong>de</strong>ne Auszüge aus<br />
alten verloren gegangenen Stralsundischen Chroniken, Stralsund 1833, 401 Seiten (online).<br />
• Andreas Theodor Kruse: Einige Bruchstücke aus <strong>de</strong>r Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Stralsund - Zur Übersicht nach <strong>de</strong>r Zeitfolge dargestellt. Erstes Buch: Mit <strong>de</strong>n Urkun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s<br />
Stralsun<strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong>ns von 1369 und 1370. Stralsund 1846, 77 Seiten (online).<br />
• Otto Fock: Rügensch-Pommersche Geschichten aus sieben Jahrhun<strong>de</strong>rten, Band 2: Stralsund und Greifswald im Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>r Gründung. Leipzig 1862, 241 Seiten (online).<br />
• Gustav Kratz: Die Städte <strong>de</strong>r Provinz Pommern - Abriß ihrer Geschichte, <strong>zu</strong>meist nach Urkun<strong>de</strong>n. Sändig Reprint Verlag, Vaduz 1996 (unverän<strong>de</strong>rter Nachdruck <strong>de</strong>r Ausgabe<br />
von 1865), ISBN 3-253-02734-1, S. 434-502<br />
• Heinrich Trost: Stralsund (Kunstgeschichtliche Städtebücher). Seemann, Leipzig 1973 (2. Auflage 1979)<br />
• Herbert Ewe: Das alte Stralsund – Kulturgeschichte einer Ostseestadt, Weimar 1994, ISBN 3-7400-0881-4.<br />
• Horst Auerbach: Festung und Marinegarnison Stralsund, Hinstorff Verlag, Rostock 1999, ISBN 3-356-00835-8.<br />
• Horst Auerbach: Als Stralsund eine Festung war. Homilius, Berlin 1997, ISBN 3-931121-42-9.<br />
• Angela Pfotenhauer, Elmar Lixenfeld: Wismar und Stralsund – Welterbe. Monumente-Edition. Monumente-Publikation <strong>de</strong>r Deutschen Stiftung Denkmalschutz, Bonn 2004,<br />
ISBN 3-936942-55-2 o<strong>de</strong>r ISBN 3-936942-56-0.
Einzelnachweise<br />
1. ↑ Mecklenburg-Vorpommern Statistisches Amt - Bevölkerungsentwicklung <strong>de</strong>r Kreise und Gemein<strong>de</strong>n 2009 (PDF; 522 KB) (Hilfe da<strong>zu</strong>)<br />
2. ↑ [http://www.xxx<br />
3. ↑ Arno Krause: "Stralsund". In: "Schicksale <strong>de</strong>utscher Bau<strong>de</strong>nkmale im Zweiten Weltkrieg". Hrsg. Götz Eckardt, Henschel-Verlag, Berlin 1978. Band 1, S.76-84<br />
4. ↑ http://www.xxx<br />
5. ↑ www.xxx<br />
6. ↑ Hauptsat<strong>zu</strong>ng § 2 Abs.1 (PDF)<br />
7. ↑ Hauptsat<strong>zu</strong>ng § 2 Abs.3 (PDF)<br />
xxx – Entsprechend unserer Statuten wer<strong>de</strong>n uns unbekannte Webadressen nicht veröffentlicht. Für eine weiterführen<strong>de</strong> Recherche gehen Sie bitte auf die entsprechen<strong>de</strong><br />
Wikipediaseite. Mehr Informationen lesen Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam, daß politische Passagen im Zuge<br />
unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.<br />
Geschichte <strong>de</strong>r Hansestadt Stralsund<br />
Der Artikel Geschichte <strong>de</strong>r Hansestadt Stralsund behan<strong>de</strong>lt die Entwicklung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Stadt Stralsund. Gegrün<strong>de</strong>t als slawische Siedlung im 10. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt Stralow<br />
im Jahr 1234 das Lübische Stadtrecht verliehen. Stralsund kam nach <strong>de</strong>m Erlöschen <strong>de</strong>s Fürstentums Rügen 1325 an Pommern-Wolgast. Es war seit <strong>de</strong>m 14. Jahrhun<strong>de</strong>rt nach Lübeck<br />
die be<strong>de</strong>utendste Hansestadt im südlichen Ostseeraum. Vom 17. bis ins frühe 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt gehörte Stralsund <strong>zu</strong>m Besitz <strong>de</strong>s Königs von Schwe<strong>de</strong>n im Heiligen Römischen Reich,<br />
danach kam es <strong>zu</strong>r preußischen Provinz Pommern und war Sitz eines Regierungsbezirkes. Den Status als Kreisstadt verlor Stralsund 1990. Die kreisfreie Hansestadt Stralsund ist seit<strong>de</strong>m<br />
Oberzentrum im Lan<strong>de</strong>steil Vorpommern <strong>de</strong>s <strong>de</strong>utschen Bun<strong>de</strong>slan<strong>de</strong>s Mecklenburg-Vorpommern.<br />
10. bis 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Slawische Siedlung<br />
Die Insel Rügen und Teile <strong>de</strong>s gegenüberliegen<strong>de</strong>n Festlan<strong>de</strong>s gehörten <strong>zu</strong>m Siedlungsgebiet <strong>de</strong>r slawischen Ranen, die sich bis <strong>zu</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 12. Jahrhun<strong>de</strong>rts ihre politische<br />
Selbständigkeit bewahrt hatten und eine <strong>de</strong>r letzten nichtchristlichen Völkerschaften in Mitteleuropa waren. Im Jahr 1168 en<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r jahrelange Zwist mit <strong>de</strong>n christlichen Nachbarn mit<br />
<strong>de</strong>m Sieg <strong>de</strong>s Dänenkönigs Wal<strong>de</strong>mar I. über die Ranen und <strong>de</strong>r Eroberung ihres Hauptheiligtums, <strong>de</strong>r Jaromarsburg am Kap Arkona. Nach <strong>de</strong>m Sieg <strong>de</strong>r Dänen wur<strong>de</strong>n die slawischen<br />
Fürsten Lehnsleute <strong>de</strong>r dänischen Krone und nahmen <strong>de</strong>n christlichen Glauben an. Die Fürsten zogen nunmehr gegen die pommerschen Umlandgebiete <strong>zu</strong> Fel<strong>de</strong> und sannen darauf, ihre<br />
Macht auch auf <strong>de</strong>m Festland aus<strong>zu</strong>bauen. Die Siedlung Strale lag strategisch günstig an <strong>de</strong>r Kreu<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lswege zwischen Rostock, Demmin, Rügen und Stettin. Die
vorgelagerte Insel Stralow bot einen natürlichen Hafen, einer <strong>de</strong>r Grün<strong>de</strong> für die Stadtansiedlung.<br />
Der Geschichtsschreiber Saxo Grammaticus berichtete, dass die Dänen schon im 12. Jahrhun<strong>de</strong>rt die Insel Stralow als Liegeplatz für ihre Schiffe bei Kriegszügen ins Lan<strong>de</strong>sinnere<br />
nutzten.[1] Auf dieser Insel befand sich lange vor <strong>de</strong>r Gründung <strong>de</strong>r Stadt ein slawisches Fischerdorf. Als gesichert gilt, dass es sich <strong>zu</strong>m Zeitpunkt <strong>de</strong>r Stadtgründung bereits um eine<br />
große Siedlung han<strong>de</strong>lte. Da<strong>zu</strong> kam <strong>de</strong>r Umstand, dass Sümpfe und Teiche eine Verteidigung erleichterten. Die Stadtteiche wur<strong>de</strong>n erst später ausgebaut. Die Lage am Strelasund<br />
ermöglichte die Zufahrt <strong>zu</strong>r Ostsee auf zwei Seiten. Aufgrund <strong>de</strong>r reichen Heringsbestän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Gewässer sie<strong>de</strong>lten sich viele Kaufleute an, die darin ihre Han<strong>de</strong>lsgrundlage sahen.<br />
Stadtrechtsverleihung<br />
Am 31. Oktober 1234 verlieh <strong>de</strong>r slawische Fürst Wizlaw I. <strong>zu</strong> Charenza (Rügen) <strong>de</strong>m Fischerdorf Stralow am Strelasund das Lübische Stadtrecht mit folgen<strong>de</strong>m Text:<br />
„Witzlaw, von Gottes Gna<strong>de</strong>n Fürst <strong>de</strong>r Ruianer, allen Getreuen, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>nen das gegenwärtige Schreiben gelangt, Gruß im Herrn. Wir wollen es allen, sowohl <strong>de</strong>m gegenwärtigen wie <strong>de</strong>m<br />
künftigen Geschlecht kund getan haben, dass wir unserer Stadt Stralow dieselbe Gerechtigkeit und Freiheit verliehen haben, welche <strong>de</strong>r Stadt Rostock verliehen ist. Auf dass nun diese<br />
von uns gegebene Zusage fest und unverbrüchlich gehalten wer<strong>de</strong>, bestätigen und bekräftigen wir sie durch gegenwärtiges Schreiben und Anhängung unseres Siegels. Gegeben <strong>zu</strong><br />
Charenz, im Jahre <strong>de</strong>r Gna<strong>de</strong> 1234, am 31. Oktober.“<br />
Die Urkun<strong>de</strong> besteht aus einem lediglich 5,5 x 15 Zentimeter großen Pergamentstreifen. Unüblich sind aber nicht nur <strong>de</strong>r spärliche Inhalt und die Größe, son<strong>de</strong>rn auch, dass keine<br />
Zeugen für diesen Akt benannt sind. Die Urkun<strong>de</strong> wird im Stadtarchiv Stralsund verwahrt.<br />
Die Stadtgründung erfolgte von Seiten <strong>de</strong>r rügenschen Fürsten nicht selbstlos: Der Han<strong>de</strong>l sollte <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Entwicklung und die <strong>zu</strong> erwarten<strong>de</strong>n Abgaben <strong>de</strong>r fürstlichen Kasse<br />
dienen. Gemäß <strong>de</strong>r damals gelten<strong>de</strong>n Kastellaneiverfassung unterstand ein Dorf <strong>de</strong>m jeweiligen Landvogt, eine Stadt aber direkt <strong>de</strong>m Fürsten. Auch die Stralsun<strong>de</strong>r Kaufleute<br />
profitierten, da mit <strong>de</strong>r Verleihung <strong>de</strong>s Stadtrechts auch die Zollfreiheit verbun<strong>de</strong>n war.<br />
13. bis 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Deutsche Besiedlung<br />
Im Zuge <strong>de</strong>r Christianisierung kamen bald Menschen aus <strong>de</strong>n westelbischen Gebieten: Nie<strong>de</strong>rsachsen, Westfalen, Holsteiner, Friesen, Hollän<strong>de</strong>r und Flamen zogen in <strong>de</strong>n ostelbischen<br />
Raum. Nach und nach nahmen sie Besitz von <strong>de</strong>n neuen Siedlungsräumen, wie die Gründungswelle <strong>de</strong>r Städte entlang <strong>de</strong>r Ostseeküste belegt. Aus <strong>de</strong>r Stadtgründungsurkun<strong>de</strong> geht<br />
hervor, dass es sich bei <strong>de</strong>n Grün<strong>de</strong>rn Stralsunds wohl um Rostocker Kaufleute han<strong>de</strong>lte. Da<strong>zu</strong> kamen weitere Einwan<strong>de</strong>rer. Anhand <strong>de</strong>r Namen im Stadtbuch von 1270 und im<br />
Bürgerbuch ab 1319, die oft auf die regionale Herkunft <strong>de</strong>uteten, ist erkennbar, dass knapp ein Drittel aus <strong>de</strong>m direkten Umland (Festland und Rügen) stammte und zwei Drittel aus<br />
ferneren Gegen<strong>de</strong>n – bis hin nach Nowgorod, Italien, Böhmen – <strong>zu</strong>gezogen waren.[2] Obwohl die Stadt auf ehemals slawisch besie<strong>de</strong>ltem Territorium lag, überwog schon bald <strong>de</strong>r Anteil<br />
<strong>de</strong>r Deutschen. Die Slawen mussten sich bald <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Zuwan<strong>de</strong>rern in Sprache und Lebensweise anpassen.<br />
Am 25. Februar 1240 stellte Fürst Witzlaw I. auf seinem Prohner Schloss eine zweite Urkun<strong>de</strong> aus, die be<strong>de</strong>utsam für Stralsund war. In <strong>de</strong>m Text nannte Witzlaw I. nochmals die<br />
Stadtrechtsverleihung nach Rostocker Vorbild, erwähnt wur<strong>de</strong> auch erstmals Stralesund als Stadtname. Der Stadt erhielt das Fährdorf (antiquus navalis transitus) gegen Zahlung von<br />
neunzig Mark rügenscher Münze und die Insel Strale sowie Wäl<strong>de</strong>r (heute: Frankenvorstadt) und Äcker (heute: Kniepervorstadt) innerhalb <strong>de</strong>r Stadtgrenzen als Geschenk. Zusätzlich<br />
gestattete die Urkun<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Stralsun<strong>de</strong>rn freien Fischfang und die Jagd auf Nie<strong>de</strong>rwild. Sie garantierte auch die Zollfreiheit im gesamten Fürstentum. Schnell entwickelte sich die junge<br />
Stadt <strong>zu</strong> einem aufblühen<strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>lsstandort und als Konkurrenz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n bestehen<strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>lstädte. Im Jahr 1249 überfiel eine Flotte <strong>de</strong>r Hansestadt Lübeck unter Alexan<strong>de</strong>r von<br />
Soltwe<strong>de</strong>ls unerwartet die Stadt und legte sie in Schutt und Asche, die Stadt wur<strong>de</strong> aber schnell wie<strong>de</strong>r aufgebaut.<br />
Die Anlage <strong>de</strong>r Stadt<br />
Die ursprüngliche Stadt reichte bis an heutigen Straßen Papenstraße und Apollonienmarkt. In <strong>de</strong>r Altstadt, ausgehend vom Alten Markt als damaligem Stadtzentrum, wur<strong>de</strong>n<br />
beeindrucken<strong>de</strong> Bauten errichtet. Die Nikolaikirche wur<strong>de</strong> 1276 erstmals erwähnt, im langen inneren Gang <strong>de</strong>s angrenzen<strong>de</strong>n Rathauses befan<strong>de</strong>n sich ursprünglich die Verkaufsstän<strong>de</strong>
vieler Händler. Das Gebiet südwestlich davon gehörte <strong>zu</strong>nächst weiterhin <strong>de</strong>m Rügenfürsten, <strong>de</strong>r dort vermutlich schon seit 1242 seine Curie (Nie<strong>de</strong>rlassung) hatte[3] und im Jahr 1251<br />
ein Dominikanerkloster grün<strong>de</strong>te.[4] Da die ursprüngliche Altstadt bald an ihre räumlichen Grenzen stieß, sie<strong>de</strong>lten sich die Bürger auch in <strong>de</strong>r Neustadt an. Diese wur<strong>de</strong> 1256 erstmals<br />
urkundlich erwähnt.[5] Im Jahre 1270 war erstmals vom Neuen Markt die Re<strong>de</strong>[6], mit <strong>de</strong>m 1298 die Marienkirche erwähnt wur<strong>de</strong>. Diese Pfarrkirche ersetzte die Peter-und-Paul-Kirche,<br />
von <strong>de</strong>r nichts erhalten ist; vermutlich befand sie sich an <strong>de</strong>r Ecke Franken- und Badstüberstraße.<br />
Bei<strong>de</strong> Teile <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong>n ab 1261 durch einen gemeinsamen Befestigungsring geschützt, <strong>de</strong>r En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts fertiggestellt wur<strong>de</strong>. Als günstig erwies sich dabei die Lage<br />
<strong>de</strong>r Stadt, die von allen Seiten durch Wasser (Strelasund, Teiche) begrenzt war. 22 Stadttore, sechs Wassertore und fünf Landtore, jeweils als Doppeltor angelegt, befan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r<br />
Stadtmauer.<br />
Da die räumliche Situation in <strong>de</strong>r Altstadt auf Grund <strong>de</strong>s prosperieren<strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>ls immer schwieriger wur<strong>de</strong>, begann in <strong>de</strong>n 1260er Jahren die Erweiterung mit <strong>de</strong>m Zusammenwachsen<br />
von Alt- und Neustadt <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 13. Jahrhun<strong>de</strong>rts. 1271 wur<strong>de</strong>n große Teile <strong>de</strong>r überwiegend aus Holz gebauten Stadt durch ein Feuer zerstört. Danach wur<strong>de</strong> die Stadt mit einem<br />
erheblich höheren Anteil an Backsteinbauten erneuert. 1283 gab es drei Ziegeleien in Stralsund.[7]<br />
Im Jahr 1269 gab Fürst Wizlaw II. urkundlich bekannt, dass er <strong>de</strong>r neuen Stadt Scha<strong>de</strong>gard („Graue Burg“) die Stadtrechte entziehen und sie „<strong>zu</strong>m Ge<strong>de</strong>ihen und Nutzen seiner geliebten<br />
Bürger <strong>zu</strong> Stralsund aufgeben“ wer<strong>de</strong> („propter melius bonum et propter utilitatem futuram […] burgensium nostrorum vi<strong>de</strong>licet dilecttorum Stralesund“). Einige Historiker vermuten<br />
eine I<strong>de</strong>ntität <strong>de</strong>r Neustadt mit Scha<strong>de</strong>gard. Dem steht die urkundliche Erwähnung <strong>de</strong>r Neustadt als solche um 1256 entgegen.<br />
Obwohl sich die Stadt recht schnell entwickelte, waren in <strong>de</strong>n ersten 50 Jahren noch viele Flächen innerhalb <strong>de</strong>r Stadtgrenze unbebaut. Die Grundlage für die Versorgung <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r<br />
mit Lebensmitteln bil<strong>de</strong>te die so genannte Feldmark, <strong>de</strong>ren Äcker, Wei<strong>de</strong>n und Gärten Bürgern <strong>de</strong>r Stadt und <strong>de</strong>n Ackerbürgern gehörten. Die zahlreichen Gewerke waren <strong>zu</strong>meist in<br />
kleineren Betrieben angesie<strong>de</strong>lt. Getrei<strong>de</strong> wur<strong>de</strong> z. B. <strong>zu</strong>m Teil direkt in <strong>de</strong>r Stadt verarbeitet, was <strong>de</strong>r Name Mühlenstraße belegt.<br />
Die große Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>r Bierherstellung zeigte sich im Vorhan<strong>de</strong>nsein eines im ersten Stadtbuch erwähnten Hopfenmarktes. Der Charakter als Seestadt war prägend für weitere<br />
Handwerkszweige wie das Schiffbauerhandwerk. Die ersten Aufzeichnungen berichten zwar erst 1393 von acht Werften auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r heutigen Frankenvorstadt[8], aus an<strong>de</strong>ren<br />
Quellen kann jedoch geschlossen wer<strong>de</strong>n, dass schon vor <strong>de</strong>r Stadtgründung Schiffe gebaut wur<strong>de</strong>n. Aus Wismar wur<strong>de</strong> 1284 vom Kauf Stralsun<strong>de</strong>r Schiffe berichtet. Aber auch alle<br />
Handwerke rund um Schiffbau und Han<strong>de</strong>l hatten sich in Stralsund angesie<strong>de</strong>lt, so beispielsweise Böttcher, <strong>de</strong>nn <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l mit nahe<strong>zu</strong> allen Produkten erfolgte damals in Tonnen und<br />
Fässern.<br />
Han<strong>de</strong>l und Gewerbe<br />
In <strong>de</strong>r Politik spielten die Handwerker keine be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Rolle. Das Lübische Stadtrecht untersagte die Mitgliedschaft von Angehörigen <strong>de</strong>r Handwerkerschaft im Rat <strong>de</strong>r Stadt. Dies<br />
führte im Laufe <strong>de</strong>r Jahre immer wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> Streit mit <strong>de</strong>n Kaufleuten, die im Rat die Geschicke <strong>de</strong>r Stadt bestimmten. Diese exportierten vor allem landwirtschaftliche Produkte, Brenn-<br />
und Bauholz, Fisch, Tran, Getrei<strong>de</strong>, Hopfen, Rin<strong>de</strong>r und Schweine sowie Bier. War anfangs noch <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l hauptsächlich auf die einheimischen Produkte beschränkt, wur<strong>de</strong> die Palette<br />
alsbald insbeson<strong>de</strong>re im Fernhan<strong>de</strong>l erweitert. Die Stralsun<strong>de</strong>r Kaufleute waren dadurch <strong>zu</strong> Zwischenhändlern gewor<strong>de</strong>n, was mehr Profit versprach.<br />
Da Stralsund auf <strong>de</strong>m Gebiet eines dänischen Lehens lag, war es nahe<strong>zu</strong> selbstverständlich, dass die Stralsun<strong>de</strong>r ihre ersten Han<strong>de</strong>lsbeziehungen nach dort knüpften. Nachgewiesen sind<br />
diese erstmals im Jahr 1249. Für dieses Jahr belegte eine Urkun<strong>de</strong>, dass Schiffbrüchige aus <strong>de</strong>n rügenschen Fürstentümern vom Strandrecht aus<strong>zu</strong>nehmen waren. Wichtig für die<br />
Kaufleute <strong>de</strong>r Stadt <strong>de</strong>r Aufbau und <strong>de</strong>r Pflege von Han<strong>de</strong>lsbeziehungen <strong>zu</strong> Kaufleuten aus Flan<strong>de</strong>rn (Brügge), Spanien, Italien, Frankreich und <strong>de</strong>m süd<strong>de</strong>utschen Raum.<br />
Han<strong>de</strong>lsbeziehungen existierten ferner nach England und Schwe<strong>de</strong>n, Probleme bereiteten die Beziehungen nach Norwegen. Dafür lief das Geschäft mit Händlern aus <strong>de</strong>m baltischen<br />
Raum hervorragend. Nowgorod, Riga, Reval und Pskow waren Ziele von Fernreisen. Dass gera<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l mit Nowgorod (Peterhof) be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Gewinne erbrachte zeigt noch heute<br />
das Nowgorodfahrergestühl in <strong>de</strong>r Nikolaikirche. Wichtigste Gil<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kaufmannschaft war <strong>zu</strong> damaliger Zeit in Stralsund die <strong>de</strong>r Gewandschnei<strong>de</strong>r.<br />
Die erstarken<strong>de</strong> Wirtschaftskraft brachte <strong>de</strong>n Vorteil mit, dass sich die Stralsun<strong>de</strong>r von ihren Lan<strong>de</strong>sherren, <strong>de</strong>n rügenschen und später <strong>de</strong>n pommerschen Fürsten, weitreichen<strong>de</strong><br />
Privilegien erkaufen konnten, die beinahe an eine Autonomie heranführten. Allerdings blieb Stralsund <strong>de</strong>r rechtliche Status einer Freien Stadt, wie ihn Lübeck o<strong>de</strong>r Hamburg erreichten,<br />
immer verwehrt – dafür spielte Stralsund eine <strong>zu</strong> große strategische Rolle in <strong>de</strong>n Plänen <strong>de</strong>r jeweils Herrschen<strong>de</strong>n.
Mit <strong>de</strong>r zweiten Verleihung <strong>de</strong>s Stadtrechts im Jahr 1240 hatte Stralsund vom Fürsten Wizlaw I. an das Stadtgebiet angrenzen<strong>de</strong>n Wald sowie die Feldmark <strong>de</strong>s alten Fährdorfes<br />
erworben und <strong>zu</strong><strong>de</strong>m neben <strong>de</strong>r Insel Strale Äcker und Wei<strong>de</strong>n geschenkt bekommen. Diese Stadtfeldmark genannten Flächen wur<strong>de</strong>n an Stralsun<strong>de</strong>r Bürger verpachtet. Die in Geld o<strong>de</strong>r<br />
Naturalien <strong>zu</strong> entrichten<strong>de</strong> Pacht bil<strong>de</strong>te schnell eine <strong>de</strong>r Haupteinnahmequellen <strong>de</strong>r Stadt neben <strong>de</strong>m Zoll auf Waren und <strong>de</strong>n Verbrauchssteuern und Mieten. Städtischer Grundbesitz<br />
wur<strong>de</strong> in Zeiten dringen<strong>de</strong>n Geldbedarfs ausschließlich an Stralsun<strong>de</strong>r Bürger verkauft, gemäß Lübischem Recht war <strong>de</strong>r Verkauf an „Geistliche, Ritter o<strong>de</strong>r Ritterbürtige“ untersagt: Die<br />
Bürgerschaft wollte einmal gewonnenes Eigentum keineswegs wie<strong>de</strong>r an Adlige o<strong>de</strong>r die Kirche abtreten.<br />
Noch im 13. Jahrhun<strong>de</strong>rt <strong>de</strong>hnte die Stadt ihren Grundbesitz <strong>de</strong>utlich über die einstigen Grenzen <strong>de</strong>r Feldmark aus. 1290 wur<strong>de</strong>n die Dörfer Voig<strong>de</strong>hagen und Lü<strong>de</strong>rshagen erworben.<br />
Von Wizlaw I. ließ sich die Stadt das Eigentum nochmals schriftlich bestätigen und da<strong>zu</strong> das Recht einräumen, auch künftig Erwerbungen von Grundbesitz außerhalb <strong>de</strong>r Stadtmauern <strong>zu</strong><br />
tätigen. 1301 kam das Dorf Vogelsang, 1302 Lüssow in städtischen Besitz. 1306 erwarb Stralsund Wei<strong>de</strong>land auf <strong>de</strong>m Zingst, 1321 dann auch die Dörfer Devin, Tessekenhagen,<br />
Zitterpennigshagen, Wendorf, Lützow, Langendorf und Kedingshagen.<br />
Mitglied <strong>de</strong>r Hanse<br />
Die (Gründungs-)Mitgliedschaft und teilweise be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Rolle in <strong>de</strong>r Hanse prägten <strong>de</strong>n Charakter <strong>de</strong>r Stadt, gaben ihr ein Selbstverständnis, welches sich wie<strong>de</strong>rum in einer Zunahme<br />
<strong>de</strong>r politischen und wirtschaftlichen Macht nie<strong>de</strong>rschlug. Mit <strong>de</strong>r Stadtgründung wur<strong>de</strong>n wirtschaftliche Interessen <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>ren Ostseestädte berührt: So hatte Lübeck bis dato diverse<br />
Han<strong>de</strong>lsprivilegien im Fürstentum Rügen inne, die zwar offiziell nicht en<strong>de</strong>ten, durch die Existenz eines aufstreben<strong>de</strong>n Konkurrenten jedoch faktisch beschnitten wur<strong>de</strong>n. Im Jahre 1249<br />
eroberte Lübeck mit seiner Flotte nach <strong>de</strong>m Sieg über <strong>de</strong>n Dänenkönig und <strong>de</strong>r Eroberung <strong>de</strong>s Kopenhagener Schlosses die neue Konkurrentin am Strelasund und brannte sie nie<strong>de</strong>r.<br />
Stralsund wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r aufgebaut, an<strong>de</strong>re Konkurrenten wie Scha<strong>de</strong>gard durch Einflussnahme <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r beim rügenschen Fürsten verdrängt. Den Han<strong>de</strong>l treiben<strong>de</strong>n Bürgern <strong>de</strong>r<br />
Städte entlang <strong>de</strong>r Ostseeküste jedoch war klar, dass ihr Wohl eher in einem Zusammengehen als in ewigem Zwist liegen wür<strong>de</strong>; nur so konnten sie auch langfristig ihre Interessen gegen<br />
die <strong>de</strong>r Adligen durchsetzen. 1265 schloss Stralsund einen Vertrag mit Demmin und 1267 mit Tribsees, in welchen weitgehen<strong>de</strong> Rechtshilfen besiegelt wur<strong>de</strong>n. 1278 erwarb Stralsund<br />
<strong>zu</strong>sammen mit Lübeck, Rostock, Wismar und Greifswald die Zollfreiheit auf <strong>de</strong>n Märkten in Hvidanger (Dänemark). 1283 waren es wie<strong>de</strong>r diese Städte sowie Stettin, Demmin und<br />
Anklam, die im Rostocker Landfrie<strong>de</strong>n Verträge mit <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sfürsten schlossen. Darin wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>n Städten erstmals auch das Recht eingeräumt, Bündnisse <strong>zu</strong> schließen.<br />
Bereits En<strong>de</strong> 1283 bewährte sich dieses Bündnis erstmals in <strong>de</strong>r Blocka<strong>de</strong> <strong>de</strong>r norwegischen Häfen im Streit zwischen Norwegen und <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Han<strong>de</strong>lsstädten. 1293 verpflichteten<br />
sich Stralsund, Lübeck, Rostock, Wismar und Greifswald <strong>zu</strong> gegenseitigem Beistand, was nach diplomatischen Maßnahmen <strong>de</strong>r Städte füreinan<strong>de</strong>r auch das Aufstellen gemeinsamer<br />
Kriegsflotten vorsah. Der Grundstein für die Städtehanse („Hanse“ be<strong>de</strong>utet „Schar“) war gelegt.<br />
In <strong>de</strong>r Folgezeit offenbarten sich immer wie<strong>de</strong>r die großen Vorteile, die das Bündnis für die Han<strong>de</strong>lsstädte bot. So wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n <strong>de</strong>utschen Hansestädten in Norwegen günstige Zölle<br />
eingeräumt; 1358 sicherte König Magnus <strong>de</strong>n Stralsun<strong>de</strong>r Bürgern seinen beson<strong>de</strong>ren Schutz <strong>zu</strong>, sofern sie Norwegen als Han<strong>de</strong>ltreiben<strong>de</strong> besuchten. Auch im Han<strong>de</strong>l mit England war<br />
die Hanse ein Trumpf für die Kaufleute. Und als es im Han<strong>de</strong>l mit Flan<strong>de</strong>rn 1356 <strong>zu</strong> Streitigkeiten um das Hansekontor in Brügge kam, die durch diplomatische Bemühungen nicht<br />
bereinigt wer<strong>de</strong>n konnten, wen<strong>de</strong>ten die Hansestädte das bewährte Mittel <strong>de</strong>r Blocka<strong>de</strong> an: 1360 gab Flan<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>n Hansestädten nach. Weitere Han<strong>de</strong>lspartner waren Kaufleute aus<br />
Westfalen (auch auf <strong>de</strong>m Landwege wur<strong>de</strong>n Waren gehan<strong>de</strong>lt, so sind rege Geschäfte <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Kaufleute mit Dortmund und Soest belegt), Elbing, Kolberg, Litauen und<br />
Nowgorod.<br />
Mit <strong>de</strong>m Han<strong>de</strong>l entwickelte sich auch das produzieren<strong>de</strong> Gewerbe. Diese Handwerker hatten sich in Ämtern (Zünfte) organisiert, die nach Gewerken unterschie<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n. Erstes<br />
nachweisbares Amt in Stralsund war das <strong>de</strong>r Schumacher, welches 1290 belegt ist. An <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>r Ämter stan<strong>de</strong>n die gewählten Altermänner (Zunftvorsteher). Im Gegensatz <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n<br />
Kaufleuten hatten jedoch die Ämter keinerlei politische Mitbestimmung. Das Lübische Recht gestattete nur Kaufleuten die Erlangung <strong>de</strong>r Mitgliedschaft im Rat <strong>de</strong>r Stadt. Altermänner<br />
konnten nur im Beisein eines Ratsherren gewählt wer<strong>de</strong>n und mussten <strong>de</strong>n Beschlüssen <strong>de</strong>r Ratsherren stets nachkommen. Wi<strong>de</strong>rspruch wur<strong>de</strong> hart bestraft: 1340 wur<strong>de</strong> ein<br />
Böttchermeister, <strong>de</strong>r die Abset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s mit <strong>de</strong>r Zustimmung <strong>de</strong>s Rates gewählten Altermannes seines Amtes gefor<strong>de</strong>rt hatte, aus <strong>de</strong>r Stadt verbannt. Die Aufnahme in ein Amt war streng<br />
reglementiert. Der um Aufnahme bitten<strong>de</strong> Handwerker musste seine eheliche und vor allem freie Geburt nachweisen, ein Meisterstück vorweisen, einen finanziellen Obolus an das Amt<br />
und eine Weinspen<strong>de</strong> an die Altermänner entrichten, das Bürgerrecht vor <strong>de</strong>m Rat erwerben und ein bestimmtes Vermögen nachweisen. Die Zahl <strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>r eines Amtes war<br />
begrenzt. Die Ämter legten <strong>zu</strong><strong>de</strong>m fest, wie viele Gesellen die Meister beschäftigen und wie viele Aufträge sie annehmen durften. Streitigkeiten hatten <strong>zu</strong>erst <strong>de</strong>n Altermännern<br />
vorgetragen <strong>zu</strong> wer<strong>de</strong>n, bevor <strong>de</strong>r Rat angerufen wur<strong>de</strong>. Dies ergab sich aus <strong>de</strong>m Lübschen Recht, das <strong>de</strong>n Ämtern die sog. Morgensprache (morgensprak) einräumte. Hierbei han<strong>de</strong>lte es
sich um die Regelung innerer Angelegenheiten auf Versammlungen <strong>de</strong>r Ämter.<br />
Die Städte waren in einer fatalen Situation, die aus ihrer Lage innerhalb von Län<strong>de</strong>rn feudaler Herrscher wie z. B. <strong>de</strong>r Dänen resultierte. Diesen gaben sie Geld gegen Privilegien. Als<br />
sich die Fürsten und Könige wie<strong>de</strong>rum ihrer Einflussnahme auf die reichen Städte weitgehend beraubt sahen, machten diese mobil gegen die Seestädte: 1311 zog im Markgrafenkrieg<br />
eine vereinigte Streitmacht aus Dänemark, Sachsen, Braunschweig, Thüringen, Meißen, Polen, Bran<strong>de</strong>nburg, Holstein, Mag<strong>de</strong>burg, Bremen und Wittenburg <strong>zu</strong>erst gegen Wismar und<br />
Rostock, die von <strong>de</strong>n Streitmächten erobert wur<strong>de</strong>n. Stralsund kaufte sich 1313 frei und verzichtete auf einen Großteil seiner bisherigen Privilegien. Schon drei Jahre später aber hatte<br />
sich die Lage wie<strong>de</strong>rum grundlegend geän<strong>de</strong>rt: Nach<strong>de</strong>m sich Stralsund mit <strong>de</strong>n Bran<strong>de</strong>nburgern verbün<strong>de</strong>te, wur<strong>de</strong> 1316 die Belagerung Stralsunds durch dänische und mit <strong>de</strong>n Dänen<br />
verbün<strong>de</strong>te Truppen gebrochen. Die Gefangennahme <strong>de</strong>s Herzogs von Sachsen-Lauenburg brachte <strong>de</strong>r Stadt hohe Lösegel<strong>de</strong>r (wahrscheinlich wur<strong>de</strong> davon <strong>de</strong>r Schaugiebel <strong>de</strong>s<br />
Rathauses finanziert), nach <strong>de</strong>m Bruch <strong>de</strong>r Koalition gegen Stralsund konnte die wie<strong>de</strong>r erstarkte Stadt ihre Privilegien sogar noch ausbauen, so erwarb Stralsund <strong>de</strong>n Stralsun<strong>de</strong>r und<br />
rügenschen Zoll sowie die Münze im Fürstentum, da<strong>zu</strong> die Schirmherrschaft über die Schulen und die fürstlichen Mühlen vor <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Nach<strong>de</strong>m mit <strong>de</strong>m To<strong>de</strong> <strong>de</strong>s rügenschen Fürsten Wizlaw III. die Besitzfrage über das Fürstentum aufkam, verbün<strong>de</strong>ten sich Dänen und Mecklenburger <strong>zu</strong>r Übernahme <strong>de</strong>r Macht dort.<br />
Stralsund schlug mit <strong>de</strong>m holsteinischen Verbün<strong>de</strong>ten jedoch 1327 die Mecklenburger, das Fürstentum Rügen vereinigte sich mit <strong>de</strong>m Herzogtum Pommern-Wolgast. Nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong><br />
dieser langen kriegerischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen, die die wirtschaftliche Entwicklung stark gehemmt hatten, blühten <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l und die Wirtschaft Stralsunds schnell wie<strong>de</strong>r auf.<br />
Durch das dank <strong>de</strong>r Vereinigung <strong>de</strong>r Län<strong>de</strong>r erweiterte Wirtschaftsgebiet und <strong>de</strong>n Ausbau <strong>de</strong>s Fernhan<strong>de</strong>ls hatte Stralsund große Vorteile. Der Ostseehan<strong>de</strong>l bekam jedoch mit <strong>de</strong>n<br />
Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen zwischen <strong>de</strong>m König Magnus von Schwe<strong>de</strong>n und Norwegen und <strong>de</strong>m holsteinischen Herrscher in Dänemark einen Dämpfer, da sich Piraterie immer mehr <strong>zu</strong>m<br />
Hin<strong>de</strong>rnis entwickelte. Erst 1343 konnten die Mitglie<strong>de</strong>rstädte <strong>de</strong>r Hanse in einem Vertrag mit König Magnus diese Hin<strong>de</strong>rnisse abstellen.<br />
Der Stralsun<strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong>n von 1370<br />
Stralsunds Rolle im Wendischen Quartier <strong>de</strong>r Hanse war <strong>zu</strong> dieser Zeit zweifellos gleich hinter Lübeck an<strong>zu</strong>setzen. Diese politische Be<strong>de</strong>utung Stralsunds fand ihren Ausdruck in <strong>de</strong>r<br />
Wahl Stralsunds für die Besiegelung <strong>de</strong>r Ergebnisse <strong>de</strong>r Verhandlungen <strong>de</strong>r Hanse mit <strong>de</strong>m dänischen Rat, was als Stralsun<strong>de</strong>r Frie<strong>de</strong>n in die Geschichte einging.<br />
Die Stadtverfassung von 1391<br />
Nach <strong>de</strong>m Sieg über Dänemark blühte <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l erneut auf. Von diesem Aufschwung profitierten nahe<strong>zu</strong> alle Schichten in Stralsund. Politisch jedoch war weiterhin einzig <strong>de</strong>r Rat<br />
bestimmend, we<strong>de</strong>r die Ämter noch an<strong>de</strong>re Handwerker hatten Mitbestimmungsrechte. Dies führte in allen Hansestädten <strong>zu</strong> Unruhen, die sich 1391 auch in Stralsund in Erhebungen<br />
äußerten. Die Stralsun<strong>de</strong>r Ratspolitik bestimmte seit 1361 maßgeblich <strong>de</strong>r Bürgermeister Bertram Wulflam mit. Zwischen 1361 und 1385 nahm er als Vertreter Stralsunds an 59<br />
Hansetagen teil, in <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Kriegen gegen Dänemark hatte er sich großes Ansehen erworben und seine Macht gefestigt. Am Alten Markt hatte er sich gegenüber <strong>de</strong>m Rathaus ein<br />
noch heute erhaltenes Han<strong>de</strong>ls- und Wohnhaus (Wulflamhaus) bauen lassen, <strong>de</strong>ssen Front bewusst <strong>de</strong>m Rathaus <strong>zu</strong>gewandt war. Sein Han<strong>de</strong>ln wur<strong>de</strong> immer diktatorischer und<br />
selbstherrlicher. Zu<strong>de</strong>m erregte auch sein Sohn Wulf Wulflam mit seiner Herrschsucht und Willkür Aufruhr. Während Bertram Wulflam immerhin durch seine Leistungen für Stralsund<br />
Ansehen genoss, konnte Wulf Wulflam, <strong>de</strong>r seine politischen Ämter auf Betreiben seines Vaters erhalten hatte, nicht mit Erfolgen aufwarten. Eine von ihm befehligte Streitmacht, die<br />
gegen Seeräuber vorgehen sollte, scheiterte 1385. In <strong>de</strong>r Folge mussten die Hansestädte 1386 mit <strong>de</strong>n adligen Seeräubern ein <strong>de</strong>mütigen<strong>de</strong>s Waffenstillstandsabkommen abschließen.<br />
Unfrie<strong>de</strong> zog in Stralsund ein und brachte <strong>de</strong>n Rat da<strong>zu</strong>, <strong>de</strong>n Wulflams nicht gewogene Ratsherren auf<strong>zu</strong>stellen. Einer von ihnen war Karsten Sarnow, <strong>de</strong>r 1391 in einem Unternehmen<br />
gegen Seeräuber diese vernichtend schlagen konnte, was ihm in Stralsund einen guten Stand sicherte. Sarnow, in Opposition <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Wulflams und <strong>de</strong>r hergebrachten Stadtverfassung<br />
stehend, erzwang am 2. Mai 1391 eine Reform dieser Stadtverfassung.<br />
Alle gelten<strong>de</strong>n Ratsverfassungen (willköre) wur<strong>de</strong>n außer Kraft gesetzt und u. a. eine Vertretung <strong>de</strong>r Altermänner, die Gemein<strong>de</strong>altermännervertretung, geschaffen. Damit gewannen die<br />
Ämter erstmals einen beschei<strong>de</strong>nen Einfluss auf die Geschicke <strong>de</strong>r Stadt. 1391 gab es eine Missernte, was <strong>zu</strong> wirtschaftlichen Schwierigkeiten und Verdruss führte. Die Bemühungen <strong>de</strong>r<br />
aus <strong>de</strong>r Stadt vertriebenen Wulflams bei <strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren Städten <strong>de</strong>r Hanse führten am 18. Oktober 1392 sogar soweit, dass Stralsund <strong>de</strong>r Ausschluss aus <strong>de</strong>r Hanse angedroht wur<strong>de</strong>, sofern<br />
nicht die alte Verfassung wie<strong>de</strong>r hergestellt wür<strong>de</strong>. Die Stimmung in Stralsund wen<strong>de</strong>te sich gegen Sarnow; er wur<strong>de</strong> am 21. Februar 1393 auf <strong>de</strong>m Alten Markt hingerichtet. Die<br />
Stadtverfassung wur<strong>de</strong> kassiert.<br />
Frie<strong>de</strong>n zog nach Stralsund weiterhin nicht ein. Stets gab es Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r mit ihren Lan<strong>de</strong>sherren o<strong>de</strong>r frem<strong>de</strong>n Mächten, aber auch intern waren Streitigkeiten
anhängig. So etwa 1407, als die Stralsun<strong>de</strong>r im Papenbrand thom Sun<strong>de</strong> drei Priester verbrannten, <strong>de</strong>nen sie Hochmut vorwarfen. Im Streit zwischen Dänemark und Holstein <strong>zu</strong> Beginn<br />
<strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts versuchten bei<strong>de</strong> Herrscher, die Hanse auf ihre Seite <strong>zu</strong> ziehen. 1423 schloss die Hanse ein Bündnis mit <strong>de</strong>m dänischen König Erich, das dieser allerdings schon<br />
1426 brach, in<strong>de</strong>m er strikte Han<strong>de</strong>lsbeschränkungen wie <strong>de</strong>n Sundzoll erließ, die die Hanse schwer trafen. Am 22. September 1426 schlossen Lübeck, Hamburg, Lüneburg, Wismar,<br />
Rostock und Stralsund ein Kriegsbündnis gegen König Erich und verbün<strong>de</strong>ten sich alsdann mit <strong>de</strong>n Herzögen von Schleswig. Nur 18 sächsische Hansestädte schlossen sich <strong>de</strong>m Bündnis<br />
an, die preußischen Städte verweigerten die Zusammenarbeit, und auch die bei<strong>de</strong>n Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s wendischen Viertels, Greifswald und Anklam, verweigerten sich. Diese bei<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n<br />
daraufhin aus <strong>de</strong>r Hanse ausgeschlossen. Stralsund stand unter pommerscher Lan<strong>de</strong>sherrschaft, die wie<strong>de</strong>rum eng mit Dänemark verban<strong>de</strong>t war. Diplomatischer Druck von dieser Seite<br />
wur<strong>de</strong> jedoch seitens Stralsunds <strong>zu</strong>rückgewiesen.<br />
1427 brachen die Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen aus. Nach anfänglichen großen Erfolgen <strong>de</strong>r Hansestädte wen<strong>de</strong>te sich schnell das Blatt. Am 11. Juli 1427 erlitt die 36 Schiffe starke Flotte <strong>de</strong>r<br />
Hanse unter Kommando <strong>de</strong>s Lübecker Bürgermeisters Ti<strong>de</strong>mann Steen im Strelasund eine schwere Nie<strong>de</strong>rlage. In <strong>de</strong>n Städten wur<strong>de</strong> Protest laut gegen <strong>de</strong>n Rat, so auch in Stralsund. Im<br />
Januar 1427 bil<strong>de</strong>te sich eine oppositionelle Gruppe unter Führung <strong>de</strong>r Brauer, die allerdings nie<strong>de</strong>rgeschlagen wur<strong>de</strong>. Trotz <strong>de</strong>r Unruhen aber wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Krieg weitergeführt. Kaperkrieg<br />
und Angriffe auf Dänemark und Norwegen wur<strong>de</strong>n forciert. Im Gegen<strong>zu</strong>g rüstete Dänemark eine mit 77 Schiffen enorm starke Flotte aus, die am 5. Mai 1429 Stralsund angriff.<br />
Vollkommen überrumpelt, gab es keinerlei nennenswerte Gegenwehr. Die Dänen kaperten die Stralsun<strong>de</strong>r Schiffe; einige entführten sie, die an<strong>de</strong>ren wur<strong>de</strong>n in Brand gesetzt. Da sich die<br />
Dänen aber für ihre Rückfahrt einige Tage Zeit ließen, die sie <strong>zu</strong>m Brandschatzen und Räubern im Strelasund nutzten, konnten die Stralsun<strong>de</strong>r sechs neu im Hafen eingetroffene Schiffe<br />
aus Wismar bzw. Lübeck <strong>zu</strong> Kriegsschiffen umrüsten und gegen die dänische Riesenflotte ziehen lassen. Dies wur<strong>de</strong> ein Erfolg, <strong>de</strong>m die Dänen sich nur durch Flucht und unter großen<br />
Verlusten an Menschen und Schiffen entziehen konnten. Zum An<strong>de</strong>nken an diesen Erfolg nannten die Stralsun<strong>de</strong>r fortan die Insel Strale <strong>de</strong>n Dänholm. Die folgen<strong>de</strong> Zeit war durch<br />
Diplomatie bestimmt. Im Jahr 1430 schloss Stralsund einen Separatfrie<strong>de</strong>n mit König Erich ab, <strong>de</strong>r bei <strong>de</strong>n Bündnispartnern Wi<strong>de</strong>rstand weckte. Stralsund jedoch hatte guten Grund für<br />
diesen Frie<strong>de</strong>n, da es durch <strong>de</strong>n Krieg mehr als die Partner auch wirtschaftliche Nachteile hatte, verlagerten sich doch die Han<strong>de</strong>lswege auch <strong>de</strong>r neutralen Städte vom Strelasund auf <strong>de</strong>n<br />
Landweg. Mit diesem Frie<strong>de</strong>n stand Stralsund nun allerdings zwischen <strong>de</strong>n Parteien, und erst mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n König Erichs mit allen Hansestädten, <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Vordingborg<br />
(1435) wur<strong>de</strong> die Lage wie<strong>de</strong>r besser. Es hatte sich gezeigt, dass die Hanse keineswegs so einig war wie in <strong>de</strong>n Anfangsjahren.<br />
Blütezeit<br />
Das 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Blütezeit Stralsunds. Fernhan<strong>de</strong>l und Schifffahrt waren die wichtigsten Han<strong>de</strong>lszweige. Zu <strong>de</strong>n bisherigen Han<strong>de</strong>lspartnern traten Schottland und Spanien.<br />
350 Kaufleute betrieben um 1450 <strong>de</strong>n Fernhan<strong>de</strong>l, davon gehörte die Hälfte <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Gewandschnei<strong>de</strong>rn. 13 Werften verzeichnet das Stadtbuch um 1421. 1488 grün<strong>de</strong>n 50 Schiffer die St.<br />
Marienbru<strong>de</strong>rschaft <strong>de</strong>r Schiffer in Stralsund, <strong>de</strong>n Vorläufer <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Schiffercompagnie, die noch heute existiert. Die Stralsun<strong>de</strong>r besaßen das Han<strong>de</strong>lsmonopol auf <strong>de</strong>r gesamten<br />
Insel Rügen und geboten über bei<strong>de</strong> Fährverbindungen zwischen Rügen und <strong>de</strong>m Festland, nämlich <strong>de</strong>r Fähre zwischen Altefähr und Stralsund (Strelasundquerung) und zwischen<br />
Glewitz und Stahlbro<strong>de</strong>. Das Bauwesen erlebte einen gewaltigen Aufschwung, sowohl durch die Erneuerung <strong>de</strong>r bestehen<strong>de</strong>n und <strong>de</strong>n Aufbau weiterer Festungsanlagen als auch durch<br />
<strong>de</strong>n Bau prächtiger Giebelhäuser durch Stralsun<strong>de</strong>r Kaufleute. Auch die Schaufassa<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Rathauses wur<strong>de</strong> nun errichtet. Ebenso wur<strong>de</strong>n die Stralsun<strong>de</strong>r Kirchen ausgebaut (bzw. die<br />
Marienkirche wie<strong>de</strong>r aufgebaut).<br />
Erst im 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt wird in Stralsund auch buchstäblich Geschichte geschrieben. Umfangreiche Aufzeichnungen, wie sie etwa in Lübeck überliefert sind, gibt es lei<strong>de</strong>r aus Stralsund<br />
nicht. Nur zwei sehr kurze Chroniken eben aus <strong>de</strong>m 15. Jahrhun<strong>de</strong>rt, geschrieben wahrscheinlich von Mönchen, sind erhalten geblieben und zeugen u. a. von <strong>de</strong>r Installation <strong>de</strong>r Uhr an<br />
<strong>de</strong>r Marienkirche im Jahre 1411 o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m Bau einer Wasserleitung 1418. Eine dritte Chronik existiert nur noch in Fragmenten – möglicherweise aber war gera<strong>de</strong> diese sehr viel<br />
umfangreicher als die bei<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>ren. Bei <strong>de</strong>r Erforschung <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Geschichte ist man somit <strong>zu</strong>meist auf Quellen an<strong>de</strong>rer Städte angewiesen. Allerdings bieten erhalten<br />
gebliebene Stadtbücher durchaus wichtige Anhaltspunkte. Zu<strong>de</strong>m ist das Stralsun<strong>de</strong>r Stadtarchiv sehr umfangreich, es beherbergt z. B. die älteste papierne Urkun<strong>de</strong> Dänemarks.<br />
Am En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 15. Jahrhun<strong>de</strong>rts offenbarte sich immer mehr <strong>de</strong>r Konflikt zwischen <strong>de</strong>n Städten und <strong>de</strong>n umgeben<strong>de</strong>n Fürstentümern. Bogislaw X. Herzog von Pommern (1474–1523)<br />
zentralisierte sein Reich und erteilte damit <strong>de</strong>n pommerschen Städten, die nach mehr Unabhängigkeit strebten, eine Abfuhr. Er erhöhte die Zölle, nahm selbst Han<strong>de</strong>lsbeziehungen <strong>zu</strong><br />
frem<strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>rn auf und ließ Län<strong>de</strong>reien, die schon einmal an Bürger verkauft wor<strong>de</strong>n waren, einziehen und dann an die Bürger verpachten. Nur unter großen Anstrengungen gelang es<br />
Stralsund, seine Privilegien bis <strong>zu</strong>m Anfang <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>zu</strong> bewahren.<br />
Aus einem erhalten gebliebenen Steuerregister vom Beginn <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts, welches die Einnahmen <strong>de</strong>r Stadt aus einer Son<strong>de</strong>rsteuer <strong>zu</strong>r Sicherung <strong>de</strong>r Privilegien in Dänemark,
Norwegen und Schwe<strong>de</strong>n auflistet, ergibt sich ein Bild <strong>de</strong>r Sozialstruktur Stralsunds. Die Liste unterteilt die Einwohner nach ihrem Vermögen in sieben Gruppen. Demnach gehörten <strong>zu</strong><br />
<strong>de</strong>n wohlhabendsten Einwohnern die Ratsherren, die Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Gewandschnei<strong>de</strong>rkorporation waren. Sie stellten 0,5 Prozent <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Bevölkerung. 1,2 Prozent stellte die<br />
zweite Gruppe, die ebenfalls aus Gewandschnei<strong>de</strong>rn und aus Großkaufleuten bestand. In <strong>de</strong>r dritten Gruppe <strong>de</strong>r Bürger, 3,9 Prozent umfassend, waren ebenfalls Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r<br />
Gewandschnei<strong>de</strong>r und Großkaufleute gelistet. In <strong>de</strong>r vierten Gruppe, 7 Prozent <strong>de</strong>r Bevölkerung umfassend, fin<strong>de</strong>n sich kleinere Kaufleute und vereinzelt auch Handwerksmeister. Viele<br />
<strong>de</strong>r Handwerksmeister, beson<strong>de</strong>rs die Knochenhauer, Bäcker und Böttcher, fin<strong>de</strong>n sich in <strong>de</strong>r 6,7 Prozent <strong>de</strong>r Bevölkerung umfassen<strong>de</strong>n fünften Gruppe. Die sechste Gruppe, 35 Prozent<br />
umfassend, vereint die restlichen Handwerksmeister. In <strong>de</strong>r siebten Gruppe, die 45,7 Prozent <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Bevölkerung umfasst, befin<strong>de</strong>n sich die Besitzlosen: Träger und Tagelöhner.<br />
Nicht besteuert und daher nicht in <strong>de</strong>r Aufstellung erfasst wur<strong>de</strong>n die Unselbständigen (Gesellen, Dienstboten und Arme).<br />
Reformation<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>r 1520er Jahre drang auch nach Nord<strong>de</strong>utschland die Reformation. Ausgehend vor allem vom Kloster Belbuck, an <strong>de</strong>ssen Klosterschule Johann Bugenhagen als Lektor tätig<br />
war, verbreitete sich die Lehre im Nor<strong>de</strong>n. Die bei<strong>de</strong>n Schüler Bugenhagens, Christian Ketelhot und Johann Kureke, kamen auf <strong>de</strong>r Flucht wegen ihrer reformatorischen Ansichten 1523<br />
nach Stralsund, ihr Ziel war Livland. Bei<strong>de</strong> setzten ihre Flucht jedoch nicht fort, son<strong>de</strong>rn predigten in Stralsund, was vor allem in <strong>de</strong>n unteren und mittleren Schichten <strong>de</strong>r Bevölkerung<br />
Anklang fand. Sie wur<strong>de</strong>n dabei von Mitglie<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Bürgerschaft, wie Franz Wessel, unterstützt. Der Rat <strong>de</strong>r Stadt allerdings nahm klar dagegen Stellung und damit schon bald gegen<br />
einen großen Teil <strong>de</strong>r Bürger. Nach Konflikten mit <strong>de</strong>n Bürgern ließ sich <strong>de</strong>r Rat, allen voran Nikolaus Smiterlow, ebenfalls auf die reformatorischen Lehren ein. Gegen diese<br />
Strömungen rebellierte die katholische Geistlichkeit. Sie versuchte, vor allem Ketelhot <strong>zu</strong> verleum<strong>de</strong>n. Auch die Hanse sah in <strong>de</strong>r Reformation ein Ärgernis. Allerdings musste sie von<br />
ihrer For<strong>de</strong>rung an Stralsund und Wismar auf <strong>de</strong>m 1525er Hansetag in Lübeck, <strong>de</strong>n neuen Glauben und die martianischen secten <strong>zu</strong> verfolgen, Abstand nehmen. En<strong>de</strong> 1525 gestand <strong>de</strong>r<br />
nächste Hansetag bereits je<strong>de</strong>r Stadt die Entscheidung über ihre Prediger selbst <strong>zu</strong>. Die pommerschen Herzöge, mehrheitlich gegen die Reformation eingestellt, konnten die Verbreitung<br />
in Stralsund nicht aufhalten. Johannes Aepinus schuf die neue Kirchenordnung, die erste evangelische in Deutschland.<br />
Der Rat <strong>de</strong>r Stadt, <strong>de</strong>r einer Min<strong>de</strong>rheit <strong>de</strong>r Bürger nahe<strong>zu</strong> alle Macht in die Hän<strong>de</strong> gab, bekannte sich zwar <strong>zu</strong>r Reformation, verweigerte aber weiter die von <strong>de</strong>n Bürgern ebenfalls<br />
angestrebten sozialen Än<strong>de</strong>rungen. Mit Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Franziskaner aus <strong>de</strong>m Stralsun<strong>de</strong>r Johanniskloster erstarkte die bürgerliche Bewegung. Wortführer war Roloff Möller, <strong>de</strong>r,<br />
obschon selbst Mitglied <strong>de</strong>r Gewandschnei<strong>de</strong>r<strong>zu</strong>nft, <strong>de</strong>r oppositionellen Bewegung beitrat und diese sogar anstachelte. Spontan zogen im Jahr 1524 Bürger <strong>zu</strong>m Rathaus und ließen sich<br />
dort vom Rat einen Rezess unterschreiben, dass ein sogenannter „48er-Ausschuss“ (nach <strong>de</strong>r Anzahl <strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>r benannt) <strong>de</strong>r Bürger fortan über <strong>de</strong>m Rat regieren sollte. Der 48er-<br />
Ausschuss ließ am 10. April 1525 alle Armen <strong>zu</strong> einer Sichtung in die Nikolaikirche beor<strong>de</strong>rn, um diejenigen <strong>zu</strong> kennzeichnen, <strong>de</strong>nen das Betteln erlaubt sei. Hierbei entstand ein<br />
allgemeiner Tumult, in <strong>de</strong>m sich auch <strong>de</strong>r Unmut <strong>de</strong>r Armen ob ihrer Situation entlud. In <strong>de</strong>r Folge wur<strong>de</strong>n Altäre und Kapellen beschädigt. Der Aufstand breitete sich schnell aus, die<br />
Johanniskirche wur<strong>de</strong> gestürmt und geplün<strong>de</strong>rt, ebenso die Behausungen <strong>de</strong>r Mönche. Weitere Zerstörungen und Plün<strong>de</strong>rungen folgten im Brigittenkloster und im Kloster St. Annen und<br />
St. Katharinen. Vor allem Gesellen, Bootleute, Mäg<strong>de</strong>, Tagelöhner, Knechte sowie Arme waren an diesem Kirchenbrechen beteiligt. Nur durch die Aufstellung einer 900 Mann starken<br />
Truppe konnten die Aufständischen gestoppt wer<strong>de</strong>n.<br />
Die Furcht nach <strong>de</strong>m Kirchenbrechen ausnutzend, ließ sich <strong>de</strong>r 48er-Ausschuss weitere Privilegien vom Rat einräumen. Zu<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong>n 1525 neun <strong>de</strong>r Mitglie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> Bürgermeistern<br />
ernannt, unter ihnen Roloff Möller und Franz Wessel. In <strong>de</strong>n Folgejahren wur<strong>de</strong> auf diese Art nahe<strong>zu</strong> <strong>de</strong>r gesamte Rat neu besetzt, so dass nunmehr die Bürger die herrschen<strong>de</strong> Rolle<br />
einnahmen. Die alten Ratsfamilien waren nahe<strong>zu</strong> vollständig <strong>zu</strong>rückgedrängt wor<strong>de</strong>n. Keine Machtbeteiligung erhielten jedoch weiterhin die Handwerksmeister. Die Kirchenbrecher von<br />
1525 wur<strong>de</strong>n bald sowohl vom 48er-Ausschuss als auch von <strong>de</strong>n Reformatoren als loses Gesin<strong>de</strong>l und Gottlose bezeichnet. Die Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Ausschusses nutzten die Stellung im Rat<br />
mehr und mehr <strong>zu</strong> ihren eigenen Gunsten aus, was 1534 <strong>zu</strong>m Sturz <strong>de</strong>s Ausschusses führte. Die Kaufmannschaft baute ihre neu erworbene Machtstellung aus und herrschte schon bald<br />
uneingeschränkt wie vorher die patrizischen Ratsherren.<br />
Bildung und Schulwesen<br />
Nach <strong>de</strong>r Reformation wur<strong>de</strong> in Pommern auch das Schulwesen grundlegend geän<strong>de</strong>rt, so auch in Stralsund. Der Landtag hatte im Jahre 1534 eine von Johann Bugenhagen reformierte<br />
Ordnung beschlossen, die nach und nach in ganz Pommern durchgesetzt wer<strong>de</strong>n sollte. In Stralsund wur<strong>de</strong>n 1560 die drei Kirchgemein<strong>de</strong>schulen im seit 1555 nicht mehr als Kloster<br />
genutzten Katharinenkloster <strong>zu</strong>sammengeführt. Die siebenklassige Lateinschule, an <strong>de</strong>r auch Lesen, Schreiben und die neue Religion unterrichtet wur<strong>de</strong>n, war <strong>zu</strong>r zentralen
Bildungsstätte <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Bürger gewor<strong>de</strong>n und trug bald <strong>de</strong>n Namen Gymnasium. Ein langjähriger Rektor war Caspar Jentzkow 1569–1598.<br />
Schule und Bildung gewannen <strong>zu</strong>nehmend an Be<strong>de</strong>utung. Dies schlägt sich in zahlreichen Aufzeichnungen nie<strong>de</strong>r, die ab <strong>de</strong>m 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt vom Leben in Stralsund berichten. Reiche<br />
Kaufleute und bestellte o<strong>de</strong>r selbst ernannte Chronisten zeigen das mittelalterliche Leben auf. Der lutherische Prediger Johann Berckmann schrieb eine die Jahre 1124 bis 1560<br />
umfassen<strong>de</strong> „Stralsundische Chronik“, in <strong>de</strong>r er die letzten 50 Jahre aufgrund eigenen Erlebens beson<strong>de</strong>rs umfangreich schil<strong>de</strong>rt. Der Bürgermeister Nikolaus Gentzkow legte in <strong>de</strong>n<br />
Jahren 1558 bis 1567 sein Leben in einem Tagebuch dar, welches auch sehr genaue Angaben über das Privatleben <strong>de</strong>r Kaufleute in Stralsund enthält. Ein von Joachim Lin<strong>de</strong>mann im<br />
Jahre 1531 begonnenes Memorialbuch (in Frühneuhoch<strong>de</strong>utsch verfasst) wur<strong>de</strong> von an<strong>de</strong>ren Schreibern bis 1611 fortgesetzt. In Mittelnie<strong>de</strong>r<strong>de</strong>utsch schrieb Gerhard Hannemann,<br />
Untervogt <strong>de</strong>s Gerichts, sein Tagebuch <strong>de</strong>r Jahre 1553 bis 1587. Das Leben <strong>de</strong>s Bürgermeisters Franz Wessel wur<strong>de</strong> von Gerhard Dröge ausführlich beschrieben. Und auch <strong>de</strong>r<br />
Bürgermeister Bartholomäus Sastrow lässt – in einer Autobiografie <strong>de</strong>r Jahre 1520 bis 1555 – Einblicke in das Leben <strong>de</strong>r Ratsherren und Bürger Stralsunds <strong>zu</strong>. Diese Chroniken sind<br />
Zeugnis <strong>de</strong>s Willens <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Bürger im 16. Jahrhun<strong>de</strong>rt, Wissen <strong>zu</strong> erwerben, <strong>zu</strong> mehren und weiter<strong>zu</strong>geben. Bis dahin war es außerhalb von Klöstern unüblich gewesen,<br />
Tagesgeschehen auf<strong>zu</strong>zeichnen. Das Bürgertum <strong>de</strong>s 16. Jahrhun<strong>de</strong>rts hatte hier eine neue Rolle eingenommen. Ergänzt wer<strong>de</strong>n diese Chroniken von <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>n „Pomerania“ <strong>de</strong>s<br />
pommerschen Chronisten Thomas Kantzow.<br />
Abkehr von <strong>de</strong>r Hanse<br />
Stralsunds Han<strong>de</strong>l mit <strong>de</strong>n Städten entlang <strong>de</strong>r Ostseeküste sowie mit Nord- und Nordwesteuropa gedieh weiterhin. Vor allem landwirtschaftliche Erzeugnisse aus Stralsunds Umgebung<br />
wur<strong>de</strong>n gehan<strong>de</strong>lt und waren begehrt. Importiert wur<strong>de</strong>n vor allem Fisch sowie Salz, Gewürze und Wein. Han<strong>de</strong>lsgesellschaften wur<strong>de</strong>n gegrün<strong>de</strong>t mit mehreren Vorteilen: So konnte<br />
durch die Bereedung eines Schiffes durch mehrere Händler das Risiko, eine volle Schiffsladung infolge von Piratenüberfällen <strong>zu</strong> verlieren, gemin<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n, da die Fracht <strong>de</strong>r<br />
Kaufleute auf mehrere Schiffe verteilt wur<strong>de</strong>; <strong>de</strong>r Schiffer hatte die Ware dann bestmöglich <strong>zu</strong> verkaufen. Den Gewinn teilten sich die Beteiligten gemäß ihren Anteilen. Ebenfalls an<br />
Be<strong>de</strong>utung gewann <strong>de</strong>r Geldhan<strong>de</strong>l <strong>de</strong>r Kaufleute. Geld wur<strong>de</strong> verliehen und brachte somit Kapital. Dass es sich hier oft auch um Wucher han<strong>de</strong>lte, belegt die Tatsache, dass zwischen<br />
1574 und 1595 111 Stralsun<strong>de</strong>r Häuser verpfän<strong>de</strong>t wur<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>ren Besitzer das geliehene Geld nicht <strong>zu</strong>rückzahlen konnten. Auch kauften die Bürger Land in <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Umgebung<br />
<strong>zu</strong>r Sicherung ihrer Han<strong>de</strong>lstätigkeit sowie <strong>zu</strong>r Verpachtung an die bisherigen Eigentümer.<br />
Zunehmen<strong>de</strong> Be<strong>de</strong>utung erlangte auch die Bierherstellung. 1594 sind in Stralsund 171 Brauhäuser nachgewiesen, von <strong>de</strong>nen die Mehrzahl Starkbier für <strong>de</strong>n Export per Seehan<strong>de</strong>l<br />
herstellte. Mehr und mehr verfolgte Stralsund auch innerhalb <strong>de</strong>s von <strong>de</strong>r Hanse übrig gebliebenen Wendischen Quartiers eigene Interessen. So wur<strong>de</strong> gegen die bisherigen Statuten und<br />
gegen die ausdrücklichen Unmutsbekundungen Lübecks <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l „über Strand“, d. h. außerhalb <strong>de</strong>r Kontore forciert. Nach<strong>de</strong>m Verhandlungen mit Dänemark über die Aufhebung <strong>de</strong>r<br />
nach <strong>de</strong>m Dreikronenkrieg (1563–1570) verhängten Beschränkungen gescheitert waren, richtete Stralsund seine Bemühungen erfolgreich auf Schwe<strong>de</strong>n. Gegen die Interessen Lübecks<br />
wur<strong>de</strong>n mit Schwe<strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>ls- und Zollfreiheiten ausgehan<strong>de</strong>lt. Stralsund entwickelte sich <strong>zu</strong>m Brückenkopf Schwe<strong>de</strong>ns auf <strong>de</strong>m Kontinent.<br />
17. Jahrhun<strong>de</strong>rt – Im schwedischen Königreich<br />
Politik<br />
Stralsund nahm immer öfter Partei für die Interessen Schwe<strong>de</strong>ns in <strong>de</strong>n Kriegen <strong>de</strong>s beginnen<strong>de</strong>n 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Damit brach es aus <strong>de</strong>r noch 1605 erklärten gemeinsamen Haltung <strong>de</strong>r<br />
Hansestädte im Krieg zwischen <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n, Spanien und England aus. 1628 wirkte sich dieses Bündnis mit <strong>de</strong>n nie<strong>de</strong>rländischen Generalstaaten in <strong>de</strong>r Art aus, dass Stralsund bei<br />
<strong>de</strong>r Belagerung durch Wallensteins kaiserliche Truppen starke Finanzhilfen aus <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n erhielt. In <strong>de</strong>n kriegerischen Konflikten Schwe<strong>de</strong>ns mit Russland, Dänemark und Polen<br />
setzte Stralsund auf die <strong>zu</strong>gesicherten Han<strong>de</strong>lsprivilegien im schwedisch besetzten Teil <strong>de</strong>s Baltikums und Pommerns.<br />
Trotz<strong>de</strong>m Stralsund nie <strong>zu</strong>r Freien Hansestadt wur<strong>de</strong> und folglich weiter <strong>de</strong>r Herrschaft <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sherren von Pommern-Wolgast unterstand, wur<strong>de</strong> doch ein großes Maß an<br />
Selbständigkeit erreicht, die auch selbstbewusst verteidigt wur<strong>de</strong>. War die Stadt mit <strong>de</strong>n Beschlüssen <strong>de</strong>s Landtages, in <strong>de</strong>m sie vertreten war, einmal nicht einverstan<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong>n diese<br />
Beschlüsse auch nicht durchgesetzt. Dies gelang auch <strong>de</strong>n Lan<strong>de</strong>sfürsten nicht; ihr Einfluss auf die Stadt blieb gering. In Kenntnis dieser Tatsache grün<strong>de</strong>te <strong>de</strong>r pommersche Herzog<br />
Bogislaw XIII. am Ort <strong>de</strong>s Klosters Neuenkamp die Stadt Franzburg, die Stralsund Konkurrenz bieten sollte. Dieser Plan scheiterte; Franzburg konnte die Rolle einer Konkurrentin<br />
Stralsunds nie wahrnehmen.
Auch innerhalb <strong>de</strong>r Stadt wuchs <strong>de</strong>r Einfluss <strong>de</strong>r Stadtherren wie<strong>de</strong>r: Der 48er Ausschuss wur<strong>de</strong> aufgelöst und die Macht somit wie<strong>de</strong>r vollständig in die Hän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Patrizier gelegt. Doch<br />
schon 1559 grün<strong>de</strong>ten Großkaufleute (vorwiegend die Altermänner <strong>de</strong>r Gewandschnei<strong>de</strong>r) einen neuen Bürgerausschuss, das „Hun<strong>de</strong>rtmänner-Kollegium“.<br />
Erbvertrag mit <strong>de</strong>m pommerschen Herzog und Bürgerverfassung<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts verschärfte sich in <strong>de</strong>r Stadt die Finanzlage drastisch. Abgaben waren <strong>zu</strong> leisten an <strong>de</strong>n Kaiser, das Reich, die Lan<strong>de</strong>sherren und an Gesandte in<br />
Han<strong>de</strong>lssachen. Stralsund musste beim Amtsantritt eines Fürsten Huldigungskosten zahlen und <strong>de</strong>n pommerschen Herzog und sein Gefolge beköstigen, sobald dieser in die Stadt kam.<br />
Daraus erwuchs ein gewaltiger Schul<strong>de</strong>nberg, <strong>de</strong>r nicht mehr durch Steuern ge<strong>de</strong>ckt war. Die Umlage <strong>de</strong>r Ausgaben auf die Einwohner <strong>de</strong>r Stadt verstärkte <strong>de</strong>n Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>r<br />
Bürgerschaft gegen <strong>de</strong>n Rat <strong>de</strong>r Stadt. Der 1595 gegen starken Wi<strong>de</strong>rstand <strong>de</strong>s Rates, vor allem von Bartholomäus Sastrow, abgeschlossene Bürgervertrag war noch nicht umgesetzt<br />
wor<strong>de</strong>n, eine Finanzkontrolle seitens <strong>de</strong>r Bürgerschaft nicht möglich. Zu<strong>de</strong>m nahm die Vetternwirtschaft innerhalb <strong>de</strong>s Rates <strong>zu</strong>. Die Verwandtschaftsbeziehungen <strong>de</strong>r Ratsmitglie<strong>de</strong>r<br />
untereinan<strong>de</strong>r schürten Un<strong>zu</strong>frie<strong>de</strong>nheit. Diese Situation machte sich <strong>de</strong>r Herzog von Pommern-Wolgast, Philip Julius (1584–1625), <strong>zu</strong> Nutzen. Am 3. Februar 1612 zog er in die Stadt<br />
ein und setzte eine Untersuchungskommission ein, die die von <strong>de</strong>r Bürgerschaft beklagten Verfehlungen <strong>de</strong>s Rates <strong>zu</strong>m Thema hatte. Der Herzog präsentierte <strong>de</strong>r Bürgerschaft einen<br />
Vertragsentwurf, <strong>de</strong>r neben <strong>de</strong>r Rechenschaftspflicht <strong>de</strong>s Rates gegenüber <strong>de</strong>r Bürgerschaft die Oberaufsicht über die Stralsun<strong>de</strong>r Kirchen durch <strong>de</strong>n Herzog selbst vorsah. Auch die<br />
Einset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Geistlichen sollte <strong>de</strong>m Herzog obliegen. Das Hun<strong>de</strong>rtmänner-Kollegium wur<strong>de</strong> mit Hilfe <strong>de</strong>s Herzogs von Verwandten <strong>de</strong>r Ratsherren und <strong>de</strong>n Altermännern <strong>de</strong>r<br />
Gewandschnei<strong>de</strong>r befreit. Zum Bürgerworthalter wur<strong>de</strong> Johann Jusquinus von Gosen gewählt.<br />
Da <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>n Vertrag nicht einhielt, zog <strong>de</strong>r Herzog am 18. März 1612 erneut nach Stralsund ein und berief zwei Bürgermeister, <strong>de</strong>n Protonotarius, vier Ratsmitglie<strong>de</strong>r und <strong>de</strong>n<br />
Syndicus <strong>de</strong>r Stadt, Dr. Lambert Steinwich, ab. Nachfolger <strong>de</strong>s als <strong>zu</strong> zögerlich angesehenen von Gosen wur<strong>de</strong> Heinrich Stamke. Auf <strong>de</strong>m Hansetag in Lübeck beschwerten sich die<br />
bei<strong>de</strong>n später vom Herzog abberufenen Ratsherren Dr. Christof Krauthof und Niklas Dinnies über die Einflussnahme <strong>de</strong>s Herzogs. Die Hanse versuchte, <strong>de</strong>n Herzog <strong>zu</strong>r Rücknahme<br />
seiner Än<strong>de</strong>rungen an <strong>de</strong>n Machtverhältnissen <strong>zu</strong> bewegen. Philip Julius allerdings sah die geringe Macht <strong>de</strong>r im Nie<strong>de</strong>rgang befindlichen Hanse und die ihm ins Konzept passen<strong>de</strong><br />
Opposition <strong>de</strong>r Bürgerschaft gegen das Patriziat und betonte in Schreiben an <strong>de</strong>n Hansetag, dass seine Eingriffe in die Geschicke <strong>de</strong>r Stadt seiner Rechtsgewalt als Reichsfürst<br />
entsprachen. Die Stralsund angedrohte Verhansung, d. h. <strong>de</strong>n Ausschluss aus <strong>de</strong>m Bündnis, sah er gelassen. Im Dezember 1612 setzte <strong>de</strong>r Herzog eine Bürgerkommission ein, die die<br />
geistlichen Güter <strong>de</strong>r Stadt untersuchen sollte. Hierbei stellte sich schnell heraus, dass seitens <strong>de</strong>s Rates eine Misswirtschaft – ob bewusst o<strong>de</strong>r unbewusst, konnte nie geklärt wer<strong>de</strong>n –<br />
vorgelegen hatte: Ganze Grundstücke waren <strong>de</strong>m Besitz ohne Nachweise abhan<strong>de</strong>ngekommen. Die Bürgerschaft war <strong>zu</strong>tiefst gespalten. Gera<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>r Besteuerung gab es nicht<br />
aus<strong>zu</strong>räumen<strong>de</strong> Differenzen in <strong>de</strong>n Ansichten. Die aufkommen<strong>de</strong>n gewaltsamen Zusammenrottungen veranlassten Philip Julius, Verhandlungen mit <strong>de</strong>m Rat auf<strong>zu</strong>nehmen, was am 11.<br />
Juli 1615 <strong>zu</strong>m Abschluss <strong>de</strong>s Erbvertrages führte. In ihm wur<strong>de</strong> vereinbart, dass Stralsund sich <strong>de</strong>m Herzog als Erbherrn <strong>zu</strong> Gehorsam und Treue verpflichtet. Gesiegelt war <strong>de</strong>r Vertrag<br />
vom Herzog, <strong>de</strong>m Rat, <strong>de</strong>n Vertretern <strong>de</strong>r vier be<strong>de</strong>utsamsten Gewerke und <strong>de</strong>n einst von Philip Julius entmachteten Gewandhausvertretern. Der Herzog musste etliche seiner<br />
For<strong>de</strong>rungen fallen lassen, nach<strong>de</strong>m ihm die landständischen Ritter in Anbetracht <strong>de</strong>r drohen<strong>de</strong>n großen Macht <strong>de</strong>s Herzogs erfolgreich Wi<strong>de</strong>rstand leisteten, was wie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r relativen<br />
Eigenständigkeit Stralsunds <strong>zu</strong>gute kam. Die Bürgerschaft jedoch hatte sich durch die Uneinigkeit jedoch selbst geschwächt.<br />
Am 14. Februar 1616 wur<strong>de</strong>n auch die For<strong>de</strong>rungen <strong>de</strong>r Bürgerschaft nach innerstädtischen Verän<strong>de</strong>rungen mit <strong>de</strong>r Siegelung eines Bürgervertrages erfüllt. Der Bürgerschaft wur<strong>de</strong>n<br />
Mitbestimmungsrechte eingeräumt. Der Rat selbst führte weiterhin die Verwaltung und repräsentierte die Stadt. Die Kontrolle <strong>de</strong>r Finanzen oblag <strong>de</strong>n Achtmännern, die sich in <strong>de</strong>r<br />
Achtmannskammer trafen. Dabei stellten <strong>de</strong>r Rat und das Hun<strong>de</strong>rtmänner-Kollegium je vier Vertreter, Ersterer zwei Bürgermeister, einen Ratsherren und <strong>de</strong>n Kämmerer, Letzterer vier<br />
Bürger. Einigkeit wur<strong>de</strong> auch in <strong>de</strong>r Frage <strong>de</strong>r Steuern erzielt. Das Bürgerrecht wur<strong>de</strong> reformiert und <strong>de</strong>m Zu<strong>zu</strong>g von müßigem Gesin<strong>de</strong>l Grenzen gesetzt. Ebenso wur<strong>de</strong> eine<br />
Arbeitspflicht für die Stadt bei Bedarf festgelegt. Der Korruption wirkten Neuregelungen für die städtischen Ämter entgegen.<br />
Der Bürgervertrag datierte fortan bis 1870 die Grundlage für die innerstädtischen Beziehungen. Herzog Philip Julius, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Vertrag durch seine Machtbestrebungen und seinen Einsatz<br />
erst ermöglicht hatte, verstarb 1625; sein Nachfolger Bogislaw XIV. konnte nicht an seine Macht anknüpfen. Die neue Ordnung funktionierte, und daher waren Themen wie das im<br />
Februar <strong>de</strong>s Jahres 1625 über Stralsund hereinbrechen<strong>de</strong> Sturmhochwasser, die große Schä<strong>de</strong>n angerichtet hatte, die Hexenverfolgungen und die Schwäche <strong>de</strong>s neuen Herzogs die<br />
bestimmen<strong>de</strong>n Themen in Stralsund<br />
Allianzvertrag mit Schwe<strong>de</strong>n
Von <strong>de</strong>n ausbrechen<strong>de</strong>n, später Dreißigjähriger Krieg genannten Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen wur<strong>de</strong> Stralsund lange Zeit nur durch Nachrichten berührt. Stralsund gehörte <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n reformierten<br />
Städten, was aber nicht in einer Gegnerschaft <strong>zu</strong>m Kaiser ausartete. 1626 verdrängten die kaiserlichen Truppen die Dänen unter König Christian IV. aus Mecklenburg. Es war nunmehr<br />
absehbar, dass auch Pommern Ziel <strong>de</strong>r Eroberungen sein sollte. Allerdings war das Land nicht in <strong>de</strong>r Lage, Wi<strong>de</strong>rstand <strong>zu</strong> leisten. In Stralsund begannen Anfang 1627 Bestrebungen, eine<br />
Verteidigung <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> ermöglichen. 100 Söldner wur<strong>de</strong>n angeworben und die nach längerer friedlicher Zeit dringend erneuerungsbedürftigen Stralsun<strong>de</strong>r Stadtbefestigungen wie<strong>de</strong>r<br />
aufgebaut; im Frühjahr 1628 waren die Arbeiten fertiggestellt. Die Bürger wur<strong>de</strong>n aufgefor<strong>de</strong>rt, sich für ein Jahr <strong>zu</strong> bevorraten und eine Wachordnung erstellt, die auch Ratsmitglie<strong>de</strong>r<br />
einbezog. Die Stadt erwarb in großem Umfang Kriegsmaterial.<br />
Nach Wismar im Oktober 1627 kapitulierte 1628 auch Rostock. Die mecklenburgischen Herzöge flohen nach Dänemark. Herzog Bogislaw XIV. von Pommern hatte sich zwar immer<br />
kaiserfreundlich verhalten; trotz<strong>de</strong>m besetzten die kaiserlichen Truppen unter Hans Georg von Arnim-Boitzenburg auch Pommern. In <strong>de</strong>r Franzburger Kapitulation vom 10. November<br />
1627 wur<strong>de</strong> vereinbart, dass Pommern fortan ca. 20.000 Mann Besat<strong>zu</strong>ngstruppen als Einquartierung erhielt. Barth und Greifswald sowie die Insel Rügen wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>n Kaiserlichen<br />
ohne nennenswerten Wi<strong>de</strong>rstand eingenommen.<br />
Seit Beginn <strong>de</strong>s Jahres 1628 stand Stralsund in Geheimverhandlungen mit <strong>de</strong>n Königen von Dänemark und von Schwe<strong>de</strong>n, die bei<strong>de</strong> Protestanten waren und erklärte Gegner <strong>de</strong>s Kaisers,<br />
die sich <strong>zu</strong><strong>de</strong>m in ihrer wirtschaftlichen Stellung im Ostseeraum bedroht sahen. Der schwedische König Gustav Adolf war schon 1620 in Stralsund gewesen und hatte hier Beziehungen<br />
geknüpft<br />
In Stralsund wuchs <strong>de</strong>r Wi<strong>de</strong>rstand gegen eine Besat<strong>zu</strong>ng. Zwar verdienten die Kaufleute an <strong>de</strong>r Belieferung <strong>de</strong>r kaiserlichen Truppen im Umland mit allen <strong>de</strong>nkbaren Waren (sogar<br />
Waffen), und versicherte <strong>de</strong>r gera<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Bürgermeister gewählte Lambert Steinwich <strong>de</strong>m Kommissar Graf Ernst Georg von Sparre das Wohlwollen <strong>de</strong>r Stadt. Eine Garnison allerdings<br />
wollte Stralsund nicht wer<strong>de</strong>n. Verhandlungen mit <strong>de</strong>n kaiserlichen Anführern wur<strong>de</strong>n aufgenommen mit <strong>de</strong>m Ziel, sich von Einquartierungen frei<strong>zu</strong>kaufen. Verlangte Oberst von Arnim<br />
anfänglich noch 150.000 Reichstaler, wur<strong>de</strong> diese Summe von ihm <strong>zu</strong> Weihnachten 1627 auf 100.000 gesenkt. Auch da<strong>zu</strong> war <strong>de</strong>r Rat nicht bereit, nur 30.000 Taler wollten die<br />
Stralsun<strong>de</strong>r zahlen.<br />
Am 11. Februar 1628 wur<strong>de</strong> im Greifswal<strong>de</strong>r Vergleich eine Zahlung von 30.000 Talern und die Beendigung <strong>de</strong>r Arbeiten an <strong>de</strong>n Stadtbefestigungen vereinbart gegen die Zusicherung,<br />
auf eine Einquartierung <strong>zu</strong> verzichten und auf <strong>de</strong>m Dänholm keine Schanzen <strong>zu</strong> errichten. Die Zahlung erfolgte, allerdings wur<strong>de</strong>n die weiteren Bedingungen <strong>de</strong>s Vergleichs von<br />
Stralsun<strong>de</strong>r Seite abgelehnt. Weitere Verhandlungen folgten, aber auch Kampfhandlungen: Am 4. April 1628 kapitulierten die Besat<strong>zu</strong>ngstruppen auf <strong>de</strong>m Dänholm vor <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r<br />
Seeblocka<strong>de</strong>, die unter <strong>de</strong>r Führung Peter Blomes und Johann Jusquinus von Gosens stand und räumten die Insel. Am 18. April 1628 erteilte Wallenstein aus Jicin <strong>de</strong>n Befehl an von<br />
Arnim, entwe<strong>de</strong>r eine Garnison in Stralsund unter<strong>zu</strong>bringen o<strong>de</strong>r die Stadt <strong>zu</strong> belagern. Die Belagerung begann am 13. Maijul./ 23. Mai 1628greg..[9] Vor Stralsund wur<strong>de</strong>n Truppen<br />
<strong>zu</strong>sammengezogen, die Zufahrten <strong>zu</strong>r Stadt wur<strong>de</strong>n gesperrt, einzig <strong>de</strong>r Hafen blieb frei. 1500 Mann Stralsun<strong>de</strong>r Truppen stan<strong>de</strong>n allein im Hauptlager von Arnims im Hainholz 8000<br />
Mann gegenüber, die <strong>zu</strong><strong>de</strong>m besser ausgerüstet waren. Am 25. Mai 1628 traf auf Bitten <strong>de</strong>s Rates dänische Hilfe in <strong>de</strong>r Stadt ein, bis Mitte August annähernd 2500 Mann. Nach<br />
Verhandlungen mit <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong>n auch von dort Hilfstruppen entsandt, die am 23. Juni 1628 in Stralsund lan<strong>de</strong>ten. Mit <strong>de</strong>r Annahme <strong>de</strong>r Hilfe erklärter Gegner <strong>de</strong>s Kaisers und<br />
<strong>de</strong>m Abschluss eines Allianzvertrages mit Schwe<strong>de</strong>n stellte sich die Stadt offen reichsfeindlich. Dies rief Wallenstein persönlich auf <strong>de</strong>n Plan. Ihm wird (auch in Schillers Trilogie<br />
„Wallenstein“) <strong>de</strong>r Spruch nachgesagt: „Und wenn die Stadt mit sieben Ketten und Schlössern am Himmel hinge, ich wer<strong>de</strong> sie doch herunter holen!“ Sein Eintreffen im Lager vor<br />
Stralsund am 26. Juni 1628 war mit einer Än<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>r Strategie verbun<strong>de</strong>n, die <strong>zu</strong>sehends Erfolge zeigte. Immer wie<strong>de</strong>r kam es <strong>zu</strong> Verhandlungen zwischen <strong>de</strong>m Rat und <strong>de</strong>n<br />
Belagerern.<br />
Nach <strong>de</strong>r Legen<strong>de</strong> schoss ihm ein Verteidiger ein Weinglas aus <strong>de</strong>r Hand, worauf Wallenstein begleitet vom Hohnblasen von <strong>de</strong>n Stralsun<strong>de</strong>r Festungsmauern entnervt abzog. Alljährlich<br />
wird dies heute mit <strong>de</strong>n Wallensteintagen gefeiert, <strong>de</strong>m größten historischen Fest in Nord<strong>de</strong>utschland.<br />
Sicher ist, dass Wallenstein nach Verstärkung <strong>de</strong>r Hilfe aus Schwe<strong>de</strong>n und Dänemark und aufgrund widriger Witterung am 15. Juli 1628 abzog und von Arnim am 21. Juli 1628 die<br />
Belagerung ganz aufgab. Die letzten kaiserlichen Einheiten zogen am 24. Julijul./ 3. August 1628greg. vor <strong>de</strong>r Stadt ab. Die Belagerung hatte etwa 12.000 Söldnern Wallensteins das<br />
Leben gekostet.[10] In <strong>de</strong>r Stadt hielten sich 4700 Soldaten aus Dänemark und Schwe<strong>de</strong>n auf, die Einwohner litten unter <strong>de</strong>n Folgen <strong>de</strong>r Belagerung und <strong>de</strong>r Versorgung <strong>de</strong>r frem<strong>de</strong>n<br />
Hilfstruppen. Der Gesandte <strong>de</strong>s schwedischen Königs traf im August 1628 in Stralsund ein und gemahnte <strong>de</strong>n Rat an die Abmachungen und die bedingungslose Bindung an Gustav<br />
Adolf von Schwe<strong>de</strong>n. Die Schwe<strong>de</strong>nzeit hatte in Stralsund begonnen.
Am 10. September 1630 traf gegen 6 Uhr morgens <strong>de</strong>r schwedische König Gustav Adolf in Stralsund ein, empfangen mit Kanonendonner und <strong>de</strong>m Läuten aller Kirchenglocken <strong>de</strong>r<br />
Stadt, und nahm im Artushof Quartier. Dem Rat <strong>de</strong>r Stadt eröffnete er, dass er <strong>zu</strong>r Sicherstellung <strong>de</strong>s Schutzes Stralsunds 100.000 Reichstaler erwarte. Da die Stadt in finanziellen Nöten<br />
war – neben <strong>de</strong>n seit Jahren angehäuften Verbindlichkeiten waren auch noch die für die Verteidigung gegen die Kaiserlichen angeworbenen Söldner <strong>zu</strong> entlohnen –, fiel das Aufbringen<br />
dieser Gel<strong>de</strong>r schwer. Gustav Adolf übereignete dafür <strong>de</strong>r Stadt und privaten Geldgebern diverse fürstliche Güter. Der König persönlich besichtigte die Stralsun<strong>de</strong>r Stadtbefestigungen<br />
und befahl <strong>de</strong>ren Ausbau. Zu<strong>de</strong>m erlegte er Stralsund eine Garnison auf – eben das, was Stralsund noch kurz <strong>zu</strong>vor strikt abgelehnt hatte. Die Aufwendungen <strong>de</strong>r Stadt für <strong>de</strong>n Ausbau<br />
<strong>de</strong>r Befestigungsanlagen und die Garnison und weitere aufgrund <strong>de</strong>r Besat<strong>zu</strong>ng anfallen<strong>de</strong> Posten beliefen sich in <strong>de</strong>n folgen<strong>de</strong>n Jahren auf ca. 40 Prozent <strong>de</strong>r gesamten Ausgaben.<br />
Einnahmequellen waren das Kopfgeld, einer nach Stan<strong>de</strong>s<strong>zu</strong>gehörigkeit festgelegten Summe, und das Pfundgeld, welches als prozentualer Anteil einer je<strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>lsware an die<br />
städtische Kasse abgeführt wer<strong>de</strong>n musste.<br />
Im schwedischen Reich<br />
Immer wie<strong>de</strong>r versuchten Vertreter <strong>de</strong>s Reichs, Stralsund <strong>zu</strong>rück<strong>zu</strong>gewinnen, vor allem nach <strong>de</strong>m Tod Gustav Adolfs 1632. Diese meist schriftlich vorgebrachten Ansinnen jedoch wies<br />
die Stadt stets <strong>zu</strong>rück. Eine Stralsun<strong>de</strong>r Abordnung wur<strong>de</strong> 1645 nach Osnabrück entsandt, um auf <strong>de</strong>m dortigen Frie<strong>de</strong>nskongress die Rechte <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> vertreten und möglichst<br />
weitreichen<strong>de</strong> Freiheiten <strong>zu</strong> erlangen. Letztendlich scheiterten diese Bemühungen in ihren Hauptfragen, <strong>de</strong>r Selbständigkeit. Im Westfälischen Frie<strong>de</strong>n wur<strong>de</strong> Stralsund als Mediatstadt in<br />
Schwedisch-Pommern eingeglie<strong>de</strong>rt. Die schwedische Herrschaft über die Stadt brachte auch wegen <strong>de</strong>r von König Karl X. Gustav und seinen Nachfolgern geführten Kriege weitere<br />
finanzielle Belastungen. Im Gegen<strong>zu</strong>g allerdings bestätigte Schwe<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Stralsun<strong>de</strong>rn viele ihrer Privilegien, was <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lstätigkeit <strong>zu</strong>gute kam.<br />
1675 überfiel Schwe<strong>de</strong>n die Mark Bran<strong>de</strong>nburg und begann somit <strong>de</strong>n Schwedisch-Bran<strong>de</strong>nburgischer Krieg. Jedoch wur<strong>de</strong>n die Schwe<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Schlacht bei Fehrbellin geschlagen<br />
und in die Defensive gedrängt, womit auch Stralsund wie<strong>de</strong>r Kriegsziel wur<strong>de</strong>. Erstmals lagerte in diesem „Pommernfeld<strong>zu</strong>g“ genannten Krieg im Oktober 1675 in Lü<strong>de</strong>rshagen <strong>de</strong>r<br />
bran<strong>de</strong>nburgische Kurfürst Friedrich Wilhelm mit einem Heer vor Stralsund, zog jedoch bald darauf aufgrund <strong>de</strong>s einbrechen<strong>de</strong>n Winters wie<strong>de</strong>r ab. Daraufhin stellte <strong>de</strong>r schwedische<br />
Feldmarschall Graf Otto Wilhelm von Königsmarck eine 14.000 Mann starke Armee in <strong>de</strong>r Region Rügen/Stralsund auf. Im September 1677 gelang es <strong>de</strong>n Dänen, auf Rügen <strong>zu</strong> lan<strong>de</strong>n<br />
und Schwe<strong>de</strong>ns Verbindung <strong>zu</strong> Vorpommern ab<strong>zu</strong>schnei<strong>de</strong>n. In dieser Situation boten <strong>de</strong>r Dänenkönig und <strong>de</strong>r Kurfürst von Bran<strong>de</strong>nburg <strong>de</strong>r Stadt die Reichsunmittelbarkeit an, sofern<br />
sie sich von Schwe<strong>de</strong>n lossage. Diesen einstmals angestrebten Status <strong>de</strong>r freien Reichsstadt wies <strong>de</strong>r Rat allerdings <strong>zu</strong>rück und die Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r schwedischen Truppen Königsmark<br />
wur<strong>de</strong> intensiviert. Stralsund, das laut Allianzvertrag keine Soldaten im Kriegsfall stellen musste, bot <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n nunmehr freiwillig alle verfügbaren Soldaten an. Im Januar 1678<br />
wur<strong>de</strong> Rügen innerhalb von fünf Tagen <strong>zu</strong>rückerobert. Dies brachte allerdings noch lange keine Sicherheit: Vor Stralsund lagern<strong>de</strong> Truppen griffen in Einzelaktionen immer wie<strong>de</strong>r die<br />
Stadt an und eroberten vor allem Vieh. Die verbün<strong>de</strong>ten dänischen und bran<strong>de</strong>nburgischen Truppen lan<strong>de</strong>ten En<strong>de</strong> September 1678 auf Rügen. Mit <strong>de</strong>r Einnahme <strong>de</strong>r Insel wur<strong>de</strong> die<br />
Lage für Stralsund hoffnungslos.<br />
Am 20. September 1678 begann die Belagerung von Stralsund durch bran<strong>de</strong>nburgische Truppen mit <strong>de</strong>r Beschießung <strong>de</strong>s Hafens. In <strong>de</strong>r Stadt herrschte Uneinigkeit zwischen <strong>de</strong>n<br />
schwedischen Besat<strong>zu</strong>ngstruppen und <strong>de</strong>m Rat. Eine gemeinsame Verteidigung <strong>de</strong>r Stadt war nicht möglich, da <strong>de</strong>r Rat und die Bürgerschaft offen mit einem Frie<strong>de</strong>nsschluss mit<br />
Bran<strong>de</strong>nburg sympathisierten. Trotz <strong>de</strong>r Bitten sowohl <strong>de</strong>s Rates als auch Königsmarcks, die Stadt <strong>zu</strong> verschonen, begann Friedrich Wilhelm am 10. Oktober 1678 mit einem<br />
Bombar<strong>de</strong>ment, da die Stralsun<strong>de</strong>r eine friedliche Übergabe ablehnten. Dem Bombar<strong>de</strong>ment fielen viele Häuser und auch große Teile <strong>de</strong>r Jakobikirche <strong>zu</strong>m Opfer. Ein Großbrand brach<br />
aus und wütete in <strong>de</strong>r Stadt. Am 11. Oktober 1678 schickte Königsmark aus <strong>de</strong>r stark beschädigten Stadt einen Unterhändler <strong>zu</strong>m Kurfürsten; am 15. Oktober 1678 schlossen die<br />
Bran<strong>de</strong>nburger mit Königsmark die Kapitulationsvereinbarung ab, die <strong>de</strong>n Schwe<strong>de</strong>n einen ehrenhaften Ab<strong>zu</strong>g ermöglichte. Die Stralsun<strong>de</strong>r vereinbarten in einem separaten Vertrag <strong>de</strong>n<br />
Schutz ihrer Privilegien und das Verbot von Plün<strong>de</strong>rungen; in <strong>de</strong>n kommen<strong>de</strong>n zehn Jahren wollte Bran<strong>de</strong>nburg Stralsund beim Wie<strong>de</strong>raufbau unterstützen. Allerdings währte die<br />
bran<strong>de</strong>nburgische Herrschaft nicht lange: Mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>nsvertrag zwischen Frankreich, Schwe<strong>de</strong>n und Bran<strong>de</strong>nburg gelangte Stralsund am 9. Juni 1679 wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong>m Königreich<br />
Schwe<strong>de</strong>n. Königsmarck kehrte als Generalgouverneur nach Stralsund <strong>zu</strong>rück.<br />
Wirtschaft<br />
Bereits mit <strong>de</strong>r teilweisen Abkehr von <strong>de</strong>n Beschlüssen <strong>de</strong>r Hanse hatte sich gezeigt, dass die Zeit <strong>de</strong>r Hanse als Bündnis <strong>de</strong>r Städte vorüber war. Durch <strong>de</strong>n starken Druck <strong>de</strong>r<br />
Lan<strong>de</strong>sherren <strong>de</strong>r die Hansestädte umgeben<strong>de</strong>n Län<strong>de</strong>r, die unterschiedliche Interessen und Machtbestrebungen hatten, waren die Städte gezwungen, vor allem ihre eigenen Interessen <strong>zu</strong><br />
vertreten. Stralsund hatte aufgrund seiner Lage im Dänemark-freundlichen Pommern kaum noch gemeinsame Interessen mit <strong>de</strong>n Städten in Mecklenburg o<strong>de</strong>r Holstein. Die Stralsun<strong>de</strong>r
Händler, vom Spanienhan<strong>de</strong>l kaum profitierend, verlegten ihre Tätigkeiten überwiegend in <strong>de</strong>n baltischen Han<strong>de</strong>l. In <strong>de</strong>n westlichen Han<strong>de</strong>lsstädten waren Stralsun<strong>de</strong>r Kaufleute<br />
überwiegend als Mittler tätig. Im Han<strong>de</strong>l mit <strong>de</strong>n Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n waren sie von <strong>de</strong>n einheimischen Händlern abhängig, einstige Privilegien waren nach <strong>de</strong>m Erstarken <strong>de</strong>r heimischen<br />
Händler obsolet gewor<strong>de</strong>n. Selbst <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l mit Norwegen, einst ein blühen<strong>de</strong>s und lukratives Geschäft, wie das Bergenfahrer-Gestühl in <strong>de</strong>r Nikolaikirche bezeugt, wur<strong>de</strong> nach <strong>de</strong>m<br />
Erstarken <strong>de</strong>r Norweger <strong>zu</strong>rückgedrängt. Stralsun<strong>de</strong>r han<strong>de</strong>lten nunmehr – am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Legalität – meist nicht mehr in <strong>de</strong>n Kontoren, son<strong>de</strong>rn „über Strand“, d. h. ohne Einschaltung<br />
<strong>de</strong>r Marktplätze. Neben kleineren Han<strong>de</strong>lsbeziehungen <strong>zu</strong> Schottland (Export von Bier) und England wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l mit Danzig, Reval und Lübeck intensiviert. Parallel da<strong>zu</strong> nahmen<br />
auch die kleineren Städte <strong>de</strong>s Ostseeraumes in Dänemark und Schwe<strong>de</strong>n einen größeren Platz ein. Die schwedischen Eroberungen im Baltikum erlaubten einen bevor<strong>zu</strong>gten Han<strong>de</strong>l bis<br />
nach Moskau. Auch die nahe gelegene Insel Rügen wur<strong>de</strong> intensiv in die Han<strong>de</strong>lsbeziehungen einbezogen. Stralsund hatte gegenüber <strong>de</strong>n <strong>zu</strong> Anfang <strong>de</strong>s 17. Jahrhun<strong>de</strong>rts aufstreben<strong>de</strong>n<br />
neuen Han<strong>de</strong>lsstädten, die an <strong>de</strong>n Flussmündungen lagen und somit besser <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l auch mit <strong>de</strong>m Inland betreiben konnten, enorme Nachteile, die sich bald schon im Rückgang <strong>de</strong>r<br />
Be<strong>de</strong>utung für <strong>de</strong>n sich entwickeln<strong>de</strong>n „Welthan<strong>de</strong>l“ auswirkten.<br />
Um 1705 gab es in <strong>de</strong>r Stadt am Strelasund annähernd 850 Meister, wobei fast die Hälfte von ihnen ohne Gesellen arbeiteten; ein etwas größerer Teil <strong>de</strong>r Handwerksmeister beschäftigte<br />
<strong>zu</strong>sammen ebenfalls etwa 850 Gesellen. Zwischen <strong>de</strong>n Zünften gab es große Unterschie<strong>de</strong> hinsichtlich <strong>de</strong>s Reichtums. Die reichsten Ämter waren die <strong>de</strong>r Schmie<strong>de</strong> und Bäcker, gefolgt<br />
von <strong>de</strong>n Schustern, Kürschnern Schnei<strong>de</strong>rn, Küfern, Barbieren, Knochenhauern und Metallgießern. Zu <strong>de</strong>n ärmeren Zünften waren die Weber, Fischer, Korbmacher und Maurer <strong>zu</strong><br />
rechnen. Nach<strong>de</strong>m rund um Rügen und auch in <strong>de</strong>n städtischen Gewässern immer mehr Fisch auch von Nicht-Zunftmitglie<strong>de</strong>rn gefangen wur<strong>de</strong> stieg diese Zunft ebenfalls <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n<br />
ärmeren ab. Ebenso erging es <strong>de</strong>n Knochenhauern, <strong>de</strong>nen Konkurrenz in <strong>de</strong>n Garbratern erwuchs, die <strong>de</strong>n Viehhan<strong>de</strong>l und <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l mit Schlachtvieh unter ihre Kontrolle gebracht<br />
hatten. Trotz dieser starken Konkurrenzsituation stagnierten die Produktionsmetho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Handwerker, die vom Einkauf <strong>de</strong>r Rohstoffe bis <strong>zu</strong>m Absatz <strong>de</strong>s Endproduktes alles in einer<br />
Hand vereinigten.<br />
Das Zentrum <strong>de</strong>r Bierproduktion in Stralsund lag in <strong>de</strong>r Langenstraße und <strong>de</strong>r Frankenstraße. Den Transport <strong>de</strong>r Bierfässer <strong>zu</strong>m nahe gelegenen Hafen nahmen Bierträger wahr, die sich<br />
<strong>zu</strong>nftähnlich organisiert hatten. Aufgrund <strong>de</strong>r Notwendigkeit, das Braurecht <strong>zu</strong> erwerben, und wegen <strong>de</strong>s sehr hohen finanziellen Aufwan<strong>de</strong>s für eine gewinnbringen<strong>de</strong> Bierproduktion<br />
konnten nur finanzstarke Kaufleute dieses Geschäft ausüben.<br />
Unmittelbar nach <strong>de</strong>r Beendigung <strong>de</strong>r Belagerung durch Wallenstein 1628 waren die nach Stralsund geflüchteten Bauern <strong>de</strong>r Umgebung wie<strong>de</strong>r auf ihre Höfe <strong>zu</strong>rückgekehrt. Daraus<br />
resultierte bald schon ein erneuter wirtschaftlicher Aufschwung in <strong>de</strong>r Stadt, die Han<strong>de</strong>l mit <strong>de</strong>n landwirtschaftlichen Erzeugnissen vor allem über See betrieb. Daraus wie<strong>de</strong>rum<br />
resultierte ein Aufschwung bei <strong>de</strong>n Werften, die nach <strong>de</strong>r Belagerung näher an die Stadt umgezogen wur<strong>de</strong>n, und allen Ämtern, die mit <strong>de</strong>m Bau und <strong>de</strong>r Ausstattung <strong>de</strong>r Schiffe<br />
beschäftigt waren. Ebenfalls seit 1630 existierte in Stralsund eine vom Postmeister Otto Reimann geführte „Botenanstalt“ <strong>zu</strong>r Beför<strong>de</strong>rung von Nachrichten.<br />
Städtebau<br />
Bei <strong>de</strong>r Belagerung 1628 waren in <strong>de</strong>r eng bebauten Stadt (eine Zeichnung von Johannes Stau<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>m Jahr 1644 zeigt, dass es innerhalb <strong>de</strong>r Stadtmauern nahe<strong>zu</strong> keine unbebauten<br />
Plätze mehr gab; so richtete sich die Bautätigkeit in Stralsund nahe<strong>zu</strong> ausschließlich auf <strong>de</strong>n Wie<strong>de</strong>raufbau) einige Gebäu<strong>de</strong> beschädigt wor<strong>de</strong>n. So wur<strong>de</strong> das völlig zerstörte<br />
Elen<strong>de</strong>nhaus im Heilgeisthospital 1641 wie<strong>de</strong>r aufgebaut. Nach einem Blitzschlag musste auch <strong>de</strong>r Turm <strong>de</strong>r vor<strong>de</strong>m mit 157 Metern Höhe <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n höchsten Bauwerken Europas<br />
gehören<strong>de</strong>n Marienkirche erneuert wer<strong>de</strong>n.<br />
In <strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>r 1678er Belagerung gera<strong>de</strong> erst im Wie<strong>de</strong>raufbau befindlichen Stadt brach am 15. Juni 1680 erneut ein Großbrand aus, <strong>de</strong>r auch Teile <strong>de</strong>s Rathauses zerstörte.<br />
18. Jahrhun<strong>de</strong>rt<br />
Politik<br />
Mit enormem Aufwand wur<strong>de</strong> am 8. März 1700 die Huldigung <strong>de</strong>s Königs Karl XII. begangen.<br />
Neue Gefahr brachte <strong>de</strong>r Große Nordische Krieg. Dieser verlief zwar <strong>zu</strong>nächst weitab <strong>de</strong>r Stadt. Die Folgen waren aber schon in Stralsund <strong>zu</strong> sehen: Im Mai 1700 wur<strong>de</strong>n 300 Matrosen<br />
in <strong>de</strong>r Stadt geworben.[11] Die Stralsun<strong>de</strong>r Garnison umfasste 1300 Soldaten.[12]
Im August 1711 rückten Truppen Sachsens, Russlands und Dänemarks in Schwedisch-Vorpommern ein, die am 7. September 1711 vor Stralsund eintrafen und sich vereinigten, Anfang<br />
Januar 1712 aber wie<strong>de</strong>r abzogen.[13] Im Laufe <strong>de</strong>s Jahres 1712 kam es <strong>zu</strong> einer Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r schwedischen Gebiete auf <strong>de</strong>m Kontinent, insbeson<strong>de</strong>re in Schwedisch-Pommern.<br />
Entlastung und die Verteidigung <strong>de</strong>r Stadt Stralsund als schwedischem Brückenkopf sollte eine Armee unter <strong>de</strong>m schwedischen Feldmarschall Magnus Stenbock bringen, <strong>de</strong>r tatsächlich<br />
die alliierte Übermacht in <strong>de</strong>r Schlacht bei Ga<strong>de</strong>busch in Westmecklenburg schlug. In dieser für Schwe<strong>de</strong>n äußerst kritischen Lage lehnte Karl XII. mehrere Frie<strong>de</strong>nsangebote ab. Er war<br />
im November 1714 aus Ben<strong>de</strong>r in die Festung Stralsund <strong>zu</strong>rückgekehrt. Der König besichtigte die Truppen vor <strong>de</strong>m Kütertor und <strong>de</strong>m Kniepertor sowie auf Rügen, und unterzeichnete<br />
einen „offenen Begnadigungs-Brief für die Stadt Stralsund vom 29. November 1714“, in <strong>de</strong>m er bestimmte, dass <strong>de</strong>r Stadt die Torschlüssel <strong>zu</strong>rückgegeben wür<strong>de</strong>n und die Stadt von <strong>de</strong>r<br />
Accise-Consumtions-Steuer und an<strong>de</strong>ren finanziellen Belastungen befreit sowie die Bürgermeister und <strong>de</strong>r Rat in <strong>de</strong>n A<strong>de</strong>lsstand erhoben wur<strong>de</strong>n. Ferner bestätigte er am 24. April 1715<br />
„alle Vortheile, Freyheiten, Begnadigungen, Gerechtigkeiten und Privilegien“ <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Als er erste Erfolge gegen die preußische Armee erzielte, wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r König von <strong>de</strong>n vereinigten dänischen, preußischen und sächsischen Truppen in <strong>de</strong>r Festung eingeschlossen.<br />
Nach<strong>de</strong>m Stralsund im Pommernfeld<strong>zu</strong>g 1715/1716 monatelang belagert wur<strong>de</strong>, ergaben sich die eingeschlossenen Schwe<strong>de</strong>n am 23. Dezember 1715. Der Preußenkönig Friedrich<br />
Wilhelm übergab Stralsund <strong>de</strong>n Dänen. Erst mit <strong>de</strong>m Frie<strong>de</strong>n von Fre<strong>de</strong>riksborg kam Stralsund wie<strong>de</strong>r ins schwedische Reich. Ab 1720 war Stralsund die Hauptstadt von Schwedisch-<br />
Vorpommern und blieb es bis <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>nzeit im Jahr 1815.<br />
1757 erlaubte <strong>de</strong>r schwedische König wie<strong>de</strong>r die Ansiedlung von Ju<strong>de</strong>n; diese begannen 1786 mit <strong>de</strong>m Bau einer Synagoge, die am 30. März 1787 geweiht wur<strong>de</strong> (siehe auch Geschichte<br />
<strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n in Stralsund).<br />
Wirtschaft<br />
In <strong>de</strong>r schwedischen Stadtaufnahme 1706/1707 sind die Besitzer <strong>de</strong>r 1601 erfassen Grundstücke nach Berufen aufgeführt. Danach gab es <strong>zu</strong> dieser Zeit in Stralsund 110 Getrei<strong>de</strong>händler,<br />
97 Mälzer, 74 Schiffer und 64 Bierbrauer. Von <strong>de</strong>n 475 Handwerkern waren 50 Schuster, 42 Fischer, 27 Bäcker, 26 Schnei<strong>de</strong>r, 23 Leinweber, 21 Schmie<strong>de</strong> und 21 Zimmerleute.<br />
Nach<strong>de</strong>m Schwe<strong>de</strong>n 1720 <strong>de</strong>n südlich <strong>de</strong>r Peene gelegenen Teil Vorpommerns an Preußen abgetreten hatte, verlor Stralsund <strong>zu</strong>nehmend an Be<strong>de</strong>utung. Es fehlte <strong>de</strong>r Stadt am Hinterland,<br />
was sie gegenüber Städten wie Hamburg o<strong>de</strong>r sogar Rostock benachteiligte. Zu<strong>de</strong>m war <strong>de</strong>r Stadt die Freiheit im Öresund entzogen wor<strong>de</strong>n. Zwar war Stralsund weiterhin <strong>de</strong>r<br />
be<strong>de</strong>utendste Export- und Importhafen in Schwedisch-Pommern, aber an die einstige Be<strong>de</strong>utung kam es nie wie<strong>de</strong>r heran. Vornehmlich Malz und Getrei<strong>de</strong> wur<strong>de</strong>n nach Schwe<strong>de</strong>n<br />
exportiert.<br />
1729 entstand in Stralsund die Amidonmacherei, die, von Daniel Joachim Kühl (1687–1745) gegrün<strong>de</strong>t, eine <strong>de</strong>r erfolgreichsten Manufakturgründungen wur<strong>de</strong>. 1731 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Import<br />
von Stärke im Land Schwedisch-Pommern verboten, 1818 konnte die Stärkefabrik sogar exportieren. Erfolgreich war anfangs auch die Wollmanufaktur <strong>de</strong>s Kaufmanns Johann Nicolaus<br />
Hennings (1719–1779). Er konnte bereits 1747 das ganze Land mit Kalmanken und Flanell versorgen, so dass die Regierung 1748 <strong>de</strong>n Import <strong>de</strong>rartiger Waren verbot. 1749 wur<strong>de</strong>n 400<br />
Spinnerinnen beschäftigt. Allerdings gingen die Stralsun<strong>de</strong>r Kramer gegen die Manufaktur mit allen, auch illegalen Mitteln vor. Hennings Ware wur<strong>de</strong> geschmäht; bei einer Zählung <strong>de</strong>r<br />
Kramwaren 1749 wur<strong>de</strong>n nur importierte Kalmanken und Flanelle gefun<strong>de</strong>n. Hennings Einspruch beim Rat <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> nur zögernd beschie<strong>de</strong>n. Die Wollmanufaktur ging 1758 ein.<br />
1755 entstand die Stralsun<strong>de</strong>r Fayencenmanufaktur. Sie wur<strong>de</strong> von Joachim Ulrich Giese (1719–1780) gegrün<strong>de</strong>t und war bald eines <strong>de</strong>r bekanntesten Unternehmen <strong>de</strong>r Stadt. Am 25.<br />
Oktober 1765 erhielt <strong>de</strong>r Graveur Johann Kaspar Kern (gest. 1791) eine Konzession <strong>zu</strong>m Betrieb einer Spielkartenfabrik, die <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts unter <strong>de</strong>m Namen<br />
Vereinigte Stralsun<strong>de</strong>r Spielkartenfabrik AG die größte Unternehmung ihrer Art in <strong>de</strong>r Welt wur<strong>de</strong>.<br />
1765 prüfte <strong>de</strong>r schwedische Reichstag, ob die Zulagenkammer Stralsund angesichts <strong>de</strong>r seit einigen Jahren nicht gezahlten Steuern unter schwedische Verwaltung <strong>zu</strong> stellen sei. 1767<br />
wur<strong>de</strong> da<strong>zu</strong> eine Kommission eingesetzt, die im Juni 1768 sieben Stralsun<strong>de</strong>r Ratsmitglie<strong>de</strong>r absetzte. Nach Protesten seitens <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r befand <strong>de</strong>r Reichstag, dass die Kommission<br />
ihre Befugnisse überschritten habe und machte die Entscheidungen rückgängig.<br />
Die Regierung in Stockholm war sehr zögerlich bei <strong>de</strong>r Unterstüt<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Bemühungen, <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>l wie<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> beleben. Erst 1766 wur<strong>de</strong> durch Aufhebung einer<br />
Son<strong>de</strong>rsteuer <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l mit nicht-baltischen Län<strong>de</strong>rn belebt. 1785 konstituierte sich in Stralsund eine Kommission <strong>de</strong>s Rates <strong>zu</strong>r Belebung <strong>de</strong>s Han<strong>de</strong>lsverkehrs. Jedoch blieb auch<br />
<strong>de</strong>ren Erfolg eher gering. Nur wenig besserte sich die Situation im letzten Drittel <strong>de</strong>s 18. Jahrhun<strong>de</strong>rts. Hier profitierte vor allem <strong>de</strong>r Schiffbau in Stralsund von einer leichten<br />
Verbesserung dank <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rbelebung <strong>de</strong>s Seehan<strong>de</strong>ls.
Städtebau<br />
In <strong>de</strong>r schwedischen Stadtaufnahme von 1706/1707 zeigt die noch immer bestehen<strong>de</strong>n Auswirkungen <strong>de</strong>r letzten Belagerung 1680. 1601 Grundstücke sind verzeichnet, davon 1392<br />
innerhalb <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Stadtbefestigungen.<br />
Gesundheitswesen<br />
Im Jahr 1709 starben in einer Pockenepi<strong>de</strong>mie in <strong>de</strong>n Monaten Januar bis Juli über 600 Kin<strong>de</strong>r. Eine vom Rat im August 1709 angestrebte Pestordnung wur<strong>de</strong> nicht verwirklicht, so dass<br />
ab August 1710 die Pest in <strong>de</strong>r Stadt ausbracht. Im September 1709 trat endlich die Pestordnung in Kraft, die das Schließen verseuchter Häuser vorsah. Sie wur<strong>de</strong>n mit einem weißen<br />
Kreuz gekennzeichnet; nur Ärzten war <strong>de</strong>r Zutritt gestattet. Fritz Adler beziffert die Zahl <strong>de</strong>r Pesttoten auf 4000[14], Jürgen Drevs nennt 7774 Tote[11], wobei diese Angabe bei 8000<br />
Einwohnern sicher <strong>zu</strong> hoch ist. Am 26. April 1711 wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Stralsun<strong>de</strong>r Kirchen ein Dankfest nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Epi<strong>de</strong>mie gefeiert.<br />
19. Jahrhun<strong>de</strong>rt: Die letzten Schwe<strong>de</strong>njahre und französische Beset<strong>zu</strong>ng<br />
Schwe<strong>de</strong>ns König Gustav IV. Adolf <strong>de</strong>n schwedischen Teil von Pommern stärker ins schwedische Reich integrieren. Am 26. Juni 1806 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Staatsstreich die<br />
Lan<strong>de</strong>sverfassung außer Kraft gesetzt, ab 1. Januar 1807 sollte schwedisches Recht gelten.<br />
Eine <strong>de</strong>r Maßnahmen war die Aufhebung <strong>de</strong>r Leibeigenschaft. Den Städten wur<strong>de</strong>n die Privilegien von 1789 versprochen, wirtschaftliche Projekte <strong>zu</strong>r Aufhebung <strong>de</strong>r Rückständigkeit<br />
Pommerns geplant.<br />
Politik<br />
Seit <strong>de</strong>r Belagerung durch preußische Truppen im Jahr 1758 hatte Stralsund keine militärischen Auseinan<strong>de</strong>rset<strong>zu</strong>ngen mehr erlebt. Im Spätsommer 1804 brach Schwe<strong>de</strong>n die<br />
diplomatischen Beziehungen <strong>zu</strong> Frankreich ab und ging im Vierten Koalitionskrieg gegen Frankreich eine Allianz mit Preußen, England und Russland ein. Teile <strong>de</strong>r auf Rügen<br />
gelan<strong>de</strong>ten russischen Truppen zogen durch Stralsund. Die nach Mecklenburg gesandten schwedischen Truppen kehrten im Frühjahr 1806 nach Pommern <strong>zu</strong>rück. In Anbetracht <strong>de</strong>r auf<br />
Pommern vorrücken<strong>de</strong>n Franzosen wur<strong>de</strong> in Stralsund am 29. Oktober 1806 <strong>de</strong>r Belagerungs<strong>zu</strong>stand verhängt und am 17. Dezember 1806 mit <strong>de</strong>m Abbruch <strong>de</strong>r Vorstädte begonnen. Die<br />
etwa 1600 dort leben<strong>de</strong>n Menschen wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Marienkirche notdürftig untergebracht.<br />
Die Franzosen rückten im Januar 1807 über die Peene weiter nach Pommern vor. Die in Vorpommern stationierten schwedischen Truppen zogen sich am 29. Januar 1807 nach Stralsund<br />
<strong>zu</strong>rück, die Stadt wur<strong>de</strong> landseitig vom französischen Heer eingeschlossen. Es kam allerdings nur <strong>zu</strong> vereinzelten leichten Geplänkel, da die Franzosen an einer Einnahme Stralsunds<br />
nicht interessiert waren; vielmehr zogen sie En<strong>de</strong> März 1807 sogar Truppen nach Kolberg ab. Die Schwe<strong>de</strong>n nutzten dies für einen Ausfall am 1. April, bei <strong>de</strong>m die Belagerer tatsächlich<br />
aus Schwedisch-Pommern vertreiben wur<strong>de</strong>n – allerdings nur für kurze Zeit; am 17. April schlugen die Franzosen die Schwe<strong>de</strong>n bei Ferdinandshof. Bei<strong>de</strong> Seiten schlossen einen<br />
Waffenstillstand, <strong>de</strong>r für Stralsund <strong>de</strong>n Vorteil hatte, dass die Stadt nicht wie<strong>de</strong>r belagert wur<strong>de</strong>.<br />
Am 12. Juni 1807 traf König Gustav IV. Adolf in Stralsund ein, das er <strong>zu</strong> seinem Hauptquartier machte. Auch ein preußisches Korps unter Befehl von General Gebhard Leberecht von<br />
Blücher wur<strong>de</strong> hier aufgestellt. Blücher bewohnte das Haus Mühlenstraße Nr. 6. Zu <strong>de</strong>n versammelten 5000 Preußen, die unter Friedrich Wilhelm Bülow von Dennewitz vor <strong>de</strong>m<br />
Frankentor übten, gehörte auch Ferdinand von Schill. Ein 8000 Mann starkes Hilfskorps aus England kam Anfang Juli ebenfalls nach Stralsund. Nach <strong>de</strong>r Kündigung <strong>de</strong>s<br />
Waffenstillstan<strong>de</strong>s durch Schwe<strong>de</strong>n rückten die Franzosen schnell wie<strong>de</strong>r in Pommern vor und erreichten am 15. Juli 1807 wie<strong>de</strong>r Stralsund. Eine Bitte <strong>de</strong>s Stralsun<strong>de</strong>r Magistrats an <strong>de</strong>n<br />
schwedischen König, die Belagerung ab<strong>zu</strong>wen<strong>de</strong>n, schlug Gustav Adolf am 23. Juli ab.<br />
Am 6. August 1807 führten die Franzosen einen ersten Angriff auf Stralsund. Am 9. August wur<strong>de</strong> die schwedische Regierung nach Bergen auf Rügen verlegt. Der König übergab am 19.<br />
August die Regierung an <strong>de</strong>n Stralsun<strong>de</strong>r Magistrat. Bürgermeister David Lukas Kühl übergab am 20. August gegen 18 Uhr die Stadt an die Belagerer. Am Abend noch besetzten<br />
französische Truppen Stralsund.<br />
Sie schleiften die Festungsanlagen, trugen die <strong>de</strong>r Verteidigung dienen<strong>de</strong>n Wälle ab und verlangten vom Land hohe Kontributionen. Einquartierungen in Privathäusern waren bis <strong>zu</strong>m
Kasernenbau die Regel. Die Franzosen unter Generalgouverneur Thouvenot nutzten das Gymnasium im ehemaligen Katharinenkloster und das Gebäu<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ressource als Kaserne, in<br />
<strong>de</strong>n Pfarrkirchen St. Marien und St. Jakobi richteten sie Magazine ein. die Johanniskirche und die Heilgeistkirche wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> Stallungen umfunktioniert. Die Besatzer schufen Relikte <strong>de</strong>r<br />
mittelalterlichen Strafgerichtsbarkeit wie <strong>de</strong>n Schandpfahl ab.<br />
Im Herbst 1808 wur<strong>de</strong>n einigen französischer Regimenter abgezogen, im Winter 1808/1809 betrug die Besat<strong>zu</strong>ngstärke 3000 Mann.<br />
Bürgermeister David Lukas Kühl traf sich 1808 in Erfurt mit Napoléon, um unter an<strong>de</strong>rem über die Beibehaltung <strong>de</strong>r ständischen Verfassung <strong>zu</strong> sprechen. Auf die Frage Napoléons, ob<br />
die Stralsun<strong>de</strong>r <strong>zu</strong> Preußen wollten <strong>de</strong>r <strong>zu</strong> Mecklenburg antwortete Kühl, sie wür<strong>de</strong>n Mecklenburg vorziehen, da man die gleiche Verfassung und Gesetze habe. Eine Entscheidung traf<br />
Napoléon allerdings nicht.[15] Nach <strong>de</strong>r Audienz wur<strong>de</strong>n die französischen Truppen im März 1808 größtenteils abgezogen und durch eine kleine Wachtruppe aus französischen und<br />
polnischen Soldaten ersetzt.<br />
Am 25. Mai 1809 traf aus Damgarten Major Freiherr Ferdinand von Schill gegen 10 Uhr in Stralsund ein. Er zog durch das Tribseer Tor in die Stadt ein, die er noch aus <strong>de</strong>m Jahr 1807<br />
kannte. Nach<strong>de</strong>m er in Damgarten erfolgreich gekämpft hatte, hoffte er in <strong>de</strong>r Festungsstadt Stralsund auf ein Fanal für die Befreiung von <strong>de</strong>r französischen Fremdherrschaft. Seinem<br />
Mitkämpfer Leutnant Leopold von Lützow rief er <strong>zu</strong>: „Wir brauchen Stralsund als Stützpunkt für <strong>de</strong>n Kleinkrieg, auch wenn wir ehrenvoll fallen sollten.“ Mit Hilfe <strong>de</strong>s in schwedischen<br />
Diensten stehen<strong>de</strong>n Offiziers Friedrich Gustav von Petersson gelang es Schills Truppen, die französische Beset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong> vertreiben und die Wie<strong>de</strong>ranlage <strong>de</strong>r geschleiften<br />
Verteidigungsanlagen voran<strong>zu</strong>treiben. Zweifel kamen auch in Schills Truppen auf angesichts <strong>de</strong>r aussichtslos erscheinen<strong>de</strong>n Lage in Stralsund.6.000 Mann <strong>de</strong>r Generäle Gratien und von<br />
Ewald zogen heran, die gewaltige Übermacht darstellten.<br />
Am 31. Mai 1809 griffen die Franzosen die Stadt am Tribseer Tor an und erste Angriff konnte abgewehrt wer<strong>de</strong>n. Jedoch rückten die angreifen<strong>de</strong>n Truppen am Tribseer Tor nur <strong>zu</strong>r<br />
Ablenkung an. Ihre Hauptmacht konzentrierte sich auf das Kniepertor, wo sie schnell in die Stadt vordringen konnte. Gegen die Übermacht hatten die Schillschen Truppen kaum eine<br />
Chance, nur einem kleinen Teil gelang die Flucht durch das Frankentor; die meisten fielen im Kampf. Schill selbst wur<strong>de</strong> nach einem Fluchtversuch, beim Ritt durch die Fährstraße von<br />
einer Kugel tödlich getroffen. Schills Körper wur<strong>de</strong> am 2. Juni 1809 auf <strong>de</strong>m St.-Jürgen-Friedhof verscharrt und <strong>de</strong>r Kopf an Napoleons Bru<strong>de</strong>r Jerome Bonaparte geschickt. 557 Männer<br />
aus Schills Truppe wur<strong>de</strong>n gefangen genommen. Einige wur<strong>de</strong>n nach Braunschweig gebracht und hingerichtet, an<strong>de</strong>re mussten auf Galeeren dienen.<br />
Die Besat<strong>zu</strong>ng wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>nächst von holländischen, dann wie<strong>de</strong>r von mecklenburgischen Truppen gestellt. Im Januar 1810 kam es <strong>zu</strong>m Frie<strong>de</strong>n zwischen Frankreich und Schwe<strong>de</strong>n und<br />
<strong>zu</strong>r Rückgabe Stralsunds an Schwe<strong>de</strong>n. Am 27. Januar 1812 zogen die Franzosen wie<strong>de</strong>r in Stralsund ein, das ihnen vom Kommandanten von Peyron kampflos übergeben wur<strong>de</strong>. Bis<br />
<strong>zu</strong>m 7. März 1813 blieb eine 4000 Mann starke Besat<strong>zu</strong>ng in Stralsund. Am 15. März 1813 zogen wie<strong>de</strong>r schwedische Truppen in das von <strong>de</strong>n Franzosen verlassenen Stralsund ein. Im<br />
Frie<strong>de</strong>n <strong>zu</strong> Kiel 1814 und durch nachfolgen<strong>de</strong> Verträge vom 4. und 7. Juni 1815 trat Schwe<strong>de</strong>n das Gebiet Schwedisch-Pommern und Rügen gegen Zahlung von 3,5 Millionen Taler<br />
preuß. Courant an Preußen ab.<br />
19. Jahrhun<strong>de</strong>rt: Die Preußenzeit<br />
Am 23. Oktober 1815 trat Schwe<strong>de</strong>n in Umset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>r Verträge <strong>de</strong>s Wiener Kongresses Stralsund und Vorpommern an Preußen ab. Die stationierten Regimenter zogen am 23. Oktober<br />
1815 symbolisch durch das Kniepertor ab und wie<strong>de</strong>r in die Stadt ein. Am selben Tag hatten sich im Meyerfeldtschen Palais, <strong>de</strong>m Sitz <strong>de</strong>s schwedischen Gouverneurs,<br />
Regierungsvertreter aus Schwe<strong>de</strong>n und Preußen sowie Deputierte <strong>de</strong>r Ritterschaft, Stän<strong>de</strong>, Kirche und <strong>de</strong>r Universität Greifswald versammelt. Die “Stralsundische Zeitung” berichtete<br />
am 28. Oktober 1815, dass <strong>de</strong>r schwedische Gesandte „vom Schmerz <strong>de</strong>r Trennung ergriffen“ das Entlassungspatent <strong>de</strong>s schwedischen Königs verlas; er verkün<strong>de</strong>te, „dass es seinem<br />
Herzen ein großes Opfer gewesen sei, sich von einem Lan<strong>de</strong> <strong>zu</strong> trennen, <strong>de</strong>ssen Einwohner je<strong>de</strong>rzeit die rührendsten Beweise <strong>de</strong>s Patriozismus und <strong>de</strong>r Anhänglichkeit an das Mutterland<br />
abgelegt hätten“.[16] Der preußische Gesandte verlas darauf das Besitzergreifungspatent <strong>de</strong>s preußischen Königs.<br />
Politik<br />
Stadtverfassung<br />
Den Stralsun<strong>de</strong>rn und Vorpommern sicherte <strong>de</strong>r König Schutz <strong>zu</strong> und <strong>de</strong>n Erhalt <strong>de</strong>r ständischen Verfassung, die er jedoch <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n gesamten Staaten <strong>zu</strong> gewähren<strong>de</strong>n allgemeinen
Verfassung anschließen wollte.[17] Die alte Stadtverfassung, <strong>de</strong>r Erb- und Bürgervertrag aus <strong>de</strong>m 17. Jahrhun<strong>de</strong>rt, teilte die Einwohner noch immer in drei Gra<strong>de</strong> auf. In <strong>de</strong>r Sit<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s<br />
Rates am 25. Oktober 1815 äußerten die Bürgermeister und Ratsmitglie<strong>de</strong>r jedoch die Vermutung, „dass es möglicherweise auf die Einführung einer neuen Verfassung o<strong>de</strong>r doch<br />
mancherlei Neuerungen ab<strong>zu</strong>sehen“ wäre.[18] Bürgermeister David Lukas Kühl wur<strong>de</strong> im Dezember 1815 nach Berlin entsandt, um vom König die alten Rechte bestätigt <strong>zu</strong> bekommen,<br />
jedoch wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Delegation keine Audienz gewährt; Kühl begegnete <strong>de</strong>m König dann auf einem Neujahrsball und wur<strong>de</strong> von ihm mit Floskeln abgefertigt.[19]<br />
Bei einer Volkszählung am 1. Dezember 1815 waren in Stralsund 6012 männliche und 7197 weibliche Personen wohnhaft. Davon gehörten ungefähr 300 Bürger <strong>de</strong>m ersten Stand an. Im<br />
Jahr 1831 trat die revidierte Städteordnung in Kraft. Zu diesem Zeitpunkt for<strong>de</strong>rten Vertreter <strong>de</strong>s dritten Stan<strong>de</strong>s vom Rat ein Mitspracherecht bei Neuwahlen und die Entfernung <strong>de</strong>r<br />
Gewandhausalterleute aus <strong>de</strong>m Rat. Der Rat sah sich gezwungen, <strong>de</strong>n For<strong>de</strong>rungen nach<strong>zu</strong>geben, allerdings verfolgte er weiter die Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>r alten Ordnung, u. a. durch<br />
mehrfache Eingaben bei <strong>de</strong>r Regierung Preußens. Prof. Dr. Carl Ferdinand Fabricius, <strong>de</strong>r einer alten Ratsfamilie entstammte, richtete nach <strong>de</strong>r Julirevolution in Frankreich eine elfseitige<br />
Petition an <strong>de</strong>n preußischen König, in <strong>de</strong>r er das <strong>de</strong>n Ratsherren geschehene Unrecht beklage und vor <strong>de</strong>n Auswirkungen warnte. König Friedrich Wilhelm IV. beauftragte <strong>de</strong>n<br />
Greifswal<strong>de</strong>r Oberappellationsgerichtspräsi<strong>de</strong>nten Goetze mit <strong>de</strong>r Einleitung notwendiger Maßnahmen. Nach<strong>de</strong>m Goetze mit <strong>de</strong>r Umset<strong>zu</strong>ng scheiterte erließ <strong>de</strong>r König am 10. Juli und<br />
27. Dezember 1844 Kabinettsor<strong>de</strong>r, die die Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>r alten Stadtverfassung verlangte; am 2. Juni 1845 zogen die Gewandhausalterleute wie<strong>de</strong>r in <strong>de</strong>n Rat ein.<br />
Bürgerliche Revolution 1848/1849<br />
Am 18. März 1848 zogen Stralsun<strong>de</strong>r Bürger durch die Stadt. Sie riefen „Es lebe die Revolution“, Fensterscheiben wur<strong>de</strong>n eingeworfen und die Polizei nahm einen Demonstranten fest.<br />
Der Rat veranlasste die Bewaffnung <strong>de</strong>s “Sicherheitsvereins” und erhielt dafür 541 Infanteriegewehre und 32 Pioniergewehre von <strong>de</strong>r Garnison. Eine weitere Demonstration gab es am<br />
22. April, nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Wortführer <strong>de</strong>s Bürgertums, <strong>de</strong>r Arzt Johannes Engelbracht, vom Rat diffamiert wor<strong>de</strong>n war. Mit Engelbracht stan<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Redakteur Carl Ludwig Kübler, <strong>de</strong>r<br />
Kanzlist Carl Ferdinand Adlerbaum, Kaufmann Ernst Heinrich Billich, Zollassessor Ludwig August Tülff und <strong>de</strong>r Gymnasiallehrer Johannes von Gruber an <strong>de</strong>r Spitze <strong>de</strong>r bürgerlichen<br />
Bewegung. Kübler gab von Mai 1848 (bis Juni 1850) die Zeitschrift “Der Fortschritt” heraus. Politische Vereinigungen wur<strong>de</strong>n gebil<strong>de</strong>t, so <strong>de</strong>r “Constitutionelle Club” und <strong>de</strong>r<br />
“Schwarz-Rot-Gol<strong>de</strong>ne Club”.<br />
In einer Abstimmung am 9. Juli 1848 entschied sich eine Mehrheit gegen die alte Stadtverfassung und für Reformen. Der Abgeordnete Stralsunds in <strong>de</strong>r Frankfurter<br />
Nationalversammlung, Gymnasialrektor Johann Ernst Nizze, schrieb dagegen am 8. August 1848 an Zober: „(…) weil wir kein republikanisches Deutschland und Preußen wollen,<br />
vielmehr ein solches für ein Unglück halten“; er riet <strong>zu</strong>r „Mäßigkeit“.<br />
Als die Regierung im November die Landwehr mobilisierte kam es <strong>zu</strong> Unruhen. Die Einkleidung eines Bataillons am 19. November 1848 wur<strong>de</strong> durch Stralsun<strong>de</strong>r Bürger massiv<br />
behin<strong>de</strong>rt, woraufhin reguläres Militär eingesetzt und <strong>de</strong>r Ausnahme<strong>zu</strong>stand verhängt wur<strong>de</strong>.[20] Für die Teilnehmer an <strong>de</strong>n Protesten am 18. März und 19. November <strong>de</strong>s Jahres wur<strong>de</strong>n<br />
Gefängnis- und Zuchthausstrafen von bis <strong>zu</strong> drei Jahren verhängt.[21] Der Zollassessor Tülff wur<strong>de</strong> in einen an<strong>de</strong>ren Ort versetzt; bei seiner durch <strong>de</strong>n “Volksverein” initiierten<br />
Verabschiedung versammelten sich am 6. Januar 1849 auf <strong>de</strong>m Alten Markt 1500 Bürger.<br />
Bei <strong>de</strong>r Wahl <strong>zu</strong>r Zweiten Kammer am 21. Januar 1849 traten <strong>de</strong>r “Volksverein” und <strong>de</strong>r “Constitutionelle Club” <strong>zu</strong>sammen als Wahlverein “Demokratisch-Konstitutionelle Partei” an<br />
und stellten fast zwei Drittel <strong>de</strong>r 72 Wahlmänner.<br />
Wahlen und Parteien<br />
Bei <strong>de</strong>r Reichstagswahl 1884 trat die Sozial<strong>de</strong>mokratische Partei Deutschlands in Stralsund erstmals mit einem Kandidaten, Eduard Müggenburg, an. Er erhielt 417 von 4191 Stimmen.<br />
[22]<br />
Am 14. Februar 1891 fand in Stralsund eine Veranstaltung <strong>de</strong>r Sozial<strong>de</strong>mokratie mit <strong>de</strong>m Referenten Fritz Herbert aus Stettin statt, die von 300 Personen besucht wur<strong>de</strong>.[23] Am 27.<br />
März 1891 erschien erstmals die “Stralsun<strong>de</strong>r Volksstimme”, das „Organ für die Interessen <strong>de</strong>r Arbeiter von Neu-Vorpommern und Rügen“.<br />
Nach<strong>de</strong>m am 10. Mai 1891, nur wenige Tage, nach<strong>de</strong>m in Stralsund erstmals <strong>de</strong>r 1. Mai als Kampftag begangen wur<strong>de</strong>, eine Volksversammlung im Restaurant “Thalia” am<br />
Knieperdamm Nr. 8 die Bildung einer Organisation <strong>de</strong>r Sozial<strong>de</strong>mokratischen Partei Deutschlands beschlossen hatte, wur<strong>de</strong> am 6. Juni 1891 in <strong>de</strong>r Herberge “Zu <strong>de</strong>n drei Kronen” in <strong>de</strong>r
Böttcherstraße Nr. 69 <strong>de</strong>r sozial<strong>de</strong>mokratische Wahlverein gegrün<strong>de</strong>t.[24] 1892 wur<strong>de</strong> Albert Genzen an die Spitze <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r SPD gewählt.<br />
Bei <strong>de</strong>r Reichstagswahl 1898 gewann die SPD 1051 Stimmen.[25]<br />
Gewerkschaften<br />
Existierte bis 1890 nur zwei freie Gewerkschaften, nämlich die <strong>de</strong>r Buchdrucker und die <strong>de</strong>r Maurer und Zimmerer, folgten ab Oktober 1891 weitere Gründungen von Gruppen, so <strong>de</strong>r<br />
Metallarbeiter, Bau- und Holzarbeiter, Brauerei- und Fabrikarbeiter, Maler, Schmie<strong>de</strong>, Schnei<strong>de</strong>r und Schuhmacher sowie 1897 die Gewerkschaft <strong>de</strong>r Fischer und Seeleute. Am 25.<br />
November 1898 wur<strong>de</strong> ein Gewerkschaftskartell gegrün<strong>de</strong>t.[26]<br />
Vertreten waren in Stralsund auch <strong>de</strong>r Hirsch-Dunckerscher Gewerkverein, <strong>de</strong>r Evangelische Arbeiter-Verein und <strong>de</strong>r Katholische Arbeiter- und Handwerkerverein.<br />
Verwaltung<br />
1818 wur<strong>de</strong> Stralsund Hauptstadt <strong>de</strong>s preußischen Regierungsbezirks. 1874 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadtkreis Stralsund gebil<strong>de</strong>t, <strong>zu</strong>vor Kreis Franzburg.<br />
Wirtschaftliche Entwicklung<br />
Schifffahrt<br />
Die Stralsun<strong>de</strong>r Ree<strong>de</strong>r mussten <strong>zu</strong> Anfang <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts Einbußen hinnehmen, die vor allem auf <strong>de</strong>n Han<strong>de</strong>lsbeschränkungen <strong>de</strong>r „Schutzzölle“ ausländischer Märkte rührten.<br />
1816 waren noch 114 Schiffe in Stralsund beheimatet; 216 Schiffer und Steuermänner, 433 Matrosen und Schiffsjungen auf großer Fahrt, 33 Binnenschiffer und Steuerleute sowie 55<br />
Steuerknechte und neun Lotsen zählte ein Wirtschaftsverzeichnis.[27] 1817 waren nur noch 100 und 1836 nur noch 65 Schiffe in Stralsund beheimatet.[28] Stralsunds Haupthan<strong>de</strong>lsgut<br />
war Getrei<strong>de</strong>, welches beson<strong>de</strong>rs hoch verzollt wur<strong>de</strong>. 1837 wur<strong>de</strong> von Stralsun<strong>de</strong>r Schiffen erstmals New York angelaufen, an Bord <strong>de</strong>r drei Briggs und zwei Galeassen waren etwa 440<br />
Tonnen Weizen und Roggen. Nach<strong>de</strong>m einige Schutzzölle aufgehoben o<strong>de</strong>r gelockert wur<strong>de</strong>n blühte auch das Geschäft mit <strong>de</strong>m Getrei<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r auf, Haupthan<strong>de</strong>lspartner waren in <strong>de</strong>n<br />
Nie<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>n und in England.<br />
Am 1. Mai 1824 legte mit <strong>de</strong>m schwedischen Raddampfer „Constitutionen“ erstmals ein Dampfschiff in Stralsund an, <strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>r Postverbindung Stralsund–Ystad <strong>zu</strong>sammen mit <strong>de</strong>m<br />
preußischen Schiff „Der Adler“ die Zeit <strong>de</strong>r Segeljachten been<strong>de</strong>te. Dem Verkehr stand allerdings bald die Verschlammung <strong>de</strong>r Fahrrinne entgegen, woraufhin Schwe<strong>de</strong>n die Route 1826<br />
nach Greifswald verlegte. Die Fahrrinne musste ausgebaggert wor<strong>de</strong>n war. Der Stralsun<strong>de</strong>r Hafen allerdings war weiterhin verschlammt, was aus <strong>de</strong>m Schleifen <strong>de</strong>r Festung während <strong>de</strong>r<br />
französischen Beset<strong>zu</strong>ng (<strong>de</strong>r Steinschutt wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Hafen gekippt), aber auch aus <strong>de</strong>r Einleitung <strong>de</strong>r Rinnsteine herrührte. Am 5. Juli 1840 informierte <strong>de</strong>r General-Postmeister <strong>de</strong>n<br />
Stralsun<strong>de</strong>r Rat, dass die Postlinie ab <strong>de</strong>m 1. Mai 1841 wie<strong>de</strong>r bis Stralsund verlaufen wür<strong>de</strong> und die Stadt <strong>de</strong>n Hafen entsprechend vor<strong>zu</strong>bereiten habe, was dann auch geschah.<br />
Von 1856 bis 1883 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r in Rostock gebaute 27 Meter lange Raddampfer “Altefähr” für <strong>de</strong>n Fährverkehr über <strong>de</strong>n Strelasund zwischen Stralsund und Altefähr auf Rügen eingesetzt.<br />
Das Schiff wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Stralsun<strong>de</strong>rn spöttisch „Flun<strong>de</strong>r“ genannt wor<strong>de</strong>n; aufgrund technischer und konstrukionstechnischer Mängel fiel häufig mitten im Betrieb die 34 PS-Maschine<br />
aus. Die Stralsun<strong>de</strong>r sangen darauf <strong>de</strong>n Gassenhauer<br />
• „Von Stralsund, seggt he,<br />
• nah Ollfähr, seggt he,<br />
• geht’n Damper, seggt he,<br />
• hen und her, seggt he.<br />
• Von’t oll Ding, seggt he,<br />
• is groot G’schrei, seggt he,<br />
• all Og’nblick, seggt he,
• is’t enttwei.“<br />
1848 verfügten die in Stralsund nie<strong>de</strong>rgelassenen Ree<strong>de</strong>r über 96 Han<strong>de</strong>lsschiffe.[29] In <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts wur<strong>de</strong> die Stralsun<strong>de</strong>r Flotte ausgebaut. 1878 waren es<br />
219 Schiffe, die in Stralsund beheimatet waren, sie hatten eine Kapazität von insgesamt 45.459 Register-Tonnen.[30] Ziele <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r waren u. a. Alexandria, Algier, Archangelsk,<br />
Batavia, Buenos Aires, Haiti, Konstantinopel, Kuba, Melbourne, O<strong>de</strong>ssa und Québec. 1856 kamen Bombay, Hongkong, Rangun, Singapur und Shanghai hin<strong>zu</strong>.[31] Damit einher ging<br />
die Entwicklung <strong>zu</strong>r internationalen Frachtschifffahrt.<br />
Zur Ausbildung <strong>de</strong>r Seeleute grün<strong>de</strong>te Carl Wilhelm Lorenz 1854 die Navigationsvorschule Stralsund, die bis 1880 1046 Matrosen absolvierten.<br />
Be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong> Ree<strong>de</strong>reien waren die <strong>de</strong>s Eugen Diekelmann, <strong>de</strong>r im Jahr 1850 29 Schiffe beree<strong>de</strong>te[32], und die <strong>de</strong>s Carl August Beugs, <strong>de</strong>r 1875 35 Schiffe beree<strong>de</strong>te.[33]<br />
Der erste Stralsun<strong>de</strong>r Dampfer, die “Stralsund”, wur<strong>de</strong> 1857 abgewrackt. 1858 nahm <strong>de</strong>r Raddampfer “Rügen” <strong>de</strong>n Fährbetrieb zwischen Stralsund und Stettin auf.[34] Im selben Jahr<br />
drohte <strong>de</strong>r Postverbindung nach Ystad in Schwe<strong>de</strong>n die Aufgabe, nach<strong>de</strong>m das von 1842 bis <strong>zu</strong>r Abwrackung im Jahr 1858 eingesetzte, viel <strong>zu</strong> groß konzipierte Dampfschiff “Königin<br />
Elisabeth” unter hohen Verlusten ausgemustert wor<strong>de</strong>n war. Die Proteste bei <strong>de</strong>r preußischen Regierung fruchteten. 1865 verlagerte Schwe<strong>de</strong>n seinen Ausgangshafen von Ystad nach<br />
Malmö, 1870 gingen die Schiffe in Privathand über. In Stralsund betrieb die Ree<strong>de</strong>rei Israel <strong>de</strong>n Dampfer “Oscar” auf dieser Linie noch bis <strong>zu</strong>m 16. Oktober 1896.<br />
Die Schifffahrt wan<strong>de</strong>lte sich, die Vereinigten Staaten und Kanada wur<strong>de</strong>n große Getrei<strong>de</strong>exporteure und verdrängten Stralsun<strong>de</strong>r Händler vom Markt. Gab es 1880 noch 200 Schiffe im<br />
Stralsun<strong>de</strong>r Schiffsregister waren es 1895 nur noch 35; die mo<strong>de</strong>rnen Flotten <strong>de</strong>r Zeit bestan<strong>de</strong>n aus Dampfschiffen, die es in Stralsund kaum gab.<br />
Schiffbau<br />
Am 24. Mai 1841 lief unter reger Beteiligung <strong>de</strong>r Bevölkerung das erste Dampfschiff mit Heimathafen Stralsund ein; es war in England gebaut wor<strong>de</strong>n. Der Stralsun<strong>de</strong>r Schiffbau<br />
allerdings kam in <strong>de</strong>n 1830er Jahren fast <strong>zu</strong>m Erliegen. Das Unterhaltungsblatt “Sundine” fragte am 6. August 1838 „warum wird in Stralsund jetzt so selten und fast gar nicht mehr ein<br />
großes Schiff gebaut?“. Die starre Zunftordnung jedoch verhin<strong>de</strong>rte Neuentwicklungen. Der Greifswal<strong>de</strong>r Schiffbauer Joachim Peter Juhl for<strong>de</strong>rte von <strong>de</strong>r Stadt, dass er sein Geschäft in<br />
Stralsund aufnehmen könne, ohne mit <strong>de</strong>m hiesigen Schiffszimmereramt in Verbindung <strong>zu</strong> geraten; „die dort in Betreff meines Gewerbes bestehen<strong>de</strong> Zunftverfassung (wür<strong>de</strong> seiner)<br />
Thätigkeit solche Fesseln anlegen, daß (er seine) Kunst nicht mit Vortheil ausüben könne“, schrieb er <strong>de</strong>r Stadtverwaltung.[35] Dies wur<strong>de</strong> ihm erlaubt, und Juhl baute 1839 eine Bark,<br />
eine Brigg und eine Jacht. Die bei<strong>de</strong>n Stralsun<strong>de</strong>r Schiffbauer Jacob Nicolaus Kasten und Johann Martin Theodor Erich legten daraufhin auch wie<strong>de</strong>r neue Schiffe auf Kiel.<br />
Im Jahr 1848 baute die Werft Juhl das erste preußische Kanonenboot, die “Strela-Sund”, die am 16. August <strong>de</strong>s Jahres vom Stapel lief. Dies gilt als die „Geburtsstun<strong>de</strong>“ <strong>de</strong>r preußischen<br />
Marine; weitere Schiffe, die auf <strong>de</strong>m Dänholm stationiert wur<strong>de</strong>n, folgten.[36]<br />
1854 wur<strong>de</strong>n in Stralsund 17 Schiffe neu gebaut.[37]<br />
Bald reichte <strong>de</strong>r Platz auf <strong>de</strong>r Lastadie vor <strong>de</strong>m Fährtor, Semlower Tor und Ba<strong>de</strong>ntor nicht mehr aus. Während Juhl die Vergrößerung <strong>de</strong>r Lastadie durch neue Bohlwerke vorschlug,<br />
plante man die Verlegung <strong>de</strong>r Schiffbauerplätze an <strong>de</strong>n Frankenstrand. Da Stralsund jedoch weiterhin Festung war, entschied das Kriegsministerium dagegen, da „die Aktionsfähigkeit<br />
<strong>de</strong>s Frankenkronwerks beeinträchtigt, die Möglichkeit <strong>de</strong>s Bestreichens <strong>de</strong>r Flächen <strong>zu</strong>m Dänholm eingeengt“ wür<strong>de</strong>n. Nach langen Verhandlungen wur<strong>de</strong> 1858 mit <strong>de</strong>r Errichtung eines<br />
neuen Gelän<strong>de</strong>s begonnen, Pfähle gerammt und Aufschüttungen vorgenommen. 1860 begannen die Werften auf <strong>de</strong>m neuen Gelän<strong>de</strong>, sie beschäftigten 220 Zimmerleute, 78 Lehrlinge, 24<br />
Brettschnei<strong>de</strong>r und 11 Arbeiter. Im Jahr 1862 wur<strong>de</strong>n auf <strong>de</strong>n Werften Stralsunds 20 Neubauten hergestellt.[38] Neben Juhl unterhielten auch Julius Preuß, Omar Johannes Kirchhoff und<br />
Carl Wilhelm Mohr leistungsfähige Werften. Produziert wur<strong>de</strong>n die Schiffe jetzt <strong>zu</strong>nehmend auch für <strong>de</strong>n eigenen, Stralsun<strong>de</strong>r Bedarf.<br />
Der Wan<strong>de</strong>l im Welthan<strong>de</strong>l brachte jedoch schon <strong>zu</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts <strong>de</strong>n Verfall <strong>de</strong>s Stralsun<strong>de</strong>r Schiffbaus. 1880 gab es nicht einen Stapellauf mehr, was bis ins 20.<br />
Jahrhun<strong>de</strong>rt anhielt. Einzig ein Neubau im Jahr 1889 (ein Gaffelschoner <strong>de</strong>r Werft Mohr) wur<strong>de</strong> aufgelegt. Die Werften hatten <strong>de</strong>n Übergang vom Segelschiff <strong>zu</strong>m Dampfschiff, <strong>de</strong>r sich<br />
rasant vollzogen hatte, verpasst, und wur<strong>de</strong>n schnell von <strong>de</strong>r Konkurrenz in Rostock o<strong>de</strong>r Stettin verdrängt.<br />
Han<strong>de</strong>l und Gewerbe
Im Jahr 1816 verzeichnete man in Stralsund die Spielkartenfabrik Schlüter, acht Tabakfabriken, sieben Hutmacher, drei Seifensie<strong>de</strong>r und Kerzengießer, eine Spiegelfabrik, eine<br />
Zuckersie<strong>de</strong>rei und eine Korkenfabrik[27], wobei die Fabriken nur kleine Betriebe waren. Weiterhin wer<strong>de</strong>n 142 Schuh- und Pantoffelmacher und Schuhflickermeister mit 100 Gehilfen<br />
und Lehrlingen, 84 Schnei<strong>de</strong>rmeister mit 60 Gehilfen und Lehrlingen, 30 Bäcker mit 70 Gehilfen, zehn Zimmermeister mit 82 Gehilfen und Lehrlingen, sieben Maurer- und<br />
Dach<strong>de</strong>ckermeister mit 63 Gehilfen, sechs Glockengießer und Gürtler, vier Instrumentenbauer, zwei Bildhauer, drei Kunstmaler, zwei Gipsgießer und Stuckateure, zehn Kunstdrechsler<br />
und Bernsteindrehermeister, ein Lohnkutscher sowie zahlreiche Schmie<strong>de</strong>, Tischler, Fleischer, Töpfer, Glaser, Weber und Maler; <strong>zu</strong>sammen 1411 im Handwerk beschäftigte Personen<br />
aus.<br />
Im „Dienst <strong>de</strong>r Herrschaft“ weist das Verzeichnis 269 männliche und 808 weibliche Personen aus.<br />
Dasselbe Verzeichnis listet 42 Mälzereien, 13 Windmühlen, fünf Wassermühlen, fünf Grützmühlen, 16 Brauereien, eine Buch- und Notendruckerei, 24 mit Ellen- o<strong>de</strong>r Schnittwaren,<br />
Eisen und Messing han<strong>de</strong>ln<strong>de</strong> Geschäfte sowie 69 Kleinkaufleute („höker“) wur<strong>de</strong>n gezählt. 14 Gasthöfe „für Personen aus <strong>de</strong>n gebil<strong>de</strong>ten Stan<strong>de</strong>n“, 16 Gasthöfe für Fuhrleute, 32<br />
Speisewirte und Garköche sowie 124 Schankstellen und Tabagien ohne Gastwirtschaft sind ebenso aufgeführt.<br />
1825 grün<strong>de</strong>te J. P. Lindner seine “Pianofortefabrik”, die ihre Instrumente weltweit exportierte.[30] Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts kamen weitere, neue Betriebe hin<strong>zu</strong>: Eine Eisengießerei,<br />
die Lichtfabrik Palm, die Ölmühlen Langemack und Hoffmann, die Destillation- und Weinessigfabrik Bollmann und Drews und die Wattefabrik Zöllner.[39]<br />
Jüdische Kaufleute entwickelten mo<strong>de</strong>rne Han<strong>de</strong>lsi<strong>de</strong>en: Am 15. April 1852 errichteten die Gebrü<strong>de</strong>r Wertheim ihr „Manufactur-Mo<strong>de</strong>waren-Geschäft“ und bauten 1875 das erste<br />
Wertheim-Kaufhaus in Stralsund. Leonhard Tietz eröffnete am 14. August 1879 einen kleinen La<strong>de</strong>n und begrün<strong>de</strong>te damit <strong>de</strong>n später als „Kaufhof“ bekannten Konzern (siehe auch<br />
Geschichte <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n in Stralsund).<br />
Die 1892 in <strong>de</strong>r Marienstraße eröffnete “Stralsun<strong>de</strong>r Bogenlampenfabrik” von Naeck&Holsten stellte elektrische Ausrüstungen her. Die Fabrik versorgte nicht nur Stralsun<strong>de</strong>r Firmen<br />
mit elektrischen Lichtanlagen, son<strong>de</strong>rn exportierte auch nach Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Russland, Spanien und Java, 1897 wur<strong>de</strong> sogar die Weltausstellung in Brüssel<br />
beliefert.[40]<br />
Eisenbahnverkehr und Straßenbahn<br />
Ab Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts bemühten sich die Stralsun<strong>de</strong>r um <strong>de</strong>n Anschluss ans Eisenbahnnetz. Erst 1863 wur<strong>de</strong> die Stadt als Nebenbahn mit Berlin und Stettin verbun<strong>de</strong>n. Der<br />
Anschluss an die Nordbahn wur<strong>de</strong> weiter verfolgt, jedoch erst am 1. Januar 1878 verwirklicht. Am 1. Juli 1883 wur<strong>de</strong> das Trajekt von Stralsund nach Altefähr eröffnet. Bereits 1869<br />
waren Entwürfe für eine Eisenbahnverbindung Berlin-Neustrelitz-Stralsund-Arkona mit Strelasundquerung und Hafen auf Rügen vorgelegt wor<strong>de</strong>n.<br />
Erst am 11. Juni 1888 wur<strong>de</strong> die Strecke von Stralsund bis <strong>zu</strong>r Lan<strong>de</strong>sgrenze Mecklenburgs abgenommen, da die mecklenburgische Regierung befürchtete, Preußen könne <strong>de</strong>n Betrieb<br />
bis nach Damgarten unter Umstän<strong>de</strong>n beschränken.[41]<br />
Die Berliner Firma Felix Singer & Co. AG, die ein Elektrizitätswerk in Stralsund errichtet hatte, baute die Straßenbahn in Stralsund auf, die am 25. März 1900 erstmals fuhr.<br />
Post- und Fernmel<strong>de</strong>wesen<br />
1851 wur<strong>de</strong> eine Telegrafenleitung von Stettin nach Stralsund und im Jahr 1854 das erste <strong>de</strong>utsche Seekabel durch <strong>de</strong>n Strelasund verlegt. Die Preußische Telegraphenstation begann<br />
ihren Betrieb am 1. Januar 1855 in einem Haus in <strong>de</strong>r Frankenstraße Nr. 32. Die ersten Telefone wur<strong>de</strong>n am 1. Oktober 1887 in Betrieb genommen – 38 Anschlüsse gab es <strong>zu</strong>nächst, das<br />
Telefonieren war nur innerhalb <strong>de</strong>r Stadt möglich. Telefonleitungen für Ferngespräche kamen ab 1894 hin<strong>zu</strong>. In diesem Jahr wur<strong>de</strong>n Leitungen nach Anklam und Stettin, 1895 nach<br />
Barth, 1897 <strong>zu</strong> Orten <strong>de</strong>r Provinz Pommern und 1898 nach Berlin gelegt.<br />
Nach<strong>de</strong>m Telegraphenamt und Post in einem Haus in <strong>de</strong>r Mühlenstraße <strong>zu</strong>sammengelegt waren wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Platz bald <strong>zu</strong> eng. Am 12. Oktober 1888 weihte General-Postdirektor Heinrich<br />
von Stephan das Postgebäu<strong>de</strong> am Neuen Markt ein. In diesem Jahr überschritt die Anzahl <strong>de</strong>r Briefsendungen die Millionengrenze.[42]<br />
Die Errichtung <strong>de</strong>r Eisenbahnstrecken brachte auch Verän<strong>de</strong>rungen im Postwesen, das bis dahin weitgehend über wöchentlich mehrmals beschickte Routen nach Barth, Greifswald,
Rostock, Rügen und Tribsees lief. Noch 1887 besaß das Stralsun<strong>de</strong>r Postamt 25 Pfer<strong>de</strong>.<br />
Gas und Elektrizität<br />
Die Stralsun<strong>de</strong>r Straßen wur<strong>de</strong>n bis <strong>zu</strong>r Mitte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts noch durch Öllampen beleuchtet. 1853 grün<strong>de</strong>ten Einwohner <strong>de</strong>n “Verein <strong>zu</strong>r Errichtung einer Gasbeleuchtung”.<br />
Einen Antrag <strong>zu</strong>m Aufbau einer solchen jedoch lehnte <strong>de</strong>r Rat am 23. Juni 1854 noch ab. Im Juni 1856 begannen die Arbeiten <strong>zu</strong>r Errichtung einer Gasbeleuchtungsanstalt in <strong>de</strong>r<br />
Frankenvorstadt, und am 27. Mai 1857 leuchteten erstmals 325 Gaslaternen in <strong>de</strong>n Straßen. 95 Privathaushalte unterhielten <strong>zu</strong><strong>de</strong>m 548 Flammen. Weitere Privathaushalte kamen hin<strong>zu</strong>,<br />
so waren es 1860 3562 Flammen, 1876 mehr als 8000 und 1888 10.236 Flammen[43] Das Stralsun<strong>de</strong>r Theater zählte schon ab 1857 <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Kun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Gasbeleuchtungsanstalt.<br />
Ab 1894 wur<strong>de</strong> das Gas auch als Brennstoff an die Privathaushalte geliefert.<br />
Die Berliner Firma Felix Singer & Co. AG errichtete ein Elektrizitätswerk in Stralsund. Ab 1899 lieferte die “Stralsun<strong>de</strong>r Bogenlampenfabrik” von Naeck&Holsten auch für<br />
Privathaushalte elektrisches Licht, nach<strong>de</strong>m ab 1895 Firmen und Geschäfte versorgt wor<strong>de</strong>n waren.<br />
Das Gaswerk und das Elektrizitätswerk wur<strong>de</strong>n 1899 <strong>zu</strong>m Betrieb “Stralsun<strong>de</strong>r Gas- und Wasserwerke” <strong>zu</strong>sammengelegt.<br />
Städtebau<br />
Durch ein Reichsgesetz vom 30. Mai 1873 wur<strong>de</strong> Stralsund entfestigt, das heißt: Der Festungscharakter wur<strong>de</strong> aufgehoben. Dieser hatte <strong>de</strong>r wirtschaftlichen Entwicklung Stralsund<br />
wie<strong>de</strong>rholt entgegengestan<strong>de</strong>n, so beim Ausbau <strong>de</strong>r Werften o<strong>de</strong>r auch bei <strong>de</strong>r notwendigen Erweiterung <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Spielkartenfabrik. Noch in <strong>de</strong>n 1860er Jahren waren auf <strong>de</strong>m<br />
Paschenberg und <strong>de</strong>r Schwarzen Kuppe Verteidigungsanlagen gebaut wor<strong>de</strong>n, die erklärter maßen auch künftige Vorstädte schützen sollten.<br />
Die Anzahl <strong>de</strong>r registrierten Privathäuser betrug im Jahr 1816 1370, im Jahr 1395. Die Einwohnerzahl erhöhte sich von fast 18.000 in <strong>de</strong>r Mitte <strong>de</strong>s Jahrhun<strong>de</strong>rts bis auf 30.000 im Jahr<br />
1900. Mit <strong>de</strong>m Ausbau <strong>de</strong>r staatlichen Verwaltungen wur<strong>de</strong> Stralsund mehr und mehr auch von Beamten bewohnt. Hin<strong>zu</strong> kamen Rentiers, allein am Knieperdamm wuchs ihre Zahl von<br />
fünf im Jahr 1875 auf 24 im Jahr 1900.<br />
In <strong>de</strong>n Straßen <strong>de</strong>r Knieper Vorstadt und <strong>de</strong>r Tribseer Vorstadt sie<strong>de</strong>lten sich wohlhaben<strong>de</strong> Unternehmer, hohe Angestellte und Militärs an. Arbeiter wohnten überwiegend in <strong>de</strong>n Straßen<br />
<strong>de</strong>r Altstadt. Wohnungsnot herrschte hier, <strong>de</strong>r Festungscharakter aber stand einer Erweiterung über die Stadtgrenzen hinaus lange im Weg. Ohne auf eine Entscheidung <strong>de</strong>r<br />
Militärverwaltung <strong>zu</strong> warten wur<strong>de</strong>n von 1860 bis 1895 fast 100 Häuser jeweils in <strong>de</strong>r Frankenvorstadt und <strong>de</strong>r Kniepervorstadt errichtet sowie fast 90 Häuser in <strong>de</strong>r Tribseer Vorstadt.<br />
Neue Straßen wur<strong>de</strong>n angelegt. Die Frankenvorstadt wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m industriellen Zentrum. Hier stan<strong>de</strong>n das Gaswerk und wur<strong>de</strong>n im Jahr 1860 Werften angelegt, zahlreiche Fabriken<br />
kamen hin<strong>zu</strong>. Auch das Militär baute diese Vorstadt für sich aus, so wur<strong>de</strong> die Frankendammkaserne errichtet und auf <strong>de</strong>m Dänholm zahlreiche weitere Kasernen. Die damalige Hafen-<br />
Vorstadt war Lagern und Speichern vorbehalten.<br />
In <strong>de</strong>r Innenstadt wur<strong>de</strong>n zahlreiche Häuser abgerissen und machten Neubauten Platz. Die Stralsun<strong>de</strong>r Stadtbefestigungen wur<strong>de</strong>n rigoros abgerissen, <strong>zu</strong>nächst 1853 das Heilgeisttor,<br />
später auch das Frankentor. In einer Denkschrift von Bürgern vom 3. Mai 1862 heißt es da<strong>zu</strong>: „Die Tore bereiten nicht allein <strong>de</strong>m Verkehr vielfache Hin<strong>de</strong>rnisse, son<strong>de</strong>rn sie bil<strong>de</strong>n auch<br />
eine Verunzierung <strong>de</strong>r Straßen.“ Das Bürgerschaftliche Kollegium beauftragte wie<strong>de</strong>rholt <strong>de</strong>n Rat, mit <strong>de</strong>m Abbruch <strong>de</strong>r Tore fort<strong>zu</strong>fahren. 1874 wur<strong>de</strong> das Fährtor, 1877 das Ba<strong>de</strong>ntor,<br />
1878 das Tribseer Tor und 1881 das Hospitalertor abgerissen.[44] Dem Abriss <strong>de</strong>s Kniepertores verweigerten Bürgermeister und Rat die Zustimmung und schrieben 1874 an die<br />
Bürgerschaft: „Durch die Beseitigung <strong>de</strong>s altertümlichen und stattlichen Turmes wür<strong>de</strong> die Stadt an ihrem eigentümlichen, <strong>de</strong>n Einwohnern wie <strong>de</strong>n sie besuchen<strong>de</strong>n Frem<strong>de</strong>n<br />
ansprechen<strong>de</strong>n baulichen Charakter eine empfindliche Beeinträchtigung erfahren, und <strong>de</strong>r nördliche Zugang <strong>zu</strong> ihr, welcher jetzt durch dieses Gebäu<strong>de</strong> in würdiger und be<strong>de</strong>uten<strong>de</strong>r<br />
Weise bezeichnet wird, wür<strong>de</strong> ein überaus nüchternes Aussehen erhalten“.[45]<br />
Schulwesen<br />
Ein Magistratsprotokoll vom 1. Oktober 1819 zeichnete ein schlimmes Bild von <strong>de</strong>n Stralsun<strong>de</strong>r Schulen: „Kaum glaublich (…), daß in einer Stadt wie Stralsund ist, außer <strong>de</strong>m<br />
Gymnasium, <strong>de</strong>n bei<strong>de</strong>n Industrie-Schulen, in welchen ungefähr zweihun<strong>de</strong>rt Kin<strong>de</strong>r unterrichtet wer<strong>de</strong>n, <strong>de</strong>r Schule im Waisenhause und <strong>de</strong>r Schule <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Militärs, welche mit
<strong>de</strong>r Stadt in keiner Beziehung steht, keine öffentlichen Schulen vorhan<strong>de</strong>n sind, und was von <strong>de</strong>n vorhan<strong>de</strong>nen Privatschulen gesagt wer<strong>de</strong>n muß, kann nur einem je<strong>de</strong>n auf das<br />
unangenehmste Wun<strong>de</strong>r nehmen.“.[46] 54 Privatschulen gab es <strong>zu</strong> <strong>de</strong>r Zeit in Stralsund, die „nur äußerst selten notwendige Anfor<strong>de</strong>rungen“ erfüllten, wie eine Kommission schrieb.<br />
Eine katholische Schule war am 7. Oktober 1807 eröffnet wor<strong>de</strong>n.<br />
Dem Pfarrer an St. Jakobi, Gottlieb Christian Mohnike, übertrug man 1819 auch das Amt <strong>de</strong>s Konsistorial- und Schulrats. Als solcher setzte er sich für die Verbesserung <strong>de</strong>r<br />
Elementarschulen ein.<br />
Am 14. Mai 1825 wur<strong>de</strong> die allgemeine Schulpflicht auch in <strong>de</strong>n neuen Teilen Preußens eingeführt. Das Elementarschulwesen in Stralsund regelte ab 1826 die „Ordnung für die<br />
Bürgerschulen in <strong>de</strong>r Stadt Stralsund“; sie sah unter an<strong>de</strong>rem als Strafe auch die körperliche Züchtigung in Form von „Schlägen über <strong>de</strong>n Rücken“ vor.<br />
In <strong>de</strong>r Innenstadt wur<strong>de</strong>n 1828 im Wohnhaus Langenstraße Unterrichtsräumen geschaffen, ebenso in <strong>de</strong>r Tribseer Straße Nr. 24, am Katharinenberg Nr. 7 und in <strong>de</strong>r Mühlenstraße Nr. 30.<br />
1860 wur<strong>de</strong>n dann auch Schulgebäu<strong>de</strong> errichtet, so 1860 in <strong>de</strong>r Tribseer Straße und 1869 in <strong>de</strong>r Mönchstraße.<br />
3341 schulpflichtige Kin<strong>de</strong>r bei 21.936 Einwohnern verzeichnet die Statistik für 1861. Sieben Elementarschulen (fünf Volksschulen und zwei Mittelschulen) mit 23 Lehrern und fünf<br />
Lehrerinnen stan<strong>de</strong>n offen, <strong>zu</strong><strong>de</strong>m existierten 16 Privatschulen mit 1064 Schülern.[47] Unter diesen Privatschulen hatte die <strong>de</strong>s Dr. Wilhelm Scheibner (1807–1851) einen<br />
ausgezeichneten Ruf, auch die an<strong>de</strong>ren Privatschulen entsprachen jetzt <strong>de</strong>n Anfor<strong>de</strong>rungen.<br />
Das humanistische Gymnasium, das seit 1560 im ehemaligen Katharinenkloster untergebracht war und nur Jungen unterrichtete, besuchten auch im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt viele später bekannte<br />
Personen. Arnold Ruge, Carl Ludwig Schleich und Hermann Burmeister waren nur einige von ihnen. Franziska Tiburtius dagegen wur<strong>de</strong> die Aufnahme verwehrt, sie besuchte daher eine<br />
Stralsun<strong>de</strong>r Privatschule.<br />
1875 wur<strong>de</strong> bei <strong>de</strong>r Marienkirche eine Realschule eröffnet, die 1882 <strong>zu</strong>m Realgymnasium umgestaltet wur<strong>de</strong>; damit besaß Stralsund zwei Gymnasien.<br />
Auch Berufsschulen und Gewerbeschulen wur<strong>de</strong>n errichtet. Nach<strong>de</strong>m die Armenpflege 1817 eine Sonntagsschule eröffnete kamen bis 1826 zwei Abendschulen, 1829 eine<br />
Gewerbeschule, 1851 die Handwerkerfortbildungschule und 1880 eine kaufmännische Berufsschule hin<strong>zu</strong>.<br />
Gesundheitswesen<br />
Krankenhäuser und medizinische Versorgung<br />
Aus <strong>de</strong>m Jahr 1784 stammte das erste Stralsun<strong>de</strong>r Krankenhaus, es war in <strong>de</strong>r ehemaligen Gasthauskirche (Marienstraße) eingerichtet wor<strong>de</strong>n und verfügte <strong>zu</strong>nächst über 24 Betten. Der<br />
Zustand <strong>de</strong>r Einrichtung wird vom Stadtphysikus Dr. Friedrich Wilhelm Mierendorff 1839 als „in <strong>de</strong>r allertraurigsten Verfassung“ befindlich beschrieben. Mierendorff schil<strong>de</strong>rte in <strong>de</strong>m<br />
Brief an <strong>de</strong>n Rat <strong>de</strong>r Stadt mangeln<strong>de</strong> Hygiene und Überfüllung. 1843 wur<strong>de</strong> die Kapazität <strong>de</strong>s Lazaretts auf 60 Betten erhöht. In <strong>de</strong>r Bleistraße wur<strong>de</strong>n 1842 eine „Irren- und<br />
Siechenanstalt“ und 1856 ein Kin<strong>de</strong>rhospital eröffnet. Das zweite Stadtkrankenhaus wur<strong>de</strong> durch Ernst von Haselberg von 1862 bis 1866 am Frankenwall errichtet; es verfügte über 120<br />
Betten und galt als mo<strong>de</strong>rnes Hospital, es verfügte über Bä<strong>de</strong>r und Wasserspülung.[48] 1874 wur<strong>de</strong> am Neuen Markt ein Militärlazarett eröffnet.<br />
Im Jahr 1816 praktizierten in Stralsund sechs Ärzte[49], 1871 waren es 16. Zu<strong>de</strong>m wur<strong>de</strong>n die Soldaten <strong>de</strong>r Garnison von Militärärzten betreut. Die Quacksalberei hatte Hochkonjunktur,<br />
es beteiligten sich Barbiere, Buchhändler, Friseure, Kaufleute, Konditoren und sogar Schmie<strong>de</strong> am Han<strong>de</strong>l mit „Geheimmitteln“.[49]<br />
Ba<strong>de</strong>wesen<br />
Ärzte empfahlen ihren Patienten warme Bä<strong>de</strong>r, was durch öffentliche Einrichtungen möglich wur<strong>de</strong>. Anfang <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts gab es eine Warmba<strong>de</strong>anstalt außerhalb <strong>de</strong>r<br />
Stadtmauern. 1829 eröffnete Gottfried Kirchhoff an <strong>de</strong>r Fährstraße ein russisches Dampfbad. An<strong>de</strong>re Duschbä<strong>de</strong>r kamen in <strong>de</strong>r zweiten Jahrhun<strong>de</strong>rthälfte hin<strong>zu</strong>. Am 19. März 1887<br />
wur<strong>de</strong> die noch heute vorhan<strong>de</strong>ne “Warmba<strong>de</strong>anstalt” in <strong>de</strong>r Sarnowstraße eröffnet. Auch das Johanniskloster bot ein Dampfbad für Arme an.<br />
Das Ba<strong>de</strong>n im kalten Wasser kam nur zögerlich auf. Im Strelasund durfte ab 1815 im Bereich vom Kniepertor bis nach Parow geba<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n. Mehrere Seeba<strong>de</strong>anstalten eröffneten, ab
1838 wur<strong>de</strong> auch Schwimmunterricht angeboten.<br />
Trinkwasserversorgung<br />
Die Sterblichkeit lag in Stralsund im Zeitraum 1851 bis 1865 bei 27,60 auf 1000 Einwohner[49], was außergewöhnlich hoch war. Grün<strong>de</strong> hierfür lagen unter an<strong>de</strong>rem in <strong>de</strong>r<br />
mangelhaften Trinkwasserversorgung. Die Stadt gewann ihr Trinkwasser aus <strong>de</strong>n Stadtteichen, die wie<strong>de</strong>rum durch das Gewerbe <strong>zu</strong>nehmend verunreinigt wur<strong>de</strong>n. Schwere Epi<strong>de</strong>mien<br />
waren regelmäßig <strong>zu</strong> verzeichnen.<br />
Von 1816 bis 1871 gab es im städtischen Krankenhaus 1700 Patienten, die wegen Unterleibstyphus eingeliefert wor<strong>de</strong>n waren, 841 litten an Wechselfieber und 445 an <strong>de</strong>r Cholera. In<br />
<strong>de</strong>n Jahren 1849–1850 starben 461 Stralsun<strong>de</strong>r an <strong>de</strong>r Cholera[50], vor allem aus <strong>de</strong>r ärmeren Bevölkerung.[51] Die Ruhr war als Krankheit schon fast „normal“. Bei einer<br />
Pockenepi<strong>de</strong>mie in <strong>de</strong>n Jahren 1870/1871 starben von 1805 Erkrankten 410.[52]<br />
Auf <strong>de</strong>m Gebet <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> seit <strong>de</strong>r zweiten Hälfte <strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts nach Quellen mit einwandfreiem Wasser gesucht, jedoch war das Ergebnis negativ. Stadtbaumeister Ernst<br />
von Haselberg schlug 1858 vor, ein Wasserwerk am Borgwallsee <strong>zu</strong> errichten; dies wur<strong>de</strong> wegen <strong>de</strong>r Kosten vom Bürgerschaftlichen Kollegium abgelehnt. Die Teiche wur<strong>de</strong>n vertieft<br />
und in <strong>de</strong>r von Haselberg gebauten Wasserkunst am Kütertor wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>sätzliche Filter eingebaut.<br />
Erst 1884 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Plan von Haselbergs umgesetzt und in Lüssow ein Wasserwerk gebaut. Da auch die Arbeiten an <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Kanalisation in diesem Jahr ihren Abschluss fan<strong>de</strong>n<br />
konnte fortan die Versorgung mit einwandfreiem Trinkwasser sichergestellt wer<strong>de</strong>n. Die grassieren<strong>de</strong> Typhusepi<strong>de</strong>mie erlosch.<br />
Kultur<br />
Um <strong>de</strong>m Wunsch <strong>de</strong>r Bürger nach Wissen nach<strong>zu</strong>kommen grün<strong>de</strong>ten sich im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt zahlreiche Vereine, die in Vorträgen Forschungsergebnisse vermittelten. 1816 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r<br />
“Musikalische Verein”, 1824 <strong>de</strong>r “Konzertverein” und 1825 die “Lie<strong>de</strong>rtafel” gegrün<strong>de</strong>t, Letztere betrieben ein Streichorchester und Chöre.<br />
In <strong>de</strong>n drei Pfarrkirchen Stralsunds (St. Marien, St. Nikolai und St. Jakobi) fan<strong>de</strong>n Orgelkonzerte auf <strong>de</strong>n berühmten Instrumenten statt.<br />
Gottlieb Christian Mohnike grün<strong>de</strong>te 1835 <strong>de</strong>n “Literarisch-Geselligen Verein”, 1841 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r “Kunstverein für Neuvorpommern und Rügen” gegrün<strong>de</strong>t. Dr. Rudolf Baier hatte<br />
größten Anteil am Aufbau und <strong>de</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>s vom Kunstverein gegrün<strong>de</strong>ten “Neuvorpommerschen Museum für einheimische Altertümer und Kunstgegenstän<strong>de</strong> in Stralsund”.<br />
Aus diesem am 1. Juli 1859 in <strong>de</strong>r Alten Küche <strong>de</strong>s Stralsun<strong>de</strong>r Rathauses eröffneten Museum ging dann das heutige Kulturhistorische Museum Stralsund hervor.<br />
Weitere Vereinsgründungen waren 1864 <strong>de</strong>r “Polytechnische Verein”, 1867 <strong>de</strong>r “Nautische Verein” und viele an<strong>de</strong>re.<br />
Am 28. August 1834 öffnete das Stralsun<strong>de</strong>r Theater am Alten Markt9. 600 Personen hatten hier Platz. Zuvor gab es verschie<strong>de</strong>ne Spielstätten, so im Haus <strong>de</strong>r Brauer-Compagnie in <strong>de</strong>r<br />
Heilgeiststraße, wo am 7. August 1827 Angelica Catalani auftrat. Anton Rubinstein spielte am 14. November 1868 im “Hotel <strong>de</strong> Bran<strong>de</strong>nbourg”.<br />
Katastrophen<br />
Im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt richteten vor allem zwei Katastrophen starke Schä<strong>de</strong>n in Stralsund an. Bei<strong>de</strong> Male traf ein Hochwasser die Hafen-Vorstadt. Im November 1864 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Ausbau<br />
dieser Vorstadt <strong>zu</strong>rückgeworfen.<br />
Eine weitere Hochwasserkatastrophe gab es am 12. und 13. November 1872. Bei orkanartigen Stürmen (siehe Ostseesturmhochwasser 1872) stieg <strong>de</strong>r Pegel auf 2,35 Meter über <strong>de</strong>m<br />
Mittelwasser <strong>de</strong>r Ostsee. Die “Stralsundische Zeitung” ließ einen Augenzeugen berichten: „Von <strong>de</strong>r äußeren Stadtmauer an war alles eine toben<strong>de</strong> Flut, aus <strong>de</strong>r nur die Speicher am<br />
Hafen hervorragten; brausend und bran<strong>de</strong>nd rollten mächtige Wogen bis auf die Zugbrücken <strong>de</strong>r äußeren Tore. Die Schiffe im Hafen und die Fahrzeuge im Kanal wur<strong>de</strong>n von Wind und<br />
Wellen hin und her und gegeneinan<strong>de</strong>r geschleu<strong>de</strong>rt. Aber noch nicht genug <strong>de</strong>s Schreckens und <strong>de</strong>r Gefahr, – es geriet die Kalknie<strong>de</strong>rlage außerhalb <strong>de</strong>s Ba<strong>de</strong>ntores in Brand, … eine<br />
funkensprühen<strong>de</strong> Flammeninsel inmitten <strong>de</strong>r alles überfluten<strong>de</strong>n Wassermassen, –überall Zerstörung. Außerhalb <strong>de</strong>s Hafens befin<strong>de</strong>n sich auf <strong>de</strong>m Mast eines gesunkenen Schiffes zwei<br />
Menschen, verzweifelnd um Hilfe rufend, aber alle Rettungsversuche erweisen sich bei <strong>de</strong>r Brandung und <strong>de</strong>m rasen<strong>de</strong>n Sturme als unausführbar …“.[53]
Der Sturm hatte <strong>de</strong>n gesamten Hafen mit Schiffsteilen und Bootstrümmern übersät, 19 Schiffe waren auf <strong>de</strong>n Kai geworfen wor<strong>de</strong>n. Die Hafenanlagen <strong>de</strong>r Eisenbahn sowie die<br />
Verla<strong>de</strong>brücken waren zerstört, die anliegen<strong>de</strong>n Häuser stan<strong>de</strong>n meterhoch unter Wasser.<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rt: 1900–1933<br />
Der Regierungsbezirk Stralsund bestand aus fünf Kreisen: Dem Stadtkreis Stralsund und <strong>de</strong>n Landkreisen Franzburg, Greifswald, Grimen und Rügen. Im Jahr 1900 lebten in diesem,<br />
über 400.000 Hektar großen Regierungsbezirk, 216.340 Menschen; <strong>de</strong>r Bezirk umfasste 14 Städte, 191 Landgemein<strong>de</strong>n und 668 Gutsbezirke[54]. Der Regierungsbezirk bestand bis<br />
Oktober 1932.<br />
Die Einwohnerzahl stieg von 38.185 im Jahr 1919 auf 43.360 im Jahr 1933[55]. 1928 wur<strong>de</strong>n die Orte An<strong>de</strong>rshof, Devin, Grünhufe, Langendorf, Lüssow, Voig<strong>de</strong>hagen und Klein<br />
Kedingshagen eingemein<strong>de</strong>t; das Stadtgebiet umfasste damit 3725 Hektar, wovon 1335 Hektar in städtischem Besitz waren. Außerhalb <strong>de</strong>r Stadtgrenzen besaß die Stadt 3539 Hektar<br />
Grund.<br />
Politik<br />
Bereits im Jahr 1891 war in Stralsund die erste Organisation <strong>de</strong>r Sozial<strong>de</strong>mokratischen Partei Deutschlands (SPD) entstan<strong>de</strong>n. Größten Einfluss aber hatte die Deutschkonservative<br />
Partei; weitere politische Parteien und Organisationen mit Einfluss im Regierungsbezirk Stralsund waren u. a. die Freisinnige Volkspartei, <strong>de</strong>r Deutsche Flottenverein, die Deutsche<br />
Kolonialgesellschaft.<br />
Bei <strong>de</strong>n Reichstagswahlen 1903 erhielt <strong>de</strong>r Kandidat <strong>de</strong>r SPD in Stralsund 1257 Stimmen[25]. Am 1. Mai 1905 wur<strong>de</strong> erstmals in Stralsund <strong>de</strong>r 1. Mai mit Arbeitsnie<strong>de</strong>rlegungen <strong>de</strong>r<br />
Bauarbeiter begangen[56]. 89 Streiks fan<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n Jahren 1904 bis 1913 im Regierungsbezirk statt[57].<br />
Der Führer <strong>de</strong>r Sozial<strong>de</strong>mokraten, Karl Liebknecht, vertrat vor Gericht die Interessen auch seiner Stralsun<strong>de</strong>r Genossen. Liebknecht weilte vom 3. bis 5. September 1909 in Stralsund<br />
und nahm am Abend <strong>de</strong>s 4. September an einer Veranstaltung mit über 400 Teilnehmern teil, auf <strong>de</strong>r er die Rüstungspolitik anprangerte und die Lebensbedingungen <strong>de</strong>r Werktätigen<br />
thematisierte[58]. Am 10. April 1910 fand in <strong>de</strong>r Stadt eine Kundgebung gegen das Dreiklassenwahlrecht Preußens und das Wahlrecht <strong>zu</strong>m Bürgerschaftlichen Kollegium statt, über 800<br />
Stralsun<strong>de</strong>r beteiligten sich daran. Am 14. September 1911 <strong>de</strong>monstrierten 1600 Stralsun<strong>de</strong>r gegen einen Krieg[59].<br />
Bei <strong>de</strong>r Reichstagswahl 1912 erhielt die SPD mit ihrem Kandidaten, <strong>de</strong>m Schriftsteller Simon Katzenstein, in Stralsund 2244 Stimmen[25], 522 Mitglie<strong>de</strong>r hatte die Partei vor Ort[60].<br />
Der Erste Weltkrieg spaltete bald die Bevölkerung in Kriegsbefürworter und Kriegsgegner. Unter <strong>de</strong>m Einfluss <strong>de</strong>r Oktoberrevolution in Russland kam es <strong>zu</strong> einer Stärkung linker<br />
Positionen unter <strong>de</strong>n Arbeitern. Am 24. Mai 1917 beschloss eine Mehrheit <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r SPD-Mitglie<strong>de</strong>r, <strong>zu</strong>r Unabhängigen Sozial<strong>de</strong>mokratischen Partei Deutschlands (USPD)<br />
über<strong>zu</strong>treten, <strong>de</strong>r Beschluss wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Kreisgeneralversammlung am 3. Juni 1917 bestätigt[61].<br />
Am 24. September 1917 wur<strong>de</strong> eine Ortsgruppe <strong>de</strong>r Deutschen Vaterlandspartei (DVP) gegrün<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>r sich <strong>zu</strong>nächst 325 Stralsun<strong>de</strong>r anschlossen und die im November 1917 bereits<br />
1258 Mitglie<strong>de</strong>r hatte[62].<br />
In Kriegsanleihen brachten Stralsun<strong>de</strong>r über drei Millionen Mark auf, nach einer vaterländischen Kundgebung in <strong>de</strong>r Nikolaikirche am 30. Oktober 1918 wur<strong>de</strong>n für weitere 580.000<br />
Mark Anleihen gezeichnet[63]. 1055 Stralsun<strong>de</strong>r starben im Krieg.<br />
Am 5. November 1918 erreichten die Meldungen über <strong>de</strong>n Kieler Matrosenaufstand Stralsund. Von Seiten <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Aufbau einer Bürgerwehr beschlossen. Am 9. November<br />
1918 kam es <strong>zu</strong> Streiks in <strong>de</strong>r Luftfahrt-Gesellschaft und <strong>de</strong>r Zuckerfabrik, Initiator war die USPD. Auf <strong>de</strong>m Alten Markt bekun<strong>de</strong>ten tausen<strong>de</strong> Teilnehmer, Arbeiter und Soldaten, ihren<br />
Unmut über eine Fortset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Krieges. Ein Arbeiter- und Soldatenrat wur<strong>de</strong> noch am selben Abend gewählt. Auf einer von <strong>de</strong>r SPD einberufenen Versammlung am 9. November, an<br />
<strong>de</strong>r 2000 Personen teilnahmen, wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Besonnenheit aufgerufen und baldige Neuwahlen verlangt[64]. Am folgen<strong>de</strong>n Tag wur<strong>de</strong> ein SPD-naher Arbeiterrat gegrün<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>m Paul<br />
Freyer, Wilhelm Goebel und Otto Neumann vorstan<strong>de</strong>n. Der USPD-nahe Arbeiter- und Soldatenrat ließ das Post- und Telegraphenamt besetzen und am 11. November 1918<br />
Oberbürgermeister Ernst August Friedrich Gronow und Bürgermeister Lütke verhaften.
Eine Min<strong>de</strong>rheit <strong>de</strong>r Soldaten <strong>de</strong>r Garnison Stralsund wählte am 9. November 1918 einen Soldatenrat. Das Offizierskorps ließ darauf hin am 10. November neu wählen, wobei ein Rat<br />
gewählt wur<strong>de</strong>, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Interessen <strong>de</strong>s Offizierskorps nahestand. Die Wachen im Post- und Telegraphenamt wur<strong>de</strong>n durch antirevolutionäre Einheiten ersetzt, Gronow und Lütke<br />
freigelassen. Am 12. November 1918 trafen sich Vertreter <strong>de</strong>s Soldatenrates, <strong>de</strong>s SPD-nahen Arbeiterrates und <strong>de</strong>r städtischen Verwaltung. Der Soldatenrat ließ abschließend mitteilen, es<br />
seien „alle Maßnahmen getroffen, um die absolute Ruhe und <strong>de</strong>n Schutz <strong>de</strong>s Eigentums <strong>zu</strong> gewährleisten. (...) Die höheren militärischen Kommandostellen (...) haben die Tätigkeit <strong>de</strong>s<br />
Soldatenrates autorisiert.“[65].<br />
Ebenfalls am 12. November 1918 bil<strong>de</strong>ten Vertreter von SPD und USPD einen Arbeiterrat, <strong>de</strong>r sich am Folgetag mit <strong>de</strong>m Soldatenrat <strong>zu</strong>sammenschloss. Am 17. November veranstaltete<br />
<strong>de</strong>r Rat eine Kundgebung <strong>zu</strong> Ehren <strong>de</strong>r Revolution, auf <strong>de</strong>r auch <strong>de</strong>r Oberbürgermeister Gronow re<strong>de</strong>te. Der Stettiner Rechtsanwalt und Landsturmmann Brock, <strong>de</strong>r <strong>de</strong>n Rat anführte,<br />
erklärte: „Russland mus uns ein abschrecken<strong>de</strong>s Beispiel sein. Das Volk muss sich daher <strong>de</strong>n Einflüssen jener bolschewistischen Gruppe verschließen, <strong>de</strong>ren Herrschaft<br />
notwendigerweise <strong>zu</strong> einem Bürgerkrieg führen muss“[65]. Die Kundgebung schloss mit einer Resolution,, wonach <strong>de</strong>r Arbeiter- und Soldatenrat gewillt sei, seine Tätigkeit gemäß <strong>de</strong>n<br />
Beschlüssen <strong>de</strong>r sozial<strong>de</strong>mokratischen Regierung aus<strong>zu</strong>üben; je<strong>de</strong> Diktatur sei ab<strong>zu</strong>lehnen[66]. Am 22. November 1918 wur<strong>de</strong> die Macht <strong>de</strong>r Polizei und am 27. November die <strong>de</strong>s<br />
Offizierskorps wie<strong>de</strong>r hergestellt. Am 25. November 1918 konstituierte sich ein aus 40 Personen bestehen<strong>de</strong>r Bürgerausschuss unter Vorsitz von Oberlyzealdirektor Karl Müller und<br />
Stadtsyndikus Carl Hey<strong>de</strong>mann.<br />
Bei <strong>de</strong>n Wahlen <strong>zu</strong>r Nationalversammlung am 19. Januar 1919 wur<strong>de</strong> in Stralsund die Sozial<strong>de</strong>mokratische Partei Deutschlands (SPD) mit 7573 Stimmen Wahlsieger vor <strong>de</strong>r Deutschen<br />
Demokratischen Partei (DDP) mit 6768 Stimmen. Die restlichen Stimmen <strong>de</strong>r 22.929 Bürger, die <strong>zu</strong>r Wahl gingen, verteilten sich auf die Deutsche Volkspartei (DVP) mit 3195,<br />
Deutschnationale Volkspartei (DNVP) mit 1103, Unabhängige Sozial<strong>de</strong>mokratische Partei Deutschlands (USPD) mit 487 und die Deutsche Zentrumspartei (Zentrum) mit 215<br />
Stimmen[67]. In das Bürgerschaftliche Kollegium wur<strong>de</strong>n am 2. März 1919 27 Abgeordnete <strong>de</strong>r bürgerlichen Parteien, 17 Abgeordnete <strong>de</strong>r SPD, zwei <strong>de</strong>r USP und zwei <strong>de</strong>s<br />
Staatsarbeiterverban<strong>de</strong>s gewählt; sechs Frauen gehörten <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Abgeordneten[68].<br />
Im Februar 1919 waren 800 Stralsun<strong>de</strong>r arbeitslos[69]. Die soziale Lage vieler Arbeiterfamilien verschlechterte sich. Am 4. Mai 1919 erzwangen zahlreiche Hausfrauen <strong>de</strong>n Verkauf <strong>de</strong>s<br />
frisch gefangenen und für <strong>de</strong>n Versand in an<strong>de</strong>re Städte bestimmten Fischfangs auf <strong>de</strong>m Alten Markt; tausen<strong>de</strong> Einwohner versammelten sich daraufhin dort. Oberbürgermeister Gronow<br />
ließ die Polizei anrücken, später wur<strong>de</strong> die Reichswehr aus Greifswald angefor<strong>de</strong>rt. Es kam <strong>zu</strong> schweren Kämpfen zwischen Arbeitern und <strong>de</strong>n Soldaten <strong>de</strong>r Reichswehr. Vom 5. bis <strong>zu</strong>m<br />
25. Mai 1919 stand die Stadt unter verschärftem Belagerungs<strong>zu</strong>stand.<br />
Am 18. September 1919 entstand in Stralsund eine Ortsgruppe <strong>de</strong>r Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD)[70].<br />
Nach <strong>de</strong>m Kapp-Putsch im März 1920 kam es auch in Stralsund wie in an<strong>de</strong>ren Städten <strong>zu</strong> Unruhen. Am 16. März begann ein Generalstreik unter Führung <strong>de</strong>r USPD. Dieser dauerte<br />
auch nach <strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rschlagung <strong>de</strong>s Putsches weiter an, erst am Abend <strong>de</strong>s 25. März wur<strong>de</strong> die Beendigung <strong>de</strong>s Streiks beschlossen[71]. Der starke Rückhalt <strong>de</strong>r USPD in <strong>de</strong>r<br />
Arbeiterschaft äußerte sich auch bei <strong>de</strong>n Wahlen <strong>zu</strong>m Reichstag am 6. Juni 1920. Sie erhielt 4610 Stimmen, nahe<strong>zu</strong> zehn mal so viel wie noch 1919. Wahlsieger wur<strong>de</strong> die DVP (8363<br />
Stimmen, ein Zuwachs von 5168 Stimmen gegenüber 1919). Die DNVP erhielt 2957 Stimmen, die SPD 2221, was ein Minus von 5352 Stimmen darstellte. Ihr folgte die DDP mit 1791<br />
Stimmen, ein Minus von 4977 Stimmen. Die erstmals angetretene KPD bekam 93 Stimmen[72]. Bei <strong>de</strong>r Reichstagswahl am 4. Mai 1924 wur<strong>de</strong> die DNVP stärkste Kraft in Stralsund, ihr<br />
gaben 8547 Stralsun<strong>de</strong>r ihre Stimme. Die SPD erhielt 3534 Stimmen, die KPD 1825, die DVP 1417 und die Deutschvölkische Freiheitspartei 1374 Stimmen[73]. Sieben Monate später,<br />
bei <strong>de</strong>r Reichstagswahl am 7. Dezember 1924, erhielt die SPD 5346 Stimmen, die KPD 768 Stimmen[73].<br />
Zur Vorbereitung <strong>de</strong>s Volksbegehrens <strong>zu</strong>r Fürstenenteignung arbeiteten SPD und KPD in Pommern <strong>zu</strong>sammen; in Stralsund kam es nicht <strong>zu</strong>r Bildung eines gemeinsamen<br />
Arbeitsausschusses. 4468 Wähler gaben <strong>de</strong>m Begehren ihre Zustimmung, an <strong>de</strong>m dann am 20. Juni 1926 von 143.600 Wahlberechtigten <strong>de</strong>s Regierungsbezirks Stralsund 38.299 an <strong>de</strong>r<br />
Abstimmung teilnahmen; 35.953 stimmten mit "ja". In Stralsund selbst nahmen von 24.561 Wahlberechtigten 6408 teil, von <strong>de</strong>nen 6091 <strong>de</strong>m Begehren <strong>zu</strong>stimmten[74].<br />
Am 12. September 1927 besuchte Reichspräsi<strong>de</strong>nt Paul von Hin<strong>de</strong>nburg Stralsund.<br />
Die wirtschaftlichen Folgen <strong>de</strong>r Weltwirtschaftskrise führten <strong>zu</strong>r Radikalisierung <strong>de</strong>r Politik. Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) gewann bei <strong>de</strong>r<br />
Reichstagswahl am 14. September 1930 5476 Stimmen[75]. Die Nationalsozialisten konnten ihren Stimmenanteil bei <strong>de</strong>r nächsten Wahl <strong>zu</strong>m Reichstag, am 10. April 1932, auf 12.281<br />
von 23.336 abgegebenen Stimmen erhöhen[76]. Am 31. Juli 1932 erhielt die NSDAP 12.079 Stimmen, die SPD 6254, die DNVP, die <strong>de</strong>n Oberbürgermeister Carl Hey<strong>de</strong>mann stellte,<br />
3596 Stimmen, die KPD 1960, das Zentrum 310, die DVP 273, die Staatspartei 215, <strong>de</strong>r Christlich-Soziale Volksdienst 68, die Wirtschaftspartei 42 und das Landvolk neun Stimmen, bei
einer Wahlbeteiligung von 90,5 Prozent[77]. Zwar verlor die NSDAP bei <strong>de</strong>r Reichstagswahl am 6. November 1932 knapp 3000 Stimmen, blieb aber stärkste Kraft.<br />
Politische Ehrungen<br />
Auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Stralsun<strong>de</strong>r Gymnasiums im ehemaligen Katharinenkloster wur<strong>de</strong> am 2. September 1900 eine Büste <strong>zu</strong>m Ge<strong>de</strong>nken an Ernst Moritz Arndt, <strong>de</strong>r diese Schule<br />
besucht hatte und in Stralsund tätig gewesen ist, eingeweiht. Auf <strong>de</strong>m Alten Markt entstand das Denkmal für Lambert Steinwich, das am 24. Juli 1904 eingeweiht wur<strong>de</strong>[78]. Vor <strong>de</strong>m<br />
Kniepertor entstand das Denkmal <strong>zu</strong> Ehren <strong>de</strong>s in Stralsund gefallen Ferdinand von Schills. Die Stadt beschloss am 18. März 1914 die Errichtung eines Reiterstandbil<strong>de</strong>s Kaiser Wilhelm<br />
II. aus Anlass <strong>de</strong>s 100. Jahrestages <strong>de</strong>r Vereinigung Stralsunds mit Preußen; dieses Vorhaben wur<strong>de</strong> jedoch wegen <strong>de</strong>s Krieges nicht umgesetzt.<br />
Wirtschaftliche Entwicklung<br />
Der maßgebliche Wirtschaftszweig im Regierungsbezirk Stralsund war die in <strong>de</strong>n Hän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Junker liegen<strong>de</strong> Landwirtschaft. Größere Industriebetriebe waren nicht vorhan<strong>de</strong>n.<br />
Während im Jahr 1895 57,4 % <strong>de</strong>r Beschäftigten im Regierungsbezirk in <strong>de</strong>r Landwirtschaft tätig waren, arbeiteten nur 30,4 % in <strong>de</strong>r Industrie[79]. Die Industriebetriebe hingen<br />
wie<strong>de</strong>rum oft direkt von <strong>de</strong>r Landwirtschaft ab. Weitere Wirtschaftszweige waren die Fischerei und <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>l mit <strong>de</strong>n Erzeugnissen <strong>de</strong>r Landwirtschaft.<br />
Die größten Unternehmen in Stralsund waren die Vereinigte Stralsun<strong>de</strong>r Spielkartenfabriken AG, die Zuckerfabrik AG und die Pommersche Eisengierei und Maschinenfabrik AG. Die<br />
Spielkartenfabrik beschäftigte im Jahr 1901 135 und im Jahr 1913 200 Arbeiter, die Zuckerfabrik über 300. Weitere Betriebe in <strong>de</strong>r Stadt waren u. a. eine Zementfabrik, vier Brauereien,<br />
vier Kornbrennereien, zwei Dampfmühlen, mehrere Essigfabriken, Bauunternehmen, die Stralsun<strong>de</strong>r Eisengießerei und Maschinenfabrik C. A. Beug, die Stralsun<strong>de</strong>r Bogenlampenfabrik<br />
und die Pianofortefabrik J. P. Lindner.<br />
Von über 600 Handwerkern und Gewerbetreiben<strong>de</strong>n, die im Jahr 1904 registriert waren, stellten die Schuhmacher mit 139 <strong>de</strong>n größten Teil, gefolgt von 54 Schnei<strong>de</strong>rn, 53 Frisören, 48<br />
Fleischern und 42 Bäckern[80]. 581 Meister, 651 Gesellen und 3222 Lehrlinge arbeiteten in diesem Jahr in 18 Gewerken.<br />
Der Beginn <strong>de</strong>s Ersten Weltkrieges am 1. August 1914 brachte auch für Stralsund eine Zäsur. Männliche Stralsun<strong>de</strong>r wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>m Kriegsdienst eingezogen. Die Lebensmittelpreise<br />
stiegen, und ab 1915 wur<strong>de</strong>n die Grundnahrungsmittel rationiert.<br />
Die Stralsun<strong>de</strong>r Spielkartenfabrik, die <strong>zu</strong>r kriegswichtigen Industrie zählte, verdoppelte zwischen 1914 und 1918 ihre Gewinne[81]. Im Sommer 1918 wur<strong>de</strong> eine Nie<strong>de</strong>rlassung <strong>de</strong>r<br />
Luftfahrzeug-Gesellschaft (LFG) in Stralsund gegrün<strong>de</strong>t, die Wasserflugzeuge (Typ „Albatros“) fertigte. Der kriegswichtige Betrieb beschäftigte 300 Arbeiter, die überwiegend aus <strong>de</strong>n<br />
Industriezentren Bitterfeld und Mag<strong>de</strong>burg stammten.<br />
Mitte <strong>de</strong>r 1920er Jahre schloss die LFG ihre Stralsun<strong>de</strong>r Nie<strong>de</strong>rlassung.<br />
Von 1924 bis 1927 lag die Zahl <strong>de</strong>r Arbeitslosen in Stralsund zwischen 600 im Sommer und 1100 <strong>zu</strong>m Jahreswechsel[82]. Im März 1928 lag die Zahl <strong>de</strong>r Erwerbslosen bei 1435, im<br />
Dezember 1928 bei 2408[83].<br />
1931 wur<strong>de</strong> die Spielkartenfabrik in Stralsund geschlossen, nach<strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Betrieb komplett nach Altenburg verlegt wor<strong>de</strong>n war. Die Be<strong>de</strong>utung <strong>de</strong>s Hafens ging <strong>zu</strong>rück, und nur zwei<br />
kleinere Werften existierten noch in <strong>de</strong>r Stadt. Die Zuckerfabrik beschäftigte während <strong>de</strong>r Saison zwischen 500 und 700 Arbeiter. Weitere nennenswerte Betriebe waren die Gas- und<br />
Wasserwerke, Elektrizitätswerk und Straßenbahn AG, Maschinenfabrik Beug und die Pommersche Eisengießerei. Die Weltwirtschaftskrise schlug sich auch in <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Wirtschaft<br />
nie<strong>de</strong>r. Von 1929 bis 1931 wur<strong>de</strong>n 65 Konkurse angemel<strong>de</strong>t und 171 Zwangsversteigerungen durchgeführt[84]. En<strong>de</strong> Januar 1932 waren im Bereich <strong>de</strong>s Arbeitsamtes Stralsund 16.277<br />
Menschen als arbeitslos registriert[85], wobei die tatsächliche Zahl weit höher lag.<br />
Städtebau<br />
Die Zahl <strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Stadt Stralsund wuchs von 3607 im Jahr 1900 auf 4520 im Jahr 1914 an[86]. Vor allem in <strong>de</strong>r Franken-, Knieper- und Tribseer Vorstadt wur<strong>de</strong> gebaut.<br />
Mehrere Schulen, ein Theater (1913/1914) und eine Nervenheilanstalt (1912) wur<strong>de</strong>n errichtet.
Im Jahr 1925 wur<strong>de</strong>n in Stralsund 2380 Wohnhäuser gezählt, im Jahr 1933 waren es 3128[87].<br />
Schulwesen<br />
Im Jahr 1911 wur<strong>de</strong> das Lyzeum errichtet, ebenso drei Vorschulen in <strong>de</strong>n Vorstädten. 5751 Schüler wur<strong>de</strong>n im Jahr 1914 von 180 Lehreren unterrichtet[88].<br />
Im Jahr 1926 existierten in Stralsund vier städtische und eine katholische Volksschulen, zwei Mittelschulen, ein Gymnasium, ein Oberlyzeum eine Oberrealschule und eine Hilfsschule.<br />
Die 93 Lehrer <strong>de</strong>r vier städtischen Volksschulen unterrichteten 3573 Kin<strong>de</strong>r, 210 Schüler besuchten das Gymnasium und 324 Schüler die Oberrealschule[89]. Eine Gewerbe- und<br />
Kaufmännische Berufsschule besuchten 1426 Handwerkslehrlinge und 531 kaufmännische Lehrlinge. Im Jahr 1927 wur<strong>de</strong> eine Landwirtschaftsschule gegrün<strong>de</strong>t.<br />
Gesundheitswesen<br />
Im Jahr 1912 wur<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Rostocker Chaussee die Heil- und Pfelgeanstalt für Nervenkranke eröffnet, die über 560 Betten verfügte[90].<br />
Kultur<br />
Auf einem Platz vor <strong>de</strong>m Kniepertor wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>n Jahren 1913/1914 ein neues Stralsun<strong>de</strong>r Stadttheater nach Plänen Carl Moritz' errichtet. Es wur<strong>de</strong> am 16. September 1916 eröffnet.<br />
Nach<strong>de</strong>m es <strong>zu</strong>nächst in städtischer Hand betrieben wur<strong>de</strong>, ging es 1921 in Pacht über.<br />
1920 wur<strong>de</strong> das Laientheater „Plattdütsch Späldäl to Stralsund“ gegrün<strong>de</strong>t, das sich <strong>de</strong>r Pflege <strong>de</strong>s Platt<strong>de</strong>utschen widmete. Drei Lichtspieltheater existierten in <strong>de</strong>r Stadt: Das Union-<br />
Theater in <strong>de</strong>r Frankenstraße 7, die Scala am Frankendamm 7 und die Bismarck-Lichtspiele in <strong>de</strong>r Mühlenstraße 20.<br />
Das Museum für Neuvorpommern und Rügen wur<strong>de</strong> 1924 im ehemaligen Katharinenkloster neu eröffnet.<br />
Militärische Einrichtungen<br />
In <strong>de</strong>r Garnison Stralsund befan<strong>de</strong>n sich Kasernen <strong>de</strong>s I., II. und IV. Bataillons <strong>de</strong>s Infanterieregiments Prinz Moritz von Anhalt-Dessau Nr. 42 (bzw. <strong>de</strong>ren Nachfolgeeinrichtungen).<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rt: 1933–1945<br />
Die Zeit von 1933 bis 1945 war geprägt von <strong>de</strong>r Herrschaft <strong>de</strong>r Nationalsozialisten und vom Zweiten Weltkrieg.<br />
Politik<br />
Nach <strong>de</strong>r Berufung Adolf Hitlers <strong>zu</strong>m Reichskanzler am 20. Januar 1933 veranstaltete die KPD in Stralsund am 31. Januar eine Demonstration. Die mehreren hun<strong>de</strong>rt Teilnehmer<br />
wur<strong>de</strong>n von Nationalsozialisten überfallen[91]. Darauf versammelten sich am folgen<strong>de</strong>n Tag über 1000 Stralsun<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>m Alten Markt. Zu einer weiteren Kundgebung gegen <strong>de</strong>n<br />
Nationalsozialismus versammelten sich am 19. Februar 1933 mehrere tausend Menschen aus ganz Vorpommern in Stralsund[92].<br />
Am 4. Februar 1933 wur<strong>de</strong> das Bürgerschaftliche Kollegium aufgelöst. Bei <strong>de</strong>n Reichstagswahlen am 5. März 1933 verteilten sich die Stimmen in Stralsund wie folgt: Die NSDAP<br />
gewann die Wahl mit 13.407 Stimmen. Es folgten die SPD mit 5945, DNVP mit 4537, die KPD mit 1737, die DVP mit 277, die Zentrumspartei mit 260, die Staatspartei mit 187, <strong>de</strong>r<br />
Christlich-Soziale Volksbund mit 60, die Sozialistische Kampfgemeinschaft mit 9 und die Deutsche Bauernpartei mit 5 Stimmen[93]. Auch bei <strong>de</strong>r Neuwahl <strong>zu</strong>m Bürgerschaftlichen<br />
Kollegium am 12. März 1933 gewann die NSDAP die absolute Mehrheit. Die neu gewählten Stadtvertreter traten am 5. April 1933 <strong>zu</strong>sammen. Die acht SPD-Abgeordneten, darunter<br />
Otto Kortüm, erschienen nach wenigen Wochen nicht mehr <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n Sit<strong>zu</strong>ngen. Die NSDAP versuchte nun, die DNVP <strong>zu</strong> entmachten. Am 7. Juni 1933 brachte die NSDAP-Fraktion ein<br />
Misstrauensvotum gegen Oberbürgermeister Carol Sohnemann (DNVP) und Bürgermeister Walter Freu<strong>de</strong>nhagen ein; dieser Antrag wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Stimmenmehrheit <strong>de</strong>r NSDAP gegen<br />
die Stimmen <strong>de</strong>r DNVP angenommen. Die Abset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Oberbürgermeisters hätte jedoch nur <strong>de</strong>r Innenminister anordnen können, in einer Sit<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s Rates am 22. Oktober 1934<br />
erklärte Sohnemann, dass er selbst <strong>de</strong>r „Führer <strong>de</strong>r Selbstverwaltung“ sei, „solange <strong>de</strong>r Oberbürgermeister das Vertrauen <strong>de</strong>s Innenministers“ habe. Auch weitere Versuche, ihn aus <strong>de</strong>m
Amt <strong>zu</strong> drängen, scheiterten, und Sohnemann blieb bis Mai 1936 und damit die vollen 12 Jahre seiner Amtszeit Oberbürgermeister. Sein Nachfolger wur<strong>de</strong> Werner Toll (NSDAP).<br />
Ab März 1933 konnte die KPD, ab 22. Juni 1933 auch die SPD nicht mehr legal wirken. Das Vermögen <strong>de</strong>r Parteien war eingezogen wor<strong>de</strong>n, da<strong>zu</strong> zählten das Gewerkschaftshaus sowie<br />
das Verlagshaus <strong>de</strong>r SPD, Alter Markt 9. Zahlreiche Sozial<strong>de</strong>mokraten und Kommunisten wur<strong>de</strong>n verhaftet. Auch Ju<strong>de</strong>n litten unter <strong>de</strong>r Verfolgung durch die staatlichen Organe. Die in<br />
Stralsund gegrün<strong>de</strong>te Firma Wertheim wur<strong>de</strong> 1937 enteignet. Ebenso erging es Leonardo Tiefe, <strong>de</strong>r in Stralsund ein Warenhaus gegrün<strong>de</strong>t hatte (heute Kaufhof).<br />
Unter <strong>de</strong>m Motto „Junger Nor<strong>de</strong>n“ wur<strong>de</strong>n ab 1937 Jugendtreffen veranstaltet, an <strong>de</strong>nen auch Schwe<strong>de</strong>n teilnahmen. 95 Prozent <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Jugendlichen zwischen 10 und 14 Jahren<br />
gehörten im September 1937 <strong>de</strong>r Hitler-Jugend an, von <strong>de</strong>n Jugendlichen zwischen 15 und 18 Jahren waren es 80 Prozent[94].<br />
Am 9. November 1939 fand auf <strong>de</strong>m Alten Markt eine Vereidigung von SS-Angehörigen statt. Zuvor war im Stralsun<strong>de</strong>r Theater eine Feier <strong>zu</strong>m Ge<strong>de</strong>nken an <strong>de</strong>n Hitler-Putsch im<br />
November 1923 abgehalten wor<strong>de</strong>n. In <strong>de</strong>r Nacht <strong>zu</strong>m 10. November 1938, <strong>de</strong>r Reichspogromnacht, zerstörten SA- und SS-Männer jüdische Geschäfte und Wohnungen und setzten die<br />
Synagoge in Brand (siehe auch Geschichte <strong>de</strong>r Ju<strong>de</strong>n in Stralsund).<br />
Bei Bombenangriffen am 13. Mai 1944, 20. Juni 1944, 18. Juli 1944 und beim Bombenangriff auf Stralsund am 6. Oktober 1944 wur<strong>de</strong>n in Stralsund große Teile <strong>de</strong>r Stadt zerstört.<br />
Mit <strong>de</strong>m Näherrücken <strong>de</strong>r Roten Armee wur<strong>de</strong> im April 1944 <strong>de</strong>r Ausbau <strong>de</strong>r Stadt <strong>zu</strong>r Festung organisiert. Am 1. Mai 1945 um 1 Uhr begann <strong>de</strong>nnoch <strong>de</strong>r Ab<strong>zu</strong>g <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Truppen<br />
über <strong>de</strong>n Rügendamm. Die Ziegelgrabenbrücke wur<strong>de</strong> von <strong>de</strong>n Wehrmachtstruppen gesprengt. In <strong>de</strong>n Morgenstun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s 1. Mai trafen sowjetische Truppen in Stralsund ein. Sie<br />
besetzten die Stadt kampflos.<br />
Wirtschaftliche Entwicklung<br />
Die Einwohnerzahl Stralsunds stieg von 44.739 im Jahr 1933 auf 49.342 im Mai 1939 an, im September 1939 waren es 49.705 Einwohner und 3000 Militärangehörige; am 1. Juli 1944<br />
zählte die Stadt 50.320 Einwohner[94].<br />
Nach <strong>de</strong>r Grundsteinlegung für <strong>de</strong>n Rügendamm am 1. August 1931 stockten die Arbeiten 1932; ab September 1933 wur<strong>de</strong>n die Arbeiten wie<strong>de</strong>r aufgenommen und stark voran<br />
getrieben. Nach <strong>de</strong>r Freigabe für <strong>de</strong>n Eisenbahnbetrieb am 5. Oktober 1936 wur<strong>de</strong> am 13. Mai 1937 auch die Straße für <strong>de</strong>n Verkehr freigegeben. 26 Millionen Reichsmark waren in das<br />
Projekt geflossen. Mit <strong>de</strong>r Fertigstellung verbesserten sich die Verkehrsbedingungen nach Rügen und weiter nach Schwe<strong>de</strong>n.<br />
Im Stralsun<strong>de</strong>r Hafen wur<strong>de</strong>n 1933 178.885 Tonnen Einfuhrgüter umgeschlagen, im Jahr 1935 waren es 264.532 Tonnen[95]. Exportiert wur<strong>de</strong>n 1936 152.410 Tonnen, darunter 124.281<br />
Tonnen Getrei<strong>de</strong>[94].<br />
Die Firmen Wertheim und Tietz wur<strong>de</strong>n 1936/1937 enteignet, da ihre Besitzer Ju<strong>de</strong>n waren. Am 15. Oktober 1938 in Stralsund noch 20 kleinere Geschäfte, <strong>de</strong>ren Inhaber Ju<strong>de</strong>n waren.<br />
Auch diese wur<strong>de</strong>n enteignet und die Besitzer verfolgt und <strong>de</strong>portiert. Am 11. Mai 1939 mel<strong>de</strong>te Oberbürgermeister Werner Stoll <strong>de</strong>m Gauleiter Schwe<strong>de</strong>-Coburg in Stettin die<br />
Beendigung <strong>de</strong>r „Abwicklung“ <strong>de</strong>r jüdischen Betriebe.<br />
Am 7. Januar 1941 wur<strong>de</strong> beim Amtsgericht Stralsund die Kröger-Werft GmbH eingetragen, am 13. März 1941 begann man mit <strong>de</strong>m Bau auf einem 56.700 Quadratmeter großen<br />
Grundstück im Industriehafen, wobei viele Kriegsgefangene eingesetzt wur<strong>de</strong>n. Ein Teil <strong>de</strong>s Fischereihafens wur<strong>de</strong> verlegt und im Hafen <strong>de</strong>r Südkai angelegt. Am 1. April 1942 begann<br />
die Produktion in <strong>de</strong>r Werft.<br />
In <strong>de</strong>r Zuckerfabrik waren 1942 232 sowjetische Kriegsgefangene und 45 Kriegsgefangene aus an<strong>de</strong>ren Län<strong>de</strong>rn eingesetzt, 1943 waren es 241 Kriegsgefangene aus Italien und 20<br />
sowjetische Kriegsgefangene.<br />
Städtebau<br />
Zwischen 1933 und 1939 wur<strong>de</strong>n 700 Wohnungen gebaut, die allerdings <strong>zu</strong>meist <strong>de</strong>r Unterbringung von Militärpersonen dienten.
Gesundheitswesen<br />
1940 wur<strong>de</strong> die Lan<strong>de</strong>sheilanstalt an <strong>de</strong>r Rostocker Chaussee in eine Kaserne <strong>de</strong>r Waffen-SS umgewan<strong>de</strong>lt. Die Heiminsassen wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>portiert. Im Juli 1943 ordnete<br />
Oberbürgermeister Fichtner die Schließung <strong>de</strong>s „St.-Josefs-Waisenhauses“ und <strong>de</strong>r „St.-Josefs-Kapelle“ an. Das Heim hatte 30 Kin<strong>de</strong>r betreut.<br />
Militärische Einrichtungen<br />
Nach einem Beschluss aus <strong>de</strong>m Jahr 1936, ein Infanterie-Bataillon nach Stralsund <strong>zu</strong> verlegen, wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Tribseer Vorstadt die „Prinz-Moritz-Kasernen“ gebaut und 1937 bezogen.<br />
Das Bataillon war auch am Feld<strong>zu</strong>g gegen Polen beteiligt.<br />
Auf <strong>de</strong>m Dänholm war die 7. Schiffsstammabteilung stationiert, in <strong>de</strong>r Frankenkaserne die 6. Kompanie. Die 11. Schiffsstammabteilung bezog neu gebaute Kasernen nordwestlich <strong>de</strong>r<br />
Schwe<strong>de</strong>nschanze.<br />
Ein großes Marinelazarett wur<strong>de</strong> am 14. Oktober 1938 am Ufer <strong>de</strong>s Strelasun<strong>de</strong>s, <strong>de</strong>r Sundpromena<strong>de</strong>, eingeweiht.<br />
Zu<strong>de</strong>m befan<strong>de</strong>n sich in Parow eine Fliegerwaffenschule (See) und ein Fliegerhorst.<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rt: 1945–1949<br />
Nach <strong>de</strong>m En<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Zweiten Weltkrieges, das für Stralsund <strong>de</strong>r 1. Mai 1945 darstellte, begann die Zeit <strong>de</strong>r Zugehörigkeit <strong>zu</strong>r Sowjetischen Besat<strong>zu</strong>ngszone Deutschlands.<br />
Politik<br />
Die Rote Armee zog am 1. Mai 1945 nahe<strong>zu</strong> kampflos in die in <strong>de</strong>n Morgenstun<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Wehrmacht in Richtung Rügen verlassene Stadt ein. Am Abend <strong>de</strong>sselben Tages traf<br />
Generalmajor Nikolai Grigorjewitsch Ljaschtschenko, Komman<strong>de</strong>ur <strong>de</strong>r 90. Ropschaer Schützendivision <strong>de</strong>r 2. Weissrussischen Front, in Stralsund ein. Die Wehrmachtstruppen hatten<br />
bei ihrem Ab<strong>zu</strong>g die <strong>zu</strong>m Rügendamm gehören<strong>de</strong> Ziegelgrabenbrücke gesprengt und sich auf <strong>de</strong>n Dänholm und die Insel Rügen <strong>zu</strong>rückgezogen. Im Auftrag <strong>de</strong>r Roten Armee wur<strong>de</strong>n<br />
zwei <strong>de</strong>utsche Parlamentärgruppen ausgesandt: Marinearzt Friedjung Glatzner leitete die Delegation, die sich <strong>zu</strong>m Dänholm begab, und Prälat Friedrich Ra<strong>de</strong>k diejenige, die sich nach<br />
Rügen begab. In <strong>de</strong>r Nacht vom 2. auf <strong>de</strong>n 3. Mai wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Dänholm geräumt, am 4. Mai 1945 rückte die Rote Armee kampflos auf die Insel Rügen.<br />
Zum Stadtkommandanten wur<strong>de</strong> Oberst Formenko eingesetzt. Otto Kortüm wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>m Oberbürgermeister ernannt, Max Fank <strong>zu</strong>m Leiter <strong>de</strong>r Stadtverwaltung. Am 6. Mai 1945 nahm<br />
die Stadtverwaltung ihre Arbeit auf. Oberbürgermeister Kortüm stan<strong>de</strong>n als Bürgermeister Emil Frost und Hermann Salinger <strong>zu</strong>r Seite. Unter Leitung von Gottfried Grünberg und Willi<br />
Bre<strong>de</strong>l arbeitete eine Gruppe <strong>de</strong>r KPD am Wie<strong>de</strong>raufbau mit. Die Stralsun<strong>de</strong>r Ortsgruppe <strong>de</strong>r KPD nahm am 13. Juni 1945 ihre Arbeit auf. Erster Vorsitzen<strong>de</strong>r war Hans Kollwitz. Die<br />
SPD-Ortsgruppe Stralsund wur<strong>de</strong> am 22. Juni 1945 neu gegrün<strong>de</strong>t. Im Juli wur<strong>de</strong>n Ortsgruppen <strong>de</strong>r Liberal-Demokratischen Partei Deutschlands (LDPD) und <strong>de</strong>r Christlich-<br />
Demokratischen Union Deutschlands (CDU) gegrün<strong>de</strong>t.<br />
Am 5. Juli 1945 wur<strong>de</strong>n im Rahmen <strong>de</strong>r Entnazifizierung 172 Mitarbeiter <strong>de</strong>r Stadtverwaltung entlassen. Auch Otto Kortüm wur<strong>de</strong>, nach<strong>de</strong>m ihm eine Mitgliedschaft in <strong>de</strong>r NSDAP<br />
nachgesagt wur<strong>de</strong>, aus <strong>de</strong>m Staatsdienst entlassen, Emil Frost wur<strong>de</strong> Oberbürgermeister. Am 13. November 1945 wur<strong>de</strong> ein Stadtausschuss gebil<strong>de</strong>t, <strong>de</strong>m je drei Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r KPD und<br />
SPD, zwei <strong>de</strong>r LDPD und eins <strong>de</strong>r CDU angehörten. Dieser Ausschuss wur<strong>de</strong> im Juni 1946 durch eine aus 30 Mitglie<strong>de</strong>rn bestehen<strong>de</strong> Versammlung ersetzt.<br />
Frida Wulff grün<strong>de</strong>te am 19. Dezember 1945 <strong>de</strong>n Frauenausschuss, <strong>de</strong>r am 4. Mai 1947 im Demokratischen Frauenbund Deutschlands (DFD) aufging. Bei <strong>de</strong>n Gewerkschaftswahlen im<br />
Januar 1946 wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Mehrzahl Sozial<strong>de</strong>mokraten als Delegierte <strong>zu</strong>r Kreis<strong>de</strong>legiertenkonferenz <strong>de</strong>s Freien Deutschen Gewerkschaftsbun<strong>de</strong>s (FDGB) bestimmt. Am 12. März 1946<br />
entstand die Kreisorganisation Stralsund <strong>de</strong>r Freien Deutschen Jugend (FDJ), <strong>de</strong>r 150 Mitglie<strong>de</strong>r angehörten. In getrennten Kreiskonferenzen von KPD und SPD beschlossen diese<br />
mehrheitlich die Vereinigung <strong>de</strong>r bei<strong>de</strong>n Parteien <strong>zu</strong>r Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED). In Stralsund entstand die erste SED-Kreisorganisation <strong>de</strong>s Lan<strong>de</strong>s Mecklenburg-<br />
Vorpommern. Erster Vorsitzen<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r SED-Kreisleitung Stralsund wur<strong>de</strong> Max Fank, <strong>de</strong>r 1947 wegen seiner Kritik an <strong>de</strong>r Verfolgung von Sozial<strong>de</strong>mokraten abgesetzt und aus <strong>de</strong>m<br />
Kreisvorstand und <strong>de</strong>r SED gedrängt wur<strong>de</strong>. Wal<strong>de</strong>mar Verner und Ernst Guth wur<strong>de</strong>n seine Nachfolger.
Am 15. September 1946 fan<strong>de</strong>n Wahlen <strong>zu</strong>r Stadtverordnetenversammlung statt. Von <strong>de</strong>n 27.693 abgegeben Stimmen entfielen 13.788 auf die SED, 10.002 auf die LDPD, 3129 auf die<br />
CDU und 195 auf <strong>de</strong>n Frauenausschuss. Damit erhielt die SED 26 <strong>de</strong>r 50 Sitze <strong>de</strong>r Stadtverordnetenversammlung, die LDPD 19 und die CDU fünf Sitze[96]. Zwischen April 1946 und<br />
April 1947 traten 4500 Menschen in die SED ein. Bei <strong>de</strong>n Betriebsratswahlen im Juni 1947 waren 51 % <strong>de</strong>r Gewählten Mitglied <strong>de</strong>r SED, 46 % waren parteilos.<br />
Politische Gegner <strong>de</strong>s unter sozialistischen Bedingungen geführten Neuaufbaus wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>nehmend verfolgt. Im Juni 1947 wur<strong>de</strong> so <strong>de</strong>r enteignete Gutsbesitzer Klausdorfs, von<br />
Hagemeister, nach <strong>de</strong>ssen Auffor<strong>de</strong>rung an die Neubauern, ihren Ablieferungspflichten nicht nach<strong>zu</strong>kommen, ausgewiesen und verließ die Sowjetische Besat<strong>zu</strong>ngszone nur mit<br />
Handgepäck. Der Rat <strong>de</strong>r Stadt beschloss am 17. Juni 1947, auch die weiteren 25 noch in <strong>de</strong>r Stadt wohnen<strong>de</strong>n ehemaligen Großgrundbesitzer aus<strong>zu</strong>weisen[97].<br />
Am 28. November 1947 sprach Wilhelm Pieck im Thälmann-Haus <strong>zu</strong>m Thema „Was wird aus Deutschland?“ anlässlich <strong>de</strong>r Londoner Außenministerkonferenz.<br />
Am Ersten Deutschen Volkskongress im Dezember 1947 in Berlin nahmen aus Stralsund Wal<strong>de</strong>mar Verner (SED), Kurt Kröning (LDPD), Annemarie Piontek (CDU), Walter Nolte<br />
(FDGB) und Heinz Lehmann (FDJ) teil[98].<br />
Im März 1948 been<strong>de</strong>te die Entnazifizierungskonferenz ihre Arbeit. Von September 1947 bis Februar 1948 hatte diese 944 Fälle bearbeitet, von <strong>de</strong>nen 221 an die Kriminalpolizei und 13<br />
an das Gericht übergeben wur<strong>de</strong>n; 25 Menschen verloren ihre Posten in leiten<strong>de</strong>n Stellungen, zwei mussten ihren Beruf als Lehrer aufgeben[99].<br />
Im September 1948 wur<strong>de</strong> die Ortsgruppe Stralsund <strong>de</strong>r National-Demokratischen Partei Deutschlands (NDPD) gegrün<strong>de</strong>t.<br />
Mit einer Großkundgebung wur<strong>de</strong> am 12. Oktober 1949 auf <strong>de</strong>m Alten Markt die Gründung <strong>de</strong>r Deutschen Demokratischen Republik (DDR) und die Wahl Wilhelm Piecks <strong>zu</strong>m<br />
Präsi<strong>de</strong>nten gefeiert.<br />
Wirtschaftliche Entwicklung<br />
Wichtige Industrieanlagen waren zerstört, die Transportmittel fehlten, die Energieversorgung lag am Bo<strong>de</strong>n. Gera<strong>de</strong> das Fehlen von Transportmöglichkeiten hemmte die sofortige<br />
Wie<strong>de</strong>raufnahme <strong>de</strong>r Produktion in zahlreichen Betrieben. Die Kommandantur stellte daraufhin 25 Pfer<strong>de</strong> <strong>zu</strong>r Verfügung[100].<br />
In einem Bericht vom 29. Juni 1945 heißt es über die Versorgungslage: „(...) Zusammenfassend kann festgestellt wer<strong>de</strong>n, dass die allgemeine Versorgungslage sowohl nach <strong>de</strong>r Seite <strong>de</strong>r<br />
Ernährung als auch <strong>de</strong>r allgemeinen Wirtschaftsseite hin als trostlos <strong>zu</strong> bezeichnen ist, wenn nicht Unterstüt<strong>zu</strong>ng und Hilfe von an<strong>de</strong>rer Seite gewährt wird.“ Im Juni 1945 konnten die<br />
rationierten Lebensmittel nur <strong>zu</strong>m Teil <strong>zu</strong>r Verfügung gestellt wer<strong>de</strong>n, ab 1. Juli 1945 wur<strong>de</strong> die wöchentliche Brotration von 1500 Gramm auf 750 Gramm gesenkt.<br />
En<strong>de</strong> Juli gab es in Stralsund 39 produzieren<strong>de</strong> Industriebetriebe, 496 Handwerksbetriebe sowie 18 Groß- und 164 Kleinhan<strong>de</strong>lsbetriebe[101].<br />
Die Bo<strong>de</strong>nreform brachte im Spätsommer 1945 die Aufteilung <strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Stadt gehören<strong>de</strong>n Güter Freienlan<strong>de</strong>, Grünhufe und Grünthal sowie <strong>de</strong>r Klostergüter Devin und Voig<strong>de</strong>hagen und<br />
<strong>de</strong>s Gutes An<strong>de</strong>rshof, <strong>de</strong>ssen flüchtiger Besitzer enteignet wur<strong>de</strong> - <strong>zu</strong>sammen 950 Hektar - auf 83 Landarbeiter und 33 Umsiedler. 878 Arbeiter erhielten Kleingartenparzellen. Auf<br />
Beschluss <strong>de</strong>r Sequesterkommission wur<strong>de</strong>n 34 örtliche Betriebe und Unternehmen sequestriert, darunter die Kröger-Werft, auf <strong>de</strong>ren Stralsun<strong>de</strong>r Gelän<strong>de</strong> die Volkswerft Stralsund<br />
entstand, die Dornquast-Werft, die Nie<strong>de</strong>rlassungen von Siemens & Halske, Siemens-Schuckertwerke und AEG. Auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Kröger-Werft entstand die „Ingenieur-Bau<br />
GmbH“ mit 106 Beschäftigten, die sich binnen kürzester Zeit <strong>zu</strong> einem <strong>de</strong>r Zentren <strong>de</strong>r DDR-Werftindustrie entwickelte. Die beschlagnahmten Betriebe wur<strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Sowjetischen<br />
Militäradministration in Deutschland (SMAD) im Mai 1946 an die <strong>de</strong>utschen Behör<strong>de</strong>n übergeben. 29 Stralsun<strong>de</strong>r Betriebe waren gemäß <strong>de</strong>m „Gesetz Nr. 4“ <strong>de</strong>r Lan<strong>de</strong>sregierung<br />
enteignet wor<strong>de</strong>n, fünf Unternehmer erhielten ihr Unternehmen <strong>zu</strong>rück[102]. Gegen die Enteignung <strong>de</strong>r Stralsundischen Vereinsbrauerei protestierten in einem Schreiben vom 23. Mai<br />
1946 31 Arbeiter <strong>de</strong>r Brauerei[103].<br />
Im Oktober 1945 lieferte das Elektrizitätswerk wie<strong>de</strong>r stun<strong>de</strong>nweise Strom. Ab 1. November 1945 konnten die Lebensmittelrationen erhöht wer<strong>de</strong>n. Ein Arbeiter erhielt eine tägliche<br />
Ration von 350 Gramm Brot, Kin<strong>de</strong>r bis 15 Jahren 200 Gramm[104]. En<strong>de</strong> Februar 1946 gab es in Stralsund 75 Industriebetriebe, 750 Handwerksbetriebe und 510 Han<strong>de</strong>lsbetriebe. Ab<br />
Februar 1946 lieferte das Gaswerk Gas an Haushalte und die Straßenbeleuchtung. Auch <strong>de</strong>r Hafenbetrieb wur<strong>de</strong> wie<strong>de</strong>r aufgenommen und intensiviert; in diesem Jahr wur<strong>de</strong>n 104.194<br />
Tonnen Güter umgeschlagen, 1947 waren es 258.299 Tonnen, 64 % mehr als 1938.<br />
Im Jahr 1947 arbeiteten von 27.241 registrierten Berufstätigen 7.503 in Gewerbebetrieben, 6.377 in Kultur und Administration, 6.069 in <strong>de</strong>r Industrie, 3.052 im Han<strong>de</strong>l, 2.882 in <strong>de</strong>r
Landwirtschaft und 1.358 bei <strong>de</strong>r Reichsbahn[105].<br />
Im Juni 1948 erging <strong>de</strong>r Befehl 103 <strong>de</strong>r SMAD über <strong>de</strong>n Aufbau einer Werft in Stralsund. Vorläufer dieser Werft war <strong>de</strong>r lan<strong>de</strong>seigene Ingenieur-Bau-Betrieb mit über 1000<br />
Beschäftigten. Daneben existierten 1948 weitere 21 volkseigene Betriebe (VEB)[106]. En<strong>de</strong> 1948 wur<strong>de</strong> die Han<strong>de</strong>lsorganisation (HO) gegrün<strong>de</strong>t, als erste Einrichtung in Stralsund die<br />
Gaststätte „Schweriner Hof“ am 16. November 1948 eröffnet. Am 11. Dezember 1948 eröffnete die erste HO-Verkaufseinrichtung in <strong>de</strong>r Ossenreyerstraße 11/12.<br />
Um die Arbeitsproduktivität <strong>zu</strong> erhöhen, wur<strong>de</strong>n zahlreiche Maßnahmen ergriffen. Die „Aktivistenbewegung“ wur<strong>de</strong> ins Leben gerufen. Am 28. Oktober 1948 vermauerte <strong>de</strong>r damals<br />
61jährige Maurerpolier Paul Sack auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Werft in acht Stun<strong>de</strong>n 2600 Steine, was einer Steigerung <strong>de</strong>r Norm von 430 % entsprach. Am Folgetag schaffte Hans Brandt 3000<br />
Steine. In <strong>de</strong>r Folge wur<strong>de</strong>n Aktivisten-Konferenzen, „Hennecke-Tage“ und Leistungswochen durchgeführt, um die Produktivität <strong>zu</strong> steigern.<br />
Die Volkswerft beschäftigte 1949 4420 Menschen[107].<br />
Städtebau<br />
Beim Bombenangriff auf Stralsund am 6. Oktober 1944 waren mehr als 35 Prozent <strong>de</strong>r Wohnungen zerstört wor<strong>de</strong>n. Die Wohnraumfrage wur<strong>de</strong> noch durch <strong>de</strong>n Zu<strong>zu</strong>g von 14.3000<br />
Umsiedlern nach Kriegsen<strong>de</strong> verstärkt.<br />
Bis 1949 wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Stadt 95.000 Kubikmeter Schutt beseitigt. Beson<strong>de</strong>ren Anteil hatten die Trümmerfrauen.<br />
Verkehr<br />
Beim Bombenangriff auf Stralsund am 6. Oktober 1944 war <strong>de</strong>r Wagenpark <strong>de</strong>r Straßenbahn zerstört wor<strong>de</strong>n. Die Ziegelgrabenbrücke, Bestandteil <strong>de</strong>r festen Querung <strong>de</strong>s Strelasun<strong>de</strong>s,<br />
war von <strong>de</strong>n abrücken<strong>de</strong>n Truppen <strong>de</strong>r Wehrmacht zerstört wor<strong>de</strong>n. Im Oktober 1946 wur<strong>de</strong> die Straßenbrücke, am 11. Oktober 1947 die Eisenbahnstrecke wie<strong>de</strong>r in Betrieb<br />
genommen[108].<br />
Gesundheitswesen<br />
Nach Kriegsen<strong>de</strong> breitete sich Typhus in <strong>de</strong>r Stadt aus, durch über 10.000 Flüchtlinge wur<strong>de</strong> die dramatische Lage noch verstärkt. Die Säuglingssterblichkeit nahm <strong>zu</strong>.<br />
Schulwesen<br />
Ab <strong>de</strong>m 3. Mai 1945 widmete sich die Schulverwaltung unter Schulrat Willy Dau <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>reröffnung <strong>de</strong>r Schulen. Der Unterricht an <strong>de</strong>n Schulen begann per Bekanntmachung am<br />
Montag, <strong>de</strong>m 1. Oktober 1945, um 9 Uhr. Sieben Volksschulen mit zehn Klassen, zwei Oberschulen und ein Gymnasium mit <strong>zu</strong>sammen 19 Klassen wur<strong>de</strong>n wie<strong>de</strong>reröffnet. 76 Lehrer<br />
betreuten 4493 Schüler. 1186 Schüler erhielten <strong>zu</strong>nächst keinen Unterricht. 35 Lehrer waren wegen ihrer Vergangenheit im Nationalsozialismus aus <strong>de</strong>m Schuldienst entlassen wor<strong>de</strong>n,<br />
35 weitere beurlaubt. Vom 24. September bis 21. Oktober 1945 fand <strong>de</strong>r erste Lehrgang für Neulehrer statt. Wur<strong>de</strong> <strong>zu</strong>nächst das Schulwesen an das <strong>de</strong>r Weimarer Republik angelehnt,<br />
begann mit <strong>de</strong>m Aufruf <strong>de</strong>r KPD <strong>zu</strong>r Schulreform ab Oktober 1945 auch die i<strong>de</strong>ologische Einflussnahme. Ab Frühjahr 1946 konnten alle Stralsun<strong>de</strong>r Schulpflichtigen unterrichtet<br />
wer<strong>de</strong>n, wofür 137 Lehrkräfte bereit stan<strong>de</strong>n. Schulbücher und Lehrmaterial stand allerdings nur sehr begrenzt <strong>zu</strong>r Verfügung, als Lesestoff dienten Märchenbücher.<br />
Kulturwesen<br />
Am 2. Juni 1945 nahm das Stralsun<strong>de</strong>r Theater <strong>de</strong>n Spielbetrieb wie<strong>de</strong>r auf. Die Stadtbibliothek wur<strong>de</strong> am 2. Oktober wie<strong>de</strong>r eröffnet. Die im Krieg ausgelagerten Bestän<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />
Stralsun<strong>de</strong>r Heimatmuseums, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>nen auch die Stellwagen-Orgel <strong>de</strong>r Marienkirche gehörte, wur<strong>de</strong>n unter Aufsicht von Käthe Rieck und mit Hilfe <strong>de</strong>r Roten Armee wie<strong>de</strong>r in das<br />
Museum gebracht.<br />
Am 27. Juli 1946 fand im Stralsun<strong>de</strong>r Rathaus in Anwesenheit von Wilhelm Pieck, Wilhelm Höcker, Johannes R. Becher, Paul Wan<strong>de</strong>l, Karl Maron und Oberst Tulpanow die Trauerfeier<br />
für <strong>de</strong>n verstorbenen Gerhart Hauptmann statt.
Die angestrebte Erneuerung <strong>de</strong>r Kultur hatte vor allem die Popularisierung <strong>de</strong>r sowjetischen Kultur und Literatur <strong>zu</strong>m Inhalt. Am Theater wur<strong>de</strong>n Werke russischer Komponisten<br />
aufgeführt, die Kinos zeigten Filme aus <strong>de</strong>r Sowjetunion.<br />
20. Jahrhun<strong>de</strong>rt: 1949–1990<br />
Politik<br />
Im Dezember 1949 wur<strong>de</strong> die Ortsgruppe <strong>de</strong>r Demokratischen Bauernpartei Deutschlands (DBD) gegrün<strong>de</strong>t. Anfang 1950 entstand in Stralsund aus <strong>de</strong>m Volksausschuss für Einheit und<br />
gerechten Frie<strong>de</strong>n die Nationale Front <strong>de</strong>s Demokratischen Deutschland. Erster Vorsitzen<strong>de</strong>r wur<strong>de</strong> Walter Wilke (SED). Als Untergruppen wur<strong>de</strong>n Wohnbezirksausschüsse und<br />
Hausgemeinschaften <strong>de</strong>r Nationalen Front gegrün<strong>de</strong>t; die erste Hausgemeinschaft <strong>de</strong>r Nationalen Front entstand am 3. Mai 1950 in <strong>de</strong>r Sarnowstraße Nr. 7.<br />
Am 5. Mai 1950 wur<strong>de</strong> Hermann Salinger (SED) <strong>zu</strong>m Oberbürgermeister gewählt. Zu <strong>de</strong>n Volkswahlen im Oktober 1950 wur<strong>de</strong>n gemeinsame Listen <strong>de</strong>r Nationalen Front aufgestellt;<br />
99,8 % <strong>de</strong>r Wähler stimmten für die Vorschlagslisten.[109] Abgeordnete <strong>de</strong>r Volkskammer wur<strong>de</strong> Gertrud Soelch, Abgeordnete im Landtag Heinz Peters und Ursula Wulff.<br />
Nach <strong>de</strong>r 2. Parteikonferenz <strong>de</strong>r SED in Berlin im Juli 1952 wur<strong>de</strong>n in Stralsund zwei Kreisorganisationen <strong>de</strong>r SED gebil<strong>de</strong>t: „Stadt“ und „Land“. Erster Sekretär <strong>de</strong>r Kreisorganisation<br />
Stralsund-Stadt war Erich Hoffmann.<br />
En<strong>de</strong> Juli 1952 wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>n neu gegrün<strong>de</strong>ten Bezirkstag <strong>de</strong>s Bezirks Rostock aus Stralsund Rudolf Warga und Walter Stadthagen entsandt.[110] Am 30. Januar 1953 konstituierte sich<br />
die Stadtverordnetenversammlung. Oberbürgermeister wur<strong>de</strong> erneut Hermann Salinger. Er wur<strong>de</strong> 1954 von Erhard Holweger abgelöst.<br />
Am 17. Juni 1953 wur<strong>de</strong>n einige Proteste gegen die Normerhöhungen laut. Am 18. Juni 1953 streikten die Arbeiter <strong>de</strong>r Volkswerft mit <strong>de</strong>r Frühschicht gegen <strong>de</strong>n bereits verhängten<br />
Ausnahme<strong>zu</strong>stand und erhoben auch politische For<strong>de</strong>rungen. 900 Personen beteiligten sich und wollten in die Stadt vordringen. Sowjetische Truppen und <strong>de</strong>utsche Polizei hin<strong>de</strong>rten sie<br />
daran, es gab 15 Festnahmen. An<strong>de</strong>re Proteste z. B. von Bauarbeitern zogen sich noch eine Woche hin. Der Platz <strong>de</strong>s 17. Juni erinnert daran.<br />
Im März 1957 wur<strong>de</strong>n die Kreisleitungen „Stadt“ und „Land“ <strong>de</strong>r SED <strong>zu</strong> einem Organ <strong>zu</strong>sammengeschlossen. 1. Sekretär wur<strong>de</strong> Heinz Chill.<br />
Im Januar 1958 wur<strong>de</strong> Bruno Motczinski von <strong>de</strong>r Stadtverordnetenversammlung <strong>zu</strong>m Nachfolger von Oberbürgermeister Erhard Holweger gewählt. Nach<strong>de</strong>m die SED-Kreisleitung im<br />
Juli 1962 „ernste Mängel“ in <strong>de</strong>r Kreisleitung <strong>de</strong>r SED, <strong>de</strong>m Rat <strong>de</strong>r Stadt und an<strong>de</strong>ren Organen analysierte, wur<strong>de</strong>n Bruno Motczinski, Heinz Chill und an<strong>de</strong>re Führungska<strong>de</strong>r ihrer<br />
Posten enthoben[111]. Neuer 1. Sekretär <strong>de</strong>r SED-Kreisleitung wur<strong>de</strong> Günter Rosenfeld, Siegfried Priewe wur<strong>de</strong> am 14. März 1963 <strong>zu</strong>m Oberbürgermeister gewählt.<br />
Dem Rat <strong>de</strong>r Stadt stand ab November 1964 Heinz Lesener als Oberbürgermeister vor.<br />
Am Volksentscheid über die neue Verfassung <strong>de</strong>r DDR nahmen am 6. April 1968 98,7 % <strong>de</strong>r Wahlberechtigten teil, 96,6 % stimmten für die Verfassung.<br />
Am 19. April 1971 wur<strong>de</strong> Heinz Lesener von <strong>de</strong>r Stadtverordnetenversammlung vom Amt <strong>de</strong>s Oberbürgermeisters abberufen und Horst Lehmann <strong>zu</strong> seinem Nachfolger gewählt.<br />
Die Anzahl <strong>de</strong>r Stadtverordneten wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r Wahl im Mai 1974 von 100 auf 150 erhöht.<br />
Der schwedische Ministerpräsi<strong>de</strong>nt Olof Palme besuchte auf Einladung Erich Honeckers am 29. Juni 1984 die Stadt. Nach seiner Ermordung wur<strong>de</strong> ein Teil <strong>de</strong>r Sarnowstraße (vor <strong>de</strong>m<br />
Stralsun<strong>de</strong>r Theater) in Olof-Palme-Platz umbenannt.<br />
Im Gebäu<strong>de</strong> Frankendamm 5 arbeitete die Kreisdienststelle <strong>de</strong>r Staatssicherheit. Eines <strong>de</strong>r operativen Ziele war die Frie<strong>de</strong>nsbewegung in <strong>de</strong>r lokalen Kirche <strong>zu</strong> Beginn <strong>de</strong>r 1980-er Jahre.<br />
1987 begann <strong>de</strong>r Olof-Palme-Frie<strong>de</strong>nsmarsch in Stralsund, <strong>de</strong>n die Opposition <strong>zu</strong>r Demonstration gegen Menschenrechtsverlet<strong>zu</strong>ngen in <strong>de</strong>r DDR nutzen konnte.[112]<br />
Oberbürgermeister Horst Lehmann trat am 8. Oktober 1989 <strong>zu</strong>rück, sein wur<strong>de</strong> Nachfolger Klaus Schlegel. Am 18. Oktober 1989 wird in Stralsund die erste Ortsgruppe <strong>de</strong>r SDP in <strong>de</strong>n<br />
drei DDR-Nordbezirken gegrün<strong>de</strong>t. Am 23. Oktober 1989 versammelten sich in <strong>de</strong>r Marienkirche 6000 Menschen <strong>zu</strong>m Frie<strong>de</strong>nsgebet. Drei Tage später konstituiert sich das Neue Forum.<br />
Auf <strong>de</strong>m Olof-Palme-Platz fand am 5. November 1989 eine Großveranstaltung mit 10.000 Teilnehmern statt; die Stadtverwaltung stellte sich <strong>de</strong>m öffentlichen Dialog mit <strong>de</strong>n
Einwohnern. Der „Unabhängige Gerechtigkeitsausschuss“ konstituierte sich am 27. November 1989.<br />
Für die letzte Volkskammerwahl am 17. März 1990 kandidierten acht Stralsun<strong>de</strong>r. Am 11. August 1990 grün<strong>de</strong>n Mitglie<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r NDPD und <strong>de</strong>r LDPD die Ortsgruppe <strong>de</strong>r FDP-Ost.<br />
Politische Ehrungen<br />
Am 16. April 1961 wur<strong>de</strong> an <strong>de</strong>r Sundpromena<strong>de</strong> (damals: „Ernst-Thälmann-Ufer“) <strong>de</strong>r Grundstein für ein überlebensgroßes Denkmal für Ernst Thälmann gelegt. Dafür wur<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r<br />
Bevölkerung und <strong>de</strong>n Betrieben Spen<strong>de</strong>n geworben. Es wur<strong>de</strong> nach Plänen von Walter Arnold geschaffen. Das Denkmal wur<strong>de</strong> am 18. August 1962 im Beisein von Thälmanns Tochter<br />
enthüllt.<br />
Der neu gestaltete Ehrenhain für die Sowjetsoldaten am Neuen Markt wur<strong>de</strong> am 7. November 1967 eingeweiht. Das Relief eines sowjetischen Offiziers und eines Arbeiters wur<strong>de</strong> von<br />
Fritz Rogge geschaffen.[113]<br />
Anlässlich <strong>de</strong>s 100. Geburtstages Lenins wur<strong>de</strong> am Hauptbahnhof am 11. April 1970 eine von Walter Preik gestaltete bronzene Ge<strong>de</strong>nktafel enthüllt; <strong>de</strong>r Neue Markt wur<strong>de</strong> am 22. April<br />
1970 in Leninplatz umbenannt.<br />
Wirtschaftliche Entwicklung<br />
Im Jahr 1949 wur<strong>de</strong>n in Stralsund 31 Betriebe in <strong>de</strong>r Form eines volkseigenen Betriebs geführt. Großbetriebe waren die Volkswerft und <strong>de</strong>r VEB Bau-Union, weitere größere Betriebe<br />
<strong>de</strong>r VEB Schiffbau- und Reparaturwerft, die Staatswerft und <strong>de</strong>r VEB Holz- und Massivbau.<br />
Die Volkswerft begann mit <strong>de</strong>r Großproduktion von Loggern. Am 7. November 1949 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r erste Logger übergeben und damit die Loggerschlacht eröffnet. Zum III. Parteitag <strong>de</strong>r<br />
SED wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Logger 424 fertiggestellt und damit <strong>de</strong>r Zwei-Jahr-Plan erfüllt. Auf <strong>de</strong>r Staatswerft, die ab 1949 wie<strong>de</strong>r aufgebaut wor<strong>de</strong>n war, wur<strong>de</strong> am 13. Oktober 1950 das aus einem<br />
Wrack aufgebaute erste Han<strong>de</strong>lsschiff <strong>de</strong>r DDR übergeben[114]. Auf <strong>de</strong>r Volkswerft lief am 13. Oktober 1951 das erste Hochseefischereifahrzeug <strong>de</strong>r DDR vom Stapel; <strong>de</strong>r Plan <strong>zu</strong>r<br />
Loggerproduktion wur<strong>de</strong> mit <strong>zu</strong>sätzlich fünf Schiffen übererfüllt[115]. Am 15. November 1952 lieferte die Werft <strong>de</strong>n 125. Logger ab und erfüllte damit ihre Reparationslieferungen<br />
gegenüber <strong>de</strong>r Sowjetunion vorfristig.<br />
Am 1. März 1953 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r VEB Seehafen gebil<strong>de</strong>t. Am 23. Mai 1953 entstand die erste Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaft (LPG) <strong>de</strong>s Typs I in An<strong>de</strong>rshof.<br />
Am 17. Juni 1953 kam es auf Baustellen und in <strong>de</strong>r Volkswerft <strong>zu</strong> Arbeitsnie<strong>de</strong>rlegungen. Einige Werftarbeiter, darunter ein Gewerkschaftsfunktionär, wur<strong>de</strong>n verhaftet. Die<br />
Arbeitsnie<strong>de</strong>rlegungen wur<strong>de</strong>n nach <strong>de</strong>m Auftreten <strong>de</strong>r bewaffneten Organe <strong>de</strong>r DDR und <strong>de</strong>r Sowjetunion been<strong>de</strong>t.<br />
Zur Verbesserung <strong>de</strong>r Versorgungslage wur<strong>de</strong>n 20 Gewerbegenehmigungen erteilt, bis <strong>zu</strong>m 30. November 1953 wur<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>sätzlich für 1,4 Millionen Mark Konsumgüter <strong>zu</strong>r Verfügung<br />
gestellt. Löhne und Gehälter wur<strong>de</strong>n erhöht, einige beschlagnahmte Grundstücke <strong>zu</strong>rückgegeben[116].<br />
Die Sowjetunion übergab am 1. Januar 1954 u. A. die Stralsun<strong>de</strong>r DERUTRA-Filiale an <strong>de</strong>n VEB Seehafen. Hier wur<strong>de</strong> ein Sozialgebäu<strong>de</strong> errichtet sowie ein vierstöckiges Kühlhaus<br />
mit einer Lagerkapazität von 6000 Tonnen.<br />
Im Nationalen Aufbauwerk (NAW) wur<strong>de</strong>n 1955 von 28.000 Helfern in 200.000 Stun<strong>de</strong>n freiwilliger, gemeinnütziger und unentgeltlicher Arbeit Werte für mehr als 220.000 Mark<br />
geschaffen. Insgesamt führten sieben Stralsun<strong>de</strong>r Betriebe im letzten Jahr <strong>de</strong>s Fünf-Jahr-Plans, 1955, mehr als 6,5 Millionen Mark <strong>zu</strong>sätzlich an <strong>de</strong>n Haushalt <strong>de</strong>r DDR ab. Davon<br />
erwirtschaftete die Volkswerft allein 4,4 Millionen Mark[117]. Mit 319 produzierten Loggern von 1950 bis 1955 war die Werft einer <strong>de</strong>r größten Exportbetriebe <strong>de</strong>r DDR.<br />
Auf einer Wahlkundgebung am 28. September 1954 auf <strong>de</strong>m Alten Markt erklärte Otto Grotewohl:<br />
„Stolz können die Stralsun<strong>de</strong>r auf ihre bisherigen Erfolge sein, und <strong>de</strong>r Schwung, mit <strong>de</strong>m sie bisher gearbeitet haben, wird auch da<strong>zu</strong> beitragen, die letzten Zeugen <strong>de</strong>s Hitlerkrieges <strong>zu</strong><br />
beseitigen.“<br />
Die SED hatte auf ihrer 21. ZK-Tagung im November 1954 das Programm „Industriearbeiter aufs Land“ beschlossen. 910 Stralsun<strong>de</strong>r Arbeiter aus Stralsund gingen allein in <strong>de</strong>n Jahren
1954 bis 1956 im Rahmen dieser Aktion in die benachbarten Kreise Stralsund, Grimmen, Putbus und Bergen.<br />
Der Produktionsanteil sozialistischer Betriebe, <strong>zu</strong> <strong>de</strong>nen die Großbetriebe zählten, betrug 1955 94,5 %. 24.652 <strong>de</strong>r 30.058 Beschäftigten in Stralsund arbeiteten in diesen sozialistischen<br />
Betrieben. Der privatwirtschaftliche Sektor umfasste im Jahr 1955 31 Industrie- und Baubetriebe, 23 Großhändler, 426 Kleinhändler und 627 Handwerksbetriebe.[118] Mit <strong>de</strong>r PGH<br />
„Elektro“ entstand am 1. Mai 1956 die erste Produktionsgenossenschaft <strong>de</strong>s Handwerks (PGH) in Stralsund, gegrün<strong>de</strong>t von drei Meistern und elf Monteuren <strong>de</strong>s Elektrohandwerks. Am<br />
27. Oktober 1956 entstand die erste Fischereiproduktionsgenossenschaft (FPG), die FPG „Vorwärts“. Mit <strong>de</strong>r Firma „Schütt & Ahrens“ (Inhaber Rudolf Ahrens, CDU) und „Carl Lange“<br />
(Inhaberin Christiane Lange, NDPD) gehörten 1956 zwei Stralsun<strong>de</strong>r Firmen <strong>zu</strong> <strong>de</strong>n ersten drei im Bezirk Rostock, die eine staatliche Beteiligung aufnahmen.[119] In<br />
Kommissionsverträge mit <strong>de</strong>m staatlichen Han<strong>de</strong>l trat als erster privater Einzelhändler Stralsunds im April 1957 das „Möbelhaus Thierfeld“, ihm folgten weitere Unternehmen. Den<br />
Bemühungen von staatlicher Seite, PGH <strong>zu</strong> grün<strong>de</strong>n, wur<strong>de</strong> von einigen privaten Unternehmern starker Wi<strong>de</strong>rstand entgegen gebracht.<br />
Die Volkswerft konnte sich im Mai 1956 bei ihrem ersten Auftritt auf einer Messe im nicht-sozialistischen Wirtschaftsgebiet (in Kopenhagen) einen Auftrag über die Lieferung von zwölf<br />
Kuttern für Island sichern. Im selben Jahr produzierte sie <strong>de</strong>n ersten von 20 Stahlkuttern für die Hochseefischerei <strong>de</strong>r DDR, und am 9. August 1957 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r erste von 172<br />
Mitteltrawlern (davon 171 für die UdSSR) vom Stapel gelassen; <strong>de</strong>r letzte dieser Reihe wur<strong>de</strong> 1960 übergeben.<br />
Am 25. Februar 1960 mel<strong>de</strong>te die Stadt das Gebiet <strong>de</strong>s Stadt- und <strong>de</strong>s Landkreises als voll genossenschaftlich in LPG organisiert. Möglich gewor<strong>de</strong>n war dies u. a. durch die aktive<br />
Einflussnahme <strong>de</strong>r SED.<br />
Die Inbetriebnahme <strong>de</strong>r zweiten Ausbaustufe <strong>de</strong>r Ölspaltanlage im Jahr 1963 ermöglichte es, täglich 200.000 Kubikmeter Gas <strong>zu</strong> produzieren, das in das Verbundnetz <strong>de</strong>s Bezirks<br />
eingespeist wur<strong>de</strong>.<br />
Im Stralsun<strong>de</strong>r Seehafen wur<strong>de</strong>n 1966 885.000 Tonnen umgeschlagen.<br />
Am 6. November 1967 lieferte die Volkswerft ihr 1000. Schiff aus, ein „Atlantik“ 7120 für die Sowjetunion. Die Werft hatte unter allen DDR-Betrieben <strong>de</strong>n höchsten Exportanteil in die<br />
Sowjetunion. Sie lieferte zwischen 1967 und 1970 107 Schiffe <strong>de</strong>s Typs „Atlantik“ aus. Am 16. März 1971 wur<strong>de</strong> neben <strong>de</strong>r Produktion <strong>de</strong>r „Atlantik“-Serie <strong>de</strong>r erste „Atlantik-<br />
Supertrawler“ aufgelegt. Am 30. Januar 1971 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Grundstein für eine neue Großsektionsbauhalle gelegt. Am selben Tag wur<strong>de</strong> das Typerprobungs- und Nullschiff <strong>de</strong>r „Atlantik-<br />
Supertrawler“-Serie abgesenkt.<br />
Im Oktober 1969 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r VEB Blechpackungswerk in Anwesenheit von Erhard Krack eröffnet. Ab 1. Januar 1971 arbeitete das Werk mit voller Kapazität.<br />
Die Grundorganisation „Artur Becker“ <strong>de</strong>r Freien Deutschen Jugend (FDJ) <strong>de</strong>r Werft rief mit einem Appell vom 14. April 1972 die DDR-Jugend da<strong>zu</strong> auf, auf <strong>de</strong>r Volkswerft <strong>zu</strong> helfen;<br />
von fast 500 Jugendlichen, die sich <strong>zu</strong>r Hilfe für ein Jahr bereit erklärten, blieben letztlich 150 dort tätig. Zur Unterbringung <strong>de</strong>r Arbeiter diente ab Mai 1972 das ehemalige<br />
Urlauberschiff <strong>de</strong>s Freien Deutschen Gewerkschaftsbun<strong>de</strong>s (FDGB) MS Fritz Heckert im Stralsun<strong>de</strong>r Hafen.<br />
1972 existierten in Stralsund noch sechs private Betriebe, 18 Betriebe arbeiteten mit staatlicher Beteiligung, da<strong>zu</strong> gab es drei industriell produzieren<strong>de</strong> PGH. Diese Betriebe beschäftigten<br />
1612 Mitarbeiter. Zur Umset<strong>zu</strong>ng <strong>de</strong>s vom Politbüro <strong>de</strong>r ZK <strong>de</strong>r SED im Februar 1972 beschlossenen Umwandlung <strong>de</strong>rartiger Betriebe in Volkseigentum wur<strong>de</strong> in Stralsund eine<br />
Arbeitsgruppe beim Rat <strong>de</strong>r Stadt gebil<strong>de</strong>t. Bereits im April entstan<strong>de</strong>n aus <strong>de</strong>r BSB Strela-Fischwerke KG <strong>de</strong>r VEB Strela-Fischwerke, aus <strong>de</strong>r Lange KG wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r VEB Zelte und<br />
Plane, aus Schütt % Ahrens KG <strong>de</strong>r VEB Kfz-Instandhaltung Vorwärts und aus <strong>de</strong>r Vorbröcker KG <strong>de</strong>r VEB Metallaufbereitung. Am 29. Mai 1972 war die Übernahme <strong>de</strong>r privaten<br />
Betriebe und industriell produzieren<strong>de</strong>n PGH abgeschlossen.<br />
Verkehrswesen<br />
Am 3. November 1967 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r erste Abschnitt <strong>de</strong>r Fernverkehrsstraße F 96 a übergeben. Die zwischen Barth und Stralsund verkehren<strong>de</strong> Kleinbahn wur<strong>de</strong> am 30. November 1968<br />
stillgelegt.<br />
Die neu entstan<strong>de</strong>nen Wohngebiete bedingten <strong>de</strong>n Aufbau neuer Hauptverkehrswege. So wird <strong>de</strong>r Tribseer Damm bis August 1960 für die Bedürfnisse <strong>de</strong>s Transitverkehrs nach<br />
Skandinavien verbreitert und <strong>de</strong>r Straßenbahnbetrieb auf dieser Straße eingestellt.
Am 17. Februar 1961 fährt die Straßenbahn erstmals wie<strong>de</strong>r nach <strong>de</strong>r kriegsbedingten Einstellung durchgängig vom Frankendamm (Friedhof) <strong>zu</strong>m Knieperdamm (Hainholzstraße). Am<br />
7. April 1966 wird <strong>de</strong>r Straßenbahnbetrieb in <strong>de</strong>r gesamten Stadt <strong>zu</strong>gunsten <strong>de</strong>s Omnibusbetriebes aufgegeben.<br />
Am 3. Februar 1966 begann <strong>de</strong>r Ausbau <strong>de</strong>r Chaussee nach Greifswald auf 7,50 Meter Breite.<br />
Städtebau<br />
Von April 1946 bis Dezember 1956 hatten die Einwohner <strong>de</strong>r Stadt im Rahmen <strong>de</strong>s Nationalen Aufbauwerks Enttrümmerungsarbeiten durchgeführt und dabei über 250.000 Kubikmeter<br />
Schutt beseitigt.<br />
Ab 1958 wur<strong>de</strong>n Wohnungen mit Großblockteilen errichtet. Richtfest für <strong>de</strong>n ersten in Großblockteilen errichteten Wohnblock war am 3. September 1958 in <strong>de</strong>r Prohner Chaussee. Der<br />
Wohnblock II wur<strong>de</strong> anlässlich <strong>de</strong>s 10. Nationalfeiertags übergeben. Auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Zuckerfabrik wur<strong>de</strong> eine Betonfabrik errichtet; sie nahm am 1. März 1959 die Produktion auf.<br />
In <strong>de</strong>r Altstadt wird am 29. Juni 1960 das im Zweiten Weltkrieg beschädigte Semlower Tor gesprengt.<br />
Bis Oktober 1959 wur<strong>de</strong>n in Stralsund nach <strong>de</strong>m Krieg 3500 Wohnungen errichtet, überwiegend im Stadtteil Tribseer Vorstadt. 1962 nahm das „Plattenwerk“ am Heinrich-Heine-Ring<br />
seinen Betrieb auf.<br />
Bis Mitte <strong>de</strong>r 1960er Jahre konzentrierte sich <strong>de</strong>r Wohnungsbau auf <strong>de</strong>n Stadtteil Knieper Nord. Von 1961 bis 1964 wur<strong>de</strong>n 2347 Wohnungen fertiggestellt, insgesamt entstan<strong>de</strong>n bis<br />
1964 2670 Wohnungen in diesem Stadtteil.[120]<br />
En<strong>de</strong> 1962 warteten von <strong>de</strong>n 66.987 Einwohnern noch 5000 Familien bzw. Einzelpersonen auf die Zuweisung von Wohnraum. 12.340 (70 Prozent) <strong>de</strong>r vorhan<strong>de</strong>nen 17.620 Wohnungen<br />
waren vor 1945 errichtet wor<strong>de</strong>n, davon sogar 4520 vor 1870. Über 400 Wohnungen waren baupolizeilich gesperrt, 2200 stark beschädigt und 2300 abbruchreif. 57 Prozent <strong>de</strong>r<br />
Wohnungen verfügten über eine Innentoilette, 32 über ein Bad.[121]<br />
Am 19. September 1963 beschloss die Stadtverordnetenversammlung <strong>de</strong>n Aufbau <strong>de</strong>s Stadtteils Knieper West auf einer 75 Hektar großen Fläche zwischen Stadtwald und<br />
Zentralfriedhof. Der erste Spatenstich für das Wohngebiet, das in Plattenbauweise errichtet wur<strong>de</strong>, fand am 25. Juni 1964 statt, Grundsteinlegung war am 26. August 1964. Das neue<br />
Wohngebiet sollte 6102 Wohnungseinheiten umfassen. Die Versorgung mit Fernwärme wur<strong>de</strong> durch ein Heizwerk, das am 1. Oktober 1967 seinen Betrieb aufnahm, sichergestellt.<br />
Auf <strong>de</strong>r Basis <strong>de</strong>s Beschlusses <strong>de</strong>r Stadtverordnetenversammlung vom 26. Juni 1958, die Innenstadt <strong>zu</strong>m <strong>de</strong>nkmalgeschützten Gebiet erklären <strong>zu</strong> lassen, erklärte <strong>de</strong>r DDR-Ministerrat<br />
am 2. Januar 1962 die Stralsun<strong>de</strong>r Altstadt <strong>zu</strong>m „Denkmal von beson<strong>de</strong>rer nationaler Be<strong>de</strong>utung und internationalem Kunstwert“. Über 400 Einzelbauten befan<strong>de</strong>n sich auf <strong>de</strong>r Liste,<br />
darunter 16 größere Profanbauten und neun Sakralbauten. Der überwiegen<strong>de</strong> Teil <strong>de</strong>r Gebäu<strong>de</strong> waren Wohnhäuser, die <strong>de</strong>r Sanierung o<strong>de</strong>r Rekonstruktion bedurften. 1963 wur<strong>de</strong> eine<br />
Arbeitskommission einberufen, in <strong>de</strong>r Folgezeit wur<strong>de</strong>n Konzepte erarbeitet. Erste Restaurierungsarbeiten wur<strong>de</strong>n am ehemaligen Johanniskloster (Stralsund) im November 1963<br />
begonnen, im Volkswirtschaftsplan 1964 waren 116 Wohnhäuser <strong>zu</strong>r Rekonstruktion vorgesehen.<br />
Im März 1965 beschloss <strong>de</strong>r Rat <strong>de</strong>r Stadt die „Konzeption <strong>zu</strong>r Entwicklung <strong>de</strong>s Wohnungsbaues 1964 bis 1970 mit <strong>de</strong>n Teilen Knieper-West, Lückenbebauung und Sanierung <strong>de</strong>r<br />
Innenstadt“.<br />
Im Stadtteil Knieper West wur<strong>de</strong> am 3. März 1969 die 2000ste Wohnung übergeben. In <strong>de</strong>r Altstadt wur<strong>de</strong> im Sommer das restaurierte Kniepertor und <strong>de</strong>r Räucherbo<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s<br />
Johannisklosters <strong>de</strong>r Nut<strong>zu</strong>ng übergeben. Die Gestaltung <strong>de</strong>s Neuen Marktes wur<strong>de</strong> im selben Jahr abgeschlossen.<br />
Ab 1970 wur<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Innenstadtsanierung polnische Bauleute eingesetzt, erstes Objekt war das Haus Fährstraße Nr. 26.<br />
Im Juni 1973 wur<strong>de</strong> die 10.000ste nach 1945 fertiggestellte Wohnung übergeben. Zwischen 1971 und 1975 wur<strong>de</strong>n 1649 Wohnungen und 122 Eigenheime gebaut und 597 Wohnungen<br />
um- und ausgebaut sowie mo<strong>de</strong>rnisiert.<br />
Am 17. April 1975 wur<strong>de</strong> vom Rat <strong>de</strong>r Stadt <strong>de</strong>r Standort für das künftige Wohngebiet Grünhufe bestätigt. Im September 1974 wur<strong>de</strong> das Plattenwerk rekonstruiert, um künftig<br />
Fertigteile für die Wohnungsbauserie 70 herstellen <strong>zu</strong> können. Bis <strong>zu</strong>m Abschluss <strong>de</strong>r Rekonstruktion im Jahr 1975 wur<strong>de</strong>n nur Einzelbauten gefertigt, so in <strong>de</strong>r Kedingshäger Straße 165
Wohnungen, an <strong>de</strong>r Kleinen Parower Straße 115 Wohnungen und an <strong>de</strong>r Müller-Grählert-Straße 75 Wohnungen.<br />
In <strong>de</strong>r Innenstadt wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Bereich Schillstraße-Alter Markt saniert. Die Stadtmauer wur<strong>de</strong> saniert, ebenso die Katharinenhalle im Meeresmuseum und <strong>de</strong>r Remter im<br />
Kulturhistorischen Museum. Unterstüt<strong>zu</strong>ng kam von Ludwig Deiters und Karl-Heinz Loui. Gleichzeitig wur<strong>de</strong>n aber auch 40 baupolizeilich gesperrte Häuser in <strong>de</strong>r Innenstadt im<br />
Bereich Heilgeiststraße, Jakobichorstraße, Mühlenstraße, Katharinenberg, Böttcherstraße und Papenstraße 9 abgebrochen.[122]<br />
Am 12. Januar 1976 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s Wohngebietes Knieper West III begonnen. Von 1976 bis 1980 wur<strong>de</strong>n 4511 Wohnungen, davon 3734 Neubauwohnungen, fertiggestellt. Am<br />
6. Oktober 1980 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Grundstein für das Wohngebiet Grünhufe gelegt.<br />
Mit <strong>de</strong>m Setzen <strong>de</strong>r letzten Platte am Block 058 in Knieper West wur<strong>de</strong> am 27. März 1981 <strong>de</strong>r Wohnungsbau in diesem Stadtgebiet abgeschlossen. 8200 Wohnungen waren hier seit <strong>de</strong>m<br />
1. September 1964 entstan<strong>de</strong>n. Die erste Platte im Wohngebiet Grünhufe wur<strong>de</strong> am 7. April 1981 gesetzt, die ersten Wohnungen (Kurt-Bürger-Straße Nr. 19) am 23. November 1981<br />
übergeben.<br />
Am Alten Markt wird am 22. Juli 1982 <strong>de</strong>r „Gol<strong>de</strong>ne Löwe“ gesprengt, an seiner Stelle wur<strong>de</strong> ein Neubau in Plattenbauweise errichtet, in <strong>de</strong>n am 22. Januar 1985 die ersten Mieter<br />
einzogen.<br />
Schulwesen und Kin<strong>de</strong>rbetreuung<br />
Am 11. September 1951 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Neubau <strong>de</strong>r Schwesternschule durch Luitpold Steidle eingeweiht. Je sechs Kin<strong>de</strong>rgärten und Schulhorte sowie ein Betriebshort wur<strong>de</strong>n zwischen<br />
1949 und 1954 errichtet.<br />
Noch im Jahr 1950 betrug die durchschnittliche Klassenstärke 42 Schüler. Mit <strong>de</strong>r Wie<strong>de</strong>rherstellung <strong>de</strong>r Fritz-Reuter-Schule <strong>de</strong>m Ausbau einer Kaserne <strong>zu</strong>r Goethe-Schule aus und<br />
eines Guthauses <strong>zu</strong>r Schule An<strong>de</strong>rshof konnte im Jahr 1955 die Schülerzahl auf 31 je Klasse gesenkt wer<strong>de</strong>n. Dadurch stieg auch das Niveau <strong>de</strong>r Ausbildung: Der Anteil <strong>de</strong>r Schüler, die<br />
das Klassenziel nicht erreichten, betrug 1952/1953 14 % und 1955 9 %.<br />
Unterrichtet wur<strong>de</strong> noch 1954 im Schichtbetrieb. An <strong>de</strong>n Oberschulen existierten 1950 400 Plätze und 1955 670 Plätze.[123] Zahlreiche Betriebe übernahmen Patenschaften über<br />
Schulen. So wur<strong>de</strong> die Volkswerft Pate <strong>de</strong>r Hansa-Oberschule, <strong>de</strong>r VEB Bau-Union Pate <strong>de</strong>r Ernst-Moritz-Arndt-Schule und die Lehreinrichtung <strong>de</strong>r VP See Pate <strong>de</strong>r Gerhart-<br />
Hauptmann-Schule.[124] Die Betriebsschulen <strong>de</strong>r Werft und <strong>de</strong>r Bau-Union wur<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Betrieben <strong>zu</strong>geordnet.<br />
Im April 1955 wur<strong>de</strong> die Jugendweihe wie<strong>de</strong>r eingeführt.<br />
Im September 1958 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r polytechnische Unterricht in <strong>de</strong>n vier zehnklassigen Schulen in Stralsund, Gerhart-Hauptmann-Schule, Wolfgang-Heinze-Schule, Lambert-Steinwich-<br />
Schule und Goethe-Schule, eingeführt.<br />
Die erste nach <strong>de</strong>m Krieg neu errichtete Schule wur<strong>de</strong> am 1. September 1959 in <strong>de</strong>r Tribseer Vorstadt eingeweiht. Weitere Schulneubauten folgten 1961 in An<strong>de</strong>rshof und 1962 an <strong>de</strong>r<br />
Vogelwiese. 1964 wur<strong>de</strong> eine neue Schule in <strong>de</strong>r Johannes-R.-Becher-Straße übergeben. Die erste neue Schule im Stadtteil Knieper West wur<strong>de</strong> am 1. September 1966 eröffnet.<br />
Als weiterführen<strong>de</strong> Bildungseinrichtung kam am 1. April 1970 auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Volkswerft die Ingenieurschule für Schiffbau hin<strong>zu</strong>. Sie wur<strong>de</strong> acht Jahre später an die Wilhelm-<br />
Pieck-Universität Rostock angeglie<strong>de</strong>rt.<br />
Die Anzahl an Kin<strong>de</strong>rgartenplätzen stieg von 1627 im Jahr 1966 auf 2179 im Jahr 1970, die <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>rkrippenplätze von 617 auf 777.[125]<br />
Von 1973 bis 1975 wur<strong>de</strong>n in Knieper West zwei und in <strong>de</strong>r Tribseer Vorstadt eine Polytechnische Oberschule (POS) errichtet. Die Zahl <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>rgartenplätze stieg im gleichen<br />
Zeitraum um 612, die <strong>de</strong>r Kin<strong>de</strong>rkrippenplätze um 240.<br />
1979 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>r POS „Karl Marx“ die 12. nach 1945 gebaute Schule eröffnet, damit verfügte Stralsund über 20 polytechnische Oberschulen und es gab ein Jahr später 30<br />
Kin<strong>de</strong>rgärten mit 3159 Plätzen.
Gesundheitswesen<br />
Auf <strong>de</strong>r Volkswerft wur<strong>de</strong> am 2. Juli 1952 die Poliklinik „Speranski“ eröffnet.<br />
Im Klinikum wird am 15. Februar 1956 das erste so genannte Retortenbaby, Anne-Kristin, <strong>zu</strong>r Welt gebracht. Im Februar 1959 wird das Pflegeheim „Rosa Luxemburg“ in <strong>de</strong>r<br />
Hafenstraße eröffnet.<br />
Die bei<strong>de</strong>n Krankenanstalten Stralsunds wur<strong>de</strong>n am 1. April 1959 <strong>zu</strong>m Bezirkskrankenhaus „Am Sund“ <strong>zu</strong>sammengelegt, 2113 Betten stan<strong>de</strong>n <strong>zu</strong>r Verfügung, womit Stralsund die beste<br />
Versorgung im Bezirk Rostock besaß.<br />
In <strong>de</strong>r Kedingshäger Straße wur<strong>de</strong> am 10. Dezember 1975 das Pflegeheim „Käthe Kern“ mit 115 Plätzen übergeben. 1978 stan<strong>de</strong>n 371 Plätze in Pflegeheimen <strong>zu</strong>r Verfügung.<br />
Kultur<br />
Zu Beginn <strong>de</strong>r 1950er Jahre wur<strong>de</strong>n in Betrieben vierzig Kultur- und Volkskunstgruppen gebil<strong>de</strong>t, diese wur<strong>de</strong>n seit Dezember 1952 beim Rat <strong>de</strong>r Stadt vom Laienkunstkabinett betreut.<br />
Am 24. Juni 1951 wur<strong>de</strong> das von Otto Dibbelt gegrün<strong>de</strong>te Naturmuseum (später: Meeresmuseum) eröffnet, am 1. September 1952 die Volksmusikschule.<br />
Das Stralsun<strong>de</strong>r Theater schloss Verträge mit Stralsun<strong>de</strong>r Betrieben für Besuchsanrechte. Georg Friedrich Hän<strong>de</strong>ls Oper „Julius Cäsar“ wur<strong>de</strong> 1955 in Stralsund in <strong>de</strong>r DDR<br />
uraufgeführt.<br />
En<strong>de</strong> September 1954 fand in Stralsund eine Kulturkonferenz statt. Die Konferenz würdigte das Naturmuseum und das Stralsundische Museum für Ostmecklenburg als die<br />
vorbildlichsten <strong>de</strong>s Bezirks Rostock. Letzteres hatte zwischen 1945 und 1954 mehr als 70 wechseln<strong>de</strong> Ausstellungen veranstaltet und zählte 1949 15.000 und 1954 mehr als 100.000<br />
Besucher. Im Naturmuseum wur<strong>de</strong>n 1954 75.000 Besucher gezählt.<br />
Die Ostseewoche wur<strong>de</strong> am 4. Juli 1958 erstmals in Stralsund eröffnet. Im Juni dieses Jahres wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Aufbau <strong>de</strong>r Freilichtbühne und im Jahr 1959 mit <strong>de</strong>m Bau <strong>de</strong>s Tierpark<br />
Stralsund begonnen.<br />
Im Rahmen <strong>de</strong>r zweiten Ostseewoche beging Stralsund vom 28. Juni bis 5. Juli 1959 sein 725. Stadtjubiläum.<br />
1970 fan<strong>de</strong>n die 12. Arbeiterfestspiele im Bezirk Rostock statt, und Stralsund war vom 12. bis 14. Juni einer <strong>de</strong>r Festspielorte. 80.000 Besucher sahen 45 Veranstaltungen.<br />
Auch bei <strong>de</strong>n 18. Arbeiterfestspiele war Stralsund Festspielort. In Stralsund wur<strong>de</strong> zeitgleich das erste „Mecklenburgische Folklorefestival“ ausgetragen. Die insgesamt 128<br />
Veranstaltungen wur<strong>de</strong>n von 200.000 Zuschauern besucht.<br />
Sport<br />
Das Sundschwimmen wur<strong>de</strong> erstmals 1948 als offener Wettkampf in <strong>de</strong>r sowjetischen Besat<strong>zu</strong>ngszone ausgeschrieben. Ab 1949 wur<strong>de</strong>n auch Motorsportveranstaltungen durchgeführt;<br />
am 2. Juli 1949 fin<strong>de</strong>t das erste Stralsun<strong>de</strong>r Bä<strong>de</strong>rrennen auf <strong>de</strong>n Straßen <strong>de</strong>r Stadt statt. Im Gewichtheben wur<strong>de</strong>n große Erfolge erzielt, ebenso im Frauenhandball.<br />
Die BSG Motor Stralsund stieg 1955 in die II. DDR-Liga auf. Im Juli 1967 wur<strong>de</strong>n die Fußballmannschaften <strong>de</strong>r ASG „Vorwärts“ von Rostock nach Stralsund gelegt; die ASG Vorwärts<br />
Stralsund spielte fortan in <strong>de</strong>r DDR-Liga mit, 1971 und 1974 konnte sie in die DDR-Oberliga aufsteigen.<br />
Am 16. Januar 1968 wur<strong>de</strong> mit <strong>de</strong>m Bau einer Schwimmhalle begonnen. Sie entstand im ehemaligen Turbinensaal <strong>de</strong>s Kraftwerkes und wur<strong>de</strong> am 4. Oktober 1969 eröffnet.<br />
Die Stralsun<strong>de</strong>r Gewichtheber <strong>de</strong>r BSG Motor Stralsund waren international erfolgreich. Zu ihnen zählte Schwergewichts-Weltmeister Helmut Losch. Monika Kallies gewann mit <strong>de</strong>m<br />
DDR-Achter bei <strong>de</strong>n Olympische Sommerspiele 1976 die Goldmedaille. Ebenfalls Gold gewann <strong>de</strong>r Offiziersschüler Uwe Potteck (im olympischen Schießen).<br />
1978 gewann Jürgen Heuser <strong>de</strong>n Weltmeistertitel im Gewichtheben, bei <strong>de</strong>n Olympischen Sommerspielen 1980 gewann er die Silbermedaille.
Militärische Einrichtungen<br />
In <strong>de</strong>n 1950er Jahren wur<strong>de</strong> Stralsund erneut Garnisonstadt. Am 1. Mai 1950 wur<strong>de</strong> in Parow durch Johannes Warnke die Schule <strong>de</strong>r Seepolizei eröffnet. Komman<strong>de</strong>ur wur<strong>de</strong> Walter<br />
Steffens. Ab 1952 wur<strong>de</strong> auf <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>nschanze unter Wilhelm Nordin mit <strong>de</strong>r Ausbildung von Offizieren begonnen.<br />
Ab 1953 wur<strong>de</strong>n auch in Stralsund Kampfgruppen aufgestellt. Grundstock dieser waren die nach <strong>de</strong>m 17. Juni 1953 von <strong>de</strong>r SED in die Betriebsschutze entsandten Arbeiter. Bis En<strong>de</strong><br />
1953 existierten Kampfgruppen in <strong>de</strong>r Volkswerft und <strong>de</strong>r Schiffbau- und Reparaturwerft mit je 60 sowie in <strong>de</strong>m VEB Bau-Union mit 18 Mitglie<strong>de</strong>rn. Im Juni 1954 waren bereits 482<br />
Mitglie<strong>de</strong>r in 15 Betrieben aufgestellt.<br />
Der VEB Bau-Union <strong>de</strong>legierte 1954 182 Bauarbeiter <strong>zu</strong>r Kasernierten Volkspolizei. Bis Februar 1956 traten 450 Werftarbeiter <strong>de</strong>r KVP bei,[126] im Juli 1955 ein ganzer Lehrgang (156<br />
Lehrlinge) <strong>de</strong>r Berufsschule <strong>de</strong>r Werft. Zu <strong>de</strong>n von <strong>de</strong>r Werft <strong>zu</strong>r KVP gegangenen Werftarbeitern zählte im Jahr 1952 auch Klaus-Jürgen Baarß.<br />
Anfang <strong>de</strong>r 1960er Jahre wur<strong>de</strong> Stralsund auch Standort eines Hubschraubergeschwa<strong>de</strong>rs <strong>de</strong>r Volksmarine. 1963 nahm die Fakultät Seestreitkräfte <strong>de</strong>r Militäraka<strong>de</strong>mie „Friedrich<br />
Engels“ ihre Arbeit auf <strong>de</strong>m Dänholm auf. Sie wur<strong>de</strong> 1969 nach Dres<strong>de</strong>n verlegt. Dafür wur<strong>de</strong> die Basis <strong>de</strong>r Schiffsstammabteilung erweitert.<br />
Am 11. Juli 1964 wur<strong>de</strong> die sowjetische Kommandantur aufgelöst.<br />
Die Offiziersschule auf <strong>de</strong>r Schwe<strong>de</strong>nschanze erhielt am 1. März 1964 <strong>de</strong>n Namen „Karl Liebknecht“. Die Flottenschule in Parow bekam am 1. Dezember 1970 <strong>de</strong>n Namen ihres ersten<br />
Leiters, „Walter Steffens“.<br />
Mit Wirkung vom 4. Januar 1971 erhielt die Offiziersschule „Karl Liebknecht“ <strong>de</strong>n Status einer Hochschule, Leiter war Heinz Irmscher. Ebenfalls ab 1971 wur<strong>de</strong>n die Absolventen <strong>de</strong>r<br />
Schule in einer Zeremonie auf <strong>de</strong>m Leninplatz <strong>zu</strong> Offizieren ernannt. Am 4. Februar 1974 erhielt die Offiziershochschule (OHS) die Auszeichnung Vaterländischer Verdienstor<strong>de</strong>n in<br />
Gold. En<strong>de</strong> 1976 übernahm Wilhelm Nordin die Leitung. Im Mai 1982 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r OHS mit Wirkung vom 1. September 1982 das Diplomrecht (Diplom-Ingenieur bzw. Diplom-<br />
Gesellschaftswissenschaftler) verliehen.<br />
Katastrophen<br />
Bei orkanartigen Stürmen am 17. Oktober 1967 starb in Stralsund ein Mensch, 22 wur<strong>de</strong>n verletzt. Der Sturm richtete große Schä<strong>de</strong>n an Häusern, in Betrieben und auf <strong>de</strong>n Straßen an.<br />
Am 11. Januar 1968 richtete ein Schneesturm Zerstörungen an, und vier Tage später ein Orkan <strong>de</strong>r Windstärke 12.<br />
Im Winter 1968/1969 dauerte die Eisperio<strong>de</strong> ungewöhnlich lang: Vom 11. Dezember 1968 bis <strong>zu</strong>m 9. April 1969.<br />
Die Jahreswen<strong>de</strong> 1978/1979 brachte erneut extreme Witterungsbedingungen. Am 31. Dezember 1978 fiel so viel Schnee, dass innerhalb weniger Stun<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r gesamte Schienen- und<br />
Straßenverkehr <strong>zu</strong>sammenbrach. Heftige Stürme und Temperaturen um minus 15 Grad Celsius gingen mit <strong>de</strong>m Schneefall einher. Mitte Februar 1979 brach <strong>de</strong>r Winter erneut mit<br />
orkanartigen Stürmen und extremen Schneefällen ein. Mit Hilfe <strong>de</strong>r Nationalen Volksarmee wur<strong>de</strong>n die enormen Schneemassen beseitigt, von Stralsund aus starteten die Marine-<br />
Hubschrauber <strong>zu</strong>r Versorgung <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong>n im Umland und auf Rügen und Hid<strong>de</strong>nsee.<br />
20./21. Jahrhun<strong>de</strong>rt: 1990 bis heute<br />
Die politische Umstrukturierung <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> (1989/1990) brachte auch Stralsund gewaltige Verän<strong>de</strong>rungen.<br />
Dies betraf <strong>zu</strong>m einen die neuen Verwaltungsstrukturen, die sich von <strong>de</strong>r zentralistischen Struktur <strong>de</strong>r DDR hin <strong>zu</strong>m fö<strong>de</strong>ralistischen Aufbau <strong>de</strong>r Bun<strong>de</strong>srepublik Deutschland<br />
verän<strong>de</strong>rten. Auf die Verwaltung <strong>de</strong>r Stadt kam somit eine Fülle von Aufgaben <strong>zu</strong>, die <strong>zu</strong> bewältigen waren. Erst reichlich ein halbes Jahr, nach<strong>de</strong>m in <strong>de</strong>n Kommunen die neuen<br />
Strukturen geschaffen wur<strong>de</strong>n, konnte <strong>de</strong>r Landtag Mecklenburg-Vorpommern gewählt wer<strong>de</strong>n. Dementsprechend wur<strong>de</strong> vom neu gebil<strong>de</strong>ten Rat <strong>de</strong>r Stadt vorerst weiter nach DDR-<br />
Recht, dann mit bun<strong>de</strong>s<strong>de</strong>utschem Recht gearbeitet.
Politik<br />
Zum Oberbürgermeister <strong>de</strong>r Stadt wur<strong>de</strong> 1990 Harald Lastovka (CDU) gewählt, <strong>de</strong>r diese Tätigkeit bis 2008 ausübte.<br />
Am 9. August stimmten 24 von 38 Bürgerschaftsabgeordneten für Schwerin als künftiger Lan<strong>de</strong>shauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern. Mit <strong>de</strong>r Verabschiedung <strong>de</strong>s Gesetzes <strong>zu</strong>r<br />
Kreisgebietsreform durch <strong>de</strong>n Landtag am 22. Juni 1993 behielt Stralsund seinen Status als kreisfreie Stadt. Dem Volksentscheid <strong>zu</strong>r Verfassung von Mecklenburg-Vorpommern<br />
stimmten am 12. Juni 1994 56,2 Prozent <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Wähler <strong>zu</strong>.<br />
Am 21. April 2006 besuchte Bun<strong>de</strong>skanzlerin Angela Merkel Stralsund mit ihrem Gast, <strong>de</strong>m schwedischen Ministerpräsi<strong>de</strong>nten Göran Persson. Zu einem Großereignis wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Besuch<br />
Angela Merkels mit <strong>de</strong>m Präsi<strong>de</strong>nten <strong>de</strong>r Vereinigten Staaten, George W. Bush, am 14. Juli 2006.<br />
Nachfolger <strong>de</strong>s aus Altersgrün<strong>de</strong>n nicht mehr angetretenen Oberbürgermeisters Harald Lastovka wur<strong>de</strong> Alexan<strong>de</strong>r Badrow (CDU).<br />
Wirtschaft<br />
Die Stralsun<strong>de</strong>r Molkerei wur<strong>de</strong> am 23. Juli 1991 an das holländische Unternehmen „Pommern Milch GmbH“ angeschlossen. Nach Einstellung <strong>de</strong>s Betriebs <strong>de</strong>r Essig- und<br />
Konservenfabrik (ESKO) an <strong>de</strong>r Rostocker Chaussee wird das Fabrikgebäu<strong>de</strong> im Januar 1992 abgerissen.<br />
Boris Becker investierte ab 1992 über 20 Millionen DM in <strong>de</strong>n Bau eines Autohauses in Stralsund.<br />
Am 14. Juli 1992 nahm die „Stralsun<strong>de</strong>r Parkquelle“, die sich später aus wettbewerbsrechtlichen Grün<strong>de</strong>n in „Stralsun<strong>de</strong>r Mineralwasser GmbH“ umbenennen musste, unter Führung <strong>de</strong>r<br />
Unternehmensgruppe Nordmann ihren Betrieb auf. Nach einer Renovierung nahm die Firma Horten in <strong>de</strong>m ehemaligen Wertheim-Kaufhaus in <strong>de</strong>r Ossenreyerstraße ihren Betrieb auf.<br />
Am 31. Dezember 1992 wur<strong>de</strong> die Zuckerfabrik nach 100-jährigem Betrieb geschlossen. Am 16. August 1993 stellte nach 40 Jahren auch die Kaffeerösterei KERMI ihren Betrieb ein.<br />
Eine mo<strong>de</strong>rne Kläranlage wur<strong>de</strong> am 28. Juni 1995 in Betrieb genommen. Ein Blockheizkraftwerk an <strong>de</strong>r Prohner Straße versorgt seit <strong>de</strong>m 3. November 1995 ca. 10.500 Wohnungen mit<br />
Fernwärme.<br />
Das Einkaufszentrum „Strelapark“ auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>r Gemein<strong>de</strong> Kramerhof eröffnete am 5. April 1995. Das Sport- und Freizeitbad „Hansedom“ eröffnete am 1. Dezember 1999 in<br />
unmittelbarer Nachbarschaft.<br />
Nach <strong>de</strong>r Entscheidung <strong>de</strong>r Unabhängigen Fö<strong>de</strong>ralismuskommission 1993, Bun<strong>de</strong>seinrichtungen in die Län<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s Beitrittsgebietes <strong>zu</strong> verlegen, errichtete die damalige<br />
Bun<strong>de</strong>sversicherungsanstalt für Angestellte (heute: Deutsche Rentenversicherung Bund) einen Verwaltungskomplex am Ran<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Stadt, in <strong>de</strong>m heute (Stand: 2009) etwa 1400<br />
Beschäftigte arbeiten. Ein weiterer wichtiger Arbeitgeber <strong>de</strong>r öffentlichen Hand ist seit 1992 die Marinetechnikschule Parow.<br />
Die Volkswerft erlebte gleich zwei Privatisierungen, ehe sie <strong>zu</strong>nächst mit <strong>de</strong>m dänischen Eigentümer A. P. Møller-Mærsk <strong>zu</strong>r Spezialwerft für Continerschiffe wur<strong>de</strong>; im Mai 2004 wur<strong>de</strong><br />
das erste Containerschiff, die „Saafmarine Cameroun“, übergeben. Seit 2008 ist die Hegemann-Gruppe neuer Eigentümer <strong>de</strong>r Werft.<br />
Der Seehafen konnte in <strong>de</strong>n Jahren 1994 und 1995 jeweils über eine Million Tonnen Güter umschlagen.<br />
Die Arbeitslosenquote in <strong>de</strong>r Stadt ist seit Jahren relativ hoch. Nur wenig Industriebetriebe sind vorhan<strong>de</strong>n; Arbeitsplätze gibt es vor allem im Tourismus.<br />
Städtebau<br />
Am 20. Januar 1995 wur<strong>de</strong> in <strong>de</strong>r Altstadt mit <strong>de</strong>m Neubau <strong>de</strong>s Löwenschen Palais begonnen.<br />
Die Altstadt wur<strong>de</strong> seit 1990 mit erheblichen öffentlichen und privaten Mitteln saniert und restauriert. Am 27. Juni 2002 wur<strong>de</strong> sie mit <strong>de</strong>r von Wismar unter <strong>de</strong>m Titel Historische<br />
Altstädte Stralsund und Wismar <strong>zu</strong>m Weltkulturerbe erklärt. Am 26. April 2004 wur<strong>de</strong> das sanierte Rathaus feierlich wie<strong>de</strong>r eröffnet.
Für <strong>de</strong>n Neubau <strong>de</strong>s Kaufhauses Peek&Cloppenburg am Ostkeuz in <strong>de</strong>r Altstadt wur<strong>de</strong> am 27. März 1996 <strong>de</strong>r Grundstein gelegt.<br />
Das Bürgerkomitee Rettet die Altstadt Stralsunds vergibt seit 1997 einen Preis für beson<strong>de</strong>rs gelungene Haussanierungen o<strong>de</strong>r Neubauten, das Koggensiegel.<br />
Rund um <strong>de</strong>n alten Stadtkern wur<strong>de</strong>n neue Wohngebiete erschlossen und Eigenheime errichtet. Für <strong>de</strong>n ersten sozialen Wohnungsbau nach 1990 wur<strong>de</strong> am 30. März 1995 <strong>de</strong>r Grundstein<br />
gelegt. Im Stadtgebiet Grünhufe, in <strong>de</strong>m 1997 ein Siebtel <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Bevölkerung lebte, begannen im Februar 1997 die Arbeiten <strong>zu</strong>r Wohnumfeldverbesserung.<br />
Verkehr<br />
Am 2. Juni 1991 verließ <strong>de</strong>r erste elektrisch angetriebene Intercity-Zug mit <strong>de</strong>m Namen Rügen in Richtung Rostock <strong>de</strong>n Hauptbahnhof.<br />
Nach<strong>de</strong>m sich die alte Strelasundquerung immer mehr <strong>zu</strong>m Na<strong>de</strong>löhr für Touristen und Wirtschaft auf <strong>de</strong>m Weg nach Rügen und Skandinavien bzw. von dort auf das Festland<br />
herausgestellt hatte, wur<strong>de</strong> 2007 mit <strong>de</strong>r Strelasundbrücke eine Hochbrücke fertiggestellt, mit <strong>de</strong>ren Bau im August 2004 begonnen wor<strong>de</strong>n war.<br />
Der Alte Markt ist seit Oktober 2005 autofrei.<br />
Für die 16 Kilometer lange Umgehungsstraße, für die Bund und Land 300 Millionen DM bereitstellten, begannen am 25. August 1997 die Bauarbeiten.<br />
Gesundheitswesen<br />
Die ehemalige Poliklinik am Frankenwall wur<strong>de</strong> am 1. Januar 1991 in Ärztegemeinschaft am Frankenwall umbenannt. 30 nie<strong>de</strong>rgelassene Ärzte betreuten dort ihre Patienten.<br />
Das Klinikum Krankenhaus am Sund verkaufte die Stadt an die DAMP-Holding.<br />
Kultur<br />
Als Außenstelle <strong>de</strong>s Meeresmuseums wur<strong>de</strong> am 1. Juni 1991 das Nautineum auf <strong>de</strong>m Dänholm errichtet. Im Jahr 2008 kam mit <strong>de</strong>m Ozeaneum Stralsund im Hafen <strong>de</strong>r Stadt eine weitere<br />
Außenstelle <strong>de</strong>s Meeresmuseums hin<strong>zu</strong>.<br />
Das erste Deutschlandtreffen <strong>de</strong>r Pommern auf pommerschem Gebiet fand vom 1. bis 3. Mai 1992 in Stralsund mit 20.000 Teilnehmern statt.<br />
Am 11. Februar 1993 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Fusionsvertrag <strong>de</strong>s Stralsun<strong>de</strong>r Theaters mit <strong>de</strong>m <strong>de</strong>r Stadt Greifswald <strong>zu</strong>m Theater Vorpommern unterzeichnet.<br />
Die Stralsun<strong>de</strong>r Brauerei veranstaltete vom 27. bis 29. Juni 1997 das erste Brauereihoffest und begrün<strong>de</strong>te damit eine erfolgreiche Veranstaltungsreihe im Sommer.<br />
Zum Ge<strong>de</strong>nken an ehemalige jüdische Bürger wur<strong>de</strong> am 25. August 2006 <strong>de</strong>r erste Stolperstein verlegt. Im April 2009 wird in <strong>de</strong>r Langenstraße eine Ge<strong>de</strong>nktafel für die von <strong>de</strong>n<br />
Nationalsozialisten beschädigte und später abgerissene Synagoge eingeweiht.<br />
Schulen<br />
Auf <strong>de</strong>m Gelän<strong>de</strong> <strong>de</strong>r ehemaligen Offiziershochschule <strong>de</strong>r NVA wur<strong>de</strong> am 4. Februar 1991 <strong>de</strong>r Lehrbetrieb im Berufsför<strong>de</strong>rungswerk (BfW) Stralsund mit 50 Rehabilitan<strong>de</strong>n<br />
aufgenommen. Die Einrichtung wur<strong>de</strong> am 28. Juni 1991 offiziell eröffnet.<br />
Für die am 1. September 1991 gegrün<strong>de</strong>te Fachhochschule Stralsund wur<strong>de</strong> am 9. Februar 1992 mit <strong>de</strong>m Bau von Stu<strong>de</strong>ntenwohnungen begonnen.<br />
Mit <strong>de</strong>r Grundsteinlegung am 19. März 1993 für die Diesterweg-Schule besitzt Stralsund <strong>de</strong>n ersten Realschulneubau Mecklenburg-Vorpommerns. Die am 27. Mai 1994 übergebene<br />
Schule ersetzte die alte Erich-Weinert-Schule, die 1991 wegen Asbestbelastung abgerissen wor<strong>de</strong>n war.<br />
Am 7. Februar 1994 wur<strong>de</strong> <strong>de</strong>r Grundstein für <strong>de</strong>n Bau <strong>de</strong>s IHK-Bildungszentrums gelegt.
Sport<br />
Die Gewichtheber <strong>de</strong>s TSV 1860 Stralsund errangen dreimal <strong>de</strong>n Meistertitel für Mannschaften.<br />
Die Handballer <strong>de</strong>s Stralsun<strong>de</strong>r HV stiegen 2003 und 2008 in die 1. Bun<strong>de</strong>sliga auf, wobei die Saison 2008/2009 <strong>zu</strong>m finanziellen Desaster wur<strong>de</strong>. Dem Verein, <strong>de</strong>r sportlich in die 2.<br />
Handball-Bun<strong>de</strong>sliga abgestiegen war, wur<strong>de</strong> die Lizenz entzogen. Die Männermannschaft startet daher in <strong>de</strong>r Saison 2009/10 in <strong>de</strong>r Oberliga Mecklenburg-Vorpommern.<br />
Die Rollstuhl-Basketballer <strong>de</strong>s SV Medizin Stralsund stiegen 2008 in die 2. Bun<strong>de</strong>sliga auf.<br />
Im August 1996 wur<strong>de</strong> die alte Sundschwimmhalle abgerissen und 1999 durch die Sport-Schwimmhalle im Hansedom ersetzt.<br />
Bei <strong>de</strong>r Bewerbung Berlins für die Olympischen Sommerspiele 2000 und Leipzigs für die Spiele 2012 bewarb sich die Stadt erfolglos um die Ausrichtung <strong>de</strong>r Segelwettbewerbe.<br />
Katastrophen<br />
Am 29. Juni 1994 richteten Sturm, schwerer Hagel und Regen Schä<strong>de</strong>n in Millionenhöhe an. Ein schweres Unwetter in <strong>de</strong>r Nacht vom 3. <strong>zu</strong>m 4. November 1995 verursachte ebenfalls<br />
schwere Schä<strong>de</strong>n in <strong>de</strong>r Stadt.<br />
Literatur<br />
• Fritz Adler: Aus Stralsunds Vergangenheit, 2. Teil: Die Schwe<strong>de</strong>nzeit Stralsunds. In: Fritz Adler und M. Wehrmann (Hrsg.): Pommersche Heimatkun<strong>de</strong>, 4. Band, Verlag Dr. Karl<br />
Moninger, Greifswald 1923.<br />
• Fritz Adler: Stralsund. In: Burkhard Meier (Hrsg.): Deutsche Lan<strong>de</strong> / Deutsche Kunst. 2. Auflage. Deutscher Kunstverlag, Berlin 1928.<br />
• Fritz Adler: Aus Stralsunds Geschichte. Zweite völlig verän<strong>de</strong>rte Auflage. Carl Meincke's Buchhandlung, Inh.: H. Bucksch, Stralsund 1937.<br />
• Hansestadt Stralsund (Hrsg.): Stralsund. Ein Almanach. Von <strong>de</strong>r Wen<strong>de</strong> bis <strong>zu</strong>r Gegenwart., 1998, ISBN 3-00-002897-8<br />
• Horst Auerbach: Festung und Marinegarnison Stralsund. 1. Auflage. Hinstorff Verlag GmbH, Rostock 1999, ISBN 3-356-00835-8.<br />
• Herbert Ewe: Stralsund. Ein Führer durch die Werftstadt. Stralsund, 1953 (Veröffentlichung <strong>de</strong>s Stadtarchiv Stralsund, <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Museen und <strong>de</strong>s Kulturbun<strong>de</strong>s <strong>zu</strong>r<br />
<strong>de</strong>mokratischen Erneuerung Deutschlands).<br />
• Herbert Ewe: Stralsund und seine Umgebung. Petermänken-Verlag, Schwerin 1955, Lizenz-Nr. 381/325/29/55.<br />
• Herbert Ewe: Stralsund. Petermännken-Verlag, Schwerin 1962, Lizenz-Nr. 381/325/24/62.<br />
• Herbert Ewe: Stralsund. 2. Auflage. VEB Hinstorff Verlag, Rostock 1972.<br />
• Herbert Ewe: Schätze einer Ostseestadt. 3. Auflage. Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1974 (Veröffentlichungen <strong>de</strong>s Stadtarchiv Stralsund Band VI), Bestell-Nr. 795<br />
499 5.<br />
• Herbert Ewe: Geschichte <strong>de</strong>r Stadt Stralsund. Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1984 (Veröffentlichungen <strong>de</strong>s Stadtarchiv Stralsund Band X), Bestell-Nr. 795 646 4.<br />
• Herbert Ewe: Stralsund. 1. Auflage. VEB Hinstorff Verlag, Rostock 1987, ISBN 3-356-00082-9.<br />
• Herbert Ewe: Kostbarkeiten in Klostermauern, Hinstorff Verlag, Rostock 1990, ISBN 3-356-00319-4.<br />
• Herbert Ewe: Das alte Stralsund. Kulturgeschichte einer Ostseestadt. 2. Auflage. Verlag Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1995, ISBN 3-7400-0881-4.<br />
• Sigrid Ro<strong>de</strong>mann und Georg Pilz: Stralsund. VEB F. A. Brockhaus Verlag, Leipzig 1977, 1984<br />
• Wolfgang Rudolph: Stralsund. Die Stadt am Sund. Carl Hinstorff Verlag, Rostock 1955. Lizenz-Nr. 391/240/7/55.<br />
• Senat <strong>de</strong>r Hansestadt Stralsund (Hrsg.): Schwedisch-Deutsche Regimenter <strong>de</strong>r Garnisonsstadt Stralsund. Stralsund (Sundische Reihe 5), ISBN 3-86139-005-1.<br />
• Senat <strong>de</strong>r Hansestadt Stralsund (Hrsg.): Zur Geschichte <strong>de</strong>r Prostitution in Stralsund. Stralsund (Sundische Reihe 6), ISBN 3-86139-007-8.<br />
• Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH (Hrsg.): Auf <strong>de</strong>n Spuren <strong>de</strong>s Welterbes. Das Stralsun<strong>de</strong>r Kellerkataster. Stralsund 2005.
• Ernst Uhsemann: Streifzüge durch das alte Stralsund, Verlag <strong>de</strong>r Königlichen Regierungs-Buchdruckerei, Stralsund 1925<br />
• Nikolaus Zaske: Stralsund. 1. Auflage, VEB F. A. Brockhaus Verlag, Leipzig 1986, ISBN 3-325-00001-0.<br />
Einzelbelege<br />
1. ↑ Saxo Grammaticus: Historica Danica, ed. G. Waltz, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores XXIX, S. 75, 142 ff.<br />
2. ↑ K. Fritze: Die Hansestadt Stralsund, S. 24 ff.<br />
3. ↑ H. Berlekamp: Probleme <strong>de</strong>r Frühgeschichte Stralsunds, S. 38<br />
4. ↑ H. Hoogeweg: Die Stifter und Klöster <strong>de</strong>r Provinz Pommern, Bd. II, Stettin 1925, S. 709 f.<br />
5. ↑ Pommersches Urkun<strong>de</strong>nbuch (PUB) II, Nr. 265<br />
6. ↑ F. Fabricius (Hrsg.): Das älteste Stralsun<strong>de</strong>r Stadtbuch (1270–1310), Berlin 1872, I 8<br />
7. ↑ C. G. Fabricius: Stralsund in <strong>de</strong>n Tagen <strong>de</strong>s Rostocker Landfrie<strong>de</strong>ns, Stettin 1847, S. 23 f<br />
8. ↑ Stadtarchiv Stralsund, Sign. Hs. I, 16: Kämmereibuch 1392–1440, fol. 7<br />
9. ↑ „Theatrum Europaeum“, Band 1, Seite 1066<br />
10.↑ „Theatrum Europaeum“, Band 1, Seite 1072<br />
11.↑ a b Jürgen Drevs: Novellen o<strong>de</strong>r Tagebuch Stralsundischer Begebenheiten vom Jahre 1687 bis <strong>zu</strong>m Jahre 1720<br />
12.↑ G. Tessin: Wismars schwedische Regimenter im Nordischen Krieg, Mecklenburgische Jahrbücher, 1937<br />
13.↑ Herbert Ewe: Aus Stralsunds Geschichte, Hermann Böhlaus Nachfolger, Weimar 1984, Seite 194<br />
14.↑ Fritz Adler: Aus Stralsunds Geschichte, Carl Meincke’sche Buchhandlung, Stralsund 1937, Seite 127<br />
15.↑ Fritz Adler: Lebensgeschichte <strong>de</strong>s Bürgermeisters David Lucas Kühl, Stralsund 1925, S. 77<br />
16.↑ “Stralsundische Zeitung”, 28. Oktober 1815<br />
17.↑ Stadtarchiv Stralsund, P121<br />
18.↑ Ratsprotokoll vom 25. Oktober 1815<br />
19.↑ Fritz Adler (Hrsg.): Lebensgeschichte <strong>de</strong>s Bürgermeisters David Lukas Kühl, Stralsund 1925, S. 114<br />
20.↑ “Der Fortschritt”, 2. Dezember 1848<br />
21.↑ Stadtarchiv Stralsund, P1549<br />
22.↑ Staatsarchiv Greifswald, Rep. 65c Nr. 871<br />
23.↑ “Stralsundische Zeitung”, 14. und 16. Februar 1891<br />
24.↑ “Stralsun<strong>de</strong>r Volksstimme”, 10. Juni 1891<br />
25.↑ a b c Staatsarchiv Greifswald, Rep. 60 Nr. 39<br />
26.↑ “Volksbote”, 18. Mai 1898<br />
27.↑ a b Stadtarchiv Stralsund, Q402<br />
28.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 15 Nr. 220<br />
29.↑ Übersicht <strong>de</strong>r Preußischen Han<strong>de</strong>lsmarine (E. Wendt & Co., Hrsg.), Stettin 1848, S. 24-26.<br />
30.↑ a b Jahresbericht <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lskammer <strong>zu</strong> Stralsund für 1878<br />
31.↑ Stadtarchiv Stralsund, rep. 5 Nr. 50, 52<br />
32.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 5 Nr. 51
33.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 15 Nr. 236<br />
34.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 15 Nr. 335<br />
35.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 5 Nr. 435<br />
36.↑ Horst Auerbach: Kriegshafen Dänholm in poseidon, Heft 4/1981, S. 22–23<br />
37.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 5 Nr. 52<br />
38.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 5 Nr. 60<br />
39.↑ Stadtarchiv Stralsund, M198<br />
40.↑ Han<strong>de</strong>lsberichte <strong>de</strong>r Stralsun<strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lskammer für 1895, 1897<br />
41.↑ Stadtarchiv Stralsund, M3706<br />
42.↑ Jahresbericht <strong>de</strong>r Han<strong>de</strong>lskammer <strong>zu</strong> Stralsund für 1888<br />
43.↑ Herbert Ewe: Zur Geschichte <strong>de</strong>r Technik in Stralsund, Ostsee-Zeitung vom 10. März 1972<br />
44.↑ Ernst von Haselberg: Die Bau<strong>de</strong>nkmale <strong>de</strong>s Regierungsbezirks Stralsund, Stettin 1902, S. 537–542<br />
45.↑ Stadtarchiv Stralsund, M4713<br />
46.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 23 Nr. 217 Band 1<br />
47.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 23 Nr. 686<br />
48.↑ W. Buchholz: Die Gasthauskirche <strong>zu</strong> Stralsund. Grundstein einer Krankenhausentwicklung, Greifswald-Stralsun<strong>de</strong>r Jahrbuch 1965, S. 181–182<br />
49.↑ a b c F. Knorr: Stralsund und Stralsun<strong>de</strong>r Ärzte<br />
50.↑ F. Knorr: Stralsund und Stralsundische Ärzte. Aus <strong>de</strong>n Quellen <strong>zu</strong>sammengestellt., Band 3 (Manuskript), 1909–1911<br />
51.↑ Ernst von Haselberg: Die asiatische Cholera im Regierungsbezirk Stralsund, Stralsund 1853, S. 39<br />
52.↑ K. Wellner: Die Pockenepi<strong>de</strong>mien im 19. Jahrhun<strong>de</strong>rt in <strong>de</strong>r Hansestadt Stralsund (Dissertation), Greifswald 1976, S. 63<br />
53.↑ “Stralsundische Zeitung”, 14. November 1872<br />
54.↑ Statistisches Jahrbuch für <strong>de</strong>n Preußischen Staat, Berlin 1905, S. 1, 3<br />
55.↑ J. Höft: Finanzstatistik Stralsunds, Stralsund 1933<br />
56.↑ Stralsundische Zeitung, 2. Mai 1905<br />
57.↑ Statistisches Jahrbuch für <strong>de</strong>n Preußischen Staat, Berlin 1904–1914<br />
58.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 25 Nr. 26<br />
59.↑ „Volksbote“, 21. September 1911<br />
60.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 25 Nr. 27<br />
61.↑ Stralsun<strong>de</strong>r Volkszeitung, 4. Juni 1917<br />
62.↑ „Stralsun<strong>de</strong>r Volkszeitung“, 7. November 1917<br />
63.↑ „Stralsun<strong>de</strong>r Tageblatt“, 8. November 1918<br />
64.↑ Stadtarchiv Stralsund, M 4016<br />
65.↑ a b „Stralsun<strong>de</strong>r Tageblatt“, 13. November 1918<br />
66.↑ „Stralsun<strong>de</strong>r Tageblatt“, 22. November 1918<br />
67.↑ „Stralsun<strong>de</strong>r Tageblatt“, 21. Januar 1919<br />
68.↑ „Stralsun<strong>de</strong>r Tageblatt“, 4. März 1919
69.↑ Volksbote, 24. Februar 1919<br />
70.↑ „Volksbote“, 30. September 1919<br />
71.↑ „Der Kämpfer“, 27. März 1920<br />
72.↑ „Der Vorpommer“, 8. Juni 1920<br />
73.↑ a b Staatsarchiv Greifswald, Rep. 60 Nr. 42<br />
74.↑ Staatsarchiv Greifswald, Rep. 60 Nr. 32<br />
75.↑ „Der Vorpommer“, 15. September 1930<br />
76.↑ „Der Vorpommer“, 11. April 1932<br />
77.↑ „Der Vorpommer“, 1. August 1932<br />
78.↑ Stadtarchiv Stralsund, vorl. Sign M 4442<br />
79.↑ Statistisches Jahrbuch für <strong>de</strong>n Preußischen Staat, Berlin 1898, S. 162–163<br />
80.↑ Staatsarchiv Greifswald, Rep. 65c Nr. 2527<br />
81.↑ W. Stuckmann: Entwicklung und Eigenart <strong>de</strong>r <strong>de</strong>utschen Spielkartenindustrie, S. 186<br />
82.↑ Stadtarchiv Stralsund, M 4204, Rep. 14 Nr. 437<br />
83.↑ Staatsarchiv Greifswald, Rep. 65c Nr. 7486, Nr. 438<br />
84.↑ IHK in Stralsund, Wirtschaftsbericht 1931<br />
85.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 25 Nr. 53<br />
86.↑ I. Kieseritzky: Stralsund geographisch betrachtet, S. 98<br />
87.↑ Haushaltsplan <strong>de</strong>r Stadt Stralsund, 1925 und 1933<br />
88.↑ J. Höft: Finanzstatistik Stralsunds, Tabelle VII<br />
89.↑ J. Höft: Finanzstatistik Stralsund<br />
90.↑ Stadtarchiv Stralsund, Rep. 14 Nr. 226<br />
91.↑ „Volkswacht“, 3. Februar 1933<br />
92.↑ „Volkswacht“, 28. Februar 1933<br />
93.↑ „Stralsun<strong>de</strong>r Tageblatt“, 6. März 1933<br />
94.↑ a b c Stadtarchiv Stralsund, Rep. 29 Nr. 66<br />
95.↑ Einwohnerbuch für Stralsund 1939, Vorwort<br />
96.↑ Stadtarchiv Stralsund, 2.00.3.13.802<br />
97.↑ Stadtarchiv Stralsund, 2.00.3.4.228<br />
98.↑ „Lan<strong>de</strong>s-Zeitung“, 6. Dezember 1947<br />
99.↑ Stadtarchiv Stralsund, 2.00.3.1.136<br />
100.↑ Stadtarchiv Stralsund, Sign. IW 474<br />
101.↑ Stadtarchiv Stralsund, 2.00.3.1.159<br />
102.↑ Staatsarchiv Schwerin, Nr. 1164, 1165<br />
103.↑ Stadtarchiv Stralsund, 2.00.3.1.59<br />
104.↑ „Volksstimme“, 24. Oktober 1945
105.↑ Stadtarchiv Stralsund, 2.00.3.4.232<br />
106.↑ Stadtarchiv Stralsund, 2.00.3.4.210<br />
107.↑ Stadtarchiv Stralsund, 2.00.3.1.50<br />
108.↑ „Lan<strong>de</strong>s-Zeitung“, 1. Februar 1948<br />
109.↑ Stadtarchiv Stralsund, 2.00.3.1.16.831<br />
110.↑ „Lan<strong>de</strong>s-Zeitung“, 30. Juli 1952<br />
111.↑ „Ostsee-Zeitung“, 26. Juli 1962<br />
112.↑ Anne Kaminsky (Hrsg.): Orte <strong>de</strong>s Erinnerns. Ge<strong>de</strong>nkzeichen, Ge<strong>de</strong>nkstätten und Museen <strong>zu</strong>r Diktatur in SBZ und DDR, Bonn 2007, <strong>zu</strong> Stralsund S. 272–275<br />
113.↑ „Ostsee-Zeitung“, 9. November 1967<br />
114.↑ „Lan<strong>de</strong>s-Zeitung“, 14. Oktober 1950<br />
115.↑ „Lan<strong>de</strong>s-Zeitung“, 20. Oktober 1951<br />
116.↑ Stadtarchiv Stralsund, Ra 698<br />
117.↑ Stadtarchiv Stralsund, Ra 497<br />
118.↑ Statistisches Taschenbuch 1956 Stralsund -Stadt<br />
119.↑ Stadtarchiv Stralsund, R. S. Nr. 6, 21. März 1957<br />
120.↑ Stadtarchiv Stralsund, St. V., 29. Juli 1965<br />
121.↑ Stadtarchiv Stralsund, St. V. Nr. 3, 27. Juni 1933<br />
122.↑ Stadtarchiv Stralsund, St. V. Nr. 14, 29. September 1976<br />
123.↑ Stadtarchiv Stralsund, St. V. 29. September 1955<br />
124.↑ Stadtarchiv Stralsund, St. V. 25. November 1954<br />
125.↑ Stadtarchiv Stralsund, St. V. Nr. 5, 21. Januar 1971<br />
126.↑ „Unsere Werft“, 23. Februar 1956<br />
Der obige Ergän<strong>zu</strong>ngsartikel wur<strong>de</strong> aus <strong>de</strong>r Freien Enzyklopädie Wikipedia übernommen und entsprechend <strong>de</strong>r gelten<strong>de</strong>n GNU-Lizenz veröffentlicht. Eine möglicherweise aktuellere Version fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>n Seiten <strong>de</strong>r Wikipedia. Eine Liste <strong>de</strong>r<br />
Autoren fin<strong>de</strong>n Sie auf <strong>de</strong>r entsprechen<strong>de</strong>n Wikipediaseite unter <strong>de</strong>m Punkt “Versionen/Autoren”. Weitergehen<strong>de</strong> Informationen und Hinweise fin<strong>de</strong>n Sie auf unserer Impressumseite. Anmerkung <strong>de</strong>r u~m~d~h~T: Wir machen darauf aufmerksam,<br />
daß politische Passagen im Zuge unserer Statuten stark gekürzt, bzw. nicht übernommen wur<strong>de</strong>n.