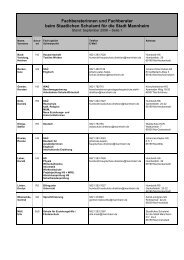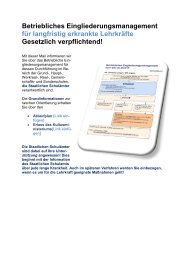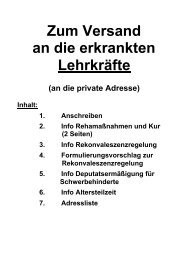Orientierungsrahmen - Schulamt Mannheim
Orientierungsrahmen - Schulamt Mannheim
Orientierungsrahmen - Schulamt Mannheim
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Orientierungsrahmen</strong><br />
Für die gemeinsame Beschulung<br />
von Kindern mit und ohne Behinderungen<br />
Im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es<br />
<strong>Mannheim</strong><br />
Arbeitspapier für die Schulen im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong>.<br />
Erarbeitet in Kooperation der Pädagogischen Hochschule Heidelberg und des<br />
Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong>
<strong>Orientierungsrahmen</strong> für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen<br />
im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong><br />
1 Was braucht gemeinsamer Unterricht von Kindern und<br />
Jugendlichen mit und ohne Behinderung<br />
1.1 Zum Sinn und Zweck des <strong>Orientierungsrahmen</strong>s<br />
Die Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts (GU) von Kindern und Jugendlichen mit<br />
und ohne Behinderung erfordert eine gute Planung und die Begleitung der beteiligten<br />
Schulen. Der vorliegende <strong>Orientierungsrahmen</strong> möchte einen konkreten Beitrag zur<br />
Unterstützung leisten.<br />
Die hier angesprochenen Qualitätsmerkmale und Leitfragen machen auf<br />
„Gelenkstellen“ der Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts aufmerksam. Die<br />
Darstellung dieser zentralen Gesichtspunkte soll eine kriteriengeleitete Reflexion und<br />
effektive Auseinandersetzung mit der Praxis des gemeinsamen Unterrichts an der<br />
eigenen Schule erleichtern und dabei folgende Aspekte in den Mittelpunkt rücken:<br />
Wo stehen wir<br />
Worauf achten wir<br />
Wohin wollen wir<br />
Aus dem <strong>Orientierungsrahmen</strong> lassen sich verbindliche Ziele und konkrete<br />
Entwicklungsaufgaben zur Qualitätsverbesserung ableiten. Insofern stellt der<br />
<strong>Orientierungsrahmen</strong> auch im Prozess der Selbstevaluation des gemeinsamen<br />
Unterrichts ein geeignetes Hilfsmittel dar.<br />
1.2 Zu den Inhalten des <strong>Orientierungsrahmen</strong>s<br />
Als zentrale Bereiche des gemeinsamen Unterrichts werden im <strong>Orientierungsrahmen</strong><br />
folgende Themenfelder betrachtet:<br />
Schulentwicklung<br />
Rahmenbedingungen<br />
Unterrichtsgestaltung<br />
Teamarbeit<br />
Fortbildung und Beratung<br />
Zusammenarbeit mit Eltern.<br />
Zu jedem dieser Themenfelder werden Qualitätsmerkmale und zugehörige Leitfragen<br />
für die konkrete Umsetzung des gemeinsamen Unterrichts formuliert. Selbstverständlich<br />
können diese erweitert, vertieft und beispielsweise für eigene Schwerpunktsetzungen<br />
variiert werden. Der <strong>Orientierungsrahmen</strong> ist bewusst offen gehalten, damit die<br />
unterschiedlichen Bedingungen vor Ort sowie die individuellen Förderbedürfnisse der<br />
beteiligten Schülerinnen und Schüler in den Blick genommen werden können.<br />
1.3 Zu den Adressaten des <strong>Orientierungsrahmen</strong>s<br />
Der <strong>Orientierungsrahmen</strong> kann von einzelnen Lehrkräften, von Teams, von der<br />
Schulleitung und den schulischen Gremien genutzt werden. Er ist sowohl für Schulen<br />
geeignet, die mit dem gemeinsamen Unterricht erst beginnen, als auch für Schulen, die<br />
damit bereits Erfahrungen haben und weitere Ziele anstreben. Seine Nutzung ist<br />
unabhängig von der Organisationsform des gemeinsamen Unterrichts möglich, er ist für<br />
Außenklassen wie auch für gruppenbezogene Lösungen und Einzelfalllösungen des<br />
gemeinsamen Unterrichts einsetzbar.<br />
Seite 2
<strong>Orientierungsrahmen</strong> für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen<br />
im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong><br />
1.4 Zur Entstehung des <strong>Orientierungsrahmen</strong>s<br />
Der <strong>Orientierungsrahmen</strong> wurde auf der Basis wissenschaftlicher Untersuchungen der<br />
Pädagogischen Hochschule Heidelberg zur Praxis des gemeinsamen Unterrichts in<br />
Außenklassen entwickelt. Die Kooperation von allgemeinen Schulen und<br />
Sonderschulen, Pädagogischer Hochschule Heidelberg und Staatlichem <strong>Schulamt</strong><br />
<strong>Mannheim</strong> bei der „Qualitätsinitiative Außenklassen“ wurde bei der Erstellung des<br />
vorliegenden <strong>Orientierungsrahmen</strong>s fortgesetzt, um die unterschiedlichen Perspektiven<br />
von Schulpraxis, Wissenschaft und Schulverwaltung zu berücksichtigen und die<br />
Weiterentwicklung des GU als eine gemeinsame Aufgabe wahrzunehmen. Der<br />
<strong>Orientierungsrahmen</strong> soll die professionelle Gestaltung des gemeinsamen Unterrichts<br />
praxisnah unterstützen.<br />
2 Schulleben/Schulentwicklung<br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf<br />
2.1 Leitbild <br />
Der GU ist ein<br />
Anliegen der<br />
gesamten Schule.<br />
Ist der GU im Leitbild der Schule verankert<br />
Ist der GU im Profil der Schule wiederzufinden<br />
2.2 Schulgemeinschaft <br />
Die Schülerinnen<br />
und Schüler des<br />
GU gehören<br />
gleichberechtigt zur<br />
Schulgemeinschaft.<br />
Die Lehrkräfte des<br />
GU gehören<br />
gleichberechtigt zur<br />
Schulgemeinschaft.<br />
Nehmen die Schülerinnen und Schüler des GU<br />
selbstverständlich an allen schulischen Aktivitäten teil<br />
Erhalten die Schülerinnen und Schüler des GU die<br />
Möglichkeit, sich aktiv in die Schulgemeinschaft<br />
einzubringen<br />
Vertritt die Schülermitverantwortung alle Schülerinnen und<br />
Schüler<br />
Sind die Lehrkräfte des GU an den Schulaktivitäten beteiligt<br />
Gibt es Regelungen zwischen den beteiligten Schulen zu den<br />
Mitwirkungspflichten/Mitwirkungsrechten der Lehrkräfte (z.B.<br />
zur Teilnahme an Konferenzen, an der Fremdevaluation, zur<br />
Berücksichtigung von Aspekten der Lehrergesundheit und<br />
effizienten Ressourcennutzung)<br />
2.3 Schulische Gremien <br />
Die schulischen<br />
Gremien werden<br />
zum GU informiert<br />
und an<br />
Entscheidungen<br />
zum GU beteiligt.<br />
Werden alle Gremien regelmäßig über den GU informiert<br />
Wird der GU in allen schulischen Gremien thematisiert<br />
Sehen die schulischen Gremien es als ihre Aufgabe an, den<br />
GU zu unterstützen und zu begleiten<br />
Seite 3
<strong>Orientierungsrahmen</strong> für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen<br />
im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong><br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf<br />
2.4 Schulentwicklung <br />
Der GU wird im<br />
Rahmen der<br />
Schulentwicklung<br />
bearbeitet.<br />
Wird der GU als notwendiger Bereich der Schulentwicklung<br />
wahrgenommen<br />
Werden Ausgangslage, Zielperspektiven und Probleme<br />
transparent im Kollegium erarbeitet<br />
Gibt es eine Arbeitsgruppe für Schulentwicklung im Bereich<br />
des GU<br />
Wird der GU regelmäßig evaluiert<br />
2.5 Kooperationen/ Öffentlichkeitsarbeit <br />
Die Schule vernetzt<br />
sich im Rahmen<br />
des GU mit<br />
anderen Schulen<br />
und mit außerschulischen<br />
Partnern.<br />
Die Schule kooperiert<br />
mit <strong>Schulamt</strong><br />
und -trägern.<br />
Der GU ist ein<br />
Thema der Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Finden Erfahrungsaustausch und Absprachen mit anderen<br />
Schulen regelmäßig statt<br />
Nutzt die Schule Kooperationsmöglichkeiten mit Vereinen,<br />
Institutionen im Stadtteil, etc.<br />
Kooperiert die Schule mit der Wissenschaft (Universität,<br />
Pädagogische Hochschule)<br />
Findet zum GU ein regelmäßiger Erfahrungsaustausch mit<br />
dem jeweiligen Schulträger und dem zuständigen <strong>Schulamt</strong><br />
statt<br />
Wird in der schulischen Öffentlichkeitsarbeit über den GU<br />
berichtet (z.B. über die Homepage, Zeitungsartikel,<br />
Informationsveranstaltungen)<br />
3 Rahmenbedingungen<br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf<br />
3.1 Räumliche Situation und Barrierefreiheit <br />
Die Schule ist<br />
barrierefrei und für<br />
alle zugänglich.<br />
Ist die Schule für Schülerinnen und Schüler mit körperlicher<br />
Behinderung barrierefrei (z.B. Zugänge, Rampen, Aufzug,<br />
Toiletten, Türbreite, Platz für Hilfsmittel)<br />
Können sich Schülerinnen und Schüler mit motorischer<br />
Behinderung auf den Außenflächen frei fortbewegen<br />
Ist die räumliche Ausstattung der Schule dem Bedarf sehgeschädigter<br />
Schülerinnen und Schüler angepasst, sodass<br />
sie angemessen am Schulleben und Unterricht teilhaben<br />
können (z.B. durch entsprechende Beleuchtung,<br />
Kennzeichnung von Gefahrenstellen, ev. Tafelkamera)<br />
Ermöglicht die Raumausgestaltung hörgeschädigten<br />
Schülerinnen und Schülern die Teilhabe am Unterricht (z.B.<br />
durch angemessene Raumakustik, Höranlagen etc.)<br />
Seite 4
<strong>Orientierungsrahmen</strong> für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen<br />
im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong><br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf<br />
Gut ausgestattete<br />
Räume für individualisierten<br />
und<br />
differenzierten<br />
Unterricht sind<br />
vorhanden.<br />
Gibt es zusätzliche Räume zur Differenzierung (z.B. für<br />
Gruppenarbeit, Einzelförderung etc.)<br />
Sind für Schülerinnen und Schüler mit Pflegebedarf<br />
geeignete Räumlichkeiten vorhanden<br />
3.2 Sächliche Ausstattung <br />
Die Zuweisung der<br />
sächlichen Mittel<br />
durch den<br />
Schulträger ist<br />
eindeutig und<br />
bedarfsgerecht<br />
geregelt.<br />
Sind die für einen differenzierten und individualisierten<br />
Unterricht erforderlichen Materialien verfügbar<br />
Steht der Schule Material für den Pflege- und Betreuungsbedarf<br />
von Schülerinnen und Schülern zur Verfügung<br />
Verfügt die Schule über eine gute Ausstattung, geeignete<br />
Lehr- und Lernmittel, Fördermaterial etc.<br />
Können zusätzliche Lehr- und Lernmittel problemlos<br />
beschafft werden, die für Kinder mit besonderen<br />
Lernvoraussetzungen erforderlich sind<br />
Gibt es zweckmäßige Regelungen für die Verwendung der<br />
Sachkosten im Rahmen des GU<br />
3.3 Personalausstattung <br />
Der Schule steht<br />
qualifiziertes<br />
Personal für den<br />
gemeinsamen<br />
Unterricht zur<br />
Verfügung.<br />
Verfügen die Lehrkräfte über die notwendigen Kompetenzen<br />
zur Gestaltung des GU<br />
Ist die erforderliche sonderpädagogische Fachlichkeit<br />
vorhanden<br />
Gibt es bei Bedarf Schulbegleitungen<br />
Steht bei Bedarf für die Betreuung und Pflege geeignetes<br />
Personal zur Verfügung<br />
Steht bei Bedarf Personal für die Betreuung in der Kernzeit<br />
und für die Nachmittagsbetreuung zur Verfügung<br />
3.4 Organisatorische Voraussetzungen für GU <br />
An der Schule gibt<br />
es die für den GU<br />
erforderlichen<br />
organisatorischen<br />
Regelungen.<br />
Wird der besondere Bedarf beim GU bei der<br />
Stundenplangestaltung berücksichtigt<br />
Gibt es Regelungen<br />
… zur Aufsichtssituation<br />
… zur Vertretungssituation<br />
… zur Klassenzusammensetzung<br />
… zur Führung der Schülerakte<br />
Erfolgen regelmäßige Abstimmungen zwischen den<br />
Schulleitungen der allgemeinen und der Sonderschulen<br />
Seite 5
<strong>Orientierungsrahmen</strong> für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen<br />
im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong><br />
4 Unterricht<br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf<br />
4.1 Unterrichtsdidaktik und –methodik <br />
Der GU hat<br />
gemeinsame<br />
didaktische und<br />
methodische<br />
Grundlagen.<br />
Werden bei zieldifferenten Lerngruppen die unterschiedlichen<br />
Bildungspläne und Curricula aufeinander abgestimmt<br />
Werden die Unterrichtsinhalte problemorientiert und<br />
fächerübergreifend angeboten<br />
Orientiert sich die gemeinsame Planung und Durchführung<br />
des Unterrichts an den individuellen Voraussetzungen aller<br />
Schülerinnen und Schüler<br />
Ermöglichen gemeinsam erarbeitete Regeln und Rituale für<br />
die Klasse die Beteiligung aller Schülerinnen und Schüler<br />
Ist die Lernumgebung so gestaltet, dass bei allen<br />
Schülerinnen und Schüler eigenverantwortliches und<br />
entdeckendes Lernen unterstützt und gefördert wird<br />
4.2 Kooperatives Unterrichten <br />
Die Lehrkräfte<br />
unterrichten<br />
kooperativ.<br />
Werden Inhalte und Themen des Unterrichts von den<br />
Lehrkräften gemeinsam geplant und umgesetzt<br />
Wird Teamteaching bewusst und reflektiert eingesetzt<br />
Gibt es ein gemeinsames Verständnis von Lehr- und<br />
Lernprozessen<br />
4.3 Individuelles Lernen <br />
Die Lernkultur ist so<br />
gestaltet, dass<br />
jedes Kind auf<br />
seinem individuellen<br />
Lernniveau,<br />
mit seinen Lernvoraussetzungen<br />
und in seinem<br />
eigenen Lerntempo<br />
am Unterricht<br />
wirksam teilhaben<br />
kann.<br />
Erfolgt eine innere Differenzierung in Bezug auf<br />
… Ziele und Inhalte,<br />
… Methoden und Medien<br />
… Lernformen und Lernniveaus<br />
Werden vielfältige Unterrichtsformen berücksichtigt, z.B.<br />
… Freiarbeit, und Stationenlernen,<br />
… Wochenplan und Werkstattunterricht,<br />
… Projektarbeit und Lernen am gemeinsamen Gegenstand<br />
Sind diagnostische Kompetenzen vorhanden, um die Stärken,<br />
den Kenntnisstand, die Lernfortschritte und<br />
Lernschwierigkeiten aller Schülerinnen und Schüler beurteilen<br />
zu können<br />
Wird eigenverantwortliches, selbstgesteuertes und aktives,<br />
handelndes Lernen gefördert<br />
Wird die dazu notwendige Methodenkompetenz bei den<br />
Schülerinnen und Schülern aufgebaut<br />
Werden die Schülerinnen und Schüler durch beobachtendes,<br />
begleitendes und beratendes Handeln der Lehrkräfte<br />
unterstützt<br />
Seite 6
<strong>Orientierungsrahmen</strong> für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen<br />
im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong><br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf<br />
4.4 Kooperatives Lernen <br />
Der Unterricht<br />
beinhaltet Phasen<br />
des kooperativen<br />
Lernens.<br />
Arbeiten die Schülerinnen und Schüler auch in heterogenen<br />
Gruppen miteinander<br />
Erarbeiten die Schülerinnen und Schüler Lerngegenstände<br />
u.a. mit Methoden des kooperativen Lernens (z.B. placemat,<br />
Gruppenpuzzle, Stationengespräch ...)<br />
Leistet jedes Mitglied der Gruppe seinen eigenen, sichtbaren<br />
Beitrag zum Gruppenergebnis<br />
Gibt es bewusst Phasen im Unterricht, in denen sich die<br />
Schülerinnen und Schüler gegenseitig unterstützen<br />
4.5 Frontalunterricht <br />
Phasen des<br />
Frontalunterrichts<br />
sind so gestaltet,<br />
dass alle<br />
Schülerinnen und<br />
Schüler aktiv daran<br />
teilhaben können.<br />
Sind die Phasen des direkten Unterrichtens/des<br />
Frontalunterrichts verständlich und gut strukturiert<br />
Wird der Lerngegenstand informativ, problem- und<br />
schülerorientiert dargeboten<br />
Werden in diesen Phasen die Inhalte durch entsprechenden<br />
Medieneinsatz allen zugänglich gemacht<br />
Ist die Gesprächsführung im Frontalunterricht prägnant und<br />
effektiv gestaltet<br />
Werden alle Schülerinnen und Schüler durch Fragen und<br />
Aufgaben aktiv einbezogen<br />
4.6 Stärkung der Klassengemeinschaft <br />
In der Klasse gibt<br />
es ein Gemeinschaftsgefühl<br />
und<br />
ein Gemeinschaftsbewusstsein.<br />
Sind die Sozialbeziehungen zu Lehrkräften und<br />
Mitschülerinnen und Mitschülern durch Akzeptanz und<br />
Wertschätzung geprägt<br />
Gibt es Rituale zur Stärkung der Klassengemeinschaft, wie<br />
z.B. Erzählkreis und Klassenrat oder Klassenfeedback<br />
Gibt es ritualisierte Formen der Konfliktbewältigung wie z.B.<br />
Streitschlichtung, Gewaltpräventionsprogramme,<br />
Sozialkompetenztrainings<br />
Gibt es Angebote für Gemeinschaftserlebnisse außerhalb des<br />
Unterrichts (z.B. Ausflüge, Klassenfahrten, Feste), die die<br />
Entwicklung eines guten Sozialklimas unterstützen<br />
Seite 7
<strong>Orientierungsrahmen</strong> für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen<br />
im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong><br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf<br />
4.7 Leistungsbeurteilung <br />
Die Leistungsbeurteilung<br />
ist ergebnisund<br />
prozessorientiert<br />
und unterstützt<br />
die Schülerinnen<br />
und Schüler in ihrer<br />
Lernentwicklung.<br />
Die Leistungsbeurteilung<br />
beschreibt Lernstand<br />
und Lernentwicklung<br />
der<br />
Schülerinnen und<br />
Schüler individuell.<br />
Berücksichtigt die Leistungsbeurteilung sowohl die<br />
Lernergebnisse als auch den Lernprozess<br />
Gibt es transparente Kriterien, welche die Qualität des<br />
Lernprozesses beschreiben<br />
Erhalten die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, ihre<br />
Lernergebnisse und ihren Lernprozess selbst zu reflektieren<br />
und einzuschätzen<br />
Folgen aus der Leistungsbeurteilung individuelle<br />
Lernberatungen und Bildungsangebote<br />
Werden für die Schülerinnen und Schüler Zeugnisse,<br />
Halbjahresinformationen und Schulberichte entsprechend<br />
ihres Bildungsganges erstellt<br />
Gibt es Verfahren zur Leistungsbeurteilung, die die individuelle<br />
Lernleistung der Schülerinnen und Schüler inhaltlich<br />
differenziert beschreiben und Entwicklungsmöglichkeiten<br />
aufzeigen (Rückmeldebögen, Lernentwicklungsberichte)<br />
Werden Instrumente zur Leistungsbeurteilung verwendet, die<br />
differenzierte Maßstäbe benutzen (z.B. Kompetenzraster)<br />
und individualisiertes Lernen zulassen<br />
Wird bei Schülerinnen und Schülern mit besonderem<br />
Förderbedarf oder mit Behinderungen bei der<br />
Leistungsbeurteilung der Nachteilsausgleich angewendet 1<br />
5 Teamarbeit<br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf<br />
5.1 Zusammensetzung des Teams <br />
Die Lehrkräfte und<br />
das weitere<br />
Personal im GU<br />
sind an der Teamarbeit<br />
beteiligt.<br />
Gibt es ein „Kernteam“, bestehend aus verantwortlichem<br />
Lehrpersonal aus der allg. Schule und der Sonderschule<br />
Gehören alle am GU beteiligten Lehrkräfte und die weiteren<br />
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem „erweiterten<br />
Team“<br />
Gibt es Absprachen mit der Schulleitung zur Unterstützung<br />
der Teamarbeit<br />
Gibt es eine gemeinsame Basis zum Rollenverständnis der<br />
Lehrkräfte<br />
1 Vgl. Verwaltungsvorschrift „Kinder und Jugendliche mit besonderem Förderbedarf und Behinderungen“<br />
in der Fassung vom 22.08.2008, Punkt 2.3<br />
Seite 8
<strong>Orientierungsrahmen</strong> für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen<br />
im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong><br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf<br />
Die Beteiligung an<br />
den Teamsitzungen<br />
ist sichergestellt.<br />
Die Kommunikation<br />
zwischen den<br />
Teammitgliedern ist<br />
sichergestellt.<br />
Gibt es eine terminlich festgelegte wöchentliche Sitzung für<br />
das Kernteam<br />
Gibt es eine festgelegte, bedarfsgerechte Beteiligung an den<br />
Teamsitzungen für die Mitglieder des „erweiterten Teams“<br />
Sind die Kontaktdaten und die Kommunikationsmittel der<br />
Teammitglieder bekannt<br />
Werden die Kommunikationsmittel verlässlich genutzt<br />
5.2 Aufgaben und Zuständigkeiten im Team <br />
Die Aufgaben der<br />
Teammitglieder<br />
sind festgelegt und<br />
die Zuständigkeiten<br />
geklärt.<br />
Die Aufgaben der<br />
Teammitglieder<br />
werden nach Bedarf<br />
und Erfordernissen<br />
flexibel<br />
angepasst.<br />
Sind die Aufgaben der Teammitglieder festgelegt<br />
Werden die Aufgabenaufteilung und Verantwortlichkeiten in<br />
den Teamsitzungen abgesprochen<br />
Gibt es eine Aufteilung der Zuständigkeiten…<br />
… unterrichtsfachbezogen<br />
… fachrichtungsbezogen<br />
… weitere Absprachen<br />
Stellt das Team sicher, dass die Aufgabenaufteilung flexibel<br />
angepasst werden kann<br />
Gibt es eine Reflexion der Aufgabenverteilung im Rahmen<br />
der Teamsitzungen<br />
5.3 Zeitliche Planung der Teamarbeit <br />
Das Team plant<br />
genügend Zeit für<br />
die Teamarbeit ein,<br />
die Schule stellt ein<br />
wöchentliches<br />
Zeitfenster dafür<br />
zur Verfügung.<br />
Gibt es ein wöchentliches Zeitfenster, das verlässlich für die<br />
Teambesprechung frei gehalten wird<br />
Sind die Stundenpläne der im GU arbeitenden Lehrkräfte<br />
entsprechend synchronisiert<br />
Planen die Teammitglieder Arbeitszeit für die Vor- und<br />
Nachbereitung der Teamsitzungen ein<br />
Seite 9
<strong>Orientierungsrahmen</strong> für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen<br />
im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong><br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf<br />
5.4 Inhalte der Teamarbeit <br />
Für den GU<br />
relevante Themen<br />
werden regelmäßig<br />
und bedarfsgerecht<br />
in den Teamsitzungen<br />
behandelt.<br />
Werden die unterrichtlichen Inhalte in den Teamsitzungen<br />
hinreichend im Voraus behandelt<br />
Werden hierzu Absprachen getroffen und alle Aufgaben<br />
aufgeteilt<br />
Werden Vereinbarungen zur gemeinsamen Elternarbeit<br />
getroffen (Gespräche, Klassenpflegschaft, Sprechtage etc.)<br />
Werden „besondere Vorkommnisse“ zeitnah besprochen<br />
Werden Lernstandserhebung, Förderplanung und<br />
Leistungsmessung im Team angemessen berücksichtigt<br />
5.5 Qualität der Teamarbeit <br />
Das Team reflektiert<br />
in angemessenen<br />
Abständen<br />
seine Arbeitsweise.<br />
In regelmäßigen<br />
Bilanzgesprächen<br />
werden Arbeitsweise<br />
und Rahmenbedingungen<br />
der Teamarbeit<br />
evaluiert.<br />
Nimmt sich das Team Zeit, über die Kooperation im Team zu<br />
reflektieren<br />
Werden die Ergebnisse einer Reflexion in die weitere<br />
Teamarbeit übergeführt<br />
Finden regelmäßig (halbjährlich/ jährlich/ bedarfsgerecht)<br />
Bilanzierungsgespräche auch mit der Schulleitung statt<br />
Sind daran auch "externe Partner" (z.B. Beratungslehrer/in,<br />
Mediator/in) beteiligt<br />
Werden die Ergebnisse dokumentiert und wird die<br />
Umsetzung notwendiger Veränderungen sichergestellt<br />
6 Fortbildung und Beratung<br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf <br />
Auf der Grundlage<br />
von Ausbildung und<br />
Fortbildung<br />
arbeiten die<br />
Lehrkräfte im GU<br />
professionell.<br />
Haben die Lehrkräfte der allgemeinen Lehrämter durch ihre<br />
Ausbildung geeignete fachliche und persönliche<br />
Voraussetzungen für die Arbeit im GU<br />
Haben die sonderpädagogischen Lehrkräfte aufgrund ihrer<br />
Ausbildung geeignete fachliche und persönliche<br />
Voraussetzungen für den GU<br />
Ist das professionelle Handeln der Lehrkräfte auf einem<br />
aktuellen Stand in Bezug auf:<br />
... Information/Wissen zu GU<br />
... Reflexion der GU-Praxis<br />
... Kommunikationsaufgaben im Zusammenhang des GU<br />
... konzeptionelles Arbeiten im GU<br />
Seite 10
<strong>Orientierungsrahmen</strong> für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen<br />
im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong><br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf <br />
Geeignete Fortbildungsangebote<br />
und<br />
Beratungsmöglichkeiten<br />
für<br />
den GU sind<br />
vorhanden und<br />
werden genutzt.<br />
Werden fachliche und überfachliche Qualifizierungs-/ und<br />
Weiterbildungsmöglichkeiten angefragt und genutzt in den<br />
Bereichen:<br />
…Teamarbeit<br />
… Fachwissenschaft und -didaktik<br />
… Einstellungen und Menschenbild<br />
… Kooperation mit Eltern und Institutionen<br />
… Lehrergesundheit<br />
Werden Lehrkräfte vor Beginn ihrer Tätigkeit im GU auf die<br />
neue Situation vorbereit und darüber hinaus begleitet<br />
Befassen sich pädagogische Tage mit grundsätzlichen und<br />
praktischen Themen zum GU<br />
Gibt es Hospitationsmöglichkeiten zum gegenseitigen<br />
Kennenlernen, Kompetenztransfer und Austausch<br />
7 Zusammenarbeit mit Eltern<br />
Qualitätsmerkmal Leitfragen Entwicklungsbedarf<br />
7.1 Allgemein <br />
Die Kommunikation<br />
mit den Eltern ist<br />
respektvoll und<br />
partnerschaftlich.<br />
Werden Eltern als gleichberechtigte Erziehungspartner für<br />
ihre Kinder geschätzt und wird ihr Wissen mit in den<br />
Schulalltag integriert<br />
Werden hierbei die Bedürfnisse der Eltern der GU-<br />
Schülerinnen und Schüler achtsam in den Blick genommen<br />
Wird die Kontaktaufnahme zwischen allen Eltern unterstützt<br />
Erfolgt die Klassenbildung für die Eltern transparent<br />
7.2 Austauschstrukturen <br />
Der Austausch mit<br />
den Eltern erfolgt in<br />
verlässlichen<br />
Strukturen und zu<br />
vereinbarten<br />
Anlässen.<br />
Gibt es regelmäßige Anlässe, die der Kontaktpflege und<br />
Zusammenarbeit dienen (z.B. Elternstammtisch, Klassenund<br />
Schulfeste, Infoveranstaltungen)<br />
Werden alle Eltern regelmäßig über Strukturen und Praktiken<br />
der Schule in Bezug auf den GU informiert<br />
Sind alle Eltern über ihre mögliche Beteiligung in der<br />
Klassenpflegschaft und dem Elternbeirat informiert<br />
Gibt es Regelungen zur Teilnahme an Elternsprechtagen,<br />
Eltern- und Förderplangesprächen<br />
Seite 11
<strong>Orientierungsrahmen</strong> für die gemeinsame Beschulung von Kindern mit und ohne Behinderungen<br />
im Bereich des Staatlichen <strong>Schulamt</strong>es <strong>Mannheim</strong><br />
8 Zur Weiterarbeit mit dem <strong>Orientierungsrahmen</strong><br />
Die nachfolgende Tabelle kann genutzt werden, um den erkannten Entwicklungsbedarf<br />
und daraus abgeleitete vorrangige Ziele übersichtlich zusammenzufassen – als<br />
Grundlage für die weitere Qualitätsentwicklung im Bereich des GU.<br />
Entwicklungsbedarf und Ziele<br />
Bereich<br />
(Nr.)<br />
Entwicklungsbedarf<br />
Ziele<br />
Verantwortlich für den Inhalt und Ansprechpersonen bei Rückfragen:<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Arnulf Amberg, Schulleiter der Maria-Montessori-Schule (Sonderpädagogisches<br />
Bildungs- und Beratungszentrum) Weinheim und Fachberater<br />
Unterrichtsentwicklung für Inklusion und GU am Staatlichen <strong>Schulamt</strong> <strong>Mannheim</strong><br />
Prof. Dr. Theo Klauß, Pädagogische Hochschule Heidelberg, Fachrichtung<br />
Geistig- und Mehrfachbehindertenpädagogik<br />
Dr. Christiane Lutz, Schulrätin, Staatliches <strong>Schulamt</strong> <strong>Mannheim</strong>, Fachbereiche<br />
Sonderschulen und Lehrkräftefortbildung<br />
Ute Raible, Lehrerin an der Friedrich Ebert Grundschule Ilvesheim und<br />
Mitarbeiterin der Arbeitsstelle Kooperation (ASKO) am Staatlichen <strong>Schulamt</strong><br />
<strong>Mannheim</strong><br />
Christiane Renner, Lehrerin an der Waldschule (WRS) Walldorf und Mitarbeiterin<br />
der Arbeitsstelle Kooperation (ASKO) am Staatlichen <strong>Schulamt</strong> <strong>Mannheim</strong><br />
Jörg Schuchardt, Schulleiter der Waldschule (WRS/RS) <strong>Mannheim</strong><br />
Stefanie Seifried, Wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Pädagogischen<br />
Hochschule Heidelberg, Fachrichtung Geistig- und Mehrfachbehindertenpädagogik<br />
Heidelberg/<strong>Mannheim</strong>, den 10. Juni 2013<br />
Seite 12