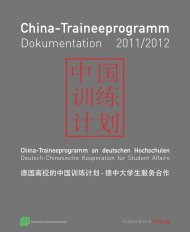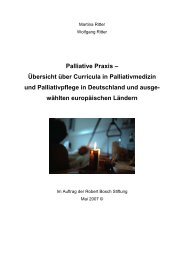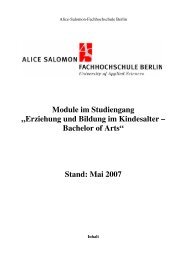Programm Schüleraustausch (PDF) - Robert Bosch Stiftung
Programm Schüleraustausch (PDF) - Robert Bosch Stiftung
Programm Schüleraustausch (PDF) - Robert Bosch Stiftung
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Deutsch-russische<br />
Schulpartnerschaften<br />
sinnvoll gestalten<br />
Begegnungen und Projekte<br />
im Rahmen deutsch-russischer<br />
Schulpartnerschaften<br />
Stand: Oktober 2009<br />
<strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch gGmbH<br />
Mittelweg 117 b<br />
20149 Hamburg<br />
Tel.: 040 /8788679-0<br />
www.stiftung-drja.de
Inhalt<br />
1 EINLEITUNG ................................................................<br />
...........................................................<br />
3<br />
2 DEUTSCH-RUSSISCHE SCHULPARTNERSCHAFTEN<br />
– MEHR ALS SCHÜLERAUSTAUSCH<br />
4<br />
2.1 Schule – Partner - Partnerschule........................................................................ 6<br />
2.2 Wie finde ich eine Partnerschule in Russland ...................................................... 7<br />
2.3 Partnerstädte - Partnerschulen.......................................................................... 8<br />
2.4 „Die Chemie muss stimmen!“ ............................................................................ 8<br />
3 FINANZIERUNG VON DEUTSCH<br />
TSCH-RUSSISCHEN LEHRER- UND SCHÜLERBEGEGNUNGEN<br />
GEN 9<br />
3.1 Die Förderung von Schulpartnerschaften ist Ländersache.......................................10<br />
3.2 Schulische Förderprogramme der <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch........11<br />
3.3 <strong>Programm</strong> A: Schulischer Austausch ..................................................................13<br />
3.3.1 <strong>Programm</strong>linie A1: Schüleraustausch ........................................................................................14<br />
3.3.2 <strong>Programm</strong>linie A2: Lehreraustausch ..........................................................................................16<br />
3.3.3 <strong>Programm</strong>linie A3: Projektorientierter Austausch ........................................................................18<br />
4 PROGRAMM B: SPRACHFÖRDERUNG<br />
RDERUNG .............................................................<br />
.............................21<br />
4.1 <strong>Programm</strong>linie B1: „Russisch kommt!“ - Aktionstage ............................................22<br />
4.2 <strong>Programm</strong>linie B2: Russisch-Spracholympiaden ...................................................23<br />
4.3 <strong>Programm</strong>linie B3: Sprachzertifikat Russisch.......................................................24<br />
5 PROGRAMMLINIE C: GASTSCHULAUFENTHALTE UND BERUFSPRAKTIKA ................25<br />
5.1 <strong>Programm</strong>linie C2: Individueller Gastschulaufenthalt im Rahmen einer<br />
Schulpartnerschaft.........................................................................................26<br />
5.2 <strong>Programm</strong>linie C3: Berufspraktikum in Russland im Rahmen einer Schulpartnerschaft 27<br />
6 REFERAT SCHULISCHER AUSTAUSCH<br />
USCH - FÖRDERUNG, BERATUNG, , FORTBILDUNG ......28<br />
ANHANG ..............................................................................................................29<br />
DIE „RUSSISCH KOMMT!“ - BOX .........................................................................29<br />
TO4KA-TREFF ................................................................................................30
1 Einleitung<br />
Seit Beginn der Fördertätigkeit im April 2006 hat das Referat<br />
Schulischer Austausch und Sprachförderung der <strong>Stiftung</strong><br />
Deutsch-Russischer Jugendaustausch Maßnahmen von mehr als<br />
300 Schulen aus allen Bundesländern gefördert. Im Mittelpunkt<br />
steht die Förderung von Begegnungen zwischen deutschen und<br />
russischen Schülerinnen, Schülern und Lehrkräften.<br />
Das Spektrum der Förderung im <strong>Programm</strong> A - Schulischer Aus-<br />
tausch reicht dabei vom klassischen Schüleraustausch über den<br />
Austausch<br />
von Lehrkräften bis hin zum projektorientierte<br />
ektorientierten Austausch von Schülerinnen und<br />
Schülern mit ganz unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten. Die Förderprogramme richten sich<br />
dabei an allgemeinbildende und berufliche Schulen.<br />
Meist in Folge von Gruppenreisen nutzen einige Schülerinnen und Schüler eine bestehende Schulpartnerschaft<br />
für längerfristige Gastschulaufenthalte, Sozial- oder Berufspraktika und können dafür eine<br />
Förderung der Reisekosten im <strong>Programm</strong> C – Gastschulaufenthalte und Berufspraktika beantragen.<br />
Auch wenn Russischkenntnisse keine Voraussetzung für erfolgreiche Schulpartnerschaften sind, engagiert<br />
sich die <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch in der Förderung und Stärkung der russischen<br />
Sprache. Im <strong>Programm</strong> B – Sprachförderung werden - Aktionstage, Spracholympiaden<br />
und Prüfungen zum russischen Sprachzertifikat TRKI unterstützt.<br />
neuer Schulpartnerschaften.<br />
Neben der Förderung berät das Referat Schulischer Austausch und<br />
Sprachförderung Schulen bei der Planung und Vorbereitung von<br />
Maßnahmen der <strong>Programm</strong>e A, B und C, führt<br />
Fortbildungsveranstaltungen tungen für Lehrkräfte aus dem gesamten<br />
Bundesgebiet durch und initiiert auch Lehrerinformationsreisen<br />
in<br />
Regionen Russlands, die bisher noch über wenig Partnerschaften mit<br />
deutschen Schulen verfügen. Ziele derartiger Reisen sind das<br />
Kennenlernen des heutigen, modernen Russlands, die Fortbildung in<br />
der Methodik und Dikatik des Russischunterrichts und die Gewinnung<br />
In der vorliegenden Broschüre werden die genannten Förderprogramme der <strong>Stiftung</strong> Deutsch-<br />
Russischer Jugendaustausch vorgestellt und erläutert. Auszüge aus Erfahrungsberichten und nützliche<br />
Tipps und Hinweise ergänzen die Ausschreibungen und Förderrichtlinien und geben somit Anregungen<br />
für die praktische Umsetzung der einzelnen <strong>Programm</strong>e. Weitere Informationen sowie Antragsformulare<br />
und Musterformulare finden Sie darüber hinaus auf der Homepage der <strong>Stiftung</strong> unter www.stiftungdrja.de<br />
.<br />
„Zusammenfassend ist mir durch den Schüleraustausch nachdrücklich deutlich geworden, dass es wohl keine<br />
geeignetere Form gibt, aufeinander zuzugehen, Brücken zum ehemals Fremden zu schlagen, und das, was die<br />
Lehrpläne „Interkulturelle Kompetenz" nennen, zielgerecht zu vermitteln. Als ich im Gespräch mit Schülern<br />
neulich erfuhr, dass diese nach wie vor mit ihren russischen Partnern in Kontakt stehen, und sogar gemeinsame<br />
Unternehmungen für die Zukunft planen, wurde mir klar, dass es sich nur um einen Abschied auf Zeit handelte<br />
und die Devise heißen muss: До новых встреч!“<br />
(Dominik Gläsner, Student und Teilnehmer am Schüleraustausch Dresden – St. Petersburg;<br />
Hans-Erlwein Gymnasium Dresden 2008)
2 Deutsch-russische Schulpartnerschaften – mehr als Schüleraustausch<br />
„Wenn der Schüleraustausch nur dazu dient, andere Städte und Kulturen, Sitten und Gebräuche kennenzulernen,<br />
ohne die größer gewordene Bedeutung von interkulturellem und grenzüberschreitendem Handeln und Gestalten<br />
deutlich werden zu lassen und dieses auch aktiv herausfordert, dann wird er den aktuellen Anforderungen der modernen,<br />
globalisierten Welt nicht gerecht.“<br />
(Impuls von Mathias Burghardt, Referent Schulischer Austausch bis Sommer 2009, auf einer Fortbildungsveranstaltung im<br />
Februar 2009)<br />
Sprache lernen<br />
Menschen kennen lernen<br />
Schüleraus-<br />
Kultur kennen lernen<br />
tausch<br />
Land kennen lernen<br />
Sich selbst kennen lernen<br />
voneinander lernen,<br />
miteinander lernen<br />
Gemeinsam Verantwortung<br />
übernehmen<br />
Gemeinsam handeln<br />
Gemeinsam verändern<br />
Gemeinsam Zukunft<br />
gestalten<br />
Während traditionell durchgeführte Schülerbegegnungen sich eher auf der linken Seite des Schemas<br />
abspielen, sollten deutsch-russische Schulpartnerschaften zukünftig den Rahmen für gemeinsame<br />
Aktivitäten der Schülerinnen und Schüler und auch der Lehrerkollegien bieten. Der traditionelle<br />
deutsch-russische Schüleraustausch, der vorrangig dem Erlernen der jeweils anderen Sprache und dem<br />
Kennenlernen der jeweils anderen Kultur dient und häufig in der alleinigen Verantwortung der Russisch-<br />
bzw. Deutschlehrkräfte liegt, muss sich zunehmend veränderten Rahmenbedingungen im Bildungsbereich<br />
stellen und auch neuen Anforderungen an interkulturelles Lernen gerecht werden. Unsere<br />
Angebote richten sich aber auch an Schulpartnerschaften – und solche, die es werden sollen – bei<br />
denen Russisch als Sprache nicht im Mittelpunkt steht.<br />
Im Zuge von Schulzeitverkürzung, Profiloberstufe und zentralen Prüfungen wird die für herkömmliche<br />
Austauschmaßnahmen zur Verfügung stehende Zeit weniger. Die Fahrt nach Russland steht zunehmend<br />
in Konkurrenz zu Projektwochen, Klassenreisen, Praktika und weiteren außerunterrichtlichen<br />
Aktivitäten und eine Abstimmung mit Klausurplänen und Prüfungszeiten wird immer schwieriger. Hinzu<br />
kommt die bereits angelaufene und weiter zunehmende Pensionierungswelle im Bildungsbereich,<br />
die unter Umständen auch dazu führen kann, dass mit der jahrelang im deutsch-russischen Kontext<br />
aktiven Lehrkraft auch der Schüleraustausch pensioniert wird. Berufseinsteiger, soweit es sie mit dem<br />
Fach Russisch oder mit einem besonderen Russlandinteresse überhaupt gibt, haben aufgrund geänderter<br />
Berufseinstiegsphasen und diverser anderer Verpflichtungen häufig nicht die Zeit, Schulpartnerschaften<br />
weiter zu pflegen oder gar neue aufzubauen.<br />
Auch in der Schule musste der Austausch vorbereitet werden. Hilfreich war das unkomplizierte Vorgehen unseres<br />
Schulleiters bei der Autorisierung von Lehrerzimmer-Aushängen, Freistellungen von Kolleginnen oder Genehmigungen<br />
außerhalb der Schule stattfindender Veranstaltungen. Da alle betreffenden Kollegen rechtzeitig und umfassend<br />
informiert waren, verlief die Teilnahme der russischen Schüler am Unterricht reibungslos.<br />
(Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg 2007)<br />
4
Gemeinsam sind wir stark!<br />
Die Bedeutung von interkultureller Kompetenz<br />
hat demgegenüber in den vergangenen Jahren<br />
zugenommen und wird mittlerweile in nahezu<br />
jedem Schulprogramm erwähnt. Durch Globalisierung<br />
und Internationalisierung auf dem<br />
Arbeitsmarkt und auch in der universitären<br />
Ausbildung gehören Mehrsprachigkeit und<br />
interkulturelles Denken und Handeln zu den<br />
Schlüsselqualifikationen für eine erfolgreiche<br />
berufliche Laufbahn. Je früher hier entsprechende<br />
Grundlagen gelegt werden und das<br />
Denken und Handeln im interkulturellen,<br />
deutsch-russischen Kontext eingeführt und<br />
gelernt wird, desto gewinnbringender kann es<br />
in der konkreten Auseinandersetzung mit aktuellen<br />
Themen und Fragestellungen praktiziert<br />
werden. Das Interkulturelle, das Deutsch-Russische sollte hierbei einen Rahmen darstellen, der<br />
den Akteuren, den Schülerinnen und Schülern und auch den Lehrkräften ausreichend Gestaltungsspielraum<br />
für kreatives Denken, Handeln und auch Erforschen lässt. Der Schüleraustausch ist also nicht das<br />
Ziel internationaler Schulkontakte, die Schulpartnerschaften bieten vielmehr den Rahmen für die gemeinsame<br />
Auseinandersetzung mit den Themen und Fragen unserer Zeit. Projekte und Begegnungen in<br />
derartig initiierten und gepflegten Schulpartnerschaften stehen dann auch nicht in Konkurrenz zu den<br />
oben genannten schulischen Veranstaltungen und Maßnahmen, sondern sind fester Bestandteil des<br />
Schulprogramms und je nach thematischer Ausrichtung der Projekte auch vereinbar mit den Rahmenplänen<br />
der beteiligten Fächer. Somit wächst die Akzeptanz innerhalb eines Kollegiums für Maßnahmen<br />
und Projekte mit der Partnerschule.<br />
Die Schulpartnerschaft bietet aber nicht nur für Schülerinnen und Schüler ein geeignetes Feld für Erfahrungen<br />
im interkulturellen Kontext, sondern auch für Lehrkräfte. Gegenseitige Hospitationen und<br />
gemeinsame Fortbildungsseminare im Rahmen eines Lehreraustausches (<strong>Programm</strong>linie A2) schärfen<br />
den Blick auf das methodisch-didaktische Handeln, insbesondere im Umgang mit Schülerinnen und<br />
Schülern mit Migrationshintergrund. Sie ermöglichen eine kritische Reflektion über den eigenen<br />
Schulalltag und geben Anregungen für die Entwicklung von Schule und Unterricht.<br />
Folgende Aspekte sollten bei der Gestaltung von Schulpartnerschaften beachtet werden:<br />
Stimmen Sie die Jahresplanung Ihrer Schule mit der Partnerschule ab. Projektzeiten können<br />
auch gemeinsam mit der Partnerschule geplant und durchgeführt werden.<br />
Motivieren Sie Fachkollegen, geplante Unterrichtseinheiten daraufhin zu prüfen, ob eine Kooperation<br />
mit der Partnerschule möglich und sinnvoll ist.<br />
Nutzen Sie einen Lehreraustausch, um die Rahmenpläne zu vergleichen und geeignete Themen<br />
für gemeinsame Projekte zu finden.<br />
Wenn eine Begegnung aus organisatorischen Gründen nicht möglich ist, kann ein Thema auch<br />
im Rahmen eines E-Mail-Projektes oder unter Nutzung eines Webportals bearbeitet werden (s.<br />
S. 30 f.).<br />
5
2.1 Schule – Partner - Partnerschule<br />
Zur Durchführung des Gegenbesuchs gehörten für uns die Treffen und Absprachen mit den Eltern der gastgebenden<br />
Schüler. Mit ihnen steht und fällt das Vorhaben. Deshalb wurden sie langfristig in die organisatorische<br />
Vorbereitung und die <strong>Programm</strong>absprachen einbezogen. Besonders hilfreich war ein auswertendes<br />
Treffen nach unserem Besuch in Sankt Petersburg, wo bei Tee und Selbstgebackenem über die frischen<br />
Erfahrungen berichtet wurde. Eine dieser hilfreichen Beobachtungen in den Gesprächen war es, den Altersunterschied<br />
der Teilnehmer bei einem Gegenbesuch unbedingt zu berücksichtigen. Ein anderer wichtiger<br />
Hinweis bezog sich auf die Beobachtung, dass wir in Sankt Petersburg sehr gut behütet, fast kontrolliert<br />
wurden. Unseren Gastgebern fiel es schwer, uns für zwei Stunden ohne Begleitung durch die Stadt oder ein<br />
Museum gehen zu lassen. Sie hatten sich darauf eingeschworen, uns jederzeit zu begleiten. Für unsere zu<br />
dem Zeitpunkt bereits volljährigen Schüler war es zunächst unverständlich, von ihren in Deutschland gewohnten<br />
Freiheiten Abstriche machen zu müssen. Nach Berichten unserer Gastgeber und im Austausch mit<br />
unseren Eltern konnten wir die Sorge der russischen Seite aber nachvollziehen und unsererseits für das<br />
Gegenprogramm entsprechend planen.<br />
(Albert-Einstein-Gymnasium Neubrandenburg 2007)<br />
Das Interesse russischer Bildungseinrichtungen an einer Partnerschaft mit einer deutschen Schule ist<br />
nach wie vor groß. An vielen Schulen in Russland wird Deutsch als Fremdsprache gelernt, nicht nur in<br />
den Metropolregionen von Moskau und St. Petersburg. Allerdings rücken auch andere Fremdsprachen<br />
mehr in den Vordergrund, so dass deutsch-russische Schulpartnerschaften für den Erhalt des Deutschunterrichts<br />
an russischen Schulen eine ähnliche Bedeutung haben, wie für die russische Sprache in<br />
Deutschland. Eine Voraussetzung dafür ist jedoch, dass die Schulen zu Partnern werden, die auf vielfältige<br />
Art und Weise ihre Zusammenarbeit gestalten.<br />
Eine Mehrheit der bereits bestehenden deutsch-russischen Schulpartnerschaften ist durch persönliche<br />
Kontakte einzelner Lehrkräfte entstanden und wird auch durch diese gepflegt und erhalten. Hierbei<br />
dienen die Begegnungen häufig der Förderung und Entwicklung der fremdsprachlichen Kompetenz der<br />
Schülerinnen und Schüler. Daher ist der Teilnehmerkreis bei Maßnahmen mit der Partnerschule häufig<br />
auf die Russischlehrkräfte und Russischlerner beschränkt.<br />
Bei anderen Kooperationen und Partnerschaften mit russischen Schulen steht die projektartige Beschäftigung<br />
mit historischen, künstlerischen, gesellschaftlichen, politischen, arbeitsweltbezogenen<br />
oder naturwissenschaftlichen Themen im Vordergrund. Hier sind häufig auch Lehrkräfte anderer Fächer<br />
beteiligt und Russisch- bzw. Deutschkenntnisse sind keine Voraussetzung für die Teilnahme an Schülerbegegnungen.<br />
Hängt die Zusammenarbeit mit einer russischen Schule lediglich von den persönlichen Kontakten einzelner<br />
Lehrkräfte ab, so besteht die Gefahr, dass die Kooperation endet, wenn die Lehrkraft die Schule<br />
verlässt. Schulen werden erst dann zu wirklichen Partnerschulen, wenn deren Kooperation auf unterschiedlichen<br />
Ebenen und in Verbindung mit mehreren Fächern stattfindet und durch die Unterstützung<br />
von weiten Teilen des Kollegiums geprägt ist. Dafür muss allerdings erst eine geeignete Partnerschule<br />
gefunden werden.<br />
6
2.2 Wie finde ich eine Partnerschule in Russland<br />
Es ist das erklärte Ziel der <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch, mehr deutsche Schulen für<br />
eine Partnerschaft mit einer russischen Schule zu interessieren. Durch Lehrerinformationsreisen und<br />
durch gezielte Vermittlung sollen hierbei besonders Regionen in Russland einbezogen werden, die<br />
jenseits der Metropolen liegen und bisher über wenig Kontakte zu deutschen Schulen verfügen.<br />
Schulen, die Interesse am Aufbau einer Partnerschaft mit einer russischen Schule haben, können sich<br />
an das Referat „Schulischer Austausch und Sprachförderung“ der <strong>Stiftung</strong> wenden.<br />
Auch im Internet findet man Unterstützung bei der Suche nach einer Partnerschule: Die Partnerbörse<br />
der <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch bietet Schulen die Möglichkeit, Suchanfragen für<br />
Partner oder Projektvorschläge online zu stellen, um potenzielle Partner in Deutschland oder Russland<br />
zu finden. Die Partnerbörse befindet sich auf unserer Homepage unter www.stiftungdrja.de/partnerboerse/.<br />
Außerdem hilft das Partnerschulnetz des Pädagogischen Austauschdienstes der Kultusministerkonferenz<br />
www.partnerschulnetz.de beim Finden einer Partnerschule.<br />
Daneben gibt es weitere Partnerbörsen, bei denen man nach passenden Schulen suchen oder ein Angebot<br />
bzw. Gesuch einstellen kann.<br />
7
2.3 Partnerstädte - Partnerschulen<br />
Ein weiteres Kriterium für die Auswahl einer russischen Partnerschule kann auch eine bereits bestehende<br />
regionale Partnerschaft sein. Viele Städte und auch Regionen haben Partnerstädte in Russland.<br />
Die Beziehungen werden für vielfältige politische, wirtschaftliche und kulturelle Kooperationsprojekte<br />
genutzt. Die städtepartnerschaftlichen Verbindungen können auch für Schulpartnerschaften<br />
von Vorteil sein:<br />
Schulische Maßnahmen stehen in einem anderen Kontext und können auf bereits bestehende<br />
außerschulische Verbindungen und sonstige Kooperationen zwischen den Partnerstädten zurückgreifen,<br />
die sich bewährt haben.<br />
Bei der Planung, Organisation und Durchführung von Schüler- und Lehrerbegegnungen können<br />
außerschulische Kooperationspartner mit einbezogen werden, die bereits über Erfahrung in<br />
der Zusammenarbeit mit der Partnerregion verfügen.<br />
Es entsteht eine stärkere Öffentlichkeitswirkung.<br />
Die Städtepartnerschaft kann auch unter dem Aspekt der finanziellen Förderung von Schulpartnerschaften<br />
von Vorteil sein, da für Projekte und Maßnahmen mit der russischen Partnerregion<br />
häufig ein Budget im Finanzplan der Region / der Stadt vorhanden ist.<br />
2.4 „Die Chemie muss stimmen!“<br />
Für den Aufbau und Erhalt einer Schulpartnerschaft sollten folgende Aspekte berücksichtigt werden:<br />
Führen Sie vor einer ersten Schülerbegegnung im Rahmen eines Lehreraustausches es eine Rei-<br />
se mit Kollegen Ihrer Schule und ggf. auch mit Schulleitungsmitgliedern zur Partnerschule<br />
durch und laden Sie auch eine Delegation der russischen Schule zu sich ein. Der Lehreraustausch<br />
kann zum gegenseitigen Kennenlernen von Schule und Umgebung und zur konkreten<br />
Festlegung von Rahmenbedingungen für die Schulpartnerschaft und für zukünftige Schülerbegegnungen<br />
genutzt werden. Kenntnisse über Schulform und -alltag und über die unterrichtlichen<br />
Voraussetzungen erleichtern die Planung von zukünftigen Begegnungen und Projekten.<br />
Darüber hinaus können derartige Informationsbesuche auch dem pädagogischen Meinungsaustausch<br />
und der interkulturellen Fortbildung dienen. In der Folge steigen die Akzeptanz<br />
der Schulpartnerschaft bei Schulleitung und Kollegium und die Bereitschaft für gemeinsame<br />
Maßnahmen und Projekte.<br />
Schließen Sie einen Partnerschaftsvertrag mit der Schule aus Russland, in dem alle Absprachen<br />
und Rahmenbedingungen für die zukünftige Kooperation verbindlich festgehalten werden.<br />
Der Vertrag sollte sowohl formale Aspekte des Gastgeberprinzips als auch inhaltliche<br />
Absprachen zur gemeinsamen <strong>Programm</strong>gestaltung und zur Projektarbeit enthalten. Der Abschluss<br />
eines Partnerschaftsvertrages kann im Rahmen einer kleinen schulischen Veranstaltung<br />
mit Einladung von Pressevertretern gefeiert werden. Einen Mustervertrag finden Sie im<br />
Leitfaden auf der Homepage der <strong>Stiftung</strong>.<br />
Achten Sie auf eine möglichst homogene Altersstruktur der Schülergruppen. Oft sind die russischen<br />
Schülerinnen und Schüler jünger als die deutschen Jugendlichen ihrer Partnerklassen.<br />
Das sollte vermieden werden. Für Oberstufengruppen kann es daher sinnvoll sein, eine<br />
Partnerschaft mit einer russischen Hochschule aufzubauen.<br />
„Die Chemie C<br />
muss stimmen“. Sprechen Sie Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten<br />
hinsichtlich der Gestaltung der Schulpartnerschaft offen mit den Projektverantwortlichen der<br />
russischen Schule an. Bei unüberwindbaren Differenzen hinsichtlich der Planung, Vorbereitung,<br />
Durchführung und auch inhaltlichen Zielsetzung von Schülerbegegnungen kann eine<br />
Partnerschaft auch beendet werden. Es gibt in Russland genügend Schulen, die sich eine<br />
Partnerschaft mit einer deutschen Schule wünschen.<br />
8
3 Finanzierung von deutsch-ru<br />
russischen<br />
Lehrer- und Schülerbegegnungen<br />
gen<br />
1. „Die empfangende Seite trägt alle Kosten für den Aufenthalt, insbesondere Unterkunft, Verpflegung<br />
sowie für schnelle und dringende medizinische Hilfe in Fällen, die ein umgehendes medizinisches<br />
Eingreifen erfordern. Sie trägt ebenfalls die Kosten für das <strong>Programm</strong> und gegebenenfalls<br />
für von ihr veranstaltete Reisen. (…).<br />
2. Die entsendende Seite trägt die Kosten für die Hinreise bis zum vereinbarten Bestimmungsort bei<br />
der empfangenden Seite und zurück.<br />
(Auszug aus dem Abkommen zwischen der Regierung der Bundesrepublik Deutschland und der Regierung<br />
der Russischen Föderation über jugendpolitische Zusammenarbeit aus dem Jahr 2004)<br />
Die Kostenaufteilung bei deutsch-russischen Lehrer- und Schülerbegegnungen ist in dem genannten<br />
Regierungsabkommen aus dem Jahr 2004 eindeutig geregelt, es gilt das Gastgeberprinzip. Jede Seite<br />
übernimmt die eigenen Reisekosten und sorgt für Unterbringung, Verpflegung und <strong>Programm</strong> während<br />
des Aufenthaltes der Gäste. Um die Aufenthaltskosten möglichst gering zu halten, erfolgt die Unterbringung<br />
in der Regel in Gastfamilien der aufnehmenden Schule. Da die Begegnungen im Rahmen von<br />
Schulpartnerschaften meist zusätzlich zu herkömmlichen Klassenreisen stattfinden und eine Reise<br />
nach Russland ihren Preis hat, sind derartige Maßnahmen häufig nur mit einer finanziellen Förderung<br />
zu realisieren. Bevor die Suche nach Fördermitteln beginnt, muss jedoch zunächst eine Kalkulation der<br />
zu erwartenden Kosten für die Reise nach Russland und/oder für den Besuch der russischen Gruppe in<br />
Deutschland erstellt werden. Folgende Kosten müssen kalkuliert werden:<br />
Kosten für die Reise nach Russland<br />
Visabeantragung, wenn diese durch einen<br />
Visadienst oder ein Reisebüro erfolgt.<br />
Im Konsulat / in der Botschaft<br />
sind die Visa für Lehrer- und Schüleraustausch<br />
gebührenfrei!<br />
An-/Abreise zum/vom Flughafen in<br />
Deutschland (falls notwendig)<br />
Flug / Bahnfahrt nach Russland<br />
An-/Abreise zum/vom Flughafen in<br />
Russland (falls notwendig)<br />
Auslandskrankenversicherung<br />
Reiserücktrittsversicherung<br />
Kosten für den Aufenthalt der russischen<br />
Gruppe in Deutschland<br />
Kranken-/Haftpflichtversicherung der<br />
Gäste (falls notwendig)<br />
Öffentliche Verkehrsmittel<br />
Verpflegung außerhalb der Gastfamilie<br />
<strong>Programm</strong>, Eintrittsgelder<br />
Projektmittel, Honorare<br />
Dokumentation<br />
Auf die Höhe der Kosten für die Reise nach Russland kann u. a. dadurch Einfluss genommen werden,<br />
dass die Buchung der Tickets möglichst frühzeitig erfolgt. Hierbei ist allerdings zu beachten, dass eine<br />
Förderung der Reisekosten durch die <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch nur möglich ist,<br />
wenn noch keine verbindliche Buchung von Tickets erfolgt ist.<br />
Die Kosten für die Begegnung in Deutschland sind sehr stark abhängig von der <strong>Programm</strong>gestaltung.<br />
Wie in Abschnitt 2 bereits angesprochen, sollte das gegenseitige Kennenlernen bei deutsch-russischen<br />
Schülerbegegnungen durch gemeinsame Aktivitäten und Aufgaben erreicht werden. Auch wenn die<br />
Erwartungshaltung (der russischen Lehrkräfte) zum Teil noch eine andere ist, sollte die deutschrussische<br />
Schülerbegegnung in Deutschland und auch in Russland vorrangig für gemeinsame Aktivitäten<br />
der beteiligten Schülerinnen und Schüler und für gemeinsamen Unterricht genutzt werden. Natürlich<br />
ist auch ein kulturelles Rahmenprogramm sinnvoll und notwendig, insbesondere dann, wenn die<br />
9
Schülerinnen und Schüler zum ersten Mal im jeweils anderen Land sind. Der touristische Teil sollte<br />
aber nur den Rahmen der Begegnung darstellen und der Besuch einer Sehenswürdigkeit oder eines<br />
Museums auch gemeinsam mit den jeweils gastgebenden Schülerinnen und Schülern erfolgen. Diese<br />
können beispielsweise die Führung vorbereiten und durchführen oder auch ein Ratespiel zum Kennenlernen<br />
der Heimatstadt erarbeiten (Stichwort: Stadtrallye). Ein rein touristisches <strong>Programm</strong> mit täglichen<br />
Ausflügen und Exkursionen, bei denen die Gäste auch noch alleine gelassen werden, widerspricht<br />
den grundlegenden Zielen von internationalen Schulpartnerschaften und ist auch nicht förderfähig.<br />
Es muss während der Begegnung jedoch auch nicht unbedingt projektartig gearbeitet werden. Das<br />
gemeinsame Erleben des Alltags, die Teilnahme am Unterricht, die private Freizeitgestaltung innerhalb<br />
der Gastfamilie bleiben häufig viel nachhaltiger in Erinnerung als der Besuch von zu vielen<br />
Sehenswürdigkeiten und Museen. Das zeigen die vielen Erfahrungsberichte, in denen die Schülerinnen<br />
und Schüler das im jeweils anderen Land Erlebte beschreiben und kommentieren.<br />
Aufgrund der vergleichsweise hohen Reisekosten bei einer Begegnung in Russland sind deutschrussische<br />
Schülerbegegnungen trotz sparsamer Kostenkalkulation meist nur mit einer Förderung zu<br />
realisieren.<br />
3.1 Die Förderung von Schulpartnerschaften haften ist Ländersache<br />
Die Förderung von internationalen Schulkontakten liegt zunächst im Verantwortungsbereich der Kultusministerien<br />
der Länder.<br />
Die für Austauschmaßnahmen zur Verfügung stehenden Fördermittel sowie die Richtlinien und das<br />
Antragsverfahren unterscheiden sich jedoch von Bundesland zu Bundesland. Um Fördermittel der Länder<br />
zu nutzen, empfehlen wir folgendes Vorgehen:<br />
Informieren Sie sich rechtzeitig bei der jeweiligen Länderstelle im Kultusministerium über<br />
die Fördermöglichkeiten des Landes für deutsch-russische Schulkontakte. Fragen Sie auch<br />
nach besonderen Budgets für eine eventuell vorhandene Partnerregion / -stadt in Russland.<br />
Die Fristen für Förderanträge an die zuständige Länderstelle liegen häufig am Ende eines Kalenderjahres<br />
(November, Dezember) für geplante Begegnungen im folgenden Kalenderjahr<br />
(nicht Schuljahr!). Dieses erfordert eine frühzeitige Planung der Schülerbegegnung.<br />
Stellen Sie in jedem Fall einen Antrag auf Förderung der von Ihnen geplanten Maßnahme bei<br />
der Länderstelle oder zumindest eine Anfrage. Die primäre Nutzung von Ländermitteln ist<br />
die Voraussetzung für eine Förderung durch die <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugend-<br />
austausch (Prinzip der Subsidiarität).<br />
Bei allen Maßnahmen, für die eine Länderförderung beantragt werden kann, fördert die <strong>Stiftung</strong> subsi-<br />
diär, d.h. zuerst sind Fördermittel beim Land zu beantragen und auszuschöpfen.<br />
Der Pädagogische Austauschdienst der Kultusministerkonferenz (PAD) www.pad-kmk.org verfügt<br />
als einzige Institution noch über Bundesmittel des Auswärtigen Amtes zur Förderung von Schulpartnerschaften.<br />
Aus dem Budget werden vorrangig die Reisekosten der russischen Teilnehmer, ein Taschengeld<br />
und Projektkosten unterstützt. Da die russischen Schulen trotz des oben zitierten Abkommens<br />
leider bisher keine Förderung für Schulpartnerschaften erhalten, ist es unter Umständen sinnvoll<br />
und notwendig, dass die deutschen Schulen einen Förderantrag an den PAD richten, um so zu gewährleisten,<br />
dass die Teilnahmemöglichkeit russischer Schülerinnen und Schüler nicht ausschließlich von<br />
der privaten finanziellen Situation abhängig ist. Auch beim PAD gibt es eine jährliche Antragsfrist, die<br />
eingehalten werden muss.<br />
Informieren Sie außerdem Ihre Schulleitung über eine geplante Maßnahme mit der russischen Partnerschule.<br />
In einigen Bundesländern verfügen die Schulen über ein Budget für internationale Schulkontakte.<br />
10
Wenn zusätzlich zu der o. a. Förderung noch Fördermittel benötigt werden oder auch bei Maßnahmen,<br />
für die keine Länderförderung möglich ist, steht die <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch<br />
mit ihrem Förderreferat „Schulischer Austausch und Sprachförderung“ zur Verfügung.<br />
3.2 Schulische Förderprogramme der <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugend-<br />
austausch<br />
Die <strong>Stiftung</strong> ist angetreten, deutschlandweit möglichst vielen Jugendlichen die Möglichkeit zu eröffnen,<br />
sich im Rahmen eines schulischen, außerschulischen oder beruflichen Austausches, sei es in einer<br />
Gruppe oder individuell, ein eigenes Bild von Russland, seinen Menschen und seiner Kultur zu machen.<br />
Mit diesem Anspruch wurden seit Gründung der <strong>Stiftung</strong> im Jahre 2006 für den schulischen Bereich<br />
<strong>Programm</strong>e entwickelt und etabliert, über die mehr als 15.000 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte<br />
(Stand August 2009) in den Genuss einer Förderung durch die <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch<br />
kamen. Und die Nachfrage nach Schüleraustausch mit Russland steigt erfreulicherweise<br />
weiter an. Finanziert wurden und werden diese <strong>Programm</strong>e überwiegend aus Mitteln der <strong>Robert</strong><br />
<strong>Bosch</strong> <strong>Stiftung</strong> und aus Erträgen der durch den Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft eingeworbenen<br />
Beteiligung der deutschen Wirtschaft am <strong>Stiftung</strong>skapital.<br />
Um auch zukünftig in der Breite fördernd tätig sein zu können, müssen angesichts des stetig wachsenden<br />
Antragsvolumens verstärkt andere Finanzmittel erschlossen werden. Deshalb fördert die <strong>Stiftung</strong><br />
ab 2010 subsidiär zum Länderengagement, das heißt zuerst müssen Fördermittel beim Land beantragt<br />
werden (s. Kapitel 3.1).<br />
11
Das <strong>Programm</strong>portfolio „Schulischer Austausch und Sprachförderung“ umfasst folgende <strong>Programm</strong>e<br />
und <strong>Programm</strong>linien:<br />
Schulischer Austausch und Sprachförderung<br />
<strong>Programm</strong> A<br />
<strong>Programm</strong>linie A1<br />
Schüleraustausch<br />
<strong>Programm</strong> A<br />
<strong>Programm</strong>linie A2<br />
Lehreraustausch<br />
<strong>Programm</strong> A<br />
<strong>Programm</strong>linie A3<br />
Projektorientierter<br />
Austausch<br />
<strong>Programm</strong> B<br />
<strong>Programm</strong>linie B1<br />
„Russisch kommt!“ -<br />
Aktionstage<br />
<strong>Programm</strong> B<br />
<strong>Programm</strong>linie B2<br />
Russisch – Spracholympiaden<br />
<strong>Programm</strong> B<br />
<strong>Programm</strong>linie B3<br />
Sprachzertifikat<br />
Russisch<br />
<strong>Programm</strong> C<br />
<strong>Programm</strong>linie C2<br />
Individueller<br />
Gastschulaufenthalt<br />
<strong>Programm</strong> C<br />
<strong>Programm</strong>linie C3<br />
Berufspraktikum in<br />
Russland<br />
Im Folgenden werden die aktuellen <strong>Programm</strong>linien mit Fördersätzen und Richtlinien vorgestellt und<br />
erläutert.<br />
12
3.3 <strong>Programm</strong> A: Schulischer Austausch<br />
Das <strong>Programm</strong> A umfasst Schüler- und Lehreraustausch, der im Rahmen einer bestehenden oder aufzubauenden<br />
Schulpartnerschaft durchgeführt wird. In der folgenden Tabelle sind die Fördersätze und<br />
Richtlinien für <strong>Programm</strong> A dargestellt:<br />
<strong>Programm</strong>linie A1<br />
Schüleraustausch<br />
<strong>Programm</strong>linie A2<br />
Lehreraustausch<br />
<strong>Programm</strong>linie A3<br />
Projektorientierter<br />
Austausch<br />
Fördersätze bei<br />
Begegnungen<br />
gen<br />
in Russland<br />
Unter Berücksichtigung des o. g. Subsidiaritätsprinzips kann eine Förderung von bis zu 50% der<br />
Reisekosten (Flugzeug, Bus, Bahn) für die Reise nach Russland und zurück für Gruppen bis max.<br />
25 Schüler und 2 Lehrkräfte<br />
durch die <strong>Stiftung</strong> DRJA erfolgen.<br />
Förderung von bis zu 1.000<br />
Euro der Projektkosten.<br />
Fördersätze bei<br />
Begegnungen<br />
in Deutschland<br />
Bei der Förderung der <strong>Programm</strong>kosten in Deutschland wird eine <strong>Programm</strong>kostenpauschale<br />
von 4,00 € pro Teilnehmer und Tag für die deutsche und die russische Seite zugrunde ge-g<br />
legt. Auch hier gilt das Subsidiaritätsprinzip, nach dem die antragstellende Schule zu-<br />
z<br />
nächst eine Förderung beim Land beantragt. Erfolgt t keine oder eine geringere Förderung<br />
durch das Land, kann die sich ergebende e Differenz zum o.g. Fördersatz von 4,00 € bei der<br />
<strong>Stiftung</strong> beantragt b<br />
werden. . Bereits bewilligte Maßnahmen sind davon nicht betroffen.<br />
Förderung von bis zu 1.000<br />
Euro der Proje<br />
jektkosten.<br />
Die Gesamtfördersumme für je eine Austauschreise nach Russland und eine Begegnung in Deutschland beträgt<br />
maximal 5.000,00 €.<br />
Nicht gefördert<br />
werden<br />
Mögliche An-<br />
A<br />
tragsteller<br />
ler<br />
Antragsfrist<br />
Anträge sollten unter Verwendung des entsprechenden Formulars mit <strong>Programm</strong>skizze und Kostenplan<br />
bis spätestens 3 Monate vor der Begegnung bei der <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch<br />
eingereicht werden, in jedem Fall jedoch vor der verbindlichen Buchung von<br />
Flugtickets oder Fahrkarten. Eine Entscheidung erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang.<br />
Grundlegende<br />
Förderbedin-<br />
gungen<br />
Nachweise /<br />
Abrechnungen<br />
Kosten, die bereits vor der Bewilligung des Antrages entstanden sind, dieses gilt auch für<br />
Frühbuchungen von Flugtickets;<br />
Kosten, die außerhalb des von der <strong>Stiftung</strong> festgelegten Bewilligungszeitraumes entstehen;<br />
Visagebühren, da diese bei Maßnahmen im deutsch-russischen Jugendaustausch nicht<br />
erhoben werden;<br />
Reisekosten der russischen Teilnehmer, da hierfür die russische Seite zuständig ist;<br />
<strong>Programm</strong>kosten in Russland, da hierfür die russische Seite zuständig ist;<br />
Reisen mit überwiegend touristischem Charakter.<br />
Antragsteller können allgemeinbildende und berufsbildende Schulen sein, die im Rahmen ihrer<br />
Schulprogrammentwicklung Interesse am Aufbau intensiver Kontakte zu einer russischen Schule<br />
mit dem Ziel einer Schulpartnerschaft haben. Auch Schulen mit einer bereits bestehenden<br />
Schulpartnerschaft können im Rahmen aller drei <strong>Programm</strong>linien eine Förderung erhalten.<br />
Unterbringung in Gastfamilien (begründete Ausnahmen möglich);<br />
Die Begegnung und das gemeinsame Erleben und Handeln stehen im Vordergrund.<br />
Abrechnung und Dokumentation der Maßnahme erfolgen auf Formularen, die mit der Bewilligung<br />
zugeschickt werden.<br />
13
3.3.1 <strong>Programm</strong>linie A1: Schüleraustausch<br />
Mit der <strong>Programm</strong>linie A1 – Schüleraustausch<br />
fördert die <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch<br />
aus Mitteln der <strong>Robert</strong> <strong>Bosch</strong> <strong>Stiftung</strong><br />
Schülerbegegnungen, die das gegenseitige<br />
Kennenlernen und die Auseinandersetzung mit dem<br />
jeweils anderen Land fördern wollen. Die<br />
Schülerinnen und Schüler sollen dabei ausreichend<br />
Gelegenheit bekommen, Alltag, Schule, Unterricht<br />
bzw. Arbeitswelt und Freizeitverhalten der<br />
gastgebenden Seite zu erleben und einen Einblick in<br />
die kulturellen Besonderheiten des Landes und der<br />
jeweiligen Region zu bekommen. Besteht die Gruppe<br />
aus Russisch- bzw. Deutschlernern, so dienen die<br />
Begegnungen auch der praktischen Anwendung und<br />
der Erweiterung der Fremdsprachenkenntnisse.<br />
Ziele:<br />
Ein Schüleraustausch soll den Schülerinnen und Schülern:<br />
einen Einblick in die geographischen, sozialen und gesellschaftlichen Besonderheiten der<br />
jeweils besuchten Region geben;<br />
einen umfangreichen Einblick in die Schule und den Unterricht des Gastlandes bieten, der<br />
zu einer kritischen Reflektion des eigenen Schul- bzw. Ausbildungsalltags anregt;<br />
ausreichend Gelegenheit geben, das Alltagsleben in der Gastfamilie kennen zu lernen;<br />
Anregungen für weitere individuelle Aufenthalte im Land / an der Partnerschule liefern (s.<br />
<strong>Programm</strong> C)<br />
eine Erweiterung ihrer Fremdsprachenkenntnisse ermöglichen<br />
Bei unserem Besuch in Moskau erleben die deutschen Schüler/innen Schulunterricht in russischer Sprache in allen<br />
Schulfächern. Sie wohnen in russischen Familien und erhalten auf diese Art einen Einblick in das russische Alltagsleben<br />
und bauen evtl. bestehende Vorurteile ab.<br />
Sie lernen die Stadt Moskau mit ihren kulturellen Sehenswürdigkeiten und Besonderheiten kennen und besuchen<br />
neben den bekannten Sehenswürdigkeiten wie Kreml, Roter Platz und Tretjakow Galerie auch verschiedene Wissenschaftsstandorte<br />
sowie das neue Stadtgebiet Moscow City. Besuche des volkskundlichen Museums sowie einer<br />
volkskundlichen Theateraufführung vertiefen die Eindrücke vom Leben in Russland. Über die Situation der Kirche<br />
in Russland erfahren die Schüler viel Wissenswertes bei Besuchen einer Synagoge, einer Moschee und des Gottesdienstes<br />
in der russischen Kirche.<br />
Ganz nebenher verbessern die Schüler/innen ihre Sprachkenntnisse und werden zum Weiterlernen motiviert, indem<br />
sie erfahren, dass die russische Sprache nicht nur Unterrichtsfach – sondern Kommunikationsmittel von Millionen<br />
von Menschen ist.<br />
(Martina Kammerer, Fanny-Leicht-Gymnasium Stuttgart-Vaihingen 2009)<br />
14
Die beteiligten Lehrkräfte sollten den Aufenthalt an der Partnerschule dafür nutzen, sich mit den Kolleginnen<br />
und Kollegen über die zukünftige Gestaltung der Partnerschaft auszutauschen und ggf. auch<br />
Möglichkeiten einer projektartigen Zusammenarbeit zu besprechen. Sinnvoll kann in diesem Zusammenhang<br />
auch das Aufsuchen außerschulischer Lernorte sein, die für zukünftige Projekte geeignet<br />
sind.<br />
Die <strong>Programm</strong>gestaltung sollte unbedingt vorher mit den russischen Lehrkräften abgestimmt werden.<br />
In dem Bestreben, den Gästen möglichst viele der regionalen Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten<br />
zu zeigen, werden häufig sehr umfangreiche Besuchsprogramme vorbereitet, an denen unter anderem<br />
auch aus finanziellen Gründen zum Teil nur die Gäste teilnehmen. Derartige <strong>Programm</strong>e entsprechen<br />
jedoch nicht der Zielsetzung von internationalen Schülerbegegnungen und werden von den betroffenen<br />
Schülergruppen auch kritisch beurteilt, wie eine Reihe von Berichten zeigt.<br />
Für die <strong>Programm</strong>gestaltung bei einem<br />
Schüleraustausch sollten folgende Grundregeln beachtet<br />
werden:<br />
Eine Schülerbegegnung mit Unterbringung in Gastfamilien ist keine Klassenreise. Die<br />
Teilnehmer sollen möglichst viel Zeit mit ihren Gastgebern in der Schule und im Alltag<br />
verbringen.<br />
<strong>Programm</strong>punkte in der Gruppe sind nur sinnvoll und den Zielen der Begegnung förderlich,<br />
wenn Gastgeber und Gäste gemeinsam teilnehmen.<br />
„Weniger ist häufig mehr“ – das kulturelle Besichtigungsprogramm gibt der Begegnung<br />
den Rahmen und steht nicht im Zentrum. Im Zentrum steht das gemeinsame Erleben<br />
von Schule und Alltag.<br />
Die Erfahrungen der vergangenen Jahre zeigen, dass eine derart ausgerichtete <strong>Programm</strong>gestaltung<br />
noch nicht selbstverständlich ist. Zum Teil wird kaum Zeit für gemeinsame Unternehmungen der jeweiligen<br />
Partnerschüler eingeplant und auch der gemeinsame Unterrichtsbesuch beschränkt sich auf eine<br />
extra initiierte Unterrichtsstunde. Für Schülerinnen und Schüler, die das erste Mal in Deutschland / in<br />
Russland sind, darf ein Besichtigungsprogramm von Kulturdenkmälern und besonderen Stätten natürlich<br />
nicht ganz fehlen. Allerdings kann die Aufgabe „Ich zeige dir meine Stadt“ auch mehr in die Verantwortung<br />
der Schülerinnen und Schüler gelegt werden, so dass Besichtigungen zu zweit oder in<br />
Kleingruppen organisiert werden.<br />
Eine derartige <strong>Programm</strong>gestaltung steigert die Schüleraktivität in der Vorbereitung der Begegnung<br />
und setzt eine enge Abstimmung mit der Partnerschule voraus. Im Zeitalter von E-Mail und Internet ist<br />
die Kommunikation mit den russischen Lehrkräften schon wesentlich einfacher geworden. Eine persönliche<br />
Begegnung zur Planung, Vorbereitung und Gestaltung von Maßnahmen im Rahmen einer<br />
Schulpartnerschaft kann dadurch aber nicht ersetzt werden. Hierfür kann ein Lehreraustausch der <strong>Programm</strong>linie<br />
A2 genutzt werden, bei dem Lehrkräfte und auch Schulleitungsmitglieder die Möglichkeit<br />
haben, sich ohne ihre Schülerinnen und Schüler kennenzulernen und Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaft<br />
abzustimmen und vorzubereiten.<br />
15
3.3.2 <strong>Programm</strong>linie A2: Lehreraustausch<br />
Für die Anbahnung und auch den Erhalt und die<br />
Weiterentwicklung von deutsch-russischen Schulpartnerschaften,<br />
die neben dem gegenseitigen Kennenlernen auch<br />
eine inhaltliche, projektorientierte Ausrichtung haben sollten,<br />
sind vorbereitende Maßnahmen auf der Ebene der<br />
verantwortlichen Lehrkräfte und ggf. auch Schulleitungen in<br />
Form eines Lehreraustausches notwendig und sinnvoll. Hierbei<br />
sollen nicht nur Russischlehrkräfte angesprochen werden,<br />
sondern gerade auch Lehrkräfte anderer Fächer, die Interesse an<br />
projektorientierten Schülerbegegnungen haben. Die<br />
Partnerschule in Russland wird in der Regel eine Schule mit<br />
Deutschunterricht sein und die teilnehmenden Lehrkräfte sollen<br />
über Deutschkenntnisse, mindestens jedoch über<br />
Englischkenntnisse verfügen.<br />
Im beruflichen Bereich muss die Frage von Fremdsprachenkenntnissen<br />
auf beiden Seiten besonders sorgfältig geprüft<br />
werden. Die Relevanz hängt dabei natürlich auch von der Fachrichtung ab. So ist z.B. bei kaufmännischen<br />
Bereichen Sprachverständigung elementar, hingegen bei handwerklich-technischen Ausrichtungen<br />
etwas weniger bedeutsam.<br />
Ziele:<br />
Der Lehreraustausch dient dem Auf- oder Ausbau einer Schulpartnerschaft und zur Anbahnung von<br />
projektorientierten Schülerbegegnungen. Er soll:<br />
einen Erstkontakt und ein persönliches Kennenlernen zwischen den verantwortlichen<br />
Lehrkräften und ggf. Schulleitungen einer deutschen und einer russischen Schule ermöglichen,<br />
wobei es sich nicht vorrangig um Fremdsprachenlehrer handeln muss;<br />
einen Einblick in die geographischen, sozialen und gesellschaftlichen Besonderheiten<br />
der jeweils besuchten Region geben;<br />
einen Überblick über das jeweilige Bildungssystem im Allgemeinen und über die jeweils<br />
besuchte Schule im Besonderen liefern;<br />
Ideen und erste konkrete Absprachen für nachfolgende (projektorientierte) Schülerbegegnungen<br />
hervorbringen.<br />
Zwei Russischlehrerinnen des Staatlichen Spezialgymnasiums für Sprachen „Salzmannschule“ in<br />
Schnepfenthal reisten vom 20. bis 25. November 2008 nach Rostow/Don in Russland. Ziel dieser Reise<br />
war es, die Grundsteine für eine Schulpartnerschaft mit dem „Lyzeum der staatlichen Bauuniversität<br />
Rostow/Don“ zu legen. Die Direktorin der Schule, Soja Wasiljewna Bondarjenko, der Rektor der<br />
Universität sowie das gesamte Lehrerkollegium des Lyzeums zeigten sich sehr interessiert und hießen<br />
die deutschen Kollegen herzlich willkommen (…). Des Weiteren nahmen sie an verschiedenen Unterrichtseinheiten<br />
teil (russische Literatur, Sprache, Morphologie, Englisch). Erfahrungen wurden ausgetauscht<br />
hinsichtlich Lehrmaterialien und Unterrichtsmethodik. (…) Im September 2009 wird die<br />
Direktorin des Lyzeums nach Schnepfenthal kommen, um das Spezialgymnasium und die Region kennenzulernen.<br />
Im Anschluss daran werden weitere Projekte geplant und ein Schulpartnerschaftsvertrag<br />
abgeschlossen.<br />
Salzmannschule, Spezialgymnasium für Sprachen, Waltershausen<br />
16
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Partnerschulen ist bei der Planung von besonderer<br />
Bedeutung. Ein gegenseitiges persönliches Kennenlernen der für die Begegnung verantwortlichen<br />
Lehrkräfte, aber auch der Schulleitungen und weiterer Mitglieder des Kollegiums erleichtert die Kooperation<br />
und erhöht das Verständnis für Begegnungen mit der Partnerschule und damit immer auch verbundenen<br />
Beeinträchtigungen des Unterrichtsalltags.<br />
Ein Lehreraustausch kann auch dafür genutzt werden, die jeweilige Vor- und Nachbereitung von Projektorientiertem<br />
Schüleraustausch gemeinsam, im deutsch-russischen Lehrerteam, zu gestalten und<br />
durchzuführen.<br />
Folgende Aspekte sollten bei der Planung eines Lehreraustausches bedacht werden:<br />
Um den Unterrichtsausfall so gering wie möglich zu halten, sollte ein Teil der Reise nach<br />
Russland in die Ferien gelegt werden. Es bieten sich hier die Herbst- oder Frühjahrsferien<br />
an, da zu der Zeit in Russland keine Schulferien sind.<br />
Es ist ratsam mindestens ein Mitglied der Schulleitung und auch Lehrkräfte anderer Fächer<br />
als Russisch für einen Lehreraustausch zu motivieren. So steigt die Akzeptanz der<br />
Schulpartnerschaft.<br />
Die Begegnung sollte auch immer für einen Meinungsaustausch / für eine Fortbildung zu<br />
einem methodisch-didaktischen Thema oder zu Fragen der Schulentwicklung genutzt<br />
werden. Hier können beide Seiten viel voneinander lernen.<br />
Die Erfahrungen und Ergebnisse eines Lehreraustausches können im Rahmen einer Konferenz<br />
oder eines Informationsabends dem Kollegium und auch interessierten Schülerinnen<br />
und Schülern und Eltern präsentiert werden. Mit einem kleinen Imbiss aus der russischen<br />
Küche oder etwas russischer Musik wird daraus eine Russisch kommt! – Veranstaltung<br />
der besonderen Art (s. <strong>Programm</strong> B).<br />
17
3.3.3 <strong>Programm</strong>linie A3: Projektorientierter Austausch<br />
Nahezu die Hälfte aller durch die <strong>Stiftung</strong><br />
Deutsch-Russischer Jugendaustausch geförderten<br />
Schülerbegegnungen findet im Rahmen eines<br />
Projektorientierten Austausches mit einem<br />
thematischen oder künstlerischen Schwerpunkt<br />
statt. Die inhaltliche Vor- und Nachbereitung ist<br />
dann Bestandteil des (Russisch-/Deutsch-/Fach-)<br />
Unterrichts an der jeweiligen Schule, nicht selten<br />
auch unter Einbeziehung weiterer nicht direkt an<br />
dem Austausch beteiligter Lehrkräfte. Die<br />
Begegnungen in Deutschland und Russland<br />
werden dann für das gemeinsame Bearbeiten eines<br />
historischen, politischen, gesellschaftlichen,<br />
beruflichen oder naturwissenschaftlichen Themas oder auch für das Einüben und Aufführen eines<br />
Theaterstückes genutzt. Das gegenseitige Kennenlernen erfolgt durch den Aufenthalt in der Gastfamilie<br />
und durch gemeinsame Unternehmungen im kulturellen Rahmenprogramm. Die gemeinsame Projektarbeit<br />
offenbart Unterschiede in Herangehensweise und Arbeitmethode, erfordert tolerantes Verhalten<br />
in Gruppenarbeitsphasen und Teamfähigkeit bei Präsentationen und Aufführungen. Die immer<br />
noch vorhandene Unterschiedlichkeit in der Ziel- und Schwerpunktsetzung der jeweiligen nationalen<br />
Bildungssysteme wirkt sich gewinnbringend auf gemeinsame Projekte aus.<br />
Was ist ein Projektorientierter Austausch<br />
Ein Projektorientierter Austausch ist grundsätzlich eine Schülerbegegnung mit einem thematischen<br />
Schwerpunkt. Zum Projekt gehören die inhaltliche Vorbereitung, die gemeinsame Projektarbeit am Ort<br />
der deutschen und/oder am Ort der russischen Schule (in Ausnahmefällen an einem dritten Ort) sowie<br />
die Nachbereitung. Die gemeinsame Projektarbeit und die Nachbereitung sollten nach Möglichkeit<br />
innerhalb eines Schuljahres stattfinden.<br />
Ziele der Projektarbeit:<br />
Ziele projektbezogener Arbeit sind neben der inhaltlichen Auseinandersetzung die gemeinsame intensive<br />
Beschäftigung mit dem jeweils anderen Land und das Kennenlernen und Erleben der anderen Kultur<br />
und Sprache. Durch die gemeinsame Arbeit an einem konkreten Projekt soll außerdem eigenverantwortliches<br />
und zielgerichtetes Handeln der Schülerinnen und Schüler an einem selbst gewählten<br />
Thema im interkulturellen Kontext gestärkt werden.<br />
… und dann soll ich auch noch ein Projekt machen.<br />
(Russisch-) Lehrkräfte, die bisher die in <strong>Programm</strong>linie<br />
A1 beschriebenen Schülerbegegnungen planen,<br />
vorbereiten und durchführen, sehen eine projektartige<br />
Begegnung häufig als zusätzliche Aufgabe an,<br />
die sie angesichts der ohnehin schon hohen Belastung<br />
und Verantwortung bei deutsch-russischen<br />
Schülerbegegnungen nicht auch noch übernehmen<br />
möchten. Folgen wir dem in Abschnitt 1 erläuterten<br />
Verständnis von Schulpartnerschaften und deren<br />
sinnvoller Gestaltung, so ist das projektorientierte<br />
Arbeiten während einer Begegnung kein zusätzlicher<br />
<strong>Programm</strong>punkt , sondern sollte sich zukünftig zum<br />
Anlass für Maßnahmen im Rahmen der Schulpartnerschaft entwickeln. Es ist auch nicht die Aufgabe<br />
18
der für den Austausch verantwortlichen Lehrkraft, sich ein Thema für einen projektorientierten Austausch<br />
auszudenken. Projektthemen sollten normalerweise von den Schülerinnen und Schülern vorgeschlagen<br />
werden und sich im besten Fall an Projekttagen in der Schule oder aktuellen Fragen und<br />
Problemstellungen orientieren, die die globale Entwicklung oder die deutsch-russischen Beziehungen<br />
betreffen. Der Themenvielfalt sind hierbei keine Grenzen gesetzt.<br />
Geschichte<br />
Sprache,<br />
Literatur<br />
Politik,<br />
Gesellschaft,<br />
Geographie<br />
Regionale<br />
Partnerschaft<br />
Projekt-<br />
Thema<br />
Sport,<br />
Freizeit<br />
Theater,<br />
Kunst,<br />
Musik<br />
Naturwissenschaft<br />
Ausbildung,<br />
Beruf<br />
Die Nutzung der Schulpartnerschaft zur praxisorientierten Unterstützung des Fachunterrichts sollte<br />
dem Kollegium auf einer Konferenz vorgestellt und auch mit der russischen Schule abgestimmt werden.<br />
Hierfür kann unter anderem der in der <strong>Programm</strong>linie A2 beschriebene Lehreraustausch für Lehrkräfte<br />
einen geeigneten Rahmen bieten.<br />
Anregungen für die konkrete Durchführung der Projekte finden Sie unter anderem in der Projektdatenbank<br />
auf der Seite unserer <strong>Stiftung</strong>.<br />
Die Umsetzung bzw. Dokumentation eines Projekts kann z.B. erfolgen durch:<br />
Zeitungsberichte, gemeinsame Ausgaben der Schülerzeitungen;<br />
Internet-Dokumentation / gemeinsame Internetseite;<br />
Fotoausstellungen, Videos oder Filme;<br />
Theateraufführungen;<br />
Aufnahme von Interviews mit Passanten, Zeitzeugen, Persönlichkeiten.<br />
Darüber hinaus erhalten alle Bewilligungsempfänger die Möglichkeit, ihr Projekt in der Projektdatenbank<br />
auf der Homepage der <strong>Stiftung</strong> zu veröffentlichen und Fotos und Berichte zu präsentieren. Eine<br />
Plattform für die Dokumentation von Projekten, für die Kommunikation während der Vor- und Nachbereitung<br />
und auch für den Einsatz im Deutsch- bzw. Russischunterricht bietet das deutsch-russische<br />
Jugendwebportal www.to4ka-treff.de (s. hierzu auch S. 30 f.).<br />
19
Projektkosten<br />
Projektkosten sind keine <strong>Programm</strong>kosten. Das bedeutet, dass wirklich nur solche Kosten, die in<br />
direktem Zusammenhang mit dem Projekt entstehen, gefördert werden können. Dies gilt insbesondere<br />
für den Besuch von Museen, Ausstellungen, Führungen oder Exkursionen. So kann bei einem historischen<br />
Projekt natürlich der gemeinsame Besuch einer Gedenkstätte abgerechnet werden, jedoch nicht<br />
eine allgemeine Stadtrundfahrt. Wichtig ist außerdem, dass die Kosten innerhalb des Bewilligungszeitraums<br />
anfallen. Kosten für Gastgeschenke können in keinem Fall gefördert werden.<br />
Eine Dokumentation der Projektergebnisse, in der diese für die Öffentlichkeit aufbereitet werden, ist<br />
sehr im Sinne der <strong>Stiftung</strong>. Entsprechende Mittel sind also bei der Kostenaufstellung einzuplanen.<br />
… Am nächsten Tag stand eine ausgiebige Stadtrundfahrt auf dem <strong>Programm</strong>, wo alle Facetten einer Millionenstadt<br />
mit all ihrer Schönheit aber auch all ihren ökologischen Problemen einer Stadt am „Meer“ und am<br />
Fluss Neva angeschaut werden konnte. …<br />
Der Unterrichtsbesuch am Samstag hatte wiederum ökologische Aspekte: Im Chemie-Unterricht wurden mehrere<br />
Wasserproben aus Düren, die von uns mitgebracht worden waren, und aus St. Petersburg untersucht und verglichen.<br />
(Gymnasium am Wirteltor in Düren mit der Schule 309 in St. Petersburg 2008)<br />
20
4 <strong>Programm</strong> B: Sprachförderung<br />
Neben der Unterstützung von schulischem Austausch werden<br />
gemäß dem Regierungsabkommen über jugendpolitische<br />
Zusammenarbeit auch Veranstaltungen zum Erlernen und zur<br />
Vertiefung der Kenntnisse der russischen Sprache in der<br />
Bundesrepublik Deutschland und Informationsveranstaltungen<br />
über Russland initiiert und gefördert. Mit dem<br />
<strong>Programm</strong> „Sprachförderung“ initiiert und unterstützt die<br />
<strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch Veranstaltungen,<br />
die das Interesse an der russischen Sprache und an<br />
Russland wecken sollen. Ziele dieses <strong>Programm</strong>s sind die<br />
bundesweite Institutionalisierung eines Informationskonzeptes<br />
nach dem Muster von „Russisch kommt!“-<br />
Aktionstagen und die Förderung von Wettbewerben in der<br />
russischen Sprache, Literatur und Landeskunde. Dabei sollen<br />
Kooperationen von schulischen und außerschulischen<br />
Institutionen besonders berücksichtigt werden. Im<br />
Folgenden werden die grundlegenden Fördersätze und<br />
Richtlinien dargestellt:<br />
Fördersätze<br />
Nicht geför-<br />
dert werden<br />
Mögliche An-<br />
A<br />
tragsteller<br />
ler<br />
Antragsfrist<br />
Grundlegende<br />
Förderbedi<br />
din-<br />
gungen<br />
Nachweise /<br />
Abrechnunn-<br />
gen<br />
<strong>Programm</strong>linie B1<br />
„Russisch kommt!“ –<br />
Aktionstag<br />
tage<br />
Bis zu 1.000,00 Euro für<br />
Sach- und Honorarkosten.<br />
<strong>Programm</strong>linie B2<br />
Russisch-<br />
Spracholympiaden<br />
Bis zu 1.500,00 Euro für<br />
Sach- und Honorarkosten.<br />
<strong>Programm</strong>linie B3<br />
Sprachzertifikat<br />
Russisch<br />
Bis zu 1.500,00 Euro<br />
für Sach- und Honorarkosten.<br />
Kosten, die bereits vor der Bewilligung des Antrages entstanden sind;<br />
Kosten, die außerhalb des von der <strong>Stiftung</strong> festgelegten Bewilligungszeitraumes<br />
entstehen<br />
Antragsteller kann eine allgemeinbildende oder berufsbildende Schule, ein Lehrerverband<br />
oder eine Jugendorganisation sein, die/der die Federführung bei der Vorbereitung<br />
und Durchführung einer Maßnahme im <strong>Programm</strong> B übernimmt. Die Beteiligung einer<br />
Schule ist Voraussetzung für die Förderung.<br />
Anträge sollten unter Verwendung des entsprechenden Formulars mit <strong>Programm</strong>skizze<br />
und Kostenplan bis spätestens tens 3 Monate vor der Veranstaltung bei der <strong>Stiftung</strong><br />
Deutsch-Russischer Jugendaustausch eingereicht werden. Eine Entscheidung erfolgt<br />
innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang.<br />
Die Vorbereitung und Durchführung sollte in Kooperation mit dem jeweiligen Kultusministerium<br />
und mit Unterstützung durch die nächstliegende Vertretung der Russischen<br />
Föderation erfolgen.<br />
Die Planung und Durchführung einer „Russisch kommt!“ – Veranstaltung muss in Kooperation<br />
mit mindestens einer weiteren regionalen Institution aus dem privaten oder<br />
öffentlichen Bereich, die im russischen Kontext tätig ist, erfolgen.<br />
Abrechnung und Dokumentation der Maßnahme erfolgen auf Formularen, die mit der<br />
Bewilligung zugeschickt werden.<br />
21
4.1 <strong>Programm</strong>linie B1: „Russisch kommt!“ - Aktionstage<br />
„Russisch kommt!“- Aktionstage sollen Interesse<br />
wecken für eine Beschäftigung mit Russland und<br />
für das Erlernen der russischen Sprache.<br />
Antragsteller kann eine Schule, ein Lehrerverband<br />
oder eine Jugendorganisation sein, die/der die<br />
Federführung des Projektes übernimmt. Die<br />
Beteiligung einer Schule ist Voraussetzung für die<br />
Förderung. An der Vorbereitung und<br />
Durchführung der Aktionstage muss mindestens<br />
eine weitere regionale Einrichtung, Institution<br />
oder Firma beteiligt sein, , die im russischen<br />
Kontext tätig ist. Durch die Aktionstage soll nach<br />
Möglichkeit ein örtliches bzw. regionales Netzwerk geschaffen werden, das die Beschäftigung mit<br />
Russland und der russischen Sprache zukünftig erleichtert. Die Aktionstage sollten nach einem einheitlichen<br />
Muster unter dem Titel „Russisch kommt!“ durchgeführt werden, was insbesondere für die<br />
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit derartiger Veranstaltungen von Bedeutung ist. Art und Umfang der<br />
Veranstaltung können den jeweiligen regionalen Gegebenheiten angepasst werden.<br />
Ein „Russisch kommt!“ - Aktionstag soll Interesse wecken für eine Beschäftigung mit Russland und<br />
das Erlernen der russischen Sprache. Dies soll durch Informationen, kulturelle Darbietungen und Mitmachangebote<br />
– in ausgewogenem Verhältnis – erreicht werden. An der Vorbereitung und Durchführung<br />
soll mindestens eine weitere Institution aus den folgenden Bereichen beteiligt werden:<br />
Schulen, Hochschulen und Volkshochschulen der Stadt oder des Schulbezirkes, an denen Russischunterricht<br />
erteilt wird,<br />
ortsansässige Institutionen, Vereine oder Bildungseinrichtungen, die mit Russland zusammenarbeiten<br />
und / oder die Verbreitung der russischen Sprache oder Kultur zur Aufgabe haben<br />
ortsansässige Firmen, die wirtschaftliche Kontakte zu Firmen in Russland haben,<br />
Organisationen, die auf dem Gebiet des deutsch-russischen Jugend- und Fachkräfteaustausches<br />
tätig sind.<br />
Bereits durch die gemeinsame Vorbereitung und Durchführung und den dabei stattfindenden Erfahrungsaustausch<br />
soll ein Netzwerk geschaffen werden, das die Arbeit der jeweiligen Institution in der<br />
Beschäftigung mit Russland und mit der russischen Sprache zukünftig erleichtert. Art und Umfang der<br />
Veranstaltung können den jeweiligen regionalen Gegebenheiten angepasst werden.<br />
Folgende Module könnten <strong>Programm</strong>punkte<br />
eines Aktionstages sein:<br />
Fotoausstellungen und Informationen über Russland<br />
Informationen über die Bedeutung der russischen Sprache<br />
Präsentationen und Informationen zu Austauschprojekten – Gespräche mit Ehemaligen<br />
Präsentationen und Informationen zum Russischunterricht<br />
Informationen über den deutsch-russischen Jugendaustausch – Gespräche mit Ehemaligen<br />
Informationen zu beruflichen Perspektiven mit Russischkenntnissen – Gespräche mit Vertretern<br />
betreffender Firmen und Institutionen<br />
Informationen zu möglichen Hochschulabschlüssen mit der Fachrichtung Slawistik –<br />
Gespräche mit Studenten und Hochschulabsolventen und/oder entsprechenden Beratern<br />
Podiumsdiskussionen / Expertenrunden zu aktuellen Themen<br />
Russisch-Schnupperstunden<br />
Russische Küche<br />
22
Russische Musik<br />
Lesungen, deutsch / russisch<br />
Tanz- oder Theateraufführungen<br />
Konzert mit russischer Band / russische Disko<br />
Diese Aufzählung ist als Anregung zu verstehen. Die <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch ist<br />
sich bewusst, dass nur Teile davon in einen beantragten Aktionstag einfließen werden. Die <strong>Stiftung</strong><br />
stellt Ihnen gerne Materialien für Ihren „Russisch kommt!“ – Aktionstag zur Verfügung (s. dazu S. 30<br />
ff.).<br />
4.2 <strong>Programm</strong>linie B2: Russisch<br />
sisch-Spracholympiaden<br />
Die <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch unterstützt bundesweit Landesolympiaden der russischen<br />
Sprache. Auf den jährlich stattfindenden<br />
Landesolympiaden werden in den jeweiligen<br />
Bundesländern die Schülerinnen und Schüler mit<br />
den besten Russischkenntnissen ermittelt. Die<br />
Sieger der Landeswettbewerbe messen sich auf der<br />
alle 3 Jahre stattfindenden Bundesolympiade der<br />
russischen Sprache, Literatur und Landeskunde.<br />
Die dort in sechs Niveaustufen ermittelten<br />
Gewinner vertreten dann die Bundesrepublik<br />
Deutschland auf der jeweils im nächsten Jahr<br />
folgenden Internationalen Olympiade der<br />
russischen Sprache, Literatur und Landeskunde in<br />
Moskau.<br />
Ziele:<br />
Die Landesolympiaden sollen den Russischlernern eine Möglichkeit bieten, sich außerhalb des Unterrichts<br />
in ihren Russischkenntnissen zu messen. Hierbei sollen Schülerinnen und Schüler aller Unterrichtsformate<br />
(1., 2., 3. Fremdsprache, AG…) und auch diejenigen mit muttersprachlichen Vorkenntnissen<br />
ihrem Leistungsniveau angemessen berücksichtigt werden. Sowohl von den Teilnehmern als<br />
auch von der Öffentlichkeit sollen die Olympiaden nicht als zusätzliche außerschulische Sprachprüfung<br />
wahrgenommen werden, vielmehr soll der „olympische Wettbewerbsgedanke“ im Vordergrund<br />
stehen.<br />
Durch ein geeignetes Rahmenprogramm sollen die Olympiaden darüber hinaus für das Erlernen der<br />
russischen Sprache werben und das Interesse an der Beschäftigung mit Russland wecken. Dieses kann<br />
unter anderem folgendermaßen erreicht werden:<br />
Wahl eines außerschulischen Austragungsortes, ggf. mit Russlandbezug,<br />
Durchführung der Landesolympiade an 2 Tagen mit einer Übernachtung,<br />
Erarbeitung von originellen Aufgaben, die sich vom herkömmlichen schulischen Aufgabenportfolio<br />
unterscheiden,<br />
Organisation eines geeigneten Rahmenprogramms im deutsch-russischen Kontext für die<br />
Schülerinnen und Schüler und für die betreuenden Lehrkräfte,<br />
Berichterstattung in der regionalen Presse.<br />
23
4.3 <strong>Programm</strong>linie B3: Sprachzertifikat Russisch<br />
Die <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch<br />
unterstützt bundesweit die Durchführung der Prüfungen<br />
zum Sprachzertifikat Russisch, wenn sie in<br />
ehrenamtlicher Tätigkeit durch Russischlehrerverbände<br />
durchgeführt werden. Nähere Informationen<br />
zum Zertifikat und fachliche Auskunft zu der<br />
Durchführung der Prüfungen erteilt das Hallische<br />
Zertifizierungszentrum für Russisch der Martin-<br />
Luther-Universität in Halle-Wittenberg unter<br />
http://www.slavistik.uni-halle.de.<br />
Das Sprachzertifikat Russisch TRKI ist ein<br />
international anerkanntes Sprachendiplom, welches<br />
von der Moskauer Lomonosov-Universität gemeinsam mit dem Ministerium für Bildung der Russischen<br />
Föderation für Russischlernende auf der ganzen Welt ausgearbeitet wurde. Es orientiert sich an internationalen<br />
Standards und existiert in sechs Niveaustufen (Elementarkenntnisse bis Aspirantur an der<br />
Hochschule). Das Zertifikat stellt eine zusätzliche Qualifikation für die in der Schule erworbene<br />
Sprachkompetenz dar.<br />
Das Sprachzertifikat Russisch ist für Schülerinnen und Schüler mit muttersprachlichen Kenntnissen<br />
und für Fremdsprachenlerner gleichermaßen ein hervorragender Nachweis der Kenntnisse und kommunikativen<br />
Fähigkeiten in der russischen Sprache. Insbesondere für Fremdsprachenlerner ist das<br />
Zertifikat eine sinnvolle Ergänzung der schulischen Nachweise für fremdsprachliche Kompetenzen,<br />
die im Zuge der Globalisierung und im Hinblick auf europäische Bildungsstandards immer mehr an<br />
Bedeutung gewinnt.<br />
Es ist die erklärte Absicht der <strong>Stiftung</strong>, durch das<br />
Sprachzertifikat TRKI die Attraktivität und die<br />
Bedeutung der russischen Sprache zu steigern.<br />
In den vergangenen Jahren haben insbesondere<br />
Schülerinnen und Schüler mit<br />
muttersprachlichen Vorkenntnissen an den<br />
Prüfungen teilgenommen. Diese Schülergruppe<br />
hat aufgrund eines nicht immer ausreichenden<br />
Angebotes an herkunftssprachlichem Unterricht<br />
häufig keinen anerkannten Nachweis ihrer<br />
oftmals hervorragenden Russischkenntnisse.<br />
Auch wenn Muttersprachler an<br />
fremdsprachlichem Russischunterricht<br />
teilnehmen, sind die dort erreichten Noten<br />
häufig wenig aussagefähig. Durch die verschiedenen Niveaustufen erhalten diese Schülerinnen und<br />
Schüler mit dem Zertifikat einen aussagefähigen und für die berufliche Perspektive bedeutsamen<br />
Nachweis ihrer Sprachkompetenzen. Durch das international anerkannte Zertifikat wird die Fremdsprache<br />
Russisch aufgewertet, dieses kann bereits bei Informationsveranstaltungen zur Wahl der 2. oder 3.<br />
Fremdsprache für Eltern und Schüler von Interesse sein und sollte in der Werbung für Russisch erwähnt<br />
werden. Die notwendigen Sprachkompetenzen zum Bestehen der ersten beiden Stufen (Elementarstufe,<br />
Basisstufe) können von Fremdsprachenlernern bereits in der Mittelstufe erreicht werden.<br />
24
5 <strong>Programm</strong>linie C: Gastschulaufenthalte<br />
schulaufenthalte und Berufspraktika<br />
Die <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch möchte Schulen die Möglichkeit eröffnen, eine bestehende<br />
Schulpartnerschaft mit einer russischen Schule vielfältig zu gestalten und ausgewählten<br />
Schülerinnen und Schülern, die bereits Erfahrungen im Schüleraustausch gesammelt haben, einen längerfristigen<br />
Aufenthalt an der Partnerschule anzubieten. Diese individuellen Gastschulaufenthalte<br />
werden von der <strong>Stiftung</strong> durch einen Zuschuss zu den Reisekosten gefördert. Im Folgenden werden die<br />
grundlegenden Fördersätze und Richtlinien für <strong>Programm</strong> C tabellarisch dargestellt:<br />
<strong>Programm</strong>linie C2<br />
Gastschulaufenthalt im Rahmen einer Schul-<br />
partnerschaft<br />
<strong>Programm</strong>linie C3<br />
Berufspraktikum in Russland im Rahmen<br />
der schulischen Berufsvorbereitung<br />
Fördersätze<br />
Nicht gefördert<br />
werden<br />
Mögliche An-<br />
A<br />
tragsteller<br />
ler<br />
Antragsfrist<br />
Grundlegende<br />
Förderbedin-<br />
gungen<br />
Förderung von bis zu 50% der Reisekosten (Flugzeug, Bus, Bahn) für die Reise nach Russland<br />
und zurück. Auch hier ist das Subsidiaritätsprinzip zu beachten!<br />
Kosten, die bereits vor der Bewilligung des Antrages entstanden sind, dieses gilt auch für<br />
Frühbuchungen von Flugtickets;<br />
Kosten, die außerhalb des von der <strong>Stiftung</strong> festgelegten Bewilligungszeitraumes entstehen;<br />
Visagebühren, da diese bei Maßnahmen im deutsch-russischen Jugendaustausch nicht<br />
erhoben werden;<br />
Reisen mit überwiegend touristischem Charakter.<br />
Antragsteller können allgemeinbildende und berufsbildende Schulen mit einer bestehenden und<br />
längerfristig erprobten Schulpartnerschaft sein, die ihren Schülerinnen oder Schülern einen<br />
Gastschulaufenthalt / ein Berufspraktikum ermöglichen möchten.<br />
Anträge können mit einem formlosen Schreiben bis spätestens tens 3 Monate vor dem geplanten<br />
Reisebeginn bei der <strong>Stiftung</strong> Deutsch-Russischer Jugendaustausch eingereicht werden, in jedem<br />
Fall jedoch vor der verbindlichen Buchung von Flugtickets oder Fahrkarten. Eine Entscheidung<br />
erfolgt innerhalb von 4 Wochen nach Antragseingang.<br />
Unterbringung in Gastfamilien (begründete<br />
Ausnahmen möglich);<br />
Teilnahme am Unterricht in der russischen<br />
Partnerschule.<br />
Unterbringung in Gastfamilien (begründete<br />
Ausnahmen möglich);<br />
die schriftliche Zusage eines Betriebes,<br />
eines Unternehmens oder einer sozialen<br />
Einrichtung in Russland am Ort der<br />
Partnerschule.<br />
25