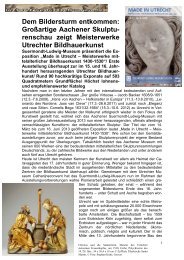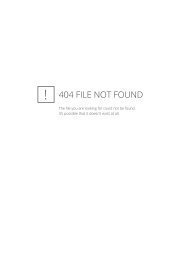Der „Meister von Flémalle“ - Historischeausstellungen.de
Der „Meister von Flémalle“ - Historischeausstellungen.de
Der „Meister von Flémalle“ - Historischeausstellungen.de
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
und betitelte Rogier, nach<strong>de</strong>m er um 1450 seine für das Brüsseler Rathaus geschaffenen<br />
„Gerechtigkeitstafeln“ (im 17. Jht. zerstört) gesehen hatte, als „Maximus<br />
Pictor“ („größter Maler“). <strong>Der</strong> Botschafter <strong>de</strong>r Herzogin <strong>von</strong> Mailand in Brüssel nannte<br />
ihn „Pittore Nobilissimo“ („vornehmster“ o<strong>de</strong>r „e<strong>de</strong>lster Maler“). Auch die nachfolgen<strong>de</strong>n<br />
Malergenerationen verehrten ihn und sein Werk. Albrecht Dürer bezeichnete ihn<br />
1520 in seinem nie<strong>de</strong>rländischen Tagebuch als <strong>de</strong>n „großen Meister Rogier“ („groß<br />
meister Rudier“). Und zahlreiche Maler nutzten Versatzstücke seiner Gemäl<strong>de</strong>, einzelne<br />
Figuren wie ganze Bildmotive. Dem Erfindungsreichtum van <strong>de</strong>r Wey<strong>de</strong>ns huldigte<br />
auch Erwin Panofsky, einer <strong>de</strong>r be<strong>de</strong>utendsten Kunsthistoriker <strong>de</strong>s 20. Jahrhun<strong>de</strong>rts.<br />
Er lobte Rogier als Ent<strong>de</strong>cker und Erfin<strong>de</strong>r <strong>von</strong> Figuren und Bildmotiven.<br />
Ein zentral zwischen Raum- und Außenwän<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Apsis stehen<strong>de</strong>s Gemäl<strong>de</strong> läutet<br />
<strong>de</strong>n Hauptbereich ein. Das Porträt mit <strong>de</strong>m „Bildnis eines Mannes“ (Nr. 41) wird <strong>de</strong>r<br />
Werkstatt Rogier van <strong>de</strong>r Wey<strong>de</strong>ns zugewiesen. Nur wenige Meter entfernt, folgt bereits<br />
eines <strong>de</strong>r eindrucksvollsten und schönsten Bil<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r gesamten Ausstellung mit<br />
<strong>de</strong>m Titel „Bildnis einer jungen Frau“ (Nr. 20/ Bild: siehe oben). Das noch heute bezaubern<strong>de</strong><br />
Porträt gilt hingegen als eigenhändiges Werk Rogiers. Mit diesen bei<strong>de</strong>n<br />
Gemäl<strong>de</strong>n kündigt sich bereits eine für das Oeuvre Rogier van <strong>de</strong>r Wey<strong>de</strong>ns typische<br />
Problematik an: die Einordnung seiner Werke als eigenhändig gemalte o<strong>de</strong>r <strong>von</strong> <strong>de</strong>r<br />
Werkstatt angefertigte Bil<strong>de</strong>r. Dazu tritt die Schwierigkeit <strong>de</strong>r Differenzierung seiner<br />
Gemäl<strong>de</strong> gegenüber <strong>de</strong>nen, die allgemein <strong>de</strong>m <strong>„Meister</strong> <strong>von</strong> Flemalle“ zugeordnet<br />
wer<strong>de</strong>n, in <strong>de</strong>nen wie<strong>de</strong>rum nach <strong>de</strong>m Neuansatz San<strong>de</strong>rs und Kemperdicks auch<br />
die „implantierte“ Kunst Rogiers zu fin<strong>de</strong>n ist. Doch damit noch nicht genug: Auch<br />
spätere Kopien seiner Werke bereiteten sogar ausgewiesenen Fachleuten größte<br />
Schwierigkeiten bei <strong>de</strong>r Verifizierung <strong>de</strong>s jeweiligen Originals. Zwei in <strong>de</strong>r Ausstellung<br />
präsentierte mustergültige Beispiele dieser Grundprobleme seien hier kurz angeführt:<br />
Neben <strong>de</strong>m „Bildnis einer jungen Frau“ sind zwei nahezu i<strong>de</strong>ntische Gemäl<strong>de</strong><br />
mit <strong>de</strong>r Bezeichnung „Bildnis eines feisten Mannes“ (Nr. 16 + 17/ Bild: siehe<br />
oben) ausgestellt. Das Verwun<strong>de</strong>rliche dabei ist die Tatsache, dass das rechte, erst<br />
1957 ent<strong>de</strong>ckte Madri<strong>de</strong>r Bild lange Zeit als Original galt, während das Berliner<br />
Porträt als schwächere Kopie abgetan wur<strong>de</strong>. Die Feststellung <strong>von</strong> Korrekturen <strong>de</strong>r<br />
Unterzeichnungen am Ohr <strong>de</strong>s Mannes auf <strong>de</strong>m Berliner Bildnis musste dann aber<br />
eine Revision dieses Urteils hervorrufen, da das Madri<strong>de</strong>r Bild keine Abweichungen<br />
vorwies und eine umgekehrte Reihenfolge <strong>de</strong>r Entstehung ausgeschlossen ist. Allerdings<br />
en<strong>de</strong>t mit dieser Berichtigung noch keineswegs die Diskussion um das nun als<br />
Original i<strong>de</strong>ntifizierte Berliner Gemäl<strong>de</strong>. Es stellte sich noch die Frage, ob das Bild<br />
ein Werk Rogiers o<strong>de</strong>r <strong>de</strong>s <strong>„Meister</strong>s <strong>von</strong> <strong>Flémalle“</strong> war. Um dies hier abzukürzen:<br />
Heute geht man mehrheitlich da<strong>von</strong> aus, dass das Bildnis wohl ein frühes Werk Rogiers<br />
ist. (Dazu siehe: Katalog, S. 265-270)<br />
Auch <strong>de</strong>r berühmte, zuvor bereits kurz erwähnte Miraflores-Altar war Gegenstand einer<br />
ähnlichen Diskussion. Lange Zeit galt die New Yorker Ausführung <strong>de</strong>s Altars als<br />
das Original und die Berliner als die Kopie. 1981 jedoch wies <strong>de</strong>r damalige Kustos<br />
<strong>de</strong>r Berliner Gemäl<strong>de</strong>galerie, Dr. Rainald Grosshanns, nach, dass <strong>de</strong>r Berliner Altar<br />
tatsächlich das Original Rogier van <strong>de</strong>r Wey<strong>de</strong>ns ist. So konnte er u.a. <strong>de</strong>utliche Verän<strong>de</strong>rungen<br />
und Umgestaltungen in <strong>de</strong>n Unterzeichnungen vor allem auf <strong>de</strong>r rechten<br />
Tafel <strong>de</strong>s Berliner Triptychons feststellen, während die frappierend ähnlich aussehen<strong>de</strong><br />
rechte Tafel <strong>de</strong>s Metropolitan Museums of Art, die in <strong>de</strong>r Ausstellung als<br />
Einzeltafel gleich neben <strong>de</strong>m vollständigen Berliner Originalaltar zu besichtigen ist<br />
(Nr. 29 + 30), solche typischen Merkmale nicht aufwies. Bestätigung erhielt Grosshanns<br />
durch die <strong>de</strong>ndrochronologische Untersuchung, die für das Berliner Werk gemäß<br />
<strong>de</strong>r Jahresringe eine Entstehungszeit um 1437 vermuten lässt, „während die<br />
zweite Version kaum vor 1490 gemalt wor<strong>de</strong>n sein kann.“ (Katalog, S. 320)<br />
Dendrochronologische Untersuchungen vor allem waren es auch, die bei vielen weiteren<br />
Ungereimtheiten und Unsicherheiten Klarheit verschaffen konnten, so etwa bei<br />
8