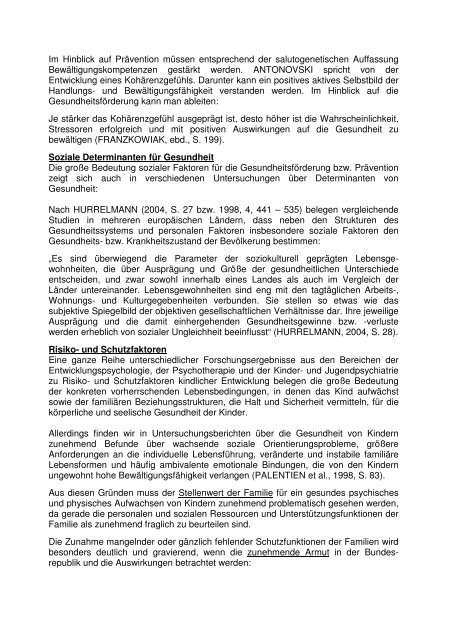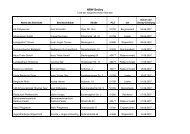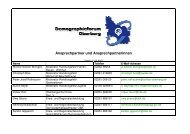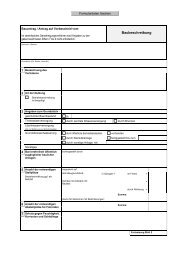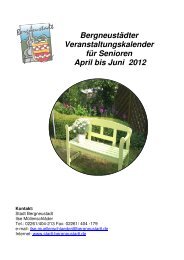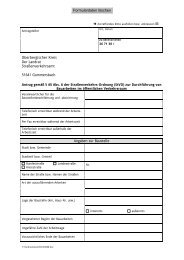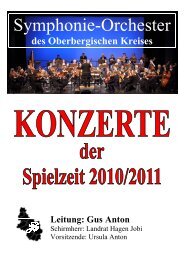Jahresbericht 2004 - Oberbergischer Kreis
Jahresbericht 2004 - Oberbergischer Kreis
Jahresbericht 2004 - Oberbergischer Kreis
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Im Hinblick auf Prävention müssen entsprechend der salutogenetischen Auffassung<br />
Bewältigungskompetenzen gestärkt werden. ANTONOVSKI spricht von der<br />
Entwicklung eines Kohärenzgefühls. Darunter kann ein positives aktives Selbstbild der<br />
Handlungs- und Bewältigungsfähigkeit verstanden werden. Im Hinblick auf die<br />
Gesundheitsförderung kann man ableiten:<br />
Je stärker das Kohärenzgefühl ausgeprägt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit,<br />
Stressoren erfolgreich und mit positiven Auswirkungen auf die Gesundheit zu<br />
bewältigen (FRANZKOWIAK, ebd., S. 199).<br />
Soziale Determinanten für Gesundheit<br />
Die große Bedeutung sozialer Faktoren für die Gesundheitsförderung bzw. Prävention<br />
zeigt sich auch in verschiedenen Untersuchungen über Determinanten von<br />
Gesundheit:<br />
Nach HURRELMANN (<strong>2004</strong>, S. 27 bzw. 1998, 4, 441 – 535) belegen vergleichende<br />
Studien in mehreren europäischen Ländern, dass neben den Strukturen des<br />
Gesundheitssystems und personalen Faktoren insbesondere soziale Faktoren den<br />
Gesundheits- bzw. Krankheitszustand der Bevölkerung bestimmen:<br />
„Es sind überwiegend die Parameter der soziokulturell geprägten Lebensgewohnheiten,<br />
die über Ausprägung und Größe der gesundheitlichen Unterschiede<br />
entscheiden, und zwar sowohl innerhalb eines Landes als auch im Vergleich der<br />
Länder untereinander. Lebensgewohnheiten sind eng mit den tagtäglichen Arbeits-,<br />
Wohnungs- und Kulturgegebenheiten verbunden. Sie stellen so etwas wie das<br />
subjektive Spiegelbild der objektiven gesellschaftlichen Verhältnisse dar. Ihre jeweilige<br />
Ausprägung und die damit einhergehenden Gesundheitsgewinne bzw. -verluste<br />
werden erheblich von sozialer Ungleichheit beeinflusst“ (HURRELMANN, <strong>2004</strong>, S. 28).<br />
Risiko- und Schutzfaktoren<br />
Eine ganze Reihe unterschiedlicher Forschungsergebnisse aus den Bereichen der<br />
Entwicklungspsychologie, der Psychotherapie und der Kinder- und Jugendpsychiatrie<br />
zu Risiko- und Schutzfaktoren kindlicher Entwicklung belegen die große Bedeutung<br />
der konkreten vorherrschenden Lebensbedingungen, in denen das Kind aufwächst<br />
sowie der familiären Beziehungsstrukturen, die Halt und Sicherheit vermitteln, für die<br />
körperliche und seelische Gesundheit der Kinder.<br />
Allerdings finden wir in Untersuchungsberichten über die Gesundheit von Kindern<br />
zunehmend Befunde über wachsende soziale Orientierungsprobleme, größere<br />
Anforderungen an die individuelle Lebensführung, veränderte und instabile familiäre<br />
Lebensformen und häufig ambivalente emotionale Bindungen, die von den Kindern<br />
ungewohnt hohe Bewältigungsfähigkeit verlangen (PALENTIEN et al., 1998, S. 83).<br />
Aus diesen Gründen muss der Stellenwert der Familie für ein gesundes psychisches<br />
und physisches Aufwachsen von Kindern zunehmend problematisch gesehen werden,<br />
da gerade die personalen und sozialen Ressourcen und Unterstützungsfunktionen der<br />
Familie als zunehmend fraglich zu beurteilen sind.<br />
Die Zunahme mangelnder oder gänzlich fehlender Schutzfunktionen der Familien wird<br />
besonders deutlich und gravierend, wenn die zunehmende Armut in der Bundesrepublik<br />
und die Auswirkungen betrachtet werden: