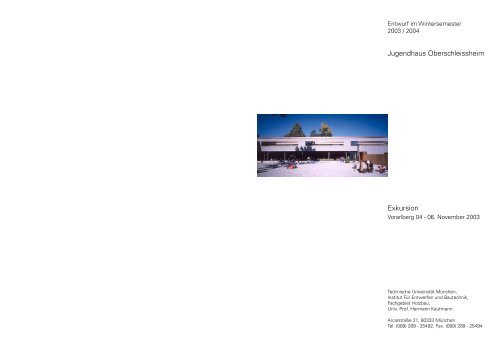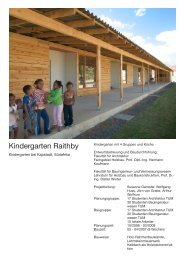Vorarlberg I, 1,4 MB - Fachgebiet Holzbau
Vorarlberg I, 1,4 MB - Fachgebiet Holzbau
Vorarlberg I, 1,4 MB - Fachgebiet Holzbau
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Entwurf im Wintersemester<br />
2003 / 2004<br />
Jugendhaus Oberschleissheim<br />
Exkursion<br />
<strong>Vorarlberg</strong> 04 - 06. November 2003<br />
Technische Universität München,<br />
Institut Für Entwerfen und Bautechnik,<br />
<strong>Fachgebiet</strong> <strong>Holzbau</strong>,<br />
Univ. Prof. Hermann Kaufmann<br />
Arcisstraße 21, 80333 München<br />
Tel. (089) 289 - 25492, Fax. (089) 289 - 25494
Programm<br />
10:00 - 16:00<br />
10:00<br />
11:15<br />
12:00<br />
12:30<br />
14:00<br />
16:00<br />
09:00 - Ende<br />
09:00<br />
16:00<br />
17:00<br />
09:00 - 17:00<br />
09:30<br />
10:15<br />
11:30<br />
12:15<br />
14:00<br />
15:00<br />
15:30<br />
16:30<br />
Dienstag, 4.11.<br />
Zimmerei Berlinger, Alberschwende<br />
Tischlerei Faißt, Hittisau<br />
Haus Neuning, Hittisau<br />
Frauenmuseum Hittisau<br />
<strong>Holzbau</strong>werk Kaufmann, Reuthe<br />
Jugendherberge<br />
Mittwoch, 5.11.<br />
Seminar Bregenz<br />
Kindergarten, Braike<br />
Präsentation<br />
Donnerstag, 6. 11<br />
Passivreihenhaus Falkenweg, Dornbirn<br />
Wohnanlage Ölzbündt, Dornbirn<br />
Sutterlüty, Weiler<br />
Hauptschule Klaus, Weiler<br />
Ökohaus Walch, Ludesch<br />
Wohnanlage Walch, Ludesch<br />
Wohnanlage Allmeinteilweg, Ludesch<br />
Bildungshaus St. Arbogast<br />
Skizzen/Notizen
Wohnanlage Walch<br />
Christian Walch<br />
Ludesch, 2003<br />
Die achtzehn Wohnungen der dreigeschossigen<br />
Anlage sind als äußerst kostengünstige<br />
„Startwohnungen“ mit flexibler Grundrissgestaltung<br />
konzipiert. So können übereinanderliegende<br />
Wohnungen leicht zu zweigeschossigen<br />
Einheiten verbunden werden, aber auch<br />
nebeneinanderliegende Einheiten zu großen<br />
Lofts gekoppelt werden. Die Ausführung mit<br />
vorgefertigten, großen Brettsperrholz-Elementen<br />
erreicht auf sehr ökonomische Art die<br />
Werte eines Niedrigenergiehauses. Zudem<br />
wurde auch die Schalldämmung durch Platten-<br />
Rippen-Decken mit Kiesschüttung einfach und<br />
effizient bewältigt. Ein spezielles Detail bilden<br />
die massiven Balkonbrüstungen, welche die<br />
darunterliegenden Decken mittragen. Die kräftige<br />
Farbgebung durch ölgebunde, natürliche<br />
Pigmente akzentuiert eine sonst unspektakuläre,<br />
doch ausschließlich mit erneuerbaren Energieträgern<br />
betriebene und mit ökologischen<br />
Materialien gefertigte Wohnanlage.<br />
Lagerhalle Kaufmann Holz-AG<br />
Hermann Kaufmann<br />
Reuthe, 1992<br />
Die Holzlagerhalle steht nahe an der Bregenzer<br />
Ach und bildet die Schaufassade der<br />
Gesamtanlage. Ihre flachen Dachtonnen und<br />
die Fassadenstützen geben einen Ryhthmus<br />
mit dem Schrittmaß von 11m vor, eine Größenordnung,<br />
die den Normalhäusern der Gegend<br />
entspricht. Dieses siedlungsbauliche Modul<br />
bietet einen nachvollziehbaren Maßsab, um<br />
den Baukörper trotz seiner Dimension im<br />
kulturellen Kontext einzuordnen. Die Reihung<br />
über 15 Joche und die Horizontalbetonung<br />
durch die gestaffelten Verdachungen mit Spanstreifenholz<br />
erzeugen ein kräftiges Kontinuum,<br />
das die landschaftlicheSituation am Fluss aufwertet.<br />
Zwischen dem horizontalen, strengen<br />
Band der Fassade und dem locker darüber hinweggleitenden<br />
Wellenspiel der Dächer wirken<br />
die beschatteten Glasflächen der Oberlichter<br />
vermittelnd.<br />
Das Ausnützen des knappen gestalterischen<br />
Spielraums, den die statisch - konstruktiven<br />
Bedingungen zulassen, erlaubt, jene Präzisierung<br />
kostengünstiger Details vorzunehmen,<br />
ohne die ein Industriebau schwerlich zu Architektur<br />
wird.
Kindergarten Braike<br />
Gruber + Gnaiger<br />
Bregenz, 2001<br />
Wie eine Oase inmitten der umgebenden<br />
Bebauung zeigt sich das Kinderhaus „In der<br />
Braike“ dem Besucher. Neben seiner außerordentlichen<br />
städtebaulichen Lösung erfüllt<br />
es im Inneren die räumlichen Anforderungen<br />
beispielhaft. Auffallend ist der klar gegliederte<br />
Grundriss, der präzis die öffentlichen von den<br />
intimeren, den Kindergruppen zugedachten<br />
Räumlichkeiten trennt. Kleinen Häusern gleich,<br />
erstrecken sich die Einheiten für die Kinder<br />
über zwei Stockwerke.<br />
Überraschend und überzeugend erscheint<br />
dabei die Maßstäblichkeit der Räume und der<br />
zugehörigen Möbel, ohne dabei verniedlichend<br />
zu wirken. Ein Haus, das ganz auf die Nutzung<br />
zugeschnitten ist und architektonisch außerordentliche<br />
Qualitäten aufweist. Die Stadt setzt<br />
auf ein innovatives Konzept und bietet ihren<br />
Bewohnern, insbesondere den Kindern, einen<br />
außergewöhnlichen Begegnungsraum.<br />
Ökohaus Walch<br />
Christian Walch<br />
Ludesch, 2001<br />
Das Produktionsgebäude der <strong>Vorarlberg</strong>er<br />
Ökohaus GmbH ist Ausdruck der Leidenschaft<br />
seines Erbauers, alle Fragen des Bauens<br />
grundsätzlich zu überdenken und sich nie damit<br />
zufriedenzugeben, etwas nur deshalb zu<br />
tun, weil es der Konvention entspricht. Daraus<br />
entsteht ein Bauwerk, das im besten Sinn Fragen<br />
aufwirft und Diskussionen auslöst.<br />
Das Tragwerk besteht aus am Fuß eingespannten<br />
Rundholzstützen, die ein Dach aus<br />
Schalenelementen tragen. Die Rundholzstützen<br />
sind in einer modernen Umsetzung<br />
der Herstellungstechnik der mittelalterlichen<br />
»Teuchelrohre« ausgebohrt und anschließend<br />
technisch getrocknet worden - somit sind<br />
sie weitgehend rissefrei und formstabil. Im<br />
selben Bestreben, Holz möglichst direkt,<br />
mit minimaler Bearbeitung einzusetzen,<br />
wurden für das Dach 8cm dünne, zweilagig<br />
gekreuzte Schalenelemente entwickelt, die<br />
aus sägerohen Brettern bestehen. Bei dieser<br />
Konstruktion kommen die hervorragenden<br />
Eigenschaften des Holzes bei Druckbeanspruchung<br />
voll zur Geltung. Mit dem Innovationspreis<br />
2001 hat die Jury die gedankliche Arbeit<br />
anerkannt, die dem Ökohaus- Produktionsgebäude<br />
zugrunde liegt und den Mut, diese<br />
Gedanken auch Wirklichkeit werden zu lassen.
Hauptschule Klaus<br />
Dietrich Untertrifaller<br />
Weiler, 2003<br />
Die neue Hauptschule fügt sich in die abgestufte<br />
Anordnung der solitären Baukörper<br />
entlang der Landesstrasse ein. Sie bildet mit<br />
dem Turnhallentrakt einen durch Bepflanzung<br />
gegenüber dem Straßenraum geschützten<br />
Platz, von dem aus Schule, Turnhalle und<br />
Bibliothek erschlossen werden. Ein zweigeschossiger<br />
Querriegel verbindet Schule mit<br />
Turnhallentrakt und bietet akustischen Schutz<br />
für Unterrichtsräume und Pausenhof. Im<br />
Hauptbaukörper sind sämtliche Stamm- und<br />
Sonderunterrichtsräume sowie die gesamte<br />
Verwaltung untergebracht. Die Erschließung<br />
des zweihüftigen Hauptbaukörpers erfolgt<br />
über einen großzügigen, dreigeschossigen,<br />
von oben belichteten Raum.<br />
Die Stammklassenräume im Erd- und Obergeschoss<br />
sind über Brücken angebunden.<br />
Der langgestreckte Kopfbau beinhaltet die<br />
zweigeschossige Pausenhalle, den gedeckten<br />
Eingangs- und Pausenbereich sowie die<br />
Bibliothek im Obergeschoss.Die Konstruktion<br />
erfolgt zur Gänze in <strong>Holzbau</strong>. Mittels kontrollierter<br />
Be- und Entlüftung, sowie der Optimierung<br />
der Bauhülle werden Verbrauchswerte<br />
geringer als 15 kW/h Heizwärmebedarf pro<br />
m² erreicht.<br />
Passivreihenhaus Falkenweg<br />
Johannes Kaufmann<br />
Dornbirn, 2002<br />
Die Reihenhauszeile mit neun Wohneinheiten<br />
und einem Gemeinschaftshaus bildet den<br />
ersten Baustein einer größeren Anlage mit<br />
Wohn- und Gewerbenutzung. Der einfache,<br />
kubische Baukörper entwickelt seine besondere<br />
Qualität aus einer gekonnt disziplinierten<br />
Detaillierung und aus der Plastizität tief liegender<br />
Fensteröffnungen und rhythmisierter<br />
Vorbauten.<br />
Die klare Grundriss-Struktur der zweigeschossigen<br />
Wohnungen sorgt für Wirtschaftlichkeit,<br />
einen großzügigen Raumeindruck und für ein<br />
hohes Maß an Flexibilität. Das Energiekonzept<br />
der Passivhäuser entspricht hohen Anforderungen<br />
an einen zeitgemäßen, ökologischen<br />
Wohnungsbau. Der ungeteilte Freibereich<br />
trägt wesentlich zur Wirkung des Gebäudes<br />
bei. Hier findet das soziale Konzept der Bauherren-Gemeinschaft<br />
ihren Ausdruck.
Wohnanlage Ölzbündt<br />
Hermann Kaufmann<br />
Dornbirn, 1997<br />
Bei diesem Bau handelt es sich um einen<br />
Niedrigenergie-Geschossholzwohnbau,<br />
dessen Konstruktion auf einem Baukasten-<br />
System mit vorfabrizierten Elementen und<br />
einem Rastersystem von 2,4 Metern beruht.<br />
Der Wohnbau ist durch eine Betonwand von<br />
einem nach Süden hin orientierten Einfamilienhaus<br />
abgetrennt, das ebenfalls von den<br />
Architekten geplant wurde.Die Längsseiten<br />
des zweigeschossigen Wohnbaus schauen in<br />
Ost-West-Richtung, wobei die Ostseite ein<br />
dem Gebäude vorgestelltes, verglastes Stiegenhaus<br />
aufweist und Laubengänge zu den<br />
einzelnen Wohnungen führen. Der Westseite<br />
wurden in den Obergeschossen Balkone und<br />
im Erdgeschoss Gärten vorgelagert.<br />
Um den Niedrigenergieverbrauch zu gewährleisten,<br />
befinden sich Sonnenkollektoren zur<br />
Warmwasseraufbereitung auf dem Dach und<br />
in den massiven Außenwänden befindet sich<br />
eine 35 cm dicke Wärmedämmung. Zusätzlich<br />
entspricht die Größe der Fensteröffnungen<br />
der jeweiligen Lichteinstrahlung, was die Geschlossenheit<br />
auf der Nordseite erklärt.<br />
Ein besonderes Augenmerk wurde auf die<br />
Temperaturregelung in den einzelnen Wohnungen<br />
gelegt: Die 2-3 Zimmer-Wohnungen<br />
verfügen über Lüftungssysteme, die über<br />
Wärmeaustauscher individuell geregelt werden<br />
können und die sonst üblichen Heizungen<br />
ersetzen<br />
Sutterlüty<br />
Hermann Kaufmann<br />
Weiler, 2002<br />
Der Sutterlüty-Markt in Weiler ist der Prototyp<br />
einer geplanten Reihe neuer Filialen, die an<br />
den archaischen Markttypus (geschäftiges<br />
Treiben unter freiem Himmel oder in grossen<br />
lichtdurchfluteten Hallen) anknüpfen möchten.<br />
Dabei soll nicht ein einmal bewährtes<br />
Patentrezept über die Dörfer und Gemeinden<br />
<strong>Vorarlberg</strong>s ausgestreut, sondern jeder Markt<br />
individuell aus den Gegebenheiten des Ortes<br />
entwickelt werden. Die Marktidee stand beim<br />
Neubau der Filiale in Weiler sichtlich im Zentrum<br />
des Konzepts.<br />
Der hohe, in <strong>Holzbau</strong>weise errichtete Hallenraum<br />
ist an der Nord- und Südseite grossflächig<br />
verglast, um den visuellen Bezug zum<br />
Aussenraum zu wahren. Die 47 cm starke<br />
Dachplatte, ca. 1.500 m² groß, überdeckt in<br />
5 m Höhe gleichsam monolithisch den Innenraum<br />
mit Auskragungen in den Außenraum<br />
bei Eingangsfront und Lieferrampe.<br />
Diese Platte ist ein Gefüge aus Hohlkastenelementen,<br />
gespannt zwischen den seitlichen<br />
Außenwänden und Hauptträgern aus<br />
Brettschichtholz, die über zwei Reihen von<br />
Stahl-Pendelstützen die Last im Innenraum<br />
abtragen. Die Spannweite der Hohlkästen<br />
beträgt zur Hälfte ca. 14 m, im übrigen Bereich<br />
(trapezförmiger Grundriss) kontinuierlich bis<br />
auf 8 m verkürzt. Die vorgefertigten Teile sind<br />
beidseitig mit Dreischichtplatten beplankt und<br />
haben Rippen aus Brettschichtholz. Die untere<br />
Platte ist die fertige Deckenuntersicht.Um<br />
diese helle Untersicht in Fichte völlig ruhig<br />
und ungeteilt zu erhalten, sind auch die bis zu<br />
72 cm breiten Hauptträger in die Deckenhöhe<br />
integriert.
Frauenmuseum Hittisau<br />
Siegfried Wäger, cukrowicz .nachbaur<br />
Hittisau, 1998<br />
Das Gebäude reagiert mit seiner Stellung, der<br />
Verteilung der Wege und Funktionen sowie in<br />
den Materialien und Konstruktionen perfekt<br />
auf den Ort und auf das von der Gemeinde<br />
definierte Programm. Während sich die Feuerwehr<br />
als Massivbau in das ansteigende<br />
Gelände hineinschiebt und zur Straße hin<br />
orientiert, schwebt der Kulturbereich als dominierender<br />
Holzquader darüber und öffnet<br />
sich über eine große Glasfront zum Dorfzentrum.<br />
Die Polarität der beiden Teile wird im<br />
Materialkonzept vertieft. Dem technischen<br />
Milieu der Feuerwehr entsprechen Beton,<br />
verzinkter Stahl und Glas. Der Kulturbereich<br />
knüpft mit moderner Holz-Elementbauweise<br />
an regionale Traditionen an, wobei hier<br />
erstmals bei einem öffentlichen Bau dieser<br />
Größenordnung sämtliche Wandoberflächen,<br />
Deckenuntersichten, Fußböden und Treppen<br />
in unbehandelter Weißtanne ausgeführt sind.<br />
Die differenzierte Lichtführung, die taktile und<br />
homogene Materialität der Innenräume vergegenwärtigen<br />
Stimmungen alter <strong>Holzbau</strong>ten in<br />
radikaler Neuinterpretation. Als Besonderheit<br />
ist anzumerken, dass vom Zuschnitt des Volumens<br />
und der Proportionalität der Öffnungen<br />
bis zu den Details der Fassaden und Decken<br />
die maßliche Koordination durchgezogen ist.<br />
Auch das kleinste Material-Modul zeigt sich<br />
so über die Gegensätze von Holz und Beton<br />
hinweg als Teil eines Ganzen.<br />
Bildungshaus St. Arbogast<br />
Hermann Kaufmann, Christian Lenz<br />
Götzis, 1992<br />
Am Rande eines Naturschutzgebietes, 1,5 km<br />
vom Ortskern entfernt, bietet der Bau der<br />
weltoffenen, überregional geschätzten Institution<br />
mit komplexem Raumprogramm und<br />
perfekter Überhöhung der Topografie einen<br />
unvervechselbaren, stimulierenden Ort. Die<br />
Position eines abgebrochenen Altbaus aufgreifend<br />
und steigernd, ist das Volumen im<br />
Winkel an die Hangkante gesetzt und bildet<br />
zum Bestand der Gästehäuser und Kirche einen<br />
neuen Platz.<br />
Eine Arkade aus Stahlstützen führt durch hohe<br />
Glaswände in die Eingangshalle - der Platz<br />
´fließt´ ins Haus. Auf diesem Niveau befinden<br />
sich Empfang, Cafeteria und Speisesäle, die<br />
sich südwärts dem Ausblick öffnen. Darüber,<br />
von einer Galerie erschlossen, die Seminarräume;<br />
im Sockel Büros, Personalräume, Garage.<br />
Differenzierte Konstruktionen, Raumqualitäten,<br />
Licht- und Blickregie.
Skizzen/Notizen<br />
<strong>Vorarlberg</strong>