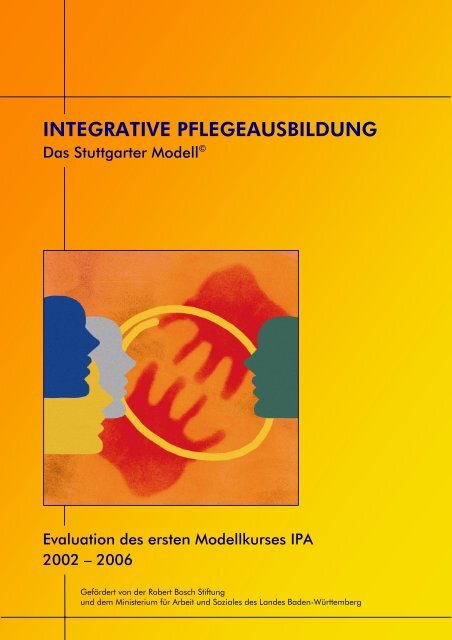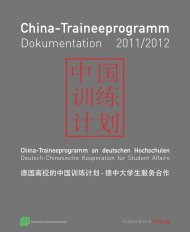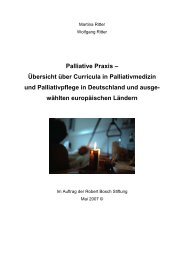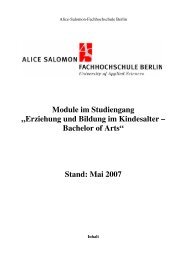Abschlussbericht Integrative Pflegeausbildung Modellkurs 2002-2006
Abschlussbericht Integrative Pflegeausbildung Modellkurs 2002-2006
Abschlussbericht Integrative Pflegeausbildung Modellkurs 2002-2006
- Keine Tags gefunden...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
INTEGRATIVE PFLEGEAUSBILDUNGDas Stuttgarter Modell ©Evaluation des ersten <strong>Modellkurs</strong>es IPA<strong>2002</strong> – <strong>2006</strong>Gefördert von der Robert Bosch Stiftungund dem Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Baden-Württemberg
GeleitwortNur wenige der zahlreichen Ausbildungsmodelle im Feld der Gesundheits- und Pflegeberufeder vergangenen Jahre wurden systematisch evaluiert und veröffentlicht.Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass der Evaluierungsprozess in erheblichemMaße Zeit und finanzielle Ressourcen fordert sowie zusätzliche Anforderungenan die Projektverantwortlichen stellt.Der externen wissenschaftlichen Begleitung kommt jedoch zentrale Bedeutung zu:Nur fundierte Modellergebnisse sind für andere Einrichtungen in größerem Umfangverwertbar und bringen den allgemeinen Reformprozess voran. Externe Begleitungund Bewertung machen ein Projekt transparent und stellen es mittels anerkannterKriterien und Methoden im Verlauf und im Ergebnis auf den Prüfstand.Die Evaluierung des Projekts „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong> – das Stuttgarter Modell© “ konnte aus Fördermitteln der Robert Bosch Stiftung realisiert werden, derengemeinnützige Ausrichtung die Überprüfung der Wirksamkeit und der Zielerreichungvon Fördermaßnahmen in besonderem Maße verlangt.Das Fazit des viereinhalb Jahre dauernden Bewertungsprozesses, der von den Mitarbeiterndes Instituts für Public Health und Pflegeforschung an der Universität Bremenunter der Leitung von Professor Görres geleistet wurde, ist erfreulich: Demnachkann das Stuttgarter Modell © als eines der fundiertesten und bedeutsamsten Modellprojektezur Reform der <strong>Pflegeausbildung</strong> im deutschsprachigen Raum eingestuftwerden. Dies belegt neben den Ergebnissen dieses Evaluationsberichts auch der bereitsim vergangenen Jahr veröffentlichte „Pflegeberufliche und pädagogische Begründungsrahmen“sowie diverse publizierte Lernmanuale. Mit diesen Publikationenlöst das Stuttgarter Modell © auch das selbst gesetzte Ziel ein, anderen Bildungseinrichtungenein Vorbild zu sein, das zur Nachahmung anregt. Zu diesem Zweck wurdenauch zwei Symposien mit 700 Teilnehmern veranstaltet und bundesweiteWorkshops für mehr als 300 Lehrkräfte durchgeführt. Bereits fünf Schulen in Freiburg,Schwäbisch Hall, Stuttgart, Bad Mergentheim und Göppingen haben ihre Ausbildungnach dem Stuttgarter Modell © reformiert.Erheblichen Anteil am Gelingen des Projekt kommt der „Kerngruppe Curriculum“ zu,der Keimzelle und „Denkfabrik“ des Stuttgarter Modells © , in der sich insgesamt zehnExpertinnen aus Pflegepädagogik und Pflegewissenschaft aus der Region Stuttgartengagiert haben. Gleiches gilt für den Kooperationsverbund von elf Trägern und 18Einrichtungen – von Seniorenheimen über ambulante Dienste bis zu Krankenhäusern– die das Vorhaben „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>“ getragen und finanziell unterstützthaben.Nicht zuletzt spiegelt sich der Erfolg des Vorhabens darin wider, dass die „<strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong>“ seit Oktober 2007 am Bildungszentrum des Robert-Bosch-Krankenhauses in den Regelbetrieb überführt wurde.Es ist zu wünschen, dass die Erfahrungen und Erkenntnisse des Stuttgarter Modells ©weite Verbreitung finden und die Diskussion zur Reform der Ausbildung in den Gesundheits-und Pflegeberufen bereichern.Robert Bosch Stiftung
InhaltsverzeichnisSeiteVorwort 10. Zusammenfassung des Projektverlaufs und abschließendeBewertung des Modellprojektes „<strong>Integrative</strong>3<strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “1. Ausgangspunkt der Evaluationsstudie 91.1 Demografischer, sozialer und gesundheitspolitischer Wandel 91.2Zukünftige Dienstleistungen und notwendige Qualifikationen der Gesundheits-und Pflegeberufe121.3 Eckpunkte einer Qualifizierungsoffensive 161.4 Zusammenfassendes Fazit: Reform der <strong>Pflegeausbildung</strong> 171.5 Kurzbeschreibung des Modellprojektes „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>:Das Stuttgarter Modell ©“ 182. Evaluation im Modellprojekt 212.1 Zielsetzung und Verlauf der Evaluation 212.2 Methodisches Vorgehen 212.3 Untersuchungsschwerpunkte 232.4 Erhebungs-, Auswertungsmethoden und Zielgruppen 242.5 Kurzzusammenfassung 283. Darstellung und zentrale Ergebnisse der Projektphasen 293.1 Planungs- und Einführungsphase (01.07.2000 - 30.09.<strong>2002</strong>) 293.2 Hauptphase I. Teil und II. Teil (01.10.<strong>2002</strong> – 31.12.2004) 303.3 Kurzzusammenfassung 394. Ausgewählte Ergebnisse zu den zentralen Untersuchungsschwerpunkten– Hauptphasen und Follow-up424.1 Einfluss der curricularen Konzeption auf das Pflegeverständnisder Auszubildenden4.1.1 Entwicklung des Pflegeverständnisses im Ausbildungsverlauf 444.1.2 Umsetzung des Pflegeverständnisses im Praxisalltag 4842
4.1.3 Kurzzusammenfassung 484.2 Einfluss der curricularen Konzeption auf die Entwicklungder beruflichen Handlungskompetenz der Auszubildenden4.2.1 Stärken der IPA-Auszubildenden 514.2.2 Schwächen der IPA-Auszubildenden 584.2.3 Beurteilung des Kompetenzprofils der Auszubildenden im Rahmen 62der praktischen Prüfungen – Ergebnisse der Beobachtung4.2.4 Einschätzung des Kompetenzprofils der Absolventen/innen hinsichtlich68zukünftiger Aufgaben und Handlungsfelder4.2.5 Kurzzusammenfassung 71504.3 Beurteilung des Transferlernens / Verhältnis integrative Basisausbildungund Schwerpunktsetzung4.3.1 Beurteilung des Transferlernens 734.3.2 Einschätzung des Verhältnisses zwischen integrativ angelegten Ausbildungsinhalten76und der Schwerpunktsetzung4.3.3 Kurzzusammenfassung 77724.4 Einfluss der dem Ausbildungsmodell zugrunde liegendenLernortkooperationen auf einen Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfer4.4.1 Einschätzung der Trägervielfalt im Kooperationsverbund 794.4.2 Beurteilung der Praxiskonferenzen und Praxisinstrumente 804.4.3 Einschätzung der Auswirkungen (Synergieeffekte) durch das Modellprojekt85in der Pflegepraxis4.4.4 Kurzzusammenfassung 89784.5 Akzeptanz und Verbreitung der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>:Das Stuttgarter Modell © “4.5.1 Bundesweite Akzeptanz und Verbreitung des Modells – politische 91Ebene4.5.2 Transfer von Modellanteilen in die Regelausbildung 934.5.3 Einfluss des Modells auf die Weiterentwicklung der <strong>Pflegeausbildung</strong> 984.5.4 Einschätzung der Vorbereitung durch die <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>auf aktuelle und zukünftige Anforderungen des Pflegeberufs -Berufseinmündung4.5.5 Kurzzusammenfassung 10590102
5.Zusammenfassung der Ergebnisse: Bewährte Bestandteiledes Modells und Herausforderungen1075.1 Pflegeverständnis 1075.2 Kompetenzentwicklung 1085.3 Lerntransfer / Verhältnis integrative Basisausbildung und Schwerpunktsetzung1095.4 Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfer 1105.5 Akzeptanz und Verbreitung 1116. Resümee: Bedeutsamkeit des Modells für die Weiterentwicklungder Pflegeberufe1126.1 Bedeutsamkeit des Modells: Berufspolitische Ebene 1126.2 Bedeutsamkeit des Modells: Berufspädagogische Ebene 1136.3 Bedeutsamkeit des Modells: Pflegepraktische und arbeitsmarktpolitische115Ebene6.4 Prospektiver Ausblick 117Literaturverzeichnis 118
AbbildungsverzeichnisSeiteAbb. 1: Pflege und Public Health: neue Zielsetzungen und Interventionstypen 13Abb. 2: Grafik Ausbildungsmodell 19Abb. 3: Ziele und Verlauf der Evaluation 22Abb. 4: Übersicht des Projektverlaufs mit jeweiligen Erhebungszeitpunkten und 25-methoden sowie ZielgruppenAbb. 5: Übersicht der Methoden, Instrumente und Zielgruppen 29Abb. 6: Entwicklung des Pflegeverständnisses im Ausbildungsverlauf – abnehmend44Abb. 7: Entwicklung des Pflegeverständnisses im Ausbildungsverlauf - zunehmend45Abb. 8: Gegenüberstellung des Pflegeverständnisses der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen47mit den VergleichsgruppenAbb. 9: Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Ausbildungsverlauf durch 52die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenAbb. 10: Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Ausbildungsverlauf durch 53die Lehrenden/ BereichslehrendenAbb. 11: Besonders stark ausgeprägte Fähigkeiten / Kompetenzen der54Absolventen/innen aus Sicht der PDL/SL/WBLAbb. 12: Einschätzung der Flexibilität integrativ Ausgebildeter im Vergleich zu56traditionell AusgebildetenAbb. 13: Einschätzung über schwach ausgeprägte Kompetenzen der IPA-60Absolventen/innen aus Sicht der PDL/SL/WBLAbb. 14: Kompetenznetz der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen anhand der Beobachtung63der praktischen PrüfungenAbb. 15: Einschätzung der beruflichen Handlungskompetenz aus Sicht der Absolventen/innen69Abb. 16: Erfüllung der Erwartungen an die IPA-Absolventen/innen aus Sicht der 70PDL/SL/WBLAbb. 17: Einschätzung der beruflichen Handlungskompetenz der IPA-Absolventen/innen70aus Sicht der PDL/SL/WBLAbb. 18: Einschätzung zum Gelingen des Wissenstransfers aus Lernsituationen 74im Unterricht auf neue Situationen in der PflegepraxisAbb. 19: Beurteilung des Bogens zur Auswertung der Leistungen im Praxisfeld 83durch die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenAbb. 20: Einschätzung der Auswirkungen des Modells auf das Verständnis als 86Praxisanleiter/in vom Auftrag der PflegeAbb. 21: Einschätzung der Auswirkungen des Modells auf die Ausbildungsqualität88durch die LehrendenAbb. 22: Einschätzung über Veränderungen in der Pflegepraxis durch das Modellprojekt88Abb. 23: Übersicht über die Verteilung der Befragten nach Bundesländern 92Abb. 24:Abb. 25:Zeiträume, in denen erste Information über das Modellprojekt erhaltenwurdenBestandteile der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>, die in die Regelausbildungübernommen werden sollten9394
Abb. 26: Beteiligung der Workshopteilnehmer/innen an der Umsetzung von Modellanteilen95bzw. am gesamten ModellAbb. 27: Modellanteile der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>, die aus Sicht der96Workshopteilnehmer/innen bereits an den Schulen umgesetzt werdenAbb. 28: Zunehmende Attraktivität des Pflegeberufes durch das Modellprojekt 101aus Sicht der Praxisanleiter/innenAbb. 29: Vorbereitung der Absolventen/innen des Modellprojekts auf die Aufgaben102im jeweiligen Handlungsfeld aus Sicht der PDL/SL/WBLAbb. 30: Zukünftige Arbeitsbereiche der IPA-Absolventen/innen 105TabellenverzeichnisSeiteTab. 1: Kategorien zum Pflegeverständnis 43Tab. 2: Auszug aus dem Kodierplan zum Pflegeverständnis 43Tab. 3: Besonders stark ausgeprägte Kompetenzen der Absolventen/innen aus 53Sicht der PDL/SL/WBL – analytisch-reflexive BegründungskompetenzTab. 4: Besonders stark ausgeprägte Kompetenzen der Absolventen/innen aus 55Sicht der PDL/SL/WBL – interaktive / soziale KompetenzTab. 5: Schwach ausgeprägte Kompetenzen der Absolventen/innen aus Sicht 60der PDL/SL/WBL – organisations-/ systembezogene KompetenzTab. 6: Mittelwerte zu den Beobachtungskriterien der analytisch-reflexiven Begründungskompetenz64Tab. 7: Mittelwerte zu den Beobachtungskriterien der praktisch-technischen65KompetenzTab. 8: Mittelwerte zu den Beobachtungskriterien der interaktiven Kompetenz 65Tab. 9:Tab. 10:Tab. 11:Tab. 12:Tab. 13:Tab. 14:Tab. 15:Tab. 16:Tab. 17:Mittelwerte zu den Beobachtungskriterien der Planungs- und SteuerungskompetenzMittelwerte zu den Beobachtungskriterien der organisations-/ systembezogenenKompetenzMittelwerte zu den Beobachtungskriterien der ethisch-moralischenKompetenzFörderliche Faktoren zur Vorbereitung auf den Berufseinstieg aus Sichtder <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenFörderliche und hinderliche Faktoren, die einen erfolgreichen Wissenstransferbeeinflussen könnenVeränderungen im Arbeitsfeld, die durch die <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>angestoßen wurdenAspekte, die mit dem Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: DasStuttgarter Modell © “ verbunden wurdenModellanteile der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>, die aus Sicht der Ministerienvertreter/innenfür die Regelausbildung geeignet sindFörderliche und hinderliche Faktoren, die eine Umsetzung von Modellanteilenoder des gesamten Modells beeinflussen666667687585929496
VorwortDie Modellklauseln in der jüngsten Gesetzgebung - Novellierung des Krankenpflegegesetzes(2004) und erstmalige bundeseinheitliche Regelung des Altenpflegegesetztes(2003) – haben bundesweit zahlreiche Reformmodelle initiiert. Von ihnenwird ein anhaltender Innovationsschub in der <strong>Pflegeausbildung</strong> erwartet. Derzeit sindrund 50 Modelle mit unterschiedlichen strukturellen und inhaltlichen Ansätzen, aberhohem Innovationsgehalt, etwa bezogen auf die Dauer der Ausbildung, die Berufsabschlüsseoder Möglichkeiten der Lernortkooperation, dabei, neue Wege in der<strong>Pflegeausbildung</strong> zu gehen. Eine Reihe dieser Modelle wird wissenschaftlich begleitetund evaluiert, denn die unterschiedlichen Ausrichtungen - integriert, integrativ o-der generalistisch – werden durchaus kontrovers diskutiert, auch wenn allgemeinKonsens darüber zu bestehen scheint, dass nur eine „gemeinsame“ <strong>Pflegeausbildung</strong>nachhaltige Lösungen für die zukünftigen Herausforderungen an die Pflege bietenkann.Bereits im Jahr 2000, zeitgleich mit dem Erscheinen der Denkschrift der RobertBosch Stiftung „Pflege neu denken“, wurde mit der Entwicklung der zukunftsweisenden<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © begonnen mit dem Ziel,auf die veränderten Aufgaben und Handlungsfelder der Pflege vorzubereiten unddurch anspruchsvolle Qualifizierung zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung desBerufsfeldes zu führen. Nach 2-jähriger intensiver Planungsphase startete das Ausbildungsmodellam 01.10.<strong>2002</strong> mit 28 Auszubildenden. Bereits drei Monate zuvorbegann die wissenschaftliche Begleitung und Evaluation des Modellprojektes, diesich insgesamt über einen Zeitraum von 4,5 Jahren erstreckte. Sie wird verantwortetvom Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP), Abteilung 3: InterdisziplinäreAlterns- und Pflegeforschung (iap), Universität Bremen.Im Rahmen von Symposien und Fachkongressen konnten zentrale Erkenntnisse undEvaluationsergebnisse bereits im Vorfeld einer breiten Fachöffentlichkeit vorgestelltwerden.Jetzt wird seitens des Evaluationsteams der <strong>Abschlussbericht</strong> vorgelegt. Dieser umfasstdie gesamte Dauer des Modellprojekts „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: DasStuttgarter Modell ©“ von Juli <strong>2002</strong> bis Dezember <strong>2006</strong>. Ausführliche Zwischenberichtewurden in den Jahren <strong>2002</strong>, 2003, 2004 und 2005 erstellt.Dem Bericht wird zunächst eine Kurzzusammenfassung der wesentlichen Ergebnisseund eine abschließende Bewertung des Modellprojektes vorangestellt, um einenschnellen Einstieg zu ermöglichen. Im Folgenden werden dann der Ausgangspunkt,das methodische Vorgehen und die Zielsetzungen der Evaluationsstudie, die zentralenErgebnisse der Projektphasen sowie der Untersuchungsschwerpunkte ausführlichbeschrieben, bevor auf der Grundlage der zusammengefassten Ergebnisse bewährteBestandteile und Herausforderungen des Modells aufgezeigt werden. Dasabschließende Resümee diskutiert die Bedeutsamkeit des Modells für die Weiterentwicklungder Pflegeberufe auf berufspolitischer, -pädagogischer sowie pflegepraktischerund arbeitsmarktpolitischer Ebene.Den Teilnehmer/innen des Modellprojekts und der Vergleichsgruppen, den Lehrer/innenund Schulleitungen, den Praxisanleiter/innen, Kooperationspartner/innen,Experten/innen, Vertretern/innen der Ministerien, Pflegedienst-, Abteilungs-, Stations-1
und Wohnbereichsleitungen sowie den Workshopteilnehmern/innen gebührt derherzliche Dank des Evaluationsteams für ihre Bereitschaft und Offenheit, an der Evaluationdes Modellprojekts mitzuwirken.Ein besonderer Dank gilt an dieser Stelle den ehemaligen und aktuellen Mitgliedernder Kerngruppe Curriculum, dem Robert-Bosch-Krankenhaus, dem Kooperationsverbundder <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> sowie der Robert Bosch Stiftung (Stuttgart)und dem Ministerium für Arbeit und Soziales des Landes Baden-Württembergfür die Unterstützung und Begleitung der Evaluationsstudie und die oftmals notwendigeGeduld.Prof. Dr. Stefan Görres(Projektleitung)Bremen, März 20072
0.Zusammenfassung des Projektverlaufs und abschließendeBewertung des Modellprojektes „<strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “Vorbemerkungen:Die Evaluation des Modellprojektes „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das StuttgarterModell © “ wurde von der Abteilung Interdisziplinäre Alterns- und Pflegeforschung (iap),Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP), Universität Bremen, unterder wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Stefan Görres durchgeführt. Die Laufzeitbetrug insgesamt 4,5 Jahre (01. 07. <strong>2002</strong> - 31. 12. <strong>2006</strong>) und umfasste die Planungs-,Einführungs- und Hauptphase sowie das Follow-up.In der vorangestellten Zusammenfassung werden, basierend auf den Ergebnissender Evaluation, in einer Gesamtschau die bewährten bzw. zur Optimierung vorgeschlagenenElemente der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> skizziert. Eine dezidierteDarstellung der Evaluationsergebnisse aller Projektphasen kann dem nachfolgenden<strong>Abschlussbericht</strong> entnommen werden.Zusammenfassung der zentralen EvaluationsergebnisseDas Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell ©“ reagiertebereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt auf die gesellschaftlichen und bildungspolitischenEntwicklungsdynamiken und trägt mit der Gestaltung eines berufsgruppenübergreifendenAusbildungsprofils maßgeblich zur Weiterentwicklung der <strong>Pflegeausbildung</strong>bei.Die Ergebnisse der Evaluationsstudie zeigen, dass sich die Planung, Konzeption undUmsetzung des Ausbildungsmodells äußerst bewährten und eine breite Akzeptanzsowohl in den vielfältigen Praxiseinrichtungen der Kooperationspartner/innen alsauch über die Projektgrenzen hinaus in anderen Pflegeschulen und auf der berufspolitischenEbene erfahren. Mehrere Pflegeschulen haben weite Teile des Curriculumsmit Unterstützung der Kerngruppe bereits implementiert bzw. befinden sich in derUmsetzungsphase. Die von der Kerngruppe Curriculum veranstalteten Workshopstrugen zudem entscheidend dazu bei, dass Elemente der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>bundesweit an andere Pflegeschulen transferiert wurden. Ein zweiter <strong>Modellkurs</strong>„<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>“ begann im April 2005 am Ausbildungszentrum fürPflegeberufe am Robert-Bosch-Krankenhaus und wird ebenfalls vom iap evaluiert,um den Entwicklungs- und Revisionsprozess weiterzuführen und einen Transfer desModells in die Regelausbildung zu erleichtern. Ein neuer integrativer Ausbildungskursstartet im Oktober 2007.Die Leitziele der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>:• die Vorbereitung auf gesellschaftlich notwendige und politisch geforderte Aufgabenund Handlungsfelder der Pflege;• eine Berufsgruppenintegration;3
• Weg von der Verrichtungsorientierung hin zu einer (Pflege-) Situationsorientierungsowie• eine Steigerung der Attraktivität des Berufsfeldes Pflege,können als erreicht angesehen werden. Dies verdeutlichen die nachstehend zusammengefasstenErgebnisse der als bewährt angesehenen Elemente des Ausbildungsprojektes.Neben den positiven Aspekten werden zugleich auch hinderliche Faktorenund Herausforderungen des Modells aufgezeigt, die z. T. bereits im Revisionsprozessder Kerngruppe Curriculum aufgegriffen wurden.Bewährt hat sich…Herausforderungen / Empfehlungen…die integrative Ausrichtung des Ausbildungsmodells:.• Die integrative Ausrichtung gewährleisteteeine hohe Flexibilität für ein breitesEinsatzspektrum in alten und neuenHandlungsfeldern der Pflege. Die Konzeptionwird damit den Anforderungen aneinen modernen Pflegeberuf gerecht undträgt zur Weiterentwicklung der Pflegeberufebei.• Nicht bewährt hat sich die anfängliche starreAnordnung von gemeinsamen integrativenAusbildungsanteilen und später einsetzenderdifferenzierender Schwerpunktbildung.Die Komplexität des pflegerischenHandlungsfelds erfordert eine Differenzierungzu einem früheren Zeitpunkt.…die Möglichkeit zum Erwerb zweier gleichwertiger Berufsabschlüsseinnerhalb von 3,5 Jahren:• Bewährt hat sich die als innovativ zu bewertendeKonzeption der zwei gleichwertigenBerufsabschlüsse, die in einemAusbildungszeitraum von 3,5 Jahren erlangtwerden können.• Aufgrund der höheren Arbeitsmarktchancendurch diese Doppelqualifikation undder neuen Vielseitigkeit des Aufgabenspektrumsträgt das Modell zu einer Attraktivitätssteigerungdes Pflegeberufesbei, sowohl für die Auszubildenden alsauch für potenzielle Arbeitgeber.• Einige potenzielle Arbeitgeber/innen befürwortenindes eine Verlängerung der Ausbildungszeitauf vier Jahre. Dies würde demgestuften Ausbildungsmodell aus derDenkschrift der Robert Bosch Stiftung „Pflegeneu denken“ (2000) entsprechen.4
Bewährt hat sich…Herausforderungen / Empfehlungen…die Trägervielfalt im Kooperationsverbund:• Die Trägervielfalt im Kooperationsverbundstellt ein erfolgreiches Element der<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> dar. Diehäufig wechselnden Einsätze in unterschiedlichenpflegerischen Institutionenboten eine Bereicherung für die Auszubildendenund förderten die Entwicklungvon Flexibilität, Reflexions-, und professionellerAnpassungsfähigkeit.• Den positiven Effekten der Lernortkooperationenstehen Probleme beim Gewinn vonHandlungssicherheit und –routine sowie einhoher organisatorischer Aufwand entgegen.Es empfiehlt sich langfristig ein gezieltesEntgegenwirken der Handlungsunsicherheiten(z. B. zusätzliche fachpraktische Ü-bungseinheiten und intensive Unterstützungdurch die Anleiter/innen).• Synergieeffekte in den Einrichtungen derKooperationspartner/innen durch die Beteiligungam Modellprojekt zeigen sichu. a. darin, dass vermehrt Praxisanleiter/innenqualifiziert und gezielt eingesetztwerden.…der pflegeberufliche und pädagogische Begründungsrahmen:• Das Modellprojekt basiert auf der theoretischenGrundlage eines explizit entwickeltenund zwischenzeitlich überarbeitetenpflegeberuflichen und pädagogischenBegründungsrahmens. Die hierin verankertenpflegeberuflichen Leitziele undpädagogischen Leitsätze sowie die darausresultierenden Ausbildungsprinzipien1 zeigen eine die bisher vorherrschendenAusbildungsmodelle überschreitendeKonzeption, die den Anforderungenan einen modernen Pflegeberufin umfassender Weise gerecht wird.1 Ausbildungsprinzipien: Orientierung am Handeln vom Menschen, Wissenschaftsorientierung, Lebenslauforientierung,Theorie-Praxis-Vernetzung, Fächerintegration5
Bewährt hat sich…Herausforderungen / Empfehlungen…die Konzeption und Umsetzung der im Begründungsrahmenfixierten pflegeberuflichen Leitziele 2 :• Die inhaltliche Fundierung fördert eineIntegration der berufsspezifischen Sichtweisender drei Pflegeberufe und förderteein differenziertes Verständnis vonPflege, gekennzeichnet durch Ressourcen-,Situations- und Pflegebedarfsorientierung.Das Modell forciert damit erfolgreichden Wandel des Pflegeberufs wegvon der Verrichtungsorientierung hin zurSituationsorientierung.… die Entwicklung eines theoretisch begründetenKompetenzmodells:• Die Ergebnisse bestätigten den positivenEinfluss der curricularen Konzeption aufdie Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz.Damit wird das angestrebteLeitziel der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>,berufliche Handlungskompetenzvor dem Hintergrund eines theoretischbegründeten Kompetenzmodells zu entwickeln,erreicht.• Mit der Kompetenzorientierung ist es denInitiatoren/innen des Modells gemäß ihremLeitziel gelungen, die Auszubildendenauf gesellschaftlich notwendige undpolitisch geforderte Aufgaben und Handlungsfeldervorzubereiten. Dies und diepflegewissenschaftlich, -pädagogischund -beruflich gut begründete Ausbildungskonzeptionleisten einen erheblichenBeitrag zur Qualitätssteigerung der<strong>Pflegeausbildung</strong>.• Es empfiehlt sich eine Überprüfung bzw.Erweiterung des Kompetenzmodells z. B.um Aspekte der personalen Kompetenz(Stressfähigkeit/ Umgang mit Belastungen,Selbstpflegekompetenz 3 ).• Entwicklungsbedarf hinsichtlich der Berufsvorbereitungwird im Bereich der praktischtechnischenKompetenz, in der Vorbereitungauf spezielle Handlungsfelder undpflegefachliche Schwerpunkte sowie in derBewältigung komplexer organisatorischerAbläufe gesehen. Es scheint daher ratsam,den Bedingungsfaktoren der fachspezifischenWissenslücken sowie Handlungsunsicherheitennachzugehen und Lösungsansätzezu deren Behebung zu entwickeln. Sokann durch eine Weiterentwicklung transferförderlicherElemente (Lernwerkstätten,Skills Labs) versucht werden, den Nachholbedarfan Handlungskompetenzen in speziellenPflegesituationen abzubauen.2 Pflegeberufliche Leitziele sind z. B.: „Die Lernenden fördern und erhalten die Selbstpflegekompetenz der Menschenmit Pflegebedarf unter Einbezug sozialer und materialer Ressourcen.“ „Die Lernenden beachten die Würdedes Menschen und setzen sich anwaltschaftlich für die Interessen von Menschen mit Pflegebedarf ein.“3 Der Begriff „Selbstpflegekompetenz“ wird hier und im weiteren Textverlauf alltagssprachlich und nicht im pflegetheoretischenSinn verwendet.6
Bewährt hat sich…Herausforderungen / Empfehlungen…die Methodenvielfalt bei der Gestaltung der Lehr-/Lernarrangements,vor allem das selbstorganisierte Lernen:• Die Absolventen/innen verfügen übereine besondere Motivation und Eigeninitiativesowie eine ausgeprägte Selbstständigkeitim pflegerischen Handeln.Diese resultierten primär aus dem hohenAnteil an selbstorganisiertem Lernen imUnterricht, der die Auszubildenden dazuanregt, auch am Lernort Pflegepraxisselbstständig zu arbeiten und sich fehlendesWissen in eigener Initiative anzueignen.Die kommunikative bzw. interaktiveKompetenz wird durch Rollenspieleund Diskussionen gefördert.• Das Transferlernen wird durch die Lehr-/Lernarrangements gezielt unterstützt. Alstransferförderliche Methode lassen sichdie Begleitung und Reflexion praktischerÜbungsphasen identifizieren.• Mit der curricularen Konzeption des Modellsist es gelungen, das traditionell hierarchischeVerhältnis zwischen Lehrendenund Lernenden aufzulösen und demeine zukunftsweisende Lehrerrolle(Lernbegleiter / Moderator statt Wissensvermittler)entgegenzusetzen.• Optimierungsmöglichkeiten werden in derstärkeren Fokussierung von Transferkompetenzenund -hilfen (z. B. kritische Überprüfungder Lernsituationen auf ihre Übertragbarkeitauf andere Situationen, Abfolgeund Länge der Praxiseinsätze, verstärktesEinbeziehen und Qualifizieren der Praxisanleiter/innenetc.) innerhalb und zwischenden theoretischen und praktischen Lernortengesehen.…die Einführung von Praxiskonferenzen zur gezielten Förderungder Theorie-Praxis-Vernetzung:• Die Praxiskonferenzen bewähren sichbei regelmäßiger Teilnahme der Anleiter/innenals Instrument zur Förderungdes Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfers. Sie werden von den Anleiter/innenals unterstützend für ihre pädagogischeArbeit und persönlich gewinnbringendgeschätzt.• Voraussetzung ist eine kontinuierliche Teilnahme,um Informationsdefiziten am LernortPflegepraxis vorzubeugen und denAuszubildenden eine effektive Unterstützungzu gewährleisten. Eine unregelmäßigeBeteiligung wirkt der Theorie-Praxis-Vernetzungentgegen. Hier bietet sich die Möglichkeit,die Anleiter/innen z. B. durch Anerkennungder Konferenzen als Fortbildungsveranstaltungzur Teilnahme zu motivierenund damit einen kontinuierlichen Dialogzwischen den kooperierenden Einrichtungenzu fördern.7
Bewährt hat sich…Herausforderungen / Empfehlungen…die im Rahmen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> entwickeltenPraxisinstrumente:• Die Praxisinstrumente 4 erleichtern denAnleiter/innen das Anknüpfen an die amLernort Schule vermittelten Lerninhalteund ermöglichen die Vorbereitung undDurchführung einer gut strukturierten undeffektiven Anleitung im pflegepraktischenHandlungsfeld.• Des Weiteren bewirkt die Arbeit mit denIPA-Auszubildenden einen Wandel derPraxisanleiter/innenrolle sowie ein neuesVerständnis von Anleitung, welches sichz. B. durch eine individuelle Begleitungder Lernenden auszeichnet.• Die anspruchsvolle Sprache der Instrumenteerzeugt Unsicherheiten und Schwierigkeitenbei der Kompetenzbeurteilung derAuszubildenden.• Im Revisionsprozess sollte die Verständlichkeitder Praxisinstrumente in Zusammenarbeitmit den Praxisanleiter/innen derkooperierenden Einrichtungen kritisch ü-berprüft werden. Um einen nachhaltigenTheorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transferzu gewährleisten, empfiehlt sich eineFortführung der Informations- und Anleitungsarbeitim Rahmen der Praxiskonferenzen.…die von den Initiatoren/innen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>veranstalteten Workshops:• Die von der Kerngruppe Curriculumdurchgeführten Workshops für Lehrkräftetrugen maßgeblich dazu bei, dass Modellanteilebundesweit erfolgreich in denRegelbetrieb übertragen werden. Vor allemdas selbstorganisierte Lernen, dieLernfelder und Lernsituationen, das Prinzipder Vielfalt der Praxiseinsatzorte, diePraxisaufträge sowie das Kompetenzmodellwurden bereits an anderen Schulenumgesetzt.4 z. B. Praxisaufträge, Blockhandbuch, Bogen zur Auswertung der Praxisbegleitung und der Leistungen im Praxisfeld,Vor- Zwischen- und Abschlussgespräche8
1.Ausgangspunkt der Evaluationsstudie1.1 Demografischer, sozialer und gesundheitspolitischer WandelDer demografische, soziale und gesundheitspolitische Wandel stellt die gesundheitlicheund pflegerische Versorgung vor große Herausforderungen. Gemeinsam mit fastallen Industrieländern befindet sich die bundesdeutsche Gesellschaft in einem strukturellenUmwandlungsprozess im Rahmen dessen ein Anstieg der Zahl der Pflegebedürftigenund ein erhöhter Versorgungsbedarf in der ambulanten und stationärenVersorgung in den nächsten Jahrzehnten prognostiziert wird (Hasseler 2004). Es bestehtallgemeiner Konsens, dass diese Entwicklungen und VeränderungsprozesseAuswirkungen auf die pflegerischen Infrastrukturen und Versorgungsprozesse habenwerden (vgl. dazu ausführlich Hasseler & Görres 2005).• Demografischer und sozialer WandelIn den nächsten Jahrzehnten wird sich die Altersstruktur aufgrund demografischerEntwicklungen verändern. Es wird einen deutlichen Strukturwandel in Richtung einessteigenden Anteils älterer und hochbetagter Menschen zu verzeichnen sein.Berechnungen gehen davon aus, dass vor allem die Zahl Hochaltriger (Menschenüber 80 Jahre) überproportional zunehmen wird.Die demografische Entwicklung wird vor allem zu einer Zunahme im Bereich der psychischenErkrankungen bzw. gerontopsychiatrischen Erkrankungen (Demenz, Depression)führen. Die Demenz ist dabei einer der häufigsten Störungen, die vor allemüberwiegend im Alter auftritt. Demgemäß ist zu erwarten, dass zukünftig mehr hochaltrigePatienten zu versorgen sind, die an einer demenziellen Erkrankung leiden.In den kommenden Jahrzehnten wird zudem bei den Migranten/innen aufgrund Veränderungender familiären Strukturen mit einer geringeren Übernahme der Pflegeund Hilfe durch Angehörige und einer höheren Inanspruchnahme professionellerpflegerischer Dienstleistungen gerechnet. Bundesweit wird damit davon ausgegangen,dass der Anteil ausländischer Senioren/innen an der Gesamtbevölkerung über60 Jahre sich bis zum Jahr 2010 mehr als verdoppeln, bis 2020 mehr als verdreifachenund bis 2030 verfünffachen wird. Im Falle einer Hilfe- und Pflegebedürftigkeitkönnen ältere Migranten/innen zwar noch auf starke innerfamiliäre Unterstützungspotenzialevertrauen. Experten/innen gehen jedoch davon aus, dass sich dieLebensentwürfe der Migranten/innen der zweiten und dritten Generation an deutscheanpassen werden, so dass die familiären Unterstützungspotenziale abnehmen unddie Inanspruchnahme professioneller pflegerischer Dienstleistungen durch diese gesellschaftlicheTeilpopulation in den nächsten Jahrzehnten aller Wahrscheinlichkeitnach steigen wird.Desgleichen werden in absehbarer Zeit mehr ältere behinderte Menschen mit einemerhöhten pflegerischen Versorgungsbedarf erwartet. Demografische Entwicklungenim Rheinland zeigen beispielsweise deutlich, dass die Gesamtheit der Behindertenimmer älter wird und sich in Richtung eines höheren Alters verschiebt.9
Der demografische Wandel steht in einem engen Verhältnis mit der Entwicklung desKrankheitsspektrums. Er wird nach allgemeiner Auffassung sehr wahrscheinlich zueiner Zunahme chronischer Krankheiten führen. Bereits heute gehen Schätzungender gesetzlichen Krankenversicherungen davon aus, dass der Anteil chronisch Krankerin der stationären und ambulanten Versorgung zwischen 40% und 50% beträgt(von Renteln-Kruse 2001). Weitere Ursachen für den Anstieg chronischer Erkrankungensind, dass mehr chronische Kranke ein höheres Lebensalter erleben und dermedizinische Fortschritt, der das Auftreten chronischer Krankheiten durch bessereBehandlungen und Therapien begünstigt (Sachverständigenrat für die KonzertierteAktion im Gesundheitswesen 2000/2001). Des Weiteren steigt statistisch betrachtetdas Risiko der Multimorbidität, d. h., dass Menschen im höheren Lebensalter anmehr als einer Krankheit erkranken. Die Gefahr von chronischen Erkrankungen istdabei größer, denn je stärker die Multimorbidität ausgeprägt ist, desto eher kommt eszum Auftreten von chronischen Krankheiten.Insgesamt bewirkt der demografische Wandel, dass sich chronische und multimorbidesowie geriatrische Erkrankungsspektren in den Vordergrund des Krankheitsgeschehensschieben. In den nächsten Jahren ist mit einer Zunahme manifester chronischerErkrankungen und der Hilfe- und Pflegebedürftigkeit zu rechnen (vgl. Hasseler& Görres 2005).Der soziale Wandel wird zu weiteren Veränderungen in den Pflegebedarfen undPflegebedarfskonstellationen führen. Gegenwärtig und in den nächsten Jahrzehntenprofitieren die Generationen von der Verlängerung der Lebenserwartung, denn diegemeinsame Lebenszeit der Generationen ist erheblich länger geworden. Die häufigvorhandene räumliche Wohnortnähe lässt die Übernahme von pflegerischen Tätigkeitenwahrscheinlicher werden, denn die meisten Tätigkeiten sind an direkte Kontaktegebunden. Dies bedeutet im Umkehrschluss, dass mit zunehmender Entfernungdie Wahrscheinlichkeit der Übernahme von pflegerischen Tätigkeiten sinkt(Kohli et al. 2000). Entscheidender aber ist, dass mit der Zunahme an kinderlosenEhepaaren, Singles und gleichgeschlechtlichen Formen des Zusammenlebenssich das Generationenverhältnis in einem erheblichen Maße verändern wird.Derzeit wird die Pflegetätigkeit von älteren Menschen zu fast drei Vierteln von weiblichenAngehörigen übernommen. Zukünftig stehen Frauen aufgrund veränderterNormal- und Erwerbsbiografien nicht mehr allein und in dem bisher gewohnten Maßefür pflegerische und betreuerische Leistungen zur Verfügung. Die traditionelle Familieallein wird und kann nicht mehr länger Garant für die Sicherung des Hilfe und Unterstützungsbedarfsim Alter sein.Aus diesen Entwicklungen lässt sich ableiten, dass zukünftig die Menschen auf Sozialbeziehungenund Hilfen außerhalb der Familien und traditionellen Lebensformenangewiesen sind und im höheren Lebensalter zu nicht verwandten Personen Beziehungenaufbauen und ggf. deren Hilfe in Anspruch nehmen müssen.• Gesundheitspolitischer WandelDie größte systemverändernde, gesundheitspolitische Maßnahme stellt die Einführungder DRGs dar. Die internationalen Erfahrungen mit DRGs zeigen, dass zwar dieKrankenhausverweildauern und -kosten verkürzt werden, jedoch wesentliche Effekteauf die stationär- klinischen und nachgelagerten Bereiche zu erwarten sind (vgl. ausführlichHasseler & Görres 2005). Für die Kliniken werden v. a. eine Verdichtung der10
Arbeit und Prozesse, Erhöhung der Fallzahlen, Auflösung der Abteilungsstrukturenund Veränderung in pflegerischer Organisation und Struktur sowie Verschlechterungder Arbeitsbedingungen für Pflegende in Kliniken (Betriebsklima, Motivation etc) diskutiert.Hinsichtlich Organisation und Strukturen der Kliniken werden v. a. eine Veränderungder Patientenaufnahme und Entlassung, Einführung von Clinical Pathwaysund ein erhöhter Bedarf an Kooperation und Verzahnung genannt.Durch die Verkürzung der Liegezeiten und demgemäß schnelleren Entlassung derPatienten/innen werden folgende Auswirkungen auf die nachsorgenden Bereicheerwartet:- frühzeitige Verlegung und Auslagerung von Leistungen und Patientengruppenin die stationäre Heimpflege, (geriatrische) Rehabilitation, Kurzzeit- und Tagespflege/-klinikensowie ambulante Pflege- Verschiebung der Behandlungs- und Pflegekosten in die nachsorgenden Bereiche- sektorale Finanzierungsprobleme- verfrühte Entlassung labiler Patienten/innen bzw. „blutige Entlassungen“- Zustrom an Patienten/innen mit therapeutischen Bedarfen in nachsorgendeBereiche (jüngere Patienten/innen mit Infektionserkrankungen, stark konsumierendenErkrankungen wie AIDS, chronisch fortschreitenden Erkrankungen,Drogenkonsum, mehr Demenz- und hirnorganische Erkrankungen)- Erhöhung der medizinisch-pflegerischen Behandlungspflege und sozialerBetreuung in den nachsorgenden Bereichen (z.B. Verbandswechsel, Verabreichenvon Injektionen und Infusionen u. ä.)- Zunahme der Fallschwere der Patienten/innen in diesen Bereichen- quantitative und qualitative Kapazitätsprobleme und Belegungsdruck aufgrundsteigender Nachfrage in den nachfolgenden Institutionen und Einrichtungen- Erhöhung von anleitenden und beratenden Tätigkeiten in den nachsorgendenBereichen- Zunahme von Krankenhaus-zu-Krankenhaus-Verlegungen- Drehtür-Effekte (Einweisung, Entlassung etc)- Versorgungsbrüche, Fehlplatzierung bspw. durch frühzeitige Entlassungen indie stationäre Rehabilitation- fehlende oder unzureichend sichergestellte Anschlussversorgung nach Entlassung- Anstieg der intersektoralen Verlagerungen und Anstieg der Verweildauern innachsorgenden Einrichtungen- Anstieg der Rehospitalisierung- inter- und intrasektorale Schnittstellenprobleme aufgrund mangelnder Zusammenarbeitzwischen Kliniken und nachsorgenden Institutionen, Dienstenund Einrichtungen- Entwicklung neuer Versorgungsbereiche wie Intermediärpflege- zunehmende Kooperationen zwischen den Kliniken11
- erhöhter Qualifikationsbedarf des Personals in den nachsorgenden Bereichen(vgl. Hasseler & Görres 2005).Mögliche Auswirkungen der Pflegeversicherung sind ebenfalls zu erwarten, ergebensich aber erst aus der Reform der Pflegeversicherung, frühestens Ende 2007. Zu erwartensind hier Impulse u. a. für die Bereiche Rehabilitation, Prävention, Förderungvon Selbstständigkeit und Autonomie.1.2 Zukünftige Dienstleistungen und notwendige Qualifikationender Gesundheits- und PflegeberufeGegenwärtige und zukünftige Bedarfskonstellationen pflegebedürftiger Menschenund Entwicklungsdynamiken in der pflegerischen und gesundheitlichen Versorgungführen zu veränderten Versorgungsbedarfen und neuen Anforderungen an die Pflege.Angesichts der demografischen, epidemiologischen, versorgungsstrukturellen undbesonders ökonomischen Entwicklungen in Deutschland und anderen europäischenStaaten sind die Anforderungen an die pflegerische und gesundheitliche Versorgunggewachsen und führen zu einer bisher deutlich unterschätzten Dynamik mit weit reichendenUmstrukturierungen (Görres & Böckler 2004).Ein wesentlicher Punkt, der für diese Dynamik und Neuorientierung nicht nur einenotwendige Voraussetzung und deren Konsequenz ist, sondern auch als Katalysatorfür ihre Beschleunigung betrachtet werden kann, ist der Faktor Qualifikation: Diegenannten Entwicklungsprozesse erfordern für die Qualifikation der GesundheitsundPflegeberufe einen ebenso umfangreichen Entwicklungsschub. Denn keineNeuorientierung in der gesundheitlichen Versorgung ist denkbar ohne eine parallellaufende Neuausrichtung von Ausbildungs- und Qualifikationszuschnitten, etwa imManagement, in der Informations- und Kommunikationstechnologie sowie im Hinblickauf multidisziplinäre bzw. interdisziplinäre Ausbildungsprofile. Dies betrifft vor allemdie gemeinsame Ausbildung bisher unterschiedlicher Berufsbilder wie Kranken-, Alten-und Kinderkrankenpflege ebenso wie den Zuschnitt neuer Aufgabenbereicheetwa im Bereich der Rehabilitation, Prävention, Gesundheitsförderung, des Pflege-,Qualitäts- und Schnittstellenmanagements und schließlich die teilweise Akademisierungund Internationalisierung der entsprechenden Ausbildungsgänge. Die Etablierungpflege- und auch gesundheitswissenschaftlicher Studiengänge hat neben dengenannten Rahmenbedingungen und Trends wesentlich zu einer Beschleunigunginnovativer Entwicklungen beigetragen.Dies wird zu einer Neudefinition klassischer und der Etablierung neuer Pflege- undGesundheitsberufe führen (vgl. Görres, Hoffmann & Terschüren 2000). Verbundendamit ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich Pflegepraxis und -berufe in neuen Handlungsfeldernbewegen und entsprechende Potenziale im tertiären Sektor entwickelnwerden (vgl. Robert Bosch Stiftung 2000: 351-353).Damit verändern sich der Charakter und auch das Selbstverständnis der Pflege: Wegvon einem allein körper- bzw. patientenbezogenen Handeln im Rahmen traditioneller12
stationärer, teilstationärer und ambulanter institutioneller Einrichtungen wie Krankenhäuser,Heime, ambulante Dienste etc. hin zu einer Pflege, die sich auch auf höherenAggregatsebenen, d. h. über die Patientenebene hinaus bewegt mit den Konsequenzen,dass sich nicht nur neue Märkte und neue Potenziale bilden, sondern auchneue Qualifikationen notwendig sind und auch das Verständnis darüber, was unterPflege zu verstehen ist, sich wandeln und neue Bezugsgrößen im Kontext neuer Paradigmenfinden muss. Landenberger (1998) sieht in diesem Kontext Pflegende alswesentliche Innovatoren für das Gesundheitswesen. Damit erfolgt zugleich eine Umorientierung:Von der relativen Binnenorientierung im Bereich des „Clinical care“ hinzu einer Außenorientierung pflegerischen Handelns im öffentlichen Raum im Sinnevon Public Health. Pflege bewegt sich damit auf höheren Aggregatsebene, wie z. B.Organisationen und Gemeinden (sekundärer Sektor) bzw. die Gesellschaftsebene(ökonomisch und strukturell; tertiärer Sektor), also Ebenen, die weit über das bisherige“Clinical care”, d. h. der Pflege von Personen in klassischen Einrichtungen (primärerSektor) hinausgehen (siehe Abb. 1).Target of InterventionHealthStructural orEconomicalLevelCommunityIndividualClinicalCareIllnessHealthPromotionPublicAdvocacyPublicPolicyType ofInterventionAbb. 1: Pflege und Public Health: Neue Zielsetzungen und Interventionstypen (in Anlehnung an Bouford1994)Damit verbunden sind verschiedene Entwicklungsperspektiven pflegerischen Handelnsund der Pflegeberufe:• Von der Krankheits- zur Gesundheitsorientierung: Pflege im öffentlichen Raumbedeutet angesichts der Herauslösung aus den traditionellen Versorgungsstrukturenauch eine Umorientierung von einem eher defizit- und an Krankheit orientiertenVerständnis hin zu einem Verständnis der Gesundheitsförderung, Präventionund Gesundheitsedukation.13
• Ziele der Intervention: Die Ziele der Intervention bewegen sich von der Aggregatsebeneder Personen in Gestalt des zu pflegenden Patienten, Heimbewohnersetc. über eine Gemeinde- bzw. Communityebene bis hin zu einer strukturellenbzw. ökonomischen Ebene und führen damit zu neuen Zielsetzungen für Pflegemit anderen pflegerischen Handlungsinhalten. Nicht mehr das einzelne zu pflegendeIndividuum allein ist der Fokus, auf das pflegerisches Handeln bezogenwird, sondern Größenordnungen wie Gemeinden bzw. die gesamte Bevölkerungeines Landes. Dies macht andere Formen der Intervention notwendig.• Formen der Intervention: Die Formen der Intervention wandeln sich notwendigerweisevom Clinical Care über Gesundheitsförderung hin zu Public Advocacy, alsoder Frage der advokatorischen Verantwortung für die Gesundheit ganzer Gruppen,Kommunen oder Bevölkerungen bis hin zur Option, den öffentlichen Raumbezogen auf gesundheitspolitische Belange mitzugestalten. Pflegerisches Handelnfindet spätestens hier ein völlig neues Selbstverständnis in Richtung "nichtpersonenbezogener"Dienstleistung, wenn es darum geht, den öffentlichen Raum bezogenauf gesundheitspolitische Belange mitzugestalten. Pflege nimmt schon andieser Stelle über eine Beratungsfunktion hinaus auch eine sozial- und gesundheitspolitischebzw. „fürsorgerische“ Funktion ein, wenn es um die Gestaltung vonVersorgungslandschaften geht und gewinnt viel stärker als bisher auch als notwendigerBestandteil unserer Kultur eine weit reichende Bedeutung.Diese Entwicklungen führen zusammengenommen auch dazu, Pflege und PublicHealth im pflegerischen Handeln miteinander zu verbinden und in der Konsequenzneue Zuschnitte pflegerischer Berufe und Ausbildungsgänge zu konzipieren. Dabeiergeben sich folgende Schwerpunkte zukünftigen pflegerischen Handelns (vgl. dazuausführlich Görres & Böckler 2004):• Beratung/InformationBeratung als Bestandteil beruflicher Handlungskompetenz Pflegender wird sich einerseitsauf der Mikroebene an Patient/innen, Klient/innen, Bewohner/innen und Angehörigedirekt richten. Denkbar sind in diesem Zusammenhang auch die Konzeptionund der Einsatz von Printmedien wie Broschüren und Publikationen, die inhaltlichdurch Pflegende gestaltet sind, sowie der Einsatz der Neuen Medien, Telekommunikationund Möglichkeiten der Nutzung von Multimediaanwendungen. Andererseitswird die Beratung von Organisationen und Institutionen auf der Makroebene an Bedeutungzunehmen. Bedarfe werden vor allem gesehen bei:• Pflege- und Krankenkassen (besonders Medizinischer Dienst der Kassen),• kommunalen Verbraucherberatungsstellen sowie -zentralen der Bundesländer,• Gesundheitsämtern,• Behörden und Ministerien,• Kindergärten und Schulen,• Trägern von Einrichtungen des Gesundheitswesens,• Wohlfahrtsverbänden und• Selbsthilfegruppen.In einer personenbezogenen Beratung werden dem Leistungsempfänger neben derkonkreten Einzelbegleitung auch institutionsbezogene Leistungsvergleiche über Angebote,Qualität und Kosten der Leistungserbringer angeboten. Es wird erwartet,14
dass der Bedarf an allgemeiner und spezieller Gesundheitsberatung steigt. Ein Tätigkeitsfeldfür Pflegende kann sich beispielsweise in der Wohnraum- oder Ernährungsberatungauftun sowie der Präventions- und Rehabilitationsberatung. PflegerischesPotenzial wird z. B. bei Fragen der Hilfsmittelversorgung und -organisation imhäuslichen Umfeld gesehen. Die Möglichkeiten einer institutionsunabhängigen Beratungstätigkeit,oder auch der Gutachtertätigkeit, bieten Pflegenden und Leistungsempfängerndie Chance, nachhaltig Rechte und Autonomie des Einzelnen im Gesundheitswesenzu stärken (Empowerment).Inhalte der organisations- und institutionsbezogenen vollprofessionellen Beratungwerden deutlicher als bisher Fragen der Pflegeüberleitung an der Schnittstelle stationär/ambulantbetreffen. Neue Trendentwicklungen werden darauf abzielen, Pflegendestärker als bisher in multiprofessionelle Teams des Gesundheitsdienstleistungssektorszu integrieren.• Gesundheitsförderung/Prävention/RehabilitationIm Wesentlichen sind hier die Prävention von Pflegebedürftigkeit und die Entwicklungpräventiver Konzepte für Familien und gesellschaftliche Randgruppen denkbar. EinPotenzial wird in der Entwicklung von Health Promotion Programmen durch Pflegendegesehen. Bedarfe werden besonders auf kommunaler (Community), betrieblicherund familiärer (Family Health Nurse) Ebene erwartet. Neben eigenständigen Kursangebotenkönnten Pflegende deutlicher als bisher Aufgaben der Gesundheitserziehungin Kindergärten und Schulen übernehmen. Auch die interdisziplinär angelegteUmsetzung der WHO-Konzeption Gesundheitsfördernder Krankenhäuser wird künftigdie Berufsgruppe der Pflegenden stärker mit einbeziehen. Wie im Feld der Beratungbereits angedeutet, bietet der Rehabilitationsbereich Raum für die Entwicklung neuerAufgaben der Pflege.• ManagementEs ist zu erwarten, dass Pflegende bereits jetzt etablierte Formen der Qualitätsentwicklungund -sicherung und des Qualitätsmanagements im Auftrag der Sozialgesetzgebungübernehmen und reorganisieren sowie Konzepte der Gesundheitslogistik,wie Case- und Care-Management umsetzen. Weitere Aufgabenfelder werden imBereich des betrieblichen Controllings gesehen, der eigenverantwortlichen Übernahmevon Aufgaben des betrieblichen Projekt- und Schnittstellenmanagements undder Einbeziehung Pflegender in innerbetriebliche strategische Planungen. In diesemKontext werden Potenziale gesehen, Pflegende in Prozesse der Unternehmens-,Personal- und Organisationsentwicklung in Gesundheitsunternehmen zu integrierenund in diesen Bereichen zu qualifizieren.• Koordination, Kooperation, VernetzungIm Kontext der zunehmenden Vernetzung von Strukturen des Gesundheits- und Sozialystemsauf institutioneller und regionaler Ebene, der Entwicklung von Versorgungskettenund Initiierung sozialer Netzwerke wird erwartet, dass Pflegende künftigvermehrt koordinatorische Aufgaben übernehmen. Dies wird nicht nur vor dem Hintergrundzu lösender Versorgungsprobleme und -engpässe geschehen, sondernauch, um die Vielfalt von Anbietern im Gesundheits- und Sozialsektor ökonomisch,kundenorientiert und Public Health orientiert zu verzahnen. Kooperation in multiprofessionellenTeams wird langfristig dazu führen, dass dem Leistungsempfänger Gesundheits-und Behandlungszentren zur Verfügung stehen, in denen die jeweiligen15
Akteure, z. B. Ärzte, Pflegedienste, Sozialarbeiter und Physiotherapeuten, ihreDienstleistungen bündeln.Nach Ansicht vieler Experten/innen wird sich im Bereich der Beratung der größteMarkt für Pflegende erschließen. Daneben werden den Bereichen Management undGesundheitsförderung/Prävention/Rehabilitation eine deutlich geringere aber dennochbemerkenswerte Relevanz zugesprochen. Des Weiteren lassen sich koordinierende,kooperierende und vernetzende Funktionen oder Tätigkeiten auf interdisziplinärerEbene identifizieren, wobei Pflegenden eine initiierende Rolle zugetraut wird.Die Entwicklung von Public Health orientierten Versorgungsstrukturen in der Pflegewird in Abhängigkeit zum sich entwickelnden Professionalisierungsgrad gesehen undmuss lebhafter als bisher innerhalb der Profession Pflege diskutiert werden. Diesmacht langfristig weitere Investitionen in Aus- und Weiterbildung notwendig.Zusammengefasst orientiert sich der erwartete Bedarf insbesondere an Prävention,Unterstützung von Rehabilitationsmaßnahmen, Beratung angesichts der Folgen sozio-demographischerEntwicklungen, steigenden Qualitätsansprüchen an gesundheitlicheVersorgung sowie dem Wunsch nach interdisziplinärer Kommunikation undKooperation (vgl. dazu ausführlich Görres & Böckler 2004).1.3 Eckpunkte einer QualifizierungsoffensiveFür die zu erwartende Entwicklung und damit einhergehende Notwendigkeit einerhoch angesetzten Qualifizierung erwirken die parallel dazu forcierten Professionalisierungbestrebungenvon Pflegekräften, die fortschreitende Etablierung der Pflegewissenschaftund -forschung und die damit verbundenen zahlreichen Reformdiskussioneneine zusätzliche Dynamisierung mit ganz neuen Schwerpunktsetzungenin der Qualifizierung: Problemdiagnosefähigkeit sowie die Kompetenz, organisations-,situations- und personenspezifisch Lösungen voranzutreiben, sind zukünftigbedeutende Qualifikationen, vor allem zur Steuerung und Optimierung von Prozessen.Die Optimierung und damit das Qualitätsniveau von Pflegeprozessen sind entscheidendabhängig von der Qualifikation der Mitarbeiter/innen. Ein hohes Qualifikationsniveauschafft erst die Voraussetzung für eine ausgeprägt hohe Qualität der Leistungserbringung.Anders sind nachhaltige Innovations- und Qualitätsprozesse kaumzu erzielen.Es macht daher gesellschafts-, bildungs- und versorgungspolitisch betrachtet Sinn,eine Qualifizierungsoffensive zu starten mit dem Ziel, durch eine Aus-, Fort- und Weiterbildungauf hohem Niveau deutlich zur Verbesserung der Pflegequalität und zurAttraktivitätssteigerung des Pflegeberufs hinzuwirken. Diese Qualifizierungsoffensivesollte folgende Strategien verfolgen:• verändertes Verständnis des Bildungsbegriffs in einer sich wandelnden Gesellschaft• zukunftsweisende Abschlüsse: integrierte, generalistische oder integrativeAusbildung mit weiterer Spezialisierung• Dynamisierung des Theorie-Praxis-Transfers• Modernisierung von Schulstrukturen und Entwicklung von Schulkulturen16
• durchlässiges, flexibles Stufensystem der Qualifikationen und neue Handlungsfelder:Orientierung an Bedarfen• Implementation von Qualitätssicherungssystemen, kontinuierliche Qualitätsentwicklungund – verbesserung als Beitrag zur Professionalisierung• Einrichtung von Pilotschulen und Transfernetzwerken als Innovationspools:Modellprojekte• kontinuierliche arbeitsplatzbezogene Fort- und Weiterbildung• konsequente Weiterentwicklung der akademischen <strong>Pflegeausbildung</strong>.1.4 Zusammenfassendes Fazit: Reform der <strong>Pflegeausbildung</strong>Die Begründungen für eine grundlegende Reform der <strong>Pflegeausbildung</strong> sind vielfältig:Zunehmende Hochaltrigkeit mit einem Anstieg von Pflegebedürftigkeit, Zunahmechronischer Erkrankungen und dementieller Veränderungen, Abnahme familiärerPflegekapazitäten und der steigende Bedarf integrierter Versorgungsstrukturen mitneuen Aufgabenzuschnitten für Gesundheits- und Pflegeberufe weisen heute schonauf einen Mehrbedarf an professionellen Pflegeleistungen hin und erfordern ein deutlicherweitertes Kompetenzprofil der Pflege sowie einen hohen Qualitätsstandard der<strong>Pflegeausbildung</strong>. Die Attraktivität des Pflegeberufes, die dringend notwendige Sicherstellungdes Berufsnachwuchses sowie die Finanzierung und gesetzliche Verankerungeiner zeitgemäßen <strong>Pflegeausbildung</strong> werden in den nächsten Jahren undJahrzehnten eine zentrale gesellschaftliche Herausforderung darstellen.Die Novellierung des Krankenpflegegesetzes, die Verabschiedung des bundeseinheitlichenAltenpflegegesetzes und die in beiden Gesetzen enthaltenen Modellklauselnsowie diverse Förderungsprogramme und –aktivitäten sind Schritte in dieseRichtung, wenn es darum geht, die Reform der <strong>Pflegeausbildung</strong> voranzutreiben undeine hohe Qualität pflegerischer Dienstleistungen sicher zu stellen. Als impulsgebendfür eine Reformierung der <strong>Pflegeausbildung</strong> kann i. S. einer konzeptionellen Vorarbeitdie Denkschrift der Robert-Bosch-Stiftung „Pflege neu denken – Zur Zukunft der<strong>Pflegeausbildung</strong>“ (2000) angesehen werden. Eine unabhängige Expertenkommissionerarbeitete in der „Zukunftswerkstatt <strong>Pflegeausbildung</strong>“ Empfehlungen für eineNeugestaltung der <strong>Pflegeausbildung</strong>. In diesem Konzept wird die bestehende Differenzierungder pflegerischen Berufe nach Lebensphasen der Pflegeempfänger abgelöstvon einer <strong>Pflegeausbildung</strong>, die durch Qualifikationsstufen gegliedert und amPflegebedarf orientiert istVor diesem Hintergrund entstanden in den letzten Jahren bundesweit Modellprojekte,deren Gegenstand die Entwicklung und Erprobung einer zukunftsfähigen, integrierten,generalistischen oder integrativen <strong>Pflegeausbildung</strong> ist. Sie nutzen damit jeneMöglichkeiten, die ihnen die Modellklauseln der neuen Berufsgesetze der KrankenundAltenpflege einräumen. Der Gesetzgeber will mit ihnen nicht nur die Neuordnungder beruflichen Pflege bestimmen, deren Professionalisierung unterstützen und diebisher unterschiedlich geregelten Ausbildungen auf eine gemeinsame Grundlagestellen und gleiche Voraussetzungen schaffen. Die Modellklauseln beider Gesetzesollen auch die Rahmenbedingungen, strukturellen sowie inhaltlichen Konzepte deutlichweiter entwickeln und ein innovatives Potenzial freisetzen (Stöcker <strong>2002</strong>).Fast 50 umfassende Modellvorhaben verfolgen strukturell und inhaltlich z. T. unterschiedlicheAnsätze, die sich alle durch einen hohen Innovationsgehalt auszeichnen,17
welcher sich z.B. in der Dauer der Ausbildung oder bei den Berufsabschlüssen widerspiegelt.Die klassische Dreiteilung der Pflegeberufe verliert schrittweise ihre Bedeutungund ermöglicht eine neue Sicht auf die Potenziale der Pflege selbst, aberauch auf deren Einsatzfelder (vgl. Görres & Wicha 2005).Vielen Ausbildungskonzepten, die in den letzten Jahren entstanden und im Entstehensind, ist gemein, dass sie Modellcharakter besitzen. Wichtig für eine Verstetigungpositiver Aspekte der Modelle hin zu einer Reform der <strong>Pflegeausbildung</strong> ist,dass die Projekte systematisch evaluiert werden.Die „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell ©“ mit ihrem hohen Innovationsgehaltzählt zu einem der wichtigsten Projekte hinsichtlich politischer Richtungsentscheidungenzukünftiger <strong>Pflegeausbildung</strong>en.1.5 Kurzbeschreibung des Modellprojektes „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>:Das Stuttgarter Modell ©“Die Konzeption der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell ©“ ist füreinen Zeitraum von dreieinhalb Jahren angelegt (vgl. Abb. 2). Diese beruht auf einergemeinsamen Basisausbildung mit zunehmender Differenzierung in den SchwerpunktenGesundheits- und Kinderkrankenpflege, Altenpflege und Gesundheits- undKrankenpflege. Die Ausbildung ermöglicht den Erwerb von zwei gleichwertigen Berufsabschlüssenbzw. von einem Berufsabschluss gekoppelt mit einem Zertifikat,welches den Absolventen/innen ein Fundament an Wissen und Können im Bereichder Prozess- und Fallsteuerung in der Pflege attestiert (vgl. Kerngruppe Curriculum<strong>2006</strong>).18
Abb. 2: Grafik Ausbildungsmodell (Quelle: http://www.ipa-stuttgartermodell.de/)Das Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell ©“5 ist durchfolgende Eckpunkte gekennzeichnet (vgl. Kerngruppe Curriculum <strong>2006</strong>):- Schwerpunktsetzung und Spezialisierung im Berufsfeld Pflege auf der Grundlageeiner Integration der Kinderkranken-, Kranken- und Altenpflegeausbildungsgänge.- Entwicklung eines an Kompetenzen ausgerichteten lernfeldorientierten Curriculums,das sowohl auf einem pflegeberuflichen und pädagogischen Begründungsrahmenbasiert, als auch an den aktuellen sowie zukünftigen Anforderungenan den Pflegeberuf ausgerichtet ist.- Inhaltliche und strukturelle Gestaltung auf der Grundlage von Ausbildungsprinzipien:Orientierung am Handeln von Menschen, Wissenschaftsorientierung,Lebenslauforientierung, Theorie-Praxis-Vernetzung und Fächerintegration.- Entwicklung von beruflicher Handlungskompetenz vor dem Hintergrund einesKompetenzmodells, dem die analytisch-reflexive Begründungskompetenz, diepraktisch-technische, die interaktive, die ethisch-moralische Kompetenz, diegesellschafts- und berufspolitische, die organisations- und systembezogenesowie die Planungs- und Steuerungskompetenz zugrunde liegen.5 Das Modellprojekt wurde von der Robert-Bosch-Stiftung und dem Ministerium für Arbeit und Soziales(Baden-Württemberg) gefördert, Kontakt: Internet: www.iap-stuttgartermodell.de19
An der Entwicklung des theorie-praxisintegrativen Curriculums für die <strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong> arbeitete seit Dezember 2000 unter prozessualen Revisionen undinterner Evaluation eine Expertengruppe, die sich aus Vertretern/innen der Gesundheits-und Kinderkrankenpflege, Gesundheits- und Krankenpflege, Altenpflege sowieWissenschaftlern/innen zusammensetzte. Die wissenschaftliche Fundierung derAusbildungskonzeption erfolgte über einen pflegeberuflichen und pädagogischenBegründungsrahmen, der die Basis für das Curriculum darstellt. Hier wurden dieAusgangspunkte, Grundlagen und Prinzipien des integrativen Modells beschriebensowie die berufspädagogischen, didaktischen und methodischen Entscheidungendifferenziert begründet (vgl. Kerngruppe Curriculum <strong>2006</strong>).Zentrales Merkmal des Modellprojekts ist die Vielfalt der Kooperationspartner 6 , dieden Auszubildenden das Kennen lernen vielfältiger betrieblicher Einsatzorte von denklassischen stationären und ambulanten Institutionen bis hin zu Einrichtungen derGesundheitsförderung, Rehabilitation, Palliativpflege und Prävention ermöglicht.Damit gründet sich das entwickelnde Berufs- und Rollenverständnis der Auszubildendenauf den diversen Leitbildern und Kulturen der jeweiligen Einrichtungen.Gleichzeitig profitieren die Kooperationspartner von den zu erwartenden und durchdas Modellprojekt forcierten Innovationen und Synergieeffekten (vgl. Kap. 4.5).6 Im <strong>2002</strong> gegründeten Kooperationsverbund kooperieren folgende Träger und Einrichtungen in <strong>Modellkurs</strong> bezogenerZusammensetzung: Caritasverband für Stuttgart e.V.: Haus St. Monika, Haus Martinus, Haus AdamMüller-Guttenbrunn; Evangelische Gesamtkirchengemeinde Stuttgart: Diakoniestation Stuttgart; Institut fürsoziale Berufe Stuttgart gGmbH: Fachschule für Altenpflege; Evangelische Heimstiftung e.V. Stuttgart:Württembergisches Lutherstift; Karl-Wacker-Heim; Klinikum Stuttgart Olgahospital: Bildungszentrum - Schulefür Gesundheits- und Kinderkrankenpflege; Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung: Altenzentrum St. Vinzenz, AltenzentrumSt. Lukas; Rems-Murr-Kliniken: Kreiskrankenhaus Waiblingen, Kinderkrankenpflegeschule; Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH: Modellschule für integrative <strong>Pflegeausbildung</strong>; Samariterstiftung: SamariterstiftungZuffenhausen, Seniorenzentrum am Parksee, Ökumenische Diakonie- und Sozialstation Sillenbuch, SamariterstiftOstfildern; Stiftung Evangelische Altenheimat: Emma-Reichle-Heim, Richard-Bürger-Heim; Vinzenzvon Paul Kliniken gGmbH: Marienhospital Stuttgart, Krankenpflegeschule; Wohlfahrtswerk für Baden-Württemberg: Else-Heydlauf-Stiftung, Haus am Weinberg.20
2.Evaluation im ModellprojektDie externe Evaluation des Modellprojekts „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das StuttgarterModell © “ führte die Abteilung Interdisziplinäre Alterns- und Pflegeforschung (iap),Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP) der Universität Bremen, unterder wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr. Stefan Görres durch. Sie bezog sichauf die gesamte Projektlaufzeit vom 01.07.<strong>2002</strong> - 31.12.<strong>2006</strong> und umfasste die Planungs-,Einführungs- und Hauptphase sowie das Follow-up (vgl. Kap. 3). AusführlicheErgebnisse aus den Jahren <strong>2002</strong>-2005 sind den Zwischenberichten zu entnehmen7 , der vorliegende <strong>Abschlussbericht</strong> beschränkt sich auf die wesentlichen Erkenntnisseaus diesem Zeitraum und fokussiert hingegen das Ende der Hauptphasesowie das Follow-up.2.1 Zielsetzung und Verlauf der EvaluationDas Erkenntnisinteresse der systematischen Evaluation des Modellprojekts „<strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ lag v. a. auf der Frage, ob durch eineintegrativ angelegte <strong>Pflegeausbildung</strong> die Auszubildenden zukunftsweisend, d. h. inHinsicht auf die neuen Anforderungen an Pflege mit einem sich wandelnden BerufsundHandlungsfeld qualifiziert werden. Im Einzelnen wurde untersucht (vgl. dazuauch Kap. 2.3),• inwieweit der durch die curriculare Konzeption intendierte Kompetenzerwerbund die Entwicklung eines zukunftsgerichteten Pflegeverständnisses der Modellteilnehmer/innenan den Lernorten Schule und Pflegepraxis wirksam undempirisch darstellbar sind,• inwieweit sich hinsichtlich der Rahmenbedingungen, curricularen Prozesse,Wissens- und Kompetenzentwicklung aller Beteiligten sowie der Transfereignungund Nachhaltigkeit des Modells förderliche bzw. begrenzende Einflussfaktorenidentifizieren lassen und• welche Maßnahmen sich bewähren und für eine Übernahme in die Regelausbildungempfehlen lassen.2.2 Methodisches VorgehenDas methodische Vorgehen der Evaluation orientierte sich am Forschungsansatz derexperimentierenden Evaluation (Heiner 1998; Rossi et al. 1988; Görres & Stöver2005). Der Forschungsansatz ist darauf ausgerichtet, die Vorstellungen der Praxismitzuentwickeln und das Gelingen des Modellprojekts, seine Übertragbarkeit und dieVerbreitung gewonnener Erfahrungen zu fördern. Die experimentierende Evaluation7 Bericht zu Workflow und Prozessrealisierung (April <strong>2002</strong>)Erste Ergebnisse zu Arbeits-, Lehr- und Lernprozessen aus der Einführungsphase (Zeitraum 01.10.<strong>2002</strong> –31.12.<strong>2002</strong>)Zweiter Zwischenbericht zu den Lehr-/Lernprozessen am Lernort Schule und am Lernort Praxis (Zeitraum01.01.2003 – 31.07.2003)Abschließender Zwischenbericht (April 2004)Kurzbericht zum Assessment-Center (Mai 2004)Zwischenbericht – Evaluation der Hauptphase (Mai 2005)21
sieht eine Verknüpfung von Praxishandeln und -forschung vor, verbunden mit einerresponsiven und partizipativen Ausrichtung. Der Ansatz erfordert einen hohen Anteilan Reflexionsarbeit vor und während der Untersuchungen. Evaluatoren/innen undProjektbeteiligte sind herausgefordert, sich auf wechselseitige Lernprozesse zugunsteneiner detaillierten Analyse der Interventionsergebnisse und -prozesse einzulassen.Dies ermöglicht die gedankliche und praktische Erprobung von Interventionsalternativenund -varianten.Die Evaluation des Modellprojekts erfolgte auf der Grundlage einer Struktur-, Prozess-und Ergebnisevaluation mit einem sich daran anschließenden Follow-up. Diefolgende Abbildung fasst die Ziele der Evaluation zusammen und gibt einen Überblickzum zeitlichen Verlauf der Studie (vgl. Abb. 3).Abb. 3: Ziele und Verlauf der EvaluationDie Strukturevaluation analysierte die Modellentwicklung durch eine Dokumentationder ablaufenden Prozesse, Rahmenbedingungen und Steuerungsmaßnahmen. DasErkenntnisinteresse galt der Ist-Analyse der Rahmen- und Ausbildungsbedingungendes Modells sowie den relevanten strukturbildenden Entscheidungspunkten. Darausließen sich zentrale Zielsetzungen und deren Begründungsargumentationen bzgl. derAusbildungsanforderungen, -inhalte und -strukturen herausfiltern und für die Entwicklungvon Umsetzungsstrategien nutzen.Die Prozessevaluation beabsichtigte, den Implementierungs- bzw. Prozessverlauf,dessen Rahmenbedingungen sowie Wirkung hinsichtlich der gesetzten innovativenZiele unter Einbezug unterschiedlicher Zielgruppen empirisch zu untersuchen. Von22
Interesse waren dabei sowohl förderliche Faktoren als auch Umsetzungshindernisseund -probleme, die, frühzeitig erkannt, zur Modifikation der Implementierungsstrategienbeitragen konnten. Ein besonderer Schwerpunkt lag auf der Evaluation desEntwicklungs- und Umsetzungsprozesses der curricularen Konzeption des Modellsim Hinblick auf die Gestaltung der Lehr-/ Lernprozesse, der Kompetenz- und Pflegeverständnisentwicklungsowie des Theorie-Praxis-Transfers mit möglichen Auswirkungenund nachfolgenden Veränderungen.Die Ergebnisevaluation richtete sich im Wesentlichen auf die Frage, inwieweit undin welcher Form die intendierten Ziele und Maßnahmen des Projektes erreicht bzw.welche Modifikations- und Implementierungsstrategien entwickelt wurden und für einenTransfer in die „Fläche“ geeignet sind (vgl. Görres & Stöver 2005).Im Fokus der Anschlussuntersuchung (Follow-up) standen Fragen zur Akzeptanzintegrativ Ausgebildeter bezüglich ihrer Qualifizierung und Einsatzmöglichkeiten aufdem Arbeitsmarkt ebenso im Vordergrund wie der bundesweite Bekanntheitsgraddes Modells und die Synergieeffekte bzw. möglichen Veränderungen durch das Modellin den Ausbildungsstätten Schule und Pflegepraxis. Ferner wurden möglicheAuswirkungen auf die weitere politische Planung hinsichtlich zukünftiger <strong>Pflegeausbildung</strong>enerfasst. Damit konnten Aussagen zur Akzeptanz, zum Transfer und zurNachhaltigkeit des Modellprojekts formuliert werden.2.3 UntersuchungsschwerpunkteFolgende Untersuchungsfragen 8 waren für die Evaluation forschungsleitend:F1: Welche Aussagen können zum Verhältnis der Generalisierung und Spezialisierunghinsichtlich einer Vorbereitung auf das zukünftige Berufsfeld getroffenwerden?F2: Welchen Einfluss hat die curriculare Konzeption auf das Berufsverständnis derAuszubildenden?F3: Welchen Einfluss hat die curriculare Konzeption auf die Entwicklung der beruflichenHandlungskompetenz der Auszubildenden?F4: Welchen Einfluss hat die curriculare Konzeption auf die Gestaltung der Lehr-,Lernprozesse und das Rollenverständnis der Lehrenden?F5: Inwieweit fördern der Lernfeldansatz und die dem Ausbildungsmodell zugrundeliegenden Lernortkooperationen einen Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfer?F6: Welche Innovationen und Synergieeffekte lassen sich in der „<strong>Integrative</strong>n8 Die Hauptuntersuchungsfragen wurden von Seiten des iap mit den Mitgliedern der Kerngruppe Curriculum prozessorientiertkommuniziert und überarbeitet bzw. im Projektverlauf ergänzt. Da die Untersuchungsfragen überunterschiedliche Reichweiten verfügten, wurde je nach Evaluationszeitraum eine Differenzierung vorgenommen(vgl. Görres, Böhnke, Stöver & Keuchel 2004; Görres, Stöver, Schmitt, Geiß, Stolle, Bohns & Dmitrieva 2005).23
<strong>Pflegeausbildung</strong>“ hinsichtlich einer Modernisierung der Pflegeberufe, die denaktuellen Anforderungen Genüge leisten, identifizieren? – Erste Einschätzunghinsichtlich der Bewährung bzw. Akzeptanz des AusbildungsmodellsF7: Welche Aussagen können im Hinblick auf eine im nationalen Vergleich wettbewerbsfähige<strong>Pflegeausbildung</strong> und deren Anschlussfähigkeit auf dem europäischenMarkt getroffen werden?F8: Welche Veränderungen bzw. Innovationen werden in den Praxiseinrichtungender Kooperationspartner/innen durch die „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>“ angestoßen?Als Ergebnis der internen Evaluation der Kerngruppe Curriculum ergab sich im Ausbildungsverlaufeine besondere Problematik im Bereich Transferlernen. Da dieserThematik eine wesentliche Bedeutung zukommt, wurde im Juli 2005 ein Auftrag andie externe Evaluation hinsichtlich eines zusätzlich zu fokussierenden Untersuchungsschwerpunkteserteilt (vgl. Kerngruppe Curriculum 2005). Folgende Fragenwurden zu diesem Untersuchungsschwerpunkt formuliert:• Wie gelingt das Transferlernen von der Lernsituation im Unterricht auf neue Situationenin der Pflegepraxis?• Wie wird das Verhältnis zwischen integrativ angelegten Ausbildungsinhalten undder Schwerpunktsetzung eingeschätzt?• Welche Optimierungsmöglichkeiten zur Unterstützung des Transferlernens lassensich ableiten?2.4 Erhebungs-, Auswertungsmethoden und ZielgruppenDie folgenden Ausführungen erläutern die Methoden der Datenerhebung und -auswertung mit anschließender Beschreibung der jeweiligen Zielgruppen, abgetragenauf einer Zeitachse (vgl. Abb. 4). Die Datenerhebung und -auswertung erfolgteim Sinne einer Triangulation von quantitativen und qualitativen Elementen der empirischenSozialforschung. Insbesondere bedurfte es einer deskriptiven Herangehensweisen,um bislang zum Forschungsgegenstand Unbekanntes zu erfassen und eineGrundlage für mögliche Operationalisierungen zu schaffen bzw. im Prozess der Explorationeiner Fragestellung die Operationalisierungen zu überprüfen (vgl. Schnell,Hill & Esser 1995).Die mittels Fragebögen (39 Erhebungen, n=740) erhobenen quantitativen Datenwurden mit dem Statistikprogramm SPSS 12.0 ausgewertet. Die Analyse der offenenFragen erfolgte nach einem inhaltsanalytischen Vorgehen durch Bildung von Auswertungskategorienmit entsprechenden Merkmalsausprägungen (vgl. Mayring2000).Innerhalb der ersten beiden Ausbildungsjahre kam zweimal ein Bogen zur Selbsteinschätzungder Kompetenzen von Zimber & Teufel (1999) im <strong>Modellkurs</strong> und inden Vergleichsgruppen zum Einsatz. Auf der Grundlage verschiedener inhaltlicher24
Diskussionen wurde auf weitere Datenerhebungen mithilfe dieses Instruments verzichtet,da er keine Aufschlüsse über die tatsächliche Kompetenzentwicklung derZielgruppen versprach 9 .Abb. 4: Übersicht des Projektverlaufs mit jeweiligen Erhebungszeitpunkten und –methoden sowieZielgruppenDie mithilfe eines Leitfadens geführten Gruppendiskussionen (9 Erhebungen,n=91) wurden auf Tonband aufgezeichnet und anschließend transkribiert. Ihre Auswertungorientierte sich an der Methode der interpretativ-reduktiven Inhaltsanalysenach Lamnek (1998) sowie der thematischen Inhaltsanalyse nach Burnard (1991),indem auf der Grundlage der Daten und in Orientierung am Leitfaden Themen undKategorien gebildet wurden.9 Nach der Datenerhebung T4 (Oktober 2003) erfolgten in Absprache mit der Kerngruppe Curriculum eine Modifikationder Items und deren Zuordnung zu den dem Modellprojekt zugrunde liegenden Kompetenzbereichen. Indieser überarbeiteten Form wurde das Instrument zum Erhebungszeitpunkt T6 (November 2004) erneut eingesetzt.Aufgrund der Anpassungen waren ein Vergleich mit den Daten zum Erhebungszeitpunkt T4 sowie eineVerlaufsbeschreibung der Kompetenzentwicklung nur eingeschränkt möglich. Weiterhin ergab sich das Problem,dass sich viele Teilnehmende bereits bei der ersten Erhebung in nahezu allen Bereichen als vollends kompetenteinstuften, sodass nach Einschätzung der Befragten bereits im ersten Ausbildungsjahr eine weitere Kompetenzentwicklungkaum möglich schien.25
Als Basis für die Telefoninterviews (5 Erhebungen, n=59) fungierte ein standardisierterFragebogen bei einer gleichzeitigen bzw. zeitnahen Protokollierung der Antworten(Bortz & Döring 2003). Die Analyse orientierte sich an den Auswertungskriteriender schriftlichen Befragungen und beinhaltete damit oben beschriebene quantitativeund qualitative Anteile.Zur Kompetenzerfassung führten zwei Teams mit jeweils zwei Beobachter/innen dienicht-teilnehmende Beobachtung (1 Erhebung, n=6) von praktischen Prüfungenzum zweiten Berufsabschluss der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen in der Krankenpflege(3), Kinderkrankenpflege (2) und Altenpflege (1) durch. Ein strukturiertes Beobachtungsrasterund ein halbstandardisiertes Protokollierungsformular ergänzten die offeneBeobachtung (vgl. Schnell, Hill & Esser 1995). Die Datenauswertung bedientesich einer thematischen Inhaltsanalyse unter Zuordnung zu einzelnen Kategorien(vgl. Bortz & Döring 2003) sowie des Statistikprogramms SPSS 12.0 (zum methodischenVorgehen vgl. auch Kap. 4.2).Folgende Hauptakteure/innen des Modellprojekts bildeten die Zielgruppen für obengenannte Untersuchungen:• <strong>Modellkurs</strong>,• Vergleichsgruppen der regulären Ausbildungsgänge der Altenpflege, Gesundheits-und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege,• Praxisanleiter/innen,• Pflegedienstleitungen (PDL) , Stations- und Wohnbereichsleitungen,• Trägervertreter/innen und Kooperationspartner/innen,• Lehrer/innen und Schulleitungen,• Experten/innen,• Vertreter/innen der Ministerien,• Workshopteilnehmer/innen.Während die Anzahl der Teilnehmer/innen am Modellprojekt am Robert-Bosch-Krankenhaus zu Ausbildungsbeginn n=28 betrug, lag sie am Ende der Ausbildungbei n=23 (Abbruchquote von 17,8%). Im Verlauf der gesamten Projektevaluationnahmen die Auszubildenden in regelmäßigen Abständen an neun schriftlichen Befragungenteil (T1/n=28; T2/n=27; T3/n=28; T4/n=26; T5/n=23; T6/n=22; T7/n=23;T8/n=23; T9/n=15). Mittels drei Gruppendiskussionen (t1/n=26; t2/n=23; t3/n=23), imjeweiligen Ausbildungsjahr eine, erfolgte eine mündliche Datensammlung. Eine nichtteilnehmendeBeobachtung (B1/n=6) fand bei den praktischen Examensprüfungenstatt.Die Vergleichsgruppen fungierten im Sinne von Kontrollgruppen, um die innovativenEffekte des Modellprojekts herauszuarbeiten und Rückschlüsse auf die Unterschiedezu den regulären Ausbildungsgängen vorzunehmen. Parallel zu den Teilnehmern/innendes Modellprojekts fand die schriftliche Befragung der Vergleichsgruppen(T1-T7) mit größtenteils identischen Fragestellungen statt:- Auszubildende der Gesundheits- und Krankenpflege (KP) der Krankenpflegeschuledes Evangelischen Diakoniewerks in Schwäbisch-Hall, Ausbildungsbeginn:n=18 (T1/n=18, T2/n=18, T3/n=18, T4/n=16, T5/n=17, T6/n=18,T7/n=18).- Auszubildende der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege (KKP) der Kinderkrankenpflegeschuledes Evangelischen Diakoniewerks in Schwäbisch-Hall,26
Ausbildungsbeginn: n=12 (T1/n=12, T2/n=12, T3/n=11, T4/n=11, T5/n=11,T6/n=11, T7/n=11).- Auszubildende der Altenpflege (AP) an der Fachschule für Altenpflege in Filderstadt,Ausbildungsbeginn: n=25 (T1/n=20, T2/n=25, T3/n=18, T4/n=20,T5/n=18, T6/n=21, T7/n=18).Die Erhebungen der Lehrer/innen und Schulleitungen des Modellprojekts fandenim Rahmen einer Gruppendiskussion (t1/n=8) zu Beginn des Projekts, mittels dreischriftlicher Befragungen (T1/n=22, T2/n=15, T3/n=11) während der Ausbildung sowienach Ausbildungsende im Follow-up mit einem Telefoninterview (TI 1/n=6) statt.Vor dem Hintergrund der Evaluationsziele wurden die Befragungsteilnehmer/innen inAbsprache mit den Projektverantwortlichen nach speziellen Kriterien (z. B. Häufigkeitder bisherigen Einsätze im <strong>Modellkurs</strong>) ausgewählt.Zur Zielgruppe der Praxisanleiter/innen zählten die für die praktische Ausbildungder <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen verantwortlichen Praxisanleiter/innen der jeweiligenPraxiseinsatzorte. In den beiden letzten Ausbildungsjahren wurden sie mündlich imRahmen von zwei Gruppendiskussionen (t1/n=4, t2/n=7) sowie schriftlich mittels vierFragebogenerhebungen (T1/n=21, T2/n=22, T3/n=23, T4/n=25) während des Projektverlaufsbefragt.Im dritten Ausbildungsjahr waren die Kooperationspartner/innen des ModellprojektsZielgruppe eines Telefoninterviews (TI 1/n=22). Unterschieden wurde zwischenTrägervertretern/innen (n=11), zu denen die Geschäftsführungen, Verwaltungsdirektoren/innenund Vorstände zählten, sowie Einrichtungsleitern/innen (n=11), die sichaus Pflegedirektoren/innen, Wohnbereichs- und Heimleitungen zusammensetzten.Die im dritten Ausbildungsjahr von der Kerngruppe Curriculum ausgewählte und mittelsTelefoninterviews befragte Zielgruppe der Experten/innen (TI 1/n=15) bestandaus für verschiedene Bereiche in der Pflege und Bildung verantwortlichen Vertretern/innender Politik, Ministerien, Verwaltung und Berufsverbänden.Im Rahmen des Follow-up erhielten die Pflegedirektoren/innen bzw. Einrichtungs-,Heim-, Pflegedienst-, Abteilungs-, Wohnbereichs- und Stationsleitungen jener Institutionen,in denen die Modellprojektabsolventen/innen einen Arbeitsplatz fanden, einenFragebogen (T1/n=24). Dies ermöglichte eine Rückmeldung zu den Absolventen/innenbzw. zur Umsetzung des Modellprojekts in der Praxis.Das Follow-up beinhaltete außerdem eine mündliche Befragung aller bundesweitenfür die Gesundheits- und Krankenpflege- bzw. Altenpflegeausbildung zuständigenVertreter/innen der Ministerien mittels Telefoninterviews bzw. einer Fragebogenbeantwortungper Mail (TI 1/n=16) zu Bekanntheitsgrad und Transferfähigkeit des Modells.Zur letzten Zielgruppe des Follow-up zählten die Workshopteilnehmer/innen, dievon der Kerngruppe Curriculum initiierte und angebotene Workshops zum Lernfeldansatzbzw. der Lernerfolgsbewertung besucht hatten. Intention dieser Fragebogenerhebung(T1/n=54) war es, die Übertragbarkeit von Modellanteilen des Projekts aufandere <strong>Pflegeausbildung</strong>seinrichtungen zu untersuchen.27
2.5 KurzzusammenfassungDie Evaluation (Struktur-, Prozess- und Ergebnisevaluation mit dem sich anschließendenFollow-up) hatte zum Ziel, wesentliche Ergebnisse des Modellprojektes hinsichtlichseiner Konzeption, Ausgestaltung, Durchführung, des Nutzens und des Zielerreichungsgradeszu sichern bzw. Maßnahmen zu identifizieren, die für einenTransfer in die „Fläche“ bzw. für die Übernahme in die Regelausbildung empfohlenwerden können. Hierzu wurde die Evaluation über die gesamte Laufzeit des Modellprojektes(01.07.<strong>2002</strong> - 31.12.<strong>2006</strong>) auf nachfolgende zentrale Aspekte ausgerichtet(vgl. Görres, Stöver, Schmitt, Geiß, Stolle, Bohns & Dmitrieva 2005):• Gewährleistung des Prozess- und Ergebniscontrollings;• Überprüfung von Maßnahmen hinsichtlich der Wirkungsweise und Effektivität;• Erkennung von Umsetzungshindernissen und -problemen;• Rückkopplung von Modifikationen der Interventionsmaßnahmen und Implementationsstrategienan die Kerngruppe Curriculum;• Überprüfung der intendierten Ziele sowie Identifikation und Sicherung transferfähigerElemente und Synergieeffekte;• Erarbeitung und Formulierung von Optimierungsempfehlungen auf folgendenzentralen Untersuchungsebenen:- Einfluss der curricularen Konzeption auf das Pflegeverständnis der Auszubildenden(vgl. Kap. 4.1)- Einfluss der curricularen Konzeption auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenzder Auszubildenden (vgl. Kap. 4.2)- Beurteilung des Lerntransfers im Rahmen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>(vgl. Kap. 4.3)- Einfluss der dem Ausbildungsmodell zugrunde liegenden Lernortkooperationenauf einen Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfer (vgl. Kap. 4.4)- Akzeptanz und Verbreitung der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das StuttgarterModell © “ (vgl. Kap. 4.5)Eine zusammenfassende Übersicht der Methoden, Instrumente und Zielgruppen derEvaluationsstudie bietet die nachstehende Abbildung 5.28
Erhebungsmethoden / Zielgruppenqualitative /quantitativeMethoden• Fragebögen (39 Erhebungen, n=740)• Gruppendiskussionen (9 Erhebungen, n=91)• Telefoninterviews (5 Erhebungen, n=59)• Beobachtungen (1 Erhebung, n=6)Zielgruppen• <strong>Modellkurs</strong> / Vergleichsgruppen: AP, KP, KKP• Praxisanleiter/innen• PDL / Stations-, Wohnbereichsleitungen• Trägervertreter / Kooperationspartner/innen• Lehrer/innen / Schulleitungen• Experten/innen / Vertreter/innen der Ministerien• Workshopteilnehmer/innenAbb. 5: Übersicht der Methoden, Instrumente und Zielgruppen3.Darstellung und zentrale Ergebnisse derProjektphasenDie Evaluation des Modellprojektes „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das StuttgarterModell © “ umfasste die Planungs- und Einführungsphase, die Hauptphase (Teil 1 bis3) und das Follow-up. Im Folgenden werden die zentralen Evaluationsergebnisse derPlanungs- und Einführungsphase und der Hauptphase (1. und 2. Teil) zusammengefasstvorgestellt. Die Ergebnisse des 3. Abschnitts der Hauptphase sowie des Follow-upwerden in einer Gesamtschau im anschließenden Kapitel 4 näher erläutert.3.1 Planungs- und Einführungsphase (01.07.00 - 30.09.02)Die Evaluation der annähernd 2-jährigen Planungsphase und der darauf folgendenEinführungsphase richtete sich im Wesentlichen auf die relevanten Entscheidungspunkteund Planungsprobleme, das Konzept, die in dieser Phase eingesetztenInstrumente sowie die entsprechenden Rahmenbedingungen. Gegenstandder Evaluation war zudem die Identifizierung von fördernden und hemmenden Faktorenim Rahmen der Schnittstellenkommunikation und Praxisintegration (vgl. Kap. 2).Ferner wurde während der Vorphase die Aufgabe einer externen Organisationsbera-29
tung („change agent“) zur Unterstützung der geplanten curricularen und strukturellenEntscheidungsprozesse übernommen 10 .Zentrale Ergebnisse der Planungs- und EinführungsphaseIm Hinblick auf Konzeption, Ausgestaltung, Umsetzung, Nutzen und Zielerreichungsgradkonnten folgende Ergebnisse formuliert werden (vgl. Görres, Bohns,Krippner & Stöver <strong>2002</strong>; Görres & Bohns 2004):• Der Kerngruppe Curriculum und den beteiligten Kooperationspartnern/innen gelanges, ein differenziertes Anforderungsprofil und Verfahren für das Assessmentder Modellschule zu erarbeiten.• Das Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ basiertauf der theoretischen Grundlage eines explizit entwickelten und zwischenzeitlichüberarbeiteten pflegeberuflichen und pädagogischen Begründungsrahmens (vgl.Kerngruppe Curriculum <strong>2006</strong>). Die in diesem Begründungsrahmen verankertenpflegeberuflichen Leitziele und pädagogischen Leitsätze sowie die daraus resultierendenAusbildungsprinzipien (Orientierung am Handeln vom Menschen, Wissenschaftsorientierung,Lebenslauforientierung, Theorie-Praxis-Vernetzung, Fächerintegration)zeigten eine die bisher vorherrschenden Ausbildungsmodelle ü-berschreitende Konzeption, die den Anforderungen an einen modernen Pflegeberufgerecht wird.• Die Entwicklung eines an Kompetenzen ausgerichteten lernfeldorientierten Curriculumsauf der Grundlage des pflegeberuflichen und pädagogischen Begründungsrahmensnahm sowohl die heute zentralen berufspädagogischen bzw. –didaktischen Anforderungen (Kompetenzorientierung, Theorie-Praxis-Vernetzung,Fächerintegration) als auch die aktuellen berufspolitischen Entwicklungen (Integrationder drei Pflegeberufe) in sich auf und bestimmte in innovativer Weisedas Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “.• Die Etablierung von Facharbeitskreisen sowie von Block- und Praxiskonferenzen,in denen Lehrende und Pflegepraktiker/innen der Kooperationspartner/innen ausden Berufsfeldern der Kinderkranken-, Kranken- und Altenpflege vertreten waren,zeigten Potenziale für ein Schulentwicklungsprogramm, das geeignet erschien,auch an andere Pflegeschulen im Raum Stuttgart und darüber hinaustransferiert zu werden.• Die Bildung eines Ausbildungsverbundes durch Kooperationspartner/innen ermöglichteeine Ressourcenoptimierung der Ausbildungsbetriebe und gewährleisteteden Einsatz in vielfältigen stationären, teilstationären und ambulanten Einsatzorten.3.2 Hauptphase I. Teil und II. Teil (01.10.02 - 31.12.04)Der erste Teil der Hauptphase setzte zum Ausbildungsbeginn, d. h. im Rahmen derkonkreten Umsetzung des Modells, im Oktober <strong>2002</strong> ein. Daran anschließend erfolgtedie Evaluation des 2. Ausbildungsjahres (II. Teil der Hauptphase). Die Darstellung10 vgl. Görres, Bohns, Krippner & Stöver (<strong>2002</strong>): Unveröffentlichter Bericht zu Workflow und Prozessrealisierungder "Kerngruppe Curriculum" in der Vorphase des Modellprojektes <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong> in Stuttgart. April<strong>2002</strong>. Institut für angewandte Pflegeforschung (iap), Universität Bremen.30
und Bewertung der Prozessevaluationsergebnisse wurde entlang der HauptuntersuchungsfragenF1 bis F8 11 vorgenommen (vgl. Kap. 2.3). Im vorliegenden <strong>Abschlussbericht</strong>wurden die zentralen Ergebnisse des I. und II. Teils zusammengeführt, um soden Entwicklungsverlauf der beiden ersten Projektphasen zu veranschaulichen (vgl.Görres, Böhnke, Stöver & Keuchel 2004; Görres, Stöver, Schmitt, Geiß, Stolle &Dmitrieva 2005).F1: Verhältnis der Generalisierung und Schwerpunktsetzung des Ausbildungsmodellshinsichtlich einer Vorbereitung auf das zukünftige BerufsfeldVor dem Hintergrund der Konzeption des Modellprojektes wurde als ein Evaluationsschwerpunktdie Entwicklung der Wahlmöglichkeit des zweiten Berufsabschlussesbzw. der Spezialisierung 12 analysiert. Folgende Ergebnisse konnten festgehaltenwerden 13 :Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (I. Teil)• Erste Aussagen zur Bereitschaft für einen 2. Berufsabschluss bezogen sich aufdie Erhebungszeitpunkte Ausbildungsbeginn und Ende des 1. Ausbildungsjahres.Zu diesen frühen Erhebungszeitpunkten zeigte sich, dass sich im Laufe des 1.Ausbildungsjahres die Bereitschaft für einen 2. Berufsabschluss tendenziell verringerte,insbesondere fehlte die Akzeptanz für den 2. Berufsabschluss in der Altenpflege.Scheinbar waren die Auszubildenden bzgl. des zweiten Abschlussesnoch unsicher und wollten erst weitere Einsätze in den jeweiligen Praxisfeldernabwarten. Weitere Gründe gegen einen 2. Berufsabschluss lagen in den nochfehlenden Erfahrungen in den anderen Berufsfeldern, der erlebten Pflegerealitätin den Einsatzorten der Altenpflege, der Vorstellung von geeigneten Berufskombinationenund der zu kurzen Ausbildungszeit für den 2. Abschluss. Zudembestand zu diesem frühen Zeitpunkt eine geringe Akzeptanz für eine Spezialisierung:Zum Ende des 1. Ausbildungsjahres lehnten 16 von 26 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmern/inneneine Spezialisierung im Bereich des 1. Berufsabschlusses ab.Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (II. Teil)• Die Bereitschaft für einen zweiten Berufsabschluss nahm bei den Teilnehmern/innenam Modellprojekt im Ausbildungsverlauf zu. Keine/r der Auszubildendenmachte von der Möglichkeit einer Spezialisierung Gebrauch (vgl. Görres;Böhnke; Stöver & Keuchel 2004). Dies wurde vor allem mit den besseren Berufschancendurch einen zweiten Berufsabschluss begründet, die Spezialisierungenim Rahmen des ersten Berufsabschlusses wurden hingegen als nicht vorteilhaftfür den Arbeitsmarkt gesehen.• Bei der Konkretisierung des zweiten Berufsabschlusses fiel im Vergleich zu früherenErhebungszeitpunkten auf, dass die Altenpflege als weiterer Abschluss anBedeutung gewonnen, die Gesundheits- und Kinderkrankenpflege im Gegensatz11 Die im 1. Evaluationsabschnitt formulierten fünf Hauptuntersuchungsfragen (F1 - F5) wurden in der 2. Evaluationsphasein Zusammenarbeit mit der Kerngruppe Curriculum um drei Fragen ergänzt (F6 - F8) (vgl. Kap. 2.3).12 Die Möglichkeit einer Spezialisierung innerhalb einer Berufsrichtung (z. B. Familiengesundheitspflege) wurdeim Ausbildungsverlauf ersetzt durch eine Spezialisierung im Bereich der Prozess- und Fallsteuerung.13 Die Ergebnisse zum Verhältnis Generalisierung und Schwerpunktsetzung beziehen sich im vorliegendem <strong>Abschlussbericht</strong>vor allem auf die Wahlmöglichkeit zweiter Berufsabschluss oder Spezialisierung.31
dazu an Akzeptanz verloren hatte. Die Verschiebung des zweiten Berufsabschlusseszugunsten der Altenpflege wurde mit den Erfahrungen in den Einsatzortenbegründet: Der Bereich der Altenpflege wurde als innovativ und zukunftsweisenderlebt.• Die Auszubildenden nutzten die vielfältigen Beratungsangebote während derAusbildung als Entscheidungshilfe hinsichtlich individueller und beruflicher Perspektiven,auch im Zusammenhang mit der Wahl des zweiten Berufsabschlusses.Die Beratung durch die Lernbegleiter am Lernort Schule und die Praxisanleiter/innensowie andere Pflegende am Lernort Pflegepraxis wurde insgesamt positivbewertet.F2: Einfluss der curricularen Konzeption auf das Berufsverständnis der AuszubildendenGegenstand der Untersuchungen waren u. a. eine kontinuierliche Analyse des Pflege-,Gesundheits- und Krankheitsverständnisses im Ausbildungsverlauf sowie desberuflichen Selbstverständnisses, um aufzuzeigen, inwieweit sich die im Begründungsrahmender „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ formuliertenpflegeberuflichen Leitziele 14 (Kerngruppe Curriculum <strong>2006</strong>) in den Begriffsbestimmungender <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen wiederfinden (vgl. Kap. 4.1). Mit demZiel, Aussagen zum Berufsverständnis treffen zu können, wurde eine Bewertung derIntegration der drei Berufsgruppen Kinderkrankenpflege, Krankenpflege und Altenpflegeim <strong>Modellkurs</strong> vorgenommen.Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (I. Teil)• Die Integration der drei Berufsgruppen der Pflege wurde im ersten Ausbildungsjahraus Sicht der Modellteilnehmer/innen und der Lehrenden überwiegend positivbeurteilt. Gründe für die positive Beurteilung ließen sich auf die Kategorien „<strong>Integrative</strong>Ausgestaltung der Lernfelder/Lernsituationen“, „<strong>Integrative</strong> Zusammensetzungder Lehrertandems und Facharbeitskreise“, „Berufsfeldweite Praxiseinsätze“sowie „Aufbau des Ausbildungsmodells“ zurückführen. Aus Sicht der Praxisanleiter/innenwaren dies vor allem die Praxiskonferenzen, der Kontakt derLehrenden zur Pflegepraxis sowie die Blockhandbücher.Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (II. Teil)• Die curriculare Konzeption der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>“ übte bereits im 2.Ausbildungsjahr einen erkennbaren Einfluss auf das Pflegeverständnis bzw. dasberufliche Selbstverständnis der Auszubildenden aus (vgl. Kap. 4.1). In den mittelsFragebogen erhobenen Beschreibungen zum Pflegebegriff spiegelten sichzunehmend die pflegeberuflichen Leitziele der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>:Das Stuttgarter Modell © “ wider. Der Perspektivenwechsel des Modellprojektes hinzu einem veränderten Verständnis von Pflege war zudem geprägt durch Mehrdimensionalitätund Situationsorientierung.14 Pflegeberufliche Leitziele sind z. B.: „Die Lernenden fördern und erhalten die Selbstpflegekompetenz der Menschenmit Pflegebedarf unter Einbezug sozialer und materialer Ressourcen.“, „Die Lernenden beachten die Würdedes Menschen und setzen sich anwaltschaftlich für die Interessen von Menschen mit Pflegebedarf ein.“32
• Ferner unterschied sich das Pflegeverständnis der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innendeutlich von dem Pflegeverständnis der Auszubildenden aus den regulären <strong>Pflegeausbildung</strong>en.In den Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflegeausbildungendominierten noch stärker die tradierten Anschauungen von Pflege (altruistische,verrichtungsorientierte sowie medizin- und krankheitsorientierte Sicht). Die <strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong> forcierte dagegen erfolgreich den Wandel des Pflegeberufsweg von der Verrichtungsorientierung hin zur Situationsorientierung, welcheletztlich eine individuelle und ganzheitliche Betreuung des Pflegeempfängers sicherstellt.• Den Hospitationseinsatz im Sommer 2004 absolvierten die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenvielfach in den jeweils benachbarten Bereichen des von ihnen angestrebtenersten Berufsabschlusses. Die Hospitation wurde von vielen Auszubildendendazu genutzt, neue Handlungsfelder der Pflege kennen zu lernen (z. B.MDK, Beratungsstellen). Dieser Ansatz wurde als geeignet angesehen, um eineBerufsgruppenintegration deutlich zu fördern.F3: Einfluss der curricularen Konzeption auf die Entwicklung der beruflichenHandlungskompetenz der AuszubildendenDie curriculare Konzeption wurde im gesamten Ausbildungsverlauf auch dahingehenduntersucht, inwieweit die intendierte Kompetenzentwicklung, die systematischüber das von der Kerngruppe Curriculum erarbeitete Kompetenzmodell aufgebautwurde, an den Lernorten Schule und Pflegepraxis beobachtbar ist. Ferner wurdeanalysiert, ob die von der Kerngruppe Curriculum angestrebten Kompetenzen mitden Anforderungen und Interessen der Pflegepraktiker/innen übereinstimmten. Fürdie ersten beiden Evaluationsabschnitte 15 wurden folgende Ergebnisse festgehalten:Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (I. Teil)• Die gelungene Vermittlung und Aneignung von Kompetenzen, insbesondere einerpraktisch-technischen und interaktiven Kompetenz sowie einer analytischreflexivenBegründungskompetenz, waren in der ersten Ausbildungsphase zunehmendzu erkennen. Der Kompetenzzuwachs, der sich im praktischen Handelnin realen Pflegesituationen zeigte, wurde vor allem auf die innovative Gestaltungder Lehr-/ Lernprozesse im Lernfeldkonzept zurückgeführt.Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (II. Teil)• Die curriculare Konzeption wirkte sich im zweiten Evaluationsabschnitt weiterhinpositiv auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz aus: Aus Sichtder Praxisanleiter/innen 16 hoben sich die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen u. a. in ihremtäglichen pflegerischen Handeln deutlich von den regulären Auszubildendenab. Die Auszubildenden im Modellprojekt verfügten über ein vergleichsweise hohesMaß an Selbstständigkeit, Flexibilität, Reflexionsfähigkeit und Eigeninitiative.15 Auf die Kompetenzerfassung und -entwicklung im weiteren Ausbildungsverlauf wird im Kapitel 4.2 ausführlicheingegangen.16 Die Ergebnisse bezogen sich auf eine Gruppendiskussion (t1, 09/04) mit den Praxisanleiter/innen (n=4). Aufgrundder geringen Teilnehmer/innenzahl sprechen die Ergebnisse nicht für die gesamte Zielgruppe der Praxisanleiter/innenund können daher nur eingeschränkt verwendet werden.33
Diese Kompetenzen wurden den Teilnehmer/innen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>ebenso von den Trägervertretern/innen und Pflegedienstleitungen zugeschrieben.• Den größten Kompetenzzuwachs nahmen die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen im Bereichder analytisch-reflexiven Begründungskompetenz, der interaktiven und derpraktisch-technischen Kompetenz wahr. Diese Kompetenzen wurden als grundlegenderachtet, um professionell, wissenschaftlich fundiert und situationsorientierthandeln und damit die zukünftigen Anforderungen des Pflegeberufs bewältigenzu können. Im praktisch-technischen Bereich empfanden sie dessen ungeachtetden größten Nachholbedarf. Als Ursache dafür wurden primär fehlendeUmsetzungsmöglichkeiten am Lernort Pflegepraxis aufgeführt.• Die Erhebung mithilfe des Instruments zur Kompetenzerfassung von Zimber &Teufel (1999) ergab, dass sich die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen bezüglich der interaktivenKompetenz sowie der organisations- und systembezogenen Kompetenzsehr positiv bewerteten, während sie in den Bereichen der praktischtechnischensowie der Planungs- und Steuerungskompetenz, z. B. hinsichtlichder Notfallversorgung oder der Anfertigung eines Pflegeplans, noch Unsicherheitenfeststellten 17 .• Die Bewertung der Kompetenzentwicklung seitens der Lehrenden bzw. Bereichslehrendenunterschied sich deutlich von der Selbsteinschätzung der Schüler/innen.Sie stuften den Zuwachs insgesamt geringer ein. Besonders augenscheinlichwaren diese Differenzen bei der praktisch-technischen und der Planungs-und Steuerungskompetenz. Der größte Zuwachs bei den <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenlag im Bereich der interaktiven Kompetenz. Begründet wurde dieseEntwicklung mit den methodisch-didaktischen Schwerpunkten der „<strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “. So konnte die interaktive Kompetenzzum Beispiel kontinuierlich und zielgerichtet durch Rollenspiele und Diskussionengefördert werden.F4: Einfluss der curricularen Konzeption auf die Gestaltung der Lehr-/ Lernprozesseund das Rollenverständnis der LehrendenEinen weiteren Schwerpunkt der Untersuchung bildete die Frage, welche Folgen dasan Kompetenzen ausgerichtete lernfeldorientierte Curriculum bezüglich der Lehr-/Lernprozesse mit sich bringt. Hierzu wurden u. a. solche Bedingungen evaluiert, diedas Lernen und Lehren in Schule und Pflegepraxis förderten oder behinderten. Fernerzielte die Evaluation darauf ab zu erheben, inwieweit der durch die Konzeptionintendierte Wandel der Lehrer/innenrolle vom Wissensvermittler zum Lernbegleiterbeobachtbar ist. Zusammenfassend konnten folgende Aussagen formuliert werden:Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (I. Teil)• Das an Kompetenzen ausgerichtete lernfeldorientierte Curriculum als Grundlageder <strong>Pflegeausbildung</strong> erwies sich bereits mit Beginn der Ausbildung als fruchtbareKomponente für die Lehr-/Lernprozesse und die Theorie-Praxis-Integration. Von17 Auf weitere Datenerhebungen mithilfe des Instruments von Zimber & Teufel wurde aus den in Kap. 2.4 dargestelltenGründen verzichtet.34
den Auszubildenden wurden insbesondere die Lernformen des selbstorganisierten/-gesteuerten,erfahrungsbezogenen sowie entdeckenden und problemlösendenLernens mit den vielfältigen Möglichkeiten der selbstständigen Auseinandersetzungmit Lerninhalten positiv hervorgehoben. Diese neuen Lernformen trugendazu bei, dass die Auszubildenden schon frühzeitig einen Einblick in das BerufsfeldPflege erhielten, bei ihnen ein integratives Denken einsetzte und Lerninhaltemiteinander vernetzt werden konnten.• Die Vielfalt der Unterrichtsmethoden wurde von der Mehrzahl der Auszubildendenals sehr gut bzw. als gut eingeschätzt. Damit konnte das mit dem Lernfeldansatzintendierte Ziel der Methodenvielfalt, das eine wesentliche Voraussetzung für dieKompetenzentwicklung der Auszubildenden darstellt, bereits in der ersten Evaluationsphaseals erreicht angesehen werden.• Bei den Lehrenden wurde vor allem der Rollenwechsel vom Wissensvermittlerzum Lernbegleiter und Moderator als sehr positiv eingeschätzt. Dieser didaktischePerspektivenwechsel führte auch dazu, dass sich die Auszubildenden mithoher Eigeninitiative Lerninhalte selbstständig aneigneten. Zudem fanden dieLehrertandems, die sich aus Lehrenden der verschiedenen Berufsfelder zusammensetzten,sowohl bei den Auszubildenden als auch bei den Lehrenden selbsteine große Resonanz.Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (II. Teil)• In der zweiten Evaluationsphase war der optimistische Trend bezüglich der Ausbildungskonzeptionweiterhin deutlich erkennbar: Die curriculare Konzeption unddie damit veränderten Lehr-/Lernarrangements beeinflussten in positiver Weisedas Lernen in Schule und Pflegepraxis. Die gezielte Förderung des selbstorganisiertenLernens und der eigenverantwortlichen Wissensaneignung bildeten einegeeignete Basis für das hohe Maß an Selbstständigkeit und Eigeninitiative derAuszubildenden am Lernort Pflegepraxis. Gleichzeitig führte die curriculare Konzeptiondazu, dass sich der intendierte Wandel der Lehrer/innenrolle zum Lernbegleiterund Berater erfolgreich vollziehen konnte.• Mit dem Lernen in Lernfeldern hatten die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen ihrer eigenenEinschätzung nach kaum Schwierigkeiten. Sie benannten vorrangig dasselbstorganisierte Lernen als förderliches Lehr-/Lernarrangement für die Erweiterungihrer Fähigkeiten/Kompetenzen. Gleichwohl äußerten sie zusätzlich dasBedürfnis nach strukturgebenden Lehr-/Lernmethoden und lehrerzentrierten Sozialformenwie dem Frontalunterricht.• Insgesamt wurde das Lernen an den Lernorten Schule und Pflegepraxis äußerstpositiv beurteilt. Als förderlich für das Lernen am Lernort Pflegepraxis wurde insbesondereeine gute Anleitung genannt. Zudem bestand der Wunsch, selbstständigarbeiten zu dürfen. Die im Rahmen der Praxiseinsätze geforderte Eigenständigkeitwurde jedoch von einigen Auszubildenden ebenso als Grund für eineÜberforderung aufgeführt.35
F5: Einfluss des Lernfeldansatzes sowie der dem Ausbildungsmodell zugrundeliegenden Lernortkooperationen auf einen Theorie-Praxis- bzw.Praxis-Theorie-TransferEine grundlegende Bedingung für eine erfolgreiche Umsetzung des Lernfeldansatzeswurde in der Kooperation der Lernorte gesehen. Zentrale Merkmale des Modellprojekteswaren daher ein breiter Verbund von Kooperationspartnern/innen und die damitverbundenen Lernortkooperationen. Das angestrebte Ziel einer gelungenen Theorie-Praxis-Vernetzungwurde im ersten Evaluationsabschnitt anhand der Zusammenarbeitzwischen den Ausbildungsstätten Schule und Praxis und der Beurteilungdes zusätzlichen Zeitaufwandes im Zusammenhang mit dem Modellprojekt überprüft.Im Rahmen der Evaluation des 2. Hauptteils wurde untersucht, inwieweit eine gezielteund systematische Kooperation zwischen den Lernorten Schule und Pflegepraxisstattfand 18 .Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (I. Teil)• Der Verwaltungs- und Organisationsaufwand für die <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>wurde von fast allen Lehrenden als sehr hoch bis hoch eingeschätzt. Vor allemdie Entwicklung der Lehr-/ Lernarrangements sowie ihre Vor- und Nachbereitung,die Unterrichtsvorbereitung im Lehrertandem und die Gremienarbeit erforderteneinen hohen zusätzlichen Arbeitsaufwand.• Weitere Tätigkeiten, die einen zusätzlichen Zeitaufwand aus Sicht der Praxisanleiter/innenbenötigten, waren u. a. die intensivere Anleitung der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenim Pflege- und Stationsablauf sowie die Teilnahme an den Praxiskonferenzen.• Die fehlende Zeit, um in den Einrichtungen häufiger präsent zu sein, sowie der zuhohe Zeitaufwand bzw. der eingeschränkte zeitnahe Informationsaustausch warenebenfalls Gründe für die weniger günstige Beurteilung der Zusammenarbeitaus Sicht der Lehrenden, der Bereichslehrer/innen und Praxisanleiter/innen.Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (II. Teil)• Die Umsetzung des Ausbildungsprinzips „Theorie-Praxis-Vernetzung" erfolgtekontinuierlich und nachhaltig durch den Einbezug von Kooperationspartnern/innenund den damit verbundenen Lernortkooperationen. Die Kooperationspartner/innender „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © " erlebtendie Auszubildenden als aktive „Wissensvermittler" in ihren Einrichtungen.Letztere gewährleisteten somit den direkten Transfer von Innovationen aus demLernort Schule in die Pflegepraxis.• Die Praxiskonferenzen bewährten sich bei regelmäßiger Teilnahme der Anleiter/innenals Instrument zur Förderung der Lernortkooperation. Eine unregelmäßigeBeteiligung an den Konferenzen führte hingegen zu einem Informationsdefizitam Lernort Praxis und wirkte einer kontinuierlichen „Theorie-Praxis-Vernetzung" entgegen. Da die Unterstützung durch die Praxisanleiter/innen ausSicht der Auszubildenden des Modellprojektes als besonders wichtig für die ei-18 Weitere Ergebnisse zur Lernortkooperation und Theorie-Praxis-Vernetzung sind dem Kapitel 4.4 zu entnehmen.36
gene Kompetenzentwicklung erachtet wurde, kam ihnen in Bezug auf den Theorie-Praxis-bzw. Praxis-Theorie-Transfer eine Schlüsselrolle zu (vgl. Kap. 4.4).F6: Welche Innovationen und Synergieeffekte lassen sich in der „<strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong>“ hinsichtlich einer Modernisierung der Pflegeberufe,die den aktuellen Anforderungen Genüge leisten, identifizieren? –Einschätzung hinsichtlich der Bewährung bzw. Akzeptanz des AusbildungsmodellsDa das Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell“ dieKompetenzentwicklung in den Kontext des Lernfeldansatzes stellte, und damit imRahmen der aktuellen gesetzlichen Veränderungen der <strong>Pflegeausbildung</strong>en, in denendie Lernfeldorientierung für alle Ausbildungsstätten einen bindenden bzw. empfehlendenCharakter hat, eine Vorreiterrolle einnahm, lag ein wesentliches Ziel derEvaluation darin, die Entwicklungen der Lehr-/Lernprozesse in den Lernorten Schuleund Praxis hinsichtlich der innovativen Aspekte zu analysieren:Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (I. Teil)• Der Lernfeldansatz als curriculare Grundlage des Ausbildungsmodells erwies sichbereits in der Einführungsphase als fruchtbare Komponente für die Lehr-/Lernprozesse und die Theorie-Praxis-Integration. Insbesondere die verschiedenenLernformen, die selbständige Auseinandersetzung mit Lerninhalten und dieden Lernsituationen zugrunde liegenden komplexen Aufgabenstellungen trugendazu bei, dass theoretische und praktische Bezüge miteinander verknüpft werdenkonnten bzw. das Denken entlang von Fächerstrukturen zugunsten eines integralenDenkens, indem sich Lerninhalte miteinander vernetzen, überwunden wurde.• Die Unterrichtstandems, die sich aus Lehrenden verschiedener Berufsfelder zusammensetzten,fanden von den Auszubildenden und Lehrenden eine große Resonanz.Denn über diesen Weg erschlossen sich für die Lehrenden und Auszubildendendie Berufswirklichkeiten der verschiedenen Berufsfelder der Pflege.Zum Erhebungszeitpunkt 10-11/2004 wurde im Rahmen der Evaluation eine ersteEinschätzung hinsichtlich der Innovationen und Synergieeffekte des Modellprojektessowie zur Bewährung des Ausbildungsmodells in der Pflegepraxis bzw. auf dem Arbeitsmarkt„Pflege" vorgenommen. Hierzu wurden die Kooperationspartner/innen desModellprojektes auf Träger- und Einrichtungsebene sowie Vertreter/innen aus Politik,Verwaltung und Berufsverbänden als Experten/innen befragt. Aus den Ergebnissenkonnten nachfolgende zentrale Aussagen formuliert werden:Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (II. Teil) 19• Das Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © " erfuhrbereits zum damaligen frühen Erhebungszeitpunkt eine hohe Akzeptanz. DerGrund hierfür lag nach Ansicht der Befragten in der Möglichkeit, zwei Berufsabschlüssein einem Ausbildungszeitrahmen von 3,5 Jahren zu erwerben. Es be-19 Die Forschungsfragen F6, F7 und F8 wurden erst im zweiten Evaluationsabschnitt bearbeitet, deshalb liegenkeine Ergebnisse aus der I. Hauptphase vor.37
stand indes bei allen drei Interviewgruppen eine leichte Tendenz, die Ausbildungauf vier Jahre zu verlängern.• Zudem wurde konstatiert, dass die integrative Ausrichtung eine hohe Flexibilitätfür ein breites Einsatzspektrum in alten und neuen Handlungsfeldern der Pflegegewährleistet.• Aufgrund der höheren Arbeitsmarktchancen für die Absolventen/innen und derneuen Vielseitigkeit des Aufgabenspektrums ergab sich die Prognose, dass dasModellprojekt zu einer deutlichen Attraktivitätssteigerung des Pflegeberufes beiträgt.F7: Aussagen im Hinblick auf eine im nationalen Vergleich wettbewerbsfähige<strong>Pflegeausbildung</strong> und deren Anschlussfähigkeit auf dem europäischenMarktLaut Projektantrag <strong>2002</strong> war vorgesehen, ein transnationales Modul aus dem Leonardoda Vinci Projekt (dt. Ltg: B. Knigge-Demal, FH Bielefeld) in die Ausbildung zuintegrieren mit dem Ziel, eine Anschlussfähigkeit an die europäische Entwicklung zuerreichen. Als zentrales Evaluationsergebnis wurde festgehalten:Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (II. Teil)• Obwohl die geplante Integration eines transnationalen Moduls in das neue Ausbildungscurriculumnicht zustande kam, wurde von der wissenschaftlichen Begleitungdennoch von einer „Europatauglichkeit" der Ausbildung durch die integrativeAusrichtung ausgegangen. Diese wurde durch die im Modellprojekt geförderteZusammenführung der drei grundständigen Pflegeberufe, die durchausmit den Ausbildungskonzeptionen anderer europäischer Länder 20 harmonisiert,begründet. Angesichts des fehlenden Einbezugs eines transnationalen Modulskonnten im weiteren Verlauf der Evaluation keine weiteren Aussagen zur nationalenVergleichbarkeit bzw. zur Anschlussfähigkeit auf dem europäischen Arbeitsmarktgetroffen werden.F8: Veränderungen bzw. Innovationen, die in den Praxiseinrichtungen derKooperationspartner/innen durch die <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong> angestoßenwerdenDer Nutzen für die Kooperationspartner/innen durch die Beteiligung am Modellprojektlag in den zu erwartenden Innovationen und Synergieeffekten der jeweiligen Einrichtungen.Inwieweit erste Veränderungen in der Pflegepraxis wahrgenommen wurden,veranschaulichen folgende Ergebnisse:Zentrale Ergebnisse der Hauptphase (II. Teil)• Erste Synergieeffekte in den Einrichtungen der Kooperationspartner/innen durchdie Beteiligung am Modellprojekt zeigten sich u. a. darin, dass vermehrt Praxisanleiter/innenqualifiziert und gezielt eingesetzt wurden. Zusätzlich fanden Fort-20 Außer in Deutschland werden nur in Italien und Österreich die Ausbildungsgänge in die Bereiche Kranken- undKinderkrankenpflege unterteilt. Eine grundständige Altenpflegeausbildung existiert in den Ländern der EuropäischenUnion lediglich in Deutschland. Quelle: Robert Bosch Stiftung 200038
ildungen sowie Mitarbeiterschulungen (z. B. zum Lernfeldansatz) statt. KonkreteVeränderungen bzw. Innovationen wurden von den Kooperationspartnern/innenzum damaligen Projektstand nicht genannt (vgl. Kap. 4.4.3).3.3 KurzzusammenfassungAngesichts der hohen Anforderungen, die ein Ausbildungsmodell mit großem Innovationspotenzialan Lehrende, Praxisanleiter/innen und Auszubildende stellt, konntendie ersten Ergebnisse aus der Planungs- und Einführungsphase sowie dem I. und II.Teil der Hauptphase insgesamt positiv bewertet werden. Einige Aspekte, die am Endeder ersten Evaluationsphase zur Optimierung vorgeschlagen wurden, wie z. B. dieBeratungsleistungen hinsichtlich des zweiten Berufsabschlusses bzw. der Spezialisierung,wurden in der zweiten Phase erfolgreich umgesetzt (vgl. Görres, Böhnke,Stöver & Keuchel 2004). Die nachstehende Zusammenschau fasst die Ergebnisseder Planungs- und Einführungsphase sowie der Hauptphase (I. und II. Teil) zusammen:• Aus Sicht der wissenschaftlichen Begleitung zeigte sich die Vorphase auch imSinne einer Kosten-/Nutzenabwägung bzgl. der eingesetzten Ressourcen als unbedingtnotwendig zur inhaltlichen und organisatorischen Vorbereitung des Modells,so dass die <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong> am 01.10.<strong>2002</strong> mit 28 Teilnehmer/innenbeginnen konnte.• Die Ergebnisse der Planungs- und Einführungsphase verdeutlichen, dass das integrativeAusbildungsmodell weit über bisherige Entwürfe zur gemeinsamen<strong>Pflegeausbildung</strong> hinausging. Erstmals wurde den Auszubildenden ein gleichwertigerzweiter Berufsabschluss bzw. der Erwerb eines zusätzlichen Zertifikats ermöglicht.• Besonders hervorzuheben war die Erarbeitung grundsätzlicher Entscheidungskriterienzur Curriculumsentwicklung, wie die Erstellung eines pflegeberuflichen undpädagogischen Begründungsrahmen, der neben einer Legitimationsfunktion fürdie Formulierung von Leit- und Richtzielen des Curriculums die Sichtweisen derbeteiligten Berufsgruppen integrativ zusammenführte und eine gemeinsameKommunikationsebene bildete.• Ein besonderes Innovationspotenzial zeigte sich in dem Kooperationsverbundder am Projekt beteiligten Träger und Institutionen und der Einrichtung eines Finanzierungspools.• Die Evaluation des I. und II. Teils der Hauptphase bestätigte die Ergebnisse ausder Planungs- und Einführungsphase hinsichtlich der Gestaltung des Modellprojektes:Die Vorteile der Ausbildungskonzeption wurden in dem Erwerb zweier Berufsabschlüsseund damit verbunden in der Möglichkeit eines breiten Einsatzfeldessowie erhöhter Berufschancen gesehen. Im Bereich der Wahlmöglichkeitzwischen einem 2. Berufsabschluss und der Option der Spezialisierung wurde imRahmen der Evaluation der I. Hauptphase vorgeschlagen, noch stärker auf diesewesentlichen innovativen Elemente des Modellprojektes, sowohl bei den Auszubildendenals auch nach außen, hinzuweisen bzw. Beratungsleistungen anzubieten.Erkennbar wurde anhand der Ergebnisse der II. Hauptphase, dass die Bereitschaftfür einen zweiten Berufsabschluss im Ausbildungsverlauf deutlich zu-39
nahm. Keiner der Auszubildenden machte von der Möglichkeit einer SpezialisierungGebrauch. Dies spricht für die Konstruktion des Ausbildungsmodells (Erwerbzweier gleichwertiger Berufsabschlüsse). Durch die Doppelqualifikationkönnen die Chancen auf dem Arbeitsmarkt erhöht und eine Attraktivitätssteigerungder <strong>Pflegeausbildung</strong> erreicht werden.• Bei der Wahl des zweiten Berufsabschlusses wurde sichtbar, dass die Altenpflegeals weiterer Abschluss im Ausbildungsverlauf an Bedeutung gewann. Dieswurde vor allem mit der als positiv gesehenen Kombination der Berufe und Handlungsfelderder Kranken- und Altenpflege begründet. Zudem wurde der Bereichder Altenpflege als zukunftsweisend und innovativ erlebt. Der zweite Berufsabschlussim Bereich der Kinderkrankenpflege verlor an Akzeptanz. Als Grund fürdie rückläufige Attraktivität konnte der vereinzelt wahrgenommene Nachholbedarfder Auszubildenden im Bereich des "Handlings" identifiziert werden. In dennächsten Erhebungen galt es, genauer zu prüfen, welches Wissen und Könnendie Auszubildenden in den jeweiligen Berufsfeldern benötigten bzw. in welchenBereichen ein höherer Anteil an Profilbildung im Sinne von Schwerpunktsetzungstattfinden sollte. Diese Thematik wurde im Rahmen der Beurteilung des Lerntransfersweitergehend untersucht (vgl. Kap. 4.3).• Die Analyse des Pflegeverständnisses und des beruflichen Selbstverständnisseszeigte in den ersten zwei Ausbildungsjahren, dass sich die im Begründungsrahmender „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ formuliertenpflegeberuflichen Leitziele (Kerngruppe Curriculum <strong>2006</strong>) zunehmend in denBegriffsbestimmungen der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen wiederfanden. Somitkonnte ein Perspektivenwechsel im Verständnis von Pflege - weg von der Verrichtungsorientierunghin zu einer (Pflege-)Situationsorientierung - ausgelöstwerden. Die Erhebungen zum Pflegeverständnis wurden im III. Hauptteil und imFollow-up fortgesetzt (vgl. Kap. 4.1).• Die Auswertung der ersten Ergebnisse zur Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenzder <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen zeigte eine positive Einschätzungder Kompetenzentfaltung. Insbesondere wurde ein Zuwachs im Bereich derinteraktiven und analytisch-reflexiven Begründungskompetenz sowie der praktisch-technischenKompetenz festgestellt. Allerdings sahen die Auszubildendengerade im letztgenannten Bereich noch den größten Weiterentwicklungsbedarf.Dieser wurde vornehmlich mit fehlenden Umsetzungsmöglichkeiten am LernortPraxis begründet. Die Analyse der Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenzwurde im weiteren Ausbildungsverlauf intensiviert (vgl. Kap. 4.2).• Ein wesentlicher innovativer Beitrag des Modells lag in der Wahrnehmungsänderungder Lehrenden hinsichtlich ihrer Rolle im Lern- und Ausbildungsprozess. DieLehrenden bzw. Bereichslehrenden bestätigten in den ersten beiden Evaluationsphasenmehrheitlich den Wandel ihres Rollenverständnisses vom Wissensvermittlerzum Lernbegleiter und Moderator. Die Erfahrungen mit der neuen Gestaltungder Lehr-/Lernarrangements wurden als positiv empfunden. Im Rahmender <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> gelang es mit dem beschriebenen Wandel, dastraditionell hierarchische Verhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden, wie esauch in der Fachliteratur zunehmend in Frage gestellt wird (Robert Bosch Stiftung2000), aufzulösen und dem die konstruktive Ausgestaltung einer zukunftsweisendenLehrerrolle (Moderator, Partner, Begleiter) entgegenzusetzen.40
• Die strukturelle und inhaltliche Verknüpfung der unterschiedlichen Lernortbereicheim Kontext der Trägervielfalt des Kooperationsverbundes stellte eine besondereHerausforderung dar. Die Umsetzung des Ausbildungsprinzips „Theorie-Praxis-Vernetzung“ konnte aber bereits in der ersten Ausbildungshälfte als gelungenbezeichnet werden. Durch den Einbezug von Kooperationspartnern/innenund den damit verbundenen Lernortkooperationen wurde ein Theorie-Praxis-Transfer in den jeweiligen Einrichtungen angestoßen. Dies geschah insbesonderedurch die gute Zusammenarbeit zwischen dem Lernort Schule und den kooperierendenEinrichtungen sowie den Auszubildenden als „Wissensvermittler“.• Die Ergebnisse verdeutlichten die hohe Akzeptanz des Modellprojektes in Bezugauf die Ausbildungskonstruktion und die 3,5-jährige Ausbildungszeit auf TrägerundEinrichtungsebene sowie bundesweit in Bereichen der Politik, Verwaltungund Berufsverbänden bereits zwei Jahre nach Ausbildungsbeginn.• Aufgrund des fehlenden Einbezugs eines internationalisierungsfähigen Modulskonnten im Rahmen der Evaluation keine weiteren Aussagen zur nationalen Vergleichbarkeit(z. B. hinsichtlich der Anerkennung von Modulen, der Vereinheitlichungdes Bewertungssystems) bzw. zur Anschlussfähigkeit auf dem europäischenMarkt getroffen werden.• Anhand der Ergebnisse konnten bereits zwei Jahre nach dem Start der AusbildungVeränderungen bzw. Innovationen durch die <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>,wie z. B. die vermehrte Praxisanleiter/innenausbildung in den Einrichtungen desKooperationsverbundes, festgestellt werden, die den geforderten Kriterien derAusbildungs- und Prüfungsverordnungen der neuen Berufsgesetze entsprachen.Vereinzelt wurden Synergieeffekte hinsichtlich Personalentwicklung (Mitarbeiter/innenschulung)und Qualitätssicherung wahrgenommen, sodass ein intendiertesZiel von Lernortkooperationen, nämlich eine möglichst hohe Qualität der Ausbildungzu erreichen bzw. schon vorhandene Qualität ständig zu verbessern,durch die Beteiligung der Kooperationspartner/innen am Modellprojekt angetriebenwurde (vgl. Robert Bosch Stiftung 2000). Dies wurde nachhaltig intensiviertund Gegenstand weiterer Untersuchungen im Rahmen der Evaluation (vgl. Kap.4.4).41
4.Ausgewählte Ergebnisse zu den zentralenUntersuchungsschwerpunkten - Hauptphasenund Follow-upIm folgenden Kapitel 4 werden die relevanten Ergebnisse der Hauptphasen und derAnschlussuntersuchung (Follow-up) zusammengeführt und entlang der für diesenletzte Evaluationsabschnitt zentralen Untersuchungsschwerpunkte Pflegeverständnis,Kompetenzentwicklung, Transferlernen, Theorie-Praxis-Vernetzung sowie Akzeptanzund Verbreitung des Modells vorgestellt.4.1 Einfluss der curricularen Konzeption auf dasPflegeverständnis der AuszubildendenEine professionelle und individuelle Pflege setzt ein erweitertes, am Menschen orientiertesPflegeverständnis voraus. Der Grundstein für die Entwicklung eines solchenVerständnisses von Pflege wird bereits in der Ausbildung gelegt (vgl. z. B. Scheu2001: 5; Robert Bosch Stiftung 2000: 30). Die curriculare Konzeption einer <strong>Pflegeausbildung</strong>sowie deren Umsetzung haben folglich einen maßgeblichen Einfluss darauf,welches Pflegeverständnis von den angehenden Pflegenden ausgebildet wird.Erkenntnisinteresse / FragestellungDiesbezügliches Ziel der Evaluation war es, die Entwicklung des Pflegeverständnissesinnerhalb der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ nachzuzeichnenund mit dem Verlauf in den traditionellen Ausbildungsgängen zu vergleichen.Im Zentrum der Untersuchung stand die Beantwortung folgender forschungsleitendenFragen:• Welches Pflegeverständnis hat sich im Ausbildungsverlauf bei den <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenentwickelt?• Ist eine Annäherung des Pflegeverständnisses an die pflegeberuflichen Leitzieledes Modells erkennbar?Die Initiatoren/innen der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “streben mit ihrer Konzeption einen Wandel weg von der Verrichtungsorientierung hinzu einer Pflegesituationsorientierung an. Zur Überprüfung dieses Leitziels wurde dasPflegeverständnis der Auszubildenden seit Ausbildungsbeginn bis hin zum Follow-upkontinuierlich (T1: 10/02; T4: 10/03; T6: 10-11/04 und T9: 08/06) erhoben. DieseVorgehensweise ermöglichte einen fortlaufenden Abgleich des Pflegeverständnissesder Auszubildenden mit den intendierten Zielen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>sowie eine regelmäßige Gegenüberstellung mit den Vergleichsgruppen (T1: 10/02;T4: 10/03; T6: 10-11/04).Methodisches VorgehenDie Datenerhebung zum Pflegeverständnis erfolgte mithilfe offener Fragestellungenin Fragebögen (vgl. Kap. 2.2). Die Teilnehmer/innen wurden jeweils dazu aufgefordert,den Begriff „Pflege“ spontan mit eigenen Worten zu beschreiben. Im Rahmen42
der qualitativen Analyse orientierte sich die Kategorienbildung zum Pflegeverständnisan den pflegeberuflichen Leitzielen der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das StuttgarterModell © “, welche im Begründungsrahmen formuliert sind (Kerngruppe Curriculum<strong>2006</strong>). Zusätzlich zu diesen Einteilungen wurden Kategorien entwickelt, die ein ehertraditionelles Verständnis von Pflege widerspiegeln (z. B. „Pflege als Verrichtung“).Tab. 1 zeigt alle Merkmalsausprägungen aus dem konzipierten Kodierplan, wobei diemit * markierten Kategorien den pflegeberuflichen Leitzielen des Modells entsprechen.Tab. 1: Kategorien zum PflegeverständnisKategorien zum Pflegeverständnis1. Menschenwürde beachten und anwaltschaftliche Pflege betreiben*2. Pflege als Beziehungsarbeit/Interaktion (menschliche Begegnung)*3. Orientierung am Menschen (Subjektorientierung)*4. Gesundheit fördern*5. Menschen mit Pflegebedarf unterstützen und beraten*6. Toleranzfähigkeit*7. Selbstpflegekompetenz bei Menschen mit Pflegebedarf fördern und erhalten (Ressourcenorientierung)*8. Wahrnehmungsfähigkeit*9. Selbstreflexion/ Reflexion pflegerischen Handelns*10. Pflege als professioneller Beruf*11. Pflege als Prozess12. Allgemeine Hilfestellung und Unterstützung13. Pflege als Konsequenz von Krankheit14. Pflege als Konsequenz von Alter15. Pflege als VerrichtungJede dieser Kategorien bzw. Ausprägungen wurde definiert und anschließend anhandvon Schlüsselwörtern und Ankerbeispielen beschrieben und abgegrenzt. Zurbesseren Veranschaulichung des methodischen Vorgehens bei der Kategorienbildungbildet Tab. 2 einen Ausschnitt aus dem Kodierplan ab.Tab. 2: Auszug aus dem Kodierplan zum PflegeverständnisVariable Ausprägung Definition Schlüsselwörter AnkerbeispieleBegriff PflegeSelbstpflegekompetenzbeiMenschen mitPflegebedarffördern und erhalten(Ressourcenorientierung)PflegeberuflichesLeitziel: Die Lernendenfördernund erhalten dieSelbstpflegekompetenzder Menschenmit Pflegebedarfunter Einbezugsozialerund materialerRessourcen.Selbstpflege, Ressourcen,Selbstständigkeit,Fähigkeitenfördern etc.„Selbstpflegefähigkeitenfördern“;„Förderung derPat. (Ressourcen)“;„Selbstständigkeitder Pflegeempfängerfördern“Eine Übersicht zu allen Kategorien und den jeweiligen Leitzielen bietet der vollständigeKodierplan zum Pflegeverständnis im Anhang.43
Die aufgezeigten Differenzen im Pflegeverständnis wurden im Rahmen des Followupebenso von knapp der Hälfte der Pflegedienstleitungen, Stationsleitungen undWohnbereichsleitungen wahrgenommen 25 (45,8% = 11 Befragte). Eine besondereOrientierung am Menschen und seinen Bedürfnissen (Subjektorientierung) bemerktenvier Befragte (16,7%). Sie beschrieben unter diesem Aspekt, dass die integrativausgebildeten Mitarbeiter/innen eine ganzheitliche Sicht aufwiesen und ihr Handelnan den jeweiligen Bedürfnissen der Pflegeempfänger ausrichteten. Des Weiterenzeichneten sich die Absolventen/innen nach Auffassung von jeweils 2 Personen(8,3%) durch ein allgemein komplexeres Pflegeverständnis sowie Erkennen des individuellenPflegebedarfs aus.4.1.2 Umsetzung des Pflegeverständnisses im PraxisalltagZur Gewährleistung eines am Pflegebedarf orientierten pflegerischen Handelns istletztlich ausschlaggebend, ob eine Umsetzung des erworbenen Pflegeverständnissesin der täglichen Praxis gelingt.Im Rahmen des Follow-up bestätigten die Absolventen/innen mehrheitlich (66,7% =10 Befragte), dass sie ihre Vorstellungen von Pflege an ihrem derzeitigen Arbeitsplatzverwirklichen und übertragen können. Die Umsetzung des persönlichen Pflegeverständnisseswird möglich durch Unterstützung der Arbeitgeber (26,7% = 4 Befragte)sowie durch individuelle Pflege und Betreuung bzw. eine gute Planung und dasSetzen von Prioritäten (je 13,3% = 2 Befragte). Als hinderliche Faktoren nahmen 4Absolventen/innen (26,7%) eine unzureichende Orientierung am Pflegeempfängerwahr, die nach ihrer Einschätzung aus Zeit und Personalmangel resultiert.Auch die Praxisanleiter/innen bemerkten ein besonderes Pflegeverständnis der integrativAusgebildeten, welches sich im täglichen pflegerischen Handeln offenbarte.Ein/e Teilnehmende/r beschrieb diese Besonderheit im Rahmen einer Gruppendiskussion:„Die IPA-Schüler interessieren sich vor allem für den Menschen und dassoziale Umfeld, und erst danach für die Krankheit und die Maßnahmen, diedurchgeführt werden sollen.“(GD t1 26 Praxisanleiter/innen, September 2004)4.1.3 KurzzusammenfassungDie kontinuierliche Evaluation des Pflegeverständnisses der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenim Ausbildungsverlauf führte zu folgenden Ergebnissen:• Die mit der Ausbildung intendierten pflegeberuflichen Leitziele der „<strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ spiegelten sich zunehmendim Pflegeverständnis der Auszubildenden wider. Darin zeigt sich ei-25 Fragestellung: „Unterscheidet sich das Pflegeverständnis der Absolventen/innen des Modellprojekts von demder regulär Ausgebildeten?“26 Aufgrund der geringen Teilnehmer/innenzahl (n=4) sprechen die Ergebnisse nicht für die gesamte Zielgruppeder Praxisanleiter/innen und können daher nur eingeschränkt gewertet werden.48
ne gelungene Umsetzung der curricularen Konzeption bzw. des pflegeberuflichenBegründungsrahmens.• Die Auszubildenden haben ein komplexes, mehrdimensionales Verständnisvon dem Begriff Pflege entwickelt. Dieses Pflegeverständnis zeichnetesich durch Subjekt- und Ressourcenorientierung aus und unterschied sichdamit von den Vorstellungen der Vergleichsgruppen, bei denen eine verrichtungs-und defizitorientierte Sichtweise deutlich häufiger anzutreffenwar.• Den Absolventen/innen gelingt es mehrheitlich, das erworbene Pflegeverständnisim pflegerischen Alltag umzusetzen. Die „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>:Das Stuttgarter Modell © “ leistet damit einen Beitrag zum Wandelweg von der Verrichtungsorientierung hin zu einer Situations- und Handlungsorientierung,die den Pflegeempfänger mit seiner jeweiligen Lebensbiographieund Lebensumwelt wahrnimmt (vgl. Bleses 1997) und als agierendePerson begreift (vgl. Wittneben 1993).49
4.2 Einfluss der curricularen Konzeption auf die Entwicklung derberuflichen Handlungskompetenzen der AuszubildendenEin Ziel der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ ist die Entwicklungberuflicher Handlungskompetenz vor dem Hintergrund eines theoretisch begründetenKompetenzmodells. Dieses Modell, welches im Rahmen der Ausbildungskonzeptionentworfen wurde, ist an den von Weidner (1995) beschriebenen konstitutivenKompetenzen professionellen Pflegehandelns angelehnt, die zum einen (pflege-)wissenschaftlicheBegründungskompetenz und zum anderen EntscheidungsundHandlungskompetenz umfassen (ebd.: 122).Erkenntnisinteresse / FragestellungDie Evaluation verfolgte das Ziel, das von der Kerngruppe Curriculum entworfeneKompetenzmodell anhand der Kompetenzentwicklung der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenkritisch zu überprüfen. Demnach bildete die Analyse und Beurteilung derberuflichen Handlungskompetenz der Auszubildenden einen zentralen Untersuchungsschwerpunkt(vgl. Kap 2.3). Der Fokus der Evaluation richtete sich im gesamtenProjektverlauf auf die folgenden forschungsleitenden Fragen, welche nach Ablaufder III. Hauptphase und des Follow-up resümierend beantwortet werden können:• Welche Kompetenzen haben die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen bis zum Ausbildungsendeentwickelt?• Wo liegen die besonderen Stärken und Schwächen der integrativ Ausgebildeten(auch im Vergleich zu traditionell ausgebildeten Pflegenden)?• Werden die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen mit dem erworbenen Kompetenzprofildem Auftrag an Pflege gerecht?Die Analyse dieser Fragen lässt Rückschlüsse auf die Qualität der curricularen Konzeptionder „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ sowie derenUmsetzung zu und ermöglicht ferner eine Einschätzung des Modells bezüglich seinerBedeutsamkeit für die Reformierung der <strong>Pflegeausbildung</strong>.Methodisches VorgehenUm eine differenzierte und umfassende Analyse der Kompetenzentwicklung derAuszubildenden zu gewährleisten, fand die Datenerhebung im Sinne der Methodentriangulationmithilfe qualitativer und quantitativer Instrumente statt. Die Kompetenzerfassungerfolgte zum einen durch geschlossene und offene Fragestellungen inFragebögen, zum anderen mithilfe von Gruppendiskussionen und Telefoninterviewssowie anhand einer nicht-teilnehmenden Beobachtung. Die Datenauswertung sämtlicherErhebungen wurde anhand eines Codierplans vorgenommen (s. Anhang), dersich am Kompetenzmodell der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> ausrichtete (zum methodischenVorgehen vgl. auch Kap. 2.4).Zur Darstellung des gesamten Entwicklungsverlaufs werden im Folgenden die Ergebnisseaus der I. und II. Hauptphase (vgl. Kap. 3) aufgegriffen und um aktuelle Datenaus der III. Hauptphase und dem Follow-up ergänzt.50
4.2.1 Stärken der IPA-AuszubildendenDie im Projektverlauf kontinuierlich erhobenen Daten erlauben differenzierte Aussagenzur Kompetenzentwicklung während der Ausbildung sowie dem erworbenenKompetenzprofil der Absolventen/innen. Die folgende Ergebnisdarstellung basiert aufeiner abschließenden inhaltsanalytischen Kategorienbildung und thematischen Zusammenfassungder Ergebnisse aller im Evaluationszeitraum durchgeführten Erhebungenzur Kompetenzerfassung. Anhand dieser Analyse lassen sich nachstehendeStärken der integrativ Ausgebildeten identifizieren:• hohe analytisch-reflexive Begründungskompetenz,• ausgeprägte interaktive bzw. sozial-kommunikative Kompetenz,• ein hohes Maß an Flexibilität und Anpassungsfähigkeit sowie• Selbstständigkeit / Eigeninitiative / Motivation.Analytisch-reflexive BegründungskompetenzBereits in den ersten Erhebungen zur Kompetenzentwicklung wurde die Reflexionsfähigkeitder integrativ Ausgebildeten als besondere Kompetenz wahrgenommen(vgl. Kap. 3.2). Beispielhaft veranschaulichen dies zwei Aussagen der Praxisanleiter/innenim Rahmen einer Gruppendiskussion:„Die IPA-Schüler setzen sich stärker als die regulären Schüler mit demeinzelnen Individuum auseinander. Bei ihnen ist einfach eine andere Herangehensweiseda. Die reflektorische Fähigkeit kommt bei Ihnen stärkerraus als bei der bisherigen Ausbildung.“(GD t1 Praxisanleiter/innen, September 2004)„Das unterscheidet sie von den Traditionellen: hinterfragen, erklären, dieBeweggründe hinterfragen, Handlungen reflektieren. Sie sind besser geschultdrin.“(GD t1 Praxisanleiter/innen, September 2004)Auch die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen erkannten ihre Stärke im analytisch-reflexivenKompetenzbereich. Sie nahmen hier bereits im zweiten Ausbildungsjahr einen großenbzw. sehr großen Zuwachs wahr (vgl. Abb. 9).51
Zuwachs an Kompetenzen im bisherigen Ausbildungsverlauf(T5 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, Mai 2004, n=23; Angaben in %)Analytisch-reflexive BegründungskompetenzPraktisch-technische KompetenzInteraktive KompetenzPlanungs- und SteuerungskompetenzOrganisations-/systembezogene KompetenzEthisch-moralische KompetenzGesellschafts- und berufspolitische Kompetenz0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100großer bzw. sehr großer ZuwachsAbb. 9: Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Ausbildungsverlauf durch die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen(T5, Mai 2004)Zum Ende der Ausbildungszeit resümierte ein/e Absolvent/in die besonderen Kompetenzen,die im Rahmen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> erworben wurden:„Ich denke auch, nicht nur zu hinterfragen haben wir gelernt, sondern zubegründen, was wir da überhaupt machen. Das find ich auch ganz wichtig,zu wissen, wieso ich was mach.“(GD t3 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, März <strong>2006</strong>)Letztlich wurde die hohe analytisch-reflexive Begründungskompetenz der <strong>Modellkurs</strong>absolventen/innenauch an ihrem jetzigen Arbeitsplatz bemerkt und geschätzt.70,8% (= 17 Befragte) der im Follow-up befragten Pflegedienstleitungen / StationsundWohnbereichsleitungen empfanden diesen Kompetenzbereich als im Vergleichzu den regulär Ausgebildeten besonders stark ausgeprägt. Ausschlaggebend für diesesErgebnis waren die beobachtete Reflexionsfähigkeit sowie ein umfangreichesFachwissen (vgl. Tab. 3).52
Tab. 3: Besonders stark ausgeprägte Fähigkeiten / Kompetenzen der Absolventen/innen aus Sichtder PDL/SL/WBL – analytisch-reflexive Begründungskompetenz (Follow-up, August <strong>2006</strong>) 27Welche Fähigkeiten/Kompetenzen sind Ihrer Ansichtnach bei den Absolventen/innen des Modellprojektsim Vergleich zu den regulär Ausgebildetenbesonders stark ausgeprägt?Anzahl derNennungenAnzahl derBefragtenAnalytisch-reflexive Begründungskompetenz 27 17 (70,8%)- Reflexionsfähigkeit 13 9 (37,5%)- Fachwissen 8 6 (25,0%)- Analysefähigkeit 2 2 (8,3%)- Sonstiges 4 3 (12,5%)n=24Interaktive bzw. sozial-kommunikative KompetenzAls weitere Stärke der integrativ Ausgebildeten erwies sich deren interaktive Kompetenz,welche von unterschiedlichen Zielgruppen hervorgehoben wurde. Bereits währenddes Ausbildungsverlaufs erkannten u. a. die Lehrenden in diesem Bereich einenbesonderen Kompetenzzuwachs (vgl. Abb. 10). Als Gründe für diese Entwicklungbenannten die Lehrkräfte das Lernfeldkonzept allgemein, die methodische Herangehensweisebei der Gestaltung der Lehr-/ Lernarrangements (interaktive Lernformen,Rollenspiele, Beratungsgespräche etc.) und die komplexen Aufgabenstellungen (situationsorientierterAnsatz) (vgl. Kap. 3.2).Zuwachs an Kompetenzen im bisherigen Ausbildungsverlauf( T2 Lehrende/Bereichslehrende, November 2004, n=15; Angaben in %)Interaktive KompetenzAnalytisch-reflexive BegründungskompetenzEthisch-moralische KompetenzOrganisations-/systembezogene KompetenzPraktisch-technische KompetenzGesellschafts- und berufspolitische KompetenzPlanungs- und Steuerungskompetenz0 10 20 30 40 50 60 70großer bzw. sehr großer ZuwachsAbb. 10: Einschätzung der Kompetenzentwicklung im Ausbildungsverlauf durch die Lehrenden/Bereichslehrenden (T2, November 2004)27 Unter dieser Fragestellung wurden von den Teilnehmenden weitere Fähigkeiten / Kompetenzen angeführt (z.B. interaktive / soziale Kompetenz: 50,0%, Planungs- und Steuerungskompetenz: 16,7%). Zur besseren Veranschaulichungwerden hier nur die Nennungen dargestellt, die dem Kompetenzbereich analytisch-reflexive Begründungskompetenzzuzuordnen sind.53
Auch die Auszubildenden schätzten sich in diesem Bereich als kompetent ein undschrieben sich selbst ein hohes Maß an sozialen Interaktionsfähigkeiten zu. DieseKompetenz sei nach Auffassung der Befragten hilfreich, um die Ausbildungsschwächenim Bereich der praktisch-technischen Kompetenzen auszugleichen (vgl. dazuKap. 4.2.2).„Also was man wieder von den Praxisanleiterinnen gehört hat, (…) also einfachdie Interaktion generell (…) das wurde immer wieder sehr deutlich gesagt,dass das sehr hoch ist, es fehlen manche praktisch – technische Kompetenzen,die aufgrund der Kürze der Einsätze (…) da sind aber, ich glaub durchdie andern Stärken, die wir haben, wird es nie ein Problem sein, wenn manuns die Zeit gibt einzuarbeiten.“(GD t3 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, März <strong>2006</strong>)Die im Rahmen des Follow-up befragten Pflegedienstleitungen/ Stations- und Wohnbereichsleitungenbestätigten die Ergebnisse der im Ausbildungsverlauf erhobenenDaten: Ihrer Auffassung nach zeigte sich die interaktive bzw. sozial-kommunikativeKompetenz bei den Absolventen/innen des <strong>Modellkurs</strong>es im Vergleich zu regulärAusgebildeten besonders stark ausgeprägt. Auf eine offene Frage zu den Stärkender Absolventen/innen führten die Befragten diesen Bereich am zweithäufigsten(50,0%) hinter Aspekten der analytisch-reflexiven Begründungskompetenz an (vgl.Abb. 11).Welche Kompetenzen sind Ihrer Ansicht nach bei den Absolventen/innendes Modellprojekts im Vergleich zu den regulär Ausgebildeten besondersstark ausgebildet?(Follow-up PDL/SL/WBL, August <strong>2006</strong>, n=24; Angaben in %)Analytisch-reflexive BegründungskompetenzInteraktive /soziale KompetenzPlanungs- und SteuerungskompetenzOrganisations-/systembezogene KompetenzFlexibilität0 10 20 30 40 50 60 70 80Abb. 11: Besonders stark ausgeprägte Kompetenzen der Absolventen/innen aus Sicht der Pflegedienstleitungen/ Stations- und Wohnbereichsleitungen (Follow-up, August <strong>2006</strong>) 2828 Dargestellt sind Kategorien mit mindestens drei Nennungen.54
Im Einzelnen offenbarte sich die interaktive Kompetenz der <strong>Modellkurs</strong>absolventen/innenaus Sicht der Pflegedienstleitungen / Stations- und Wohnbereichsleitungenin einer angemessenen Kommunikation allgemein, einer hohen sozialen Kompetenz,in der Fähigkeit zu Beratung und Gesprächsführung sowie im Umgang mit Pflegeempfängernund deren Bezugspersonen (vgl. Tab. 4).Tab. 4: Besonders stark ausgeprägte Kompetenzen der Absolventen/innen aus Sicht derPDL/SL/WBL – interaktive / soziale Kompetenz (Follow-up, August <strong>2006</strong>) 29Welche Fähigkeiten/Kompetenzen sind Ihrer Ansichtnach bei den Absolventen/innen des Modellprojekts imVergleich zu den regulär Ausgebildeten besondersstark ausgeprägt?Anzahl derNennungenAnzahl derBefragtenInteraktive / soziale Kompetenz 17 12 (50,0%)- Kommunikation 6 6 (25,0%)- Soziale Kompetenz 5 5 (20,8%)- Beratung/ Gesprächsführung 2 2 (8,3%)- Interaktive Kompetenz 2 2 (8,3%)- Umgang mit Patienten und Angehörigen 2 2 (8,3%)n=24Flexibilität, AnpassungsfähigkeitDas Durchlaufen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> bringt ein hohes Maß an Flexibilitätmit sich, insbesondere bedingt durch die häufig wechselnden Praxiseinsatzorte.Neue Institutionen und veränderte Abläufe erfordern von den Auszubildenden eineschnelle Anpassung an die Gegebenheiten und führen letztlich zu einem breitenWissens- und Erfahrungsspektrum, auf dessen Basis flexibles Denken und Handelnmöglich werden.Die im Jahr 2004 befragten Kooperationspartner/innen des Modellprojekts bescheinigtenden integrativ Ausgebildeten mehrheitlich die zur Erfüllung der gestiegenenAnforderungen des pflegerischen Alltags erforderliche Flexibilität (vgl. Abb. 12; vgl.Kap. 3.2).29 Unter dieser Fragestellung wurden von den Teilnehmenden weitere Fähigkeiten / Kompetenzen angeführt. Zurbesseren Veranschaulichung werden hier nur die Nennungen dargestellt, die dem Bereich interaktive Kompetenzzuzuordnen sind.55
Heute wird von Pflegepersonen zunehmend eine höhere Flexibilität imEinsatz erwartet. Glauben Sie, dass integrativ Ausgebildete im Vergleichzu traditionell Ausgebildeten dieseAnforderungen besser erfüllen?(I1 PDL/Träger, Okt./Nov. 2004, Angaben in %)1008081,881,8604018,2209,1 9,10Träger (n=11)PDL's (n=11)ja nein weiß nicht keine AngabenAbb. 12: Einschätzung der Flexibilität integrativ Ausgebildeter im Vergleich zu traditionellAusgebildeten (PDL I1, Träger I1, Oktober / November 2004)Unterstützt wurde diese Einschätzung ebenso von der Zielgruppe der Lehrenden:„Sie haben auf jeden Fall sehr gut gelernt, Problemlösungen zu finden unddie dann auch umzusetzen. (...) Ja, sie sind flexibel in der Umsetzung,auch von Dingen, von Veränderung, anpassungsfähig.“(TI Lehrende, Juli <strong>2006</strong>)Aufgrund dieser Flexibilität bezüglich der Organisation und Gestaltung der Arbeitsabläufefällt es den Auszubildenden im Vergleich zu den traditionell ausgebildeten Pflegendenleichter, sich in neuen Einrichtungen zu orientieren und einzuarbeiten.„Ich glaub auch dass wir fähig sind, uns schnell auf neue Gegebenheiteneinzustellen, weil man einfach (…) drauf angewiesen war durch (…) immerwieder neue Häuser, immer wieder ganz neue (…), Dokumentation (…) alleshalt eben neu. `ne ganze neue Station, einfach, dass man da, fähig ist(…) sich schnell auf was Neues irgendwie einzulassen und sich auch dortschnell zurechtzufinden.“(GD t3 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, März <strong>2006</strong>)Die im Follow-up befragten Pflegedienstleitungen / Stations- und Wohnbereichsleitungenbenannten ebenfalls die Flexibilität als eine Stärke der Absolventen/innen.Diese gewährleiste nach ihren Erfahrungen eine schnelle Einarbeitung im neuen Arbeitsumfeld.Die folgenden Aussagen aus der schriftlichen Erhebung veranschaulichenexemplarisch die Einschätzung der Befragten:56
*: flexibler, anpassungsfähiger durch Einsätze in mehreren Häusern*: hohe Flexibilität, kann sich auf neue Situationen schnell einstellen*: gut vorbereitet auf komplexe Zusammenhänge, wechselnde Rahmenbedingungen*: konnte trotz frisch „examinierten Status“ sehr schnell einen Überblicküber die Aufgaben und deren Prioritäten erhalten(Follow-up PDL/SL/WBL, August <strong>2006</strong>)Selbstständigkeit / Eigeninitiative / MotivationBereits zu Beginn der Ausbildung unterschieden sich die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenaus Sicht der Praxisanleiter/innen durch ihre besondere Selbstständigkeit und einhohes Maß an Eigeninitiative und Motivation von regulären Auszubildenden (vgl.Kap. 3.2).„Diese Selbstständigkeit, Sachen zu erlernen, also ich merke da Unterschiede,dass ich bei den Regulären jetzt da immer so ein bisschen einenAnstoß geben muss... und bei denen ist es irgendwie klar und sie fordernund sie gehen einem nach und wollen es wissen.“(GD t1 Praxisanleiter/innen, September 2004)Desgleichen bestätigten die Praxisanleiter/innen gegen Ende der Ausbildung (T4,Oktober 2005) mehrheitlich (64,0% = 16 Befragte), dass die integrativ Ausgebildetenan ihrem Arbeitsplatz überwiegend selbstgesteuert lernen 30 .Diese Einschätzung spiegelten sie den <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen im Rahmen ihrerPraxiseinsätze wider:„Mir ist es auch schon oft so gegangen, dass von der Praxis her oft gesagtworden ist, der Unterschied zur regulären Ausbildung, dass die Eigeninitiativeviel höher ist, einfach zu fragen, was kann ich sehen, was gibt’s Signifikantesdrüber, was ist hier Besonderes und so, dass von uns aus, dasswir da sehr offen sind, auch neugierig und halt interessiert, alles kennen zulernen, dass das wohl bei regulären Schülern, die auch immer im gleichenHaus sind, dass da das Interesse nicht so groß ist oder wenn vielleicht dasInteresse schon besteht, aber die nicht von sich aus auf die Leute zugehen,sondern eher darauf warten, bis sie jemand anspricht.“(GD t2 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, August 2004)Als unterstützend für die Entwicklung von Selbstständigkeit und die ausgeprägte Motivationund Eigeninitiative ließen sich im Wesentlichen zwei Faktoren identifizieren:Der hohe Anteil an selbstorganisiertem Lernen im Unterricht förderte auch am Arbeitsplatzdie Fähigkeit, selbstgesteuert zu handeln und sich bei Bedarf fehlendesWissen anzueignen. Darüber hinaus wirkten sich das Kennen lernen unterschiedli-30 Ergebnisse im Einzelnen (T4 Praxisanleiter/innen, Oktober 2005, n=25):Zustimmung zu der Aussage „Die IPA-Auszubildenden lernen an ihrem Arbeitsplatz überwiegend selbstgesteuert.“:trifft voll zu: 20,0%; trifft eher zu: 44,0%; teils-teils: 28,0%; trifft eher nicht zu: 4,0%; trifft überhaupt nicht zu:0%; keine Angabe: 4,0%.57
cher Einrichtungen und pflegerischer Handlungsmöglichkeiten sowie Hospitationen inpflegefernen Bereichen positiv auf Interesse und Motivation der Auszubildenden aus:„Also ich find jetzt auch die Motivation größer wie jetzt von anderen Schülernegal von welchem Haus, die können dann halt auch, ja, von verschiedenenHäusern Vergleiche ziehen. Und was ich auch gut fand, so die Hospitation,die sie hatten, die jetzt nicht in der AP, KP, KKP waren, sondernauch mal im Kinderheim, im Kindergarten sonst wo, wo man ja sonst eigentlichja in unserer Ausbildung eigentlich nicht hinkam.“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)Die beschriebene Eigeninitiative sowie die Offenheit und das Interesse am HandlungsfeldPflege der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen wurde über das Ausbildungsendehinaus auch an ihrem ersten Arbeitsplatz von einigen Befragten positiv angemerkt 31 .4.2.2 Schwächen der IPA-AuszubildendenNeben den oben beschriebenen Stärken wurden gleichermaßen auch Schwächender integrativ Ausgebildeten wahrgenommen. Die nachfolgend dargestellten Problembereichezeigten sich meist kontinuierlich im Ausbildungsverlauf und wurden vonverschiedenen Zielgruppen beobachtet und erläutert:• Handlungsunsicherheiten im Bereich praktisch-technischer Kompetenz,insbesondere in der Kinderkrankenpflege,• Schwächen in der organisations-/ systembezogenen Kompetenz und• begrenztes Wissen in speziellen Bereichen.Handlungsunsicherheiten im Bereich praktisch-technischer Kompetenz, insbesonderein der KinderkrankenpflegeBereits ab Ende des ersten Ausbildungsjahres formulierten die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenden Wunsch nach einer verstärkten Vermittlung praktisch-technischerKompetenzen 32 (vgl. Kap. 3.2). Begründet wurde dieser Nachholbedarf im praktischtechnischenBereich mit fehlenden Umsetzungsmöglichkeiten am Lernort Pflegepraxis,wie die folgenden Ausführungen verdeutlichen:31 Ergebnisse im Einzelnen (Follow-up PDL/SL/WBL, August <strong>2006</strong>, n=24):„Welche Eindrücke haben Sie bisher von den Absolvent/innen des Modellprojekts in positiver Hinsicht erhalten?“(offene Frage): Interesse / Motivation: 12,5%; weitere Nennungen: analytisch-reflexive Begründungskompetenz:58,3%; interaktive / soziale Kompetenz: 29,2%; ethisch-moralische Kompetenz und Planungs- und Steuerungskompetenz:jeweils 12,5%32 Ergebnisse im Einzelnen (T4 IPA, Oktober 2003, n=26): „Welche Fähigkeiten / Kompetenzen möchten Sie imweiteren Verlauf Ihrer Ausbildung erwerben?“: Praktisch-technische Kompetenz: 65,4%(T5 IPA, Mai 2004, n=23): „Welche am Lernort Schule geförderten Fähigkeiten / Kompetenzen konnten Sie nochnicht in der täglichen pflegerischen Arbeit entwickeln?“: 7 von 10 Befragten, auf die diese Frage zutraf, nanntendie praktisch-technische Kompetenz.„Fühlen Sie sich Ihrem Ausbildungsstand entsprechend in der Praxis kompetent?“: 31,3% (= 7 Befragte) verneintendies, 6 von Ihnen führten Nachholbedarf im Bereich der praktisch-technischen Kompetenz an.58
*: Keine Möglichkeit gehabt, es durchzuführen!*: War in diesen Arbeitsfeldern noch nicht eingesetzt oder hatte nicht dieMöglichkeit, bin noch nicht in gewisse Situationen gekommen*: Da bestimmte Pflegetätigkeiten an den Praxisstellen, die auf einen Blockfolgen, nicht gegeben sind, z. B. Katheter legen im ambulanten Einsatznicht möglich*: Zu wenig Praxiseinsätze im entsprechenden Bereich*: Möglichkeiten waren nicht gegeben, da die letzten Einsatzorte oft nichtdiese Themen als Lernangebote hatten.(T5 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, Mai 2004)Defizite empfanden die Auszubildenden vor allem im Bereich der Gesundheits- undKinderkrankenpflege, z. B. bezüglich der Hilfestellung bei der Körperpflege:„Aber so vom Praktischen her habe ich schon gemerkt, dass mir da Einigesfehlt, gerade auch, weil es in den Häusern manchmal unterschiedlichgemacht wird, gerade so einfache Sachen in der Grundpflege, bei Säuglingenoder so, und da habe ich mich da schon zum Teil nicht so gut vorbereitetgefühlt wie jetzt in der regulären Pflege.“(GD t2 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, August 2004)Auch die Praxisanleiter/innen bemerkten im Handlungs- und Aufgabenfeld der Kinderkrankenpflegedie größten Schwierigkeiten, die sie mit zu kurzen Einsatzzeitenbegründeten. Sie prophezeien den Absolventen/innen infolgedessen eine eingeschränkteHandlungsfähigkeit in diesem Bereich:„Ich finde in der Kinderkrankenpflege gibt´s bestimmt das eine oder andereManko noch. (...) Allein von diesem Umgang mit den Patienten, weil sieeinfach nicht genug Zeit hatten zu lernen: wie nehme ich ein Baby, was istda für´n Verhaltensmuster, was ist das Kleinkind, das große Kind; das sindeinfach, das Spektrum ist so groß, (...) da tun sie sich bestimmt am Anfangschwer.“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)Im Rahmen des Follow-up bestätigten 45,8% der Pflegedienstleitungen / StationsundWohnbereichsleitungen (= 11 Befragte), dass sie bei den Absolventen/innen der<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> auch schwach ausgeprägte Kompetenzen wahrnehmen(vgl. Abb. 13).59
Gibt es Ihrer Meinung nach bei den Absolventen/innen desModellprojekts im Vergleich zu regulär Ausgebildeten auch schwachausgeprägte Kompetenzen?(Follow-up PDL/SL/WBL, August <strong>2006</strong>, n=24; Angaben in %)keine Angabe17%ja45%nein38%ja nein keine AngabeAbb. 13: Einschätzung über schwach ausgeprägte Kompetenzen der IPA-Absolventen/innen ausSicht der PDL/SL/WBL (Follow-up, August <strong>2006</strong>)In diesem Kontext wurden Schwächen im praktisch-technischen Bereich von 4 Befragten(16,7%) angeführt 33 .Schwächen in der organisations-/ systembezogenen KompetenzDefizite im organisations-/ systembezogenen Kompetenzbereich wurden von den befragtenZielgruppen im Ausbildungsverlauf kaum thematisiert. Indessen stellten diePflegedienstleitungen / Stations- bzw. Wohnbereichsleitungen im Follow-up diesbezüglicheSchwächen fest. Sie registrierten insbesondere Probleme bei der Gestaltungarbeitsorganisatorischer Abläufe und im Zeitmanagement (vgl. Tab. 5).Tab. 5: Schwach ausgeprägte Kompetenzen der Absolventen/innen aus Sicht der PDL/WBL/SL –organisations-/ systembezogene Kompetenz (Follow-up, August <strong>2006</strong>) 34Welche Fähigkeiten/Kompetenzen sind Ihrer Ansicht nachbei den Absolventen/innen des Modellprojekts im Vergleichzu den regulär Ausgebildeten eher schwach ausgeprägt?Anzahl derNennungenAnzahl derBefragtenOrganisations- systembezogene Kompetenz 7 7 (29,2%)- Arbeitsorganisation 5 5 (20,8%)- Zeitmanagement 2 2 (8,3%)n=2433 Ergebnis im Einzelnen (Follow-up PDL/SL/WBL, August <strong>2006</strong>, n=24): Aussagen zu den Schwächen im praktisch-technischenBereich: *: Durchführung von kleinen Aktivierungsangeboten*: fachpraktische Kompetenz; Schwerpunkt Akutkrankenhaus ist zu wenig praktisch berücksichtigt.*: oft leider keine praktischen Fähigkeiten*: selbstständiges Arbeiten/Übernahme eines Bereiches von 12 Pat.34 Unter dieser Fragestellung wurden von den Teilnehmenden weitere Fähigkeiten / Kompetenzen angeführt. Zurbesseren Veranschaulichung werden hier nur die Nennungen dargestellt, die dem Bereich organisations-/ systembezogeneKompetenz zuzuordnen sind.60
Begrenztes Fachwissen in speziellen BereichenInsgesamt betrachtet verfügen die Absolventen/innen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>über ein breites und fundiertes pflegerisches Fachwissen, das von den Kollegen/innenin der Praxis positiv hervorgehoben und geschätzt wurde. Beispielhaftspiegeln dies zwei Aussagen aus einer Gruppendiskussion mit den Praxisanleiter/innen(t2, März <strong>2006</strong>) wider:„Ich finde auch rhetorisch und überhaupt sind die super drauf, und die habenein Wissen, das ist ganz toll und das erschüttert einen auch (lacht).“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)„Also bei uns ist durch dieses theoretische Wissen, was die Schüler gebrachthaben mancher ins Nachdenken gekommen, ob er jetzt eigentlichauch nicht selber noch mal ein Buch herholen müsste, weil wir jetzt in derPraxis sind.“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)Dessen ungeachtet beschrieben die Praxisanleiter/innen auch Defizite bezüglich desspeziellen Fachwissens der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen:„Und wir haben auch (…) oft schon festgestellt, dass bei vielen theoretischeLücken da sind von Dingen, die wir einfach vorausgesetzt haben vonDrittjahrschülern, Examensschülern. Da hab ich oft schon gedacht, hoppla,an was liegt´s?“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)Die Auszubildenden nahmen diesen Widerspruch bezüglich des theoretischen Wissensebenfalls wahr. Sie erläuterten die Diskrepanz zwischen einem breit angelegten,soliden Basiswissen einerseits und fehlenden spezifischen Fachkenntnissen andererseits,wobei sie letztgenannte insbesondere im Bereich der Kinderkrankenpflegefeststellten:„Vielleicht eben auch noch ein Stück weit (…) in die Tiefe gehen zu können,weil man hat durch die Ausbildung ein sehr breites Wissen (…) undsehr breites Spektrum an Erfahrungen, aber halt in die Tiefe, man hat vieleinfach nicht gesehen oder gemacht.“(GD t3 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, März <strong>2006</strong>)„Also ich fand auch wir haben schon viel theoretischen Input gehabt, abermanches, halt so, also grad ich hab z. B. Kinderkrankenpflege gemacht imersten Abschluss und da haben einfach Sachen gefehlt, die wichtig sind,ja, die wir einfach nie behandelt haben und (…) das mussten wir dann haltselber erst mal merken, dass es fehlt (lacht) und zweitens, uns selber aneignen.“(GD t3 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, März <strong>2006</strong>)61
Die kritische Einschätzung der theoretischen und praktischen Kompetenzen im Bereichder Gesundheits- und Kinderkrankenpflege mag ein Grund dafür gewesen sein,warum nur ein/e Absolvent/in nach Abschluss der Ausbildung einen Arbeitsplatz indiesem Handlungsfeld gefunden hat (Stand Juli <strong>2006</strong>). Unklar bleibt jedoch, ob indiesem Bereich kein Interesse an integrativ ausgebildeten Pflegenden vorhandenwar oder ob die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen aufgrund negativer Erfahrungen sowieselbst empfundener Unsicherheiten von Bewerbungen in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflegevon vornherein abgesehen haben.4.2.3 Beurteilung des Kompetenzprofils der Auszubildenden imRahmen der praktischen Prüfungen – Ergebnisse derBeobachtungDie Evaluation der praktischen Examensprüfungen verfolgte das Ziel, die zum Abschlussder Ausbildung erworbenen Kompetenzen der Absolventen/innen direkt imPraxisfeld zu erheben und mit Blick auf die Ausbildungskonzeption zu analysieren.Gleichzeitig wurde angestrebt, das von der Kerngruppe Curriculum entworfene Kompetenzmodelleiner kritischen Prüfung zu unterziehen. Handlungsleitend waren dabeidie folgenden Forschungsfragen (vgl. auch 62. Protokoll der Kerngruppe Curriculum):• Ist das Kompetenzmodell der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das StuttgarterModell © “ in der Prüfungssituation abgebildet?• Werden die Kompetenzen beobachtet, die im Kompetenzmodell der „<strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ vorgesehen sind?• Werden evtl. weitere Kompetenzen gezeigt, die nicht explizit im Modell der„<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ verankert sind?Nachfolgend werden die Ergebnisse der Beobachtung in gekürzter Form dargestelltsowie die hierbei leitenden Forschungsfragen beantwortet. Eine umfassende Beschreibungdes methodischen Vorgehens und eine detaillierte Datenauswertung und–analyse mit einer Fallbeschreibung zu jeder Prüfung bietet der Bericht zur Evaluationder praktischen Abschlussprüfungen im Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>:Das Stuttgarter Modell © “ (iap <strong>2006</strong>).Im Rahmen der Ergebnisdarstellung ist einleitend auf die eingeschränkte Aussagekraftder Erhebung hinzuweisen. Diese ergibt sich aus der kleinen Stichprobe vonn=6 sowie insbesondere aus den sehr heterogenen Prüfungssituationen mit unterschiedlichenAnspruchsniveaus. Unter den bestehenden Voraussetzungen war einevorbehaltlose Vergleichbarkeit der Prüfungen und der dabei beobachteten Kompetenzennicht gegeben. Dessen ungeachtet ließen sich anhand der begleiteten PrüfungenAussagen bezüglich der Umsetzung des Kompetenzmodells der „<strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ treffen und Tendenzen zum Stand derberuflichen Handlungskompetenz der Absolventen/innen nachzeichnen. Die Gesamtauswertungder 12 Beobachtungsraster (6 Prüfungen à 2 Beobachterinnen)zeigte, dass die sechs bewerteten Kompetenzen bei den Auszubildenden im Schnittals gut entwickelt zu beurteilen waren (vgl. Abb. 14).62
Ethisch-moralische K.Analytisch-reflexive K.54321Praktisch-technische K.Organisations-/systembezogene K.Interaktive K.Planungs- und Steuerungsk.(5=sehr gut; 4=gut; 3=zufrieden stellend; 2=ausreichend; 1=unbefriedigend)Abb. 14: Kompetenznetz der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen anhand der Beobachtung derpraktischen Prüfungen (B1, Februar <strong>2006</strong>)Zu den einzelnen Kompetenzbereichen lassen sich zusammenfassend folgende Ergebnissefesthalten:Ergebnisse zur analytisch-reflexiven BegründungskompetenzDie bisherigen Datenerhebungen im Ausbildungsverlauf ergaben eine besonders hoheEinschätzung der analytisch-reflexiven Begründungskompetenz, sowohl von Seitender Praxisanleiter/innen und Pflegedienstleitungen / Stations- und Wohnbereichsleitungenals auch aus Sicht der Auszubildenden selbst (vgl. Kap. 3; 4.2.1). Daherüberraschte das Ergebnis der Beobachtungen, in denen dieser Kompetenzbereichals eher schwächer ausgeprägt wahrgenommen wurde. Aus Sicht der Evaluatorinnenist diese Abweichung damit zu erklären, dass die Demonstration analytischreflexiverKompetenzen mitunter von dem Verhalten der Prüfer/innen beeinflusstwurde. Sofern die Lehrenden keine oder nur wenige Nachfragen an die Auszubildendenrichteten, wurden letztere in ihren Fähigkeiten nur bedingt herausgefordert.Eine andere mögliche Erklärung ist, dass den Praxisanleiter/innen die analytischreflexivenKompetenzen der integrativ Ausgebildeten besonders im Vergleich zu denregulär Ausgebildeten ins Auge fielen und damit zu einer sehr positiven Einschätzungdes Bereiches in vorangegangenen Untersuchungen führten. Eventuell sind dieAbweichungen in der Bewertung auf die unterschiedlichen Sichtweisen und Bewertungsmaßstäbeder Praxisanleiter/innen auf der einen Seite sowie der Evaluatorinnenund Prüfenden auf der anderen Seite zurückzuführen. Ein direkter Vergleich der63
erhaltenen Ergebnisse gestaltet sich ferner durch die Anwendung verschiedener Methoden(Fragebogen, Gruppendiskussion, Beobachtung) schwierig.Erstellt man eine Übersicht aller Mittelwerte der beobachteten Kriterien zur analytisch-reflexivenBegründungskompetenz, so lassen sich die in den Prüfungssituationenbeobachteten Stärken und Schwächen im Einzelnen identifizieren (vgl. Tab. 6).Tab. 6: Mittelwerte zu den Beobachtungskriterien der analytisch-reflexiven Begründungskompetenz 35BeobachtungskriteriumMittelwertBegründungsfähigkeit 4,33Reflexionsfähigkeit 4,00Selektion von Informationen 3,78Problemlösefähigkeit 3,60Analysefähigkeit 2,86(5=sehr gut; 4=gut; 3=zufrieden stellend; 2=ausreichend; 1= unbefriedigend)Die Tabelle zeigt, dass die Auszubildenden gut in der Lage waren, ihr Handeln zubegründen und zu reflektieren. Hingegen ist die Analysefähigkeit der Absolventen/innenetwas schwächer zu bewerten, da das Heranziehen von Pflegemodellenund –konzepten zur Analyse der jeweiligen Pflegesituation nur bedingt erfolgte.Ergebnisse zur praktisch-technischen KompetenzBei der praktisch-technischen Kompetenz ergibt eine Gegenüberstellung mit bisherigenDaten ebenfalls eine Diskrepanz: In diesem Bereich stellten Auszubildende undPraxisanleiter/innen in vorherigen Erhebungen mehrheitlich einen Nachholbedarf z.B. bezüglich des Handlings und der Krankenbeobachtung in der Kinderkrankenpflegefest (vgl. Kap. 3.2; Kap. 4.2.2), der sich im Rahmen der Beobachtungen nicht bestätigte.Wie anhand des Kompetenznetzes ersichtlich ist (vgl. Abb. 14 S. 63), wurde diepraktisch-technische Kompetenz von allen Kompetenzbereichen als am besten entwickelteingestuft. Es gilt jedoch an dieser Stelle die fehlende Repräsentativität dergewählten Methode zu beachten, welche keinen einwandfreien Vergleich zu den bisherigenDaten zulässt. Einschränkend ist überdies zu bemerken, dass die Kriterienzur Bewertung der praktisch-technischen Kompetenz eher allgemein formuliert undvon einem verhältnismäßig geringen Abstraktionsniveau waren (z. B. „Einhaltung einesangemessenen Zeitrahmens“, „Berücksichtigung hygienischer Richtlinien“). Aufgrundder vorab unbekannten und letztlich sehr verschiedenartigen Prüfungssituationenwar eine spezifischere Beurteilung dieses Kompetenzbereichs anhand des Beobachtungsrastersnicht möglich. Ferner ist anzumerken, dass über die Methode derBeobachtung praktisch-technische Kompetenz am unmittelbarsten sichtbar und einschätzbarwird. Dessen ungeachtet kann positiv gewertet werden, dass die vermeintliche„Schwäche“ der integrativ Ausgebildeten innerhalb der Prüfungen relativiertwerden konnte. Einen Überblick über die Ergebnisse zu den Kategorien der praktisch-technischenKompetenz bietet Tab. 7.35 Kategorien mit weniger als 7 gültigen Werten werden hier nicht berücksichtigt.64
Tab. 7: Mittelwerte zu den Beobachtungskriterien der praktisch-technischen Kompetenz 36BeobachtungskriteriumMittelwertEinhaltung eines angemessenen Zeitrahmens 4,50Berücksichtigung hygienischer Richtlinien 4,38Berücksichtigung von Prinzipien 4,29Sicherheit 4,25Korrekte Anwendung von Hilfsmitteln 4,10(5=sehr gut; 4=gut; 3=zufrieden stellend; 2=ausreichend; 1= unbefriedigend)Alle Beobachtungskriterien zur praktisch-technischen Kompetenz können demnachals gut bis sehr gut entwickelt bezeichnet werden. Zwischen den einzelnen Kategoriendieses Kompetenzbereichs lassen sich lediglich geringfügige Unterschiede erkennen.Ergebnisse zur interaktiven KompetenzMit der durchweg guten Einschätzung der interaktiven Kompetenz bestätigten sichdie positiven Evaluationsergebnisse zu diesem Kompetenzbereich aus den vorherigenDatenerhebungen (vgl. Kap. 3.2; Kap. 4.2.1). Tab. 8 veranschaulicht die Ergebnisse.Tab. 8: Mittelwerte zu den Beobachtungskriterien der interaktiven Kompetenz 37BeobachtungskriteriumMittelwertWertfreie Informationsweitergabe 4,58Personenorientierte Kommunikation 4,08Aktive Gestaltung des Beziehungsprozesses 3,92Situationsangemessene Anwendung von Kommunikationstechniken3,83Schaffen einer angemessenen Gesprächsatmosphäre3,63Fähigkeit zu aktivem Zuhören 3,50(5=sehr gut; 4=gut; 3=zufrieden stellend; 2=ausreichend; 1= unbefriedigend)Die Auszubildenden zeigten in den Prüfungssituationen, dass sie Informationen wertfreiweitergeben und ihre Kommunikation an dem Pflegeempfänger orientieren konnten.Etwas geringer bewertet wurden das Schaffen einer angemessenen Gesprächsatmosphäresowie die Fähigkeit zu aktivem Zuhören. Möglicherweise wurden dieseAspekte durch die Anspannung in der Prüfungssituation und die Anwesenheit vonPrüfern/innen und Beobachterinnen erschwert.Ergebnisse zur Planungs- und SteuerungskompetenzAbweichend von allen anderen Beobachtungskriterien im Bereich der Planungs- undSteuerungskompetenz wurde die Anwendung des Pflegeprozesses im Durchschnittals lediglich zufrieden stellend wahrgenommen. Während die im Rahmen der Prü-36 Kategorien mit weniger als 7 gültigen Werten werden hier nicht berücksichtigt.37 Kategorien mit weniger als 7 gültigen Werten werden hier nicht berücksichtigt.65
fungen erstellten Pflegeplanungen mehrheitlich als gut strukturiert und differenziertbeurteilt wurden, gelang den Auszubildenden die Umsetzung in der konkreten Pflegesituationhingegen nur bedingt. In Tab. 9 werden die einzelnen Beobachtungskriterienmit den jeweiligen Mittelwerten aus dem Beobachtungsraster dargestellt.Tab. 9: Mittelwerte zu den Beobachtungskriterien der Planungs- und Steuerungskompetenz 38BeobachtungskriteriumMittelwertAnwendung von Pflegefachsprache 4,33Fähigkeit zur Dokumentation 4,29Fähigkeit zur Informationsbeschaffung 3,92Anwendung des Pflegeprozesses 3,00(5=sehr gut; 4=gut; 3=zufrieden stellend; 2=ausreichend; 1= unbefriedigend)Ergebnisse zur organisations-/ systembezogenen KompetenzIm Bereich der organisations- und systembezogenen Kompetenz ließen sich letztlichnur drei Beobachtungskriterien prüfungsübergreifend bewerten. Die Ergebnisse dieserEinschätzungen zeigt Tab. 10.Tab. 10: Mittelwerte zu den Beobachtungskriterien der organisations-/ systembezogenenKompetenz 39BeobachtungskriteriumMittelwertIndividuelle Abstimmung von Rahmenbedingungen 3,83Individuelle Abstimmung von arbeitsorganisatorischenAbläufen3,82Fähigkeit zur Gesamtübersicht 3,58(5=sehr gut; 4=gut; 3=zufrieden stellend; 2=ausreichend; 1= unbefriedigend)Insgesamt gelang den Auszubildenden die individuelle Abstimmung von Rahmenbedingungenund arbeitsorganisatorischen Abläufen gut. Ihre Fähigkeit zur Gesamtübersichterwies sich im Durchschnitt als etwas schwächer ausgeprägt.Ergebnisse zur ethisch-moralischen KompetenzWie in Tab. 11 ersichtlich, ist die ethisch-moralische Kompetenz der beobachtetenAbsolventen/innen ebenfalls als gut entwickelt zu beurteilen. Insbesondere ihreWertschätzung sowie Akzeptanz / Respekt gegenüber dem Pflegeempfänger undseinen Bezugspersonen wurden in den Prüfungen sichtbar.38 Kategorien mit weniger als 7 gültigen Werten werden hier nicht berücksichtigt.39 Kategorien mit weniger als 7 gültigen Werten werden hier nicht berücksichtigt.66
Tab. 11: Mittelwerte zu den Beobachtungskriterien der ethisch-moralischen Kompetenz 40BeobachtungskriteriumMittelwertWertschätzung 4,33Akzeptanz / Respekt 4,08Sensibilität 3,86Verantwortungsbewusstsein 3,67(5=sehr gut; 4=gut; 3=zufrieden stellend; 2=ausreichend; 1= unbefriedigend)Vor dem Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse lassen sich die forschungsleitendenFragen der Beobachtung wie folgt beantworten:• Ist das Kompetenzmodell der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das StuttgarterModell © “ in der Prüfungssituation abgebildet?Mit Ausnahme der „gesellschafts- und berufspolitischen Kompetenz“, welche bewusstnicht in die Beobachtung einbezogen wurde, ließen sich in den Prüfungssituationenalle Bereiche des Kompetenzmodells beobachten. Daraus lässt sich ableiten,dass innerhalb der 3,5-jährigen <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> alle Kompetenzbereichegleichwertig berücksichtigt und vermittelt wurden. Die analytischreflexiveBegründungskompetenz sowie die praktisch-technische Kompetenzkonnten nur teilweise in der Situation gezeigt bzw. von den Beobachterinnen umfassendeingeschätzt werden. Diese Einschränkungen ergaben sich aus den äußerstheterogenen Prüfungssituationen bzw. aus der schwierigen Operationalisierbarkeitder Beobachtungen und sind nicht auf die Umsetzung des Kompetenzmodellszurückzuführen. Zusammenfassend lässt sich aussagen, dass sichdas Kompetenzmodell der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell© “ in den Pflegehandlungen der Absolventen/innen widerspiegelte.• Werden die Kompetenzen beobachtet, die im Kompetenzmodell der „<strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ vorgesehen sind?Die Mehrzahl der aus dem Kompetenzmodell entwickelten Bewertungskriterienkonnte in der Prüfungssituation von den Evaluatorinnen beobachtet und beurteiltwerden. Einige Kategorien ließen sich nur bedingt bewerten, was wiederum mitden unterschiedlichen Pflegesituationen zu begründen ist, welche die jeweiligenKompetenzen vielfach nicht explizit erforderten bzw. nicht hergaben. Die Tatsache,dass diese Kompetenzen nicht beobachtet wurden, lässt demnach nicht aufDefizite bei den Auszubildenden schließen.• Werden evtl. weitere Kompetenzen gezeigt, die nicht explizit im Modellder „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ verankertsind?Dem bei der Evaluation verwendeten Beobachtungsraster wurden zwei Kategorienhinzugefügt, die nicht ausdrücklich im Kompetenzmodell aufgeführt, jedochim Rahmen der Beurteilung pflegerischer Handlungskompetenz von Interessesind 41 . Bezüglich des Kriteriums „Stressfähigkeit / Umgang mit Belastungen“ istfestzuhalten, dass diese Kompetenz in allen Prüfungssituationen wahrgenommen40 Kategorien mit weniger als 7 gültigen Werten werden hier nicht berücksichtigt.41 vgl. hierzu: BMFSFJ (Hrsg.) (<strong>2002</strong>): Die Entwicklung der Kommunikationskultur in Pflegeheimen. Ein Praxishandbuch.Kohlhammer67
und insgesamt als gut ausgeprägt beurteilt werden konnte (Mittelwert 4,00). DieKategorie „Aushandlungskompetenz“ ließ sich hingegen nur in der Hälfte der Prüfungenbeobachten, was mit den unterschiedlichen Anforderungen in den gezeigtenPflegesituationen zu erklären ist. Darüber hinaus demonstrierten einige Auszubildendeeine besondere Flexibilität bei wechselnden Anforderungen und Veränderungenim Ablauf sowie die Fähigkeit, während der Prüfungssituation auchihre eigene Gesundheit im Blick zu haben (Selbstpflegekompetenz). Mit Blick aufdiese Ergebnisse empfiehlt sich eine Erweiterung bzw. Überprüfung des Kompetenzmodells.4.2.4 Einschätzung des Kompetenzprofils der Absolventen/innen hinsichtlich zukünftiger Aufgaben und HandlungsfelderZur abschließenden Beurteilung des Kompetenzprofils der Absolventen/innen der <strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong> ist von zentraler Bedeutung, inwiefern diese in Hinblickauf zukünftige Aufgaben und Handlungsfelder der Pflege qualifiziert sind. Diese Fragestellungwurde insbesondere im Rahmen des Follow-up fokussiert.Mit einer deutlichen Mehrheit (93,3% = 14 Befragte) gaben die Absolventen/innen an,durch die „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ gut auf den Berufseinstiegvorbereitet zu sein 42 . Einen wichtigen Beitrag zu diesem guten Start inden Beruf leisteten nach eigener Einschätzung primär die Vielfalt der Praxiseinsatzorte(53,3% = 8 Befragte), das selbstständige Arbeiten und Lernen während derAusbildung (40,0% = 6 Befragte) und die gute Anleitung bzw. Begleitung im Praxiseinsatz(26,7% = 4 Befragte). Weitere als förderlich wahrgenommene Faktoren sindTab. 12 zu entnehmen.Tab. 12: Förderliche Faktoren zur Vorbereitung auf den Berufseinstieg aus Sicht der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen(T9, Juli <strong>2006</strong>)Was hat dazu beigetragen, dass Sie sich gut aufden Berufseinstieg vorbereitet gefühlt haben?Anzahl derNennungenAnzahl derBefragtenVielfalt der Praxiseinsatzorte 8 8 (53,3%)selbstständiges Arbeiten und Lernen 6 6 (40,0%)gute Anleitung/ Begleitung im Praxiseinsatz 4 4 (26,7%)erforderliche Flexibilität in der Ausbildung 3 3 (20,0%)Vermittlung von theoretischem Wissen 3 3 (20,0%)praktische Fähigkeiten 2 2 (13,3%)Vorteile durch längere Ausbildung 2 2 (13,3%)Sonstiges 6 5 (33,3%)n=15Die Absolventen/innen beurteilten ihre berufliche Handlungsfähigkeit in der Pflegepraxisvier Monate nach Abschluss der Ausbildung insgesamt als gut bis sehr gut(vgl. Abb. 15).42 Ergebnis im Einzelnen (T9 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, Juli <strong>2006</strong>, n=15):„Haben Sie sich durch die <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ auf den Berufseinstieg gut vorbereitetgefühlt?“: ja: 93,3%; nein: 0%; ja und nein: 6,7%68
Wie beurteilen Sie Ihre berufliche Handlungskompetenz in derPflegepraxis zum jetzigen Zeitpunkt?(T9 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, Juli <strong>2006</strong>, n=15; Angaben in %)keine Angabe13% sehr gut33%gut54%sehr gut gut schlecht sehr schlecht keine AngabeAbb. 15: Einschätzung der beruflichen Handlungskompetenz aus Sicht der Absolventen/innen(T9 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, Juli <strong>2006</strong>)Begründet wurde die eigene Handlungsfähigkeit erneut mit der guten theoretischenVorbereitung (26,7% = 4 Befragte), den Erfahrungen in unterschiedlichen Einrichtungensowie dem selbstständigen Arbeiten während der durchlaufenen Ausbildung (jeweils20,0% = 3 Befragte).Trotz der als gut bis sehr gut empfundenen eigenen Handlungskompetenz im pflegeberuflichenAlltag vertraten 6 Teilnehmer/innen (40,0%) die Auffassung, dass nichtalle Kompetenzen in der Ausbildung ausreichend erworben wurden. Vornehmlichvermissten die Absolventen/innen auch rückblickend die Vermittlung praktischtechnischerKompetenz (26,7% = 4 Befragte).Die im Follow-up befragten Pflegedienstleitungen / Stations- bzw. Wohnbereichsleitungenbestätigten mehrheitlich, dass sich ihre Erwartungen an die Absolventen/innendes Modellprojekts insgesamt erfüllt haben (vgl. Abb. 16).69
Haben sich Ihre Erwartungen an die Absolventen/innen desModellprojekts im Großen und Ganzen bisher erfüllt?(Follow-up PDL/SL/WBL, August <strong>2006</strong>, n=24; Angaben in %)ja und nein8%keine Angabe17%ja54%nein21%ja nein ja und nein keine AngabeAbb. 16: Erfüllung der Erwartungen an die IPA-Absolventen/innen aus Sicht der PDL/SL/WBL(Follow-up, August <strong>2006</strong>)Darüber hinaus bekräftigten sie, dass die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen mit ihrer erworbenenHandlungskompetenz den aktuellen Anforderungen des beruflichen Alltagsgerecht werden (vgl. Abb. 17).Werden Ihrer Ansicht nach die Absolventen/innen des Modellprojektesmit ihrer beruflichen Handlungskompetenz den aktuellenAnforderungen des beruflichen Alltags gerecht?(Follow-up PDL/SL/WBL, August <strong>2006</strong>, n=24; Angaben in %)keine Angabe21%nein4%ja75%ja nein keine AngabeAbb. 17: Einschätzung der beruflichen Handlungskompetenz der IPA-Absolventen/innen ausSicht der PDL/SL/WBL (Follow-up, August <strong>2006</strong>)70
Begründet wurde diese Einschätzung vorwiegend mit dem selbstständigen Wissenserwerb(16,7% = 4 Befragte), dem bereits vorhandenen Fachwissen und der sinnvollenKombination der Berufsabschlüsse (jeweils 12,5% = 3 Befragte).4.2.5 KurzzusammenfassungDie Evaluation der Kompetenzentwicklung im Ausbildungsverlauf der „<strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ ergab die folgenden Ergebnisse:• Als besondere Stärke der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen erwies sich die analytisch-reflexiveBegründungskompetenz. Diese zeigte sich insbesondereanhand von fundiertem theoretischem Basiswissen und der Fähigkeit, daseigene Handeln selbstkritisch zu hinterfragen und zu begründen. Die Absolventen/innenhaben eine professionelle Haltung entwickelt, die sichdurch wissenschaftliche Reflexion sowie kritisches Denken auszeichnet.Sie handeln wissensbasiert (orientiert an pflegetheoretischen Erkenntnissen)und tragen somit zur Autonomie und zur Professionalisierung desPflegeberufes bei.• Als weitere Stärke lässt sich die ausgeprägte interaktive bzw. sozialkommunikativeKompetenz der Auszubildenden benennen. Diese wurdevor allem durch die methodische Herangehensweise bei der Gestaltungder Lehr-, Lernarrangements (interaktive Lernformen, Rollenspiele etc.)und die komplexen Aufgabenstellungen (situationsorientierter Ansatz) gezieltgefördert. Diese Kompetenz befähigt die Absolventen/innen der <strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong> dazu, Anleitungs- und Beratungssituationen imberuflichen Alltag fachkundig zu planen und effizient zu gestalten sowiedem Pflegeempfänger und seinen Bezugspersonen kommunikative Unterstützungbei Auseinandersetzungsprozessen z. B. bezüglich der Einstellungauf veränderte Lebensbedingungen zu leisten.• Die häufig wechselnden Einsätze in unterschiedlichen Institutionen derpflegerischen Praxis brachten eine hohe Flexibilität der Absolventen/innenmit sich. Diese beinhaltet eine rasche Anpassungsfähigkeit an neue Arbeitsbedingungenund Handlungsabläufe in pflegerischen Settings, welchezukünftigen Arbeitgebern/innen die Möglichkeit bietet, sie je nach Bedarf inunterschiedlichen Bereichen einzusetzen und mit wechselnden Aufgabenzu betrauen. Die Absolventen/innen sind damit auch den Anforderungen inneuen Handlungsfeldern (z. B. Tageskliniken, Pflegeberatungsstellen, Familienpflege)gewachsen, da sie dazu in der Lage sind, sich schnell zu orientierenund einzuarbeiten.• Den Absolventen/innen wird eine besondere Motivation und Eigeninitiativesowie eine ausgeprägte Selbstständigkeit im pflegerischen Handeln bescheinigt.Diese resultieren primär aus dem hohen Anteil an selbstorganisiertemLernen im Unterricht, der die Auszubildenden dazu anregte, aucham Lernort Pflegepraxis selbstgesteuert zu arbeiten und sich bei Bedarffehlendes Wissen anzueignen. Damit haben sie die Voraussetzungen fürein erfolgreiches lebenslanges Lernen und die Gestaltung individueller Lebens-und Arbeitschancen erworben.71
• Als Schwäche der integrativ Ausgebildeten ließ sich die praktisch-technischeKompetenz identifizieren, welche über den gesamten Ausbildungsverlaufund von unterschiedlichen Zielgruppen bemerkt wurde. Unsicherheitenbestanden im Besonderen im Handlungsfeld der Gesundheits- undKinderkrankenpflege. Diese sind den häufig wechselnden Praxiseinsatzortengeschuldet, die den Erwerb von Handlungsroutine und –sicherheit erschwertenund der praktischen Umsetzung des Gelernten hinderlich entgegenstanden.• Neben dem Nachholbedarf im praktisch-technischen Bereich wurden Defizitein Bezug auf organisations-/systembezogene Kompetenzen (Arbeitsorganisation,Zeitmanagement) sowie spezifisches Fachwissen - vor allemin der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege - erkannt. Letzteres steht einembreit angelegten Basiswissen der Absolventen/innen gegenüber.• Die Ergebnisse aus der Beobachtung der praktischen Examensprüfungenzeigten eine erfolgreiche Kompetenzentwicklung in allen Bereichen. Damitkann das Leitziel der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell© “, berufliche Handlungskompetenz vor dem Hintergrund eines theoretischbegründeten Kompetenzmodells zu entwickeln, als erreicht bezeichnetwerden. Dessen ungeachtet empfiehlt sich anhand der Evaluationsergebnisseeine Überprüfung bzw. Erweiterung des Kompetenzmodells, z. B.um Aspekte der personalen Kompetenz (Stressfähigkeit / Umgang mit Belastungen,Selbstpflegekompetenz).• Aus Sicht der Evaluation lässt sich zusammenfassend konstatieren, dassdas Kompetenzprofil der Absolventen/innen dem an Komplexität zunehmendenAuftrag an Pflege gerecht wird und ihren Einsatz in alten undneuen Handlungsfeldern ermöglicht. Damit ist es den Initiatoren/innen der„<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ gemäß ihremLeitziel gelungen, die Auszubildenden auf gesellschaftlich notwendige undpolitisch geforderte Aufgaben und Handlungsfelder ausreichend vorzubereiten.4.3 Beurteilung des Transferlernens / Verhältnis integrativeBasisausbildung und SchwerpunktsetzungEin besonderes Merkmal der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> liegt in dem Einbezugder Sichtweisen der drei Pflegeberufe vom Auftrag und Gegenstand der Pflege. DieIntegration der Pflegeberufe bzw. die Entstehung eines erweiterten Berufsverständnisseserfolgte im Modellprojekt durch die Anlage von gemeinsamen und schwerpunktbezogenenSequenzen über die gesamte Ausbildungszeit hinweg (vgl. Kap. 1).Der Auftrag an die Evaluation richtete sich im Wesentlichen darauf, wie die Auszubildendendas Gelernte in einer neuen Pflegesituation anwenden bzw. welches Wissen(integratives versus schwerpunktbezogenes) die Lernenden zum jeweiligen Ausbildungsstandbenötigen.72
Das Transferlernen bzw. der Transferbegriff gewann im fortgeschrittenen Projektverlaufan Bedeutung und wird im Rahmen der Evaluation des zweiten <strong>Modellkurs</strong>es der„<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ vertiefend bearbeitet. Diedargestellten Ergebnisse in dem vorliegenden <strong>Abschlussbericht</strong> beziehen sich aufeine eher eng gefasste, traditionelle Bedeutung des Begriffs Transfer, die das Transferierenvon Wissen aus der Theorie in die Praxis meint.Der Transferbegriff der Kerngruppe Curriculum des Stuttgarter Modells geht über dasbloße „Hinübertragen“ von schulischem Wissen in die Praxis hinaus und wird weitergefasst. So wird angenommen, „… dass gar nichts von einer Basis- in eine Zielaufgabehineingetragen wird, sondern dass vielmehr Wissen aufgrund einer Analyse derZielaufgabe herüber geholt werden muss …“ (Kerngruppe Curriculum <strong>2006</strong>: 110).Demzufolge geht es im Wesentlichen um die Fragen: „Wie erkennen die Lernendendie die konkrete Situation oder Aufgabe konstituierenden Prinzipien und Strukturen?Und wie gelangen sie zu der Erkenntnis, welche Denkprozesse und Strategien ihnenbeim Erschließen dieser Prinzipien und Strukturen helfen“ (ebd.: 110)?4.3.1 Beurteilung des TransferlernensEine Problematik beim Transferlernen der Auszubildenden wurde im dritten Ausbildungsjahrals Ergebnis der internen Evaluation der Kerngruppe Curriculum wahrgenommen.Hieraus leitete sich der Auftrag an die externe Evaluation ab, das Transferlernenals weiteren Untersuchungsschwerpunkt aufzunehmen (vgl. Kap. 2.3).Erkenntnisinteresse / FragestellungIm Zentrum der Untersuchung standen folgende Fragen:• Wie gelingt das Transferlernen von der Lernsituation im Unterricht aufneue Situationen in der Pflegepraxis?• Wie wird das Verhältnis zwischen integrativ angelegten Ausbildungsinhaltenund der Schwerpunktsetzung eingeschätzt?• Welche Optimierungsmöglichkeiten zur Unterstützung des Transferlernenslassen sich ableiten?Zur Einschätzung des Transferlernens wurde zuerst allgemein nach der Integrationvon Wissen in die Pflegepraxis gefragt. Die überwiegende Zahl (76% = 19 Befragte)der befragten Praxisanleiter/innen war der Meinung, dass die Auszubildenden ihrPflegewissen aktiv in die Pflegepraxis integrieren können 43 .Nachfolgend sind ausgewählte Aussagen der Praxisanleiter/innen aufgeführt, die sieals Begründung für das Gelingen der Wissensintegration angaben:43 Fragebogen für die Praxisanleiter/innen T4: 10/05, n=25: Nein: 0%; Weiß nicht: 16%; Keine Angabe: 8%73
T4 (Okt. 2005) 44„Sie sind sehr selbstständig und haben eine Begabung für logisches Denkenund ein gutes Umsetzungsvermögen.“„Durch gutes Hintergrundwissen kann der IPA – Azubi sich adäquat einbringen.“„Durch die Motivationsbereitschaft, sie suchen sich selbst die für sie wichtigenLernsituationen aus.“Im nächsten Schritt sollten die Zielgruppen Praxisanleiter/innen, Lehrende und <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innendie Frage beantworten, ob den IPA-Auszubildenden derWissenstransfer aus Lernsituationen im Unterricht auf neue Situationen in der Pflegepraxisgelingt. Die Ergebnisse bestätigten die von der Kerngruppe Curriculumwahrgenommene Problematik beim Transferlernen: Die Anzahl der Lehrenden, dieden Wissenstransfer für geglückt hielten, war eher gering. Der relativ hohe Anteil derAntworten im Bereich der Kategorie „teils/teils“ deutete vielmehr auf möglicheSchwierigkeiten beim Transfer von Wissen in die Pflegepraxis hin (vgl. Abb. 18).Gelingt den Auszubildenden der Wissenstransfer aus Lernsituationenim Unterricht auf neue Situationen in der Pflegepraxis?(T8 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, Okt. 2005; T4 Praxisanleiter/innen, Okt.2005; T3Lehrende, Nov. 2005; Angaben in %)jaLehrendePraxisanleiter<strong>Modellkurs</strong>neinteils-teilskeine Angabe<strong>Modellkurs</strong>LehrendePraxisanleiter<strong>Modellkurs</strong>LehrendePraxisanleiter0 10 20 30 40 50 60 70<strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen (n=23)Praxisanleiter/innen (n=25)Lehrende (n=11)Abb. 18: Einschätzung zum Gelingen des Wissenstransfers aus Lernsituationen im Unterricht aufneue Situationen in der Pflegepraxis44 exemplarische Aussagen aus dem Fragebogen74
Diese Einschätzung konnte durch die Ergebnisse der Telefoninterviews mit den Lehrenden(n=6) bestätigt werden. Sie sahen insgesamt einen Handlungsbedarf hinsichtlichder Förderung des Transferlernens:„wo wir optimieren wollen, (…), welche Transfermöglichkeiten brauchendie Auszubildenden eigentlich bei diesem exemplarischen Lernen. (…) unsereEinschätzung ist jetzt eigentlich, dass der Transfer (…) nicht von alleinegeht“.(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)„das Problem ist (…) dann den Transfer von einzelnen Situationen dannauf die Praxis und da denke ich, diese Transferleistung (…) da muss manwirklich noch mal ein größeres Augenmerk drauflegen“.(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Nach den förderlichen und hinderlichen Faktoren für einen gelungenen Transfer vonschulischem Wissen auf neue Situationen am Lernort Pflegepraxis gefragt, wurdenvon den Zielgruppen 45 nachfolgende Angaben gemacht (vgl. Tab. 13):Tab. 13: Förderliche und hinderliche Faktoren, die einen erfolgreichen Wissenstransferbeeinflussen könnenFörderliche Faktoren(+) Methodenvielfalt der Lehr-, Lernarrangements (z. B. Exemplarisches Lernen)(+) Begleitung und Reflexion praktischer Übungsphasen(+) Training der Problemlösefähigkeit(+) Ausbildungsinstrumente der IPA (z. B. Praxisaufträge, Blockhandbücher)(+) gezielte PraxisanleitungHinderliche Faktoren(-) unzureichende Abstimmung von Lernsituation und Praxiseinsätzen(-) hohes sprachliches Niveau der Ausbildungsinstrumente führt z. T. zu Verständnisschwierigkeitenin der Praxis(-) unzulängliche Rahmenbedingungen (Zeit-, Personalmangel und Qualifikationsbedarf)Die Praxisanleiter/innen, Lehrenden und Auszubildenden machten zudem Angaben,wie das Transferlernen intensiver gefördert werden könnte. Folgende Optimierungsmöglichkeitenzum Transferlernen wurden aufgeführt:• Abstimmung der Abfolge von Lernsituationen mit Praxis,45 T8 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, Oktober 2005, n=23; T4 Praxisanleiter/innen Oktober 2005, n=25; T3 LehrendeNovember 2005, n=1175
• verständliche Umsetzung der Instrumente in die Praxis,• verstärktes Einbeziehen und Qualifizieren der Praxisanleiter/innen (Bedarfserfassung,Fortbildungsangebote),• Verbesserung der Transferinstrumente (z. B. Einrichtung von Lernwerkstätten,Skills Labs),• stärkere Integration des Transfergedankens in den Pflegealltag.4.3.2 Einschätzung des Verhältnisses zwischen integrativangelegten Ausbildungsinhalten und derSchwerpunktsetzungDie Ausbildungskonzeption verfolgt eine Stufung 46 von gemeinsamen integrativenAusbildungsanteilen und eine differenzierende Schwerpunktbildung zur Entwicklungvon Kompetenzen für die Pflege von Menschen spezifischer Zielgruppen (Kinder,Jugendliche, Familien, Erwachsene, Menschen im hohen Lebensalter). Ziel der Evaluationwar es, zu überprüfen, inwieweit sich das Verhältnis von integrativ angelegtenund schwerpunktbezogenen Anteilen bewährte.Die Ergebnisse zeigen, dass die Mehrzahl der interviewten Lehrenden 47 das Verhältniszwischen integrativ angelegten Ausbildungsinhalten und der Schwerpunktsetzungkritisch bewertete. So schrieben einige dem Berufsfeld der Krankenpflege ein mangelndesIdentitätsbewusstsein zu aufgrund einer unzureichenden Identifizierung undDefinition originärere Berufsschwerpunkte bzw. entsprechender Kompetenzentwicklungen.„Ich hatte den Eindruck, dass wir das nicht richtig durchdacht hatten. (…)In der Kerngruppe waren wirklich Tendenzen da, die nach mehr Integrationgesucht haben. (…) und ich hatte ja manchmal den Eindruck, dass es ja u.a. auch ein Problem der Krankenpflege ist, wir am Ende auch nicht wussten,was eigentlich unsere originären Pflegethemen sind“.(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)„(…) nach meinen Vorstellungen müsste die Schwerpunktsetzung immermal wieder auch dazwischen durchkommen und nicht erst am Ende derAusbildung. Vor allem im zweiten Abschluss fand ich dann die Spezialisierungsehr kompakt und die Zeit war zu kurz am Ende, dass man da vielleichtwas verändern müsste.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)46 Die Ausbildungskonzeption sah anfangs folgende Differenzierung vor: Die ersten zwei Jahre umfassten dieVermittlung von integrativem Basiswissen und -können der Pflege. Im dritten Ausbildungsjahr erfolgte dieSchwerpunktsetzung hinsichtlich des ersten Berufsabschlusses. In den letzten sechs Monaten der Ausbildungfand eine weitere Schwerpunktsetzung (zweiter Berufsabschluss) oder eine Spezialisierung statt. Diese Stufungwurde zum Projektende von der Kerngruppe Curriculum folgendermaßen revidiert: Nun werden in den ersten dreiJahre sowohl Anteile an integrativem Basiswissen als auch Anteile an spezifischem Wissen vermittelt (Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH <strong>2006</strong>).47 Ergebnisse aus den Telefoninterviews mit den Lehrenden: TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>, n=676
Die Befragten erlebten die Vermittlung der integrativen Anteile rückblickend als sehrherausfordernd, da bestimmte Themen einen engen Bezug zur jeweiligen Berufsgruppeaufwiesen und sich nur begrenzt auf andere übertragen ließen. Dies galt vorallem für die Kinderkrankenpflege. Die Lehrenden hoben in den Interviews die Bedeutungeiner klaren Definition vom Gegenstand und Auftrag der Pflege hervor, umeine adäquate Vermittlung sowie einen erfolgreichen Transfer zu ermöglichen.„(…) diese gemeinsamen Prinzipien, die die Pflegeberufe haben, die müssennoch mal im Sinne der Auszubildenden noch mal festgemacht werden,wie übe ich das, wenn ich in anderen Situationen bin.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Das Verhältnis zwischen integrativ angelegten Ausbildungsinhalten und der Schwerpunktsetzungbot den Befragten Anlass zur Diskussion und Weiterentwicklung. IhrerAnsicht nach erfordert die Breite bzw. Komplexität des pflegerischen Handlungsfeldesauch eine frühe inhaltliche Vertiefung in einem Berufsfeld. So sind entsprechendeSchwerpunkte, evtl. auch unabhängig von den drei Lebensphasen, noch detaillierterzu definieren und mittels optionaler Lernangebote den Auszubildenden in Theorieund Praxis zu vermitteln.„Auch das Thema Schwerpunktsetzung ist sicherlich etwas, was wir nochmal viel diskutieren werden. So wie ich es jetzt sehe, haben wir ja einigeVertiefungsangebote, Schwerpunktsetzung für die drei Berufsgruppen, angeboten.Aber ich bin nach wie vor der Überzeugung, dass es Schwerpunktsetzungbraucht, eben auch unter dem Transfergedanken, dass dieAusbildung, ist ja tatsächlich sehr breit angelegt, sehr vielfältige Einsatzfelderhat, aber doch ja so eine wirkliche Sicherheit in dieser Breite und imTiefgang (…) von wenigen der Auszubildenden erreicht werden konnte.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)4.3.3 KurzzusammenfassungDie von der Kerngruppe Curriculum wahrgenommen Schwierigkeiten beim Transferlernender Auszubildenden wurden durch die Ergebnisse der externen Evaluationbestätigt:• Die IPA-Auszubildenden konnten zwar ihr erworbenes Pflegewissen aktivin die Pflegepraxis integrieren, z. T. bemerkten aber insbesondere die LehrendenSchwierigkeiten beim Transferlernen.• Optimierungsmöglichkeiten wurden in der stärkeren Fokussierung vonTransferkompetenzen und -hilfen (z. B. kritische Überprüfung der Lernsituationenauf ihre Übertragbarkeit auf andere Situationen, Abfolge und Längeder Praxiseinsätze, verstärktes Einbeziehen und Qualifizieren der Praxisanleiter/innenetc.) innerhalb und zwischen den theoretischen und praktischenLernorten gesehen.77
• Das Verhältnis von integrativen Ausbildungsanteilen und der Schwerpunktsetzungbot Anlass zur Diskussion bzw. Weiterentwicklung. Es erscheinteine detaillierte Definition zielgruppenbezogener Schwerpunkte erforderlich,um eine quantitative und qualitative Ausgestaltung der Schwerpunktsetzungzu ermöglichen.• Die Breite und Komplexität des pflegerischen Handlungsfelds erfordert eineinhaltliche Vertiefung bzw. Ausbildung der Schwerpunkte zu einem früherenZeitpunkt 48 .4.4 Einfluss der dem Ausbildungsmodell zugrunde liegendenLernortkooperationen auf einen Theorie-Praxis- bzw.Praxis-Theorie-TransferErkenntnisinteresse / FragestellungEin zentrales Merkmal der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “war ein breiter Verbund von Kooperationspartnern/innen, der den Auszubildendeneine Vielzahl von unterschiedlichen Einsatzfeldern ermöglichte. Vor diesem Hintergrundfokussierte die Evaluation folgende Fragestellungen:• Inwieweit haben die Lernortkooperationen Auswirkungen auf einen Theorie-Praxis-bzw. Praxis-Theorie-Transfer?• Welchen Beitrag leisten die entwickelten Instrumente zur Förderung eineserfolgreichen Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfers?• Welche Innovationen bzw. Synergieeffekte werden in der Pflegepraxis innerhalbder kooperierenden Einrichtungen wahrgenommen?Die Effekte der Lernortkooperationen auf den Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfer werden im Folgenden anhand dieser Schwerpunkte erläutert. Zunächst erfolgteine Einschätzung der Trägervielfalt im Kooperationsverbund bezüglich seinerVor- und Nachteile für die Beteiligten am Modellprojekt. Im Anschluss findet eine abschließendeBewertung der Praxiskonferenzen und weiterer für die <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>entwickelten Instrumente statt, bevor abschließend die Synergieeffektedes Modellprojektes in der Pflegepraxis aus Sicht der einzelnen Zielgruppen aufgezeigtwerden.48 Im Revisionsprozess der Kerngruppe Curriculum wurde bereits die starre Stufung in integrative Ausbildungsinhalteund differenzierende Schwerpunktbildung als nicht bewährt angesehen. Stattdessen wird eine gemeinsame<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong> mit Differenzierungsangeboten von Ausbildungsbeginn an präferiert. Aus einem Vortragvon Dr. Elisabeth Holoch, Mitglied der Kerngruppe Curriculum, gehalten im Rahmen des 2. Symposium:Pflegeexpertise kompetenzorientiert ausbilden, am 10.11.06 in Stuttgart78
4.4.1 Einschätzung der Trägervielfalt im KooperationsverbundDie Vielfalt an Kooperationspartnern/innen ermöglichte den Auszubildenden dasKennen lernen unterschiedlicher Praxisfelder und Einrichtungen des Gesundheitswesensmit verschiedenen Spezialgebieten. Dies erlebten sie als eine Bereicherung,die ihnen die Chance bot, sich über ihre zukünftigen Tätigkeitsfelder einen persönlichenEindruck zu verschaffen und persönliche Prioritäten zu setzen:„Die ganzen verschiedenen Einsatzgebiete, also die haben mir auch vielgebracht, dass ich mal in dem Bereich war, dass ich mal (…) in dem Krankenhauswar. (…) es werden verschiedene Schwerpunkte gesetzt in denEinrichtungen selbst, (…) das einfach mal mitzuerleben und sich das Besterauszufiltern, dass fand ich auch sehr interessant.“(GD t3 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, März <strong>2006</strong>)Das breite Spektrum an pflegerischen Handlungsmöglichkeiten in den verschiedenenPraxisfeldern regte zum Hinterfragen und Reflektieren des eigenen Handelns an undtrug damit zu einer besonderen Entwicklung dieser Kompetenzen bei (vgl. Kap.4.2.1). Gleichzeitig stellte die Verschiedenartigkeit der Handlungsfelder hohe Anforderungenan die professionelle Anpassungsfähigkeit der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen:„Man kommt an die Grenzen, einfach weil´s jedes Mal wieder was Neuesist und man muss sich wieder neu drauf einlassen (…) aber ich hab´sschon auch als Chance gesehen so viele verschiedene Fachgebiete oderauch Einrichtungen zu sehen. Und sich da auch, ja, bewusst zu machen,wo man gerne arbeiten möchte dann.“(GD t3 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, März <strong>2006</strong>)Allerdings sahen die Auszubildenden aufgrund der oftmals raschen Einrichtungswechselauch Nachteile bei der Gewinnung ihrer Handlungssicherheit im Bereich derpraktisch-technischen Kompetenz, wie die folgenden Aussagen exemplarisch zeigen(vgl. auch Kap. 4.2.2):„Dadurch dass man viele verschiedene Möglichkeiten kennen gelernt hat, istman manchmal auch etwas unsicher.“(GD t3 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, März <strong>2006</strong>)„Und in der Krankenpflege (…) haben wir noch Defizite was die Praxis (…)angeht, weil wir eben öfters in verschiedenen Häusern eingesetzt waren.“(GD t3 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, März <strong>2006</strong>)Die Lehrenden bewerteten die Vielfalt der Träger und die damit verknüpften Lernortkooperationenabschließend als erfolgreiches Element der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>.Sie maßen der Lernortkooperation einen sehr großen und Stabilität bietendenStellenwert bei, der einen hohen Lerneffekt für alle beteiligten Kooperationspartner/innen,u. a. durch die gemeinsame Entwicklung von Lernfeldern und -situationen,barg. Die Lehrenden betonten in diesem Kontext den interdisziplinären Austausch79
der verschiedenen Berufsgruppen, denn die Vielfalt der Einrichtungen bot allen Beteiligtendas Kennen lernen neuer Perspektiven, Leitbilder, Kulturen und Sichtweisenund bereicherte damit das gegenseitige Verständnis:„Also besonders bewährt hat sich auf jeden Fall die Lernortkooperation,(...) weil ich denke, da haben alle Teile dran gelernt. (...) auch die Zusammenarbeitmit den verschiedenen Schulen und den Lehrern und (...). Ja,und der Austausch unter den Berufsgruppen auch mit. Und auch mit demgegenseitigen Verständnis zu arbeiten.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Die Trägervielfalt im Kooperationsverbund forderte von den Lehrenden einen erhöhtenKommunikations- und Koordinationsaufwand. Als Nachteil für die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenbenannten einige Lehrende die häufigen Lernortswechsel und damitverknüpft immer neue Betreuungspersonen und einen hohen Organisationsaufwandhinsichtlich der Festigung ihres pflegefachlichen Handelns.4.4.2 Beurteilung der Praxiskonferenzen und PraxisinstrumentePraxiskonferenzenDie im Rahmen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> durchgeführten Praxiskonferenzen,die regelmäßig etwa alle drei Monate stattfanden, dienten der Unterstützung derTheorie-Praxis-Vernetzung im Ausbildungsverlauf. Ziel dieser Konferenzen, an denendie Praxisanleiter/innen, einige Lehrende und Auszubildende des <strong>Modellkurs</strong>esteilnahmen, war es, die aktuellen Praxisinstrumente und Inhalte der Theorieblöcke indie Pflegepraxis zu transportieren sowie die Reflexion und den Erfahrungsaustauschuntereinander voranzutreiben.Die Praxisanleiter/innen beurteilten die Praxiskonferenzen insgesamt sehr positiv 49 .In Hinblick auf eine Theorie-Praxis-Vernetzung waren ihnen folgende Aspekte beiden gemeinsamen Treffen wichtig:- die Rückmeldungen der Auszubildenden von den Praxiseinsätzen,- die Rückmeldungen aus der Schule: Ausbildungs-, Erfahrungsstand derAuszubildenden, Inhalt der Theorieblöcke,- die Bearbeitung eines konkreten Themas in den Konferenzen und- der gegenseitige Erfahrungsaustausch.Zudem betrachteten die Anleiter/innen die Praxiskonferenzen auch als zusätzlichesFortbildungsangebot, von dem sie persönlich profitierten.Aus Sicht der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen war eine kontinuierliche Teilnahme derPraxisanleiter/innen an den Konferenzen eine entscheidende Bedingung für einengelungenen und nachhaltigen Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfer. Eine unregelmäßigeBeteiligung an den Praxiskonferenzen führte hingegen zu Informations-49 Die Beurteilung der Konferenzen basiert auf der Gruppendiskussion t1 (September 2004, n=4). Da nur vierPraxisanleiter/innen an der Diskussion teilnahmen, sprechen die Ergebnisse nicht für die gesamte Zielgruppe,sondern können nur eingeschränkt verwendet werden.80
defiziten in den Einsatzorten, die von den Auszubildenden selbst abgebaut werdenmussten.„Ich habe auch erlebt, dass die Mentoren, sehr wenige eigentlich wirklichkontinuierlich zu den Praxiskonferenzen gehen und viele Mentoren überhauptkeine Ahnung haben, was sie mit unserem Bogen da anfangen sollen.Die finden es nicht wichtig, die kennen sich mit dem ganzen System garnicht aus und dementsprechend muss man denen das selber eben erst alleserklären usw., das fand ich nicht so schön.“(GD t2 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, August 2004)Der Eigeninitiative der Auszubildenden kam demzufolge ein hoher Stellenwert für eineerfolgreiche Theorie-Praxis-Vernetzung zu.„Also ich denke eigentlich, die Hauptschiene, wo Theorie und Praxis vernetztwerden, sind eigentlich wir, weil sonst alles so über das Offizielle oderso, habe ich eigentlich eher den Eindruck, dass da nicht so viel jetzt übertragenwird, sondern man muss das eigentlich dann selber versuchen, dasirgendwie zusammen zu bringen.“(GD t2 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, August 2004)Die für die Ausbildung entwickelten Praxisinstrumente wurden sowohl von den <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenals auch von Praxisanleiter/innen und Bereichslehrendeninsgesamt als gut geeignet eingeschätzt. Dessen ungeachtet gab es einige Anregungenzur Förderung ihrer Praktikabilität:BlockhandbuchAls besonders gelungen und methodisch bedeutsam für den Theorie-Praxis-Transferbeurteilten die Praxisanleiter/innen das Blockhandbuch, da sie anhand dieses Leitfadenseinen Überblick zu den theoretisch vermittelten Themen bekamen und darananknüpfen konnten. Zum Teil bot das Blockhandbuch sogar ein „zu viel“ an Informationen.„Wir wussten ja sonst eigentlich nicht, was die Schüler theoretisch so allesbehandelt haben und wenn man jetzt die Zeit gehabt hätte, oder auch die E-nergie, dann hätte man sich immer genau orientieren können, was haben diegehabt und was kann ich jetzt in der Praxis umsetzen. Allerdings manchmalhat es einen fast erschlagen.“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)81
Vor-, Zwischen- und AbschlussgesprächeWeiterhin wurden die Vor-, Zwischen- und Abschlussgespräche von den Anleiter/innenals hilfreiche Instrumente des Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfers empfunden. Die vorgegebene Struktur gewährleistete eine regelmäßigeDurchführung der Gespräche mit den Auszubildenden. Hiervon profitierten Auszubildendeund Praxisanleiter/innen gleichermaßen, da sie zu intensiven Auseinandersetzungenund Klärung von gegenseitigen Ansprüchen und Erwartungen anregten.„Dadurch, dass (...) das, ja einfach erwartet wurde und wir das auch durchgeführthaben, hat man eigentlich sich viel mehr Zeit für die Schüler genommenund äh, ja, ganz intensive Gespräche geführt. Ich denke, es war für beide Seitensehr wichtig. Ich denke, ich konnte dem Schüler die Dinge vermitteln, diebei uns eben wichtig waren. [Im] Gegenzug hab ich dann äh, von den Schülernauch wieder so gehört und erfahren, was die von unserem Haus erwarten.Das war eigentlich ´ne ganz gute Sache.“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)Bogen zur Auswertung der PraxisbegleitungSowohl die Auszubildenden als auch die Bereichslehrenden beurteilten den Bogenzur Auswertung der Praxisbegleitung durchweg positiv 50 . Die Mehrzahl der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenäußerte dennoch Verbesserungsvorschläge zu dem Instrument,die sich vor allem auf eine gezielte Anpassung an den jeweiligen Einsatzortbezogen (22,7% = 5 Befragte).Bogen zur Auswertung der Leistungen im PraxisfeldAn dem Bogen zur Auswertung der Leistungen im Praxisfeld hoben die Praxisanleiter/inneninsbesondere die Möglichkeit zur Selbsteinschätzung durch die Auszubildendenpositiv hervor. Diese reflektierten anhand des Bogens ihre eigenen Stärkenund Schwächen, woraus sich weitere Anregungen für Gespräche ergaben.„Dadurch, dass die Schüler sich selber im Vorfeld einschätzen müssen, wo siestehen, da gab es ganz interessante Gespräche“.(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)Auch die Auszubildenden bezeichneten das Bewertungsinstrument für die Leistungenim Praxisfeld mehrheitlich als gut geeignet zur Beurteilung ihrer Kompetenzen(vgl. Abb. 19).50 Ergebnisse im Einzelnen (T6 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, November 2004, n=22):„Wie beurteilen Sie den Bogen zur Auswertung der Praxisbegleitung, mit dessen Hilfe die Bereichslehrer/innenIhre Leistungen und Kompetenzen einschätzen?“: sehr gut: 27,3%; eher gut: 72,7%; weder gut noch schlecht:0%; eher schlecht: 0%; schlecht: 0%Ergebnisse im Einzelnen (T2 Lehrende, November 2004, n=15):Fragestellung an die 6 Bereichslehrenden: „Wie schätzen Sie insgesamt den Bogen zur Auswertung der Praxisbegleitungein?“: sehr gut: 50%; eher gut: 50%; weder gut noch schlecht: 0%; eher schlecht: 0%; schlecht: 0%82
Sind Sie der Meinung, dass sich der Bogen zur Auswertung derLeistungen im Praxisfeld gut zur Beurteilung ihrer Kompetenzeneignet?(T6 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, November 2004, n=22; Angaben in %)nein0%weiß nicht9%ja91%ja nein weiß nichtAbb. 19: Beurteilung des Bogens zur Auswertung der Leistungen im Praxisfeld durch die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen(T6, November 2004)Begründet wurde diese positive Einschätzung primär mit der Möglichkeit einer Reflexion/Kontrolleder eigenen Kompetenzentwicklung (40,9% = 9 Befragte). Weitere Aspektefür die positive Bewertung des Instruments waren u. a. Aufbau/Struktur (36,4%= 8 Befragte) sowie Umfang des Bogens und das geeignete Bewertungsschema (jeweils31,8% = 7 Befragte).Als verbesserungswürdig empfanden die Auszubildenden vor allem die Sprache/Formulierungeninnerhalb des Instruments (36,4% = 8 Befragte). Diese sei mitunterschwer verständlich und führte in der Pflegepraxis zu Unsicherheiten. Die Aussagender Praxisanleiter/innen bekräftigten diesen Umstand, als mögliche Lösungwurde daher ein „IPA-Wörterbuch“ mit den angewandten Fachbegriffen vorgeschlagen.Insbesondere die Sprache des Kompetenzmodells wurde wiederholt als problematischthematisiert. Sie führte sowohl bei den Auszubildenden als auch bei den Praxisanleiter/innenanfangs zu Verständnisschwierigkeiten. Als Folge gestaltete sich dieBeurteilung der Kompetenzen der Auszubildenden anhand des Bewertungsinstrumentsmitunter schwierig.„... mit den Beurteilungen hab ich jetzt am Anfang ziemlich Probleme gehabt,weil ich oft von der Sprache nicht zurecht kam, was man eigentlich meint“.(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)„Also ich denk mal dass es am Anfang von der Sprache auch relativ, ja, auchverschiedene Schlüsse zuließ, sagen wir mal so. Was meint jetzt eigentlich,was steht jetzt eigentlich da dahinter? Und da, äh, hätt’ ich mir gewünscht,dass man so, wenn wir das selbe sagen, auch das gleiche meinen. (...). Und83
das war schon ein bisschen, ähm, schwer, für mich jetzt war es schwer zuverstehen, umzusetzen vor allem dann auch und, äh, runterzubrechen aufden Alltag.“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)Als einen besonders veränderungsbedürftigen Aspekt erkannten auch die Lehrendenrückblickend die Sprache bzw. sprachliche Vermittlung des Modellprojekts. Zukünftigmüsse auf die wiederholt rückgemeldeten Verständnisschwierigkeiten der Praxiszeitnah reagiert werden, beispielsweise durch verstärkten Einbezug der Beteiligten indie Veränderungsprozesse des Projekts. Ebenso sei die Vernetzung und integrierteZusammenarbeit zu fördern und der sprachliche Ausdruck dem Verständnis der Praxisanzupassen.„Der Sprachgebrauch war anfangs sehr ungewohnt, vor allem für die Leuteaus der Praxis. Da würde ich (...) einiges verändern. Was ja auch immerwieder von der Praxis angemerkt worden ist.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Diese Probleme konnten teilweise in den Praxiskonferenzen gelöst und somit Unsicherheitenmit den Fachbegriffen im Ausbildungsverlauf abgebaut werden. Demnachhaben sich die Praxiskonferenzen, in denen eine kontinuierliche Schulung der Anleiter/innenstattfand, äußerst bewährt.„(...) als es dann mal Thema war in der Praxiskonferenz war ich ganz frohdrüber, dass doch das eine oder andere klarer wurde“.(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)PraxisaufträgeMit Blick auf die Anfangsphase der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> schilderten diePraxisanleiter/innen darüber hinaus Probleme im Umgang mit den Praxisaufträgensowie in der Auseinandersetzung mit zu hohen Erwartungen und Unsicherheiten allerBeteiligten. Sie hoben jedoch ausdrücklich und positiv hervor, dass diese anfänglichenSchwierigkeiten sehr zeitnah und zufrieden stellend mit der Schule geklärt werdenkonnten.„(...) da ist ziemlich rasch reagiert worden und auf ein mögliches Maß dannzurückgeschnitten worden. (...) was ich jetzt so zurückblickend sagen kann(...), dass das dann in Ordnung war, dass (...) die Praxisaufgaben, äh sowohldem Schüler, dem Auszubildenden als auch dem der Schule entsprochenhat.“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)84
4.4.3 Einschätzung der Auswirkungen (Synergieeffekte) durchdas Modellprojekt in der PflegepraxisInnerhalb aller zu diesem Themenschwerpunkt befragten Zielgruppen bestand Einigkeitdarüber, dass die „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ Synergieeffektein der Pflegepraxis herbeiführt.Die Lehrenden bestätigten diese Auswirkungen mehrheitlich (66,7% = 10 Befragte)und nannten als primären Effekt in der Pflegepraxis Veränderungen in Bezug auf diePraxisanleitung 51 . Dieses Ergebnis bekräftigten wiederum die Praxisanleiter/innen,indem sie die Gestaltung der Anleitung als vorwiegende Veränderung durch die <strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong> beschrieben (vgl. Tab. 14).Tab. 14: Veränderungen im Arbeitsfeld, die durch die <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong> angestoßenwurden (T4 Praxisanleiter/innen, Oktober 2005)AntwortkategorienAnzahl der Anzahl derNennungen Befragtenveränderte Anleitung der Auszubildenden 8 8 (32,0%)veränderte Einstellung zur Praxisanleitung 5 5 (20,0%)regelmäßige Freistellung für Anleitung und Praxiskonferenzen3 3 (12,0%)verbesserte Zusammenarbeit und Kommunikationauf der Station3 2 (8,0%)Sonstiges 5 5 (20,0%)trifft nicht zu -- 8 (32,0%)n=25Einige Anleiter/innen nahmen zudem Veränderungen in Bezug auf ihr Verständnisvom Auftrag der Pflege wahr (vgl. Abb. 20).In diesem Kontext wurde von 6 Befragten ein durch das Modellprojekt hervorgerufenesneues Verständnis von Anleitung erläutert, welches sich z. B. durch eine individuelleBegleitung des Lernenden auszeichnet. Einige Anleiter/innen erlebten zudemdie besonderen Kompetenzen und Fähigkeiten der Auszubildenden als Herausforderungund motivierend für die eigene Arbeit. Ferner wurde die Ausbildungstätigkeit inder Praxis im Zusammenhang mit dem Modellprojekt als Bereicherung und Vertiefungdes eigenen Könnens und Wissens geschätzt.51 Ergebnisse im Einzelnen (T2 Lehrende, November 2004, n=15):Fragestellung: „Glauben Sie, dass die "<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © " Auswirkungen aufdie Praxis hat?“: ja: 66,7%; nein: 13,3%; keine Antwort: 20,0%“Fragestellung: „Wenn ja, welche Auswirkungen sind das?“ (n=10): Praxisanleitung (50,0%); Kompetenzentwicklung;berufsübergreifende Zusammenarbeit; Sonstiges (jeweils 30,0%)85
Bitte geben Sie an, inwieweit Sie der folgenden Aussage zustimmen:"Die IPA hat dazu geführt, dass sich mein Verständnis alsPraxisanleiter/in vom Auftrag der Pflege verändert hat."(T4 Praxisanleiter/innen, Oktober 2005, n=25; Angaben in %)stimmt eher nicht/ stimmt nicht40%keine Angabe4%stimmt voll undganz / stimmt40%stimmt voll und ganz / stimmtstimmt eher nicht / stimmt nichtteils-teils16%teils-teilskeine AngabeAbb. 20: Einschätzung der Auswirkungen des Modells auf das Verständnis als Praxisanleiter/invom Auftrag der Pflege (T4 Praxisanleiter/innen, Oktober 2005)Neben den Veränderungen hinsichtlich der Gestaltung der Praxisanleitung bemerktendie Anleiter/innen Auswirkungen des Modellprojektes auf ihr Arbeitsfeld und profitiertenvon den innovativen Ansätzen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>. Aus Sichtder Befragten lieferte das Modell Denkanstöße für die Praxiseinsatzorte.Aus den Anregungen durch die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen resultierte mitunter eineintensive Bearbeitung von Pflegesituationen, die zum Diskutieren und Ausprobierenneuer Ideen führte und bewirkte, dass starre Handlungsroutinen reflektiert, erweitertoder verändert wurden.„Zum Schluss war´s einfach so, dass wir intensiv miteinander auch pflegerischeSachen entwickelt haben, ja. Sie hatten neue Ideen, ich hatte Ideen wirhaben es zusammengenommen, wir haben es diskutiert, wir haben es ausprobiert.Wir haben positive Effekte dabei rausgekriegt, nicht nur, aber wir habeneinfach neue Denkweisen auch mal ausprobiert und auch, die habenauch geklappt.“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)„Und das (...) ist sogar übergesprungen (...) auf die Älteren, die schon erfahrener,länger dabei sind, selbst die haben gesagt, ja eigentlich hast du Recht,das könnte man auch so machen. Wir machen das seit 20 Jahren so und jetztkönnen wir das ja auch noch mal verändern. Und diese Veränderungen sindalso echt positiv angekommen.“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)86
Weitere Auswirkungen durch das Modell auf die Pflegebereiche der Befragten Praxisanleiter/innenbetrafen die regulären Auszubildenden sowie die Pflegekräfte selbst.Für beide ergaben sich höhere Anforderungen an die Eigeninitiative in Bezug auf einenselbstständigen Wissenserwerb.„Also bei uns ist durch dieses theoretische Wissen, was die Schüler gebrachthaben mancher ins Nachdenken gekommen, ob er jetzt eigentlich auch nichtselber noch mal ein Buch herholen müsste“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)Weiterhin wurde eine berufsübergreifende Herangehensweise auch bei der Betreuungder regulär Auszubildenden als gewinnbringend erkannt.„Und was sich noch bei mir geändert hat, ich nehme jetzt auch andere Berufsgruppenmit. Also wenn die Krankengymnastin, wenn ich sehe, die hatZeit und dann sag ich zu der Schülerin setz dich mal mit der Krankengymnastinzusammen und lass dir erklären, was sie macht. Also nicht mehr, dass ichnur vermittle, sondern dass ich sie auch abgebe an andere und dahin verweis.“(GD t2 Praxisanleiter/innen, März <strong>2006</strong>)Die Mehrheit der <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen (60,0% = 9 Befragte) teilte im Follow-updie Überzeugung, als Absolvent/in der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> in der PflegepraxisVeränderungen bewirken zu können 52 . 3 Befragte sahen ihren Beitrag im Bereichder Qualitätssicherung, wobei zwei Personen unter diesem Aspekt die Pflegedokumentationnannten. Darüber hinaus nahmen jeweils 2 Teilnehmer/innen an, einegute Interaktion mit den Pflegeempfängern, mehr Eigeninitiative / Eigenverantwortungsowie eine zunehmende Wissenschaftsorientierung der Pflegepraxis anregenzu können.Die Lehrenden bemerkten neben den Synergieeffekten in der Pflegepraxis Auswirkungendes Modellprojektes auf den Lernort Schule (73,3% = 11 Befragte), die sievor allem an Veränderungen hinsichtlich ihrer Rolle als Lehrende (54,6% = 6 Befragte)sowie an Entwicklungen in den regulären Ausbildungskursen (36,4% = 4 Befragte),z. B. durch die Integration von Lernsituationen, festmachten 53 .Aus Sicht der Lehrenden bringt die <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong> ferner eine Steigerungder Ausbildungsqualität mit sich (vgl. Abb. 21), welche insbesondere durch dieKompetenzorientierung des Modells ausgelöst wird.52 Ergebnis im Einzelnen (T9 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, Juli <strong>2006</strong>, n=15):Fragestellung: „Sind Sie der Ansicht, dass sie als Absolvent/in der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das StuttgarterModell © “ Veränderungen in der Pflegepraxis anstoßen können?“: ja: 60,0%; nein: 33,3%; ja und nein: 6,7%53 Ergebnisse im Einzelnen (T2 Lehrende, November 2004, n=15):Fragestellung: „Glauben Sie, dass die "<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © " Auswirkungen aufIhre Schule hat?“: ja: 73,3%; nein: 6,7%; keine Angabe: 20,0%“Fragestellung: „Wenn ja, welche Auswirkungen sind das?“ (n=11): Veränderung der Lehrerrolle (54,6%); Veränderungenin der regulären Ausbildung (36,4%); curriculare Veränderungen (27,3%); integrative Zusammenarbeit(27,3%); Schulentwicklung (18,2%); allgemeine Auswirkungen (18,2%)87
Führt Ihrer Meinung nach die "<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: DasStuttgarter Modell © " zu einer Steigerung der Ausbildungsqualität?(T2 Lehrende, November 2004, n=15; Angaben in %)keine Angabe20%nein13%ja67%ja nein keine AngabeAbb. 21: Einschätzung der Auswirkungen des Modells auf die Ausbildungsqualität durch dieLehrenden (T2, November 2004)Im Rahmen des Follow-up wurden zu dieser Thematik ebenso Vertreter/innen ausden Ministerien 54 befragt. Die überwiegende Mehrheit der Experten/innen (75,0% = 9Befragte) erwartet, dass das Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das StuttgarterModell ©“ langfristig Veränderungen in der Pflegepraxis herbeiführen wird (vgl.Abb. 22).Denken Sie, dass das Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: DasStuttgarter Modell©“ langfristig Veränderungen in der Pflegepraxisherbeiführen wird?(TI Ministerien, September <strong>2006</strong>, n=12; Angaben in %)keine Angabe17%nein8%ja75%ja nein keine AngabeAbb. 22: Einschätzung über Veränderungen in der Pflegepraxis durch das Modellprojekt(TI Ministerien, September <strong>2006</strong>)54 Zur Zielgruppe der Expertenbefragung vgl. Kap. 4.5.1, S. 92.88
Die politischen Entscheidungsträger führten als vornehmlichen Effekt der <strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong> eine Erhöhung der Handlungskompetenz und die Bereitschaft zurÜbernahme von Verantwortung der Absolventen/innen an. In diesem Zusammenhangbenannten zwei Befragte flexiblere Einsatzmöglichkeiten sowie eine Aufwertungder Pflege als Konsequenzen der gesteigerten Verantwortung und Qualifikation.Des Weiteren prognostizierten die Experten/innen eine zunehmende Vernetzung derPflegeberufe.4.4.4 KurzzusammenfassungHinsichtlich des Einflusses der dem Ausbildungsmodell zugrunde liegenden Lernortkooperationenauf einen Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfer lassen sichaus Sicht der Evaluation folgende Ergebnisse festhalten:• Die Trägervielfalt im Kooperationsverbund stellt ein erfolgreiches Elementder <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ dar. Sie bot eineBereicherung für die Auszubildenden durch das Kennen lernen unterschiedlicherpflegerischer Institutionen und Handlungsfelder und fördertegleichzeitig die Entwicklung von Reflexionsfähigkeit, Flexibilität und professionellerAnpassungsfähigkeit. Diesen positiven Effekten der Lernortkooperationenstanden Probleme beim Gewinn von Handlungssicherheit undein hoher organisatorischer Aufwand durch die häufigen Lernortswechselentgegen.• Die Praxiskonferenzen erwiesen sich als gelungenes Instrument zur Förderungdes Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfers und wurden vonden Praxisanleiter/innen als unterstützend für ihre pädagogische Arbeitund als persönlich gewinnbringend geschätzt. Voraussetzung für diese positivenAuswirkungen war jedoch eine kontinuierliche Teilnahme der Anleiter/innen,um Informationsdefiziten am Lernort Pflegepraxis vorzubeugenund damit den Auszubildenden eine effektive Unterstützung zu gewährleisten.• Die im Rahmen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> entwickelten Praxisinstrumenteerleichterten den Praxisanleiter/innen das Anknüpfen an die amLernort Schule vermittelten Lerninhalte und ermöglichten die Vorbereitungund Durchführung einer gut strukturierten und gelungenen Anleitung impflegepraktischen Handlungsfeld. Gleichwohl rief die anspruchsvolle Spracheder Instrumente Unsicherheiten und Schwierigkeiten bei der Beurteilungder Kompetenzen der Auszubildenden hervor. Dieser Problematikwurde durch Information und Anleitung innerhalb der Praxiskonferenzengezielt entgegengewirkt.• Als vorwiegende Synergieeffekte in der Pflegepraxis ließen sich Veränderungenin Bezug auf die Durchführung der Praxisanleitung bzw. ein neuesVerständnis von Anleitung erkennen. Ferner lieferten die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenmit ihren innovativen Anregungen Denkanstöße für die Praktiker/innenund induzierten mitunter eine kritische Reflexion tradierter pflegerischerHandlungsabläufe. Darüber hinaus löste die Arbeit mit den <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innenbei den Praxisanleiter/innen gestiegene Ansprü-89
che an reguläre Auszubildende bezüglich des selbstständigen Wissenserwerbsaus und gab Anlass zur Aufarbeitung und/oder Erweiterung des eigenenWissens.• Am Lernort Schule nahmen die Projektbeteiligten als Folge der <strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong> einen Wandel der Lehrerrolle wahr. Das Ausbildungsmodellbirgt nach Einschätzung der Lehrenden Potenzial für eineSteigerung der Ausbildungsqualität, insbesondere durch seine Kompetenzorientierung.• Die im Follow-up befragten Experten/innen aus den Landesministerienprognostizierten ebenfalls Veränderungen in der Pflegepraxis. Die „<strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ bewirke langfristig eine erhöhteHandlungskompetenz sowie eine zunehmende Verantwortungsbereitschaftseitens der Absolventen/innen.4.5 Akzeptanz und Verbreitung der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>:Das Stuttgarter Modell ©Die Hauptziele des Modells lagen u. a. in der Vorbereitung zukünftig Pflegender aufgesellschaftlich notwendige und politisch geforderte Aufgaben und Handlungsfeldersowie in einer Steigerung der Attraktivität des Berufsfeldes Pflege. Eine Einschätzungzur Akzeptanz des Modells hinsichtlich seiner Ausbildungskonstruktion wurdebereits in der ersten Evaluationsphase vorgenommen (vgl. Kap. 3).Erkenntnisinteresse / FragestellungDie Planung und Umsetzung sowie die interne und externe Evaluation der <strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong> können als Weiterentwicklung bzw. als Reformprozess der<strong>Pflegeausbildung</strong> angesehen werden (vgl. Kerngruppe Curriculum <strong>2006</strong>). Das Erkenntnisinteresseder externen Evaluation lag insbesondere auf der Beantwortungder Frage, welche Effekte sich in dem Stuttgarter Modell © bewähren und für einenTransfer in den Regelbetrieb empfohlen werden können. Zur Überprüfung der intendiertenZiele und Maßnahmen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> wurden im Rahmendes Follow-up Erhebungen bei Ministerienvertretern/innen, Workshopteilnehmern/innen,IPA-Absolventen/innen, Pflegedienst-, Wohnbereichs- und Stationsleitungendurchgeführt. Folgende zentrale Fragen standen dabei im Vordergrund derEvaluation:• Wie ist die Bekanntheit und Akzeptanz der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>:Das Stuttgarter Modell © auf der politischen Ebene?• Welche Innovationen und Synergieeffekte sind für den Transfer in den Regelbetriebgeeignet?• Welchen Beitrag leistet das Modell zu einer Steigerung der Attraktivität desPflegeberufes?90
4.5.1 Bundesweite Akzeptanz und Verbreitung des Modells –politische EbeneIm Zeitraum von Mitte August bis Mitte September <strong>2006</strong> führte das iap eine bundesweiteErhebung zum Bekanntheitsgrad des Stuttgarter Modells © innerhalb der zuständigenLandesministerien durch. Die Datenerhebung erfolgte anhand von leitfadengestütztenTelefoninterviews bzw. mittels eines Email-Fragebogens mit identischenFragestellungen.Die Zielgruppe der Expertenbefragung umfasste die Personen, die für die Altenund/oderKrankenpflegegesetze in den Landesministerien verantwortlich sind (vgl.Kap. 2.4). Als Grundlage für eine bewusste Auswahl an Experten/innen diente die„Synopse über Aktivitäten der zuständigen Ministerien in den Bundesländern zu curricularenEntwicklungen des Altenpflegegesetzes/2003 und Krankenpflegegesetzes/2004“55 . Ein Abgleich der jeweiligen Adressen erfolgte durch eine zusätzliche telefonischeRecherche in den zuständigen Landesministerien. Letztendlich setzte sichdie Stichprobe aus 27 möglichen Ansprechpartnern/innen der politischen Ebene zusammen.Die Responsequote betrug 59,3% (16 Personen 56 ). Die befragten Experten/innenrepräsentierten unterschiedliche Gesetzesbereiche hinsichtlich der <strong>Pflegeausbildung</strong>in den Landesministerien (6 Befragte: Altenpflegegesetz; 5 Befragte: Krankenpflegegesetz;5 Befragte: Altenpflege- und Krankenpflegegesetz). In welchen Bundesländerndie 16 interviewten Personen ansässig waren, verdeutlicht Abbildung 23.Zum Bekanntheitsgrad des Modells befragt, stimmten 75,0% (= 12 Befragte) zu, dasModellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell ©“ zu kennen. 4Personen 57 (25,0%) waren dagegen nicht mit diesem Projekt vertraut.55 Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schwesternverbände und Pflegeorganisationen e.V.; Deutscher Berufsverbandfür Pflegeberufe und Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe (2004). Synopse über Aktivitäten der zuständigenMinisterien in den Bundesländern zu curricularen Entwicklungen des Altenpflegegesetzes (2003) und Krankenpflegegesetz(2004): www.dbfk.de/download/download/ synopselogo2004-07-19.pdf (03.01.2007).56 9 befragte Personen (56,3%) beteiligten sich in Form eines telefonischen Interviews an der Erhebung und weitere7 Personen (43,8%) entschieden sich, stattdessen einen Email-Fragebogen auszufüllen.57 Verteilung der Personen nach Bundesländern: 1 Befragte/r: Sachsen Anhalt; 2 Befragte: Sachsen; 1 Befragte/r:Rheinland-Pfalz.91
Bundesländerverteilung der befragten Ministerienvertreter(TI Ministerien, September <strong>2006</strong>, n=16)2. Ergebnisse im Einzelnen (TI Ministerien 9/06, n=16):1Akzeptanz und Verbreitung des Modells21111212 112Abb. 23: Übersicht über die Verteilung der Befragten nach Bundesländern 58 (TI Ministerien,September <strong>2006</strong>)Den meisten Befragten (75,0%) war bekannt, dass im Rahmen des Modellprojekts„<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ eine gemeinsame grundlegende<strong>Pflegeausbildung</strong> für die Bereiche Alten-, Gesundheits- und Kranken- sowieGesundheits- und Kinderkrankenpflege angeboten wird bzw. es sich um ein integrativesAusbildungskonzept (58,3%) handelt. Tabelle 15 gibt einen Überblick über weitereAspekte, die die Experten/innen aus den zuständigen Ministerien mit dem Modellprojektin Verbindung brachten.Tab. 15: Aspekte, die mit dem Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “verbunden wurden (TI Ministerien, September <strong>2006</strong>)AntwortkategorienAnzahl derNennungenAnzahl derBefragten (%)Gemeinsame Grundausbildung für Auszubildendeder Pflege9 9 (75,0%)<strong>Integrative</strong>s Ausbildungskonzept 8 7 (58,3%)Ausbildungsdauer von 3 ½ Jahren 7 7 (58,3%)Erwerb von 2 Berufsabschlüssen 5 5 (41,7%)Entscheidungsmöglichkeit zwischen einem 2.3 3 (25,0%)Berufsabschluss bzw. einer SpezialisierungStrukturelle Informationen zum Modellprojekt 5 2 (16,7%)Sonstiges 2 2 (16,7%)n=12; Mehrfachantworten möglich58 An der Befragung nicht teilgenommen haben Vertreter aus Hessen, Niedersachsen, NRW und Thüringen.92
Die Mehrheit der politischen Entscheidungsträger (83% = 10 Befragte) hatten schonvor mindestens 3 Jahren erste Informationen zum Stuttgarter Modellprojekt erhalten(vgl. Abb. 24).Wann haben Sie das erste Mal Informationen zu diesemModellprojekt erhalten?(TI Ministerien, September <strong>2006</strong>, n=12; Angaben in %)vor 1 - 2 Jahren17%vor 5 Jahren41%vor 3 - 4 Jahren42%vor 5 Jahren vor 3 - 4 Jahren vor 1 - 2 JahrenAbb. 24: Zeiträume, in denen erste Information über das Modellprojekt erhalten wurden(TI Ministerien, September <strong>2006</strong>)4.5.2 Transfer von Modellanteilen in die RegelausbildungBezüglich der Eignung von Modellanteilen für die Regelausbildung vertrat die Mehrheitder politischen Entscheidungsträger (66,7% = 8 Befragte) 59 die Meinung, dasseinige Elemente des Modellprojekts „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das StuttgarterModell © “ transferfähig seien. Bei der Nachfrage, welche Aspekte des Modells sie fürgeeignet hielten, wurden eher allgemeine Faktoren genannt, z. B. die gemeinsameGrundausbildung (62,5%) oder der Theorie-Praxis-Transfer (37,5%) (vgl. Tab. 16).59 Nein: 8,3%; Weiß nicht: 25%93
Tab. 16: Modellanteile der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>, die aus Sicht der Ministerienvertreter/innen für die Regelausbildung geeignet sind (TI Ministerien, September <strong>2006</strong>)AntwortkategorienAnzahl der Anzahl derNennungen BefragtenGemeinsame Grundausbildung / Spezialisierung 5 5 (62,5%)Theorie-Praxis-Transfer 3 3 (37,5%)Fächerintegration 2 2 (25,0%)Lernfeldansatz 1 1 (12,5%)Erwerb von 2 Berufsabschlüssen 1 1 (12,5%)Leistungsbewertung 1 1 (12,5%)Sonstiges 2 2 (25,0%)n=8; Mehrfachantworten möglichAuch die Absolventen/innen wurden im Rahmen des Follow-up nach Bestandteilender <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> befragt, die in die Regelausbildung übernommenwerden sollten. Die ehemaligen <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen hielten vor allem dasselbstorganisierte Lernen (67,7% = 10 Befragte), den Lernfeldansatz mit seinem fächerübergreifendenUnterricht (60% = 9 Befragte) sowie die Vielfalt der Einsatzorte(53,3% = 8 Befragte) für einen Transfer in die traditionelle <strong>Pflegeausbildung</strong> für geeignet(vgl. Abb. 25).Welche Bestandteile der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> solltenIhrer Meinung nach auf jeden Fall in die Regelausbildungübernommen werden?(T 9 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, Juli <strong>2006</strong>, n=15; Angaben in % u. absolutenHäufigkeiten)selbstorganisiertes LernenLernfeldansatz/FächerintegrationVielfalt der PraxiseinsatzorteFallarbeitReflexionGruppenarbeitselbst präsentieren/vortragenSonstigeskeine Angabe1233450 10 20 30 40 50 60 708910Abb. 25: Bestandteile der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>, die in die Regelausbildung übernommenwerden sollten (T9 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, Juli <strong>2006</strong>)94
Um die Frage nach dem Transfer von Innovationen des Modells in den Regelbetriebnoch genauer beantworten zu können, führte das iap in einer Anschlussuntersuchungeine schriftliche Fragebogenerhebung bei 240 Teilnehmer/innen 60 derWorkshops „Lehr-Lernarrangements im Lernfeldansatz gestalten“ bzw. „Lernerfolgsbewertungin der <strong>Pflegeausbildung</strong> integrativ gestalten“ durch 61 . Die Befragung verfolgtedie Absicht, zu ermitteln, inwieweit die aus den Workshops entstandenen Impulsein den Regelbetrieb umgesetzt wurden. Ferner lag das Ziel der Erhebung inder Identifizierung von Faktoren, die eine Umsetzung von Modellanteilen bzw. desgesamten Modells der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ einerseitsbegünstigten und andererseits erschwerten.Die Ergebnisse der Erhebungen zeigen, dass fast die Hälfte der ehemaligen Workshopteilnehmer/innen(48% = 27 Befragte bezogen auf 56 Befragte) Modellanteilewährend ihrer beruflichen Tätigkeit umsetzten. 18% (10 Befragte) beteiligten sich sogaran der Integration des gesamten Modells. Dahingegen nahmen 29% (16 Befragte)der Workshopteilnehmer/innen nicht an der Umsetzung des Modells bzw. Modellanteilenteil (vgl. Abb. 26).Setzen Sie mittlerweilen Modellanteile um bzw. sind Sie an derUmsetzung des gesamten Modells beteiligt?(Follow-up Workshopteilnehmer/innen, September <strong>2006</strong>, n=56; Angaben in %)nein29%keine Angabe5%ja, das gesamteIPA-Modell18%ja, einigeModellanteile48%ja, das gesamte IPA-Modellneinja, einige Modellanteilekeine AngabeAbb. 26: Beteiligung der Workshopteilnehmer/innen an der Umsetzung von Modellanteilen bzw.am gesamten Modell (Follow-up Workshopteilnehmer/innen, September <strong>2006</strong>)60 Die Rücklaufquote betrug 23,3% (56 Befragte). Diese relativ niedrige Quote erklärt sich aus dem Sachverhalt,dass der Besuch der Workshops in einigen Fällen bis zu 5 Jahren zurücklag und die Erinnerungen an diesen Besuchteilweise nur noch unvollständig vorlagen sowie in der nicht aktualisierten Adressdatei der Workshopteilnehmer/innen.61 Die Workshops wurden von der Kerngruppe Curriculum des Modellprojekts „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: DasStuttgarter Modell © “ durchgeführt und fanden teilweise im Robert-Bosch-Krankenhaus bzw. in Form von Inhouse-Schulungen in den beteiligten Einrichtungen statt.95
Nach den konkreten Modellanteilen gefragt, die bereits an den Schulen der Workshopteilnehmer/innenrealisiert werden, wurden vor allem die Integration von Lernsituationen(92,6%), die Praxisaufträge (74,1%), das Kompetenzmodell (55,6%) unddie Lernfelder (48,1%) des Stuttgarter Modells © genannt (vgl. Abb. 27).Wenn ja, welche Modellanteile setzen Sie um?(Follow-up Workshopteilnehmer/innen, September <strong>2006</strong>, n=27; Angaben in % u.absoluten Häufigkeiten)Lernsituation25Praxisaufträge20Kompetenzmodell15Lernfelder13Praxisinstrumente6Arbeiten im Kooperationsverbund 2Sonstiges 40 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Abb. 27: Modellanteile der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>, die aus Sicht der Workshopteilnehmer/innen bereits an den Schulen umgesetzt werden (Follow-up, September <strong>2006</strong>)Bei der Identifizierung von Elementen, die eine Umsetzung von Modellanteilen bzw.des gesamten Modells der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “an den Pflegeschulen begünstigen oder erschweren, konnten aus Sicht der Workshopteilnehmer/innenfolgende zentrale Faktoren ermittelt werden (vgl. Tab. 17):Tab. 17: Förderliche und hinderliche Faktoren, die eine Umsetzung von Modellanteilen oder desgesamten Modells beeinflussen (Follow-up Workshopteilnehmer/innen, September <strong>2006</strong>)Förderliche Faktoren(+) angemessene Rahmenbedingungen in den Schulen (zeitliche, mediale, personale, räumliche,finanzielle)(+) Bereitschaft und Motivation der Lehrenden zu Schulentwicklungsprozessen(+) Entwicklungsbereitschaft u. Angebot bzw. Teilnahme an Fortbildungen/ Schulungen(+) Bereitschaft zur Teamarbeit, Austausch, Reflexion(+) akademische bzw. hohe Qualifikation der Lehrenden(+) gesetzliche Vorgaben(+) Motivation und Akzeptanz der Pflegepraxis(+) Kooperationsbereitschaft zwischen den Ausbildungsstätten96
Hinderliche Faktoren(-) unzureichende Rahmenbedingungen in den Schulen (zeitliche, mediale, personale, räumliche,finanzielle)(-) organisatorische Probleme, z. B. durch hohen Anteil an Fremddozenten(-) unterschiedlicher Wissens- u. Informationsstand der Lehrenden über das Modell(-) fehlende Motivation und Bereitschaft der Lehrenden, an Schulentwicklungsprozessenmitzuwirken(-) unterschiedliches Lehr-/Rollenverständnis der Lehrenden(-) unzulängliche Voraussetzungen in der Praxis, z. B. mangelnde Qualifikation undInformation der Pflegepraktiker/innen(-) mangelnde Kooperation zwischen den AusbildungsstättenAuch die am Modellprojekt beteiligten Lehrenden wurden nach Empfehlungen gefragt,die sie im Zusammenhang mit der Modellumsetzung an andere Pflegeschulenweitergeben möchten. Zur Umsetzung der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> rieten dieLernbegleiter 62 den Schulen zunächst die Gewährleistung personeller Rahmenbedingungen.Dies beinhalte eine adäquate pädagogische Qualifizierung des Lehrpersonals,u. a. mit akademischen Abschlüssen, wie es bereits von den Workshopteilnehmern/innenformuliert wurde (vgl. Tab. 17). Sich durch diverse Kompetenzen ergänzend,sollten sie zur Teamarbeit und zum Unterrichten im Lehrertandem fähigsein. Dafür bedürfe es einer internen oder externen Unterstützung der Lehrenden inihrem Arbeits- und Entwicklungsprozess, um sie bei der Umsetzung der neuen Lehr-/Lernmethoden professionell zu begleiten.„(…) wichtig ist es auch daran zu denken, wie Lehrer begleitet werden indiesem Umdenken, (...) jemanden im Team zu haben, der ausschließlichdafür da ist, Lehrer dann auch in der Entwicklung von Lernsituationen zubegleiten, zu unterstützen.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Als entscheidende Bedingung für die Modellumsetzung erachteten die Befragten dasVorhandensein vielfältiger und interdisziplinärer Kooperationspartner/innen, die unterschiedlichsteInstitutionen, Kompetenz- und Handlungsfelder der drei Pflegeberuferepräsentieren sollten. Einen regelmäßigen und systematischen Austausch hieltensie für unabdingbar, um eine Netzwerkbildung und Etablierung von Kommunikationsstrukturenzu institutionalisieren und zu stabilisieren.„(…) und eben der Austausch immer wieder, (...), mit denen, die daran beteiligtwaren. (...) dann auch Netzwerke zu bilden, um (...) im Austausch zubleiben.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Die Implementierung des Modells setze nach Auffassung der Lehrenden zunächsteine Auseinandersetzung mit dem theoretischen Begründungsrahmen voraus. Mit62 Ergebnisse aus den Telefoninterviews mit den Lehrenden (TI Lehrende Juni/Juli <strong>2006</strong>)97
allen Projektbeteiligten, vor allem den Lehrenden, sei das eigene pädagogische undpflegerische Verständnis zu eruieren, um eine gemeinsame Arbeitsbasis zu schaffenund Ziele klar zu definieren. Davon ausgehend ließen sich Elemente des Modells füreine Übernahme auswählen.„Ich empfehle da wirklich so etwas wie einen Begründungsrahmen oderBegriffsklärungen oder inhaltliche Diskussionen zum Pflegeverständnisund zum pädagogischen Verständnis immer wieder zu führen.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Die konkrete Umsetzung des Modells sollte sich den Lehrenden zufolge individuellabhängig nach den jeweiligen personellen, strukturellen und konzeptuellen Gegebenheitenbzw. Bedürfnissen der Schule richten. Das setze eine Reflexion des eigenenStatus quo, der angestrebten Ziele sowie vorhandener Potenziale und Ressourcenvoraus und bringe einen intensiven Auseinandersetzungsprozess im Team mitsich, den erfahrene Kollegen/innen aus anderen Schulen oder auch externe Beraterbegleitend unterstützen könnten.„Ich glaube es ist gut möglich, einzelne Teile des Modells umzusetzen.Wenn man es insgesamt übertragen möchte oder auch wirklich anpassenwill, dann muss man sicher davon ausgehen, dass es ein längerer Schulentwicklungsprozessauch ist, der vieles aufrüttelt, aber das ist sicherlichauch eine Chance.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)4.5.3 Einfluss des Modells auf die Weiterentwicklung der<strong>Pflegeausbildung</strong>Konsens bestand in der Gruppe der befragten Ministerienvertreter/innen, dass dasModell sich auf die weitere politische Planung bezüglich der zukünftigen <strong>Pflegeausbildung</strong>enauswirkt. Die Effekte der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> wurden zusammengefasstwie folgt beschrieben 63 :• Forcierung der Prozesse, die Regelausbildung in integrativer oder generalistischerForm weiterzuentwickeln;• Einbeziehung der Ergebnisse (aller Modelle) in politische Entscheidungsprozesse,insbesondere hinsichtlich der vertikalen und horizontalen Durchlässigkeit;• Änderungen in der bundesrechtlichen Regelung zur <strong>Pflegeausbildung</strong>.Auch die Lehrenden 64 konstatieren eine hohe Bedeutsamkeit des Modellprojektes fürdie Weiterentwicklung der <strong>Pflegeausbildung</strong>, begründet durch das große Interessevon Einrichtungen und Schulen an der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>. Die Befragtenführten dies vor allem auf die pflegewissenschaftlich, -pädagogisch und -beruflich gut63 TI Ministerien, September <strong>2006</strong>, n=1664 Ergebnisse aus den Telefoninterviews mit den Lehrenden (TI, Juni/Juli <strong>2006</strong>, n=6)98
fundierte Ausbildungskonzeption zurück. Folgende innovative Bestandteile des Modellprojektsbewährten sich ihrer Meinung nach besonders:• der pflegeberufliche und pädagogische Begründungsrahmen;• der Lernfeldansatz, damit einhergehende Schulungen und gemeinsamesUnterrichten;• das Kompetenzmodell sowie das Lernerfolgsbewertungskonzept und• die Idee des Kooperationsverbundes.Diese Konzeptelemente fungierten nicht nur als Impulse, Strukturhilfe bzw. Lehr- undLernmaterial für die <strong>Pflegeausbildung</strong>, sondern bewirkten auch positive Effekte inden jeweiligen Einrichtungen.„Also ich glaube am Anfang war ja diese Bedeutsamkeit vor allem auchüber die Umsetzung des Lernfeldansatzes, wo auch viele profitiert habenüber diese Schulungen.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Vor allem die integrativen Anteile des Modellprojekts lösten nach Ansicht der LehrendenSynergieeffekte aus. Die Ausbildungsinhalte der drei Pflegeberufe überschnittenund ergänzten sich. Sie bildeten eine zukunftweisende Basisausbildung,die anschließender Spezialisierungen, möglicherweise auch fakultativ nach dem Berufseinstieg,bedürfe. Damit forciere das Modellprojekt berufspolitisch und inhaltlichden Diskussionsprozess um eine gemeinsame <strong>Pflegeausbildung</strong> und biete differenzierteArgumentationshilfen zur Beantwortung der Frage nach einem gemeinsamenPflegeberuf.„(…) es sind sehr viele Inhalte, die in allen 3 Ausbildungsgängen, in dentraditionellen, vorkommen und die sich sehr gut kombinieren lassen undman braucht deshalb nicht unterschiedliche Ausbildungsgänge da anbieten.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Das Modellprojekt leistet nach Auffassung der Lehrenden einen wesentlichen Beitragzur Professionalisierung und Weiterentwicklung der Pflege. Der Entwicklungs- undDurchführungsprozess des Modellprojekts stelle eine wichtige Lernerfahrung für alleProjektbeteiligten dar, die sich auf Neues einlassen, Altes überdenken, reflektierenund ihrem Wortlaut nach ‚anders’ pflegen mussten. Die bedarfs- und praxisorientierteAusbildung berücksichtige besonders präventive und gesundheitspolitische Aspekte.Sie beabsichtige ebenso, die Auszubildenden zu Engagement und Freude am Berufzu motivieren und sie zu verantwortungsvollen, reflektierten, systematisch und weitsichtighandelnden Menschen auszubilden.„(…) weil (nicht verständlich) der Professionalisierungsprozess der Pflegeberufeenorm vorangetrieben werden kann. (...), es hat einen Einfluss,indem wir (...) anders über Pflege denken. (...) Und ich denke wir wollen jaauch unsere Auszubildenden dahin bringen, dass sie sich an Gesundheitspolitikmit beteiligen und begleiten. (...) und Freude am Weiterentwickelnauch haben.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)99
Ferner trug das Stuttgarter Modell nach Meinung der Lehrenden zur Qualitätssteigerungin der <strong>Pflegeausbildung</strong> bei. Die Lernbegleiter waren sich darüber einig, dassinsbesondere in Bezug auf den Theorie-Praxis-Transfer das Modellprojekt die Qualitätder <strong>Pflegeausbildung</strong> erhöhte. Die praxisnahe Unterrichtsgestaltung mit den innovativenLehr-/ Lernmethoden sowie die Praxisaufträge forderten die Lehrenden zueinem intensiven Praxisbezug heraus und trugen konstruktiv zu einer praxisnahen<strong>Pflegeausbildung</strong> bei.„Ja, in der Theorie-Praxis-Vernetzung. (...), also durch diese enge Verknüpfungan eine Pflegesituation, dies fordert Lehrende heraus, sich immerwieder auch in die Praxis zu begeben, um nach entsprechenden Pflegesituationenzu schauen.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Zu einem weiteren Qualitätsmerkmal zählten die pflegetheoretischen Grundlagendes Modellprojekts. Insbesondere das Curriculum und das Kompetenzmodell beruhenden neuen gesetzlichen Grundlagen entsprechend auf pflegewissenschaftlichenErkenntnissen. Sie bieten eine fundierte und differenzierte Basis für eine wissenschaftlichbegründete und qualitätsbewusste <strong>Pflegeausbildung</strong>.„(…) was jetzt auch noch neu im Krankenpflegegesetz mehr gefordertwird, wie Pflegeforschung, Pflegewissenschaft, dass sie in der Ausbildungauch gute Inhalte mitbringen. Was natürlich auch zur Qualitätssteigerungbeiträgt.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Als besonders qualitätssteigernd erlebten die Lehrenden den durch das Modellprojektausgelösten intensiven Auseinandersetzungs- und Diskussionsprozess, einhergehendmit einer beständigen Selbstreflexion und -revision. Zu einer Weiterentwicklungdes Projekts trugen auch die externe Projektevaluation und die dabei neu aufgeworfenenFragen bei, die zur ständigen Neuanpassung von Inhalten und Qualitätsentwicklungdes Modellprojekts führten.„(…) was sicher eine Chance war, dass wir uns die Zeit nehmen konnten,auch genommen haben, wirklich auch alle Schritte intensiv zu diskutieren,zu begründen und zu reflektieren.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Um der Frage nachgehen zu können, welchen Beitrag das Modell zu einer Steigerungder Attraktivität des Pflegeberufes leistet, wurden die im Modellprojekt involviertenPraxisanleiter/innen und Lehrenden befragt. 72% (18 Befragte) glaubten an eineAttraktivitätssteigerung der Pflegeberufe, ausgelöst durch die <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>(vgl. Abb. 28).100
Denken Sie, dass der Pflegeberuf durch das Modellprojekt anAttraktivität gewinnt?(T4 Praxisanleiter/innen, Oktober 2005, n=25; Angaben in %)weiß nicht24%nein4%ja72%ja nein weiß nichtAbb. 28: Zunehmende Attraktivität des Pflegeberufes durch das Modellprojekt aus Sicht derPraxisanleiter/innen (T4, Oktober 2005)Begründet wurde die positive Auswirkung des Modellprojekts mit dem Erwerb zweiergleichwertiger Berufsabschlüsse, dem durch das Modell vermittelten hohen Anspruchan den Pflegeberuf sowie mit dem Austausch zwischen den drei Pflegeberufen undden damit verbundenen breiten Einsatzmöglichkeiten der Absolventen/innen.Auch nach Ansicht der befragten Lehrenden 65 führt das Ausbildungsmodell zu einerAttraktivitätssteigerung des Pflegeberufes. Diese sei an der hohen Bewerberzahl fürdas Ausbildungsangebot, insbesondere ab 2007 bei der Übernahme des Modells indie Regelausbildung, zu erkennen.„(…) was ja auch noch ein Ziel war, auch die Attraktivität der Pflegeberufedamit zu steigern, (...) wir haben immer noch extrem hohe Nachfragennach diesem Ausbildungsangebot von den Bewerbern.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)65 Ergebnisse aus den Telefoninterviews mit den Lehrenden (TI, Juni/Juli <strong>2006</strong>, n=6)101
4.5.4 Einschätzung der Vorbereitung durch die <strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong> auf aktuelle und zukünftigeAnforderungen des Pflegeberufs - BerufseinmündungZur Berufseinmündung wurden im Follow-up die Pflegedienst-, Stations- und Wohnbereichsleitungengefragt, ob die Absolventen/innen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>gut auf die Aufgaben in ihrem jeweiligen Handlungsfeld vorbereitet waren. DieErgebnisse zeigen, dass fast die Hälfte der Befragten die Vorbereitung als gut einschätzte(vgl. Abb. 29).Waren Ihrer Ansicht nach die Absolventen/innen desModellprojekts gut auf die Aufgaben in Ihrem Handlungsfeldvorbereitet?(Follow-up PDL/SL/WBL, August <strong>2006</strong>, n=24; Angaben in %)keine Angabe27% ja42%ja und nein4%nein27%ja nein ja und nein keine AngabeAbb. 29: Vorbereitung der Absolventen/innen des Modellprojekts auf die Aufgaben im jeweiligenHandlungsfeld aus Sicht der PDL/SL/WBL (Follow-up, August <strong>2006</strong>)Insbesondere gut vorbereitet waren die Absolventen/innen laut den Aussagen derPflegedienst-, Stations- und Wohnbereichsleitungen auf:• Anwendung von Fachwissen,• Umsetzen von Pflegemaßnahmen,• Anwendung des Pflegeprozesses,• Gesprächsführung mit Pflegeempfänger bzw. deren Bezugspersonen und• flexible Erfordernisse im Arbeitsalltag.Der Anteil der Befragten, der die Vorbereitung der Absolventen/innen negativ beurteilte(27%), begründete dies mit einer eingeschränkten Vorbereitung auf:• spezielles Fachwissen,• spezielle fachpraktische Situationen sowie• komplexe organisatorische Abläufe.102
Parallel wurden die Lehrenden zur Berufseinmündung der IPA-Absolventen/innenbefragt. Mehrheitlich bestätigten die Lernbegleiter/innen 66 die gute Vorbereitung derAuszubildenden auf den Berufseinstieg in Theorie und Praxis. Ihre hohe Auffassungsgabe,Anpassungsfähigkeit, Motivation und pflegefachliche Kompetenz ermöglicheihnen, sich schnell auf neue Situationen und Institutionen einzustellen. Sie reflektierten,begründeten und kommunizierten ihr Handeln und glichen vorhandeneDefizite aus, nachdem sie sich systematisch und gezielt Informationen angeeignethatten.„Ich glaube, da haben sie eine gute Systematik inzwischen entwickelt,auch so einen Leitfaden im Kopf zu haben, davon bin ich überzeugt, dasssie wissen, wie muss ich mir jetzt welche Information erschließen, damitich hier schnell handlungsfähig bin.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Einschränkend merkten einige Befragte eine individuell abhängige Unsicherheit derAuszubildenden im Praxisalltag an. Die Vielfalt und der schnelle Wechsel der Einsatzortebeeinträchtigten den Erwerb einer Alltagsroutine und Handlungssicherheit,vor allem in den Schwerpunktgebieten (vgl. Kap. 4.4.1). Daher waren sie nebst üblichenSchwierigkeiten von Berufsanfängern/innen stärker als die regulär Ausgebildetenauf Praxiserfahrungen angewiesen.„Ich denke, dass sie schon gut vorbereitet worden sind vonseiten derSchule, dass sie aber einfach dadurch, dass sie so viele verschiedeneLernsituationen/Lernfelder hatten, in der Praxis vor allem, dass sie vieleÜbungs- und Festigungsmöglichkeiten brauchen, hinterher noch.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Übereinstimmend sahen die Befragten Nachholbedarf bei den Absolventen/innen imHinblick auf den Erwerb von Routine und Sicherheit in praktisch-technischen Fertigkeiten.Sowohl in der Theorie als auch in der Praxis sollten spezielle Pflegetechniken,v. a. in den Schwerpunkten, intensiver vermittelt und geübt werden. Es gelte, dieaufgrund der raschen Einsatzwechsel evtl. eingeschränkten Übungsmöglichkeitenmittels effektiver Lehr- und Lerninstrumente auszugleichen (vgl. Kap. 4.2).„Ich denke, dass sie ein gutes Grundwissen haben. (...) Ich denke aber,dass die Auszubildenden sehr viel Übungs- und Festigungsmöglichkeitenbrauchen jetzt nach der Ausbildung.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Im Hinblick auf die Arbeitsmarktsituation sahen die Lehrenden die Vorbereitung derAuszubildenden auf die speziellen Handlungsfelder eher kritisch. Sie zweifelten aneiner erfolgreichen und dem Markt angemessenen Berufsvorbereitung, weil sie dieneuen Handlungsfelder bzw. entsprechenden Stellen noch nicht erkennen konnten.66 Ergebnisse aus den Telefoninterviews mit den Lehrenden (TI, Juni/Juli <strong>2006</strong>, n=6)103
„Was für mich problematisch ist, wir haben sie eigentlich auch für neueHandlungsfelder vorbereiten wollen. Und ich sehe diese neuen Handlungsfeldernoch nicht wirklich. Und ich entdecke diese Stellen nicht auf demMarkt.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Zur zukünftigen beruflichen Entwicklung gefragt, teilten die Lehrenden mehrheitlichdie Einschätzung, dass sich die Absolventen/innen zukünftig auf jeden Fall weiterqualifizierenwerden. Sie waren davon überzeugt, dass sie aufgrund ihrer Motivation,Neugierde und auch bereits erworbener Bildung ein Studium oder fachliche Weiterbildungenaufnehmen werden.Die Befragten konnten sich die Absolventen/innen gut in anleitenden bzw. leitendenFunktionen, beispielsweise in der Altenpflege als Wohnbereichsleitung oder Anleiter/in,vorstellen. Nicht nur ihre Vorbildung und v. a. ihre sozial-kommunikativenKompetenzen, sondern auch ihre Fähigkeit, systematisch und begründet zu organisierenund sich zu artikulieren, prädestiniere sie für Führungsaufgaben.„Ja, also ich glaube schon, dass der Großteil in 5 Jahren schon in (...) leitendenFunktionen tätig sein werden. (...) weil sie schon allein von ihrerVorbildung, bevor sie die Ausbildung angefangen haben, einiges mitbringenund auch innerhalb der Ausbildung, einfach durch die Ausbildungsinhaltesehr gut vorbereitet wurden.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Darüber hinaus glaubten die Lehrenden, dass die Absolventen/innen, die durch dieAusbildung ein besonders hohes und ausgeprägtes pflegerisches Berufsverständnisaufwiesen, in fünf Jahren auf jeden Fall in der direkten Pflege tätig sein werden.„Ja, wo sehe ich die in fünf Jahren. In der Pflege. (...) die haben eine besondersstarke geprägte pflegeberufliche Perspektive und Berufsidentifikation.(...) Immer wieder zu fragen, was bedeutet das jetzt alles, die Pflegebrilleaufsetzen. Das hat schon eine große Rolle gespielt.“(TI Lehrende, Juni/Juli <strong>2006</strong>)Die Aussagen der Lehrenden zur zukünftigen beruflichen Entwicklung der ehemaligen<strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen decken sich mit den Ergebnissen der Abschlussbefragungder IPA-Absolventen/innen. Auch sie sehen ihren Arbeitsbereich in 5-10 Jahrenvor allem im Handlungsfeld Pflege, z. B. im Bereich der onkologischen Pflege, inleitenden Positionen bzw. in der Weiterqualifikation (vgl. Abb. 30).104
Wo würden Sie sich gerne beruflich in 5-10 Jahren sehen?(T9 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen, Juli <strong>2006</strong>, n=15; Angaben in % u. absolutenHäufigkeiten, offene Frage)direkte Pflege14Leitungsposition/Studium5unklar, aber in der Pflege4Praxisanleitung3Sonstiges20 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100Abb. 30: Zukünftige Arbeitsbereiche der IPA-Absolventen/innen (T9 <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen,Juli <strong>2006</strong>)4.5.5 KurzzusammenfassungDie Ziele des Modellprojektes, die u. a. in der Vorbereitung zukünftig Pflegender aufneue Aufgaben- und Handlungsfelder der Pflege und in einer Attraktivitätssteigerungdes Pflegeberufes lagen, können als erreicht angesehen werden. Zur Begründungwerden nachfolgend die in diesem Kapitel aufgeführten Ergebnisse zusammengefasst:• Es lag eine hohe bundesweite Bekanntheit und Akzeptanz des Modells aufder politischen Ebene vor. Die Entscheidungsträger der zuständigen Ministerienverbanden mit dem Projekt vor allem eine gemeinsame Grundausbildungbzw. ein integratives Ausbildungskonzept und die als innovativ zu bewertendeAusbildungszeit von 3 ½ Jahren.• Einige Modellanteile bzw. das gesamte Modell 67 wurden bzw. werden bereitserfolgreich in die Regelausbildung übertragen. Vor allem das selbstorganisierteLernen, die Lernfelder und Lernsituationen, die Vielfalt der Praxiseinsatzorte,die Praxisaufträge sowie das Kompetenzmodell wurden für transferfähigerachtet.67 Die Schule für Pflegeberufe der Klinik am Eichert in Göppingen, die Berufsfachschule für Pflegeberufe am Caritas-KrankenhausBad Mergentheim GmbH und das Bildungszentrum Pflegeschulen des Ev. DiakoniewerksSchwäbisch Hall e.V. übertragen weite Teile des Curriculums auf ihre <strong>Pflegeausbildung</strong>sgänge (vgl. KerngruppeCurriculum <strong>2006</strong>).105
• Im Rahmen der Identifizierung von transferförderlichen und -hinderlichen Faktorenzeigte sich vor allem, dass angemessene zeitliche, mediale, personale,räumliche und finanzielle Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche Modellumsetzungvorhanden sein müssen. Ferner sollte die Bereitschaft und Motivationder Lehrenden, die über entsprechende pädagogische Qualifikationenverfügen (u. a. durch akademische Abschlüsse), und Mitarbeit an Schulentwicklungsprozessenbestehen.• Das Modellprojekt konnte durch seine hohe Professionalisierungstendenz(längere, differenzierte, anspruchsvolle Ausbildung mit zwei gleichwertigenBerufsabschlüssen und breiten Einsatzmöglichkeiten) einen Beitrag zur Weiterentwicklungund Attraktivitätssteigerung der Pflegeberufe leisten. Insbesondereforcierte das Stuttgarter Modell © den Diskussionsprozess um eine Neugestaltungder <strong>Pflegeausbildung</strong> und bot detaillierte Argumentationshilfen zurBeantwortung der Frage nach einem gemeinsamen Pflegeberuf.• Zur Qualitätssteigerung der <strong>Pflegeausbildung</strong> trug das Modell vor allem durchdie pflegewissenschaftlich, -pädagogisch und -beruflich gut begründete Ausbildungskonzeptionund den Theorie-Praxis-Transfer bei. Die Diskussionsprozessein der Entwicklungs- und Umsetzungsphase sowie die interne und externeEvaluation mit Reflexions- und Revisionsphasen wurden als Qualitätsmerkmaleidentifiziert und führten zu einer permanenten Qualitätsentwicklungdes Modellprojektes.• Das Kompetenzprofil der Absolventen/innen (hohe analytisch-reflexive und interaktiveKompetenz, Flexibilität) wird dem an Komplexität zunehmenden Auftragan Pflege gerecht und ermöglicht ihren Einsatz in aktuellen und neuenHandlungsfeldern. Optimierungsbedarf hinsichtlich der Berufsvorbereitungwurde im Bereich der praktisch-technischen Kompetenz, in der Vorbereitungauf spezielle Handlungsfelder und pflegefachliche Schwerpunkte sowie in derBewältigung komplexer organisatorischer Abläufe gesehen.• Die zukünftige berufliche Entwicklung der Absolventen/innen liegt nach Ansichtder Befragten in den klassischen Handlungsfeldern der direkten Pflegesowie im Bereich anleitender bzw. leitender Funktion und Weiterqualifizierungbzw. Studium.106
5.Zusammenfassung der Ergebnisse: Bewährte Bestandteiledes Modells und HerausforderungenIm folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Evaluationsstudie anhand der Leitzieledes Modells zusammengefasst. Diese lauteten im Einzelnen:- weg von der Verrichtungsorientierung hin zu einer Pflegesituationsorientierung;- Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz vor dem Hintergrund eines theoretischbegründeten Kompetenzmodells;- Vorbereitung auf gesellschaftlich notwendige u. politisch geforderte Aufgabenund Handlungsfelder der Pflege;- Steigerung der Attraktivität des Berufsfeldes Pflege.Ferner werden positive Erfahrungen, bewährte Elemente, aber auch erschwerendeFaktoren und Herausforderungen des Modellprojektes aufgezeigt.5.1 PflegeverständnisDie Evaluationsergebnisse führen zu der Annahme, dass das im Rahmen der „<strong>Integrative</strong>n<strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ intendierte Leitziel „weg von derVerrichtungsorientierung hin zu einer Pflegesituationsorientierung“ erreicht wurde.Dies belegen die folgenden Ergebnisse:• Das Pflegeverständnis entsprach im Ausbildungsverlauf zunehmend den pflegeberuflichenLeitzielen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>. Bereits im zweiten Ausbildungsjahrließ die Analyse der Begriffsbestimmungen von Pflege einen vonMehrdimensionalität und Situationsorientierung geprägten Perspektivenwechselerkennen (vgl. Zwischenbericht iap 2005), der sich bis zum Ende der Ausbildungweiter vollzog und in die Pflegepraxis transferiert werden konnte.• Die <strong>Modellkurs</strong>teilnehmer/innen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> verinnerlichtendie Subjekt- und Ressourcenorientierung als zentralen Aspekt professionellenpflegerischen Handelns. Dieses Verständnis von Pflege divergierte von den Vorstellungender Vergleichsgruppen, bei denen eine verrichtungs- und defizitorientierteSichtweise erkennbar häufiger vorzufinden war.• Die Evaluation des Pflegeverständnisses der Auszubildenden spricht demnachfür eine gelungene Umsetzung der curricularen Konzeption bzw. des pflegeberuflichenBegründungsrahmens. Die Integration der berufsspezifischen Sichtweisender drei Pflegeberufe innerhalb der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das StuttgarterModell © “ förderte ein neues, differenziertes Verständnis von Pflege, gekennzeichnetdurch Ressourcen-, Situations- und Pflegebedarfsorientierung.107
5.2 KompetenzentwicklungMit Blick auf die Evaluationsergebnisse kann resümierend eine positive Auswirkungder curricularen Konzeption der „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell© “ auf die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz konstatiert werden:• Mit dem erworbenen Kompetenzprofil, welches sich durch eine ausgeprägte Reflexionsfähigkeitund interaktive Kompetenz sowie ein hohes Maß an Selbstständigkeitauszeichnet, sind die Absolventen/innen dazu in der Lage, aktuelle undzukünftige Anforderungen des Pflegeberufs fachkundig und souverän zu bewältigenund Positionen in alten und neuen Handlungsfeldern der Pflege zu begleiten.Demzufolge ist es den Initiatoren/innen der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> gemäßihrem Leitziel gelungen, die Auszubildenden auf gesellschaftlich notwendige undpolitisch geforderte Aufgaben und Handlungsfelder vorzubereiten.• Die Vielfalt der Kooperationspartner/innen trug zur Ausbildung einer besonderenFlexibilität und raschen Anpassungsfähigkeit der integrativ Ausgebildeten bei.Damit empfehlen sie sich bei potenziellen Arbeitgebern, indem sie je nach Bedarfin unterschiedlichen Bereichen einsetzbar sind und ihnen wechselnde Aufgabenübertragen werden können. Durch ihr reflektiertes, kritisches und pflegetheoretischbasiertes Handeln besitzen sie darüber hinaus das Potenzial, einen Beitragzur Qualitätssicherung in der Pflegepraxis sowie zur Professionalisierung desPflegeberufes zu leisten.• Gleichwohl empfiehlt sich langfristig ein gezieltes Entgegenwirken der den häufigenLernortswechseln geschuldeten Defiziten im praktisch-technischen Kompetenzbereich(z. B. durch zusätzliche fachpraktische Übungseinheiten am LernortSchule und intensive Unterstützung durch die Praxisanleiter/innen am LernortPflegepraxis). Ferner scheint es ratsam, den Bedingungsfaktoren der fachspezifischenWissenslücken sowie Handlungsunsicherheiten in der Gesundheits- undKinderkrankenpflege nachzugehen und Lösungsansätze zu deren Behebung zuentwickeln (z. B. in Form vermehrter Praxiseinsätze im Handlungsfeld oder ergänzender,dem Bedarf der Auszubildenden nachkommender Lernangebote).• Die Ergebnisse aus der Beobachtung der Examensprüfungen bestätigten den positivenEinfluss der curricularen Konzeption des Ausbildungsmodells auf die Entwicklungberuflicher Handlungskompetenz. Damit wurde das angestrebte Leitzielder „<strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “, berufliche Handlungskompetenzvor dem Hintergrund eines theoretisch begründeten Kompetenzmodellszu entwickeln, erreicht. Die Datenanalyse der Beobachtungen ließdennoch eine Überprüfung bzw. Erweiterung des Kompetenzmodells um Aspekteder personalen Kompetenz (Stressfähigkeit / Umgang mit Belastungen, Selbstpflegekompetenz)als ratsam erscheinen.108
5.3 Lerntransfer / Verhältnis integrative Basisausbildung undSchwerpunktsetzungDass Transferlernen im Lernfeldansatz keine Selbstverständlichkeit ist, wurde vonder Kerngruppe Curriculum im Ausbildungsverlauf festgestellt und als Untersuchungsschwerpunktim Evaluationsplan aufgenommen. Die Ergebnisse verdeutlichendie besondere Herausforderung von Transferleistungen der Auszubildenden, die vorallem in der Übertragung von Wissen aus einem Handlungsfeld (einer Pflegesituation)in ein anderes Handlungsfeld (eine andere Pflegesituation) liegen:• Die Ergebnisse bestätigten die von der Kerngruppe vermuteten Unsicherheitenbeim Transfer des Wissens. Den IPA-Auszubildenden gelang zwar allgemein eineIntegration von Wissen in die Praxis, Probleme zeigten sich allerdings beim Wissenstransferaus Lernsituationen im Unterricht auf neue Situationen in der Pflegepraxis.• Das Transferlernen wurde durch die Ausbildungskonzeption gezielt unterstützt.So konnten als transferförderliche Faktoren im Modellprojekt die Methodenvielfaltder Lehr-/ Lernarrangements, die Begleitung und Reflexion praktischer Übungsphasen,die Ausbildungsinstrumente und eine gezielte Praxisanleitung identifiziertwerden.• Hinderlich auf das Transferlernen wirkten sich die unzureichende Abstimmungvon Lernsituation und Praxiseinsätzen, das hohe sprachliche Niveau der Ausbildungsinstrumente(welches z. T. zu Verständnisschwierigkeiten in der Praxisführte) und unzureichende Rahmenbedingungen (Zeit-, Personaldefizit, Qualifikationsbedarf)aus.• Zur Unterstützung des Erwerbs von Transferkompetenzen sollte im Revisionsprozesseine dezidierte Abstimmung der Abfolge von Lernsituationen mit der Praxiserfolgen und die Verständlichkeit der Praxisinstrumente kritisch überprüft werden.Ferner bedarf es eines verstärkten Einbeziehens und Qualifizierens der Praxisanleiter/innenüber Bedarfserfassung und daran ausgerichteten Fortbildungsangeboten.Darüber hinaus könnten Handlungsunsicherheiten der Auszubildendendurch eine Weiterentwicklung der Transferinstrumente (z. B. Einrichtungen vonLernwerkstätten, Skills Labs) abgebaut werden. Es gilt, den Transfergedanken inden Pflegealltag und in die Schule bewusst zu integrieren.• Nicht bewährt hat sich die anfängliche starre Anordnung von gemeinsamen integrativenAusbildungsanteilen (zwei Jahre) und differenzierender Schwerpunktbildung(ab dem 3. Ausbildungsjahr). Die Vielschichtigkeit bzw. Komplexität despflegerischen Handlungsfelds erfordert eine Differenzierung zu einem früherenZeitpunkt. So sind relevante Schwerpunkte genau zu definieren (auch unabhängigder drei Lebensphasen), um Aufschlüsse über die zeitliche und inhaltlicheAusgestaltung der Differenzierungsangebote zu erhalten.109
5.4 Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-TransferGemäß ihrem Ausbildungsprinzip „Theorie-Praxis-Vernetzung“ verfolgte die „<strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ das Ziel, durch gezielte und systematischeKooperation zwischen Schule und Praxisfeld den Auszubildenden eine Brückezwischen Theorie und Praxis zu schlagen (vgl. Broschüre der Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH). Die zu diesem Zweck eingegangenen Lernortkooperationen imRahmen des Ausbildungsmodells zeigten positive Auswirkungen auf den Theorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfer sowie auf die Entwicklung beruflicher Handlungskompetenz:• Die Trägervielfalt im Kooperationsverbund wurde als Bereicherung erlebt, die dasKennen lernen verschiedener pflegerischer Institutionen und Handlungsfelder zuließund zugleich die Entwicklung von Reflexionsfähigkeit, Flexibilität und professionellerAnpassungsfähigkeit unterstützte.• Unter Voraussetzung einer regelmäßigen Teilnahme bewährten sich die von denProjektbeteiligten initiierten Praxiskonferenzen als Instrument zur Förderung desTheorie-Praxis- bzw. Praxis-Theorie-Transfers sowie zur fachlichen und persönlichenWeiterentwicklung der Praxisanleiter/innen.• Gleichermaßen erleichterten die entwickelten Praxisinstrumente (z. B. das Blockhandbuch)den Praxisanleiter/innen das Anknüpfen an die am Lernort Schulevermittelten Lerninhalte und gewährleisteten die Vorbereitung und Durchführungeiner gut strukturierten und effektiven Anleitung am Lernort Pflegepraxis.• Synergieeffekte in der Pflegepraxis zeigten sich an Veränderungen in Bezug aufdie Durchführung der Praxisanleitung und einem neuen Verständnis von Anleitung.Die Auszubildenden der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> gaben Denkanstößefür die Praktiker/innen und regten eine kritische Reflexion starrer Handlungsabläufean. Damit fungierten sie als aktive Wissensvermittler in den Einrichtungenund trieben den Transfer pflegewissenschaftlich fundierter Innovationen in diePraxis voran.• Am Lernort Schule vollzog sich als Folge der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> einWandel der Lehrerrolle (vom Wissensvermittler zum Lernbegleiter und –berater).Des Weiteren bescheinigten die Projektbeteiligten dem Ausbildungsmodell aufgrundseiner Kompetenzorientierung Potenzial für eine Steigerung der Ausbildungsqualität.• Den oben beschriebenen positiven Auswirkungen der Lernortkooperationen standenSchwierigkeiten beim Gewinn praktischer Handlungssicherheit entgegen, dieaus den häufigen Lernortswechseln resultierten. Diese Handlungsroutine gilt es,mithilfe zusätzlicher pflegepraktischer Übungsangebote an den Lernorten Schuleund Pflegepraxis gezielt auszubilden.• Um Informationsdefiziten am Lernort Pflegepraxis vorzubeugen und damit denAuszubildenden eine effektive Unterstützung zu garantieren, muss eine regelmäßigeTeilnahme der Anleiter/innen an den Praxiskonferenzen sichergestellt werden.Hier bietet sich die Möglichkeit, die Praxisanleiter/innen beispielsweise durcheine Anerkennung der Konferenzen als Fortbildungsveranstaltung zusätzlich zur110
Teilnahme zu motivieren und damit einen kontinuierlichen Dialog zwischen denkooperierenden Einrichtungen zu fördern.• Die anspruchsvolle Sprache der Praxisinstrumente verursachte Unsicherheitenund Schwierigkeiten bei der Beurteilung der Kompetenzen der Auszubildenden.Um dieser Problematik zu begegnen, empfiehlt sich eine Fortführung der Informations-und Anleitungsarbeit im Rahmen der Praxiskonferenzen und darüber hinausin den kooperierenden Einrichtungen.5.5 Akzeptanz und VerbreitungDie Ziele des Stuttgarter Modells, die u. a. in der Vorbereitung auf gesellschaftlichnotwendige und politisch geforderte Aufgaben und Handlungsfelder der Pflege sowiein einer Steigerung der Attraktivität des Berufsfeldes Pflege lagen, können als erreichtangesehen werden:• Das Modellprojekt erzielte bereits frühzeitig eine hohe bundesweite Bekanntheitund Akzeptanz, sowohl auf der politischen als auch auf Träger- und Einrichtungsebene.• Bewährt hat sich die Konzeption der zwei gleichwertigen Berufsabschlüsse, die ineinem Ausbildungszeitraum von 3½ Jahren erlangt werden können, wenn aucheine leichte Tendenz bestand, die Ausbildung auf vier Jahre zu verlängern.• Von der Möglichkeit, ein Zertifikat zu erwerben, welches den Absolventen/innenein Grundlagenwissen und -können für die Prozess- und Fallsteuerung in derPflege bescheinigt, machten die Auszubildenden keinen Gebrauch. Begründetwurde dies mit den vermuteten höheren Arbeitsmarktchancen durch den zweitenBerufsabschluss.• Die von der Kerngruppe Curriculum veranstalteten Workshops bzw. Inhouse-Schulungen für Lehrkräfte an Pflegeschulen trugen maßgeblich dazu bei, dassModellanteile (z. B. Lernfelder, Lernsituationen, Prinzip der Vielfalt der Praxiseinsatzorte,Praxisaufträge) erfolgreich in den Regelbetrieb übertragen wurden.• Das Modell leistete durch seine hohe Professionalisierungstendenz einen Beitragzur Weiterentwicklung und Attraktivitätssteigerung der Pflegeberufe. Die integrativeAusrichtung gewährleistete zudem eine hohe Flexibilität für ein breitesEinsatzspektrum in aktuellen und neuen Handlungsfeldern der Pflege, wenngleichentsprechende Stellen zukünftiger Handlungsfelder von den Befragten noch nichterkannt wurden.• Ferner trug das Modell insbesondere durch seinen pflegeberuflichen und pädagogischenBegründungsrahmen und den Theorie-Praxis-Transfer zur Qualitätssteigerungder <strong>Pflegeausbildung</strong> bei: Qualitätsmerkmale konnten identifiziert undkontinuierliche Qualitätsentwicklungsprozesse etabliert werden.111
6.Resümee: Bedeutsamkeit des Modells für dieWeiterentwicklung der PflegeberufeVor dem Hintergrund der gewonnenen Erkenntnisse aus der Evaluation des Modellprojekts„<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ lässt sich abschließendeine Einschätzung zur Bedeutsamkeit der Ausbildungskonzeption auf berufspolitischer,berufspädagogischer sowie pflegepraktischer und arbeitsmarktpolitischerEbene vornehmen und ihre Tragweite damit in einen größeren Kontext stellen, derbei weiteren ausbildungs- und professionsrelevante Entscheidungen des GesetzgebersBeachtung finden wird.6.1 Bedeutsamkeit des Modells: Berufspolitische EbeneSteigender Qualifizierungsbedarf für Lehrende/Praxisanleiter/innenDas Modellprojekt zeigt angesichts der im Begründungsrahmen eindrucksvoll dargelegtenhohen Anforderungen an die Gesundheits- und Pflegeberufe deutlich die dringendeNotwendigkeit eines damit einhergehend erhöhten Qualifizierungsbedarfs deran der <strong>Pflegeausbildung</strong> beteiligten Lehrenden und Praxisanleiter/innen auf. Seitensdes Gesetzgebers wurde dem bereits durch die Anhebung der Lehrerqualifikation aufHochschulniveau sowie die gesetzliche Vorgabe einer berufspädagogisch geschultenPflegekraft (Zusatzqualifikation von mindestens 200 Stunden) am Lernort Pflegepraxisim Rahmen der Novellierung des Krankenpflegegesetzes Rechung getragen. DasProjekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ hat dies in konsequenterWeise umgesetzt und damit auch erheblich zur Attraktivitätssteigerung desBerufes beigetragen, denn für zukünftige Lehrende und Lernende wird das Niveauder Ausbildung ein wesentliches Qualitätsmerkmal sein, das bei der Berufswahl nichtunerheblich zur Entscheidungsfindung beitragen dürfte.Konzeptionelle Grundlage für eine gestufte <strong>Pflegeausbildung</strong> bzw. Übergang intertiären Bildungsbereich: vertikale DurchlässigkeitDas Projekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ bietet eine geeignetekonzeptionelle Grundlage für eine gestufte <strong>Pflegeausbildung</strong> wie sie in demAusbildungsmodell (2 bzw. 4 Jahre) der Denkschrift „Pflege neu denken“ der RobertBosch Stiftung skizziert wird. Denn einerseits wird deutlich, dass die traditionelle dreijährigeAusbildung in vielen Belangen der gestiegenen Komplexität der Anforderungennicht mehr gewachsen ist und eine qualifizierte Ausbildung auf höherem Niveauund damit eine längere Ausbildungszeit unumgänglich sind. Andererseits wird aberauch deutlich, dass es nicht nur eine Flexibilität hin zu höheren Ausbildungslevels mitlängerer Ausbildungsdauer, sondern auch zu Qualifikationslevels geben muss, diedarunter liegen. Zur Gewährleistung eines Übergangs in den tertiären Bildungsbereichund einer damit verknüpften vertikalen Durchlässigkeit bedarf es darüber hinausder Möglichkeit zur Erlangung der Fachhochschulreife im Rahmen der Ausbildung.Damit wird der Entwicklung Rechnung getragen, dass zukünftig viele Spezialisierungenund Weiterbildungen in der Pflege an Hochschulen angesiedelt werdensollen, wie es beispielsweise vom Deutschen Bildungsrat für Pflegeberufe (2007) gefordertwird, um eine Vergleichbarkeit europäischer Qualifikationen sicherzustellen.112
Ankerpunkt für modellhafte Exzellenz: Kompetenzzentren als „Leuchttürme“Die Zukunft der <strong>Pflegeausbildung</strong> und die notwendige Qualitätsentwicklung in derPraxis fordern zukunftsträchtige Konzepte, die dazu in der Lage sind, Potenziale vonAusbildung, Versorgungseinrichtungen und Wissenschaft zu bündeln, ihre Synergienzu optimieren und daraus entstehende Produkte zu vermarkten. Von seinen Ansätzenher bietet das Projekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ alleVoraussetzungen zur Weiterentwicklung in Richtung eines regionalen Kompetenzzentrumsmit überregionalem „Leuchtturm“-charakter. Als regionale „Kompetenz- undEntwicklungsschmiede“ bündelt es in einem Netzwerk die multidisziplinären Kompetenzenaus Ausbildungseinrichtungen, Versorgungseinrichtungen und Wissenschaftzugunsten einer Zugänglichkeit und nachhaltigen Effizienz des Wissenstransfers inSachen Pflege. Ausgehend von dem Grundsatz „Optimierung nach innen und Vermarktungnach außen“ verfolgt ein solches Kompetenzzentrum durchaus auch unternehmerischeIdeen. Es fokussiert auf zukunftsträchtige Themen wie Pflege undTechnik, Wissenstransfer, Pflegeforschung, Schnittstellen-/Qualitätsmanagementund Organisationsentwicklung mit folgenden Intentionen:• Optimierung systematischer, patientenorientierter Informations-, Kommunikations-und Kooperationsstrukturen für eine nachhaltige, interdisziplinäre Zusammenarbeit,• Förderung innovativer, praxis- und bedarfsorientierter Weiterentwicklungen inPflegepraxis u. -wissenschaft, Gesundheitswirtschaft und -technologie zurSteigerung der Versorgungsqualität,• Optimierung innovativer, nutzerorientierter Produktentwicklung,• interdisziplinäre, institutionsübergreifende Generierung innovativer Ideen, u. a.durch die Zusammenarbeit mit „lead users“, die Bedarfe erheblich früher artikulierenals durchschnittliche Anwender,• innovative Entwicklung marktfähiger Produkte, bedarfsgerechter Versorgungsleistungenund Optimierung von Ausbildungs- und Arbeitsprozessen,• Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette von der Idee, Forschung biszur Entwicklung, Produktion, Erprobung und Vermarktung neuer Technologien,Verfahren und Dienstleistungen in der Pflege.Die gemeinsame Initiierung, Planung, Durchführung und Evaluierung von Projektenmultiprofessioneller Akteure, die gegenseitige Ergänzung von Potenzialen und einschnellerer Wissenstransfer tragen mit richtungs- und zukunftsweisenden Innovationenzu einer Leistungsoptimierung der <strong>Pflegeausbildung</strong>, -praxis und -wissenschaftbei und bieten innovative Lösungen.6.2 Bedeutsamkeit des Modells: Berufspädagogische EbeneBestätigung der <strong>Integrative</strong>n Ausbildung und Notwendigkeit neuer Schnittmengenzwischen den Gesundheits- und Pflegeberufen: statt Orientierung anLebensphasen – QuerschnittsaufgabenDie Notwendigkeit neuer gemeinsamer Schnittmengen zwischen den GesundheitsundPflegeberufen wird eindrucksvoll durch das Projekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>:Das Stuttgarter Modell © “ mit seiner integrativen Ausrichtung bestätigt. „Es istüberholt, die Ausbildung an den Lebensphasen der Menschen auszurichten (Kran-113
ken-, Kinderkranken-, Altenpflege)“ (Robert Bosch Stiftung 2000: 20). Denn zentralsind Phänomene der Pflege, Pflegekonzepte und der Einbezug des Menschen alsIndividuum mit seinen sozialen Bezügen. Hier wird vor allem der Beratung und Informationein bedeutsamer Stellenwert zukommen. Die Empfehlungen der „Zukunftswerkstattzur Verbesserung der <strong>Pflegeausbildung</strong>“ sehen u. a. vor, dass diedrei grundständigen <strong>Pflegeausbildung</strong>en zu einer gemeinsamen <strong>Pflegeausbildung</strong>zusammengefasst und ein Ausbildungsabschluss mit Schwerpunktsetzung ermöglichtwird (vgl. ebd.: 4).Beratung als Bestandteil beruflicher Handlungskompetenz Pflegender wird sich wesentlichauf der Mikroebene an Patienten/innen, Klienten/innen, Bewohner/innen undAngehörige direkt richten. Es wird erwartet, dass der Bedarf an allgemeiner und speziellerGesundheits- und Pflegeberatung steigt. Ein Tätigkeitsfeld für Pflegende kannsich beispielsweise in der Wohnraum- oder Ernährungsberatung auftun sowie in derPräventions- und Rehabilitationsberatung. Pflegerisches Potenzial wird auch beiFragen der Hilfsmittelversorgung und -organisation im häuslichen Umfeld gesehen.Die Möglichkeiten einer institutionsunabhängigen Beratungstätigkeit, oder auch derGutachtertätigkeit, bieten Pflegenden darüber hinaus die Chance, nachhaltig Rechteund Autonomie des Einzelnen im Gesundheitswesen zu stärken.Inhalte der organisations- und institutionsbezogenen vollprofessionellen Beratungwerden deutlicher als bisher Fragen der Pflegeüberleitung an der Schnittstelle stationär/ambulantbetreffen. Neue Trendentwicklungen werden darauf abzielen, Pflegendestärker als bisher in multiprofessionelle Teams des Gesundheitsdienstleistungssektorszu integrieren.Klärungsbedarf im Verhältnis Integrationsanteil und Schwerpunktsetzung: Generalistenvs. SpezialistenDie Evaluationsergebnisse zeigen einen noch ausstehenden Klärungsbedarf bezüglichdes Verhältnisses zwischen Integrationsanteil und Schwerpunktsetzung auf (Generalistenversus Spezialisten). Eine zu starre Trennung gemeinsamer und differenzierterAnteile hat sich zur Bewältigung spezieller pflegerischer Aufgaben in unterschiedlichenSettings nicht bewährt.Fächerintegrativer, kompetenz- und lernfeldorientierter Unterricht: Katalysatorfür den sicheren Umgang mit komplexen Pflegesituationen und OrganisationsgestaltungDie im Projekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ fächerintegrativeund kompetenzorientierte Ausrichtung der Lehr-Lernarrangements sowie derenUmsetzung in Form selbstorganisierter Lernprozesse im Rahmen des StuttgarterModells erweisen sich als Katalysator für die berufliche Handlungsfähigkeit in komplexenPflegesituationen bzw. waren Voraussetzung dafür, dass diese Komplexitätüberhaupt erst erkannt, reflektiert und ergebnisorientiert bewältigt werden konnte.Lernortkooperationen als Garant für nachhaltigen Theorie- Praxis-Transfer:Bedarf an Weiterentwicklung geeigneter InstrumenteDie Vielzahl der bestehenden Lernortkooperationen im Ausbildungsmodell gewährleisteteeinen nachhaltigen Theorie-Praxis-Transfer. Es besteht indes grundsätzlicher114
Bedarf an der Weiterentwicklung und modellhaften Erprobung geeigneter Instrumente,um diesen nachhaltig zu fördern (z. B. Lernwerkstätten, Anleiter/innenkonzepte).Das Projekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ ist hierzu eineausgezeichnete Plattform.Notwendigkeit und Bewährung wissenschaftlich fundierter Basis der Ausbildung:evidenzbasiertes Pflegehandeln, Risikomanagement und SteuerungsfähigkeitDie pflegetheoretisch und -pädagogisch begründete Ausbildungskonzeption im Projekt„<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ hat sich aus Sicht derEvaluation äußerst bewährt. Eine wissenschaftlich fundierte Basis, wie sie hier entwickeltwurde, bildet die Voraussetzung für die Ausübung evidenzbasierter pflegerischerHandlungen sowie für eine systematische Organisationsgestaltung, Pflegecontrollingund Risikomanagement.Diesbezüglich befördern die notwendigen Veränderungen und neuen Anforderungenim Gesundheitswesen in einem hohen Maße die Diskussion um den Einsatz effektiverund effizienter Steuerungsinstrumente und zwar in Bezug auf betriebsinterne Abläufe,aber auch hinsichtlich des Schnittstellenmanagements und der Steuerung imöffentlichen Raum.Derzeit sind im Gesundheitssektor erste Ansätze sichtbar, die darauf abzielen, durchumfangreiches Qualitätsmanagement und neue Steuerungsinstrumente die notwendigeModernisierung und Innovationsfähigkeit in diesem Bereich zu entwickeln, umstrukturinnovative Neuorientierungen zu intendieren und zu implementieren. Um dieerwünschten Leistungen erstellen zu können, benötigt die Pflegepraxis allerdingsausreichende Handlungsspielräume.6.3 Bedeutsamkeit des Modells: Pflegepraktische undarbeitsmarktpolitische EbeneBeitrag zum Paradigmenwechsel hin zur Ressourcen- und Personenorientierung:Autonomie- und SelbstständigkeitsförderungDas Projekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ leistet mit seinerpflegetheoretisch fundierten Konzeption und deren Umsetzung einen Beitrag zumParadigmenwechsel weg von Defizit- und Verrichtungsorientierung hin zu einer Ressourcen-und Personenorientierung im Sinne von Autonomie- und Selbstständigkeitsförderungvon Patienten und Heimbewohnern und zukünftigen potenziellen Pflegeempfängern,die sich nicht nur aus den klassischen Versorgungssettings rekrutierenlassen werden und damit Zielgruppen und Aufgabenspektrum erheblich erweitern.Höheres Spektrum an innovativen Aufgabenzuschnitten und Einsatzmöglichkeitenin neuen Handlungsfeldern: Gesundheitsförderung, Prävention und RehabilitationDas mit dem Ausbildungsmodell erworbene Kompetenzprofil ermöglicht den Einsatzüber kurative Handlungsfelder hinaus in gesundheitsfördernden, präventiven, rehabilitativenund palliativen Bereichen. Bedarfe werden besonders auf kommunaler, betrieblicherund familiärer Ebene erwartet.115
Damit trägt das Projekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ zurWeiterentwicklung innovativer Aufgabenzuschnitte und zukünftig neuen Verantwortungsbereichenin den Pflegeberufen bei, die bis in den Public Health nahen Bereichenragen und zu ganz neuen Pflegearrangements und Zielgruppen führen werden.Denn: Gegenwärtige und zukünftige Bedarfskonstellationen pflegebedürftiger Menschenund Entwicklungsdynamiken in der pflegerischen und gesundheitlichen Versorgungführen zu veränderten Versorgungsbedarfen und neuen Anforderungen andie Pflege. Die These ist, dass sich zukünftig eine Vielzahl innovativer Potenzialeund neuer Handlungsfelder und damit auch neuer Dienstleistungen seitens der Pflegeentwickeln werden, die an der Schnittstelle von Pflege und Public Health anzusiedelnsind, um den unterschiedlichen Bedarfen von pflegerisch und gesundheitlich relevantenTeilpopulationen gerecht zu werden.Förderung intersektoraler und interdisziplinärer Arbeitszusammenhänge:Teamfähigkeit und SchnittstellenmanagementDie intensive Förderung der interaktiven und organisations-/systembezogenen Kompetenzinnerhalb des Projekts „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “bildet eine geeignete Basis für die Initiierung und Organisation interdisziplinärer Arbeitszusammenhängeim Rahmen des Schnittstellenmanagements, begründet durchdie neuen Einsatzfelder der Pflege, wie beispielsweise der Beratung und Steuerungvon Gesundheitsdienstleistungen.Angesichts einer angestrebten integrierten Gesundheitsversorgung werden Pflegendewesentlich häufiger in die Rolle der steuernden und koordinierenden Professiongeraten.Vorbereitung auf steigende Anforderungen des Pflegearbeitsmarktes und diehohe Dynamik im Gesundheitswesen: KonkurrenzfähigkeitMit der gezielten Förderung von Flexibilität angesichts der durch die Trägervielfalt imKooperationsverbund bedingte Vielfalt von Ausbildungsszenarien reagiert das Projekt„<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ auf die der hohen Dynamikim Gesundheitswesen geschuldeten steigenden Anforderungen des Pflegearbeitsmarktes.In der Erweiterung des Aufgabenspektrums wird ein starkes Potenzial für den Zuwachsan Berufsautonomie und Verselbstständigung im Dienstleistungs- und Beratungssektorsowie eine fortschreitende Professionalisierung gesehen. Es ergibt sichjedoch ein kritisches Bild hinsichtlich der Möglichkeiten einer Loslösung von traditionellenAufgabenfeldern der Pflege hin zu neuen Aufgaben. Einerseits wird der Bedarfgesehen und andererseits gibt es Barrieren in der Berufsgruppe selbst, aber auch imgesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Umfeld.Potenzial zur Steigerung der Berufsattraktivität und Professionalisierung derPflegeberufe: hohes Ausbildungslevel und internationale StandardsDie Doppelqualifikation (zwei Berufsabschlüsse) trägt wesentlich zur Konkurrenzfähigkeitder Absolventen/innen bzw. zur Steigerung der Berufsattraktivität und Professionalisierungder Pflegeberufe bei. Damit erreicht das Stuttgarter Modell ein hohesAusbildungslevel, welches internationalen Standards gleichkommt. Dies ist dringendnotwendig, denn der bisher eher gering ausgeprägte Professionalisierungsgrad der116
Pflegeberufe wird im internationalen Vergleich zzt. als hemmend für die Entwicklungneuer Aufgabenbereiche beurteilt. Dieses betrifft sowohl traditionelle als auch übergreifendeTätigkeiten. Nicht nur der gering ausgeprägte Professionalisierungsgradder Pflegeberufe wird diesbezüglich als Hemmnis angesehen, sondern auch dasFehlen einer "qualifizierten Ausbildung mit Vorbehaltsaufgaben" ist dabei deutlich alsHauptursache hervorzuheben.Der Akademisierung und der Ausblick auf einen Paradigmenwechsel innerhalb derPflegeberufe von der Krankheitsorientierung hin zur Gesunderhaltung werden hoheChancen eingeräumt, Professionalisierung nachhaltig zu unterstützen.6.4 Prospektiver AusblickMit dem 2. Symposium „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © “ unterdem Titel „Pflegeexpertise kompetenzorientiert ausbilden“ am 10. November <strong>2006</strong> inStuttgart wurde der erste <strong>Modellkurs</strong> erfolgreich abgeschlossen. Das Symposiumkann als ein gelungener Austausch zwischen Projektbeteiligten, Praktiker/innen derLernorte Schule und Pflegepraxis sowie Fachexperten/innen gewertet werden undbot eine aktuelle Diskussionsgrundlage über den Beitrag des Stuttgarter Modells fürdie Weiterentwicklung der <strong>Pflegeausbildung</strong>.Im Rahmen dieser Veranstaltung schilderten die Projektbeteiligten u. a. ihren durchdie interne und externe Evaluation angestoßenen intensiven Revisionsprozess. Derim April 2005 gestartete zweite <strong>Modellkurs</strong> der <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong> profitiertbereits jetzt von den Neuerungen innerhalb der Ausbildungskonzeption.Schon jetzt steht seitens der Modellschule am Robert-Bosch-Krankenhaus und denKooperationspartnern/innen jedoch fest, das Projekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>:Das Stuttgarter Modell © “ in den Regelbetrieb zu überführen. Ein neuer integrativerAusbildungskurs startet am 01. Oktober 2007.117
LiteraturverzeichnisBGBI. (Bundesgesetzblatt) I (2003a): Gesetz über die Berufe in der Krankenpflegeund zur Änderung weiterer Gesetze (KrPflG) v. 21.07.2003, S. 1442-1458.BGBI. (Bundesgesetzblatt) I (2003b): Gesetz über den Beruf in der Altenpflege(AltPflG) v.24.11.2000, geändert in der Fassung v. 25.08.2003, S. 1690-1696.BGBI. (Bundesgesetzblatt) I (2003c): Ausbildungs- und Prüfungsverordnung für dieBerufe in der Krankenpflege – KrPflAPrV, v.19.11.2003, S. 2263-2273.Bleses, H. (1997): Entwicklung und Erprobung eines ganzheitlichen Pflegesystems.In: Büssing, A. (1997): Von der funktionalen zur ganzheitlichen Pflege. Reorganisationvon Dienstleistungsprozessen im Krankenhaus. Göttingen: Verlagfür angewandte Psychologie.Bortz, J.; Döring, N. (2003): Forschungsmethoden und Evaluation für Human- undSozialwissenschaftler. Berlin; Heidelberg; New York: Springer.Burnard, P. (1991): A method of analysing interview transcripts in qualitativeresearch. Nurse Education Today, 11/2001, S. 461-466.Darmann, I.; Muths, S. (2005): <strong>Pflegeausbildung</strong> im Umbruch – Modellprojekte unddie Entwicklung neuer Curricula. Dr. med. Mabuse, Sept./Okt. 2005, S. 29-32.Deutscher Bildungsrat für Pflegeberufe (Hrsg.) (2007): Pflegebildung offensiv:Das Bildungskonzept des Deutschen Bildungsrates für Pflegeberufe <strong>2006</strong>,Urban & Fischer.Görres, S.; Bohns, S.; Krippner, A.; Stöver, M. (<strong>2002</strong>): Modellprojekt „<strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong> in Stuttgart". Bericht zu Workflow und Prozessrealisierungder "Kerngruppe Curriculum" in der Vorphase des Modellprojektes <strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong> in Stuttgart. April <strong>2002</strong>. Unveröffentlichter Bericht. Institutfür angewandte Pflegeforschung (iap), Universität Bremen.Görres, S.; Böhnke, U.; Stöver, M. & Keuchel, R. (2004): Modellprojekt „<strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © ". Abschließender Zwischenbericht.Unveröffentlichter Bericht. Institut für angewandte Pflegeforschung (iap),Universität Bremen.Görres, S.; Böckler, U. (2004): Innovative Potenziale und neue Märkte für zukünftigeDienstleistungen in der Pflege – Ergebnisse einer Delphistudie.Pflege, 2/2004, S. 105-112.Görres, S.; Bohns, S. (2004): Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: DasStuttgarter Modell © ". Kurzbericht zum Assessment Center. UnveröffentlichterBericht. Institut für angewandte Pflegeforschung (iap), Universität Bremen.Görres, S.; Hoffmann, W.; Terschüren, C. (2000): Entwicklung des Gesundheitssystemsbis zum Jahr 2020 – Trends und Einflussfaktoren – Expertenpapier118
im Auftrag der „Zukunftswerkstatt <strong>Pflegeausbildung</strong>“. Gefördert durch dieRobert Bosch Stiftung. Universität Bremen, Zentrum für Public HealthGörres, S.; Stöver, M.; Schmitt, S.; Geiß, J.; Stolle, C.; Bohns, S.; Dmitrieva, Z.(2005): Modellprojekt <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © .Evaluation der Hauptphase (3. Teil). Zeitraum: 01.01.2004 - 31.12.2004.Unveröffentlichter Bericht. Institut für angewandte Pflegeforschung (iap),Universität Bremen.Görres, S.; Stöver, M. (2005): Relevanz und Nutzen der Evaluation von Modellprojektenin der <strong>Pflegeausbildung</strong> – Die Evaluation des Modellprojektes „<strong>Integrative</strong><strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell ©“ als Beitrag zur Nachhaltigkeitund zum Transfer von Innovationen. In: Pflegemagazin 1/2005, S. 32-39.Görres, S.; Wicha, I. (2005): Modellprojekte vernetzen. In: Pflege aktuell 1/2005,S. 8-10.Hasseler, M. (2004): Gesellschaftliche Rahmenbedingungen und Veränderungen.In: Hasseler, M.; Meyer, M. (Hrsg.): Ambulante Pflege: neue Wege undKonzepte für die Zukunft. Professionalität erhöhen – Wettbewerbsvorteilesichern. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft. S. 23-30.Hasseler, M.; Görres, S. (2005): Was Pflegebedürftige wirklich brauchen.Zukünftige Herausforderungen an eine bedarfsgerechte ambulante undstationäre pflegerische Versorgung. Hannover: Schlütersche Verlagsgesellschaft.Heiner, M. (Hrsg.) (1998): Experimentierende Evaluation. Ansätze zur Entwicklunglernender Organisationen. Weinheim, München.Institut für Public Health und Pflegeforschung, Abt. Interdisziplinäre AlternsundPflegeforschung (iap) (<strong>2006</strong>): Unveröffentlichter Bericht zur Evaluationder praktischen Abschlussprüfungen im Modellprojekt „<strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>:Das Stuttgarter Modell © “. Universität Bremen.Kerngruppe Curriculum (2005): Unveröffentlichtes 59. Protokoll der KerngruppeCurriculumKerngruppe Curriculum (2005): Unveröffentlichtes 62. Protokoll der KerngruppeCurriculumKerngruppe Curriculum (<strong>2006</strong>) (Hrsg.): Pflegeberuflicher und pädagogischerBegründungsrahmen. <strong>Integrative</strong> <strong>Pflegeausbildung</strong>: Das Stuttgarter Modell © .Braunschweig: Winklers.Kohli, M. et al. (2000): Generationenbeziehungen. In: Kohli, M.; Künemund, H.(Hrsg.): Die zweite Lebenshälfte. Gesellschaftliche Lage und Partizipation imSpiegel des Alterssurvey. Opladen: Leske + Budrich. S. 176-207.Lamnek, S. (1998): Gruppendiskussion. Theorie und Praxis. Weinheim: Beltz,Psychologie-Verl.-Union.119
Landenberger, M. (1998): Innovatoren des Gesundheitssystems. Bern; Göttingen;Toronto; Seattle: Huber.Mayring, P. (2000): Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken. 7.Aufl. Weinheim: Beltz.Mischo-Kelling, M. & Wittneben, K. (1995): Pflegebildung und Pflegetheorien.München; Wien; Baltimore: Urban und Schwarzenberg.Robert-Bosch-Krankenhaus GmbH (o. A.): Neue integrative <strong>Pflegeausbildung</strong> –Qualifiziert für die Zukunft. Informationsbroschüre zur <strong>Integrative</strong>n <strong>Pflegeausbildung</strong>.http://www.integrative-pflegeausbildung.de/ (21.02.2007)Robert Bosch Stiftung (Hrsg.) (2000): Pflege neu denken. Zur Zukunft der<strong>Pflegeausbildung</strong>. Stuttgart: Schattauer.Rossi, P. H.; Freeman, H. E.; Hofmann, G. (1988): Programm-Evaluation:Einführung in die Methoden angewandter Sozialforschung. Stuttgart: Enke.Sachverständigenrat für die Konzertierte Aktion im Gesundheitswesen(2000/2001): Bedarfsgerechtigkeit und Wirtschaftlichkeit, Bd. III: Über-, Unter- undFehlversorgung. Deutscher Bundestag, 14/6871.Scheu, P. (2001): Vorstellung des Zukunftsmodells <strong>Pflegeausbildung</strong> „Pflege neudenken“ nach der Denkschrift der Robert Bosch Stiftung. Referat amFachbereich Gesundheitswesen der Ev. Fachhochschule Hannover imStudienbereich Pflegepädagogik.http://www.mutzumhandeln.de/pflegeneudenken.pdf (15.01.2007)Schnell, R.; Hill, P.; Esser, E. (1995): Methoden der empirischen Sozialforschung.München: Oldenbourg.Stöcker, G. (<strong>2002</strong>): Bildung und Pflege. Eine berufs- und bildungspolitischeStandortbestimmung. Hannover: Schlütersche.Renteln-Kruse, W. v. (2001): Epidemiologische Aspekte der Morbidität im Alter.In: Zeitschrift für Gerontologie und Geriatrie 34: Suppl. I.: S. 10-15.Vosseler, B. (<strong>2006</strong>): Krankenschwester ade – das neue Gesicht der Pflege. In:PrInterNet 11/06, S. 596-605.Weidner, F. (1995): Professionelle Pflegepraxis und Gesundheitsförderung: eineempirische Untersuchung über Voraussetzungen und Perspektiven desberuflichen Handelns in der Krankenpflege. Frankfurt am Main: Mabuse.Wittneben, K. (1993): Patientenorientierte Theorieentwicklung als Basis einerPflegedidaktik. In: Pflege. Band 6, Heft 3, S. 203-209.Zimber, A.; Teufel, S. (1999): Wie gut bin ich eigentlich? In: Altenpflege, 10/1999,S. 45-48.120