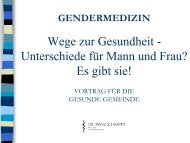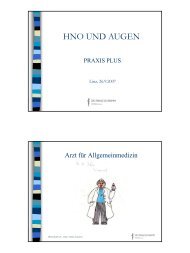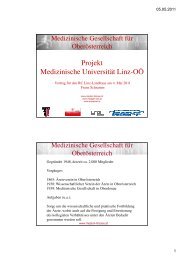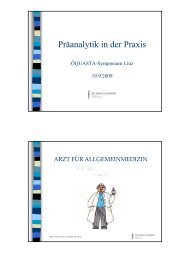Alkoholkrankheiten
Alkoholkrankheiten
Alkoholkrankheiten
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Praxis plus<br />
<strong>Alkoholkrankheiten</strong>
Arzt für Allgemeinmedizin<br />
Lehrbeauftragter an der Medizinischen Universität Wien<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
www.schramm.at
� Epidemiologie und Diagnose<br />
� Intervention<br />
� Therapieziele<br />
� Ambulanter Entzug<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
VERWENDETE LITERATUR<br />
� R. Room et al.: Alcohol and public health<br />
The Lancet Vol 365 February 5, 2005.<br />
� G. Kruse et al.: Alkoholabhängigkeit erkennen und behandeln<br />
Psychiatrie-Verlag 2001<br />
� G.Fischer: Warum Frauen gesünder leben und Männer früher<br />
sterben Verlagshaus der Ärzte 2005<br />
� Wissenschaftliche Grundlagen zum Programm der Österreichischen<br />
Vorsogeuntersuchung, Mai 2005<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
� Epidemiologie und Diagnose<br />
� Intervention<br />
� Therapieziele<br />
� Ambulanter Entzug<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
� Bei nur 60 Prozent der Bevölkerung gilt der Alkoholkonsum als<br />
unbedenklich<br />
� 5 Prozent sind alkoholkrank (66.000 Frauen, 264.000 Männer)<br />
� 13,3 Prozent sind alkoholgefährdet aber nicht abhängig<br />
� Alkoholiker verlieren 17 Lebensjahre, Alkoholikerinnen 20<br />
� Jeder dritte 11- bis 15-jährige trinkt regelmäßig Alkohol<br />
� 8.000 Menschen sterben in Österreich jährlich an den Folgen ihres<br />
Alkoholkonsums<br />
� 6,8 % der Gesundheitsausgaben werden durch Alkohol verursacht<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
ALKOHOL IN ZAHLEN
� 20 % der Verkehrsunfälle sind alkoholbedingt<br />
� 30 % der Ösophaguskarzinome sind alkoholbedingt<br />
� 7 % der Mammakarzinome sind alkoholbedingt<br />
� 26 % der Suizide erfolgen unter Alkoholeinwirkung<br />
� 18 % der hämorrhagischen Insulte sind alkoholbedingt<br />
� 18 % der epileptischen Anfälle sind alkoholbedingt<br />
� Aber: 70 % der Alkoholkranken kommen mindestens einmal<br />
jährlich in die Arztpraxis<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
ALKOHOL IN ZAHLEN
ALKOHOL UND GESELLSCHAFT<br />
� Eine Theorie, welche alle Phänomene der <strong>Alkoholkrankheiten</strong><br />
bündelt ist nicht in Sicht.<br />
� Ein Trost (?): In der Bibel gibt es 25 positiv besetzte Aussagen zum<br />
Thema Alkohol und 31 negative.<br />
� Praktisch kann man sich an den Faktoren orientieren, welche einen<br />
hohen Konsum begünstigen.<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
ALKOHOL UND GESELLSCHAFT<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
GENDERASPEKTE: MÄNNER<br />
� nach außen gerichtete Verhaltensweisen überwiegen (explosives<br />
Verhalten, verbale Verrohung, Verlust von sozial adäquatem Verhalten)<br />
� Verpflichtungen werden vernachlässigt<br />
� Großer Gruppendruck<br />
� Gesellschaftstrinker<br />
� Andere werden für das eigene Nicht-Handeln verantwortlich gemacht<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
GENDERASPEKTE: FRAUEN<br />
� Nach innen bzw. gegen sich selbst gerichtete Verhaltensweisen<br />
überwiegen, häufig Störungen vom Borderline-Typ<br />
� Personen und Situationen werden idealisiert und nach dem ersten<br />
negativen Erlebnis dämonisiert<br />
� Unterentwickeltes Selbstwertgefühl<br />
� Neigen zu Partnerschaften mit substanzabhängigen Männern<br />
� Trinken eher heimlich, dadurch späte Diagnose<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
Problembewusstsein<br />
Gesellschaftliche<br />
Bedeutung<br />
Handlungsbedarf<br />
Bereitschaft für<br />
Entzug<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
GENDERASPEKTE<br />
Männer<br />
Alkoholassoziierte<br />
Probleme werden<br />
direkt mit Alkohol in<br />
Verbindung gebracht<br />
Werden lange nicht<br />
moralisch verurteilt<br />
Werden früher<br />
entdeckt und<br />
behandelt<br />
Früher. Motivation<br />
durch Arbeitsplatz,<br />
Familie und<br />
Gesetzeskonflikte<br />
Frauen<br />
Suchen Ursache für<br />
Probleme häufig in<br />
Depression und<br />
Angststörung<br />
Gesellschaftlich rasch<br />
geächtet<br />
Trinken oft heimlich.<br />
Erkennen erst im<br />
fortgeschrittenen<br />
Stadium<br />
Später. Motivation<br />
durch gesundheitliche<br />
Probleme und Beruf
Therapietreue<br />
Medikamentenwirkung<br />
Partner<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
GENDERASPEKTE<br />
besser<br />
Männer<br />
Gut untersucht<br />
Eine feste<br />
Beziehung wirkt<br />
psychisch und<br />
körperlich<br />
stabilisierend<br />
schlechter<br />
Frauen<br />
Wirkungen und<br />
Nebenwirkungen schlecht<br />
untersucht<br />
Häufig ist der Partner an der<br />
Entstehung des Problems<br />
mitbeteiligt und erschwert<br />
den Eintritt in die Therapie.<br />
Unverheiratete haben eine<br />
deutlich geringere<br />
Rückfallquote
ÄRZTE UND ABHÄNGIGKEIT<br />
� Das Abhängigkeitsrisiko ist um das 30 – 100-fache erhöht.<br />
� In den USA sind 90 Prozent der bedeutsamen Erkrankungen<br />
berufstätiger Ärzte Abhängigkeitserkrankungen.<br />
� „Pharmakologischer Optimismus“ und „Titanicsyndrom“ gelten als<br />
berufsspezifische begünstigende Faktoren.<br />
� Der Volksmund behauptet: „Alkoholiker ist man, wenn man mehr<br />
trinkt als sein behandelnder Arzt!“<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
ALKOHOLABHÄNGIGKEIT (ICD-10)<br />
� Der starke Wunsch oder Zwang Alkohol zu trinken.<br />
� Verminderte Kontrollfähigkeit des Konsums.<br />
� Ein charakteristisches Alkoholentzugssyndrom bzw. Alkoholkonsum<br />
zur Vermeidung oder Milderung von Entzugssyndromen.<br />
� Toleranzentwicklung.<br />
� Zunehmende Vernachlässigung anderer Interessen zugunsten des<br />
Substanzkonsums.<br />
� Anhaltender Substanzgebrauch trotz des Nachweises schädlicher<br />
körperlicher oder psychischer Folgen.<br />
DREI KRITERIEN MÜSSEN ERFÜLLT SEIN<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
ALKOHOLMISSBRAUCH (DSM-IV*)<br />
Fortgesetztes Trinken hat zu<br />
einer Gesundheitsschädigung oder<br />
einer psychischen Störung geführt<br />
� Schwerwiegende Beeinträchtigung bei der Arbeit, im Haushalt oder<br />
in der Schule.<br />
� Trinken in Situationen, die mit besonderen Gefahren verbunden sind.<br />
� Wiederholte Probleme mit Polizei oder Justiz.<br />
� Wiederholte soziale oder interpersonelle Probleme.<br />
* Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
Typ<br />
Alpha<br />
Beta<br />
Gamma<br />
Delta<br />
Epsilon<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
TYPEN NACH JELLINEK<br />
Beschreibung<br />
Stress- und Konflikttrinker<br />
Soziale Anlässe<br />
Kontrollverlust<br />
Spiegeltrinker<br />
„Quartalsäufer“<br />
Abhängigkeit<br />
physisch<br />
Soziokulurell<br />
psychisch, dann physisch<br />
starke physische<br />
psychisch<br />
WEDER FÜR DIE PROGNOSE NOCH FÜR DIE THERAPIE<br />
VON WESENTLICHER BEDEUTUNG!<br />
MEHRZAHL: „MISCHTYPEN“
� Wenig riskanter Konsum (BMA):<br />
168 g/Wo bzw. 112 g/Wo mit zwei abstinenten Tagen<br />
� Wenig riskanter Konsum (WHO):<br />
Männer 40 g/d, Frauen 20 g/d<br />
� Gefährdungsgrenze (The Plinius Maior Society):<br />
Männer 35 Drinks pro Woche, Frauen 21<br />
� Vermindertes KHK-Risiko:<br />
(R. Room et al.,The Lancet Vol 365 February 5, 2005):<br />
20 g/d (höheres Risiko als Abstinenzler bei über 70g/d)<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
„GRENZWERTE“<br />
ALSO:<br />
nicht Trinkmenge sondern<br />
Abhängigkeitsproblem eruieren!
CAGE KUZTEST<br />
1. Cut Down:<br />
„Haben Sie bisweilen das Gefühl, Sie sollten Ihren Alkoholkonsum<br />
verringern?“<br />
2. Angry:<br />
„Haben Sie sich darüber geärgert, dass jemand Sie wegen Ihres<br />
Trinkens kritisiert hat?“<br />
3. Guilty:<br />
„Fühlen Sie sich manchmal wegen Ihres Trinkens schlecht oder<br />
schuldig?“<br />
4. Eye-Opener:<br />
„Haben Sie morgens getrunken, um sich zu beruhigen oder einen<br />
Kater loszuwerden?“<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
AUDIT:<br />
Alcohol<br />
Use<br />
Disorders<br />
Identification<br />
Test<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
LABORPARAMETER UND ALKOHOL<br />
Messgröße<br />
Kohlenhydratdefizientes<br />
Transferrin<br />
(carbohydratedeficient<br />
transferrin)<br />
CDT<br />
Mittleres<br />
Erythrozytenvolumen<br />
MCV<br />
γ –Glutamyltransferase<br />
γ-GT<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
pathobiochemischer<br />
Mechanismus<br />
Aethanolinduzierte, reduzierte<br />
hepatische Clearance des CDT<br />
primär:<br />
Toxischer Ethanoleffekt<br />
sekundär:<br />
Folsäuremangel, Lebererkr.<br />
mikrosomale Induktion durch<br />
Ethanol<br />
Gesteigerte Synthese durch<br />
sekundäre Cholestase<br />
Partielle Membranschädigung<br />
und Enzymfreisetzung<br />
klinische Wertigkeit<br />
Sensitivität 92%, Spezifität<br />
97%, integraler Parameter der<br />
Alkoholkonsumption von<br />
>60g/die für mindestens 7 Tage,<br />
langsame Normalisierung bei<br />
Abstinenz (t 1/2 ca. 15 Tage)<br />
Sensitivität 65 %,<br />
Spezifität 90-95%,<br />
kein guter Screening-Parameter<br />
Sensitivität 55%,<br />
Spezifität 85%,<br />
geringe Korrelation zwischen γ-<br />
GT-Aktivität und Grad des<br />
Alkoholabusus
� Epidemiologie und Diagnose<br />
� Intervention<br />
� Therapieziele<br />
� Ambulanter Entzug<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
Eine 38-jährige normalgewichtige Bürokauffrau, verheiratet, zwei<br />
Kinder, kommt mit Magenbeschwerden. Nach einer eingehenden<br />
Anamnese und einer klinischen Untersuchung des Abdomens und der<br />
Lunge wird die Diagnose Gastritis gestellt.<br />
Die Patientin wird über die notwendigen Allgemeinmaßnahmen<br />
informiert. Diese beinhalten auch den Hinweis, dass mehr als ein Drink<br />
pro Tag gesundheitsschädigend ist und Alkohol zu einer Gastritis führen<br />
kann. Sie erhält ein Rezept für einen Protonenpumpenhemmer für zwei<br />
Wochen und wird aufgefordert, sich bei Nichtbesserung oder bei<br />
neuerlichem Auftreten der Beschwerden wieder zu melden.<br />
Nach acht Wochen kommt sie wegen eines grippalen Infekt in die<br />
Ordination. Auf Nachfrage gibt sie an, dass ihre Magenschmerzen einige<br />
Tage nach Therapieende wieder aufgetreten sind.<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
FALLBEISPIEL
CAGE KUZTEST<br />
1. Cut Down:<br />
„Haben Sie bisweilen das Gefühl, Sie sollten Ihren Alkoholkonsum<br />
verringern?“<br />
2. Angry:<br />
„Haben Sie sich darüber geärgert, dass jemand Sie wegen Ihres<br />
Trinkens kritisiert hat?“<br />
3. Guilty:<br />
„Fühlen Sie sich manchmal wegen Ihres Trinkens schlecht oder<br />
schuldig?“<br />
4. Eye-Opener:<br />
„Haben Sie morgens getrunken, um sich zu beruhigen oder einen<br />
Kater loszuwerden?“<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
MOTIVIERENDE GESPRÄCHSFÜHRUNG<br />
� Feedback – Befunde und Beobachtungen emotionslos und<br />
sachgerecht mitteilen (keine Spekulation über Motive)<br />
� Responsibility – Abklärung wer für welche Veränderungsschritte<br />
verantwortlich ist<br />
� Advice – fachliche Beratung über Strategien<br />
� Menu – möglichst breite Auswahl anbieten<br />
� Empathy – sich in die Gedanken- und Gefühlswelt des Patienten<br />
versetzen, „emotionales Mitdenken“<br />
� Selfefficiaty – fühlt sich selbst für die Umsetzung in der Lage<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
F R A M E S (nach Miller und Sanchez, 1993)
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
WAAGE MODELL<br />
„Ja, aber…“<br />
„Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust!“<br />
„Die eine will sich von der andren trennen!“
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
CO-ABHÄNGIGKEIT<br />
Alle Umgangsformen, mit denen andere Menschen einem<br />
Abhängigkeitskranken das Trinken leichter machen oder<br />
mit dem sie es für ihn notwendiger erscheinen lassen.<br />
- Konflikte werden bagetellisiert.<br />
PHASENHAFTER VERLAUF<br />
-Der Abhängige wird nach außen beschützt und beschirmt.<br />
- Es wird immer mehr Verantwortung übernommen, auch durch den<br />
Versuch, selbst die Trinkmenge zu kontrollieren.<br />
- Hoffnungen entstehen, werden enttäuscht – Schuldgefühle entstehen.<br />
- Verzweiflung schlägt in generelle Beschuldigungen um.<br />
- Trennungsgedanken werden erwogen.
CO-ABHÄNGIGKEIT – DIE 7 K´s<br />
� Kontrolle des Trinkens aufgeben.<br />
� Konferenz mit anderen Betroffenen.<br />
� Kenntnisse über Krankheit und Therapieoptionen sammeln.<br />
� Kontakt in eigener Sache mit Selbsthilfegruppen und<br />
Beratungsstellen.<br />
� Konfrontation des Kranken mit den Auswirkungen.<br />
� Konsequenz im Durchhalten von Entschlüssen.<br />
� Kooperation bei Behandlungsangeboten für das kranke<br />
Familienmitglied.<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
� Epidemiologie und Diagnose<br />
� Intervention<br />
� Behandlungsziele<br />
� Ambulanter Entzug<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
BEHANDLUNGSZIELE
Ein 58-jähriger Mann kommt in die Praxis; er ist seit langem arbeitslos<br />
und lebt alleine in einer Kleinstwohnung. Er war schon zweimal zum<br />
stationären Entzug, die Teilnahme bei den Anonymen Alkoholikern hat er<br />
nach kurzer Zeit aufgegeben. Obwohl er versichert, keinen Alkohol mehr<br />
zu trinken, riecht sein Atem nach Alkohol.<br />
Er berichtet, dass ihm aufgefallen sei, dass seine Unterschenkel angeschwollen<br />
sind und ihm bei körperlicher Anstrengung, z.B. beim<br />
Stiegensteigen, die Luft ausgeht. Auch hat sein Husten zugenommen, was<br />
er auf sein Rauchen zurückführt. Es fällt auf, dass er Wortfindungsstörungen<br />
hat. Bei der körperlichen Untersuchung finden sich beidseits<br />
Unterschenkelödeme, eine plumprandige, harte Leber, drei Querfinger<br />
unter dem Rippenbogen reichend und vereinzelte feuchte Rasselgeräusche<br />
über beiden Lungen; der Puls ist regelmäßig mit einer Ruhefrequenz<br />
von 100/min.<br />
Eine Einweisung ins Krankenhaus lehnt er ab.<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
FALLBEISPIEL
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
BEHANDLUNGSZIELE<br />
„Entweder Abstinenz<br />
oder weitere Verschlechterung<br />
des Gesundheitszustandes?“<br />
CAVE!<br />
Therapeutischer Nihilismus
� Änderung des Suchtverhaltens<br />
� Verbesserung der körperlichen Gesundheit<br />
� Verbesserung der seelischen Gesundheit<br />
� Verbesserung des Sexuallebens<br />
� Verbessertes Sozialverhalten<br />
� Verbesserung von Tagesstruktur und Tätigsein<br />
� Nutzen von Hilfsangeboten<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
BEHANDLUNGSZIELE
ARTEN DES ALKOHOLKONSUMS<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
� Normales Trinken<br />
� Moderates Trinken<br />
� Kontrolliertes Trinken<br />
u.a. von Anonymen Alkoholikern<br />
als Therapieoption abgelehnt
KONTROLLIERTES TRINKEN<br />
� Maximaler täglicher Konsum<br />
� Maximaler wöchentlicher Konsum<br />
� Alkoholfreie Tage pro Woche<br />
� Trinktagebuch<br />
� Regelmäßige Kontrollkonsultationen<br />
� Überprüfen der Therapieziele<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
KONTROLLIERTES TRINKEN<br />
„Abstinence is controlled drinking<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
with a limit of zero.“<br />
Nancy Handmaker
� Epidemiologie und Diagnose<br />
� Intervention<br />
� Therapieziele<br />
� Ambulanter Entzug<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
1. Wenn die häusliche Umgebung nicht unterstützt<br />
2. Bei Entzugsanfällen in der Vergangenheit<br />
3. Polytoxikomanie<br />
4. Starker Tremor und Tachykardie vor Entzug<br />
5. Orientierungsstörungen oder Halluzinationen<br />
6. Suizidgefahr<br />
7. Ikterus, Zirrhose, Kachexie o.ä.<br />
8. Fehlgeschlagener ambulanter Entzug in der Anamnese<br />
9. Wenn der Patient es klar bevorzugt<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
KONTRAINDIKATIONEN
1. Wenn der Patient selbst Hilfe sucht ist die Prognose besser<br />
2. Die Behandlungsintensität ist ohne Einfluss<br />
3. Medikamente über den akuten Entzug hinaus haben keinen<br />
gesicherten Einfluss auf das Behandlungsergebnis<br />
4. Für Psychotherapie gibt es bezüglich Entzug keine Evidenz<br />
5. Das Erkennen und Mitbehandeln von psychiatrischen<br />
Komorbiditäten verbessert die Prognose<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
PROGNOSEKRITERIEN
Oxazepam<br />
(Praxiten)<br />
4 x 15 mg<br />
8 x 7,5 mg<br />
FESTES THERAPIESCHEMA<br />
Plus Trileptal<br />
3 x 300 mg<br />
Plus tägliche<br />
klinische Kontrolle!<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
Ev. Diazepam<br />
(Valium, Gewacalm, Harmomed)<br />
4 x 10 mg, dann<br />
8x 5 mg<br />
Ev. Lorazepam<br />
(Temesta, Lorazepam Lannacher)<br />
4 x 2 mg dann<br />
8 x 1 mg
UNTERSTÜTZUNG SICHERN<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
UNTERSTÜTZUNG SICHERN<br />
http://www.anonyme-alkoholiker.at<br />
ALKOHOLKRANKHEITEN
ALKOHOLKRANKHEITEN<br />
ZUSAMMENFASSUNG<br />
� 900.000 direkt Betroffene, 6,7% der Gesundheitsausgaben.<br />
� Co-Abhängigkeiten werden zu wenig wahrgenommen und behandelt<br />
� 70% der Alkoholkranken kommen zumindest einmal jährlich in die<br />
Arztpraxis.<br />
� Therapeutischer Nihilismus sollte der Vergangenheit angehören.<br />
� Nicht nur Abstinenz kann als Therapieziel vereinbart werden<br />
� Ein ambulanter Entzug ist möglich<br />
� Akademischer Titel schützt nicht vor Sucht!<br />
www.schramm.at