Kirchengeschichte II - Willkommen auf der Homepage von Siegfried ...
Kirchengeschichte II - Willkommen auf der Homepage von Siegfried ...
Kirchengeschichte II - Willkommen auf der Homepage von Siegfried ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Siegfried</strong> F. Weber<br />
Das Mittelalter<br />
© by <strong>Siegfried</strong> F. Weber, Selbstverlag, Großheide, 2000.<br />
(Meine Manuskripte dürfen für private, schulische, sowie gemeindliche Zwecke kopiert und kostenlos weitergereicht<br />
werden, nicht jedoch für gewerbliche Zwecke).
Inhaltsverzeichnis<br />
I. DIE VÖLKERWANDERUNG ....................................................................................... 4<br />
1.EINLEITUNG ..................................................................................................................... 4<br />
2. GRUND DER VÖLKERWANDERUNG ................................................................................. 4<br />
3. FOLGEN DER VÖLKERWANDERUNG ................................................................................ 4<br />
4. KIRCHENGESCHICHTLICHE FOLGEN ................................................................................ 4<br />
<strong>II</strong>. GERMANENMISSION ................................................................................................. 5<br />
1. DER ERSTE GERMANENMISSIONAR: WULFILA (WÖLFIN) ................................................ 5<br />
2. CHRISTIANISIERUNG DER FRANKEN: CHLODEVECH ........................................................ 5<br />
3. EIN INTERMEZZO MIT DEM RÖM. KAISER JUSTINIAN ....................................................... 6<br />
4. DIE IROSCHOTTISCHEN MÖNCHE GRÜNDEN KLÖSTER AUF DEM GERMANISCHEN<br />
FESTLAND........................................................................................................................... 7<br />
5. PAPST GREGOR I., D.GR. (590 – 604) FESTIGT DAS PAPSTTUM ....................................... 8<br />
6. MISSION UNTER DEN NORDGERMANEN UND FRIESEN ..................................................... 9<br />
7. FRIESENMISION ............................................................................................................. 11<br />
<strong>II</strong>I. DAS KAROLINGISCHE ZEITALTER (9.JH.) ..................................................... 13<br />
1. DER BILDERSTREIT IN BYZANZ ..................................................................................... 13<br />
2. ENTSTEHUNG DES KIRCHENSTAATES ............................................................................ 14<br />
3. KARL DER GROßE (769-814) ......................................................................................... 15<br />
4. POLITISCHE U. KIRCHLICHE STREITIGKEITEN UNTER DEN NACHFOLGERN KARLS ......... 16<br />
IV. DIE KIRCHE UNTER DEN OTTONEN (10.JH.) ................................................. 18<br />
1. DIE NACHFOLGER KARLS D. GR. .................................................................................. 18<br />
2. DAS REICH OTTOS D.GR. (936 – 973) ........................................................................... 18<br />
3. DIE GEISTLICHE FÜRSTENMACHT .................................................................................. 18<br />
4. DIE CLUNISCHE REFORMBEWEGUNG ............................................................................ 21<br />
5. ENDGÜLTIGER BRUCH ZWISCHEN ROM UND BYZANZ ................................................... 22<br />
6. DAS DIKTAT GREGORS V<strong>II</strong>. - HEINRICHS BUßGANG NACH CANOSSA ......................... 23<br />
V. DIE KREUZZÜGE ....................................................................................................... 24<br />
VI. DIE ORDEN ................................................................................................................ 27<br />
1. EINLEITUNG .................................................................................................................. 27<br />
2. DIE ZISTERZIENSER (ODER BERNHARDINER) ................................................................ 27<br />
3. SPITAL- UND RITTERORDEN .......................................................................................... 29<br />
4.KARTÄUSER UND PRÄMONSTRATENSER ........................................................................ 30<br />
5. DIE ARMUTSBEWEGUNG ............................................................................................... 31<br />
5.1. Einleitung ............................................................................................................. 31<br />
5.2. Joachim, Prophet <strong>der</strong> Endzeit .............................................................................. 31<br />
5.3. Arnold <strong>von</strong> Brescia ............................................................................................... 32<br />
5.4. Die Albigenser o<strong>der</strong> Katharer ............................................................................. 32<br />
5.5. Die Waldenser ..................................................................................................... 33<br />
5. 6. Die Dominikaner ................................................................................................ 38<br />
5. 7. Die Augustiner Eremiten ..................................................................................... 38<br />
5. 8. Der Franziskaner Orden ................................................................................. 38<br />
5. 9. Die deutsche Mystik ............................................................................................. 41<br />
2
V<strong>II</strong>. DIE HERRSCHAFT DES PAPSTTUMS .................................................. 44<br />
1. DIE INQUISITION ........................................................................................................... 44<br />
2. PAPST INNOCENZ <strong>II</strong>I (1198 - 1216) UND DAS VIERTE LATERANKONZIL VON 1215 ....... 46<br />
3. WEITERE HÖHEPUNKTE DES MITTELALTERS ................................................................ 47<br />
V<strong>II</strong>I. DIE SCHOLASTIK .......................................................................................... 48<br />
1. VON DER SCHULE BIS ZUR UNIVERSITÄT ...................................................................... 48<br />
2. ANSELM VON CANTERBURY ......................................................................................... 49<br />
3. DER UNIVERSALIENSTREIT ........................................................................................... 49<br />
4. THOMAS VON AQUIN (O.P.) .......................................................................................... 50<br />
5. DUNS SCOTUS (O.F.M.) ................................................................................................ 53<br />
6. WILHELM VON OCCAM (O.F.M.) .................................................................................. 53<br />
IX. NIEDERGANG UND VERSAGEN DER PAPSTKIRCHE<br />
(SPÄTMITTEL.) .......................................................................................................... 54<br />
1. DER PAPST BONIFAZ V<strong>II</strong>I ............................................................................................. 54<br />
2. DIE BABYLONISCHE GEFANGENSCHAFT DER PÄPSTE IN AVIGNON ................................ 56<br />
X. VORREFORMATORISCHE BESTREBUNGEN .................................................... 58<br />
1. JOHN WICLIF (1328 - 1384) .......................................................................................... 58<br />
2. JOHANNES HUS VON PRAG ............................................................................................ 60<br />
LITERATURVERZEICHNIS MIT ABKÜRZUNGEN ................................................ 64<br />
3
I. Die Völkerwan<strong>der</strong>ung<br />
1.Einleitung 1<br />
Ab 400 n.C. beginnt die unerklärliche Völkerwan<strong>der</strong>ung, die Jahrhun<strong>der</strong>te andauert. Die<br />
Angeln und die Sachsen verlassen Dt. und ziehen nach England. 2<br />
Die Langobarden verlassen die Elbe und ziehen über Ungarn nach Italien: 586 n.C. gründen<br />
sie in Italien ihr Reich (heute Lombardei).<br />
Die Burgun<strong>der</strong> verlassen die O<strong>der</strong> und ziehen in die Schweiz!<br />
Die Wandalen verlassen ebenfalls die O<strong>der</strong> und erreichen über Spanien sogar Karthago in<br />
Afrika.<br />
Die Goten kommen <strong>von</strong> <strong>der</strong> Weichsel, ziehen zur Krim, an<strong>der</strong>e nach Frankreich und Spanien<br />
und wie<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e nach Italien, wo Theo<strong>der</strong>ich d. Gr. 489 n.C. das Ostgotenreich errichtet.<br />
2. Grund <strong>der</strong> Völkerwan<strong>der</strong>ung<br />
Bleibt letztlich ungeklärt. Wahrscheinlich ist es <strong>der</strong> kulturelle Reichtum des Römischen<br />
Reiches.<br />
3. Folgen <strong>der</strong> Völkerwan<strong>der</strong>ung<br />
Zerstörung des Weströmischen Reiches:<br />
� 410 n.C. fällt Rom in die Hände <strong>der</strong> Westgoten.<br />
� 455 n.C. plün<strong>der</strong>n die Wandalen Rom.<br />
� 486 n.C. beendet <strong>der</strong> Frankenkönig Chlodowech den römischen Anspruch <strong>auf</strong> Gallien.<br />
4. Kirchengeschichtliche Folgen<br />
Die Röm-Kath. Kirche beginnt die Germanenmission. Es entsteht eine römischgermanische<br />
Kultur:<br />
� Die Germanen übernehmen den christlichen Glauben.<br />
� Außerdem übernehmen sie die Sitten und die Bildung.<br />
� Die Römer müssen politisch abtreten.<br />
1<br />
Vgl. Heussi, Kompendium, § 30-31; K.D.Schmidt, ab S. 148; E. Schnepel, Jesus im Frühen Mittelalter, S.<br />
12; Sierszyn, 2000 Jahre KG, <strong>II</strong>.<br />
2<br />
Karten: dtv-Atlas zur Weltgeschichte, I, S. 114. Ferner: Tim Dowley, Atlas – Bibel u. Geschichte des<br />
Christentums, Brockhaus, Wuppertal, 1997, S. 82 f.<br />
4
<strong>II</strong>. Germanenmission<br />
1. Der erste Germanenmissionar: Wulfila (Wölfin)<br />
Wulfila wird 341 in Konstantinopel zum Bischof <strong>der</strong> Goten geweiht. Er übersetzt die Bibel<br />
in die gotische Sprache. Dazu verwendet <strong>der</strong> Apostel <strong>der</strong> Goten das gotische Alphabet und<br />
die griechischen Unzialen (Großbuchstaben). Erhalten geblieben ist uns <strong>der</strong> Codex argenteus<br />
(ein Evangelienbuch) aus dem 5.Jh. n.C., das älteste Denkmal germanischer Literatur.<br />
Aufgrund <strong>der</strong> Sippenherrschaft wurden alle Goten „Christen“.<br />
Wir sprechen nicht <strong>von</strong> Germanenbekehrung, son<strong>der</strong>n <strong>von</strong> Germanenchristianisierung arianischen<br />
Glaubens!<br />
Merke: 451 n.C. : Hunnen werden geschlagen<br />
Schlacht <strong>auf</strong> den Katalaunischen Fel<strong>der</strong>n bei Paris. Ein religionsgeschichtlich wichtiges Ereignis,<br />
denn die heidnischen Hunnen werden <strong>von</strong> vom Bündnis römischer Katholiken mit<br />
den Germanen zurückgeschlagen. Damit kann die Christianisierung Westeuropas beginnen<br />
und somit bleibt das starke christianisierte Westeuropa vor dem Islam (600 n.C.) bewahrt.<br />
Fazit <strong>der</strong> Völkerwan<strong>der</strong>ung:<br />
Die Völkerwan<strong>der</strong>ung hat die Zerstörung des Weströmischen Reiches zur Folge.<br />
An<strong>der</strong>erseits kann sich die Röm-Kath. Kirche <strong>auf</strong> Westeuropa ausbreiten, da die<br />
Germanen „Christen“ werden.<br />
2. Christianisierung <strong>der</strong> Franken: Chlodevech 3<br />
2.1. Der Arianismus<br />
Unter Wulfila wurden die Goten (Germanen) 341 n.C. arianisch. Die Arianer lehnten die<br />
Göttlichkeit Jesu ab. Jesus sei nicht präexistent – er sei geschaffen. Dieser germanischarianische<br />
Glaube hatte sich weit verbreitet.<br />
Doch um 500 n.C. kam die Wende: Der romanisch-katholische Glaube breitete sich immer<br />
mehr aus. Jener Glaube betonte die Göttlichkeit Jesu.<br />
2.2. Chlodovechs Reich 4<br />
Chlodovech (Chlodwig), <strong>der</strong> König <strong>der</strong> salischen Franken (466 – 511 n.C.) gründet das<br />
umfassende Frankenreich mit dem Sitz in Paris und <strong>der</strong> Herrschaft über Nordgallien, über<br />
die Alemannen (Schwarzwald) und über die Burgun<strong>der</strong>, weiter über die Westgoten zwischen<br />
Loire u. Garonne (heute Frank-reich).<br />
2.3. Bekehrung zum katholischen Glauben<br />
Chlodovech war germanischen Glaubens. Doch war seine Frau Chrotechilde katholisch.<br />
Weihnachten 496 n.C. ließ König Chlodovech sich in Rheims t<strong>auf</strong>en. Der Übertritt hatte<br />
auch politische Überlegungen. Der Frankenkönig sah in dem Übertritt vor allem das günstige<br />
Mittel, mit Hilfe <strong>der</strong> Römer seine Macht über die Burgun<strong>der</strong> und Westgoten auszudehnen,<br />
und zwar im Namen <strong>von</strong> Glaubenskriegen.<br />
3 Vgl. K.D.Schmidt, S. 164; Th. Brandt, I, S. 135; Heussi, Kompendium § 35; Sierszyn, 2000 Jahre KG, Bd.<br />
2.<br />
4 Karte: Tim Dowley, Atlas, S. 83.<br />
5
„Mich schmerzt es zu sehen, dass <strong>der</strong> schönste Teil <strong>von</strong> Gallien im Besitz <strong>der</strong> Arianer ist.<br />
Laßt uns mit Gottes Hilfe gegen sie <strong>auf</strong>brechen, so wollen wir ihre fruchtbaren Landschaften<br />
unter uns verteilen.“ 5<br />
Für die röm.-kath. Kirche war das <strong>der</strong> theologische Sieg gegen die Arianer.<br />
2.4. Christianisierung <strong>der</strong> Franken<br />
Mit König Chlodovech wurde nach und nach das ganze Volk röm.-kath. Die Zeit <strong>der</strong> Arianer<br />
war vorbei. Wurde ein Fürst kath., so trat <strong>der</strong> ganze Stamm mit über. So verstand es<br />
<strong>der</strong> Frankenkönig, die Bischöfe aus den Adelsgeschlechtern zu holen.<br />
Damit wurden ganze Sippen kath.<br />
Zum an<strong>der</strong>en behielt Chlodovech die politische Oberhand über die Kirche. Denn die Bischöfe<br />
hatten sich ihm unterzuordnen.<br />
Somit entstand im Frankenland die Reichskirche.<br />
2.5. Fazit<br />
� Übertritt <strong>der</strong> germanisch-arianischen Goten zum röm.-kath. Glauben.<br />
� Christianisierung eines Volkes <strong>auf</strong>grund <strong>der</strong> Sippentradition.<br />
� Sieg <strong>der</strong> röm.-kath. Kirche über den Arianismus.<br />
� Entstehung <strong>der</strong> Reichskirche im Reich <strong>der</strong> Franken (Eigenkirchen des Königs).<br />
Anmerkung:<br />
Als Chlodovech das Frankenreich begründete, herrschte <strong>der</strong> Ostgote Theo<strong>der</strong>ich d.Gr. in<br />
Italien (Ostgotenreich).<br />
3. Ein Intermezzo mit dem röm. Kaiser Justinian<br />
3.1. Justinian I. (527 – 565 n.C.)<br />
Justinian war <strong>der</strong> letzte römische Kaiser, <strong>der</strong> zumindest noch einmal das oströmische Reich<br />
regieren durfte. 6 Er konnte den Goten Italien und den Vandalen Nordafrika abringen. Dieses<br />
sog. Oströmische Reich reichte <strong>von</strong> Italien, über Griechenland und Kleinasien bis nach<br />
Israel, Ägypten und Karthago.<br />
3.2. Kirchengeschichtliche Folgen<br />
o Stärkung des Cäsaropapismus (Verbindung <strong>der</strong> kirchlichen Oberleitung mit <strong>der</strong><br />
Staatsgewalt).<br />
o 529 n.C. wird die antike Philosophenschule in Athen geschlossen. Das Ende <strong>der</strong><br />
Antike! Das Mittelalter wird fortan <strong>von</strong> <strong>der</strong> romanisch-christlichen Kultur bestimmt.<br />
o Beseitigung des Arianisums.<br />
3.3. Auflösung des Oströmischen Reiches: Islam<br />
a) Ab 620 n.C. beginnt die Islamisierung des Oströmischen Reiches 7 : Syrien, das<br />
Land Israel, Ägypten (das Ende <strong>der</strong> alexandrinischen Schule) und ganz Nordafrika<br />
(Karthago) fallen in die Hände <strong>der</strong> Moslems.<br />
5 Th. Brandt, Kirche im Wandel <strong>der</strong> Zeit, I, Brockhaus, Wuppertal, 1978, S. 136.<br />
6 Karte: Tim Dowley, Atlas, S. 84 f.<br />
7 Karte: Tim Dowley, Atlas, S. 87 ff.<br />
6
) In Frankreich jedoch werden die Mohamedaner <strong>von</strong> dem Frankenkönig Karl Martell<br />
im Jahre 732 n.C. bei Tours zurückgeschlagen. Die Araber müssen Frankreich<br />
wie<strong>der</strong> verlassen. Damit bleibt Westeuropa christliches Abendland.<br />
3.4. Der Überrest des Römischen Reiches<br />
Mit Griechenland und Kleinasien bleibt dem Römischen Reich nicht viel erhalten. Konstantinopel<br />
(Byzanz) bildet das Zentrum. Später sprechen wir vom byzantinischen Reich. 8<br />
3.5. Der Fall Konstantinopels<br />
Am 29.05.1453 n.C. erobern die Türken Konstantinopel und begründen das Osmanische<br />
Reich. 9 Das ist endgültig das Ende des Oströmischen Reiches! 10<br />
Bedeutung:<br />
� Entstehung des osmanischen Großreichs, welches Europa bedroht (16.Jh.: Türken<br />
vor Wien).<br />
� Das antike Erbe transferiert sich nach Westeuropa: Entstehung des europäischen<br />
Humanismus.<br />
� Die Macht <strong>der</strong> orthodoxen Kirche verlagert sich <strong>von</strong> Konstantinopel nach Moskau:<br />
Das dritte Rom.<br />
� Europa verliert mit dem Zugang zum Schwarzen Meer den Landweg nach Indien.<br />
Auf <strong>der</strong> Suche nach dem Seeweg (Christoph Columbus) wird die Neue Welt entdeckt.<br />
4. Die iroschottischen Mönche gründen Klöster <strong>auf</strong> dem germanischen<br />
Festland<br />
4.1. Mission in Schottland und England 11<br />
Der Hauptbegrün<strong>der</strong> des Christentums in Irland war <strong>der</strong> Hl. Patrick (432 n.C. ?). Viele<br />
Klöster wurden gegründet. Die irischen Mönche gingen zunächst nach Schottland, wo sie<br />
die Pikten und Skoten bekehrten. In Schottland gründet Columban <strong>der</strong> Ältere 563 n.C.<br />
ein Kloster. Die Iro-Schottischen Mönche waren <strong>von</strong> Rom unabhängig.<br />
Es entwickelte sich nun in <strong>der</strong> Abgeschiedenheit <strong>der</strong> irischen Insel ein Typus des<br />
Christentums, den wir im ganzen übrigen Europa nicht treffen. Nicht die christlichen Gemeinden<br />
werden die entscheidenden Brennpunkte, son<strong>der</strong>n die Klöster. In ihnen sammelt<br />
sich das eigentliche Leben <strong>der</strong> Kirche. Der Abt des Klosters ist zugleich das kirchliche<br />
Oberhaupt <strong>der</strong> Gegend. Er ist nicht <strong>der</strong> Bischof, son<strong>der</strong>n ernennt hierzu einen seiner<br />
Mönche, <strong>der</strong> die priesterlichen Aufgaben ausübt und die Weihen zum Bischof, Presbyter<br />
und Diakon vollzieht. Die Leitung <strong>der</strong> Kirche aber liegt in <strong>der</strong> Hand des Abtes, <strong>der</strong> selbst<br />
nicht Bischof ist.<br />
Wie die Klöster <strong>der</strong> übrigen Welt war auch für die irischen Klöster die Askese das charakteristische<br />
Kennzeichen. Den Höhepunkt <strong>der</strong> Askese aber erblickten sie im Einsiedlertum und<br />
Wan<strong>der</strong>leben (peregrinatio) in <strong>der</strong> Fremde. Darin drückte sich für sie die höchste Hingabe<br />
an Gott aus, dass man die liebsten Menschen, die man hatte, verließ und auch die eigene<br />
Heimat preisgab, an <strong>der</strong> sie mit allen Fasern ihres Herzens hingen. Sie zogen nicht in<br />
8 Karte: Tim Dowley, Atlas, S. 91. Auch S. 94.<br />
9 Karte: Tim Dowley, Atlas, S. 105 und 110.<br />
10 Das Osmanische Reich findet sein Ende im 1.Weltkrieg.<br />
11 Karte: Tim Dowley, Atlas, S. 92<br />
7
die Fremde, um Missionare zu werden, son<strong>der</strong>n um die Liebe zu ihrer Familie und ihrer<br />
Heimat zu opfern und dadurch unter Beweis zu stellen, dass sie Jesus mehr liebten als alles.<br />
12<br />
Die Iro-Schottischen Mönche dehnten ihrerseits die Mission nach England aus: Entstehung<br />
<strong>der</strong> Iro-Schottischen Kirche.<br />
4.2. Coloumbanus d. Jüngere<br />
Zu den Iro-Schottischen Mönchen gehörte u.a. Columbanus <strong>der</strong> Jüngere. Grund seiner<br />
Auswan<strong>der</strong>ung zum germanischen Festland war die „peregrinatio“ (Pilgerschaft / Auslandsreise),<br />
und zwar nicht aus missionarischen Gründen, son<strong>der</strong>n aus asketischen. Ungezwungener<br />
Maßen wurden die Iro-Schotischen Mönche <strong>auf</strong> ihren Auslandsreisen dennoch<br />
zu Missionaren.<br />
Columbanus d.J. gründete Klöster in den Vogesen (Elsas). 610 n.C. gründete er bei den<br />
Alemannen am Bodensee das Kloster Bregenz – das älteste <strong>auf</strong> deutschem Boden (jedenfalls<br />
was später dt. wurde).<br />
Sein Schüler Gallus gründete das Kloster St. Gallen (Schweiz).<br />
5. Papst Gregor I., d.Gr. (590 – 604) festigt das Papsttum<br />
Zu dieser Zeit beherrschen die Langobarden Italien.<br />
5.1. Gregors Kirchenpolitik<br />
a) Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong> weltlichen Macht des Papsttums in Italien – Grundlage des späteren<br />
Kirchenstaates. Er beruft sich <strong>auf</strong> das Erbgut des Hl. Petrus (Patrimonium).<br />
b) Er bindet die germ. Völker enger an den röm. Stuhl.<br />
� Er stellte das Ansehen d. Papstes bei den Franken wie<strong>der</strong> her.<br />
� Die Sueven wurden katholisch.<br />
� Christianisierung <strong>der</strong> Langobarden.<br />
c) Gegenüber Konstantinopel stärkte er die alten Primatsansprüche.<br />
Joh. IV. aus Konstantinopel bezeichnete sich als ökumenischer Patriarch. Gregor<br />
selbst nahm den demütigen Titel „servus servorum Dei“ (Diener aller Diener Gottes)<br />
an. Seitdem krönten sich alle Päpste gern mit diesem Titel.<br />
5.2. Die Bindung <strong>der</strong> Angelsachsen an Rom<br />
Im Jahre 597 n.C. schickte Papst Gregor I., d.Gr. den römischen Abt Augustinus mit vierzig<br />
Benediktinern nach England. Im selben Jahr ließ sich König Ethelbert <strong>von</strong> Kent t<strong>auf</strong>en.<br />
Neben <strong>der</strong> Iroschottischen Kirche gab es nun bald die röm.-kath. Kirche.<br />
Auf <strong>der</strong> Synode <strong>von</strong> Streaneshalch (664 n.C.) musste sich die Iroschottische Kirche <strong>der</strong><br />
röm.-kath. Kirche unterwerfen.<br />
12 Erich Schnepel, Jesus im Frühen Mittelalter, S. 76 f.<br />
8
6. Mission unter den Nordgermanen und Friesen 13<br />
Drei Missionare kamen aus England zu den Friesen: Wilfrith, Willibroad und Bonifatius. 14<br />
6.1. Wilfrith (634 – 710 n.C.)<br />
Die Angelsachsen aus England hatten nicht so große Sprachprobleme mit den Friesen wie<br />
die Franken. Wilfrith war Bischof <strong>von</strong> York. Der Friesenkönig Aldgisl erlaubte Wilfrith<br />
unter den Friesen zu wirken. Doch es dauerte nicht lange, da zog Wilfrith weiter nach Rom<br />
und kehrte nicht wie<strong>der</strong> zurück.<br />
6.2. Wilibroad (657 – 739 n.C.)<br />
Willibroad hatte seine Ausbildung im Kloster Ripon bei York. Von Utrecht (Holland) aus<br />
wollte er seine Mission starten. Als Missionar geriet er unter den Zwistigkeiten <strong>der</strong> Franken<br />
mit den Friesen. König Radbod konnte die Franken zurückdrängen und zerstörte die<br />
Anfänge <strong>der</strong> Kirche <strong>auf</strong> friesischem Boden.<br />
Willibroad muss den Friesenkönig soweit beeindruckt haben, dass dieser bereit war, die<br />
T<strong>auf</strong>e anzunehmen. Als Radbod mit den Füßen am Rande des T<strong>auf</strong>beckens stand, stellte er<br />
noch eine letzte Frage: „Wo sind meine bisherigen Verwandten?“<br />
Dar<strong>auf</strong> erwi<strong>der</strong>te Willibroad: „Die sind verloren, in <strong>der</strong> Hölle.“<br />
Dar<strong>auf</strong>hin lehnt Radbod die T<strong>auf</strong>e prompt ab, denn er wollte doch später bei seinen Verwandten<br />
sein.<br />
Eine kleine Interpolation:<br />
Schon im Jahre 1290 n.C. wurde ein Kloster in Großheide gegründet (eingegangen 1562).<br />
Damals gab es in Berumerfehn nur Moor und in Großheide nur kargen Sandboden und<br />
Gestrüpp.<br />
Haus<strong>auf</strong>gabe:<br />
1) Suche den Gedenkstein <strong>von</strong> dem Friesenkönig Radbod in Großheide <strong>auf</strong>. Was steht<br />
dar<strong>auf</strong> geschrieben?<br />
2) Welche Überreste gibt es <strong>von</strong> dem Kloster in Großheide und wo befinden sie sich?<br />
13<br />
Literatur: Menno Smid, Ostfriesische <strong>Kirchengeschichte</strong>, Reihe: Ostfriesland im Schutze des Deiches,<br />
Bd. VI, 1974.<br />
Lutz v. Padberg, Wynfreth-Bonifatius, Brockhaus, Wuppertal, 1989.<br />
14<br />
Karte: Tim Dowley, Atlas, S. 92<br />
9
6.3 Bonifatius (672–754)<br />
Der erste erfolgreiche Friesenmissionar sollte Bonifatius werden. 15 Das Gebiet <strong>der</strong><br />
Friesen erstreckt sich vom Norden <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>lande (Westfriesland) bis nach Ostfriesland.<br />
a) Auftrag<br />
Eigentlich heißt unser Friesenmissionar Wynfrith. Er war ein angelsächsischer Mönch<br />
aus dem Kloster Nhutscelle (England). Papst Gregor <strong>II</strong> gab ihm den Auftrag zur Mission<br />
unter den Nordgermanen. Seitdem heißt er Bonifatius.<br />
b) 1. Periode 719-722<br />
Nach dem Tode des Friesenkönigs Radbod (719) und <strong>der</strong> Eroberung Frieslands durch<br />
die Franken konnte Bonifatius mit <strong>der</strong> Mission beginnen. 16 Zwischendurch aber besucht<br />
er Rom und erhält die Bischofsweihe. Er leistet den Gehorsamseid:<br />
„Ich, Bonifatius, <strong>von</strong> Gottes Gnaden Bischof, gelobe Euch, Dir, dem heiligen Petrus,<br />
dem Apostelfürsten, und Deinem Stellvertreter, dem Papst Gregor, und seinen Nachfolgern<br />
bei dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist...,dass ich alle Treue und die<br />
Reinheit des katholischen Glaubens an den Tag legen und mit Gottes Hilfe in <strong>der</strong> Einheit<br />
dieses Glaubens verharren will...Aber auch wenn ich erfahre, dass Priester gegen<br />
die alten Anordnungen <strong>der</strong> heiligen Väter verstoßen, mit ihnen keine Gemeinschaft o<strong>der</strong><br />
keine Verbindung haben...will.“ 17<br />
c) 2. Periode 723-732 Hessen<br />
Bonifatius verkündigte in <strong>der</strong> Muttersprache des jeweiligen Volkes. Das brachte ihm Gönner.<br />
Der Papst verlangte ordentliche Verhältnisse in Hessen und Thüringen. Karl Martell gab<br />
dem Bonifatius einen Schutzbrief mit.<br />
723 fällte Bonifatius demonstrativ in Geismar (bei Fulda) die dem Stammesgott Donar<br />
geweihte Eiche (Donarseiche). 18 Somit wurde öffentlich <strong>der</strong> Sieg Christi proklamiert, weil<br />
die Götter sich nicht verteidigten. Tausende <strong>von</strong> Germanen wurden Christen. T<strong>auf</strong>e im<br />
Vogelsberg.<br />
Durch den Zuzug <strong>von</strong> vielen Mönchen und Nonnen wurde die Kirche in Hessen organisiert.<br />
Dennoch war die Reorganisation <strong>der</strong> hessischen Kirche mit Schwierigkeiten verbunden,<br />
denn es gab Kleriker, „die Amulette herstellten, indem sie Bibelsprüche als Schutz- und<br />
Heilmittel <strong>auf</strong> Kärtchen schrieben, die man an einer Schnur um den Hals trug, wie an<strong>der</strong>e<br />
Stückchen <strong>von</strong> Bernstein o<strong>der</strong> Achat.“ 19<br />
Auch die Heiligen- und Reliquienverehrung ersetzte willkommen die germanischen Götter.<br />
Die heidnische Religion verlässt durch die Vor<strong>der</strong>tür ihr Zuhause und kommt durch die<br />
15<br />
Landkarte: Tim Dowley, Atlas, S. 92<br />
16<br />
Frankreich: dtv-Atlas, I, 122<br />
17<br />
Tn. Brandt, Kirche im Wandel..., I, 140. Vgl. auch Padberg, Bonifatius S. 69<br />
18<br />
Donarseiche, auch Joviseiche genannt (Jovis=Jupiter, germanisch Donar). Aus dem Holz baute B. ein<br />
Bethaus.<br />
19<br />
Bonifatius an Gregor <strong>II</strong> in: L.v. Padberg, Bonifatius, S. 76. (Unterstreichung: SFW)<br />
10
Hintertür wie<strong>der</strong> herein.<br />
d) 3. Periode: 732-747<br />
Gregor <strong>II</strong>I. (731-741) verlieh Bonifatius die erzbischöfliche Würde. Er wurde päpstlicher<br />
Vikar für ganz Germanien. Eine solche Stellung hatte ein Papst einem Geistlichen noch nie<br />
gewährt.<br />
Bonifatius widmete sich nun auch <strong>der</strong> Bayrischen und Thüringischen Kirche.<br />
Auch festigte er die fränkische Kirche und hob das päpstliche Ansehen dort an. Ebenfalls<br />
widmete er sich dem Kloster zu Fulda.<br />
Bedroht wurde die fränkische Kirche immer wie<strong>der</strong> durch Sachseneinfälle.<br />
Letzte Missionsreise: 80 Jahre alt<br />
Im Frühjahr 754 n.C. zog Bonifatius <strong>auf</strong> seine letzte Missionsreise, und zwar nach Friesland.<br />
Er erreichte sogar die Küste im Norden. Doch in <strong>der</strong> Nähe <strong>von</strong> Dokkum 20 wurde er<br />
<strong>von</strong> beutegierigen Heiden erschlagen.<br />
Mit einem Buch (Codex Ragyndrudis aus Luxeuil in Burgund, 700 n.C.) versuchte er sich<br />
zu verteidigen. 21 Noch heute erkennt man den Schwerthieb im Codex.<br />
716 n.C. hatte Bonifatius erstmals Friesland besucht. 38 Jahre später fand er bei den Friesen<br />
den Tod.<br />
Zu Fulda wurde er begraben: Auf dem Grabstein stehen die Initialien: HBq = Hic Bonifatius<br />
quievit (Hier ruht B.)<br />
Nach dem Tod:<br />
Erst später wurde Bonifatius zum Märtyrer und zum Apostel <strong>der</strong> Deutschen geweiht.<br />
7. Friesenmision 22<br />
7.1 Willehad in Ostfriesland<br />
Ostfriesischen Boden hat zuerst <strong>der</strong> Bremer Bischof Willehad 780 n. C. betreten.<br />
7.2 Luidger aus Münster<br />
Um 800 n.C. kümmerte sich Luidger aus Münster um verschiedene Kirchen in Ostfriesland<br />
(Pewsum, Hinter, Loppersum). Ferner Pilsum, Jennelt, Uttum.� daher <strong>der</strong><br />
Name „Ludgerikirche“ in Norden. Luidger wurde auch später Schutzpatron.<br />
Luidger in Leer:<br />
Die Fischer an <strong>der</strong> Leda sollten ihm etwas zu essen geben. Sie aber entgegneten, dass<br />
sie seit langer Zeit nichts mehr in <strong>der</strong> Leda gefangen hätten. Luidger befahl, die Netze<br />
durchs Wasser zu ziehen. Und tatsächlich hatten sie einen großen Fisch gefangen, den<br />
20 Putzger, Historischer Weltatlas, S. 37<br />
21 Abb. in L. Padberg, a.a.O., S. 102.<br />
22 Menno Smid, Ostfries. KG, S. 4 ff.<br />
11
sie Stör nannten. 23<br />
7.3 Lex Frisiorum<br />
Karl <strong>der</strong> Große erließ 802 n.C. das für ganz Friesland geltende Gesetz Lex Frisiorum<br />
(Friesengesetz). Er deklarierte die Sonntagsheiligung unter Strafandrohung.<br />
7.4 Archäologische Spuren<br />
In Dunum bei Esens wurde ein großes Gräberfeld mit 400 Bestattungen entdeckt.<br />
Um 800 n.C. än<strong>der</strong>t sich <strong>der</strong> Bestattungsbrauch. Die alte heidnische Grabrichtung mit<br />
dem Blick <strong>der</strong> Toten in nördlicher Richtung (Nordsee) zum Totenreich <strong>der</strong> „Hel“ 24<br />
wurde in jener Zeit durch die christlich bestimmte West-Ost-Richtung 25 <strong>der</strong> Gräber abgelöst.<br />
26<br />
Dies geschah <strong>auf</strong>grund <strong>der</strong> Friesenmission. In einem <strong>der</strong> Gräber fand man einen Petrusschlüssel<br />
(Amulett).<br />
7.5. Ansger 27<br />
831 n.C. gründet Ansger das Erzbistum Hamburg (Ansgarikirche). Später wurde Hamburg<br />
durch die Wikinger zerstört.<br />
An<strong>der</strong>e Normannen (Dänen) plün<strong>der</strong>ten 100 Jahre lang (810-900 n.C.) die friesische<br />
Küste. Von einem Sieg allerdings wissen die Friesen in dieser Zeit zu berichten. Der<br />
Bremer Bischof Reinberd schlägt 884 n.C. zusammen mit den Friesen die Normannen<br />
zurück. 28<br />
23 M. Smid, Ostfr. KG, S. 18<br />
24 Aus „Hel“ wurde später „Hölle“. „Hel“ steht einfach für das Totenreich. In <strong>der</strong> nordischen Mythologie tritt<br />
„Hel“ auch personifiziert <strong>auf</strong>, beachte „Hel“ als Name <strong>der</strong> germ. Todesgöttin. (Duden-Etymologie, Bd. 7, S.<br />
270).<br />
25 Die Auferstehung erfolgt, wenn Christus wie<strong>der</strong>kommt. Von Westeuropa aus gesehen, kommt er im Osten<br />
wie<strong>der</strong>: In Israel. Deshalb sind die Gräber nach Osten hin ausgerichtet.<br />
26 M. Smid, Ostfries. KG, S. 21<br />
27 Heussi § 45 b<br />
28 M. Smid, Ostfries. KG., S. 24.<br />
12
<strong>II</strong>I. Das karolingische Zeitalter (9.Jh.)<br />
Genealogie: Sierszyn <strong>II</strong>, S. 354<br />
Landkarte: Tim Dowley, Atlas, S. 90<br />
In dieser Periode geht es uns vor allen Dingen um den Kaiser Karl d. Gr. (768-814), <strong>der</strong><br />
das Frankenreich <strong>von</strong> Friesland, Sachsen, Böhmen bis nach Italien 29 erweiterte und nicht<br />
nur den christlichen Glauben als einzige Religion bestätigte, son<strong>der</strong>n auch für rege geistige<br />
Bildung sorgte. 30<br />
Vorher aber wollen wir noch ein wenig zurückschauen, zunächst nach Byzanz.<br />
1. Der Bil<strong>der</strong>streit in Byzanz<br />
(Konstantinopel) 31<br />
Auf dem VI. Ökumenischen Konzil war 680 n.C. die Darstellung Christi als Mensch in<br />
Bil<strong>der</strong>n beschlossen worden. Die dogmatische Begründung liegt in Jh 12, 41; Jes 6; Hes.<br />
1,26, wo die Propheten die Herrlichkeit Gottes sahen. 32<br />
Kaiser Leo <strong>II</strong>I verbot jedoch 730 n.C. die Bil<strong>der</strong>verehrung. Alle Ikonen wurden zerstört:<br />
Christusbil<strong>der</strong>, Heiligenbil<strong>der</strong> (Bil<strong>der</strong>stürmer).<br />
Erst <strong>auf</strong> dem V<strong>II</strong>. ökumenischen Konzil konnte 787 n.C. die Bil<strong>der</strong>verehrung wie<strong>der</strong>hergestellt<br />
werde: Den Bil<strong>der</strong>n komme andächtige Verehrung zu, aber keine Anbetung.<br />
Noch heute feiert die orthodoxe Kirche diesen Sieg.<br />
Bil<strong>der</strong>theologie = Götzendienst<br />
„Der gläubige erfährt die Ikone als Vermittlung <strong>der</strong> Gnade. Gottes unsichtbares<br />
Wirken trifft in <strong>der</strong> Ikone sein betrachtendes Auge und durch das Auge hindurch den anschauenden<br />
Geist, <strong>der</strong> wie<strong>der</strong>um <strong>auf</strong> dem Wege nach oben in die Offenbarungswirklichkeit<br />
Christi hineingezogen wird.“ 33<br />
Calvin verurteilt die Bil<strong>der</strong>verehrung<br />
Der spätere Schweizer Reformator Johannes Calvin lehnt in seiner „Institutio Religionis<br />
Christianae“ jegliche Bil<strong>der</strong>verehrung ab. Er schreibt:<br />
„wie die Erzväter die Opfer <strong>der</strong> Heiden benutzt haben, so müssen auch die Christen<br />
Heiligenbil<strong>der</strong> haben statt <strong>der</strong> Götzen <strong>der</strong> Heiden.“ 34<br />
So argumentierten die Verehrer <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong>. Weiter sagen sie:<br />
Gott werde... nicht bloß durch das Hören seines Wortes erkannt, son<strong>der</strong>n auch<br />
durch das Anschauen <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong>“. 35<br />
29<br />
Grundlage für das spätere Hl. Röm. Reich Dt. Nation<br />
30<br />
Putzger, Historischer Weltatlas, S. 42<br />
31<br />
Heussi § 42 b-e<br />
32<br />
Alfred Adam, Dogmengeschichte I, S. 369 – 373.<br />
33<br />
A. Adam, Dogmengeschichte, S. 372.<br />
34<br />
J. Calvin, Unterricht in <strong>der</strong> christlichen Religion (Institutio), Buchhandlung des Erziehungsvereins, Neukirchen,<br />
1936, Bd. I, S. 91 (wissenschaftliche Abk.: Calvin, Institutio, I, 11,14 = Buch I, 11.Kapitel, Artikel<br />
14).<br />
35<br />
Calvin, Institutio, I, 11, 9<br />
13
Calvin hebt die grotesken Begründungen aus den Angeln und kontert mit 2. Mo 20,4.<br />
„Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, we<strong>der</strong> <strong>von</strong> dem, was oben im<br />
Himmel, noch <strong>von</strong> dem, was unten <strong>auf</strong> Erden, noch <strong>von</strong> dem, was im Wasser unter <strong>der</strong> Erde<br />
ist.“<br />
Den Ursprung <strong>der</strong> Bil<strong>der</strong>verehrung sieht <strong>der</strong> Reformator im Unglauben o<strong>der</strong> umgekehrt:<br />
Der Mensch will Gott sehen und fühlen. Sobald man sich ein Bild <strong>von</strong> Gott o<strong>der</strong> <strong>von</strong><br />
Christus gemacht hat, legt man in ihm die göttliche Kraft hinein. 36<br />
2. Entstehung des Kirchenstaates<br />
2.1 Land für den Papst<br />
In Rom sorgt man sich um die Sicherheit des päpstlichen Stuhls. Einmal regierten die<br />
Langobarden in Italien, dann wie<strong>der</strong> die Franken. Deshalb bemühten sich die Päpste in<br />
Rom um ein eigenes unantastbares Stück Land.<br />
Zu den bisherigen Frankenkönigen, dem Geschlecht <strong>der</strong> Merowinger (<strong>von</strong> Chlodewech<br />
ausgehend, Großvater Merowech) hatten die Päpste kein gutes Verhältnis. Die Merowinger<br />
handelten selbstmächtig, ohne <strong>auf</strong> die Päpste zu schauen. 37<br />
Ein positives Verhältnis bekamen die Päpste zunächst zu den Karolingern (Pippin/Karl<br />
d.Gr.). 38<br />
2.2 Die pippinsche Schenkung<br />
751 n.C. wurde <strong>der</strong> Karolinger Pippin König <strong>der</strong> Franken. Dazu empfing <strong>der</strong> neue König<br />
Pippin durch Erzbischof Bonifatius als erster fränkischer König die Salbung mit dem heiligen<br />
Öl. Damit war die enge Verknüpfung mit dem Papststuhl hergestellt.<br />
Kurz dar<strong>auf</strong> drangen die Langobarden in Rom ein und for<strong>der</strong>ten die Unterwerfung des<br />
Papsttums. Papst Stefan <strong>II</strong> erschien 753 n.C. hilfesuchend am fränkischen Hof. Der Papst<br />
unterstellte Rom den dauernden Schutz des Frankenkönigs.<br />
Dar<strong>auf</strong>hin vertrieb Pippin 754 n.C. die Langobarden aus Italien und schenkte dem Papst<br />
ein Stück Land (Petersdom). Damit war <strong>der</strong> Kirchenstaat (ein religiöser Staat innerhalb des<br />
politischen Staates „Italien“) entstanden. Man beruft sich dabei gern <strong>auf</strong> das Vermögen des<br />
Petrus (Patrimonium Petri).<br />
2.3 Weitere Entwicklung des Kirchenstaates<br />
Napoleon Bonaparte hob 1801 den Kirchenstaat <strong>auf</strong> und nahm den Papst gefangen.<br />
Auf dem Wiener Kongress 1814 (Neuordnung Europas) wurde <strong>der</strong> Kirchenstaat wie<strong>der</strong>hergestellt<br />
36 Calvin, Institutio I, 11, 9<br />
37 Stammbaum <strong>der</strong> Merowinger: Sierszyn, <strong>II</strong>, Anhang, S. 353.<br />
38 Stammbaum <strong>der</strong> Karolinger: Sierszyn, <strong>II</strong>, Anhang, S. 354 f.<br />
14
2.4 Das Gebiet<br />
Im Mittelalter nahm <strong>der</strong> Kirchenstaat sogar ein Drittel „Italiens“ in Anspruch. 39<br />
2.5 Untergang<br />
1870 erobern die Italiener Rom. Sie heben endgültig den päpstl. Anspruch <strong>auf</strong> einen<br />
Staat <strong>auf</strong>. Bis 1929 bezeichneten sich die Päpste als Gefangene des Vatikans. 40<br />
2.6 Lateranverträge 1929<br />
Mussolini vereinbarte 1929 im päpstl. Lateran (Residenz in Rom) 41 mit Papst Pius XI.<br />
mehrere Verträge. Der Staatsvertrag garantierte die Souveränität des hl. Stuhls <strong>auf</strong> internationaler<br />
Ebene mit <strong>der</strong> Vatikanstadt als neuem Staat und dem Papst als Staatsoberhaupt<br />
und bestätigte die röm.-kath. Religion als Staatsreligion Italiens.<br />
An<strong>der</strong>erseits erkannte <strong>der</strong> Papst Rom als Hauptstadt Italiens an.<br />
Der Lateranpalast wurde dem Papst geschenkt. Kirchliche Eheschließung wurde Zivilrecht.<br />
1947 wurden die Lateranverträge in die Verfassung <strong>der</strong> Republik Italiens <strong>auf</strong>genommen.<br />
3. Karl <strong>der</strong> Große (769-814)<br />
Karten: Putzgers Historischer Weltatlas, S. 42<br />
Tim Dowley, Atlas, S. 90<br />
Literatur: Heussi § 43<br />
Sierszyn, <strong>II</strong>, S. 92 ff.<br />
3.1 Das Reich<br />
Karl <strong>der</strong> Große dehnte das Frankenreich aus. Sachsen und Italien kamen dazu. Sein<br />
abendländisches Universalreich fasste einen großen Teil <strong>der</strong> christlichen Län<strong>der</strong> zusammen.<br />
So wurde <strong>der</strong> Frankenkönig <strong>der</strong> Schutzherr und Leiter <strong>der</strong> Kirche des Abendlandes.<br />
Unter seinem Schutz konnte die Mission unter den Friesen und den Sachsen<br />
vollendet werden.<br />
3.2 Unterwerfung <strong>der</strong> Sachsen (Widukind)<br />
Heftigen Wi<strong>der</strong>stand leistete <strong>der</strong> Sachse Widukind. 782 n.C. gibt es den „dies arter“,<br />
den „schwarzen Tag“, zu Verden an <strong>der</strong> Aller: Der <strong>auf</strong> <strong>der</strong> Seite Karls stehende sächsische<br />
Adel liefert 4500 <strong>auf</strong>ständische Sachsen an Karl zur Hinrichtung aus: Der dies ater<br />
(schwarze Tag) in <strong>der</strong> Geschichte Karls.<br />
785 empfängt <strong>der</strong> Sachsenführer Widukind die T<strong>auf</strong>e.<br />
772 hatte Karl bereits die Evesburg erobert und das Heiligtum Irminsul zerstört. Die<br />
Kriege mit den Sachsen kostete dem Karl die größte militärisch-polit. Kraftanstrengung.<br />
Auch bei den Friesen kam es immer wie<strong>der</strong> zu Unruhen.<br />
792 erhoben sich die Sachsen wie<strong>der</strong>. Karl musste nun die Sachsen in fränkische Gebiete<br />
deportieren und fränkische Aussiedler pflanzte er nach Sachsen um.<br />
39 Tim Dowley, Atlas, S. 121<br />
40 Heussi § 115 r.<br />
41 Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 13, S. 128<br />
15
787 entstanden acht Bistümer: Bremen, Verden, Minden, Münster, Pa<strong>der</strong>born, Osnabrück,<br />
Hildesheim u. Halberstadt.<br />
Die Friesen- und Sachsenmission konnte nun ihre Vollendung finden (lex frisiorum).<br />
3.3 Kirchliche Organisation unter Kar. d. Gr.<br />
� Karl ehrte den Papst, aber eigenmächtige Eingriffe des Papstes in die fränkische Kirche<br />
kamen nicht vor. Karl sei <strong>der</strong> König David und <strong>der</strong> Papst sei Mose.<br />
� Karl setzte die Abgabe des Zehnten an die Kirche (Kirchensteuer) gesetzlich durch<br />
(Kirche wird Volkskirche).<br />
� Bischöfe werden durch den König ernannt (Ober<strong>auf</strong>sicht durch den Staat).<br />
4 deutsche Erzbistümer: Trier, Köln, Mainz, Salzburg.<br />
� Die Pfarrkirchen sind selbständig: T<strong>auf</strong>recht, Friedhof, Zehnter. Pfarrbezirk: parochia,<br />
da<strong>von</strong> parochus = Pfarrer (pfarochus). Pfarrer sind dem Erzpriester (Dekanat) untergestellt.<br />
� vita canonica = gemeinsames Leben <strong>der</strong> Kleriker (Art <strong>von</strong> Mönchtum).<br />
� Beson<strong>der</strong>s schätzte Karl die Predigt in <strong>der</strong> Volkssprache! Einführung <strong>der</strong> römischen<br />
Liturgie und <strong>der</strong> Beichte.<br />
� Je<strong>der</strong> muss das Vaterunser (Pater noster) in seiner Muttersprache auswendig können.<br />
Regelmäßiger Besuch des Gottesdienstes.<br />
� Karl führte das Kirchenläuten ein (später 3mal am Tag = Gebetsläuten).<br />
3.4 Geistiges Leben<br />
Karl gründete viele Klosterschulen (Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Arithmetik, Geometrie,<br />
Astronomie, Musik).<br />
� Karls Gelehrte revidierten die Bibelübersetzung des Hieronymus: Nun wird sie zur<br />
eigentlichen Vulgata.<br />
Fazit: Auswirkungen bis heute<br />
� Trinität<br />
Karl ließ 809 <strong>auf</strong> einer Synode zu Aachen das Filioque (und dem Sohn) anerkennen.<br />
Der Heilige Geist wirkt nicht nur aus dem Vater, son<strong>der</strong>n auch aus dem Sohn (filio<br />
que).<br />
3.5 Karl d. Große wird römischer Kaiser (800 n.C.)<br />
800 n. C. weiht Papst Leo <strong>II</strong>I. den Franken-König Karl d. Gr. zum römischen Kaiser.<br />
Dies ist eine Voraussetzung zum späteren Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation.<br />
Fortan nannten sich Karls Nachfolger: „Römische Kaiser“. Da auch noch Byzanz<br />
seinen Kaiser hatte, gab es nun zwei christliche Kaiser.<br />
4. Politische u. kirchliche Streitigkeiten unter den Nachfolgern Karls<br />
16
4.1 Reichsteilung<br />
Die Nachfolger Karls teilen das Fränkische Reich unter sich <strong>auf</strong>. 42<br />
� Karl <strong>II</strong>, <strong>der</strong> Karle, bekommt Frankreich.<br />
� Lothar I. bekommt Friesland, Lothringen (Name)! und Italien.<br />
� Ludwig <strong>der</strong> Deutsche bekommt Deutschland.<br />
Schon bald kam es in den fränkischen Nachfolgestaaten zu einem kirchlichen und<br />
moralischen Zerfall. Der Adel raubt Klostergut. Der Abt haust mit Konkubinen,<br />
samt Kin<strong>der</strong>n und Kriegern im Kloster.<br />
4.2 Abendmahlslehre<br />
Radbertus festigt 831 n.C. die kath. Abendmahlslehre (Eucharistie). In je<strong>der</strong> Messe<br />
verwandelt sich bei den Einsetzungsworten des Priesters Brot und Wein in Leib und<br />
Blut Jesu (Transsubstantiationslehre).<br />
Hostie (Brot) wird <strong>auf</strong>bewahrt.<br />
4.3. Slavenmission (860 n.C.)<br />
Slavenapostel waren Methodius und Kyrill aus Thessalonich. Sie gebrauchten die slavische<br />
Sprache und führten somit die Slaven dem Christentum zu. Damit die Bibel in ihre Sprache<br />
übersetzt werden konnte, wurde das kyrillische Alphabet erfunden. 43 In dieser Zeit kam das<br />
Christentum auch nach Bulgarien.<br />
4.4. Schisma zwischen Rom und Byzanz (867 n.C.)<br />
Streit gab es zwischen beiden Kirchen vor allen Dingen um die Slavenmission. Wer hat<br />
das Recht, sie zu missionieren?<br />
Rom for<strong>der</strong>te Land <strong>von</strong> Byzanz, welches den Päpsten vor etlichen Jahren genommen worden<br />
war. Dar<strong>auf</strong>hin schlossen sich die Bulgaren sich <strong>der</strong> lat. Kirche an.<br />
Der byzantinische Patriarch verhängte über den röm. Papst den Bann. Schon bald kehrten<br />
die Bulgaren zur byzantinischen Kirche zurück.<br />
Die östliche Kirche verwarf:<br />
� Fasten am Sonnabend.<br />
� Den Genuss <strong>von</strong> Milchprodukten in den Fastenwochen<br />
� Den obligatorischen Priesterzölibat.<br />
Es kam zum Schisma zwischen Rom und Byzanz.<br />
42 Putzgers Histor. Weltatlas, S. 43<br />
43 Vielleicht durch Klement Ochrisdski (Brockhaus, Enzyklopädie, Bd. 12, S. 6649.<br />
17
IV. Die Kirche unter den Ottonen (10.Jh.)<br />
1. Die Nachfolger Karls d. Gr.<br />
Stammbaum <strong>der</strong> Karolinger: Sierszyn, 2000 Jahre KG, Bd. 2, Anhang.<br />
Das große Frankenreich wird geteilt:<br />
� Karl <strong>II</strong>. erhält Frankreich<br />
� Lothar I. bekommt Friesland, Belgien, Elsass und Italien<br />
� Ludwig d. Dt. erhält Deutschland<br />
2. Das Reich Ottos d.Gr. (936 – 973)<br />
Stammbaum <strong>der</strong> Ottonen: Sierszyn, 2000 Jahre KG, Bd. 2, Anhang.<br />
Otto d.Gr. 44 lässt sich 962 n.C. in Rom zum Kaiser krönen, und zwar durch den Papst Johannes<br />
X<strong>II</strong>, <strong>der</strong> als 17jähriger bereits den Hl. Stuhl betrat.<br />
Deutschland, Österreich und Italien bildeten ein Reich. Im 15.Jh. kam für das Gebiet <strong>von</strong><br />
Dt. u. Italien <strong>der</strong> Begriff „Heiliges Römisches Reich Deutscher Nation“ <strong>auf</strong>. 45<br />
Das „Heilige Römische Reich Deutscher Nation“<br />
Seit 962 ist durch Otto I. das Kaisertum eng mit Rom verbunden. Kaiserkrönungen fanden<br />
bereits seit Karl d.Gr. in Rom statt!<br />
Zweck: Fortsetzung des römischen Reiches! Vgl. dazu das Kreuz (Abb. mit Augustus).<br />
Die Bezeichnung „Romanum Imperium“ gehörte bereits zum Kaisertitel Karls d.Gr., seit<br />
Konrad <strong>II</strong>. (1034) amtlicher Titel des Reichs. Als „Sacrum Imperium“ wird das Reich seit<br />
1157 in Urkunden Friedrichs I. tituliert, um die sakrale Würde zu betonen.<br />
Seit 1254 bürgerte sich in den Krönungsurkunden die Bezeichnung „Sacrum Romanum<br />
Imperium“ ein. In dt. Urkunden bei Karl IV. erwähnt. Der Zusatz „Deutsche Nation“ wurde<br />
im 15.Jh. beigefügt.<br />
Erst 1806 löste sich unter Napoleon das Hl. Röm. Reich Dt. Nation <strong>auf</strong>. 46<br />
3. Die geistliche Fürstenmacht<br />
3.1. Die Investitur<br />
Das mhd. Wort „Investitur“ bedeutet „Einsetzung in ein Amt.“<br />
Otto gab den Bischöfen Besitz und fürstliche Macht (= Adel).<br />
Gerichtsbarkeit und Zollämter lagen in den Händen <strong>der</strong> Bischöfe.<br />
Fortan setzten die Kaiser die Bischöfe ein. So wurden auch „Laien“ ohne<br />
Theologiestudium einfach als Bischöfe o<strong>der</strong> Erzbischöfe eingesetzt.<br />
Als Zeichen <strong>der</strong> Erwählung gab <strong>der</strong> Kaiser o<strong>der</strong> <strong>der</strong> König dem Bischof<br />
den bischöflichen Stab und den Ring als Zeichen <strong>der</strong> Vermählung des Fürstentums<br />
mit <strong>der</strong> Kirche.<br />
Man kann sich gut vorstellen, dass das Papsttum damit nicht einverstanden war.<br />
44 Krone: Siehe: „Menschen in ihrer Zeit“, Bd. <strong>II</strong>I, S. 40<br />
45 Abb. in Tim Dowley, Atlas, S. 122.<br />
46 Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 9, S. 612<br />
18
Fortan gab es zwischen den Päpsten und den Königen den Investiturstreit, denn Päpste<br />
und Könige beanspruchten die Ernennung des Bischofs je für sich. 47<br />
Da die Bischöfe sich nun auch um politische Angelegenheiten kümmern mussten, setzten<br />
sie für die kirchlichen Belange den Archidiakon ein.<br />
3.2. Die Folgen <strong>der</strong> Investitur<br />
Folgen <strong>der</strong> Investitur ist <strong>der</strong> geistliche Zerfall <strong>der</strong> Kirche:<br />
a) Simonie<br />
Vgl. Apg. 8, 18 – 24. Der Adel konnte sich mit Geld das Bischofszepter k<strong>auf</strong>en.<br />
Laien, die über Geldmittel verfügten, wurden Priester.<br />
b) Nikolaitismus<br />
Vgl. Apk. 2,6. Die Kleriker lebten in Ehe und Konkubinat.<br />
3.3. Das Ende des Investiturstreits 48<br />
Das Wormser Konkordat <strong>von</strong> 1122 beschließt das Ende des Investiturstreits, und zwar zwischen<br />
König Heinrich V. und dem Papst Kalixt <strong>II</strong>.<br />
Heinrich verzichtete <strong>auf</strong> die Investitur <strong>von</strong> Ring und Stab, d. h. <strong>der</strong> König darf hinfort nicht<br />
mehr die geistliche Würde (Bischofsamt) und den Besitz (Bistum; Kirchengebäude) übertragen.<br />
Die Wahl des Bischofs erfolgt durch Klerus und Adel. Der König darf anwesend sein.<br />
Der König darf aber weiterhin die Investitur mit dem Zepter übertragen, d. h. <strong>der</strong> Kirche<br />
weltlichen Besitz (Gebiete) verleihen (belehen!). Die Bischöfe leisten dem König politische<br />
Treue.<br />
Exkurs: Lehen<br />
Das Wort Lehen hat mit dem Verb „leihen“ zu tun, lat. „feudum“ (daher „feudal, Feudalherren“).<br />
Der Herr (König, Adel, Graf, Fürst) leiht dem Untertanen Besitz und/o<strong>der</strong> Land. Der Leihende<br />
verbürgt mit Treue, Dienstbarkeit, Naturalabgaben und Heeresdienst. Vor dem Lehnshof wurde<br />
<strong>der</strong> Lehnseid geschworen. Der Lehnsdienst konnte auch aus Heerfahrt und Hoffahrt bestehen.<br />
Lehnsherren o<strong>der</strong> Feudalherren hatten Leibeigene. Das Lehnverhältnis wurde begründet durch<br />
förmliche Belehung (Investitur), meist unter Darreichung <strong>von</strong> Herrschaftsymbolen (Schwert,<br />
Zepter, Fahne, Ring, Kreuz, Handschuh). 49<br />
Exkurs Ende<br />
47 Heussi, Kompendium, § 48 b und § 50 t - z<br />
48 Heussi, Kompendium § 50 x<br />
49 Brockhaus Enzyklopädie, Bd. 13, S. 216<br />
19
Belehnung<br />
mit<br />
Besitz und<br />
Amt.<br />
____<br />
Schutz<br />
Die Lehnpyramide<br />
König gibt<br />
Grundbesitz<br />
und<br />
Ämter<br />
Herzöge und Bischöfe<br />
verleihen<br />
Land und Ämter<br />
Ritter und Äbte<br />
geben<br />
Land und Schutz<br />
Hörige und leibeigene Bauern<br />
- Abgabe <strong>von</strong><br />
Naturalien<br />
- Arbeitsdienst<br />
- Heeresdienst<br />
- Hofdienst<br />
20
Der Wortlaut des Wormser Konkordats:<br />
„Der Kaiser übergibt Gott, dem heiligen Petrus und Paulus und <strong>der</strong> heiligen katholischen<br />
Kirche alle Investitur mit Ring und Stab. Er gestattet, dass in allen Kirchen in<br />
seinem Königsland und Reich die Wahl und Weihe frei nach den Kirchgesetzen (kanonisch)<br />
geschehe. Der Papst gesteht zu, dass die Wahl deutscher Bischöfe und Äbte in<br />
Gegenwart des Kaisers, aber ohne Gewalt und Simonie vollzogen werde. Bei zwiespältiger<br />
Wahl hilft <strong>der</strong> Kaiser dem verständlichen Teile nach des Erzbischofs und <strong>der</strong> Bischöfe<br />
Rat. Der Gewählte empfängt die Reichslehen durch das kaiserliche Zepter und<br />
leistet, was Rechtens ist, und wird dann investiert. In den an<strong>der</strong>en Teilen des Reichs<br />
empfängt <strong>der</strong> Investierte in gleicher Weise binnen sechs Monaten die Belehnung.“ 50<br />
Die Kurie hat den Friedensschluss <strong>auf</strong> <strong>der</strong> ersten ökumenischen Lateransynode 1123 als<br />
ihren Sieg gefeiert.<br />
3.4. Die Aufhebung des geistlichen Fürstentums<br />
Im Jahre 1803 wurde nach dem Reichsdeputationsbeschluss <strong>von</strong> Regensburg das geistliche<br />
Fürstentum <strong>auf</strong>gehoben. Die Landesherren konnten nun mit kirchl. Besitztümern verfahren<br />
wie sie wollten. Viele Klöster wurden <strong>auf</strong>gelöst.<br />
Der Reichsdeputationsbeschluss regelte auch noch einmal den Konfessionalismus. Die<br />
Landesfürsten sollten Menschen an<strong>der</strong>er Konfessionszugehörigkeit dulden. Volle politische<br />
und bürgerliche Gleichberechtigung für Konfessionsmin<strong>der</strong>heiten in einem Bundesland.<br />
4. Die clunische Reformbewegung<br />
4.1. Die Klosterreform<br />
Herrschsucht, Laienbischöfe, Säkularismus, Ausschweifung, Nikolaitismus (Konkubinat)<br />
und Simonie (Priesteramt k<strong>auf</strong>en) beherrschten die kirchliche Bühne im 10.Jh. Reformen<br />
waren notwendig und diese begannen wie so oft in <strong>der</strong> Stille, in dem Kloster Cluny in Südfrankreich.<br />
a) Gründung<br />
Das Koster Cluny wurde 910 n.C. vom Herzog Wilhelm <strong>von</strong> Aquitanien begründet. 51<br />
b) Reformen<br />
1) Reform <strong>der</strong> Kosterwirtschaft: Ausdehnung des Klostergutes und Sicherstellung gegen<br />
Raublust weltlicher Herren.<br />
2) Befreiung <strong>der</strong> Klöster <strong>von</strong> <strong>der</strong> Obergewalt des Episkopats. Unmittelbare Unterstellung<br />
unter den Papst.<br />
3) Strenge Durchführung <strong>der</strong> Mönchszucht nach <strong>der</strong> Benediktinerregel.<br />
4) Pflege einer spezifisch romanischen Mönchsreligiosität (Mystik).<br />
50 Aus: Th. Brandt, Kirche im Wandel <strong>der</strong> Zeit, Teil 1, S. 177<br />
51 Abb. in Tim Dowley, Atlas, S. 96.<br />
21
c) Ausbreitung<br />
In kurzer Zeit breiteten sich die Reformen <strong>auf</strong> alle Klöster Frankreichs und Norditaliens<br />
aus. Unabhängig da<strong>von</strong> breitete sich analog dazu die lothringische Klosterreform in<br />
Deutschland aus.<br />
Innerhalb <strong>von</strong> 100 Jahren hatte Cluny 165 Tochterklöster und 1000 Mönchsgemeinschaften.<br />
52<br />
4.3. Die kirchenpolitischen Reformen<br />
Die Klosterreform <strong>von</strong> Cluny dehnte sich aus <strong>auf</strong> die Kirchen. Die Reformfreunde begannen<br />
den Kampf gegen Simonie und Nikolaitismus.<br />
a) Zustand (Simonie)<br />
Johann XIX. hatte das Gold rollen lassen, um Papst zu werden.<br />
Später verk<strong>auf</strong>te Benedikt IX. die päpstliche Würde an den römischen Kleriker Johannes<br />
Gratian.<br />
b) Heinrich <strong>II</strong>I. besiegt die Simonie<br />
Der deutsche König Heinrich <strong>II</strong>I. (1039 – 1056), <strong>der</strong> durch seine Gemahlin Agnes <strong>von</strong><br />
Poitou eng mit Cluny verbunden war, beseitigte 1046 <strong>auf</strong> den Synoden zu Sutri und<br />
Rom die simonitischen Päpste. Nun wurde ein neuer Papst Klemens <strong>II</strong>. vom Klerus<br />
und Volk kanonisch gewählt. Jener krönte gleichzeitig Heinrich in Rom zum Kaiser. In<br />
<strong>der</strong> Zeit Heinrichs <strong>II</strong>I. waren alle Päpste aus Deutschland.<br />
Papst Leo IX. begründete 1050 das Kardinalat, d. i. <strong>der</strong> päpstliche Senat. Das Wort<br />
kommt vom Lat. „cardo“, was „Türangel, Drehpunkt“ bedeutet. Die Kardinäle sollen<br />
mit dem Papst in enger Tuchfühlung sein, damit die Hierarchie unter Kontrolle bleibt.<br />
5. Endgültiger Bruch zwischen Rom und Byzanz<br />
Schisma <strong>von</strong> 1054 n.C.<br />
Dogmatische Unterschiede hatte es zwischen Rom und Byzanz schon immer gegeben<br />
(Zwei-Naturen-Lehre). Rom berief sich stets <strong>auf</strong> das Patrimonium Petri. Byzanz aber wollte<br />
Rom ebenbürtig sein. Es waren machtpolitische Streitigkeiten um Gebiete. Das byzantinische<br />
Patriarchat erkannte auch nie den Papst an! Der Knall kam 1054 n.C. Die päpstliche<br />
Kurie legte am 16.Juli 1054 den päpstlichen Bannfluch über Byzanz <strong>auf</strong> den Altar <strong>der</strong> Hagia<br />
Sophia. Dar<strong>auf</strong>hin antworteten die Byzantiner mit <strong>der</strong> Exkommunikation (Abbruch<br />
aller Beziehungen).<br />
Auf dem <strong>II</strong>. Vatikanischen Konzil <strong>von</strong> 1965 nahm Rom die Bannbulle gegen Byzanz zurück<br />
(ökumenische Bestrebungen).<br />
In den Texten des Zweiten Vatikanischen Konzils heißt es:<br />
„Da nun eine gewisse Verschiedenheit <strong>der</strong> Sitten und Gebräuche, wie sie<br />
oben erwähnt wurde, nicht im geringsten <strong>der</strong> Einheit <strong>der</strong> Kirche entgegensteht,<br />
son<strong>der</strong>n vielmehr ihre Zierde und Schönheit vermehrt und zur Erfüllung ihrer Sendung<br />
nicht wenig beiträgt, so erklärt das Heilige Konzil feierlich, um jeden Zweifel<br />
auszuschließen, dass die Kirchen des Orients, im Bewusstsein <strong>der</strong> notwendigen<br />
Einheit <strong>der</strong> ganzen Kirche, die Fähigkeit haben, sich nach ihren eigenen Ordnun-<br />
52 Abb. Tim Dowley, Atlas, S. 97.<br />
22
gen zu regieren, wie sie <strong>der</strong> Geistesart ihrer Gläubigen am meisten entsprechen<br />
und dem Heil <strong>der</strong> Seelen am besten dienlich sind.“ 53<br />
In Bezug <strong>auf</strong> die dogmatischen Unterschiede zwischen West und Ost hält das Zweite Vatikanische<br />
Konzil fest, dass Differenzen sehr gut zur Klärung bestimmter Fragen beitragen.<br />
6. Das Diktat Gregors V<strong>II</strong>. - Heinrichs Bußgang nach Canossa<br />
6.1. Das Diktat in 27 Thesen<br />
Gregor V<strong>II</strong>. (1073-1085) festigte das geistliche und weltliche Machtmonopol<br />
wie kein Papst vor ihm. Der Papst ist nicht nur <strong>der</strong> Herr <strong>der</strong> Universalkirche,<br />
son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong> Herr <strong>der</strong> Welt. Er bezeichnete sich selbst als die Sonne und<br />
den König als Mond, <strong>der</strong> <strong>von</strong> <strong>der</strong> Sonne das Licht empfängt, was bedeutet, dass<br />
<strong>der</strong> König dem Papst untergeordnet ist.<br />
Als sichtbares Zeichen trug <strong>der</strong> Papst die Tiara, die Krone, ein Zeichen <strong>der</strong><br />
fürstlichen Gewalt (später bestand sie aus drei Kronen). 54<br />
Bei <strong>der</strong> Liturgie trägt <strong>der</strong> Papst die Mitra, die spitze Bischofsmütze.<br />
Als Zeichen <strong>der</strong> päpstlichen Macht führt er den Hirtenstab.<br />
Gregor V<strong>II</strong>. verfasste 27 Thesen, die „Dictatis Gregorii Papae“, in denen er<br />
seine Position festigte 55 :<br />
1) Die Römische Kirche ist <strong>von</strong> dem Herrn allein gegründet worden.<br />
2) Der Römische Bischof allein darf <strong>der</strong> allgemeine Bischof genannt werden.<br />
3) Nur jener kann Bischöfe absetzen o<strong>der</strong> wie<strong>der</strong> in die Gemeinschaft <strong>der</strong> Kirche <strong>auf</strong>nehmen..<br />
4) Sein Legat soll allen Bischöfen <strong>auf</strong> dem Konzil vorsitzen, auch wenn er geringeren Ranges ist, und er<br />
kann über sie das Urteil <strong>der</strong> Absetzung aussprechen..<br />
5) Der Papst vermag Abwesende abzusetzen.<br />
6) Mit denen, die er in den Bann getan hat, soll man unter an<strong>der</strong>em nicht im selben Hause<br />
weilen.<br />
7) Er allein darf, wenn es die Zeit erfor<strong>der</strong>t, neue Gesetze geben, neue Gemeinden bilden, aus<br />
einem Chorherrenstift eine Abtei machen und an<strong>der</strong>erseits ein reiches Bistum teilen und<br />
arme Bistümer zusammenlegen.<br />
8) Er allein darf sich <strong>der</strong> kaiserlichen Insignien bedienen.<br />
9) Des Papstes Füße allein haben alle Fürsten zu küssen.<br />
10) Sein Name allein darf in den Kirchen genannt werden.<br />
11) Dieser Name ist einzig in <strong>der</strong> Welt.<br />
12) Ihm ist es erlaubt, Kaiser abzusetzen.<br />
13) Ihm ist es gestattet, falls die Notwendigkeit dazu zwingt, Bischöfe <strong>von</strong> einem Sitze nach einem an<strong>der</strong>en<br />
zu versetzen.<br />
14) Er kann einen Geistlichen <strong>von</strong> je<strong>der</strong> Kirche senden, wohin er will.<br />
15) Der <strong>von</strong> ihm Eingesetzte kann wohl einer an<strong>der</strong>n Kirche vorstehen, darf aber nicht dienen und soll auch<br />
nicht <strong>von</strong> irgendeinem Bischof einen höheren Rang annehmen.<br />
16) Keine Synode darf ohne seine Einwilligung als eine allgemeine bezeichnet werden.<br />
17) Kein Rechtssatz und kein Buch darf ohne seine Ermächtigung als kanonisch gelten.<br />
18) Sein Ausspruch darf <strong>von</strong> keinem in Frage gestellt werden; er selbst darf allein die Urteile aller verwerfen.<br />
19) Er selbst darf <strong>von</strong> niemand gerichtet werden.<br />
20) Niemand unterfange sich, einen zu verurteilen, <strong>der</strong> an den Apostolischen Stuhl appelliert.<br />
21) Alle wichtigeren Angelegenheiten einer jeden Kirche sollen dem Apostolischen Stuhl übertragen werden.<br />
22) Die Römische Kirche hat sich nie geirrt und wird nach dem Zeugnis <strong>der</strong> Schrift nie in Irrtum verfallen.<br />
23) Der Römische Bischof wird, falls seine Wahl kanonisch gültig erfolgte, unzweifelhaft kraft <strong>der</strong> Verdienste<br />
des heiligen Petrus heilig, wie <strong>der</strong> heilige Bischof Ennodius <strong>von</strong> Pavia bezeugt; ihm stimmen viele heilige<br />
Väter zu, wie man aus den Dekreten des seligen Papstes Symmachus ersehen kann.<br />
24) Nach seiner Entscheidung und mit seiner Erlaubnis ist es den Untertanen gestattet, Klage zu erheben.<br />
53 Karl Rahner u. Herbert Vorgrimler, Kleines Konzilkompendium, S. 244.<br />
54 Abb. In: 2000 J. Christentunm, S. 287.<br />
55 Günther Stemberger, 2000 J. Christentum, S. 286 – 288.<br />
23
25) Er vermag ohne Mitwirkung einer Synode Bischöfe abzusetzen und Gebannte wie<strong>der</strong> in die Gemeinschaft<br />
<strong>der</strong> Kirche <strong>auf</strong>zunehmen.<br />
26) Niemand soll als Katholik gelten, <strong>der</strong> nicht mit <strong>der</strong> katholischen Kirche übereinstimmt.<br />
27) Er vermag Untertanen <strong>von</strong> ihrer Treueverpflichtung gegen Ungerechte zu entbinden.<br />
6.2. Heinrichs Bußgang nach Canossa<br />
Auf <strong>der</strong> Fastensynode 1074 verschärfte Papst Gregor V<strong>II</strong>. die Zölibatsvorschriften. Die<br />
Amtshandlungen <strong>der</strong> verheirateten Priester erklärte er für ungültig.<br />
Auf <strong>der</strong> Fastensynode 1075 verbot er die Laieninvestitur. Der König durfte keine Bischöfe<br />
mehr einsetzen. Damit wären alle materiellen Verpflichtungen <strong>der</strong> Bischöfe nicht an den<br />
König gegangen, son<strong>der</strong>n an den Papst.<br />
Der dt. König Heinrich IV. wi<strong>der</strong>sprach und setzte eigenmächtig Bischöfe ein. Auf <strong>der</strong><br />
Synode zu Worms 1076 setzte Heinrich IV. den Papst einfach ab.<br />
Dar<strong>auf</strong>hin exkommunizierte <strong>der</strong> Papst den König. Nun aber fielen die dt. Bischöfe und<br />
Fürsten <strong>von</strong> Heinrich ab, da er im päpstlichen Bann verweilte. Binnen Jahresfrist sollte<br />
Heinrich Kirchenbuße tun.<br />
Ihm blieb nichts an<strong>der</strong>es übrig, als sich <strong>auf</strong> den Weg nach Rom zu begeben, um vor dem<br />
Papst barfüßig zu erscheinen.<br />
Der Papst befand sich 1077 <strong>auf</strong> <strong>der</strong> italienischen Burg Canossa. Mit Mühe gelangte Heinrich<br />
über die schneebedeckten Alpen, bis er schließlich Canossa erreichte. Im Büßergewand,<br />
ohne königliche Würdezeichen, erschien Heinrich an drei Tagen hintereinan<strong>der</strong> barfuß<br />
vor <strong>der</strong> im Schnee liegenden Burg. Da musste <strong>der</strong> Papst ihn vom Bann lossprechen.<br />
Canossa bedeutete den Tiefpunkt in <strong>der</strong> Geschichte des dt. Königtums. Daraus haben die<br />
Dt. gelernt, denn fortan stärkten sie ihr Nationalbewusstsein.<br />
Später jedoch musste Papst Gregor V<strong>II</strong>. wegen Unruhen Rom verlassen. Er starb 1085 in<br />
Süditalien mit den Worten:<br />
„Ich habe die Gerechtigkeit geliebt und das Unrecht gehasst. Deshalb sterbe ich in <strong>der</strong><br />
Verbannung.“<br />
V. Die Kreuzzüge<br />
1. Die Gründe<br />
Die Kreuzzüge stellen ein <strong>der</strong> dunkelsten Kapitel in <strong>der</strong> KG dar.<br />
1. Grund:<br />
Das Vordringen des Islam bis nach Spanien. Im 11. Jh. bekämpften <strong>der</strong> spanische<br />
und <strong>der</strong> südfranzösische Adel erfolgreich die arabische Macht.<br />
1090 verdrängten die Normannen <strong>auf</strong> Sizilien die Sarazenen.<br />
2. Grund<br />
Es gab Pilgerfahrten ins Heilige Land. Aber als die Seldschuken (Türken) das Hl.<br />
Land besetzten, kam es immer wie<strong>der</strong> zu Übergriffen <strong>auf</strong> die Pilgrime. Das Hl.<br />
Land war im Besitz des Islam. Das konnte die westl. Kirche nicht länger dulden.<br />
3. Grund<br />
Auch Byzanz fürchtete sich vor dem Vordrängen <strong>der</strong> Türken. Der byzantinische<br />
Kaiser Alexios I. Kommenos bat den Westen um Hilfe.<br />
4. Grund<br />
Der Aufruf des Papstes Urban <strong>II</strong>.<br />
Er versprach ritterliche und kirchliche Ehren, sowie vollkommenen Ablass aller<br />
Sünden. Die Kreuzfahrer wurden zur militia St. Petri (Militär des Petrus).<br />
24
Urban <strong>II</strong>. verkündigte die Kreuzzüge als gottgewollt (deus lo volt: Gott will es).<br />
So verblendet waren die Menschen, dass sei die Bibel mit dem Schwert verwechselten.<br />
Außerdem lockten Abenteuer und Beute.<br />
2. Der erste Kreuzzug 56<br />
2.1 Die Rede Urban <strong>II</strong>.<br />
Zum Abschluss einer Kirchenversammlung in Clermont (Südfrankreich) im Jahr 1095, an<br />
<strong>der</strong> mehr als 600 Bischöfe und Äbte teilnahmen, hielt <strong>der</strong> Papst eine öffentliche Rede im<br />
Freien vor dem Volk und rief zum 1. Kreuzzug <strong>auf</strong>:<br />
„Das gottlose Volk <strong>der</strong> Sarazenen hat das Heilige Land besetzt und hält die Gläubigen<br />
dort in Knechtschaft und Unterwerfung. Wem will nicht das Herz darüber<br />
brechen? Die ehrwürdigen Orte sind in Schafrippen und Viehställe verwandelt.<br />
Welche Schmach für den Ort, wo Christus gelebt! Jerusalem ist Christi Erbgut, es<br />
gehört ihm zu eigen. Bewaffnet euch, liebe Brü<strong>der</strong>, seid Gefolgsleute des Herrn!<br />
Ich rufe euch zum Kriegsdienst Gottes! Erobert die Stammburg Christi zurück.<br />
Seid Lehensmannen des Heilands! Macht seine Sache zur euren! Er vertraut eurer<br />
Tapferkeit und eurem Ehrgefühl. Das ist kein unrechter Krieg, es ist Gottes Kampf,<br />
ein Kreuzzug des Herrn. Und wenn ihr fragt, was ihr <strong>von</strong> Gott als sicheren Lohn<br />
für solche Kriegsarbeit erwarten dürft, so verspreche ich euch, dass je<strong>der</strong>, <strong>der</strong> das<br />
Zeichen des Kreuzes nimmt und ein reines Bekenntnis ablegt, <strong>von</strong> aller Sünde frei<br />
sein soll und das ewige Leben empfangen wird, wenn er sein irdisches Leben <strong>auf</strong><br />
diesem Kreuzzug verliert.“ 57<br />
Der erste Kreuzzug dauerte <strong>von</strong> 1096 bis 1099.<br />
5000 Ritter und 30000 Freiwillige brachen <strong>auf</strong>. Sie erreichten Byzanz und 1099 eroberten<br />
die Kreuzfahrer Jerusalem. Gottfried <strong>von</strong> Bowillon, Herzog <strong>von</strong> Nie<strong>der</strong>lothringen, ließ<br />
sich zum Herzog des hl. Grabes krönen.<br />
Die Kreuzfahrer hatten immer ein Schild mit dem Kreuz.<br />
Auf den Kreuzfahrten kam es auch zu Judenverfolgungen, denn auch sie gehörten ja<br />
zu einer an<strong>der</strong>en Weltreligion.<br />
Es entstanden Kreuzfahrerstaaten (Putzger, S. 49).<br />
� Klein-Armenien: 1091-1375<br />
� Antiochien:1098-1268<br />
� Edessa:1098-1146<br />
� Königreich Jerusalem: 1099-1187 + 1299-1244<br />
Es entstanden mehrere Burgen und Schlösser.<br />
2. Der zweite Kreuzzug (1147-1149) Ludwig V<strong>II</strong> + Konrad <strong>II</strong>I.<br />
Einige Kreuzfahrer waren im Hl. Land geblieben und wurden sesshaft. Es gab immer wie<strong>der</strong><br />
Zwistigkeiten mit den Arabern. Bernhard <strong>von</strong> Clairveaux rief zum Zweiten Kreuzzug<br />
<strong>auf</strong>:<br />
„Seht, die heilserfüllten Tage sind da. Erschüttert wurden die Lande und bebten, weil Gott<br />
im Himmel sein Land zu verlieren begann. Sein Land, sage ich; dort sah man ihn das Wort<br />
seines Vaters lehren, dort wandelte er über 30 Jahre als Mensch unter Menschen. Sein<br />
Land, das er mit Wun<strong>der</strong>n erleuchtet, das er mit dem eignen Blute geweiht hat, darin die<br />
ersten Blüten <strong>der</strong> Auferstehung erschienen. Jetzt schaffen es unsere Sünden, dass dort die<br />
Feinde des Kreuzes ihr verruchtes Haupt erhoben haben; mit <strong>der</strong> Schärfe des Schwertes<br />
56 Tim Dowley, Atlas – Bibel und Geschichte des Christentums, S. 98 f.<br />
57 Wolfgang Hug u. Erhard Rumpf, Menschen in ihrer Zeit, Bd. <strong>II</strong>I, Mittelalter, Ernst Klett Verlag, Stuttgart,<br />
1970.<br />
25
verheeren sie das Land <strong>der</strong> Verheißung. Schon ist es nicht fern – wenn kein Verteidiger<br />
sich findet - , und sie brechen ein in die Stadt des lebendigen Gottes selbst, sie zerstören<br />
die Stätten unserer Erlösung und besudeln die heiligen Orte, wo das fleckenlose Lamm<br />
sein purpurnes Blut ließ... Was tut Ihr, tapfere Männer? Was tut Ihr, Diener des Kreuzes?<br />
So wollt Ihr das Heiligtum den Hunden und die Perlen den Säuen geben? ... Enden möge<br />
jene Ritterunart <strong>von</strong> ehedem, nach <strong>der</strong> ihr einan<strong>der</strong> zu ver<strong>der</strong>ben pflegt und einer den an<strong>der</strong>n<br />
umbringt... Du tapferer Ritter, Du Mann des Krieges, jetzt hast Du eine Fehde ohne<br />
Gefahr, wo <strong>der</strong> Sieg Ruhm bringt und dem Tode Gewinn!... Nimm das Kreuzeszeichen,<br />
und für alles, was Du reuigen Herzens beichtest, wirst Du <strong>auf</strong> einmal Ablass erlangen.“ 58<br />
Dieser endete vor den Toren Damaskus. Viele waren durch Hunger und durch Türkenangriffe<br />
ums Leben gekommen.<br />
3. Der dritte Kreuzzug (1189-1192) Dtv-Atlas, I, 151<br />
Kaiser Friedrich I. Barbarossa führt den dritten Kreuzzug an. Die Idee: Universelle Stellung<br />
des Kaisers an <strong>der</strong> Spitze des Christl. Abendlandes. Nach dem glänzenden Sieg bei<br />
Ikonion am 10.6. 1190 ertrinkt Barbarossa im Kalykadnus (Salph).<br />
Richard Löwenherz <strong>von</strong> England und Philipp <strong>II</strong>. August (Frankr.) erobern Akkon:<br />
Friedensvertrag mit den Arabern. Die Christen dürfen Jerusalem besuchen.<br />
4. Kreuzzug: 1202-1204: Papst Innozenz <strong>II</strong>I.<br />
Der Adel Europas erobert Konstantinopel und errichtet das Lateinische Kaisertum.<br />
1212 Kin<strong>der</strong>kreuzzug: Tausende Kin<strong>der</strong> werden durch betrüger. Reden <strong>von</strong> Marseille nach<br />
Alexandria als Sklaven verk<strong>auf</strong>t.<br />
5. Kreuzzug: 1228-29<br />
Die Kreuzfahrer erhalten durch Vertrag Jerusalem, Bethlehem und Nazareth.<br />
6. Kreuzzug 1248-1254<br />
Vergeblicher Versuch, Ägypten zu erobern.<br />
7. Kreuzzug: 1270 <strong>der</strong> letzte K.<br />
Ein großes Heer kommt bei Tunis um.<br />
Folgen: Gesteigerter Handel mit dem Orient.<br />
Aufsteigendes Bürgertum<br />
58 A. Sierszyn, 2000 Jahre <strong>Kirchengeschichte</strong>, Bd. 2, S. 128 f.<br />
26
VI. Die Orden<br />
1. Einleitung<br />
1.1 Klöster und Mönche<br />
Das Mönchtum entsteht schon im 3. Jh. n.C. Das griech. Wort Monachus bedeutet "<strong>der</strong><br />
Einsame". Die Mönche entfliehen dem pompösen weltlichen und kirchlichen Treiben und<br />
wan<strong>der</strong>n in die Einsamkeit, um in <strong>der</strong> Stille ungestört die Bibel zu lesen, zu beten und zu<br />
meditieren (auch Eremiten genannt, <strong>von</strong> Eremos = <strong>der</strong> Einsame).<br />
Schon bald fanden sich viele Mönche zusammen und gründeten ein Kloster. Das erste<br />
Kloster wurde <strong>von</strong> Pachomius 323 n.C. zu Tabennisi gegründet. Das erste Kloster war<br />
schon bald mit 1300 Mönchen überfüllt. Es entstanden Tochterklöster.<br />
Im Jahr 529 verfasst Benedict (<strong>der</strong> Gesegnete) <strong>von</strong> Nursia die später nach ihm benannte<br />
benediktinische Mönchsregel (Sierszyn, Bd. I, S. 251 ff).<br />
Die Regeln Benedikts sind in <strong>der</strong> einen Sentens zusammengefasst: ora et labora<br />
(bete und arbeite).<br />
Es gibt drei Hauptregeln:<br />
(1) Ortsbeständigkeit<br />
(2) Armut<br />
(3) Gehorsam<br />
Der Tag ist <strong>von</strong> 2Uhr morgens bis 20 Uhr straff eingeteilt.<br />
Die Klöster aber haben oft untereinan<strong>der</strong> keine Verbindung, obwohl überall die Regel<br />
Benedikts vorherrschend ist. Die Klöster unterstehen dem Bischof, in dessen Amtsbezirk<br />
sie liegen.<br />
Dies än<strong>der</strong>t sich durch die Orden. Die Orden schließen mehrere Klöster zusammen.<br />
Sie alle unterstehen dem Mutterkloster und dem Abt.<br />
2. Die Zisterzienser (o<strong>der</strong> Bernhardiner)<br />
2.1 Entstehung<br />
Der Benediktinerabt Robert <strong>von</strong> Molesme gründet 1098 an diesem einsamen und wilden<br />
Ort, genannt Distercium (daher <strong>der</strong> Name des Ordens) ein kleines Kloster.<br />
Schon bald wird ein junger Mönch namens Bernhard be<strong>auf</strong>tragt, ein Tochterkloster zu<br />
gründen.<br />
Bernhard wählt als Ort eine noch unberührte Wildnis, ein Sonnen beschienenes Tal in<br />
Nordburgund. Er nennt den Ort Clara Vallis = lichtes Tal. Daraus wird später <strong>der</strong> Name<br />
Clairvaux.<br />
Schon bald gab es viele Tochterklöster. Stephan Harding löste die Klöster <strong>von</strong> den Benediktinern<br />
- obwohl er die Regeln beibehielt - und fasste sie zu einem selbständigen Orden<br />
zusammen.<br />
27
In <strong>der</strong> charta charitatis <strong>von</strong> 1118 werden alle Zisterzienser - Klöster direkt dem Papst unterstelt<br />
und nicht mehr dem Bischof. An <strong>der</strong> Spitze <strong>der</strong> Klöster steht <strong>der</strong> Abt <strong>von</strong> Cistercium<br />
(Cîteaux).<br />
2.2 Bernhard prägt den Orden<br />
Beson<strong>der</strong>s Bernhard <strong>von</strong> Clairvaux ist es, <strong>der</strong> den Zisterzienserorden prägt. Nach Bernhards<br />
Willen müssen die Klöster wie<strong>der</strong> mehr Orte <strong>der</strong> Weltflucht werden.<br />
Auch in <strong>der</strong> Kleidung sollen Armut und Bescheidenheit zum Ausdruck kommen. Die faltenreiche<br />
schwarze Mönchskette <strong>der</strong> Cluniazenser weicht einem schlichten, ungefärbten<br />
Ordenskleid aus Wolle. Auch das Meßgewand soll nicht aus Seide, son<strong>der</strong>n aus ungefärbter<br />
wolle o<strong>der</strong> Baumwolle gefertigt werden.<br />
Kreuze und Kelche müssen aus Holz sein, denn Christus hat nicht an einem Silberkreuz<br />
erlöst.<br />
"Die Wände <strong>der</strong> Kirchen strahlen, doch die Armen leiden Not", takelt Bernhard seine Zeit<br />
(Sierszyn, <strong>II</strong>, 125).<br />
Während 30 Jahren besteht seine Abtzelle aus einem bescheidenen Winkel neben <strong>der</strong><br />
Pforte. Sein Haupt legt er <strong>auf</strong> ein mit Stroh umwickeltes Stück Holz. In Windeseile verbreitet<br />
sich <strong>der</strong> neue Orden. "Die Welt ist voll Mönche!" jubelt Bernhard (Sierszyn, <strong>II</strong>,<br />
125).<br />
Den Zisterzienserkirchen - alles Marienkirchen - fehlen ursprünglich die Türme. Die Fensterverglasung<br />
darf nur aus Scheiben mit Schil<strong>der</strong>ungen in grauer Farbe bestehen.<br />
Erst später sind es die Zisterzienser, die breiten Glasflächen <strong>der</strong> gotischen Fenster ihrer<br />
Kirchen mit farbiger Malerei schmücken. So werden manche Zisterzienserklöster zu Zentren<br />
<strong>der</strong> Glasmalerei.<br />
2.3 Die Ausbreitung und die Laienbrü<strong>der</strong><br />
Die Mönche stammen vorwiegend aus dem Adel. Nun kommen auch die sog. Laienbrü<strong>der</strong><br />
(fratres laici) aus dem Bauernstand hinzu. Sie nehmen am Klosterleben teil, aber nicht an<br />
<strong>der</strong> Regierung.(Abtwahl usw.). Vor allen Dingen sind sie für den Ackerbau zuständig. In<br />
Mecklenburg Vorpommern und Brandenburg leisten sie um 1200 n.C. kolonisatorische<br />
und kulturelle Pionierarbeit. Orte wie Lehnin, Chorin, Deberan o<strong>der</strong> Pelpin sind Gründungen<br />
<strong>der</strong> Bernhardiner.<br />
Um 1270 werden 671 Zisterzienserabteien gezählt. Der Orden als solcher lebt bis<br />
zur Gegenwart weiter.<br />
2.4. Bernhard <strong>von</strong> Clairvaux<br />
Heussi §54; Sierszyn, 2, 116 ff<br />
Bernhard (1091-1153) gründete 68 Klöster in Frankreich, Deutschland und in <strong>der</strong> Schweiz.<br />
Seine Bedeutung erstreckt sich vom Mönchtum über das Papsttum und das Rittertum bis<br />
zur Mystik. Man hat ihn auch als ungekrönten Papst und Kaiser bezeichnet. Das 12. Jh.<br />
Bezeichnet man schlechthin als das bernhardinische. Er selbst nennt sich die „Chimäre“<br />
(das Unwesen) des Jh..<br />
An Papst Eugen 3. schreibt er, dass <strong>der</strong> Papst nicht herrschsüchtig sein soll, son<strong>der</strong>n ein<br />
Diener aller.<br />
28
„Denn nackt bist du geboren und nackt musst du <strong>von</strong> dannen.“<br />
Dennoch hält Bernhard an die Stellvertretungstheorie des Papstes fest.<br />
Bernhard als Mystiker<br />
Das 12. und 13. Jh. ist das Zeitalter des Minnesangs. Mittelpunkt <strong>der</strong> Dichtung ist die Liebe.<br />
(„Dt.MA.“ S. 756). Bernhard knüpft an und spricht <strong>von</strong> <strong>der</strong> Liebe zu Gott.<br />
Er unterscheidet vier Stufen <strong>der</strong> Liebe:<br />
1. Der Mensch liebt sich selbst um seiner selbst willen<br />
2. Der Mensch liebt Gott, weil Gott ihm aus <strong>der</strong> Not helfen kann = egoistische Gottesliebe<br />
3. Der Mensch liebt Gott, weil es eine Freude ist ihn zu lieben.<br />
4. Der Mensch liebt Gott und auch sich selbst nur noch um Gottes willen. Er ist ein<br />
Geist mit Gott.<br />
Wenn man durch Meditation und Kontemplation die vierte Stufe erreicht, dann ist die Seele<br />
eins mit Gott. Das ist die unio mystica. Gott erfüllt die Seele so, dass diese in Gott <strong>auf</strong>geht.<br />
Mystik kommt <strong>von</strong> dem griechischen Wort : mylin= die Augen schließen.<br />
Bernhard ist Christus - Mystiker.<br />
Die Meditation geschieht noch bei wachem Zustand. Bei <strong>der</strong> Kontemplation des Gekreuzigten<br />
ist die Seele entrückt (2. Kor. 12, 2) Bernhard ist <strong>der</strong> mittelalterliche Schöpfer <strong>der</strong><br />
Blut-und Wundenfrömmigkeit. Auf ihn zurück geht das Passionslied <strong>von</strong> Paul Gerhard:<br />
„Oh Haupt voll Blut und Wunden“<br />
Der Abt <strong>von</strong> Clairvaux schrieb 86 Auslegungen über das Hohelied, welches er christozentrisch<br />
auslegt. Christus ist <strong>der</strong> Bräutigam, die Seele ist die Braut. Schon Origenes pflegt im<br />
3. Jh. diese Auslegung. Die Theologie Bernhards ist staurozentrisch: „Jesus kennen, den<br />
Gekreuzigten, das ist die Summe meiner Weisheit.“<br />
Beurteilung<br />
1) Die Mystik steht in <strong>der</strong> Gefahr- wie auch die mo<strong>der</strong>ne charismatische Bewegung des<br />
20.Jh.- das Fundament des Wortes Gottes zu verlassen. Mystik hilft dem Menschen,<br />
innerlich zur Ruhe zu kommen, seine Gedanken weg <strong>von</strong> <strong>der</strong> Sünde hin <strong>auf</strong> Christus<br />
zu konzentrieren. Aber Staurologie und Christologie müssen an dem Worte Gottes erwachsen,<br />
sonst besteht die Gefahr, dass an<strong>der</strong>e Mächte und Geister Einfluss gewinnen.<br />
2) Bernhards propagandistische Kreuzzugsreden beweisen, dass er nicht klar <strong>auf</strong> dem<br />
Boden des Wortes Gottes stand.<br />
3) Wenn <strong>der</strong> Gekreuzigte ihm wichtiger war als alles an<strong>der</strong>e in <strong>der</strong> Welt, wie konnte er da<br />
noch das Papsttum anerkennen?<br />
4) Wenn auch Bernhard in <strong>der</strong> Mystik den Gekreuzigten fand , so bleibt er in <strong>der</strong> Dogmatik<br />
doch ein Kind seiner Zeit.<br />
5) Seine Liebe zu Gott scheint nur da bloße Theorie gewesen zu sein, wo es um den<br />
Kreuzzug gegen die Nichtgläubigen ging.<br />
Fazit:<br />
Der geistliche Antagonismus Bernhards ist ein Kennzeichen des ganzen Mittelalters.<br />
3. Spital- und Ritterorden<br />
3.1. Spitalorden<br />
29
Die Spitalorden widmeten sich vor allen Dingen <strong>der</strong> Krankenpflege und <strong>der</strong> Losk<strong>auf</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Christensklaven. Den Dienst an Kranken nennt man in <strong>der</strong> kath. Kirche Charitas ( lat.<br />
„ caritas“ = Liebe/ Nächstenliebe), in <strong>der</strong> ev. Kirche „Diakonie“(gr.“diakonia“= dienen).<br />
Die Spitalorden waren Verbände <strong>von</strong> Laienbru<strong>der</strong>schaften: Also nicht: Kloster, Abt,<br />
Mönche, son<strong>der</strong>n: Haus, Meister, Bru<strong>der</strong>.<br />
3.2. Ritterorden<br />
Die Ritterorden sind eine Frucht <strong>der</strong> Kreuzzüge. Sie bestehen aus zwei Elementen: Rittertum<br />
und Mönchtum. Zu Grunde liegt die Regel Benedikts. Der Zweck des gemeinsamen<br />
Lebens heißt: militare domino christo = Man leistet Militärdienst für den König Christus<br />
im Krieg gegen das Böse:<br />
- im eigenen Herzen als Mönch<br />
- in dieser Welt als Ritter<br />
a) Der älteste Ritterorden: Die Templer<br />
1120 n. Chr. vereinigen sich in Jerusalem acht französische Ritter unter <strong>der</strong> Führung <strong>von</strong><br />
Hugo <strong>von</strong> Payens (Champagne) zu einer mönchischen Genossenschaft zum bewaffneten<br />
Schutz des heiligen Landes und <strong>der</strong> Pilger. Man nannte sie bald „Milites templi“, da ihnen<br />
Balduin 2. <strong>von</strong> Jerusalem einen Teil seines vermeintlich <strong>auf</strong> dem alten Tempelplatz gelegenen<br />
Palastes angewiesen hatte. An <strong>der</strong> Spitze steht <strong>der</strong> <strong>auf</strong> Lebenszeit gewählte Großmeister,<br />
unter ihm die adligen Ritter, die adligen Geistlichen und die nichtadligen dienenden<br />
Brü<strong>der</strong>. Die Ordenstracht <strong>der</strong> Ritter war ein weißer Mantel mit rotem Kreuz. Durch die<br />
Kreuzzüge wurde <strong>der</strong> Orden schnell reich (<strong>der</strong> Mönch bleibt arm). Ihr Haus in Paris, genannt<br />
„Le Temple“, wird im 13. Jh. zur Zentrale des europäischen Geldverkehrs. Schon<br />
bald zerfällt <strong>der</strong> Orden moralisch. 1312 lässt Papst Clemens 5. den Orden <strong>auf</strong>lösen.<br />
b) Johanniterorden (Malteser, Hospitaliter)<br />
Zunächst wurde ein Hospital in Jerusalem gegründet. Das <strong>von</strong> Laien betreute Spital bekommt<br />
den Namen Johannes – Hospital, so benannt nach <strong>der</strong> nahegelegenen Johanneskirche.<br />
1120 macht Meister Raimund du Pui daraus einen Orden. Haupt<strong>auf</strong>gabe: Krankenpflege<br />
und Waffendienst. Ordenstracht: schwarzer Mantel mit weißem Kreuz. Von 1200 –<br />
1500 stellen sie die beherrschende Seemacht dar (Schutz <strong>der</strong> Schiffe vor Piraten). 1530<br />
weist ihnen Karl V. die Insel Malta zu, daher <strong>der</strong> Zusatzname Malteser.<br />
Heute gehören zum Orden 10.000 Mitglie<strong>der</strong>.<br />
Friedrich Wilhelm 4. gründete 1852 auch einen evangel. Zweig <strong>der</strong> Malteser mit <strong>der</strong> Aufgabe<br />
<strong>der</strong> Krankenpflege.<br />
4.Kartäuser und Prämonstratenser<br />
4.1.Die Kartäuser<br />
Bruno <strong>von</strong> Köln gründet mit sechs Brü<strong>der</strong>n 1084 im wilden Felsental Cartusia (daher<br />
Kartäuser) bei Grenobla eine Wohn- und Arbeitsgemeinschaft. Je<strong>der</strong> Kartäuser wohnt<br />
in einem kleinen Häuschen, das eine Werkstatt und drei Räume enthält und zu einem<br />
Gärtchen führt. Sie halten sich an die Benediktinerregel. Außerdem sind Schweigen<br />
und Vegetarismus angebracht. Gemeinschaft findet man im gemeinsamen Chorgebet.<br />
Gegen 1500 werden 230 Kartausen gezählt. 1977 gibt es noch 19 mit 269 Mönchen.<br />
4.2.Prämonstratenser<br />
Norbert <strong>von</strong> Xanten gründet 1120 in Prémonté (daher <strong>der</strong> Name) bei Laon ein Kloster<br />
(Augustinerregel). Die Prämonstratenser sind ein Klerikerorden. Laienbrü<strong>der</strong> besorgen die<br />
30
äußeren Geschäfte und kultivieren ganze Landstriche. 1978 zählt <strong>der</strong> Orden noch 48 Abteien<br />
und 1280 Mitglie<strong>der</strong>.<br />
4.3.Begriffe: Kanoniker und Chorherren<br />
An den Bischofskirchen und größeren Pfarrkirchen einer Stadt brauchte es eine Mehrzahl<br />
<strong>von</strong> Geistlichen zur Erfüllung <strong>der</strong> gottesdienstlichen und seelsorgerlichen Aufgaben. Oft<br />
schlossen sie sich zu einer mönchsähnlichen Gemeinschaft zusammen. Ihr Name wurde in<br />
eine bischöfliche Liste, genannt Kanon, eingetragen. Daher <strong>der</strong> Name Kanoniker. Die Gemeinschaft<br />
als solche nennt man Stift (=fromme Stiftung, Gründung). Im 12. Jh. wird auch<br />
<strong>der</strong> Ausdruck Chorherr gebräuchlich.<br />
5. Die Armutsbewegung<br />
(Sierszyn, <strong>II</strong>, 150ff; Heussi §59)<br />
5.1. Einleitung<br />
Die Armutsbewegung ist ein Sammelname für alle Strömungen des Mittelalters, die sich<br />
gegen den Reichtum <strong>der</strong> Kirche wehren, um diese zur apostolischen Armut zurückzuführen.<br />
Alle europäischen Län<strong>der</strong> liefern dem Papst als Steuer den Denarius Sancti Petri (Peterspfennig).<br />
Seit <strong>der</strong> Kreuzzugszeit hängen Wechseleinrichtungen, Bankwesen und Papsttum<br />
eng miteinan<strong>der</strong> zusammen. Die Kirche des 13. Jhs. wurde schon als Schöpferin des Bankenwesens<br />
bezeichnet. 59<br />
Es gibt vier Versuche, um die Kirche wie<strong>der</strong> zur Armut und Echtheit zurückzuführen:<br />
1. Der politische Weg: Arnold <strong>von</strong> Brescia<br />
2. Die völlige Ablehnung: Albigenser / Katharer<br />
3. Mission und Erneuerung durch die Bibel: Waldenser<br />
4. Innere Erneuerung: Bettelorden<br />
5.2. Joachim, Prophet <strong>der</strong> Endzeit<br />
Joachim aus Kalabrien gründet 1189 seinen eigenen Orden, dem schon bald 40 Klöster<br />
angehören. Joachim meint, dass die Endzeit angebrochen sei und bereitet seine Mönche<br />
dar<strong>auf</strong> vor. Er bedient sich <strong>der</strong> allegorischen Bibelauslegung und berechnet <strong>auf</strong> das Jahr<br />
1260 das Ende <strong>der</strong> Welt. Dann bricht <strong>der</strong> ewige Sabbat an. Das Jahr 1260 ergibt sich aus<br />
<strong>der</strong> Überzeugung, dass die Geschichte <strong>der</strong> Kirche <strong>der</strong>jenigen des Volkes Israel entspricht.<br />
Von Abraham bis <strong>auf</strong> Christus zählt Matthäus 42 Generationen. Da Jesus 30 Jahre alt wurde,<br />
ist das die Zahl einer Generation. 30 x 42 ergibt 1260 n.C. 60 Joachim schreibt auch eine<br />
59 Das europäische Bankwesen hat seinen Ursprung <strong>auf</strong> den großen Handelsplätzen. Hier wurden <strong>auf</strong> einem<br />
großen Tisch (lat. banca) die verschiedensten Münzsorten ausgebreitet und gewechselt. Ein beson<strong>der</strong>er<br />
Schwerpunkt, schon im 12. Jh., liegt in Oberitalien. Bancheri stellten die Familien Medici (14./15. Jh. in<br />
Florenz) und Fugger (seit 15. Jh. Augsburg) . Den Medici entstammen auch verschiedene Päpste.<br />
60 Endzeitberechnungen finden sich immer wie<strong>der</strong> in <strong>der</strong> KG. Der Augustinermönch und Mathematiker (Algebra)<br />
Michael Stifel (*1487, gest. 1567), <strong>der</strong> sich öffentlich für M. Luther einsetzte, berechnete den Welt-<br />
31
Auslegung <strong>der</strong> Offenbarung. Hier findet er sieben Zeitabschnitte. Die siebte Epoche ist das<br />
Millenium.<br />
Endzeitberechnungen per dato sind <strong>der</strong> Hl. Schrift zuwi<strong>der</strong> (SFW). Jesus sagt nur, dass wir<br />
<strong>auf</strong> die Zeichen <strong>der</strong> Zeit achten sollen. Das Datum sollen wir nicht berechnen.<br />
5.3. Arnold <strong>von</strong> Brescia<br />
Arnold wurde um 1100 in Brescia am Südfuß <strong>der</strong> Alpen geboren. Hier wird er <strong>der</strong> Vorsteher<br />
eines Stiftes <strong>von</strong> Augustiner Chorherren. Arnold betont das arme Leben Jesu und<br />
meint, dass auch alle Päpste und Bischöfe arm leben sollen. Die Kirche soll überhaupt <strong>auf</strong><br />
politische Rechte verzichten. Die Priester sollen gemäß des AT allein vom Zehnten <strong>der</strong><br />
Gläubigen leben. Wegen seiner Gedanken wird Arnold in Rom verklagt und <strong>auf</strong> das Laterankonzil<br />
61 <strong>von</strong> 1139 vorgeladen. Er wird zwar nicht als Ketzer, aber als Schismatiker<br />
verurteilt. 62 Arnold wird nach Frankreich verbannt. Später taucht er in Italien wie<strong>der</strong> <strong>auf</strong>,<br />
und zwar an <strong>der</strong> Spitze einer demokratischen Volksbewegung <strong>der</strong> Ewigen Stadt. Sie hat<br />
das Ziel, Rom in die Hände des Volkes zu bringen. Arnold wird zum römischen Volkstribun<br />
erhoben. Der Papst Eugen <strong>II</strong>I. bittet den deutschen König um Hilfe. 1155 kommt<br />
Friedrich Barbarossa nach Rom und läßt sich die Kaiserkrone <strong>auf</strong>setzen. Bei dieser Gelegenheit<br />
gibt <strong>der</strong> Kaiser Rom dem Papst zurück. Arnold wird dar<strong>auf</strong>hin als Ketzer verbrannt.<br />
5.4. Die Albigenser o<strong>der</strong> Katharer<br />
Die eigentlichen Katharer bilden keine Einheit. Sie treten in Oberitalien und in Südfrankreich<br />
<strong>auf</strong>. In Italien wurden sie Gazzari genannt (griech. katharoi� = Die Reinen. Von dem<br />
Wort Katharer kommt <strong>der</strong> deutsche Name „Ketzer“). Nach <strong>der</strong> Stadt Albi wurden sie<br />
auch Albigenser genant.<br />
Die Katharer kritisieren den reichen Pop, aber auch die Weltlichkeit <strong>der</strong> Katholischen Kirche<br />
und verstehen sich selbst als die reine wahre Kirche. Sie verwerfen die Sakramentslehre<br />
<strong>der</strong> römischen Kirche. T<strong>auf</strong>e und Abendmahl sind rein symbolisch zu verstehen. Sie<br />
lehren die Präexistenz <strong>der</strong> Seelen, den freien Willen, die Seelenwan<strong>der</strong>ung und das Endheil<br />
aller Seelen. Eid und Ablaß, Fegefeuer und Totenmesse lehnen sie ab, auch jede Art <strong>von</strong><br />
Blutvergießen wie Krieg o<strong>der</strong> Todesstrafe. Die Katharer unterscheiden zwei Klassen: Credentes<br />
(Gläubige) und Perfecti (Vollkommene). Ein Perfectus wird man durch den Empfang<br />
<strong>der</strong> Geistest<strong>auf</strong>e.<br />
Es gibt 6 Hauptgebote für die Vollkommenen:<br />
1. Vegetarische Ernährung. Menschen, die sich im Leben nicht bewährt haben, erscheinen<br />
zur eigenen Läuterung wie<strong>der</strong> als Tiere.<br />
2. Eheverbot.<br />
untergang für den 18.10.1533. Auf Betreiben Luthers brachte ihm das ein Jahr Arrest in Wittenberg (Brockhaus<br />
Enzyklopädie, Bd. 21, S.219).<br />
61 Alle Konzile bis ins 13. Jh. sind Laterankonzile, weil <strong>der</strong> Papst <strong>auf</strong> <strong>der</strong> linken Tiberseite, im Lateran -<br />
nicht im Vatikan - residiert. Der Latranpalast, <strong>der</strong> ursprünglich <strong>der</strong> römischen Familie <strong>der</strong> Laterani gehört,<br />
wird nach Konstantins Sieg dem römischen Bischof übertragen und bleibt bis zum Brand 1308 die Residenz<br />
<strong>der</strong> Päpste. Erst nach <strong>der</strong> Rückkehr aus Avignon wohnen die Päpste im Vatikan, <strong>der</strong> im 14. / 15. Jh. ausgebaut<br />
wird.<br />
Das erste Laterankonzil 1123: Bestätigung des Wormser Konkordates.<br />
Das zweite Laterankonzil 1139: Bischofswahl durch das Domkapitel.<br />
Das dritte Laterankonzil 1179: Papstwahl bedarf <strong>der</strong> 2/3 Mehrheit <strong>der</strong> Kardinäle. Verbot <strong>der</strong> Katharer.<br />
Das vierte Laterankonzil 1215: Bischöfliche Inquisition gegen Katharer und Waldenser. Jährliche Beichte<br />
beim Pfarrer und Osterkommunion obligatorisch. Transsubstantiationslehre.<br />
62 Ein Ketzer irrt in <strong>der</strong> Lehre, er trennt sich <strong>von</strong> <strong>der</strong> Seele <strong>der</strong> Kirche. Der Schismatiker trennt sich nur vom<br />
Körper (Verfassung) <strong>der</strong> Kirche.<br />
32
3. Gemeinschaftliches Leben.<br />
4. Verzicht <strong>auf</strong> Eidschwur.<br />
5. Bereitschaft zum Martyrium.<br />
6. Kein lebendes Wesen töten. Keinen Kriegsdienst.<br />
Verfassung und Gottesdienst<br />
Es gibt Bistümer und Konzilien. Bil<strong>der</strong> und Kreuze werden abgelehnt. Die Räume müssen<br />
schmucklos sein. Ein wichtiger Brauch ist das Consolamentum (lat. consolator = Tröster;<br />
<strong>der</strong> hl. Geist). Es ist eine Art Geistest<strong>auf</strong>e. Dadurch wird man ein Perfecti. Nur Vollkommene<br />
werden ins Himmelreich kommen. Das Consolamentum ist <strong>der</strong> Trost für Sterbende.<br />
Als Vorbereitung für das Consolamentum ist ein einjähriges Noviziat vorgeschrieben. Der<br />
Täufling muß versprechen, <strong>der</strong> Kath. Kirche für immer und ewig zu entsagen. Nach dem<br />
Bekenntnis liegt man ihm die Bibel und die Hand <strong>auf</strong>s Haupt zum Empfang des Geistes.<br />
Wer kurz vor dem erwarteten Tod das Consolamentum empfängt und dann wie<strong>der</strong> gesund<br />
wird, sollte Selbstmord begehen.<br />
Die Versammlungen fanden meist unter freiem Himmel statt. Um 1200 n. C. sind die Katharer<br />
in Südfrankreich stärker als die Kath. Kirche!<br />
Reaktion <strong>der</strong> Kath. Kirche<br />
1. Der Papst schickt Legaten in die ketzerischen Gegenden. Doch sie erscheinen mit Glanz<br />
und Pomp.<br />
2. Der Spanier Dominicus gründet in Toulouse eine Genossenschaft zur Bekehrung <strong>der</strong><br />
Albigenser. Seine Brü<strong>der</strong> ziehen in apostolischer Armut predigend und diskutierend<br />
durchs Land. Es gelingt ihnen, einige Albigenser in den Schoß <strong>der</strong> Kirche zurückzuführen.<br />
Aus ihrer Genossenschaft wird später <strong>der</strong> Dominikanerorden.<br />
3. Papst Innocenz <strong>II</strong>I. ruft zu einem Kreuzzug gegen die Anhänger <strong>der</strong> „ketzerischen Bosheit“<br />
<strong>auf</strong>. Die grauenvollen Albigenserkriege rotten in den Jahren 1209 - 1229 das südfranzösische<br />
Albigensertum völlig aus.<br />
5.5. Die Waldenser<br />
Literatur: Fritz Junker, Die Waldenser, ein Volk unter Gottes Wort, EVZ Verlag, Zürich,<br />
1969 (Die Seitenzahlen in Klammern beziehen sich <strong>auf</strong> dieses Werk).<br />
A. Die Bibel als Grundlage (S. 37)<br />
Allein aus <strong>der</strong> Botschaft <strong>der</strong> Bibel entstand das mittelalterliche Waldensertum. Seine Losung<br />
lautet: „Sei getreu bis an den Tod“ (Sii fedele fino alla morte! Offb. 2,10).<br />
Im Waldenserwappen steht geschrieben: „Lux lucet in tenebris“ (Das Licht scheint in <strong>der</strong><br />
Finsternis: Joh. 8,12 bezieht sich <strong>auf</strong> das Licht <strong>der</strong> Bibel).<br />
B. Frühe Rufer in <strong>der</strong> Wüste (S. 44)<br />
1) Im 9. Jh. nahm Claudius, Bischof <strong>von</strong> Turin, den Kampf gegen Götzendienst und Aberglauben<br />
in <strong>der</strong> Kath. Kirche <strong>auf</strong>. Weil er unter dem Schutze des Kaisers, Ludwig des<br />
Frommen (814-840), stand, wagte <strong>der</strong> Klerus keine Hand an ihn zu legen.<br />
2) Berengar <strong>von</strong> Tours wirkte im 11. Jh. und verurteilte das heidnische Dogma <strong>der</strong> Messe.<br />
Dafür kam er ins Gefängnis.<br />
33
3) Peter <strong>von</strong> Bruys kämpfte gegen die Verweltlichung <strong>der</strong> Kirche und landete 1126 <strong>auf</strong><br />
dem Scheiterh<strong>auf</strong>en.<br />
4) Heinrich <strong>von</strong> Cluny verkündigte allein das Evangelium und starb 1150 im Gefängnis.<br />
5) Auch Arnold <strong>von</strong> Brescia musste büßen, weil er dem Papst die Stellvertreterfunktion<br />
absprach.<br />
C. Die Bekehrung <strong>von</strong> Petrus Waldus (S. 47)<br />
Petrus Waldus tritt um 1160 n. C. in Lyon (Südfrankreich) in Erscheinung. In <strong>der</strong> Textilbranche<br />
hat er sich hochgearbeitet und wurde bald ein begüterter K<strong>auf</strong>mann. Woher er<br />
genau stammt, weiß man nicht. Der plötzliche Tod seines Freundes hat ihn erschüttert. Er<br />
denkt über den Sinn des Lebens nach. In seiner Herzens- und Gewissensnot suchte er einen<br />
Priester <strong>auf</strong>, <strong>der</strong> ihm die Geschichte vom reichen Jüngling erzählt. Peter Waldus gehorchte<br />
wörtlich dem Befehle Christi und verteilte sein ganzes Vermögen. Seiner Frau überließ er<br />
das Geschäft. Seine Töchter steckte er ins Kloster. Dar<strong>auf</strong> holte er zwei befreundete Priester<br />
zu sich, und zusammen übersetzten sei ein Evangelium aus dem Lat. in die französische<br />
Volkssprache. Um vom geschriebenen Text unabhängig zu sein, lernte Peter Waldus<br />
ganze Teile <strong>der</strong> Evangelien auswendig.<br />
Dann begann er ganz schlicht die Wahrheit des Evangeliums zu verkündigen. Unter dem<br />
Volk führte er ein vorbildliches Leben. Auch seine Jünger verk<strong>auf</strong>ten ihren Besitz und verkündigten<br />
das Wort Gottes. Der Erzbischof <strong>von</strong> Lyon war unzufrieden, weil sie ihr Besitz<br />
nicht <strong>der</strong> Kirche, son<strong>der</strong>n den Armen gegeben hatten, und weil die Laien die Bibel auslegten.<br />
Peter Waldus erschien 1179 <strong>auf</strong> dem Laterankonzil, wo ihm <strong>der</strong> Papst Alexan<strong>der</strong> <strong>II</strong>I.<br />
das Predigen verbot, sowie das Austeilen <strong>der</strong> Sakramente. Dar<strong>auf</strong>hin musste Peter Waldus<br />
Lyon verlassen. Aber in Südfrankreich verkündigte er weiterhin, und schon bald hatte er<br />
8000 Anhänger. Da verhängte 1183 Papst Lucius <strong>II</strong>. den Bann über die Waldenser, wie sie<br />
hinfort genannt wurden. Sie wurden aus <strong>der</strong> Kath. Kirche ausgestoßen. Peter Waldus<br />
flüchtete später über Norditalien nach Böhmen, wo er 1217 starb.<br />
D. Lehre und Leben 63<br />
Zur Vollkommenheit des geistlichen Lebens gehören Armut, Enkrateia (Enthaltsamkeit)<br />
und das Kerygma (die Verkündigung). Die einzige Autorität ist die inspirierte Bibel. Darum<br />
legen die Waldenser Wert <strong>auf</strong> Bibelübersetzungen und Bibelkenntnis. Ein kirchliches<br />
Recht gibt es nicht. Wer sich durch ein Gelübde zum apostolischen Leben verpflichtet,<br />
gehört zu pauperes spiritu (fratres et sorores), also zu den Armen im Geist und zu den Brü<strong>der</strong>n<br />
und Schwestern. Das Hauptanliegen <strong>der</strong> Waldenser ist die Verbreitung <strong>der</strong> biblischen<br />
Botschaft in <strong>der</strong> Sprache (!) des Volkes. Sie verwerfen Ablaß, Seelenmessen, Fegefeuer,<br />
Heiligenverehrung sowie Eid und Kriegsdienst. An <strong>der</strong> kath. Transsubstantiationslehre und<br />
am Zölibat halten sie bis zur Reformation fest. Die Gemeindeverfassung richtet sich nach<br />
dem NT. Sie berufen Prediger, Bischöfe, Älteste u. Diakone. Jährlich treffen sie sich <strong>auf</strong><br />
einer Synode mit Laien und Pastoren.<br />
E. Verfolgung und Flucht (S. 50)<br />
Neben den Waldensern gibt es in Südfrankreich auch die Albigenser. Sie verwerfen Papsttum<br />
und die Sakramente. Papst Innocenz <strong>II</strong>I. ruft zu einem Kreuzzug gegen die Albigenser<br />
<strong>auf</strong>. 1209 bis 1218 werden in Südfrankreich 20 Städte und 200 Dörfer zerstört. 60 000<br />
Menschen werden <strong>von</strong> <strong>der</strong> alleinseligmachenden Kirche umgebracht, darunter auch viele<br />
Waldenser. Die übrigen Waldenser flüchten nach Italien, und zwar in die hochgelegenen,<br />
kaum zu erreichbaren Alpen zwischen Turin und <strong>der</strong> französischen Grenze (Pinerolo).<br />
63 A. Sierszyn, 2000 J. KG, <strong>II</strong>, S. 162<br />
34
Ein Inquisitor schreibt über die Waldenser: „Man kann sie an ihren Sitten und Redensarten<br />
erkennen. Sie sind einfach und sauber angezogen. Ihre Klei<strong>der</strong> sind prunklos und we<strong>der</strong><br />
aus schlechtem, noch aus kostbarem Stoffe. Sie treiben keinen Handel, damit sie nicht lügen,<br />
schwören o<strong>der</strong> betrügen müssen. Sie leben <strong>von</strong> ihrer Hände Arbeit, und sogar ihre<br />
Lehrer üben den Beruf eines Webers o<strong>der</strong> Schuhmachers aus... Sie sind keusch, mäßig und<br />
besuchen we<strong>der</strong> Wirtschaften noch Tanzanlässe, denn an solchen Dingen haben sie keine<br />
Freude.“ 64<br />
F. Das verborgene Predigerseminar (S. 52)<br />
Die unverheirateten Wan<strong>der</strong>prediger ziehen als Hausierer in <strong>der</strong> Verkleidung eines Handwerkers<br />
<strong>von</strong> Ort zu Ort und <strong>von</strong> Haus zu Haus. Sie werden auch Barbi (Onkel 65 ) genannt,<br />
wohl deshalb, weil sie lange Bärte 66 tragen. Ein an<strong>der</strong>er Inquisitor schreibt im Jahre 1260<br />
über das Vorgehen <strong>der</strong> Hausierer:<br />
„Der Krämer kommt <strong>auf</strong> ein Schloß. Er bietet den Damen Ringe, Schleier und an<strong>der</strong>en<br />
Schmuck und den Dienstboten seine einfache Ware an. Dann fügt er bei: ich habe noch<br />
sehr schöne und kostbare Edelsteine, aber ihr dürft mich nicht verraten. Wenn er die Zusicherung<br />
des Schweigens erhalten hat, fährt er fort: Ich habe eine so leuchtende Perle, dass<br />
man durch <strong>der</strong>en Kraft Gott erkennen kann. Und ich habe eine an<strong>der</strong>e so strahlende, dass<br />
sie in jedem die Gottesliebe anzündet, <strong>der</strong> sie besitzt. Ich rede bildlich, aber was ich sage,<br />
ist lauterste Wahrheit. Dann zieht er vor <strong>der</strong> <strong>auf</strong>merksamen Zuhörerschaft ein Evangelium<br />
hervor und liest Worte des Herrn Christus, zum Beispiel das Wort vom breiten und schmalen<br />
Weg, und for<strong>der</strong>t zur Entscheidung <strong>auf</strong>, doch <strong>auf</strong> dem Letzteren zu wandeln.“ 67<br />
Für die Zurüstung <strong>der</strong> Wan<strong>der</strong>prediger wird in den unzugänglichen italienischen Alpen<br />
eine Bibelschule eingerichtet, das sog. Collegio dei Barbi o<strong>der</strong> auch Zigeuneruniversität<br />
genannt. Die Gottesdienste fanden in den Häusern (Hospize genannt) statt. Seit <strong>der</strong> Reformation<br />
werden die Pfarrer in Genf ausgebildet, seit 1922 sogar in Rom.<br />
Immer wie<strong>der</strong> müssen die Waldenser schwere Verfolgungen erleiden, in denen viele ihr<br />
Leben lassen müssen.<br />
G. Anschluß an die Reformation<br />
Da die Waldenser kein klares Bekenntnis haben, werden 1526 Gespräche mit Farel (Neuenburg),<br />
Ökolampad (Basel) und Bucer (Straßburg) geführt. Am 12. 9. 1532 schließen sich<br />
die Waldenser unter <strong>der</strong> Aufsicht <strong>von</strong> Farel <strong>der</strong> schweizerischen Reformation an. Damit<br />
wird aus einer Laienbewegung eine evangelisch - reformierte Kirche. Sogleich beschloß<br />
die Synode eine Bibelübersetzung. Olivetan, <strong>der</strong> Neffe Calvins, übersetzt die ganze Bibel<br />
aus dem Hebräischen und dem Griechischen in die französische Sprache. Die Waldenser<br />
sind noch immer zweisprachig: Italienisch und Französisch.<br />
H. Neue Verfolgungen (S. 58)<br />
Im gleichen Jahr 1535, als Olivetan den Waldensern die Bibelübersetzung überreichen<br />
konnte, erteilte Herzog Karl <strong>II</strong>I. <strong>von</strong> Turin die ersten Verurteilungen <strong>der</strong> Waldenser, und<br />
zwar <strong>auf</strong> Druck des Erzbischofs <strong>von</strong> Turin. Pfr. Girardet starb als Märtyrer.<br />
1559 wurden den Waldensern die Gottesdienste verboten. 6000 Soldaten durchstreiften die<br />
Waldensertäler. Etliche landeten <strong>auf</strong> den Galeeren, <strong>auf</strong> dem Scheiterh<strong>auf</strong>en o<strong>der</strong> sie wurden<br />
ertränkt.<br />
64 A. Sierszyn, a.a.O., S. 164.<br />
65 Ders., a.a.O., S. 40<br />
66 F. Junker, die Waldenser, S. 52.<br />
67 Ders., a.a.O., S. 53<br />
35
Zu Ostern 1655 rückte Herzog Karl Emanuel <strong>II</strong>. mit 15000 Soldaten an. 8000 Waldenser<br />
kamen ums Leben (Piemontesische Ostern). Schließlich wagten einige unter Führung <strong>von</strong><br />
Giosui Gianavello den Wi<strong>der</strong>stand. Als <strong>der</strong> englische Staatsmann Oliver Cromwell intervenierte,<br />
konnte Frieden geschlossen werden. Den Gefangenen wurde Amnestie gewährt.<br />
I. Im Exil (1685 / S. 64)<br />
Im Jahre 1685 hob <strong>der</strong> französiche König Ludwig XIV. das Edikt <strong>von</strong> Nantes <strong>auf</strong>. Die Verfolgungen,<br />
die dar<strong>auf</strong> die französischen Protestanten erdulden mussten, hatten unmittelbaren<br />
Einfluß auch <strong>auf</strong> die Waldenser. Ludwig XIV. drängte den regierenden Herzog <strong>von</strong><br />
Piemont 68 , Viktor Amadeus <strong>II</strong>., dessen Frau des Königs Nichte war, den evangelischen<br />
Glauben im Piemont ebenfalls auszurotten. 1681 verbot <strong>der</strong> Herzog die evangelische Konfession<br />
und machte sogleich alle reformierten Kirchen dem Erdboden gleich. Schon bald<br />
wurden 4000 Reformierte in Oberitalien getötet, 14 000 schmachteten in Gefängnissen.<br />
Den Waldensern blieb nichts an<strong>der</strong>es übrig als ins Exil in die reformierte Schweiz auszuwan<strong>der</strong>n.<br />
Aber bereits 1689 gab <strong>der</strong> Herzog seine starke Bindung an Frankreich <strong>auf</strong>. Pfr. Henri<br />
Arnaud erkannte die Chance und kehrte mit 900 Waldensern nach Piemont zurück. Nur<br />
300 erreichten ihre Heimat. Am 1. September 1689 gelobten sie zu Sibaud, allezeit einig<br />
zu bleiben.<br />
Ende Oktober 1689 hatten 12 000 französiche und piemontesische Soldaten den Gipfel <strong>der</strong><br />
Balziglia umzingelt. Für die Waldenser rund um Henri Arnaud gab es kein Entkommen<br />
mehr. In <strong>der</strong> Nacht aber ließen sie ihre Fackeln brennen und stiegen an einem steilen Hang<br />
talwärts. Lautlos konnten sie entwischen.<br />
Am 4. Juni 1690 gewährte <strong>der</strong> Herzog Viktor Amadeus <strong>II</strong>. den Waldensern völlige Religionsfreiheit.<br />
Er entließ 500 Gefangene aus den Gefängnissen und <strong>von</strong> den Galeeren. Der<br />
Turiner Herzog gab den Waldensern Nahrung und Kleidung, und zwar aus taktischen<br />
Gründen. Er brauchte Hilfe gegen den französischen König.<br />
Aber schon 1696 schloß Viktor Frieden mit Ludwig XIV. Und schon fing die Verfolgung<br />
<strong>der</strong> Waldenser <strong>von</strong> vorne an. Wie<strong>der</strong> mussten sie in die Schweiz fliehen. Manche Waldenser<br />
flüchteten nach Württemberg, Baden und Hessen. Die Waldenser waren es, die zum<br />
ersten Mal die Kartoffelknollen mit nach Deutschland brachten. 69<br />
J. Gleichberechtigung und Religionsfreiheit in Italien (S. 75 ff.)<br />
Der Ausbruch <strong>der</strong> französischen Revolution 1789, mit ihrem Rufe nach Freiheit, Gleichheit<br />
und Brü<strong>der</strong>lichkeit, fand großen Wi<strong>der</strong>hall in dem seit Jahrhun<strong>der</strong>ten unterdrückten<br />
Waldenservolke.<br />
1805 kam Napoleon nach Turin und verfügte, dass fortan die Besoldungen <strong>der</strong> Waldenserpfarrer,<br />
wie die Kosten des Schulunterrichtes, <strong>von</strong> <strong>der</strong> Regierung bezahlt werden müssten.<br />
1825 erweckte <strong>der</strong> Genfer Evangelist Felix Neff die Waldenser zu neuem geistlichen Leben.<br />
1827 besuchte <strong>der</strong> englische General Karl Beckwith die Waldensertäler und beschloß<br />
dort zu wohnen. Er heiratete eine Waldenserin und richtete über 100 Dorfschulen ein<br />
(Beckwith - Schulen). Außerdem finanzierte er Weisenhäuser, Altersheimen und Waldenserkirchen.<br />
1850 wurde in Turin eine kleine Waldensergemeinde gegründet, später in<br />
Genua, Mailand, Verona, Venedig und 1883 sogar in Rom.<br />
68 Piemont heißt <strong>der</strong> Bezirk in Oberitalien mit <strong>der</strong> Hauptstadt Turin und dem Fluß Po. Nordwestlich befindet<br />
sich <strong>auf</strong> französischer Seite <strong>der</strong> Mont Blanc.<br />
69 A. Sierszyn, S. 166.<br />
36
1848<br />
wurde Italien eine Republik. Das Edikt „Lettere Patenti“ gewährte den Waldensern<br />
endlich die bürgerliche Gleichberechtigung und Gleichstellung mit ihren kath. Mitbürgern.<br />
Sie dürfen fortan alle Schulen bis zur Universität besuchen. Die „Lettere Patenti“<br />
bedeutet für die Waldenser das Ende einer 600jährigen Verfolgung und Unterdrückung<br />
und zugleich das Ende ihrer Ghettoexistenz in den hohen Alpen. In <strong>der</strong> Verfassung <strong>von</strong><br />
1848 ist die Glaubensfreiheit und das Recht zur Glaubensverkündigung garantiert!<br />
K. Die Waldenserkirche heute<br />
Heute gibt es in Italien etwa 30 000 Waldenser. 100 Gemeinden sind über ganz Italien<br />
verstreut. Aber allein 15 000 leben noch immer in den Alpen <strong>von</strong> Piemont. Der karge Boden<br />
vermag sie kaum noch zu ernähren. Deshalb ziehen viele in die Städte. Der Tourismus<br />
und die Technisierung bringt den Säkularismus und den Pluralismus. Manch ein Waldenser<br />
verliert dabei den Glauben seiner Väter.<br />
Die Waldenserkirche sowie die Waldenserschulen bekommen keine staatliche Unterstützung<br />
mehr. Die Schulen und die sozialen Einrichtungen werden <strong>von</strong> Spendengel<strong>der</strong>n getragen.<br />
Dennoch sind die „diakonischen“ Einrichtungen sehr beliebt. Auf Sizilien kümmert<br />
sich das Werk „Agape“ um die Armen.<br />
Die berechtigte Frage lautet: Wie kann <strong>der</strong> Glaube <strong>der</strong> Waldenser in <strong>der</strong> postmo<strong>der</strong>nen Zeit<br />
überleben? Der englische General Beckwith hat bereits die Antwort gegeben:<br />
„Sarete missionari, o sarete niente!“ - Ihr werdet Missionare sein, o<strong>der</strong> ihr werdet<br />
nichts sein.<br />
Wenn die Waldenser sich an das Licht <strong>der</strong> Bibel halten, dann heißt es auch in <strong>der</strong> Zukunft:<br />
Lux lucet in tenebris<br />
Licht leuchtet in <strong>der</strong> Finsternis!<br />
L. Die Waldenser und wir<br />
Die Waldenser haben 600 Jahre lang die Schmach Christi getragen (Hebr. 11, 24 - 29). Sie<br />
verzichteten <strong>auf</strong> die Schätze <strong>der</strong> Kath. Kirche (Hebr. 11,26), weil sie <strong>auf</strong> die ewige Belohnung<br />
schauten (Hebr. 11, 26). Sie verzichteten <strong>auf</strong> das bürgerliche städtische Leben und<br />
wie Mose in <strong>der</strong> Wüste zogen sie ein Leben in Armut in den Bergwäl<strong>der</strong>n <strong>der</strong> italienischen<br />
Alpen vor. Sie verzichteten <strong>auf</strong> Karriere, Titel und Anerkennung (Hebr. 11,24). Auch heute<br />
dürfen sich manche Prediger in Deutschland nicht Pastor o<strong>der</strong> Pfarrer nennen. Manche<br />
Freikirchen werden als Sekte abgestempelt. Manche Theologen, die ein ausgezeichnetes<br />
Studium an bibeltreuen Hochschulen im Ausland absolviert haben, werden in Deutschland<br />
nicht anerkannt, weil sie die Historisch - Kritische Methode ablehnen, mit <strong>der</strong> die Bibel als<br />
gewöhnliches Buch seziert wird.<br />
Die Waldenser erdulden die Ungerechtigkeit, ohne sich zu rächen. In allen Ungerechtigkeiten<br />
sehen wir <strong>auf</strong> den unsichtbaren HERRN und ERLÖSER, als sähen wir ihn (Hebr.<br />
11,27). Manch ein Christ erfährt im Beruf Benachteiligungen, weil er ehrlich und <strong>auf</strong>richtig<br />
ist und Korruption und Lügen ablehnt.<br />
Die Waldenser steigen nachts waghalsig am steilen Abhang <strong>der</strong> Alpen hinunter, um <strong>der</strong><br />
Umzingelung zu entkommen (Hebr. 11,29).<br />
Auch heute bekommen die Waldenser keine staatliche Unterstützung für ihre Schulen und<br />
für die sozialen Einrichtungen, ähnlich wie bei freikirchlichen Werken und Bibelschulen in<br />
Deutschland.<br />
Der Glaube for<strong>der</strong>t Wi<strong>der</strong>stand (Hebr. 11,27), den Gehorsam (Hebr. 11,28) und die Tat<br />
(Hebr. 11,29).<br />
37
5. 6. Die Dominikaner 70<br />
Der Orden <strong>der</strong> Dominikaner wurde <strong>von</strong> Dominikus gegründet. Der Orden wird auch Ordo<br />
Fratrum Praedicorum (Abkürzung: O. P.) genannt: Orden <strong>der</strong> predigenden Brü<strong>der</strong> o<strong>der</strong><br />
einfach Predigerorden. Dominikus wird um 1175 in Spanien geboren. Wegen dem moslemischen<br />
Mauren muß er seinen Glauben ausleben. In Südfrankreich spürt er dagegen eine<br />
Art <strong>von</strong> Gleichgültigkeit. 1215 gründet er in Touluse das erste Ordenshaus. Auch er lebt in<br />
Armut. Eines Tages gewinnt Dominikus einen Albigenser durch ein Gespräch zum katholischen<br />
Glauben zurück. Das macht er fortan zu seinem Lebensprogramm. Man gewinne die<br />
Ketzer nicht durch Druck und Verfolgung zurück, son<strong>der</strong>n durch überzeugende Gespräche<br />
und durch ein vorbildliches Leben. Dominikus und seine Anhänger beginnen zu predigen.<br />
Papst Honorius <strong>II</strong>I. bestätigt 1216 den Dominikanerorden. Sie erhalten den päpstlichen<br />
Auftrag, das Wort in aller Welt zu verkündigen. Die Dominikaner verpflichten sich zur<br />
Armut denn sie distanzieren sich bewußt vom gemästeten Klerus. Den Predigern vermittelt<br />
er Kenntnisse in Rhetorik und Homiletik. Zum Orden sind Kleriker und Laien zugelassen.<br />
Im Speisesaal (Refektorium) bekommt <strong>der</strong> Klostervorsteher sein Menü zuletzt. Bald entstehen<br />
auch Nonnenklöster, welche die Predigt <strong>der</strong> Brü<strong>der</strong> durch Gebet unterstützen.<br />
Die Abschiedsworte <strong>von</strong> Dominikus lauten: „Wandelt in <strong>der</strong> Liebe, in <strong>der</strong> Vernunft und in<br />
<strong>der</strong> Armut.“<br />
Nach dem Tode des Stifters besetzen schon bald viele Dominikaner die Universitäten.<br />
Thomas <strong>von</strong> Aquin kommt aus ihrer Mitte. Weil die Dominikaner sich mit beson<strong>der</strong>em<br />
Eifer für die „rechte Glaubenslehre“ (<strong>der</strong> kath. Kirche) einsetzen, betraut sie <strong>der</strong> Papst bald<br />
mit <strong>der</strong> Führung <strong>der</strong> Inquisition.<br />
5. 7. Die Augustiner Eremiten<br />
Ein weiterer Bettelorden entsteht: Ordo Fratrum Eremitarum S. Augustini: Orden <strong>der</strong> einsamen<br />
Brü<strong>der</strong> nach <strong>der</strong> Regel des Heiligen Augustinus. Zu diesem Orden gehörte Martin<br />
Luther als Mönch.<br />
5. 8. Der Franziskaner Orden 71<br />
A. Kennzeichen <strong>der</strong> Bettelorden<br />
� Armut<br />
� Klosterleben<br />
� Armut und Besitzlosigkeit gelten für alle Mönche<br />
� Ernährung vom Betteln, das <strong>der</strong> eigenen Demütigung dient.<br />
B. Franz <strong>von</strong> Assisi<br />
Franziskus wird im Jahr 1182 in Assisi (Italien / Umbrien) als Sohn eines reichen Tuchhändlers<br />
geboren. Seine Mutter stammt aus einer vornehmen französischen Familie. Franz<br />
spricht franz. u. ital. In <strong>der</strong> Kathedrale zu San Rufino wird er <strong>auf</strong> den Namen Giovanni<br />
Bernardone get<strong>auf</strong>t. Der Beiname Franziskus (= kleiner Franzose) wird ihm vermutlich<br />
70 Sierszyn, KG, <strong>II</strong>, S. 176<br />
71 Sierszyn, S. 167.<br />
38
vom Vater und den Spielkameraden gegeben, weil er die französische Mode bevorzugt. Da<br />
ihm reichlich Gel<strong>der</strong> zur Verfügung stehen, will er sein Leben als Ritter verwirklichen.<br />
1202 beteiligt er sich am Krieg zwischen Assisi und Perrugia und gerät für ein Jahr in Gefangenschaft.<br />
Durch eine Krankheit ruft ihn Gott zur Besinnung. Nun beginnt er, das<br />
weltliche Treiben zu meiden. In einer Höhle außerhalb <strong>von</strong> Assisi empfängt er 1205 die<br />
Gewissheit, sein Leben dem gekreuzigten Christus zu weihen. Vor den Toren seiner<br />
Stadt liegen Scharen <strong>von</strong> hungernden Aussätzigen. Nun fühlt er Mitleid und Erbarmen<br />
mit ihnen. Er, <strong>der</strong> vorher diesen Elendsgestalten immer ausgewichen ist, wird plötzlich zu<br />
diesen Ärmsten <strong>der</strong> Armen hingezogen. Franz erlebt eine Bekehrung <strong>von</strong> hochfahrenden<br />
Ritterplänen zum Dienst an den Kranken. Er wird Krankenpfleger und küsst ihre Wunden.<br />
Vor dem Kreuz <strong>der</strong> zerfallenden Kapelle San Damino vernimmt er die Stimme Christi:<br />
„Geh und baue meine Kirche wie<strong>der</strong> <strong>auf</strong>!“ Eigenhändig beginnt er zu bauen.<br />
Erbost über die verschwen<strong>der</strong>ische Wohltätigkeit des Sohnes enterbt ihn sein Vater. In<br />
einer Gerichtssitzung vor dem Stadtbischof (!) verzichtet Franz <strong>auf</strong> Eigentum und Erbschaft.<br />
Auch seine Klei<strong>der</strong> gibt er dem Vater mit den Worten:<br />
„Bis hierher habe ich Euch meinen Vater <strong>auf</strong> Erden genannt. Von nun an aber darf ich<br />
ruhig sagen: Unser Vater im Himmel, bei dem all mein Haben ruht, <strong>auf</strong> den ich all mein<br />
Hoffen setze.“<br />
Am 24. Februar 1209 hört er in <strong>der</strong> Maria - Kirche zu Protiuncula (bei Assisi) das Evangelium:<br />
Matth. 10! Das ist seine Berufung: Nachfolge Christi in apostolischer Armut als<br />
Wan<strong>der</strong>prediger!<br />
So wird Franz Volksmissionar und Bußprediger. An<strong>der</strong>e folgen seinem Beispiel (ehemalige<br />
Freunde und Kameraden). Die Brü<strong>der</strong> durchziehen Umbrien und die benachbarten<br />
Landschaften.<br />
Im Jahr 1210 zieht Franz mit seinen ersten elf Gefährten nach Rom, um <strong>von</strong> Papst Innocenz<br />
<strong>II</strong>I. seine Lebensweise bestätigen zu lassen. Die Brü<strong>der</strong> predigen zentrale Wahrheiten<br />
des Evangeliums: Buße, die Ankunft des Reiches Gottes und den Tod als Eingang zu den<br />
himmlischen Freuden. Sie unterstützen die Priester. Sie haben nicht die Absicht, ihre Sünden<br />
ans Licht zu zerren. Wenn sie predigen, liegt Freude <strong>auf</strong> ihren Gesichtern.<br />
Im Jahr 1212 schließt sich Klara <strong>von</strong> Assisi <strong>der</strong> franziskanischen Lebensweise an. Es entsteht<br />
<strong>der</strong> Klarissenorden.<br />
C. Der Franziskaner Orden<br />
Hun<strong>der</strong>te <strong>von</strong> Menschen folgen dem Vorbild des Franziskus. Sie alle brauchen eine Organisation.<br />
Der Papst schickt Kardinal Ugolino <strong>von</strong> Ostia, <strong>der</strong> die Vereinigung zu einem Orden<br />
mit Regeln umfunktioniert. In <strong>der</strong> Franziskanerregel heißt es:<br />
� Die Regel und Lebensweise <strong>der</strong> Min<strong>der</strong>brü<strong>der</strong> ist diese, dass sie nach dem Evangelium<br />
wandeln in Gehorsam, ohne Eigentum und in Keuschheit. Bru<strong>der</strong> Franziskus verspricht<br />
dem Papst Honorius und seinen Nachfolgern Gehorsam und Ehrfurcht, und die übrigen<br />
Brü<strong>der</strong> sollen Franziskus und seinen Nachfolgern gehorsam sein.<br />
� Ich ermahne meine Brü<strong>der</strong> , wenn sie durch die Welt wan<strong>der</strong>n, nicht mit Worten zu<br />
streiten o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e zu richten, son<strong>der</strong>n mit allen ehrbar, sanftmütig und demütig zu reden.<br />
Dem heiligen Evangelium gemäß soll es ihnen gestattet sein, <strong>von</strong> allen Speisen, die<br />
man ihnen vorsetzt, zu essen.<br />
� Allen Brü<strong>der</strong>n befehle ich, dass sie keinerlei Geld o<strong>der</strong> Münzen annehmen.<br />
� Gegenstände zu ihrer Notdurft dürfen sie sich geben lassen.<br />
� Die Brü<strong>der</strong> sollen in einem Bistum nicht predigen, wenn <strong>der</strong> Bischof es ihnen verboten<br />
hat. Kein Bru<strong>der</strong> soll es wagen zu predigen ohne Prüfung und Erlaubnis des Generalministers.<br />
72<br />
72 Sierszyn, KG, <strong>II</strong>, S. 171<br />
39
Am 29. Nov. 1223 bestätigt Papst Honorius die Regel.<br />
Aufgabe: Warum akzeptiert die römische Kirche die Franziskaner, nachdem sie die Waldenser<br />
und die Albigenser abgelehnt hat?<br />
Als Gewand tragen die Brü<strong>der</strong> die Kleidung armer Leute: eine Kutte (Sacktuch) mit Kapuze<br />
und einem Strick als Gürtel, notfalls sind Sandalen erlaubt.<br />
D. Franz als Mystiker<br />
Franziskus empfindet Armut nicht als Not, son<strong>der</strong>n als Fülle. Er vermählt sich mit <strong>der</strong><br />
schönen Frau Armut. Allein das Berühren <strong>von</strong> Geld ist Sünde, denn es stammt vom Bösen.<br />
Franz ermahnt alle Tiere. Er ist kein Pantheist, aber er lobt den Schöpfer und die Schöpfung.<br />
Im Anschluß an Ps. 148 entsteht <strong>der</strong> berühmte Sonnengesang:<br />
Du höchster, allmächtiger, guter Herr,<br />
Dein ist <strong>der</strong> Lobpreis und Ruhm, die Ehre und jeglicher Segen.<br />
Dir allein Höchster, gebühren sie.<br />
Und keiner <strong>der</strong> Menschen ist wert, dich im Munde zu führen.<br />
Sei gelobt, mein Herr, mit all deinen Kreaturen,<br />
Son<strong>der</strong>lich mit <strong>der</strong> hohen Frau, unserer Schwester, <strong>der</strong> Sonne,<br />
Die den Tag macht und mit ihrem Licht uns leuchtet.<br />
Wie schön in den Höhen und prächtig in mächtigem Glanze<br />
Bedeutet sie, Herrlicher, dich!<br />
Sei gelobt, mein Herr, durch Bru<strong>der</strong> Mond und die Sterne,<br />
Die du am Himmel geformt in köstlich funkeln<strong>der</strong> Ferne.<br />
Sei gelobt, mein Herr, durch Bru<strong>der</strong> Wind,<br />
Durch Luft und Gewölk und heitres und jegliches Wetter,<br />
Wodurch du belebst die Kreaturen, dass sie sind.<br />
Sei gelobt, mein Herr, durch Bru<strong>der</strong> Wasser,<br />
Der so nützlich ist, gering und köstlich und keusch.<br />
Sei gelobt, mein Herr, durch Bru<strong>der</strong> Feuer,<br />
Durch den du erleuchtest die Nacht.<br />
Sein Sprühen ist kühn, heiter ist er, schön und gewaltig und stark.<br />
Sei gelobt, mein Herr, durch unsere Schwester Mutter Erde,<br />
Die uns versorgt und nährt,<br />
Und zeitigt allerlei Früchte und farbige Blumen und Gras.<br />
Lobt und preist meinen Herrn voll Dankbarkeit<br />
Und dient ihm in aller Niedrigkeit. 73<br />
Auch das folgende Gedicht <strong>von</strong> Franz <strong>von</strong> Assisi ist bekannt: Das Werkzeug des Friedens<br />
Herr, mache mich zu einem Werkzeug Deines Friedens,<br />
dass ich Liebe übe, wo man sich haßt;<br />
verzeihe, wo man sich beleidigt;<br />
verbinde, da wo Streit ist;<br />
die Wahrheit sage, wo <strong>der</strong> Irrtum herrscht;<br />
den Glauben bringe, wo <strong>der</strong> Zweifel drückt;<br />
die Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält;<br />
73 Cuthbert u. J. Widlöcher, Der Heilige Franz <strong>von</strong> Assisi, S. 357.<br />
40
Dein Licht anzünde, wo Finsternis regiert;<br />
Freude mache, wo <strong>der</strong> Kummer wohnt.<br />
Nach langer seelischer Krankheit stirbt Franz am 3. Okt. 1226. Als man ihn fand, entdeckt<br />
man die Wundmale (Stigmata) Jesu an Händen, Füßen und an <strong>der</strong> Seite (vgl. Gal. 6,17).<br />
Nach seinem Tode dehnt sich <strong>der</strong> Orden rasch aus, so z. B. auch nach Deutschland. Später<br />
gibt es einige Abspaltungen: die Kapuziner und die Konventualen (O.F.M. Conv.). Den<br />
Höchststand an Mitglie<strong>der</strong> haben die Orden in den 60ziger Jahren des 20. Jh. Danach lassen<br />
Wohlstand, Ideologien und Individualisierung die Orden rasch schrumpfen.<br />
E. Beurteilung<br />
(1) Positives:<br />
� Die Armut bringt nicht die Unzufriedenheit hervor. Im Gegenteil: Die Konsum- und die<br />
Wohlstandsgesellschaft för<strong>der</strong>t die Unzufriedenheit. Mit dem Wenigen zufrieden zu<br />
sein, ist eine biblische Tugend. „Seit dankbar in allen Dingen.“<br />
� Die Demut festigt die Gemeinschaft (Eph. 4,2; Phil. 2,3).<br />
� Der einfache Lebensstil unterstreicht die überzeugende Predigt.<br />
� Im Sonnengesang kommt die Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer zum Ausdruck. In<br />
<strong>der</strong> technisierten Welt steht <strong>der</strong> postmo<strong>der</strong>ne Christ in Gefahr, die Schöpfung nicht<br />
mehr zu sehen und damit auch nicht mehr den Schöpfer.<br />
(2) Kritik:<br />
� Franz und sein Orden kleben am Papsttum mehr als an Christus.<br />
� Im Gedicht des Franziskus heißt es doch: „...dass ich die Wahrheit sage, wo <strong>der</strong> Irrtum<br />
herrscht.“ Aber diese Wahrheit wird verdeckt, wenn es um die Irrlehren <strong>der</strong> Kath. Kirche<br />
und um die Kreuzzüge geht. Das System steht über <strong>der</strong> Wahrheit <strong>der</strong> Bibel.<br />
� Das Geld ist keine Sünde; es ist wertneutral. Es kommt dar<strong>auf</strong> an, was <strong>der</strong> Mensch mit<br />
ihm macht. Der Christ kann es zum Bau des Reiches Gottes verwenden. Die Franziskaner<br />
durften Gegenstände und Brot <strong>von</strong> den Bürgern des Landes annehmen. Diese Sachen<br />
wurden doch durch Geld erworben.<br />
� Die Stigmata Christi: In Gal. 6,17 geht es nicht um die Wundmale des Gekreuzigten an<br />
Händen und Füßen. Es geht um die Brandmale (Stigmata) <strong>der</strong> Verfolgung (2.Kor. 11,<br />
24 - 28).<br />
� Im Sonnengesang wird die Erde als Mutter Erde bezeichnet. Ein postmo<strong>der</strong>ner Ausdruck<br />
im Zeitalter <strong>von</strong> Feminismus und New Age. Das Geschöpf darf nicht über den<br />
Schöpfer stehen (Röm. 1, 25).<br />
5. 9. Die deutsche Mystik<br />
Im 11. -15. Jh. zieht <strong>der</strong> Schleier <strong>der</strong> Mystik über ganz Europa. Das Wort Mystik kommt<br />
<strong>von</strong> dem griech. Wort „myein“, d. h. die Augen verschließen, um in Meditation und Kontemplation<br />
mit den Augen des Herzens Gott zu schauen. Bei <strong>der</strong> Verinnerlichung kommt<br />
es zu Visionen und Träumen. Ziel <strong>der</strong> Mystik ist die unio mystica, die Einheit <strong>der</strong> Seele<br />
mit dem Bräutigam Christus. Hungersnöte, Pest und Erdbeben treiben viele dazu, allem<br />
Äußerlichen abzusagen und sich dem wahren inneren Leben hinzugeben. Der Zustrom zu<br />
den Frauenklöstern ist immens. Allein in Straßburg entstehen im 13. Jh. sieben Dominikanerinnenklöster.<br />
74<br />
74 Sierszyn, S. 232.<br />
41
A. Hildegard <strong>von</strong> Bingen<br />
Hildegard <strong>von</strong> Bingen 75 (1098 - 1179), Äbtissin des Benediktinerinnenklosters <strong>auf</strong> dem<br />
Rupertsberg bei Bingen am Rhein (bei Mainz), erlebt gewaltige Visionen über die Heilsgeschichte,<br />
die sie in mehreren Schriften nie<strong>der</strong>schreibt. Im Wachzustand erlebt sie 26<br />
Visionen. Sie schaut tiefe Geheimnisse über die Erschaffung <strong>der</strong> Welt, das Geheimnis <strong>der</strong><br />
Dreieinigkeit, das Opfer Christi und das Ende <strong>der</strong> Welt.<br />
Als erste deutsche Naturforscherin und Ärztin verfaßt sie verschiedene Werke <strong>der</strong> Natur-<br />
und Heilkunde. Dabei geht sie bis zum Kräuteraberglauben. Beson<strong>der</strong>s preist sie Heilziest<br />
als Mittel gegen unglückliche Liebe. Gegen Vergeßlichkeit empfiehlt sie das Einreiben<br />
<strong>von</strong> Brennessselöl. Ihre Bücher über Heilkräuter werden im New Age Zeitalter neu<br />
vermarktet und erleben hohe Auflagen.<br />
B. Meister Eckhart 76<br />
Magister Eckhart (1260 - 1327) stammt aus Thüringen. An <strong>der</strong> Pariser Universität erwirbt<br />
er sich den Magister. Er wird Dozent in Paris, Straßburg und Köln. 1303 ist er Vorsteher<br />
<strong>der</strong> sächsischen Dominikaner - Provinz mit 47 Konventen und 70 Frauenklöstern. Auch<br />
Meister Eckhart glaubt an das Seelenfünklein im Menschen, das sich mit Christus vereinigen<br />
muß. Die biblische Soteriologie tritt dabei in den Hintergrund. Er schreibt:<br />
„ Da wird die Seele in Gott und göttliche Natur get<strong>auf</strong>t und empfängt ein göttlich Leben<br />
und wird nach Gott geordnet... Wenn die Seele den Kuß <strong>der</strong> Liebe empfängt <strong>von</strong> <strong>der</strong> Gottheit,<br />
so steht sie in vollendeter Schöne und Seligkeit. Da verstummen alle Sinne.... Im innersten<br />
Wesen <strong>der</strong> Seele, im Fünklein <strong>der</strong> Vernunft geschieht diese Gottesgeburt.“ 77<br />
Eckhart wirkt <strong>auf</strong> die deutsche Sprache schöpferisch. Begriffe wie Abgeschiedenheit, Persönlichkeit,<br />
Natürlichkeit, Wirklichkeit, Zeitlichkeit gehen <strong>auf</strong> ihn zurück.<br />
C. Johannes Tauler 78<br />
Johannes Tauler lebte und wirkte in Straßburg (1300 - 1361). Als in Straßburg die Pest die<br />
Menschen verzehrte, flohen viele aus <strong>der</strong> Stadt, doch Tauler blieb und pflegte die Kranken.<br />
Er überstand die Pest. Er veröffentlichte Briefe, in denen er das Papsttum angriff. Christus<br />
sei für alle gestorben und <strong>der</strong> Papst könne keinem den Weg des Heils verschließen, indem<br />
er einfach in den Bann geworfen werde. An dieser Stelle ist Tauler ein Vordenker Martin<br />
Luthers. Man müsse dem König Jesus mehr gehorchen als dem Papst. Luther hat in seinen<br />
Briefen 1515 - 1518 mehrfach <strong>auf</strong> Tauler hingewiesen und <strong>auf</strong> die hier vorgetragene „alte<br />
reine Theologie“. 79 Der Verfechter <strong>der</strong> biblischen Soteriologie predigte den Menschen,<br />
dass sie eine neue Kreatur werden müssten, um gerettet zu werden. Man könne nicht dem<br />
Gericht Gottes entfliehen, indem man einem Orden angehöre und bete. Später kamen die<br />
Schriften Taulers <strong>auf</strong> den Index <strong>der</strong> verbotenen Bücher.<br />
D. Thomas <strong>von</strong> Kempen<br />
75<br />
Sierszyn, S. 229<br />
76<br />
Reden in dt. Sprache: Deutsches Mittelalter, ausgewählt v. F. <strong>von</strong> <strong>der</strong> Leyen, Insel Verlag, Frankfurt am<br />
Main, 1980, S. 875<br />
77<br />
Theodor Brandt, Kirche im Wandel <strong>der</strong> Zeit, S. 199.<br />
78<br />
E. H. Broadbent, Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt, S. 103 f.<br />
79<br />
Kurt Aland, Geschichte <strong>der</strong> Christenheit, S. 371.<br />
42
Thomas ist Mitglied <strong>der</strong> Augustiner Chorherren - Bru<strong>der</strong>schaft (1380 - 1471). In dem berühmten<br />
Buch „Nachfolge Christi“ (de imitatione Christi) schreibt er: „ Unser erstes Bestreben<br />
sei, uns in das Leben Jesu zu versenken.“ Sein Buch, das in über 100 Sprachen und<br />
in mehr als 3000 Auflagen vorliegt, ist das neben <strong>der</strong> Bibel mit verbreitetste Buch überhaupt.<br />
80 Noch heute existieren da<strong>von</strong> 700 spätmittelalterliche Handschriften. Auch die Urschrift<br />
bzw. Endredaktion <strong>von</strong> Thomas aus dem Jahr 1221 ist sichergestellt.<br />
Das Buch „Nachfolge Christi“ kann man auch als „parakletisch 81 - homiletische Betrachtungen“<br />
bezeichnen o<strong>der</strong> als ein „pietistisches Andachtsbuch <strong>der</strong> täglichen Heiligung“.<br />
Der lat. Titel lautet: „de imitatione Christi“ = Nachahmung Christi.<br />
Über Joh. 14,6 macht Thomas <strong>von</strong> Kempen die treffende Aussage:<br />
„Ohne Weg geht man nicht, ohne Wahrheit erkennt man nicht, ohne Leben<br />
lebt man nicht.<br />
Ich bin <strong>der</strong> Weg, dem du folgen sollst. Ich bin die Wahrheit, <strong>der</strong> du glauben sollst. Ich bin<br />
das Leben, das du hoffen sollst. Ich bin <strong>der</strong> unzerstörliche Weg, die unbetrügliche Wahrheit<br />
und das unendliche Leben. Ich bin <strong>der</strong> allergeradeste und richtigste Weg, die höchste<br />
Wahrheit, das wahre Leben, ein seliges Leben, ein unerschaffenes Leben.“ 82<br />
Wenn wir christliche Schriften o<strong>der</strong> die Bibel selbst lesen, müssen wir mit ihnen kongenial<br />
sein:<br />
„Man soll auch solche heilige Schriften in demselben Geist lesen, mit welchem sie geschrieben<br />
und gemacht sind.“ 83<br />
Über die Begierden schreibt er:<br />
„Warum sind manche heilige Menschen so vollkommen gewesen und so hoch gekommen in<br />
Beschauung himmlischer Dinge? Vornehmlich darum, dass sie sich beflissen haben, ihnen<br />
selbst und allen irdischen Begierden abzusterben; darum konnten sie allein Gott Anhangen<br />
<strong>von</strong> ganzem Herzen und <strong>von</strong> allen Sorgen frei seinem Lob und Dienst abwarten. Wir haben<br />
allzuviel zu tun mit unsern eigenen Begierden, und bekümmern uns allzusehr mit vergänglichen<br />
Dingen. Wir überwinden auch selten ein Laster gänzlich, und werden nicht entzündet<br />
zur täglichen Besserung; darum bleiben wir also laulich und kalt.“ 84<br />
Thomas lebte noch vor <strong>der</strong> Reformation und folglich war er in <strong>der</strong> Lehre <strong>der</strong> Katholischen<br />
Kirche <strong>auf</strong>gewachsen. Deshalb vertrat er auch ihre Abendmahlslehre:<br />
„Denn allein die ordnungsmäßig in <strong>der</strong> Kirche geweihten Priester haben die Gewalt, den<br />
Leib und das Blut Christi zu weihen und das Sakrament zu spenden.“ 85<br />
Somit versteht er auch die Eucharistie nicht symbolisch, son<strong>der</strong>n real: „Sie genießen das<br />
fleischgewordene Wort Gottes.“ 86<br />
Diese Art <strong>von</strong> Realpräsenz kommt auch in den Worten zum Ausdruck: „Denn ich habe<br />
dich im heiligen Sakramente wahrhaft gegenwärtig, obgleich unter frem<strong>der</strong> Gestalt verborgen.“<br />
87<br />
Das Herrenmahl ist für ihn eine Arznei und eine Labsal. 88<br />
80<br />
Bunyons Pilgerreise wurde in angeblich 147 Sprachen übersetzt.<br />
81<br />
Das griech. Wort „parakaleo“, welches häufig im NT verwendet wird, bedeutet: „ermahnen, erbauen, ermutigen,<br />
trösten“.<br />
82<br />
Thomas <strong>von</strong> Kempen, Vier Bücher über die Nachfolge Christi nach <strong>der</strong> Übersetzung <strong>von</strong> Johann Arndt,<br />
Ernst Röttgers Verlag, Kassel, 1906, S. 277 (Hervorhebung <strong>von</strong> SFW).<br />
83<br />
Thomas <strong>von</strong> Kempen, a.a.O., S. 31.<br />
84 Thomas <strong>von</strong> Kempen, a.a.O., S. 39<br />
85 Ders., a.a.O., 312<br />
86 Ders., a.a.0, 329.<br />
87 Ders., a.a.O., 328.<br />
43
Der mystische Einschlag findet sich in den Sätzen:<br />
„Dank dir, Schöpfer und Erlöser <strong>der</strong> Menschen, <strong>der</strong> du, um <strong>der</strong> ganzen Welt deine Liebe zu<br />
beweisen, das große Mahl gestiftet hast, in dem du uns nicht das vorbildliche Osterlamm,<br />
son<strong>der</strong>n deinen heiligsten Leib und dein Blut zu essen vorsetztest, alle Gläubigen mit <strong>der</strong><br />
heiligen Mahlzeit erfreuend und sie trunken machend mit deinem heiligen Kelch, in dem<br />
alle Lust des Paradieses enthalten ist, an <strong>der</strong> auch die heiligen Engel mit uns teilnehmen,<br />
nur in ganz ungetrübter Seligkeit.“ 89<br />
Es gibt zwei Dinge, die ihm im Leben äußerst Wertvoll sind: Die Speise (Abendmahl) und<br />
das Licht (die Bibel):<br />
„Denn zwei Dinge fühle ich für mich zumeist notwendig in diesem Leben, ohne welche mir<br />
dieses elende Leben unleidlich wäre. Gefangen im Körper dieses Leibes, bekenne ich,<br />
zweierlei Dinge zu bedürfen, nämlich Speise und Licht. Darum hast du mir Schwachen<br />
deinen Leib gegeben zur Erquickung des Geistes und des Leibes und hast gesetzt eine<br />
Leuchte für meine Füße, nämlich dein heiliges Wort. Ohne diese beiden könnte ich nicht<br />
leben; denn das Wort Gottes ist das Licht meiner Seele und dein heiliges Sakrament das<br />
Brot des Lebens.“ 90<br />
Zuletzt tritt <strong>der</strong> katholische Einschlag in <strong>der</strong> Sentenz „<strong>der</strong> Priester soll für die Ruhe <strong>der</strong><br />
Toten flehen“ hervor. 91<br />
E. Beurteilung <strong>der</strong> Mystik<br />
Die Mystiker nehmen sich Zeit für Gott. Die Zeit des Gebetes ist ihnen wichtiger als alle<br />
an<strong>der</strong>en Termine und Arbeit. Das können wir <strong>von</strong> ihnen lernen. Aber die Gefühle und die<br />
Träume können täuschen. Die Visionen haben sich <strong>der</strong> Bibel unterzuordnen. Was wir über<br />
die Heilsgeschichte und über die Zukunft wissen sollen, ist in <strong>der</strong> Bibel offenbart. Diese<br />
Offenbarung ist zum Abschluß gebracht. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen (Offb. 22,<br />
18f.). Zu einem Weg <strong>der</strong> Nachfolge Christi gehört nicht nur das schöne Gefühl, die<br />
Stimmulierung, die Freude, son<strong>der</strong>n auch <strong>der</strong> Gehorsam und die voluntaristische Entscheidung<br />
(Joh. 6, 66 - 71). Die Hl. Schrift ruft uns zur Nüchternheit und zur Wachsamkeit <strong>auf</strong><br />
(1.Thess. 5,6; 1.Petr. 5,8).<br />
V<strong>II</strong>. Die Herrschaft des Papsttums<br />
1. Die Inquisition<br />
1.1. Ein Laststein für die Kirche<br />
Das lat. Wort „inquisitio“ bedeutet „das Aufsuchen, das Erforschen, die Untersuchung“.<br />
Fast in jedem Buch über die Alte Kirche steht das eindrückliche Wort Tertullians:<br />
„Das Blut <strong>der</strong> Märtyrer ist <strong>der</strong> Same <strong>der</strong> Kirche.“ Diese Aussage könnte man auch <strong>auf</strong> die<br />
88 Ders., a.a.O., 330.<br />
89 Ders., a.a.O., 331.<br />
90 Ders., a.a.O., 330.<br />
91 Ders., a.a.O., 314.<br />
44
Verfolgten <strong>der</strong> Kath. Kirche beziehen. Bischof Wazo <strong>von</strong> Lüttich schreibt im Jahr 1048 an<br />
einen Amtsbru<strong>der</strong>, niemand dürfe diejenigen töten, welche <strong>der</strong> Schöpfer leben lasse. „Diejenigen,<br />
welche die Welt jetzt als Unkraut ansieht, kann er als Weizen sammeln, wenn die<br />
Zeit <strong>der</strong> Ernte kommt. Die, welche wir für Gegner Gottes halten, kann er im Himmel über<br />
uns stellen.“ 92<br />
Und Nietzsche hat einmal gesagt: „Leiden sehen ist schön, leiden machen noch schöner.“<br />
Dies trifft nicht nur <strong>auf</strong> die Inquisitoren zu, son<strong>der</strong>n auch <strong>auf</strong> die Spielfilme unserer postmo<strong>der</strong>nen<br />
Gesellschaft, in denen Gewalt glorifiziert wird (cf. Reality TV).<br />
1.2. Begriffe<br />
Es begann mit <strong>der</strong> Exkommunikation, d. i. <strong>der</strong> Ausschluß aus <strong>der</strong> Kirchengemeinschaft,<br />
aber nicht Ausschluß vom Heil. Der Exkommunizierter wird zu einem Schismatiker, <strong>der</strong><br />
sich <strong>von</strong> <strong>der</strong> Verfassung <strong>der</strong> Kirche trennt. Die Griechisch - Orthodoxe Kirche hat sich<br />
durch ein Schisma <strong>von</strong> <strong>der</strong> Römisch - Katholischen Kirche (1054 n.C.)getrennt. Der<br />
Schismatiker trennt sich nicht aus Gründen <strong>der</strong> Lehre, son<strong>der</strong>n wegen dem System und <strong>der</strong><br />
Organisation <strong>der</strong> Kath. Kirche. 93<br />
Der Häretiker dagegen trennt sich wegen den Lehren <strong>der</strong> Kath. Kirche. Das Wort Häresie<br />
kommt <strong>von</strong> dem griech. Wort „hairesis“ und bedeutet „selbsterwählte Anschauung“. 94 Er<br />
stellt je nach Beliebtheit im Volk eine Gefahr für den Leib <strong>der</strong> Kirche dar. Das dt. Wort<br />
„Ketzer“ stammt <strong>von</strong> dem Begriff „Katharer“ ab, das sind die Albigenser. 95<br />
1.3. Der Weg zur Inquisition<br />
Das frühe Mittelalter greift selten zu harten Strafen gegenüber Irrlehren. Die ersten Ketzer<br />
des Mittelalters sind die Albigenser. Im Jahr 1022 werden in Orlean erstmals 13 Ketzer<br />
verbrannt. Papst Innocenz führt sogar einen Kreuzzug gegen die Albigenser in Südfrankreich.<br />
Auf dem 4. Laterankonzil 1215 wird beschlossen:<br />
„Wir schließen aus und verfluchen jede Häresie, die sich gegen den heiligen, rechtmäßigen<br />
katholischen Glauben erhebt, mit welchem Namen sie immer benannt sein mag.“<br />
Kaiser Friedrich <strong>II</strong>. führt 1232 den Feuertod als gesetzliche Strafe für die Ketzerei im ganzen<br />
Reich ein. Der Leib wird verbrannt, damit die Seele gerettet werde. 96<br />
1.4. Die Inquisitionsprozesse<br />
Nach dem Laterankonzil wurde ein Inquisitionsgericht (sanctum officium) eingerichtet.<br />
Die Inquisitoren (Dominikaner) spürten die Ketzer <strong>auf</strong> und brachten sie vor das Gericht.<br />
Wer sich freiwillig meldete, kommt mit einer Geldstrafe da<strong>von</strong>. Es ist die Pflicht aller Bürger<br />
und Katholiken Verdächtige anzuzeigen. Dafür erhalten sie den Plenarablass. Wer es<br />
unterläßt, gerät selbst in Verdacht, <strong>der</strong> Ketzerei zu frönen. Somit wird das Volk eingeschüchtert.<br />
Der Angeklagte steht ohne Verteidiger vor dem Gericht. Gibt er dort seine<br />
Schuld zu, so werden ihm Bußwerke <strong>auf</strong>erlegt: Fasten, Gefängnis, Güterkonfiskation,<br />
Selbstgeißelung o<strong>der</strong> strapaziöse Wallfahrten. Die Todesurteile liegen unter 10 %. Die<br />
Prozesse finden unter absoluter Geheimhaltung statt.<br />
Bleibt <strong>der</strong> Angeklagte hartnäckig, wird er gefoltert. 1252 hat das Papsttum die Folterung<br />
gestattet. Wer sich unter <strong>der</strong> Folterung „bekehrt“, hat mit lebenslänglichem Kerker zu<br />
rechnen. Die Hinrichtungen werden nach einem Gottesdienst öffentlich durchgeführt. Die<br />
92 A. Sierszyn, 2000 Jahre KG, Bd. <strong>II</strong>, S. 336.<br />
93 Vgl. Karl Heussi, Kompendium <strong>der</strong> KG, § 14 a (Fußnote 1).<br />
94 In diesem Sinne zuerst bei Ignatius (110 n. C.). Im NT bedeutet <strong>der</strong>selbe Begriff „Schule, Partei“ (kommt<br />
9x nach <strong>der</strong> Computer Konkordanz zum Novum Testamentum Graece vor: Apg. 5,17; 15,5; 24,5.14; 26,5;<br />
28,22; 1.Kor. 11,19; Gal. 5,20; 2.Petr. 2,1)<br />
95 A. Sierszyn, 2000 Jahre KG, <strong>II</strong>, S. 156.<br />
96 Vgl. auch Hauschild, Lehrbuch <strong>der</strong> Kirchen- und Dogmengeschichte, I, § 8, Kap. 10,3 (S. 460 ff.)<br />
45
Zuschauer singen dabei das „Te deum“ (Großer Gott, wir loben dich). Die Inquisition wütet<br />
vor allen Dingen in Italien, Südfrankreich und Spanien. Zu <strong>der</strong> Inquisition gehören auch<br />
die Hexenverbrennungen, die erst 1792 <strong>auf</strong>hören. Über eine Million angebliche Hexen<br />
wurden verbrannt. Rom schafft die Inquisition erst 1870 ab.<br />
In Spanien werden im 15. Jh. auch die Juden <strong>von</strong> <strong>der</strong> Inquisition verfolgt.<br />
2. Papst Innocenz <strong>II</strong>I (1198 - 1216) 97 und das Vierte Laterankonzil <strong>von</strong><br />
1215<br />
Dieser Papst war einer <strong>der</strong> größten machtpolitischen Päpste des Mittelalters. Er hatte zu<br />
Paris und Bologna Theologie und Rechte studiert. Er wurde mit 37 Jahren schon Papst.<br />
Innocenz war ein rein politischer Papst. Sein gebürtiger Name lautet Lothar <strong>von</strong> Segni. Die<br />
Päpste nehmen den Namen ihrer Vorgänger an, um die theologische und politische Richtung<br />
ihrer Legislaturperiode anzuzeigen.<br />
Die weltlichen Herrscher betrachtete Innocenz als Lehnsträger des Papstes. Der Papst ist<br />
die Sonne, <strong>der</strong> König nur <strong>der</strong> Mond, <strong>der</strong> <strong>von</strong> <strong>der</strong> Sonne das Licht bekommt. „Die königliche<br />
Macht empfängt <strong>von</strong> <strong>der</strong> päpstlichen Gewalt den Glanz ihrer Würde“, schreibt er. 98<br />
Die Gemeinde betrachtet Innocenz <strong>II</strong>I. als Leib. Das Haupt ist <strong>der</strong> Papst (siehe dagegen<br />
Eph. 1,22). 99<br />
Er selbst bezeichnete sich als Stellvertreter Christi und Gottes. Früher nannten sich die<br />
Päpste „vicarius petri“ (Stellvertreter des Petrus) – Innocenz <strong>II</strong>I. nennt sich nun „vicarius<br />
Christi“ (Stellvertreter Christi). 100<br />
1213 erklärte Innocenz ganz England zu seinem Besitz. Zum ersten Mal in <strong>der</strong> Geschichte<br />
gibt es einen König ohne Land, Johann ohne Land, so nennt man ganz spöttisch den König<br />
<strong>von</strong> England. Innocenz ruft auch zum 4. Kreuzzug (1202 - 1204) <strong>auf</strong>. In Konstantinopel<br />
kommt es noch einmal zur Errichtung des Lateinischen Kaisertums (1204 - 1261). Auf<br />
<strong>der</strong> IV. ökumenischen 101 Lateransynode 1215, an <strong>der</strong> mehr als 2000 Delegierte teilnehmen,<br />
setzt er die bischhöfliche Inquisition durch sowie das Verbot neuer Ordensgründungen.<br />
Die Transsubstantiationslehre 102 wird zum unwi<strong>der</strong>sprochenen Dogma (!)<br />
erklärt. Die Laien verzichten <strong>auf</strong> den Kelch! Nach <strong>der</strong> Elevation <strong>der</strong> Hostie (Emporheben<br />
<strong>der</strong> Hostie = Brot) fallen die Gläubigen <strong>auf</strong> die Knie.<br />
Innocenz <strong>II</strong>I. kontrolliert den Klerus durch den Ausbau <strong>der</strong> Kurie!<br />
Außerdem wird die Ohrenbeichte zur Pflicht eines jeden Katholiken erklärt. Wenigstens<br />
einmal im Jahr muß <strong>der</strong> Gläubige den Priester <strong>auf</strong>suchen und seine Sünden bereuen, wo-<br />
97 K. Heussi, Kompendium <strong>der</strong> KG, § 56, l - v.<br />
98 Th. Brandt, Kirche im Wandel <strong>der</strong> Zeit, I, S. 187.<br />
99 Vgl. Hauschild, Lehrbuch <strong>der</strong> Kirchen- und Dogmengeschichte, I, § 8, Kap. 9,2 (S. 452).<br />
100 Vgl. dazu die Literatur <strong>von</strong> Rolf Hochhuth: Der Stellvertreter, Rowohlt, 1967. In diesem Roman kritisiert<br />
er das Schweigen des Papstes Pius X<strong>II</strong>. zur Endlösung <strong>der</strong> Juden im 3. Reich.<br />
101 Das griech. Wort „oikumene“ bedeutet „die ganze Erde“.<br />
102 Die Verwandlung <strong>von</strong> Brot und Wein ganz real in Blut und Leib Christi während den Einsetzungsworten<br />
des Priesters.<br />
46
<strong>auf</strong> <strong>der</strong> Seelsorger mit den Worten antwortet: „ego te absolvo“ (ich vergebe dir) - ansonsten<br />
gibt es kein kirchliches Begräbnis.<br />
Auszug aus dem vierten Laterankonzil 1215: Über die Eucharistie:<br />
„Es gibt nur eine allgemeine Kirche <strong>der</strong> Gläubigen. Außer ihr wird keiner gerettet. In ihr<br />
ist Jesus Christus Priester und Opfer zugleich. Sein Leib und Blut ist im Sakrament des<br />
Altars unter den Gestalten <strong>von</strong> Brot und Wein wahrhaft enthalten, nachdem durch Gottes<br />
Macht das Brot in den Leib und <strong>der</strong> Wein in das Blut verwandelt sind: damit wir vom Seinigen<br />
empfangen, was er vom Unsrigen annahm und so die geheimnisvolle Einheit vollendet<br />
werde.“ 103<br />
Über die Ehe:<br />
Im 13. Jh. gab es noch keine kirchliche Trauung, aber die Brautmesse und die Einsegnung.<br />
Das kirchliche Aufgebot (schon <strong>von</strong> Karl d. Gr. gefor<strong>der</strong>t) wurde zur Pflicht erklärt. Die<br />
kirchliche Trauung entstand erst im 14. Jh. 104<br />
Das Fronleichnamsfest entstand 1246 durch eine Vision <strong>der</strong> hl. Juliana zur Erinnerung an<br />
die Eucharistie (Abendmahl). In einer Prozession wird die Hostie (Brot) öffentlich durch<br />
die Straßen getragen. 105<br />
Beschluss über die Juden: Sie dürfen keine öffentlichen Ämter bekleiden. Sie sollen sich<br />
in ihrer Klei<strong>der</strong>tracht <strong>von</strong> den Christen unterscheiden. Die Konvertiten sollen keine jüdischen<br />
Lebensgewohnheiten übernehmen. 106<br />
3. Weitere Höhepunkte des Mittelalters<br />
3.1. Die sieben Sakramente:<br />
T<strong>auf</strong>e, Firmung, Abendmahl, Beichte, letzte Ölung, Priesterweihe, Ehe. Sakramente vermitteln<br />
Gnade und Heil.<br />
3.2. Die Heiligen und Maria<br />
Die Zahl <strong>der</strong> Heiligen wuchs im 13. Jh. <strong>auf</strong> etwa 1500. Die erste <strong>von</strong> Rom aus erfolgende<br />
Heiligsprechung war die des Bischofs Ulrich <strong>von</strong> Augsburg 993. Seit Gregor IX. (1234)<br />
war die Heiligsprechung ein Vorrecht des Papstes; vordem hatte das Volk bestimmt, wer<br />
heilig sei, wohl meist mit bischöflichem Einverständnis.<br />
Beson<strong>der</strong>s blühte die Marienverehrung. Seit dem Ende des 12. Jh. betete man das Ave Maria.<br />
107 Die Marienfeste waren seit c. 1140 um das Fest <strong>der</strong> unbefleckten Empfängnis bereichert.<br />
Auch das Rosenkranzgebet 108 , das seit dem 12. Jh. <strong>auf</strong>kam, bezeugt die Vorliebe für<br />
die Maria. Beson<strong>der</strong>s ausschweifend trat die Marienverehrung in <strong>der</strong> Predigt hervor. Schon<br />
für Berthold <strong>von</strong> Regensburg war Maria eine Versöhnerin (!) aller Christenleute. Berthold<br />
<strong>von</strong> Regensburg (O.F.M., gest. 1272) war <strong>der</strong> bedeutendste Volksprediger des 13. Jh., <strong>der</strong><br />
<strong>auf</strong> seinen ausgedehnten Predigtwan<strong>der</strong>ungen unter beispiellosem Andrange des Volkes<br />
103<br />
Günter Stemberger, Hrsg., 2000 Jahre Christentum, S. 321.<br />
104<br />
K. Heussi § 61 i.<br />
105<br />
K. Heussi § 61 k.<br />
106<br />
Hauschild, Lehrbuch <strong>der</strong> Kirchen- u. Dogmengeschichte, I, § 8, Kap. 9.3. (S. 455).<br />
107<br />
Das Ave-Maria (gegrüßet seist du, Maria) ist ein Gebet zur Verehrung Marias, bestehend aus dem Gruß<br />
des Engels, den Worten Elisabeths und einem kurzen Bittgebet.<br />
108<br />
Der Rosenkranz besteht aus 6 größeren Perlen (für jede Perle ein Vater Unser) und 53 kleineren (für jede<br />
Perle ein Ave Maria) und endet mit einem Kreuz.<br />
47
sprach und <strong>auf</strong> die breitesten Schichten wirkte. Selbstverständlich wurde in <strong>der</strong> Volkssprache<br />
gepredigt. 109<br />
3.3. Joachim <strong>von</strong> Floris und das Zeitalter des Geistes<br />
Joachim <strong>von</strong> Floris (Stifter und erster Abt des Zisterzienserklosters Floris in Calabrien,<br />
gest. 1201) betrieb eifrig biblisch - apokalyptische Studien und entwarf mit typologischer<br />
Exegese (!) die Dreizeitalterlehre: Auf das Zeitalter des Vaters (AT) und dem Zeitalter<br />
des Sohnes (NT) folgt das Zeitalter des Geistes, nämlich ab 1260, in welchem beson<strong>der</strong>s<br />
die Mönche vorherrschen. 110 Es werde ein vollkommenes Zeitalter sein, so versprach er. In<br />
Italien verbreiteten sich die Anschauungen rasch. Die Anhänger nannte man Joachimiten,<br />
die den Papst als Antichristen bezeichneten. Die durch die Joachimiten auch unter den<br />
Laien verbreitete Erwartung, dass 1260 das „Zeitalter des Geistes“ anbrechen werde, rief in<br />
Italien 1260 eine große Geißelwallfahrt hervor. Flagellanten nahmen an Geißlerprozessionen<br />
teil. Die Flagellanten ziehen oft barfuß durch die Straßen und peitschen sich selbst aus,<br />
um ihre „<strong>auf</strong>richtige“ Buße zu bekunden und um einen Freischein für den Himmel zu bekommen.<br />
Das 13. Jh. schreit nach <strong>der</strong> Reformation. Die Zeit reift nur langsam heran.<br />
3.4. Bedrohung durch den Mongolensturm<br />
Seit 1208 eroberten die wilden, heidnischen Mongolenhorden des „Dschingis-Khan“ (=<br />
Ober Kahn) Temudschin das nördliche China, seit 1218 verwüsteten sie den Iran und drangen<br />
bis Russland vor. 111 Seit 1238 verheerte Batu Russland, schlug die Russen, die Polen,<br />
die Ungarn, 1241 bei Liegnitz die deutschen und polnischen Ritter, ohne den Sieg auszunutzen.<br />
Der Tod ihres Kahns veranlasst sie zum Rückzug aus Europa, welches sie nicht<br />
wie<strong>der</strong> besetzten. Es hätte sonst fatale Folgen für das christliche Abendland gehabt. 112<br />
V<strong>II</strong>I. Die Scholastik<br />
1. Von <strong>der</strong> Schule bis zur Universität<br />
1.1. Was heißt Scholastik?<br />
Scholastik bedeutet Schulwissenschaft. Sie ist die theologische und philosophische Wissenschaft<br />
des Mittelalters. Kennzeichnend ist die Herrschaft <strong>der</strong> Tradition, nämlich <strong>der</strong><br />
Kath. Kirche! Daneben leisten Plato und Aristoteles ihre Hilfsdienste. 113<br />
Es gibt die Frühscholastik (ab 9. Jh.), die Hochscholastik (ab 12. Jh.) und die Spätscholatik<br />
(14. Jh.).<br />
In <strong>der</strong> Hochscholastik beschäftigt man sich mit folgenden Fragen: Wer ist Gott? Wie und<br />
wieweit können wir ihn erkennen? Wie hängen Glauben und Denken zusammen? Was ist<br />
Erkenntnis? Die Philosophie soll <strong>der</strong> Theologie bei <strong>der</strong> Beantwortung <strong>der</strong> Fragen helfen.<br />
Die Philosophie wird zur Schwester <strong>der</strong> Theologie, was für die biblische Disziplin fatale<br />
Folgen haben wird. Die großen Werke, welche in dieser Zeit entstehen, nennt man „Summen“.<br />
109 Heussi § 61, l + m<br />
110 Heussi § 61, v + w<br />
111 Heussi § 64, l + m<br />
112 Karte über den Mongolensturm: dtv - Atlas zur Weltgeschichte, I, S. 178.<br />
113 Sierszyn, <strong>II</strong>, S. 201 ff.<br />
48
1.2. Die Universitäten<br />
Zunächst gab es nur Klosterschulen. Für die Priester gab es noch Kathedral- o<strong>der</strong> Domschulen.<br />
Im 12. Jh. entstanden noch zusätzlich in den Städten die Bürgerschulen. Das <strong>auf</strong>steigende<br />
und begüterte Bürgertum konnte es sich leisten, eine Ausbildung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> zu<br />
finanzieren.<br />
Zum Weiterstudium entstanden erst im 12./13. Jh. die Universitäten. Der Name „Universitas“<br />
bedeutet „Gemeinschaft“, die Gemeinschaft <strong>der</strong> Lehrenden und Lernenden. Die ersten<br />
drei Universitäten entstehen in Bologna, Paris und Oxford. Sie gehen aus Domschulen<br />
hervor.<br />
Grundsätzlich kann auch ein Zwölfjähriger an die Universität. Voraussetzung ist Latein.<br />
Der Aufbau des Studiums:<br />
1. Zwei Jahre Studium <strong>der</strong> sieben freien Künste: Grammatik, Rhetorik, Dialektik, Astronomie,<br />
Arithmetik, Geometrie und Musik. Nach bestandenem Examen ist <strong>der</strong> Student<br />
ein Baccalaureus.<br />
2. Dann ist er zwei Jahre als Lehrer <strong>der</strong> freien Künste (artes liberales) tätig. Daneben erfolgt<br />
ein Weiterstudium in Metaphysik, Ethik und Politik. Nach erneutem Examen wird<br />
<strong>der</strong> Student zum Magister artium beför<strong>der</strong>t. 114<br />
3. Der Magister muß sich zunächst zwei Jahre als Lehrer bewähren. Dar<strong>auf</strong> erfolgt ein<br />
Studium <strong>der</strong> höheren Künste: Theologie o<strong>der</strong> Medizin o<strong>der</strong> Jura. Für ein Fach muß er<br />
sich entscheiden. Calvin hatte z. B. zunächst Jura studiert, danach Theologie.<br />
2. Anselm <strong>von</strong> Canterbury<br />
Nun wollen wir uns wichtige und einflußreiche Persönlichkeiten <strong>der</strong> Scholastik anschauen.<br />
Anselm lebte <strong>von</strong> 1033 bis 1109. 115 Er war Erzbischof <strong>von</strong> Canterbury. Der Ausgangspunkt<br />
seines theologischen Denkens ist <strong>der</strong> Satz: „credo, ut intelligam“ = „ich glaube, um<br />
zu erkennen.“ Anselm schließ an Jes. 7,9 an: „Glaubt ihr nicht, so erkennt ihr nicht“<br />
(LXX). 116 Ohne Glaube geschieht keine Erkenntnis. Zudem führt er den ontologischen 117<br />
Gottesbeweis an: Weil man sich nichts Höheres als Gott denken kann, muß es folglich Gott<br />
geben. O<strong>der</strong>: Allein, weil es den Begriff „Gott“ gibt, muß Gott existieren. Ist das richtig? 118<br />
In seinem berühmten Werk „cur deus homo“ (Warum wurde Gott Mensch) beschreibt er<br />
seine Satisfaktionstheorie (Satisfaktion meint die Wie<strong>der</strong>gutmachung <strong>von</strong> Sünden): Sünde<br />
heißt: Gott nicht die schuldige Unterwürfigkeit unter seinen Willen erzeigen, Gott das Seine<br />
rauben. Die Ehre Gottes for<strong>der</strong>t nicht bloß Rückerstattung des Geraubten, son<strong>der</strong>n eine<br />
Genugtuung (lat. / engl. satisfactio). Zu <strong>der</strong> Genugtuung ist <strong>der</strong> Mensch aber außerstande.<br />
Seine Schuld ist zu groß. „Du hast noch nicht überlegt, wie hoch die Bürde für die Sünde<br />
ist“, schreibt Anselm. Indem nun Christus sein Leben freiwillig hingibt, schafft er eine<br />
Genugtuung <strong>von</strong> unendlichem Wert.<br />
3. Der Universalienstreit<br />
Die fundamentale Frage <strong>der</strong> Scholastik lautete: Was ist wirklich?<br />
114 Begriffe werden im angelsächsischen Sprachraum heute noch verwendet: baccle of artes (B. A.) and master<br />
of arts (M. A.), ferner Master of Divinity (M. Div.) und Master of Theology (M. Th.).<br />
115 Heussi § 53 g - i<br />
116 M.L.: „glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“<br />
117 Ontologie ist die Lehre vom „Sein“.<br />
118 Es fehlt <strong>der</strong> Begriff „Offenbarung“.<br />
49
Die Beantwortung <strong>der</strong> Frage spaltete die Scholastiker in zwei Lager: Die Realisten und die<br />
Nominalisten.<br />
3.1. Die Realisten<br />
Für sie hat das Einzelne keine Wirklichkeit. Nur das Allgemeine hat Realität. Der Europäer<br />
denkt bei dem Begriff „Baum“ an die Eiche, <strong>der</strong> Afrikaner an die Palme und ein Eskimo<br />
an gar nichts. Von daher gesehen sagen die Realisten, hat nur die Idee „Baum“ Realität.<br />
Die Idee war schon immer vorhanden. Die Ideen, die Begriffe an und für sich, nennt man<br />
Universalien.<br />
3.2. Die Nominalisten<br />
Die Nominalisten kontern: Ideen und Begriffe haben keine wirkliche Existenz, sie werden<br />
erst im nachhinein durch den Verstand gebildet. Wirklich sind die Einzeldinge hier und<br />
jetzt. Und: Alle Dinge und Begriffe dieser Welt sind unsere Denkerzeugnisse. Sie entstehen<br />
in unserem Kopf (Empirismus). Nur das, was ich sehe, ist real.<br />
3.3. Beurteilung<br />
Die Tragweite <strong>der</strong> Thematik wird uns deutlich am Beispiel des Guten und <strong>der</strong> Sünde.<br />
Der Nominalist: Das Gute an sich existiert nicht. Nur die guten Taten sind real.<br />
Der Realist: Das Gute hat sein bestimmtes Wesen, und zwar in Gott selbst. Gott selbst ist<br />
das Gute. Anselm führt diesen Gottesbeweis an: Gott an sich ist das „absolut Gute“<br />
(summum bonum: Plato). Er ist <strong>der</strong> Allervollkommenste (ens perfectissimus: Anselm).<br />
Etwas Größeres als Gott kann man sich nicht denken (lat. „quo majus cogitari non potest“:<br />
Anselm).Seine Existenz folgt aus seinem Begriff.<br />
SFW: Gott kann man we<strong>der</strong> durch „gute Taten“ (Nominalisten) noch durch den Begriff des<br />
Guten (Realisten) beweisen, denn Gott ist uns nur dann bekannt, wenn er sich offenbart!<br />
Der Mensch kann <strong>von</strong> sich aus nicht <strong>auf</strong> Gott schließen und auch nicht zu Gott kommen,<br />
son<strong>der</strong>n Gott kommt in seinem Sohn zum Menschen und macht sich ihm bekannt.<br />
Der Nominalist: Die Sünde an und für sich gibt es nicht. Es gibt nur sündige Taten.<br />
Der Realist: Die Sünde besteht nicht nur aus einzelne Taten, sie ist eine Wesenheit, eine<br />
gottfeindliche, transzendentale Macht, aus <strong>der</strong> die sündigen Einzelhandlungen herauswachsen<br />
(Röm. 7,17; 8,1 ff).<br />
SFW: Beides stimmt. Es gibt sündige Taten, aber die Sünde ist auch ein Zustand (Röm.<br />
5,12).<br />
4. Thomas <strong>von</strong> Aquin (O.P.)<br />
4.1. Biographie 119<br />
Thomas wird 1225 als Sohn des Grafen <strong>von</strong> Aquino (Italien) <strong>auf</strong> dem Schloß Roccasecca<br />
geboren. Mit 14 Jahren geht er zum Studium <strong>der</strong> Freien Künste nach Neapel. 1244 tritt <strong>der</strong><br />
19jährige zum Entsetzen <strong>der</strong> Eltern in den mo<strong>der</strong>nen Bettelorden <strong>der</strong> Dominikaner ein. Er<br />
wird aber <strong>von</strong> den Eltern entführt und etwa ein Jahr unter Hausarrest gestellt. Da er bei<br />
seiner Überzeugung bleibt, darf er 1245 in den Orden zurückkehren. Dann studiert er drei<br />
Jahre bei Albertus Magnus in Paris. In Köln erhält Thomas die Priesterweihe. Er vertieft<br />
sich in die Philosophie des Aristoteles. 1252 kehrt er nach Paris zurück. 1259 - 1268 lehrt<br />
er Theologie an <strong>der</strong> Kurie in Rom.<br />
Sein erstes Hauptwerk ist ein Kommentar zu Aristoteles, sein zweites ist die „Summe gegen<br />
die Heiden“, ein apologetisches Handbuch für die Heidenmission.<br />
119 Sierszyn, <strong>II</strong>, S. 218<br />
50
Sein drittes und einflussreichstes Hauptwerk ist die „summa theologica“, die Summe <strong>der</strong><br />
Theologie. Die „summa theologica“ ist noch heute das dogmatische Standartwerk <strong>der</strong><br />
Röm. - Kath. Kirche! Von <strong>der</strong> dt. - lat. Ausgabe gibt es 36 Bde. Dennoch blieb sein Werk<br />
unvollendet. Der neben Augustin einflussreichste Theologe <strong>der</strong> Kath. Kirche stirbt erst<br />
49jährig (1274).<br />
4.2. Philosophie als Schwester <strong>der</strong> Theologie<br />
Thomas spricht an dieser Stelle <strong>von</strong> <strong>der</strong> doppelten Wahrheit (duplex veritas). 120 Für ihn ist<br />
die Philosophie genau so Wahrheit wie die Theologie. Beide zusammen seien Geschwister.<br />
Das hat fatale Folgen. Denn nun wird Gott durch das menschliche Denken erklärt.<br />
Sein großes Thema ist die Unterscheidung <strong>von</strong> Glauben und Wissen. Die Philosophie befasst<br />
sich mit allem, was <strong>der</strong> Mensch durch das natürliche Denken zu verstehen vermag.<br />
Der Glaube hält sich an das Übernatürliche, ans Mysterium. Die Wahrheiten des Glaubens,<br />
insbeson<strong>der</strong>e das Geheimnis Christi, sind übervernünftig. Die Vernunft kann sie nicht fassen.<br />
Die Glaubensinhalte sind nicht wi<strong>der</strong>vernünftig. 121<br />
4.3. Die Gottesbeweise<br />
Thomas meint, dass bestimmte Glaubensaussagen durch die Vernunft zu erklären wären.<br />
Er überlegt, wie er den Nichtgläubigen Gott erklären kann, seine Existenz und seine<br />
Schöpfung. Den ontologischen Gottesbeweis <strong>von</strong> Anselm lehnt Thomas ab: Man könne<br />
nicht aus dem Begriff Gott <strong>auf</strong> die Existenz Gottes schließen, so Thomas gegen Anselm. 122<br />
Thomas führt nun seinerseits fünf Gottesbeweise an: 123<br />
1. Der motorische Gottesbeweis: Der Beweis aus <strong>der</strong> Bewegung (Der kinesiologische<br />
Beweis). Jede Bewegung in dieser Welt braucht eine bewegende Kraft (priumum movens<br />
= die erste Kraft, den ersten Anstoß). Es gibt eben kein perpetuum mobile, also ein<br />
Gegenstand, welches sich <strong>von</strong> selbst in Bewegung setzt. Gott ist die bewegende Kraft.<br />
Er hat die Erde in Bewegung gesetzt.<br />
2. Der Kausalitätsbeweis: Alles, was es in <strong>der</strong> Welt gibt, hat eine Ursache, einen Grund<br />
(Kausalität). Ohne Ursache keine Wirkung. Gott sei die erste Ursache (prima causa).<br />
3. Der kosmologische Beweis: Die Schöpfung braucht einen Schöpfer. Kein Ding entsteht<br />
ex nihilo, aus dem Nichts. Thomas schließt wie Aristoteles <strong>von</strong> dem Endlichen <strong>auf</strong> das<br />
Unendliche.<br />
4. Der moralische Gottesbeweis: Je<strong>der</strong> Mensch trachtet nach <strong>der</strong> Vollkommenheit, nach<br />
einer vollkommenen Ethik. Der Mensch möchte das Gute tun. Die Grundlage aller<br />
Vollkommenheit ist eben Gott, <strong>der</strong> das absolute Gute ist (summum bonum = Plato).Die<br />
Vollkommenheit des christlichen Lebens besteht darum nach Thomas in <strong>der</strong> Gottes- und<br />
Nächstenliebe.<br />
5. Der teleologische Gottesbeweis: Das griech. Wort „Telos“ bedeutet das „Ende, Ziel“.<br />
Alles in <strong>der</strong> Welt strebt letztlich <strong>auf</strong> ein gemeinsames Ziel zu. Der Mensch strebt nach<br />
120 A. Adam, Dogmengeschichte, <strong>II</strong>, S. 102.<br />
121 Sierszyn, <strong>II</strong>, S. 219.<br />
122 Paul Hinneberg, Allgemeine Geschichte <strong>der</strong> Philosophie, Verlag <strong>von</strong> B.G.Teubner, Leipzig, Berlin, 1913,<br />
S. 397. Man nennt den ontologischen Beweis auch den apriorischen Schluß, d. i. die Existenz Gottes allein<br />
aus dem Denken begründen (a priorie = allein aus <strong>der</strong> Vernunft, aus dem Denken). Dagegen stehen die Beweise<br />
„ a posteriori“ = Die Gottesbeweise aus <strong>der</strong> Wahrnehmung.<br />
123 A. Adam, Dogmengeschichte, <strong>II</strong>, S. 110. Vgl. A. Stückelberger, Menschl. Wissen, Gottes Weisheit, S. 80.<br />
51
Frieden und Gerechtigkeit. Die selige Schauung Gottes ist das letzte Ziel des Menschen.<br />
Der Mensch lebt nicht ziellos. Der Kosmos bewegt sich nicht planlos. 124<br />
4.4. Stellungnahme<br />
Wie nehmen wir zu den Gottesbeweisen Stellung? Kann man Gott überhaupt beweisen?<br />
Aus <strong>der</strong> Vernunft sicherlich nicht. Aber gibt es nicht Hinweise aus <strong>der</strong> Schöpfung? Viele<br />
christliche Denker schließen aus <strong>der</strong> Existenz alles Seienden, alles Stofflichen analog <strong>auf</strong><br />
Gott (analogia entis = aus dem Sein analog <strong>auf</strong> Gott schließen. Denkfehler des Analogieschlusses).<br />
Karl Barth, <strong>der</strong> Kirchenvater des 20. Jh., lehnte diesen Analogieschluss ab. Sein<br />
Kontrahent Emil Brunner dagegen schloss <strong>von</strong> Natur <strong>auf</strong> den Schöpfer. Tut dies nicht auch<br />
<strong>der</strong> Apostel Paulus in Röm. 1,20?<br />
Die Gefahr besteht darin, dass aus Röm. 1 u. 2 eine „Natürliche Theologie“ entsteht wie<br />
bei Thomas <strong>von</strong> Aquin: Gott könne man durch die Natur kennen lernen. Das ist nie möglich.<br />
Der Mensch kann <strong>von</strong> sich aus nicht zu Gott kommen. Er ist durch die Sünde getrennt.<br />
In <strong>der</strong> „Natürlichen Theologie bleibt Gott ein philosophischer und ein unpersönlicher.<br />
Bei unserer ganzen Diskussion fehlt eben noch <strong>der</strong> Begriff „Offenbarung“ (ich spreche<br />
deshalb <strong>von</strong> <strong>der</strong> Offenbarungstheologie).Wir können Gott nicht kennen lernen, wenn<br />
er sich nicht offenbart, und zwar durch Jesus Christus. In <strong>der</strong> Offenbarungstheologie wird<br />
Gott zu einem Du.<br />
Die Natur, die Bewegung <strong>der</strong> Erde, das menschliche Streben nach Vollkommenheit und<br />
Zielverwirklichung zeigen höchstens die Fußspuren Gottes. Sie erwecken in uns die Frage<br />
nach <strong>der</strong> Existenz Gottes. In diesem Sinne ist die kreationistische Literatur zu verstehen. In<br />
uns beginnt ein Suchen nach Gott, wenn wir die Werke <strong>der</strong> Schöpfung betrachten. Erlösung<br />
allerdings gibt es allein in und durch Jesus Christus.<br />
4.5. Die Bedeutung des Thomas in <strong>der</strong> <strong>Kirchengeschichte</strong><br />
Thomas ist eine zutiefst fromme, mystische Persönlichkeit. Er besitzt die Tränengabe. Unter<br />
einer Flut <strong>von</strong> Tränen beginnt er jedes Buch zu schreiben. Theologie ist ihm Gottesdienst.<br />
125 Thomas hat die kirchliche Tradition restlos verteidigt, auch die Unfehlbarkeit des<br />
Papstes. Späteren katholischen Generationen dient er immer wie<strong>der</strong> als reiches Waffenarsenal.<br />
1323 wird er heiliggesprochen. Beim Konzil <strong>von</strong> Trient liegen <strong>auf</strong> dem Altar <strong>der</strong><br />
Marienkirche neben <strong>der</strong> Bibel und den Papstdekreten auch die Summa des Thomas. 1567<br />
wird er zum „Lehrer <strong>der</strong> Kirche“ erklärt. Leo X<strong>II</strong>I. ernennt ihn 1879 zum Schutzpatron<br />
aller kath. Schulen, <strong>der</strong> Buchhändler und <strong>der</strong> Bleistiftfabrikanten. Er erhebt Thomas zum<br />
124 A.E. Wil<strong>der</strong> Smith und W. Gitt führen heute den Gottesbeweis aus <strong>der</strong> Informatik an: Die DNS - Moleküle,<br />
die Bausteine des Lebens, können nicht per Zufall entstanden sein. Es braucht Information und eine<br />
Planung. Woher kommt die Information? Woher kommt die Ordnung <strong>der</strong> DNS - Moleküle? Es muss einen<br />
Planer geben, nämlich Gott. Vgl. A. E. Wil<strong>der</strong> Smith, Die Naturwissenschaften kennen keine Evolution,<br />
Schwabe Verlag, Basel u. Stuttgart, 1982, S. 54, 62, 86. O<strong>der</strong> siehe W. Gitt, Das biblische Zeugnis <strong>von</strong> <strong>der</strong><br />
Schöpfung, Hänssler, Neuhausen, 1985, S. 129:<br />
1. Eine Konstruktion bedingt die Idee eines Bauplanes und somit einen Konstrukteur.<br />
2. Die Qualität einer Erfindung drückt sich in <strong>der</strong> Zweckmäßigkeit <strong>der</strong> Problemlösung aus. Ihre Genialität<br />
ist ein Hinweis <strong>auf</strong> den Ideenreichtum des Erfin<strong>der</strong>s.<br />
3. Jede empfangene Information benötigt einen Sen<strong>der</strong>, <strong>der</strong> sie <strong>auf</strong> <strong>der</strong> Basis eines gemeinsamen Codes<br />
übermittelt.<br />
4. Sich selbst überlassene Materie bringt keine Konzeptionen hervor.<br />
5. Die Bausteine <strong>der</strong> Materie haben keine psychischen Eigenschaften, sie planen nicht und können nicht<br />
denken. Sie haben keine eigene Zielvorgabe. Nur ein intelligentes Wesen kann Materie zielorientiert bearbeiten<br />
und verarbeiten. (Siehe Ton und Töpfer).<br />
6. Satz des Pasteur: Leben kann nur <strong>von</strong> Leben abstammen!<br />
125 Sierszyn, <strong>II</strong>, S. 219.<br />
52
kath. Normaltheologen. Die Theologie und die Philosophie des Thomas sollen die Grundlage<br />
aller katholischen Wissenschaft sein. 126<br />
5. Duns Scotus (O.F.M.)<br />
Duns Scotus kommt aus Südschottland und lehrt mit 23 Jahren als Professor <strong>der</strong> Theologie<br />
in Oxford, Paris und Köln. 127 Seine Theologie lässt sich in dem einen Satz resümieren:<br />
Gottes Wille ist souverän! Scotus verleiht dem Willen und <strong>der</strong> Liebe einen höheren Stellenwert<br />
als <strong>der</strong> Einsicht (gegen Thomas). Er trennt die Philosophie <strong>von</strong> <strong>der</strong> Theologie.<br />
„Nicht nur die <strong>von</strong> Thomas als übervernünftig anerkannten Mysterien <strong>der</strong> Trinität und Inkarnation,<br />
son<strong>der</strong>n auch Gottes Leben, seine Vernunft, sein Wille, sein Vorauswissen, seine<br />
Vorausbestimmung und vieles an<strong>der</strong>e sind kein Gegenstand strenger Vernunftbeweise, so<br />
wenig wie die Unsterblichkeit <strong>der</strong> Seele und das göttliche Gericht.“ 128 Nur <strong>der</strong> Glaube<br />
kann hier Gewissheit geben. Gott ist absolut frei. Gott ist nicht primär ein Sein (esse), son<strong>der</strong>n<br />
Wille (voluntas). Was Gott will, ist gut, weil er es will. Gott wirkt, wo und wann er es<br />
will (ubi et quando deus est vult). Die Offenbarung muss auch nicht unbedingt denknotwendig<br />
sein. Gott steht jenseits <strong>von</strong> Gut und Böse, er ist an kein Sittengesetz gebunden, in<br />
das wir ihn einfangen können. Gott „musste“ also nicht Mensch werden, er wollte es. Gott<br />
wird durch Glauben und Gehorsam wahrgenommen, nicht durch Denken und Philosophie.<br />
Die Welt kann ohne göttliche Erleuchtung wahrgenommen werden, die Offenbarung aber<br />
nur durch Glauben und Gehorsam (Joh. 7,17). Dem Gottesbild entspricht auch das Menschenbild:<br />
Der menschliche Wille steht über dem Verstand. Der Wille des Menschen ist<br />
frei (gegen Luther).<br />
Scotus lehrt die unbefleckte Empfängnis <strong>der</strong> Maria. Diese Lehre wird 1854 zum Dogma<br />
erklärt.<br />
5.1. Vergleich zwischen Thomas und Scotus 129<br />
THOMAS VON AQUIN DUNS SCOTUS<br />
Gotteslehre Gott ist das absolute Sein Gott ist Wille<br />
Psychologie Vernunft über Willen Wille über Vernunft<br />
Werk Christi ein unendlicher Wert persönlich annehmen<br />
Marienlehre nicht frei <strong>von</strong> Erbsünde unbefleckte Empfängnis<br />
6. Wilhelm <strong>von</strong> Occam (O.F.M.)<br />
Wilhelm <strong>von</strong> Occam (1285 - 1349) wurde in London geboren. Die Vernunft ist für ihn<br />
keine Erkenntnisquelle des Göttlichen. Staat und Kirche sind zwei völlig getrennte Gebiete,<br />
und eine hierarchische Papstkirche ist für die Kirche nicht zwingend. Theologie hat<br />
126 Sierszyn, <strong>II</strong>, S. 221.<br />
127 Sierszyn, <strong>II</strong>, S. 222.<br />
128 P. Hinneberg, Geschichte <strong>der</strong> Philosophie, S. 412.<br />
129 Heussi, § 62 n.<br />
53
eim ihm nichts mit <strong>der</strong> Vernunft zu tun. Gott, Dreieinigkeit, Menschwerdung, Himmel<br />
usw. gehören nicht <strong>der</strong> wissenschaftlichen Erkenntnis an. Die Inhalte des christlichen<br />
Glaubens sind nicht nur übervernünftig, son<strong>der</strong>n auch wi<strong>der</strong>vernünftig. Gott geht törichte<br />
Wege. Tertullians „Ich glaube, weil es absurd ist“, ist damit wie<strong>der</strong> erstanden. Eine Begründung<br />
des Glaubens ist unmöglich. Was Thomas einst zu einem harmonischen Gebäude<br />
vereinte, fällt zusammen.<br />
Occam geht den Weg <strong>von</strong> 1.Kor.1u.2. Der Apostel Paulus verkündigt nicht die Weisheit<br />
dieser Welt, son<strong>der</strong>n allein den gekreuzigten Christus. Aber diese Predigt des Evangeliums<br />
erfolgt nicht immer wi<strong>der</strong>vernünftig (gegen Occam): Stephanus bewies den Juden, dass<br />
Jesus <strong>der</strong> Christus ist. In Apg. 17 knüpft Paulus an Religion und an die Philosophie Athens<br />
an. Und in 1.Kor. 15 legt Paulus überzeugend die Auferstehung Christi dar.<br />
IX. Nie<strong>der</strong>gang und Versagen <strong>der</strong> Papstkirche (Spätmit-<br />
tel.) 130<br />
1. Der Papst Bonifaz V<strong>II</strong>I<br />
1.1. Das Jubeljahr<br />
Bonifaz (o<strong>der</strong> Bonifatius) ist <strong>von</strong> 1294 - 1303 Papst. Der stolze Mann liebte es, durch großen<br />
Prunk zu bekunden, dass er <strong>der</strong> Herr <strong>der</strong> Welt sei. Im Jahr 1300 ließ er das Jubeljahr<br />
ausrufen: Jedem Rompilger stellt Bonifaz vollkommenen Erlaß <strong>der</strong> zeitlichen Sündenstrafen<br />
in Aussicht. 131 Die Straßen <strong>der</strong> Ewigen Stadt wimmeln <strong>von</strong> Menschen. Die Wall-<br />
130 Heussi § 65; Sierszyn, <strong>II</strong>, S. 347 ff.; K. D. Schmidt § 31; Th. Brandt, I, S. 204 ff.; K. Aland, I, S. 321 ff.<br />
131 Sierszyn, <strong>II</strong>, 347.<br />
54
fahrer bringen Geschenke und Geld in die Stadt. Es ist das erste Mal, dass es eine so außerordentliche<br />
Vergünstigung gibt. Ein Jubeljahr, heißt es, könne nur alle 100 Jahre stattfinden.<br />
Später wie<strong>der</strong>holen sich solche nach 33 und nach 5 Jahren, je nachdem, wie viel<br />
Geld Rom benötigt. Ein großes Bedürfnis nach Buße, Sühne und Vergebung erfüllt die<br />
spätmittelalterliche Christenheit. Päpstliche Werber durchziehen das Abendland und schüren<br />
die Wallfahrtstimmung. Dem Papst bringen die Besucherströme wie<strong>der</strong> einen Prestigegewinn<br />
und vor allem Ströme <strong>von</strong> Geld.<br />
1.2. Die Bulle „Unam sanctam“ <strong>von</strong> 1302<br />
In seiner Macht überschätzt sich Bonifaz. Der Papst unterlag einem Streit mit den Königen<br />
Europas. Der Gegenstand des Streits war die Besteuerung des Klerus und <strong>der</strong> Klöster durch<br />
den Staat. 132 1296 erklärte Bonifaz in <strong>der</strong> Bulle „Clericis laicos“ (die Kleriker sind nur<br />
Laien) die Besteuerung <strong>der</strong> Kirchen für das ausschließliche Recht des Papstes und bedrohte<br />
die Verletzung dieses Rechts mit Bann und Interdikt. 133 Aber we<strong>der</strong> in England noch in<br />
Frankreich vermochte <strong>der</strong> Papst durchzudringen. Der französische König Philipp IV. ließ<br />
sogar den päpstlichen Legaten gefangen nehmen. Dar<strong>auf</strong>hin veröffentlichte Bonifaz die<br />
berühmte Bulle „Unam sanctam ecclesiam“ („die eine heilige Kirche“) 1302. Ich zitiere in<br />
Auszügen: 134<br />
Außerhalb <strong>der</strong> Kirche kein Heil:<br />
„Und wir glauben fest und bekennen einfältig, dass außer ihr kein Heil ist und keine<br />
Vergebung <strong>der</strong> Sünden, wie <strong>der</strong> Bräutigam im Hohenlied ausruft: `Einzig ist meine<br />
Taube, die Makellose, die Einzige ihrer Mutter, die Erwählte ihrer Gebärerin´.“<br />
Die Kath. Kirche ist die Arche Noah:<br />
„Eine Arche Noach war gewißlich zur Zeit <strong>der</strong> Sintflut und bildete die eine Kirche vor,<br />
... die einen Steuermann und Lenker hatte, nämlich Noach, und außer ihr wurde, wie<br />
wir lesen, alles bestehende Leben <strong>auf</strong> Erden zerstört.“<br />
Wer sich nicht dem Papst unterordnet, gehört nicht zu den Schafen Christi:<br />
„Wenn also Griechen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e behaupten, sie seien Petrus und seinen Nachfolgern<br />
nicht anvertraut, bekennen sie damit notwendig, dass sie nicht zu den Schafen Christi<br />
gehören, da <strong>der</strong> Herr spricht - bei Johannes -, dass es eine Herde und einen Hirten geben<br />
werde (Joh. 10,16).“<br />
Das weltliche (Staat) und das geistliche (Kirche) Schwert:<br />
In Anlehnung an Luk. 22,38 u. Mt. 26,52 heißt es in <strong>der</strong> Bulle:<br />
„Beide also sind in <strong>der</strong> Gewalt <strong>der</strong> Kirche, das geistliche nämlich wie das materiale, dieses<br />
jedoch soll für die Kirche, jenes aber <strong>von</strong> <strong>der</strong> Kirche geführt werden; jenes durch die<br />
Hand des Priesters, dieses durch die Hand <strong>der</strong> Könige und Krieger, aber <strong>auf</strong> Geheiß und<br />
mit Erlaubnis des Priesters. Das Schwert nun muß unter dem Schwert stehen und die<br />
weltliche Autorität <strong>der</strong> geistlichen Macht unterworfen sein.... Wenn also die irdische<br />
Gewalt abweicht, wird sie <strong>von</strong> <strong>der</strong> geistlichen Gewalt gerichtet werden, wenn aber eine<br />
geringere geistliche abweicht, <strong>von</strong> ihrer höheren; wenn aber die oberste, kann sie allein<br />
<strong>von</strong> Gott, nicht aber <strong>von</strong> einem Menschen gerichtet werden.... Somit erklären, behaupten<br />
132 Heussi § 65 b.<br />
133 Das lat. Wort „interdictum“ bedeutet „Verbot“. Das Interdikt wurde als Kirchenstrafe über Personen o<strong>der</strong><br />
über Orte verhängt. Es untersagte den Vollzug o<strong>der</strong> die Teilnahme an gottesdienstliche Handlungen (Brockhaus<br />
Enzyklopädie, Bd. 10, S. 561).<br />
134 G. Stemberger, Hrsg., 2000 Jahre Christentum, S. 310 - 312.<br />
55
und entscheiden wir, dass allen menschlichen Geschöpfen überhaupt zum Seelenheil<br />
notwendig ist, sich dem römischen Bischof zu unterwerfen.“<br />
Der französische König Philipp appellierte dar<strong>auf</strong>hin an ein allgemeines Konzil, welches<br />
<strong>der</strong> Papst Bonifaz ablehnte. Da ließ <strong>der</strong> König den Papst im Schlosse zu Anagni gefangen<br />
nehmen. Dieser Vorgang bedeutet den Sturz <strong>der</strong> päpstlichen Weltherrschaft. Von den Bürgern<br />
zu Anagni wurde <strong>der</strong> Papst zwar wie<strong>der</strong> befreit, weil er ihnen totale Absolution versprochen<br />
hatte, aber infolge <strong>der</strong> Aufregung starb Bonifaz wenige Wochen später in Rom.<br />
2. Die babylonische Gefangenschaft <strong>der</strong> Päpste in Avignon<br />
2.1. Die Päpste außerhalb Roms<br />
Von 1309 - 1377 residierten die Päpste nicht in Rom, son<strong>der</strong>n in Avignon. Sie waren total<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> französischen Krone abhängig. Deshalb spricht man <strong>von</strong> <strong>der</strong> 70jährigen babylonischen<br />
Gefangenschaft des Papsttums. Klemens V. wird nicht in Rom, son<strong>der</strong>n in Lyon zum<br />
Papst inthronisiert. Klemens musste <strong>auf</strong> Verlangen des Königs Philipp IV. die Bulle „Unam<br />
sanctam“ annullieren. Und außerdem musste <strong>der</strong> Papst unter französischem Druck den<br />
Tempelorden <strong>auf</strong>heben. Einige Ordensmitglie<strong>der</strong> landeten <strong>auf</strong> dem Scheiterh<strong>auf</strong>en. Die<br />
Päpste waren nur Marionetten <strong>der</strong> französischen Könige.<br />
2.2. Die päpstlichen Einnahmequellen<br />
Das Papsttum verfügt zu seiner Zeit über die folgenden Geldquellen: 135<br />
1. Einkünfte aus dem Kirchenstaat (Patrimonium Petri).<br />
2. Der Peterspfennig; eine regelmäßige Häusersteuer in England, Irland, Skandinavien,<br />
Polen und Ungarn.<br />
3. Zinsen <strong>der</strong> Klöster und Bistümer.<br />
4. Gebühren für die Verleihung geistlicher Ämter (die Bischofskrone konnte ein Fürst sich<br />
k<strong>auf</strong>en).<br />
5. Spolien (Nachlass <strong>der</strong> Bischöfe).<br />
6. Verwaltungsgebühren.<br />
7. Ablässe, beson<strong>der</strong>s in den Jubeljahren.<br />
2.3. Die Ausgaben <strong>von</strong> Papst Johann XX<strong>II</strong> (1316 - 1334)<br />
� Der Papst verbrauchte allein für seine Kriege (!) 63,7 % (!) <strong>der</strong> Einnahmen;<br />
� für die Beamtengehälter 12,7 %;<br />
� für Almosen, wozu auch die Gaben für kirchliche Neubauten und die Mission gehörten;<br />
7,16 %;<br />
� für Kleidung 3,35 %;<br />
� für Schmuck 0,17 %,<br />
� für Bauten 2,9 %;<br />
� für Küche und Keller 2,5 %;<br />
� für seine Verwandten und Freunde 4 %.<br />
Das ist die Haushaltung des Stellvertreters Christi! 136<br />
2. 4. Zwei Stellvertreter gleichzeitig: Rom und Avignon (das Papstschisma 1378 - 1415)<br />
135 Heussi § 65 o; Sierszyn, <strong>II</strong>, S. 350<br />
136 K. D. Schmidt, S. 256.<br />
56
Die oligarchischen 137 Bestrebungen <strong>der</strong> italienischen Kardinäle duldeten nicht länger ein<br />
Papsttum in Avignon. Sie wählten einfach Urban VI. (1378 - 1389) als Papst in Rom. Sein<br />
Kontrahent Klemens V<strong>II</strong>. (1378 - 1394) aus Avignon wollte mit seinen Truppen Rom erobern,<br />
was ihm aber nicht gelang. Nun spaltete sich das westliche Abendland für 51 Jahre<br />
in zwei Obödienzen: 138 Zu Avignon gehörten Frankreich, Sardinien, Sizilien, Neapel,<br />
Schottland und habsburgische Gebiete. Nach Rom orientierten sich Flan<strong>der</strong>n, England,<br />
Deutschland und Italien.<br />
PÄPSTE IN ROM PÄPSTE IN AVIGNON<br />
Urban VI. (1378 - 1389) Klemens V<strong>II</strong>. (1378 - 1394)<br />
Bonifaz IX. (1389 - 1409) Benedikt X<strong>II</strong>I. (1394 - 1409)<br />
Innocenz V<strong>II</strong>. (1404 - 1406)<br />
Gregor X<strong>II</strong>. (1406 - 1409)<br />
Schließlich wollten die Kardinäle <strong>von</strong> Rom und Avignon ein Papstschisma weiterhin nicht<br />
dulden. Sie trafen sich zu einem Konzil zu Pisa 1409. Die Synode verhängte über Gregor<br />
X<strong>II</strong>. und Benedikt X<strong>II</strong>I. die Absetzung und wählte einen neuen Papst, Alexan<strong>der</strong> V., einen<br />
Griechen. Aber da die beiden an<strong>der</strong>en Päpste sich weigerten, ihrer Würde zu entsagen, war<br />
das Übel nur vergrößert: statt zweier Päpste hatte die Kirche drei!<br />
2.5. Das Konzil zu Konstanz (1414 - 1418)<br />
Es war das Verdienst des Königs Sigismund, durch welchen das Konzil zustande kam. Es<br />
sollte die unwürdigen päpstlichen Verhältnisse beseitigen. Für vier Jahre ließen sich über<br />
100 000 Menschen am Bodensee nie<strong>der</strong>. Das brachte für die Stadt Konstanz wirtschaftlichen<br />
Aufschwung. Man zählt 33 Kardinäle, 47 Erzbischöfe, 228 Bischöfe, 500 geistliche<br />
Würdenträger, 24 päpstliche Geheimschreiber, 217 Doktoren <strong>der</strong> Gottesgelehrsamkeit, 361<br />
juristische Doktoren, 171 Doktoren <strong>der</strong> Arzneikunde, 1400 Magister <strong>der</strong> Freien Künste,<br />
dazu Grafen, Herzöge, Freiherren und Ritter ohne Zahl. Allein die Leibwache 139 des Papstes<br />
Johannes XX<strong>II</strong>I. bestand aus 1600 Mann. Hinzu kommt schließlich ein Heer <strong>von</strong> K<strong>auf</strong>leuten,<br />
Spielleuten, Bäckern und Gauklern. 140<br />
Folgende Punkte wurden beschlossen: 141<br />
1. Das allgemeine Konzil ist dem Papst übergeordnet. Am 6.April 1415 wird <strong>der</strong> Episkopalismus<br />
142 zum Dogma erklärt.<br />
2. Die drei Päpste werden abgesetzt. Ein einziger neuer Papst Martin V. (1417 - 1431)<br />
wird gewählt.<br />
3. Am 4. Mai 1415 werden Lehre und Person Wiclifs verurteilt.<br />
4. Am 6. Juli 1415 wird Johannes Hus und am 30. Mai 1416 sein Anhänger Hieronymus<br />
<strong>von</strong> Prag zum Feuertode verurteilt.<br />
137 Oligarchie ist die Regierung durch die Min<strong>der</strong>heit.<br />
138 Obödienz (auch „Obedienz“, lat. Oboedientia = Gehorsam) ist die Gehorsamspflicht <strong>der</strong> Kleriker und<br />
Ordensangehörigen gegenüber dem Papst.<br />
139 Heute kommt die Leibwache aus <strong>der</strong> neutralen Schweiz.<br />
140 Sierszyn, <strong>II</strong>, 351 f.<br />
141 Heussi § 69 c - g.<br />
142 Episkopalismus ist die Herrschaft <strong>der</strong> Episkopen (Bischöfe, Kardinäle usw.) über dem Papst, bzw. die<br />
Entscheidungsfreiheit des Papstes wird eingeschränkt.<br />
57
Das Konzil <strong>von</strong> Basel (1431 - 1449) bezeichnet den Höhepunkt des Konziliarismus. 143 Als<br />
nämlich <strong>der</strong> Papst Eugen IV. am 18. Dez. 1431 die Synode <strong>auf</strong>löste und für 1433 nach<br />
Bologna berief, wi<strong>der</strong>setzte sich die Baseler Versammlung, erhob gegen den Papst Anklage<br />
und begann durchgreifende Reformen. Der Papst lenkte ein. Er erkannte das Konzil<br />
schließlich an.<br />
X. Vorreformatorische Bestrebungen<br />
1. John Wiclif (1328 - 1384)<br />
1.1. Das Leben Wiclifs<br />
John Wiclif (Wyclif) wurde um 1328 in <strong>der</strong> Grafschaft York geboren. 144 Etwa um 1345<br />
beginnt er sein Studium an <strong>der</strong> Universität Oxford und promoviert 1361 zum Magister <strong>der</strong><br />
Sieben freien Künste. Er lehrt nun Theologie (1372 Doktor <strong>der</strong> Theologie). Der König <strong>von</strong><br />
England verleiht ihm 1374 die Pfarrei zu Lutterworth.<br />
Zunächst argumentiert er rein nationalistisch: Die Kirche muß durch die weltlichen Fürsten<br />
enteignet werden; sie waren es ja auch, die <strong>der</strong> Kirche einst ihre Güter übertrugen. Dem<br />
römischen Kirchengesetz stellt er das „evangelische Gesetz“ (lex evangelica) und das Gesetz<br />
Christi (lex Christi) gegenüber.<br />
Über die Röm. Kirche urteilt er:<br />
„Es wäre für die Kirche heilsam, wenn es keinen Papst o<strong>der</strong> Kardinäle gäbe, denn <strong>der</strong><br />
Bischof <strong>der</strong> Seelen, <strong>der</strong> Herr Jesus Christus, samt seinen treuen Knechten würde ohne<br />
einen solchen Papst und die übrigen Prälaten die Kirche <strong>auf</strong> Erden viel besser regieren.<br />
So haben Petrus und die übrigen besitzlosen Priester nach <strong>der</strong> Himmelfahrt des Herrn<br />
die Kirche regiert, bevor sie mit weltlichem Besitz ausgestattet wurde, warum sollten sie<br />
das heute nicht mehr tun können? ... Denn die lästerliche Erteilung <strong>von</strong> Ablässen im<br />
Himmel, die ekelhaften Bedrückungen <strong>der</strong> Gläubigen <strong>auf</strong> Erden samt den Traditionen<br />
und Verfolgungen des Antichrists fänden in <strong>der</strong> Kirche ein Ende... Dann würde ohne<br />
Zweifel kein Papst, Bischof o<strong>der</strong> Kleriker weltlich herrschen, denn aus dem Zeugnis <strong>der</strong><br />
Schrift bei<strong>der</strong> Testamente ist es offenbar, dass <strong>der</strong> Herr Jesus Christus so gelebt und<br />
gelehrt hat.“ 145<br />
1.2. Die wahre Kirche<br />
Was viele erahnt und gedacht hatten, aber nicht auszusprechen wagten, hatte nun endlich<br />
jemand einmal zu Papier gebracht. Aber konnte Wiclif mit seinen Reformgedanken durchdringen?<br />
Theologisch denkt Wiclif stark in den Bahnen Augustins. Die Kirche ist eine Gemeinschaft<br />
<strong>der</strong> Erwählten. Diese sind das „corpus verum“ (<strong>der</strong> wahre Leib Christi) <strong>der</strong> Kirche. Die<br />
äußere Kirche ist eine Mischung <strong>von</strong> Lämmern und Böcken (corpus permixtum). Kein<br />
Mensch kann es <strong>von</strong> einem an<strong>der</strong>en wissen, ob er zu den Erwählten gehört, denn es gibt<br />
viel Scheinheiligkeit. Es gibt indessen Zeichen dafür, ob jemand zu wahren Gemeinde gehört:<br />
die Früchte des sittlichen Lebens.<br />
1.3. Wiclifs Nein zu kath. Dogmen<br />
143 Der Konziliarismus bezeichnet die Entscheidungsgewalt des Konzils über den Papst.<br />
144 Heussi § 68 a - f; Sierszyn, <strong>II</strong>, S. 243.<br />
145 Sierszyn, <strong>II</strong>, S. 244.<br />
58
Bei seiner Kritik an <strong>der</strong> kath. Kirche muß er tiefgründiger die Bibel studieren. Er bekommt<br />
eine Liebe zur Hl. Schrift. Wiclif sagt nein zur römischen Abendmahlslehre. Brot und<br />
Wein werden nicht verwandelt in Leib und Blut Christi. Der Leib des Herrn bleibt im<br />
Himmel, Brot und Wein sind nur Zeichen seiner geistigen Gegenwart. Den Höhepunkt <strong>der</strong><br />
Messe, die Wandlung (Transsubstantiation), nennt er „Greuel <strong>der</strong> Verwüstung“ an heiliger<br />
Stätte. Im Papsttum erblickt er den Antichristen. Der Herr hat dem Petrus nie einen absoluten<br />
Primat gegeben, geschweige denn seinen Nachfolgern. Wiclif verwirft auch die Letzte<br />
Ölung, das Priesterzölibat, das Mönchtum, die Heiligenverehrung, die Totenmessen und<br />
die Beichte (Sünden müssen zur Vergebung nicht zwingend einem Menschen reuig bekannt<br />
werden). Auch die Beschlüsse <strong>der</strong> Päpste und Konzilien sind wertlos, wenn sie sich<br />
nicht an die Hl. Schrift halten.<br />
1.4. Wiclifs Bibelübersetzung<br />
Wiclifs Hauptwerk ist die Übersetzung <strong>der</strong> Bibel in die englische Sprache. Die Hl. Schrift<br />
hat absolute Autorität vor aller mündlichen Tradititon <strong>der</strong> Kirche. Alle Christen haben das<br />
Recht, die Bibel zu kennen. Wiclif übersetzt das NT in die volkstümliche Sprache. Als<br />
Vorlage dient ihm die Vulgata. Sein Freund Nicolaus <strong>von</strong> Hereford übersetzt das AT. Vor<br />
ihnen hatten wohl schon an<strong>der</strong>e denselben Versuch unternommen, doch war ihnen die<br />
Übersetzung nicht geglückt. Der Stil war zu holperig. 1382 war dann die ganze Bibel übersetzt.<br />
Sie musste zur Vervielfältigung immer wie<strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Hand abgeschrieben werden.<br />
Gedruckt wurde das NT lei<strong>der</strong> erst 1731, die ganze Bibel 1810. 146 Auch die heutige englische<br />
Bibel geht in ihren Wurzeln <strong>auf</strong> Wiclif zurück. Gern berufen sich heute die Wycliff -<br />
Bibelübersetzer in Burbach (Deutschland) <strong>auf</strong> den Oxfor<strong>der</strong> Theologieprofessor. Ihr Ziel<br />
ist es, dass jedes Volk die Bibel in seiner Muttersprache bekommt.<br />
Heute arbeiten die Wycliff - Bibelübersetzer mit einer einzigen CD - Rom (HFB = Handbuch<br />
für Bibelübersetzer). Sie enthält viele verschiedene Bibelübersetzungen (engl., span.,<br />
franz., u.a.), das griech. NT, das hebr. AT, die LXX (Septuaginta), versch. Lexika, Wörterbücher,<br />
Handbücher für Übersetzer, Exegetische Zusammenfassungen, Hilfen für Muttersprachenübersetzungen,<br />
CONNOT - eine Datenbank mit Notizen <strong>von</strong> Übersetzungsberatern,<br />
Prüflisten für Eigennamen und Parallelstellen in den Evangelien, ein Buch zur Ausbildung<br />
<strong>von</strong> Muttersprachenübersetzern u. v. a. m. 147<br />
1.5. Wiclifs Verfolgung<br />
Zunächst musste sich Wiclif 1377 vor dem Bischof in London verantworten. Das bewaffnete<br />
Eingreifen des Adels schützte den Theologen. 1382 wurde er <strong>von</strong> dem Erzbischof<br />
<strong>von</strong> Canterbury nach London geladen. Als die Sätze Wiclifs verworfen wurden, wackelten<br />
die Wände, denn ein Erdbeben hatte London erschüttert. Wiclif erkannte das „Erdbebenkonzil“<br />
als Gericht Gottes. Dennoch konnten es die Oxfor<strong>der</strong> nicht verhin<strong>der</strong>n, dass Wiclif<br />
vom Konzil verbannt wurde. Er musste seine Professur <strong>auf</strong>geben, durfte aber weiterhin als<br />
Pfarrer in Lutterworth arbeiten. 1384 starb er eines natürlichen Todes.<br />
Wiclif hatte Laienprediger durchs Land geschickt, die vom Klerus „Lollarden“, d. h. Unkrautsäer,<br />
genannt wurden. Die Inquisition kann die Lollarden stoppen und schickt etliche<br />
<strong>von</strong> ihnen <strong>auf</strong> den Scheiterh<strong>auf</strong>en.<br />
Das Konstanzer Konzil ließ die Gebeine Wiclifs exhumieren, verbrennen und die Asche<br />
ins Dorfflüsschen streuen.<br />
146 Nach Wiclif gelang es William Tyndale 1526 eine englische Bibel drucken zu lassen. Er übersetzte direkt<br />
aus dem Hebräischen und dem Griechischen. Sein Vorhaben wurde in England verboten. Also ließ er einige<br />
Exemplare in Deutschland drucken. Dafür landete Tyndale in Antwerpen <strong>auf</strong> dem Scheiterh<strong>auf</strong>en.<br />
147 Zeitschrift <strong>der</strong> Wycliff - Bibelübersetzer, Nr. 2 / 1997.<br />
59
2. Johannes Hus <strong>von</strong> Prag<br />
2.1. Professor und Priester in Prag 148<br />
Jan (Johannes) Hus wurde 1369 in Böhmen geboren. Als 20jähriger ging er an die Universität<br />
Prag. Im Jahr 1400 wird er als Priester geweiht. Karl IV., Kaiser <strong>von</strong> Deutschland und<br />
König <strong>von</strong> Böhmen, gründete 1348 die Universität zu Prag. Zwar waren die Tschechen<br />
an <strong>der</strong> Universität in Mehrzahl, aber die Deutschen hatten zu bestimmen. Karl gab den<br />
Tschechen im Rat <strong>der</strong> Universität nur eine Stimme, den Deutschen dagegen drei - ein böser<br />
Same....! 1382 vermählt sich Karls Tochter mit dem englischen König. Dank dieser verwandtschaftlichen<br />
Brücke konnten Prager Studenten in Oxford studieren, wo sie mit <strong>der</strong><br />
Lehre Wiclifs vertraut wurden. Hus las in Prag alle Schriften Wiclifs und veröffentlichte<br />
diese. Er schrieb sie fast wortwörtlich ab.<br />
Die tschechischen Professoren und die tschechische Bevölkerung standen <strong>auf</strong> <strong>der</strong> Seite des<br />
Hus. Die Deutschen waren gegen Hus. Es kam zu harten Auseinan<strong>der</strong>setzungen. Schließlich<br />
mussten alle dt. Professoren und Studenten Prag verlassen. Sie zogen gemeinsam nach<br />
Leipzig und gründeten dort 1409 eine neue Universität. Die erste Phase <strong>der</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzungen<br />
mit Hus waren also fast rein nationaler Art.<br />
In dieser Zeit meldet Hus siegesfroh nach England:<br />
„Unser ganzes Volk will nichts hören als die heilige Schrift, vor allem das Evangelium<br />
und die Episteln. Wo in irgendeiner Gemeinde o<strong>der</strong> Stadt, in Haus o<strong>der</strong> Schloss ein Prediger<br />
<strong>der</strong> heiligen Wahrheit erscheint, dort strömen die Leute h<strong>auf</strong>enweise zusammen.“<br />
149<br />
Auch <strong>der</strong> böhmische Hof mit Wenzel, des Sohnes Karls IV. und seine Gemahlin Sophie<br />
sind dem Hus zugetan.<br />
2.2. Hus bekommt Gegenwind<br />
Einer allerdings bleibt hart: <strong>der</strong> Erzbischof <strong>von</strong> Prag Sbynko. Er verbietet Hus die Kanzel.<br />
Doch Hus hält sich nicht an das Verbot. Am 16. Juli 1410 läßt <strong>der</strong> Erzbischof 200 kostbar<br />
verzierte Schriften und Bücher Wiclifs verbrennen. Auf Hus wird <strong>der</strong> Bann gelegt. Das<br />
Prager Gericht verurteilt den Erzbischof, die Besitzer <strong>der</strong> wertvollen Bücher mit hohen<br />
Geldsummen zu entschädigen.<br />
Da greift Papst Johannes XX<strong>II</strong>I. entscheidend in den Streit ein. In Prag erscheinen päpstliche<br />
Gesandte, die allen hohen Ablaß in Aussicht stellen, die mit ihrem Gut o<strong>der</strong> Blut<br />
dem heiligen Vater zu Hilfe eilen. Nun wendet sich die Prager Universität gegen Hus<br />
(1412). Und <strong>der</strong> Papst verhängte den großen Bann über Hus und das Interdikt über jeden<br />
Ort, an dem Hus verweilen würde. Auf den Wunsch Wenzels verließ Hus Prag und begab<br />
sich in den Schutz böhmischer Adliger.<br />
148 Heussi § 68 g - l; Sierszyn, <strong>II</strong>, S. 247 ff.<br />
149 Sierszyn, <strong>II</strong>, 250.<br />
60
2.3. Hus <strong>auf</strong> dem Konzil zu Konstanz<br />
Wäre Hus nicht zum Konzil gegangen, hätte er den Schutz des böhmischen Volkes genossen.<br />
Vielleicht hätte es dann eine böhmische Reformation gegeben. Aber nun kam alles<br />
an<strong>der</strong>s.<br />
Inzwischen war Sigismund, Wenzels jüngerer Bru<strong>der</strong>, König <strong>von</strong> Deutschland geworden.<br />
Sigismund war Schirmherr des Konstanzer Konzils (1414 - 1418). Sigismund lädt Hus vor<br />
das Konzil und sichert ihm freies Geleit zu. Auch <strong>der</strong> Papst gewährt ihm Schutz. Er darf in<br />
Konstanz predigen. Doch ganz unverhofft wird Hus <strong>von</strong> päpstlichen Legaten verhaftet.<br />
König Sigismund droht, das Konzil zu verlassen, wenn Hus nicht freigegeben wird. Da<br />
erklären die Konzilsteilnehmer, das Konzil <strong>auf</strong>zulösen, wenn Hus nicht als Gefangener<br />
sich verantwortet. Der König gibt nach, denn Papst und Konzil sind ihm zu stark. Nicht<br />
einmal ein König konnte gegen das Bollwerk des Papalismus, des Episkopalismus und<br />
des Konziliarismus seine Meinung durchsetzen.<br />
Vor <strong>der</strong> Inquisition hält Hus zwar an <strong>der</strong> Wandlungslehre im Abendmahl sowie an <strong>der</strong><br />
Verehrung <strong>der</strong> Heiligen fest, doch seine antipäpstliche Haltung gibt er nicht <strong>auf</strong>. Die Inquisitoren<br />
könne Hus nicht durch die Bibel belehren, son<strong>der</strong>n nur durch ihre kirchlichen<br />
Dogmen. Hus schreibt in seinem letzten Brief:<br />
„Wenn ich etwas Schlimmes geschrieben habe, will ich darüber belehrt sein - wor<strong>auf</strong><br />
<strong>der</strong> oberste Kardinal erwi<strong>der</strong>te: >Wenn du belehrt sein willst, mußt du zuvor deine Lehren<br />
wi<strong>der</strong>rufen.Herr, in<br />
deine Hand befehle ich meinen GeistEs ist<br />
nicht <strong>von</strong>nötenWas soll ich wi<strong>der</strong>rufen? Ich<br />
habe mich keines Irrtums schuldig gemacht.
deshalb geschehen, damit die Vögel die Asche nicht als eine Reliquie nach Böhmen führten.“<br />
152<br />
Kurz vor seinem Tode soll Hus prophezeit haben:<br />
„Ihr bratet heute eine magere Gans; aber aus meiner Asche wird in hun<strong>der</strong>t Jahren ein<br />
Schwan emporsteigen, den werdet ihr nicht braten können.“ 153<br />
2.5. Die Hussiten<br />
Der Tod <strong>von</strong> Johannes Hus gab dem tschechischen Volk einen Märtyrer und Nationalheiligen.<br />
Der 6. Juli gilt fortan als Nationalfeiertag. Ganz Böhmen ist in Aufruhr. Als Wenzel<br />
1419 starb, ging die böhmische Krone an den dt. König Sigismund über. Nun hatte das<br />
böhmische Volk einen Gegner. Von 1419 bis 1436 wüteten in Böhmen die schauervollen<br />
Hussitenkriege.<br />
Dabei teilten sich die Hussiten in zwei Lager:<br />
1. Die Kalixtiner o<strong>der</strong> Utraquisten. 154 Sie verlangen beim Abendmahl nicht nur das Brot,<br />
son<strong>der</strong>n auch den Kelch (Calix), also beides (utraque): Brot und Wein. Das Volk, <strong>der</strong><br />
böhmische Hof und sogar <strong>der</strong> Prager Erzbischof schließen sich ihnen an. 1420 veröffentlichen<br />
die Kalixtiner die vier Prager Artikel:<br />
I. Artikel: Freie Predigt des göttlichen Wortes.<br />
<strong>II</strong>. Artikel: Laienkelch (auch die Gottesdienstbesucher erhalten beim Abendmahl den<br />
Kelch).<br />
<strong>II</strong>I. Artikel: Apostolische Armut des Klerus.<br />
IV. Artikel: Strenge Kirchenzucht unter dem Klerus.<br />
Auf dem Baseler Konzil (1431 - 1449) erscheint eine Delegation <strong>der</strong> Kalixtiner. In den<br />
sog. Prager Kompaktaten bewilligt man ihnen den Laienkelch: je<strong>der</strong> Böhme, <strong>der</strong> den Kelch<br />
begehrt, soll ihn hinfort empfangen. Dagegen verstehen es die Kirchenfürsten, die Wortverkündigung<br />
in <strong>der</strong> Landesprache und die Veräußerung <strong>der</strong> Kirchengüter zu verhin<strong>der</strong>n.<br />
In diesem Sinne kommt das tschechische Volk glimpflich da<strong>von</strong>. An<strong>der</strong>s steht es um die<br />
zweite Partei <strong>der</strong> Hussiten:<br />
(2) Die Taboriten.<br />
Sie sind viel radikaler. Sie lehnen die gesamte Kath. Kirche ab. In Böhmen machen sie sich<br />
eine Festung und nennen sie Tabor. Sie führen einen Kampf gegen alle Nichtgläubigen.<br />
Wenn sie den Kampf gewonnen haben, dann bricht das Millenium an. Schließlich vereinigen<br />
sich die königlichen Heere aus Deutschland zusammen mit den Kalixtinern und stürmen<br />
die taboritische Festung.<br />
1485 kommt es zum „böhmischen Frieden“ zwischen den gemäßigten Hussiten (Kalixtinern)<br />
und den böhmischen Katholiken. Die Kalixtiner behaupten den Laienkelch. Später<br />
schließen sich die Kalextiner <strong>der</strong> Reformation an.<br />
2. 6. Die Böhmischen Brü<strong>der</strong><br />
Während <strong>der</strong> langen Kämpfe erwachsen aus dem Hussitentum kleine Gemeinschaften,<br />
welche Krieg und Gewalt ablehnen. Peter <strong>von</strong> Cheltschitz schließt diese Versammlungen<br />
152 Traurige Berühmtheit erlangte <strong>der</strong> Ketzerprozess <strong>von</strong> Jeanne d `Arc <strong>von</strong> 1431: Sie befreite die Franzosen<br />
in Orléans <strong>von</strong> den Englän<strong>der</strong>n. Sie wird auch die Jungfrau <strong>von</strong> Orléans genannt. Doch <strong>der</strong> Herzog <strong>von</strong> Burgund<br />
- mit den Englän<strong>der</strong>n verbündet - nimmt Jeanne gefangen und liefert sie an die Englän<strong>der</strong> aus. Zunächst<br />
wurde sie zu lebenslangem Kerker verurteilt. Doch im „Rückfälligkeitsprozeß“ verurteilte man Jeanne zum<br />
Tod <strong>auf</strong> dem Scheiterh<strong>auf</strong>en am 30. Mai 1431.<br />
153 Der Name Hus bedeutet „Gans“; <strong>der</strong> Schwan deutet <strong>auf</strong> Martin Luther.<br />
154 Calix = <strong>der</strong> Kelch. Sie begehren das Abendmahl unter bei<strong>der</strong>lei Gestalt. Lat. utraque = beides.<br />
62
zu den „Böhmischen bzw. Mährischen Brü<strong>der</strong>n“ (o<strong>der</strong> auch Brü<strong>der</strong>unität) zusammen.<br />
Der neue böhmische König Podjebrad gibt ihnen das Dorf Kunwald. Ihr erster Bischof<br />
Matthias <strong>von</strong> Kunwald empfängt seine Weihe <strong>von</strong> einem Waldenser. Die Böhmischen<br />
Brü<strong>der</strong> verwerfen Kriegsdienst, Eid und staatliche Ämter. Sie haben einfache Formen des<br />
Gottesdienstes. Ihr Prinzip: Zurück zur Bibel und zur Urgemeinde. Sie setzten Älteste<br />
ein. Auch führten sie die Gläubigent<strong>auf</strong>e ein. Ihre Mitglie<strong>der</strong> erklärten förmlich die Trennung<br />
<strong>von</strong> <strong>der</strong> Kath. Kirche. 1725 werden die Böhmischen Brü<strong>der</strong> schwer verfolgt. Sie fliehen<br />
nach Sachsen und werden <strong>von</strong> Ludwig Graf <strong>von</strong> Zinzendorf <strong>auf</strong>genommen. Es entsteht<br />
die Herrnhuter Brü<strong>der</strong>gemeine (Herrnhuter Losungen). 155<br />
155 Sierszyn, <strong>II</strong>, 256; Heussi, § 71 v - w; E. H. Broadbent, Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt, 1984, S. 123 ff.<br />
63
Literaturverzeichnis mit Abkürzungen<br />
1. Adam, Alfred: Lehrbuch <strong>der</strong> Dogmengeschichte, Bd. 2, Mittelalter und Reformation,<br />
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh, 1981 4 (Alfred Adam stellt die Theologie<br />
und die Dogmatik <strong>der</strong> Reformatoren dar). (Abk.: Adam, Lehrbuch <strong>der</strong> Dogmengeschichte).<br />
2. Aland, Kurt: Geschichte <strong>der</strong> Christenheit, Bd. I, Von den Anfängen bis an die Schwelle<br />
<strong>der</strong> Reformation, Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, Gütersloh, 1980. (Abk.:<br />
Aland, Geschichte d. Christenheit o<strong>der</strong> einfach Aland).<br />
3. Brandt, Theodor: Kirche im Wandel <strong>der</strong> Zeit, Teil I, Von Paulus bis Luther, Brockhaus,<br />
Wuppertal, 1977 (heute neu <strong>auf</strong>gelegt unter dem Titel „Basiswissen <strong>Kirchengeschichte</strong>“).<br />
(Abk.: Brandt, Kirche im Wandel <strong>der</strong> Zeit o<strong>der</strong> einfach Brandt).<br />
4. Broadbent, E. H.: Gemeinde Jesu in Knechtsgestalt; Hänssler, Neuhausen, 1984 2 .<br />
5. Brockhaus Enzyklopädie in 24 Bde., F.A. Brockhaus, Mannheim, 1986 ff.<br />
6. Cuthbert, P. und Widlöcher, P. Justinian: Der Heilige Franz <strong>von</strong> Assisi, Verlag<br />
Otto Schloz, Stuttgart, 1931<br />
7. Dowley, Tim: Altals – Bibel und Geschichte des Christentums, Brockhaus, Wuppertal,<br />
1997. (Tim Dowley, Atlas).<br />
8. dtv-Atlas zur Weltgeschichte, Bd. 1, München, 1985 20<br />
9. Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde, hrsg. v. H. Burkhardt u. U.<br />
Swarat u.a., 3 Bde., R. Brockhaus Verlag, Wuppertal, 1998 2 (Abk.: Ev. Lex. Theol. u.<br />
Gmde.).<br />
10. Hauschild, Wolf-Dieter: Lehrbuch <strong>der</strong> Kirchen- und Dogmengeschichte, Bd. 1,<br />
Alte Kirche und Mittelalter, Chr. Kaiser: Gütersloher Verlagshaus, 2000 2 (Hauschild,<br />
Lehrbuch d. Kirchen- u. Dogmengeschichte).<br />
11. Heine, Wolfgang: Bekannte Lie<strong>der</strong> – wie sie entstanden, hänssler, Stuttgart, 1989.<br />
(Heine, Lie<strong>der</strong>).<br />
12. Heussi, Karl: Kompendium <strong>der</strong> <strong>Kirchengeschichte</strong> 16 , J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen,<br />
1981 (Abk.: Heussi).<br />
13. Hinneberg, Paul: Allgemeinde Geschichte <strong>der</strong> Philosophie, Verlag <strong>von</strong> B. G. Teubner,<br />
Leipzig, Berlin, 1913. (P. Hinneberg, Geschichte d. Philosophie).<br />
14. Hug, Wolfgang und Rumpf, Erhard: Menschen in ihrer Zeit, Im Mittelalter, Bd. 3,<br />
Ernst Klett Verlag, Stuttgart, 1970.<br />
15. Junker, Fritz: Die Waldenser, ein Volk unter Gottes Wort, EVZ Verlag, Zürich,<br />
1969.<br />
16. Kempen, Thomas <strong>von</strong>: Vier Bücher über die Nachfolge Christi nach <strong>der</strong> Übersetzung<br />
<strong>von</strong> Johann Arndt, Ernst Röttgers Verlag, Kassel, 1906.<br />
17. Kraft, Heinrich: Kirchenväter Lexikon, Kösel-Verlag, München, 1966 (Kraft, Kirchenväter<br />
Lex.).<br />
18. Mayer, Hans Eberhard: Geschichte <strong>der</strong> Kreuzzüge, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart,<br />
1965 (Mayer: Kreuzzüge).<br />
19. Padberg, Lutz v.: Wynfreth-Bonifatius, Brockhaus, Wuppertal, 1989 (L. v. Padberg:<br />
Bonifatius)<br />
20. Putzger, F. W.: Historischer Weltatlas, Cornelsen-Velhagen & Klasing, Berlin, 1978<br />
(Abk.: Putzger, Hist. Weltatlas).<br />
21. Rahner, Karl und Vorgrimler, Herbert, Kleines Konzilkompendium, Sämtliche<br />
Texte des Zweiten Vatikaniuums, Her<strong>der</strong>, Freiburg i. B., 1991 23 .<br />
64
22. Reden in dt. Sprache: Deutsches Mittelalter, ausgewählt, v. F. <strong>von</strong> <strong>der</strong> Leyen, Insel<br />
Verlag, Frankfurt am Main, 1980.<br />
23. Religion in Geschichte und Gegenwart (Abk.: RGG 3 ), hrsg. v. Kurt Galling, Ungekürzte<br />
Studienausgabe in 7 Bde., 1986, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen.<br />
24. Smid, Menno: Ostfriesische <strong>Kirchengeschichte</strong>, Reihe: Ostfriesland im Schutze des<br />
Deiches, Bd. VI, hrsg. v. d. nie<strong>der</strong>sächsischen Deichacht u. d. Deichacht Krummhörn,<br />
Selbstverlag, Pewsum,1974 (Smid, Ostfr. KG).<br />
25. Schmidt, Kurt Dietrich: <strong>Kirchengeschichte</strong>, V & R, Göttingen, 1984 8 (Abk.:<br />
Schmidt, <strong>Kirchengeschichte</strong> o<strong>der</strong> einfach Schmidt).<br />
26. Schnepel, Erich: Jesus im Frühen Mittelalter, Verlag <strong>der</strong> Liebenzeller Mission, Bad<br />
Liebenzell, 1963 4 , 2.Taschenbuch<strong>auf</strong>lage (Schnepel, Jesus im MA).<br />
27. Sierszyn, Armin: 2000 Jahre <strong>Kirchengeschichte</strong>, Bd. 2, Das Mittelalter, hänssler Theologie,<br />
hänssler Verlag, Neuhausen, 1997 (Abk.: Sierszyn).<br />
28. Stemberger, Günther, Hrsg.: 2000 Jahre Christentum, Manfred Pawlak Verlagsgesellschaft,<br />
Herrsching, 1983 (Abk.: Stemberger, 2000 Jahre Christentum).<br />
29. Steubing, Hans: Hrsg., Bekenntnisse <strong>der</strong> Kirche, Brockhaus Verlag, Wuppertal, 1985<br />
(Steubing, Bekenntnisse <strong>der</strong> Kirche).<br />
30. Stückelberger, Alfred Emanuel: Menschliches Wissen – Gottes Weisheit, Geschichte<br />
<strong>der</strong> Philosophie <strong>von</strong> ihren Anfängen bis zur Gegenwart, Verlag <strong>der</strong> Schriftenmission<br />
<strong>der</strong> Ev. Gesellschaft für Dt., Wuppertal, 1980.<br />
65




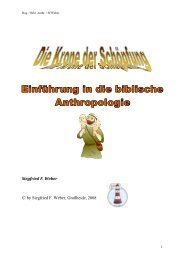
![Hermeneutik der Gewissheit.Teil_2.Juli.2[...]](https://img.yumpu.com/5351397/1/184x260/hermeneutik-der-gewissheitteil-2juli2.jpg?quality=85)
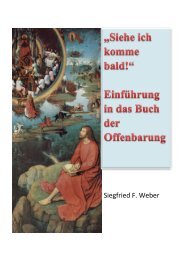
![Der Billardjunge aus Varel.Wie der Bapti[...]](https://img.yumpu.com/4629819/1/184x260/der-billardjunge-aus-varelwie-der-bapti.jpg?quality=85)


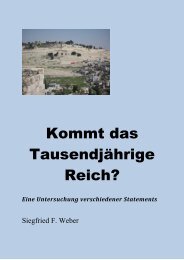
![Kaiser Augustus und die Ankunft des Rett[...]](https://img.yumpu.com/4557540/1/184x260/kaiser-augustus-und-die-ankunft-des-rett.jpg?quality=85)
