Hermeneutik der Gewissheit.Teil_2.Juli.2[...]
Hermeneutik der Gewissheit.Teil_2.Juli.2[...]
Hermeneutik der Gewissheit.Teil_2.Juli.2[...]
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong><br />
<strong>Teil</strong> 2 – Kurzer Gang durch die<br />
Auslegungsgeschichte<br />
Siegfried F. Weber
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
<strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong><br />
<strong>Teil</strong> 2 – Kurzer Gang durch die<br />
Auslegungsgeschichte sowie die Untersuchung<br />
<strong>der</strong> Auslegungsmethoden in ihrer Stellung zur<br />
Bibel als das Wort Gottes<br />
Siegfried F. Weber<br />
Abb. auf dem Cover: Die Delfter Bibel in zwei Folienbänden. Sie wurde in den Nie<strong>der</strong>landen (Delft) 1477<br />
gedruckt. Sie enthält das Alte Testament ohne Psalmen. Foto privat, Bibelausstellung.<br />
© by Siegfried F. Weber, Selbstverlag, Großheide, 2010.<br />
(Meine Manuskripte dürfen für private, schulische, sowie gemeindliche Zwecke kopiert und<br />
kostenlos weitergereicht werden, nicht jedoch für gewerbliche Zwecke).<br />
2
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
I. Ein kurzer Gang durch die Auslegungsgeschichte _______________________________ 5<br />
1.Allegorische Schulen ________________________________________________ 5<br />
1.1. Griechischer Allegorismus ________________________________________ 5<br />
1.2. Jüdischer Allegorismus ___________________________________________ 6<br />
1.3. Patristischer Allegorismus _________________________________________ 6<br />
1.4. Die <strong>Hermeneutik</strong> des Mittelalters ___________________________________ 9<br />
2. Buchstäbliche Schulen _____________________________________________ 10<br />
2.1. Jüdischer Literalismus ___________________________________________ 10<br />
2. 2. Die syrische Schule in Antiochien _________________________________ 12<br />
2. 3. Die Reformatoren ______________________________________________ 12<br />
3. Erbauliche Schulen ________________________________________________ 17<br />
3.1. Spener – Auslegung und Anwendung _______________________________ 17<br />
3.2. Francke – Bibellektüre in den Grundsprachen ________________________ 17<br />
3.3. Bengel – Vergleich <strong>der</strong> Handschriften ______________________________ 18<br />
3.4. Hamann - Wi<strong>der</strong> die Vernunft _____________________________________ 19<br />
3.5. Beck – pneumatische Exegese _____________________________________ 20<br />
4. Die <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> Dialektiker Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts ___________ 21<br />
5. Katholische <strong>Hermeneutik</strong> __________________________________________ 25<br />
6. Zusammenfassung herkömmlicher hermeneutischer Ansätze ____________ 27<br />
II. Jüdisch-rabbinische Schriftauslegung _______________________________________ 28<br />
III. Synchrone und diachrone Lektüre __________________________________________ 33<br />
IV. Kritische Ansätze in <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> _______________________________________ 35<br />
1. Die historisch-kritische Methode (HKM) ______________________________ 35<br />
2. Entmythologisierung - Rudolf Bultmann ______________________________ 53<br />
3. Kontextuale <strong>Hermeneutik</strong> __________________________________________ 57<br />
4. Ökumenische <strong>Hermeneutik</strong> _________________________________________ 58<br />
5. Feministische <strong>Hermeneutik</strong> _________________________________________ 63<br />
6. Tiefenpsychologische <strong>Hermeneutik</strong> __________________________________ 66<br />
7. Der philosophische Ansatz von Hans-Georg Gadamer __________________ 68<br />
7.1. Die persönliche Wirkungsgeschichte _______________________________ 70<br />
V. Neuere Ansätze in <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> _________________________________________ 71<br />
1. Bibliodrama ______________________________________________________ 71<br />
2. Rezeptionsästhetische Analyse ______________________________________ 72<br />
3. Narrative Analyse (Narratologie) ____________________________________ 74<br />
Zusammenfassung von neueren hermeneutischen Ansätzen ________________ 76<br />
VI. Fachliches Abkürzungsverzeichnis von Nachschlagewerken _____________________ 77<br />
VII. L i t e r a t u r mit Anmerkungen __________________________________________ 79<br />
1. Literatur für praktische Anleitung einer bibeltreuen exegetischen Arbeit __ 79<br />
2. Literatur zur Anleitung <strong>der</strong> historisch-kritischen Methode ______________ 79<br />
3
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
3. Stellungnahmen zur historisch-kritischen Methode (HKM) ______________ 80<br />
4. Zur Geschichte <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> ____________________________________ 81<br />
5. <strong>Hermeneutik</strong> im Lichte <strong>der</strong> Heilsgeschichte ___________________________ 81<br />
6. Allgemeine Literatur <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> _______________________________ 82<br />
4
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Vorwort<br />
Nach dem ersten <strong>Teil</strong> meiner <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong>, in dem es zunächst um die<br />
praktischen Regeln einer Offenbarungshermeneutik ging, folgt nun im zweiten <strong>Teil</strong> ein<br />
kurzer Überblick über die Geschichte <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong>.<br />
I. Ein kurzer Gang durch die Auslegungsgeschichte<br />
„Eine Kenntnis <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong> Bibelinterpretation ist für das Studium <strong>der</strong> Heiligen<br />
Schrift von unschätzbarem Wert. Sie dient als Schutz gegen Irrtümer und zeigt die<br />
Aktivität und die Bemühungen des menschlichen Geistes bei seiner Suche nach Wahrheit<br />
und im Zusammenhang mit den wichtigsten Themen überhaupt. Sie zeigt, welche<br />
Einflüsse zum Missverstehen des Wortes Gottes geführt haben und wie sich<br />
scharfsinnige Denker durch ein Missverständnis des Wesens <strong>der</strong> Bibel irreführen ließen<br />
und in ihrem Inhalt mystische und vielfältige Bedeutungen gesucht haben.“ 1<br />
Ich werde zunächst kurz die hermeneutischen Ansätze <strong>der</strong> frühen Kirchengeschichte<br />
zusammenfassen, dann die des Mittelalters, <strong>der</strong> Reformation, des Pietismus und<br />
schließlich <strong>der</strong> Mo<strong>der</strong>ne.<br />
1.Allegorische Schulen<br />
1.1. Griechischer Allegorismus<br />
Die allegorische Interpretation glaubt, dass unter dem Buschstaben die eigentliche<br />
Bedeutung des Abschnitts liegt. Eine Allegorie wird von wenigen als erweiterte Metapher<br />
definiert. Es gibt eine literarische Allegorie, mit <strong>der</strong> eine Botschaft in historischer Form<br />
weitergegeben wird. Bunyans Pilgerreise ist so eine Allegorie, und es gibt sie auch in <strong>der</strong><br />
Bibel. Wenn die Bibel von Allegorese spricht, deutet sie dies an wie in Gal. 4,22-31. In<br />
Gal. 4,24 heißt es: „Die Worte allegorisieren etwas.“ Dort deutet <strong>der</strong> Apostel Paulus<br />
geleitet und inspiriert durch den Geist Gottes die Magd Hagar auf Knechtschaft und auf<br />
das irdische Jerusalem und Sara auf die Freiheit und auf das himmlische Jerusalem.<br />
Vergleiche ferner das Bild vom Weinstock in Jh. 15,1-11, wo zwar das Wort<br />
„Allegorese“ nicht vorkommt, wohl aber die Sache.<br />
In <strong>der</strong> antiken-klassischen, in <strong>der</strong> byzantinischen Zeit und auch noch im Mittelalter (bis<br />
zur Reformation) war die Allegorese die Methode <strong>der</strong> Schriftauslegung. Doch das<br />
Problem des Allegorismus besteht darin, zu schnell in den Text etwas hineinzulegen,<br />
etwas deuten zu wollen, was nun wirklich gar nicht dasteht. Manchmal sind es die<br />
Wünsche des Auslegers, die in den Text hineingelegt werden. Wenn es keine eindeutigen<br />
Hinweise für Allegorese im biblischen Text gibt, we<strong>der</strong> direkte (wie in Gal. 4,22-31)<br />
1 M. S. Terry: Biblical Hermeneutics, in: Bernhard Ramm: Biblische <strong>Hermeneutik</strong>, hrsg. V. International<br />
Correspondence Institute (ICI), Deutsches Büro, Asslar, 1991 (Amerikanische Originalausgabe: Ramm:<br />
Protestant Biblical Interpretation, Baker Book House, Grand Rapids / Michigan / USA, 3 1970.<br />
5
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
noch indirekte (wie in Jh. 15,1-11) und wenn es auch keine Hinweise in den<br />
Parallelstellen und Paralleltexten gibt, dann sollte man den Boden <strong>der</strong> buchstäblichen<br />
Auslegung nicht verlassen.<br />
1.2. Jüdischer Allegorismus<br />
Die allegorische Methode <strong>der</strong> Textinterpretation kam von Homer zu den Juden. Der<br />
herausragende jüdische Allegorist war Philo von Alexandria (1.Jh. n. Chr.). 2 Eine<br />
Bibelstelle durfte nach Philo allegorisch ausgelegt werden, wenn<br />
(1) eine Aussage etwas Unwürdiges über Gott aussagt<br />
(2) eine Aussage einer an<strong>der</strong>en wi<strong>der</strong>spricht o<strong>der</strong> schwierig erscheint<br />
(3) <strong>der</strong> Bericht selbst vom Wesen her allegorisch ist.<br />
Ferner weisen nach Philo grammatische und stilistische Beson<strong>der</strong>heiten, Zahlen, Zeichen<br />
und Symbole sowie die Bedeutung von Namen auf Allegorese hin. Zudem gibt es das<br />
Gesetz <strong>der</strong> doppelten Anwendung:<br />
Natürliche Objekte stehen für geistliche Dinge (Himmel bedeutet Verstand, Erde<br />
bedeutet Gefühl, so Philo).<br />
1.3. Patristischer Allegorismus<br />
Die Kirchenväter machten das Alte Testament zu einer christlichen Schrift, denn das<br />
Evangelium steht an erster Stelle. Damit aber verloren die Aussagen des Alten<br />
Testaments über Israel ihre wörtliche Bedeutung. Alle Aussagen über Israel wurden<br />
allegorisch gedeutet und auf die Gemeinde Christi projiziert.<br />
Die Schwierigkeiten einer bevorzugten allegorischen Auslegung des Alten Testaments<br />
ergeben sich von selbst:<br />
(1) Die historische Bedeutung wurde bei <strong>der</strong> Exegese nicht berücksichtigt. Die<br />
historische Methode taucht erst bei Erasmus von Rotterdam und dann bei Luther<br />
wie<strong>der</strong> auf.<br />
(2) Das Alte Testament schien den Kirchenvätern zu dunkel, weil sie die<br />
fortschreitende Offenbarung nicht berücksichtigten. Die Opfergesetze haben<br />
deshalb keine Gültigkeit mehr, weil in Jesus sich das Gesetz erfüllt hat. Damit<br />
aber hätten sich nun alle eschatologischen Verheißungen in den Schriftpropheten,<br />
die sich dort primär auf Israel beziehen, ihre Erfüllung schon in Jesus gefunden,<br />
so dass Israel keine nationale Zukunft mehr hat.<br />
(3) Da die Bibel voll von Bil<strong>der</strong>n, Metaphern, Symbolen und Rätseln ist, könnte man<br />
sie nur mit <strong>der</strong> allegorischen Methode entschlüsseln (die Bibel wird zu einem<br />
Code-Buch).<br />
2 Vgl. P. Stuhlmacher: Vom Verstehen des Neuen Testaments, 2 1986, 72-74.<br />
6
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
(4) Die Kirchenväter verwechseln die Allegorese mit <strong>der</strong> Typologie. Eine Typologie<br />
enthält wohl einen Hinweis auf Christus o<strong>der</strong> auf das Gemeindezeitalter, aber <strong>der</strong><br />
alttestamentliche Text verliert dabei nicht seine wörtliche Bedeutung!<br />
(5) Die Kirchenväter meinten die griechische Philosophie in <strong>der</strong> Bibel zu entdecken,<br />
so zum Beispiel den Logosbegriff im Johannesevangelium. Der Logos, das Wort,<br />
war schon immer da, auch schon in <strong>der</strong> Weisheit <strong>der</strong> Philosophen des Altertums.<br />
(6) Die allegorische Methode hatte folgenschwere Konsequenzen für die Dogmatik<br />
(z. B. für die Heilsgeschichte und für die Eschatologie)<br />
„Die Bibel wird, wenn sie allegorisch behandelt wird, zu Wachs in den Händen des<br />
Exegeten“, konstatiert Bernhard Ramm. 3<br />
Die <strong>Hermeneutik</strong> von Clemens von Alexandria (um 200 n. Chr.):<br />
(1) Die Hl. Schrift hat einen historischen Sinn. Es gibt tatsächlich geschichtliche<br />
Ereignisse im Alten Testament.<br />
(2) Die Hl. Schrift hat einen dogmatischen Sinn. Sie trägt zur Lehre für die Gemeinde<br />
bei.<br />
(3) Sie hat natürlich auch einen prophetischen Sinn.<br />
(4) Sie hat einen philologischen Sinn (grammatisch-syntaktische Analyse des<br />
Textes).<br />
(5) Sie hat aber auch einen mystischen (verborgenen) Sinn, d. h. sie muss allegorisch,<br />
geistlich gedeutet werden.<br />
Origenes (185-254 n. Chr.) wurde von Philo beeinflusst. So wie <strong>der</strong> Mensch aus Leib,<br />
Seele und Geist besteht, so hat auch die <strong>Hermeneutik</strong> drei Wesenszüge:<br />
(1) Die Hl. Schrift hat einen buchstäblichen Sinn (<strong>der</strong> Leib).<br />
(2) Sie hat einen moralischen Sinn (die Seele)<br />
(3) Sie hat einen pneumatischen Sinn (<strong>der</strong> Geist).<br />
Origenes wollte dem Judaismus entkommen, indem er das Alte Testament vergeistlicht.<br />
Die wahre Exegese <strong>der</strong> Bibel sei die geistliche. Das Alte Testament ist Vorbereitung für<br />
das Neue Testament. Das Neue Testament sei schon im Alten Testament enthalten. Das<br />
Alte Testament ist in Christus erfüllt und damit überholt.<br />
Ein Beispiel aus Jh. 2,13 verdeutlicht die drei Stufen <strong>der</strong> Schriftauslegung bei Origenes 4 :<br />
(1) Zunächst wird die Aussage „und kurz vor dem Passah <strong>der</strong> Juden zog Jesus hinauf<br />
nach Jerusalem“ wörtlich verstanden: Gemeint ist das jährliche Passahfest, so<br />
wie es die Juden seit dem Exodus feiern.<br />
(2) Danach deutet Origenes das Passah nach dem moralischen Sinn und bezieht es<br />
auf Christus. Christus ist unser Passahlamm (1.Kor. 5,7).<br />
3 Ramm: Biblische <strong>Hermeneutik</strong>, a.a.O., 45.<br />
4 P. Stuhlmacher: Vom Verstehen, 2 1986, 79-82.<br />
7
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
(3) Und schließlich legt er die Stelle von Jh. 2,13 pneumatisch-geistlich aus: das<br />
Passahmahl wird einst im Himmel gefeiert, und zwar mit allen Gläubigen<br />
zusammen, denn so erklärt er nach Hebr. 10,1: alle Gegenstände und Ereignisse<br />
aus dem Alten Testament seien ein Schatten des Zukünftigen.<br />
Tertullian (um 200 n. Chr.)<br />
Für Tertullian ist die altkirchliche Glaubensregel 5 Maßstab und Rahmen aller<br />
Schriftauslegung.<br />
„Bleibt die Glaubensregel in Geltung, so kannst du getrost fragen und untersuchen, so<br />
viel du Lust hast“, konstatiert er in seiner Schrift gegen die Häretiker. Allerdings bekräftigt<br />
er den Vorzug des Glaubens. Der Glaube hat den absoluten Vorrang vor <strong>der</strong><br />
Schriftgelehrsamkeit. Tertullian stellt fest: „Dein Glaube hat dir geholfen (Lk. 18,42), heißt<br />
es, nicht (deine) Schriftgelehrsamkeit! Der Glaube (aber) ist in <strong>der</strong> Glaubensregel<br />
nie<strong>der</strong>gelegt. (Da) hat er sein Gesetz, und aus <strong>der</strong> Beobachtung des Gesetzes (kommt)<br />
das Heil. Die Schriftgelehrsamkeit dagegen stammt aus <strong>der</strong> Neugierde und hat ihren<br />
Ruhm vom Streben nach Erkenntnis. Platz dem Glauben vor <strong>der</strong> Neugier! Platz dem Heil<br />
vor dem Ruhm! Wenn (Neugier und Ruhm) schon nicht Ruhe halten (können), so sollen<br />
sie jedenfalls nicht stören! Nichts zu wissen gegen die Glaubensregel heißt alles<br />
wissen!“ 6<br />
Richtig ist anzumerken, dass Tertullian den Glauben <strong>der</strong> Schriftgelehrsamkeit vorzieht.<br />
Das sollte je<strong>der</strong> Exeget beherzigen. Je<strong>der</strong> geisterfüllte Gläubige kann die Schrift<br />
auslegen. Dazu braucht er keinen Wissenschaftler heranzuziehen. Jedoch hat sich <strong>der</strong><br />
Glaube allein an die Hl. Schrift zu orientieren und nicht primär an irgendeine<br />
Glaubensregel <strong>der</strong> Kirche.<br />
Hieronymus (340-397 n. Chr.)<br />
Hieronymus setzte sich für die historische und buchstäbliche Exegese ein. In <strong>der</strong> Praxis<br />
aber war er ein Allegorist.<br />
Aurelius Augustinus (354 – 430) aus Thagaste (Nordafrika)<br />
Die Regeln für die Schriftauslegung hat Augustin verfasst in seinem Werk „De doktrina<br />
christiana“ (= über die christliche Lehre). Diese Schrift wurde zu einer vorbildlichen<br />
und gerne gebrauchten <strong>Hermeneutik</strong> in <strong>der</strong> Kirchengeschichte. Wir fassen die<br />
hermeneutischen Regeln kurz zusammen. 7 Vor allem soll die Liebe Christi den Ausleger<br />
treiben, denn das Wissen bläht auf, die Liebe aber erbaut, meint Augustin (1.Kor. 8,7).<br />
5 Die Glaubensregel, die regula fidei, wurde von Tertullian selber verfasst und stellte zu seiner Zeit das<br />
trinitarische Bekenntnis <strong>der</strong> Kirche dar. Text bei: Hans Steubing: Bekenntnisse <strong>der</strong> Kirche, Wuppertal,<br />
1985, 14.<br />
6 Tertullian: Praescr. Haer. 14, in: Stuhlmacher, a.a.O., 84.<br />
7 Ramm: <strong>Hermeneutik</strong>, a.a.O., 48-52. Stuhlmacher: Vom Verstehen, a.a.O., 87-90.<br />
8
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
(1) Exegese setzt den Glauben voraus.<br />
(2) Die Hl. Schrift hat eine historische Bedeutung.<br />
(3) Die Bibel hat mehr als eine Bedeutung und deshalb ist die allegorische Methode<br />
zulässig.<br />
(4) Die Zahlen sind bedeutsam.<br />
(5) Das Alte Testament ist eine christliche Schrift.<br />
(6) Der Exeget hat die Schrift auszulegen. Er darf nichts in sie hineinlegen.<br />
(7) Sowohl die Liebe zu Gott und zu den Menschen als auch die Analogie des<br />
Glaubens sind die Prinzipien <strong>der</strong> Exegese.<br />
(8) Kein Vers darf als alleinstehende Einheit betrachtet werden (Kontext).<br />
(9) Eine unklare Bibelstelle darf nicht die Basis einer Lehre sein.<br />
(10) Der Ausleger muss Hebräisch und Griechisch beherrschen.<br />
(11) Der unklare Abschnitt muss dem klaren weichen.<br />
(12) Keine Schriftstelle darf so ausgelegt werden, dass sie in Konflikt mit einer<br />
an<strong>der</strong>en gerät.<br />
(13) Die fortschreitende Offenbarung muss berücksichtigt werden.<br />
1.4. Die <strong>Hermeneutik</strong> des Mittelalters<br />
Zum Verständnis <strong>der</strong> Bibel gehören vier Auslegungsmethoden, die das ganze Mittelalter<br />
durchziehen. Man spricht auch vom vierfachen<br />
Schriftsinn (<strong>der</strong> sogenannten „Quadriga sensuum“) in<br />
<strong>der</strong> Scholastik (Schultheologie des Mittelalters).<br />
(1) Der buchstäblich-historische Sinn des Textes<br />
(2) Der allegorische (bildhafte) Sinn des Textes<br />
(3) Der tropologische (moralisch-geistliche) Sinn<br />
(4) Der anagogische (eschatologische) Sinn<br />
<strong>Hermeneutik</strong> des Mittelalters -<br />
Der vierfache Schriftsinn:<br />
� buchstäblich<br />
� allegorisch<br />
� tropologisch<br />
� anagogisch<br />
Das griechische Wort „tropos“ bedeutet im klassischen<br />
Griechisch zunächst „Wendung“, dann übertragen „Denkweise, Handlungsweise, Sitte,<br />
Brauch, Gesinnung. Die tropologische Auslegung betrifft also die Ethik, die Moral, den<br />
sittlichen Lebenswandel.<br />
Das griechische Wort „angoge“ bedeutet „hinaufführen“. Anagogische Auslegung führt<br />
vom Wortsinn zu höherer Wortbedeutung, wodurch Geheimnisse entschlüsselt werden<br />
sollen. Der Gegenstand dieser Auslegungsmethode ist hauptsächlich das Reich Gottes<br />
(hier und jetzt, in Christus, in <strong>der</strong> Zukunft und in <strong>der</strong> Ewigkeit).<br />
9
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Der vierfache Schriftsinn konnte aber auch in falscher Weise angewendet werden im<br />
apologetischen Sinne <strong>der</strong> allgemein-anerkannten (katholischen) Kirche. Das soll das<br />
Beispiel vom „Verlorenen Sohn“ (Lk. 15) zeigen:<br />
(1) Der buchstäbliche Sinn: Die Geschichte vom „Verlorenen Sohn“ stellt im<br />
historischen Sinn die Krise einer reichen Familie in Israel dar.<br />
(2) Der allegorische Sinn: Der „Verlorene Sohn“ stellt bildlich die Ketzer und<br />
Häretiker <strong>der</strong> anerkannten Kirche dar.<br />
(3) Der tropologische Sinn: Halte dein Geld zusammen! Gib dich nicht <strong>der</strong> Unmoral<br />
hin! Vertrau dich nicht Fremden an!<br />
(4) Der anagogische Sinn: Wenn die Abgefallenen zur allgemein-anerkannten Kirche<br />
zurückgekehrt sind, bricht das Gottesreich auf Erden an.<br />
2. Buchstäbliche Schulen<br />
2.1. Jüdischer Literalismus<br />
Ein wichtiges Element <strong>der</strong> Auslegung ist die Buchstäblichkeit, bzw. <strong>der</strong> wörtliche Sinn,<br />
auch Literalsinn genannt (lat. „sensus literalis“ bei den Reformatoren). Beim<br />
Literalsinn geht es darum, die Aussagen <strong>der</strong> Bibel wörtlich zu verstehen, in ihrer<br />
eigentlichen Aussage, also das wie<strong>der</strong>zugeben, was bereits dasteht. Das bedeutet, dass<br />
wir die historischen Aussagen auch als historische Fakten verstehen und entsprechend<br />
interpretieren. Wenn Israel also 40 Jahre durch die Wüste Sinai gezogen ist, dann haben<br />
wir das wörtlich zu verstehen. Erst wenn die Bibel von selbst bildliche Rede,<br />
Gleichnisse, Metaphern, Symbole verwendet, sollen wir diese auch entsprechend<br />
behandeln und bildlich auslegen. Solange sie das aber nicht tut, ist die buchstäbliche<br />
Auslegung <strong>der</strong> allegorischen, typologischen und bildlichen vorzuziehen.<br />
Der erste jüdische Exeget war Esra. Für seine Auslegung verwendete er die aramäische<br />
Sprache. In Esra 7,6 wird er als Schriftgelehrter bezeichnet, <strong>der</strong> sich sehr viel mit <strong>der</strong><br />
Thora beschäftigt hatte und sich somit ausgezeichnet auskannte, eine wichtige<br />
Voraussetzung für einen guten Exegeten. Das Wissen aber reicht allein nicht aus, denn<br />
das Leben muss mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Von Esra heißt es, dass er sein<br />
ganzes Herz auf das Gesetz des HERRN richtete. Er hat das Wort Gottes lieb gewonnen,<br />
beherzigt es, lebt es aus und erst dann lehrt er das Volk (Esra 7,10). Das ist die biblischgöttliche<br />
Reihenfolge in <strong>der</strong> Schriftauslegung, eine an<strong>der</strong>e wäre eine rein menschliche.<br />
10
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Bibel studieren<br />
und erforschen<br />
wie Esra<br />
Das Wort Gottes<br />
lieben,<br />
beherzigen und es<br />
leben wie Esra<br />
Erst viel später haben die Rabbinen Hillel, Ischmael und Elieser seit dem ersten<br />
Jahrhun<strong>der</strong>t n. Chr. hermeneutische Regeln aufgestellt:<br />
(1) Die Schriftaussage muss in ihrem Kontext richtig verstanden werden.<br />
(2) Die Schriftstellen müssen miteinan<strong>der</strong> verglichen werden.<br />
(3) Eine klare, eindeutige Stelle hat den Vorrang gegenüber einer unklaren.<br />
(4) Die Grammatik muss berücksichtigt werden.<br />
(5) Die Schrift ist wörtlich-historisch zu verstehen.<br />
Das Wort Gottes<br />
lehren wie Esra<br />
(6) Die Auslegung muss den Zuhörer im Blickfeld haben, seine jetzige kulturelle<br />
Situation.<br />
Die Schwäche <strong>der</strong> rabbinischen <strong>Hermeneutik</strong> ist <strong>der</strong> „Hyperliteralismus“ (peschat) und<br />
die Buchstabengläubigkeit. Es entstanden Berge aus Nebensächlichkeiten. Je<strong>der</strong><br />
Buchstabe eines Wortes wurde so interpretiert, dass er für ein an<strong>der</strong>es Wort stehen<br />
konnte („notarikon“). Die Wörter wurden mit Zahlenwerten versehen („gemetria“). Die<br />
Buchstaben eines Wortes konnten vertauscht werden und man las eine neue Bedeutung<br />
heraus („termura“). 8 Der buchstäbliche Ansatz in <strong>der</strong> rabbinischen <strong>Hermeneutik</strong> ist schon<br />
richtig, er wurde nur weit übertrieben. Die buchstäbliche Exegese darf nicht den Sinn <strong>der</strong><br />
biblischen Aussagen verdrehen. Das Ziel <strong>der</strong> buchstäblichen Exegese ist es, den<br />
wörtlichen Sinn <strong>der</strong> Aussage wie<strong>der</strong>zugeben, so wie es <strong>der</strong> biblische Verfasser gemeint<br />
hat.<br />
8 Ramm, a.a.O., 60-62. Vgl. dazu im Manuskript Abschnitt V. „Jüdisch-rabbinische Schriftauslegung“.<br />
Ferner: Günther Stemberger: Vollkommener Text in vollkommener Sprache. Zum rabbinischen<br />
Schriftverständnis, in: JBTh 12 (1997), 53-66, sowie Josef Wohlmuth: Jüdische <strong>Hermeneutik</strong>, in: JBTh 12<br />
(1997), 193-220.<br />
11
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
2. 2. Die syrische Schule in Antiochien<br />
Die syrische Schule bekämpfte Origenes als Erfin<strong>der</strong> <strong>der</strong> allegorischen Methode. Sie<br />
vertrat die buchstäbliche und die historische Exegese. „Das Auge des Herrn ruht auf mir“<br />
wäre nach den Antiochenern ein bildlich-buchstäblicher Satz.<br />
Die buchstäbliche Exegese lässt den Bibeltext so stehen wie er ist. Um nicht die<br />
buchstäbliche Exegese mit <strong>der</strong> Buchstabengläubigkeit <strong>der</strong> Rabbinen zu verwechseln,<br />
sollte man vielleicht besser vom „Literalsinn“ o<strong>der</strong> vom „wörtlichen Sinn“ sprechen.<br />
Der buchstäbliche und historische Ansatz garantiert <strong>der</strong> alttestamentlichen Geschichte<br />
ihre notwendige Realität. Die buchstäbliche Exegese berücksichtigt deshalb die<br />
Zeitgeschichte. Anstelle <strong>der</strong> allegorischen Interpretation des Alten Testaments setzten die<br />
Syrer einen typologischen Ansatz.<br />
2. 3. Die Reformatoren<br />
Der kirchlichen Reformation ging eine hermeneutische Reformation voraus. Von dem<br />
Scholastiker Occam hatte Luther gelernt, dass man zwischen Philosophie und<br />
Offenbarung unterscheiden muss. Bei Thomas von Aquin waren ja noch Theologie und<br />
Philosophie miteinan<strong>der</strong> verknüpft. Luther erkannte, dass die Bibel nicht mit<br />
philosophischen Methoden <strong>der</strong> Scholastiker auszulegen ist, weil sie göttliche<br />
Offenbarung ist, inspiriert durch den Hl. Geist. Selbst Gnade und Natur sind zu trennen,<br />
was in <strong>der</strong> katholischen Dogmatik zusammengedacht werden konnte. Die Gnade, die<br />
Lehre vom Heil, ist allein <strong>der</strong> Offenbarung zu entnehmen und nicht <strong>der</strong> Natur. Die Schrift<br />
also allein (sola scriptura) ist <strong>der</strong> Maßstab allen Verstehens und jeglicher Auslegung.<br />
Die Humanisten Reuchlin (1455-1522, Pforzheim) und Erasmus von Rotterdam ebneten<br />
<strong>der</strong> buchstäblichen und historischen Exegese die Wege, indem sie sich an den<br />
Universitäten für das Studium des Hebräischen und Griechischen einsetzten. Bisher<br />
konnte man nur die lateinische Vulgata lesen. Im Zeitalter <strong>der</strong> Renaissance erschien 1494<br />
ein gedrucktes hebräisches Altes Testament. Erasmus von Rotterdam gab 1516 ein<br />
griechisches Neues Testament heraus, das Luther 1521 ins Deutsche übersetzte.<br />
Luthers hermeneutisches Prinzip sieht folgen<strong>der</strong>maßen aus 9 :<br />
(1) Das psychologische Prinzip<br />
Prämisse für die Bibelauslegung sind Glaube und Leitung durch den Hl. Geist.<br />
Weil die Bibel inspiriert ist, for<strong>der</strong>t sie vom Ausleger einen geistlichen Ansatz<br />
(Kongenialität = Geistesverwandtschaft mit <strong>der</strong> Schrift). Das setzt wie<strong>der</strong>um die<br />
Wie<strong>der</strong>geburt voraus. Die Bibel muss mit an<strong>der</strong>en Augen betrachtet werden als<br />
alle an<strong>der</strong>en Bücher. Sie ist Gottes Wort.<br />
(2) Das Autoritätsprinzip<br />
9 Vgl. Ramm, a.a.O., 66-73; Stuhlmacher, a.a.O., 97-109.<br />
12
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Die Bibel ist die höchste Autorität (auctoritas). Sie allein ist <strong>der</strong> Maßstab allen<br />
Verstehens und aller Dogmatik (nicht die Konzilen und auch nicht die Kirche).<br />
(3) Das buchstäbliche Prinzip<br />
Jedes Wort <strong>der</strong> Bibel steht in seiner natürlichen Bedeutung (sensus literalis,<br />
Literalsinn, wörtlicher Sinn). Die Predigten gründete Luther auf das<br />
buchstäbliche Wort <strong>der</strong> Bibel („es steht geschrieben“). Luther verwarf die<br />
Allegorese. Die alten Sprachen Griechisch und Hebräisch haben ihren wichtigen<br />
Stellenwert. In <strong>der</strong> Apologetik sind die Sprachen unverzichtbar. Vor allem ist<br />
immer wie<strong>der</strong> <strong>der</strong> Kontext <strong>der</strong> Bibel zu berücksichtigen.<br />
(4) Das Genügsamkeitsprinzip (sufficentia = Suffizienz)<br />
Die Hl. Schrift allein genügt. Sie allein reicht aus. In ihr ist alle Lehre enthalten,<br />
die wir als Christen zum Glaubenswachstum und zur Ermahnung brauchen. Sie<br />
ist Eigentum aller Christen. Je<strong>der</strong> Christ darf die Hl. Schrift auslegen, wenn er<br />
sich an die hermeneutischen Regeln hält. Die Bibel ist eine organische und<br />
theologische Einheit.<br />
(5) Das Prinzip <strong>der</strong> Klarheit (claritas)<br />
Die Bibel ist klar und verständlich. Natürlich hat enthält sie auch Aussagen, die<br />
wir (noch) nicht verstehen, weil wir als natürlichen Menschen die göttliche Tiefe<br />
und Weite niemals begreifen können. Aber was sie über das Heil sagt, über die<br />
Heilsgeschichte, über Jesus Christus, darin ist sie eindeutig, klar und verständlich.<br />
In seiner Abhandlung „Vom unfreien Willen“ (De servo arbitrio), die zu seinen<br />
reformatorischen Hauptschriften gehört und sich an Erasmus richtet, spricht<br />
Luther über die äußere und innere Klarheit <strong>der</strong> Schrift. Die äußere Klarheit<br />
bezieht sich auf Wortlaut und Grammatik. Die innere Klarheit (claritas interna)<br />
bezieht sich auf das Evangelium, auf die geistliche Botschaft.<br />
Zum Herzstück <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> Luthers gehört das Bekenntnis „sola scriptura“ (allein<br />
die Schrift), seine damit verbundene Autorität (auctoritas), die Klarheit (claritas) <strong>der</strong><br />
Schrift wie auch das Auslegungsprinzip: „Die Schrift ist ihr eigener Ausleger“ (scriptura<br />
sui ipsius interpres)!<br />
Das christologische Prinzip Luthers:<br />
„Und darin stimmen alle rechtschaffenen heiligen Bücher überein, dass sie allesamt<br />
Christum predigen und treiben. Auch ist das <strong>der</strong> rechte Prüfstein, alle Bücher zu tadeln (=<br />
zu untersuchen), wenn man siehet, ob sie Christum treiben o<strong>der</strong> nicht, sintemal alle<br />
Schrift Christum zeiget, Röm. 3 (21), und S. Paulus nichts als Christum wissen will,<br />
1.Kor. 2 (2). Was Christum nicht lehret, das ist nicht apostolisch, wenn’s gleich S. Petrus<br />
13
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
o<strong>der</strong> S. Paulus lehrete. Wie<strong>der</strong>um, was Christum predigt, das ist apostolisch, wenn’s<br />
gleich Judas, Hannas, Pilatus und Herodes täte (WA, DB 7, 384,25ff.). 10<br />
An an<strong>der</strong>er Stelle hat Luther noch einmal das christologische Prinzip mit den Worten<br />
zusammengefasst: „Wenn du gut und sicher auslegen willst, nimm Christus mit dir, denn<br />
er ist <strong>der</strong>jenige, den alles betrifft.“ 11<br />
Zwar hat Luther recht, das Christus die Mitte <strong>der</strong> Schrift ist, aber es darf nicht dazu<br />
führen, aus dem Alten Testament ein christliches Buch zu machen, so dass die<br />
eschatologischen Prophezeiungen für Israel dahinfallen o<strong>der</strong> dass solche Bücher aus dem<br />
Kanon ausgeschlossen werden, die dem christologischen Prinzip Luthers nicht folgen wie<br />
<strong>der</strong> Jakobbrief, den <strong>der</strong> Reformator eine „stroherne Epistel“ nannte.<br />
Matthias Flacius und <strong>der</strong> Skopus<br />
Eine zusammenfassende und systematische lutherische <strong>Hermeneutik</strong> hat Matthias<br />
Flacius Illyricus (1520-1575) in einem zweibändigen Werk „Schlüssel zur heiligen<br />
Schrift“ (Clavis scripturae sacrae) dargelegt. Bis ins 18. Jahrhun<strong>der</strong>t hinein war<br />
diese <strong>Hermeneutik</strong> das Standartwerk. Vor allem betont Flacius, dass keine Dogmatik <strong>der</strong><br />
<strong>Hermeneutik</strong> vorausgesetzt werden darf. Umgekehrt soll es sein: die Lehre ergibt sich<br />
aus <strong>der</strong> Auslegung. Das kann nicht oft genug betont werden.<br />
Vier wichtige Schlüssel zur Auslegung von Flacius wollen wir festhalten 12 :<br />
(1) Wenn <strong>der</strong> ganze Text dunkel erscheint, dann soll man sich den Kontext und die<br />
Gattung genau anschauen. Handelt es sich um eine Erzählung, um ein Klagelied,<br />
um eine Berichterstattung, um eine Metapher, um ein Gleichnis, um eine<br />
Unterweisung o<strong>der</strong> um eine Prophetie? Hat man die Gattung richtig erfasst, kann<br />
man von da aus auf die eigentliche<br />
Intention (Ziel, Zweck, Absicht) des<br />
Textes schließen.<br />
(2) Bei allen auszulegenden Texten muss<br />
man unbedingt von Anfang an den<br />
Skopus (die Aussageabsicht) ins Augen<br />
fassen und bei <strong>der</strong> Auslegung im Auge<br />
behalten! Gerade bei Erzählungen,<br />
Berichterstattungen und Gleichnissen<br />
spielt <strong>der</strong> Skopus eine große Rolle,<br />
damit <strong>der</strong> Ausleger nicht zu weit<br />
abschweift, son<strong>der</strong>n das Ziel im Auge behält.<br />
(3) Ziel aller Auslegung soll es sein, dem Hörer, bzw. dem Leser, die Bibel als einen<br />
lebendigen, einheitlichen Organismus vorzustellen. Die Schrift ist nicht konfus<br />
10 Zitat bei Stuhlmacher, a.a.O., 103.<br />
11 Ramm, a.a.O., 70.<br />
12 Stuhlmacher, a.a.O, 111-114.<br />
Vier Schlüssel zur Auslegung<br />
(von Matthias Flacius):<br />
(1) Kontext und Gattung!<br />
(2) Skopus (Aussageabsicht)!<br />
(3) Die Schrift, ein Organismus!<br />
(4) Gesun<strong>der</strong> Glaube als<br />
Schranke!<br />
14
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
o<strong>der</strong> gar chaotisch, son<strong>der</strong>n sie hat einen heilsgeschichtlichen roten Faden in<br />
Christus. Die ganze Schrift beinhaltet Gottes weisen Plan mit dieser Welt und <strong>der</strong><br />
zukünftigen.<br />
(4) Grundlage aller Auslegung muss die „Analogie des Glaubens“ sein. Der gesunde<br />
Glaube weist den Ausleger immer wie<strong>der</strong> in die Schranken. Der Glaube orientiert<br />
sich am Bekenntnis zu Christus.<br />
Calvins Zeugnis des Geistes<br />
Johannes Calvin aus Genf (1509-1564) hat die reformatorische <strong>Hermeneutik</strong> Luthers<br />
übernommen und konsequent umgesetzt. Das bezeugen Calvins Kommentare. Der Jurist<br />
und Theologe Calvin ist ein Systematiker und von daher gesehen, haben seine<br />
Kommentare eine große Bedeutung für die christliche Unterweisung. Calvin wird von<br />
manchen Forschern sogar als <strong>der</strong> erste wissenschaftliche Ausleger in <strong>der</strong> Geschichte <strong>der</strong><br />
christlichen Kirche bezeichnet.<br />
Auch für Calvin ist die Bibel inspiriert (Institutio I, 6,2). Niemand kann die rechte und<br />
heilsame Lehre <strong>der</strong> Hl. Schrift verstehen, wenn er nicht zuvor ein Schüler <strong>der</strong> Schrift<br />
geworden ist (Institutio, I, 6,2). Die Schrift muss in <strong>der</strong> Absicht gelesen werden, Christus<br />
in ihr zu finden. Noch stärker als Luther lehnt er die Allegorese ab und hält am<br />
Literalsinn (sensus literalis), dem wörtlichen Sinn fest. Ihm kommt es vor allem auf die<br />
historische und philologische Interpretation an.<br />
Lei<strong>der</strong> hat auch Calvin wie alle Reformatoren den Literalsinn bei <strong>der</strong> Auslegung <strong>der</strong><br />
alttestamentlichen Propheten nicht konsequent durchgezogen, denn die eschatologischen<br />
Verheißungen, die z. B. bei Jesaja o<strong>der</strong> Jeremia Israel betreffen, bezieht Calvin allesamt<br />
typologisch auf die Gemeinde. Man vergleiche dazu seine Kommentare zu Jesaja und<br />
Jeremia. Das hat mit <strong>der</strong> Bundestheologie 13 zu tun, die für die Exegese als Prämisse<br />
genommen wird: Calvin geht davon aus, dass <strong>der</strong> alttestamentliche Bund in Christus<br />
erfüllt ist und damit auch alle Verheißungen. Zwar hat sich <strong>der</strong> alttestamentliche Bund in<br />
Christus erfüllt (Hebr. 9,10b), nicht aber die eschatologischen Verheißungen.<br />
Vor allem bekennt sich Calvin in <strong>der</strong> Schriftauslegung zu dem „inneren Zeugnis des Hl.<br />
Geistes“ (testimonium spiritus sancti internum). Was kann Nichtgläubige, Agnostiker<br />
und Zweifler überzeugen? Keine menschlichen Beweise können einen Menschen zum<br />
Glauben an JESUS führen, auch nicht zum Glauben an die Bibel als das geoffenbarte<br />
Wort Gottes. Das kann allein <strong>der</strong> Hl. Geist. Das Zeugnis des Hl. Geistes in <strong>der</strong> Schrift ist<br />
besser als alle Beweise.<br />
13 Zur Vertiefung <strong>der</strong> Bundestheologie vgl. Martin Hohl: Heinrich Bullinger und seine Bundestheologie,<br />
RVB, Hamburg, 2001.<br />
15
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
„Denn wie Gott selbst in seinem Wort <strong>der</strong> einzige vollgültige Zeuge von sich selber<br />
ist, so wird auch dies Wort nicht eher im Menschenherzen Glauben finden, als bis<br />
es vom inneren Zeugnis des Heiligen Geistes versiegelt worden ist. Denn <strong>der</strong>selbe<br />
Geist, <strong>der</strong> durch den Mund <strong>der</strong> Propheten gesprochen hast, <strong>der</strong> muss in unser Herz<br />
dringen, um uns die <strong>Gewissheit</strong> zu schenken, dass sie treulich verkündet haben,<br />
was ihnen von Gott aufgetragen war“ (Inst. I, 7,4).<br />
Von <strong>der</strong> Betrachtung eines Gemäldes zur Anwendung<br />
„Du musst bei deinen Studien doch auch darauf achten, dass sie Dir nicht bloß<br />
zur Unterhaltung, son<strong>der</strong>n zu dem Zweck dienen, einst <strong>der</strong> Kirche Christi Nutzen<br />
zu bringen. Denn diejenigen, welche von <strong>der</strong> Wissenschaft nichts an<strong>der</strong>es<br />
wollen, als mit ehrenwürdiger Beschäftigung die Langeweile des Müßiggangs<br />
vertreiben, kommen mir immer vor wie Leute, die ihr ganzes Leben damit<br />
zubringen, schöne Gemälde zu betrachten.“<br />
Vor allem weist Calvin darauf hin, dass <strong>der</strong> Ausleger nicht nur für sich allein auslegt,<br />
son<strong>der</strong>n für die Gemeinde, für den Nächsten. In einem Brief an einem Pfarrer aus dem<br />
Jahre 1540 rät er 14 :<br />
14 Stuhlmacher, a.a.O., 107<br />
16
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
3. Erbauliche Schulen<br />
3.1. Spener – Auslegung und Anwendung<br />
Philipp Jakob Spener (1635-1705) 15 veröffentlichte 1675 die „Pia Desi<strong>der</strong>ia“ (Fromme<br />
Wünsche). Er betont das allgemeine Priestertum, d. h. je<strong>der</strong> soll eifrig die Hl. Schrift<br />
studieren. Die Bibel soll erbaulich gelesen werden. Sie ist nicht natürlich, son<strong>der</strong>n<br />
geistlich und sie kann deshalb auch nur mit dem Hl. Geist ausgelegt werden. Wie aber<br />
können Geist und Schrift miteinan<strong>der</strong> korrelieren? Dazu schreibt Spener:<br />
„Man möchte zwar sagen, die Schrift sei ja selbst ein Licht und bedürfe dazu nicht erst<br />
den Hl. Geistes und dessen Licht. Freilich ist die Schrift ein Licht, uns zu erleuchten,<br />
aber sie ist ein Wort des Geistes, wo wir daher den Hl. Geist von dem Wort abson<strong>der</strong>n<br />
könnten (was nicht geschehen kann), würde es alsdann nichts mehr wirken.“ 16<br />
Vor allem betont Spener, dass die Bibel unter Gebet ausgelegt werden soll.<br />
3.2. Francke – Bibellektüre in den Grundsprachen<br />
August Hermann Francke (1663-1727) 17 gründete in Halle ein „Kollegium <strong>der</strong><br />
Bibelfreunde“ (Collegium Philobiblicum) zum Studium <strong>der</strong> Hl. Schrift. Dabei sollte die<br />
Bibel vor allem in ihren Grundsprachen Hebräisch, Aramäisch und Griechisch gelesen<br />
werden, aber eben zu dem Zweck <strong>der</strong> Erbauung und <strong>der</strong> praktischen Anwendung. Die<br />
sieben Thesen zur <strong>Hermeneutik</strong> lauten nach Francke:<br />
(1) Die Intention des biblischen Textes beachten (Skopus).<br />
(2) Den Kontext beachten.<br />
(3) Vor <strong>der</strong> Auslegung die Einleitungsfragen klären (wer, wo, wann, wie, wozu,<br />
warum).<br />
(4) Vergleiche das Alte Testament mit dem Neuen und umgekehrt.<br />
(5) Eine Wahrheit ist aus <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en zu erschließen, denn die Bibel wi<strong>der</strong>spricht<br />
sich nicht.<br />
(6) Die Bibel ist eine Harmonie und darf nicht seziert werden.<br />
15<br />
Biographische Notizen unter http://www.bautz.de/bbkl/s/spener_p_j.shtml (Biographisch-<br />
Bibliographisches Kirchenlexikon – Bautz).<br />
16<br />
Spener: Das nötige und nützliche Lesen <strong>der</strong> Hl. Schrift, 1694, aus: Hauptschriften Philipp Jakob Speners,<br />
hrsg. v. Paulus Grünberg, in: Cochlovius / Zimmerling: Evangelische Schriftauslegung, 1987, 54.<br />
17<br />
Biographische Notizen unter http://www.bautz.de/bbkl/f/francke_a_h.shtml (Biographisch-<br />
Bibliographisches Kirchenlexikon – Bautz).<br />
17
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
(7) Die Worte nach dem geistlichen Sinn klären und nicht nach philosophischrationalistischen<br />
Erwägungen!<br />
Die Bibel: ein historisch-geoffenbartes Buch<br />
Eine linguistisch-zeitgeschichtliche Interpretation des Wortes reicht allein nicht aus, wenn<br />
wir nicht den göttlichen Offenbarungscharakter in ihm erkennen! Beispiele dazu haben wir<br />
genug. Das Wort „Kyrios“ bekommt im Neuen Testament eine völlig neue Dimension. Im<br />
Alten Testament wird Gott als Kyrios tituliert, im römischen Reich <strong>der</strong> Kaiser und im<br />
Neuen Testament JESUS. In gleicher Weise wird das oft im klassischen Umfeld<br />
gebrauchte Wort „Evangelium“ mit neuem Inhalt gefüllt: Es ist jetzt das Evangelium von<br />
JESUS Christus, dem Sohn Gottes (Mk. 1,1). Der Begriff „Herrenmahl“ (griech. „kyriakon<br />
deipnon“) kennt keine zeitgeschichtliche Parallele. Im Neuen Testament bezieht er sich auf<br />
das letzte Mahl Jesu mit seinen Jüngern. Und auch das römische Wort „Kreuz“<br />
(„Marterpfahl“) bekommt im Neuen Testament eine ganz an<strong>der</strong>e Interpretation, nämlich<br />
eine theologisch-soteriologische. Die Bibel ist eben mehr als ein rein historischphilologisches<br />
Buch – sie ist ein göttlich-geoffenbartes Buch.<br />
3.3. Bengel – Vergleich <strong>der</strong> Handschriften<br />
Johann Albrecht Bengel (1687-1752) 18 aus Tübingen stellt ebenfalls sieben<br />
Arbeitsschritte <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> dar 19 :<br />
(1) Zunächst soll <strong>der</strong> Grundtext festgestellt werden, d. h. man vergleiche die<br />
Handschriften miteinan<strong>der</strong>. Bengel hat selber viele Handschriften gesammelt und<br />
diese miteinan<strong>der</strong> verglichen. Diese Art <strong>der</strong> Test-Feststellung des hebräischen und<br />
griechischen Grundtextes war etwas völlig Neues. Zur Zeit Luthers orientierte man<br />
sich an den Textus Receptus, an den anerkannten Grundtext. Doch im Laufe <strong>der</strong><br />
Jahrhun<strong>der</strong>te kamen immer mehr Bibelhandschriften dazu und somit wurde das<br />
Interesse für die Grundtext-Feststellung geweckt (Fachwort „Textkritik“, obwohl<br />
es mit Kritik nichts zu tun hat, son<strong>der</strong>n eben mit <strong>der</strong> Text-Feststellung).<br />
(2) Erhellung des eigentlichen Wortsinns. Durch die philologische Untersuchung den<br />
Wortsinn (sensus literalis) herausarbeiten. Das Wort „baptidso“ bedeutet wörtlich<br />
z. B. „untertauchen“.<br />
(3) Beachte den Kontext.<br />
(4) Das Gewicht <strong>der</strong> einzelnen Worte miteinan<strong>der</strong> abwägen.<br />
(5) Stelle in Bezug auf Worte und Perikopen einen innerbiblischen Vergleich her.<br />
18<br />
Biographische Notizen unter http://www.bautz.de/bbkl/b/bengel_j_a.shtml (Biographisch-<br />
Bibliographisches Kirchenlexikon – Bautz).<br />
19<br />
Nach Gerhard Maier: Wie legen wir die Schrift aus?, Brunnen, TVG, Gießen, 1982, 23f.<br />
18
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
(6) Führe zeitgeschichtliche und religionsgeschichtliche Studien durch.<br />
(7) Stelle einen dogmatischen Vergleich auf.<br />
3.4. Hamann - Wi<strong>der</strong> die Vernunft<br />
Der Philosoph Immanuel Kant aus Königsberg (1724-1804) hat in seiner Schrift „Der<br />
Streit <strong>der</strong> Fakultäten“ (1798) für Auslegungsansätze plädiert, die von <strong>der</strong> Vernunft<br />
diktiert sein sollen. Dem wi<strong>der</strong>spricht vehement dessen Freund und späterer Kritiker<br />
Johann Georg Hamann 20 (*1730 Königsberg, † 1788 in Münster). Haman studierte<br />
Theologie, Philosophie, Jura, Sprachen, Naturwissenschaften und obwohl er ein Studium<br />
nie richtig abgeschlossen hat, besaß er ein enzyklopädisches Wissen. Er lehrte an keiner<br />
Universität, dagegen übte er verschiedene Berufe aus. Nebenbei war er sehr stark<br />
schriftstellerisch tätig. Seine Schriften sind allerdings schwer zugänglich, da er einen<br />
ironischen Schreibstil führt. Mit dem Bauernmädchen Anna Regina Schuhmacher, die<br />
sich um seinen Vater kümmerte, führte er eine Gewissensehe. Am 31. März 1758 kam es<br />
in London beim Lesen des fünften Kapitels des 5. Buches Mose zu einer Bekehrung. 21 Er<br />
entdeckte seine Liebe zur Bibel. Hamann bezeichnet „Gott als einen Schriftsteller“.<br />
„Gott ein Schriftsteller! Die Eingebung dieses Buches ist eine eben so große Erniedrigung und<br />
Herunterlassung Gottes als die Schöpfung des Vaters und Menschwerdung des Sohnes. Die<br />
Demuth des Herzens ist daher die einzige Gemüthsverfassung, die zur Lesung <strong>der</strong> Bibel gehört,<br />
und die unentbehrlichste Vorbereitung zur selbigen.“ 22<br />
Hamann vertritt die Verbalinspiration und er schließt jede<br />
Sachkritik an <strong>der</strong> Bibel aus. Die Bibel ist für ihn historische Hamann:<br />
Offenbarung. Das heißt, dass Gott nirgends an<strong>der</strong>s redet als<br />
Alte Lumpen<br />
in <strong>der</strong> geschichtlichen biblischen Offenbarung. Wer wie<br />
Lessing ewige Wahrheiten jenseits o<strong>der</strong> abseits <strong>der</strong><br />
Demut<br />
geschichtlichen Offenbarung <strong>der</strong> Bibel suchen will,<br />
versteigt sich „in das Kabinett des göttlichen Verstandes.“<br />
Die Bibel ist ein historisches Buch und ihre Geschichten sind wahr und gerade in <strong>der</strong><br />
Geschichte offenbart sich nun <strong>der</strong> lebendige und ewige Gott.<br />
„Natur und Geschichte sind daher die 2 grossen Commentarii des Göttlichen Wortes und dies<br />
hingegen <strong>der</strong> einzige Schlüssel, uns eine Erkenntnis in beyden zu eröffnen.“ 23<br />
In dieser Hinsicht spricht Hamann von <strong>der</strong> Kondeszendenz (Herablassung) Gottes in <strong>der</strong><br />
Schrift (Inverbation). Der ewige und heilige und unzugängliche Gott haucht seinen<br />
20 G. Maier: <strong>Hermeneutik</strong>, 1990, 304-310; P. Stuhlmacher: Vom Verstehen, 2 1986, 140-142; Quellentexte<br />
bei Cochlovius / Zimmerling: Ev. Schriftauslegung, 1987, 104-116. Werke: Sämtliche Werke in 6 Bänden,<br />
hrsg. v. Josef Nadler: Johann Georg Hamann – Sämtliche Werke, Bd. I-VI, Wien, 1949-57 (Abk.: N I, N II<br />
usw.).<br />
21 Hamann: Gedanken über meinen Lebenslauf (N II, 39-44) in: Cochlovius / Zimmerling, a.a.O., 105-108.<br />
22 Hamann: Über die Auslegung <strong>der</strong> Heiligen Schrift (N I, 5f.), in: Cochlovius / Zimmerling, a.a.O., 104.<br />
23 Hamann: Brocken § 3 (N I, 303f.), in: Cochlovius / Zimmerling, a.a.O., 112.<br />
19
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Propheten und Aposteln sein Wort ein. Damit wird die Bibel zum Wort Gottes. Auch<br />
wenn die Bibel in menschlicher Sprache geschrieben ist, immer wie<strong>der</strong> abgeschrieben<br />
wurde, so dass viele Handschriften entstanden, so ist sie dennoch Gottes Wort. Hamann<br />
vergleicht diese Bibel mit „alten Lumpen“, mit denen <strong>der</strong> Prophet Jeremia aus <strong>der</strong> Grube<br />
gezogen wurde. Es sind nur alte Lumpen, aber gerade diese alten Lumpen verhelfen den<br />
Jeremia zum Leben. So weist auch uns die Bibel den Weg zu JESUS und damit zum<br />
Leben. Nicht das Ansehen <strong>der</strong> Schriften <strong>der</strong> Bibel spielen eine Rolle wie bei den alten<br />
Lumpen, son<strong>der</strong>n die Dienste, ihr Gebrauch.<br />
3.5. Beck – pneumatische Exegese<br />
Johann Tobias Beck 24 (1804-1878) 25 war zunächst Pfarrer in<br />
Württemberg und später Dozent in Basel und Tübingen.<br />
Zu seinem Schüler gehört Adolf Schlatter. Für Beck ist<br />
die Bibel absolute Autorität. Je<strong>der</strong> wissenschaftliche<br />
Zweifel hat sich ihr zu beugen. Beck kann man als<br />
den Vater <strong>der</strong> „pneumatischen Exegese“ bezeichnen,<br />
weil er immer wie<strong>der</strong> betont, dass <strong>der</strong> Ausleger die<br />
Bibel niemals ohne den Hl. Geist auslegen könne.<br />
Johann Tobias Beck:<br />
Pneumatische<br />
Exegese und ihre<br />
Anwendung<br />
„Das Wort Gottes ist das Werk eines Geistes, <strong>der</strong> das Leben<br />
selbst ist, also kein todtes Schriftwerk hinstellt, son<strong>der</strong>n ein<br />
solches, in welchem er lebendig inne bleibt, und dem er beständig<br />
gegenwärtig ist mit seiner lebendigen Wirksamkeit, die sich auch noch<br />
ausser dem Wort in die Menschengeister hinein erstreckt. Der eigene Geist <strong>der</strong> Schrift ist auch ihr<br />
Ausleger, muss demnach die Erklärer erst vergeistigen in sein heiliges Wesen, ehe sie geistig im<br />
heiligen Sinn die Schrift können auslegen, und diese heilige Vergeistigung geschieht im<br />
Glauben...“ 26<br />
Vor allem betont Beck, dass die Exegese einen Übergang zur Anwendung im Leben des<br />
Christen finden muss. Sie darf nicht nur systematisch sein, son<strong>der</strong>n eben auch<br />
pragmatisch.<br />
Fünf Fundamentalsätze zur Auslegung <strong>der</strong> Hl. Schrift hat Beck konstituiert 27 :<br />
Erster Fundamentalsatz:<br />
Die Anwendung muss aus dem Text <strong>der</strong> Bibel hervorgehen („es steht geschrieben“).<br />
Zweiter Fundamentalsatz:<br />
Die Folgerungen, mittelst <strong>der</strong>en wir den Text anwenden, müssen richtig begründet sein.<br />
24<br />
Biographische Notizen unter http://www.bautz.de/bbkl/b/beck_joh_to.shtml (Biographisch-<br />
Bibliographisches Kirchenlexkion – Bautz).<br />
25<br />
G. Maier, a.a.O., 310-312; P. Stuhlmacher, a.a.O., 155-156; Cochlovius / Zimmerling, a.a.O., 135-139.<br />
26<br />
J. T. Beck: Einleitung in das System <strong>der</strong> Christlichen Lehre o<strong>der</strong> Propädeutische Entwicklung <strong>der</strong><br />
Christlichen Lehrwissenschaft, 2. Aufl., Stuttgart, 1870, S. 255ff., in: Cochlovius / Zimmerling, a.a.O.,<br />
135.<br />
27<br />
J. T. Beck, a.a.O., in: Cochlovius / Zimmerling, a.a.O., 137 – 139.<br />
20
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Dritter Fundamentalsatz:<br />
Die Erzählungen des Alten Testaments sind <strong>der</strong> weissagende Umriss unseres eigenen<br />
Lebensganges.<br />
Vierter Fundamentalsatz:<br />
Jede Geschichte bietet ihre allgemeinen und beson<strong>der</strong>en Wahrheiten, findet aber ihre<br />
volle Bedeutung erst in einer individuellen Lehrwahrheit.<br />
Fünfter Fundamentalsatz:<br />
Alle Auslegung soll <strong>der</strong> geistlichen Erbauung und Besserung dienen.<br />
4. Die <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> Dialektiker Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts<br />
Eine Antwort auf die historisch-kritische <strong>Hermeneutik</strong> und auf den Historismus des 18.<br />
und 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts bestand in dem offenbarungstheologischen Ansatz <strong>der</strong> jungen<br />
Dialektiker zu Beginn des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts mit Karl Barth, Emil Brunner, Eduard<br />
Thurneysen und Friedrich Gogarten. 28<br />
Die neue Ära <strong>der</strong> Bibelinterpretation am Anfang des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts wurde durch Karl<br />
Barth eingeleitet. „Gott ist <strong>der</strong> ganz an<strong>der</strong>e“, schrieb Karl Barth (1886-1968) im Jahre<br />
1922 in seinem Römerbrief-Kommentar. 29 Damit grenzte Barth sich von <strong>der</strong> Theologie<br />
des 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts ab, die Gott rationalistisch zu begreifen suchte. Barths Römerbrief<br />
führte in <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> zu einer Wende, jedenfalls bei denen, die mit <strong>der</strong><br />
rationalistischen Theologie unzufrieden waren. Die neue Bewegung um Barth nannte<br />
man „Theologie <strong>der</strong> Krise“, weil sie Gottes Gericht betonte, auch „Neo-Orthodoxie“,<br />
weil sie die reformatorischen Erkenntnisse wie<strong>der</strong>gewinnen wollte und auch „Neo-<br />
Supranaturalismus“, weil sie im Gegensatz zum Mo<strong>der</strong>nismus die Kategorie des<br />
Transzendentalen (also <strong>der</strong> göttlichen Sphäre) neu zu erfassen suchte. Barth also betont<br />
die O f f e n b a r u n g in <strong>der</strong> Bibel. Der Ausleger soll von dem reden, was Gott offenbart<br />
hat. Dem Hörer interessieren die historisch-kritischen Forschungsergebnisse kaum o<strong>der</strong><br />
gar nicht.<br />
28 Die historisch-kritische <strong>Hermeneutik</strong> werde ich später unter dem Punkt VII,1 „Kritische Ansätze <strong>der</strong><br />
<strong>Hermeneutik</strong>“ (Die historisch-kritische Methode) besprechen, und zwar deshalb, weil die historischkritische<br />
Methode zwar ihre Wurzeln in <strong>der</strong> rationalistischen Theologie des 18. und 19. Jahrhun<strong>der</strong>ts hat,<br />
aber bis heute als die bedeutende wissenschaftliche Methode <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> an den Universitäten<br />
angesehen wird. Und weil wir uns jetzt gerade in einem kirchengeschichtlichen Überblick befinden,<br />
möchte ich an dieser Stelle die Neo-Orthodoxie besprechen.<br />
29 Karl Barth: Der Römerbrief, EVZ, Zürich, 1940, 4.<br />
21
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Das hatte auch Emil Brunner erkannt: Die historisch-kritische Methode geht mit <strong>der</strong><br />
Bibel um wie mit einem Kunstwerk . Sie beschreibt die Entstehung des Kunstwerkes,<br />
die Technik, die Komposition, den Werdegang, den Lokus, also eben alle<br />
Äußerlichkeiten, aber sie beschäftigt sich viel zu wenig mit dem Inhalt, mit <strong>der</strong><br />
eigentlichen Intention, mit <strong>der</strong> Botschaft des Werkes. Ja selbst <strong>der</strong> Künstler, <strong>der</strong> Schöpfer<br />
des Werkes, wird außer Acht gelassen. Das ist das Dilemma <strong>der</strong> historischen Erforschung<br />
<strong>der</strong> Bibel im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t, das ist auch noch heute ihr Desaster.<br />
Zwar setzen de facto die jungen Dialektiker neue Schwerpunkte (Barth: „Gott, <strong>der</strong> ganz<br />
an<strong>der</strong>e“; Brunner: „<strong>der</strong> persönliche Gott“), aber überwunden haben sie die historischkritische<br />
Methode (HKM) und den religionsgeschichtlichen Ansatz Ritschl’s lei<strong>der</strong> nicht.<br />
Das Offenbarungsprinzip<br />
Nach Karl Barth geschieht Offenbarung nur dann, wenn Gott redet. Die Bibel wäre nicht<br />
primär das geoffenbarte Buch, son<strong>der</strong>n sie es nur, wenn Gott redet. „Die Bibel ist also<br />
nicht selbst und an sich Gottes geschehene Offenbarung, wie ja auch die kirchliche<br />
Verkündigung nicht selbst und an sich die erwartete künftige Offenbarung ist. ... Die<br />
Bibel ist nicht selbst und an sich Gottes geschehene Offenbarung, son<strong>der</strong>n indem sie<br />
Gottes Wort wird, bezeugt sie Gottes geschehene Offenbarung und ist sie geschehene<br />
Offenbarung in <strong>der</strong> Gestalt <strong>der</strong> Bezeugung.“ 30 Die Bibel „muss Gottes Wort je und je<br />
werden.“ 31 Somit leugnet Barth die Bibel an sich als Wort Gottes. Sie wird erst dann<br />
Gottes Wort, wenn Gott redet 32 . Obwohl Barth auf <strong>der</strong> einen Seite ganz neu die<br />
Offenbarung betont, die vom Rationalismus völlig abgelehnt worden war, fällt er doch<br />
auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en Seite in den Graben <strong>der</strong> Liberalen Theologie, indem er Offenbarung und<br />
Bibel auseinan<strong>der</strong>reißt. Denn damit macht er die Bibel zu einem menschlichen Buch, von<br />
irrtümlichen Menschen geschrieben und mit menschlichen Methoden auszulegen. Nur in<br />
<strong>der</strong> Verkündigung, wenn Gott redet, würde die Bibel Gottes Wort werden. Barth<br />
überkleidet die historisch-kritische Methode mit dem Mantel <strong>der</strong> Offenbarung, ein<br />
Paradoxon, was sich wi<strong>der</strong>spricht, was nicht möglich ist. Man kann nicht eine Quelle,<br />
woraus bitteres Wasser fließt, einfach versüßen.<br />
30<br />
K. Barth: Kirchliche Dogmatik, I,1, München, 1935, 114.<br />
31<br />
Ders., a.a.O., 120.<br />
32<br />
Das Wort Gottes in seiner dreifachen Gestalt nach Karl Barth:<br />
1. Stufe: Jesus ist das geschehene Wort.<br />
2. Die Jünger und Apostel bezeugen das Wort.<br />
3. Das Neue Testament verkündigt das Wort.<br />
Dazu stellt P. Stuhlmacher fest: „Das biblische Zeugniswort liegt uns als Bezeugung des Evangeliums und<br />
Grundlegung <strong>der</strong> (mündlichen) Evangeliumspredigt vor; es kann und soll seinem Wortlaut und Inhalt nach<br />
gehört, durchdacht und (wie alle Prophetie) kritisch geprüft werden… Eine <strong>der</strong> Bibel entsprechende<br />
<strong>Hermeneutik</strong> hat also zwischen biblischem Zeugniswort und Evangelium gebührend zu unterscheiden…“<br />
Peter Stuhlmacher: Vom Verstehen des Neuen Testaments. Eine <strong>Hermeneutik</strong>, Göttingen, 2 1986, 52.<br />
22
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Das christologische Prinzip<br />
Nur das, was Zeugnis von Christus ablegt, ist verbindlich. Lehraussagen werden nur so<br />
verstanden wie sie mit Jesus Christus, dem Wort Gottes, verbunden sind. Barth betont<br />
immer wie<strong>der</strong> in seiner Dogmatik Jesus Christus, seine ganz Dogmatik (9 000 Seiten) hat<br />
einen christologischen Ansatz. Darin folgt ihm sogar Emil Brunner: Kein Lehrsatz ist ein<br />
christlicher Lehrsatz, wenn er nicht eine christologische Orientierung bekommt. 33 Wie<br />
wir bereits besprochen haben, darf dieser christologische Ansatz nicht dazu führen, die<br />
alttestamentlichen Aussagen nur noch auf die Gemeinde zu beziehen und nicht mehr auf<br />
Israel.<br />
Das Totalitätsprinzip<br />
Barth, Brunner, Lewis und Nierbuhr behaupten, dass man eine Lehre nicht beweisen<br />
kann, indem man eine o<strong>der</strong> mehrere Bibelstellen zitiert. Die Lehre <strong>der</strong> Bibel kann man<br />
erkennen, wenn man die G e s a m t h e i t dessen, was sie lehrt, in Betracht zieht.<br />
Brunner meint: „Wir sind durch keine Bibelstelle gebunden, die für sich isoliert wird und<br />
ganz sicher nicht durch isolierte Abschnitte des Alten Testaments.“ 34 Richtig daran ist,<br />
dass <strong>der</strong> gesamte Kontext <strong>der</strong> Bibel für die Lehre berücksichtigt werden sollte, aber die<br />
Zehn Gebote zum Beispiel haben für sich genommen göttliche Autorität und bedürfen<br />
keine Bestätigung durch weitere Bibelstellen. Zudem gibt es in den Propheten<br />
eschatologische Offenbarungen, die nur ein einziges Mal o<strong>der</strong> nur wenige Male erwähnt<br />
werden - wie will man da auf den Kontext <strong>der</strong> Bibel zurückgreifen?!<br />
Das existenzielle Prinzip<br />
Der dänische Philosoph Sören Kierkekaard (1813-1855) schlug vor, die Bibel<br />
existenziell zu lesen. Sie muss in meine Existenz, in mein Leben hineinsprechen. Ich<br />
muss die Hl. Schrift gespannt, voller Erwartung, mit einem Geist des Gehorsams, mit<br />
verlangendem Herzen lesen. Dieses existenzielle Prinzip hat zwar später Rudolf<br />
Bultmann angeregt und führte ihn zur „existentialen Interpretation“, jedoch unterscheidet<br />
sich Kierkegaard massiv von dem Theologen Bultmann, weil für den dänischen<br />
Philosophen die Bibel Gottes Wort ist. Für Kierkegaard beginnt die Bibelexegese mit <strong>der</strong><br />
Bibellektüre: „Derjenige, <strong>der</strong> nicht allein ist mit Gottes Wort, liest nicht Gottes<br />
Wort.“ 35<br />
Man kann sich mit Wissen über die Bibel vollstopfen, aber dennoch an <strong>der</strong> Bibel<br />
„vorbeilesen“, wenn man sie nur als Gegenstand <strong>der</strong> Forschung betrachtet und nicht mehr<br />
als Liebesbrief Gottes an den Menschen. Kierkegaard benutzt als Illustration einen<br />
Jungen, <strong>der</strong> seine Hose mit Tüchern ausstopft, um die Schläge zu mil<strong>der</strong>n, die er<br />
erwartet. So stopft <strong>der</strong> Gelehrte seine akademische Hose mit Grammatiken, Lexika und<br />
Kommentaren aus, und die Bibel als Gottes Wort erreicht niemals seine Seele. Beide<br />
33 E. Brunner, Dogmatik, II, in: Ramm, a.a.O., 87.<br />
34 E. Brunner, Dogmatik, II, in: Ramm, a.a.O., 87f.<br />
35 Zitiert bei Ramm, a.a.O., 90.<br />
23
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Prinzipien, das geistige und das geistliche Prinzip, ergänzen sich auf wun<strong>der</strong>barer Weise.<br />
Die grammatikalisch-historische Forschung (das geistige Prinzip) in <strong>der</strong> Ehrfurcht vor<br />
Gott erschließt uns Gottes Wort auf für die ekklesiologische Lehre und für die<br />
Apologetik, das geistliche Prinzip dient <strong>der</strong> Auferbauung <strong>der</strong> Gemeinde und des<br />
Einzelnen.<br />
„Derjenige, <strong>der</strong> nicht allein ist mit Gottes Wort, liest nicht Gottes Wort“<br />
(Sören Kierkegaard)<br />
Das paradoxe Prinzip <strong>der</strong> Dialektiker<br />
Kierkegaard versuchte biblische Gegensätze als das paradoxe Prinzip darzustellen. Karl<br />
Barth übernahm dieses Prinzip und sprach von <strong>der</strong> dialektischen Theologie. Alle<br />
scheinbaren Gegensatzpaare wurden durch dieses dialektische Prinzip „gelöst“.<br />
Gott ist einer, aber auch drei. Gott will, dass alle Menschen errettet werden, aber er<br />
erwählt auch. Gott ist Liebe, aber auch zornig. Das Kreuz ist Torheit bei den Menschen,<br />
aber bei Gott Weisheit. Gott ist ganz nah, aber er kann auch ganz fern sein. Es gibt den<br />
Himmel (Transzendenz) und die Erde (Immanenz). Es gibt Gnade und Gericht, die<br />
Theodizee. Gott ist <strong>der</strong> Ewige, <strong>der</strong> Unsichtbare, und dann wird Gott Mensch.<br />
Diese „paradoxen“ Aussagen kann <strong>der</strong> menschliche Verstand nicht begreifen – sie<br />
können nur im Glauben erfasst werden. 36<br />
Karl Barth knüpft an Kierkegaard an und versucht nun alle Aussagen <strong>der</strong> Bibel durch die<br />
dialektische Brille zu verstehen und zu interpretieren. Dialektik meint das Denken in<br />
Gegensätzen. Der Dialektiker muss nun aber jede Aussage durch seine entgegengesetzte<br />
Aussage korrigieren. 37 Karl Barth distanziert sich bewusst von Martin Luthers<br />
„himmelstürmende Geradlinigkeit“, als könnte man Gott problemlos mit menschlichen<br />
Begriffen beschreiben. 38<br />
Zwar gibt es für die menschliche Perspektive „paradoxe Aussagen“ in <strong>der</strong> Bibel. Aber<br />
man kann nicht einfach die dialektische Methode anwenden und alle Aussagen in <strong>der</strong><br />
Bibel in einen Wi<strong>der</strong>spruch stellen. Man muss auch die göttliche Perspektive in <strong>der</strong><br />
Exegese berücksichtigen! Meines Erachtens wird die Dialektik in JESUS aufgelöst. Aber<br />
dies geschieht bei Barth gerade nicht, weil JESUS uns nur wie eine Tangente streift. 39<br />
Zurecht distanzierte sich Emil Brunner später von Barths Dialektik. Für Barth war Gott<br />
<strong>der</strong> ganz an<strong>der</strong>e, <strong>der</strong> unerreichbare, <strong>der</strong> unendliche. Emil Brunner aber meint, dass Gott<br />
mit uns in eine Ich-Du-Beziehung treten will. Bei Barth fehlt <strong>der</strong> entscheidende Punkt,<br />
dass <strong>der</strong> unendliche Gott durch JESUS in die Geschichte eingeht.<br />
Wenn Martin Luther manche Schriftaussagen nicht verstand, dann sprach er von dem<br />
verborgenen Gott (deus absconditus). Gott ist ewig, unendlich, allgegenwärtig,<br />
36 3<br />
W. Anz: Artikel: Kierkegaard, in: RGG, Bd. 3 <strong>der</strong> Studienausgabe, 1986, Sp. 1269.<br />
37 3<br />
W. Pannenberg: Dialektik, in: RGG, Bd. 2 <strong>der</strong> Studienausgabe, 1986, Sp. 171.<br />
38<br />
Ders., ebd. Sp. 172.<br />
39<br />
K. Barth: Der Römerbrief, a.a.O., 6<br />
24
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
allmächtig, allwissend, <strong>der</strong> erwählende Gott. Gott ist in seinem Wesen vom<br />
menschlichen Verstand nicht zu begreifen. Darin ist er verborgen und will verborgen<br />
bleiben. Aber in JESUS Christus hat er sich den Menschen offenbart. In JESUS, seinem<br />
Sohn, ist ER <strong>der</strong> sich offenbarende Gott (deus revelatus). Viele Bibelstellen erhellen sich<br />
in JESUS Christus, im Neuen Bund, in <strong>der</strong> Heilsgeschichte!<br />
5. Katholische <strong>Hermeneutik</strong><br />
Die katholischen Exegeten orientieren sich selbstverständlich an Augustin und Thomas<br />
von Aquin.<br />
(1) Der katholische Gelehrte akzeptiert die Vulgata und damit die Apokryphen.<br />
(2) Der katholische Ausleger akzeptiert, was die röm.-kath. Kirche ausdrücklich über<br />
die biblischen Bücher konstituiert hat (Konzilsbeschlüsse, päpstliche Enzykliken).<br />
(3) Er akzeptiert, bzw. berücksichtigt in seiner Auslegung alle Verse, die die<br />
Glaubenskongregation <strong>der</strong> röm.-kath. Kirche offiziell interpretiert hat.<br />
(4) Einer <strong>der</strong> größten Vorbil<strong>der</strong> und Kirchenvater ist Thomas von Aquin (1225-1274).<br />
Er betonte die buchstäbliche Auslegungsmethode. Auf einer reinen allegorischen<br />
Auslegung könne man kein Lehrgebäude aufbauen.<br />
(5) Nach Thomas kann aber die Schrift mehr als nur eine Bedeutung haben. Sie kann<br />
allegorisch, anagogisch (eschatologisch) und tropologisch (moralisch-geistlich)<br />
sein. Thomas deutet z. B. Brot und Wein des Melchizedek, das Manna, das Passa,<br />
sowie Öl und Mehl des Elia auf die neutestamentliche Eucharistie.<br />
(6) Die katholische Kirche ist die offizielle Auslegerin <strong>der</strong> Hl. Schrift. Sie ist die<br />
Wächterin. Wer nicht mit ihrer Lehre übereinstimmt, muss den Hut nehmen und<br />
gehen.<br />
(7) Der Exeget darf nicht seine Meinung kundtun, son<strong>der</strong>n er muss das auslegen, was<br />
überall, immer und von allen geglaubt worden ist (quod ubique, quod semper,<br />
quod omnibus creditum est). Das ist gebundene Kollektiv-Exegese. Sie ist<br />
gebunden an Schrift, Tradition und Kirche, also an die Konzilsbeschlüsse und<br />
Enzykliken.<br />
(8) Indirekte Anspielungen in <strong>der</strong> Schrift reichen für ein Lehrgebäude aus: Mariologie<br />
nach Lk. 1,46 o<strong>der</strong> Gen. 3,16 o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Papalismus nach Mt. 16,18.<br />
(9) Die Trinitätslehre ist ein unwi<strong>der</strong>ruflicher Bestandteil kirchlicher Lehre.<br />
(10) In <strong>der</strong> Enzyklika Providentissimus Deus von Leo XIII. heißt es: „Obwohl die<br />
Studien von Nichtkatholiken, mit Verstand gebraucht, manchmal für den<br />
katholischen Bibelforscher nützlich sein mögen, sollte er dennoch gut im Kopf<br />
behalten, ... dass man nicht erwarten sollte, den Sinn <strong>der</strong> Heiligen Schrift bei<br />
25
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Autoren zu finden, die ohne den wahren Glauben sind und nur an <strong>der</strong> Rinde <strong>der</strong><br />
Heiligen Schrift nagen und niemals das Mark erreichen.“ 40<br />
Im Katechismus <strong>der</strong> röm.-kath. Kirche wird die Frage gestellt:<br />
Wem steht es zu, das Glaubensgut verbindlich auszulegen? Daraufhin erfolgt in Artikel<br />
85-90 die Antwort:<br />
„Die verbindliche Auslegung des Glaubensgutes obliegt allein dem lebendigen Lehramt <strong>der</strong><br />
Kirche, das heißt dem Nachfolger Petri, dem Bischof von Rom, und den Bischöfen in<br />
Gemeinschaft mit ihm. Dem Lehramt, das im Dienst des Wortes Gottes das sichere Charisma<br />
<strong>der</strong> Wahrheit besitzt, steht es auch zu, Dogmen zu definieren: Das sind Formulierungen von<br />
Wahrheiten, die in <strong>der</strong> göttlichen Offenbarung enthalten sind. Diese Autorität erstreckt sich auch<br />
auf Wahrheiten, die mit <strong>der</strong> Offenbarung in einem notwendigen Zusammenhang stehen.“ 41<br />
40 Ramm: Biblische <strong>Hermeneutik</strong>, 1991, 59.<br />
41 Quelle: Katechismus <strong>der</strong> RKK:<br />
http://www.vatican.va/archive/compendium_ccc/documents/archive_2005_compendium-ccc_ge.html<br />
26
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
6. Zusammenfassung herkömmlicher hermeneutischer Ansätze<br />
Byzantinische Zeit<br />
• allegorisch<br />
Mittelalter (vierfacher Schriftsinn)<br />
• buchstäblich<br />
• allegorisch<br />
• tropologisch (geistlich)<br />
• anagogisch (eschatologisch)<br />
Reformation<br />
• buchstäblich<br />
• christologisch<br />
Aufklärung<br />
• historisch-kritisch (Troeltsch)<br />
• literaturkritisch<br />
• religionsgeschichtlich (Ritschl)<br />
Pietismus<br />
• anwenden (Spener)<br />
• philologisch (Francke)<br />
• Vergleich <strong>der</strong> Handschriften (Bengel)<br />
• Demut (Hamann)<br />
• pneumatisch (Beck)<br />
Neuzeit<br />
• existential (Kierkegaard)<br />
• offenbarungstheologisch-dialektisch (Barth)<br />
• formgeschichtlich (Gunkel)<br />
• entmythologisieren (Bultmann)<br />
• biblisch-historisch , offenbarungstheologisch (evangelikal)<br />
Mo<strong>der</strong>ne<br />
• psychologisch<br />
• ökumenisch<br />
• feministisch<br />
• literarisch (Erzählungen, intertextual, diachron)<br />
27
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
II. Jüdisch-rabbinische Schriftauslegung<br />
Literatur:<br />
1) Arnold Goldberg: Formen und Funktionen von Schriftauslegung in <strong>der</strong> frührabbinischen<br />
Literatur (1. Jh. v. Chr. Bis 8. Jh. n. Chr.), Linguistica Biblica 64 (1990).<br />
2) Arnold Goldberg / M. Schlüter / P. Schäfer: Rabbinische Texte als Gegenstand <strong>der</strong><br />
Auslegung, Mohr Siebeck, Tübingen, 1999.<br />
3) Bernhard Ramm: Biblische <strong>Hermeneutik</strong>, International Correspondence Institute, Asslar,<br />
1991, Kapitel 2: Historische Schulen: § 2 Buchstäbliche Schulen, a) Jüdischer Literalismus.<br />
4) Günther Stemberger: Einführung in Talmud und Midrasch, München, 8 1992.<br />
5) Günter Stemberger: Midrasch – vom Umgang <strong>der</strong> Rabbinen mit <strong>der</strong> Bibel – Einführung –<br />
Texte – Erläuterungen, C.H.Beck Verlag, München, 1989.<br />
6) Artikel aus dem Studium des Neuen Testaments:<br />
a) E. J. Schnabel: Exkurs: Die jüdisch-rabbinische Schriftauslegung aus dem Artikel „Die<br />
Verwendung des Alten Testaments im Neuen“ (Kap. 8) in: Das Studium des Neuen<br />
Testaments, Bd. 2, hrsg. v. H-W. Neudorfer u. E. J. Schnabel, Wuppertal, 2000.<br />
b) Roland Deines: Kap. 5: Historische Analyse I. Die jüdische Umwelt in: Das Studium<br />
des NT, Bd. 1, Wuppertal, 1999.<br />
7) Ludwig Schnei<strong>der</strong>: Schlüssel zur Thora – Rabbinische Gedanken zu den 54 Thora-<br />
Wochenlesungen.<br />
8) Hermann L. Strack: Einleitung in Talmud und Midrasch, Beck’sche Verlagsbuchhandlung,<br />
München, 6 1976: Kapitel XI: <strong>Hermeneutik</strong> des Talmuds u. <strong>der</strong> Midraschim.<br />
9) Hermann L. Strack und Paul Billerbeck: Kommentar zum NT aus Talmud und Midrasch,<br />
C.H.Beck, München, 1924 ff.<br />
Midrasch<br />
Midrasch bedeutet die Auslegung <strong>der</strong> Tenach (39 kanonischen Bücher), vor allem aber<br />
<strong>der</strong> Thora.<br />
Das Wort „Midrasch“ kommt vom hebr. Wort „darasch“, das „suchen, fragen“ bedeutet.<br />
Esra 7,10: „das Gesetz Gottes erforschen“ („darasch“ : vrd ).<br />
Jes. 34,16: „im Buch Gottes nachforschen“ („darasch“).<br />
Das Substantiv „Midrasch“ kommt in <strong>der</strong> Bibel nur in zwei späten Stellen vor: nach<br />
2.Chron. 13,22 ist die Geschichte Abijas „aufgezeichnet im Midrasch des Propheten<br />
Iddo“ (vr:Þd>miB.). 2.Chron. 24,27 spricht vom „Midrasch zum Buch <strong>der</strong> Könige.“<br />
Die genaue Bedeutung von Midrasch in den genannten Bibelstellen ist nicht ganz sicher.<br />
Ist einfach ein „Buch“ o<strong>der</strong> ein „Werk“ gemeint (so übersetzen Septuaginta und Vulgata:<br />
„biblion“; „graphe“, bzw. „liber“)? O<strong>der</strong> meint hier <strong>der</strong> Chronist doch schon im späteren<br />
28
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Sinn eine „Auslegungsschrift“, etwa einen erbaulichen Kommentar zur<br />
Königsgeschichte?<br />
Sir. 51,23 ist <strong>der</strong> erste Beleg für „bet midrasch“ (Lehrhaus); ein direkter Bezug auf das<br />
Studium <strong>der</strong> Bibel scheint darin aber noch nicht eingeschlossen. Erst in <strong>der</strong> rabbinischen<br />
Zeit steht „Midrasch“ für „Forschung, Studium“. In diesem Sinne ist dann auch vom „bet<br />
hamidrasch“ (Lehrhaus) die Rede. Der Ort war vor allem die Synagoge.<br />
Je<strong>der</strong> Buchstabe <strong>der</strong> Thora hat seine Bedeutung<br />
Gegenstand <strong>der</strong> Auslegung ist die Thora. Die Thora ist Wort für Wort von Gott<br />
eingegeben. Gott ist ein absolut kompetenter Sprecher. Es gibt daher in diesem Text<br />
nichts zufällig Geschriebenes, keine belanglose Redeweise, j e d e s sprachliche<br />
Z e i c h e n darin ist b e d e u t u n g s h a l t i g und entspricht einer Intention, die durch<br />
Auslegung zu erheben ist.<br />
Dazu ein Exempel von Martin Buber:<br />
Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde! Es klingt wie ein einziger Bogenstrich, und müßig<br />
ist es zu fragen, ob dem Schöpfer Himmel o<strong>der</strong> Erde mehr am Herzen liegt. Himmel und<br />
Erde zusammen ist das eine Werk, das er gemacht hat.<br />
Das demonstriert Martin Buber, indem er eine jüdische Tradition aufnimmt. Diese<br />
Überlieferung sagt, dass <strong>der</strong> erste Buchstabe <strong>der</strong> Bibel, das Bet im ersten Wort<br />
von Gen 1,1 „Bereschit“ (im Anfang) zugleich die Zahl 2 darstellt.<br />
Bet hat im hebräischen Schriftzeichen zwei horizontale Linien, die mit einer vertikalen Linie<br />
verbunden sind.<br />
Die zwei übereinan<strong>der</strong> liegenden Linien wollen die Zweidimensionalität des biblischen<br />
Zeugnisses, die unsichtbare Welt (die obere Linie) und die sichtbare Welt (die untere Linie)<br />
veranschaulichen. Himmel und Erde sind durch eine vertikale Linie verbunden.<br />
Der Mensch ist nach Gottes Schöpfungsordnung Bürger bei<strong>der</strong> Welten, <strong>der</strong> einen Schöpfung<br />
Gottes. Himmel und Erde werden nach <strong>der</strong> Bibel wohl unterschieden, aber nicht geschieden.<br />
Diese Zweidimensionalität ist die Grundlage hebräischer Anthropologie. Danach findet <strong>der</strong><br />
Mensch sein Selbstverständnis nur in unlöslichem Bezug zur Transzendenz.<br />
Die Rabbinen gehen vom Grundsatz aus, dass je<strong>der</strong> Bibeltext einen v i e l f a chen Sinn<br />
enthält, infolgedessen auch verschiedene Auslegungen gleich richtig sein können:<br />
„Eine Bibelstelle hat mehrere Bedeutungen“ (Sanhedrin 34a).<br />
Es gibt daher keinen Anspruch einer bestimmten Auslegung auf ausschließliche Geltung!<br />
Die Rabbinen korrigieren, erweitern, erneuern und ergänzen ihre Kommentare<br />
gegenseitig.<br />
Das tun die Qumraner nicht. Denn nach den Qumranern beruht <strong>der</strong> Kommentar auf<br />
Offenbarung.<br />
b<br />
29
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Gesetzliche und erbauliche Auslegung<br />
Prinzipiell ist im Midrasch zwischen halakhischer und haggadischer Auslegung zu<br />
unterscheiden:<br />
Halakhische (Halakh: <strong>der</strong> Weg) Auslegung hat das Gesetz als Gegenstand. Das Gesetz<br />
wird erklärt, ausgelegt und auf das heutige gesellschaftliche Leben angewandt. Das wird<br />
bis heute so in Israel durchgeführt. Man spricht auch vom Religionsgesetz, das auf die<br />
Thora aufbaut.<br />
Die haggadische (erzählende) Auslegung umfasst die erbauliche, ermunternde,<br />
ermutigende, ermahnende Erklärung <strong>der</strong> Thora.<br />
P e schat und D e rasch<br />
P e schat umfasst die „einfache“, klare Bedeutung des Textes. Es geht um die wörtliche,<br />
buchstäbliche Auslegung (Literalsinn).<br />
D e rasch bezeichnet eine Auslegung, die in einem Text eine verborgene Bedeutung finden<br />
will (Allegorie).<br />
Beide Auslegungsmethoden zusammengefasst ergeben eine biblisch orientierte<br />
Sichtweise, denn beides kommt in <strong>der</strong> Bibel vor. Jede Auslegungsmethode für sich kann<br />
aber auch bei manchen Exegeten zu Extremen führen:<br />
Im P e schat kann eine seitenlange Exegese über einen Buchstaben erfolgen. In diese<br />
übertriebene Kategorie würde auch <strong>der</strong> Bibelcode gehören.<br />
Aber auch im D e rasch kann es gerade beim Allegorisieren zu Übertreibungen kommen.<br />
Auslegungstechniken<br />
Im Laufe <strong>der</strong> Zeit haben sich bei den Rabbinen Regeln („Middoth“) entwickelt. Einige<br />
davon sind auch in <strong>der</strong> evangelischen <strong>Hermeneutik</strong> bekannt.<br />
Hillel kannte 7 Regeln:<br />
Unter an<strong>der</strong>em spricht er von mehreren Bibelstellen, die inhaltlich zusammengehören,<br />
von <strong>der</strong> „Familie“ (also: Parallelstellen sammeln und bei <strong>der</strong> Auslegung<br />
berücksichtigen).<br />
O<strong>der</strong>: Näherbestimmung des Allgemeinen durch das Beson<strong>der</strong>e (induktive Methode).<br />
O<strong>der</strong>: Analogie (Stellen mit ähnlichem Inhalt suchen).<br />
O<strong>der</strong>: Berücksichtige den Kontext.<br />
Rabbi Jischmael entwickelte 13 Middoth:<br />
Wenn zwei Verse sich angeblich wi<strong>der</strong>sprechen, dann soll man einen dritten zur Klärung<br />
hinzunehmen: In Ex. 12,5 heißt es, dass man Schafe und Ziegen für das Passah wählen<br />
soll. In Deut. 16,2 heißt es dann, dass man vom Kleinvieh und vom Rindvieh (rq"+b'W<br />
!acoå) etwas schlachten soll. Soll man also Rin<strong>der</strong> für das Passahfest wählen. Nun kommt<br />
30
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
die klärende dritte Stelle hinzu: Ex. 12,21: „Auf, verschafft euch Kleinvieh (!aco±) für<br />
eure Familien und schlachtet Passah.“<br />
Die 32 Middoth:<br />
Schließlich bildeten sich 32 Auslegungsregeln heraus, die angewendet wurden. Nicht alle<br />
Rabb. aber benutzen sie regelmäßig. Manche haben ihre eigene Auslegung.<br />
Einige dieser Regeln lauten:<br />
� Wenn eine Aussage in <strong>der</strong> Thora nicht eindeutig ausgesprochen wurde, dann werden<br />
die Schriften und Propheten hinzugezogen.<br />
� Bedeutungsvoller Gebrauch eines Ausdrucks, z. B. Mal. 2,16 „Der Gott Israels“.<br />
Dieser Ausdruck kommt bei den nachexilischen Propheten Haggai, Sacharja und<br />
Malechi ansonsten nicht mehr vor.<br />
� Eine Aussage ist in Bezug auf einen Gegenstand gemacht, gilt aber auch für einen<br />
an<strong>der</strong>en: Ps. 97, 11: Licht und Freude sind identisch.<br />
� Etwas ist mit zwei Dingen verglichen, und man legt ihm nur die guten Eigenschaften<br />
bei<strong>der</strong> bei: Ps 92,13, wo <strong>der</strong> Fromme mit <strong>der</strong> fruchtbringenden (aber schattenlosen)<br />
Palme und <strong>der</strong> schattigen (aber keine genießbaren Früchte bringenden) Ze<strong>der</strong><br />
verglichen wird.<br />
� Weiter: Zerlegung eines Wortes in zwei o<strong>der</strong> mehr. Deutung <strong>der</strong> einzelnen<br />
Buchstaben.<br />
� Weiter: Zahlensymbolik hat ihre Bedeutung.<br />
� Kleine Partikel wie „nur“ weisen auf Einschränkung, Ausschließung o<strong>der</strong><br />
Vermin<strong>der</strong>ung hin. In Gen. 7,23 heißt es, dass n u r Noah übrig blieb. Wenn also die<br />
ganze Menschheit umkam, aber nur Noah und seine Familie gerettet wurden, dann ist<br />
er wahrscheinlich nicht ungeschoren davon gekommen. Die Partikel „nur“ weise<br />
darauf hin. Aber was hat Noah denn an seinem Körper abbekommen? Nun die<br />
Rabbinen haben die Antwort: Noah hat einem Löwen in <strong>der</strong> Arche nicht rechtzeitig<br />
die Nahrung gereicht und sei daher von ihm gebissen worden.<br />
31
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Die verschiedenen Voraussetzungen zwischen jüdischer und christlicher <strong>Hermeneutik</strong>:<br />
Judentum<br />
Thora<br />
Talmud<br />
Christentum<br />
AT<br />
NT<br />
32
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
III. Synchrone und diachrone Lektüre<br />
Es gibt zwei Möglichkeiten, biblische Bücher des Alten o<strong>der</strong> Neuen Testaments zu lesen,<br />
nämlich synchron (einheitlich) o<strong>der</strong> diachron (uneinheitlich, querbeet). 42<br />
Bei <strong>der</strong> synchronen Lektüre wird das Buch als Ganzes durchgelesen und als eine Einheit<br />
in <strong>der</strong> Botschaft und in den theologischen Aussagen betrachtet. Die Verkündiger, die<br />
Vertreter einer heilsgeschichtlichen Theologie, die Dogmatiker, die sich für die<br />
Gotteslehre o<strong>der</strong> für die Christologie im Buch Jeremia interessieren, sind auf ein<br />
synchrones Studium angewiesen. Prophetische, heilsgeschichtliche und eschatologische<br />
Aussagen werden nämlich durch die diachrone Methode in Frage gestellt.<br />
Einleitungswissenschaftler und manche Exegeten aber verwenden bei ihren Forschungen<br />
die diachrone Methode.<br />
Die diachrone Lektüre vergleicht biblische Texte miteinan<strong>der</strong>, und zwar innerhalb des<br />
alttestamentlichen Buches, dann mit den übrigen Büchern des Alten Testamentes und<br />
schließlich auch mit außerblichen Texten (intertextuale Lektüre). Daran ist nichts<br />
auszusetzen. Solche Vergleiche können sogar zum Verstehen eines Abschnittes hilfreich<br />
sein.<br />
Aber viele Einleitungswissenschaftler und Exegeten benutzen die diachrone Methode<br />
unter kritischen Voraussetzungen.<br />
Die Annahme verschiedener Quellen mit unterschiedlicher Verfasserschaft beruht auf <strong>der</strong><br />
Basis <strong>der</strong> „diachronen Lektüre“ des Jeremiabuches. Einzelne Abschnitte werden<br />
nämlich miteinan<strong>der</strong> verglichen. Es wird die Frage gestellt, ob dieser o<strong>der</strong> jener<br />
Abschnitt in die Zeit des Propheten passt o<strong>der</strong> ob er nicht besser diachron zu behandeln<br />
wäre und von daher später zu datieren sei. Aussagen des Propheten über das Gesetz<br />
werden z. B. mit dem Deuteronomium verglichen. Sobald sogenannte<br />
deuteronomistische Aussagen im Jeremiabuch gefunden werden (vielleicht aus <strong>der</strong><br />
Anfangszeit des Propheten um 620 v. Chr.), werden sie dem Jeremia abgesprochen und<br />
diese Abschnitte werden später datiert, denn das gesamte deuteronomistische Werk ist<br />
erst exilisch, nachexilisch. Das ist diachrones, kritisches Studium.<br />
Bei <strong>der</strong> diachronen Lektüre achtet <strong>der</strong> Forscher auf eventuelle literarkritische,<br />
traditionsgeschichtliche und redaktionsgeschichtliche Elemente, die im Buch<br />
vorkommen könnten.<br />
Historizität und Authentizität (Echtheit und Wahrhaftigkeit) sind <strong>der</strong> „diachronen<br />
Methode“ untergeordnet.<br />
Die Propheten aber des Alten Testaments treten im Namen Gottes auf, <strong>der</strong> beschworen<br />
hat, dass er nicht lügt. Sie treten in <strong>der</strong> Autorität Gottes auf und sie verkündigen das Wort<br />
des HERRN, nicht ihr eigenes Wort. Jeremia wäre sicherlich nicht bereit gewesen, wegen<br />
42 Vgl. Erich Zenger in seinem Vorwort von 1995 zu seinem Werk: Einleitung in das AT, 6 2006, 9.<br />
33
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
„seinem Wort“ in die Schlammgrube geworfen zu werden. Die Propheten verkündigen<br />
nicht sich selbst, son<strong>der</strong>n das Wort des HERRN. Das Wort des HERRN aber ist<br />
zuverlässig, historisch gültig, authentisch und wahrhaftig. Gottes Zusagen und<br />
Voraussagen erfüllen sich. Gerade in den prophetischen Büchern treffen Historizität und<br />
Prophetie/Eschatologie aufeinan<strong>der</strong> o<strong>der</strong> sie sind ineinan<strong>der</strong> verwoben. Geschichtliche<br />
Ereignisse sind von Wun<strong>der</strong>n umrahmt. Gerade dieses Ineinan<strong>der</strong> von Historizität und<br />
Offenbarung macht aus dem Buch <strong>der</strong> Bücher die Bibel, das Wort Gottes. Es ist und<br />
bleibt ein schwieriges Unterfangen, will man stets Historizität und Offenbarung<br />
voneinan<strong>der</strong> trennen. Man bewegt sich auf dünnem Eis. Denn da, wo die Historizität in<br />
Frage gestellt wird, wird auch die Offenbarung eliminiert. Und da, wo die Offenbarung<br />
eliminiert wird, wird auch schließlich <strong>der</strong> Glaube eliminiert.<br />
Diachrone Lektüre auf <strong>der</strong> Grundlage von Historizität und Authentizität ist m. E.<br />
möglich, denn die biblischen Ereignisse sind durch archäologische Zeugnisse bestätigt<br />
worden und Gott selbst hat sein Wort bestätigt, indem prophetische Vorhersagen<br />
wortwörtlich in Erfüllung gegangen sind.<br />
34
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
IV. Kritische Ansätze in <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong><br />
1. Die historisch-kritische Methode (HKM)<br />
1) Definition<br />
Die historisch-kritische Methode (HKM) betrachtet die Bibel primär wie ein ganz<br />
gewöhnliches profanes, literarisches Werk, welches mit rein geschichtlich-literarischen<br />
Methoden gelesen und unter kritischer Einstellung ausgelegt werden muss. Offenbarung<br />
und Inspiration treten zurück o<strong>der</strong> werden sogar ganz aufgegeben.<br />
Klaus Haacker konstatiert: „In diesem Bereich geht es um die Prüfung berichten<strong>der</strong> Texte<br />
auf die Richtigkeit ihrer Angaben hin und somit auch um die ‚Kritik‘ = kritische<br />
Untersuchung <strong>der</strong> biblischen Geschichtsentwürfe im großen und ganzen.“ 43<br />
Haacker weiß, dass genau an dieser Stelle die historisch-kritische Wissenschaft sich von<br />
<strong>der</strong> dogmatischen Bibelwissenschaft trennt, die keine historischen Irrtümer in <strong>der</strong> Bibel<br />
gelten lassen will und mit <strong>der</strong> Inspiration aller 66 kanonischen Bücher rechnet. 44<br />
2) Ziel<br />
„Als Leitmethode wissenschaftlicher Bibelauslegung bemüht sich die historisch-kritische<br />
Exegese zu ermitteln, welchen Sinn ein biblischer Text zur Zeit seiner Abfassung hatte.<br />
Sie berücksichtigt dabei, dass sich dieser Sinn durch Erweiterungen und Verän<strong>der</strong>ungen<br />
gewandelt haben kann.“ 45 Die historisch-kritische Forschung rechnet mit langen<br />
mündlichen Überlieferungsprozessen, in denen Botschaften, Geschichten und<br />
Erzählungen oft verän<strong>der</strong>t, revidiert und ergänzt worden seien.<br />
Der historisch-kritischen Methode geht es also vor allem darum, den Entstehungsprozess<br />
<strong>der</strong> biblischen Texte nachzuzeichnen. Das ist ein äußerst schwieriges Unterfangen, da die<br />
meisten Texte nichts über ihre Entstehung aussagen. Anscheinend war die<br />
Überlieferungsgeschichte den Verfassern nicht so essentiell wichtig. Ihnen ging es wohl<br />
eher darum, den Inhalt <strong>der</strong> Botschaft so zu vermitteln, dass je<strong>der</strong> Leser Gottes Nachricht<br />
erhält. Die nachgezeichneten Entstehungsprozesse <strong>der</strong> historisch-kritischen Forschung<br />
sind oft sehr komplex, hypothetisch, literaturwissenschaftlich trocken und undurchsichtig<br />
und vom Leser we<strong>der</strong> zu evaluieren noch zu verifizieren. Dazu kommen<br />
Forschungsergebnisse aus annähernd zwei Jahrhun<strong>der</strong>ten mit einer unübersichtlichen<br />
Datenfülle von Forschern, die sich zudem nicht zu wenig kontradiktorisch<br />
wi<strong>der</strong>sprechen. 46<br />
43 2<br />
Klaus Haacker: Neutestamentliche Wissenschaft, Wuppertal, 1985, 20.<br />
44<br />
Ders., ebd.<br />
45<br />
Joachim Vette (Februar 2008) in WiBiLex, Artikel: „Bibelauslegung, historisch-kritisch“. Download<br />
vom 12.August 2010.<br />
http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/dasbibellexikon/details/quelle/WIBI/referenz/15249/cache/76c<br />
035fac5ff416de91ae2a64b557d20/<br />
46<br />
Das gesteht auch Joachim Vette ein: „Zu den Kritikpunkten gehört die Vernachlässigung des Textes in<br />
seiner Jetztgestalt, mangelnde methodische Interaktion mit an<strong>der</strong>en theologischen Disziplinen jenseits des<br />
eigenen Fachbereichs, eine schier unübersehbare Fülle unterschiedlicher Hypothesen zur Textentstehung<br />
und die Spannung zwischen <strong>der</strong> Anwendung vermeintlich objektiver Methoden und dem subjektiven Urteil<br />
35
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
In diesem Sinne kommt schon Ulrich Körtner zu <strong>der</strong> Feststellung: „An den Universitäten<br />
ist sie weiterhin unangefochten. In <strong>der</strong> kirchlichen und religionspädagogischen Praxis<br />
aber wird ihr Nutzen durchaus in Frage gestellt. … Im Kern lautet die sich formierende<br />
Kritik an <strong>der</strong> historisch-kritischen Exegese, dass sie dem Bedeutungsverlust <strong>der</strong> Bibel<br />
Vorschub leistet.“ 47<br />
3) Das Wesen <strong>der</strong> HKM<br />
Sie stellt biblische Texte auf dieselbe Stufe wie die profanen Texte. Dadurch verliert<br />
die Hl. Schrift ihre Autorität, ihren Offenbarungscharakter und ihre Inspiration.<br />
Sie lehnt die Inspiration (Verbalinspiration) ab. Dadurch werden biblische Texte zu<br />
literarischen Texten, von Menschen geschrieben, die nicht bei <strong>der</strong> Nie<strong>der</strong>schrift durch<br />
den Geist Gottes geleitet wurden.<br />
Damit leugnet sie die Göttlichkeit des Wortes Gottes.<br />
Sie stellt die zuverlässige Historizität <strong>der</strong> Bibel in Frage. Historizität muss<br />
wissenschaftlich verifizierbar sein. Wun<strong>der</strong>, Theophanien (Gotteserscheinungen),<br />
Engelserscheinungen und Prophetien werden in diesem Sinne angezweifelt.<br />
4) Ausgangspunkt<br />
Geburtsort <strong>der</strong> HKM ist die autonome Vernunft (Aufklärung). Alles, was <strong>der</strong><br />
Vernunft wi<strong>der</strong>spricht, muss angezweifelt werden (Wun<strong>der</strong>, Theophanien, Engel,<br />
Prophetie, Eschatologie).<br />
Der Historismus im 19. Jahrhun<strong>der</strong>t. Texte werden in ihrem historischen Kontext<br />
untersucht. Die Botschaft des Textes tritt in den Hintergrund.<br />
Die Bibel wird nicht pneumatisch (durch dem HI. Geist), son<strong>der</strong>n rationalistisch und<br />
empirisch ausgelegt. 48<br />
5) Entstehung <strong>der</strong> HKM<br />
Johann Salomo Semler<br />
Vater <strong>der</strong> HKM ist Johann Salomo Semler 49 (1725-1791). Er leugnet Inspiration und<br />
trennt HI. Schrift vom Wort Gottes: Jesu Historizität wäre nicht zu leugnen. Er ist <strong>der</strong><br />
Retter <strong>der</strong> Sün<strong>der</strong> und Zöllner. Die Jungfrauengeburt aber wäre von <strong>der</strong> späteren<br />
Gemeinde erfunden worden, um die Göttlichkeit Jesu zu beweisen.<br />
Semler kennt nur einen Zugang zur Bibel: Die Geschichte. Er vergleicht alle biblischen<br />
des jeweiligen Auslegers.“ Quelle: WiBiLex: Art. „Bibelauslegung, historisch-kritisch“ (Februar 2008),<br />
a.a.O. Vgl. dazu auch die unüberschaubaren Ergebnisse <strong>der</strong> Pentateuchforschung: Erich Zenger: „Die<br />
Bücher <strong>der</strong> Thora / des Pentateuch“, in: Erich Zenger, Hrsg., Einleitung in das Alte Testament,<br />
Kohlhammer, Stuttgart, 6 2006, 60-187.<br />
47 Ulrich Körtner: Einführung in die theologische <strong>Hermeneutik</strong>, 2006, 97.<br />
48 Dabei bringt man <strong>der</strong> Bibel wenig Vertrauen entgegen. Ein kritischer Geist benebelt so manchen<br />
Ausleger a priori. Dabei tritt selbst Klaus Haacker für mehr Objektivität ein: „Für den Profanhistoriker ist<br />
das Vertrauen in die Quellen so lange Arbeitshypothese, bis gegenteilige Beobachtungen eine Quelle als<br />
unzuverlässig erwiesen haben.“ Klaus Haacker: Neutestamentliche Wissenschaft, a.a.O., 78.<br />
49 Armin Sierszyn: Die Bibel im Griff?, Brockhaus, Wuppertal, 1978, 15 ff<br />
36
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Texte mit <strong>der</strong> damaligen Umwelt. Er leugnet den Zugang zur Schrift über den HI. Geist<br />
und durch Gebet.<br />
Friedrich Schleiermacher<br />
Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher (1768-1834) hat als erster die <strong>Hermeneutik</strong><br />
systematisiert. Seine <strong>Hermeneutik</strong> könnte man als „<strong>Hermeneutik</strong> des Kompromisses“<br />
bezeichnen, denn er versuchte Wissenschaft, Philosophie und die religiöse <strong>Gewissheit</strong><br />
miteinan<strong>der</strong> zu vereinigen. Es gibt also keine explizite Abgrenzung <strong>der</strong> Bibel als Wort<br />
Gottes gegenüber <strong>der</strong> Philosophie und <strong>der</strong> kritischen Wissenschaft. „Historische Kritik<br />
ist, wie für das gesamte Gebiet <strong>der</strong> Geschichtskunde, so auch für die historische<br />
Theologie das allgemeine und unentbehrliche Organon“, schreibt Schleiermacher in <strong>der</strong><br />
zweiten Auflage seiner „Kurze(n) Darstellung des theologischen Studiums…“ von<br />
1830. 50<br />
Seine hermeneutischen Überlegungen hat Schleiermacher in dem Werk „<strong>Hermeneutik</strong><br />
und Kritik“ dargelegt, das nach seinem Tode von Fr. Lücke 1838 in Berlin<br />
herausgegeben wurde.<br />
Zwei Grundsätze sind für die <strong>Hermeneutik</strong> Schleiermachers 51 bindend:<br />
1. Grundsatz: <strong>Hermeneutik</strong> als Kunstlehre<br />
In <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> geht es um die Kunstlehre des Verstehens, die explizit den<br />
Grundsätzen <strong>der</strong> Sprache (Grammatik) und des logischen Denkens folgen muss.<br />
Damit grenzt Schleiermacher sich von <strong>der</strong> „<strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>geburt“ im<br />
Pietismus ab. Die Bibel ist ein gewöhnliches Buch. Die Inspiration <strong>der</strong><br />
neutestamentlichen Verfasser lehnt Schleiermacher ab, weil sie Allgemeingut <strong>der</strong><br />
Kirche ist, d. h. je<strong>der</strong> Christ ist inspiriert. Die Bibel ist so auszulegen wie jede an<strong>der</strong>e<br />
christliche Geschichtsquelle auch (§ 130,2 Glaubenslehre).<br />
2. Grundsatz: psychologisches Verstehen<br />
Biblische Texte müssen in ihrem historischen Kontext und im Blickfeld des Autors<br />
interpretiert werden. Das Alte Testament spielt für Schleiermacher keine Rolle; er<br />
möchte es lieber als Anhang zum Neuen Testament betrachten.<br />
Ernst Troeltsch<br />
Ernst Troeltsch 52 (1865-1923) hat die historisch-kritische Methode weiter geformt. Drei<br />
Grundansätze <strong>der</strong> HKM gibt er:<br />
a) Kritik<br />
Die Bibel muss kritisch gelesen werden, so Troeltsch. Die Kritik stellt die Bibel in<br />
Frage. In <strong>der</strong> „objektiven“ Kritik werden sowohl positive als auch negative Bewertungen<br />
abgegeben. Die historisch-kritische Methode scheut sich nicht davor, die das Wort Gottes<br />
50 Zitat in: P. Stuhlmacher: Vom Verstehen, a.a.O., 146.<br />
51 P. Stuhlmacher: Vom Verstehen, a.a.O., 147f.<br />
52 A. Sierszyn: Die Bibel im Griff, a.a.O., 20 ff<br />
37
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
auch negativ zu beurteilen.<br />
b) Analogie (= Ähnlichkeit)<br />
Alles Geschehene in <strong>der</strong> Bibel muss dem heutigen Geschehen entsprechen (analog sein).<br />
Gibt es heute keine Totenauferstehungen, so gab es sie damals auch nicht. Troeltsch<br />
sprach von <strong>der</strong> „Allmacht <strong>der</strong> Analogie“ 53<br />
c) Korrelation (Wechselwirkung)<br />
Alles Geschehene in <strong>der</strong> Bibel muss eine Parallele zu <strong>der</strong> politischen, sozialen,<br />
kulturellen und religiösen Umwelt haben (Religionsgeschichtliche Methode). Israel stand<br />
in <strong>der</strong> Korrelation zu seinen Nachbarn. Alles scheint Israel von den Nachbarreligionen<br />
übernommen zu haben, die Namen Gottes, die Opferhandlungen, die<br />
Schöpfungsgeschichte, die Sintflutgeschichte.<br />
Das Korrelationsprinzip basiert auf <strong>der</strong> Überzeugung <strong>der</strong> immanenten Kausalität aller<br />
historischen Vorgänge 54 , d. h. alle Ereignisse müssen von <strong>der</strong> Vernunft her und auf<br />
natürlicher Weise erklärbar sein, somit auch Wun<strong>der</strong>, Epiphanien usw.<br />
Damit wird jegliche Offenbarung abgelehnt. Die HKM hat das Ziel, aus dem ewig<br />
geoffenbartem Wort Gottes ein menschlich-irdisches-geschichtliches Buch zu machen.<br />
Erste Anfragen an die HKM:<br />
1) Die HKM behandelt die Bibel als ein fremdes Objekt.<br />
2) Die Ergebnisse führen den Leser in eine Unsicherheit und in Zweifel hinein.<br />
3) Das angestrebte Ziel, den Leser in eine engere Beziehung zur Botschaft <strong>der</strong> Bibel zu<br />
bringen, wird nicht erreicht.<br />
4) Die Erträge <strong>der</strong> HKM sind häufig steril-akademisch und we<strong>der</strong> für Gottesdienst noch<br />
für die persönliche Lebenspraxis brauchbar. 55<br />
„Die Inspiration <strong>der</strong> Bibel als Offenbarung Gottes des Schöpfers und Erlösers beinhaltet<br />
die Erwartung, in den Worten <strong>der</strong> menschlichen Schreiber das Wort Gottes zu hören.“ 56<br />
„Es gibt keine neutrale Beschäftigung mit dem Text <strong>der</strong> Bibel, wenn sie heilige Schrift<br />
ist.“ 57<br />
53 H.-W. Neudorfer / E. J. Schnabel: Das Studium des NT, Bd. 1, Wuppertal, 1999, 24 f.<br />
54 Neudorfer / Schnabel, a.a.O., 25.<br />
55 Neudorfer / Schnabel, a.a.O., 27<br />
56 Neudorfer / Schnabel, a.a.O., 31<br />
57 Neudorfer / Schnabel, a.a.O., 36<br />
38
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
6) Die Methoden <strong>der</strong> HKM<br />
Zu den methodischen Arbeitsschritten <strong>der</strong> HKM vergleiche Jürgen Roloff 58 , Heinrich<br />
Zimmermann 59 o<strong>der</strong> Conzelmann / Lindemann 60 .<br />
6.1. Literarkritik (LK)<br />
Die Literarkritik denkt in großen Bausteinen, aus denen ein Werk zusammengesetzt ist<br />
und sie fragt nach <strong>der</strong> Baugeschichte bis hin zu seiner uns vorliegenden Endfassung. 61<br />
Folgende Stichpunkte gehören zur Literarkritik: Quellen (Quellenscheidung),<br />
Komposition, <strong>Teil</strong>ungshypothesen, Spannungen.<br />
Sie hat das Ziel, „etwaige Phasen in <strong>der</strong> literarischen Herstellung einer Schrift zu<br />
erkennen, sei es in Form von Quellenbenutzung o<strong>der</strong> in Form von nachträglicher<br />
Überarbeitung.“ 62<br />
Dabei wird nicht bedacht, dass durch diese Arbeitsmethode die Einheitlichkeit des<br />
biblischen Wortes zerstückelt wird und dadurch die Intention, die Botschaft verloren<br />
geht.<br />
Das stellt auch Jürgen Roloff fest, wenn er schreibt: „Diese Zuversicht stand hinter <strong>der</strong> klassischen<br />
Literarkritik, <strong>der</strong>en Hauptexponenten Julius Wellhausen und Heinrich J. Holtzmann waren. Sie ging<br />
gleichsam mit dem Seziermesser an die Texte heran, wobei je<strong>der</strong> logische Wi<strong>der</strong>spruch, jede fehlende<br />
Gedankenverbindung, je<strong>der</strong> Unterschied im Sprachgebrauch aufgespürt und zum Indiz für das Vorliegen<br />
verschiedener Quellen gemacht wurde. Ziel <strong>der</strong> Arbeit war nicht das Verständnis des vorliegenden Textes,<br />
son<strong>der</strong>n die Rekonstruktion <strong>der</strong> Quelle, von <strong>der</strong> man sich jene exakte historische Information erhoffte, die<br />
<strong>der</strong> Text in seiner vorliegenden Form schuldig blieb.“ 63<br />
Der Philipperbrief sei eine Briefkomposition aus mehreren Briefen: Brief A (Phil. 4,10-<br />
20); B (1,1-3,1; 4,4-7.21-23) C (3,2-4,3.8f.). 64<br />
Auch die Evangelien schöpften aus verschiedenen Quellen. An die Stelle des Hl. Geistes<br />
als Hauptverfasser setzt man die Quellentheorie. Wer die Quellenscheidung nicht<br />
benutze, sei nicht wert, ein Exeget zu heißen, meint Klaus Koch. 65 Haacker dagegen<br />
gesteht ein, dass die Quellenfrage <strong>der</strong> Synoptiker ein fast unlösbares Problem darstellt. 66<br />
Kritik an <strong>der</strong> Literarkritik:<br />
a) Die Arbeiten beruhen hauptsächlich auf Hypothesen. Für die Quellen und Schichten<br />
gibt es keine externen Hinweise.<br />
b) Können „unterschiedliche Schichten“ nicht auch Ausdrucksformen damaliger Zeit<br />
sein?<br />
58 2 7<br />
Jürgen Roloff: Neues Testament, Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1979 ( 1999), 4 – 45.<br />
59<br />
Heinrich Zimmermann: Neutestamentliche Methodenlehre. Darstellung <strong>der</strong> historisch-kritischen<br />
Methode. Neubearbeitet von Klaus Kliesch, Stuttgart, 7 1982.<br />
60 12<br />
Hans Conzelmann / Andreas Lindemann: Arbeitsbuch zum NT, Mohr Siebeck, Tübingen, 1998<br />
( 14 2004). Erster <strong>Teil</strong>: Methodenlehre, § 1 – 12.<br />
61<br />
Haacker: Neutestamentliche Wissenschaft, a.a.O., 40.<br />
62<br />
Ders., a.a.O., 41<br />
63 2<br />
Roloff: Neues Testament, 1979, 5.<br />
64<br />
Eduard Lohse: Die Entstehung des Neuen Testaments, Ev. Verlagsanstalt, Berlin, 1976, 51<br />
65<br />
K. Koch in J. Roloff, a.a.O., 5<br />
66<br />
Haacker: Neutestamentliche Wissenschaft, a.a.O., 44.<br />
39
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
c) In den Einzelergebnissen <strong>der</strong> Historisch-kritischen Forschung gab es zunehmend<br />
keinen Konsens.<br />
d) Gegenstand je<strong>der</strong> Exegese muss aber zuallererst <strong>der</strong> Text <strong>der</strong> Bibel in <strong>der</strong> Jetztgestalt<br />
sein.<br />
e) Die HKM nimmt die Verfasser und die Historizität zu wenig ernst.<br />
6.2. Die Formgeschichte (FG)<br />
Literatur: Klaus Koch: Was ist Formgeschichte? - Neukirchen-Vluyn, 5 1989 (Kritisches<br />
Standardwerk).<br />
Der Vater <strong>der</strong> alttestamentlichen Formgeschichte (FG) ist Hermann Gunkel (1862 –<br />
1932), eingeführt wurde <strong>der</strong> Begriff aber von Martin Dibelius (1883-1947) im Jahre 1919<br />
mit seinem Buch „die Formgeschichte des Evangeliums.“<br />
Der Untersuchungsgegenstand <strong>der</strong> FG ist <strong>der</strong> „Sitz im Leben“ (Begriffseinführung<br />
erfolgte durch Gunkel). Der „Sitz im Leben“ stellt die Relation dar zwischen dem Autor<br />
(bzw. dem Text, <strong>der</strong> Gattung) und <strong>der</strong> gesellschaftlichen Situation <strong>der</strong> damaligen Zeit<br />
(sozialer Kontext, kultureller Kontext, Gemeindesituation). Texte haben also eine soziale<br />
Funktion.<br />
Vor allem seien viele Formen und Traditionen von <strong>der</strong> Gemeinde Jesu geschaffen<br />
worden. Man rechnet also mit langen mündlichen Überlieferungen. Viele Darstellung in<br />
den Evangelien sind also nicht auf Jesus und auf die damalige Situation von Jesus und<br />
seinen Jüngern zurückzuführen, son<strong>der</strong>n entstammen <strong>der</strong> nachösterlichen<br />
Gemeindebildung. Ort <strong>der</strong> Formung sei <strong>der</strong> Gottesdienst gewesen, wo in <strong>der</strong><br />
Verkündigung Sprüche Jesu durch Zusätze und „wun<strong>der</strong>liche“ Ausschmückungen<br />
erweitert und gestaltet worden wären. Dadurch wird die Echtheit, die historische<br />
Zuverlässigkeit und die Wahrhaftigkeit <strong>der</strong> Evangelientexte in Frage gestellt.<br />
Die Frage <strong>der</strong> Historizität:<br />
Gunkel stellt zu Beginn seines Genesiskommentars die provozierende These auf: „Die<br />
Genesis ist eine Sammlung von Sagen“ (S. XXVI).<br />
„Die Religion Abrahams ist in Wirklichkeit die Religion <strong>der</strong> Sagenerzähler, die sie<br />
Abraham zuschrieben“ (S. LXXIX).<br />
Die Pioniere <strong>der</strong> neutestamentlichen „Formgeschichte“ waren Karl Ludwig Schmidt<br />
(1891-1956), Martin Dibelius (1883-1947) und Rudolf Bultmann (1884-1976).<br />
Nach K. L. Schmidt seien die Evangelien Sammelwerke. Sie bestehen aus einer Anzahl<br />
ursprünglich selbständiger Erzählungen (Traditionen). Von daher seien die<br />
zusammengebastelten Evangelien für eine „Leben-Jesu-Forschung“ unbrauchbar.<br />
Dibelius konzentriert sich auf die vorliegenden Formen in den Evangelien, als da sind:<br />
a) Paradigmen (abgerundete Erzählungen),<br />
b) Novellen (ausschmückende Erzählungen),<br />
40
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
c) Legenden (Geschichten, die die Frömmigkeit, die Heiligkeit und Göttlichkeit des<br />
Helden betonen),<br />
d) Mythen (eine überirdische Person trete handelnd auf),<br />
e) Passionsgeschichte und<br />
f) Paränese (Weisheitssätze, Vergleichssätze, Bildworte, Gebote, ethische<br />
Ermahnungen).<br />
D i e k l a s s i s che F o r m g e s chicht e i s t ü b e r z e u g t , d a s s j ede F o r m etwas<br />
ü b er die Her k u n f t u n d ü b e r d a s A l t e r d es T extes ver r ä t !<br />
Bultmann hat den Rede- und Erzählstoff <strong>der</strong> Evangelien in vier Rubriken eingeteilt:<br />
1) Apophthegmata (Aussprüche Jesu, pointierte Worte, Streit- und Schulgespräche).<br />
2) Herrenworte (Logien Jesu, prophetische, apokalyptische, Gesetzesworte,<br />
Gemein<strong>der</strong>egeln, Gleichnisse).<br />
3) Wun<strong>der</strong>geschichten (Heilungswun<strong>der</strong>, Naturwun<strong>der</strong>, usw.).<br />
4) Geschichtserzählungen und Legenden (Täufergeschichte, Passionsgeschichte,<br />
Ostergeschichten).<br />
Das Beispiel vom Gichtbrüchigen (Mk. 2):<br />
Die Formgeschichte untersucht die soziokulturelle Umwelt (Sitz im Leben) <strong>der</strong> Bibel.<br />
Das sogenannte Herrenwort an den Gichtbrüchigen "dir sind deine Sünden vergeben", stamme wohl von<br />
Jesus. Aber die Heiligungsgeschichte vom Gichtbrüchigen sei eine spätere Erfindung <strong>der</strong> Gemeinde, um in<br />
<strong>der</strong> Verkündigung den Christen sagen zu können, dass Jesus <strong>der</strong> Erretter ist und Sünden vergibt. „Sitz im<br />
Leben“ wäre die Verkündigung innerhalb <strong>der</strong> Gemeinde. Wun<strong>der</strong> werden abgelehnt und man sucht das<br />
Wort Gottes im Wort Gottes.<br />
Kritik an <strong>der</strong> formgeschichtlichen Methode:<br />
1) Die Historizität wird dabei oft in Frage gestellt.<br />
2) Fast jede Form ist polyfunktional und kann von daher nicht (einem Sitz im Leben)<br />
zugeordnet werden.<br />
3) Die Klassifizierung von Gattungen und Formen geschieht nicht selten willkürlich.<br />
4) Die schöpferische Produktivität <strong>der</strong> Urgemeinde ist problematisch, weil<br />
hypothetisch.<br />
5) Zudem rechnet man mit langen und sich verän<strong>der</strong>nden mündlichen<br />
Überlieferungssträngen. Die jüdische mnemotechnische Schultradition wird<br />
ausgeklammert.<br />
Die Kritik von Klaus Haacker an <strong>der</strong> <strong>der</strong> formgeschichtlichen Methode 67 :<br />
Die Jesusüberlieferung als solche ist nicht von <strong>der</strong> Kirche für ihre Bedürfnisse<br />
geschaffen, son<strong>der</strong>n besteht adäquat aus Erinnerungen an Jesus.<br />
67 Haacker: Neutestamentliche Wissenschaft, 56-61.<br />
41
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Die formgeschichtliche Methode kann wohl Gattungen und Formen bestimmen, sie kann<br />
aber keine Auskunft über den geschichtlichen Werdegang dieser und jener Formen und<br />
Gattungen geben. Haacker konstatiert: „Das Verhältnis eines konkreten Textes zu<br />
‚seiner‘ Gattung liefert keine Erkenntnisse über sein relatives Alter und erlaubt auch<br />
keine Rückschlüsse auf seinen ‚Werdegang‘ hin zu <strong>der</strong> uns vorliegenden Form.“ 68<br />
Haacker selbst spricht dann auch lieber von „F o r m k r i t i k “ 69 , um sich von <strong>der</strong><br />
herkömmlichen „Formgeschichte“ abzugrenzen. Die Formkritik hat nicht so sehr den<br />
Autor des Textes im Visier, son<strong>der</strong>n konzentriert sich auf gesellschaftliche Vorgänge und<br />
Verhältnisse des Autors, die ihn ja schließlich beeinflusst hätten. Der Ausleger hat also<br />
nach <strong>der</strong> „Lebenssituation“ des Autors und nach dem ‚Leben in <strong>der</strong> Gemeinschaft‘ zu<br />
fragen. Treten typische, wie<strong>der</strong>kehrende Lebenssituationen auf, so spricht man vom „Sitz<br />
im Leben“.<br />
Typische wie<strong>der</strong>kehrende Situationen haben in den Texten ihre beson<strong>der</strong>en Merkmale<br />
von Einleitungs- o<strong>der</strong> Schlussformeln zum Beispiel. Stimmen mehrere Texte in ihrer<br />
Konstruktion überein, kann man sie einer bestimmten Gattung zuordnen (Erzählung,<br />
Brief, Gleichnis, Fabel, Sage, Mythen, Ätiologien, Apokalypsen).<br />
Kritik an <strong>der</strong> Formkritik<br />
Die bestimmende Lebenssituation des Verfassers entspräche <strong>der</strong> menschlichen Seite <strong>der</strong><br />
Inspiration, d. h. die Verfasser des Neuen Testaments unterscheiden sich in Sprache und<br />
Stil. Auch verwenden sie verschiedene Gattungsformen, wobei mit <strong>der</strong> Echtheit und<br />
Zuverlässigkeit historischer Überlieferung im Rahmen <strong>der</strong> Offenbarungsgeschichte zu<br />
rechnen ist. Aber auch die Autoren sind unabhängig von ihrer gesellschaftlichen<br />
Lebenssituation durch den Hl. Geist inspiriert. Und uns heute interessiert primär, was<br />
dieser Hl. Geist den Verfassern eingegeben hat, welche Botschaft uns heute erreichen<br />
soll. Uns interessiert also vielmehr die Intention des Textes als sein historischer<br />
Werdegang, den man sowieso nur hypothetisch nachzeichnen kann, weil die Daten dafür<br />
fehlen.<br />
6.3. Überlieferungsgeschichte (ÜG)<br />
Definition: Die Überlieferungsgeschichte (ÜG) beschäftigt sich mit <strong>der</strong> mündlichen<br />
Überlieferungsphase bis zur ersten Verschriftung.<br />
Unterschied zwischen <strong>der</strong> Überlieferungsgeschichte und <strong>der</strong> Literarkritik (LK):<br />
ÜG will die mündliche Überlieferungsphase herauskristallisieren.<br />
LK will die schriftliche Überlieferungsphase herausarbeiten.<br />
68 Ders., a.a.O., 61.<br />
69 Ders., a.a.O., 48-52.<br />
42
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Prämisse: Die ÜG rechnet mit langen mündlichen Überlieferungen und damit mit<br />
Umformungs- und Erweiterungsprozessen! Es fanden Wandlungen am Überlieferungsgut<br />
statt.<br />
An die Stelle eines einzelnen Verfassers tritt nun das „Verfasser-Kollektiv“!<br />
Zur Problematik <strong>der</strong> ÜG:<br />
Die Prämissen beruhen auf Hypothesen!<br />
Nicht zu übersehen ist <strong>der</strong> religionsgeschichtliche Aspekt: Das Beson<strong>der</strong>e des<br />
israelitischen Glaubens habe sich in einem langen Prozess entwickelt. Inspiration und<br />
Offenbarung als ein direktes Eingreifen und Handeln Gottes werden in diesem Modell<br />
stark zurückgedrängt. Es wird in einseitiger Weise nur die menschliche Seite bei <strong>der</strong><br />
Entstehung <strong>der</strong> Texte als Zeugnisse des Glaubens wahrgenommen.<br />
6.4. Traditionsgeschichte (TG)<br />
Die Traditionsgeschichte (im Wesen verwandt mit <strong>der</strong> Formgeschichte) untersucht die Perikope<br />
auf „vorgeprägte inhaltliche Stoffe“!<br />
Tradierte Vorstellungen fanden vor <strong>der</strong> schriftlichen Fixierung ihren Nie<strong>der</strong>schlag.<br />
Beispiele für Traditionen im Alten Testament sind die Exodus-, Sinai 70 -, Landnahme-, David-<br />
o<strong>der</strong> Zionstradition.<br />
Diese „Traditionen“ wurden von Generation zu Generation den Kin<strong>der</strong>n weitererzählt und<br />
natürlich geformt, bis sie in <strong>der</strong> Exilszeit (609-639 v. Chr.) ihre schriftliche Fixierung gefunden<br />
haben.<br />
Eine Tradition zeigt sich in <strong>der</strong> Regel an einem „gemeinsamen Wortfeld“ sowie an<br />
„übereinstimmenden charakteristischen Begriffen“ (Leit- und Zentralbegriffe). Außerdem liegt<br />
eine vergleichbare Formulierungsstruktur vor o<strong>der</strong> es findet sich <strong>der</strong> Hinweis auf eine<br />
übernommene Rede- o<strong>der</strong> Denkweise.<br />
Zu den im Neuen Testament aufgenommenen Traditionen gehören unter an<strong>der</strong>em<br />
alttestamentliche Zitate und Anspielungen. Dazu zählen z. B. die christologischen<br />
Hoheitstitel Jesu (Messias, Menschensohn, ...), ferner Begriffe wie „Weltgericht“ (Tag<br />
des HERRN), die Erwählung, das endzeitliche Freudenmahl, <strong>der</strong> Weinberg usw.<br />
Die Traditionsgeschichte ist eng mit <strong>der</strong> Überlieferungsgeschichte verbunden.<br />
70 In Bezug auf die Sinaitradition schreibt G. von Rad: „Ausschlaggebend für das Aneinan<strong>der</strong>- und<br />
Ineinan<strong>der</strong>verwachsen <strong>der</strong> vielen Überlieferungen war vor allem die Gemeinsamkeit ihrer lokalen (Sinai)<br />
und personalen (Mose) Bestimmtheit. So sind am Ende höchst verschiedene Stoffe zusammengekommen<br />
und z. T. völlig asyndetisch aneinan<strong>der</strong>gereiht worden, eben alles, was man in Israel irgendwo und<br />
irgendwann einmal von <strong>der</strong> Sinaioffenbarung hergeleitet hat. So for<strong>der</strong>te es die Auffassung von den<br />
Überlieferungen als von Dokumenten einer Gottesgeschichte“ (Theologie des Alten Testaments, Bd. 1,<br />
München, [1960], 9 1987, 201f.).<br />
43
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
„Tradition“ meint sowohl den Vorgang des Überlieferns (traditio) als auch den<br />
überlieferten Inhalt (traditum).<br />
Die Überlieferungsgeschichte beschäftigt sich mit <strong>der</strong> „traditio“, also mit <strong>der</strong><br />
(mündlichen) Überlieferung, mit dem Werdegang einer Sache.<br />
Die Traditionsgeschichte bearbeitet den „Inhalt“, also das „traditum“.<br />
Die traditionsgeschichtliche Methode setzt umfangreiches theologie-, religions- und<br />
geistesgeschichtliches Wissen und exegetisches Fingerspitzengefühl voraus. Für<br />
Studierende stellt sich diese exegetische Methode daher als schwierig dar.<br />
Natürlich gibt es Linien, Verbindungen, Rückbezüge im Kontext des Alten Testaments.<br />
Aber die Traditionsgeschichte (TG) innerhalb <strong>der</strong> historisch-kritischen Methode ist<br />
vehement kritisch eingestellt. Mit Hilfe <strong>der</strong> TG werden Texte spätdatiert, verschiedene<br />
Verfasser und Überlieferungsstränge angenommen, mit Legenden und Ätiologien<br />
gerechnet und es werden Verbindungen zu den Religionen Kanaans als Ursprungsort<br />
israelischer Theologie gezogen. Unter diesen Voraussetzungen können wir die<br />
Traditionsgeschichte <strong>der</strong> HKM nicht in einer biblischen Offenbarungshermeneutik<br />
übernehmen. Man sollte stattdessen lieber von „Traditionen und kulturellen<br />
Überlieferungen“ sprechen, die übernommen wurden. Es geht also um die<br />
Begriffsdefinition und um die Voraussetzung einer Methode, ob sie unter kritischen<br />
Vorzeichen Verwendung findet o<strong>der</strong> unter offenbarungstheologischen Vorzeichen.<br />
Vergleicht man die Anwendung <strong>der</strong> traditionsgeschichtlichen Methode bei den Liberalen,<br />
dann erkennt man nicht nur den kritischen Ansatz, son<strong>der</strong>n auch das kritische Ergebnis.<br />
Bei <strong>der</strong> Untersuchung von Traditionen spielt eben nicht nur das Alte Testament eine<br />
Rolle, son<strong>der</strong>n auch außerbiblisches (apokryphisches, jüdisches, hellenistisches und<br />
pseudepigraphisches) Schrifttum, das den gleichen Wert hat wie das AT!!! Und das ist<br />
<strong>der</strong> kritische Ansatz. Die Bibel wird auf die gleiche Stufe gestellt wie die<br />
außerkanonische Literatur.<br />
Hinzu kommt, dass die Offenbarung zurückgesetzt wird, denn in Mt. 24 (par.) finden wir<br />
keine Rede Jesu mehr vor, son<strong>der</strong>n lange Überlieferungsstränge, die ihre Traditionen in<br />
<strong>der</strong> jüdischen und hellenistischen Apokalyptik hätten.<br />
Offb. 5 vergleicht Klaus Berger z. B. mit <strong>der</strong> „Pseudo-Johannes-Apokalypse“ und kommt<br />
zu dem Ergebnis, dass in Offb. 5 „ältere, nicht christianisierte Form <strong>der</strong> Tradition<br />
vorliegt“. 71<br />
Ferner schreibt Berger: „Finden sich mehrere außerkanonische Parallelen, so können<br />
<strong>der</strong>en gemeinsame Abweichungen vom kanonischen Text erkennen lassen, wo im<br />
kanonischen Text redaktionelle Zusätze liegen.“ 72<br />
71 Klaus Berger: Exegese des Neuen Testaments, Wiesbaden, (1971), 3 1991, 173<br />
72 Berger, a.a.O., 173 f.<br />
44
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Dieses Zitat von Berger zeigt eindeutig, dass außerbiblische Texte einen höheren<br />
Stellenwert haben als die kanonischen. Von den außerbiblischen Texten werden<br />
Rückschlüsse auf die Entstehung biblischer Texte gezogen.<br />
An an<strong>der</strong>er Stelle vergleicht Berger das Gleichnis vom verlorenen Schaf (Mt. 18,12-14)<br />
mit dem „Thomas-Evangelium“ und kommt wie<strong>der</strong>um zu <strong>der</strong> Konklusion, dass es sich<br />
um gemeinsames Gleichnismaterial handelt. 73<br />
Die pseudepigraphischen Texte gehören nicht mehr zu den verführerischen Texten, die<br />
kontradiktorisch zur Bibel stehen, son<strong>der</strong>n sie stehen in <strong>der</strong> historisch-kritischen<br />
Forschung in einem verwandtschaftlichen Verhältnis, die gemeinsames Traditionsgut<br />
hätten.<br />
Die kritische und unvoreingenommene Verwendung <strong>der</strong> traditionsgeschichtlichen<br />
Methode führt den Exegeten von <strong>der</strong> Authentizität, Wahrhaftigkeit, Autorität und<br />
Zuverlässigkeit biblischer Texte weg. In diesem Sinne streut sie mehr Zweifel als<br />
Glaubwürdigkeit. Sie drängt den Offenbarungscharakter <strong>der</strong> Hl. Schrift zurück.<br />
„Tradition“ ersetzt die „Offenbarung“. Die traditionsgeschichtliche Methode, so wie sie<br />
von <strong>der</strong> historisch-kritischen Forschung verwendet wird, ist äußerst zweifelhaft.<br />
6.5. Redaktionsgeschichte<br />
D e f i n i t i o n : Die Redaktionsgeschichte (Red.G.) nimmt ihren Ausgangspunkt bei den<br />
in <strong>der</strong> Literaturkritik (LK) bestimmten Textschichten und fragt nach <strong>der</strong>en<br />
Zusammenwachsen auf allen Bearbeitungsstufen von <strong>der</strong> ersten Verschriftung bis zur<br />
literarischen Endform.<br />
Voraussetzungen:<br />
Ein bestimmtes religionsgeschichtliches Geschichtsbild wird zugrunde gelegt, mit dessen<br />
Hilfe entschieden werden kann, welche Aussagen in welcher Zeit denkbar sind und<br />
welche nicht.<br />
Klaus Koch schreibt:<br />
„Aber es gibt – außer einigen neutestamentlichen Briefen – kein biblisches Buch, das uns<br />
noch in <strong>der</strong> Gestalt vorliegt, die ihm bei <strong>der</strong> ersten Verschriftung gegeben worden ist!“ 74<br />
Durchbruch erlebte die Red.G. vor allem in den Pentateuchstudien, die das sogenannte<br />
„Deuteronomistische Geschichtswerk“ hervorgebracht hat. Zum Deuterogeschichtlichen<br />
Geschichtswerk gehören das Deuteronomium zusammen mit Josua, Richter, Ruth,<br />
Samuel und Könige. Das Werk sei erst im babylonischen Exil entstanden.<br />
Ebenfalls seien die Schriftpropheten mehrfach redaktionell überarbeitet und erweitert<br />
worden.<br />
73 Berger, a.a.O., 176<br />
74 Klaus Koch: Was ist Formgeschichte. Methoden <strong>der</strong> Bibelexegese, Neukirchen-Vluyn, (1964), 5 1989, S.<br />
73.<br />
45
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Als Begrün<strong>der</strong> <strong>der</strong> neutestamentlichen redaktionsgeschichtlichen (bzw.<br />
redaktionskritischen) Methode gelten für das Lukasevangelium Hans Conzelmann 75 , für<br />
das Markusevangelium Willi Marxen 76 und für das Matthäusevangelium Günther<br />
Bornkamm 77 . Alle drei zusammen entstammen <strong>der</strong> Bultmannschule. Die<br />
redaktionskritische Arbeit 78 sei eine Ergänzung zur formkritischen Fragestellung.<br />
Systematisch wird jetzt zwischen Formkritik und Redaktionskritik unterschieden:<br />
Die Formkritik versucht, die ältesten Traditionsstücke <strong>der</strong> synoptischen<br />
Überlieferungen zu rekonstruieren, die möglicherweise auf Jesus selbst zurückgeführt<br />
werden können. Zugleich will sie zeigen, wie solche authentischen Elemente im Laufe<br />
ihrer im wesentlichen mündlichen Überlieferung verän<strong>der</strong>t und durch neue Stoffe ergänzt<br />
worden sind.<br />
Demgegenüber richtet die R ed ak ti onsk ritik (nach Conzelmann, Marxen und<br />
Bornkamm) das Augenmerk auf die Verarbeitung des Traditionsgutes durch die<br />
Evangelisten und fragt nach den Verän<strong>der</strong>ungen, die <strong>der</strong> Traditionsstoff durch das<br />
Eingreifen <strong>der</strong> Redaktoren erfahren hat sowie nach den hinter dem Redaktionsvorgang<br />
stehenden theologischen Motiven. 79<br />
Es geht bei <strong>der</strong> Redaktionskritik also um die E n d r ed ak t i o n ! Was veranlasste den<br />
Endredaktor, seinen Stoff so auszuwählen, wie er jetzt im kanonischen Text vorliegt?<br />
Welche M o ti ve, vor allem welche theologischen Motive leiteten ihn bei <strong>der</strong> Auswahl?<br />
An dieser Stelle kann man natürlich einige Vergleiche zwischen den Synoptikern ziehen,<br />
da sie oftmals über dieselben Ereignisse berichten, aber unterschiedliche Schwerpunkte<br />
setzen. Lukas z. B. ordnet den Inhalt vor allem heilsgeschichtlich an, Matthäus<br />
messianisch und Markus pragmatisch.<br />
75 H. Conzelmann: Die Mitte <strong>der</strong> Zeit. Studien zur Theologie des Lukas, BHTh 17, Tübingen, 1954<br />
( 9 1993).<br />
76 W. Marxsen: Der Evangelist Markus: Studien zur Redaktionsgeschichte des Evangeliums, FRLANT 67,<br />
Göttingen, 1956 ( 2 1959).<br />
77 G. Bornkamm, G. Barth, H. J. Held: Überlieferung und Auslegung im Matthäusevangelium, WMANT 1,<br />
Neukirchen, 2 1961.<br />
78 Zur neutestamentlichen Redaktionskritik außerhalb <strong>der</strong> Evangelien vgl. H. Zimmermann:<br />
Neutestamentlichen Methodenlehre: Darstellung <strong>der</strong> historisch-kritischen Methode, Stuttgart, 1982 (1978).<br />
79 Klaus Berger räumt allerdings ein, dass eine genaue Scheidung von traditionellen und redaktionellen<br />
Stoffen häufig unmöglich ist (Exegese des NT, 206).<br />
46
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Beurteilung<br />
Natürlich haben die Synoptiker inhaltliche und theologische Schwerpunkte gesetzt. Das<br />
wissen wir aus eigenen Studien heraus und das wissen wir auch schon seit den<br />
Kirchenvätern, die dies herauskristallisiert haben (Eus., h. e., III, 24,7-11; VI,14,7). Dazu<br />
brauchen wir die kritischen Ansätze <strong>der</strong> Redaktionskritik mit ihren Voraussetzungen <strong>der</strong><br />
Formkritik nicht. Denn die Redaktionskritik rechnet we<strong>der</strong> mit <strong>der</strong> Historizität <strong>der</strong><br />
Evangelien noch mit ihrer Wahrhaftigkeit und Zuverlässigkeit.<br />
Folglich lehnt R. L. Thomas 80 die redaktionsgeschichtliche Arbeit kategorisch ab, weil<br />
sie das Vertrauen in den historischen Wert <strong>der</strong> Evangelien zerstört. Thomas spricht lieber<br />
von <strong>der</strong> grammatikalisch-historischen Arbeit an den Evangelien.<br />
Es stellt sich vor allem die Frage, wem denn nun diese „redaktionsgeschichtlichen“<br />
Untersuchungen nützen? Wir können doch den Verfassern nicht mehr die Frage stellen,<br />
weshalb sie diese Elemente in ihrem Evangelium aufgenommen haben und jene nicht!<br />
Sie wurden doch bei <strong>der</strong> Stoffauswahl durch den Hl. Geist geleitet. Der Hl. Geist schreibt<br />
Heilsgeschichte. Die theologischen Schwerpunkte bei den einzelnen Evangelisten sind in<br />
den kanonischen Endtexten zu entdecken und nicht innerhalb von hypothetischen<br />
Quellen, die angeblich benutzt wurden und die überhaupt nicht mehr (o<strong>der</strong> nie)<br />
vorhanden sind (waren).<br />
Verwendung <strong>der</strong> Redaktionskritik in <strong>der</strong> Liberalen Theologie<br />
Klaus Berger stellt die Redaktionskritik nach <strong>der</strong> Arbeitsweise <strong>der</strong> historisch-kritischen<br />
Methode vor. 81<br />
„Kriterium für eine befriedigende redaktionsgeschichtliche Erklärung ist u. a. die<br />
mögliche theologiegeschichtliche und historische Einordnung in das Werden des frühen<br />
Christentums.“<br />
Das bedeutet also wie<strong>der</strong>um, dass die Gemeindesituation während <strong>der</strong> Abfassung <strong>der</strong><br />
neutestamentlichen Schriften (vor allem <strong>der</strong> Evangelien und <strong>der</strong> Apostelgeschichte) eine<br />
wichtige Rolle spielten und somit die Verfasser bei ihrer Nie<strong>der</strong>schrift beeinflusst hätten.<br />
Als Beispiel wird die Endzeitrede aus Mk. 13 vorgelegt. 82 Mk. habe die ganze Tradition<br />
<strong>der</strong> Eschatologie umstilisiert, und zwar auf die Zeit <strong>der</strong> Mission und <strong>der</strong> Gegenwart <strong>der</strong><br />
Gemeinde hin. Die Gemeinde ist von Leiden und Verfolgungen geprägt. Das<br />
apokalyptische Schulmaterial hat Markus für die Gemeinde rezipiert und angeglichen.<br />
80 R. L. Thomas: Hermeneutics of Evangelical Redaction Criticism, JETS 29 (1986), 447-459. Thomas<br />
setzt sich auch kritisch mit den Evangelienkommentaren von Robert H. Gundry, William L. Lane und I.<br />
Howard Marshall auseinan<strong>der</strong>.<br />
81 Klaus Berger, a.a.O., 205-217<br />
82 Vgl. dazu Berger, a.a.O., 210<br />
47
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Man könnte an dieser Stelle von einer markianischen Gemeindetheologie sprechen.<br />
Damit wird die Endzeitrede nicht mehr Jesus selbst zugebilligt, son<strong>der</strong>n sie ist nunmehr<br />
sekundär, erweitert, verän<strong>der</strong>t, bei Markus auch gekürzt und durch die sogenannte<br />
„markianische Gemeindetheologie“ neu geschrieben.<br />
In gleicher Weise geht Walter Grundmann 83 anhand von Mt. 23 vor: Die Mahnrede<br />
(Wehe-Rufe) Jesu über die Pharisäer wurde von Matthäus für die Gemeinde<br />
umgeschrieben! Zur Zeit <strong>der</strong> Abfassung des Evangeliums zwischen 70 und 100 n. Chr.<br />
steht die christliche Gemeinde nämlich in <strong>der</strong> Auseinan<strong>der</strong>setzung mit dem sich in Jabne-<br />
Jamnia neu konstituierenden Judenschaft. Die Weherufe gelten also <strong>der</strong> Judenschaft in<br />
Jabne-Jamnia. Zwar hätte sich ja auch schon Jesus mit den Pharisäern<br />
auseinan<strong>der</strong>gesetzt, aber so vehement wie dies in Mt. 23 geschieht, kann diese scharfe<br />
Konfrontation erst im Gemeindezeitalter geschehen sein. Welche Worte aus Mt. 23<br />
überhaupt noch auf Jesus selbst zurückgehen, bleibt fraglich. Der Zweifel durch die<br />
redaktionskritische Arbeit ist beim Leser gestreut und damit hat sie ihr Ziel erreicht.<br />
Anhand dieser zwei Beispiele (Berger / Grundmann) erkennen wir, wie riskant die<br />
Redaktionskritik seitens <strong>der</strong> liberalen Theologie ist und wohin ihre wohlgemeinten<br />
wissenschaftlichen Studien führen und weshalb starke Grenzen zwischen <strong>der</strong><br />
Redaktionskritik und <strong>der</strong> eigentlichen Arbeit <strong>der</strong> neutestamentlichen Verfasser gezogen<br />
werden müssen. Denn die neutestamentlichen Verfasser hatten das Bedürfnis, die Worte<br />
ihres HERRN und Meisters, dem Messias und dem Sohn Gottes, dem Retter <strong>der</strong> Welt, so<br />
genau wie möglich (Lk. 1,1-4) unter <strong>der</strong> Leitung des Hl. Geistes, <strong>der</strong> sie in alle Wahrheit<br />
leitet (Jh. 14,26), aufzuschreiben, damit Leser und Leserinnen zum lebendigen Glauben<br />
an JESUS kommen können (Jh. 20,31) und diese Berichte eben nicht zu verän<strong>der</strong>n, zu<br />
erweitern, zu verkürzen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Gemeindetheologie anzupassen.<br />
6.6. Die Religionsgeschichte<br />
Die Religionsgeschichte sucht nach Parallelen in <strong>der</strong> Umwelt Israels o<strong>der</strong> auch <strong>der</strong><br />
neutestamentlichen Gemeinde. Dabei wird vor allem die biblische Offenbarung<br />
zurückgedrängt und es wird behauptet, dass das Volk Israel viele religiöse Elemente von<br />
den Nachbarvölkern übernommen hätte.<br />
Die Problematik besteht darin, dass die Texte aus <strong>der</strong> Umwelt zum<br />
religionsgeschichtlichen Vergleich herangezogen werden. Den Texten aus <strong>der</strong> Umwelt<br />
wird mehr Vertrauen entgegengebracht als den biblischen Texten. Wenn die Texte aus<br />
<strong>der</strong> Umwelt etwas an<strong>der</strong>es sagen als die biblischen Texte, dann werden jene aus <strong>der</strong> oft<br />
Umwelt bevorzugt. Das hat damit zu tun, dass sowohl die überlieferungsgeschichtliche<br />
als auch die redaktionsgeschichtliche Methode die biblischen Texte sehr spät datiert.<br />
83 Walter Grundmann: Das Evangelium nach Matthäus (ThHNT), Berlin, 6 1986 (1968), 481 – 483.<br />
48
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Die religionsgeschichtliche Methode geht davon aus, dass die israelitische Religion sich<br />
durch einen langen Entwicklungsprozess aus <strong>der</strong> kanaanitischen Religion<br />
herauskristallisiert habe.<br />
Viele Gesamtdarstellungen alttestamentlicher Forschung erscheinen nicht mehr unter<br />
dem Titel „Theologie des Alten Testaments“, son<strong>der</strong>n unter dem Titel<br />
„Religionsgeschichte Israels“.<br />
In den Evangelien wendet man das Abstraktionsverfahren an: Die Ausscheidung alles<br />
Jüdischen und alles Christlichen aus <strong>der</strong> Jesusüberlieferung soll uns zu den echten<br />
Jesusworten führen, konstatieren Bultmann 84 und Käsemann 85 .<br />
Das lehnt selbst Klaus Haacker ab: „Die Ausscheidung alles Jüdischen und alles<br />
Christlichen aus <strong>der</strong> Jesusüberlieferung führt also nicht zu einem historisch gesicherten,<br />
son<strong>der</strong>n zu einem von vornherein mit Sicherheit unhistorischen Bild von Jesus.“ 86<br />
Zur Begründung seiner Antithese wendet Haacker das Abstraktionsverfahren auf Martin<br />
Luther an:<br />
„Man stelle sich vergleichsweise vor, wir besäßen keine Schriften Martin Luthers und<br />
müssten seine Gestalt und Theologie aus <strong>der</strong> Überlieferung seiner Schüler rekonstruieren<br />
(etwa aus den am besten vergleichbaren Tischgesprächen). Es wäre geradezu lächerlich,<br />
wenn man den ‚echten‘, den ‚historischen‘ Luther nach einem entsprechenden<br />
Subtraktionsprinzip zu rekonstruieren suchte, indem man am überlieferten Lutherbild<br />
sowohl alles Spätmittelalterliche, als auch alles Altprotestantische streichen würde. Es<br />
käme alles an<strong>der</strong>e heraus als <strong>der</strong> Luther, <strong>der</strong> im 16. Jahrhun<strong>der</strong>t gelebt und die<br />
Reformation ausgelöst hat.“ 87<br />
84 1<br />
R. Bultmann: Die Geschichte <strong>der</strong> synoptischen Tradition, Berlin, 1921, 5.Aufl., 222. Vgl. dazu Kl.<br />
Haacker: Neutestamentliche Wissenschaft, a.a.O., 75.<br />
85<br />
Käsemann: Exegetische Versuche und Besinnungen, Bd. I, Göttingen, 1960, 205. Vgl. dazu Kl. Haacker:<br />
Neutestamentliche Wissenschaft, a.a.O., 76.<br />
86<br />
Kl. Haacker: Neutestamentliche Wissenschaft, a.a.O., 76.<br />
87 Ders., a.a.O., 76f.<br />
49
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Struktur <strong>der</strong> HKM<br />
Überlieferungsgeschichte (Suche nach mündlicher Überlieferung) →<br />
Traditionsgeschichte (Inhalt und Geschichte <strong>der</strong> Überlieferung, innerbiblisch und<br />
außerkanonisch) → Literarkritik (schriftliche Fixierungen umlaufen<strong>der</strong> tradierter<br />
Quellen / Formkritik = formgeschichtliche Methode: Sitz im Leben) →<br />
Religionsgeschichte (Einfluss durch die Umwelt) → Redaktionsgeschichte<br />
(Sammlung durch Schüler / Endverfasser / kanonische Endgestalt).<br />
Sind die historisch-kritische Methode und die biblische Offenbarungshermeneutik<br />
vereinbar?<br />
Die historisch-kritische Methode ist von ihrer rationalistischen Herkunft, ihrem<br />
methodischen Ansatz (Gleichwertigkeit <strong>der</strong> Bibel mit außerbiblischen Quellen, bzw. <strong>der</strong>en<br />
Bevorzugung) und vom kritischen Ergebnis her (streut mehr Zweifel als Glauben) nicht<br />
mit einer biblisch-historischen Offenbarungshermeneutik vereinbar!<br />
Hier treffen Rom und Jerusalem, Finsternis und Licht, Rationalismus und Glaube<br />
aufeinan<strong>der</strong>, die unvereinbar sind.<br />
Auch Ulrich Körtner stellt in seiner <strong>Hermeneutik</strong> fest, dass die historisch-kritische<br />
Exegese auch innerhalb <strong>der</strong> wissenschaftlichen Theologie in Frage gestellt wird. 88<br />
Das Ziel verfehlt<br />
88 Körtner: Einführung in die theologische <strong>Hermeneutik</strong>, 2006,78.<br />
50
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Durch die traditionsgeschichtlichen, überlieferungsgeschichtlichen,<br />
religionsgeschichtlichen, formgeschichtlichen und redaktionsgeschichtlichen<br />
Forschungsergebnisse verlieren die Wun<strong>der</strong>, die Offenbarungen Gottes (Theophanien),<br />
die Engelserscheinungen, die Prophetien, einschließlich <strong>der</strong> Eschatologie und die<br />
Heilsgeschichte ihre Authentizität, ihre Glaubwürdigkeit, ihre Echtheit, ihren<br />
außerordentlichen Son<strong>der</strong>status in <strong>der</strong> Weltliteratur und damit ihre eigentliche Intention,<br />
nämlich den Menschen zum Glauben an Gott und sein Wort zu führen (Jh. 20,31).<br />
Das hat bereits Rudolf Bultmann 1927 erkannt, wenn er schreibt:<br />
„Wir mögen uns ja wun<strong>der</strong>n, aber die konkrete Situation ist doch für den Verkündiger<br />
einfach die, dass wenn er auf die Kanzel steigt, ein gedrucktes Buch vor ihm liegt, auf<br />
Grund dessen er verkündigen soll; wie ‚vom Himmel gefallen‘, gewiss: denn seine<br />
historisch-kritisch zu ergründende Entstehung geht ihn offenbar in diesem Momente<br />
nichts an.“ 89<br />
Metanoia <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong><br />
Eine Metanoia <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> ist gefragt, das heißt eine völlige Sinnesän<strong>der</strong>ung, ein<br />
neuer Denkansatz, eine neue hermeneutische, nämlich an <strong>der</strong> Bibel sich orientierende<br />
Methode. Kein Synkretismus, son<strong>der</strong>n ein biblischer Neuansatz. Die biblisch-historische<br />
Offenbarungshermeneutik geht von <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>geburt des Auslegers aus, sie rechnet mit<br />
<strong>der</strong> Inspiration und Autorität <strong>der</strong> Bibel als Wort Gottes, sie rechnet mit Wun<strong>der</strong>n,<br />
Offenbarungen und Prophetien, sie demütigt sich unter dem Wort des redenden und<br />
handelnden Gottes. Sie lässt sich korrigieren. Sich sucht das Gespräch. Sie dient <strong>der</strong><br />
Gemeinde. Erst in diesem Licht <strong>der</strong> Offenbarung und unter <strong>der</strong> Autorität des Heiligen<br />
Geistes kann <strong>der</strong> Ausleger Formen und Gattungen, literarische Beson<strong>der</strong>heiten,<br />
Verfasserschaftsfragen, Traditionen und kulturelle Beson<strong>der</strong>heiten untersuchen.<br />
Beurteilung<br />
89 R. Bultmann: Glauben und Verstehen, Gesammelte Aufsätze, Tübingen, 1933, 100 (Darin <strong>der</strong> Abschnitt:<br />
Zur Frage <strong>der</strong> Christologie, in: Zwischen den Zeiten, V, 1927, 41-69).<br />
51
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Die HKM ist eine rationalistische Arbeitsmethode, wobei die Vernunft und die<br />
Wissenschaft über die Inspiration gestellt werden. Zwar will sie historisch arbeiten, aber<br />
die Geschichtsdarstellung <strong>der</strong> Bibel wird nur zum <strong>Teil</strong> ernst genommen.<br />
Für die HKM ist die Bibel ein Arbeitsbuch, ein Quellenbuch, aber nicht autoritatives<br />
Wort Gottes. 90<br />
Wer <strong>der</strong> HKM den Finger reicht, <strong>der</strong> reicht ihr die ganze Hand, sagt einer <strong>der</strong> Väter <strong>der</strong><br />
HKM. 91<br />
Auch <strong>der</strong> Apostel Paulus weiß um den geistlichen Kampf gegen die menschliche<br />
Vernunft:<br />
"Und mein Wort und meine Predigt war nicht in vernünftigen Reden menschlicher<br />
Weisheit, son<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> Erweisung des Geistes und <strong>der</strong> Kraft, auf dass euer Glaube nicht<br />
auf Menschenweisheit bestehe, son<strong>der</strong>n auf Gottes Kraft" (1.Kor. 2,4-5).<br />
Wer sich auch nur ein wenig auf die rationalistische Arbeitsmethode <strong>der</strong> HKM einlässt,<br />
<strong>der</strong> ist dem Spielball <strong>der</strong> menschlich-gefallenen Vernunft unterworfen. Nicht, dass wir<br />
die Vernunft ganz und gar ausschließen, aber sie muss sich durch Jesus Christus erneuern<br />
lassen durch den HI. Geist und sich ihm unterordnen.<br />
90 Vgl. auch Körtner: Einführung, 2006, 103.<br />
91 E. Troeltsch in A. Sierszyn, a.a.O., 22<br />
52
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
2. Entmythologisierung - Rudolf Bultmann<br />
Rudolf Bultmann wurde am 20.08.1884 in Wiefelstede bei Oldenburg geboren. Der<br />
evangelische Theologe starb am 30.07.1976 in Marburg. Er wurde bekannt durch sein<br />
Programm <strong>der</strong> Entmythologisierung <strong>der</strong> neutestamentlichen Verkündigung. Bultmann<br />
war Professor für Neues Testament in Marburg. Sein Denken wurde durch den<br />
Philosophen Martin Heidegger beeinflusst.<br />
Was ist ein Mythos?<br />
„Mythos ist <strong>der</strong> Bericht von einem Geschehen o<strong>der</strong> Ereignis, in dem übernatürliche,<br />
übermenschliche Kräfte o<strong>der</strong> Personen wirksam sind (daher oft einfach als<br />
Göttergeschichte definiert). Mythisches Denken ist <strong>der</strong> Gegenbegriff zum<br />
wissenschaftlichen Denken. Das mythische Denken führt bestimmte Phänomene und<br />
Ereignisse auf übernatürliche, auf ‚göttliche‘ Mächte zurück.“ 92<br />
Demgegenüber steht das wissenschaftliche Denken, das an Raum und Zeit gebunden ist<br />
und nach Ursache und Wirkung fragt. Das Weltbild <strong>der</strong> Naturwissenschaften ist<br />
geschlossen, d. h. nicht offen für den Eingriff jenseitiger Mächte. Alle Begebenheiten<br />
führt <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>ne Mensch auf sich selbst zurück (S. 182). Er führt es nicht mehr wie <strong>der</strong><br />
Mythos auf den Eingriff dämonischer o<strong>der</strong> göttlicher Mächte zurück. Die<br />
Geschichtswissenschaft z. B. rechnet nicht mit dem Eingreifen Gottes o<strong>der</strong> des Teufels<br />
o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Dämonen. Auch wenn sie heute etwa von Dämonen redet, so ist das nur<br />
bildliche Redeweise (S. 182).<br />
„Der Mythos redet von jenseitigen Mächten, von Dämonen und von Göttern als von<br />
Mächten, von denen sich <strong>der</strong> Mensch abhängig weiß, über die er nicht verfügt, <strong>der</strong>en<br />
Gunst er bedarf, <strong>der</strong>en Zorn er fürchtet“ (S. 183). Der Mensch ist nicht Herr über die<br />
Welt und über sein Leben. Der Mythos bringt damit ein bestimmtes Verständnis <strong>der</strong><br />
menschlichen Existenz zum Ausdruck.<br />
Erste Anfragen<br />
Zwei Bereiche werden hier angesprochen: Auf <strong>der</strong> einen Seite steht die<br />
Religionswissenschaft, die um den Mythos in den Religionen weiß. Auf <strong>der</strong> an<strong>der</strong>en<br />
Seite steht die Geschichtswissenschaft, die das Übernatürliche negiert. Redet Bultmann<br />
als Geschichtswissenschaftler o<strong>der</strong> als Religionswissenschaftler? Wie wie<strong>der</strong>um sollte<br />
ein Theologe reden? Versucht Bultmann etwa alles miteinan<strong>der</strong> in Einklang zu bringen?<br />
Darüber geben die folgenden Zitate Aufschluss.<br />
92 R. Bultmann: Zum Problem <strong>der</strong> Entmythologisierung, in: Hans Werner Bartsch: Kerygma und Mythos.<br />
Diskussionen und Stimmen zum Problem <strong>der</strong> Entmythologisierung, Bd. 2, Hamburg, 1952, 180. Die im<br />
Text angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf den Beitrag Bultmanns: „Zum Problem <strong>der</strong><br />
Entmythologisierung.“<br />
Zur weiteren Vertiefung: Rudolf Bultmann: Glauben und Verstehen. Gesammelte Aufsätze, Tübingen,<br />
1933.<br />
53
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Der biblische Bezug<br />
Die Götter sind mit übermenschlicher Macht begabt. Der Mythos „macht die Götter (o<strong>der</strong><br />
Gott) zu überlegen-gewaltigen Menschen, und er tut das auch wenn er von Gottes<br />
Allmacht und Allwissenheit redet“ (S. 184). Bultmann überträgt nun das griechischmythologische<br />
Denken auf die Bibel!<br />
Was will nun die Entmythologisierung?<br />
„Die Entmythologisierung will die eigentliche Intention des Mythos zur Geltung<br />
bringen“ (S. 184). Mit <strong>der</strong> Intention meint Bultmann die Absicht <strong>der</strong> Erzählung. Was hat<br />
das Mythos dem mo<strong>der</strong>nen Menschen in seiner Existenz zu sagen? Das ist die<br />
exegetische Methode, mit <strong>der</strong> man den Text auslegt. Es geht nicht darum, ob sich das<br />
Wun<strong>der</strong> wirklich so zugetragen hat, es geht darum, was es uns heute noch zu sagen hat.<br />
Damit will Marburger Exeget einen Gegenpol zur rationalistischen <strong>Hermeneutik</strong> des 19.<br />
Jahrhun<strong>der</strong>ts setzen. Er will sagen, dass es den biblischen Texten gar nicht um echte<br />
Historizität geht, son<strong>der</strong>n vielmehr um das Kerygma, um die Verkündigung <strong>der</strong> Botschaft<br />
an den Menschen. Im Kerygma geht es um die Intention, um die Botschaft an sich, nicht<br />
so sehr um historische Fakten.<br />
„Negativ ist die Entmythologisierung daher Kritik am Weltbild des Mythos...“ (S. 184).<br />
„Positiv ist die Entmythologisierung existentiale Interpretation, indem sie die Intention<br />
des Mythos deutlich machen will, eben seine Absicht, von <strong>der</strong> Existenz des Menschen zu<br />
reden“ (S. 184). Diesen Gedankengang hat Bultmann von Heidegger übernommen.<br />
Die existentiale Interpretation nach Bultmann ist eine Methode <strong>der</strong> Auslegung (S. 184).<br />
Tatsächlich wendet Marburger Neutestamentler dieses Modell auf die Bibel an, indem er<br />
sagt: „Die Entmythologisierung <strong>der</strong> biblischen Schriften ist folglich Kritik am<br />
mythologischen Weltbild <strong>der</strong> Bibel“ (S. 184).<br />
„Die entmythologisierende Interpretation will aber ja gerade durch die Kritik die<br />
eigentliche Intention <strong>der</strong> biblischen Schriften zur Geltung bringen“ (S. 184). Die<br />
Entmythologisierung beseitigt durch ihre Kritik am Weltbild <strong>der</strong> Bibel den Anstoß, den<br />
dieses für den mo<strong>der</strong>nen Menschen notwendig bietet (S. 188).<br />
Beispiel: Mk. 2,1-12 (Heilung des Gichtbrüchigen)<br />
Historisch echt ist die Diskussion Jesu mit den Pharisäern um die Sündenvergebung nach<br />
Bultmann. Eingekleidet wird nun diese Begebenheit später durch eine mythologische<br />
Erzählung <strong>der</strong> christlichen Urgemeinde.<br />
Die Aufgabe des Exegeten besteht nun darin, die eigentliche Absicht <strong>der</strong> gesamten<br />
Erzählung herauszuschälen.<br />
1) Zunächst muss festgestellt werden, was mythisch ist und was nicht. Zum Mythos<br />
gehört die Heilung des Gichtbrüchigen. Damit hat man den Text zunächst einmal<br />
„ent-mythologisiert“, das Mythos ist herausgeschält. Dieses Wun<strong>der</strong> von <strong>der</strong><br />
Krankenheilung passt nicht in unser mo<strong>der</strong>nes Weltbild hinein. Man kann es bei<br />
Seite lassen.<br />
54
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
2) Der zweite Schritt besteht in <strong>der</strong> existentialen Interpretation. Worin besteht die<br />
eigentliche Intention (Absicht) des Textes? Antwort: Jesus hat die Vollmacht,<br />
Sünden zu vergeben. Damit spricht <strong>der</strong> Text direkt in unsere heutige Situation hinein,<br />
denn Schuldkomplexe hat je<strong>der</strong>.<br />
3) Was hat <strong>der</strong> entmythologisierte Text uns noch zu sagen? Das ist die Aufgabe <strong>der</strong><br />
Verkündigung (Kerygma). Antwort: Gott rechnet uns unsere Schuld nicht zu.<br />
Fazit<br />
Rudolf Bultmann kommt zum folgenden Fazit: „Glaube ist die Antwort auf die Frage des<br />
je mich anredenden Kerygmas“ (S. 188).<br />
Erste Bewertung<br />
Die Wun<strong>der</strong> <strong>der</strong> Bibel werden rigoros abgelehnt. Man meint damit <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Welt<br />
etwas Gutes getan zu haben, erweist ihr aber einen Bärendienst. Der Glaube entstehe<br />
doch durch die Verkündigung, aber gleichzeitig wird dem Glauben das Fundament<br />
entzogen: die Zuverlässigkeit des Wortes Gottes. Denn auch die Auferstehung Jesu und<br />
damit die ganze Eschatologie verliert ihre Wahrhaftigkeit. Wenn aber Christus nicht<br />
auferstanden ist, dann ist unser Glaube vergebens und dann geschieht auch die<br />
Verkündigung umsonst (1.Kor. 15,14). Bei Bultmann wird <strong>der</strong> Glaube zu einem<br />
immanenten Objekt profaner Religionsphilosophie. Deshalb kam es zu Aussagen wie:<br />
„Ich glaube an das leere Grab“, d. h. ich glaube an das, was ich sehe. Aber: „Ich glaube<br />
nicht an die leibliche Auferstehung Christi.“ So etwas darf es in <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen<br />
naturwissenschaftlichen Welt nicht geben. Das wäre mythologischer Glaube.<br />
Die gemäßigte Kritik<br />
Manche Theologen lehnen zwar den radikalen Ansatz Bultmanns ab, gebrauchen aber<br />
dennoch sein Vokabular. Man versucht den goldenen Mittelweg zu gehen, den es gar<br />
nicht gibt. Bultmann selbst enttarnt diese gemäßigt-kritischen Theologen, wenn er<br />
schreibt:<br />
„Eine Entmythologisierung ist es doch auch – wenngleich eine unklare – wenn Thielicke<br />
die Jungfrauengeburt als ‚Bild <strong>der</strong> geschichtlichen Tatsache <strong>der</strong> Gottessohnschaft‘<br />
bezeichnet (S. 186f.). Gemäßigte Kritik ist Akkomodationstheologie, eine Theologie <strong>der</strong><br />
Angleichung und Anpassung an die Historisch-Kritische Methode und an die<br />
Entmythologisierung Bultmanns.<br />
Beurteilung<br />
Rudolf Bultmann versucht das biblische Weltbild mit dem mo<strong>der</strong>nen in Einklang zu<br />
bringen.<br />
Als Methode dient ihm dabei das Prinzip <strong>der</strong> Entmythologisierung.<br />
Damit überträgt er das griechisch-mythologische Weltbild auf die Bibel, was ohnehin<br />
nicht möglich ist, denn die Bibel beruht auf Offenbarung, die griechische Mythologie auf<br />
Menschenillusionen.<br />
55
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Rudolf Bultmann will den Mythos in <strong>der</strong> Bibel erkennen und das eigentlich Gesagte (die<br />
Intention) herausschälen, so dass die Botschaft im Kerygma für den mo<strong>der</strong>nen<br />
aufgeklärten wissenschaftlichen Menschen wie<strong>der</strong> aktuell wird (existentiale<br />
Interpretation). Der mo<strong>der</strong>ne Mensch glaubt nicht mehr an Wun<strong>der</strong>. Er vertraut einfach<br />
dem Verkündiger, <strong>der</strong> ja Theologie studiert hat und wissen müsse, wie die Bibel in<br />
rechter Weise zu verstehen sei!<br />
Die Folge: Der Glaube wird Diesseitsglaube. Die biblischen Texte werden ihrer<br />
historischen Offenbarungsaussage subtrahiert. Die Bibel wird nicht nur<br />
entmythologisiert, son<strong>der</strong>n letztendlich e n t t h e o l o g i s i e r t . 93<br />
Die neue <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> Bultmannschüler Ebeling und Fuchs<br />
Zu <strong>der</strong> historisch-kritischen Methode fügt Gerhard Ebeling (1912-2001, Tübingen,<br />
Hamburg, Zürich) noch die „Intuition“ hinzu. Der Exeget ist ein Künstler und auf<br />
Eingebung angewiesen. Seine hermeneutische Regel lautet:<br />
„Glaubensaussagen müssen als Situationsaussagen interpretierbar sein.“ 94<br />
Aussagen wie „Sein in Gott, in Christus, Christus eins mit dem Vater, Christus in uns, <strong>der</strong><br />
Hl. Geist nimmt Wohnung in uns“, müssen anhand von den Präpositionen erklärt werden.<br />
Sicherlich spielen Präpositionen innerhalb <strong>der</strong> exegetischen Arbeit eine wichtige Rolle.<br />
Lei<strong>der</strong> sucht aber auch Ebeling den Zugang zur Bibel auf historisch-kritischem Wege zu<br />
finden. Der Hl. Geist ist für ihn entbehrlich. Ebeling schreibt:<br />
Die <strong>Hermeneutik</strong> „hat keine eigene ‚pneumatische‘ o<strong>der</strong> wie immer bezeichnete<br />
Methode <strong>der</strong> Auslegung zur Verfügung, die sich als Methode von <strong>der</strong> Art<br />
unterschiede, wie etwa ein Platotext zu interpretieren ist.“ 95<br />
Nach Ernst Fuchs (1903-1983, Marburg) ist Exegese ein „Vorgang in uns selbst“. 96<br />
Gerade die Texte von Paulus und Johannes treffen uns selbst. Das nennt Fuchs die<br />
‚Existenzdialektik“. Der Anknüpfungspunkt sieht Fuchs in <strong>der</strong> Auslegung bei <strong>der</strong><br />
Sprache. Im Sprachgeschehen, d. h. wenn Jesus o<strong>der</strong> wen Paulus redet, wirkt das Wort in<br />
meine Existenz hinein. Dabei klammert auch Fuchs das Wirken des Hl. Geistes aus. Für<br />
ihn ist Reden Jesu immer nur ein Reden in <strong>der</strong> Vergangenheit. Das Sprachprinzip ersetzt<br />
den Hl. Geist. Für Fuchs ist das Neue Testament wohl Glaubenssprache, aber keine<br />
Offenbarungssprache. Existenzielle Interpretation aber ohne den Hl. Geist ist meines<br />
Erachtens tote Interpretation (vgl. 1.Kor. 2,14).<br />
93 Die Bultmannschülerin Eta Linnemann, die später eine geistliche Umkehr selber erfahren hat, hat von<br />
dem Bultmannschüler Ernst Käsemann kurz vor seinem Sterben erfahren, dass Rudolf Bultmann sich auf<br />
dem Sterbebett bekehrt und seine Studenten um Vergebung gebeten habe. Eta Linnemann: Was ist<br />
glaubwürdig? Die Bibel o<strong>der</strong> die Bibelkritik?, VTR, Nürnberg, 2007, 13.<br />
94 Gerhard Ebeling: Dogmatik und Exegese, ZThK 77/1, 1980, 271 ff., in: Cochlovius / Zimmerling:<br />
Evangelische Schriftauslegung, Wuppertal, 1987, 222-226.<br />
95 Ebeling, ebd.<br />
96 Ernst Fuchs: <strong>Hermeneutik</strong>, Tübingen, 4 1970, 95f., in: Cochlovius / Zimmerling: Evangelische<br />
Schriftauslegung, Wuppertal, 1987, 235-241.<br />
56
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Die gegenwärtige theologische Situation<br />
Zwar spricht man heute wie<strong>der</strong> von Wun<strong>der</strong>n und vom Übernatürlichen. Aber dennoch<br />
ist Bultmanns exegetischer Ansatz nicht überholt. Die historische Faktizität <strong>der</strong> Bibel<br />
wird auch heute in <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen <strong>Hermeneutik</strong> bei Seite gelassen, denn dann müsste man<br />
ja <strong>der</strong> Bibel die Wahrheit zusprechen und Wahrheit ist heute relativ. Der<br />
Entmythologisierungsansatz Bultmanns hat seinen Nie<strong>der</strong>schlag in <strong>der</strong> ökumenischen, in<br />
<strong>der</strong> feministischen und befreiungstheologischen <strong>Hermeneutik</strong> gefunden, eigentlich<br />
überall dort, wo ebenfalls die historische Faktizität und <strong>der</strong> Offenbarungscharakter <strong>der</strong><br />
Bibel aufgehoben wird. Auch wenn <strong>der</strong> Begriff „Entmythologisierung“ nicht mehr in den<br />
Mund genommen wird, so wird <strong>der</strong> hermeneutische Ansatz dennoch praktiziert.<br />
3. Kontextuale <strong>Hermeneutik</strong><br />
Am Ende des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts kamen weitere Auslegungsmethoden hinzu. Die eine ist<br />
die kontextuale.<br />
Kontextuale Bibelexegese besagt, dass man die sozialen, politischen und kulturellen<br />
Fragen, die Menschen heute umtreiben, zur bestimmenden Perspektive <strong>der</strong><br />
<strong>Hermeneutik</strong> erklärt. 97 Man sucht sogleich aus <strong>der</strong> Bibel die Antworten auf sozialpolitische<br />
Fragestellungen o<strong>der</strong> an<strong>der</strong>s ausgedrückt: die Bibel muss dafür erhalten.<br />
Die Befreiungstheologie nennt dies den „hermeneutischen Zirkel“: Wenn <strong>der</strong> Prophet<br />
Amos die Reichen anklagt, weil sie die Armen unterdrücken (Amos 2,6; 4,1; 5,11.12), so<br />
führt man den Zirkel weiter zu den Ureinwohnern Südamerikas, die ausgebeutet und<br />
unterdrückt werden. Die Sache ist zwar richtig, aber <strong>der</strong> Weg ist verkehrt. Denn die Bibel<br />
wird zu einer politischen Charta. Die Bibelexegese wird dazu missbraucht, dass<br />
unterdrückte Völker aufgefor<strong>der</strong>t werden, das Schwert in die Hand zu nehmen – wozu<br />
<strong>der</strong> Weltkirchenrat immer wie<strong>der</strong> insgeheim in Südafrika aufrief.<br />
Kontextuale Bibelexegese gibt es auch in <strong>der</strong> ökumenischen und feministischen<br />
<strong>Hermeneutik</strong>.<br />
97 Peter Beyerhaus: Aufbruch <strong>der</strong> Armen, Bad Liebenzell, 1981, 41.<br />
57
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
4. Ökumenische <strong>Hermeneutik</strong><br />
Quellen:<br />
1) Joachim Cochlovius / Peter Zimmerling, Hrsg.: Evangelische Schriftauslegung – ein<br />
Quellen- und Arbeitsbuch für Studium und Gemeinde, Brockhaus, Wuppertal, 1987:<br />
Beitrag von Reinhard Slencka: Schrift – Tradition, Kontext – die Krise des<br />
Schriftprinzips und das ökumenische Gespräch: S. 424 – 433.<br />
2) Hans Steubing: Bekenntnisse <strong>der</strong> Kirche, Brockhaus, Wuppertal, 1985.<br />
3) Karl Rahner u. Herbert Vorgrimler: Kleines Konzilskompendium – sämtliche Texte<br />
des Zweiten Vatikanischen Konzils: Her<strong>der</strong>, Freiburg i. Br., 1991.<br />
4) Ulrich H.J. Körtner: Einführung in die theologische <strong>Hermeneutik</strong>, WBG, Darmstadt,<br />
2006. § VIII Ökumenische <strong>Hermeneutik</strong>.<br />
Damit eine Verständigung <strong>der</strong> Kirchen erfolgen kann, braucht es eine gemeinsame<br />
Grundlage.<br />
Verschiedenheiten müssen aufgehoben werden, o<strong>der</strong> aber man lässt sie anstehen.<br />
Die unterschiedlichen Konfessionen suchen auch nach einer gemeinsamen <strong>Hermeneutik</strong>.<br />
Grundlage für die <strong>Hermeneutik</strong> ist die Bibel. Und damit fängt die Kontroverse schon an:<br />
Was ist die Bibel? Welche Bedeutung hat sie? Über welche Autorität verfügt sie? Wie<br />
steht es mit dem Umfang des Kanons? Ist sie Gottes Wort o<strong>der</strong> Menschenwort? Gilt sie<br />
nur für das Leben o<strong>der</strong> auch für die Lehre?<br />
Über alle diese Fragen wird es in <strong>der</strong> ökumenischen Diskussion nie einen gemeinsamen<br />
Nenner geben.<br />
Also muss man nach an<strong>der</strong>en Lösungen suchen. Die Bibel darf dabei nicht so eine große<br />
Rolle spielen o<strong>der</strong> gar keine.<br />
Wir sprechen von <strong>der</strong> Krise des Schriftprinzips.<br />
Von daher versucht man den gemeinsamen Nenner nicht in <strong>der</strong> Bibel zu finden, son<strong>der</strong>n<br />
in <strong>der</strong> Geschichte, denn in <strong>der</strong> langen Geschichte <strong>der</strong> Kirchen findet man immer<br />
Gemeinsamkeiten. Man will also die Gemeinsamkeiten finden und Unterschiede bei<br />
Seite lassen.<br />
Die dogmatische Entscheidung weicht dem Prinzip <strong>der</strong> geschichtlichen Entwicklung!<br />
Einfach gesagt: Einheit um jeden Preis, auch wenn biblische Wahrheiten dabei zu<br />
Grunde gehen und mit Füßen getreten werden. Auf <strong>der</strong> 9. Weltmissionskonferenz im<br />
Jahre 1980 in Melbourne (Australien) wurde in <strong>der</strong> Sektion III,22 aufgefor<strong>der</strong>t:<br />
„Wir könnten dabei vielleicht auch entdecken, dass Gott in den Erfahrungen an<strong>der</strong>er<br />
Religionen frische Inspirationen für uns bereit hält.“ 98<br />
98 Peter Beyerhaus: Aufbruch <strong>der</strong> Armen, Bad Liebenzell, 1981, 47.<br />
58
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Dabei müssen in <strong>der</strong> ökumenischen Bewegung die Kirchen nicht ihre Identität aufgeben.<br />
Einheit kann es dennoch geben: „Es gibt viele Kirchen, die Kirchen bleiben und eine<br />
Kirche werden“, sagte vor Jahren Kardinal Josef Ratzinger (Papst Benedikt XVI.).<br />
Aber was müssen die einzelnen Kirchen nicht alles auf dem Weg zur Einheit verwerfen?<br />
Und damit sind wir bei <strong>der</strong> Basis <strong>der</strong> Kirchen angelangt: Es geht um die Bibel.<br />
Schrift und Tradition<br />
In <strong>der</strong> röm.-kath. Kirche spielt die Tradition eine große Rolle.<br />
Zur Tradition gehören die Kirchenväter, Augustin, Thomas von Aquin, die Bekenntnisse,<br />
die Enzykliken.<br />
Was sagt nun die röm.-kath. Kirche zur Tradition (heilige Überlieferung)?<br />
Auf dem 2. Vatikanischen Konzil vom 18. 11. 1965 heißt es in <strong>der</strong> Konstitution „DEI<br />
VERBUM“ (Gottes Wort):<br />
„Die heilige Überlieferung und die Heilige Schrift sind eng miteinan<strong>der</strong><br />
verbunden und haben aneinan<strong>der</strong> Anteil. Demselben göttlichen Quell<br />
entspringend, fließen beide gewissermaßen in eins zusammen und streben<br />
demselben Ziel zu. Die Heilige Schrift ist Gottes Rede, insofern sie unter dem<br />
Anhauch des Heiligen Geistes schriftlich aufgezeichnet wurde. Die heilige<br />
Überlieferung aber gibt das Wort Gottes, das von Christus dem Herrn und<br />
vom Heiligen Geist den Apostel anvertraut wurde, unversehrt an <strong>der</strong>en<br />
Nachfolger weiter, damit sie es unter <strong>der</strong> erleuchtenden Führung des Geistes<br />
<strong>der</strong> Wahrheit in ihrer Verkündigung treu bewahren, erklären und ausbreiten.<br />
So ergibt sich, dass die Kirche ihre <strong>Gewissheit</strong> über alles Geoffenbarte nicht<br />
aus <strong>der</strong> Heiligen Schrift allein schöpft. Daher sollen beide mit gleicher Liebe<br />
und Achtung angenommen und verehrt werden.“<br />
Reaktion <strong>der</strong> protestantischen Kirchen<br />
Man würde erwarten, dass die protestantischen Kirchen sich nun wie<strong>der</strong> an Luthers „sola<br />
scriptura“ (allein die Schrift) erinnern und sich darauf berufen und dass sie neu die 66<br />
Bücher <strong>der</strong> Bibel hoch halten gegen die Apokryphen, die in dem Kanon <strong>der</strong> röm. – kath.<br />
Kirche aufgenommen wurden.<br />
Aber da kann man lange warten. Im Gegenteil:<br />
Die protestantischen Kirchen haben das „sola scriptura“ vergessen, bewusst vergessen, es<br />
aufgehoben, zur Seite gedrängt, es in den tiefsten Ozean versenkt. Sie sind so sehr vom<br />
Rausch <strong>der</strong> Einheit umnebelt, betäubt, befangen, dass sie bereit sind, alle Wahrheiten<br />
aufzugeben, um nur dieses Ziel zu erreichen.<br />
59
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Gerhard Ebeling spricht von <strong>der</strong> „<strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> Konfessionen“. 99 Man will also<br />
nur noch von einer <strong>Hermeneutik</strong> sprechen, <strong>der</strong> alle zustimmen können. Auch hier muss<br />
man dann wie<strong>der</strong> Kompromisse eingehen.<br />
Grundlage für eine gemeinsame <strong>Hermeneutik</strong> ist dann auch nicht mehr die Lutherbibel,<br />
son<strong>der</strong>n die ökumenische Einheitsübersetzung.<br />
Ebeling versucht den gemeinsamen Nenner wie<strong>der</strong>um in <strong>der</strong> Kirchengeschichte zu<br />
finden. Und er konstatiert, dass die vielen Bekenner und Theologen <strong>der</strong> verschiedenen<br />
Kirchen und Konfessionen doch irgend wie immer wie<strong>der</strong> dieselben Wahrheiten erkannt<br />
haben. Gott hat sich doch auch in den verschiedenen Kirchen quer durch die Geschichte<br />
immer wie<strong>der</strong> offenbart: „Insofern gehört die Kirchengeschichte mit zum<br />
Offenbarungsgeschehen.“<br />
Ähnlich geht <strong>der</strong> Bultmannschüler Ernst Käsemann vor, wenn er sagt:<br />
Die Schrift steht nicht mehr gleichzeitig <strong>der</strong> Kirche aller Zeiten gegenüber (!), son<strong>der</strong>n<br />
sie entfaltet sich gewissermaßen in <strong>der</strong> Kirchengeschichte und in <strong>der</strong> Vielfalt von<br />
Kirchen und Konfessionen! 100<br />
Damit steht nicht mehr die Hl. Schrift über die Kirchen, son<strong>der</strong>n sie ist nur noch ein <strong>Teil</strong><br />
<strong>der</strong> Offenbarungen innerhalb <strong>der</strong> Kirchen!<br />
Damit ist die Bibel nicht mehr „norma normens“, also alleinige Norm! Die Bibel hat ihre<br />
Autorität verloren. Sie ist nicht mehr das Fundament.<br />
Weltkonferenz für Glauben und Verfassung in Montreal 1963<br />
Auf <strong>der</strong> 4. Weltkonferenz für Glauben und Verfassung in Montreal 1963 wird dann auch<br />
gar nicht mehr von <strong>der</strong> Bibel als Gottes Wort gesprochen. Für das Wort „Bibel“ setzt<br />
man das Wort „Tradition“ ein. Und man spricht auf <strong>der</strong> Konferenz von T r a d i t i o n<br />
und T r a d i t i o n e n !<br />
Unter Tradition versteht man die Bibel, aber auch die kirchliche Überlieferung. 101<br />
Damit sind die Kirchen <strong>der</strong> röm.- kath. Kirche entgegen gekommen!<br />
Und wie ist die röm. –kath. Kirche den protestantischen Kirchen entgegen gekommen?<br />
Im Jahre 1998 veröffentlichte die Ständige Kommission „Faith and Or<strong>der</strong>“ des Weltrats<br />
<strong>der</strong> Kirchen ihren Entwurf einer ökumenischen <strong>Hermeneutik</strong> mit dem Titel „A Treasure<br />
in Earthen Vessels“ („ein Schatz in irdenen Gefäßen“, 2.Kor. 4,7). 102 Die bisherige<br />
99<br />
Gerhard Ebeling: Wort Gottes und Tradition. Studien zu einer <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> Konfessionen (Kirche<br />
und Konfession, Bd. 7), Göttingen, 1964, 9-27 in: Evangelische Schriftauslegung, hrsg. v. Cochlovius u.<br />
Zimmerling, 1987, 425f.<br />
100<br />
Zusammengefasstes Zitat in: Evangelische Schriftauslegung, hrsg. v. Cochlovius u. Zimmerling, a.a.O.,<br />
426.<br />
101<br />
R. Slenczka: Schrift-Tradition-Kontext, in: Evangelische Schriftauslegung, a.a.O., 427.<br />
102<br />
U. Körtner: Einführung in die theologische Hermenutik,2006, 159-171. Körtner selbst versteht seine<br />
theologische <strong>Hermeneutik</strong> als ein Beitrag zur ökumenischen <strong>Hermeneutik</strong> (Epilog, S. 172).<br />
60
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Schrift- und Dogmenhermeneutik wurde um das Thema einer <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> Symbole,<br />
Riten und Bräuche erweitert. Neben den Begriff <strong>der</strong> Einheit tritt <strong>der</strong> Begriff <strong>der</strong> Kohärenz<br />
(Zusammenhang): Differenzen und Gemeinsamkeiten <strong>der</strong> Konfessionen sollen kohärent<br />
nebeneinan<strong>der</strong> stehen und toleriert werden. Ferner spricht man von <strong>der</strong> „<strong>Hermeneutik</strong> im<br />
Dienst <strong>der</strong> Einheit“. Dabei tritt die Wahrheitsfrage selbstverständlich in den Hintergrund,<br />
denn niemand darf behaupten, dass er im Besitz <strong>der</strong> Wahrheit wäre. <strong>Hermeneutik</strong> im<br />
Dienst <strong>der</strong> Einheit um den Preis <strong>der</strong> Wahrheit, so könnte das Fazit <strong>der</strong> neueren<br />
ökumenischen <strong>Hermeneutik</strong> lauten.<br />
Wechsel <strong>der</strong> Zeiten<br />
Galt in <strong>der</strong> reformatorischen Zeit das „sola scriptura“ zeitlos und bedingungslos, so ist<br />
dieses Bekenntnis heute verloren gegangen. Die Bibel war das geoffenbarte Wort Gottes.<br />
Sie zeigt den Weg zum Leben, denn JESUS ist das Wort Gottes.<br />
Der Mensch wird geboren aus dem Wort Gottes, sagt <strong>der</strong> Apostel Petrus.<br />
Wie will <strong>der</strong> Mensch an JESUS glauben, wenn man die Bibel nicht mehr hat?<br />
Was wir über JESUS wissen, ist uns in <strong>der</strong> Bibel bezeugt.<br />
Wenn die Bibel nicht mehr „norma normens“ ist, dann schmelzen die Worte aus<br />
Joh. 10,11; 11,25; 14, 6; Apg. 4,12 wie Eis dahin.<br />
Wenn die Wahrheit nicht mehr in <strong>der</strong> Bibel zu finden ist, wo dann?<br />
Wer ist dann <strong>der</strong> Weg?<br />
Wenn die historisch – kritische Methode <strong>der</strong> Bibel das Vertrauen entzogen hat (und<br />
Tausende haben dadurch ihr Vertrauen zur Bibel verloren), so hat die ökumenische<br />
Bewegung das „sola scriptura“ aufgehoben. Damit ist die Autorität hinfällig. 103<br />
Wo aber gibt es dann Autoritäten?<br />
Der postmo<strong>der</strong>ne, postaufgeklärte Christ liest wohl noch die Bibel, aber er lebt nicht<br />
mehr nach dieser göttlichen Autorität:<br />
Die rationalistisch-emotionale, situationsbedingte Subjektivität wird zur „norma<br />
normens“, zur alleinigen Autorität.<br />
Wenn <strong>der</strong> emanzipierte Mensch die Wegweisung nicht in <strong>der</strong> Schrift findet, dann in dem<br />
Kollektiv.<br />
Damit vergisst aber <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>ne diesseitsorientierte Mensch, dass es nicht nur die<br />
göttliche Sphäre gibt. Wenn er die Bibel als Autorität verwirft, dann steht er in <strong>der</strong><br />
Gefahr sich an<strong>der</strong>en Autoritäten bewusst o<strong>der</strong> unbewusst hinzugeben.<br />
103 Die Herrnhuter Losungen stehen in <strong>der</strong> Gefahr, den Weg <strong>der</strong> liberalen Anpassung zu gehen: Für den 10.<br />
Sonntag nach Trinitatis gab es zwei Predigtvorschläge, einmal aus Jes. 62, 6-12 und dann auch aus dem<br />
Buch <strong>der</strong> Apokryphen Sirach 36, 13 – 19. Und das Losungswort für den Monat September 2006 stammte<br />
aus Weisheit 15,1. Für die fortlaufende Bibellese kann <strong>der</strong> Leser sich dann für 1. Chronik o<strong>der</strong> für das<br />
apokryphische Buch <strong>der</strong> Weisheit entscheiden.<br />
61
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Wie aktuell klingt doch noch immer das Bekenntnis <strong>der</strong> Barmer Theologischen<br />
Erklärung von 1934:<br />
„Jesus Christus, wie er uns in <strong>der</strong> Heiligen Schrift bezeugt wird, ist das eine Wort<br />
Gottes, das wir zu hören, dem wir im Leben und im Sterben zu vertrauen und zu<br />
gehorchen haben.<br />
Wir verwerfen die falsche Lehre, als könne und müsse die Kirche als Quelle ihrer<br />
Verkündigung außer und neben diesem einen Wort Gottes auch noch an<strong>der</strong>e Ereignisse<br />
und Mächte, Gestalten und Wahrheiten als Gottes Offenbarung anerkennen.“<br />
Fazit<br />
„Wo das kritische Gegenüber von reden<strong>der</strong> Schrift und Hören <strong>der</strong> Gemeinde fehlt, wird<br />
zugleich das Gegenüber von HERR und Gemeinde aufgehoben“, konstatiert <strong>der</strong><br />
Systematiker Reinhard Slencka. Und weiter schreibt er:<br />
„Die Kirche verselbstständigt sich in <strong>der</strong> Geschichtlichkeit ihrer Erscheinung: die<br />
christliche Subjektivität wird zum Selbstzweck und ringt um ihre geschichtliche<br />
Selbstverwirklichung.“ 104<br />
Die biblische Lehre hat damit ihren Auftrag verloren. Es gibt keine Dogmatik mehr. Und<br />
wenn es eine Dogmatik gibt, dann als fließende, sich stets verän<strong>der</strong>nde, sich anpassende<br />
Lehre. Sie wird zur Situationsdogmatik.<br />
Eine ökumenische <strong>Hermeneutik</strong> hat nicht mehr die Bibel als Grundlage <strong>der</strong> Auslegung.<br />
Es gibt kein „sola scriptura“ mehr. Die Basis für eine ökumenische <strong>Hermeneutik</strong> bildet<br />
dann das Konvergenzverfahren, d.h. man sucht zwischen den Konfessionen immer erst<br />
den gemeinsamen Nenner. Welche heiligen Schriften haben die an<strong>der</strong>en? Somit wird <strong>der</strong><br />
K o n t e x t zwischen den Konfessionen zur „norma normens“ (zur neuen Norm <strong>der</strong><br />
Exegese).<br />
Der Schritt zum Kontext <strong>der</strong> Religionen ist nicht mehr fern!<br />
104 R. Slenczka: Schrift-Tradition-Kontext, in: Ev. Schriftauslegung, hrsg. v. Cochlovius u. Zimmerling,<br />
a.a.O., 432.<br />
62
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
5. Feministische <strong>Hermeneutik</strong><br />
Die Bibel sei ein patriarchales Werk. Sie berücksichtige zu wenig das Wesen und das<br />
Bild einer Frau. Deshalb sind alle Texte in <strong>der</strong> Bibel unter „Verdacht“ zu lesen, also mit<br />
einem Vorurteil, eben kritisch. Elisabeth Schüssler Fiorenza spricht deshalb von <strong>der</strong><br />
„<strong>Hermeneutik</strong> des Verdachts“. Die Bibel muss neu interpretiert werden, nämlich unter<br />
dem Gesichtspunkt femininer Aspekte. Feministinnen legen die Bibel feministisch aus, d.<br />
h. sie ersetzen männliche Sprache durch feminine. Auch die feministische Theologie<br />
bedient sich <strong>der</strong> historisch-kritischen Schriftauslegung. Feministinnen ergreifen Partei für<br />
die Frauen in <strong>der</strong> Bibel. Die Frauen in <strong>der</strong> Bibel werden gerne mit einem<br />
emanzipatorischen Mantel umhüllt. Es werden vor allem Frauen als Leitbild genommen,<br />
die selber Leid erfahren haben, stark wurden und die aus eigenem Antrieb in Aktion<br />
getreten sind. Gerne arbeiten feministische Auslegerinnen mit Symbolismen in <strong>der</strong><br />
Bibel, d. h. die historische Echtheit spielt keine Rolle, son<strong>der</strong>n die Intention und diese<br />
ließe sich leichter durch Symbolismen herauskristallisieren.<br />
Lutz von Padberg hat die Regeln einer feministischen <strong>Hermeneutik</strong> kurz zusammen<br />
gefasst:<br />
(1) Grundlage <strong>der</strong> feministischen <strong>Hermeneutik</strong> ist die historisch-kritische Methode.<br />
(2) Die religionsgeschichtliche Methode muss dazu herhalten, dass ältere<br />
Gottesvorstellungen mütterlichen Charakter gehabt hätten. Es wird ein Bezug<br />
hergestellt zu Naturreligionen.<br />
(3) Die kontextuale Methode wird konsequent angewandt, d. h. zeitgenössische Texte<br />
werden gleichberechtigt neben biblische Texte gestellt, und zwar solche<br />
zeitgenössischen Texte, in denen Frauen dieselben leidvollen Erlebnisse gehabt<br />
haben wie zu biblischen Zeiten. Dabei werden einzelne biblische Aussagen,<br />
Begriffe und Texte aus dem Zusammenhang gelöst und mit Ideen und <strong>der</strong> Praxis<br />
des säkularen Feminismus verknüpft.<br />
(4) Der Kanon <strong>der</strong> Bibel wird durch die Frauenbewegung erweitert. Apokryphische<br />
Texte und weitere außerbiblische Texte erhalten ihre Gleichberechtigung.<br />
(5) Der Hl. Geist sei die Intuition <strong>der</strong> Frau.<br />
(6) Bei <strong>der</strong> Bibelexegese spielen Gefühle und Erfahrungen eine große Rolle. Dabei<br />
wird vor allem die Assoziationsbildung geför<strong>der</strong>t, die die Bibel nur noch als<br />
Aufhänger benutzt und ihr ganz an<strong>der</strong>sartige Bedeutungen unterlegt.<br />
(7) Das Schriftverständnis <strong>der</strong> feministischen Theologie erweist diese als Prozess-<br />
und Erfahrungstheologie, <strong>der</strong> es vor allem auf Aktion, Erfahrung und Handlung<br />
ankommt. So wird aus <strong>der</strong> Theologie unter Verwendung <strong>der</strong> Jungschen<br />
Psychologie die „Theo-Phantasie“, die die Bibel in den Befreiungsprozess <strong>der</strong><br />
Frauen integriert und die Offenbarung fortführt. 105<br />
105 Lutz von Padberg: Feminismus, Wuppertal, 1985, 144f.<br />
63
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Ein Produkt <strong>der</strong> feministischen Exegese ist die „Bibel in gerechter Sprache“. 106<br />
Der „Bibel in gerechter Sprache“ liegt ein dreifaches Leitinteresse zugrunde: ein<br />
„geschlechtergerechtes“, ein Interesse des gegenwärtigen christlich-jüdischen Dialogs<br />
und ein Interesse an <strong>der</strong> Bedeutung <strong>der</strong> biblischen Texte für die gesellschaftliche<br />
Lebenswirklichkeit. 107 Es geht den Übersetzerinnen und Übersetzern primär um eine<br />
„geschlechtergerechte Sprache“ und nicht um die Bewahrung des theologischen und<br />
linguistischen Inhalts des griechischen Neuen Testaments. Es gelten nicht mehr die<br />
Regeln <strong>der</strong> Übersetzung und <strong>der</strong> Grammatik, son<strong>der</strong>n da wird interpretiert, ergänzt<br />
und verän<strong>der</strong>t. Es ist von „Apostelinnen und Aposteln“ die Rede (Apg. 1,3-11), von<br />
„Jüngerinnen und Jüngern“ (Mt. 10,24) sowie von „Pharisäerinnen und Pharisäern“.<br />
Der Apostel Johannes hätte Jüngerinnen und Jünger gehabt, was historisch nie<br />
verifizierbar sein wird. Bei den Ältesten wird hinzugefügt, dass es sich um Frauen<br />
und Männer handelt (Offb. 5,11). Es heißt nicht mehr in Jh. 1,14 „das Wort ward<br />
Fleisch“, son<strong>der</strong>n ganz unpersönlich und materialistisch „die Weisheit wurde<br />
Materie“. Damit wird die Inkarnation geleugnet. Die Ausdrücke „Vater“ und „Sohn“<br />
in Bezug auf Gott und JESUS werden häufig ersetzt, wodurch inhaltliche<br />
Verän<strong>der</strong>ungen hervorgerufen werden. Wenn JESUS von „meinem Vater“ spricht,<br />
wird dies übersetzt durch „Gott, Vater und Mutter für mich“ (Mt. 7,21; 10,32.33;<br />
12,50; 15,13; 16,17 u.a.). In den johanneischen Schriften wird „Vater“ überwiegend<br />
mit „Gott“ wie<strong>der</strong>gegeben (Jh. 2,16; 6,32; 8,49 u.a.). „Unsere Mutter und unser<br />
Vater“ steht in Phil. 2,11; Kol. 3,17. Vielfach ist von Jesus statt von „Gottes Sohn“<br />
von „Gottes Kind“ die Rede (Mk. 1,2; Mt 8,29; 27,43.54; Lk. 8,38; Jh. 3,16.18 u.a.).<br />
Die Umdeutung <strong>der</strong> Christologie in eine Anthropologie wird deutlich in Jh. 5,19:<br />
„Das Kind kann nichts von sich aus tun, wenn es nicht die Eltern etwas tun sieht. Was<br />
nämlich jene machen, das macht genauso auch das Kind.“ In den johanneischen<br />
Schriften wird „Sohn Gottes“ am häufigsten mit „<strong>der</strong> Erwählte Gottes“ übersetzt<br />
(Jh. 1,49.51; 3,18; 5,25; 6,40; 11,4.27 u.a.). Auch <strong>der</strong> christologische Titel<br />
„Menschensohn“ wird häufig mit „Mensch“ (Mt. 17,9.12; Mk. 10,45; Lk. 9,44 u.a.)<br />
umschrieben o<strong>der</strong> „<strong>der</strong> erwählte Mensch“ (Jh. 1,51; 3,13f.; 5,27; 6,27 u.a.). Kyrios<br />
wird durch „die Ewige“ o<strong>der</strong> „die Lebendige“ vorwiegend ersetzt (im<br />
Lukasevangelium steht durchweg „die Lebendige“: 1,6.8.11.15f.17.25.28.32.45. Im<br />
1. Korintherbrief 4,4f.; 7,17.22.25.32.34f.39; 9,14; 10,9.21.26; 12,5; 16,7.10.21<br />
herrscht „die Ewige“ vor). Das geschieht in philologischer Willkür – an keiner<br />
einzigen dieser Stellen gibt es auch nur ein sprachliches Anzeichen dafür, die Rede<br />
von Gott dem „Herrn“ sei weiblich zu verstehen. Im Magnificat ruft die Maria aus:<br />
„Großes hat die göttliche Macht an mir getan und heilig ist ihr Name“ (Lk. 1,49). Das<br />
106 Ich beschränke mich an dieser Stelle auf das Neue Testament.<br />
107 Ulrike Bail, Frank Crüsemann, Marlene Crüsemann, Erhard Domay, Jürgen Ebach, Claudia Janssen,<br />
Hanne Köhler, Helga Kuhlmann, Martin Leutzsch und Luise Schottroff (Hrsg.): Bibel in gerechter<br />
Sprache, Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 2006. - Das dreifache Leitinteresse findet sich im Vorwort<br />
(S. 5) von dem Kirchenpräsidenten <strong>der</strong> Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau Dr. Dr. h. c. Peter<br />
Steinacker als auch in <strong>der</strong> Einleitung (S. 10f.).<br />
64
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Gebet, das <strong>der</strong> HERR seinen Jüngern lehrte beginnt mit den Worten: „Gott, für uns<br />
wie Vater und Mutter im Himmel, dein heiliger Name werde wirksam unter uns.“<br />
Der emeritierte Professor für Neues Testament und ehemalige Bischof des Sprengels<br />
Holstein-Lübeck Ulrich Wilckens (geb. 1928, Hamburg) und Verfasser <strong>der</strong> Theologie<br />
des Neuen Testaments erstellte ein Theologisches Gutachten zur „Bibel in gerechter<br />
Sprache“. 108 Vor allem kritisiert er, dass die eigentlichen theologischen und<br />
christologischen Aussagen des Neuen Testaments so stark verän<strong>der</strong>t werden, dass sie<br />
einen an<strong>der</strong>en, meist abgeschwächten, anthropologischen Sinn bekommen. „Diese<br />
Übersetzung beraubt das Neue Testament <strong>der</strong> Wahrheit <strong>der</strong> beiden Grundkenntnisse<br />
aller christlichen Kirchen, die sie in ihrer Heiligen Schrift begründet wissen: Der<br />
Wahrheit <strong>der</strong> Gottessohnschaft Jesu Christi und damit <strong>der</strong> Wahrheit des Drei-einen<br />
Gottes.“ 109<br />
In Bezug auf die Abwertung <strong>der</strong> Christologie in <strong>der</strong> „Bibel in gerechter Sprache“ hält<br />
Ulrich Wilckens fest: „Mit <strong>der</strong> weitgehenden Vermeidung des biblischen<br />
‚Sohnes’prädikats wird Jesus Christus seiner völligen Einheit mit Gott und Gottes mit<br />
ihm beraubt, kraft <strong>der</strong>er er allein unser Erlöser ist und sein kann. Statt dessen<br />
erscheint er als vorbildlicher Mensch, <strong>der</strong> uns Menschen als seinen ‚Geschwistern‘<br />
die weiblichen Züge seiner Gotteserfahrung nahe bringen möchte, wozu ihm die<br />
Übersetzerinnen endlich zur Sprache zu kommen helfen wollen.“ 110<br />
Sein Schlussurteil lautet:<br />
„Die ‚Bibel in gerechter Sprache‘ ist nicht nur für den Gebrauch in <strong>der</strong> Praxis <strong>der</strong><br />
Kirche nicht zu empfehlen, we<strong>der</strong> für den Gottesdienst, noch auch für den kirchlichen<br />
Unterricht und nicht einmal für die persönliche Lektüre. Sie ist vielmehr für jeglichen<br />
Gebrauch in <strong>der</strong> Kirche abzulehnen. Denn diese ‚Übersetzung‘ unterwirft den Text<br />
<strong>der</strong> Bibel – jedenfalls des Neuen Testaments – sachfremden Interessen ideologischer<br />
Art und verfälscht so in entscheidenden Grundaspekten ihren Sinn. Weil aber die<br />
Bibel als Heilige Schrift die Wurzel und <strong>der</strong> Grund alles Glaubens und Lebens <strong>der</strong><br />
Kirche und aller Christen ist, und weil deshalb das Bekenntnis <strong>der</strong> Kirche seine<br />
Wahrheit in <strong>der</strong> Wahrheit <strong>der</strong> Heiligen Schrift hat, darum ist die ‚Bibel in gerechter<br />
Sprache‘ als bekenntniswidrig zu beurteilen und aus jeglichem Gebrauch des Lebens<br />
in <strong>der</strong> Kirche auszuscheiden.“ 111<br />
108 http://www.bigs-gutachten.de/bigs-theol-gutachten.pdf vom 15.02.2007. (Zugriff: 10.07.09).<br />
109 U. Wilckens: Gutachten, a.a.O., S. 1<br />
110 Ders., a.a.O., S. 6<br />
111 Ders., a.a.O., S. 26.<br />
65
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
6. Tiefenpsychologische <strong>Hermeneutik</strong><br />
Bei manchen mo<strong>der</strong>neren liberalen Theologen kommt die <strong>Hermeneutik</strong> aus<br />
tiefenpsychologischer Sicht hinzu. So ist ihr Vorreiter <strong>der</strong> katholische Privatdozent und<br />
erfolgreiche Schriftsteller, <strong>der</strong> Priester Eugen Drewermann, geb. 1940 in Bergkamen.<br />
Persönlich habe ich ihn in einem Vortrag am 29. Okt. 1992 in Aurich gehört, wo er<br />
folgende Thesen aufgestellte: „Das Gottesbild hätten die Kin<strong>der</strong> von den Eltern<br />
übernommen; eine Hölle gäbe es nicht, da Gott Liebe ist; Ehebruch sei keine Sünde,<br />
son<strong>der</strong>n ein Unglücksfall; <strong>der</strong> Begriff ‚Sünde‘ sei überholt – man sollte eher von<br />
‚Schwäche‘ o<strong>der</strong> ‚Unfähigkeit‘ sprechen.“<br />
Mit Hilfe <strong>der</strong> Psychoanalyse von Sigmund Freud und Carl Gustav Jung will Drewermann<br />
die historisch-kritische Methode <strong>der</strong> Bibelexegese überwinden. In Wirklichkeit aber<br />
überwindet er sie nicht, son<strong>der</strong>n wendet sie konsequent an.<br />
Der katholische Priester übernimmt die Lehre <strong>der</strong> ‚Archetypen‘ von dem<br />
Psychoanalytiker C. G. Jung. Das griechische Wort ‚Arche‘ bedeutet ‚Anfang /<br />
Ursprung‘. Archetypen seinen Urbil<strong>der</strong> im menschlichen Unterbewusstsein, die auf den<br />
evolutionistischen Ursprung es Menschen hinweisen. Diese Urbil<strong>der</strong> tauchen im Traum,<br />
in <strong>der</strong> Phantasie, im Märchen 112 , in Mythen und in Formen von Symbolen 113 wie<strong>der</strong> auf.<br />
Wenn ein Kleinkind mit angewinkelten Beinen schläft, so erinnere es sich unbewusst an<br />
die Zeit im Mutterleib. Dieser Schlafzustand drücke nach Jung dann die Geborgenheit<br />
aus. Jung spricht von dem ‚kollektiv Unbewussten‘, weil die ganze Menschheit solche<br />
Archetypen kenne.<br />
Eugen Drewermann spricht nun von einer ‚archetypischen <strong>Hermeneutik</strong>‘. 114 Die<br />
mosaische Urgeschichte (Gen. 1-11) legt er tiefenpsychologisch-archetypisch aus.<br />
Schöpfung, Sündenfall, Bru<strong>der</strong>mord (Neid), Sintflut und Turmbau (Hochmut) spiegeln<br />
nur archetypische Bedürfnisse des Menschen wie<strong>der</strong>, um eine Antwort auf die Genese<br />
(Entstehung) des Menschen und <strong>der</strong> Sünde (des Bösen in <strong>der</strong> Welt) zu bekommen. Es<br />
sind für Drewermann keine historischen Fakten, son<strong>der</strong>n nur archetypische Denkmuster,<br />
die im Unterbewusstsein (Erbgedächtnis) als Mythen und Legenden gespeichert sind.<br />
Der Schlüsselbegriff für Gen. 3-11 sei Angst. Der Mensch lebt seit dem Sündenfall<br />
außerhalb <strong>der</strong> Gemeinschaft mit Gott. Diese Angst wird anhand <strong>der</strong> Erzählungen von<br />
Gen. 3-11 bewältigt. Sün<strong>der</strong> wird nur als Angst beschrieben, nicht als Trennung von<br />
Gott, aus <strong>der</strong> Eigenverantwortung des Menschen heraus. Klaus Rudolf Berger, <strong>der</strong> sich<br />
kritisch mit Drewermanns archetypischen <strong>Hermeneutik</strong> auseinan<strong>der</strong>gesetzt hat, schreibt:<br />
„Sünde, die eigentliche Trennung des Menschen von Gott, wird bei Drewermann in<br />
Angst umgedeutet und durch Selbsterkenntnis und Beobachtung schließlich integrierbar,<br />
so dass wir Menschen mit ihr Leben können. Echte Befreiung zeigt er nicht.“ 115<br />
112<br />
Dieser Ansatz erinnert an Bultmanns Entmythologisierung.<br />
113<br />
Es ist auf die semiotische Bibelauslegung zu verweisen.<br />
114<br />
Klaus R. Berger in: Factum 11/12, 1991, 16. Vgl. auch dazu E. Hahn in: Das Studium des NT,<br />
Wuppertal, 2000, Bd. 2, 19-24<br />
115<br />
Klaus R. Berger in: Factum 11/12, 1991, 18.<br />
66
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Die Schlange in Gen. 3 wird zu einer weisen Therapeutin, die das Handeln gegen Gottes<br />
Gebot als notwendig zur Erkenntnis von Gut und Böse werden lässt.<br />
Der Glaube an Gott ist für Drewermann die Antwort des Menschen auf Angst. Wer aus<br />
<strong>der</strong> Angst heraus an Gott glaubt, hat noch eine gebrochene Beziehung zu ihm.<br />
Biblische Texte sollte man nach Drewermann durch Träume, durch Gefühle und<br />
durch die Sprache <strong>der</strong> Sehnsucht auslegen.<br />
Gott erkennen könne man besser durch die Natur als durch die Bibel. In seinem<br />
pantheistischen Gottesansatz ist es für Drewermann kein Problem, alle Religionen<br />
synkretistisch miteinan<strong>der</strong> zu verknüpfen. Das Kreuz dürfe nicht länger dazu herhalten,<br />
die Natur des Menschen sündig zu sprechen. Deshalb lehnt er auch den stellvertretenden<br />
Sühnetod Christi radikal ab. 116<br />
116 Drewermann: Markusevangelium. Bil<strong>der</strong> von <strong>der</strong> Erlösung, Bd. 2: Mk 9,14-16,20, Olten / Freiburg i.<br />
Br., 1988, 142-143<br />
67
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
7. Der philosophische Ansatz von Hans-Georg Gadamer<br />
Die Philosophie gehört zu den Geisteswissenschaften und beschäftigt sich von daher<br />
gesehen vor allem mit Texten. In <strong>der</strong> Mitte des 20. Jh. gab es durch Hans-Georg<br />
Gadamer (1900 – 2002) einen neuen Durchbruch in <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong>, und zwar mit<br />
seinem international bekannt gewordenen Werk „Wahrheit und Methode. Grundzüge<br />
einer philosophischen <strong>Hermeneutik</strong>“, Tübingen, 1960.<br />
Je<strong>der</strong> Text ist in ein Geflecht von vor- und außertextlichen Voraussetzungen eingewoben<br />
(Kontext / Intertextualität). Was dasteht, hat mit an<strong>der</strong>en Worten immer schon eine Art<br />
Vorgeschichte. Texte sind als <strong>Teil</strong> <strong>der</strong> menschlichen Erfahrungswelt ausgewiesen.<br />
Als zentralen Gedanken dieser Analyse formuliert Gadamer: „Wer einen Text verstehen<br />
will, vollzieht immer ein Entwerfen. Er wirft sich einen Sinn des Ganzen voraus, sobald<br />
sich ein erster Sinn im Text zeigt. Ein solcher zeigt sich wie<strong>der</strong>um nur, weil man den<br />
Text schon mit gewissen Erwartungen auf einen bestimmten Sinn hin liest. Im<br />
Ausarbeiten eines solchen Vorentwurfs, <strong>der</strong> freilich beständig von dem her revidiert<br />
wird, was sich bei weiterem Eindringen in den Sinn ergibt, besteht das Verstehen dessen,<br />
was dasteht“(GW 1,271). 117<br />
Niemand geht ohne Vorurteile (persönliche, bewusste o<strong>der</strong> unbewusste) und<br />
V o rmeinungen an einen Text heran. Es gibt keine Neutralität und vollkommene<br />
Objektivität seitens des Interpreten.<br />
Von daher betrachtet braucht es beim Interpreten eine gewisse O f f enhei t für die<br />
Meinung des an<strong>der</strong>en bzw. des Textes. 118<br />
In einer Art von h ermeneu ti s ch em Postu lat formuliert Gadamer:<br />
„Wer einen Text verstehen will, ist [...] bereit, sich von ihm etwas sagen zu lassen. Daher<br />
muss ein hermeneutisch geschultes Bewusstsein für die An<strong>der</strong>sheit des Textes von<br />
vornherein empfänglich sein. Solche Empfänglichkeit setzt aber we<strong>der</strong> sachliche<br />
‚Neutralität’ noch gar Selbstauslöschung voraus, son<strong>der</strong>n schließt die abhebende<br />
Aneignung <strong>der</strong> eigenen Vormeinung und Vorurteile ein“ (GW 1, 273 f.).<br />
117 Hans-Helmuth Gan<strong>der</strong>: Erhebung <strong>der</strong> Geschichtlichkeit des Verstehens zum hermeneutischen Prinzip<br />
(Gadamer, Gesammelte Werke 1, 270-311) in: Wahrheit und Methode. Klassiker auslegen, hrsg. v.<br />
Günther Figal, Berlin, 2007, 105 – 125.<br />
118 Gadamer bezog seine <strong>Hermeneutik</strong> nicht nur auf Texte, son<strong>der</strong>n auch auf die Kunst und auf das<br />
Gespräch (auf die Kommunikation im Dialog).<br />
68
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Es gilt „<strong>der</strong> eigenen Voreingenommenheit innezusein, damit sich <strong>der</strong> Text selbst in seiner<br />
An<strong>der</strong>sheit darstellt und damit in die Möglichkeit kommt, seine sachliche Wahrheit<br />
gegen die eigene Vormeinung auszuspielen“ (GW 1, 274).<br />
In unserem O f f ensein für die hermeneutische Reflexion sind unsere V o r m ei nungen<br />
prinzipiell r ev idi erb ar.<br />
Dies ist aber nur möglich, wenn unser Vorwissen nicht bei uns und für sich bleibt,<br />
son<strong>der</strong>n sich flexibel neuen Erfahrungen stellt und d. h. sich für Erfahrungen und<br />
An<strong>der</strong>sheit öffnet. Nach Gadamer wird „das eigene Vorurteil dadurch recht eigentlich ins<br />
Spiel gebracht, dass es selber auf dem Spiele steht. Nur indem es sich ausspielt, vermag<br />
es den Wahrheitsanspruch des an<strong>der</strong>n [etwa des Textes] überhaupt zu erfahren und<br />
ermöglicht ihm, dass er sich auch ausspielen kann“ (GW 1, 304).<br />
Wenn in diesem Sinne Wahrheitsvermutung auf Seiten des Textes liegt und damit eine<br />
Überlegenheit seines Wahrheitsanspruches suggeriert, so bedeutet die darin implizierte<br />
Unterlegenheit des Interpreten aber keineswegs dessen grundsätzliche Unfähigkeit, die<br />
sachlichen Wahrheitsansprüche zu erkennen. Denn erst aus dem Anerkennen und in<br />
diesem Sinne Erkennen des sachlichen Wahrheitsanspruches gewinnt die kritische<br />
Vernunft, auf <strong>der</strong> Gadamer als Instanz <strong>der</strong> Vorurteilsprüfung besteht, die Möglichkeit,<br />
ihre Funktion und Rolle im Verstehensprozess zu begreifen. Hier setzt erneut seine<br />
Kritik am Vernunftsbegriff <strong>der</strong> Aufklärung an. Die Vernunft darf nicht Herr sein, son<strong>der</strong>n<br />
bleibt stets auf Gegebenheiten angewiesen.<br />
Mit an<strong>der</strong>en Worten sind wir dafür offen, „dass ein überlieferter Text es besser weiß, als<br />
die eigene Vormeinung gelten lassen will“ (GW 1,299).<br />
Die entsprechende hermeneutische Haltung ist <strong>der</strong> „Versuch, das Gesagte als wahr gelten<br />
zu lassen“ (GW 1,299).<br />
Natürlich rechnet Gadamer als Philosoph nicht damit, dass auch die menschliche<br />
Vernunft dem Lapsus (dem Sündenfall) unterliegt (Eph. 4,18) und von daher begrenzt,<br />
betört, irregeleitet, verwirrt, manipuliert ist und wird. Der biblische Exeget braucht von<br />
daher die Erleuchtung (Eph. 5,8.14) seiner verdunkelten Vernunft (1.Kor. 2,14), damit er<br />
überhaupt geistliche Zusammenhänge in <strong>der</strong> Hl. Schrift erkennen kann.<br />
69
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
7.1. Die persönliche Wirkungsgeschichte<br />
Kernstück <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> Hans Georg Gadamers ist die „Wirkungsgeschichte“.<br />
Verstehen ist ein wirkungsgeschichtlicher Vorgang.<br />
Wirkungsgeschichte ist das Verhältnis von Vergangenheit und Gegenwart.<br />
Der Autor eines Textes hat ein soziales Umfeld, eine Erziehung, vielleicht eine Religion.<br />
Dieses Umfeld wirkt auf den Autor und auf den Text und <strong>der</strong> Text wirkt in die<br />
Gegenwart hinein. Er hat einen Einfluss auf den Interpreten <strong>der</strong> Gegenwart<br />
(Rezeptionsästhetik).<br />
Geschichte ist also überhaupt nichts Abgeschiedenes, son<strong>der</strong>n immer auch<br />
Wirkungsgeschichte.<br />
Der biblische Exeget kann seine persönliche Wirkungsgeschichte nicht ausklammern.<br />
Seine persönliche Wirkungsgeschichte kann aus <strong>der</strong> Kultur bestehen, worin er<br />
aufgewachsen ist. Diese Kultur projiziert <strong>der</strong> Ausleger bewusst o<strong>der</strong> unbewusst auf den<br />
biblischen Text und legt diesen so aus, dass seine Kultur Bestätigung findet. Die<br />
persönliche Wirkungsgeschichte kann ferner aus <strong>der</strong> mitgebrachten Tradition bestehen,<br />
die <strong>der</strong> Ausleger durchlebt hat, entwe<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Familie o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Gemeinde.<br />
Schließlich kann die Wirkungsgeschichte aus <strong>der</strong> Konfession (lutherisch, reformiert,<br />
freikirchlich etc.) bestehen o<strong>der</strong> auch aus einer mitgebrachten Dogmatik einer<br />
konfessionellen Richtung. Hierzu gehört auch die theologische Ausbildungsstätte.<br />
Schließlich kann die persönliche Wirkungsgeschichte aus verschiedenen Kommentaren<br />
zur Bibel begleitet sein, die <strong>der</strong> Ausleger bereits studiert hat und nun unbewusst<br />
anwendet.<br />
Natürlich kann niemand seine persönliche Wirkungsgeschichte völlig ausklammern und<br />
abstreifen, aber er kann sie in Christus überwinden. Ich muss bereit sein, meine<br />
persönliche Wirkungsgeschichte zu erkennen, sie zugestehen und ein Stück weit<br />
zurückzustellen, bevor ich den biblischen Text auszulegen versuche.<br />
Damit wir unsere persönliche Wirkungsgeschichte erkennen können, ist es hilfreich, in<br />
die Kirchengeschichte und Theologiegeschichte hineinzublicken, denn aus den<br />
Vorüberlegungen zu bestimmten Sachthemen können wir lernen, eben auch aus ihren<br />
Fehlern.<br />
Zurecht konstatiert Donald A. Carson:<br />
„Wenn wir unsere Meinungen, Werte, und Denkweisen nicht an die Lehren <strong>der</strong> Bibel<br />
knüpfen, wissen wir we<strong>der</strong>, was die Autorität <strong>der</strong> Bibel bedeutet, noch was Unterordnung<br />
unter die Herrschaft Jesu Christi heißt. Es gibt viele verschiedene Meinungen darüber,<br />
was die Bibel wirklich sagt – Meinungsunterschiede, die manchmal mit demütigem<br />
Austausch und viel Zeit überwunden werden können; doch für Christen ist es<br />
unverzeihlich, wenn man mit <strong>der</strong> falschen Begründung, die Erkenntnis objektiver<br />
Wahrheit sei unmöglich, die Aussagen <strong>der</strong> Schrift ignoriert o<strong>der</strong> ihnen ausweicht.“ 119<br />
119 Donald A. Carson: Stolpersteine <strong>der</strong> Schriftauslegung, 124f.<br />
70
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
V. Neuere Ansätze in <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong><br />
1. Bibliodrama<br />
Beim Bibliodrama handelt es sich um die „dramatische“ Aneignung und Umsetzung<br />
biblischer Texte. Dabei sind sehr unterschiedliche Methoden und Akzente möglich, so<br />
dass es DAS Bibliodrama nicht gibt. Allen Richtungen gemeinsam ist ein ganzheitliches<br />
und erfahrungsorientiertes Arbeiten in Gruppen unter Einbeziehung des Körpers und mit<br />
Einsatz kreativer Elemente, von Gestus über Stimme und Klang bis hin zu Farbe und<br />
Form.<br />
Das Ziel, ein lebendiges Bibelverständnis zu erreichen, das die <strong>Teil</strong>nehmenden und<br />
gegebenenfalls die Zuschauenden existenziell angeht, verbindet die verschiedenen<br />
Ansätze. Im Unterschied zum Bibeltheater will Bibliodrama nicht illustrativ einen<br />
Bibeltext nachspielen, son<strong>der</strong>n zur Vergegenwärtigung führen.<br />
Jedes Bibliodrama findet in drei Phasen statt, die in <strong>der</strong> Literatur zum <strong>Teil</strong> noch in<br />
weitere Schritte ausdifferenziert werden:<br />
� In <strong>der</strong> Aufwärmphase (Warming-up) wird die Begegnung mit dem Text<br />
vorbereitet. Es findet ein Wechsel aus <strong>der</strong> Alltagswelt in die Welt des Textes statt,<br />
indem <strong>der</strong> „Textraum“ erkundet wird. In dieser Phase ist bewusste Körperarbeit<br />
beson<strong>der</strong>s wichtig.<br />
� In <strong>der</strong> Spielphase begeben die <strong>Teil</strong>nehmenden sich durch die Identifikation mit<br />
einer Person, einem Symbol o<strong>der</strong> Gegenstand des Textes in die Perspektive des<br />
Textes selbst hinein. Nachdem Rollen eingenommen und mit einem Profil<br />
verbunden sind, wird <strong>der</strong> Text o<strong>der</strong> ein <strong>Teil</strong> davon in Szene gesetzt.<br />
� Ebenso wichtig wie die eigentliche Spielphase ist die Reflexionsphase. Die<br />
<strong>Teil</strong>nehmenden verlassen die eingenommenen Rollen und reflektieren, wie sie<br />
sich selbst und die an<strong>der</strong>en im Spiel wahrgenommen haben. Berührungspunkte<br />
mit dem Alltagsleben und Glaubensleben werden erkannt. Der Binnenperspektive<br />
des Textes im Spiel folgt <strong>der</strong> Blick von außen auf den Text und die verän<strong>der</strong>te<br />
Frage nach den Aussagen <strong>der</strong> Bibel für die Einzelnen und für die Gruppe. 120<br />
Kritische Reflexion<br />
Bibeltheater und Bibliodrama werden vor allem im Kin<strong>der</strong>gottesdienst und in <strong>der</strong><br />
Sonntagsschule angewendet, inzwischen eben auch in Erwachsenenkreisen. Sicherlich<br />
prägen sich bestimmte Verhaltensmuster einiger Geschichten besser ein, wenn sie<br />
gespielt werden. Aber dadurch gewinnt man nicht den Zugang zum ganzen Text, weil<br />
immer nur Ausschnitte vorgetragen werden. Ob damit die Ansätze des Bibeltheaters und<br />
120 Eleonore Reuter: Art. „Bibliodrama“, WiBiLex 2008: http://www.bibelwissenschaft.de/wibilex/dasbibellexikon/details/quelle/WIBI/zeichen/o/referenz/15309///cache/57c47f248f/<br />
(Zugriffsdatum: 01.07.09).<br />
71
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
des Bibliodramas in den Bereich <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> hineingehören, ist meines Erachtens<br />
fraglich. Sie gehören vielmehr in den Bereich <strong>der</strong> Pastoraltheologie, <strong>der</strong> praktischen<br />
Anwendung biblischer Texte. Will man aber biblische Texte auf das gegenwärtige Leben<br />
anwenden, müssen sie zuvor die richtige historische Zuordnung erfahren haben, müssen<br />
sie zuvor kulturell aufgearbeitet worden sein und sie müssen zuvor exegetisch verstanden<br />
worden sein. Hermeneutische Studien stellen also die Voraussetzungen des Bibeltheaters<br />
und des Bibliodramas dar, nicht umgekehrt.<br />
2. Rezeptionsästhetische Analyse<br />
Unter „Rezeption“ 121 verstehen wir die „Annahme“ (Aufnahme) eines Textes bei den<br />
Lesern und Leserinnen. Unter „Ästhetik“ versteht man die „Wahrnehmung“ eines<br />
Gemäldes, eines Gegenstandes, in <strong>der</strong> biblischen <strong>Hermeneutik</strong> eben die „Wahrnehmung“<br />
eines biblischen Textes. 122<br />
Dabei spricht man zunächst einmal vom „Erstrezipienten“. Darunter werden zunächst die<br />
Verfasser <strong>der</strong> neutestamentlichen Bücher verstanden, dann auch die Gemeinden, die die<br />
Geschichten von Jesus mitgestaltet hätten (Rezeptionsprozess). Die frühchristlichen<br />
Gemeinden hätten die neutestamentlichen Geschichten von Jesus, dem Nazarener,<br />
aufgenommen, geformt, gestaltet, erweitert. Am Ende des Rezeptionsprozesses steht<br />
schließlich die redaktionelle Bearbeitung des neutestamentlichen Autors. Leser und<br />
Leserinnen sollten sich also zunächst fragen, wie <strong>der</strong> Autor selbst die Geschichten um<br />
Jesus verstanden hat. Schon <strong>der</strong> Autor hatte ein inneres Bild von einem Leser vor Augen,<br />
dem er die Geschichte erzählen möchte, dem „impliziten (fiktiven) Leser“.<br />
Schließlich gelangen wir zum „realen Leser“, bzw. dem „Endrezipienten“. Damit sind<br />
alle Leser und Leserinnen in <strong>der</strong> heutigen Zeit gemeint, die diese alten Geschichten aus<br />
dem Neuen Testament lesen. Das Neue Testament wird als ein „literarisches Kunstwerk“<br />
verstanden. Je<strong>der</strong> Betrachter nimmt beim Betrachten des Kunstwerkes etwas an<strong>der</strong>es war<br />
(Ästhetik). Und auch beim mehrmaligen Betrachten fallen dem Betrachter neue<br />
signifikante Merkmale auf. Je<strong>der</strong> deutet die Texte subjektiv. Dabei spielen beim<br />
Interpreten kulturelle Hintergründe, das soziale Umfeld und geschlechtliche Faktoren<br />
eine wichtige Rolle wie auch seine bisherigen persönlichen Erlebnisse und Erfahrungen.<br />
Der Ansatz geht also davon aus, dass die „B e d e u t u n g “ nicht im Text („Sinnfin<strong>der</strong>“),<br />
son<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> W i r k u n g auf die Leser und Leserinnen zu finden ist („Sinnstifter“). Die<br />
buchstäbliche Untersuchung (sensus literalis) des biblischen Textes wird ersetzt durch<br />
die intuitive Wahrnehmung des Lesers (sensus lectoris).<br />
121 Zur Vertiefung vergleiche die Dissertation von Moisés Mayordomo: Den Anfang hören. Leserorientierte<br />
Evangelienexegese am Beispiel von Matthäus 1-2, FRLANT 180, Göttingen, 1998. Eine kurze Abhandlung<br />
über die rezeptionsästhetische Analyse von Mayordomo findet sich in dem Werk „Das Studium des Neuen<br />
Testaments“, Bd. 2, Spezialprobleme, hrsg. v. H.-W. Neudorfer und E. J. Schnabel, Wuppertal, 2000, 33-<br />
58.<br />
122 Zum Thema: Umberto Eco: Einführung in die Semiotik, UTB 105, München, 9 2002. Ders.: Die Grenzen<br />
<strong>der</strong> Interpretation, München, 1992. Ders.: Lector in fabula. Die Mitarbeit <strong>der</strong> Interpretation in erzählenden<br />
Texten, München / Wien, 1987. Wolfgang Iser: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung, UTB<br />
636, München, 3 1990. Rainer Warning, Hrsg.: Rezeptionsästhetik, UTB 303, München, 1975.<br />
72
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Beim Lesen eines biblischen Textes kann es zu einer I n t e r a k t i o n zwischen dem<br />
Leser und „dem Helden“ <strong>der</strong> Geschichte kommen, indem <strong>der</strong> Leser assoziativ (Übernahme<br />
einer Rolle in einer geschlossenen imaginären Welt einer Spielhandlung), bewun<strong>der</strong>nd, einfühlsam<br />
(mitleidend), erschütternd o<strong>der</strong> ironisch reagiert. Jede Lektüre ist eine Form, den Text<br />
neu zu schreiben. Der Text ist demnach eine instabile Größe. Alles, was man dem Text<br />
zuschreibt, ist Ergebnis <strong>der</strong> Interpretation.<br />
Kritische Bemerkungen zur rezeptionsästhetischen Analyse:<br />
Der Textinhalt, die Intention, bzw. <strong>der</strong> Skopus des Textes, tritt zurück („Texttod“), die<br />
Wahrnehmung und Annahme beim Leser tritt in den Vor<strong>der</strong>grund. 123 Subjektive<br />
Erlebnisse und Erfahrungen spielen eine Rolle. Der biblische Text wird zu einem<br />
Picknickkorb, zu dem <strong>der</strong> Autor die Wörter und <strong>der</strong> Leser den Sinn mitbringt. Die<br />
Normativität des kanonischen Textes tritt zurück o<strong>der</strong> wird als unangenehme Botschaft<br />
ganz ausgeschlossen. Die mo<strong>der</strong>nen gesellschaftlichen Lebensprozesse und spirituellen<br />
Erfahrungen bestimmen nunmehr die Sinndeutung. Der Text ist also stets<br />
u n v o l l s t ändig und auf Mitarbeit angewiesen.<br />
Natürlich stellt auch <strong>der</strong> Leser - wie übrigens auch in <strong>der</strong> herkömmlichen <strong>Hermeneutik</strong> -<br />
Fragen an den biblischen Text. „Warum und zu welchem Zweck lese ich den Text?“ Wenn<br />
aber dabei die Autorität und die eigentliche Intention des biblischen Textes in den<br />
Hintergrund geraten und meine subjektiven Erwartungen in den Vor<strong>der</strong>grund stehen,<br />
dann verfehlt dieser hermeneutische Ansatz seine theologische Zielsetzung.<br />
Die rezeptionsästhetische Analyse entstammt dem Bereich <strong>der</strong> Literaturwissenschaft. Der<br />
biblische Text wird wie ein profaner Text behandelt, <strong>der</strong> mit den Methoden <strong>der</strong><br />
Literaturwissenschaft zu interpretieren sei.<br />
Inspiration und Offenbarung geraten völlig aus dem Augenschein. Nach dem Motto des<br />
mo<strong>der</strong>nen Humanismus tritt <strong>der</strong> Mensch in den Vor<strong>der</strong>grund und in den Mittelpunkt. Es<br />
wird nicht mehr danach gefragt, was Gott mir durch den biblischen Text sagen will und<br />
was ER von mir for<strong>der</strong>t, son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Mensch stellt die Frage an den Text: „Was will ich<br />
vom Text haben?“ und „Was will ich entdecken und was ist für mich wichtig?“ Der Text<br />
wird zum Gesprächspartner. Lesen wird zu einer freien Operation. „Wie ich und was ich<br />
lesen soll, kann mir keiner vorschreiben.“<br />
In diesem Prozess <strong>der</strong> ästhetischen Wahrnehmung biblischer Texte wird die Wahrheit<br />
relativiert. Wahrheit ist nicht mehr im biblischen Text zu finden, son<strong>der</strong>n in <strong>der</strong><br />
Erfahrung des Individuums. Der absolute und geoffenbarte Wille Gottes in dem<br />
normativen kanonischen Text <strong>der</strong> Bibel wird ausgeschlossen.<br />
Auch <strong>der</strong> Hl. Geist, <strong>der</strong> dem Leser den biblischen Text zugänglich macht und in den<br />
Herzen und im Gewissen wirkt und den Verstand erleuchtet, bleibt bei diesem<br />
hermeneutischen Ansatz außen vor.<br />
123 Kritische Rückfragen zur rezeptionsästhetischen <strong>Hermeneutik</strong> stellt auch Helge Stadelmann: Die Wende<br />
vom Text zum Hörer: Der Paradigmenwechsel zur emanzipatorischen <strong>Hermeneutik</strong> in <strong>der</strong> Praktischen<br />
Theologie, in: Ders. (Hrsg.): Den Sinn biblischer Texte verstehen. Eine Auseinan<strong>der</strong>setzung mit<br />
neuzeitlichen hermeneutischen Ansätzen, Gießen, 2006, 29-49.<br />
73
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
3. Narrative Analyse (Narratologie)<br />
Narrative Darstellungen sind mündliche, geschriebene o<strong>der</strong> gefilmte verbale<br />
Darstellungen von Ereignissen, die man an<strong>der</strong>en o<strong>der</strong> sich selbst berichtet. Es geht um<br />
die Story. Es handelt sich auch um fiktionale Darstellungen wie Mythen, Legenden und<br />
Volksmärchen. Die Wirkung auf den Zuhörer: Bewusstsein schärfen, Kultur wahren und<br />
weitergeben, gemeinsame Geschichte und Gruppenidentität schaffen. Ein gewisser<br />
MacAdams (1993) glaubt, dass jede Person die Kernthemen seiner Lebensgeschichte<br />
konstruiert – diese werden im Laufe des Lebens revidiert und verän<strong>der</strong>t. 124<br />
Die Narrative Analyse versucht Erzählungen zu erklären, zu verstehen und zu deuten.<br />
Erzählungen beinhalten Erfahrungen und eigene Lebensgeschichten.<br />
Die Disziplin wird N a r r at ol o gi e (Erzählkunst / Erzählanalyse) genannt. 125<br />
Entsprechend kreist die Narratologie um drei große Fragen: „Wer erzählt?“ (bzw. „Aus<br />
welcher Instanz wird erzählt?“), „Wie wird erzählt?“ und „Was wird erzählt?“. Mit Blick<br />
auf die zuletzt genannte Frage „Was wird erzählt?“ sind die Handlungssequenz (<strong>der</strong> Plot)<br />
und die Personen, die die diese vorantreiben und tragen, entscheidend. Die Narratologie<br />
lenkt mit ihrer Unterscheidung zwischen dem „wie“ (discourse) und dem „was“ (story)<br />
das Augenmerk auf das, was für die Geschehensabfolge entscheidend ist, nämlich „wie“<br />
erzählt wird. 126<br />
Die narrative Exegese gründet sich auf die Beobachtung, dass viele Abschnitte <strong>der</strong> Bibel<br />
Erzähltexte sind: zum Beispiel die Erzählungen in <strong>der</strong> Genesis über die Erzväter o<strong>der</strong> die<br />
epischen Stücke in den Samuel- und Königebüchern als auch die Erzählstücke in den<br />
Evangelien und in <strong>der</strong> Apostelgeschichte. Daher wendet die narrative Bibelexegese<br />
Methoden aus <strong>der</strong> Literaturwissenschaft an.<br />
David Trobisch beschäftigte sich mit <strong>der</strong> narrativen Welt <strong>der</strong> Apostelgeschichte. 127 Er<br />
vergleicht das biblische Werk mit den Werken von Karl May. Beide Werke haben die<br />
narrative Erzählkomposition als literarisches Mittel. In beiden Werken geht es darum<br />
Geschichten zu erzählen. Die Realität und die historische Wahrhaftigkeit treten zurück<br />
o<strong>der</strong> sie werden sogar ganz aufgegeben. Trobisch fragt: „Ist Karl May eine zuverlässige<br />
Quelle für die Situation in Nordamerika im ausgehenden 19. Jahrhun<strong>der</strong>t? Wohl kaum.“<br />
124 Charles P. Smith: Inhaltsanalyse und narrative Analyse: http://dtserv2.compsy.unijna.de/ss2006/entwpsy_uj/28749227/content.nsf/Pages/ABB2A383209B8883C12571930068F9B3/$FILE/I<br />
nhaltsanalyse%20und%20narrative%20Analyse.ppt. Datum des Downloads: 5. August 2010.<br />
125 Artikel „Narrativität“ (Juli 2009) von Dorothea Erbele-Küster in „WiBiLex“:<br />
http://www.bibelwissenschaft.de/nc/wibilex/das-bibellexikon/ vom 5. August 2010.<br />
126 Ursprungsland <strong>der</strong> narrativen Interpretation ist Frankreich in den 60iger Jahren des 20. Jahrhun<strong>der</strong>ts.<br />
Von dort verlagerte sich die literarische Disziplin in die USA („New Criticism“ und „Close Reading“) und<br />
nach Deutschland. Sie ist mit <strong>der</strong> Rezeptionsästhetik verwandt, da es u. a. auch darum geht, dass <strong>der</strong> Leser<br />
und die Leserin an <strong>der</strong> Entstehung des Textsinns beteiligt sind.<br />
127 David Trobisch: Die narrative Welt <strong>der</strong> Apostelgeschichte, in: Zeitschrift für Neues Testament, Heft 18,<br />
9. Jahrgang, 2006, Narr Francke Attempto Verlag, Tübingen, S. 11-14.<br />
74
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Ähnlich verhält es sich mit <strong>der</strong> Apostelgeschichte. Lukas erzählt die Welt aus seiner<br />
Sicht. Er will uns mitteilen, wie die christlichen Feste (Himmelfahrt und Pfingstfest)<br />
entstanden sind, aber die historische Wahrhaftigkeit bleibt dabei auf <strong>der</strong> Strecke. 128<br />
Kritische Reflexion<br />
Sicherlich treibt Trobisch seine narrativen Studien auf die Spitze <strong>der</strong> literarischen<br />
Forschung. Es fehlt die Objektivität, offenbart aber auch seinerseits, wessen Geistes Kind<br />
er ist. Die Bibel als das göttlich geoffenbarte Wort Gottes wird zu einem Märchen herab<br />
degradiert. Man fragt sich, weshalb er seine kostbare Zeit mit solchen sinnlosen Studien<br />
verbringt. Leser und Leserinnen erfüllt mit dem Hl. Geist werden weitaus größere,<br />
wertvollere und geistlich tiefere Entdeckungen in den Erzählungen des Alten und Neuen<br />
Testaments machen und sie werden daraus pragmatische Schlüsse für ihren täglichen<br />
Lebenswandel ziehen.<br />
128 Dorothea Erbele-Küster spricht in diesem Zusammenhang von dem Begriff <strong>der</strong> „Fiktion“ in <strong>der</strong><br />
Narratologie. Zwar sieht sie darin keinen Gegenbegriff zur Wirklichkeit und spricht darum lieber von<br />
„Erfahrungsräumen“, doch ganz aufgeben will sie den Begriff <strong>der</strong> „Fiktion“ auch nicht, so dass eine<br />
eindeutige Abgrenzung zur Realität und zur Wahrhaftigkeit signalisiert würde. Artikel „Narrativität“ in<br />
WiBiLex, a.a.O.<br />
75
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Zusammenfassung von neueren hermeneutischen Ansätzen<br />
Bibliodrama<br />
semiotische<br />
Interpretation<br />
Rezeptionsästhetische<br />
Analyse<br />
Narrative Lektüre<br />
Bibel als literarisches<br />
Produkt<br />
• Texte erleben und erfahren.<br />
• Lebensprozesse bestimmen die Sinndeutung.<br />
• "Wie wirkt <strong>der</strong> Text?" statt "was sagt <strong>der</strong> Text?"<br />
• Bibel als Codebuch<br />
• biblischer Text unvollkommen und bedarf <strong>der</strong><br />
Ergänzung<br />
• Bibel als offenes literarisches Kunstwerk<br />
•Bedeutung liegt nicht im Text, son<strong>der</strong>n in <strong>der</strong> Wirkung<br />
auf den Leser<br />
•Picknickesegese: Der Autor bringt die Worter, <strong>der</strong> Leser<br />
den Sinn mit.<br />
•Wahrheit bestimmt <strong>der</strong> Leser<br />
•Normativität des Textes tritt hinter spirituellen<br />
Erfahrungen zurück.<br />
• Die Bibel als Story<br />
• Identifizierung mit Lebensgeschichten<br />
• Erzählungen haben Erfahrungswelten<br />
(Historizität tritt zurück)<br />
• Methoden <strong>der</strong> Literaturwissenschaft<br />
• Offenbarung und Intention treten zurück<br />
76
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
VI. Fachliches Abkürzungsverzeichnis von Nachschlagewerken<br />
Siehe dazu: Siegfried Schwertner: Internationales Abkürzungsverzeichnis für Theologie und<br />
Grenzgebiete (IATG), Berlin / New York, 2 1992.<br />
Balz, H. / Schnei<strong>der</strong>, G., Hrsg.: Exegetisches Wörterbuch zum NT, 3 Bde., Kohlhammer, Stuttgart,<br />
2 1992<br />
Bauer, Walter : Griechisch-Deutsches Wörterbuch zu den Schriften des NT’ s u. <strong>der</strong> übrigen<br />
urchristlichen Literatur, Walter de Gruyter, Berlin, 5 1971.<br />
Neuausgabe: Walter Bauer und Kurt Aland u.a.: Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den<br />
Schriften des Neuen Testaments und <strong>der</strong> frühchristlichen Literatur, Berlin, 6 1988.<br />
Botterweck, G. J. und H. Ringgren, Hrsg.: Theologisches Wörterbuch zum AT, Kohlhammer,<br />
Stuttgart, 1970 - 2000<br />
Bühlmann, Walter / Scherer, Karl: Sprachliche Stilfiguren <strong>der</strong> Bibel. Von Assonanz bis<br />
Zahlenspruch. Ein Nachschlagewerk, Gießen, 2 1994<br />
Das Große Bibellexikon, Bd. I - III, hrsg. v. H. Burkhardt, F. Grünzweig, F. Laubach, G. Maier,<br />
Brockhaus und Brunnen, Wuppertal und Gießen, 1987<br />
Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet <strong>der</strong> Deutschen Bibelgesellschaft Stuttgart.<br />
www.wibilex.de<br />
Duden-Etymologie, bearbeitet von G. Drosdowski, P. Grede, Duden Bd. 7, Dudenverlag,<br />
Mannheim, 1963.<br />
Der Kleine Pauly – Lexikon <strong>der</strong> Antike in 5 Bde. – auf <strong>der</strong> Grundlage von Pauly’ s<br />
Realenzyklopädie <strong>der</strong> klassischen Altertumswissenschaft in 80 Bde., hrsg. v. Konrat Ziegler u.<br />
Walther Sontheimer, dtv, München, 1979<br />
Evangelisches Lexikon für Theologie und Gemeinde. Hrsg. v. H. Burkhardt u. U. Swarat, Bd. 1-<br />
3 <strong>der</strong> Studienausgabe, Brockhaus, Wuppertal, 2 1998<br />
Evangelisches Kirchenlexikon (EKL), hrsg. v. Erwin Fahlbusch, Jan M. Lochman u. John S.<br />
Mbiti, 5 Bde. (einschl. Register), 3. Aufl., V&R, Göttingen 1986-1997. Internationale theologische<br />
Enzyklopädie, 3800 Seiten. Als CD-ROM sehr günstig erhältlich.<br />
Harris, R. L. / Archer, Jr. G. L. / Waltke, B. K.: Theological Wordbook of the Old Testament,<br />
Vol. 1-2, Moody Bible Institute of Chicago, 1980.<br />
Haubeck, Wilfrid, von Siebenthal, Heinrich, Neuer Sprachlicher Schlüssel zum Griechischen<br />
Neuen Testament, Bd. 1 - 2, TVG, Brunnen, Gießen, 1994/97<br />
Jahrbuch für Evangelikale Theologie, hrsg. im Auftrag des Arbeitskreises für Evangelikale<br />
Theologie von R. Hille, H. Stadelmann, B. Weber, J. Eber u. R. Gebauer, Brockhaus, Wuppertal.<br />
EWNT<br />
ThWAT<br />
GBL<br />
WiBiLex<br />
Duden<br />
77<br />
WBNT<br />
BA<br />
Der Kleine Pauly<br />
ELThG<br />
EKL<br />
ThWBOT<br />
NSSNT<br />
JETh
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Jenni, Ernst / Westermann, Claus, Theologisches Handwörterbuch zum AT, Kaiser Verlag,<br />
München, 1984<br />
Kittel, Gerhard, Hrsg., Theologisches Wörterbuch zum NT, 11 Bde., Verlag Kohlhammer,<br />
Stuttgart, 1957-1979 (neu herausgegeben von Friedrich Gerhard, Kohlhammer-Verlag, Stuttgart,<br />
1990)<br />
Koehler, Ludwig und Baumgartner, Walter: hebräisches und Aramäisches Lexikon zum AT, 2<br />
Bde., E. J. Brill- Verlag, Köln, 3 1995<br />
Neues Testament und Antike Kultur, hrsg. v. Kurt Erlemann, Karl Leo Loethlichs: 4 Bde.,<br />
Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 2004 ff.<br />
Oehler, Gustav Fr., Theologie des Alten Testaments, Bd. 1: Einleitung und Mosaismus; Bd. 2:<br />
Prophetismus und alttestamentliche Weisheit, Verlag von J. J. Heckenhauer, Tübingen 1873 u.<br />
1874.<br />
Passow, Franz: Handwörterbuch <strong>der</strong> Griechischen Sprache, neu bearbeitet von Val. Chr. Fr. Rost u.<br />
Friedrich Palm, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 5 1983, I,1.2; II, 1.2<br />
Real-Enzyklopädie für protestantische Theologie und Kirche, begründet v. J.J. Herzog, in 17 Bde.,<br />
J. C. Hinrichsche Buchhandlung, Leipzig, 2 1877 - 1888.<br />
Theologische Realenzyklopädie, hrsg. in Gemeinschaft von Horst Robert Balz, Gerhard Müller<br />
u.a., Studienausgabe I-III, Bd. 1-36, Verlag Walter de Gruyter, Berlin, 1977-2004<br />
Religion in Geschichte und Gegenwart, hrsg. v. Kurt Galling, J. C. B. Mohr, Tübingen, 3 1986<br />
(Studienausgabe in 7 Bde.).<br />
Neuherausgabe in vierter Auflage von Hans Dieter Betz u.a., 8 Bde., Mohr Siebeck-Verlag,<br />
Tübingen, 1998-2005.<br />
Rienecker, Fritz / Maier, Gerhard: Lexikon zur Bibel, Brockhaus, Wuppertal,, 1994, 1998 (1.<br />
Son<strong>der</strong>ausgabe)<br />
ThHWAT<br />
ThWNT<br />
HAL<br />
NTAK<br />
Oehler, ThAT<br />
Passow<br />
RE<br />
TRE<br />
RGG 3<br />
RGG 4<br />
Lex.z.B.<br />
Steubing, H., Bekenntnisse <strong>der</strong> Kirche, Brockhaus, Wuppertal, 1985<br />
Strack, H. L., Billerbeck, P., Kommentar zum Neuen Testament aus Talmud u. Midrasch, C. H.<br />
Steubing, BKG<br />
Beck, München, Bd. I – IV.2, 9 1986.<br />
ST-B<br />
Theologisches Begriffslexikon zum Neuen Testament, begründet durch E. Beyreuther, H.<br />
Bietenhard und L. Coenen; neu hrsg. v. Lothar Coenen und Klaus Haacker: Wuppertal, 1997, 1.<br />
Son<strong>der</strong>auflage 2005 in einem Band (mit CD-ROM).<br />
von Rad, Gerhard: Theologie des Alten Testaments, Bd. 1-2, Kaiser Verlag, 1987 9<br />
ThBLNT<br />
v.Rad ThAT<br />
78
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
VII. L i t e r a t u r mit Anmerkungen<br />
Hinweise<br />
� Wenn nicht an<strong>der</strong>s erwähnt, wurde die Martin Luther Übersetzung von 1984,<br />
Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, verwendet.<br />
� Die übrigen verwendeten Bibelausgaben, Übersetzungen sowie die Schriftfonds <strong>der</strong><br />
zitierten Verse entstammen „Bible Works 4.0“ (1999) bis 7.0 (2007), dis tributet by<br />
<strong>Hermeneutik</strong>a Bible Research Sotfware, Big Fork, Montana, USA.<br />
� Der Text wurde mit Microsoft Word 2007 (Microsoft Corporation) erstellt und<br />
formatiert.<br />
� Biblische ClipArts entstammen Masters Art Collection Nr. 7, ClipArts zur Bibel,<br />
Agathos Verlag, Exxlesia Equipment, H. T. Mislisch, Sonthofen.<br />
� Weitere ClipArts sind PrintMaster Gold Deluxe 4.0 entnommen, Mindscape<br />
International, Mülheim a.d.R., 1997.<br />
1. Literatur für praktische Anleitung einer bibeltreuen exegetischen Arbeit<br />
1) Howard G. Hendricks / William G. Hendricks: Bibellesen mit Gewinn. Handbuch<br />
für das persönliche Bibelstudium . Christliche Verlagsgesellschaft, Dillenburg 1995.<br />
Das Handbuch ist didaktisch gut aufbereitet; hilft zu einer echten Beschäftigung mit dem Bibeltext.<br />
2) R.C. Sproul: Bibelstudium für Einsteiger. Eine Einführung in das Verstehen <strong>der</strong> Heiligen<br />
Schrift, Betanien Verlag, Oerlinghausen, 2009 (Erstausgabe 1977 „Knowing Scripture“).<br />
Der reformierte Theologe R.C. Sproul ist einer <strong>der</strong> Väter <strong>der</strong> „Chicago-Erklärung zur Irrtumslosigkeit<br />
<strong>der</strong> Bibel“ und Mitherausgeber <strong>der</strong> Genfer Studienbibel. In kurzer Form stellt er Anleitungen zur<br />
Auslegung <strong>der</strong> Bibel dar. Vor allem interessant ist das Kapitel „Bibel und Kultur“.<br />
3) Helge Stadelmann / Thomas Richter: Bibelauslegung praktisch – in zehn<br />
Schritten den Text verstehen, Brockhaus Verlag, Wuppertal, 2006.<br />
Sehr gute praktische Tipps zu einer bibeltreuen Exegese unter Berücksichtigung <strong>der</strong> Heilsgeschichte.<br />
4) Jacob Thiessen: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> Bibel. Grundsätze zur Auslegung und Anwendung<br />
biblischer Texte – ein offenbarungstheologischer Standpunkt, Jota-Publikationen,<br />
Hammerbrücke, 2 2009.<br />
Biblische Darstellung <strong>der</strong> Inspiration, Irrtumslosigkeit und Autorität <strong>der</strong> Bibel. Bedeutung des<br />
biblischen Kanons. Bibelübersetzung und Bibelauslegung. Berücksichtigung <strong>der</strong> Heilsgeschichte für<br />
die Auslegung.<br />
2. Literatur zur Anleitung <strong>der</strong> historisch-kritischen Methode<br />
A ltes Testam ent<br />
1) Uwe Becker: Exegese des Alten Testaments. Ein Methoden- und Arbeitsbuch. UTB 2664.<br />
Mohr Siebeck, Tübingen 2005.<br />
Knappe Übersicht; ohne neuere Methoden; weiterführende Literaturangaben.<br />
2) A.H.J. Gunneweg: Vom Verstehen des Alten Testaments. Eine <strong>Hermeneutik</strong>, Reihe:<br />
Grundrisse zum Alten Testament, ATD Ergänzungsreihe Bd. 5, Göttingen, 1977.<br />
79
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
3) Odil Hannes Steck: Exegese des Alten Testaments. Leitfaden <strong>der</strong> Methodik. Ein Arbeitsbuch<br />
für Proseminare, Seminare und Vorlesungen. 14., durchgesehene und erweiterte Auflage,<br />
Neukirchener-Verlag, Neukirchen-Vluyn 1999.<br />
Immer noch das Standardwerk, ohne die neueren Ansätze.<br />
4) Helmut Utzschnei<strong>der</strong> / Stefan Ark Nitsche: Arbeitsbuch literaturwissenschaftliche<br />
Bibelauslegung. Eine Methodenlehre zur Exegese des Alten Testaments. Kaiser/Gütersloher<br />
Verlagshaus, Gütersloh 2001.<br />
Berücksichtigt auch die neueren "synchronen" Methoden.<br />
N eues Testam ent<br />
1) Hans Conzelmann / Andreas Lindemann: Arbeitsbuch zum Neuen Testament, UTB, Mohr<br />
Siebeck, Tübingen, 1998 12 , Erster <strong>Teil</strong>: Methodenlehre, § 6 die exegetischen Methoden.<br />
2) Klaus Berger: Exegese des Neuen Testaments, UTB, Quelle und Meyer, Heidelberg und<br />
Wiesbaden, 3 1991 (1977).<br />
(Klaus Berger gehört zu den konservativen Theologen. In <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> aber vertritt er die HKM).<br />
3) Wilhelm Egger: Methodenlehre zum Neuen Testament. Einführung in linguistische und<br />
historisch-kritische Methoden. Her<strong>der</strong>, Freiburg 1987.<br />
Klassiker; bezieht linguistische Methoden mit ein.<br />
4) Klaus Haacker: Neutestamentliche Wissenschaft. Eine Einführung in Fragestellungen und<br />
Methoden, Wuppertal, 2 1985.<br />
Kurze und gut verständliche Einführung in die methodischen Arbeitsschritte <strong>der</strong> historisch-kritischen<br />
Methode. Haacker stellt auch kritische Rückfragen.<br />
5) Jürgen Roloff: Neues Testament, Neukirchen-Vluyn, 7 1999.<br />
Überblick über die historisch-kritischen Arbeitsmethoden mit konkreten Beispielen und Übungen.<br />
6) Udo Schnelle: Einführung in die neutestamentliche Exegese. 6. neubearb. Aufl. UTB 1253.<br />
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2005.<br />
Knappe Übersicht; wird im ev. Theologiestudium häufig verwendet.<br />
7) Heinrich Zimmermann: Neutestamentliche Methodenlehre. Darstellung <strong>der</strong> historischkritischen<br />
Methode, 7. Aufl., neubearb. v. Klaus Kliesch, Kath. Bibelwerk, Stuttgart, 1982.<br />
Das klassische Standardwerk.<br />
3. Stellungnahmen zur historisch-kritischen Methode (HKM)<br />
1) Eta Linnemann: Original o<strong>der</strong> Fälschung. Historisch-kritische Theologie im Licht <strong>der</strong><br />
Bibel, CLV, Bielefeld, 1994 (1999 2 ), ISBN 3-89397-754-6.<br />
Prof. Eta Linnemann war früher eine Vertreterin <strong>der</strong> HKM. Einen Namen hatte sie sich in <strong>der</strong><br />
Gleichnisforschung gemacht, wo sie in <strong>der</strong> Literatur zusammen mit Adolf Jülicher und Joachim<br />
Jeremias auftauchte. Durch einen Studentinnen-Bibel-Kreis kam sie zum lebendigen Glauben an Jesus<br />
Christus. Daraufhin hat sie ihre kritischen Bücher vernichtet. Sie erkannte für sich die absolute<br />
Wahrheit und Autorität <strong>der</strong> Bibel in allen ihren Aussagen an.<br />
80
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
2) Eta Linnemann: Was ist glaubwürdig? Die Bibel o<strong>der</strong> die Bibelkritik?, VTR, Nürnberg,<br />
2007.<br />
3) Gerhard Maier: Das Ende <strong>der</strong> historisch-Kritischen Methode, Brockhaus, 1974 ( 5 1984).<br />
4) Armin Sierszyn: Die Bibel im Griff? Historisch-kritische Denkweise und biblische<br />
Theologie, Brockhaus, Wuppertal, 1978.<br />
Armin Sierszyn beugt sich unter die Autorität <strong>der</strong> ganzen Bibel als das geoffenbarte und normative<br />
Wort Gottes. Der Schweizer Theologe hat an den deutschen Universitäten Theologie studiert und er<br />
hat bei Walter Künneth promoviert. Seit den Anfängen <strong>der</strong> Staatsunabhängigen Theologischen<br />
Hochschule Basel ist er dabei und seit vielen Jahren Prorektor. Er kennt sich mit den kritischen<br />
Denkansätzen gut aus. Die Lektüre for<strong>der</strong>t die volle Konzentration, aber sie zeigt deutlich auf, dass<br />
<strong>der</strong> Ausleger seinen Verstand allein durch den Hl. Geist erleuchten lassen muss, und nicht durch<br />
ideologische Denkrichtungen. Nur durch die Erfüllung mit dem Hl. Geist ist eine Konspiritualität mit<br />
dem Wort Gottes möglich, eine zentrale Voraussetzung für die Bibelexegese. Der so vom hl. Geist<br />
erleuchtete Verstand wie<strong>der</strong>um ist zusammen mit den objektiven Methoden <strong>der</strong> Wissenschaft auch in<br />
<strong>der</strong> hermeneutischen und exegetischen Forschung von großem Nutzen.<br />
4. Zur Geschichte <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong><br />
1) Graf Henning Reventlow: Epochen <strong>der</strong> Bibelauslegung, 4 Bde., München, 1990/94/97/2001.<br />
2) Peter Stuhlmacher: Vom Verstehen des NT - Eine <strong>Hermeneutik</strong>, NTD, Ergänzungsreihe 6,<br />
Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen, 1986.<br />
3) Bernhard Ramm: Biblische <strong>Hermeneutik</strong>, ICI, Asslar, 1991. Artikel 2: Historische Schulen.<br />
5. <strong>Hermeneutik</strong> im Lichte <strong>der</strong> Heilsgeschichte<br />
1) Arnd Brettschnei<strong>der</strong>: Heilsgeschichtliche Schriftauslegung. Die Bibel heilsgeschichtlich<br />
lesen, verstehen und anwenden, Dillenburg, 2006.<br />
2) Rinaldo Diprose: Israel aus <strong>der</strong> Sicht <strong>der</strong> Gemeinde, Edition Wiedenest, Hammerbrücke,<br />
2001.<br />
Diprose beschäftigt sich hauptsächlich mit <strong>der</strong> Substitutionstheorie, die besagt, dass die Gemeinde für<br />
immer Israel ersetzt hätte. Diprose bringt dagegen sehr gute Einwände aus <strong>der</strong> Hl. Schrift.<br />
3) Martin Heide: Worauf noch warten? – Das Reich Gottes im Wandel <strong>der</strong> Zeiten, CLV,<br />
Bielefeld, 1992.<br />
In den Exkursen und Statements gibt Heide praktisch-exegetische Beispiele in Bezug auf das<br />
Millennium und die Stellung Israels und <strong>der</strong> Gemeinde. Z. B. Amos 9, Römer 11; Mt. 24,30. Die<br />
Bedeutung des Reiches Gottes. Die Prophetie Joels. Israels Verwerfung und das NT. Die Drangsal.<br />
Das gegenwärtige und zukünftige Zeitalter. Die Offenbarung als symbolisches Buch. Die erste<br />
Auferstehung. Die Offenbarung im Zugriff <strong>der</strong> Philosophie. Geistliche und leibliche Auferstehung.<br />
Die Wie<strong>der</strong>kunft Christi. Die Wolken des Himmels.<br />
4) Cyrus Ingerson Scofield: Legen wir die Bibel richtig aus?, Verlag Hermann Schulte,<br />
Wetzlar, 1974 (Originalausgabe: „Rightly Dividing the Word of Truth“ im Verlag<br />
Zon<strong>der</strong>van, Publishing House, Grand Rapids, Michigan, 1896).<br />
Scofield legt die Sicht des klassischen Dispensationalismus dar und vertritt die „Sieben-Zeitalter-<br />
Lehre“. Im deutschsprachigen Raum wurde er durch die Scofield-Studienbibel (1909) bekannt.<br />
5) Helge Stadelmann / Berthold Schwarz: Heilsgeschichte verstehen, CV, Dillenburg, 2008.<br />
81
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
Das Buch bietet einen optimalen Überblick über die heilsgeschichtlichen Zusammenhänge des Alten<br />
und Neuen Testaments wie auch über die verschiedenen heilsgeschichtlichen Epochen, die <strong>der</strong><br />
Ausleger beim Studium des Alten und Neuen Testaments berücksichtigen sollte. Die fortschreitende<br />
Offenbarung wird erklärt ebenso wie die Ökonomien und Dispensationen. Es gibt genügend<br />
Fallbeispiele. Auch die verschiedenen Richtungslager in ihrer Wirkungsgeschichte mit ihren<br />
verschiedenen Vertretern werden vorgestellt. Dabei wird davor gewarnt, dass <strong>der</strong> Ausleger nicht über<br />
das Ziel <strong>der</strong> Schriftoffenbarung hinausschießen darf. Es gibt Tipps zum Verständnis <strong>der</strong> Evangelien,<br />
<strong>der</strong> Bergpredigt und des Reiches Gottes. Zum Schluss gibt es praktische Hinweise für eine<br />
heilsgeschichtliche Schriftauslegung.<br />
6) Helge Stadelmann: Grundlinien eines bibeltreuen Schriftverständnisses, Wuppertal, 3 1996<br />
(1985).<br />
Der Autor weist in diesem Buch vor allem auf die notwendige Beachtung <strong>der</strong> großen<br />
heilsgeschichtlichen Linien in <strong>der</strong> Exegese hin.<br />
6. Allgemeine Literatur <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong><br />
Die wichtigste Literatur zum Studium <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> und <strong>der</strong> Exegese mit kurzen Erläuterungen in<br />
Auswahl.<br />
1. Otto Betz: Wie verstehen wir die Bibel?, Aussat Verlag, Wuppertal,1981.<br />
2. Claus von Bornmann: <strong>Hermeneutik</strong> I, TRE, 15, 108-137, hrsg. v. Gerhard Müller, deGruyter,<br />
Berlin u. New York, 1986.<br />
3. Jakob van Bruggen: Wie lesen wir die Bibel?, Hänssler, Neuhausen-Stuttgart, 1998<br />
Bruggen bringt gute Beispielexegesen zu Ps. 69; 1.Kor. 15,29; Ps. 2 u. zu Melchisedek. Er stellt dem<br />
Leser praktische Hausaufgaben und im Anhang des Buches hat er eine ausgezeichnete Literaturliste.<br />
Kritik: Auf den Seiten 151 - 156 legt er Röm. 9 - 11 auf die Gemeinde hin aus. Das bedeutet: Israel hat<br />
nach van Bruggen als Nation keine eschatologische Zukunft mehr. Für Israel gibt es keine nationale,<br />
wirtschaftliche und geistliche Wie<strong>der</strong>geburt. Und folglich gelten alle eschatologischen Verheißungen<br />
im AT nicht Israel, son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Gemeinde. Diese antieschatologische Ansicht ist von <strong>der</strong> Exegese und<br />
von <strong>der</strong> Heilsgeschichte her nicht haltbar, weil es noch unerfüllte alttestamentliche Prophezeiungen<br />
gibt, die eindeutig Israel gelten. Und zuletzt: van Bruggen stülpt <strong>der</strong> Bibel seine calvinistische Ansicht<br />
über. Der Calvinismus ist amillennialistisch eingestellt. Van Bruggen zieht die Dogmatik <strong>der</strong><br />
<strong>Hermeneutik</strong> vor. Umgekehrt soll es aber sein.<br />
4. Donald A. Carson: Stolpersteine <strong>der</strong> Schriftauslegung, Betanien-Verlag, Oerlinghausen, 2007<br />
(Original: „Exegetical Fallacies, Baker Academic, Grand Rapids, 1996).<br />
Donald Arthur Carson lehrt an <strong>der</strong> Trinity Evangelical Divinity School (Deerfield) und ist zusammen<br />
mit Douglas J. Moo <strong>der</strong> Verfasser einer „Einleitung in das Neue Testament“, Gießen, 2010 (925 S.). In<br />
dem kleinen Büchlein „Stolpersteine <strong>der</strong> Schriftauslegung“ deckt er einige Fehler, bzw.<br />
Fehlermöglichkeiten auf, die bei <strong>der</strong> Auslegung immer wie<strong>der</strong> gemacht werden (können). Dabei ist er<br />
in seinen Untersuchungen unabhängig von konfessionellen Bestimmungen. Das Büchlein ist sehr<br />
praktisch und verständlich, geht aber auch in die Tiefe <strong>der</strong> griechischen Grammatik hinein.<br />
5. Joachim Cochlovius / Peter Zimmerling, (Hrsg.): Evangelische Schriftauslegung,<br />
Quellentexte, TVG, Brockhaus, Wuppertal, 1987 (Dieses Arbeitsbuch enthält Darstellungen mit<br />
Quellentexten über die Auslegungsmethoden von den Reformatoren bis zur Gegenwart).<br />
82
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
6. Manfred Dreytza / Walter Hilbrands / Harmtut Schmid (Hrsg.): Das Studium des Alten<br />
Testaments – Eine Einführung in die Methoden <strong>der</strong> Exegese , TVG, Brockhaus,<br />
Wuppertal, Brunnen, Gießen.<br />
Die drei Autoren beschäftigen sich eingehend mit <strong>der</strong> Auslegung des Alten Testaments. Aus vielen<br />
Beiträgen kann man einiges lernen. Sie selber titulieren ihren hermeneutischen Ansatz als eine<br />
„literarisch-historisch-theologische Auslegung“ (S. 153-155); „literarisch“, weil die Bibel verschiedene<br />
Gattungen aufweist (Bericht, Biographie, Erzählung, Poesie usf.); „historisch“, weil die Bibel einen<br />
historischen Kontext und ein geschichtliches Umfeld hat und „theologisch“, weil die Bibel nicht nur<br />
ein Buch wie jedes an<strong>der</strong>e ist, son<strong>der</strong>n geoffenbartes Wort Gottes, wodurch Gott redet und seinen<br />
Heilsplan mitteilt. Die Autoren scheuen sich aber auch nicht davor, die Arbeitsmethoden <strong>der</strong> historischkritischen<br />
Forschung insoweit einzubeziehen, wenn sie <strong>der</strong> historisch-literarischen Arbeit dienlich sein<br />
können. Zwar werden einige Methoden kritisch bewertet (wie die Formgeschichte und Literarkritik),<br />
an<strong>der</strong>e aber werden zu unkritisch übernommen (wie die Überlieferungsgeschichte, die<br />
Redaktionsgeschichte und die Traditionsgeschiche).<br />
7. Gordon Fee und Douglas Stuart: Effektives Bibelstudium, ICI, Asslar, 3 1996<br />
Die Abschnitte über die Erzählungen des Alte Testament, über die Apostelgeschichte, über das Gesetz,<br />
über die Psalmen und Weisheit sind sehr lehrreich; ansonsten leichte Ansätze einer zu einer offenen<br />
(liberalen) <strong>Hermeneutik</strong> und vorausgesetzte dogmatische Ansätze, welche <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong> vorgezogen<br />
werden.<br />
8. Günter Figal (Hrsg.): Hans-Georg Gadamer: Wahrheit und Methode, Berlin, 2007.<br />
(Philosophische <strong>Hermeneutik</strong>).<br />
9. Günter Figal (Hrsg.): Internationales Jahrbuch für <strong>Hermeneutik</strong>, Mohr / Siebeck, 2002 ff.<br />
(philosophisch).<br />
10. Helmuth Frey: Geistliche Schriftauslegung, Brunnen-Verlag, Gießen, 2002 (72 S.).<br />
11. Klaus Haacker: Neutestamentliche Wissenschaft. Eine Einführung in Fragestellungen und<br />
Methoden. (1981) 2. Aufl. R. Brockhaus, Wuppertal 1985 (eher knapp)<br />
12. Heinzpeter Hempelmann: Nicht auf <strong>der</strong> Schrift, son<strong>der</strong>n unter ihr – Grundsätze und<br />
Grundzüge einer <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> Demut, VLM, 2000.<br />
Der Titel klingt zwar gut und in vielen Ansätzen möchte <strong>der</strong> Autor eine bibeltreue <strong>Hermeneutik</strong><br />
vertreten, doch lei<strong>der</strong> tut er das nicht konsequent. Er zeigt bibeltreue Ansätze auf, aber er kann genauso<br />
gut Ansätze <strong>der</strong> historisch-kritischen Methode (HKM) übernehmen, da wo sie nützlich scheinen. Er<br />
mag die HKM nicht grundsätzlich verwerfen. Außerdem kann er <strong>der</strong> Bibel nicht in allen ihren<br />
Aussagen folgen (6-Tage-Schöpfung, Datierung von Jesaja u.a.m.).<br />
13. Biblische <strong>Hermeneutik</strong>: Jahrbuch für Biblische Theologie (JBTh 12 / 1997), Neukirchen-<br />
Vluyn, 1998.<br />
Themen wie die Verbindlichkeit des Alten Testaments, christlicher Kanon, jüdische <strong>Hermeneutik</strong>,<br />
Missbrauch <strong>der</strong> Bibel werden besprochen.<br />
14. Ulrich H. J. Körtner: Einführung in die theologische <strong>Hermeneutik</strong>, WBG, Darmstadt, 2006.<br />
Eine Darstellung verschiedener hermeneutischer Ansätze, auch <strong>der</strong> neueren, Einblicke in die<br />
<strong>Hermeneutik</strong> innerhalb <strong>der</strong> systematischen Theologie. Der Autor selbst vertritt eine ökumenische<br />
<strong>Hermeneutik</strong>.<br />
15. Mathias J. Kürschner: Martin Luther als Ausleger <strong>der</strong> Heiligen Schrift, Brunnen-Verlag,<br />
Gießen, 2004 (64 S.).<br />
83
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
16. Dieter Lührmann: Die Auslegung des Neuen Testaments. Zürcher Grundrisse zur Bibel.<br />
(1984) 2. Aufl. Zürich 1987<br />
17. Gerhard Maier: Biblische <strong>Hermeneutik</strong>, TVG, Brockhaus, Wuppertal, 1990<br />
Eine Art Kompendium <strong>der</strong> <strong>Hermeneutik</strong>. Maier vertritt die Offenbarungs-<strong>Hermeneutik</strong>, denn ohne<br />
Offenbarung Gottes gibt es keine Schrifterkenntnis.<br />
18. Wolfgang Nethöfel: Theologische <strong>Hermeneutik</strong>. Vom Mythos zu den Medien (NBSTh 9),<br />
Neukirchen-Vluyn, 1992.<br />
19. Heinz-Werner Neudorfer / Eckhard J. Schnabel (Hrsg.): Das Studium des Neuen<br />
Testaments, TVG, Brockhaus, Wuppertal, Brunnen, Gießen,<br />
Bd. 1: Eine Einführung in die Methoden <strong>der</strong> Exegese (1999).<br />
Bd. 2: Spezialprobleme (2000). Beide Bde. erschienen 2006 in einem Band.<br />
Aufbau des ersten Bandes: 1) Skizze <strong>der</strong> geschichtlichen Entwicklung des jeweiligen Ansatzes, 2)<br />
Ergebnisse <strong>der</strong> Forschungsgeschichte, 3) Darstellung des methodischen Vorgehens, 4) Diskussion, 5)<br />
bewertende Darstellung <strong>der</strong> Relevanz für die praktische Auslegung des Neuen Testaments als Heilige<br />
Schrift.<br />
Folgende Methoden werden besprochen: Textkritik, Sprachwissenschaftliche Aspekte, die jüdische<br />
Umwelt, die griechisch-römische Umwelt, Traditionsgeschichte, Literarische Analyse, <strong>der</strong> synoptische<br />
Vergleich, Form- und Gattungsanalyse, Rhetorische Analyse, die redaktionsgeschichtliche Methode,<br />
die Abfassung einer schriftlichen Exegese, die Predigtvorbereitung.<br />
Bewertung: Wer Begrifflichkeiten <strong>der</strong> historisch-kritischen Methode übernimmt, sollte klipp und klar<br />
deutlich machen, worin er sich von ihr unterscheidet. Weshalb werden die Arbeitsmethoden <strong>der</strong><br />
historisch-kritischen Methode dargestellt und später in Übungen verwendet?<br />
Die Übungsbeispiele sollen zur eigenen exegetischen Arbeit anleiten, so heißt es im Vorwort. Am Ende<br />
des Buches stelle ich mir die Frage, zu welcher exegetischen Arbeit denn nun angeleitet werden soll?<br />
Zur Arbeit <strong>der</strong> historisch-kritischen Methode o<strong>der</strong> zur biblisch-historischen Offenbarungshermeneutik?<br />
Die Antwort soll in einer evangelikalen <strong>Hermeneutik</strong> eigentlich klar auf <strong>der</strong> Hand liegen?!<br />
Natürlich wird von <strong>der</strong> „schriftgewordenen Offenbarung Gottes in Jesus Christus“ gesprochen, aber<br />
lei<strong>der</strong> wird diese Offenbarung zu wenig betont und gegenüber <strong>der</strong> historischen Kritik zu wenig<br />
abgegrenzt.<br />
20. Manfred Oeming: Biblische <strong>Hermeneutik</strong>. Eine Einführung, Darmstadt, 1998.<br />
Der Autor stellt die unterschiedlichen Lektüreweisen wie historisch-kritische Methode,<br />
sozialgeschichtliche Exegese, kanonische Schriftauslegung usw. nacheinan<strong>der</strong> vor und benennt jeweils<br />
Vor- und Nachteile.<br />
21. J. D. Pentecost: Bibel und Zukunft, CV, Dillenburg, 1993: <strong>Teil</strong> 1: Die Auslegung <strong>der</strong><br />
Prophetie: Kap. 1: Die Methoden <strong>der</strong> Auslegung; Kap. 2: Die Geschichte <strong>der</strong> Auslegung;<br />
Kap. 3: Grundsätzliche Erwägungen zur Auslegung; Kap. 4: Die Auslegung von Prophetie. (S.<br />
24 bis 88 <strong>der</strong> 1.Aufl.)<br />
Wie legen wir Prophetie aus? Wie gehen wir mit eschatologischen Texten um? Wie sind Bil<strong>der</strong> und<br />
Symbole in den apokalyptischen Texten auszulegen? Auf diese Fragen gibt <strong>der</strong> Verfasser Antworten,<br />
vor allem aber aus <strong>der</strong> dispensationalistischen Sicht.<br />
22. Bernhard Ramm: Biblische <strong>Hermeneutik</strong>, ICI, Asslar, 1991.<br />
Diese übersichtliche, leicht verständliche und bibeltreue <strong>Hermeneutik</strong> ist empfehlenswert. Die<br />
Anregungen lassen sich leicht in die Praxis umsetzen.<br />
23. Eckart Reinmuth: <strong>Hermeneutik</strong> des Neuen Testaments. Eine Einführung in die Lektüre des<br />
Neuen Testaments (UTB 2310), Göttingen, 2002.<br />
84
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
24. Ron Rhodes: Verstehst du, was du liest? Schwierige Bibelstellen leicht verständlich erklärt,<br />
Brockhaus-SCM, Witten, 2009.<br />
Im ersten Kapitel stellt <strong>der</strong> Autor elf Prinzipien <strong>der</strong> Schriftauslegung auf, wobei er sich an <strong>der</strong><br />
reformatorischen <strong>Hermeneutik</strong> orientiert. In den folgenden Kapiteln versucht er schwierige Bibelverse<br />
auszulegen.<br />
25. Thomas Schirrmacher (Hrsg.): Bibeltreue in <strong>der</strong> Offensive. Die drei Chicago -<br />
Erklärungen zur<br />
a) Irrtumslosigkeit<br />
b) <strong>Hermeneutik</strong><br />
c) Anwendung<br />
Verlag für Kultur und Wissenschaft, biblia et symbiotica, Bonn, 1993.<br />
26. Helge Stadelmann: Grundlinien eines bibeltreuen Schriftverständnisses, Wuppertal, 3 1996<br />
(1985).<br />
27. Helge Stadelmann (Hrsg.): Den Sinn biblischer Texte verstehen. Eine Auseinan<strong>der</strong>setzung<br />
mit neuzeitlichen hermeneutischen Ansätzen, TVG, Brunnen Verlag, Gießen, 2006.<br />
<strong>Teil</strong> 1: Herausfor<strong>der</strong>ungen aus <strong>der</strong> Praxis:<br />
Kontextualisation in <strong>der</strong> missionarischen Kommunikation (Peter Beyerhaus); Die Wende vom Text<br />
zum Hörer: Der Paradigmenwechsel zur emanzipatorischen <strong>Hermeneutik</strong> in <strong>der</strong> Praktischen Theologie<br />
(Helge Stadelmann); Der Texttod <strong>der</strong> Predigt und seine Überwindung: Wilfried Engemanns semiotischhomiletische<br />
Konzeption (Thomas Richter).<br />
<strong>Teil</strong> 2: Der Sinn des Textes in den Bibelwissenschaften:<br />
Zur Verbindlichkeit kanonischer Texte: Der „sensus literalis“ und hypothetische Sinnschichten über<br />
bzw. unter dem Text in seiner kanonischen Gestalt (Herbert Klement); Der „sensus literalis“<br />
neutestamentlicher Texte angesichts <strong>der</strong> Herausfor<strong>der</strong>ung leseorientierter Ansätze in <strong>der</strong> Exegese<br />
(Roland Gebauer); Was ist <strong>der</strong> Sinn des Textes? Anmerkungen zur neutestamentlichen Exegese aus<br />
sprachwissenschaftlicher Sicht (Heinrich von Siebenthal).<br />
<strong>Teil</strong> 3: Theologisch-philosophische Hintergründe:<br />
Literalsinn und Klarheit <strong>der</strong> Schrift im Schriftverständnis von Martin Luther (Jochen Eber);<br />
Reformatorisches Schriftverständnis und neuzeitliche <strong>Hermeneutik</strong>: Die Bibel im Licht von Taufe und<br />
Abendmahl lesen (Bernhard Rothen); „Der Wille zur Macht“: Grundsätzliche postmo<strong>der</strong>ne<br />
nachmethaphysischer <strong>Hermeneutik</strong> nach Friedrich Nietzsche (Heinzpeter Hempelmann).<br />
28. Hans Steubing: Bekenntnisse <strong>der</strong> Kirche. Bekenntnistexte aus zwanzig Jahrhun<strong>der</strong>ten,<br />
Wuppertal, 1985.<br />
29. Peter Stuhlmacher: Vom Verstehen des Neuen Testaments - Eine <strong>Hermeneutik</strong>, NTD,<br />
Ergänzungsreihe 6, Vandenhoeck u. Ruprecht, Göttingen, 1986<br />
Diese <strong>Hermeneutik</strong> wird an den Universitäten verwendet. Es handelt sich um eine <strong>Hermeneutik</strong> des<br />
Einverständnisses. So beschreibt <strong>der</strong> Autor selber seinen hermeneutischen Ansatz. Er möchte mit den<br />
Texten <strong>der</strong> Bibel im Einverständnis sein. Gleichzeitig befindet sich <strong>der</strong> Autor aber auch im<br />
Einverständnis mit <strong>der</strong> historisch-kritischen Methode.<br />
30. John Wenham: Jesus und die Bibel, hänssler, Holzgerlingen, 2000.<br />
Das Buch von Wenham gehört zur Bibliologie aber auch zum Fach <strong>Hermeneutik</strong>. Er durchsucht die<br />
Evangelien und beleuchtet das Schriftverständnis von unserem HERRN JESUS Christus. Wie ging<br />
85
Siegfried F. Weber: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> <strong>Gewissheit</strong> – <strong>Teil</strong> 2<br />
JESUS mit dem AT um? Wie wandte ER das AT an? Und wie legte er es aus? Wir sollten von <strong>der</strong><br />
„<strong>Hermeneutik</strong>“ Jesu lernen.<br />
31. Georg Wieland: <strong>Hermeneutik</strong>, in: Lexikon für Theologie und Kirche, hg. v. Walter Kasper,<br />
Bd. V, Her<strong>der</strong>, Freiburg, 1996, Sp. 1-3.<br />
32. Oda Wischmeyer: <strong>Hermeneutik</strong> des Neuen Testaments. Ein Lehrbuch. Neutestamentliche<br />
Entwürfe zur Theologie 8. Francke, Tübingen/Basel 2004<br />
Wischmeyer versucht eine Synthese verschiedener Zugangsweisen, indem sie historisches,<br />
rezeptionsgeschichtliches, sachliches und textuelles Verstehen unterscheidet.<br />
33. Ruben Zimmermann: <strong>Hermeneutik</strong> <strong>der</strong> Gleichnisse Jesu, WUNT, Mohr Siebeck, 2008<br />
(660 S.).<br />
86


![Hermeneutik der Gewissheit.Teil_2.Juli.2[...]](https://img.yumpu.com/5351397/1/500x640/hermeneutik-der-gewissheitteil-2juli2.jpg)

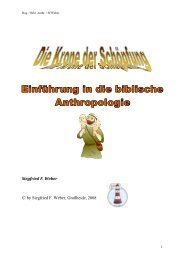
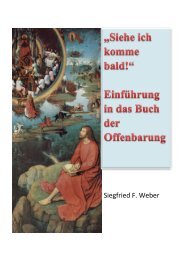
![Der Billardjunge aus Varel.Wie der Bapti[...]](https://img.yumpu.com/4629819/1/184x260/der-billardjunge-aus-varelwie-der-bapti.jpg?quality=85)


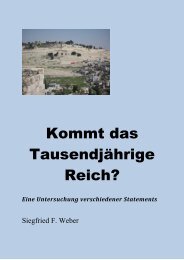
![Kaiser Augustus und die Ankunft des Rett[...]](https://img.yumpu.com/4557540/1/184x260/kaiser-augustus-und-die-ankunft-des-rett.jpg?quality=85)

