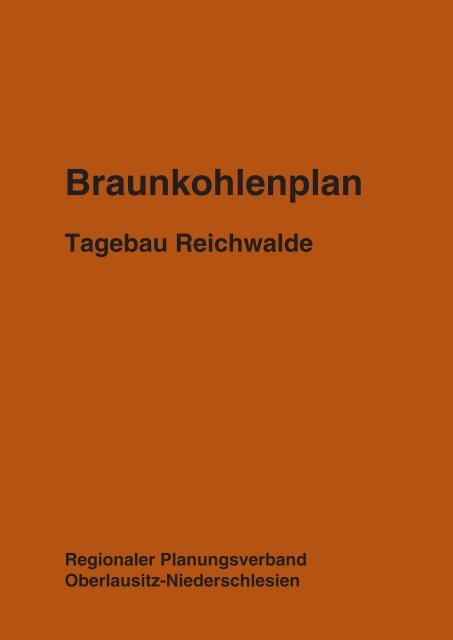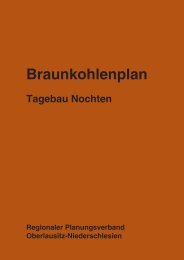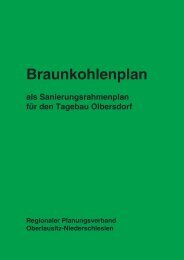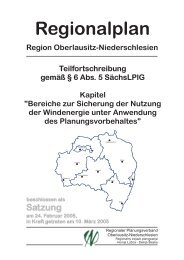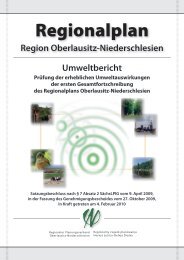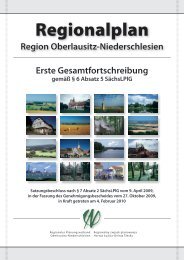Braunkohlenplan Tagebau Reichwalde - Regionaler ...
Braunkohlenplan Tagebau Reichwalde - Regionaler ...
Braunkohlenplan Tagebau Reichwalde - Regionaler ...
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Braunkohlenplan</strong><strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong><strong>Regionaler</strong> PlanungsverbandOberlausitz-NiederschlesienInternetfassung
<strong>Braunkohlenplan</strong><strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong>für das Vorhaben Weiterführung des<strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> 1994 bis AuslaufInternetfassung
Impressum:Der <strong>Braunkohlenplan</strong> <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> wurde erarbeitet von der RegionalenPlanungsstelle Oberlausitz-Niederschlesien im Auftrag des RegionalenPlanungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien.Anschrift des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien:Flugplatz Bautzen-LittenPF 13 4302603 BautzenInternetfassung
InhaltsverzeichnisInhaltSeiteÜbersicht über die Verfahrensschritte bis zur Genehmigungdes <strong>Braunkohlenplan</strong>es <strong>Reichwalde</strong>ISatzung über die Feststellung des <strong>Braunkohlenplan</strong>es <strong>Reichwalde</strong>IIIGenehmigung des <strong>Braunkohlenplan</strong>es <strong>Reichwalde</strong>IV<strong>Braunkohlenplan</strong> <strong>Reichwalde</strong> 1Internetfassung
Internetfassung
Internetfassung- I -
- II -Internetfassung
Internetfassung- III -
- IV -Internetfassung
Internetfassung- V -
- VI -Internetfassung
Internetfassung- VII -
- VIII -Internetfassung
Internetfassung- IX -
- X -Internetfassung
<strong>Braunkohlenplan</strong><strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong>für das Vorhaben Weiterführung des<strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> 1994 bis AuslaufVom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt undLandesentwicklung am 31.01.1994 genehmigt undfür verbindlich erklärtInternetfassung
Internetfassung
InhaltsübersichtPunkt Inhalt SeiteVorbemerkung 21 Allgemeine Angaben 31.1 Definition, Aufgabe und Inhalt des <strong>Braunkohlenplan</strong>es 31.2 Rechtsgrundlagen, rechtliche Wirkungen 51.3 Ausgangssituation für die Erarbeitung derBraunkohlenpläne 81.4 Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> 91.4.1 Darstellung der gegenwärtigen Situation 101.4.2 Untersuchte Abbauvarianten 151.5 Natur und Landschaft 181.5.1 Beschreibung von Natur und Landschaft vor Beginn des<strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> 181.5.2 Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft im Abbaugebietund im Einwirkungsbereich der Grundwasserabsenkung 192 Ziele des <strong>Braunkohlenplan</strong>es und deren Begründungen 242.1 Bergbau 242.2 Wasser 312.3 Natur und Landschaft 372.4 Staub- und Lärmimmission 422.5 Klima 442.6 Abfallwirtschaft und Abwässer 452.7 Archäologie und Denkmalpflege 462.8 Umsiedlungen und Infrastruktur 473 Quellenverzeichnis 504 Kartenverzeichnis 52Internetfassung
VorbemerkungEine der Voraussetzungen für die langfristige Weiterführung der <strong>Tagebau</strong>e Nochten und <strong>Reichwalde</strong>ist die Aufstellung von Braunkohlenplänen im Jahr 1993, die die landesplanerische Grundlage für diebergrechtlichen Betriebspläne bilden.Auf der Gründungsversammlung des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Nieder schlesien wurdeam 25.09.1992 auf der Grundlage des § 8 Abs. 1 SächsLPlG beschlossen, die Braunkohlenpläne fürdie <strong>Tagebau</strong>e Nochten und <strong>Reichwalde</strong> als Braunkohlenpläne erster Stufe zu erarbeiten.Ausgehend von dieser Zielstellung wurde der <strong>Braunkohlenplan</strong> <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> von der RegionalenPlanungsstelle Oberlausitz-Niederschlesien erarbeitet. Der hier vorliegende <strong>Braunkohlenplan</strong>enthält in beschreibender und zeichnerischer Form die in § 8 Abs.2 SächsLPlG vorgegebenen Mindestangaben.Der Braunkoh lenplan schließt nicht aus, daß Themenkomplexe, die in späte ren Phasendes Planungs zeitraumes relevant werden, zu gegebener Zeit als gesonderte räumliche und sachlicheTeilabschnitte in Fortschreibung des <strong>Braunkohlenplan</strong>es behandelt werden.Dem <strong>Braunkohlenplan</strong> liegen im wesentlichen zugrunde:- Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsenvom 24.06.1992- Beschluß der Verbandsversammlung vom 25.09.1992 zur Aufstellung des „<strong>Braunkohlenplan</strong>eserste Stufe“ im Jahr 1993- Leitlinien der Staatsregierung zur künftigen Braunkohlenpolitik in Sachsen vom02.06.1992- Leitlinien der Staatsregierung für den Abbau oberflächennaher Rohstoffe(Rohstoffsicherungskonzept) vom 13.07.1993- Energieprogramm Sachsen vom 06.04.1993- Zuarbeit der LAUBAG zum <strong>Braunkohlenplan</strong> für das Vorhaben Weiterführung des<strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> 1994 bis Auslauf vom 01. 12. 1992- Ergänzung zur Zuarbeit der LAUBAG zum <strong>Braunkohlenplan</strong> für das VorhabenWeiterführung des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> 1994 bis Auslauf vom 15. 01.1993Die Hinweise zu geographischen Koordinaten beziehen sich auf das Gauß - Krüger - Meridianstreifensystem.Die Höhenangaben erfolgen gemäß dem Normalhöhensystem 1976, bezogen auf den KronstädterPegel in HN.Internetfassung
Allgemeine Angaben - Definition, Aufgabe und Inhalt des <strong>Braunkohlenplan</strong>es 1.1Inhalt des <strong>Braunkohlenplan</strong>esEs besteht die Zielstellung, die Erfordernisse der langfristigen Energieversorgung mit denendes Umweltschutzes und der weiteren Raumnutzung in Einklang zu bringen.Im § 8 Abs.2 des SächsLPlG ist der Inhalt des <strong>Braunkohlenplan</strong>es wie folgt festgelegt:Braunkohlenpläne enthalten, soweit es für die geordnete <strong>Braunkohlenplan</strong>ung und die räumlicheEntwicklung der Bergbaufolgelandschaft im <strong>Braunkohlenplan</strong>gebiet erforderlich ist, in beschreibenderoder zeichnerischer Form, insbesondere Angaben und Festlegungen über:- Zielsetzungen des <strong>Braunkohlenplan</strong>es,- Abbaugrenzen und Sicherheitslinien des Abbaus, Grenzen der Grundwasserbeeinflus sung,Haldenflächen und deren Sicherheitslinien,- sachliche, räumliche und zeitliche Vorgaben,- Grundzüge der Oberflächengestaltung und Wiedernutzbarmachung, anzustrebende Landschaftsentwicklungim Rahmen der Rekultivierung des Plangebietes sowie den Wiederaufbauvon Siedlungen,- Räume, in denen Änderungen an Verkehrswegen, Vorflutern, Bahnen oder Leitungen allerArt vorzunehmen sind.Der <strong>Braunkohlenplan</strong> legt somit die Rahmenbedingungen in Form von Zielen der Raumordnungund Landesplanung fest, unter denen die als unverzicht bar erachtete Braunkohlengewinnunglangfristig sinnvoll ermöglicht wird und zugleich um welt- und sozialverträglich bleibt.Einem <strong>Braunkohlenplan</strong> müssen also umfangreiche Ab wägungs- und Entscheidungsprozessevorausgehen. Nur wenn der Braunkohlentagebau und die Vermei dung bzw. Minderung seinerbelastenden Wirkung als durchführbar festge stellt werden, kann der entsprechende <strong>Braunkohlenplan</strong>genehmigt werden.Im Regionalplan und damit auch im <strong>Braunkohlenplan</strong> können Vorrang- und Vorbehaltsgebieteausgewiesen werden.Vorranggebiet /-standort ist ein Gebiet oder Standort, in dem aufgrund raumstruktureller Erfordernisseeine bestimmte Aufgabe vorrangig vor anderen Aufgaben zu erfüllen ist und in demalle raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen mit der vorrangigen Zweckbe stimmungvereinbar sein müssen. Vorranggebiete sind Ziele der Raumordnung und Lan desplanung.Ziele sind verbindliche Festlegungen zur Ausgestaltung und Verwirklichung der Grundsätze derRaumordnung und Landesplanung.Sie sind Aussagen, die sachlich und räumlich bestimmt oder bestimmbar und raumbe deutsamsind. Sie sind aufeinander abgestimmt und dürfen sich in ihren Festlegungen nicht widersprechen.Ziele sind bei raumbedeutsamen Planungen von den im § 4 Abs.5 ROG ge nannten Stellenzu beachten, d. h. sie sind einer Abwägung nicht mehr zugänglich.Vorbehaltsgebiet/-standort ist ein Gebiet oder Standort, in dem einem bestimmten, überörtlichbedeutsamen, fachlichen Belang bei der Abwägung mit konkurrierendem Nutzungsan spruchbesonderes Gewicht beizumessen ist. Vorbehaltsgebiete sind Grundsätze der Raumordnungund Landesplanung.Grundsätze sind Leitvorstellungen zur Ordnung und Entwicklung des Raumes. Sie sind vonden in § 4 Abs.5 ROG genannten Stellen im Rahmen ihres Ermessens bei raumbedeutsamenPlanungen gegeneinander und untereinander abzuwägen.4 BlochInternetfassung
Allgemeine Angaben - Rechtsgrundlagen, rechtliche Wirkung 1.2Sied lungs- und Freiraumstruktur sowie deren Abstimmung mit den Verkehrs- und Versorgungsnetzener forderlich ist.Gegenwärtig wird für die Region Oberlausitz - Niederschlesien ein Regionalplan erarbeitet.Der Regionalplan beinhaltet Ziele der Raumordnung und Landesplanung, die für die gesamtePlanungsregion von Bedeutung sind und die demzufolge nicht im <strong>Braunkohlenplan</strong> enthaltensind. Da sich der Regionalplan für die Region Oberlausitz - Niederschlesien erst in Aufstellungbefindet, ist eine generelle Abstimmung des <strong>Braunkohlenplan</strong>es mit dem Regionalplan auf demWege einer Anpassung vorzunehmen. Die raumbedeutsamen Ziele des <strong>Braunkohlenplan</strong>essind, sofern erforderlich, nach seiner Verbindlicherklärung in den Regionalplan zu übernehmen.<strong>Braunkohlenplan</strong>ung:Ausgehend vom Inhalt der Regionalpläne stellen Braunkohlenpläne somit Teile der Regio nalplänedar. Im § 8 Abs.1 des SächsLPlG heißt es dazu:„Die Regionalen Planungsverbände Oberlausitz-Niederschlesien und Westsachsen sind verpflichtet,als Teile des Regionalplanes für jeden <strong>Tagebau</strong> im <strong>Braunkohlenplan</strong>gebiet (Abs. 3)einen <strong>Braunkohlenplan</strong> aufzustellen, bei einem stillgelegten oder stillzulegenden <strong>Tagebau</strong> alsSanierungsrahmenplan. Braunkohlenpläne sind auf der Grundlage langfristiger energiepolitischerVorgaben der Staatsregierung aufzustellen. Die für die Energiewirtschaft zuständigeoberste Landesbehörde kann Weisungen erteilen, soweit dies zur Durchsetzung der staatli chenEnergiepolitik erforderlich ist.“Im § 8 Abs.6 des SächsLPlG ist ausgeführt: „Der <strong>Braunkohlenplan</strong> soll vor Beginn, Fortfüh rungoder Abschluß eines Abbau- oder Sanierungsvorhabens im <strong>Braunkohlenplan</strong>gebiet auf gestelltund verbindlich erklärt sein. Die Betriebspläne der im <strong>Braunkohlenplan</strong>gebiet gelege nen Bergbauunternehmenoder die Sanierungsvorhaben sind mit dem Braunkohlen plan in Einklang zubringen. „Grundlage für die langfristige <strong>Braunkohlenplan</strong>ung bilden die Leitlinien der Staatsregierung zurkünftigen Braunkohlenpolitik in Sachsen vom 02.06.1992 sowie das Energieprogramm Sachsenvom 06.04.1993.Die vorrangige Aufstellung der Braunkohlenpläne wurde auf der konstituierenden Sitzung desRegionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Nieder schlesien am 25.09.1992 beschlossen. DieAusarbeitung wurde der Regionalen Planungsstelle Ober lausitz-Niederschlesien übertragen.Zuständiges Organ für die sachlichen und verfahrensmäßigen Entscheidungen zur Erarbei tungder Braunkohlenpläne sowie deren Aufstellung ist der Braunkohlenausschuß. Er stellt eine Erweiterungdes Planungsausschusses dar. Der <strong>Braunkohlenplan</strong> ist von der Verbandsversammlungdes Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien durch Satzung festzustellen.Verbindlicherklärung des <strong>Braunkohlenplan</strong>esIm § 9 Abs.1 des SächsLPlG heißt es:„Die Grundsätze und Ziele der Regionalpläne werden von der obersten Raumordnungs- undLandesplanungsbehörde im Einvernehmen mit den berührten Staatsministerien durch Genehmigungfür verbindlich erklärt, soweit der Regionalplan nach diesem Gesetz aufge stellt ist,sonstigen Rechtsvorschriften nicht widerspricht und sich in die angestrebte Ent wicklung desLandes einfügt, wie sie sich aus dem Landesentwicklungsplan und Fachlichen Entwicklungsplänensowie staatlichen Planungszielen aufgrund von Entscheidungen des Landtages, derStaatsregierung und der obersten Landesbehörde ergibt.“6 BlochInternetfassung
Allgemeine Angaben - Ausgangssituation für die Erarbeitung der Braunkohlenpläne 1.3Aufbauend auf die Grundaussagen der „Ökologischen Untersuchungen zum Beeinflussungsgebietdes <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> einschließlich Vorschlag zur Bergbaufolgelandschaft“ sind diesefortzuführen. Die notwendige Untersuchungstiefe ist gemäß Eingriffsregelung nach §§ 8 bis11 SächsNatSchG in den bergrechtlichen Betriebsplanverfahren mit den Naturschutzbehördenfestzulegen. Die Ergebnisse der weiteren Untersuchungen sind in die nachfolgenden Planverfahren,insbesondere in das bergrechtliche Betriebsplanverfahren einzubeziehen.1.3 Ausgangssituation für die Erarbeitung der BraunkohlenpläneSituation des Braunkohlenbergbaues in der sächsischen LausitzDie Braunkohleförderung, geprägt durch das Autarkiestreben in der Energieversorgung in derehemaligen DDR, war in der Vergangenheit einerseits die wichtigste Primärenergie grundlageund andererseits mit unverantwortbaren Eingriffen in die historisch gewachsene Siedlungsstruktursowie in Natur und Landschaft ver bunden, ohne angemessene Berücksichtigung ökologischerund sozialer Belange. Darüber hinaus blieb die Rekultivierung der abgebauten Flächenhinter der Inanspruchnahme von Flächen zurück.Dies führte zu Zerstörungen im Lebensraum, die auf Jahrzehnte große Anstrengungen in derEnergie-, Umwelt- und Landesentwicklungspolitik gemeinsam mit der Wirtschaft erfor dern.Zugleich muß die durch die vergangene Praxis verlorengegangene Akzeptanz des Braunkohlenbergbausin der Bevölkerung wiedergewonnen werden.Mit der Übernahme des Berg- und Umweltrechtes der Bundesrepublik Deutschland sind gesetzlicheRahmenbedingungen für das Ziel einer sicheren, preisgünstigeren, umweltgerechterenund ressourcenschonenden Energieversorgung in Sachsen geschaffen.Trotz wesentlicher Erweiterung konkurrierender Angebote und deutlicher Reduzierung der Förderungbleibt Braunkohle durch ihren Anteil an der Verstromung über die Jahrhundert wendehinaus wichtigster Primärenergieträger in Sachsen.Die Kohleförderung und Stromerzeugnung werden wesentlich zur Wertschöpfung in der Re gionOstsachsen beitragen und geben damit Tausenden Menschen in dieser Region in Tage bauen(<strong>Tagebau</strong> Nochten, <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong>, <strong>Tagebau</strong> Berzdorf und <strong>Tagebau</strong> Scheibe) und inKraftwerken Arbeit.Im nördlich an das ostsächsische Braunkohlenrevier angrenzenden Braunkohlenförder raumBrandenburgs bestehen ähnliche Ausgangspositionen.Im Freistaat Sachsen belaufen sich die wirtschaftlich verfügbaren Reserven des heimischenRohstoffes Braunkohle aus erschlossenen und nicht erschlossenen Feldern nach Aussage derLeitlinien der Staatsregierung zur künftigen Braunkohlenpolitik in Sachsen vom 02.06.1992auf insgesamt 8 100 Mio. t, davon entfallen 5 900 Mio. t auf die Region West sachsen und2 200 Mio. t auf die Region Oberlausitz-Niederschlesien.Die Staatsregierung bekennt sich in den Leitlinien zur künftigen Braunkohlenpolitik in Sach senzur langfristigen Fortführung des subventionsfreien Braunkohlenabbaus im wesentlich reduziertenUmfang.Folgende Prämissen sind im Zusammenhang mit dieser Grundsatzaussage zu beachten:Der Braunkohlenabbau, mit dem Ziel der langfristigen Konzentration auf wenige Abbau schwerpunkte,ist unter Prüfung aller Abbauvarianten umwelt- und sozialverträglich zu ge stalten, sodaß insbesondere8 BlochInternetfassung
Allgemeine Angaben - Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> 1.4- weitere Ortsverlegungen weitestgehend vermieden werden, jedenfalls gegen den Willen derüberwiegenden Mehrheit der betroffenen Bevölkerung nach Möglichkeit unterblei ben. VonUmsiedlungen betroffene Menschen müssen die Chance bekommen, in neuer Siedlungsgemeinschaftzusammenzufinden. Es müssen geeignete Entschädigungslö sungen angebotenwerden, die die Schaffung vergleichbaren Lebensraumes ermögli chen,- den Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Sanierung und Wiedernutzbarmachung Rechnunggetragen wird,- die wasserwirtschaftlichen Zusammenhänge und Erfordernisse beachtet werden,- noch vorhandene Kulturlandschaften möglichst erhalten und verbessert werden.Diese genannten Prämissen machen den Neubeginn bei gleichzeitiger Zukunftssicherung fürdie sächsische Braunkohle deutlich.Dadurch wird der notwendige Rahmen für die erforderliche Planungssicherheit der Wirt schaftwie auch der Landesentwicklung ermöglicht. Außerdem wird für die Altlastenbeseiti gung undRekultivierung die Kraft des aktiven Bergbaus nutzbar gemacht.Die Staatsregierung wird ihre landespolitischen Entscheidungen an einer gutachterlich abgeschätzten langfristigen Förderung in den sächsischen Revieren von insgesamt ca.40 - 45 Mio. t/a, (davon ca. 25 - 30 Mio. t in der Lausitz und ca. 15 Mio. t im Südraum von Leipzig),für etwa 30 Jahre ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der neu errichteten bzw. sa nier tenGroßkraft werke zur Stromerzeugung orientieren.Diese Braunkohlenmenge sichert die ausreichend langfristige Versorgung der neu errichte tenbzw. ertüchtigten Großkraftwerke in beiden Revieren.Am Standort Boxberg hat das zuständige Unternehmen Vereinigte Energiewerke Aktiengesellschaft die Entscheidung getroffen, zwei 500-MW-Blöcke nach dem modernsten Stand derTechnik nachzurüsten und zusätzlich ein hoch modernes Kraftwerk mit 2 x 800 MW-Blockeinheitenzu errichten und zu betreiben.Dies bedeutet, daß dafür als Förderzentren in der sächsischen Lausitz die zwei <strong>Tagebau</strong>eNochten und <strong>Reichwalde</strong> langfristig betrieben werden.Im Energieprogramm Sachsen vom 06.04.1993 heißt es u. a.:„In Ostsachsen liegen im Bereich der <strong>Tagebau</strong>e Nochten und <strong>Reichwalde</strong> so große Vorräte(nach 2010 noch über 800 Mio. t lt. Berechnungen der LAUBAG), daß damit nach der Generationder bis 2000 zu installierenden 800-MW-Blöcke bezüglich der Vorräte eine weitereKraftwerksgeneration (Gas-Dampfturbinen-Kraftwerk) versorgt werden könnte. Das würde bedeuten,daß dann der Braunkohlenbergbau bis über die Mitte des kommenden Jahrhundertshinaus betrieben werden könnte.“Als landesplanerische Grundlage für die Weiterführung der o. a. <strong>Tagebau</strong>e ab 01.01.1994 ist esnotwendig, im Jahr 1993 Braunkohlenpläne zu erarbeiten und für verbindlich zu erklä ren.1.4 Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong>Die Abbauplanung im <strong>Braunkohlenplan</strong> schließt an die- Raumordnerische Beurteilung 1992/93 des Regierungspräsidiums Dresden vom18.05.1992 und an- den Hauptbetriebsplan 1992/93, zugelassen vom Bergamt Hoyerswerda am 19.06.92un ter der Nr. 1386/92 an.BlochInternetfassung9
Allgemeine Angaben - Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> 1.4Abb. 1:Braunkohlenreviere in der Bundesrepublik DeutschlandQuelle: Jahrbuch Bergbau, Öl und Gas, Elektrizität, Chemie; 99. Jg. (1992)BlochInternetfassung11
Allgemeine Angaben - Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> 1.4Geologischer Aufbau der Lagerstätte und geohydrologische VerhältnisseDie Schichtenfolge der Ablagerungen geht aus dem Normalprofil des Kohlefeldes <strong>Reichwalde</strong>in Abbildung 2 hervor. Das in Abbau befindliche 2. Lausitzer Flöz ist im Durch schnitt 9 bis 10 mmächtig. Es ist eine generelle Abnahme der Flözmächtigkeit von Nord westen nach Süd osten zuerkennen. Im Osten des Abbauraumes beträgt sie noch ca. 7 m. Im Zentralteil der Lagerstätteist in einer NNE-SSW-gerichteten Zone das Mittel zwischen dem 2. Lausitzer Flöz und dem Unterbegleiternicht ausgebildet, das 2. Lausitzer Flöz er reicht in diesem Bereich Mächtigkeiten bis12 m. Die tertiäre Schichtenfolge ist im wesentli chen ungestört. Beherr schendes Strukturelementdes Kohlefeldes ist die Zweibrückener Rinne. Sie trennt die nördli che von der „südlichentertiären Hochfläche“ und ist durch die- vollständige Erosion der tertiären Hangendabfolge,- teilweise Erosion des Flözesgekennzeichnet.Der Einsatz der miozänen Kohle erfolgt als Kesselkohle. Sie besitzt folgende Qualitätsparameter(Durchschnittswerte, bezogen auf grubenfeuchte Kohle):- Heizwert 8200 kJ/kg- Wassergehalt 56,0 %- Aschegehalt 6,8 %- Schwefelgehalt 1,1 %Typisch für das 2. Lausitzer Flöz des Kohlefeldes <strong>Reichwalde</strong> ist der hohe Xylitgehalt.Das Baufeld <strong>Reichwalde</strong> kann nach den Ablagerungsverhältnissen des Abraumes in fol gendeBereiche gegliedert werden:Bereich durchschnittliche Deckgebirgsmächtigkeitbindige Anteilesüdliche tertiäreHochfläche 40 m - 45 m 25 % - 30 %Zentralteil(ZweibrückenerRinne)60 m - 65 m 10 % - 15 %nördliche tertiäreHochfläche 65 m - 70 m 15 % - 20 %Materialfeinsandig bisschluffig (Tertiär);sandig (Pleistozän)Sande bis Kiese; es fehlender Hangend-schluffund die tertiä ren Schichtensandig, mit Hangendschluffund tertiärenHangendschichtenAm Südrand des Südfeldes reicht in einem schmalen Streifen Geschiebemergel in das Abbaugebiet,so daß lokal bindige Anteile von 60 bis 65 % auftreten.Das Mittel zwischen dem 2. Lausitzer Flöz und dem Unterbegleiter besteht überwiegend ausSchluffen, in Ausnahmen aus Feinsand.Das am Südrand des Lausitzer Urstromtales gelegene Kohlefeld <strong>Reichwalde</strong> wird von plei stozänenAuswaschungsrinnen begrenzt.12 BlochInternetfassung
Allgemeine Angaben - Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> 1.4Dazu gehören:- im NW die Schadendorfer und Nochten-Pecherne Rinne- im SW die Boxberg-Krebaer Rinne und abzweigend davon die<strong>Reichwalde</strong>r und Koseler Rinne,- im E die Daubitzer und Weißkeißel-Steinbacher Rinne und- als äußerste östliche Begrenzung die Uhsmannsdorfer Rinne.Über die östlichen Rinnen besteht eine direkte Verbindung zur Lausitzer Neiße. Mit Ausnahmeder südlichen Rinnen sind in ihnen überwiegend Sande und Kiese der El ster- und Saale 1-Kaltzeitabgelagert. In der Boxberg-Krebaer und <strong>Reichwalde</strong>r Rinne sind mäch tige grundwasserstauendeHorizonte anzutreffen. Die pleistozänen Rinnen trennen das Kohlefeld <strong>Reichwalde</strong>von den Kohlefeldern Bärwalde im SW, Nochten im NW und Pechern im NE.Den Übergang vom Feld zur Rinne bildet ein umfangreiches Altmoränengebiet mit den dafürtypischen Ablagerungen. Im Osten schließt sich die Petershainer Saale-Endmoräne an. DieseFormationen bilden eine hydraulische Barriere gegen ein Übergreifen der Entwässerungswirkungnach Süden auf das Gebiet der Lausitzer Heide- und Teichlandschaft.Die Beeinflussung der Umgebung erfolgt überwiegend durch die Absenkung des Hangendgrundwasserleiters,da über die genannten Auswaschungsrinnen eine Kommunikation zwischenHangend- und Liegendgrundwasserleiter (einschließlich der Spremberger Folge mitGrundwasserleiter 700) erfolgt. Somit ergeben sich im Hangenden und Liegenden gleiche Absenkungsreichweiten.Auswirkungen der Grundwasserabsenkung auf das Gebiet der RepublikPolen können somit ausgeschlossen werden.Den Haupthangend-Grundwasserleiter bilden im Abbaubereich des Feldes <strong>Reichwalde</strong> die pleistozänenAblagerungen (GWL 122 und 13 - Obere und Untere Talsande). Im Nord- und Südteildes Fel des nimmt der Anteil der tertiären GWL (321 und 41, 42, 43) und damit eine Verbreitungder bindigen Schichten zu. In den Rinnen lagern unter den Talsanden Schluffe mit Kiesein lagerungen,Sande sowie Geschiebemergel und Tertiärschollen der Elster- bzw. Saale 1-Kaltzeit(GWL 15, 16, 17).Im südöstlichen Raum sind Relikte der Raunoer Folge verbreitet, die teilweise bis zur Ge ländeoberflächeanstehen. Ausgedehnte Binnendünenfelder, bestehend aus Parabel- und Strichdünen,überlagern die genannten GWL im nördlichen Einzugsgebiet. Das übrige Gebiet weistnur vereinzelt Dünenbildun gen auf.Holozäne Bildungen sind als Torfe, Auelehme und humose Sande im Bereich des Weißen undSchwarzen Schöps sowie ihrer Zuflüsse anzutreffen.Die beschriebene GWL-Abfolge ist im Normalprofil (Abb. 2) dargestellt.Der Kohlevorrat in den einzelnen Feldesteilen der Lagerstätte beträgt nach Angaben derLAUBAG ca. 429 Mio. t bezogen auf den 01.01.1994. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden bzw.werden seit Aufnahme der Kohleförderung im Oktober 1987 aus <strong>Reichwalde</strong>-Süd ca. 69 Mio. tRohbraunkohle gefördert.BlochInternetfassung13
Allgemeine Angaben - Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> 1.414 BlochInternetfassung
Allgemeine Angaben - Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> 1.4Die Förderkapazität des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> beträgt 14 Mio. t/Jahr. Die gewonnene Kohlewird hauptsächlich zur Verstromung im ca. 6 km entfernten Kraftwerk Boxberg - ge genwärtigeKapazität 3 520 MW - eingesetzt.Bergbauliche Maßnahmen werden im <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> seit 1980, dem Beginn der für einen<strong>Tagebau</strong>betrieb notwendigen Entwässerungsmaßnahmen durchgeführt. Die Auf schlußbaggerung,bei der ca. 40 Mio m³ Abraummassen mit einem Bandbetrieb auf die Au ßenhalde<strong>Reichwalde</strong> transportiert wurden, erfolgte von 1985 bis 1987, mit der Rohkohle förderung wurdeim Oktober 1987 begonnen. Nach Fertigstellung der 60-m-Abraumförder brücke ging diese imJuli 1988 in Betrieb.Für eine Wiedernutzbarmachung der Kippenfläche wird entgegen den früheren Planungen abJanuar 1993 ein Vorschnitt betrieben, mit dessen Massen die Brückenkippe überzogen wird.Mit der Aufnahme des Vorschnittbetriebes ist der <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> gerätetechnisch wiefolgt ausgestattet:Die Vorschnittmassen werden mit einem Schaufelradbagger SRs 702 bzw. SRs 400 gewonnen,mittels ei ner Bandanlage zum Absetzer A2RsB 10 000 transportiert und von dort auf dievorhandene Brückenkippe verstürzt. Erst mit dem Abbau des Nordfeldes, etwa im Jahre 2005,ist sowohl aus Kapazitätsgründen als auch wegen der großen Abtragsmächtigkeit der Einsatzeines SRs 2000 erforderlich.Durch die 60 m Abraumförderbrücke mit ihren 2 Eimerkettenbaggern Es 3750 erfolgt die Abraumbaggerungmit anschließendem Direktversturz der Massen auf die Kippe.Zur Kohlegewinnung sind 2 Schaufelradbagger SRs 1301 und 3 Eimerkettenbagger ERs 710eingesetzt. Die gewonnene Kohle wird über eine Bandanlage den Kohleverladungen I und IIzugeführt. Die Rohbraunkohle wird im Zugbetrieb zum Kraftwerk Boxberg transportiert.Bis zum 31.12.1993 erfolgt durch den <strong>Tagebau</strong>betrieb voraussichtlich eine Flächeninanspruchnahmevon 1131 ha, davon 181 ha für die ca. 4 km nördlich von Schadendorf liegende Außenhalde.Die Flächenrückgabe wird bis zu diesem Zeitraum 280 ha betragen. Als betrieblichgenutzte Flächen, d.h. Flä chen für Randstreifen, Tages-, Entwässerungs-, Versorgungs- undVerkehrsanlagen wer den bis Ende 1993 840 ha benötigt.1.4.2 Untersuchte AbbauvariantenDie vom Bergbauunternehmen LAUBAG am 01.12.92 bzw. am 15.01.93 an die Regionale Planungsstelleübergebenen Unterlagen „Zuarbeit zum <strong>Braunkohlenplan</strong>“ und „Ergänzung zur Zuarbeitzum <strong>Braunkohlenplan</strong>“ für die Weiterführung des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> 1994 bis Auslaufenthalten neben der vom Unternehmen konzipierten Grundvariante der vollen Aus schöpfungder Lagerstätte noch weitere Varianten. Die Varianten haben folgende Be zeich nung:Variante 1- Grundvariante mit Inanspruchnahme Hammerstadt und TeichgebietFür die bei dieser Variante vom Abbau betroffenen Einwohner von Hammerstadtist eine sozial verträglich zu gestaltende Umsiedlung erforderlich. Fürdas Teichgebiet sowie die vorhandenen schützenswerten Tier- und Pflanzenartensind geeignete Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen notwendig.BlochInternetfassung15
Allgemeine Angaben - Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> 1.4Variante 2.1- keine Inanspruchnahme von Hammerstadt und des größten Teiles desTeichgebietesDie Variante 2.1 ist technologisch möglich. Die Wasserversorgung der nichtvom Abbau betroffenen Teiche kann durch die Bereitstellung der notwendigenAusgleichswassermengen gesichert werden.Variante 2.2- keine Inanspruchnahme von Hammerstadt, teilweise Inanspruchnahmedes TeichgebietesAuch die Variante 2.2 ist technologisch durchführbar. Bei dieser Variantekommt es zur Inanspruchnahme eines Teiles der Teichfläche, dabei sind sowohldie notwendigen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen entsprechend derVariante 1 durchzuführen als auch die entsprechenden Ausgleichswassermengenfür die nicht vom Abbau betroffenen Teiche bereitzustellenVariante 2.3- Erhalt der Ortschaften Viereichen, Altliebel und Hammerstadt sowie desTeichgebietesDie Durchführung dieser Variante ist mit unverhältnismäßig hohen Aufwendungenverbunden. Bedingt durch den erreichten Abbaustand wären dieArbeiten zur Umstellung des <strong>Tagebau</strong>es auf diese Variante der Abbauführungnur unter technologischen Erschwernissen, die bis zu einer zeitweiligenStundung des <strong>Tagebau</strong>es führen würden, noch realisierbar. Ergänzend ist zubemerken, daß sich der überwiegende Teil der Bevölkerung von Altliebel undViereichen in einer Umfrage für eine Umsiedlung ausgesprochen hat.Die bei den Varianten 1, 2.1, 2.2 und 2.3 auftretenden Vorratsverluste, die notwendigentechnologi schen und terminlichen Zwangspunkte sowie die (soweit untersucht) wirtschaftlichenKon se quenzen sind in der nachfolgenden Tabelle auf Seite 17 dargestellt.Als ein zu beachtender Faktor zur Vollständigkeit des <strong>Braunkohlenplan</strong>verfahrens wurde imFebruar 1993 in der Ortschaft Hammerstadt eine Haushaltsbefragung durchgeführt. Als Auftragnehmerfungierte die „Städtebauliche Arbeitsgemeinschaft Dr. Thünker/Dr. Hecken bücker“aus Meckenheim-Merl. Die Durchführung oblag der Firma „Produkt + Markt“ aus Wallen horst/Osnabrück. Von insgesamt 42 Haushalten wurden 41 befragt; ein Haushalt konnte nicht erreichtwerden. Die Befragung erbrachte, daß sich von den 41 Haushalten 33 (80 %) für einen Verbleibin Hammerstadt sowie 8 (20 %) für eine Umsiedlung ausspra chen.Dem Entwurf des <strong>Braunkohlenplan</strong>es vom 14.06.1993 wurde nach Erörterung der inhaltlichenAussagen der einzelnen Varianten mit Beschluß des Braunkohlenausschusses vom 30.04.1993die Variante 2.2 der <strong>Tagebau</strong>weiterführung zugrunde gelegt.16 BlochInternetfassung
Allgemeine Angaben - Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> 1.4BlochInternetfassung17
Allgemeine Angaben - Natur und Landschaft 1.5Im Rahmen des Beteiligungsverfahrens wurde vom Bergbauunternehmen ein „Programm fürdie bergbaulichen Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmen im Bereich Hammerstadt“ mit DatumSeptember 1993 als Modifizierung der Variante 2.2. mit folgenden wesentlichen Inhalten erarbeitet:- Einziehen der Abbaukante westlich von Hammerstadt und Minimierung des Sicherheitsstreifensum etwa 32 ha - damit Erhalt von Teichflächen in der Größenordnung von 53,4 ha unddes Altlaufes der Raklitza, verbunden mit einem Kohleverlust von 3 Mio. t,- Erweiterung des Abbaugebietes südwestlich der Teichgruppe Hammerstadt um die gleicheFläche mit einem gewinnbaren Lagerstätteninhalt von 3 Mio. t Braunkohle,- Möglichkeit der Schaffung von Ersatzteichen in einer Größe von 27 ha,- Gestaltung eines temporären Feuchtgebietes westlich von Hammerstadt von ca. 22 ha,- veränderte Lage des Restsees durch eine Verlagerung des Drehpunktes an die Nordmarkscheidedes <strong>Tagebau</strong>es (damit verbunden ist eine Reduzierung der Staub- und Lärmbelastungim Bereich Hammerstadt).Dem <strong>Braunkohlenplan</strong> wird nach Abwägung der einzelnen Grundsätze nach § 2 Abs. 1 ROGunter Einbeziehung des Ergebnisses der Erörterungsverhandlung am 24.09.1993 eine Präzisierungder modifizierten Variante 2.2 bei Inkaufnahme eines Lagerstättenverlustes von 3 Mio.t Braunkohle Rechnung getragen.Die eventuelle Inanspruchnahme einer über die Abbaubegrenzung und Sicherheitslinie desvorliegenden <strong>Braunkohlenplan</strong>es hinausgehenden Fläche südwestlich von Hammerstadt miteinem gewinnbaren Lagerstättenanteil von 3 Mio. t Braunkohle ist Gegenstand einer Fortschreibungdes <strong>Braunkohlenplan</strong>es im Jahr 1994.1.5 Natur und Landschaft1.5.1 Beschreibung von Natur und Landschaft vor Beginn des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong>Das Abbau- und Beeinflussungsgebiet des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> ist naturräumlich in dieOberlausitzer Heide- und Teichlandschaft im Südfeld und in die Muskauer Heide im Nord- undNordostfeld gegliedert. Durch die Jahrhunderte währende Tätigkeit des Menschen ent standenin diesen Gebieten Kulturlandschaften. Als Ausgangspunkt für die Bewertung des Zustandesvon Natur und Landschaft vor Beginn der bergbaulichen Tätigkeit wurde anhand von TopographischenKarten und Veröffentlichungen der Zeitraum 1937/1940 gewählt. Er widerspiegelteine Landschaftsstruktur, die durch eine hohe Arten- und Standortvielfalt ge kennzeichnet war.Im Gebiet des Südfeldes wies die Landschafts- und Nutzungsstruktur um 1940 folgende Merkmaleauf:Die grundwassernahen Standorte im Bereich der Flußauen des Weißen und Schwarzen Schöpses,der Raklitza sowie der zahlreichen Fließe waren von Mooren, Feuchtwiesen und ausgebautenTeichsystemen für die Fischzucht durchsetzt. In unmittelbarer Ortsnähe be fanden sichAckerflächen.Die Teichareale bei <strong>Reichwalde</strong>, Altliebel, Wunscha, Publik und Hammerstadt waren mit ihrenVerlandungszonen Lebensraum für viele vom Aussterben bedrohte Arten. Die Feuchtwiesenauf den nährstoffarmen Sandböden hatten seltene Gräser- und Blütenpflan zenbestände.Die durch Bäume und Sträucher aufgelockerten Weiden und Felder boten inVer bindung mit der Ufervegetation der Fließe und Stillgewässer ideale Möglichkeitenzum geneti schen Austausch von Tieren und Pflanzen. Die mannigfaltige Vernetzung der18 BlochInternetfassung
Allgemeine Angaben - Natur und Landschaft 1.5einzelnen Landschaftselemente förderte die Entfaltung artenreicher und vielgestaltiger Biozönosen.Die das Gebiet vielfältig auflockernden Waldflächen wurden bereits im vorigen Jahrhundert imZuge der Aufforstungsarbeiten mit Kiefern bestockt. Die Flächenstruktur des Südfeldes gliedertesich vor ca. 40 Jahren wie folgt auf:Wald ca. 40 %Acker ca. 20 %Gewässer ca. 20 %Feuchtwiesen ca. 15 %Moore und Torfstiche ca. 5 %Die Teilfelder <strong>Reichwalde</strong>-Nord und <strong>Reichwalde</strong>-Nordost befinden sich ausschließlich im Gebietder Muskauer Heide. Dieses größte Binnendünengebiet Deutschlands und gleich zeitig einesder größten zusammenhängenden Kiefernwaldgebiete ist bei Geländehöhen von +135 bis+162 m HN morphologisch mit einem Kleinkuppenrelief stark strukturiert.Je nach der Nähe zum Grundwasserstand und durch Staunässe bildeten sich Heideflächenoder Moore heraus. Die Kiefernforste wurden ebenfalls im vorigen Jahrhundert angepflanzt undwaren von einem gleichmäßigen Wirtschaftswegenetz durchsetzt.Die vorindustrielle Produktion in der Landwirtschaft war die Basis für die Entwicklung offe nerZwergstrauchheiden. Die Schafhaltung verhinderte in den Heiden den Birken- und Grasaufwuchs,so daß sich an hellen Standorten prächtige Ericagesellschaften herausbildeten.Eine Flächenzerschneidung durch Fernstraßen im zentralen Bereich des Abbaugebietes warnoch nicht gegeben. Es befanden sich nur unterhaltene Fahrwege in dem Gebiet. Die ReichsbahntrasseWeißwasser--Görlitz und die Fernstraße 115 führt im östlichen Teil durch die zusammenhängendeWaldfläche.1.5.2 Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft im Abbaugebiet und imEinwirkungsbereich der GrundwasserabsenkungLandschaftsbild sowie Flora und FaunaDas ehemals geschlossene Waldgebiet der Muskauer Heide im nördlichen Teil der Lager stätteist durch jahrzehntelange militärische Nutzung aufgerissen worden. Es entstanden große Freiflächen.Charakteristische Elemente sind Calluna-Heiden, Binnendünen, Kiefern forste, Trockenrasensowie Reste der naturnahen Kiefernwälder oder Kiefern-Fichtenwälder.Im unberührten Zustand zeigt die Calluna-Heide einen lockeren Bestand an Birken- und Kiefernverjüngung.In der Bodenflora überwiegt das Heidekraut. Die Vielfalt der Landschaft zeigteine interessante Fauna. Neben einem breiten Spektrum geschützter sowie vom Aussterbenbedrohter Tierarten ist hier vor allem die größte intakte Flachlandpopulation des Birkhuhnes inDeutschland erwähnenswert.Die südlichste Kette des Binnendünengebietes, etwa im Bereich nördlich des verlegten WeißenSchöpses, bildet eine deutliche Grenze zur südlich anschließenden Oberlausitzer Heide- undTeichlandschaft.Das Gebiet der Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft ist vom Ursprung her durch grö ßereAnteile von Talsanden mit geringen Grundwasserflurabständen charakterisiert. Typi sche Formenelementeder flachwellig-ebenen Heide- und Teichlandschaft sind breite Tal niederungenund nur wenig höher liegende Sandflächen. Charakteristisch für die Land schaft ist die Auflockerungder Waldgebiete durch eingestreute Ackersiedlungen und Teichflächen.BlochInternetfassung19
Allgemeine Angaben - Natur und Landschaft 1.5Die Vegetation im Verlandungsbereich der Teichgebiete setzt sich hauptsächlich aus weit verbreitetenSumpf- und Wasserpflanzen zusammen. Das offene Wasser der Teiche um säumenSchilfgürtel. In den Uferzonen der Teichgruppen sind u. a. Schwarzerle, Stieleiche, Eberesche,Birke und Robinie die vorherrschenden Gehölzarten. Lokal liegen zwischen den Teichen versumpfteFeucht- und Naßwiesen.Bei den dominierenden Kiefernforsten sind die grundwasserbeeinflußten Standorte dem Kie fern-Fichtenwald, auf trockenen Standorten dem Zwergstrauch-Kiefernwald ähnlich. Be ach tenswertsind Inselvorkommen ehemals großer Fichtenwaldgebiete in der Umgebung der Raklitza westlichvon Rietschen.Bemerkenswert ist der Artenreichtum der Auenvegetation im Verlauf von Schöps und Raklitza.Neben verschiedenen Weidenarten sind die unverbauten Flußläufe und Altwas serarme überwiegendmit Stieleiche, Eberesche, Gemeiner Esche, Faulbaum, Birke, Schwarzem Holunder,Später Traubenkirsche, Zitterpappel und Kiefer bestockt. In der ar tenreichen Krautschicht tre tenvereinzelt Heidenelke, Echter Baldrian und Sumpfschafgarbe auf.Die Fauna ist insbesondere im Bereich der Teichgebiete durch ein reiches Artenspektrum derVogelarten charakterisiert. Wesentlichen Anteil haben hierbei die Sumpf- und Wasser vögel.Die Teichgebiete sind ein bevorzugtes Nahrungsreservat und Raststätte für Fischad ler und dieReiher der Kolonie <strong>Reichwalde</strong>. Eine Vielzahl von Vogelarten nutzt das Territo rium als Brut platzbzw. als Sammel- und Nahrungsgebiet während des Vogelzuges.GrundwasserflurabständeDie Grundwasserflurabstände lassen sich im Beeinflussungsgebiet in vier Bereiche aufgliedern:. flurfern (größer 5 m) im Verbreitungsgebiet der Binnendünen und der glazialenHochflächen mit natürlichen, schon im vorbergbaulichen Zustand flurfernenGrundwasserständen und durch Entwässerung verursachten flurfernen Standorten. flurnah im Tal der Lausitzer Neiße. flurnah in großflächigen Niederungsgebieten, die durch Flußbereiche des Weißen undSchwarzen Schöpses sowie ihrer Nebenarme geprägt wurden. flurnahe, niederschlagsabhängige Bereiche auf den glazialen Hochflächen und derPetershainer EndmoräneDie Grundwasserflurabstände unterliegen seit dem Beginn der bergbaulichen Tätigkeit ei ner Beeinflussung.Jedoch vermindern oberflächennah anstehende, wasserstauende Schichten einesolche flächenhafte Absenkung, wie dies im Hauptgrundwasserleiter der Fall ist. Eine zu sätzlichstauende Wirkung üben die Deformationen der tertiären Schichten und pleistozänen bindigenAblagerungen am südlichen Feldesrand aus. Auf der südlich des Ta gebaues anste henden Endmoränesind weitflächig verbreitete flurnahe Grundwasserab stände anzutreffen. Sie stehen mitder großräumigen, vom Bergbau beeinflußten Grund wasserströmung nicht in Zusammenhang.Die Wasserversorgung dieser Gebiete ist aus schließlich vom Niederschlag abhängig.Schutzgebiete und BiotopeEine vorläufige Übersicht der vorkommenden Schutzgebiete und Biotope ist in den vom Bergbautreibendenvorgelegten ökologischen Untersuchungen enthalten.Das infolge einer geringen Wirtschaftstätigkeit örtlich vorhandene naturnahe Mosaik aus FeuchtundNaßwiesen, Moorflächen, Teichen, Heiden und Binnendünen führte in der Re gion zu verstärkterAusweisung bzw. Beantragung von Schutzgebieten und Flächennatur denkmalen.Im Abbaubereich des <strong>Tagebau</strong>es befinden sich keine festgesetzten Naturschutzgebiete.Das einstweilig gesicherte Naturschutzgebiet „Muskauer Heide“ liegt im Bereich derGrund wasser beeinflussung. Festgesetzte Landschaftsschutzgebiete liegen ebenfalls nicht20 BlochInternetfassung
Allgemeine Angaben - Natur und Landschaft 1.5im Ab baube reich. Im Beeinflussungsbereich der Wasserabsenkung befindet sich das Boxberg-Reich walder Wald- und Wiesengebiet. Für dieses Gebiet ist durch die untere Naturschutzbehördeeine Flächenerweiterung vorgesehen, die sich beginnend östlich von <strong>Reichwalde</strong> überNeuliebel, Hammerstadt und Daubitz bis in das Teichgebiet Niederspree erstreckt. Damit liegenTeilbereiche dieser Erweiterung im geplanten Abbaubereich sowie im Gebiet der Grundwasserbeeinflussung.Durch die ebenfalls beantragte Schutzgebietserweiterung des LandschaftsschutzgebietesNeißeaue liegen diese Teile im Grundwasserbeeinflus sungsgebiet.Das den Ort Hammerstadt umgebende Teichgebiet stellt einen wichtigen Teil des Planungsgebietes„Naturschutzgroßprojekt Niederspree“ dar. Damit ist es eingebunden in das Förderprogrammdes Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit für „Naturschutzgroßprojekteim Rahmen der Errichtung und Sicherung schutzwürdiger Teile von Naturund Landschaft mit gesamtstaatlich repräsentativer Bedeutung“. Die Bezeichnung „gesamtstaatlichrepräsentativ“ bedeutet, daß es sich um großräumige Natur- bzw. Kulturlandschaftenhandelt, die für den Naturschutz und die Landschaftspflege, insbesondere Biotop- und Artenschutzeinen herausragenden Wert besitzen. Die hohe ökologische Wertigkeit der TeichgruppeHammerstadt ergibt sich nicht nur aus dem Vorkommen von ca. 40 bis 50 Tier- und Pflanzenarten,die in den Roten Listen des Freistaates Sachsen stehen, sondern vor allem durch dieenge Verflechtung von Biotoptypen innerhalb der Teichgruppe, die Verknüpfung mit den anderenTeichgruppen im Projektgebiet und mit dem Naturraum Muskauer Heide. Unmittelbar südwestlichdes Teichgebietes Hammerstadt schließt sich das Biosphärenreservat „OberlausitzerHeide- und Teichlandschaft“ an. Mit der unmittelbaren Nähe zur Muskauer Heide besteht eineenge Verzahnung unterschiedlicher Naturräume, die überregionale Bedeutung besitzt. Dieseräumliche Nähe und die damit verbundene Gewährleistung von Austauschbewegungen bedingteine hohe Artenmannigfaltigkeit von Flora und Fauna.Von den nach § 20 c Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) sowie § 26 SächsNatSchG ökologischbedeutsamen Biotopen, die durch die Biotopkartierung des Freistaates Sachsen bishererfaßt wurden, liegen folgende im Abbaubereich:- Feuchtgebiet Altliebel- Buchenwäldchen nördlich Viereichen- Teile der Teichgruppe Hammerstadt- Gehölzbiotop „Stachelbeergarten“- Binnendünengebiet und ZwergstrauchheideAußerhalb des Abbaubereiches sind von der Grundwasserabsenkung folgende Biotope bzw.Flächennaturdenkmale betroffen:- Teile der Teichgruppe Hammerstadt- Flußverlauf Vereinigter Schöps (geringe Beeinflussung)- Reiherkolonie bei <strong>Reichwalde</strong> (Flächennaturdenkmal)- naturnaher Uferverlauf des Schwarzen Schöps südlich <strong>Reichwalde</strong>- Oberteich <strong>Reichwalde</strong> (geringe Beeinflussung)- Koboldteich (geringe Beeinflussung)- Tongrube <strong>Reichwalde</strong> (geringe Beeinflussung)- Schwarze Löcher Rietschen (Flächennaturdenkmal)- Erlenbruchwald Rietschen- Torfstich Rietschen- Tümpel nordwestlich Rietschen- Oberteich Rietschen- Teichgruppe Rietschen- Fichtenwald Rietschen- naturnaher Verlauf der Raklitza bis Einmündung bei Hammerstadt.BlochInternetfassung21
Allgemeine Angaben - Natur und Landschaft 1.5Beschreibung der Auswirkungen des Abbaues auf Natur und LandschaftNach Auswertung vorhandener Unterlagen sowie durchgeführten Abstimmungen mit Naturschutzbehördenund Kommunen gibt es folgende Auswirkungen des <strong>Tagebau</strong>es auf den NaturundWasserhaushalt:- Im direkten Abbaugebiet einschließlich der <strong>Tagebau</strong>randbebauung und auf den Flächen derBetriebsanlagen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt ca. 40 % von der im Feld <strong>Reichwalde</strong>-Südliegenden vielfältig strukturierten Heide- und Teichlandschaft verloren ge gangen. Das betrifftinsbesondere große Areale der Schöpsauen zwischen Schadendorf und <strong>Reichwalde</strong> sowieWunscha und Publik. Des weiteren sind die Teichgruppen nördlich <strong>Reichwalde</strong> und zwischenWunscha und Publik bereits überbaggert worden. Das <strong>Tagebau</strong> vorfeld ist bis zu den Ortsla genMocholz und Viereichen von freigeschlagenen Trassen für Entwässerungsriegel durch zogen.Der östliche Bereich ist an der Oberfläche noch nicht vom Bergbau beeinflußt.- Im Gebiet der Muskauer Heide ist das Grundwasser im Hauptgrundwasserleiter infolge derEntwässerungsmaßnah men für die <strong>Tagebau</strong>e Nochten und <strong>Reichwalde</strong> um 20 - 70 m abgesenkt.- Im vom <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> in Anspruch zu nehmenden bzw. beeinflußten Landschafts teilbefinden sich eine Reihe von im Freistaat Sachsen vom Aussterben bedrohter bzw. stark gefährdetersowie bedrohter Pflanzenarten. Gleiches gilt für eine Reihe bundesweit vom Aussterbenbedrohter faunistischer Arten.- Weitere ungünstige Auswirkungen hat die Art der Verlegung des Weißen und des SchwarzenSchöps. Als rein technische Bauwerke fügen sie sich weder in die Landschaft ein, noch bietensie potentiellen Bio zönosen Lebens raum. Die monotone Linienführung und der einheitlicheQuerschnitt führen zu gleichförmigem Fließverhalten, das dem in Fließgewässern möglichenArtenreichtum entgegenwirkt.- Der 3. Bauabschnitt zur Verlegung des Weißen Schöps wurde auf ca. 2,4 km Länge un vollendeteingestellt und beeinflußt durch das Flußprofil und die damit gestörte Vernetzung derBiotope den natürlichen Lebensraum, insbesondere in bezug auf den genetischen Austauschzur unbeeinflußten Landschaft.- Eine durch den Bergbau bedingte Beeinflussung der Moore zwischen Nappatsch und demWeißen Lug kann aufgrund der in diesem Bereich bestehenden geologischen Verhältnisse ausgeschlossenwerden.- Die Teiche im Beeinflussungsgebiet des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> lagen ursprünglich in derNiederung des Weißen Schöps, der aber durch mehrmalige Verlegung später südlich dieserNiederung verlaufen wird.Gegenwärtig wird von der bestehenden Teichgruppe Hammerstadt nur der Gelbe Teichdurch die <strong>Tagebau</strong>entwässerung beeinflußt. Die Wirkungen der Entwässerung können jedochals minimal eingeschätzt werden, da der Bereich des Gelben Teiches von jeher einentieferen Grundwasserstand aufwies. Die bisher aufgetretenen Sickerwasserverluste wurdennicht ge messen, liegen aber nach den Berech nungen zwischen 10 und 30 l/s für den GelbenTeich und 170 l/s für die gesamte Teichgruppe. Dabei sind die Sickerwasserverluste inden einzelnen Teichen, je nach dem Kolmationsgrad, unterschiedlich. Außerdem vergrößertsich dann die Sickerwassermenge, wenn die Grundwasseroberfläche unter der Teichsohleliegt, so daß eine freie Versickerung eintreten kann. Mit der weiteren Annäherung der<strong>Tagebau</strong>entwäs serung an die Fischteiche wird daher die Versickerung zunehmen. EinenHöchst wert wird diese 1997 mit 350 bis 400 l/s erreichen. In der Berechnungs menge ist nochnicht berücksichtigt, daß als Folge der zunehmenden Versickerung durch die im Wasser vorhandenenSchwebstoffe auch die Kolmationsschicht zunimmt, die der Ver sickerung entgegenwirkt.Stellt man der o.g. Sickerwassermenge den mittleren Niedrigwasserabfluß (MNQ) der22 BlochInternetfassung
Allgemeine Angaben - Natur und Landschaft 1.5Raklitza von 460 l/s gegenüber, so ist auch der Verdunstungsverlust (ca. 5 mm/d) mit abgesichert.Nach 1997 reduziert sich die bewirtschaftete Teichfläche und damit der Sickerwasserverlustauf 250 bis 285 l/s, obwohl gleichzeitig die freie Versickerung aus den Teichen zunimmt.Es kann daher davon ausgegangen werden, daß auch ohne Zusatzmaßnahmen die Teichgruppein der nach 1998 bestehenden Form mit Wasser versorgt werden kann. Außerdem kann gegebenenfallsdurch die nördlich von Hammerstadt zu errichtende Grubenwasser reinigungsanlagezusätzlich noch 1000 l/s gereinigtes Wasser als Reserve zur Verfügung gestellt werden.Am Südrand des <strong>Tagebau</strong>es kommen kompakte Geschiebemergelablagerungen vor. Hier liegendie Sickerwassermengen in Bereichen, die ebenfalls über Vorfluter und Grubenwasser ausgeglichenwerden können, zumal das oberirdische Einzugsgebiet und die von Süden kommendenVorfluter vom <strong>Tagebau</strong> kaum beeinflußt werden. Dies betrifft insbesondere den Ober- undKoboldteich. Die Teiche östlich von Daubitz werden ebenfalls nur unbedeutend beeinflußt.BlochInternetfassung23
Ziele und Begründungen - Bergbau 2.12 Ziele des <strong>Braunkohlenplan</strong>es und deren Begründungen2.1 BergbauZiel 1- SicherheitslinieDie bergbauliche Tätigkeit innerhalb der in Karte 1 dargestellten Sicherheitslinie, diedurch Koordinaten bestimmt ist, ist so zu planen und durchzuführen, daß durch den Abbaubzw. die Verkippung bedingte Gefährdungen auf der Geländeoberfläche außerhalbder Sicherheitslinie - soweit vorhersehbar - ausge schlossen sind. Die Sicherheitslinie istin alle räumlich und sachlich betroffenen nachfolgen den Pläne zu übernehmen.Die Bergbautätigkeit einschließlich der damit verbundenen vorbereitenden, begleitendenund nachfolgenden Maßnahmen sowie die genaue Festlegung der Abbaugrenze sindso zu gestal ten, daß Beeinträchtigungen von bestehenden Nutzungen und Funk tionenaußerhalb der Si cherheitslinie möglichst vermieden werden; soweit erkennbare Beeinträchtigungenunvermeid lich sind, ist rechtzeitig vor ihrem Eintreten für ent sprechendenAusgleich oder Ersatz zu sor gen.Begründung:Der Bereich zwischen der Sicherheitslinie und der Abbaugrenze wird als Sicherheitszone bezeichnet.Der Abstand der Sicherheitslinie von der Abbau- bzw. Verkippungskante beträgt imall ge mei nen 150 m. Die Festlegung der genauen Lage der Abbaukante innerhalb der Sicherheitslinieerfolgt nach Vorlage von Standsicherheitsuntersuchungen in weiteren Betriebsplanverfahren(Hauptbetriebspläne).Die Bedeutung der Sicherheitszone besteht einerseits in der Gefahrenabwehr, andererseitshat sie als Pufferzone die Aufgabe, eventuell unter Zuhilfenahme technischer Maßnahmen dieBergbautätigkeit mit den außerhalb angrenzenden Nutzungen verträglich zu gestalten. Weiterhinkann die Sicherheitszone unbeschadet weitergehender, außerhalb der Sicher heitsliniewirksam werdender landschaftspflegerischer Erfordernisse für die ökologischen Ausgleichsmaßnahmenherangezogen werden, die vom Bergbau unmittelbar ausgelöst werden.Als Maßnahme hierfür kommen z. B. Anpflanzungen oder Errichtung von Erdwällen und de renBepflanzung in Betracht. In welchem Maße und in welcher Form die Sicherheitszone für solcheMaßnahmen heranzuziehen ist und welche Breite die Sicherheitszone insbesondere im Nahbereichvon Wohngebieten und Verkehrstrassen haben muß, wird in den nachfol genden Betriebsplanverfahrenkonkret festgelegt.Die derzeitige zeichnerische Darstellung im <strong>Braunkohlenplan</strong> ist im wesentlichen durch bergsicherheitlicheund technologische Erfordernisse begründet.Die Koordinaten der Sicherheitslinie sind aus der Tabelle auf Seite 25 sowie der Abbildung 3auf Seite 26 ersichtlich.24 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Bergbau 2.1Koordinaten der Sicherheitslinie Braukohlenplan<strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong>Koordinatensystem: Gauß-KrügerLfd.-Nr.123456789101112131415161718192021222324252627282930313233RechtswertX54 75 93254 76 14154 76 41154 76 84054 76 95254 77 35354 77 93154 78 74554 78 93854 79 78954 80 27554 80 92154 81 66654 82 26154 83 96254 85 21054 82 73254 82 54654 82 33654 82 20854 82 12254 82 33254 81 97254 81 62154 81 22954 80 89854 79 94654 79 87054 79 18354 78 45854 77 87554 77 46654 76 613HochwertY56 97 27656 97 98856 98 02956 98 87856 99 07756 99 67757 00 34857 01 25757 01 41457 01 84657 02 14557 02 51957 02 91657 03 22157 01 60856 98 76056 97 51256 57 08756 96 73856 96 56956 96 26656 95 72756 95 13556 94 76056 94 45256 94 43656 94 39656 94 36456 94 33056 94 29856 94 35156 94 43256 94 754BlochInternetfassung25
Ziele und Begründungen - Bergbau 2.1Abb. 3: Koordinaten der Sicherheitslinie <strong>Braunkohlenplan</strong> <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong>26 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Bergbau 2.1Ziel 3- MassendispositionDie zur Kohlefreilegung zu bewegenden Abraummassen sind innerhalb der Abbaugrenzenzu verkippen. Damit sind die Voraussetzungen für eine attraktive und zeitgemäßgestaltete Berg baufolgelandschaft zu schaffen. Notwendige geotechnische Vorgabenzur Gewährlei stung einer späteren gefahrlo sen Nutzung der Rückgabeflächen aufdem Kippenge lände in Form von Standsicherheitsuntersuchungen sind vom Bergbauunternehmenein zuhalten.Begründung:In der ursprünglichen Planung des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> war im Südfeld aufgrund geringerDeckge birgsmächtigkeiten nur der Einsatz einer 60 m-Abraumförderbrücke vorgesehen,dementspre chend wurde der <strong>Tagebau</strong> ausgerüstet und betrieben. Die entstehende Brückenkippesollte zu einem späteren Zeitpunkt mit Abraummassen des seinerzeit geplanten <strong>Tagebau</strong>esNeu liebel überzogen werden. Durch eine geänderte Unternehmensplanung - ohne <strong>Tagebau</strong>Neuliebel - war somit das Wie dernutzbarmachungskonzept zu ändern. WesentlichsterBe standteil dieser Änderung ist das Betreiben eines Vorschnittes ab Januar 1993. Mit den da beigewonnenen pleistozänen rekul tivierungsfreundlichen Massen werden die Flächen der Abraumförderbrückenkippeüberzogen. Die dabei entstehende Kippenoberfläche muß zur Gewährleistungder geotechnischen Sicher heit, d. h. in diesem Fall zur Vermeidung grund bruchähnlicherErscheinungen des gekippten Materiales, eine Mindesttrockenüberdeckung aufweisen, die jenach konkreter geotechnischer Situation bis zu 5 m über dem künftigen Grundwasserspiegel betragenkann, wobei Setzungen und Sackun gen berücksichtigt sind. Diese Forderung führt dazu,daß im Südfeld eine Überhöhung des gekippten Geländes gegenüber den früheren grundwassernahenNiederungsgebieten ein tritt. Der Massenbedarf für diese Überhöhung mit den zur Außenhaldegefahrenen Auf schlußmassen und der gewinnbaren Kohle führt im Südfeld zu ei nemMassendefizit. Das dabei entstehende negative Verhältnis zwischen Flächeninanspruch nahmeund -rückgabe kann erst mit den im Nordfeld anstehenden größeren Abtragsmächtig keiten verbessertwerden. Dabei ist vorgesehen, daß die Morphologie der sich im Nordfeld be findlichenStrich- und Parabeldü nen im Verkippungsprozeß wieder annähernd nachgestaltet wird. DieseArbeiten erfolgen im Zuge der Vorschnittverkippung.Um die Fläche des künftigen Restloches möglichst klein zu halten, ist bei der höhenmäßi genReliefausbildung mit den verfügbaren Massen sparsam umzugehen. Nach dem Ab schluß derKohleförderung werden die Arbeiten zur Gestaltung des Restraumes mit der Ab flachung undSicherung der Endböschungen sowie abschließender Rekultivierung durchge führt.Das nach Abschluß des <strong>Tagebau</strong>betriebes entstehende Restloch hat, wie in der Karte 4 dargestellt,eine Fläche in der Größenordnung von 1 490 ha. Die sich einstellende Endstauhöhe imRestsee wird +130 m HN, das Restseevolumen ca. 310 Mio. m ³ betragen.Ziel 4- Regulierung von BergschädenDie im Zusammenhang mit der bergbaulichen Grundwasserabsenkung bzw. mit demGrund wasserwiederanstieg nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfung entstehendenBerg schäden sind vom Verursacher zu regulieren.28 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Bergbau 2.1Begründung:Bedingt durch die bestehenden geologischen Verhältnisse im Auswirkungsbereich des Ta gebauessind Schäden an Bauwerken durch Bodensenkung infolge Grundwasserentzuges möglich.Die Schäden sind vom davon Betroffenen beim Verursacher anzumelden. Sie werden nachden §§ 110 - 121 BBergG bewertet und bei Anerkennung vom Verursacher beseitigt oder entschädigt.Ziel 5- BegleitrohstoffeDie Gewinnung von Begleitrohstoffen im Abbaubereich soll dem Grund satz der Nutzbarmachungdieser Bodenschätze dienen, bevor sie durch den <strong>Tagebau</strong> betrieb auf Dauerverloren sind. Abgrabungen im Vorfeld sollen zeitlich und räumlich so gestaltet werden,daß die Gewinnung der Braunkohle nicht beeinträchtigt wird.Begründung:Dieser Zielsetzung kann durch die gesonderte Verkippung von Bodenschätzen im Rahmen deslaufenden <strong>Tagebau</strong>es Rechnung getragen werden. Die Gewinnung von Begleitrohstoffen im<strong>Tagebau</strong> bzw. dessen Vorfeld kann zeitgleiche Abgrabungen im Umfeld des <strong>Tagebau</strong>es erübrigen.Dabei sind die im Bundesberggesetz § 42 - Mitgewinnung von Bodenschätzen bei derGewinnung bergfreier Bodenschätze - bestehenden Aussagen zu be achten.Der § 42 Bundesberggesetz - Mitgewinnung von Bodenschätzen bei der Gewinnung berg freierBodenschätze - hat folgenden Wortlaut:„(1) Bei der Gewinnung bergfreier Bodenschätze hat der Gewinnungsberechtigte das Recht,innerhalb des Feldes seiner Gewinnungsberechtigung andere Bodenschätze mitzugewin nen,soweit sie nach der Entscheidung der zuständigen Behörde bei planmäßiger Durch führungder Gewinnung aus bergtechnischen oder sicherheitstechnischen Gründen nur gemeinschaftlichgewonnen werden können. Andere an diesen Bodenschätzen Berechtigte hat der Gewinnungsberechtigtevon der Entscheidung nach Satz 1 unverzüglich in Kenntnis zu setzen.(2) Der Gewinnungsberechtigte hat die Herausgabe1. mitgewonnener bergfreier Bodenschätze, für die Aneignungsrechte Dritter bestehen, und2. mitgewonnener nicht bergfreier Bodenschätzedem jeweils anderen Berechtigten gegen Erstattung der für die Ge winnung und eine erforderlicheAufbereitung gemachten Aufwen dun gen und einer für die Gewinnung zu zahlendenFörderabgabe anzu bieten und diese Boden schätze auf Verlangen herauszugeben. Der andereBerechtigte kann die Heraus gabe nur in nerhalb von zwei Monaten nach Kenntnisnahme nachAbsatz 1 Satz 2 verlan gen. Die bis zu dem Zeitpunkt des Verlangens mitgewonnenen Bodenschätzeunterliegen nicht der Herausga bepflicht.Das gleiche gilt, wenn1. die Trennung der mitgewonnenen Bodenschätze von den übrigen Bodenschätzen nicht möglichoder wegen der damit verbundenen Aufwendungen nicht zumutbar ist oder2. die mitgewonnenen Bodenschätze zur Sicherung des eigenen Be triebes des Gewin nungsberechtigtenoder in diesem Betrieb zur Sicherung der Oberfläche verwendet werden.BlochInternetfassung29
Ziele und Begründungen - Bergbau 2.1Können herauszugebende Bodenschätze nicht voneinander getrennt werden oder ist eine Trennungwegen der damit verbundenen Auf wendungen nicht zumutbar und stehen sie meh rerenanderen Berech tigten zu, so hat der Gewinnungsberechtigte jedem dieser Berechtigten einenseiner Berechtigung entsprechenden Anteil herauszu geben.(3) Ist dem jeweils anderen Berechtigten die Übernahme herauszu gebender Bodenschätzenicht zumutbar, so kann er für diese Bo denschätze von dem Gewinnungsberechtigten ei nenangemessenen Ausgleich in Geld verlangen, soweit der Gewinnungsberechtigte die Bodenschätzeverwerten kann. Die Aufwendungen für die Gewin nung und eine erforderli che Aufbereitungsowie eine für die Ge winnung zu zahlende Förderabgabe sind anzurech nen.(4) Auf Antrag des Gewinnungsberechtigten oder eines anderen Be rechtigten entscheidet diezuständige Behörde über die Unmög lichkeit oder Unzumutbarkeit der Trennung der Bo denschätzeund die Größe der Anteile.“Im Abbaugebiet des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> stehen Begleitrohstoffe mit unterschiedlichen Nutzungsmöglichkeitenan.FindlingeIm Gewinnungsprozeß anfallende große Steine (sog. „Findlinge“) werden ausgehalten undsind für die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft oder zur Vermarktung, u.a. als Dekorstein,vorge sehen. Als Findlinge bezeichnet man eiszeitliche Geschiebe, die eine bestimmte Mindestgrößeüberschreiten.KiessandeIm mittleren Teil des Kohlefeldes stehen in einer E-W streichenden Zone größere Mengen vonFeinkies, grobsandig, an. Die Kiessande enthalten organische Beimengungen, sie ent spre chender Qualität „sonstiger Kiessand ungesiebt“; nicht verunreinigte Bereiche von Kies sind zwarvorhanden, aber nicht selektiv gewinnbar. Eine Verwendung für Betonroh stoffe ist nach entsprechenderAufbereitung (Waschprozesse) möglich. Wegen ihrer geringen Qualität und derLage in den Förderbrückenschnitten ist eine großtechnische se lektive Gewin nung nicht vorgesehen.Für den Eigenbedarf, als Bettungskies werden im laufenden Be trieb mit HilfsgerätenMassen entnommen.DünensandeIm Nordteil der Braunkohlenlagerstätte <strong>Reichwalde</strong> stehen weitverbreitet spätweichselkalt zeitlichbis holozäne Dünensande an. Die Dünensande sind relativ frei von organischen Beimengungenund entsprechen hinsichtlich der Korngröße den Anforderungen an Zu schlagstoffe fürdie Kalksandsteinproduktion nach DIN 106. Eine selektive Gewinnung ist prinzipiell möglich. Siewurde wegen des späten Abbauzeitraumes bisher nicht näher unter sucht. Dünensande sind fürdie Rekultivierung der Bergbaufolgelandschaft einzusetzen.TorfIm südlichen Feldesteil <strong>Reichwalde</strong>-Süd sind Torfe auf mehreren Flächen nachgewiesen worden.Die vorhandenen Mengen belaufen sich auf ca. 400 000 m³. Die Mächtigkeit erreicht maximal4 m. Der überwie gende Teil eignet sich als Grundrohstoff zur Kompostierung. Im Zugeder Feldes entwicklung ist vorgesehen, den Torf gesondert zu gewinnen und als Bodenhilfsstofffür die Rekultivierung der Bergbaufolge landschaft sowie für Zwecke des Naturschutzes zu gewinnen.30 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Wasser 2.2Umsetzung der Ziele:Die Umsetzung und Konkretisierung der in Pkt. 2.1 genannten Ziele ist insbesondere im bergrechtlichenBetriebsplanverfahren vorzunehmen.2.2 WasserZiel 6- Einwirkungsbereich der GrundwasserabsenkungDie Auswirkungen der für den <strong>Tagebau</strong>betrieb notwendigen Grundwasserabsenkung aufdie Umwelt sollen maximal bis zu den in der Karte 3 dargestellten Grenzen des Einwirkungsbereichesreichen.Begründung:Das <strong>Tagebau</strong>feld <strong>Reichwalde</strong> liegt überwiegend im Einzugsgebiet der Spree. Im E wird dasEinzugsgebiet der Lausitzer Neiße berührt. Der <strong>Tagebau</strong> ist der am weitesten östlich gele geneAbbauraum innerhalb des Lausitzer Reviers. Zusammen mit den jahrzehntelang be triebenen<strong>Tagebau</strong>en Bärwalde, Lohsa und Nochten verursacht der <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> einen geschlossenenAbsenkungstrichter, der bis weit nach E in die Nähe der Lausitzer Neiße reicht.Das Grundwassergefälle ist von SE nach NW, von den Hochflächen im Süden zum Breslau-Magdeburger Urstromtal gerich tet. Im Urstromtal selbst haben sich eine E-W-Strömung im Einzugsgebietder Spree und eine SE-NE-Strömung im Bereich der Lausitzer Neiße eingestellt.Durch den Einfluß der <strong>Tagebau</strong>ent wässerung wird lokal die Fließrichtung zum <strong>Tagebau</strong> abgelenkt,das generelle Fließgeschehen wird jedoch nicht verändert. Die Reichweiten haben sichentsprechend der Gebirgsdurchläs sigkeiten entwickelt:- im NE und E erfolgt eine weiträumige Beeinflussung.- Im SW, S und SE bildet sich nur eine verhältnismäßig geringe Entwässerungsreichweiteaus.In der Karte 3 ist die Entwicklung der Grundwasserbeeinflussung für die Jahre 1991, 1999,2004, 2008, 2012, 2017, 2026 und 2030 aufgezeigt. Der Absenkungstrichter umfaßt in seinermaximalen Ausdehnung ge meinsam mit dem <strong>Tagebau</strong> Nochten eine Gesamtfläche von ca. 480km².Die Grenze des Einwirkungsbereiches im Norden endet am Muskauer Faltenbogen. Im Ostenwird sich diese Grenze von 1991 bis zum Jahre 2030 um 6 km in Richtung Lausitzer Neiße verschieben- etwa im Bereich Skerbersdorf, Pechern sowie westlich Klein-Priebus - ohne aber dieLausitzer Neiße zu erreichen. Der südliche Bereich des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> weist auf grundder geohydrologischen Verhältnisse nur geringe Reichweiten der Grund wasserabsen kung von0,5 - 1,5 km auf (Ortschaften <strong>Reichwalde</strong> südlich Nappatsch und Neuliebel südlich von Rietschen).Im östlichen Bereich der Grundwasserbeeinflussung kommt es zu Überlage rungen derReichweiten aus den <strong>Tagebau</strong>en Nochten und <strong>Reichwalde</strong>. Bis zum Jahre 2005 hat der <strong>Tagebau</strong>Nochten den größeren Einfluß, da die Beeinflussung dieser Gebiete durch den <strong>Tagebau</strong><strong>Reichwalde</strong> erst mit dem Übergang in das Nordfeld zunimmt.Die Verlagerung der Beeinflussung in Richtung Nordosten in den Jahren 2010 bis 2030 isthauptsächlich der Entwicklung des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> im Nordfeld und im Nordostfeld zuzuordnen.Die maximale Reichweite der Grundwasserabsenkung wird im Jahre 2030 er reicht.Eine Beeinflussung von Gebieten des Landes Brandenburg und der Republik Polen durch dieGrundwasser absenkung im <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong> tritt nicht ein.BlochInternetfassung31
Ziele und Begründungen - Wasser 2.2Ziel 7- Einwirkungsbereich und Maßnahmen zur Begrenzung der GrundwasserabsenkungDie Grundwasserabsenkung und -entspannung der einzelnen Grundwasserleiter sollenräumlich und zeitlich so betrieben werden, daß ihre nachteiligen Auswirkungen unterBerücksichtigung der bergsicher heitlichen Notwendigkeiten so gering wie möglich gehaltenwerden. Die Auswirkungen sollen nach dem jeweiligen Stand der Technik insbesonderedurch- örtlich gezielte und zeitlich gestaffelte Entwässerung,- Grundwasseranreicherungen und Abdichtungsmaßnahmen zum Schutz vonFeuchtgebieten und- Ausgleich sonstiger Grundwasserentnahmen durch Sümpfungswasserlieferungenminimiert werden. Der hierfür erforderliche Aufwand soll in einem angemessenen Verhältniszu dem erwarteten Nutzen stehen.Begründung:Zur Verminderung der mit der Grundwasserabsenkung verbundenen Nachteile und Schä denfür den Wasser- und Naturhaushalt müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die dieflächenhafte und räumliche Ausdehnung der Grundwasserentnahmen reduzieren. Dazu hat derBergbautreibende Möglichkeiten zu untersuchen und Lösungen umzusetzen.Zur Prognose der Grundwasserstandsentwicklung und zur Abgrenzung des durch die <strong>Tagebau</strong>ebeeinflußten Gebietes wurde vom Bergbauunternehmen eine Modellrechnung mit demgeohy drologischen Modell „Ostlausitz“ (dynamisches Modell) durchgeführt. Dabei er folgte dieSimu lation der Grundwasserströmungsverhältnisse gemeinsam für die <strong>Tagebau</strong>e Nochten,Reich walde und Bärwalde. Es wurde das Programmsystem GEOFIM verwendet, mit dem Menge-und Güteprobleme gelöst sowie Parameteridentifikationen durchgeführt werden können.Auf der Grundlage der Ergebnisse dieser Modellrechnungen ist eine orts- und zeitdiskrete Planungder Entwässerungsanlagen möglich. Das Programmsystem wird seit mehreren Jahren zurLösung bzw. Prognose von praktischen Problemen wiegenutzt. Grundwasserbewirtschaftung- <strong>Tagebau</strong>- und Kippenentwässerung GrundwasserwiederanstiegDer notwendige Entwässerungsvorlauf ist in den einzelnen Grundwasserleitern (GWL) unterschiedlich.So ist für den Hauptgrundwasserleiter im Hangenden ein mittlerer Entwässerungsvorlaufzwischen 3 und 4 Jahren erforderlich, während für die Liegendgrundwasserleiter schon2 - 3 Jahre aus rei chen. Das liegt daran, daß im Gegensatz zu den Hangend-GWL die Liegend-GWL nur teilent wässert bzw. entspannt werden müssen. Im Vergleich mit dem früher praktiziertenVorlauf von 5 - 7 Jahren Entwässerungszeit wird der Vorlauf in der Entwässerung auf dasunbedingt not wendige Maß herabgesetzt.Durch diese zeitliche Reduzierung des Entwässerungsvorlaufes wird erreicht, daß die Ab senkungsreichweiteund die damit verbundenen Auswirkungen auf das umliegende Territo rium aufdas für eine sichere Betriebsführung notwendige Maß beschränkt bleiben.Eine weitere Maßnahme ist die Wasserbereitstellung zum Ausgleich der Sickerwasserverlusteaus Teichen und Vorflutern sowie zur Erhaltung von Feuchtgebieten, die im Einwirkungsbereich der Grundwasserabsenkung liegen. Gleichzeitig wird damit eine Grundwas ser-32 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Wasser 2.2anreiche rung erzielt. Dafür findet gereinigtes Grubenwasser aus der Grubenwasserreinigungsanlage(GWRA) Hammerstadt Verwendung.Ziel 8- SümpfungswassermengeBei allen bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ist das Gebot der größtmöglichen Schonungder Grundwasservorräte zu beachten. Das Sümpfungswasser soll vorrangig alsErsatz- und Ausgleichswasser sowie für die Bereitstellung der Mindestwassermen geder Vorflut verwendet werden. Die nach den gesetzlichen Anforderungen und Naturgegebenheitenzu fordernde Qualität ist durch Wasserrechtsbescheid festzusetzen.Begründung:Durch den weiträumig wirkenden Sümpfungseinfluß sind öffentliche Wasserversorgungsun ternehmen,private Wasserentnehmer und der Naturhaushalt betroffen. Deshalb ist es not wen dig,wegen der gezielten Entnahme des Grundwasservorrates nicht nur den Wasser nutzern, sondernauch für den Eingriff in den Naturhaushalt Ausgleich und Ersatz zu lei sten.Die Gesamtwassermengen des Sümpfungswassers beinhalten die Hangend-, Liegend- undOberflächenwasseranteile. Sie werden nicht als Einzelwassermengen, sondern in ihrer Gesamtheitaufgelistet, da die Brunnen als kombinierte Filterbrunnen ausgebaut werden.Die aus dem Liegenden geförderten Wassermengen werden mit 10 - 20 %, das im offenen<strong>Tagebau</strong> gehobene Oberflächenwasser mit 1 - 3 % der gesamten Sümpfungswassermengeeingeschätzt.Die Fördermengen werden im Jahre 1994 ca. 58 Mio. m ³ betragen. Danach erfolgt ein An stiegin der Wasserhebung auf ca. 100 Mio m ³ /a bis zum Jahre 2003. Im weiteren Verlauf verringertsich diese Menge wieder auf 85 bis 90 Mio m ³ /a. Die maximale Sümpfungswas sermenge aufder Grundlage der durchgeführten Modellrechnung mit objektiven hydrologi schen Randbedingungenund technologischen Ansätzen entsprechend dem Rahmenbe triebsplan wird im Jahre2028 mit ca. 115 Mio. m ³ /a erreicht. Danach geht die Förderung des Wassers bis zum Jahre2035 auf Null zurück.Nach Beendigung des <strong>Tagebau</strong>betriebes im Jahre 2032 wird bis zum Jahre 2035 Wasser nurnoch gehoben, um Restarbeiten wie die Gestaltung des Endböschungssystems, die Demontagevon Förderein richtungen u. a. durchführen zu können.Das gehobene Sümpfungswasser wird über die bestehende Grubenwasserreinigungsanla ge(GWRA) Kringelsdorf abgeleitet. Sie hat als Gemeinschaftsanlage für die <strong>Tagebau</strong>e <strong>Reichwalde</strong>und Nochten eine Kapazität von 540 m ³ /min.Ab 2003 kommt eine Neubauanlage nördlich von Hammerstadt mit einer Kapazität von 60 m ³ /minhinzu. Aufgrund von Versickerung und Verdunstung in den Vorflutern und Reinigungsanla genvon ca. 12 bis 13 % sowie technologischer Faktoren, dabei insbesondere die notwen dige Verflüssigungdes in den Grubenwasserreinigungsanlagen anfallenden Eisenhydroxid schlammes,ist mit einer für Bilanzierungszwecke nutzbaren Wassermenge von 85 % des gesamten Sümpfungswasseraufkommenszu rechnen. Die Sümpfungswasserbilanz des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong>beinhaltet ei nerseits das Dargebot aus der Sümpfung und die da von nutzbare Menge undandererseits die Abgabe des Wassers in die Vorflut sowie für den Eigenverbrauch des Unternehmens.Von den gehobenen Sümpfungswassermengen wer den im Jahre 1994 somit ca.48,6 Mio. m³, im Jahre 2003 ca. 84,4 Mio. m³ und im weiteren Verlauf des <strong>Tagebau</strong>be triebesetwa 75 Mio m³/a in die Vorflut Weißer Schöps abgegeben. Die maximale Sümpfungswassermengewird im Jahr 2028 gefördert, davon stehen ca. 97,5 Mio. m³ zur Abgabe in die VorflutWeißer Schöps zur Verfügung.BlochInternetfassung33
Ziele und Begründungen - Wasser 2.2Dabei ist zu berücksichtigen, daß von der in die Vorflut abzugebenden Menge der jeweils notwendigeAnteil als Ersatz- und Ausgleichwasser bereitgestellt werden kann. Unter Er satzwas server steht man das Bereitstellen und Liefern von Wasser für bergbaulich beein trächtigte Wasserversorgungs-und Betriebswasseranlagen, dazu gehört auch Wasser für eventuell notwendigeBeregnungsanlagen. Als Ausgleichwasser bezeichnet man das Be reitstellen und direkte Lie fernvon geeignetem Wasser zur Feuchthaltung eines von der Grundwasserabsen kung beein flußtenFeuchtbiotopes.Die in den einzelnen Grundwasserstockwerken vorhandenen Wässer weisen keine signifi kantenUnterschiede in ihrer Beschaffenheit aus. Alle Wässer sind als oberflächennahe Tagwässereinzustufen. Dies drückt sich in leicht erhöhten Eisen- und Mangangehalten der oberstenGrundwasserleiter aus. Der pH-Wert bewegt sich überwiegend im Neutralbereich schwankendbzw. leicht darüber. Auswirkungen land- und forstwirtschaftlicher Nutzungen sind nicht nachweisbar.Die Anforderungen an die Wasserqualität richten sich nach den vorgegebenen Nutzungszielen.Bei Erfordernis sind Maßnahmen zur Verbesserung der Wasser beschaffenheit in denGrubenwasserreini gungsan lagen einzuleiten.Ziel 9- WasserversorgungDie Sicherstellung der öffentlichen und privaten Wasserversorgung in Menge und Qualitätist für die Dauer der bergbaulich bedingten Auswirkungen auf das Grundwas ser zugewährlei sten.Begründung:Durch die bergbauliche Grundwasserabsenkung werden Wassergewinnungsanlagen in unterschiedlichemAusmaß beeinflußt. Der Bergbautreibende ist verpflichtet, durch geeig nete Maßnahmenso lange Ersatz zu leisten, wie die Beeinflussung andauert.Im Untersuchungsbereich werden neben der bergbaulichen Wasserhebung aus folgendenWasserwerken Grundwasser für Trink- und Brauchwasserzwecke gehoben:WasserwerkeFördermengeQ in m³/dRietschen 1 600Weißkeißel 2 450Pechern 300Die durch den Braunkohlenbergbau hervorgerufene Beeinflussung von Wasserfassungsan lagenist sowohl von der geographischen Lage zum <strong>Tagebau</strong> als auch von den jeweiligen hydrogeologischenVerhältnissen im Umfeld der Fassungsanlagen abhängig.Das Wasserwerk Rietschen entnimmt das Wasser aus dem Grundwasserleiter (GWL) 7. Obwohldas Einzugsgebiet im wesentlichen tagebaufern liegt, kommt es durch den Bergbau zurteilweisen Entspannung des Entnahmehorizontes.Zur Stabilisierung der Wasserversorgung werden ggf. erst nach 2023 Zusatzbrunnen erfor derlich.Die Beeinflussung des Wasserwerkes Weißkeißel durch die Entwässerungsmaßnahmendes <strong>Tagebau</strong>es Nochten und später <strong>Reichwalde</strong> erfordert ab dem Jahr 2018 Ersatzmaßnahmen,da die Entnahme ausschließlich aus den pleistozänen GWL erfolgt. Die Fassungsanlagendes am Randbereich der bergbaulichen Grundwasserbeeinflussung34 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Wasser 2.2gelegenen Wasserwerkes Pechern werden nur in geringfügigen Maße durch die bergbaulicheGrundwas serabsenkung beein flußt. Die gegenwärtige Fördermenge dieses Wasserwerkeskann somit gewährleistet werden.Mit den für die beeinflußten Wasserwerke vorgesehenen Ersatz- und Ausgleichsmaßnah menwerden negative Auswirkungen weitestgehend vermieden.Ziel 10- OberflächengewässerBei den durch die Sümpfung bedingten Abflußminderungen in für die Wasserwirtschaftoder den Naturhaushalt bedeutsamen Fließgewässern soll der Erhalt der Abflußverhältnissedurch die Einspeisung von Sümpfungswasser sichergestellt werden. Dabeisoll eine Mindestwasserführung gewährleistet und die Verschlechterung der Wasserbeschaffenheitvermieden werden.Begründung:Die Vorfluter im Bearbeitungsgebiet sind im Westen die Spree und im Osten die Lausitzer Neiße.Zu den untergeordneten Vorflutern gehören im Norden der Floßgraben, im Südosten derAltlauf Weißer Schöps und die Raklitza, im Süden der Modergraben, im Südwesten der teilweiseneuverlegte Schwarze Schöps, der mit dem neuverlegten Weißen Schöps zum Ver einigtenSchöps zusammenfließt, der Altlauf Schwarzer Schöps sowie der verlegte Weiße Schöps, derdas Süd- vom Nordfeld trennt.Außerhalb des Abbaufeldes befinden sich im Südosten Teile der Teichgruppe Hammer stadtund im Osten die Teichgruppe Rietschen sowie im Süden die Teiche bei Nappat sch.Durch die <strong>Tagebau</strong>entwicklung im Südfeld war die Umverlegung des Weißen Schöps von Rietschen-Werdabis Schadendorf erfor der lich. Der zweite Bauabschnitt dieser Maßnahme wurdeim Dezember 1989 abgeschlos sen, die Verlegelänge betrug 8,5 km. Vor dem Übergang des<strong>Tagebau</strong>es in das Nordfeld ist eine nochmalige Verlegung des Weißen Schöps notwendig. DieseMaßnahme wird bis zum Jahre 2003 fertiggestellt.Das gesamte Sümpfungswasser des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> wird bis zum Jahre 2003 in derGWRA Kringelsdorf ge reinigt und danach wieder in den Weißen Schöps eingeleitet. Über denVereinigten Schöps fließt es in die Spree.Bis zum Jahre 2003 wird der größte Teil des gehobenen Sümp fungswassers ungereinigt inden verlegten Teil des Weißen Schöps geleitet und in der GWRA Kringelsdorf gereinigt. Eingeringer Teil des Sümpfungswassers wird über den Gru benwasser ableiter 2 direkt der GWRAKringelsdorf zugeführt.Gleichzeitig mit der Verlegung des Weißen Schöps - 3. Bauabschnitt - wird etwa im Jahre 2003eine neue GWRA nördlich von Hammerstadt in Betrieb genommen. Damit sind die Voraussetzungengeschaffen, ausschließlich gereinigtes Sümpfungswasser in den Weißen Schöps ein zu leitenund zur Speisung von Teich- und Feuchtgebieten bereitzustellen.Der vom <strong>Tagebau</strong> durchgeschnittene Altlauf des Schwarzen Schöps bei <strong>Reichwalde</strong> wird 1993/94durch eine neue, naturnah zu gestaltende Vorflut mit dem verlegten Schwarzen Schöps verbunden.Die bei <strong>Reichwalde</strong> verbliebenen Teiche werden in Abhängigkeit vom <strong>Tagebau</strong>fortschrittweiter renaturiert. Die Teiche bei Nappatsch können noch 1993 bespannt werden, ohne dieTage bausicherheit zu gefährden. Für die Teich gruppe Rietschen ist die Beeinflussung gering,da deren Einzugsgebiete im unbeeinflußten Süden bzw. Südosten liegen. Eventuell notwen digeAusgleichswassermengen können von der GWRA Hammerstadt bereitgestellt werden.BlochInternetfassung35
Ziele und Begründungen - Wasser 2.2Ziel 11- Wasserwirtschaftliche VerlegemaßnahmenDer an der nördlichen Grenze des Baufeldes <strong>Reichwalde</strong>-Süd verlaufende verlegte WeißeSchöps ist rechtzeitig vor dem Übergang des <strong>Tagebau</strong>es in das Baufeld <strong>Reichwalde</strong>-Nord nochmals in einem 3. Bauabschnitt zu verlegen. Für die Schöpsverlegung soll einnaturnaher Verlauf erreicht werden.Begründung:Für den Trassenverlauf wurden Projektunterlagen bearbeitet und liegen dem UnternehmenLAUBAG vor.Für die Schöpsverlegung ist ein nach den geltenden Rechtsvorschriften gesondertes Planverfahrenerforderlich.Vor einer Weiterführung der Verlegung ist ein landschaftspflegerischer Begleitplan aufzu stel len.Für die Schöpsverlegung ist die Einbindung vorhandener Feucht- und Teichgebiete sowie derErhalt des Altlaufes Weißer Schöps bis zur Einmündung der Raklitza vorzusehen.Ziel 12- Wasserwirtschaftliche Verhältnisse nach <strong>Tagebau</strong>ende, RestseeDie Wiederauffüllung des abgesenkten Grundwasserkörpers soll gezielt beschleunigtwerden, wenn sich dies aus wasserwirtschaftlicher Sicht und unter Beachtung der geotechnischenSi cherheit als möglich und zweckmäßig erweist.Begründung:Bereits vor Ende der Auskohlung beginnt mit der laufenden Außerbetriebnahme von Filterbrunnenim rückwärtigen Bereich des <strong>Tagebau</strong>es ein schrittweiser Grundwasserwiederan stieg.Ein Teil des Grundwasserwiederanstieges erfolgt über die Grundwasserneubildung. Die Grundwasserneubildungbasiert auf einem Gebietsniederschlagsmittelwert von 661 mm/a. Entsprechenddes Hydrotopgefüges (Bodenart, Grundwasserflurabstand u. a.) liegt sie zwi schen maximal7 l/sec km² im Kippenbereich und ca. 2 l/sec km² in Feuchtgebieten, im Mittel bei 5 bis6 l/sec km². Um den Restsee auf einen Wasserspiegel von +129 bis +130 m HN aufzufüllen,sind 660 Mio. m ³ Wasser für die Auffüllung des Porenvolumens in den Kippen bereichen und imangrenzenden Gewachsenen erforderlich. Dazu kommen noch 310 Mio. m ³ als Seevolumen.Der Gesamtwasserbedarf beträgt damit 970 Mio. m ³ . Nach Auslauf des <strong>Tagebau</strong>es erstrecktsich der See nordwestlich der Ortslage Rietschen in ei ner Größenordnung von 1 490 ha. Zwischendem See und den Teichgruppen Rietschen und Hammerstadt entsteht durch die geänderteFahrweise des <strong>Tagebau</strong>es eine etwa 1500 m breite Kippenfläche. Die Seetiefen liegen imBereich des nach dem <strong>Tagebau</strong>betrieb verbleibenden Randschlauches von 20 m bis maximal70 m, dieser Bereich entspricht 22% der Restseefläche. Im Bereich der Förderbrückenkippe beträgtdie Tiefe des Sees bis zu 20 m. Nach Erreichen der Höhe + 130 m HN ist der Auslauf desSees über das Einzugsgebiet der Lausitzer Neiße zu regulieren. Zur Auffüllung des Poren- undRestseevolumens stehen am Anfang jährlich max. 41,5 Mio. m ³ Wasser aus der Grundwasserneubildungdes Einzugsgebietes zur Verfügung. Die Auffüllzeit ohne Fremdwasserzuführungbeträgt ca. 40 Jahre. Aus dem Einzugsgebiet der Raklitza und des Weißen Schöps könnenzumindest zu Zeiten der Hochwasserführung noch bestimmte Wassermengen zur Flutungabgeschlagen werden. Unter diesen Voraussetzungen würde die Flutung jedoch mindestens30 Jahre dauern. Wenn die Zeit des Wiederanstieges 20 Jahre nicht über schreiten soll, wirdeine Zuführung von 20 Mio. m³/a für einen Zeitraum von 18 Jahren aus der Lausitzer Neiße fürerforderlich gehalten.36 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Natur und Landschaft 2.3Eine Abstimmung über die entsprechend der Wasserbilanz zur Verfügung stehenden Wassermengensollte dahingehend geführt werden, daß eine optimale Flutung der künftigen Restseenin der Region erfolgen kann.Detaillierte Angaben zur Fremdwasserzuführung sind gegenwärtig nicht möglich, die Klärungdieser Problematik ist in der nachfolgenden Fachplanung herbeizuführen.Gestützt auf durchgeführte Grundwasser-Modellrechnungen werden sich unter dem Einfluß desSees im Gesamtgebiet annähernd die ursprünglichen Grundwasserverhältnisse wieder einstellen.Durch die eintretende Verminderung des hydraulischen Gefälles zwischen dem Restseeund den Teichen der Teichgruppen Rietschen und Hammerstadt ist eine Verringerung der Versickerungin diesen Teichen zu erwarten. Auch wird es nur noch einen Grundwasserleiter imAbbaufeld geben, da durchgehende Stauhorizonte fehlen. Die Wassergüte wird wesentlich davonabhängig sein, ob für die Flutung des Restsees Fremdwasser zur Verfügung steht. OhneZuführung von Fremdwas ser kommt es durch den hohen Pyritgehalt im Abraum und im Liegendenzu einer Verände rung der Grundwasserqualität beim Eintritt in den Restsee, der pH-Wertdes Wassers ver ringert sich, d. h. es bildet sich saures Wasser.Umsetzung der Ziele:Die Umsetzung und Konkretisierung der in Pkt. 2.2 genannten Ziele ist insbesondere im- bergrechtlichen Betriebsplanverfahren,- Verfahren nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Sächsischen Wassergesetz,vorzunehmen.2.3 Natur und LandschaftZiel 13- Darstellung von Ausgleichs-, Ersatz- und GegenmaßnahmenDie bergbaubedingten lang andauernden Eingriffe und deren Auswirkungen auf Naturund Landschaft im Abbaubereich sollen, soweit möglich, bereits während des Eingriffes,spätestens im Zuge der Wiedernutzbarmachung der Erdoberfläche ausgeglichenwerden, anderenfalls sind sie durch entsprechende Maßnahmen zu ersetzen. Kann derEingriff nicht ausgeglichen werden, sind an anderer Stelle des <strong>Reichwalde</strong>r Bergbaugebietesdie Funktionen des Naturhaus haltes oder der Landschaft wiederherzustellen.Die im Vorfeld des fortschreitenden <strong>Tagebau</strong>es bestehenden ökologischen Funktionensollen möglichst lange erhalten werden.Begründung:Das Betreiben eines Braunkohlentagebaues stellt aufgrund der damit verbundenen großflächigenFlächeninanspruchnahme und Grundwasserabsenkung einen erheblichen und nachhaltigen,nicht ausgleichbaren Eingriff in Natur und Landschaft dar.Dieser Eingriff des Braunkohlenabbaus in den Naturhaushalt, die Vernichtung öko logi scherFunktionen und die Wiederherstellung des Naturhaushaltes nach dem Abbau und der Verkippungerfordern unter Berücksichtigung des § 8 BNatSchG sowie der §§ 8 bis 12 des SächsNatSchG die Minderung der durch den Bergbau verursachten negativen Auswirkun gen diesesEingriffes durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.Wichtige Hinweise zu den Ausgleichs-, Ersatz- und Gegenmaßnahmen sind bereits in der vomRegierungspräsidium Dresden erstellten raumordnerischen Beurteilung zum Vorhaben „Weiterführungdes <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> in den Jahren 1992/93“ vom 18.05.1992 ent hal ten und inden nachfolgend aufgeführten Maßnahmen berücksichtigt.BlochInternetfassung37
Ziele und Begründungen - Natur und Landschaft 2.3Ersatzstandorte und Initialbereiche:- Rietschener TeichgruppeDiese Teiche werden als Initialbereich für die spätere Wiederbesiedlung der Bergbaufolgelandschafteine wesentliche Rolle spielen. Für ih ren Erhalt sind ausreichend Schutzmaßnahmenvorzusehen. Die außerhalb der Feldesgrenzen liegenden Teiche sind durch entsprechendeVorsorge zu er halten.- Calluna-HeideFür die Wiederausbreitung der Calluna- und Zwergstrauchheide sowie von Borstgrasrasen aufder späteren Bergbaufolgelandschaft sind vorhandene Standorte als Initialstandorte weitestgehendzu erhalten und zu sichern.- DünencharakterIm zu gestaltenden Kippenrelief ist vorgesehen, den ursprünglichen Binnendünencharakter imRelief der Folgelandschaft mit den vorkommenden Dünensanden zu Strich- und Parabeldünenzu gestalten. Bei der Festlegung des dafür vorgesehenen Areals ist zu beachten, daß die Überhöhungender Kippe den durch das Massendefizit be dingten Restraum anteilig vergrößern.- WaldgebieteBei der Wiederaufforstung der Kippenflächen ist die gegenwärtig vorherrschende Monokul turmit Kiefernbeständen durch naturnahe Mischwälder zu ersetzen. Im Rahmen von de taillier tenPlanungen ist zu prüfen, inwieweit die Standortvielfalt durch den Einbau von oberflächennahenStauschichten verbessert werden kann.Maßnahmen zur Renaturierung der bestehenden und naturnahen Gestaltungder zu verlegenden Gewässer- Altlauf Schwarzer SchöpsDer Altlauf ist als Stillwasserbereich vorübergehend Lebensraum für Amphibien, Insektenund Algen. Die Wiedereinbindung als fließendes Gewässer in die Vorflut ist möglich. Sie wird1993/94 realisiert. Damit sind gleichzeitig die Voraussetzungen zur möglichen Wieder auffüllungder <strong>Reichwalde</strong>r Teichgruppe geschaffen.- Verlegter Schwarzer SchöpsZur Verbesserung der ökologischen Situation ist unter Berücksichtigung der erdstatischen undhydraulischen Verhältnisse zu untersuchen, ob die gleichmäßige Quer schnittsform variiert werdenkann, damit sich Buchten und Schmalstellen herausbilden kön nen. Damit kann durch denEinbau von Sohlschwellen, Störsteinen und Sohlgleiten aus Steinen unterschiedlicher Körnungein kleinflächig wechselndes Strömungsmuster entste hen.- Verlegung Weißer SchöpsDer bereits realisierte Teil des 3. Bauabschnittes sowie die weiteren Abschnitte sind vor derFlutung durch Querschnittsvariation, Störsteine und Sohlgleiten sowie Uferbepflanzung zu naturieren.Feucht- und Teichgebiete, beispielsweise bei Nappatsch und Neuliebel, sind in dieTrassenführung einzubinden. Darüber hinaus sind die abgeholzten Trassenbereiche als Waldübergängemit Wiesen, Gehölzen und heimischen Laubbäumen zu gestalten. In die Renaturierungsind auch die Altläufe der Raklitza und des Weißen Schöps einzubeziehen.38 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Natur und Landschaft 2.3- Teichgruppe HammerstadtIn ihrer Gesamtheit stellt die Teichgruppe Hammerstadt ein ca. 93 ha großes Gebiet mit 23kleineren und größeren, durch die Raklitza gespeisten Teiche dar. Davon werden durch die<strong>Tagebau</strong>weiterführung der Koppenteich, der Gelbe Teich, die Hirschteiche, der Koarkenteichund der Altteich sowie am südlichen <strong>Tagebau</strong> rand der Alte Pechteich mit einer Gesamtflächevon 52,2 ha betroffen. Für diesen Teil des Teichgebietes sind Ersatz- und Ausgleichsmaßnahmenvorzuneh men. Im Bereich von Hammerstadt ist vom Bergbautreibenden die Schaffung vonneuen Teichflächen vorzusehen. Da bei erscheinen Maßnahmen zur Umsetzung schutzwürdigerNaturausstattung sinnvoll. Als ein geeigneter Ansiedlungsraum kommt neben den verbleibendenTeichen der Teichgruppe bei spielsweise das Beeinflussungsgebiet des stillgelegten<strong>Tagebau</strong>es Bärwal de in Frage. In den verbleibenden Teichen könnte somit gegebenenfallsdurch zusätzliche Wasserzuführung aus gereinigtem Grubenwasser ein zwar beein flußter, aberimmer noch ar tenreicher Feuchtstandort bestehen bleiben. Den bestehenblei benden Teichender Teich gruppe Hammerstadt kommt als Initialbereich für eine spätere Wiederbesiedlung derBergbau folgelandschaft wesentliche Bedeutung zu.Nach der bergbaulichen Inanspruchnahme ca. 2010 können die nicht überbaggerten Teile derHirschteiche, des Koarkenteiches und des Altteiches wieder renaturiert werden. Diese Arbeitenschließen eine Beräumung der Flächen, das Abdichten der Teichsohlen und den Anschluß andie Vorflut ein. Damit können ca. 11 ha Teichfläche wieder hergestellt werden.Die notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind durch weiterzuführende ökologischeUntersuchungen zum Beeinflussungsgebiet des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> zu konkretisieren. Alslandschaftsökologische Entscheidungsgrundlage für notwendige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmensind Biotopkartierungen und weitere Untersuchungen der betreffenden Gebiete durchzuführen.Die Maßnahmen und Standorte sind im einzelnen mit den Naturschutzbehörden zubestimmen.Ziel 14- Wiedernutzbarmachung und LandschaftsgestaltungBei der durchzuführenden Wiedernutzbarmachung und Oberflächengestaltung derBergbau folgelandschaft sind sowohl die forst- und landwirtschaftliche Nutzung als auchdie Belange des Naturschutzes zu berücksichtigen.Die konzipierte Bergbaufolgelandschaft soll in den umgeben den Naturraum eingebundenwerden. Die Landschaftsgestaltung soll Entwicklungspotentiale für Gewerbe, Industrie,Land- und Forstwirtschaft, Fremdenverkehr und Freizeit im Bergbaugebiet unterstützen.Begründung:Die Wiedernutzbarmachung der gekippten Flächen wird unmittelbar nach der Abschlußver kippungdurchgeführt. In den bergrechtlichen Betriebsplänen ist die Aufholung der derzeit vorhandenenRückstände in der Wiedernutzbarmachung auszuweisen. Die Höhengestaltung erfolgtso, daß ein weitestgehend böschungs freier Anschluß an das unverritzte Gelände und einedauerhaft gesicherte Oberflächenent wässe rung hergestellt werden. Die Grundvoraussetzungfür die Herstellung qualitativ hoch wertiger landwirtschaftlicher Flächen wäre die Verkippungpleistozäner bindiger Kippenroh böden mit einer Mächtigkeit > 2 m an der Oberfläche und einemöglichst homogene Zu sammensetzung der Substrate. Diese Voraussetzungen sind im <strong>Tagebau</strong><strong>Reichwalde</strong> nicht gegeben.Im Abbaugebiet vorkommende wertvolle Deckgebirgskomponenten, vor allem Geschiebemergelsowie in den Flußniederungen auftretende Auelehme, sind für die Wiedernutzbarmachungder Bergbaufolgelandschaft zu verwenden. Die gewinnbaren Torfvorkommen in der Abbauflächesind zur Herstel lung von Bodenhilfsstoffen für Rekultivierungsaufgaben sowie für Zweckedes Naturschutzes vorgesehen.BlochInternetfassung39
Ziele und Begründungen - Natur und Landschaft 2.3In der Karte 4 ist der Entwurf der konzipierten Bergbaufolgelandschaft dargestellt. Die durchden Betrieb des <strong>Tagebau</strong>es entstehenden Flächen sind z. T., sofern dort längere Zeit keineendgültige Wiedernutzbarmachung erfolgen kann, umgehend zwischenzubegrünen. Zu diesenMaßnah men gehört auch die mit der Jahresscheibe 1993 begonnene kontinuierliche Zwischenbegrünung der Förderbrückenkippe.Einen erheblichen Anteil der künftigen Bergbaufolgelandschaft nimmt der entstehende Restseedes Ta ge baues ein. Es ist anzustreben, daß bei einem entsprechenden Interesse der Bevölkerungein Seeteil für Freizeit und Erholung nach dem Jahre 2050 zur Verfügung steht. Der Seewird ein gebettet in einer waldreichen Bergbaufolgelandschaft liegen, die mit Arten, die für denOberlausitzer Naturraum typisch sind, ausgestattet werden soll.Die detaillierte Umsetzung dieser Konzeption ist im Rahmen späterer Fachplanungen vorzunehmen.Die im <strong>Braunkohlenplan</strong> nach § 6 Abs. 1 i. V. m. § 7 Abs. 2, § 8 Abs. 1 SächsLPlG auf derGrundlage einer Bewertung des Zustandes von Natur und Landschaft mit ihrer gewachsenenSiedlungsstruktur aufgestellten Ziele für die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft sind bei derAufstellung des Regionalplanes zu beachten.Grundlage der zukünftigen Flächennutzungsarten sind die bereits genannten bodengeologischenVorfeld- und Kippengutachten. Resultierend aus den bodengeologischen Kippengut achtenwird der Aufwand für die Melioration der Kippenflächen ermittelt.Die im Vorfeld anstehenden ertragsarmen Böden sind nicht geeignet, leistungs- und damit wettbewerbsfähigelandwirtschaftliche Nutzflächen herzustellen. In der Nähe von Ortschaf ten solltedie Schaffung von Freiflächen zur landwirtschaftlichen Nutzung im Sinne von Land schaftspflegevorgesehen werden. In diesem Zusammenhang wird auf eine Aussage des Sächsi schenStaatsministeriums für Landwirtschaft, Ernährung und Forsten verwiesen, in der ge fordert wird,daß bei der Rekultivierung der Kippenlandschaft weitestgehend die land schaftstypische Wald-Wiesen-Feld-Verteilung erreicht wird. Kein vorrangiges Interesse be steht an einer agrarwirtschaftlichenNutzung der Kippenflächen.Die Aufforstung ist mit der Zielstellung einer Mehrfachnutzung der entstehenden Wälder zubetreiben. Dabei sollen die Wälder sowohl den Anforderungen an die Produktion von Holz alsauch dem Zweck der Erholung und Ökologie gerecht werden. Mit der Aufforstung wird ein naturnaher,artenreicher Wald mit ca. 30 bis 40% Laubgehölzen geschaffen, wobei die Gehölzestandort- und herkunftsgerecht ausge wählt wer den. Voraussetzung für die Schaffung dieserForstflächen ist die qualitätsgerechte Herstellung der Kippenoberfläche mit einer Mächtigkeit> 2 m aus kulturfreundlichen quartä ren Abraum massen in einer möglichst homogenen Zusammensetzungder Substrate. Die Forstflächen zeichnen sich durch ein abwechslungsreichesRelief aus. Im Nordfeld ist die Morphologie eini ger der dort ursprünglich vorhandenen Dünenzügewieder zu gestalten. Hierfür sind die vorkommenden Dünensande vorzusehen. Eingebettetwerden die Dünen in eine sich weit ausdehnende Calluna-Heidelandschaft. Strauchzonen,Wachol derheide, Sukzessionsflächen, Wildäcker und Trockenrasenstand orte lockern die Forstgebieteauf und führen zu einer ökologischen Bereicherung der Waldge biete. Durch gezielteAbleitung von Oberflächenwasser in gedichtete grundwasserferne Kippenbereiche sind temporäreFeuchtgebiete zu schaffen. Sämtliche Forstflächen sind durch ein ausreichend befahrbaresWirt schaftswegenetz zu erschließen, welches den Forderungen des Waldbrandschutzesentspricht.Im Bereich der Forstflächen und Heidegebiete sind Sukzessi ons flächen geplant, die u. a. mitGeröllflächen und Gehölzen ausgestaltet werden. Als Vorrangflächen für den Naturschutz innerhalbder Bergbaufolgelandschaft sind in Abstimmung mit der unteren Naturschutzbehördefolgende Flächen vorgesehen:- Sukzessionsflächen auf der Innenkippe,40 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Natur und Landschaft 2.3- Calluna Heide,- Naturwaldparzelle,- Uferzone des künftigen Restsees und- RestseeAuf dafür geeigneten Flächen der Bergbaufolgelandschaft sollte im Nahbereich von Ortschaftendie Schaffung von weiteren Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten zu den im Bereichder Ort schaft <strong>Reichwalde</strong> bereits bestehenden vorgesehen werden. Ein weit verzweigtesWirtschaftswe genetz sowie der Bau von öffentlichen Straßen sind für die Erschließung und denAnschluß der Bergbaufol gelandschaft an das umliegende Gebiet zu planen. Dabei sollen auchhisto risch gewachsene Straßen wiederhergestellt werden. Alleen, Einzelbäume, Strauch- undHeckenpflanzen sind als land schaftsgestalterische Elemente zur Umgrünung der Wege undStraßen sowie an den verlegten Flußläufen vorzusehen.Entlang der Straßen und Wirtschaftswege sind Entwässerungsgräben zur Aufnahme überschüssigenOberflächenwassers anzulegen. Diese Gräben stehen im Verbund mit einzel nenStichgräben und leiten das überschüssige Niederschlagswasser in Feuchtbiotope bzw. in denWeißen Schöps ab.Über die künftige Nutzung von nicht mehr benötigten betrieblich genutzten Flächen sind diedafür erfor derli chen Abstimmungen zwischen den jeweiligen Nutzern und dem Bergbauunternehmenzu füh ren. Diese Flächen sind bei Erfordernis in die Renaturierung einzubeziehen.Ziel 15- Nutzung des künftigen RestseesDie Nutzung des künftigen Restsees im westlichen und südlichen Bereich (Ruheteil) sollvorrangig unter ökologischen Gesichtspunkten vorgesehen werden.Begründung:Aus der Karte 4 geht die Lage des nach Beendigung des <strong>Tagebau</strong>betriebes entstehenden Restlocheshervor. Der bergbaubedingte Restraum wird sich langfristig zu einem See ent wickeln.Die Seefläche wird ca. 1 490 ha betragen, wobei die Endstauhöhe bei +130 m HN liegt. Da derWasseranstieg sehr langsam erfolgt, werden die unter dem künftigen Wasser spiegel des Seesliegenden Flächen zunächst mit mehrjährigen einheimischen Pflanzen begrünt.Die Uferzone im westlichen und südlichen Bereich des künftigen Restsees ist als Vorrangflächefür die Belange des Landschafts- und Naturschutzes vorzusehen. Ein künftiger Strandbereichist am östlichen gewachsenen Ufer des Sees mit naher Verkehrsverbindung an die B 115 anzustreben.Die Gestal tung der Uferlinien sowie die Schaffung von Flachwasserbereichen sindnach den Ge sichtspunkten der künftigen Nutzung des Sees vorzunehmen.Die weiteren Untersuchungen zu dieser Problematik sind im Rahmen einer Fortschreibung des<strong>Braunkohlenplan</strong>es zu führen.Es ist vorgesehen, daß eine geländegleiche Schließung des Restraumes der Fläche des ehemaligenHaldenstützeneinschnittes des Brückenmontageplatzes westlich von <strong>Reichwalde</strong> mitanschließender Rekultivierung erfolgt. Bei der Verkippung der Massen sind Setzungen infolgedes Grundwasserwiederanstieges zu berücksichtigen.BlochInternetfassung41
Ziele und Begründungen - Staub- und Lärmimmission 2.4Umsetzung der Ziele:Die Umsetzung und Konkretisierung der in Pkt. 2.3 genannten Ziele ist insbesondere im- bergrechtlichen Betriebsplanverfahren,- Verfahren nach dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Sächsischen Wassergesetz,- Verfahren nach dem Bundesnaturschutzgesetz und dem Sächsischen Naturschutzgesetzvorzunehmen.2. 4 Staub- und LärmimmissionZiel 16- StaubimmissionDie an den <strong>Tagebau</strong> angrenzenden Ortslagen sind rechtzeitig vor dem Abbau durch geeigneteMaßnahmen vor Stau bimmissionen des <strong>Tagebau</strong>es nach dem Stand der Technikwirk sam zu schützen, dabei dürfen die Immissionswerte der 22. Verordnung zur Durchführungdes Bundes-Immissionsschutzgesetztes in der jeweils gültigen Fassung nichtüberschritten werden.Begründung:Die Gewinnung von Braunkohle in <strong>Tagebau</strong>en ist mit der Emission von Staub ver bunden.<strong>Tagebau</strong>e und die zum Betrieb eines <strong>Tagebau</strong>es erforderlichen Anlagen bedürfen keiner immissionsrechtlichenGenehmigung. Diese Anlagen sind nach § 22 Bundes-Immissions schutzgesetz(BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.05.1990 (BGBl. I S. 880) so zu errich tenund zu betreiben, daß schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Standder Technik vermeidbar sind und unvermeidbare, schädliche Umweltein wirkungen auf ein Mindestmaßbeschränkt werden. Die notwendigen Immissionsschutz maßnahmen können aktive,daß heißt Minderung der Staubemission am Entstehungsort, und passive Maßnahmen, wie dasAnlegen von Schutzpflanzungen, umfassen.Der <strong>Tagebau</strong>betrieb führt zwangsläufig zur Freilegung beträchtlicher Abraum- und Kohleflä chensowie zwischenzeitlich nicht rekultivierter Kippenflächen, die vor allem in den Sommer monatenwegen des fehlenden Bewuchses in Abhängigkeit von Temperatur, Niederschlag, Luftfeuchtigkeitund Windbewegung trocken und staubig werden können. Durch das Berg bau unternehmenwird seit dem 01.01.1992 im Einflußbereich der <strong>Tagebau</strong>e ein mit der zuständi gen Behörde(Bergamt Hoyerswerda) abgestimmtes Immissionsmeßnetz zur Ermittlung des Staubniederschlagesbe trieben. Die einzelnen Meßpunkte befinden sich invon den Tage bauen be einfluß ten Siedlungsgebieten und werden entsprechend der <strong>Tagebau</strong>entwicklungjährlich in Abstim mung mit dem Bergamt Hoyerswerda aktualisiert. Das Betreibendes Meß netzes erfolgt nach den dafür geltenden Vorschriften. Die Auswertungen derMeßergeb nisse erfolgen mo natlich, sie werden quartalsweise dem Bergamt Hoyerswerda alsder zu ständigen Behörde mitgeteilt. Für Sonderfälle sind unabhängige Gutachten vorzusehen.Die für Januar bis September 1992 vorliegende Meßreihe weist nach, daß die Immissionswerteder Ziffer 2.5.2 der TA Luft zum Schutz vor erheblichen Nachteilen und Belästigungen (LangzeitwertIW 1 und Kurzzeitwert IW 2) an keinem Meßpunkt überschritten wurden. Die derzeitigeStaubniederschlagsbelastung der <strong>Tagebau</strong>randgemeinden ist als nicht kritisch zu bewerten. Alsmaximal zulässige Immissionswerte der Staubbelastung gelten entsprechend TA Luft 0,35 g/(m²·d) für den Mittelwert aus allen Meßwerten und 0,65 g/(m²·d) für den 98-Perzentil-Wert.Der Immissionsgrenzwert der 22. BImSchV für Schwebstaub beträgt 150 µg/m³ (arithmetischesMittel aller während des Jahres gemessenen Tagesmittelwerte) und42 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Staub- und Lärmimmission 2.4300 µg/m³ (95-Prozentwert der Summenhäufigkeit aller während des Jahres gemessenen Tagesmittelwerte).Zur Minderung der Staubentwicklung und als Schutz gegen Flugstaub sind für den <strong>Tagebau</strong><strong>Reichwalde</strong> unter anderem folgende Maßnahmen durchzuführen oder vorzubereiten:- die Zwischenbegrünung der F 60-Kippe entsprechend der raumordnerischen Beurteilung1992/93,- die Pflege bestehender Waldflächen oder Anlegen neuer Schutzgürtel am <strong>Tagebau</strong>rand,auch in Form von Lückenschließungen bewaldeter Bereiche,- das Anlegen von bepflanzten Erdwällen am unmittelbaren <strong>Tagebau</strong>rand, die nachVorbeischwenken des <strong>Tagebau</strong>es in die Wiedernutzbarmachung einbezogen werden.Ziel 17- LärmimmissionDie an den <strong>Tagebau</strong> angrenzenden Ortslagen sind rechtzeitig vor dem Abbau durch geeigneteMaßnahmen vor Lärmimmissionen des <strong>Tagebau</strong>es nach dem Stand der Technikwirksam zu schützen, dabei sind die gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte der TALärm einzuhalten. Die gebotenen Lärmschutzmaßnahmen sind vorrangig an der Quelleder Emis sionen, insbesondere an den Hauptantrieben, Hauptbändern und Graborganender Bagger durchzu führen.Begründung:Die Gewinnung von Braunkohle in <strong>Tagebau</strong>en ist mit der Emission von Lärm ver bunden. <strong>Tagebau</strong>eund die zum Betrieb eines <strong>Tagebau</strong>es erforderlichen Anlagen bedürfen keiner immissionsrechtlichenGenehmigung. Diese Anlagen sind nach § 22 Bundes-Immissions schutzgesetz(BImSchG) i. d. F. der Bekanntmachung vom 14.05.1990 (BGBl. I S. 880) so zu errich tenund zu betreiben, daß schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Standder Technik vermeidbar sind und unvermeidbare, schädliche Umweltein wirkungen auf ein Mindestmaßbeschränkt werden. Die notwendigen Immissionsschutz maßnahmen können aktive,daß heißt Reduzierung der Lärmemission an der Lärmquelle und passive Maßnahmen wiebeispielsweise Lärmschutzwälle umfassen.Beim Betrieb eines <strong>Tagebau</strong>es gelten als wesentlichste Emittenten von Lärm die Großgeräte,die Bandanlagen mit den Antriebs statio nen sowie der Werkbahnbetrieb. Zur Ermittlung undBeurteilung der Schall immissionen in den Randgemeinden des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> liegtein Bericht des Schall techni schen Beratungsbüros Müller-BBM GmbH, Dresden, vom 28.10.91vor. Die Ergebnisse wurden bereits im Rahmen der raumordnerischen Beurteilung 1992/93öffentlich erörtert.Im Rahmen des von der Fa. PCE Consultec GmbH, Berlin, weiter zu bearbeitenden ökologischenAn forderungsprofiles werden weitere Vorschläge zur Vermeidung bzw. Minimierung dervorhan denen Beeinträchtigungen erarbeitet. Durch die vorgesehene <strong>Tagebau</strong>weiterführung istin fol genden Ortschaften mit einer erhöhten Lärmimmission zu rechnen: Nappatsch, Neuliebel,Hammerstadt, Rietschen-Werda und Ortsteil Haide der Gemeinde Weißkeißel. Da von betroffenwerden auch die am nördlichen Rand des Nordostfeldes gelegenen Kaser nenanlagen derDeutschen Bundeswehr. Die Ortschaft <strong>Reichwalde</strong>-Ziegelei ist aufgrund des Abbaufortschrit tesbereits belastet.Die sich aus der vorgesehenen <strong>Tagebau</strong>weiterführung ergebenden Änderungen auftretenderLärmimmissionen sind in regelmäßigen Zeitabständen gutachterlich zu bewerten. In diese Untersuchungensollten auch die Ergebnisse von technischen Versuchen zur Minderung von Lärmemissionenan den <strong>Tagebau</strong>geräten mit einfließen.BlochInternetfassung43
Ziele und Begründungen - Klima 2.5Seit 01.01.93 wird im Einflußgebiet der <strong>Tagebau</strong>e des Bergbauunternehmens ein Immissi onsmeßnetzfür Lärm betrieben. Da vom Gesetzgeber keine Bestimmungen für den Aufbau einesLärmimmissionsmeßnetzes erlassen wurden, erfolgt deren Gestaltung in enger An lehnung andas bestehende Staubniederschlagsmeßnetz. Diese Verfahrensweise ermög licht damit die Bewertungeines einheitlichen Einwirkungsbereiches von Staub und Lärm. Für den Aufbau desLärmimmissionsmeßnetzes werden folgende Prämissen festgelegt:- Bestimmung von Meßpunkten in Ortslagen mit einer maximalen Entfernung von2 500 m zum aktiven <strong>Tagebau</strong>- die Anzahl der Einzelmeßpunkte je Ortslage wird auf maximal drei begrenzt,- die Messungen werden in Ortslagen unter 1 000 m Abstand zum aktiven <strong>Tagebau</strong>halbjährlich vorgenommen, bei Standorten über 1 000 m erfolgt eine Jahresmessung.Für die durch eine erhöhte Lärmimmission betroffenen Ortschaften sind Schutzmaßnah men,gegliedert nach technischen, planerischen und organisatorischen Maßnahmen vorgesehen.Umsetzung der Ziele:Die Umsetzung und Konkretisierung der in Pkt. 2.4 genannten Ziele ist insbesondere im- bergrechtlichen Betriebsplanverfahren nach immissionsschutzrechtlichen Grundsätzenvorzunehmen.2.5 KlimaZiel 18Das bestehende Mesoklima im Bergbaugebiet und auch in seiner Umgebung soll durchden Bergbau und seine Folgen nicht wesentlich beeinflußt werden.Begründung:Innerhalb größerer Gebiete mit einheitlichen klimatischen Verhältnissen können lokalklimatischeAbweichungen auftreten. Dies wird hervorgerufen durch unterschiedliche Geländefor men,durch unterschiedlichen Bewuchs sowie durch unterschiedliche Wasserflächen. Nach Abschlußder Wiedernutzbarmachung, die sich im wesentlichen an den Reliefunterschieden sowie demauf der ehemaligen Fläche vorhandenen Bewuchs orientiert, kann die entstehende Wasserflächedes Restsees lokalklimatische Abweichungen hervorrufen. Lokal klimatische Besonderheitenzeigen sich insbesondere in der Temperatur- , Feuchte- und Nie derschlagsverteilung sowiein den Wind- und Strahlungsverhältnissen.Die klimatischen Verhältnisse im Raum <strong>Reichwalde</strong> sind durch folgende Werte gekennzeichnet:Jahresmitteltemperaturmittlere Januartemperaturmittlere JulitemperaturTemperaturextrememittlerer Niederschlag/Jahr+8,5°C-1,2°C+18°C-31°C, +38°C625 mm44 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Abfallwirtschaft und Abwässer 2.6Über der entste henden Wasserfläche des Restsees werden sowohl die Temperaturen als auchVerdun stung und Wärmehaushalt insgesamt verändert. Die häufigste Windrichtung im Winterkommt aus Südwest, während im Sommer der Wind aus westlicher Richtung dominiert. Derentstehende Restsee liegt nord westlich von Rietschen, also nicht in den genannten Windrichtungenin bezug auf die Orts lage. Für die B 115 Rietschen--Weißkeißel könnten sich durch denRestsee bei entspre chenden Wetterlagen intensive Nebelbänke bemerkbar machen, da derSee bei unter schiedlichen Tiefen von 3 bis 70 m und einem Fassungsvermögen von 310 Mio.m ³ ein gro ßes Wärmereservoir besitzt. In versionshäufigkeiten werden durch die Wasserflächeetwas abgeschwächt, da über den freien Flächen verstärkte Windbewegungen auftreten.Zusammenfassend ist festzustellen, daß sich lokal durch die Flächenveränderungen, insbesondereum den Restsee und auf Kippenflächen, ein Einfluß auf Wind, Wärme- und Wasserhaushaltbemerkbar macht. Für das Gebiet liegt ein „Amtliches Gutachten zum Klima BergbaufolgelandschaftNochten, <strong>Reichwalde</strong> und Bärwalde“ des Wetteramtes Dresden vom 16.03.1993 vor. Dieinhaltlichen Aussagen des Gutachtens sind bei der Zulassung der Betriebspläne, insbesondereder Hauptbetriebspläne, neu zu bewerten.2.6 Abfallwirtschaft und AbwässerZiel 19Die im <strong>Tagebau</strong> anfallenden Reststoffe, Abwässer und Abfälle sind ordnungsgemäß zuent sorgen. Altlastenverdachtsflächen (Altablagerungen und Altstandorte) sind nach derZielhierarchie- erfassen,- bewerten,- sichernzu behandeln.Altablagerungen, die im Abbaubereich liegen, sind zur Vermeidung negativer Einflüsseauf das Grundwasser nicht zusammen mit dem Abraum zu verkippen. Sie sind vor derbergbauli chen Inanspruchnahme zu entsorgen.Begründung:Der Bergbautreibende hat die im Abbaubereich befindlichen Altablagerungen und Altstandortenach den Prinzipien der Sächsischen Altlastenmethodik zu behandeln. Die Siche rung, Sanierungoder Entsorgung der Altlasten ist zu veranlassen.Wiederverwertbare Stoffe oder Reststoffe lt. § 2 Abs. 3 AbfG sind unter Beachtung gesetzli cherBestimmungen einer stofflichen Verwertung zuzuführen.Abwässer sind in Über ein stimmung mit den gesetzlichen Anforderungen entweder in betriebseigenenoder kommu na len Abwasserbehandlungsanlagen zu reinigen. Das im <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong>an fallende Abwasser wird in betriebseigenen Kleinkläranlagen nach vorgegebenenGrenzwerten der Wasserbehörde mechanisch gereinigt und nur über die GrubenwasserreinigungsanlageKringelsdorf in den Weißen Schöps geleitet.Alle nichtbergbaulichen Abfälle sind auf den dafür zugelassenen Entsorgungsanlagen zu entsorgen.Die Entsorgung von Abfällen im Sinne des § 2 Abs. 2 AbfG ist über entsprechendeEntsorgungsnachweise der zuständigen Behörde nachzuweisen. Bergbauspezifische Abfälle,für die die Vorschriften des § 1 Abs. 3 Ziffer 3 AbfG keine Anwendung finden, sind nach denBestimmungen des Bundesberggesetzes zu behandeln.BlochInternetfassung45
Ziele und Begründungen - Archäologie und Denkmalpflege 2.7Für das Abbaugebiet der Teilfelder Nord und Nordost im Bereich des Truppenübungsplat zesNochten sind die Ergebnisse aus einer „Datenerhebung Altlastenverdachtsflächen, TruppenübungsplatzNochten“ (I/1992) der Wehrgeologischen Stelle Fürstenfeldbruck be kannt.Diese von der Deutschen Bundeswehr genutzten Flächen des Truppenübungsplatzes No chtenim künftigen Abbaugebiet sind nach den Bestimmungen des „Ersten Gesetzes zur Abfallwirtschaftund zum Bodenschutz im Freistaat Sachsen vom 12.08.91“ EGAB von be stehendenAltlasten freizumachen. Des weiteren sind diese Flächen munitionsfrei zu über geben. Entsprechendevertragliche Regelungen zwischen dem Bergbauunternehmen und der Deutschen Bundeswehrsind zu treffen.Bei der weiteren Arbeit zur Erfassung, Gefährdungsabschätzung und Sanierung aller im Einflußbereichdes <strong>Tagebau</strong>es befindlichen Altablagerungen und Altstandorte ist zu beach ten, daßder <strong>Tagebau</strong> am Südrand des Lausitzer Urstromtales liegt. Die Sümpfung des Ab baugebietesbewirkt eine deutliche Absenkung des Grundwassers und beeinflußt dessen Fließrichtung teilweiseabweichend zum Zustand vor dem Bergbau.Wegen der guten Durchlässigkeit des Deckgebirges besteht für niederschlagsbedingte Sickerwässereine gute Wasserwegsamkeit. Durch das teilweise Fehlen hydraulischer Barrieren istdie Möglichkeit eines relativ ungehinderten Schadstoffein tra ges in das Grundwasser bei etwaigenBodenkontaminationen auch bei großem Flurab stand gegeben.Nach Beendigung des Braunkohlenbergbaues können mögliche kontaminierte Bodenberei chewegen des Grundwasserwiederanstieges direkt im Grundwasser bzw. mit geringem Abstandzu diesem liegen. Um Gefährdungen auszuschließen, ist die Sicherung bzw. Sanierung dieserBereiche nach den geltenden gesetzlichen Bestimmungen vorzusehen.Für die Kippenflächen des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> liegen bisher keine An forderungen zur Nutzungvon Reststoff- oder Mülldeponien vor. Mülldeponien be dürfen spe zieller Standortuntersuchungenund Vorkehrungen. Möglichkeiten zur Verbrin gung nicht kon taminierter Reststoffe,wie Bodenaushub oder Abbruchmaterial, können im Interesse der Ver ringerung des Massendefizits,der Reliefgestaltung oder bei Eignung zur Herstellung vorüber gehender Schutzwällegeschaffen werden.Umsetzung des Zieles:Die Umsetzung und Konkretisierung des im Pkt. 2.6 genannten Zieles ist insbesondere im- bergrechtlichen Betriebsplanverfahren,- Verfahren nach dem Abfallgesetz und dem Ersten Gesetz zur Abfallwirtschaft undzum Bodenschutz im Freistaat Sachsenvorzunehmen.2.7 Archäologie und DenkmalpflegeZiel 20Die fachgerechte Untersuchung und Bergung von vorhandenen Kulturdenkmalen im Abbaubereichsoll vom Bergbautreibenden ermöglicht werden.Begründung:Bei der Weiterführung des <strong>Tagebau</strong>es ist zu erwarten, daß im Abbaubereich archäologi scheFunde und Bodendenkmale auftreten können. Den zuständigen Behörden ist recht zeitig Gelegenheitzur wissenschaftlichen Untersuchung und zur Bergung zu geben.46 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Umsiedlung und Infrastruktur 2.8Bergbaulich bedingte negative Auswirkungen auf Kulturdenkmale außerhalb des Abbaubereichessollten weitestgehend vermieden werden, im Einzelfall ist nach dem SächsDSchG zu verfahren.Vor der Inanspruch nahme von Ortschaften ist eine vollständige Dokumentation der Orteund Einzelobjekte unter Einbeziehung des Sorbischen Institutes Bautzen vorzu nehmen. Diedenkmalgeschützten Gebäude, insbesondere die Schrot holzhäuser, werden nach Umsetzungund Wiederaufbau im „Erlichthof“ in Riet schen gezeigt. Entspre chend den Bestimmungen desGesetzes zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmale im Freistaat Sachsen (SächsischesDenkmalschutzgesetz - SächsD SchG) vom 03.03.93 unter stützt das Bergbauunternehmen dieseArbeiten der Behörden. Denkmalschutzbehörden sind die unteren Verwaltungsbehörden. DieFachbehörden sind das Landesamt für Denkmalpflege und das Landesamt für Archäologie.Umsetzung des Zieles:Die Umsetzung und Konkretisierung des im Pkt. 2.7 genannten Zieles ist insbesondere im- bergrechtlichen Betriebsverfahren,- Verfahren nach dem Sächsischen Denkmalschutzgesetzvorzunehmen.2.8 Umsiedlungen und InfrastrukturZiel 21- UmsiedlungenDie am 01.01.1994 noch nicht abgeschlossenen Umsiedlungen der im Abbaubereich liegendenOrte und Ortsteile sind in einer sozial verträglichen Form durchzuführen.Begründung:Die Planung und Gestaltung einer sozial verträglichen Umsiedlung verfolgt vor allem fol gendeZiele:- Erhalt und Fortbestand der Dorfgemeinschaft- rechtzeitige Information der Bürger und Mitwirkungsmöglichkeiten bei der Vorbereitungund Durchführung der Umsiedlung- möglichst geringe Belastungen für die Dorfgemeinde und die einzelnen Bürger- Erhalt der bisherigen Vermögenssubstanz- der neue Wohnort soll möglichst bald zum neuen „Zuhause“ werden.Im Falle der Umsiedlungen im Abbaugebiet des Ta gebaues <strong>Reichwalde</strong> läuft nicht nur die Vorbereitungund Planung, sondern auch die Durch führung der Umsiedlung selbst schon seit einigenJahren. Das heißt, der Umsied lungspro zeß wurde unter Voraussetzungen und Bedingungeneingeleitet, die nur teilweise von den o. g. systematischen Anforderungen geleitet waren.Das bedeutet aber auch, daß die Umsiedlung schon eine Reihe von Auswirkungen hervor gerufenhat, die nicht mehr rückgängig gemacht werden können und kaum veränderbar sind. DieKonsequenz dieses Sachverhaltes ist, daß sozial verträgliche Lösungsvorschläge nur mehr inbegrenztem Maße wirken - und dies eher im individuellen Bereich, d. h. für den einzelnen Umsiedler.Von der Umsiedlung sind - bezogen auf den Stand 30.04.1993 - noch 62 Einwohner dersich im Baufeld <strong>Reichwalde</strong>-Süd befindlichen Orte Viereichen, Mocholz, Zweibrücken undAltliebel betroffen, die zur Einheitsgemeinde Rietschen gehören. Vor dem Beginn der Um -BlochInternetfassung47
Ziele und Begründungen - Umsiedlung und Infrastruktur 2.8siedlung im Jahre 1989 wohnten in diesen Ortschaften insgesamt 154 Einwohner.Zur Feststellungdes Umsiedlungswillens der Bevölkerung der Orte Viereichen und Altliebel wurde im Juli1992 von der Gemeinde Rietschen eine Bürgerbefragung durchgeführt. Sie erbrachte un terBeachtung des gegenwärtigen Standes der Umsiedlung das Ergebnis, daß 80 % der Bürgervon Altliebel und 87 % der Bürger von Viereichen für eine Umsiedlung stimmten. Mit Stand vom30.04.1993 stellt sich die Situation in den betreffenden Orten wie folgt dar:Ortschaft Einwohner Anwesen bisher vom Unter nehmenerworbene Anwesenzum 30.04.1993freigezo gene AnwesenMocholz/Zweibrücken9 26 23 19Viereichen 44 20 18 5Altliebel 17* 13 10 8Gesamt 70 59 51 32*8 Einwohner werden nicht vom Abbau betroffenAls Umsiedlungsstandort wurde vom Unternehmen LAUBAG ein neues Wohngebiet in Rietschen-Niederprauskeerschlossen. Infrastrukturelle Angebote und Gemeinschafts einrichtungensind am neuen Wohnort Nie derprauske vorläufig nicht vorgesehen. Diese Funktionen werdenvom ca. einen Kilometer entfernten zentralen Ortsteil Rietschen wahrgenommen.Ziel 22- Schaffung von Ersatzflächen für sonstige ObjekteFür die durch den Kohleabbau beanspruchten Flächen des Truppenübungsplatzes Nochtender Deutschen Bundeswehr sollen geeignete Ersatzflächen bereitgestellt werden.Begründung:Im Zuge der weiteren <strong>Tagebau</strong>entwicklung im Baufeld <strong>Reichwalde</strong>-Nord und <strong>Reichwalde</strong>-Nordostkommt es zur Inanspruchnahme von Teilen des Truppenübungsplatzes Nochten. Seitensder Deutschen Bundeswehr besteht die Forderung nach einer Kompensation des ein tretendenÜbungsplatzverlustes. Die Schaffung von Ersatzflächen sollte in einzelnen Abschnitten auf dendafür vorgesehenen Flächen gemäß der bergbaulichen Inanspruchnahme des TruppenübungsplatzesNochten erfolgen. Die notwendige Verle gung der auf dem Übungsplatz vorhandenenmilitärischen Anlagen sowie der durch dieses Gebiet führenden Panzerstraße als Voraussetzungfür eine vollständige Gewinnung der Kohle im Nordfeld und im Nordostfeld ist durch rechtzeitigeSchaffung von Ersatzmaßnah men, die auch den Ersatzbau für die Kaserne und dieAnbindung an das Verkehrs- und Versorgungsnetz beinhalten, zu ermöglichen. Ent sprechendevertragliche Regelungen sind zu dem dafür notwendi gen Zeitpunkt zu treffen.Ziel 23- Straßen und BahnstreckenDas um den <strong>Tagebau</strong> verbleibende Straßennetz soll dem Bedarf entsprechend so ergänztwerden, daß seine Leistungsfähigkeit erhalten bleibt und seine Konzeption in Verbindungmit den Er satzstraßen eine sinnvolle Funktion ergibt.Beim Übergang des <strong>Tagebau</strong>es vom Nordfeld in das Nordostfeld ist die Bahn streckeGörlitz--Cottbus--Berlin nach Osten außerhalb der Sicherheitslinie zu verlegen. Dabei ist48 BlochInternetfassung
Ziele und Begründungen - Umsiedlung und Infrastruktur 2.8eine Trassenführung durch das Teichgebiet Rietschen zu vermeiden. Für den bisher bestehendenBahnhof Rietschen soll an der Neubautrasse ein Ersatz vorgesehen werden.Begründung:Nach der vorliegenden Konzeption werden die im Südfeld <strong>Reichwalde</strong> vorhandenen Ortsverbindungsstraßen beim weiteren <strong>Tagebau</strong>fortschritt überbaggert. Der Entwurf des neuenVer kehrswegenetzes geht aus der Darstellung in Karte 4 hervor. Beim Übergangdes Ta ge baues vom Nordfeld in das Nordostfeld wird die Verlegung der BahnstreckeGörlitz--Cottbus--Berlin im Jahre 2021 erforderlich. Die Strecke verbindet Cottbus (Oberzentrummit regionalem Entwicklungsschwerpunkt) mit Görlitz (Mittelzentrum). Eine Ersatzstreckeist vom Bereich südlich Rietschen bis südlich von Weißwasser auf einer Länge von ca. 15,5 kmnotwendig. Dabei ist die Forderung der Deutschen Bundeswehr zu beachten, daß die Trasseder verlegten Strecke, bedingt durch die Erfor der nisse der Nutzung des Truppenübungsplatzesnicht östlich der B 115 verlaufen soll. Bei der Verlegung der Eisenbahnstrecke westlich derB115 ist zu berücksichtigen, daß die Bahntrasse und die B115 außerhalb der Sicherheitsliniedes <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> verlaufen. Der genaue Verlauf der Trasse ist in dem dafür notwendigengesonderten Verfahren festzulegen.Ziel 24- LeitungenBevor durch den Abbaufortschritt des <strong>Tagebau</strong>es Versorgungsleitungen unterbro chenwerden, ist die jeweilige leistungsabhängige Versorgung durch geeignete Maß nahmenrechtzeitig sicherzustellen.Begründung:Bei den von der weiteren <strong>Tagebau</strong>entwicklung betroffenen Leitungen handelt es sich zum größtenTeil um Objekte, die im Zusammenhang mit den Ortsinanspruchnahmen ersatzlos rückgebautund überbaggert werden können. Ersatz ist zu schaffen für Hochspannungslei tun gen derEnergieversorgung Spree-Schwarze Elster AG bzw. Energieversorgung Sachsen Ost AG. DieDemontage und Ersatzneubauten sind zu gegebener Zeit mit den Versorgungsunternehmenabzustimmen und von diesen auszuführen. Die Mit telspan nungsleitungen des UnternehmensLAUBAG werden innerhalb der Sicherheitszone vorwie gend mit Leitungstrossen errichtet. DieTrinkwasserleitungen sind ersatzlos zurückzu bauen bzw. zu überbaggern. Ein zentrales Entwässerungssystemexistiert im beanspruch ten Territorium nicht.Eine Beeinträchtigung der parallel zur B 115 verlaufenden Gasleitung durch den <strong>Tagebau</strong> betriebist auszuschließen. Die Bandanlagen des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> befinden sich in nerhalb desAbbaugebietes auf der Arbeitsebene des Vor schnittes und in der Grube. Auf der Rasensohleverlegte Bandtrassen liegen innerhalb der Sicherheitszone. Beeinträch tigungen der Öffentlichkeitsind auszuschließen.Umsetzung der Ziele:Die Umsetzung und Konkretisierung der in Pkt. 2.8 genannten Ziele ist insbesondere im- bergrechtlichen Betriebsplanverfahren,- Bauleitplanverfahren,- Planfeststellungsverfahren nach dem Bundesfernstraßengesetz und demSächsischen Straßengesetz und in- sonstigen fachplanerischen Verfahrenvorzunehmen.BlochInternetfassung49
Quellenverzeichnis3 QuellenverzeichnisVerzeichnis der Gesetze und Verordnungen:AbfGBBergGBImschGBNatSchGEGABGesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (Abfallgesetz) i.d.F.der Bekanntmachung vom 27.08.1986 (BGBl. I S.1410, ber. durch BGBl. 1986I S. 1501/BGBl. III 2129-15), zuletzt geändert durch Art. 6 Investitionserleichterungs-und Wohnbauland G vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)Bundesberggesetz vom 13.08.1980 (BGBI. I S. 1310, BGBl. III 750-15), zuletztgeändert durch Art 3 Zweites G zur Änderung des Gerätesicherheits G vom26.08.1992Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionschutzgesetz)i.d.F. der Bekanntmachung vom 14.05.1990 (BGBI. I S.880), zuletzt geändert durch Art. 8 Investitionserleichterungs- und WohnbaulandG vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundes naturschutzgesetz)i.d.F. der Bekanntmachung vom 12.03.1987 (BGBI. I S. 889), zuletzt geändertdurch Art. 5 Investitionserleichterungs- und Wohnbauland G vom 22.04.1993(BGBl. I S. 466)Erstes Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz im Freistaat Sachsenvom 12.08.1991 (Sächs GVBl. 306)ROG Raumordnungsgesetz vom 08.04.1965 i.d.F. der Bekanntmachungvom 28.04.1993 (BGBl. I S. 630), zuletzt geändert durch Art.4 Investitionserleichterungs- und Wohnbauland G vom 22.04.1993(BGBl. I S. 466)SächsLPIGGesetz zur Raumordnung und Landesplanung des Freistaates Sachsen vom24.06.1992 (SächsGVBl. S. 259)Gesetz über die Vorläufigen Grundsätze und Ziele zur Siedlungsentwicklungund Landschaftsordnung im Freistaat Sachsen vom 20.06.1991 (SächsGVBl.S. 164)SächsDSchG Sächsisches Denkmalschutzgesetz vom 03.03.1993 (SächsGVBl. S. 229)SächsNatSchGSächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege(Sächsisches Naturschutzgesetz) vom 16.12.1992 (SächsGVBl. S. 571)WHG Wasserhaushaltsgesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.1986(BGBl. I S. 1529)SächsWG Sächsisches Wassergesetz vom 23.02.1993 (SächsGVBl. S. 201)TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 16.07.1968(Beil. BAnz. Nr. 137)TA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 27.02.1986 (GMBl. S. 95,ber. S. 202)Verordnung überZweiundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-50 BlochInternetfassung
QuellenverzeichnisImmissionswerte Immissionsschutzgesetzes vom 26.10.1993 (BGBl. I S. 1819)- 22. BImSchVFStrG Bundesfernstraßengesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom 08.08.1990(BGBl. I S. 1714)SächsStrG Sächsisches Straßengesetz vom 21.01.1993 (SächsGVBl. S. 93)SächsWaldG Sächsisches Waldgesetz vom 10.04.1992(SächsGVBl. S. 137)Sonstige Quellen:Brecht et al.Jahrbuch 1992 - Bergbau, Öl und Gas, Elektrizität, Chemie(1992) 99. Jahrgang.-EssenLausitzer Braun- „Zuarbeit zum <strong>Braunkohlenplan</strong> für das Vorhaben Weiterführungkohle AG (LAUBAG) des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> 1994 bis Auslauf“ vom01.12.1992.-(1992) SenftenbergLausitzer Braun- „Ergänzung zur Zuarbeit zum <strong>Braunkohlenplan</strong> für das Vorhabenkohle AG (LAUBAG) Weiterführung des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> 1994 bis Auslauf“ vom (1993)15.01.1993.-SenftenbergLausitzer Braun- <strong>Tagebau</strong> <strong>Reichwalde</strong>, Umsiedlung Viereichen, Mocholz, Zweibrückenkohle AG (LAUBAG) und Altliebel - Angaben zur Prüfung der Sozialverträglichkeit -(1993) - Januar 1993, SenftenbergPCE Consultec „ Ökologische Untersuchungen zum Beeinflussungsgebiet des Tage-GmbH Berlinbaues <strong>Reichwalde</strong> einschließlich Vorschlag zur Bergbaufolgeland-(1993) schaft“ vom April 1993.-BerlinRegierungsprä- Raumordnerische Beurteilung zum Vorhaben „Weiterführung dessidium Dresden <strong>Tagebau</strong>es <strong>Reichwalde</strong> in den Jahren 1992/93“ vom 18.05.1992.-(1992) DresdenSächsische Staatsregierung(1992)Sächsisches StaatsministeriumfürWirtschaft undArbeit (1993)Leitlinien zur künftigen Braunkohlenpolitik in Sachsenvom 02.06.1992.-DresdenEnergieprogramm Sachsen vom 06.04.1993.-DresdenBlochInternetfassung51
Kartenverzeichnis4 KartenverzeichnisKarte Bezeichnung Maßstab1 Zielkarte Abbaubereich und Sicherheitslinie 1: 50 0002 Erläuterungskarte Abbauentwicklungin Zeitetappen 1:100 0003 Zielkarte Einwirkungsbereich derGrundwasserabsenkung 1:100 0004 Zielkarte Gestaltung der Bergbaufolgelandschaftim Endzustand 1: 50 00052 BlochInternetfassung