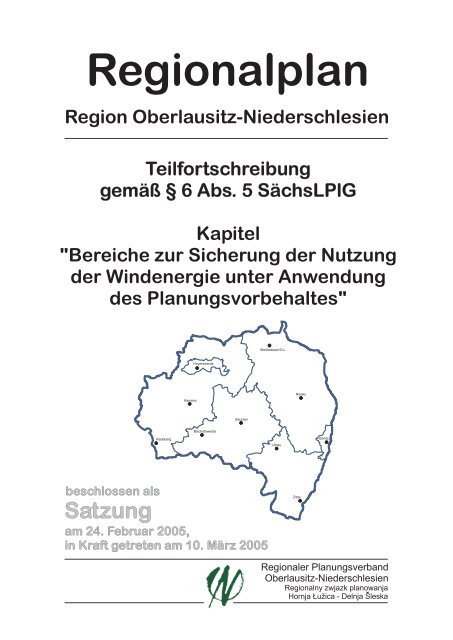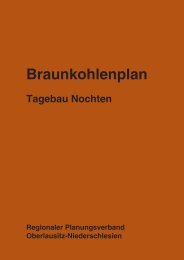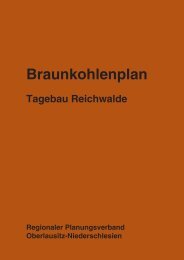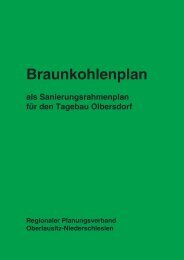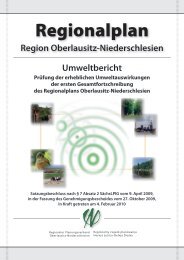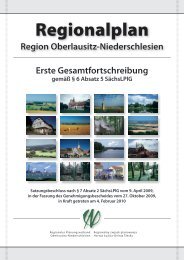Teilfortschreibung gemäß § 6 Abs. 5 SächsLPlG Satzung am 24 ...
Teilfortschreibung gemäß § 6 Abs. 5 SächsLPlG Satzung am 24 ...
Teilfortschreibung gemäß § 6 Abs. 5 SächsLPlG Satzung am 24 ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Regionalplan<br />
Region Oberlausitz-Niederschlesien<br />
<strong>Teilfortschreibung</strong><br />
<strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 5 <strong>SächsLPlG</strong><br />
Kapitel<br />
"Bereiche zur Sicherung der Nutzung<br />
der Windenergie unter Anwendung<br />
des Planungsvorbehaltes"<br />
beschlossen als<br />
<strong>Satzung</strong><br />
Radeberg<br />
K<strong>am</strong>enz<br />
Hoyerswerda<br />
Bischofswerda<br />
Bautzen<br />
<strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005,<br />
in Kraft getreten <strong>am</strong> 10. März 2005<br />
Weißwasser/O.L.<br />
Löbau<br />
Niesky<br />
Zittau<br />
Görlitz<br />
Regionaler Planungsverband<br />
Oberlausitz-Niederschlesien<br />
Regionalny zwjazk planowanja<br />
Hornja £užica - Delnja Sleska
Inhalt<br />
<strong>Satzung</strong> über die Feststellung der <strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplanes<br />
für das Kapitel II.4.4.7 "Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie<br />
unter Anwendung des Planungsvorbehaltes” 1<br />
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7 "Bereiche zur Sicherung<br />
der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes” 2<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von<br />
gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie im Sinne des<br />
Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 des Gesetzes zur Raumordnung und<br />
Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz - <strong>SächsLPlG</strong>)<br />
vom 14. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 716), das durch Artikel 5 des Gesetzes<br />
vom 14. November 2002 (SächsGVBl. S. 307, 310) geändert worden ist 16<br />
Anlage 2: Karte "<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplanes für das Kapitel II.4.4.7 Bereiche zur<br />
Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes"<br />
Impressum<br />
Herausgeber: Regionaler Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien<br />
Käthe-Kollwitz-Straße 17, Haus 3<br />
02625 Bautzen<br />
Telefon 03591 / 273 280<br />
Telefax 03591 / 273 282<br />
E-Mail rpv.ol-ns@t-online.de<br />
Internet www.rpv-oberlausitz-niederschlesien.de<br />
Bearbeitung: Regionale Planungsstelle Bautzen<br />
Käthe-Kollwitz-Straße 17, Haus 3<br />
02625 Bautzen<br />
Telefon 03591 / 273 <strong>24</strong>0<br />
Telefax 03591 / 273 282<br />
E-Mail rps-bautzen@rpdd.sachsen.de<br />
Schutzgebühr: 12 Euro<br />
Druck: Lausitzer Druck- und Verlagshaus GmbH<br />
Töpferstraße 35<br />
02625 Bautzen<br />
Kartendruck: Offizin Andersen Nexö Leipzig<br />
Spenglerallee 26-30<br />
04422 Zwenkau
<strong>Satzung</strong><br />
des Regionalen Planungsverbandes Oberlausitz-Niederschlesien<br />
über die Feststellung der <strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplanes<br />
für das Kapitel II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie<br />
unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
<strong>Satzung</strong><br />
Die Verbandsvers<strong>am</strong>mlung hat auf Grund von <strong>§</strong> 7 <strong>Abs</strong>. 2 Satz 1 des Gesetzes zur Raumordnung<br />
und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz - <strong>SächsLPlG</strong>) vom 14. Dezember<br />
2001 (SächsGVBl. S. 716), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom 14. November 2002<br />
(SächsGVBl. S. 307, 310) geändert worden ist, <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005 folgende <strong>Satzung</strong> beschlossen:<br />
<strong>Satzung</strong><br />
über die Feststellung der <strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplanes<br />
für das Kapitel II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie<br />
unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
<strong>§</strong> 1<br />
Die <strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplanes für das Kapitel II.4.4.7 „Bereiche zur Sicherung der<br />
Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planvorbehaltes“ bestehend aus dem Textteil und<br />
einer Karte (Anlagen zu dieser <strong>Satzung</strong>) - wird als <strong>Satzung</strong> beschlossen.<br />
<strong>§</strong> 2<br />
Das Kapitel II.4.4.7 „Schutzbedürftige Bereiche für die Sicherung von Windenergiepotentialen“ des<br />
Regionalplanes Oberlausitz-Niederschlesien (festgestellt durch <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> 10. November 2000,<br />
zuletzt geändert durch <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> 10. Januar 2002) wird aufgehoben.<br />
Die <strong>Satzung</strong> tritt mit der Bekanntmachung <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 7 <strong>Abs</strong>. 4 Satz 4 <strong>SächsLPlG</strong> in Kraft.<br />
Bautzen, <strong>24</strong>. Februar 2005<br />
Lange<br />
Verbandsvorsitzender<br />
<strong>§</strong> 3<br />
1
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Karte: Die Vorrang- und Eignungsgebiete für die Nutzung von Windenergie sind in der Karte<br />
„<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplanes für das Kapitel II.4.4.7 Bereiche zur Sicherung<br />
der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
ausgewiesen.<br />
Ziel II.4.4.7.1 Außerhalb der ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebiete für die Nutzung<br />
von Windenergie ist die Errichtung raumbedeuts<strong>am</strong>er Windkraftanlagen sowie<br />
die bauleitplanerische Ausweisung von dafür vorgesehenen Gebieten ausgeschlossen.<br />
Begründung<br />
Sächsisches Umweltqualitätsziel ist es, fünf Prozent des Endenergieverbrauches bis zum Zeitraum<br />
2005-2010 aus erneuerbaren Energien zu decken (vgl. Klimaschutzprogr<strong>am</strong>m des Freistaates<br />
Sachsen 2001). Von diesen 4600 GWh pro Jahr sollen 25 % durch die Nutzung der Windenergie<br />
gedeckt werden. Mit dem <strong>am</strong> 01.01.2004 in Kraft getretenen LEP 2003 liegen landesplanerische<br />
Vorgaben zum Ausbau der erneuerbaren Energien und d<strong>am</strong>it auch der Windenergie vor. Entsprechend<br />
dem Grundsatz 11.3 des LEP 2003 werden die Träger der Regionalplanung beauftragt,<br />
darauf hinzuwirken, dass die im Klimaschutzprogr<strong>am</strong>m formulierten Ziele für die energetische Nutzung<br />
u. a. der Windenergie umgesetzt werden. Ziel 11.4 LEP 2003 verpflichtet die Regionalplanung<br />
zur Sicherung der räumlichen Voraussetzungen für die Nutzung von Windenergie und zur<br />
abschließenden flächendeckenden Planung, dessen Grundlage die im Klimaschutzprogr<strong>am</strong>m formulierte<br />
Zielstellung bildet. Der Regionale Planungsverband Oberlausitz-Niederschlesien hat somit<br />
für sein Planungsgebiet die Aufgabe, das Landesziel für den Bereich der Windenergie mit seinen<br />
raumplanerischen Instrumenten zu konkretisieren und umzusetzen. Die Region Oberlausitz-<br />
Niederschlesien hat einen Flächenanteil von ca. <strong>24</strong>,4 % an der Ges<strong>am</strong>tfläche Sachsens. Der Flächenanteil<br />
bietet gegenwärtig die einzig objektive Möglichkeit, den Anteil der Planungsregionen an<br />
der Umsetzung des Klimaschutzprogr<strong>am</strong>ms für den Bereich der Windenergie zu bestimmen. Das<br />
sächsische Windmessprogr<strong>am</strong>m (WMP), dass in mehreren <strong>Abs</strong>chnitten zwischen 1994 und 1997<br />
durchgeführt wurde, kann auf Grund des heute erreichten Standes der Technik für eine Potenzialanalyse<br />
dahingehend nur noch bedingt angewendet werden, dass die Standorterträge durch die<br />
größeren Nabenöhen der WKA höher liegen werden als ermittelt. Es kann jedoch davon ausgegangen<br />
werden, dass die im WMP ermittelten Daten eine für die Regionalplanung ausreichende<br />
Datengrundlage darstellen. Konkrete Überprüfungen oder zeitaufwendige Ermittlungen vor Ort sind<br />
dagegen für ein regionalplanerisches Konzept nicht erforderlich (vgl. OVG Münster, Urteil vom<br />
30.11.2001 – 7 A 4857/00). Entsprechend dem <strong>Abs</strong>chlussbericht für das WMP „Windpotenziale in<br />
Sachsen“ (SMUL: Windenergienutzung im Freistaat Sachsen = Materialien zum Klimaschutz<br />
I/1997) liegt der Anteil der Planungsregion <strong>am</strong> realistischen technischen Windpotenzial Sachsens<br />
bei einer angenommenen Nabenhöhe von 60 m bei ca. 19 %. Dabei wurden für die vier untersuchten<br />
Teilregionen „Oberlausitz“, „Pulsnitz“, „Hoyerswerda“ und „Görlitz“ windhöffige Flächen in einer<br />
Größe von ca. 180 km² mit einem Ges<strong>am</strong>tpotenzial von ca. 3,5 TWh/a ermittelt. Das realistische<br />
technische Potenzial der Planungsregion beträgt <strong>gemäß</strong> dem <strong>Abs</strong>chlussbericht ca. 25 % des Ges<strong>am</strong>tpotenzials<br />
und somit ca. 875 GWh/a. Mit den heute erreichbaren Nabenhöhen von teilweise<br />
über 100 m ist ein anderer Anteil möglich, der jedoch mit den derzeit bekannten Untersuchungen<br />
nicht objektiv berechenbar ist.<br />
Somit wird der prozentual höhere Flächenanteil der Planungsregion als Grundlage verwendet, aus<br />
dem sich das Ziel (<strong>gemäß</strong> Ziel 11.4 LEP 2003 i. V. m. dem sächsischen Klimaschutzprogr<strong>am</strong>m)<br />
ergibt, ein Flächenpotential für die Nutzung der Windenergie in der Region raumordnerisch zu sichern,<br />
dass die Erzeugung von mindestens 280 GWh pro Jahr gewährleisten kann.<br />
2 beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Es wird auf Grund des heute erreichten Standes der Technik der binnenlandoptimierten Windkraftanlagen<br />
(WKA) mit Nabenhöhen bis über 100 m davon ausgegangen, dass der überwiegende Teil<br />
der Planungsregion als windhöffig gilt. Ausnahmen ergeben sich insbesondere im Bereich von in<br />
Hauptwindrichtung vorgelagerten größeren Erhebungen sowie von Muldenlagen innerhalb größerer<br />
zus<strong>am</strong>menhängender Waldflächen. Dies ist der wesentliche Unterschied im Vergleich zu den<br />
Ausgangsbedingungen in den Jahren 1997 bis 1999, wo ein regionalplanerischer Steuerungsbedarf<br />
auf Grund niedrigerer Nabenhöhen und anderer Einspeisevergütungen nur für die im Rahmen<br />
des Windmessprogr<strong>am</strong>mes für den Freistaat Sachsen Teil II näher betrachtete „Gefildelandschaft“<br />
bestand.<br />
Mit dieser neu zu bewertenden Eignung der Region Oberlausitz-Niederschlesien ist der mit dieser<br />
Fortschreibung räumlich erweiterte regionalplanerische Steuerungsbedarf begründet. Die Steuerung<br />
erfolgt durch die Anwendung des „Planungsvorbehaltes“ im Sinne von <strong>§</strong> 35 <strong>Abs</strong>. 3 Satz 3<br />
BauGB für die ges<strong>am</strong>te Planungsregion durch die Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebieten<br />
<strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 2 <strong>Abs</strong>. 2 <strong>SächsLPlG</strong>. Der „Planungsvorbehalt“ dient einer geordneten Errichtung der<br />
Windkraftanlagen in der Landschaft und kann einem planerisch nicht gewollten „Wildwuchs“ entgegenwirken.<br />
Auch die Entwicklung und Standortverteilung der errichteten, genehmigten sowie im<br />
Genehmigungsverfahren befindlichen WKA seit dem Jahr 2000 bestätigt diese Annahme und begründet<br />
den in Anspruch genommenen Planungsvorbehalt.<br />
Die regionalplanerische Steuerung der Standorte beschränkt sich dabei auf raumbedeuts<strong>am</strong>e Einzelanlagen,<br />
Anlagengruppen und Windparks. Ob eine Raumbedeuts<strong>am</strong>keit vorliegt, ist dabei einzelfallbezogen<br />
zu prüfen. Kriterien für die Raumbedeuts<strong>am</strong>keit einer Planung oder Maßnahme sind<br />
die Raumbeanspruchung und die Beeinflussung der räumlichen Entwicklung eines Gebietes bzw.<br />
der Funktion eines Gebietes. Die Raumbedeuts<strong>am</strong>keit kann sich dabei insbesondere aus dem<br />
besonderen Standort (z. B. weithin sichtbare Kuppe, großräumiges Offenland) und den d<strong>am</strong>it verbundenen<br />
Sichtbeziehungen, den Auswirkungen der Anlage auf bestimmte Ziele der Raumordnung<br />
(z. B. Schutz von Natur und Landschaft, Erholung und Fremdenverkehr, Rohstoffsicherung)<br />
oder auch allein auf Grund der Dimension der Anlage (Höhe, Rotordurchmesser) ergeben. Mit den<br />
heute üblichen Ges<strong>am</strong>thöhen der WKA von 70 m bis ca. 160 m ist, unabhängig vom Standort, i. d.<br />
R. schon bei Einzelanlagen von einer Raumbedeuts<strong>am</strong>keit auszugehen. Weiterhin ist bei der Beurteilung<br />
der räumliche Zus<strong>am</strong>menhang von mehreren für sich genommen nicht raumbedeuts<strong>am</strong>en<br />
Anlagen zu berücksichtigen. Die Raumbedeuts<strong>am</strong>keit ergibt sich dann aus der Ges<strong>am</strong>tbetrachtung<br />
der Einzelvorhaben bzw. -anlagen.<br />
Um das mit der <strong>Teilfortschreibung</strong> angestrebte Ziel des Klimaschutzes durch die Sicherung und<br />
Steuerung der Standorte mit einer möglichst geringen Flächeninanspruchnahme und Raumbeanspruchung<br />
zu sichern, kommt es darauf an, möglichst ertragsstarke Standorte zu sichern, die im<br />
Wesentlichen konfliktfrei zu den anderen, auf der Ebene der Regionalplanung erkennbaren<br />
(Raum-)Nutzungen sind. Bei der Auswahl wurden die in der Begründung zum Ziel 11.4 des LEP<br />
2003 genannten Kriterien berücksichtigt.<br />
Gemäß dem <strong>§</strong> 2 <strong>Abs</strong>. 2 Satz 3 <strong>SächsLPlG</strong> darf die Ausweisung von Eignungsgebieten (EG) im<br />
Sinne von <strong>§</strong> 7 <strong>Abs</strong>. 4 Nr. 3 ROG nur in Verbindung mit der Ausweisung von Vorranggebieten<br />
(VRG) zugunsten der betreffenden Nutzung erfolgen. Unter diesem Grundprinzip erfolgt mit dieser<br />
<strong>Teilfortschreibung</strong> ausschließlich die Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebieten für die Nutzung<br />
von Windenergie als Ziele der Raumordnung, die als eine Ausweisung an anderer Stelle im<br />
Sinne von <strong>§</strong> 35 <strong>Abs</strong>. 3 Satz 3 BauGB gelten. Weiterhin wird auf die Anpassungspflicht für die Gemeinden<br />
<strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 1 <strong>Abs</strong>. 4 BauGB verwiesen. Die räumliche Abgrenzung der Vorrang- und Eignungsgebiete<br />
ist dabei identisch. Auf die Ausweisung großräumiger Eignungsgebiete, die auf der<br />
Ebene der Regionalplanung nicht vollständig konfliktfrei ermittelt sein müssen und die in ihrer Innenwirkung<br />
im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung und von Fachplanungen einer weiteren<br />
Abwägung unterliegen, wird daher verzichtet. D<strong>am</strong>it wird auch dem Umstand Rechnung getragen,<br />
dass es den Gemeinden im zeitlichen Rahmen kaum möglich sein wird, großflächige Eignungsgebiete<br />
in der kommunalen Bauleitplanung entsprechend auszuformen.<br />
beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005 3
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
1. Schritt Ausschluss von Flächen auf Grund raumordnerischer Kriterien<br />
Im ersten Bearbeitungsschritt des Plankonzeptes wurden auf Grund von Kriterien Gebiete ermittelt<br />
und festgelegt, die nicht für die Ausweisung von VRG/EG für die Nutzung von Windenergie in Betracht<br />
kommen. Dabei wird unterschieden zwischen Tabubereichen und Bereichen mit besonderem<br />
Prüfungserfordernis (Restriktionsbereiche). Zu Tabubereichen entwickeln Vorrang- und Eignungsgebiete<br />
für die Nutzung von Windenergie ein besonders hohes Konfliktpotential, so dass sie<br />
aus der Standortsuche für auszuweisende Gebiete generell ausgeschlossen wurden. In Gebieten<br />
mit besonderem Prüfungserfordernis sind teilräumig differenziert mittlere bis hohe Konfliktpotenziale<br />
vorhanden. Im Rahmen der Abwägung wurde in diesen Gebieten in einem späteren Arbeitsschritt<br />
eine Einzelfallprüfung vorgenommen. Sofern erhebliche Beeinträchtigungen für konkurrierende<br />
Belange nachweisbar bzw. anzunehmen sind, kann die Ausweisung von VRG, die eine landesplanerische<br />
Letztentscheidung darstellen, nicht mehr begründet werden.<br />
Die Notwendigkeit für diese relativ strikte Regelung ergibt sich daraus, dass wegen der hier vorgenommenen<br />
ausschließlichen Ausweisung von VRG der Nutzung der Windenergie im Konfliktfall<br />
stets ein größeres Gewicht zukommt als anderen Nutzungen und diese d<strong>am</strong>it einen absoluten<br />
Nutzungsvorrang durch eine landesplanerische Letztentscheidung zugewiesen bekommen hat<br />
(BVerwG, Urteil v. 19.7.2001 – 4 C 4/00 = NVwZ 2002, 476). Innerhalb und im Umfeld der Vorrang-<br />
und Eignungsgebiete für die Nutzung von Windenergie sind demnach alle Nutzungen ausgeschlossen,<br />
die mit der vorrangigen Nutzung Windenergie nicht vereinbar sind (<strong>§</strong> 7 <strong>Abs</strong>. 4 Nr. 1<br />
ROG). Aus diesem Grund werden mit diesem Plankonzept auch diejenigen Raumnutzungen nicht<br />
mit einem VRG/EG für die Nutzung von Windenergie überlagernd ausgewiesen, denen lediglich<br />
Grundsatzcharakter zukommt (z. B. Vorbehaltsgebiete) und eine grundsätzliche Vereinbarkeit beider<br />
Raumnutzungen nicht gegeben ist. Diese Vorgehensweise entspricht dem Gebot der planerischen<br />
Konfliktbewältigung. Demnach wird verlangt, Konflikte, soweit sie erkennbar und auf Ebene<br />
der Regionalplanung lösbar sind, nicht in nachfolgende Planungsstufen zu verlagern. Wenn dies<br />
bei anderen Raumnutzungen im Regionalplan 2002 in einigen Fällen trotzdem erfolgt ist (z. B. überlagernde<br />
Ausweisung eines VRG oberflächennahe Rohstoffe mit einem VBG für Natur und<br />
Landschaft oder eines VRG für Landwirtschaft mit einem VBG Trinkwasser) dann deshalb, weil:<br />
a) diese im Gegensatz zu WKA ortsgebunden sind, d. h. auf die geografische oder geologische<br />
Eigenart der Stelle angewiesen sind (BVerwG, Urteil v. 16.6.1994 – 4 C 20/93 = NVwZ 1995,<br />
64),<br />
b) sich daher die räumliche Abgrenzung dieser schutzbedürftigen Bereiche auch an natürlichen<br />
Gegebenheiten orientieren muss (z. B. Größe des Trinkwassereinzugsgebietes bzw. der Rohstofflagerstätte),<br />
c) die überlagernde Ausweisung bestimmte Maßgaben für die vorrangige Nutzung bewirken kann<br />
(z. B. Abbautechnologie sowie Folgenutzung beim Rohstoffabbau, Einsatz von Dünge- und<br />
Pflanzenschutzmitteln in der Landwirtschaft), was bei WKA i. d. R. nicht möglich ist oder<br />
d) die raumordnerische Ausweisung auch einer langfristigen (vorsorgenden) Sicherung der<br />
Raumnutzung dient, bevor eine fachplanerische Sicherung erfolgt (z. B. Festsetzung eines<br />
Schutzgebietes nach BNatSchG oder <strong>§</strong> 48 SächsWG) bzw. ein Genehmigungsverfahren eingeleitet<br />
wird (z. B. nach BBergG). Diese langfristig vorsorgende Sicherung ist bei der raumordnerischen<br />
Sicherung von Standorten für die Nutzung der Windenergie wegen der zügigen Inanspruchnahme<br />
nicht möglich.<br />
Weiterhin war zu beachten, dass mit diesem Verfahren keine Fortschreibung anderer sachlicher<br />
Teile des Regionalplanes 2002 erfolgt; d. h., mit dieser <strong>Teilfortschreibung</strong> bleiben alle im Regionalplan<br />
2002 und den Braunkohlenplänen enthaltenen Regelungen, außer denen des Kapitels<br />
II.4.4.7 des Regionalplanes, unverändert. Eine raumordnerische Konfliktlösung war daher nur<br />
durch eine räumliche Trennung sich widersprechender Grundsätze und Ziele möglich. Gleichzeitig<br />
wurde für einige raumordnerischen Ausweisungen eine Pufferzone festgelegt. Dabei wurde teilweise<br />
ein pauschales <strong>Abs</strong>tandsflächenkonzept angewendet. Dies begründet sich darauf, dass<br />
zwischen bestimmten schützenswerten Bereichen und Flächen, auf denen eine Mehrzahl von<br />
Windkraftanlagen errichtet werden dürfen, <strong>Abs</strong>tände einzuhalten sind. Zur Konfliktfreiheit der Ausweisungen<br />
wurden Pufferzonen auch zu Vorbehaltsgebieten oberflächennahe Rohstoffe und zu<br />
4 beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Vorbehaltsstandorten für Erholung festgesetzt, da bei Errichtung von WKA innerhalb der Pufferzone<br />
zu erwarten ist, dass das mit dem Vorbehaltsgebiet/-standort zu berücksichtigende Gewicht der<br />
zugeordneten Raumnutzung nicht mehr sach<strong>gemäß</strong> berücksichtigt werden kann. Bereits vorhandene<br />
regionalplanerische Ausweisungen würden somit selbst konterkariert. Pufferzonen wurden<br />
auch hier im Sinne einer planerischen Vorsorge z. T. pauschal festgesetzt. Dies begründet sich<br />
allein daraus, dass die Regionalplanung wegen der Vielzahl an Ausweisungen und der Größe des<br />
Planungsgebietes keine Einzelfallprüfung auf konkret einzuhaltende <strong>Abs</strong>tandswerte zu jeder räumlich<br />
festgelegten Raumnutzung durchführen kann und muss. Diese Einzelfallprüfung durch die Regionalplanung<br />
wäre auch erst dann möglich, wenn die raumordnerischen Grundsätze und Ziele<br />
durch die Fachplanung bzw. durch die Bauleitplanung umgesetzt sind oder ein Genehmigungsverfahren<br />
z. B. für den Rohstoffabbau durchgeführt wurde.<br />
Bei der Ausweisung von VRG/EG für die Nutzung von Windenergie sind demnach Überlagerungen<br />
mit anderen Raumnutzungen möglich (ja) bzw. ausgeschlossen (nein) sowie folgende Pufferzonen<br />
festgelegt:<br />
Ausweisung <strong>gemäß</strong> Regionalplan 2002<br />
VRG/EG für die<br />
Nutzung von<br />
Windenergie<br />
Pufferzone (<strong>Abs</strong>tand in m)<br />
Restriktionsbereich<br />
Tabubereich (besonderes Prüfungserfordernis)<br />
VRG/VBG für Natur und Landschaft nein Einzelfall in Abhängigkeit<br />
von<br />
Schutz- bzw. Entwicklungszielen<br />
Einzelfall<br />
VRG/VBG für oberflächennahe Rohstoffe und Braunkohle nein 200 (Hartgestein)<br />
50 (Lockergestein)<br />
Einzelfall<br />
Abbaugebiet Braunkohle nein<br />
(ja für bereits abgebauten<br />
Bereich,<br />
sofern mit Folgenutzung<br />
vereinbar)<br />
Sicherheitslinie -<br />
VRG/VBG Wald nein - -<br />
VRG Verteidigung nein - -<br />
VRG Brauchwasser nein - -<br />
VRG/VBG Trinkwasser<br />
ja<br />
- -<br />
(sofern Trinkwasserschutzzone I und II)<br />
(nein)<br />
VRG/VBG Landwirtschaft ja - -<br />
Vorrangstandort Erholung nein 500 -<br />
Vorbehaltsstandort Erholung nein 500 -<br />
VBG Erholung ja - -<br />
VBG Überschwemmungsbereich nein - -<br />
Regionaler Grünzug, Grünzäsur nein* - -<br />
landschaftsprägende Höhenrücken, Kuppen und Hanglagen nein Hangfuss Einzelfall<br />
naturnahe Flussabschnitte regional bedeuts<strong>am</strong>er Fließgewässer nein 50 Einzelfall<br />
regional bedeuts<strong>am</strong>e Vogelzugachsen und Vogelzugkorridore (Dar- nein 200 bis 10fache<br />
stellung i. V. m. Ziel II.4.2.3.3 des Regionalplanes)<br />
Anlagenhöhe<br />
regional bedeuts<strong>am</strong>e Vogelzugrastgebiete im Offenland sowie wassergebundene<br />
Rastplätze (Darstellung i. V. m. Ziel II.4.2.3.3 des<br />
Regionalplanes)<br />
nein** 200 500<br />
strukturierungsbedürftige ausgeräumte Agrarflur ja - -<br />
Umwandlung Ackerland in Grünland oder Wald ja - -<br />
regional bedeuts<strong>am</strong>es, zus<strong>am</strong>menhängendes Waldgebiet nein - -<br />
Tabelle 1: Abwägungsmatrix für raumordnerische Grundsätze und Zielinhalte<br />
Hinweise<br />
* - In der Begründung zum Ziel II.4.3.1.1 des Regionalplanes 2002 wird darauf verwiesen, dass Standorte für die Nutzung der Windenergie<br />
mit Regionalen Grünzügen mit Bedeutung für das Siedlungsklima und den Wasserschutz in der Regel vereinbar sind. Diese<br />
Regelung zielt auf eine Klarstellung zum <strong>§</strong> 35 <strong>Abs</strong>. 3 Satz 2 BauGB ab, nach dem entsprechende Vorhaben den Zielen der Raumordnung<br />
nicht widersprechen dürfen. Nach in Kraft treten dieser <strong>Teilfortschreibung</strong> gilt diese Regelung weiterhin, jedoch nur für nicht raumbedeuts<strong>am</strong>e<br />
Vorhaben. Im Rahmen des hier vorgenommenen Planungskonzeptes werden regionale Grünzüge generell von der Standortsuche<br />
ausgenommen.<br />
** - Bereits im Rahmen der Erarbeitung des Regionalplanes 2002 wurde für das im Randbereich des größten Rastplatzes für Wildgänse<br />
Ostsachsens liegende Vorrang- und Eignungsgebiet EW 22 Melaune in <strong>Abs</strong>timmung mit naturschutzfachlichen Belangen eine Ausnah-<br />
beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005 5
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
me formuliert. Die Ausweisung dieses Gebietes und die darauf hin erfolgte Errichtung von WKA ist an besondere naturschutzfachliche<br />
Nebenbestimmungen geknüpft (z. B. Versuch eines gezielten Angebotes an Ersatznahrungsflächen für Wildgänse).<br />
Schritt 2 Ausschluss von Flächen auf Grund bestehender Nutzungen und fachplanerischer<br />
Kriterien<br />
Hinzu kommen Konflikte mit weiteren Belangen, die aus fachplanerischen Gründen bzw. wegen<br />
bestehender Nutzungen bei der Ausweisung der VRG/EG für die Nutzung von Windenergie zu<br />
berücksichtigen bzw. zu beachten sind. Auch hier wurden im Sinne einer Vorsorge vor schädlichen<br />
Umweltauswirkungen z. T. pauschalisierte Pufferzonen festgelegt. Diese Pufferzonen wurden sowohl<br />
für den Ausschluss bestimmter Flächen von einer Vorrangausweisung als auch für eine eindeutige<br />
Abgrenzung der Vorrang- und Eignungsgebiete festgelegt. Mit der Ausweisung als Vorrang-<br />
und Eignungsgebiet für die Nutzung von Windenergie wird keine Aussage über den konkreten<br />
Standort oder Typ einer zulässigen WKA innerhalb dieses Gebietes getroffen. Die Ausweisung<br />
der Vorrang- und Eignungsgebiete soll daher die Errichtung raumbedeuts<strong>am</strong>er WKA gewährleisten,<br />
begründet jedoch nicht die Zulässigkeit der größtmöglichen WKA an jedem beliebigen Standort<br />
innerhalb des Gebietes (vgl. dazu auch Bielenberg/Runkel/Spannowski: Raumordnungs- und<br />
Landesplanungsrecht des Bundes und der Länder. Band 2 Kommentar. K <strong>§</strong> 4 Randnummer 340).<br />
Da beispielsweise einzelfallbezogene Belange der Agrarstruktur oder der Einfluss auf Sendeanlagen<br />
im Regionalplan nur schwierig abgeprüft werden können, müssen diese Belange im Rahmen<br />
der nachfolgenden Planungsebenen bzw. Genehmigungsverfahren für konkrete WKA-Standorte in<br />
den ausgewiesenen Gebieten betrachtet werden. Die im folgenden beschriebenen <strong>Abs</strong>tandswerte<br />
gelten dabei ausschließlich für die Auswahl und Abgrenzung der ausgewiesenen Gebiete. Im<br />
Rahmen konkreter Planungen können die realen <strong>Abs</strong>tände zu Infrastruktureinrichtungen (<strong>Abs</strong>chnitt<br />
2.4) auf Grund der jeweiligen Typen der WKA von den hier angewandten abweichen. So kann sich<br />
der <strong>Abs</strong>tand einer WKA mit einer Ges<strong>am</strong>thöhe von 140 m zur Autobahn auf Grund der fachplanerischen<br />
Regelung (1,5fache Höhe als Mindestabstand) auf 210 m erhöhen. Diesen Regelungen<br />
wird hier nicht vorgegriffen.<br />
2.1 Konflikte mit bestehenden Siedlungen und geplanten Siedlungsentwicklungen<br />
� bestehende und geplante Wohn- und Mischbauflächen, Kurgebiete sowie Freizeit- und Erholungseinrichtungen mit<br />
Schutzanspruch in einem Mindestabstand von 500 m (Tabubereich), besonderes Prüfungserfordernis bis 1200 m,<br />
Wohngebäude im Außenbereich in einem Mindestabstand von 350 m (Tabubereich)<br />
In Sachsen gibt es derzeit keine verbindliche Vorschrift zu Mindestabständen. Für diese <strong>Teilfortschreibung</strong> wurden daher die vom<br />
SMUL empfohlenen „Orientierungswerte für Mindestabstände der Windnutzungsgebiete zu den Baugebieten unter Einhaltung der<br />
immissionsschutzrechtlichen Anforderungen an die Geräusch- und Schatteneinwirkungen im Rahmen der Regionalpläne und der<br />
Flächennutzungspläne“ (Schreiben des SMUL an das SMI vom 20.07.2001, Az.: 52-8826.00) für die Bewertung herangezogen.<br />
Zur Sicherstellung, dass durch die in den ausgewiesenen Gebieten zulässigen raumbedeuts<strong>am</strong>en WKA keine schädlichen Umwelteinwirkungen<br />
im Sinne des Immissionsschutzes hervorgerufen werden, wurde ein pauschaler Mindestabstand (Tabubereich)<br />
von 500 m zwischen Vorrang- und Eignungsgebieten für die Nutzung von Windenergie und schützenswerter Bebauung innerhalb<br />
des Ortszus<strong>am</strong>menhanges festgelegt. Je nach Schutzwürdigkeit der Baugebiete und der Anzahl der in den Vorrang- und Eignungsgebieten<br />
möglichen WKA kann sich dieser Mindestabstand in Bezug auf die Geräuschimmissionen im Einzelfall bis auf<br />
1200 m erhöhen. Diesem Sachverhalt wurde d<strong>am</strong>it Rechnung getragen, dass für die auszuweisenden Vorrang- und Eignungsgebiete<br />
eine Einzelfallprüfung anhand der Orientierungswerte des SMUL und der bauordnungsrechtlichen Einstufung der Baugebiete<br />
erfolgt ist und der <strong>Abs</strong>tand zur Bebauung gegebenenfalls vergrößert wurde. In Bezug auf die Erheblichkeit von optischen Immissionen<br />
(Licht-/Schatteneinwirkung) ist diese Einzelfallprüfung auf der Ebene der Regionalplanung nicht möglich. Die Empfehlungen<br />
des SMUL enthalten außer dem Mindestabstand von 500 m keine weitergehenden anwendbaren Aussagen. Grundsätzlich<br />
ist davon auszugehen, dass in westlicher oder östlicher Richtung zu einer WKA große Schattenreichweiten möglich sind. Ob sich<br />
diese jedoch erheblich auf eine Bebauung auswirken, richtet sich neben der Entfernung und der Höhe der WKA auch nach den<br />
topografischen Verhältnissen (z. B. abschattende Wirkung des Waldes, Relief). Unter Berücksichtigung der Orientierungswerte<br />
des SMUL kann davon ausgegangen werden, dass aus den o. g. Aspekten in den Vorrang- und Eignungsgebieten die Errichtung<br />
raumbedeuts<strong>am</strong>er WKA möglich ist, es kann jedoch nicht garantiert werden, dass an jedem Standort innerhalb des Gebietes auch<br />
die größtmögliche WKA errichtet werden kann. Diese Zulässigkeit und ggf. notwendige Maßnahmen (z. B. <strong>Abs</strong>chaltmaßnahmen)<br />
sind in den nachfolgenden Genehmigungsverfahren zu klären. Regionalplanerisch relevant ist auch die Sicherung möglicher Siedlungserweiterungen.<br />
Die Gemeinden sollen nicht durch ausgewiesene VRG/EG für die Nutzung von Windenergie in ihren notwendigen<br />
Entwicklungen behindert werden. Entwürfe von Bauleitplanungen sowie von den Kommunen vorgetragene potenzielle<br />
Siedlungserweiterungen für einen zukünftigen Bedarf wurden daher einzelfallbezogen berücksichtigt. Im Rahmen der in einem<br />
späteren Arbeitsschritt erfolgten Detailprüfung wurden auch die außerhalb des Bebauungszus<strong>am</strong>menhanges liegenden schutzwürdigen<br />
Bebauungen (z. B. Wohngrundstücke und Kleingartenanlagen) berücksichtigt. Auch hier wurde zur Vermeidung eines<br />
unzumutbaren Schattenwurfes grundsätzlich ein <strong>Abs</strong>tand von 500 m angewendet, der im Einzelfall auf Grund der topografischen<br />
Verhältnisse und der Himmelsrichtung auf minimal 350 m verkleinert wurde.<br />
Unberührt von dem pauschalen <strong>Abs</strong>tandsflächenkonzept für die Ausweisung der VRG/EG verbleibt die immissionsschutzrechtliche<br />
Einzelfallprüfung für beantragte WKA innerhalb der hier ausgewiesenen Gebiete in Bezug auf Schallimmissionen und Schattenwurf.<br />
Dies ist auch d<strong>am</strong>it zu begründen, dass sich die regionalplanerische Ausweisung nicht speziell auf das zur Genehmigung<br />
6 beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
anstehende Vorhaben und dessen konkrete Standorte beziehen muss, es reicht aus, wenn das Vorhaben dem Typus nach erfasst<br />
und ihm einen Standortbereich zugewiesen wird (Bielenberg/Runkel/Spannowski: Kommentar ROG Bund K <strong>§</strong> 4 Randnummer<br />
340).<br />
2.2 Konflikte mit Naturschutz und Landschaftspflege<br />
Für die Zulässigkeit von WKA in Schutzgebieten nach <strong>§</strong><strong>§</strong> 16 bis 22 SächsNatSchG sind der jeweilige Schutzzweck und die festgesetzten<br />
Verbote und Erlaubnisvorbehalte der jeweiligen Schutzgebietsverordnung oder der <strong>Satzung</strong> nach <strong>§</strong> 22 SächsNatSchG primäre<br />
Beurteilungsgrundlage. Von der Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebieten für die Nutzung von Windenergie wurden auch Landschaftsschutzgebiete<br />
(LSG) ausgenommen. Gemäß <strong>§</strong> 19 <strong>Abs</strong>. 1 SächsNatSchG werden in LSG zum Schutz von Natur und Landschaft<br />
mehrere Zielrichtungen verfolgt, die alle grundsätzlich nicht mit der Ausweisung eines VRG/EG für die Nutzung von Windenergie vereinbar<br />
sind. Mit der Ausweisung von VRG für die Nutzung von Windenergie würde eine landesplanerische Letztentscheidung zugunsten<br />
der Windenergie erfolgen, die i. d. R. dem jeweiligen besonderen Schutzzweck zuwiderläuft bzw. den Charakter der geschützten Gebiete<br />
verändert.<br />
Die auf Grund der jeweiligen EU-Richtlinien durch den Freistaat Sachsen gemeldeten Gebiete besitzen auch eine funktionale Außenwirkung,<br />
d. h. erhebliche Beeinträchtigungen für die gebietsspezifischen Erhaltungsziele, die sich durch Vorhaben auch außerhalb der<br />
Grenzen der Gebiete ergeben, sind zu vermeiden. Die für die Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien in der Vorschlagliste von<br />
Bird-Life-International und dem NABU enthaltenen IBA-Gebiete (bedeutende Vogelschutzgebiete) gelten <strong>gemäß</strong> der ständigen Rechtssprechung<br />
des Bundesverwaltungsgerichtes und des Europäischen Gerichtshofes als „faktische“ Vogelschutzgebiete und wurden daher<br />
bei der Abwägung berücksichtigt (Veröffentlichung in: Ber. Vogelschutz 38 (2002)).<br />
Vorrang- und Eignungsgebiete für die Nutzung von Windenergie wurden nicht ausgewiesen in:<br />
� bekanntgemachten Vogelschutzgebieten <strong>gemäß</strong> EWG-Vogelschutzrichtlinie 79/409/EWG einschließlich eines einzelfallbezogen<br />
ermittelten Pufferbereiches (Bekanntmachung der Europäischen Vogelschutzgebiete <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 10 <strong>Abs</strong>. 6<br />
BNatSchG vom 2. Mai 2003 im Bundesanzeiger vom 11.06.2003)<br />
� gemeldeten Gebieten <strong>gemäß</strong> EWG Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie 92/43/EWG einschließlich eines einzelfallbezogen<br />
ermittelten Pufferbereiches<br />
� Naturschutzgebieten (festgesetzt bzw. einstweilig gesichert), Biosphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft<br />
(Zonen 1 und 2) einschließlich eines einzelfallbezogen ermittelten Pufferbereiches)<br />
� Landschaftsschutzgebieten<br />
� Naturdenkmalen, geschützten Landschaftsbestandteilen und besonders geschützten Biotopen nach <strong>§</strong> 26 Sächs-<br />
NatSchG<br />
� Nist-, Brut-, Wohn- oder Zufluchtsstätten sowie Nahrungs- und Rastplätzen wildlebender Tiere der besonders geschützten<br />
und bestimmten anderen Arten und ihrer im Einzelfall ermittelten Umgebung (vgl. Tabelle 2).<br />
Art<br />
Diese Regelung ergibt sich aus <strong>§</strong> 42 <strong>Abs</strong>. 1 Nr. 3 BNatSchG bzw. <strong>§</strong> 25 SächsNatSchG. In diese Konfliktregelung integriert wurden<br />
die vom StUFA Bautzen zur Verfügung gestellten fachlichen Aussagen zu „<strong>Abs</strong>tänden von Windenergieanlagen zu geschützten Artenvorkommen<br />
(Pufferzonen)“ – Stand März 2003. Prüfungsgrundlage bildeten die Daten des StUFA Bautzen (Kenntnisstand:<br />
2003/2004) Die Pufferzonen der Tab. 2 gelten nicht als Tabubereich, sondern sind so zu interpretieren, dass in dem angegebenen<br />
Radius (entspricht i. d. R. dem Aktionsradius der Art) um den jeweiligen Lebensraum (Brutplatz bzw. Wochenstube) ein besonderes<br />
Prüfungserfordernis bei der Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebieten besteht. Diese Prüfung erfolgte im Rahmen des nachfolgenden<br />
Bearbeitungsschrittes (Detailprüfung innerhalb der planerischen Auswahl) in fachlicher <strong>Abs</strong>timmung mit dem StUFA<br />
Bautzen. Sofern sich innerhalb der Pufferzone bevorzugt in Anspruch genommene Gebiete befinden, die erheblich beeinträchtigt<br />
werden können, erfolgte keine Ausweisung als VRG/EG für die Nutzung von Windenergie. Dabei wurden die natürlichen Zug- und<br />
Wanderwege ebenfalls berücksichtigt (vgl. <strong>§</strong> 1 Nr. 2 SächsNatSchG).<br />
<strong>Abs</strong>tand (bzw. Puffer)<br />
zwischen Lebensraum<br />
und WEA (Prüfradius)<br />
Rote Liste<br />
Sachsen<br />
(1999)<br />
Rote Liste<br />
Deutschland<br />
(1998, 2002)<br />
Vogel-<br />
Schutz-RL<br />
Anh.1<br />
FFH-RL<br />
BNatSchG<br />
Birkhuhn 3000 m 1 1 x b<br />
Baumfalke 3000 m 2 3 bs<br />
Fischadler 3000 m R 3 x bs<br />
Kranich 3000 m 2 - x bs<br />
Rohrdommel 3000 m 1 1 x bs<br />
Rohrweihe, (Korn- u. Wiesenweihe) 2000 m -(1,1) -(1,2) x bs (bs, bs)<br />
Rotmilan 2000 m - (V) x bs<br />
Seeadler 3000 m 2 3 x bs<br />
Singschwan 3000 m R R x bs<br />
Schwarzstorch 3000 m 2 3 x bs<br />
Schwarzmilan 2000 m - - x bs<br />
Steinkauz 3000 m 1 2 bs<br />
Uhu 3000 m 2 3 x bs<br />
Wanderfalke 3000 m 1 3 x bs<br />
Weißstorch 3000 m 3 3 x bs<br />
Wespenbussard 2000 m 3 - x bs<br />
Wiedehopf 2000 m 1 1 - bs<br />
Zwergdommel 3000 m 1 1 x bs<br />
beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005 7
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Brachpieper 2000 m 2 2 x bs<br />
Heidelerche 1000 m 2 3 x bs<br />
Neuntöter 1000 m - - x b<br />
Ortolan 1000 m 2 2 x bs<br />
Raubwürger 2000 m 2 1 bs<br />
Sperbergrasmücke 1000 m 3 - x bs<br />
Wachtelkönig 3000 m 1 2 x bs<br />
Ziegenmelker 2000 m 1 2 x bs<br />
Kolonien von: Möwen, Graureiher,<br />
Flußseeschwalbe, Saatkrähe, Dohle<br />
Nahrungs- und Rastflächen sowie<br />
Schlafplätze von: Kranichen, Gänsen,<br />
Limikolen u.ä.<br />
Fledermäuse:<br />
Wochenstube Mausohr ab 300 Alttiere<br />
Wochenstube Mausohr ab 50 Alttiere<br />
Wochenstube Mausohr < 50 Alttiere<br />
2000 m zu kleinen Kolonien<br />
3000 m zu großen Kolonien<br />
(Großmöwen, Flussseeschwalbe,<br />
Dohle ab 20<br />
Vögel, Graureiher, Saatkrähe<br />
ab 50 Vögel)<br />
2000 m (sofern nicht bereits<br />
in Flächenabgrenzung<br />
berücksichtigt)<br />
6000 m<br />
3000 m<br />
2000 m<br />
Wochenstube Kleine Hufeisennase 2000 m<br />
Wochenstuben aller weiteren Fledermausarten<br />
Fledermausnahrungsgebiete und -<br />
zugkorridore<br />
Regional und landesweit bedeuts<strong>am</strong>e<br />
Fledermauswinter- sowie Fledermausschwärmquartiere<br />
1000 m<br />
Abgrenzung bereits inkl.<br />
Puffer<br />
1000 m<br />
- ,2, R -, R, (II)<br />
2 3<br />
1 1<br />
-, R, 3, 2, 1<br />
-, 3, 2, 1, (G,<br />
D, V)<br />
Tabelle 2: <strong>Abs</strong>tände von Windenergieanlagen zu geschützten Artenvorkommen (Pufferzonen)<br />
Quelle: StUFA Bautzen, Stand 03/2003<br />
Rote Liste Sachsen (1999)<br />
V – Arten der Vorwarnliste<br />
0 – ausgestorben oder verschollen<br />
1 – vom aussterben bedroht<br />
2 – stark gefährdet<br />
3 – gefährdet<br />
R – extrem selten<br />
Rote Liste Deutschland (1998, 2002)<br />
0 – ausgestorben oder verschollen<br />
1 – vom aussterben bedroht<br />
2 – stark gefährdet<br />
3 – gefährdet<br />
G – Gefährdung anzunehmen<br />
D – Datenlage mangelhaft<br />
R – extrem selten<br />
V – zurückgehend, Art der Vorwarnliste<br />
FFH Anhang 2<br />
u. 4<br />
FFH Anhang 2<br />
u. 4<br />
FFH Anhang 2<br />
bzw.4,<br />
- “ - - “ - - “ - - “ -<br />
- “ - - “ - - “ - - “ -<br />
Vogelschutzrichtlinie Anhang 1<br />
x – in Anhang 1 enthalten<br />
BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz:<br />
b – besonders geschützt<br />
s – streng geschützt<br />
Im Windpark Puschwitz / Bóšicy ist eine erhebliche Gefährdung mehrerer Fledermausarten festgestellt worden (mehr als<br />
30 Totfunde in einem Untersuchungszeitraum von ca. 3 Wochen im September 2002). Diese Tatsache rechtfertigt neben<br />
der Streichung des Vorranggebietes Puschwitz / Bóšicy auch eine stärkere Berücksichtigung des Schutzes dieser sowohl<br />
nach europäischem als auch nach bundesdeutschem Recht geschützten Tierarten. Die 2002 im Auftrag des StUFA<br />
Bautzen begonnenen Untersuchungen wurden 2003 fortgesetzt und auf ein größeres Gebiet ausgedehnt. Dabei wurden<br />
die Untersuchungsergebnisse aus 2002 bekräftigt. Die mittlerweile vorliegenden Daten, insbesondere zu Nahrungsgebieten<br />
und Zugkorridoren der Fledermäuse zeigen, dass für ein größeres Gebiet der Planungsregion aus Gründen des<br />
Fledermausschutzes auf die Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebieten verzichtet werden muss (vgl. dazu:<br />
TRAPP u. a.: Fledermausverluste in einem Windpark der Oberlausitz. In: Naturschutzarbeit Sachsen 2002, S. 53ff,<br />
BACH, L.: Flerdermäuse und Windenergienutzung – reale Probleme oder Einbildung. In: Vogelkundliche Berichte Niedersachsen,<br />
2001, S. 119ff). Für die derzeit bekannten bedeuts<strong>am</strong>en Fledermauszugkorridore, die aus Richtung des<br />
Heide- und Teichgebietes nach Süden und Südwesten in Richtung des Oberlausitzer Berglandes und der Sächsischen<br />
Schweiz sowie aus dem Raum Löbau (Bischdorf, Rotstein) über den Raum Herrnhut in das Gebiet um Zittau (Hainewalde)<br />
verlaufen, k<strong>am</strong> es darauf an, ausreichend große windparkfreie Zonen zu sichern und auf eine Ausweisung vor allem<br />
quer zur Zugrichtung zu verzichten. Mehrere Todfunde verschiedener Flerdermausarten, die auf eine erhebliche Beeinträchtigung<br />
schließen lassen, wurden auch in den landschaftlich strukturreicheren Teilen des Gebietes EW 16 Charlottenhof<br />
verzeichnet. Die massierte Aufstellung großer Windparks ohne ausreichende <strong>Abs</strong>tände untereinander kann nach<br />
gegenwärtigen Erkenntnissen zu weiteren erheblichen Beeinträchtigungen vor allem in den Zugkorridoren führen. Die<br />
ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebiete für die Nutzung von Windenergie wurden daher mit dem StUFA Bautzen<br />
abgestimmt. Daraus resultiert auch die Streichung des Vorranggebietes bei Pohla sowie die Reduzierung des EW 16<br />
Charlottenhof auf Grund der nachgewiesenen Lage in einem Zugkorridor. <strong>Abs</strong>chließende Aussagen sind gegenwärtig<br />
noch nicht möglich. Die Untersuchungen sollen in den kommenden Jahren fortgesetzt werden.<br />
2.3 Konflikte mit Rohstoffabbau<br />
Im Regionalplan sind nicht alle im Abbau befindlichen Rohstoffgewinnungsstätten als VRG bzw. VBG für oberflächennahe Rohstoffe<br />
ausgewiesen. Da sich aus einem Rohstoffabbau auch für diese Flächen Restriktionen für andere Raumnutzungen ergeben, ist dieser<br />
8 beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005<br />
bs<br />
bs<br />
bs
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Belang hier entsprechend einzubeziehen. Der größere Mindestabstand für Hartsteinbrüche ist durch den vorsorglich einzuhaltenden<br />
Sicherheitsabstand auf Grund von Sprengarbeiten begründet. Es gelten die zugelassenen Betriebsplangrenzen.<br />
� Lockergesteinstagebaue in einem Mindestabstand von 50 m (Tabubereich)<br />
� Hartsteinbrüche in einem Mindestabstand von 200 m (Tabubereich)<br />
2.4 Konflikte mit Infrastruktureinrichtungen<br />
� Flugplätze einschließlich deren Bauschutzbereiche nach <strong>§</strong> 12 LuftVG und Schutzbereiche von Flugsicherungsanlagen<br />
(<strong>§</strong> 18 a LuftVG) bzw. Platzrunden für Sonderlandeplätze (besonderes Prüfungserfordernis)<br />
I. d. R. widerspricht die Ausweisung eines VRG als landesplanerische Letztentscheidung innerhalb eines Bauschutzbereiches<br />
bzw. im Einflussbereich von Flugsicherungsanlagen den fachplanerischen Festsetzungen. Ausnahmen ergeben sich, sofern die<br />
durch die WKA erreichbaren Höhen nicht die für den jeweils konkreten Standort festgelegten Bauhöhen überschreiten.<br />
In der Planungsregion befinden sich z. Zt. sieben Flugplätze, welche durch Luftfahrtzeuge regelmäßig genutzt werden (Verkehrslandeplatz<br />
Bautzen, Verkehrslandeplatz Rothenburg, Verkehrslandeplatz K<strong>am</strong>enz, Verkehrslandeplatz Görlitz, Verkehrslandeplatz<br />
Nardt, Sonderlandeplatz Klix, Sonderlandeplatz Brauna). Weiterhin reichen die Bauschutzbereiche des Flughafens Dresden<br />
und des Flugplatzes Welzow (Land Brandenburg) in die Planungsregion hinein. Gemäß dem Grundsatz III.6.4.5 des Regionalplanes<br />
sollen bei Kottmarsdorf (Landkreis Löbau-Zittau) die räumlichen Voraussetzungen für die Anlage eines Sonderlandeplatzes<br />
geschaffen werden. Auch wenn derzeit keine konkreten Planungen bekannt sind, ist der Bereich im Sinne der planerischen Vorsorge<br />
freizuhalten. Die beiden Hubschraubersonderlandeplätze auf dem Klinikum Hoyerswerda und dem Kreiskrankenhaus Bautzen<br />
(luftverkehrsrechtliche Verfahren abgeschlossen) bedingen ebenfalls freizuhaltende Korridore. Die konkrete Prüfung dieses<br />
Belanges erfolgte im dritten Bearbeitungsschritt.<br />
Hinweis: Gemäß <strong>§</strong> 14 LuftVG v. 25.08.1998 sind alle Planungen für Bauwerke und Anlagen über 30 m Ges<strong>am</strong>thöhe (bei WKA<br />
Nabenhöhe + Rotorradius) zur Prüfung der luftrechtlichen Zulässigkeit der zivilen und der militärischen Luftfahrtbehörde<br />
vorzulegen.<br />
� elektrische Anlagen – Freileitungen/Schaltanlagen in einem <strong>Abs</strong>tand von 100 m (Tabubereich)<br />
Gemäß der Empfehlung der Vereinigung Deutscher Elektrizitätswerke – VDEW – e. V. vom Januar 1999 wird zwischen der WKA<br />
und elektrischen Anlagen ein Mindestabstand empfohlen, der bei Freileitungen bis 30 kV sowie Freileitungen über 30 kV mit<br />
Schwingungsschutzmaßnahmen dem einfachen Rotordurchmesser und bei Freileitungen über 30 kV ohne Schwingungsschutzmaßnahmen<br />
sowie bei Freiluftschaltanlagen dem dreifachen Rotordurchmesser entspricht. Maßgeblich ist der <strong>Abs</strong>tand zwischen<br />
der Rotorblattspitze und dem äußersten ruhenden Leiterseil einer Freileitung. Als Tabubereich wurden für die Abgrenzung von<br />
Vorrang- und Eignungsgebieten für die Nutzung von Windenergie und für den Ausschluss bestimmter Flächen unter Berücksichtigung<br />
des gegenwärtigen Standes der Technik pauschal 100 m festgelegt. D<strong>am</strong>it wird dem Umstand Rechnung getragen, dass für<br />
WKA-Betreiber theoretisch und in <strong>Abs</strong>timmung mit dem Netzbetreiber die Möglichkeit besteht, Schwingungsschutzmaßnahmen<br />
an Hochspannungsleitungen durchführen zu lassen (wobei dies natürlich auf Kosten dieser Betreiber erfolgen muss) und somit<br />
den Mindestabstand vom dreifachen auf den einfachen Rotordurchmesser zu reduzieren. Die Ausweisung der VRG/EG greift diesen<br />
<strong>Abs</strong>timmungen jedoch nicht vor.<br />
� bestehende und geplante Straßen sowie raumordnerisch gesicherte Trassen in einem Mindestabstand von 100 m<br />
zu Bundesautobahnen (Tabubereich), bis zu 300 m zu Streckenabschnitten, die eine besondere Aufmerks<strong>am</strong>keit<br />
erfordern (z. B. Autobahnkreuze, -dreiecke und -anschlussstellen) (besonderes Prüfungserfordernis), von 40 m zu<br />
Bundes-, Staats- und Kreisstraßen (Tabubereich)<br />
Der Tabubereich für Autobahnen und Bundesstraßen ergibt sich aus <strong>§</strong> 9 <strong>Abs</strong>. 1 FStrG (Verbot) sowie <strong>§</strong> 9 <strong>Abs</strong>. 2 i. V. m. <strong>§</strong> 9 <strong>Abs</strong>.<br />
3 FStrG (Versagen der Zustimmung). Ein besonderes Prüfungserfordernis ergibt sich aus <strong>§</strong> 19 <strong>Abs</strong>. 2 SächsBO im Einzelfall<br />
durch die Stellungnahmen der Straßenbaubehörden zu den ausgewiesenen VRG/EG. Es wird auf die <strong>Abs</strong>tandsregelungen für<br />
WKA an Bundesautobahnen und deren Anlagen im Freistaat Sachsen des Autobahn<strong>am</strong>tes Sachsen verwiesen, die hier berücksichtigt<br />
wurden. Demnach beträgt der Mindestabstand 100 m, jedoch mindestens der 1,5 fache Wert der Ges<strong>am</strong>thöhe der WKA.<br />
Der Tabubereich für Staats- und Kreisstraßen ergibt sich aus <strong>§</strong> <strong>24</strong> <strong>Abs</strong>. 1 SächsStrG (Verbot) und <strong>§</strong> <strong>24</strong> <strong>Abs</strong>. 2 i. V. m. <strong>Abs</strong>. 3<br />
SächsStrG (Versagen der Zustimmung).<br />
Die <strong>Abs</strong>tandsflächenregelungen zu öffentlichen Verkehrsflächen nach <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 2 und <strong>§</strong> 7 (<strong>Abs</strong>tandsflächenübernahme) SächsBO<br />
bleiben unberührt. Die hier vorgenommenen <strong>Abs</strong>tandsregelungen dienen nur der Abgrenzung der VRG/EG für die Nutzung von<br />
Windenergie.<br />
� bestehende und geplante Bahnanlagen in einem Mindestabstand zwischen 100 und 250 m (Tabubereich)<br />
Aus Gründen der Betriebssicherheit dürfen bauliche Anlagen <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 3 des Landeseisenbahngesetzes bei gerader Streckenführung<br />
in einer Entfernung bis zu 50 m, bei gekrümmter Streckenführung in einer Entfernung bis zu 250 m von der Mitte des<br />
nächstgelegenen Gleises nicht errichtet werden. Relevant ist der <strong>Abs</strong>tand vom äußersten Rand der Rotorblätter. Für elektrifizierte<br />
Bahnstrecken ist der o. g. <strong>Abs</strong>tand zu elektrischen Freileitungen relevant. Da die Deutsche Bahn AG <strong>gemäß</strong> ihrer Stellungnahme<br />
keiner Übertragung von <strong>Abs</strong>tandsflächen nach <strong>§</strong> 6 und 7 SächsBO zustimmt, wurden VRG/EG in keinem Fall näher als 100 m zu<br />
Eisenbahnflächen ausgewiesen.<br />
� Richtfunkstrecken, (Rundfunk)sendeanlagen, Gasleitungen<br />
Für Rundfunksendeanlagen ist entsprechend der Auskunft des zuständigen TÖB (T-System International Broadcast GmbH) eine<br />
Prüfung erst nach Angabe der konkreten Standorte für einzelne WKA möglich. Bei Markersdorf betreibt die Regulierungsbehörde<br />
beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005 9
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
für Telekommunikation und Post einen Messstandort. Dieser sollte <strong>gemäß</strong> der Stellungnahme in einem Radius von 2 km, besser<br />
jedoch 5 km freigehalten werden. Mit der vorgesehenen Änderung des BauGB soll die Störung der Funktionsfähigkeit von Funkstellen<br />
und Radaranlagen explizit als öffentlicher Belang aufgenommen werden, der der Errichtung von WKA entgegenstehen<br />
kann. Dies wird hier berücksichtigt.<br />
Die weiteren möglichen Konflikte wurden bei der Ausweisung der VRG/EG nur grob betrachtet, da sie bei der konkreten Standortwahl<br />
für einzelne WKA in späteren Planungsebenen berücksichtigt werden können. Dies ist dadurch zu rechtfertigen, dass der<br />
zwischen den WKA betriebstechnisch und aus Standsicherheitsgründen einzuhaltende <strong>Abs</strong>tand i. d. R. bereits größer ist als der<br />
für den Richtfunk bzw. für die Gasleitung freizuhaltende Sektor. Sofern der Regionalplanung der Verlauf von Richtfunkstrecken<br />
bzw. der Gasleitungen innerhalb der VRG/EG bekannt ist, wird auf den Sachverhalt entsprechend verwiesen (siehe Tabelle 3).<br />
2.5 Konflikte mit (Grund-) Wasserschutz<br />
� Trinkwasserschutzzonen 1 und 2 (Tabubereich)<br />
Gemäß <strong>§</strong> 2 <strong>Abs</strong>. 2 Nr. 8 ROG sind Grundwasservorkommen zu schützen. In der Regel stellen VRG/EG für die Nutzung von<br />
Windenergie innerhalb der Trinkwasserschutzzonen 1 und 2 von Trinkwasserschutzgebieten mit Rechtskraft bzw. fachtechnischer<br />
Abgrenzung eine Gefährdung für das zu gewinnende Trinkwasservorkommen dar. Für die Schutzzone 3 erfolgte eine Einzelfallprüfung<br />
im Rahmen der bestehenden Verbote.<br />
� Fließgewässer 1. und 2. Ordnung einschließlich ihrer Gewässerrandstreifen <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 50 SächsWG und/oder ihrer<br />
natürlichen Auenbereiche bzw. Stillgewässer > 0,5 ha einschließlich ihrer Uferbereiche (Tabubereich)<br />
Gewässer stellen neben ihrer wasserwirtschaftlichen Bedeutung wesentliche Elemente des Biotopverbundes dar. Aus Gründen<br />
des Arten- und Biotopschutzes werden die Gewässer und ihre unmittelbar angrenzenden Bereiche von der Standortsuche ausgenommen.<br />
� Überschwemmungsgebiete (Tabubereich)<br />
Die Regelung erfolgt auf Grund der mit dem Gesetz zur Erleichterung des Wiederaufbaus und zur Verbesserung des Hochwasserschutzes<br />
vom 14.11.2002 erfolgten Änderung des <strong>§</strong> 100 <strong>Abs</strong>. 3 SächsWG, nachdem bis zur Festsetzung nach <strong>§</strong> 100 <strong>Abs</strong>. 1<br />
SächsWG, längstens bis zum 31. Dezember 2012 auch die Gebiete als Überschwemmungsgebiete gelten, die bis zu einem<br />
Hochwasserereignis, mit dem statistisch einmal in hundert Jahren zu rechnen ist, überschwemmt werden, soweit diese Gebiete in<br />
Arbeitskarten der zuständigen Wasserbehörden, der Staatlichen Umweltfachämter oder des Landes<strong>am</strong>tes für Umwelt und Geologie<br />
dargestellt sind.<br />
2.6 Konflikte mit Wäldern (Tabubereich)<br />
Für eine Einstufung als Wald gilt ausschließlich <strong>§</strong> 2 SächsWaldG. Datengrundlage bildeten die Waldfunktionenkarten des Freistaates<br />
Sachsen 1 : 25 000 (Herausgeber: Sächsische Landesanstalt für Forsten, Bearbeitungsstand 1994-96) sowie die im Rahmen der Erarbeitung<br />
der <strong>Teilfortschreibung</strong> bekanntgewordenen, nach Erstellung der Waldfunktionenkarten erfolgten (Erst)aufforstungen. Grundsätzlich<br />
sind Waldflächen auf Grund ihrer Oberflächenrauhigkeit weitaus weniger für die Nutzung von Windenergie geeignet als waldfreie<br />
Flächen. Aus den Grundsätzen der Raumordnung des ROG (<strong>§</strong> 2 <strong>Abs</strong>. 2 Nr. 8) ergibt sich für Waldflächen, dass Eingriffe auf das Notwendige<br />
zu beschränken und darauf zu prüfen sind, ob sie in dieser Weise notwendig sind oder ob es auch andere Möglichkeiten gibt,<br />
die Natur und Landschaft besser gerecht werden (Cholewa/Dyong/von der Heide/Arenz: Kommentar ROG <strong>§</strong> 2 Nr. 8 Randnummer 39, 5.<br />
Lfg. der 4. Aufl. vom Januar 2001). Die Ausweisung von VRG/EG für die Nutzung von Windenergie ist stets flächenhaft. Mit der flächenhaften<br />
Überlagerung bestehender Waldflächen mit einem VRG/EG für die Nutzung von Windenergie würde eine raumordnerische<br />
Letztentscheidung zugunsten der Windenergie getroffen. Dies wirft einen grundsätzlichen Konflikt mit dem Gebot der Walderhaltung<br />
und Waldmehrung auf. Eine Konfliktlösung ist nur dadurch möglich, dass innerhalb von Waldflächen keine VRG/EG für die Nutzung von<br />
Windenergie ausgewiesen werden. Dabei wird auch dem Umstand Rechnung getragen, dass in der Planungsregion außerhalb des<br />
Waldes genügend Flächen ausgewiesen werden können, um das sächsische Klimaschutzziel zu erreichen. Weiterhin werden die besonderen<br />
Waldfunktionen, insbesondere die Lebensraum- und Erholungsfunktion berücksichtigt. Wald stellt die naturnächste Nutzungsform<br />
einer Landschaft dar. Mit der Ausweisung eines VRG/EG für die Nutzung von Windenergie würde dies aufgegeben werden. Ausnahmen<br />
bilden lediglich zus<strong>am</strong>menhängende Freiflächen innerhalb des Waldes, die eine Flächengröße von 10 ha erreichen (siehe<br />
auch Mindestgröße der auszuweisenden VRG/EG, <strong>Abs</strong>chnitt 3 der Begründung).<br />
2.7 Konflikte mit dem Denkmalschutz und dem Schutz der Kulturlandschaft<br />
Eine detaillierte Abwägung zu diesen Belangen fand im Rahmen der Vorhabenskonzentrierung und planerischen Auswahl der auszuweisenden<br />
Gebiete statt. Gemäß <strong>§</strong> 2 <strong>Abs</strong>. 2 Grundsatz Nr. 13 Satz 2 ROG sind die gewachsenen Kulturlandschaften in ihren prägenden<br />
Merkmalen sowie mit ihren Kultur- und Naturdenkmälern zu erhalten. Windkraftanlagen sind auf Grund ihrer Höhe geeignet, in die<br />
wesensbestimmende Struktur von Kulturlandschaften einzugreifen. Dies verlangt von der Regionalplanung, Standorte (Vorrang- und<br />
Eignungsgebiete) so auszuwählen, das dieser Eingriff minimiert wird. Der allgemeine Aspekt des Kulturlandschaftsschutzes sowie die<br />
standortkonkret zu prüfenden Belange waren:<br />
� Kulturdenkmäler und deren Umgebungsschutz (besonders Prüfungserfordernis)<br />
Aufgabe der räumlichen Planung ist neben dem Erhalt dieser Kulturdenkmäler der Umgebungsschutz, der sicherstellt, dass die<br />
Kulturdenkmäler in ihrer ursprünglichen Umgebung wirken können und nicht Belastungen aus der Umgebung ausgesetzt sind.<br />
Dieser Umgebungsschutz ist in Bezug auf WKA insbesondere bei den landschaftsbildprägenden Kirchen, Schlössern, Burgen,<br />
Herrenhäusern und Parkanlagen sowie den zu schützenden Ges<strong>am</strong>tensembles (Ortsbilder und Stadtansichten) relevant. Der Belang<br />
wurde im Rahmen der Detailprüfung einzelfallbezogen bewertet. Dabei wurde berücksichtigt, dass sich der maßgebliche<br />
Umgebungsbereich eines Kulturdenkmals danach bestimmt, welchen Umgebungsbereich das Kulturdenkmal selbst unmittelbar<br />
prägt und darüber hinaus auch die Bereiche umfasst, die für die Ausstrahlungskraft des Denkmals wesentlich sind und in denen<br />
die Errichtung von WKA einen optischen Bezug zu dem Kulturdenkmal aufweist.<br />
10 beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
� Sichtachsen zu herausragenden Elementen der Natur- und Kulturlandschaft<br />
In der ges<strong>am</strong>ten Planungsregion verteilt, jedoch in unterschiedlicher Dichte, bestehen zahlreiche Aussichtspunkte mit z. T. herausragenden<br />
Sichtbeziehungen zu den Elementen der Kultur- bzw. Naturlandschaft. Relevant sind insbesondere die unmittelbare<br />
Umgebung der Aussichtspunkte (kein Versperren der Sichtachsen <strong>am</strong> Ausgangspunkt) bzw. die unmittelbare Umgebung der Zielobjekte.<br />
Diese Umgebung ist teilweise über die Ausweisung Regionaler Grünzüge im Regionalplan geschützt. Für die nicht in dieser<br />
Weise geschützten Bereiche erfolgte eine Einzelfallprüfung.<br />
2.8 Konflikte mit Belangen der militärischen Verteidigung<br />
� Truppenübungsplatz Oberlausitz (Tabubereich)<br />
Die Grenzen des TÜP Oberlausitz sind im Bereich der Außenhalde Reichwalde nicht mit denen des VRG für Verteidigung identisch.<br />
In diesem Bereich ergeben sich Restriktionen aus Sicht der Bundeswehr. Unter Berufung auf <strong>§</strong> 2 <strong>Abs</strong>. 2 Nr. 15 ROG wurde<br />
der ges<strong>am</strong>te Bereich des TÜP von der Ausweisung von VRG/EG für die Nutzung von Windenergie ausgenommen.<br />
� Radaranlage Döbern (LK Spree-Neiße, Land Brandenburg) in einem Mindestabstand von 5000 m (Tabubereich)<br />
Für die Wirks<strong>am</strong>keit der Radaranlage ist ein militärischer Schutzbereich in einem Radius von mindestens 5000 m notwendig. Dieser<br />
Radius betrifft in der Gemeinde Groß Düben auch das Gebiet der Planungsregion Oberlausitz-Niederschlesien. Neben dem<br />
militärischen Schutzbereich nach dem Schutzbereichgesetz (SchBG) existiert ein sogenanntes Interessengebiet mit einem Radius<br />
von 20 km vom Drehpunkt der Antenne der Verteidigungsanlage, in dem Beeinträchtigungen der Radaranlage nicht ausgeschlossen<br />
werden können. Zur ausreichenden Berücksichtigung der räumlichen Erfordernisse der militärischen Verteidigung <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 2<br />
<strong>Abs</strong>. 2 Nr. 15 ROG erfolgte innerhalb dieses Interessengebietes eine Einzelfallprüfung durch die zuständige Bundeswehrverwaltung<br />
(Wehrbereichsverwaltung Ost).<br />
3. Schritt Aspekte der Vorhabenskonzentrierung und planerische Auswahl<br />
Unter dem Aspekt der Ausweisung von Konzentrationsflächen für WKA gilt es, raumbedeuts<strong>am</strong>e<br />
Einzelanlagen in kleinere Gruppen oder Windparks zus<strong>am</strong>menzuführen. Als Mindestgröße für die<br />
auszuweisenden VRG/EG für die Nutzung von Windenergie wurden daher 10 ha angesetzt. Diese<br />
Größe garantiert in Abhängigkeit vom räumlichen Zuschnitt der VRG/EG bei Einhaltung bestimmter<br />
<strong>Abs</strong>tandswerte zwischen WKA (Windabschattung, Betriebslasten durch Turbulenzintensität)<br />
sowie der konkreten Standortbestimmung die Errichtung von 2-4 großen WKA mit je mindestens<br />
1,5 MW Leistung.<br />
Nach Reduzierung um die in den beiden ersten Bearbeitungsschritte genannten Tabubereiche und<br />
der Aussondierung von Flächen kleiner 10 ha verblieb in der Planungsregion eine in Betracht zu<br />
ziehende Fläche von ca. 270 km². Dabei ist eine teilräumlich differenzierte Verteilung der verbliebenen<br />
„weißen Flächen“ zu verzeichnen. Im östlichen Teil der Planungsregion (östlich der Linie<br />
Ebersbach/Sa.–Löbau–Niesky) sind zahlreiche großflächige Gebiete (Einzelgrößen z. T. mehrere<br />
km²), im zentralen Teil viele kleinflächige Gebiete (Größenordnung zwischen 10 und 50 ha) mit<br />
einzelnen großflächigen Gebieten Flächen und in den übrigen Teilen der Region eher verstreut<br />
liegende Gebiete unterschiedlicher Größenordnung zu verzeichnen.<br />
Anliegen des Planungsvorbehaltes ist es, Standorte für die Nutzung von Windenergie (Vorrangund<br />
Eignungsgebiete) so zu planen, dass eine großräumige Dominanz im Landschaftsbild weitgehend<br />
vermieden wird (Konzentration auf bestimmte Standorte). Nur so kann ausgeschlossen werden,<br />
dass eine Aneinanderreihung bzw. Häufung nahe beieinanderliegender Windparks, Gruppenoder<br />
Einzelanlagen sowie eine planerisch nicht gewollte „schleichende Erweiterung“ der ausgewiesenen<br />
Gebiete erfolgt. Dieses Grundprinzip, das im Regionalplan 2000 bereits Grundlage für<br />
den Planungsvorbehalt in der „Gefildelandschaft“ war, wurde mit der <strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplanes<br />
weiter verfolgt und muss für die Auswahl der Vorrang- und Eignungsgebiete nunmehr für<br />
die ges<strong>am</strong>te Planungsregion entsprechend konkretisiert und mit nachvollziehbaren und eindeutigen<br />
Werten (Mindestabständen) hinterlegt werden. Aus diesem Grund und in Anbetracht der heute<br />
erreichten Höhen von WKA wurde ein Mindestabstand zwischen Vorrang- und Eignungsgebieten<br />
für die Nutzung von Windenergie festgelegt, um eine Überprägung ganzer Landschaften zu vermeiden.<br />
Berücksichtigt wurden dabei hinsichtlich der landschaftlichen Einordnung auch die außerhalb<br />
der ausgewiesenen Gebiete zulässigerweise errichteten WKA, wobei zu beachten ist, dass für<br />
die Flächenbilanz und Ertragsprognose bei der Anwendung des Planungsvorbehaltes nur die planerisch<br />
als Ziel gesicherten Vorrang- und Eignungsgebiete herangezogen werden können<br />
beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005 11
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
(BVerwG, Urteil vom 13.03.2003, Az.: 4 C 4.02). Dabei müssen vor allem der visuelle Einwirkungsbereich,<br />
von dem aus die WKA in der Landschaft aufgrund ihrer Fernwirkung wahrgenommen<br />
werden können und die visuelle Verletzlichkeit der Landschaft räumlich differenziert betrachtet<br />
werden. Ausschlaggebend sind das Relief sowie die überwiegende Flächennutzung im Raum<br />
(Wald bzw. Offenland). Weiterhin wurde die Größe der ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebiete<br />
bzw. die Anzahl der darin möglichen WKA berücksichtigt.<br />
Für die naturräumliche Einheit des Oberlausitzer Gefildes (Abgrenzung <strong>gemäß</strong> Regionalplan 2002,<br />
Karte „Naturräumliche Gliederung“) beträgt der Mindestabstand zwischen Vorrang- und Eignungsgebieten,<br />
die jeweils größer als 50 ha und für mehr als 10 WKA geeignet sind, 10 km zum nächsten<br />
Vorrang- und Eignungsgebiet, für die kleinflächigeren oder für weniger als 10 WKA geeigneten<br />
Vorrang- und Eignungsgebiete beträgt dieser Mindestabstand 4 km. Für die anderen Teilregionen<br />
beträgt der Mindestabstand zwischen Vorrang- und Eignungsgebieten, die jeweils größer als 50 ha<br />
und für mehr als 10 WKA geeignet sind, 5 km zum nächsten Vorrang- und Eignungsgebiet, für die<br />
kleinflächigeren oder für weniger als 10 WKA geeigneten Vorrang- und Eignungsgebiete beträgt<br />
dieser Mindestabstand 2 km. Die doppelt so großen <strong>Abs</strong>tandswerte für das Oberlausitzer Gefilde<br />
ergeben sich aus dem besonderen naturräumlichen Charakter dieses Gebietes und seiner kulturlandschaftlichen<br />
Bedeutung in Anlehnung an <strong>§</strong> 2 <strong>Abs</strong>. 2 Nr. 13 ROG (vgl. u. a. Anhang zu Kapitel<br />
II.4.1 des Regionalplanes – Regionalisiertes Leitbild für das Oberlausitzer Gefilde). Für die Abbau-<br />
und Sanierungsgebiete des Braunkohlenbergbaus (Abgrenzung <strong>gemäß</strong> Regionalplan 2002 Karte<br />
„Landschaftspflege, -sanierung und -entwicklung“) wurde unabhängig von der Größe der Gebiete<br />
ein Mindestabstand von 2 km festgelegt. D<strong>am</strong>it werden die in Bezug auf das Landschaftsbild bestehende<br />
Vorbelastung durch den Braunkohlenbergbau und die topografischen Besonderheiten<br />
(Sichtverschattung durch hohen Waldanteil) berücksichtigt.<br />
Auf Grund der o. g. Randbedingungen ergab sich für die planerische Auswahl der Gebiete eine<br />
teilräumig differenzierte Herangehensweise:<br />
Im zentralen Teil der Planungsregion, der in etwa der naturräumlichen Einheit des Oberlausitzer<br />
Gefildes entspricht, ergab sich ein Konfliktpotenzial durch einerseits zahlreiche kleinere zu prüfende<br />
Flächen und andererseits dem Aspekt, dass für diese Art von Landschaften aus ästhetischen<br />
Gründen eher wenige, dafür jedoch größere Windparks zu bevorzugen sind als viele kleine. Dagegen<br />
sprechen jedoch wieder die aktuellen Untersuchungen zu den Fledermäusen (siehe <strong>Abs</strong>chnitt<br />
2.2). Es galt also, die bereits im vorherigen Regionalplan verfolgten Zielstellungen (Landschaftsästhetik<br />
und Erhaltung gewachsener Kulturlandschaften im Gefilde) mit den d<strong>am</strong>als bereits bekannten<br />
(avifaunistische Bedeutung des Gebietes zwischen Weißenberg und Hochkirch und der Talsperre<br />
Bautzen) sowie noch nicht bekannten artenschutzrelevanten Sachverhalten in Übereinstimmmung<br />
zu bringen.<br />
Im östlichen Teil der Planungsregion war das wesentliche Kriterium dagegen weniger die Auswahl,<br />
sondern vorrangig die Begrenzung der Größe der Gebiete. Aus dem Relief und dem Bewuchs ergeben<br />
sich für diese Landschaft nicht so großräumige Sichtweiten wie in der Gefildelandschaft, so<br />
dass das Gebiet nur von relativ wenigen Stellen in seiner Ges<strong>am</strong>theit überblickt werden kann.<br />
Daraus resultiert auch die größere Anzahl der dort ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebiete.<br />
Die räumliche Begrenzung erfolgte anschließend unter dem Aspekt der Erhaltung kleinräumiger<br />
Orts- und Landschaftsbilder und der entsprechenden Sichtachsen. Der Korridor Löbau–Herrnhut–<br />
Zittau wurde aus den im <strong>Abs</strong>chnitt 2.2 beschriebenen Gründen freigehalten.<br />
Im nördlichen Teil der Planungsregion treten die Aspekte der Vorhabenskonzentrierung dagegen<br />
weitgehend zurück. Nach Reduzierung um die Tabuflächen wurden die potenziellen Gebiete nur<br />
noch der Detailprüfung hinsichtlich artenschutzrelevanter und sonstiger fachplanerischer Belange<br />
(z. B. Bauschutzbereiche der Flug- und Landeplätze, bergrechtliche <strong>Abs</strong>chlussbetriebspläne für die<br />
bereits abgebauten Bereiche der Tagebaue Nochten und Reichwalde) unterzogen. Ausnahme<br />
bildet der Raum Bad Muskau, wo aus landschaftsästhetischen Gründen im Hinblick auf die angestrebte<br />
Anerkennung des Muskauer Parks als Weltkulturerbe der UNESCO grundsätzlich ein Bereich<br />
von 5 km um den Park sowie weitere Flächen auf Grund der Einzelfallprüfung relevanter<br />
Sichtachsen aus dem Park freigehalten wurden.<br />
12 beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Grundprinzip bei der planerischen Auswahl war zunächst die Sicherung des regionalplanerischen<br />
Mindestzieles von 280 GWh/a Windenergieertrag. Die im Regionalplan 2002 bereits ausgewiesenen<br />
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete für die Nutzung von Windenergie unterlagen der Auswahlentscheidung<br />
nicht mehr, da dies bereits im vorherigen Regionalplanverfahren erfolgte. Das heißt,<br />
sofern ein bereits im Regionalplan 2002 ausgewiesenes Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet keinem<br />
Tabubereich der Schritte 1 und 2 zuzuordnen war und neue artenschutzrechtliche Aspekte nicht zu<br />
berücksichtigen waren, wurde es in dieser <strong>Teilfortschreibung</strong> ohne weitere planerische Abwägung<br />
als Vorrang- und Eignungsgebiet ausgewiesen.<br />
Für das im Sanierungsrahmenplan für den stillgelegten Tagebau Berzdorf ausgewiesene Vorranggebiet<br />
für die Nutzung von Windenergie wurde durch Beschluss des Regionalen Planungsverbandes<br />
vom 16. April 2003 die Fortschreibung eingeleitet. Da mit der Fortschreibung die Aufhebung<br />
als Vorranggebiet für die Nutzung von Windenergie bezweckt wird, erfolgt hier keine Übernahme<br />
mehr. Das Verfahren für die Fortschreibung des Sanierungsrahmenplanes bleibt von den hier vorgenommenen<br />
Regelungen unberührt.<br />
Für bestehende raumbedeuts<strong>am</strong>e WKA, die nicht innerhalb eines Vorrang- und Eignungsgebietes<br />
für die Nutzung von Windenergie liegen, gilt der baurechtliche Bestandsschutz. Darüber hinausgehende<br />
genehmigungsbedürftige Erweiterungen/Erneuerungen sind jedoch i. d. R. nicht möglich.<br />
Folgende Vorrang- und Eignungsgebiete werden ausgewiesen:<br />
Gebiet Bezeichnung<br />
ca. Größe<br />
in (ha)*<br />
EW 1 Leuba 80 8 (4)<br />
EW 2 Bernstadt 80 6 (6)<br />
EW 4 Leutersdorf 20 4 (4)<br />
EW 5 Oberseifersdorf 30 7 (3)<br />
EW 6 Dittelsdorf 35 7 (5)<br />
EW 7 Laucha 10 2 (0)<br />
EW 9 Röhrsdorf 29 4 (4)<br />
EW 10 Wachau 30 5 (3)<br />
max.<br />
WKA*(davon<br />
Hinweise für die räumliche Konkretisierung<br />
in Betrieb<br />
Mai 2004)<br />
<strong>Abs</strong>tände zu den Hochspannungsleitungen beachten, archäologisch<br />
relevanter Bereich<br />
Siedlungsabstand Bernstadt und <strong>Abs</strong>tand zur Hochspannungsleitung<br />
beachten, archäologisch relevanter Bereich<br />
Siedlungsabstand Leutersdorf und Neuwalde (Neugersdorf)<br />
beachten, archäologisch relevanter Bereich<br />
<strong>Abs</strong>tand zur Hochspannungsleitung beachten, Richtfunkstrecke<br />
freihalten, der regionale Grünzug zwischen beiden Teilflächen ist<br />
nicht Bestandteil des EW 5, archäologisch relevanter Bereich<br />
Siedlungsabstand Wittgendorf und Wittgendorfer Feldhäuser<br />
sowie <strong>Abs</strong>tand zur Hochspannungsleitung beachten, archäologisch<br />
relevanter Bereich<br />
Siedlungsabstand Laucha und Carlsbrunn sowie <strong>Abs</strong>tand zum<br />
VBG Gb 53*/Abbaugrenze Steinbruch Laucha <strong>gemäß</strong> Hauptbetriebsplan<br />
und zur Planung B 178 (neu) beachten, archäologisch<br />
relevanter Bereich<br />
Siedlungsabstand Röhrsdorf sowie <strong>Abs</strong>tand von 500 m zum<br />
SPA-Gebiet „Königsbrücker Heide“ beachten, archäologisch<br />
relevanter Bereich<br />
Siedlungsabstand Wachau und <strong>Abs</strong>tand zur BAB 4, beachten,<br />
Richtfunkstrecke der Deutschen Telekom AG freihalten, das<br />
nördlich angrenzende kleine Waldgebiet ist nicht Bestandteil des<br />
VRG/EG, archäologisch relevanter Bereich.<br />
EW 12** Scheibe / Šiboj 30 5 (0) <strong>Abs</strong>tand zur Hochspannungsleitung beachten<br />
EW 13 Zerre / Drĕtwa 68 10 (5)<br />
<strong>Abs</strong>tand zur Hochspannungsleitung beachten, Bundeswehr<br />
(WBV Ost Strausberg) beteiligen<br />
die in der Karte noch dargestellte 220-kV-Leitung wurde zurück-<br />
EW 15 Reichenbach 32 8 (7) gebaut, Straßenplanung OU Reichenbach beachten, archäologisch<br />
relevanter Bereich<br />
<strong>Abs</strong>tand zur Bahnstrecke und zur BAB 4 beachten, Richt-<br />
EW 16 Charlottenhof 91 13 (9) funkstrecke Vattenfall Europe freihalten, 200 m Waldabstand,<br />
archäologisch relevanter Bereich<br />
Siedlungsabstand Randhäuser (Radeberg) beachten, Richt-<br />
EW 17 Kleinröhrsdorf 15 3 (3) funkstrecke Rettungszweckverband Westlausitz freihalten, archäologisch<br />
relevanter Bereich<br />
die in der Karte noch dargestellte 220-kV-Leitung wurde zurück-<br />
EW 18 Sohland a. R. 56 9 (6) gebaut, Richtfunkstrecke D2-Vodafone freihalten, archäologisch<br />
relevanter Bereich<br />
beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005 13
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Gebiet Bezeichnung<br />
ca. Größe<br />
in (ha)*<br />
max.<br />
WKA*(davon<br />
in Betrieb<br />
Mai 2004)<br />
EW 20 Deschka 75 9 (6)<br />
EW 21 Thonberg 100 12 (12)<br />
EW 22 Melaune 70 9 (7)<br />
EW 25 Bernsdorf 12 3 (3)<br />
EW 26 Leippe 30 4 (3)<br />
EW 29<br />
EW 30<br />
Tagebau Spreetal /<br />
Sprjeminy Doł<br />
Tagebau Reichwalde /<br />
Rychwałd<br />
110 14 (0)<br />
26 6 (0)<br />
EW 31 Burkau/Marienberg 20 3 (2)<br />
EW 33 Schmiedefeld 14 2 (0)<br />
Ges<strong>am</strong>t 1063 153 (91)<br />
Tabelle 3: Auflistung der Vorrang- und Eignungsgebiete für die Nutzung von Windenergie<br />
Hinweise für die räumliche Konkretisierung<br />
Begrenzung durch VBG KS 59* (keine Überlagerung) sowie im<br />
Norden durch die „Kirschallee“, Verregnungsnetz Zodel der<br />
Agrargenossenschaft bei konkreter Standortplanung berücksichtigen,<br />
archäologisch relevanter Bereich<br />
Siedlungsabstand Prietitz und geplante Trasse für Staatsstraße<br />
S 102 beachten, Gasleitung der GASO GmbH beachten, archäologisch<br />
relevanter Bereich<br />
Siedlungsabstand Tetta, Melaune, Feldhäuser und Neucunnewitz<br />
beachten, <strong>Abs</strong>tand zum Tontagebau Buchholz (Vorranggebiet<br />
T 3) beachten, archäologisch relevanter Bereich<br />
Begrenzung auf waldfreie Schneise, archäologisch relevanter<br />
Bereich<br />
Begrenzung auf Bestand Landwirtschaft lt. Sanierungsrahmenplan<br />
Tagebau Heide, archäologisch relevanter Bereich<br />
Gebiet umfasst ausschließlich landwirtschaftlich genutzte Fläche<br />
südlich des Spreetaler Sees, 500 m <strong>Abs</strong>tand zum Kernbereich<br />
„Terra Nova“ einhalten, Sächsisches Oberberg<strong>am</strong>t im Genehmigungsverfahren<br />
beteiligen (Kippenfläche)<br />
Gebiet östlich der Tagesanlagen Reichwalde (Schadendorf) und<br />
südlich des heutigen Nordrandschlauches, das <strong>gemäß</strong> Braunkohlenplan<br />
Reichwalde (Karte 4) als Grün- bzw. landwirtschaftliche<br />
Nutzfläche ausgewiesen ist (derzeit weitgehende Zwischenbegrünung<br />
durch den Bergbautreibenden erfolgt), die Grenze im<br />
Osten verläuft in dem Bereich, der nach Wiederaufnahme des<br />
Tagebaubetriebes nochmals überkippt wird, Sächsisches Oberberg<strong>am</strong>t<br />
im Genehmigungsverfahren beteiligen (Kippenfläche),<br />
Bundeswehr (WBV Ost Strausberg) beteiligen<br />
Siedlungsabstand Burkau und Schönbrunn sowie <strong>Abs</strong>tand zu<br />
den Hochspannungsleitungen beachten, die ehemalige Bahntrasse<br />
ist nicht Bestandteil des Gebietes, archäologisch relevanter<br />
Bereich<br />
Siedlungsabstand Schmiedefeld und Rennersdorf-Neudörfel<br />
(Stadt Stolpen) beachten, Beteiligung BGS Pirna im Genehmigungsverfahren<br />
notwendig (Schlechtwetterroute für Hubschrauber),<br />
archäologisch relevanter Bereich<br />
* 1. Die räumliche Konkretisierung der VRG/EG erfolgt i. d. R. durch die kommunale Bauleitplanung. Da die regionalplanerisch<br />
nur gebietsscharfe Ausweisung im Rahmen dieser Konkretisierung räumlich schärfer abgegrenzt wird, gelten die hier angegebenen<br />
Flächengrößen der VRG/EG nur als Orientierung.<br />
2. Die maximale Anzahl der WKA in den jeweiligen VRG/EG wurde anhand der bekannten, betriebstechnisch (Nachlaufströmung)<br />
bzw. betriebswirtschaftlich (Ertrag) notwendigen Mindestabstände zwischen den einzelnen Anlagen geschätzt. Relevant<br />
ist insbesondere der Mindestabstand in Hauptwindrichtung, der nach den Informationen der Hersteller zwischen einem 3-<br />
und 5-fachen Rotordurchmesser beträgt. Bereits bestehende WKA wurden berücksichtigt. Für die Schätzung möglicher zusätzlicher<br />
Anlagen auf den noch freien Flächen wurde eine WKA mit 70 m Rotordurchmesser angenommen. Bei größeren<br />
Rotordurchmessern verringert sich die Anzahl möglicher WKA innerhalb der Vorrang- und Eignungsgebiete.<br />
** Ausweisung <strong>gemäß</strong> dem verbindlichen Sanierungsrahmenplan für den stillgelegten Tagebau Scheibe<br />
Einige vorhandene Windparks/Windkraftanlagen liegen nur teilweise innerhalb eines ausgewiesenen<br />
Vorrang- und Eignungsgebietes für die Nutzung von Windenergie (z. B. Windpark Deschka<br />
sechs der in Betrieb befindlichen WKA innerhalb und zwei außerhalb des Vorrang- und Eignungsgebietes<br />
EW 20). Die in der Tabelle aufgeführte maximale Anzahl von WKA bezieht sich nur auf<br />
das VRG/EG. Somit wären innerhalb des VRG/EG EW 20 Deschka maximal 9 WKA möglich, mit<br />
den beiden außerhalb des VRG/EG liegenden und bereits genehmigten WKA könnte theoretisch<br />
ein Windpark mit insges<strong>am</strong>t 11 WKA entstehen.<br />
14 beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Folgende Tabelle gibt die Situation für alle davon betroffenen WKA bzw. Vorrang- und Eignungsgebiete<br />
wieder:<br />
Standort<br />
in Betrieb befindliche<br />
WKA innerhalb<br />
des VRG/EG<br />
in Betrieb befindliche<br />
WKA außerhalb<br />
des<br />
VRG/EG mit<br />
Bestandsschutz<br />
Begründung<br />
innerhalb des VRG/EG<br />
zusätzlich mögliche WKA<br />
(Maximalwert)<br />
Leutersdorf 4 2 Siedlungsabstand 0<br />
Kittlitz-Laucha 0 1<br />
Siedlungsabstand, Vorbehaltsgebiet<br />
Gb 53<br />
2<br />
Wachau 3 2 Siedlungsabstand 2<br />
Deschka 6 2 Vorbehaltsgebiet KS 59 3<br />
Sohland a. R. 6 1 Siedlungsabstand 3<br />
Oberseifersdorf/Eckartsberg 3 1 Regionaler Grünzug 4<br />
Charlottenhof 9 9 Fledermauszugkorridor 4<br />
Tabelle 4: Windkraftstandorte, die nur teilweise einem Vorrang- und Eignungsgebiet für die Nutzung von Windenergie zugeordnet<br />
wurden mit Begründung<br />
Durch die ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebiete für die Nutzung von Windenergie werden<br />
mehr als 1050 ha raumordnerisch als Ziel gesichert. Auf dieser Fläche können bei optimaler Auslastung<br />
maximal 153 WKA errichtet werden. Mit Kenntnisstand Mai 2004 waren innerhalb der Vorrang-<br />
und Eignungsgebiete 91 WKA mit einer Ges<strong>am</strong>tleistung von ca. 117 MW in Betrieb/im Bau.<br />
Für die folgende Prognose der durchschnittlichen jährlichen Energieerträge in den ausgewiesenen<br />
Vorrang- und Eignungsgebieten wurden die Ergebnisse des sächsischen Windmessprogr<strong>am</strong>ms,<br />
Teil II (1996) sowie der <strong>Abs</strong>chlussbericht aus dem Jahr 1997 (Grundlage: Nabenhöhe 60 m), die in<br />
Bauanträgen bzw. Beteiligungsprospekten veröffentlichten Ertragsprognosen und, soweit bekannt,<br />
die realen Standortergebnisse in Betrieb befindlicher WKA herangezogen. Mit den im Mai 2004 in<br />
Betrieb befindlichen 91 WKA innerhalb der VRG/EG können im Jahresdurchschnitt ca. 220 GWh/a<br />
erzeugt werden, die noch nicht belegten Flächen bieten in der Maximalvariante der Flächenverfügbarkeit<br />
(62 WKA mit angenommenen je 1,5 MW) zusätzliche Möglichkeiten für die Erzeugung von<br />
ca. 190-230 GWh/a (Berechnungsgrundlage: Daten vorliegender Bauanträge, ansonsten Errichtung<br />
von Anlagen der 1,5 MW-Klasse). Somit kann mit den ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebieten<br />
ein jährlicher Ertrag von im Jahresdurchschnitt ca. 410-450 GWh gesichert werden.<br />
Da zunehmend leistungsstärkere Anlagen (1,8 MW, 2,0 MW, 2,3 MW) mit größeren Nabenhöhen<br />
für die bestehenden freien Flächen in den VRG/EG in Betracht kommen, kann sich dieser Wert<br />
noch erhöhen. Nicht berücksichtigt werden kann gegenwärtig bei der Potenzialanalyse ein mögliches<br />
Repowering (Erneuerung älterer Anlagen durch leistungsstärkere), da die Entscheidung für<br />
den Zeitpunkt nicht vorhergesagt werden kann. Mit Kenntnisstand vom Mai 2004 bestehen bzw.<br />
sind im Bau weitere 48 WKA mit einer installierten Leistung von insges<strong>am</strong>t ca. 56 MW außerhalb<br />
der hier ausgewiesenen VRG/EG. Mit diesen WKA werden jährlich etwa 80 bis 90 GWh produziert.<br />
Somit kann mit den ausgewiesenen VRG/EG für die Nutzung von Windenergie in der Planungsregion<br />
das Klimaschutzprogr<strong>am</strong>m des Freistaates Sachsen 2001 für den Bereich der Windenergie<br />
erfüllt und somit das Ziel 11.4 des LEP 2003 regionalplanerisch umgesetzt werden.<br />
beschlossen als <strong>Satzung</strong> <strong>am</strong> <strong>24</strong>. Februar 2005 15
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher<br />
Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie im Sinne<br />
des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 des Gesetzes zur Raumordnung<br />
und Landesplanung des Freistaates Sachsen (Landesplanungsgesetz - <strong>SächsLPlG</strong>)<br />
vom 14. Dezember 2001 (SächsGVBl. S. 716), das durch Artikel 5 des Gesetzes vom<br />
14. November 2002 (SächsGVBl. S. 307, 310) geändert worden ist<br />
1. Allgemeine Grundlagen<br />
Die Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen<br />
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (92/43/EWG) - FFH-Richtlinie - zielt darauf ab,<br />
unter der Bezeichnung „Natura 2000“ ein kohärentes Netz besonderer Schutzgebiete<br />
aus<br />
- den ca. <strong>24</strong>0 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-Richtlinie,<br />
- den Habitaten des Anhangs II der FFH-Richtlinie,<br />
welche durch die Ausweisung als sog. FFH-Gebiete geschützt werden sollen,<br />
und den<br />
- Vogelschutzgebieten - SPA-Gebiete - nach Artikel 4 der Richtlinie des Rates der Europäischen Gemeinschaften<br />
vom 2. April 1979 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten (79/409/EWG) -<br />
Vogelschutzrichtlinie -.<br />
zu schaffen.<br />
Grundlegende Vorschrift für die Verträglichkeitsprüfung von Raumordnungsplänen nach der FFH-Richtlinie<br />
(nachfolgend kurz Verträglichkeitsprüfung genannt) ist <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 Sätze 2 und 3 <strong>SächsLPlG</strong>, welcher <strong>§</strong> 7<br />
<strong>Abs</strong>. 7 ROG umsetzt. Danach sind in der Abwägung auch die Erhaltungsziele oder der Schutzzweck der<br />
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete im Sinne des<br />
BNatSchG zu berücksichtigen. Soweit diese erheblich beeinträchtigt werden können, sind die Vorschriften<br />
des BNatSchG über die Zulässigkeit oder Durchführung von derartigen Eingriffen sowie die Einholung der<br />
Stellungnahme der Kommission anzuwenden.<br />
Die Prüfung erfolgt anhand der „Hinweise für die Prüfung von Raumordnungsplänen nach der Flora-Fauna-<br />
Habitatrichtlinie der EU“ (Schreiben des SMI an die Regionalen Planungsverbände vom 17. April 2002, Az.:<br />
64-<strong>24</strong>32.58) und der „Arbeitshilfe“ des SMUL vom 27. März 2003 (Az.: 61-8830.10/6) sowie der Arbeitshilfe<br />
des SMUL zur Anwendung der Vorschriften zum Aufbau und Schutz des Europäischen ökologischen Netzes<br />
„Natura 2000“ (Schreiben des SMUL vom 27. März 2003, Az.: 61-8830.10/6).<br />
Grundlage für die Prüfung ist der Meldestand <strong>gemäß</strong> dem Kabinettsbeschluss Nr. 03/0589 vom 19. März<br />
2002 sowie die <strong>gemäß</strong> dem Kabinettsbeschluss vom 23. September 2003 erfolgte Ergänzung für das Gebiet<br />
Nr. 90 E „Truppenübungsplatz Oberlausitz“ (Nachmeldung an das BMU vom 12. Februar 2004).<br />
Bezüglich der Europäischen Vogelschutzgebiete gilt der Stand der Bekanntmachung vom 2. Mai 2003 (Bundesanzeiger<br />
vom 11. Juni 2003, S. 40 f).<br />
Der Bewertungsmaßstab für die Vorprüfung orientiert sich ausschließlich an den Erhaltungszielen der „Natura<br />
2000-Gebiete“, wobei grundsätzlich auch Auswirkungen auf das Entwicklungs- und Wiederherstellungspotenzial<br />
des Gebietes, Vorbelastungen, Summationswirkungen und Kohärenzaspekte zu berücksichtigen<br />
sind. Der Vorprüfung liegen für die FFH-Gebiete die gebietsspezifischen Erhaltungsziele des Sächsisches<br />
Landes<strong>am</strong>tes für Umwelt und Geologie (LfUG), Abt. Natur- und Landschaftsschutz, mit Stand 01/2003 sowie<br />
für die Teilgebiete des Europäischen Vogelschutzgebietes „Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft“ die<br />
Erhaltungsziele des LfUG (Natura 2000 – Arbeitsmaterialien) zugrunde.<br />
16 Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
2. Vorprüfung/Erheblichkeitsabschätzung FFH-Gebiete<br />
Wenn eine planerische Ausweisung ein Natura 2000-Gebiet unmittelbar in Anspruch nimmt oder in dessen<br />
räumlicher Nähe erfolgt, ist zunächst im Rahmen einer Vorprüfung eine Prognose abzugeben, ob diese<br />
Ausweisung zu Beeinträchtigungen führen kann. Einer Verträglichkeitsprüfung bedarf es nur, wenn ein Vorhaben<br />
die formalen Voraussetzungen des Projektbegriffs erfüllt und wenn erhebliche Beeinträchtigungen<br />
ernsthaft zu erwarten sind (Vorprüfung/Erheblichkeitsabschätzung) (SMUL 2003).<br />
Für alle FFH- und EU-Vogelschutzgebiete gilt somit zusätzlich zur direkten räumlichen Überlagerung ein<br />
Umgebungsschutz. Die Gebiete besitzen d<strong>am</strong>it auch eine funktionale Außenwirkung, d. h. erhebliche Beeinträchtigungen<br />
für die gebietsspezifischen Erhaltungsziele, die sich durch Vorhaben auch außerhalb der<br />
Grenzen der Gebiete ergeben, sind zu vermeiden.<br />
Natura 2000-Gebiete werden durch die ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebiete für die Nutzung von<br />
Windenergie nicht unmittelbar in Anspruch genommen. Dies ergibt sich aus dem <strong>Abs</strong>chnitt 2.2 der Begründung<br />
der <strong>Teilfortschreibung</strong>, nachdem die Ausweisung von Vorrang- und Eignungsgebieten in den bekanntgemachten<br />
bzw. gemeldeten Vogelschutzgebieten bzw. FFH-Gebieten ausgeschlossen wurde.<br />
Mögliche Beeinträchtigungen der lebensraumbezogenen Erhaltungsziele der „Natura 2000-Gebiete“ können<br />
durch die räumliche Trennung der ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebiete für die Nutzung von<br />
Windenergie und der „Natura 2000-Gebiete“ ausgeschlossen werden. Sekundärwirkungen wie Grundwasserabsenkungen<br />
und Stoffeinträge sind auf Grund der Vorhabenspezifik nicht zu erwarten. Selbst ein möglicher<br />
Schattenwurf durch einzelne WKA kann i. d. R. nicht zu einer Beeinträchtigung der relevanten Lebensräume<br />
führen. Gegebenenfalls kann dieser Aspekt auch in den nachfolgenden Planungsstufen bzw. bei Genehmigungen<br />
betrachtet werden, da im Rahmen des Regionalplanes weder über den genauen Standort<br />
noch über den genauen Typ der WKA entschieden wird.<br />
Für die in den gebietsspezifischen Erhaltungszielen benannten Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse<br />
kann durch die räumliche Trennung der VRG/EG und der FFH-Gebiete sowie der nur unbedeutenden<br />
Sekundäreffekte beim Bau von WKA jegliche Beeinträchtigung ausgeschlossen werden.<br />
� Die Verträglichkeit der Ausweisungen der <strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplanes für das Kapitel<br />
II.4.4.7 Windenergie mit den gebietsspezifischen Erhaltungszielen für die natürlichen Lebensräume<br />
von gemeinschaftlichem Interesse <strong>gemäß</strong> Anhang I der Richtlinie 92/43/EWG sowie<br />
den Pflanzenarten <strong>gemäß</strong> Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG ist somit gegeben.<br />
Die Vorprüfung beschränkt sich auf eine mögliche Beeinträchtigung der Tierarten von gemeinschaftlichem<br />
Interesse in den gemeldeten Gebieten, für welche Beeinträchtigungen durch in der Umgebung ausgewiesenen<br />
Vorrang- und Eignungsgebiete für die Nutzung von Windenergie nicht von vorn herein ausgeschlossen<br />
werden können und die für die Auswahl der FFH-Gebiete von Bedeutung waren. Auswirkungen auf Arten<br />
(auch des Anhanges II der FFH-Richtlinie), die für die Auswahl des Gebietes nicht von Bedeutung waren<br />
oder auf andere nach der FFH-Richtlinie zu schützenden Arten (z. B. Anhang IV) oder von Arten, die allein<br />
nach nationalem Recht geschützt sind, sind selbst dann im Rahmen der Verträglichkeitsprüfung irrelevant,<br />
wenn sie in den Schutzzielen einer zur Sicherung des Gebietes erlassenen naturschutzrechtlichen Schutzgebietsausweisung<br />
im Schutzzweck miterfasst sind (FFH-Arbeitshilfe des SMUL, <strong>Abs</strong>chnitt 7.2.1).<br />
Somit umfasst der Prüfmaßstab die Arten, die auf Grund ihrer Habitatansprüche empfindlich auf die Errichtung<br />
und den Betrieb von Windkraftanlagen reagieren können. Beeinträchtigungen von Wirbellosen, Fischen<br />
und Rundmäulern, Amphibien sowie Säugetieren (mit Ausnahme der Fledermäuse) können durch die räumliche<br />
Trennung der ausgewiesenen Gebiete von den FFH-Gebieten jedoch ausgeschlossen werden. Eine<br />
noch nicht ausreichend untersuchte mögliche Störung durch Ultraschall, die über größere Distanzen möglich<br />
ist, ist auf einzelne WKA-Typen beschränkt (BACH 2001). Da mit der Ausweisung der VRG/EG nicht über<br />
einen speziell zu errichtenden WKA-Typ entschieden wird, kann dieser Prüfungsaspekt in nachfolgenden<br />
Planungsebenen betrachtet und bewertet werden.<br />
Die Vorprüfung der einzelnen VRG/EG für die Nutzung von Windenergie beschränkt sich somit auf die in<br />
den Erhaltungszielen genannten Fledermausarten von gemeinschaftlichem Interesse <strong>gemäß</strong> der Richtlinie<br />
92/43/EWG.<br />
Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004 17
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
In den Erhaltungszielen der in der Region Oberlausitz-Niederschlesien gemeldeten FFH-Gebiete werden die<br />
Fledermausarten <strong>gemäß</strong> Anhang II der FFH-Richtlinie Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus), Großes<br />
Mausohr (Myotis myotis), Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros), Teichfledermaus (Myotis dasycneme),<br />
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) explizit benannt.<br />
2.1 Lebensraumansprüche der genannten Fledermausarten <strong>gemäß</strong> Anhang II<br />
Die Angaben wurden den Artenbeschreibungen unter http://lfugwww.smul.sachsen.de/de/wu/umwelt/lfug/<br />
lfug-internet/index.html entnommen.<br />
Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)<br />
Die Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) ist eine mittelgroße Fledermausart mit kurzer aufgewölbter<br />
»mopsartiger« Schnauze. Sie besiedelt in den Sommermonaten waldreiche Gebiete (Waldfledermaus), jagt<br />
aber auch an Baumreihen, Hecken und Feldgehölzen.<br />
Die Wochenstuben, die oft nur aus wenigen (10 bis 25) Weibchen bestehen, befinden sich in Spaltenquartieren<br />
hinter Holzverkleidung, Fensterläden oder Schildern an Gebäuden und Bäumen, beispielsweise hinter<br />
abstehender Borke oder in Baumhöhlen, zum Teil auch in Fledermauskästen. Als Winterquartiere werden<br />
Höhlen, Stollen, Keller, Bunker, Tunnel und Wasserdurchlässe genutzt. Die Mopsfledermaus ist eine kälteresistente<br />
Art, die sich durch häufigen Quartierwechsel auszeichnet; weite Wanderungen werden nur ausnahmsweise<br />
vorgenommen. Die Nahrung besteht vorwiegend aus kleinen weichhäutigen Insekten wie<br />
Kleinschmetterlingen und Mücken. Die Mopsfledermaus ist in ganz Deutschland verbreitet, aber meist nicht<br />
sehr zahlreich. In den letzten Jahrzehnten ist die Art stark zurückgegangen, so dass sie heute bundesweit<br />
vom Aussterben bedroht ist. In Sachsen kommt die Art zerstreut vor, wobei eine Häufung der Quartiere im<br />
Vorgebirgsland und in den Mittelgebirgen (300 bis 500 m ü. NN) zu verzeichnen ist.<br />
Trotz des hohen Gefährdungsgrades gilt der Ges<strong>am</strong>tbestand von jeweils mehr als 200 Individuen in Wochenstuben<br />
und Winterquartieren heute als relativ stabil. Flächendeckende Untersuchungen stehen allerdings<br />
noch aus.<br />
Gefährdungsfaktoren für die Art ergeben sich aus der Aufgabe der naturnahen Waldbewirtschaftung, dem<br />
Verlust an Altholzbeständen, der Sanierung von Gebäuden und aus dem möglichen Nahrungsmangel durch<br />
Landschaftsveränderungen und den Einsatz von Insektiziden.<br />
Großes Mausohr (Myotis myotis)<br />
Das Große Mausohr (Myotis myotis) ist mit einer Spannweite von 350 bis 430 Millimetern und einer Körperlänge<br />
von 67 bis 79 Millimetern die größte europäische Fledermausart.<br />
Die Sommerquartiere befinden sich auf geräumigen Dachböden von Kirchen oder anderen großen Gebäuden.<br />
Vereinzelt werden Wochenstuben auch in unterirdischen Räumen, unter Brücken, in Baumhöhlen und<br />
Fledermauskästen angetroffen.<br />
Die Nahrung des Großen Mausohrs besteht vorwiegend aus Käfern – insbesondere Laufkäfer –, Nachtschmetterlingen,<br />
Heuschrecken und Spinnen. Als Nahrungshabitate werden Areale mit frei zugänglicher<br />
Bodenoberfläche wie hallenartige Wälder mit fehlender beziehungsweise gering ausgeprägter Strauch- und<br />
Krautschicht, Parks und frisch gemähtes oder beweidetes Grünland aufgesucht. Die Fledermäuse nutzen<br />
dabei große Jagdgebiete.<br />
Die Fledermäuse überwintern einzeln oder in Gruppen bis zu 100 Tieren in Höhlen, Stollen und Kellern.<br />
Auch in den Wochenstuben werden nicht selten mehrere Hundert Exemplare angetroffen. Über 55 Nachweise<br />
von Winterquartieren liegen schwerpunktmäßig aus dem mittleren Sachsen und dem Erzgebirge, stellenweise<br />
auch über 600 m ü. NN. vor.<br />
Mausohren legen teilweise weite Wanderungen zwischen Sommer- und Winterquartieren zurück. Die<br />
Verbreitung der Wochenstuben in Sachsen beschränkt sich auf Höhenlagen unter 600 m ü. NN. Insges<strong>am</strong>t<br />
sind mehr als 35 Wochenstuben mit einem Ges<strong>am</strong>tbestand von rund 2700 adulten und vorjährigen Tieren<br />
bekannt.<br />
18 Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
Das Große Mausohr hat teilweise drastische Bestandesrückgänge zu verzeichnen. Heute ist die Art in Sachsen<br />
stark gefährdet. Als Hauptgefährdungsfaktoren müssen die Vernichtung beziehungsweise Beeinträchtigung<br />
der Sommerquartiere wie Gebäudesanierung, Einsatz von Holzschutzmitteln, Verschließen von Einflugmöglichkeiten<br />
und der Einsatz von Insektiziden in der Land- und Forstwirtschaft angesehen werden.<br />
Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros)<br />
Die Kleine Hufeisennase (Rhinolophus hipposideros) verdankt ihren N<strong>am</strong>en dem hufeisenförmigen Hautaufsatz<br />
der Nase. Die Wochenstuben der Art, die ab April bezogen werden und freie Einflugsmöglichkeiten<br />
aufweisen, befinden sich vorwiegend an warmen, zugluftfreien Stellen wie Dachböden und Heizungskeller in<br />
Gebäuden. Als Winterquartiere nutzt die Kleine Hufeisennase vor allem frostfreie unterirdische Hohlräume<br />
wie ehemalige Kalkbergwerke, Stollen und Höhlen, die oft in relativer Nachbarschaft zu den Sommerquartieren<br />
liegen.<br />
Als Jagdgebiete werden strukturreiche Areale mit einem hohen Grenzlinienanteil in der näheren Umgebung<br />
der Quartiere bevorzugt. Saum- und gehölzreiche Strukturen wie beispielsweise Hecken, Baumreihen,<br />
Streuobstwiesen, Altbaumbestände, Friedhöfe und Parkanlagen dienen gleichzeitig als Leitstrukturen. Die<br />
Nahrungsgrundlage besteht vorwiegend aus fliegenden Insekten.<br />
Die nach 1985 nachgewiesenen Vorkommen der Kleinen Hufeisennase liegen in der Umgebung von Dresden<br />
(Elbtal und Seitentäler), in der Sächsischen Schweiz, im unteren Osterzgebirge und im südlichen Teil<br />
der östlichen Oberlausitz. Die meisten Vorkommen liegen in einer Höhenlage von etwa 300 m ü. NN.<br />
Gegenwärtig sind in Sachsen jeweils 8 Sommer- und Winterquartiere bekannt. Der Ges<strong>am</strong>tbestand in<br />
Sommerquartieren beträgt etwa 550 adulte und vorjährige Tiere. Die sächsischen Vorkommen der Kleinen<br />
Hufeisennase liegen an der nördlichen Verbreitungsgrenze der Art.<br />
Die Kleine Hufeinsennase ist in Sachsen und in ganz Deutschland vom Aussterben bedroht. Bis in die 80er<br />
Jahre des 20. Jahrhunderts waren starke Bestandeseinbußen zu verzeichnen. Seitdem hat sich der Bestand<br />
in Sachsen auf niedrigem Niveau stabilisiert, wobei die Zahl der besetzten Quartiere auch heute noch zurückgeht.<br />
Da sich der Bestand in Wochenstuben auf immer weniger Quartiere verteilt, kann das Erlöschen<br />
einzelner Quartiere zu einer ernsthaften Gefährdung für die Ges<strong>am</strong>tpopulation führen. Das gilt insbesondere<br />
vor dem Hintergrund, dass Sachsen aufgrund des hohen Anteils <strong>am</strong> deutschen Ges<strong>am</strong>tbestand eine hohe<br />
Bedeutung für die Erhaltung der Art besitzt.<br />
Neben der direkten Vernichtung von Quartieren sind Strukturveränderungen in den Jagdhabitaten (zum Beispiel<br />
Flurbereinigung, Bebauung) und der Einsatz von Bioziden Ursachen für den Rückgang. Zu den besonderen<br />
Schutznotwendigkeiten der Art gehört insbesondere die weitere Betreuung der bekannten Quartiere.<br />
Teichfledermaus (Myotis dasycneme)<br />
Die Teichfledermaus (Myotis dasycneme) ist mit einer Kopf-Rumpf-Länge von 57 bis 68 Millimetern und<br />
einer Spannweite von <strong>24</strong>0 bis 320 Millimetern gleichfalls nur eine mittelgroße Art. Wochenstuben sind fast<br />
ausschließlich aus Gebäuden bekannt, Winterquartiere befinden sich in Stollen, Kellern und Bunkern. Zwischen<br />
Sommer- und Winterquartieren können teilweise weite Wanderungen durchgeführt werden.<br />
Die Nahrungshabitate liegen in gewässerreichen Gebieten des Tief- und Hügellandes. Die Tiere jagen an<br />
und über der Wasseroberfläche nach Wasserinsekten, Schmetterlingen, Zweiflüglern und ähnlichem.<br />
In Sachsen ist die Teichfledermaus nach der Roten Liste »extrem selten«. Dementsprechend liegen nur<br />
wenige Nachweise vor, regelmäßig besetzte Quartiere sind bisher nicht bekannt. Neuere Einzelnachweise<br />
mit einer Häufung nach 1990 erfolgten vor allem in der Oberlausitz mittels Netzfängen und im Eingangsbereich<br />
eines Stollens bei Brand-Erbisdorf. Mit dem regelmäßigen Auftreten der Art in größeren Teichgebieten<br />
des Tieflandes (z.B. im Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet) und in den großen Flußauen ist zu rechnen.<br />
Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004 19
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)<br />
Die Bechsteinfledermaus ist eine mittelgroße Fledermausart mit auffallend langen Ohren, die, nach vorn<br />
umgelegt, die Schnauzenspitze überragen. Die ausgesprochene Waldart besiedelt bevorzugt feuchte<br />
Mischwälder, aber auch Kiefernwälder, Parks und Gärten. Als Sommerquartiere werden insbesondere<br />
Baumhöhlen genutzt; regelmäßig können Wochenstuben auch in Nistkästen und vereinzelt in Gebäuden<br />
gefunden werden. Die Winterquartiere befinden sich in ehemaligen Bergwerksstollen, wo meist freihängende<br />
Einzeltiere beobachtet werden. Die Nahrung aus vorwiegend Insekten wird im Jagdflug erbeutet oder von<br />
der Vegetation abgelesen. Der Aktionsradius ist dabei vergleichsweise gering. Meist liegt er unter einem<br />
Kilometer. Vorkommen der Bechsteinfledermaus sind in Sachsen ausgesprochen selten (Rote Liste Kategorie<br />
R). Insges<strong>am</strong>t ist nur eine Wochenstube bei Wittgendorf (Landkreis Löbau-Zittau) bekannt, die jedoch<br />
nach Aussage des für den Landkreis zuständigen Fledermausexperten, Herrn POIK, gegenwärtig nicht mehr<br />
genutzt wird. Winterquartiere und frühere Nachweise st<strong>am</strong>men hauptsächlich aus dem Elbsandsteingebirge<br />
und Osterzgebirge sowie vorgelagerten Bereichen.<br />
Wesentliche Gefährdungen sind in der Zerstörung von Sommerlebensräumen (Verlust naturnaher Wälder<br />
mit höhlenreichen Altholzbeständen) und im Verlust beziehungsweise der Störung von Winterquartieren zu<br />
sehen.<br />
Zu Vorkommen und Verbreitung der Art in Sachsen besteht noch erheblicher Untersuchungsbedarf.<br />
2.2 Prüfung der ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebiete für die Nutzung von Windenergie<br />
hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen von Fledermauslebensräumen<br />
Konflikte zwischen der Nutzung der Windenergie und Lebensräumen von Fledermäusen können sich neben<br />
der Vernichtung oder Beeinträchtigung von Quartieren auch aus der Störung durch Ultraschallemission,<br />
Kollision mit den Rotoren (Fledermausschlag), Barriereeffekt (Verlust oder Verlagerung von Flugkorridoren)<br />
und Verlust des Jagdgebietes ergeben (BACH 2001).<br />
Fledermausquartiere, die den Regelungen der FFH-Richtlinie unterliegen, werden durch die ausgewiesenen<br />
VRG/EG für die Nutzung von Windenergie nicht überlagert (vgl. Begründung der <strong>Teilfortschreibung</strong>, <strong>Abs</strong>chnitt<br />
2.2. Ebenso erfolgte zur Gewährleistung eines freien An- und Abfluges keine Ausweisung im Nahbereich<br />
dieser Quartiere. Die Prüfung erfolgt daher entsprechend dem Kohärenzgedanken der RL 92/43/EWG<br />
unter den Aspekten:<br />
� Beeinträchtigung (Verlust) von Jagdhabitaten,<br />
� Beeinträchtigung von Flugkorridoren zwischen einzelnen Habitaten (z. B. für Fortpflanzung, Ernährung,<br />
Migration, Durchzug, Zuflucht und Überwinterung) durch Kollisionsgefahr.<br />
Um eine Beeinträchtigung von Fledermausjagdgebieten auszuschließen, wurden die im Einzelfall zu prüfenden<br />
Pufferzonen um Wochenstuben und Nahrungsgebiete entsprechend der Tabelle 2 der Begründung der<br />
<strong>Teilfortschreibung</strong> in fachlicher <strong>Abs</strong>timmung mit dem StUFA Bautzen, Abt. Naturschutz und Landschaftspflege<br />
festgelegt. Diese betragen je nach Fledermausart und Größe der Wochenstube (Anzahl der Alttiere) zwischen<br />
1000 m und 6000 m. Durch die Prüfung innerhalb dieses Radius sollen abriegelnde Wirkungen von<br />
WKA zwischen Quartier und Jagdgebiet vermieden werden. Bei der sächsischen FFH-Gebietsmeldung sind<br />
bei den Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie jedoch bereits alle Teilhabitate bei der Meldung berücksichtigt<br />
wurden, die für die Gewährleistung eines günstigen Erhaltungszustandes notwendig sind (Ausnahme<br />
FFH-Gebiet Nr. 147 „Separate Fledermausquartiere in der Oberlausitz“). Bei Fledermäusen betrifft das beispielsweise<br />
Wochenstuben und Jagdgebiete ebenso wie Winterquartiere (vgl. Aussagen zur Auswahl der<br />
Natura 2000-Gebiete in Sachsen unter: http://lfugwww.smul.sachsen.de/de/wu/umwelt/lfug/lfuginternet/index.html).<br />
Daher ist die Frage, ob ein außerhalb des gemeldeten FFH-Gebietes ausgewiesenes<br />
VRG/EG für die Nutzung von Windenergie selbst ein potenzielles Habitat für eine FFH-Art darstellt, außer<br />
bei den Teilgebieten des FFH-Gebietes Nr. 147 „Separate Fledermausquartiere in der Oberlausitz“, nicht im<br />
Rahmen dieser FFH-Prüfung zu beurteilen.<br />
Die Prüfung kann sich daher im wesentlichen auf eine Beeinträchtigung von Flugkorridoren beschränken,<br />
um die in den gebietsspezifischen Erhaltungszielen genannte funktionale Kohärenz innerhalb des Gebietssystems<br />
NATURA 2000 zu gewährleisten. Seit den im Jahr 2002 begonnenen Untersuchungen i. A. des<br />
StUFA Bautzen, Abt. Naturschutz und Landschaftspflege (nachfolgend StUFA Bautzen) hat sich der Kennt-<br />
20 Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
nisstand dazu wesentlich verbessert. Jedoch können abschließende Aussagen zum gegenwärtigen Zeitpunkt<br />
noch nicht getroffen werden. Alle bekannten und seit 2002 neu bekanntgewordenen Flugkorridore,<br />
insbesondere zwischen den Sommer- und Winterquartieren, wurden im Rahmen der Detailprüfung und<br />
Auswahlentscheidung für die ausgewiesenen VRG/EG für die Nutzung von Windenergie in Zus<strong>am</strong>menarbeit<br />
mit dem StUFA Bautzen bewertet (3. Schritt <strong>gemäß</strong> Begründung der <strong>Teilfortschreibung</strong>). Dies führte unter<br />
anderem zur Streichung der Gebiete bei Wetro (Gemeinde Puschwitz, Landkreis Bautzen) sowie Pohla<br />
(Gemeinde Demitz-Thumitz, Landkreis Bautzen). Weiterhin ist jedoch zu berücksichtigen, dass über die<br />
Zugwege, die Orientierung während des Zuges und Zughöhen bisher nur rudimentäre Erkenntnisse existieren<br />
(BACH 2001). Es besteht aber die Möglichkeit, dass bereits durch verschiedene Geländehöhen und unterschiedliche<br />
Höhen der WKA differenzierte Beeinträchtigungen für die wandernden Arten auftreten (mdl.<br />
FÖRSTER, StUFA Bautzen 2003 in Bezug auf die Interpretation der Totfunde beim Windpark Puschwitz sowie<br />
nicht nachgewiesener Totfunde bei zwei WKA bei Crostwitz). Es besteht demnach die Möglichkeit, dass<br />
entsprechende Beeinträchtigungen für wandernde Arten (in Bezug auf die gebietsspezifischen Erhaltungsziele<br />
der FFH-Gebiete) im Rahmen konkreter Genehmigungsverfahren näher untersucht und bewertet werden<br />
können.<br />
Bei folgenden VRG/EG kann durch die Entfernung zu den nächstgelegenen FFH-Gebieten und unter Berücksichtigung<br />
von bekannten Fledermauszugkorridoren (Kohärenzaspekt) sowie der Habitatansprüche der<br />
in den gebietsspezifischen Erhaltungszielen (Stand 01/2003) genannten Arten eine Beeinträchtigung ausgeschlossen<br />
werden.<br />
� EW 4 Leutersdorf Entfernung > 6000 m<br />
� EW 5 Oberseifersdorf Entfernung > 2000 m<br />
� EW 7 Laucha Entfernung ca. 2000 m<br />
� EW 12 Scheibe Entfernung ca. 2000 m<br />
� EW 21 Thonberg Entfernung ca. 2500 m<br />
� EW 26 Leippe Entfernung ca. 2500 m<br />
� EW 29 Tagebau Spreetal Entfernung ca. 3000 m<br />
Für die weiteren VRG/EG wird im Rahmen der Vorprüfung nachfolgend eine Einzelfallprüfung durchgeführt.<br />
� EW 1 Leuba<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 300 m westlich von Teilen des FFH-Gebietes Nr. 93 „Neißegebiet“ (pSCI<br />
4454-302) sowie ca. 350 m östlich und südöstlich des FFH-Gebietes Nr. 114 „Pließnitzgebiet“ (pSCI 4954-<br />
301). Innerhalb des VRG/EG sind zwei WKA bereits seit 12/97 und zwei weitere WKA seit 08/98 in Betrieb.<br />
Weitere vier WKA innerhalb und eine WKA außerhalb des EW 1 sind genehmigt, jedoch noch nicht in Betrieb.<br />
Neben den bereits errichteten sowie genehmigten WKA ist die Errichtung weiterer WKA innerhalb des<br />
VRG/EG nicht möglich.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen für das Pließnitzgebiet sind das Großes Mausohr und die Mopsfledermaus<br />
genannt. Diese Fledermausarten betreffend, ist die Erhaltung und zielgerichtete Entwicklung<br />
einer naturnahen Baumartenzus<strong>am</strong>mensetzung, Alters- und Raumstruktur der verschiedenartigen, miteinander<br />
verzahnten Waldgesellschaften sowie die Erhaltung und Förderung von naturnahen, unzerschnittenen,<br />
alt- und totholzreichen, partiell lichten Wäldern als Jagdhabitat hervorgehoben. Diese Jagdgebiete liegen<br />
vorrangig in den zum FFH-Gebiet gehörenden Bereichen um Berthelsdorf und Herrnhut. Das EW 1 befindet<br />
sich auf einer landwirtschaftlich genutzten Hochfläche außerhalb von bevorzugten Nahrungshabitaten der<br />
Fledermäuse. In den Erhaltungszielen für das FFH-Gebiet „Neißegebiet“ sind keine Fledermausarten explizit<br />
genannt. Eine Versperrung von Zugkorridoren liegt nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht vor.<br />
Eine Vorbelastung des Raumes besteht durch die 380-kV-Leitung Kiesdorf-Nikolausdorf (Mikulowa, Republik<br />
Polen), die gebündelten vier Hochspannungsleitungen nördlich des EW 1 sowie die 110-kV-Leitung Hagenwerder-Hirschfelde.<br />
Bei der Ausweisung des VRG/EG in der Nähe dieser Hochspannungsleitungen spielen<br />
neben landschaftsästhetischen Aspekten auch artenschutzrelevante Belange eine Rolle. Mit der erfolgten<br />
Konzentration von WKA und Hochspannungsleitungen können zusätzliche Barriereeffekte an anderer Stelle<br />
vermieden werden. Eine genehmigte, jedoch noch nicht errichtete WKA befindet sich unmittelbar <strong>am</strong> Rand<br />
des FFH-Gebietes Nr. 93 „Neißegebiet“. Inwieweit Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet zu erwarten sind,<br />
ist nicht bekannt. Durch das ca. 350 m von dieser WKA entfernte EW 1 sind jedoch in Summation keine<br />
zusätzlichen Beeinträchtigungen gegeben.<br />
Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004 21
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
� Eine Beeinträchtigung der FFH-Gebiete „Neißegebiet“ und „Pließnitzgebiet“ in ihren für die<br />
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch das VRG/EG ist somit<br />
nicht zu erwarten.<br />
� EW 2 Bernstadt<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 700 m südlich und 500 m östlich des FFH-Gebietes Nr. 114 „Pließnitzgebiet“<br />
(pSCI 4954-301. Innerhalb des Gebietes wurden im März 2003 nach Aufstellung eines Bebauungsplanes<br />
durch die Stadt Bernstadt a. d. E. sechs WKA errichtet. Die Errichtung weiterer WKA innerhalb des VRG/EG<br />
ist nicht möglich.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen für das Pließnitzgebiet sind das Großes Mausohr und die Mopsfledermaus<br />
genannt. Diese Fledermausarten betreffend, ist die Erhaltung und zielgerichtete Entwicklung<br />
einer naturnahen Baumartenzus<strong>am</strong>mensetzung, Alters- und Raumstruktur der verschiedenartigen, miteinander<br />
verzahnten Waldgesellschaften sowie die Erhaltung und Förderung von naturnahen, unzerschnittenen,<br />
alt- und totholzreichen, partiell lichten Wäldern als Jagdhabitat hervorgehoben. Diese Jagdgebiete liegen<br />
vorrangig in den zum FFH-Gebiet gehörenden Bereichen um Berthelsdorf und Herrnhut (nächstgelegenen<br />
Bereiche, die als Jagdrevier relevant sein können, in ca. 700 m Entfernung). Das EW 1 befindet sich auf<br />
einer landwirtschaftlich genutzten Hochfläche außerhalb von bevorzugten Nahrungshabitaten der Fledermäuse.<br />
Eine Versperrung von Zugkorridoren liegt nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht vor.<br />
Eine Vorbelastung besteht durch die südlich verlaufende 380-kV-Hochspannungsleitung. Auch in Verbindung<br />
mit dieser Vorbelastung sind Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet nicht erkennbar.<br />
� Eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Pließnitzgebiet“ in seinen für die Erhaltungsziele<br />
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch das VRG/EG ist somit nicht zu erwarten.<br />
� EW 6 Dittelsdorf<br />
Das VRG/EG liegt etwa 850 m südlich des FFH-Gebietes Nr. 30 E „Basalt- und Phonolithkuppen der östlichen<br />
Oberlausitz“ (pSCI 4753-303) – Teilgebiet Buchberg. Innerhalb des EW 6 sind seit Mai 2000 fünf WKA<br />
in Betrieb, die Errichtung von zwei zusätzlichen WKA innerhalb des VRG/EG ist möglich.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen für das FFH-Gebiet Nr. 30 E sind das Große Mausohr und die<br />
Bechsteinfledermaus genannt. Diese Fledermausarten betreffend, ist die der Erhaltung und zielgerichteten<br />
Entwicklung einer naturnahen Baumartenzus<strong>am</strong>mensetzung, Alters- und Raumstruktur der verschiedenartigen,<br />
miteinander verzahnten Waldgesellschaften sowie der Erhaltung und Förderung von naturnahen, unzerschnittenen,<br />
alt- und totholzreichen, partiell lichten Wäldern als Jagdhabitat für Fledermäuse hervorgehoben.<br />
Das Waldgebiet um den Buchberg gilt als Fledermauslebensraum für beide in den Erhaltungszielen<br />
genannten Arten. Auch wenn die früher genutzte Wochenstube der Bechsteinfledermaus <strong>am</strong> Buchberg gegenwärtig<br />
nicht mehr besetzt ist (mdl. POIK <strong>am</strong> 26.05.2004), muss in Bezug auf die in den Erhaltungszielen<br />
genannte Bewahrung bzw. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkommenden<br />
Populationen eine Bewertung erfolgen.<br />
Das VRG/EG EW 6 liegt inmitten einer landwirtschaftlich genutzten Fläche (Waldabstand minimal ca. 500<br />
m). Die Bechsteinfledermaus ist eine ausgesprochene Waldart. Daher und auf Grund des relativen geringen<br />
Aktionsradius von meist unter einem Kilometer ist keine Beeinträchtigung von Jagdgebieten dieser Art durch<br />
das EW 6 zu erwarten. Das Große Mausohr jagt ebenso vorwiegend in Wäldern, weist jedoch größere Aktionsdistanzen<br />
auf. Auch hier ist jedoch auf Grund der Lage des EW 6 inmitten einer landwirtschaftlich genutzten<br />
Fläche nicht von einem Verlust von Jagdgebieten durch eine Barrierewirkung auszugehen.<br />
Eine Vorbelastung besteht durch die östlich verlaufende 110-kV-Hochspannungsleitung. Auch in Verbindung<br />
mit dieser Vorbelastung sind Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet nicht erkennbar.<br />
� Eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Basalt- und Phonolithkuppen der östlichen Oberlausitz<br />
– Teilgebiet Buchberg“ in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen<br />
Bestandteilen durch das VRG/EG ist somit nicht zu erwarten.<br />
22 Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
� EW 9 Röhrsdorf<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 600 m südwestlich des FFH-Gebietes Nr. 49 „Königsbrücker Heide“ (pSCI<br />
4648-302) sowie ca. 200 m östlich des FFH-Gebietes Nr. 46 „Molkenbornteiche Stölpchen“ (pSCI 4648-301).<br />
Innerhalb des EW 9 sind bereits vier WKA seit September 1998 bzw. Juli 1999 in Betrieb. Die Errichtung<br />
weiterer WKA innerhalb des VRG/EG ist nicht möglich.<br />
Zu den gebietsspezifischen Erhaltungszielen zählt u. a. die Bewahrung bzw. wenn aktuell nicht gewährleistet,<br />
Entwicklung eines günstigen Erhaltungszustandes der im Gebiet vorkommenden Populationen aller Tier-<br />
und Pflanzenarten von gemeinschaftlichem Interesse <strong>gemäß</strong> Anhang II und IV der Richtlinie 92/43/EWG.<br />
Von den im Anhang II aufgeführten Fledermausarten war für die Meldung des Gebietes „Königsbrücker Heide“<br />
das Große Mausohr relevant. Nachgewiesene Arten des Anhanges IV sind Breitflügelfledermaus, Graues<br />
Langohr, Braunes Langohr, Kleine Bartfledermaus, Großer Abendsegler, Wasserfledermaus, Fransenfledermaus<br />
sowie Rauhautfledermaus (SCHLEGEL 2004). Bezüglich des Verlustes von Jagdgebieten sind auf<br />
Grund der Habitatansprüche mögliche Beeinträchtigungen von Breitflügelfledermaus, Großem Abendsegler<br />
und Rauhautfledermaus relevant, jedoch entsprechend der FFH-Arbeitshilfe des SMUL (<strong>Abs</strong>chnitt 7.2.1) hier<br />
nicht zu prüfen.<br />
Die Habitatansprüche des Großen Mausohrs sind bei der Meldung und Abgrenzung des FFH-Gebietes bereits<br />
berücksichtigt. Ein bekannter Zugkorridor zwischen Teilhabitaten verläuft nicht über bzw. im Einflussbereich<br />
des EW 9.<br />
Im Sinne der Kohärenz zwischen beiden FFH-Gebieten ist vor allem die Größe und Anordnung des VRG/EG<br />
für die Beurteilung der Auswirkungen relevant. Auf Grund der geringen Größe des VRG/EG von ca. 29 ha<br />
und seiner Kompaktheit (Ausdehnung ca. 600 m x 500 m), die die Errichtung von max. 4 WKA zulässt, ist<br />
keine großräumige abriegelnde Wirkung zwischen den Fledermausquartieren und den Jagdgebieten zu erwarten.<br />
Vier WKA sind bereits seit 1998 bzw. 1999 in Betrieb, ohne dass eine Beeinträchtigung der beiden<br />
FFH-Gebiete als Quartier bzw. Jagdgebiet nachgewiesen werden konnte. Die Errichtung weiterer WKA ist<br />
durch die räumliche Begrenzung des EW 9 nicht möglich. D<strong>am</strong>it können zukünftige Beeinträchtigungen unter<br />
diesem Aspekt ausgeschlossen werden.<br />
In der Summationswirkung sind für diese FFH-Gebiete der Grauwackesteinbruch Kreuzberg (zugelassener<br />
Rahmenbetriebsplan vom 25.06.2001), der sich ca. 800 m südlich befindet sowie die sich <strong>gemäß</strong> FNP-<br />
Entwurf der Stadt Königsbrück vom September 2002 direkt nördlich anschließende „Tierpension“ zu prüfen.<br />
Für den Steinbruch Kreuzberg wurde im Rahmen des Betriebsplanverfahrens eine FFH-<br />
Verträglichkeitsprüfung (GEOMONTAN 2000) vorgenommen. Demnach bewirkt dieses Vorhaben weder erhebliche<br />
noch unerhebliche Beeinträchtigungen für die beiden FFH-Gebiete. Zur Tierpension werden im Erläuterungsbericht<br />
des FNP keine konkreteren Angaben gemacht. Da jedoch eine ehemals militärisch genutzte<br />
Lagerfläche außerhalb der FFH-Gebiete überplant wird, kann grundsätzlich davon ausgegangen werden,<br />
dass keine Beeinträchtigungen entstehen. Auch in Summation mit diesen beiden Vorhaben sind keine Beeinträchtigungen<br />
durch das VRG/EG erkennbar.<br />
� Eine Beeinträchtigung der FFH-Gebiete „Königsbrücker Heide“ und „Molkenbornteiche Stölpchen“<br />
in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen<br />
durch das VRG/EG ist somit nicht zu erwarten.<br />
� EW 10 Wachau<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 200 m westlich des FFH-Gebietes Nr. 142 „Fließgewässersystem Kleine Röder<br />
und Orla“ (pSCI 4749-302) sowie ca. 1850 m nordöstlich des FFH-Gebietes Nr. 143 „Rödertal oberhalb<br />
Medingen“ (pSCI 4848-301). Im EW 10 sind seit Juni 2000 drei WKA in Betrieb. Zwei weitere WKA außerhalb<br />
des VRG/EG bestehen seit April 1995. Innerhalb des EW 10 ist die Errichtung von zwei weiteren WKA<br />
möglich.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen des Gebietes „Rödertal oberhalb Medingen“ wird das Große<br />
Mausohr genannt. Auf Grund der großen Entfernung zu den Teilbereichen dieses FFH-Gebietes und der<br />
Lage auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Auch in<br />
Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004 23
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
Summation mit den beiden bestehenden WKA außerhalb des EW 10, die mehr als 1500 m vom FFH-Gebiet<br />
entfernt liegen, sind Beeinträchtigungen unwahrscheinlich. Gleiches gilt für die ca. 200 m nördlich verlaufende<br />
BAB 4 als lineares Element.<br />
� Eine Beeinträchtigung der FFH-Gebiete „Fließgewässersystem Kleine Röder und Orla“ sowie<br />
„Rödertal oberhalb Medingen“ in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen<br />
Bestandteilen durch das VRG/EG ist somit nicht zu erwarten.<br />
� EW 13 Zerre<br />
Das VRG/EG liegt unmittelbar östlich des FFH-Gebietes Nr. 99 „Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und<br />
Spremberg“ (pSCI 4452-301). Das VRG/EG befindet sich dabei auf der Hochkippe Zerre (anthropogen geschaffene<br />
und rekultivierte Aschekippe), die durch ein ca. 10-15 m hohes Böschungssystem vom Spreetal<br />
als Teil des FFH-Gebietes getrennt wird. Im EW 13 sind seit August 2002 fünf WKA in Betrieb. Die Planungen<br />
für die Errichtung weiterer drei WKA sind abgeschlossen.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen werden keine Fledermausarten explizit benannt bzw. die Bewahrung<br />
und Entwicklung ausgewählter Lebensräume für Fledermäuse nicht hervorgehoben.<br />
� Eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Spreetal und Heiden zwischen Uhyst und Spremberg“<br />
in seinen für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen<br />
durch das VRG/EG ist somit nicht zu erwarten.<br />
� EW 15 Reichenbach<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 400 m nordwestlich des FFH-Gebietes Nr. 106 „Schwarzer Schöps oberhalb<br />
Horscha“ (pSCI 4654-302). Innerhalb des EW 15 sind zwei WKA seit September 1996 und fünf WKA seit<br />
Dezember 1999 in Betrieb. Die ausgewiesene Fläche bietet die theoretische Möglichkeit zur Errichtung einer<br />
weiteren WKA.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen wird die Mopsfledermaus sowie die Erhaltung und Förderung<br />
von naturnahen, unzerschnittenen, alt- und totholzreichen, partiell lichten Wäldern mit einem hohen Angebot<br />
an Baumhöhlen und natürlichen Spaltenquartieren (z. B. abstehende Rinde) als primärer Sommerlebensraum<br />
und Jagdhabitat für Fledermäuse genannt. Da die Mopsfledermaus strukturgebunden jagt und sich das<br />
EW 15 auf landwirtschaftlichen Nutzflächen befindet, sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten.<br />
Geplant ist der Neubau einer Staatsstraße (S 70) als gleichzeitige Ortsumgehung für die Stadt Reichenbach/O.<br />
L.. Die geplante Trasse verläuft zwischen einzelnen Teilen des EW 15 und quert in einer Entfernung<br />
von ca. 500 m vom EW 15 das FFH-Gebiet. Eine Summationswirkung für die Erhaltungsziele des FFH-<br />
Gebietes ist auf Grund der linearen Struktur der geplanten Straße nicht erkennbar.<br />
� Eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Schwarzer Schöps oberhalb Horscha“ in seinen für<br />
die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch das VRG/EG ist<br />
nicht zu erwarten.<br />
� EW 16 Charlottenhof<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 1100 m nordöstlich des FFH-Gebietes Nr. 111 „Fließgewässer bei Schöpstal<br />
und Kodersdorf“ (pSCI 4755-302) sowie etwa 1250 m westlich des FFH-Gebietes Nr. 93 „Neißegebiet“ (pSCI<br />
4454-302). Innerhalb des EW 16 sind vier WKA seit Februar 2000 und fünf WKA seit April 2004 in Betrieb.<br />
Weitere neun WKA bestehen außerhalb des ausgewiesenen VRG/EG. Innerhalb des EW 16 können maximal<br />
weitere 4 WKA errichtet werden.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Fließgewässer bei Schöpstal und Kodersdorf“<br />
wird das Große Mausohr sowie die Erhaltung und Förderung von naturnahen, unzerschnittenen, alt-<br />
<strong>24</strong> Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
und totholzreichen, partiell lichten Wäldern als Jagdhabitat für Fledermäuse genannt. Durch die große Entfernung<br />
des FFH-Gebietes zum EW 16 sind diesbezüglich keine Beeinträchtigungen zu erwarten.<br />
Im Rahmen der in den Jahren 2002 und 2003 im Auftrag des StUFA Bautzen durchgeführten Untersuchungen<br />
(Stichprobe STUFA 2002 sowie ENDL 2003) wurden im zentralen Teil des zu diesem Zeitpunkt noch erheblich<br />
größeren VRG/EG zahlreiche Totfunde mehrerer Fledermausarten erfasst. Die Totfunde waren auf<br />
die waldnahen und strukturreichen Bereiche beschränkt. Die Erfassung erfolgte während der Zugzeiten der<br />
wandernden Arten und deutet somit auf eine größere Bedeutung des zentralen Teiles als Zugkorridor für<br />
wandernde Fledermausarten (z. B. Großer Abendsegler, Rauhautfledermaus) hin. Aus diesem Grund wurde<br />
der zentrale Teil einschließlich eines <strong>Abs</strong>tandes von 200 m zum Wald von der regionalplanerischen Ausweisung<br />
ausgenommen. Die verbliebenen nunmehr zwei Teile des EW 16 sind auf unstrukturierte landwirtschaftliche<br />
Nutzflächen beschränkt. Ob dieser Aspekt im Sinne der FFH-Richtlinie (Kohärenz) zu betrachten<br />
ist, kann hier dahingestellt bleiben, da der betreffende Teil von der Ausweisung als VRG/EG ausgenommen<br />
wurde. Durch die jetzt erfolgte Abgrenzung des EW 16 ist eine Beeinträchtigung nicht zu erwarten.<br />
Als Summationseffekte für die o. g. FFH-Gebiete sind die südlich angrenzende BAB 4, die östlich verlaufende<br />
Bahnlinie Görlitz–Cottbus, die ca. 800 m nordwestlich betriebene Abfalldeponie Kunnersdorf sowie die in<br />
der Planung befindliche Staatsstraße S 127 für den <strong>Abs</strong>chnitt B 115 Kunnersdorf–Deschka zu betrachten.<br />
Auf Grund der großen Entfernungen sind jedoch auch in Verbindung mit diesen Vorbelastungen bzw. Planungen<br />
keine Beeinträchtigungen zu erwarten.<br />
� Eine Beeinträchtigung der FFH-Gebiete „Fließgewässer bei Schöpstal und Kodersdorf“ sowie<br />
„Neißegebiet“ in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen<br />
durch das VRG/EG ist nicht zu erwarten.<br />
� EW 17 Kleinröhrsdorf<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 1300 m nordöstlich des FFH-Gebietes Nr. 143 „Rödertal oberhalb Medingen“<br />
(pSCI 4848-301). Innerhalb des EW 17 sind seit Dezember 1998 drei WKA in Betrieb. Die Errichtung weiterer<br />
WKA im EW 17 ist nicht möglich.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen des FFH-Gebietes wird das Große Mausohr sowie die Erhaltung<br />
und Förderung von naturnahen, unzerschnittenen, alt- und totholzreichen, partiell lichten<br />
Wäldern als Jagdhabitat für Fledermäuse genannt. Durch die große Entfernung des FFH-Gebietes zum<br />
EW 17 sind diesbezüglich keine Beeinträchtigungen zu erwarten.<br />
� Eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Rödertal oberhalb Medingen“ in seinen für die Erhaltungsziele<br />
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch das VRG/EG ist nicht zu<br />
erwarten.<br />
� EW 18 Sohland a. R.<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 250 m westlich des FFH-Gebietes Nr. 30 E „Basalt- und Phonolithkuppen der<br />
östlichen Oberlausitz“ (pSCI 4753-303) – Teilgebiet Spitzberg sowie ca. 2500 m südöstlich des FFH-<br />
Gebietes Nr. 147 „Separate Fledermausquartiere und -habitate in der Lausitz“ (pSCI 4551-303) – Teilgebiet<br />
Sohland/Rotstein (Turmkuppel der Evang. Kirche). Innerhalb des EW 18 sind seit September/Oktober 2001<br />
fünf WKA, seit April 2002 eine weitere WKA in Betrieb. Außerhalb des EW 18 besteht eine WKA seit 1992.<br />
Die Errichtung weiterer drei WKA innerhalb des VRG/EG ist möglich.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen des FFH-Gebietes Nr. 30 E werden die Bechsteinfledermaus<br />
und das Großes Mausohr sowie die Erhaltung und Förderung von naturnahen, unzerschnittenen, alt- und<br />
totholzreichen, partiell lichten Wäldern als Jagdhabitat für Fledermäuse genannt. Für den Spitzberg als<br />
betreffenden Teil des FFH-Gebietes sind keine Quartiere der beiden Fledermausarten bekannt. Das EW 18<br />
wurde in einem <strong>Abs</strong>tand von ca. 250 m zum bewaldeten Spitzberg ausgewiesen. D<strong>am</strong>it kann eine Beeinträchtigung<br />
dieses potenziellen Jagdgebietes für Fledermäuse ausgeschlossen werden. Der derzeit bekannte<br />
Fledermauszugkorridor Löbau/Sohland a. R.–Herrnhut–Zittau/Hainewalde liegt ca. 1 bis 1,5 km weiter<br />
westlich, so dass auch hier nach gegenwärtigem Kenntnisstand keine Beeinträchtigungen zu erwarten.<br />
Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004 25
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
In der Evangelischen Kirche in Sohland a. R. befindet sich eine Wochenstube des Großen Mausohrs in einer<br />
Größenordnung von gegenwärtig unter 50 Alttieren (mdl. POIK <strong>am</strong> 01.06.2004) . Gemäß Tabelle 2 der Begründung<br />
der <strong>Teilfortschreibung</strong> beträgt der Prüfradius für diese Größenordnung 2000 m. D<strong>am</strong>it liegt das<br />
VRG/EG EW 18 außerhalb des <strong>gemäß</strong> Tabelle 2 der Planbegründung festegelegten Prüfradius. Zu den Erhaltungszielen<br />
des FFH-Gebietes „Separate Fledermausquartiere und -habitate in der Lausitz“ zählt die Erhaltung<br />
bzw. Förderung unzerschnittener Flugkorridore zwischen den einzelnen Habitaten entsprechend des<br />
Kohärenzgedankens der RL 92/43/EWG. Daher sind Beeinträchtigungen in Bezug auf diese Flugkorridore<br />
zu prüfen. Eine Versperrung von Flugkorridoren zu den Jagdgebieten, die sich vorwiegend in den Wäldern<br />
<strong>am</strong> Rotstein befinden, kann durch die Lage des EW 18 i. V. m. der Entfernung von der Wochenstube ausgeschlossen<br />
werden. Zum großräumigen Flugkorridor zwischen Löbau/Sohland a. R.–Herrnhut–<br />
Zittau/Hainewalde gelten die o. g. Aussagen.<br />
Im ihrer Summationswirkung mit dem EW 18 ist als Vorbelastung die vorhandene WKA unmittelbar westlich<br />
des VRG/EG zu betrachten. Jedoch ist auch hier sowohl einzeln als in der Summation keine Beeinträchtigung<br />
für die beiden FFH-Gebiete zu erwarten.<br />
� Eine Beeinträchtigung der FFH-Gebiete „Basalt- und Phonolithkuppen der östlichen Oberlausitz“–<br />
Teilgebiet Spitzberg sowie „Separate Fledermausquartiere und -habitate in der Lausitz“ –<br />
Teilgebiet Sohland/Rotstein (Turmkuppel der Evang. Kirche) in ihren für die Erhaltungsziele<br />
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch das VRG/EG ist nicht zu erwarten.<br />
� EW 20 Deschka<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 900 m westlich des FFH-Gebietes Nr. 93 „Neißegebiet“ (pSCI 4454-302).<br />
Innerhalb des EW 20 sind seit Mai 2003 sechs WKA in Betrieb. Zwei weitere Anlagen bestehen außerhalb,<br />
jedoch direkt östlich des EW 20 ebenfalls seit Mai 2003. Innerhalb des VRG/EG können drei weitere WKA<br />
errichtet werden.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen des FFH-Gebietes werden keine Fledermausarten explizit benannt<br />
bzw. die Bewahrung bzw. Entwicklung ausgewählter Lebensräume für Fledermäuse nicht hervorgehoben.<br />
� Eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Neißegebiet“ in seinen für die Erhaltungsziele oder<br />
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch das VRG/EG ist nicht zu erwarten.<br />
� EW 22 Melaune<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 750 m westlich des FFH-Gebietes Nr. 106 „Schwarzer Schöps oberhalb Horscha“<br />
(pSCI 4654-302) sowie etwa 650 m südöstlich des FFH-Gebietes Nr. 116 „Täler um Weißenberg“<br />
(pSCI 4753-302). Innerhalb des EW 22 sind zwei WKA seit Dezember 1999, eine WKA seit März 2000,<br />
zwei Anlagen seit August 2000 und je eine WKA seit Juli bzw. August 2001 in Betrieb. Innerhalb des<br />
VRG/EG können zwei weitere WKA errichtet werden.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen der FFH-Gebiete werden die Mopsfledermaus (Nr. 106) sowie<br />
das Große Mausohr (Nr. 116) explizit benannt. Weiterhin wird die Erhaltung und Förderung von naturnahen,<br />
unzerschnittenen, alt- und totholzreichen, partiell lichten Wäldern mit einem hohen Angebot an Baumhöhlen<br />
und natürlichen Spaltenquartieren (z. B. abstehende Rinde) als primärer Sommerlebensraum und Jagdhabitat<br />
für Fledermäuse, insbesondere für Mopsfledermaus und Großes Mausohr aufgeführt. Durch die Lage des<br />
VRG/EW auf einer landwirtschaftlich genutzten Fläche in einer bereits größeren Entfernung zum FFH-Gebiet<br />
ist davon auszugehen, dass keine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes und der genannten Arten erfolgt.<br />
Westlich des VRG/EG befindet sich die im Abbau befindliche Tonlagerstätte Buchholz. Für den Tagebau<br />
liegt ein Planfeststellungsbeschluss des Sächsischen Oberberg<strong>am</strong>tes vom 22.08.2000 vor. Im Beschluss ist<br />
die Vorprüfung für die FFH-Verträglichkeit für dieses Vorhaben integriert, welche zu dem Ergebnis kommt,<br />
dass sich i. V. m. den entsprechenden Nebenbestimmungen im Planfeststellungsbeschluss keine Gefährdungen<br />
oder erheblichen Beeinträchtigungen durch den Tontagebau ergeben. Auch in Summation mit diesem<br />
Tagebau sind durch das EW 22 keine Beeinträchtigungen zu erwarten.<br />
26 Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
� Eine Beeinträchtigung der FFH-Gebiete „Schwarzer Schöps oberhalb Horscha“ sowie „Täler<br />
um Weißenberg“ in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen<br />
durch das VRG/EG ist nicht zu erwarten.<br />
� EW 25 Bernsdorf<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 150 m nördlich des FFH-Gebietes Nr. 135 „Otterschütz“ (pSCI 4650-301).<br />
Innerhalb des EW 25 sind drei WKA seit September 2001 in Betrieb. Die Errichtung weiterer WKA innerhalb<br />
des VRG/EG ist nicht möglich.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen des FFH-Gebietes werden keine Fledermausarten explizit benannt<br />
bzw. die Bewahrung und Entwicklung ausgewählter Lebensräume für Fledermäuse nicht hervorgehoben.<br />
Hinsichtlich der Summationswirkung ist die geplante Ortsumgehung von Bernsdorf im Zuge der Staatsstraße<br />
S 94 zu betrachten. Für diesen Bauabschnitt der S 94 wird die Vorplanung gegenwärtig durch das SMWA<br />
geprüft. Die im Rahmen der Vorplanung für die favorisierte Trassenvariante (Variante 1 A) durchgeführte<br />
Verträglichkeitsprüfung k<strong>am</strong> zu dem Ergebnis, dass eine Verträglichkeit mit den gebietsspezifischen Erhaltungszielen<br />
des FFH-Gebietes „Otterschütz“ erreicht werden kann. In Summation mit dieser Straßenplanung<br />
sind auch durch das VRG/EG EW 25 keine Beeinträchtigungen für die gebietsspezifischen Erhaltungsziele<br />
zu erwarten, da eine räumliche Trennung zwischen FFH-Gebiet und dem VRG/EG in diesem Fall ausreichend<br />
ist.<br />
� Eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Otterschütz“ in seinen für die Erhaltungsziele oder<br />
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch das VRG/EG ist nicht zu erwarten.<br />
� EW 30 Tagebau Reichwalde<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 750 m südlich des FFH-Gebietes Nr. 90 E „Truppenübungsplatz Oberlausitz“<br />
(pSCI 4552-301). Bisher sind noch keine WKA innerhalb des EW 30 und seiner Umgebung errichtet. Innerhalb<br />
des VRG/EG können bis zu sechs WKA errichtet werden.<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen des FFH-Gebietes werden keine Fledermausarten explizit benannt<br />
bzw. die Bewahrung und Entwicklung ausgewählter Lebensräume für Fledermäuse nicht hervorgehoben.<br />
In der Umgebung des VRG/EG EW 30 ist der gegenwärtig gestundete Braunkohlentagebau Reichwalde<br />
hinsichtlich der Summationswirkungen zu prüfen. Für diesen Tagebau liegt ein 1994, also vor Ablauf der in<br />
der FFH-Richtlinie vorgesehenen Umsetzungspflicht(en), für verbindlich erklärter Braunkohlenplan vor. Der<br />
Abbaubetrieb soll voraussichtlich mittelfristig wieder anlaufen. Der Abbaubereich des Tagebaus ist nicht<br />
Bestandteil der FFH-Gebietsmeldung. Unabhängig von möglichen Beeinträchtigungen für das FFH-Gebiet<br />
„Truppenübungsplatz Oberlausitz“ durch den Braunkohlenabbau sind auch durch das VRG/EG EW 30 hinsichtlich<br />
von Summationswirkungen keine Beeinträchtigungen zu erwarten.<br />
� Eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Truppenübungsplatz Oberlausitz“ in seinen für die<br />
Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch das VRG/EG ist<br />
nicht zu erwarten.<br />
� EW 31 Burkau/Marienberg<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 1300 m südlich des FFH-Gebietes Nr. 134 „Klosterwasserniederung“ (pSCI<br />
4651-302). Innerhalb des EW 31 sind zwei WKA seit August bzw. September 2003 in Betrieb. Innerhalb des<br />
EW 31 kann eine weitere WKA errichtet werden.<br />
Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004 27
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen des FFH-Gebietes werden keine Fledermausarten explizit benannt<br />
bzw. die Bewahrung und Entwicklung ausgewählter Lebensräume für Fledermäuse nicht hervorgehoben.<br />
� Eine Beeinträchtigung des FFH-Gebietes „Klosterwasserniederung“ in seinen für die Erhaltungsziele<br />
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch das VRG/EG ist nicht zu<br />
erwarten.<br />
� EW 33 Schmiedefeld<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 1300 m westlich des FFH-Gebietes Nr. 162 „Wesenitz unterhalb Buschmühle“<br />
(pSCI 4949-302) sowie in etwa gleicher Entfernung zum FFH Gebiet Nr. 145 „Obere Wesenitz und Nebenflüsse“<br />
(pSCI 4850-301). Innerhalb des VRG/EG sind bisher keine WKA errichtet. Das EW 33 wurde in<br />
direktem räumlichen Zus<strong>am</strong>menhang mit dem im Regionalplan der Region Oberes Elbtal/Osterzgebirge<br />
ausgewiesenen Vorranggebiet Nr. 7 „Rennersdorf West – Sandberg“ ausgewiesen, in dem bereits seit Januar<br />
2002 vier WKA in Betrieb sind. Die Verträglichkeit dieser Ausweisung mit dem FFH-Gebiet „Obere Wesenitz<br />
und Nebenflüsse“ wurde durch den Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge nachgewiesen<br />
(Schreiben des RPV Oberes Elbtal/Osterzgebirge an das SMI vom 15.05.2002 Az.:<br />
tfwind_3melde_smi.doc).<br />
In den gebietsspezifischen Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Obere Wesenitz und Nebenflüsse“ wird das<br />
Große Mausohr explizit benannt; in den gebietsspezifischen Erhaltungszielen für das FFH-Gebiet „Wesenitz<br />
unterhalb Buschmühle“ werden dagegen keine Fledermausarten explizit benannt bzw. die Bewahrung und<br />
Entwicklung ausgewählter Lebensräume für Fledermäuse nicht hervorgehoben. Unter Bezugnahme auf die<br />
durchgeführte Verträglichkeitsprüfung durch den Regionalen Planungsverband Oberes Elbtal/Osterzgebirge<br />
kann eingeschätzt werden, dass durch die verhältnismäßig geringfügige Erweiterung des in der Nachbarregion<br />
ausgewiesenen Vorranggebietes für die Nutzung von Windenergie sowie der relativ großen Entfernung<br />
zu den FFH-Gebieten auch in Summation beider VRG/EG keine Beeinträchtigung zu erwarten ist.<br />
Die bestehenden vier WKA bei Rennersdorf haben bisher zu keinen Tötungen von Fledermäusen geführt<br />
(StUFA Bautzen 2004).<br />
� Eine Beeinträchtigung der FFH-Gebiete „Wesenitz unterhalb Buschmühle“ und „Obere Wesenitz<br />
und Nebenflüsse“ in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen<br />
Bestandteilen durch das VRG/EG ist nicht zu erwarten.<br />
2.3 Fazit<br />
Eine Beeinträchtigung von FFH-Gebieten in ihren für die Erhaltungsziele oder den Schutzzweck maßgeblichen<br />
Bestandteilen durch die im Rahmen der <strong>Teilfortschreibung</strong> ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebiete<br />
für die Nutzung von Windenergie ist nicht zu erwarten.<br />
3. Vorprüfung/Erheblichkeitsabschätzung SPA-Gebiete<br />
Als relevante Gebiete kommen im Hinblick auf die Beeinträchtigungen von Vögeln in erster Linie die bestehenden<br />
Europäischen Vogelschutzgebiete (SPA) in Betracht. Für die Planungsregion Oberlausitz-<br />
Niederschlesien sind dementsprechend mögliche Beeinträchtigungen für die im Bundesanzeiger vom 11.<br />
Juni 2003 bekanntgemachten Europäischen Vogelschutzgebiete <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 10 <strong>Abs</strong>. 6 BNatSchG zu ermitteln.<br />
In dieser Bekanntmachung ist das „Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet“ (SPA-Nr. 4550-401) in einer Ges<strong>am</strong>tgröße<br />
von ca. 38.956 ha mit seinen insges<strong>am</strong>t siebzehn betroffenen Schutzgebieten enthalten.<br />
Zu den bekanntgemachten SPA-Gebieten existieren sogenannte „faktische“ Vogelschutzgebiete (IBA – Important<br />
Bird Area) . Diese sind in den IBA-Listen enthalten (SUDFELDT, C. ET AL. 2002). Die digitalen Daten<br />
zur räumlichen Abgrenzung der IBA-Gebiete wurden dem Regionalen Planungsverband freundlicherweise<br />
vom Naturschutzinstitut / AG Region Leipzig zur Verfügung gestellt. Die IBA-Gebiete werden im Rahmen<br />
dieser Prüfung mit behandelt, wobei jedoch berücksichtigt wird, dass die Grenzen eines IBA-Gebietes nicht<br />
automatisch als die eines „faktischen“ Vogelschutzgebietes angesehen werden. Daher bleibt die räumliche<br />
28 Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
Abgrenzung eines faktischen Vogelschutzgebietes einer genauen Betrachtung des Einzelfalls vorbehalten<br />
(WEIHRICH 2001, EUGH, Urteil vom 18.03.1999 „Seine-Mündung“, OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom<br />
28.05.2003 - 8 A 10481/02.OVG). Für diese Einzelfallbetrachtung wurden hier auch vorliegende Untersuchungen<br />
und Gutachten genutzt.<br />
Bekanntgemachte SPA-Gebiete wurden als Tabubereich für die Ausweisung von VRG/EG für die Nutzung<br />
von Windenergie definiert (vgl. <strong>Abs</strong>chnitt 2.2 der Planbegründung). IBA-Gebiete unterlagen hinsichtlich ihrer<br />
Abgrenzung sowie der Beurteilung von möglichen Beeinträchtigungen der Einzelfallprüfung.<br />
3.1 Prüfung der ausgewiesenen Vorrang- und Eignungsgebiete für die Nutzung von Windenergie<br />
hinsichtlich möglicher Beeinträchtigungen von Europäischen Vogelschutzgebieten und IBA-<br />
Gebieten<br />
Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele der SPA-Gebiete können auch durch außerhalb der Gebiete ausgewiesene<br />
VRG/EG für die Nutzung von Windenergie auftreten. Die Beeinträchtigungen ergeben sich aus<br />
der Analyse der von der Planung ausgehenden Wirkfaktoren und den gebietsspezifischen Empfindlichkeiten<br />
der betroffenen Arten und Lebensräume im Gebiet. Bei Windkraftanlagen spielen insbesondere Störungswirkungen<br />
durch die Anlagen, die zur Entwertung von Brut-, Nahrungs- und Rasthabitaten führen können,<br />
eine wesentliche Rolle (WEIHRICH 2001). Diese Entwertung kann durch eine Inanspruchnahme der Habitate<br />
selbst, aber auch durch die Versperrung von bedeutenden Flugkorridoren zwischen einzelnen Habitaten<br />
auftreten.<br />
Bei folgenden VRG/EG kann auf Grund der großen Entfernung von mehr als 5000 m zu Europäischen Vogelschutzgebieten<br />
bzw. IBA-Gebieten und der Lage außerhalb der regional bedeuts<strong>am</strong>en Vogelzugachsen<br />
davon ausgegangen werden, dass (a) keine erhebliche Beeinträchtigung der für die Erhaltungsziele oder<br />
den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteile, (b) der für die IBA-Einstufung relevanten Kriterien sowie (c)<br />
unter Kohärenzaspekten zu erwarten ist. Bei dieser <strong>Abs</strong>chätzung werden die in Tabelle 2 der Planbegründung<br />
festgelegten Prüfradien für bestimmte Vogelarten bereits berücksichtigt:<br />
EW 1 Leuba<br />
EW 2 Bernstadt<br />
EW 4 Leutersdorf<br />
EW 10 Wachau<br />
EW 12 Scheibe<br />
EW 13 Zerre<br />
EW 15 Reichenbach<br />
EW 16 Charlottenhof<br />
EW 17 Kleinröhrsdorf<br />
EW 18 Sohland a. R.<br />
EW 20 Deschka<br />
EW 21 Thonberg<br />
EW 26 Leippe<br />
EW 31 Burkau<br />
EW 33 Schmiedefeld.<br />
Für die weiteren VRG/EG wird im Rahmen der Vorprüfung nachfolgend eine Einzelfallprüfung durchgeführt.<br />
� EW 5 Oberseifersdorf / EW 6 Dittelsdorf<br />
Die Entfernung zum IBA-Gebiet „Königsholz bei Niederoderwitz“ (IBA Nr. SN037) beträgt ca. 3500 bzw.<br />
4500 m. Relevante Arten für die Aufnahme in die IBA-Liste sind der Schwarzstorch und der Uhu.<br />
� Auf Grund der Lage beiden VRG/EG außerhalb des Prüfradius <strong>gemäß</strong> Tabelle 2 der Planbegründung<br />
und auf landwirtschaftlich genutzten Flächen (Ackerland ohne wesentlichen Grünlandanteil),<br />
die nicht den Habitatansprüchen der beiden Arten entsprechen, ist eine Beeinträchtigung<br />
für das IBA-Gebiet „Königsholz bei Niederoderwitz“ nicht zu erwarten.<br />
Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004 29
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
� EW 7 Laucha<br />
Die Entfernung zum IBA-Gebiet „Oberlausitzer Gefilde bei Weißenberg“ (IBA Nr. SN032) beträgt ca. 800 m.<br />
Die Bedeutung des Gebietes liegt vorrangig in der Funktion als überregional bedeuts<strong>am</strong>es Rast- und Nahrungsgebiet<br />
für schwarm- oder koloniebildende Wasservogelarten im Offenland (speziell Wildgänse) sowie<br />
als Brutgebiet des Ortolans. Bezüglich der Funktion als Rast- und Nahrungsgebiet sind die Flugkorridore zu<br />
betrachten, die von den Wildgänsen von ihren Rast- und Schlafplätzen (Biosphärenreservat Oberlausitzer<br />
Heide- und Teichlandschaft, Talsperre Quitzdorf und Talsperre Bautzen als SPA-Gebiete) für die tägliche<br />
Nahrungssuche vorrangig genutzt werden. Wesentliche Grundlage dafür bilden die in der Karte „Regionale<br />
Grünzüge sowie regional bedeuts<strong>am</strong>e Vogelzugachsen und Vogelzugrastgebiete“ des Regionalplanes 2002<br />
dargestellten regional bedeuts<strong>am</strong>en Vogelzugkorridore zwischen Rast-, S<strong>am</strong>mel- und Nahrungsplätzen.<br />
Eine dieser Zugkorridore verläuft etwa 1000 m östlich des EW 7 entlang des Löbauer Wassers in Richtung<br />
Oelsa/Löbau. Dieser <strong>Abs</strong>tand genügt grundsätzlich, um eine Beeinträchtigung zu vermeiden (vgl. Tabelle 1<br />
der Begründung der <strong>Teilfortschreibung</strong>). In Bezug auf die bereits seit 1995 in Betrieb befindliche WKA ca.<br />
200 m südlich des EW 7 liegen dem StUFA Bautzen keine Unterlagen oder Beobachtungen vor, aus der sich<br />
ein geändertes Flugverhalten entlang des Zugkorridors ergibt. Der <strong>Abs</strong>tand zum Nahrungsgebiet selbst von<br />
ca. 800 m liegt außerhalb des Restriktionsbereiches für regional bedeuts<strong>am</strong>e Vogelzugrastgebiete im Offenland,<br />
für den ein besonderes Prüfungserfordernis besteht (vgl. Tabelle 1 der Begründung der <strong>Teilfortschreibung</strong>).<br />
Nach KRUKENBERG und JAENE (1999) ist für einen untersuchten Windpark ab der <strong>Abs</strong>tandskategorie<br />
von 600 m die Gänseverteilung vom Windpark nicht mehr beeinflusst.<br />
Für den Ortolan gilt <strong>gemäß</strong> Tabelle 2 der <strong>Teilfortschreibung</strong> ein Prüfradius von 1000 m um den Brutplatz. Die<br />
Brutplätze innerhalb des IBA-Gebietes befinden sich in größeren Entfernungen zum EW 7 (STUFA BAUTZEN,<br />
Brutvogelstandortkartierung), so dass keine Beeinträchtigungen für den Lebensraum dieser Art zu erwarten<br />
sind.<br />
� Für das IBA-Gebiet „Oberlausitzer Gefilde bei Weißenberg“ sind nach Einzelfallprüfung keine<br />
Beeinträchtigungen durch das VRG/EG EW 7 zu erwarten.<br />
� EW 9 Röhrsdorf<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 500 m südwestlich des SPA-Gebietes „Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet“<br />
(SPA-Nr. 4550-401), Teilgebiet NSG „Königsbrücker Heide“ sowie ca. 4800 m nordöstlich des Teilgebietes<br />
NSG „Zschornaer Teichgebiet“. Die IBA-Gebietsabgrenzung für die „Teiche bei Zschorna“ geht über die<br />
Abgrenzung des bekanntgemachten SPA-Gebietes hinaus, verkleinert jedoch nicht den <strong>Abs</strong>tand zum EW 9.<br />
Innerhalb des VRG/EG sind seit mehreren Jahren vier WKA in Betrieb. Seit der Inbetriebnahme liegen zahlreiche<br />
Beobachtungen über den Einfluss der WKA auf die Avifauna vor (zus<strong>am</strong>menfassend SCHLEGEL 2004).<br />
Die Errichtung von mehr als der bereits bestehenden vier WKA innerhalb des VRG/EG ist nicht möglich.<br />
Sofern ein Repowering mit größeren Anlagen angestrebt wird, sind dadurch mögliche Beeinträchtigungen<br />
projektbezogen einer Verträglichkeitsprüfung zu unterziehen.<br />
Die Beobachtungen der letzten Jahre (SCHLEGEL 2004) zeigen keine relevanten Veränderungen bei den<br />
Brutvögeln nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie innerhalb des SPA-Gebietes „Königsbrücker Heide“.<br />
Daher ist davon auszugehen, dass unmittelbare Störwirkungen auf Brutvögel (Erhaltungsziel (1) für das<br />
SPA-Gebiet) nicht bestehen. Die Fläche des EW 9 hat keine überragende Bedeutung als Nahrungsgebiet für<br />
Vogelarten nach Anhang I der Vogelschutzrichtlinie, die im SPA-Gebiet vorkommen. Nach SCHLEGEL (2004)<br />
sind zwar Einschränkungen des Nahrungsreviers z. B. für Kraniche beobachtet worden. Diese Einschränkungen<br />
werden hier jedoch nicht als erheblich bewertet, da die Kraniche auf gleichermaßen geeignete benachbarte<br />
Flächen ausweichen können.<br />
Eine erhebliche Beeinträchtigung für die Erhaltung der Funktion des SPA-Gebietes als Nahrungs-, Rast- und<br />
Durchzugsgebiet für die im Anhang I der Vogelschutzrichtlinie genannten Arten (Erhaltungsziel (2) für das<br />
SPA-Gebiet) kann ebenfalls nicht abgeleitet werden. Das Flugverhalten der Vögel hat sich zwar geändert,<br />
indem „der Einflug in die Königsbrücker Heide entweder nördlich oder südlich der vier WKA erfolgt“<br />
(SCHLEGEL 2004). Es stehen jedoch Ausweichkorridore in unmittelbarer Umgebung zur Verfügung, welche<br />
auch genutzt werden bzw. die WKA werden überflogen. Über das EW 9 verläuft kein regional bedeuts<strong>am</strong>er<br />
Vogelzugkorridor (vgl. „Karte „Regionale Grünzüge sowie regional bedeuts<strong>am</strong>e Vogelzugachsen und Vogelzugrastgebiete“<br />
des Regionalplanes 2002). Diese Darstellung im Regionalplan ist nicht abschließend, im<br />
30 Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
Rahmen des Anhörungsverfahrens für die <strong>Teilfortschreibung</strong> wurde dem Regionalen Planungsverband von<br />
den Naturschutzbehörden bzw. -verbänden eine derartige Funktion auch nicht mitgeteilt.<br />
Direkte Auswirkungen auf das SPA-Gebiet „Zschornaer Teichgebiet“ können auf Grund der Entfernung ausgeschlossen<br />
werden. Durch die o. g. Aussagen zu Vogelzugkorridoren kann auch davon ausgegangen werden,<br />
dass im Sinne der Kohärenz des „Natura 2000-Netzes“ keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten<br />
sind.<br />
Ergänzend wird auf <strong>Abs</strong>chnitt 12 der FFH-Arbeitshilfe (SMUL 2003) verwiesen, nachdem auch nach den<br />
Stichtagen für die nationale Umsetzung der SPA- bzw. FFH-Richtlinie bestandskräftig erlassene Zulassungsentscheidungen<br />
grundsätzlich nicht mehr aufgegriffen werden. Eine Abweichung davon kann nur vorgenommen<br />
werden, wenn erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele wahrscheinlich erscheinen,<br />
das Projekt noch nicht endgültig verwirklicht wurde und im Zulassungsverfahren eine bestehende Prüfpflicht<br />
offensichtlich verkannt wurde. Aus den Baugenehmigungsbescheiden für die vier WKA ist nicht ersichtlich,<br />
dass eine Verträglichkeitsprüfung (zumindest Vorprüfung) erfolgt ist. Andererseits sind die Beeinträchtigungen<br />
der Erhaltungsziele der SPA-Gebiete zumindest nicht erheblich, da die Baugenehmigungen bisher nicht<br />
wieder aufgegriffen wurden.<br />
Das VRG/EG EW 9 ist hinsichtlich möglicher Summationswirkungen mit dem ca. 850 m südlich gelegenen<br />
Grauwacksteinbruch Kreuzberg zu prüfen. Für den Steinbruch liegt ein durch das Berg<strong>am</strong>t Hoyerswerda<br />
zugelassener Rahmenbetriebsplan vor, in welchen eine Verträglichkeitsprüfung integriert ist. Es wird eingeschätzt,<br />
dass auch in Summation mit diesem Vorhaben keine erheblichen Beeinträchtigungen für das SPA-<br />
Gebiet zu erwarten sind. Zugkorridore für relevante Vogelarten werden durch den Steinbruchbetrieb in keiner<br />
Weise beeinträchtigt. Nahrungs- und Rasträume, die durch den Steinbruch potenziell, aber unerheblich<br />
beeinträchtigt werden können, betreffen andere Arten als beim EW 9, da der Steinbruch innerhalb einer<br />
Waldfläche liegt, das VRG/EG dagegen im Offenland. In Summation sind daher auch diesbezüglich keine<br />
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten.<br />
� Für das SPA-Gebiet „Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet“, Teilgebiete NSG Königsbrücker<br />
Heide und NSG Zschornaer Teichgebiet sind nach Einzelfallprüfung keine Beeinträchtigungen<br />
durch das VRG/EG EW 25 zu erwarten. Diese Beurteilung bezieht sich auf die in Betrieb befindlichen<br />
WKA innerhalb des EW 9. Sofern ein Repowering mit größeren WKA angestrebt wird,<br />
sind mögliche Beeinträchtigungen projektbezogen neu zu bewerten.<br />
� EW 12 Scheibe<br />
Die Entfernung zum IBA-Gebiet „Bergbaufolgelandschaft bei Hoyerswerda“ (IBA Nr. SN025) beträgt ca.<br />
2000 m. Das IBA-Gebiet hat eine bedeutende Funktion als Brutgebiet für Offenlandarten sowie als Durchzugs-,<br />
Rast- und Brutgebiet für Wasservögel. Für die Errichtung von fünf WKA innerhalb des EW 12 liegt ein<br />
avifaunistisches Gutachten vor (KRÜGER 2002 i. A. der Sachsenkraft GmbH), in dessen Ergebnis folgendes<br />
festgestellt wird:<br />
„Aus all den genannten Gründen kann man zu dem Schluss kommen, dass bei Abwägung aller Vor- und<br />
Nachteile und den bisherigen Erkenntnissen zu Windkraftanlagen im deutschen Raum aus avifaunistischer<br />
Sicht dem Standort für 5 Windkraftanlagen <strong>am</strong> Restsee Scheibe, Nordostseite, nichts entgegensteht“<br />
(KRÜGER 2002, Seite 15).<br />
� Die Errichtung von mehr als der fünf mit dem Gutachten bewerteten WKA ist innerhalb des EW<br />
12 nicht möglich, so dass bezugnehmend auf das vorhandene Gutachten keine Beeinträchtigungen<br />
für das IBA-Gebiet „Bergbaufolgelandschaft bei Hoyerswerda“ zu erwarten sind.<br />
� EW 22 Melaune<br />
Das VRG/EG EW 22 betrifft in seinem westlichen Teil direkt das IBA-Gebiet „Oberlausitzer Gefilde bei Weißenberg“<br />
(IBA Nr. SN032). Die Bedeutung des Gebietes liegt vorrangig in der Funktion als überregional bedeuts<strong>am</strong>es<br />
Rast- und Nahrungsgebiet für schwarm- oder koloniebildende Wasservogelarten im Offenland<br />
(speziell Wildgänse) sowie als Brutgebiet des Ortolans. Bezüglich der Funktion als Rast- und Nahrungsgebiet<br />
sind die Flugkorridore zu betrachten, die von den Wildgänsen von ihren Rast- und Schlafplätzen (Bio-<br />
Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004 31
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
sphärenreservat Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft, Talsperre Quitzdorf und Talsperre Bautzen als<br />
SPA-Gebiete) für die tägliche Nahrungssuche vorrangig genutzt werden. Wesentliche Grundlage dafür bilden<br />
die in der Karte „Regionale Grünzüge sowie regional bedeuts<strong>am</strong>e Vogelzugachsen und Vogelzugrastgebiete“<br />
des Regionalplanes 2002 dargestellten regional bedeuts<strong>am</strong>en Vogelzugkorridore zwischen Rast-,<br />
S<strong>am</strong>mel- und Nahrungsplätzen. Eine dieser Zugkorridore verläuft von der Talsperre Quitzdorf kommen über<br />
die Diehsaer Höhe in das Gebiet hinein. Ein weiterer relevanter Zugkorridor wurde im Rahmen der avifaunistischen<br />
Untersuchungen zum Windpark östlich des EW 22 entlang des Schwarzen Schöps in Richtung<br />
Markersdorf, Reichenbach, Kittlitz festgestellt. Auf Grund der bereits im Jahr 1998 bekannten besonderen<br />
avifaunistischen Bedeutung wurde seitens des Vorhabensträgers (Boreas Energie GmbH) ein avifaunistisches<br />
Gutachten erarbeitet. Dieses Gutachten basiert auf einer Windparkgröße von insges<strong>am</strong>t ca. 110 ha<br />
gegenüber dem ca. 70 ha großem EW 22; die Lage der mit dem Gutachten untersuchten Fläche entspricht<br />
in etwa dem VRG/EG EW 22. Daher können die Aussagen dieses Gutachten einschließlich der dazu abgegebenen<br />
naturschutzfachlichen Stellungnahme des StUFA Bautzen vom 06.05.1998 (Az.: 42-fö) weiterhin<br />
als gültig angesehen werden (mdl. FÖRSTER Mai 2004). In der naturschutzfachlichen Stellungnahme des<br />
StUFA wird betont, dass bei Realisierung bestimmter Ausgleichsmaßnahmen (dauerhafte Stilllegung einer 7<br />
ha großen Ackerfläche sowie Rotationsstilllegung von 25 ha/Jahr <strong>gemäß</strong> Vertrag mit der Landfarm Melaune<br />
GbR) die „hinsichtlich des Schutzes des Jahreslebensraumes von wandernden Tierarten auf der Grundlage<br />
der Bonner Konvention vom 23.06.1979 bestehenden Bedenken aus naturschutzfachlicher Sicht ausgeräumt<br />
werden.“ Die Untersuchungen für dieses „Modellvorhaben“ (gezieltes Angebot von Ersatznahrungsflächen)<br />
sind noch nicht abgeschlossen. Die Beobachtungsberichte (GAERTNER 2002) zeigen eine differenzierte<br />
Inanspruchnahme der angebotenen Ersatzflächen durch die Wildgänse. Dies hängt jedoch weniger von den<br />
vorhandenen sieben WKA ab, als viel mehr von anderen exogenen Einflüssen auf die Gänse (windige Lage,<br />
Lage außerhalb der täglichen Flugroute der Gänse, schlechte Einsehbarkeit). Aus der Interpretation der<br />
Beobachtungen und nach Auskunft des StUFA ergibt sich nicht, dass eine erhebliche Beeinträchtigung des<br />
überregional bedeuts<strong>am</strong>en Gänserast- und Nahrungsplatzes aufgetreten ist bzw. zu erwarten ist.<br />
Für den Ortolan gilt <strong>gemäß</strong> Tabelle 2 der <strong>Teilfortschreibung</strong> ein Prüfradius von 1000 m um den Brutplatz. Die<br />
Brutplätze innerhalb des IBA-Gebietes befinden sich in größeren Entfernungen zum EW 22 (STUFA<br />
BAUTZEN, Brutvogelstandortkartierung), so dass keine Beeinträchtigungen für den Lebensraum dieser Art zu<br />
erwarten sind.<br />
� Für das IBA-Gebiet „Oberlausitzer Gefilde bei Weißenberg“ sind nach Einzelfallprüfung unter<br />
Bezugnahme auf vorhandene Gutachten und Beobachtungsberichte keine Beeinträchtigungen<br />
durch das VRG/EG EW 22 zu erwarten.<br />
� EW 25 Bernsdorf<br />
Das VRG/EG befindet sich ca. 4000 m südwestlich des SPA-Gebietes „Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet“<br />
(SPA-Nr. 4550-401), Teilgebiet NSG Dubringer Moor sowie ca. 3500 m nördlich des Teilgebietes NSG<br />
Teichgebiet Biehla-Weißig.<br />
Für die in den Erhaltungszielen für das Europäische Vogelschutzgebiet (Teilgebiete NSG Dubringer Moor<br />
bzw. NSG Teichgebiet Biehla-Weißig) genannten Brutvogelarten ergibt sich i. V. m. Tabelle 2 der Begründung<br />
der <strong>Teilfortschreibung</strong> bereits aus der Entfernung, dass keine Beeinträchtigungen zu erwarten sind.<br />
Auch für die in den Erhaltungszielen genannte Funktion der Gebiete als Nahrungs-, Rast- und Durchzugsgebiet<br />
für zahlreiche (Zug)vogelarten sind keine Beeinträchtigungen zu erwarten, da kein bedeutender Zugkorridor<br />
über das bzw. in der näheren Umgebung des VRG/EG EW 25 verläuft.<br />
� Für das SPA-Gebiet „Oberlausitzer Heide- und Teichgebiet“, Teilgebiete NSG Dubringer Moor<br />
und NSG Teichgebiet Biehla-Weißig, sind nach Einzelfallprüfung keine Beeinträchtigungen<br />
durch das VRG/EG EW 25 zu erwarten.<br />
� EW 29 Tagebau Spreetal<br />
Das VRG/EG befindet sich innerhalb des IBA-Gebietes „Bergbaufolgelandschaft bei Hoyerswerda“ (IBA-Nr.<br />
SN025). Das IBA-Gebiet mit einer Ges<strong>am</strong>tgröße von 7636 ha hat eine bedeutende Funktion als Brutgebiet<br />
für Offenlandarten sowie als Durchzugs-, Rast- und Brutgebiet für Wasservögel. Für den Bereich des IBA-<br />
32 Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
Gebietes und darüber hinaus liegt der Entwurf eines „Pflege- und Entwicklungsplanes Lausitzer Seenland<br />
vor (SIEDLUNG UND LANDSCHAFT 2003).<br />
Für das Gebiet liegt eine projektbezogene Erheblichkeitsabschätzung für die Errichtung von elf WKA mit<br />
jeweils ca. 150 m Ges<strong>am</strong>thöhe vor (BEAK CONSULTANS GMBH 2004). Die Auswirkungen von Errichtung und<br />
Betrieb der Windkraftanlagen an diesem Standort auf die im Gebiet vorkommenden Vogelarten des Anhanges<br />
I der VRL wurden darin im einzelnen geprüft. Die Prüfung kommt zu dem Ergebnis, dass erhebliche<br />
Beeinträchtigungen der Vogelpopulationen nicht zu erwarten sind. Die Errichtung weiterer WKA innerhalb<br />
des EW 29 über das Vorhaben hinaus ist nicht möglich.<br />
� Für das IBA-Gebiet „Bergbaufolgelandschaft bei Hoyerswerda“ sind demnach keine Beeinträchtigungen<br />
durch das VRG/EG EW 29 zu erwarten.<br />
� EW 30 Tagebau Reichwalde<br />
Das VRG/EG befindet sich etwa 1000 m südlich des IBA-Gebietes „Muskauer Heide“ (IBA-Nr. SN030). Die<br />
Bedeutung des Gebietes liegt vorrangig in der Funktion als Lebensraum des Birkhuhns. Der Prüfabstand für<br />
das Birkhuhn beträgt <strong>gemäß</strong> Tabelle 2 der Begründung der <strong>Teilfortschreibung</strong> 3000 m. Der zwischen EW 30<br />
und IBA-Gebiet befindliche Nordrandschlauch des Braunkohlentagebaus Reichwalde hat eine habitatbegrenzende<br />
Funktion für das Birkhuhn. Es ist nach Auskunft des StUFA nicht d<strong>am</strong>it zu rechnen, dass sich die<br />
Umgebung des EW 30 mittelfristig zu einem potenziellen Birkhuhnlebensraum entwickeln wird. Eine Beeinträchtigung<br />
für das Birkhuhn kann somit ausgeschlossen werden.<br />
� Für das IBA-Gebiet „Muskauer Heide“ sind nach Einzelfallprüfung keine Beeinträchtigungen<br />
durch das VRG/EG EW 22 zu erwarten<br />
3.2 Fazit<br />
Eine Beeinträchtigung von SPA-Gebieten und „faktischen“ Vogelschutzgebieten in ihren für die Erhaltungsziele<br />
oder den Schutzzweck maßgeblichen Bestandteilen durch die im Rahmen der <strong>Teilfortschreibung</strong> ausgewiesenen<br />
Vorrang- und Eignungsgebiete für die Nutzung von Windenergie ist nicht zu erwarten.<br />
3. Ges<strong>am</strong>teinschätzung Vorprüfung/Erheblichkeitsabschätzung<br />
Durch die im Rahmen der <strong>Teilfortschreibung</strong> des Kapitels II.4.4.7 des Regionalplanes ausgewiesenen Vorrang-<br />
und Eignungsgebiete sind keine erheblichen Beeinträchtigungen für die Erhaltungsziele oder den<br />
Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzgebiete zu<br />
erwarten.<br />
Im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen und/oder projektbezogener Vorhaben innerhalb der Vorrang-<br />
und Eignungsgebiete werden die Ergebnisse dieser Prüfung berücksichtigt und im erforderlichen Umfang<br />
konkretisiert. Die hier erfolgte Prüfung kann daher die Verträglichkeitsprüfungen nachgeordneter Planungen<br />
und Vorhaben, sofern nicht bereits vorhanden, nicht ersetzen. In diesen Verfahren sind in Abhängigkeit<br />
von den konkreten Standorten der einzelnen WKA und deren Typ (Nabenhöhe, Rotordurchmesser) Präzisierungen<br />
notwendig.<br />
Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004 33
<strong>Teilfortschreibung</strong> des Regionalplans für das Kapitels II.4.4.7<br />
„Bereiche zur Sicherung der Nutzung der Windenergie unter Anwendung des Planungsvorbehaltes“<br />
Anlage 1: Berücksichtigung der Erhaltungsziele und des Schutzzweckes der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und der Europäischen Vogelschutzrichtlinie<br />
im Sinne des Bundesnaturschutzgesetzes <strong>gemäß</strong> <strong>§</strong> 6 <strong>Abs</strong>. 3 <strong>SächsLPlG</strong><br />
5. Quellen<br />
Bach, L. (2001): Fledermäuse und Windenergienutzung – reale Probleme oder Einbildung? - Vogelkundliche Berichte<br />
Niedersachsen 33: 119-1<strong>24</strong>.<br />
beak Consultans GmbH i. A. der Boreas Energie GmbH (2004): Landschaftspflegerischer Begleitplan für das Windeignungsgebiet<br />
EW 29 Elsterheide – Endfassung.<br />
Endl, P. (2003): Erfassung von Totfunden an Windkraftanlagen der Landkreise Bautzen, K<strong>am</strong>enz und Niederschlesische<br />
Oberlausitz i. A. des StUFA Bautzen.<br />
Gaertner, G. (2002): Beobachtungsberichte über die Annahme der Stilllegungsflächen durch Gänse im Winter 1999/2000<br />
sowie 2000/2001 für den Windpark Melaune i. A. der Boreas Energie GmbH.<br />
GEO montan (2000): Nachtrag zum fakultativen Rahmenbetriebsplan für den Steinbruch Grauwacke Kreuzberg i. A. der<br />
M. Grafe Beton GmbH Stölpchen.<br />
Koch, T. (2002): Rechtsfragen der Auswahl von FFH-Gebieten im Freistaat Sachsen = Regionaler Planungsverband<br />
Oberlausitz-Niederschlesien (Hrsg.): Schriftenreihe zur Regionalentwicklung Heft 3/2002.<br />
Krüger, S. (2002): Avifaunistisches Gutachten über den vorgesehenen Standort von Windkraftanlagen an der Nordostseite<br />
des Restsees Scheibe/Kreis K<strong>am</strong>enz i. A. der Sachsenkraft GmbH/Dresden.<br />
Krukenberg, H. und J. Jaene (1999): Zum Einfluss eines Windparkes auf die Verteilung weidender Blässgänse in Rheiderland<br />
(Landkreis Leer, Niedersachsen). In: Natur und Landschaft 1999: 420-427.<br />
Naturschutzinstitut Dresden (1994): Schutzwürdigkeitsgutachten für die geplanten Erweiterungsflächen des Naturschutzgebietes<br />
„Molkenbornteiche“ (Landkreis Riesa Großenhain) i. A. des StUFA Radebeul.<br />
Rahmel, U.; Bach L.; Brinkmann, R.; Dense, C.; Limpens, H.; Mäscher, G.; Reichenbach, M. & A. Roschen (1999):<br />
Windkraftplanung und Fledermäuse – Konfliktfelder und Hinweise zur Erfassungsmethodik. - Bremer Beiträge für<br />
Naturkunde und Naturschutz, Band 4: 155-161.<br />
Sächsisches Landes<strong>am</strong>t für Umwelt und Geologie (2003): Gebietsspezifische Erhaltungsziele für die Europäischen Vogelschutzgebiete<br />
sowie die sächsischen Gebietsvorschläge nach der FFH-Richtlinie.<br />
Sächsisches Staatsministerium des Innern (2002): Hinweise für die Prüfung von Raumordnungsplänen nach der Flora-<br />
Fauna-Habitatrichtlinie der EU vom 17.04.2002, Az.: 64-<strong>24</strong>32.58.<br />
Sächsisches Staatsministerium des Innern (2003): Landesentwicklungsplan Sachsen.<br />
Sächsisches Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (2003): Arbeitshilfe zur Anwendung der Vorschriften zum<br />
Aufbau und Schutz des Europäischen ökologischen Netzes „Natura 2000“ („FFH-Arbeitshilfe“) vom 27.03.2003,<br />
Az.: 61-8830.10/6.<br />
Schlegel, C. (2004): Erweiterung des WKA Standortes Röhrsdorf (Ortsteil von Königsbrück) – Zuarbeit durch die Gebietsbetreuung<br />
NSG „Königsbrücker Heide“ für die Verträglichkeitsprüfung.<br />
Siedlung und Landschaft (Planungsbüro Illig-Kläge-Ludloff GbR) (2003): Pflege- und Entwicklungsplan Lausitzer Seenland<br />
– Entwurf vom 27.10.2003 - i. A. der Lausitzer Seenland GmbH.<br />
Staatliches Umweltfach<strong>am</strong>t Bautzen, Abteilung Naturschutz und Landschaftspflege (2004): Windkraftanlagen und Fledermausschutz<br />
in der Oberlausitz – Zuarbeit zur <strong>Teilfortschreibung</strong> Windenergie.<br />
Sudfeld, C.; Doer, D.; Hötker, H.; Mayr, C.; Unselt, C.; von Lindeiner, A. und H.-G. Bauer (2002): Important Bird Areas<br />
(Bedeutende Vogelschutzgebiete) in Deutschland. In: Berichte Vogelschutz 38 (2002), 17-27.<br />
Verwaltung des Biosphärenreservates Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft (Hrsg.) (1999): Die Brutvögel im Biosphärenreservat<br />
Oberlausitzer Heide- und Teichlandschaft.<br />
Weihrich, D. (2001): Windkraft und Vögel – Konfliktlösung im Rahmen der FFH-Verträglichkeitsprüfung. In: Tagungsband<br />
„Windenergie und Vögel – Ausmaß und Bewältigung eines Konfliktes“, Tagung an der Technischen Universität<br />
Berlin <strong>am</strong> 29./30.11.2001, 157-165.<br />
Internetquellen<br />
http://lfugwww.smul.sachsen.de/de/wu/umwelt/lfug/lfug-internet/index.html<br />
http://www.fledermausverband.de<br />
http://www.tu-berlin.de/fb7/ile/fg_lbp/schwarzesbrett/windkraft-tagung.htm<br />
34 Fassung <strong>gemäß</strong> des Genehmigungsbescheides vom 7. Dezember 2004 und der Hinweise des SMI vom 15. Dezember 2004