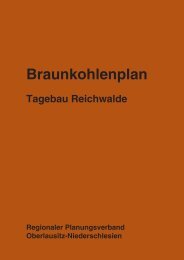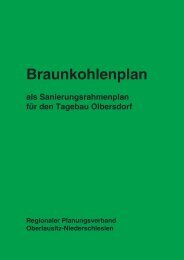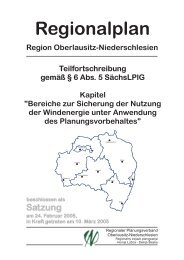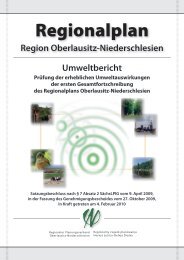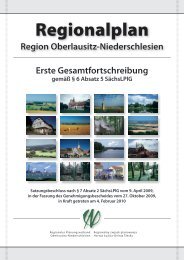Braunkohlenplan Tagebau Nochten - Regionaler Planungsverband ...
Braunkohlenplan Tagebau Nochten - Regionaler Planungsverband ...
Braunkohlenplan Tagebau Nochten - Regionaler Planungsverband ...
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
InhaltsverzeichnisInhaltSeiteÜbersicht über die Verfahrensschritte bis zur Genehmigungdes <strong>Braunkohlenplan</strong>es <strong>Nochten</strong>ISatzung über die Feststellung des <strong>Braunkohlenplan</strong>es <strong>Nochten</strong>IIIGenehmigung des <strong>Braunkohlenplan</strong>es <strong>Nochten</strong>IV<strong>Braunkohlenplan</strong> <strong>Nochten</strong> 1Internetfassung
Internetfassung
Internetfassung- V -
- VI -Internetfassung
<strong>Braunkohlenplan</strong><strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong>für das Vorhaben Weiterführung des<strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> 1994 bis AuslaufVom Sächsischen Staatsministerium für Umwelt undLandesentwicklung am 07.02.1994 genehmigt undfür verbindlich erklärtInternetfassung
Internetfassung
InhaltsübersichtPunkt Inhalt SeiteVorbemerkung 21 Allgemeine Angaben 31.1 Definition, Aufgabe und Inhaltdes <strong>Braunkohlenplan</strong>es 31.2 Rechtsgrundlagen, rechtliche Wirkung 51.3 Ausgangssituation für die Erarbeitungdes <strong>Braunkohlenplan</strong>es 81.4 Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong> 101.4.1 Darstellung der gegenwärtigen Situation 101.4.2 Untersuchte Abbauvarianten 141.5 Natur und Landschaft 151.5.1 Beschreibung von Natur und Landschaft vorBeginn des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> 151.5.2 Bestandsaufnahme von Natur und Landschaft imAbbaugebiet und im Einwirkungsbereich derGrundwasserabsenkung 151.6 Klima 182 Ziele des <strong>Braunkohlenplan</strong>es und deren Begründungen 202.1 Bergbau 202.2 Wasser 262.3 Natur und Landschaft 312.4 Staub- und Lärmimmission 352.5 Abfallwirtschaft, Abwässer und Bodenschutz 392.6 Archäologie und Denkmalschutz 402.7 Siedlungswesen, Bevölkerung und Infrastruktur 412.8 Leitungen und Bandanlagen 443 Quellenverzeichnis 454 Abkürzungen 475 Kartenverzeichnis 47Internetfassung
Allgemeine Angaben - Ausgangssituation für die Erarbeitung des <strong>Braunkohlenplan</strong>es 1.3Bei Vorhaben des Bundes oder bundesunmittelbarer Planungsträger ist hinsichtlich der Beachtenspflichtder Ziele der Raumordnung und Landesplanung allerdings die Einschränkungdes § 6 ROG zu beachten (Widerspruchsvorbehalt bei konkurrierenden bun desgesetzlichenVorhaben). Dem einzelnen Bürger gegenüber hat der Braunkohlen plan keine unmittelbareRechtswirkung.Bergrechtliche BetriebspläneDie in den Braunkohlenplänen formulierten Ziele der Raumordnung und Landesplanung sindgemäß § 8 (6) Satz 2 SächsLPlG, § 5 (4) ROG und § 48 (2) Satz 1 BBergG nach ihrer Verbindlicherklärungbei der bergbehördlichen Zulassung von Betriebsplänen zu beachten. Nach§ 52 (1) BBergG ist für die Errichtung und Führung des Betriebes ein Hauptbetriebsplan undnach § 53 BBergG für die Einstellung des Betriebes ein Abschlußbetriebsplan aufzustellen.Gemäß Einigungsvertrag (Anlage I Kapitel V, Sachgebiet D, Abschnitt III Nr. 1, Buchstabeh, Abschnitt bb) ist bei Vorhaben, bei denen das Verfahren zur Zulassung des Betriebes,insbesondere zur Genehmigung eines Technischen Betriebsplanes, am Tage des Wirksamwerdensdes Beitritts bereits begonnen war, d.h. also für laufende <strong>Tagebau</strong>e, kein Planfeststellungsverfahrendurchzuführen. Daher wird nach den bergrechtlichen Bestimmungen vomBergbautreibenden (nur) die Aufstellung von Rahmenbetriebsplänen nach § 52 (2) BBergG(fakultativer Rahmenbetriebsplan) gefordert.1.3 Ausgangssituation für die Erarbeitung des <strong>Braunkohlenplan</strong>esSituation des Braunkohlenbergbaues in der Sächsischen LausitzDie Braunkohleförderung, geprägt durch das Autarkiestreben in der Energieversorgung in derehemaligen DDR, war in der Vergangenheit einerseits die wichtigste Primärenergie grundlageund andererseits mit unverantwortbaren Eingriffen in Natur, Landschaft und historisch gewachseneSiedlungsstruktur ver bunden, ohne angemessene Berücksichtigung ökologischer,sozialer und kultureller Belange. Darüber hinaus blieb die Rekultivierung der abgebautenFlächen hinter der Inanspruchnahme von Flächen zurück.Dies führte zu Zerstörungen im Lebensraum, die auf Jahrzehnte große Anstrengungen inder Energie-, Umwelt- und Landesentwicklungspolitik gemeinsam mit der Wirtschaft erfordern.Zugleich muß die durch die frühere Praxis verlorengegangene Akzeptanz des Braunkohlenbergbaus in der Bevölkerung zurückgewonnen werden.Mit der Übernahme des Umweltrechtes der Bundesrepublik Deutschland sind gesetzlicheRahmenbedingungen für das Ziel einer sicheren, preisgünstigeren, umweltge rechteren undressourcenschonenden Energieversorgung in Sachsen geschaffen.Trotz wesentlicher Erweiterung konkurrierender Angebote und deutlicher Reduzierung derFör derung bleibt Braunkohle durch ihren Anteil an der Verstromung über die Jahrhundertwendehinaus wichtigster Primärenergieträger in Sachsen.Die Kohleförderung und Stromerzeugung werden wesentlich zur Wertschöpfung in der RegionOstsachsen beitragen und geben damit Tausenden Menschen in dieser Region in <strong>Tagebau</strong>en(<strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong>, <strong>Tagebau</strong> Reichwalde, <strong>Tagebau</strong> Berzdorf und <strong>Tagebau</strong> Scheibe)und in Kraftwerken Arbeit.Im nördlich des ostsächsischen Braunkohlenrevieres angrenzenden Braunkohlenförder raumBrandenburgs bestehen ähnliche Ausgangspositionen.Im Freistaat Sachsen belaufen sich die wirtschaftlich verfügbaren Reserven des heimischenRohstoffes Braunkohle aus erschlossenen und nicht erschlossenen Feldernnach Aussage der Leitlinien der Staatsregierung zur künftigen Braunkohlenpolitik in8 HeidenfelderInternetfassung
Allgemeine Angaben - Ausgangssituation für die Erarbeitung des <strong>Braunkohlenplan</strong>es 1.3Sachsen vom 02.06.1992 auf insgesamt 8 100 Mio t, davon entfallen 5 900 Mio t auf die RegionWest sachsen und 2 200 Mio t auf die Region Oberlausitz-Niederschlesien.Die Staatsregierung bekennt sich in den Leitlinien zur künftigen Braunkohlenpolitik in Sachsenzur langfristigen Fortführung des subventionsfreien Braunkohlenabbaus im wesentlichredu zierten Umfang.Folgende Prämissen sind im Zusammenhang mit dieser Grundsatzaussage zu beachten:Der Braunkohlenabbau, mit dem Ziel der langfristigen Konzentration auf wenige Abbauschwerpunkte, ist unter Prüfung aller Abbauvarianten umwelt- und sozialverträglich zu gestalten,so daß insbesondere- weitere Ortsverlegungen weitestgehend vermieden werden, jedenfalls gegen den Willen derüberwiegenden Mehrheit der betroffenen Bevölkerung nach Möglichkeit unterblei ben. VonUmsiedlungen betroffene Menschen müssen die Chance bekommen, in neuer Siedlungsgemeinschaftzusammenzufinden. Es müssen geeignete Entschädigungslö sungenangebo ten werden, die die Schaffung vergleichbaren Lebensraumes ermögli chen,- den Erfordernissen einer ordnungsgemäßen Sanierung und Wiedernutzbarmachung Rechnunggetragen wird,- die wasserwirtschaftlichen Zusammenhänge und Erfordernisse beachtet werden,- noch vorhandene Kulturlandschaften möglichst erhalten und verbessert werden.Diese genannten Prämissen machen den Neubeginn bei gleichzeitiger Zukunftssicherung fürdie sächsische Braunkohle deutlich.Dadurch wird der notwendige Rahmen für die erforderliche Planungssicherheit der Wirt schaftwie auch der Landesentwicklung ermöglicht. Außerdem wird für die Altlastenbeseiti gung undRekultivierung die Kraft des aktiven Bergbaus nutzbar gemacht.Die Staatsregierung wird ihre landespolitischen Entscheidungen an einer gutachterlichab ge schätzten langfristigen Förderung in den sächsischen Revieren von insgesamt ca.40 - 45 Mio t/a, (davon ca. 25 - 30 Mio t in der Lausitz und ca. 15 Mio t im Südraum vonLeipzig), für etwa 30 Jahre ab dem Zeitpunkt der Inbetriebnahme der neu errichteten bzw.sa nierten Großkraft werke zur Stromerzeugung orientieren.Diese Braunkohlenmenge sichert die ausreichend langfristige Versorgung der neu errichte tenbzw. ertüchtigten Großkraftwerke in beiden Revieren.Am Standort Boxberg hat das zuständige Unternehmen Vereinigte Energiewerke Aktiengesellschaft die Entscheidung getroffen, zwei 500-MW-Blöcke nach dem modernsten Standder Technik nachzurüsten und zusätzlich ein hoch modernes Kraftwerk mit zwei 800 MW-Blockein heiten zu errichten und zu betreiben.Dies bedeutet, daß dafür als Förderzentren in der Sächsischen Lausitz die zwei <strong>Tagebau</strong>e<strong>Nochten</strong> und Reichwalde langfristig betrieben werden.HeidenfelderInternetfassung9
Allgemeine Angaben - Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong> 1.4Abb. 1Braunkohlenreviere in der Bundesrepublik DeutschlandQuelle: Jahrbuch Bergbau, Öl und Gas, Elektrizität, Chemie; 99. Jg. (1992)HeidenfelderInternetfassung11
Allgemeine Angaben - Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong> 1.4Abb. 2Geologisches Normalprofil Braunkohlenfeld <strong>Nochten</strong>Quelle: Angaben der LAUBAG12 HeidenfelderInternetfassung
Allgemeine Angaben - Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong> 1.4Im Abbaugebiet ist die Gewinnung des 2. Lausitzer Flözes und zusätzlich etwa ab 2005 dieGewinnung der Oberbank des 1. Lausitzer Flözes vorgesehen. Das 2. Lausitzer Flöz ist 8,5 mbis maximal 20 m mächtig. Die durchschnittliche Mächtigkeit beträgt 11,3 m. Das 2. LausitzerFlöz fällt von +65 m HN im SE auf + 45 m HN im NW ein.Das 1. Lausitzer Flöz steht gespalten in Unter- und Oberbank an. Die abbauwürdige Oberbankhat eine durchschnittliche Mächtigkeit von 2 m (max. 3,6 m). Das Hangende des Flö zesliegt im SE bei etwa + 120 m HN, es fällt nach NW auf + 110 m HN ein.Der Einsatz der Kohle erfolgt als Kraftwerkskohle und Brikettierkohle. Das 2. Lausitzer Flözbeinhaltet die Brikettierkohle und weist nachfolgende durchschnittliche Qualitätsparameter,bezogen auf grubenfeuchte Kohle, auf:Heizwert 8650 kJ/kgAschegehalt 2,9 %Wassergehalt 57,2 %Schwefelgehalt 0,4 - 0,6 %Der Abbau der Braunkohle durch den <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong> erfolgte bisher im Westfeld der Lagerstätte<strong>Nochten</strong>. Die ersten vorbereitenden Maßnahmen für den Aufschluß des Tage baues<strong>Nochten</strong> begannen 1958 im Raum Mulkwitz--Mühlrose. Die Aufschlußfigur wurde in den Jahren1968 - 1973 hergestellt, und der Feldesbetrieb begann 1974 mit dem Einsatz der Förderbrücke.Die Kohleförderung wurde im <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong> im Jahr 1973 aufgenommen. Sie erreichteüber die Laufzeit bis 31. 12. 93 eine Gesamtmenge von ca. 468 Mio t. Die Abraumbewe gungzur Freilegung dieser Kohle betrug ca. 2 217 Mio m ³ . Die Jahresförderung der Kohle schwanktemit Ausnahme des Anlaufbetriebes zwischen 18,3 Mio t (1991) und 31, 5 Mio t (1989).Die Kohle wird in der Kohleverladung bei Mühlrose über eine Bandverladung direkt oder überdie Grabenbunkerverladung in Kohlezüge verladen und den Verbrauchern (Kraftwerk Boxbergund unternehmenseigene Veredlungsanlagen) zu geführt.Die Kohlefreilegung erfolgt durch die Abraumförderbrücke. Der über dem Abtragsvermögender Förderbrücke anstehende Abraum wird im Vorschnittbetrieb gewonnen und über einege genwärtig ca. 9 km lange Bandanlage zur Vorschnittkippe gefördert. Ein Absetzer ver kipptden Vorschnittabraum auf die Förderbrückenkippe und stellt somit die Abschlußkippe für dieBerg baufolgelandschaft her.Nachstehende Tabelle enthält die Flächenbilanz für die Landinanspruchnahme sowie dieWie dernutzbarmachung vom <strong>Tagebau</strong>aufschluß bis zum Ausgangsstand 01.01.94:GesamtLandwirtschaftForstwirtschaftWasserflächeSonstigeLandinanspruchnahme(ha) 4 642 712 3 753 16 161Wiedernutzbarmachung(ha) 745 214 480 - 51HeidenfelderInternetfassung13
Allgemeine Angaben - Beschreibung zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong> 1.41.4.2 Untersuchte AbbauvariantenIn den am 01.12.92 vom Bergbauunternehmen an die Regionale Planungsstelle Oberlau sitz-Niederschlesien übergebenen Unterlagen zum <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong> wurde nur eine Ab bauvariantedargestellt. Diese Variante, in der Folge als Variante 0 bezeichnet, ging vom Abbaudes gesamten Brückenfeldes bis zum Jahr 2034 und danach des Sonderfeldes bis 2040bei Inan spruchnahme der Orte Rohne, Mulkwitz, Mühlrose und Teilen der Orte Schleife undTreben dorf aus.Am 15.01.1993 übergab das Bergbauunternehmen die „Ergänzungen zur Zuarbeit zum <strong>Braunkohlenplan</strong><strong>Nochten</strong>“ mit Angaben zu weiteren drei Abbauvarianten.Variante 1Abbau des Brückenfeldes bis 2026 und Erhaltung der Innenbereiche von Schleife, Rohne,Mulkwitz, Mühlrose sowie Neu-Trebendorf.Variante 2Abbau des Brückenfeldes bis 2026 und danach Abbau des Sonderfeldes bis 2034 und Erhaltungvon Schleife, Rohne, Mulkwitz sowie Neu-Trebendorf bei Inanspruchnahme vonMühlrose.Variante 3Abbau des Brückenfeldes bis 2026 und danach eines Teiles des Sonderfeldes und Erhal tungvon Schleife, Rohne, Mulkwitz, Mühlrose und Neu-Trebendorf.Gegenüberstellung der Abbauvarianten im Hinblick auf Kohlevorrat, Umsiedlung und voraussichtliches<strong>Tagebau</strong>ende:VarianteKohlevorrat(Mio t)Vorratsausgrenzung(Mio t)Umsiedlung AnzahlEinwohner<strong>Tagebau</strong>ende0123909609740719--300169190~ 1 735~ 216~ 406~ 2652 0402 0262 034~ 2 031Die Variante 1 entspricht den „Leitlinien der Staatsregierung...“ bezüglich der Kohle bereit stellungfür die neu zu errichtenden bzw. zu sanierenden Kraftwerke im abgeleiteten Pla nungszeitraum.Gleichzeitig wird diese Variante 1 den Forderungen nach größtmöglicher Scho nungdes sorbischen Siedlungsgebietes im Nordwestteil der Braunkohlenlagerstätte wei testgehendgerecht.Mit dem <strong>Braunkohlenplan</strong>entwurf vom 14.06.1993 wurde die Variante 1 im öffentlichen Beteiligungsverfahrenbekanntgemacht. Dem <strong>Braunkohlenplan</strong> in der vorliegenden Fassung liegtnach Abwägung der einzelnen Grundsätze nach § 2 (1) ROG unter Einbeziehung des Ergebnissesder Erörterungsverhandlung vom 29.10.1993 die Variante 1 zugrunde. Der Lagerstättenteil,der außerhalb der Abbaufläche liegt, sollte als Vor rangfläche entsprechend Definitionin Pkt. 1.1 eingeordnet werden.14 HeidenfelderInternetfassung
Allgemeine Angaben - Klima 1.6mittlere Zahl der Frosttage(Tagesmaximum 0°C) 92Sonnenscheindauer 1 700 hNebeltage 53Gewittertage 32mittlerer Niederschlag/Jahr 625 mmDie <strong>Tagebau</strong>e nehmen in dieser Region eine relativ große Fläche ein. Deshalb wirken sie aufdas Lokalklima durch Veränderungen in den Temperatur- und Windverhältnissen. Die großenunbewachsenen Flächen führen bei windschwachen Wetterlagen nachts zu niedri geren,tagsüber zu etwas höheren Temperaturen. Da in den meisten Fällen die <strong>Tagebau</strong>e von Wäldernumgeben sind, wird die Windgeschwindigkeit in großen Bereichen der Tage bauflächenwegen der etwas niedrigeren Geländeoberkante vermindert sein. In Abhängig keit von derStrömungsrichtung treten Zonen mit stark erhöhter Turbulenz auf. Dies trifft vor allem für dieder Luftströmung zugewandten <strong>Tagebau</strong>kanten zu.Einfluß der Bergbaufolgelandschaft auf klimatische AbläufeLokal wird sich durch die Flächenveränderungen insbesondere um den Restsee und im<strong>Tagebau</strong> gebiet bis zur abgeschlossenen Rekultivierung ein Einfluß auf Wind, Wärme- undWasser haushalt bemerkbar machen. Über der entstehenden Wasserfläche des Restseeswerden sowohl die Temperaturen als auch die Verdunstung und der Wärmehaushalt insgesamtver ändert. Inversionshäufigkeiten werden durch die Wasserfläche etwas abgeschwächt,da über dieser freien Fläche verstärkt Windbewegungen auftreten.Für das Gebiet liegt ein „Amtliches Gutachten zum Klima Bergbaufolgelandschaft <strong>Nochten</strong>,Reichwalde und Bärwalde“ des Wetteramtes Dresden vom 16.03.1993 vor. Die inhaltlichenAussagen des Gutachtens sind bei der Zulassung der Betriebspläne, insbesondere der Hauptbetriebspläne,neu zu bewerten.HeidenfelderInternetfassung19
Ziele und Begründungen - Bergbau 2.1Verbunden mit der Festlegung des „Vorranggebietes für Braunkohlengewinnung“ muß eineUnterstützung der betroffenen Gemeinden durch staatliche und kommunale Behörden1. beim Aufholen der Infra-Struktur und des Entwicklungsrückstandes (soweit er durchdie bisherige Einstufung als Bergbauschutzgebiet bedingt ist)2. bei kooperativen Entscheidungen bei Planungs-/Bauvorhaben durch die Genehmigungsbehörden3. bei der Berücksichtigung im Rahmen von Förderprogrammen des Landes, des Bundesoder der EUerfolgen.Ziel: 3Die bergbauliche Tätigkeit innerhalb der in Karte 1 dargestellten Sicherheitslinie istso zu planen und durchzuführen, daß durch den Abbau bzw. die Verkippung bedingteGefährdungen auf der Geländeoberfläche außerhalb der Sicherheitslinie - soweitvorherseh bar - ausgeschlossen sind.Die Koordinaten der Sicherheitslinie sind aus der Tabelle auf Seite 23 sowie der Abbildung3 auf Seite 24 ersichtlich.Die Sicherheitslinie ist in alle räumlich und sachlich betroffenen nachfolgenden Plänezu übernehmen.Begründung:Der Bereich zwischen der Sicherheitslinie und der Abbaugrenze wird als Sicherheitszonebezeichnet. Mit der Sicherheitslinie wird diejenige Fläche umschlossen, auf welcher Auswirkungender Ab bau- bzw. Verkippungsmaßnahmen auf die Geländeoberfläche nicht ausgeschlossenwerden können, so daß ggf. Maßnahmen zur Sicherung gegen Gefahren getroffenwerden können. Die Sicherheitslinie verläuft in der Regel in einem Abstand von 150 m zurAbbau grenze.Die Festlegungen der genauen Lage der Abbaugrenze innerhalb der Sicherheitslinie erfolgtnach Vorlage von Standsicherheitsuntersuchungen in weiteren Betriebsplanverfahren (Hauptbetriebspläne).Die Sicherheitszone hat neben ihrer Bedeutung zur Gefahrenabwehr zugleich als Pufferzonedie Aufgabe, die Bergbautätigkeit mit den außerhalb der Sicherheitslinie angrenzendenNut zungen verträglich zu machen. Als Maßnahmen hierfür kommen z. B. Anpflanzun genoder Er richtung von Erdwällen und deren Bepflanzung in Betracht. Die derzeitige zeichnerischeDar stellung im <strong>Braunkohlenplan</strong> ist im wesentlichen durch grubensicherheit liche bzw.böschungs statische und technologische Erfordernisse begründet.22 HeidenfelderInternetfassung
Ziele und Begründungen - Bergbau 2.1Koordinaten der Sicherheitslinie <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong>(nach Gauß - Krüger)Quelle: Angaben der LAUBAGPunkt Rechtswert Hochwert Punkt Rechtswert Hochwert12345678910111213141516171819202154 72,79872,93273,62574,14174,90075,28575,83875,91176,46976,92477,20377,52177,64177,37776,73176,17274,90574,51574,00073,63571,93056 99,85899,86099,79099,59299,46799,44399,54199,57099,96957 00,54701,24202,58503,32104,21504,53604,76605,50505,74005,99506,22507,78122232425262728293031323334353637383940414254 71,13069,97669,66968,90168,87168,65268,54068,25966,69766,51766,44566,27166,22065,65165,67065,95766,50768,54468,03269,60269,44957 08,14409,73109,83210,59110,62110,65410,69710,74710,24809,92309,94309,73209,74509,20108,89708,50007,38705,91605,14504,19204,043HeidenfelderInternetfassung23
Ziele und Begründungen - Bergbau 2.1Abb. 3:Koordinaten der Sicherheitslinie<strong>Braunkohlenplan</strong> <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong>24 HeidenfelderInternetfassung
Ziele und Begründungen - Bergbau 2.1Ziel: 4Alle innerhalb der Abbaugrenze anfallenden Abraummassen sollen grundsätzlich imAbbaube reich für die Wiederherstellung einer naturnahen Bergbaufolgelandschaft genutztwerden.Begründung:Insgesamt werden bis zum Auslauf 3 924 Mio m³ Abraum bewegt. Infolge des Massendefizites ergibt sich bei Beendigung des <strong>Tagebau</strong>es ein Restloch mit einem Volumen von478 Mio m³. Als Endge staltung dieses Restloches kommt nur eine Wasserfüllung in Betracht.Mit dem Versturz der innerhalb der Abbaugrenze anfallenden Abraummassen sollen bei derKippengestaltung die geotechnischen Erfordernisse, die Minimierung der Restlochfläche sowiedie in Ziel 13 formulierten Anforderungen an eine möglichst naturnahe Gestaltung derBergbaufolgelandschaft gewährleistet werden.Ziel: 5Die Gewinnung von Begleitrohstoffen im Abbaubereich soll dem Grund satz der Nutzbarmachungdieser Bodenschätze dienen, bevor sie durch den <strong>Tagebau</strong> betrieb fürimmer verloren gehen. Dieser Zielsetzung soll auch die gesonderte Ver kippung vonBodenschätzen im Rahmen des laufenden <strong>Tagebau</strong>es dienen. Die Ge winnung vonBegleitrohstoffen im Ab baubereich des <strong>Tagebau</strong>es soll zeitgleiche Ab grabungen vonRohstoffen in der Region erübrigen; dies gilt auch für die Nut zung der hochwertigenTonvorkommen östlich der Gemeinde Mühlrose für die Versorgung des Gipsdepotsund von Ziege leien. Abgrabungen im Abbaubereich sind zeitlich und räumlich so zuregeln, daß die Gewinnung der Braunkohle nicht beeinträchtigt wird.Begründung:FlaschentonAb 2002 werden durch den <strong>Tagebau</strong> Flaschentone überbaggert, deren selektive Gewin nungmöglich ist und die bei Bedarf einer Verwertung zugeführt werden können. Davon wurde imBereich der Jahresscheibe 2005 - 2015 ein geologischer Vorrat von 14,5 Mio t nutzbarenRohstoffes im 4. Flaschentonhorizont, der sich zur Herstellung eines säure- und laugebeständigenKlinkers eignet, erkundet. Die Nutzung dieser Tonlagerstätten innerhalb des Braunkohlenabbaubereichesdurch Dritte sollte zur Verwirklichung des Zieles (Vermeidung zeitgleicherAbgrabungen von Rohstoffen im <strong>Tagebau</strong>umfeld) im Einklang mit dem Braunkohlenunternehmenermöglicht werden.Diese Tone sind ebenfalls für die wirksame Abdichtung von Deponien geeignet. Zum Zeitpunktdes einsetzenden Eigenbedarfes ab 1994 (max. 500 000 m³/a) sind in keinem der laufenden<strong>Tagebau</strong>e Dichtungstone selektiv gewinn bar.TorfFür die Landwirtschaft nutzbare Torfe in Mooren wurden im Gebiet „Rothwassergraben“ und„Altteicher Moor“ nachgewiesen. Waldbrände im Mai 1992 schädigten die oberflächen nahan stehenden Schichten. Die Torflagerstätte „Rothwassergraben“ liegt in den Jahres scheiben2001 bis 2004. Das Bergwerkseigentum Altteich (Torf) innerhalb des Braunkoh lenabbaubereicheswird derzeit durch Dritte für die Herstellung von Humus genutzt. Mit dem Nutzungsberechtigtensollen rechtzeitig vor Abbaubeginn Ver handlungen gemäß § 42 BBergG aufgenommenwerden. Der im Abbaubereich anstehende Torf ist selektiv zu gewinnen und vorrangigfür die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft und von Feuchtbiotopen zu verwenden.HeidenfelderInternetfassung25
Ziele und Begründungen - Wasser 2.2FindlingeIm Gewinnungsprozeß anfallende große Steine (sog. „Findlinge“) werden ausgehalten undsind für die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft oder zur Vermarktung, z. B. als Dekorstein,vorge sehen. Als Findlinge bezeichnet man eiszeitliche Geschiebe, die eine bestimmteMindestgröße überschreiten.Umsetzung der Ziele:Die Umsetzung und Konkretisierung der im Punkt 2.1 genannten Ziele ist insbeson dere imbergrechtlichen Betriebsplanverfahren vorzunehmen.2.2 WasserZiel: 6Die Einwirkungen der für den <strong>Tagebau</strong>betrieb notwendigen Grundwasserabsenkungauf die Umwelt sollen den in Karte 3 dargestellten Einwirkungsbereich der Grundwasserabsenkungin seiner maximalen Ausdehnung nicht überschreiten.Bei allen bergbaulichen Sümpfungsmaßnahmen ist das Gebot der größtmöglichenSchonung der Grundwasservorräte zu beachten.Die Grundwasserabsenkung und -entspannung der einzelnen Grundwasserleiter sollenräumlich und zeitlich so betrieben werden, daß ihre Einwirkungen unter Berücksichtigungder bergsicher heitlichen Notwendigkeit so gering wie eben möglich gehaltenwerden. Es ist darauf hinzuwirken, die Einwirkungen nach dem jeweiligen Stand derTechnik, insbesondere durch- örtlich gezielte und zeitlich gestaffelte Entwässerung,- Grundwasseranreicherungen und Abdichtungsmaßnahmen zum Schutz von Feuchtgebietenund- Ausgleich sonstiger Grundwasserentnahmen durch Sümpfungswasserlieferungenzu minimieren.Begründung:Zur Verminderung der mit der Grundwasserabsenkung verbundenen Nachteile und Schä denfür den Wasser- und Naturhaushalt müssen geeignete Maßnahmen ergriffen werden, die dieflächenhafte Ausdehnung der Grundwasserentnahmen reduzieren. Dazu hat der BergbautreibendeMöglichkeiten zu untersuchen und Lösungen umzusetzen.Zur Prognose der Grundwasserstandsentwicklung und zur Abgrenzung des durch die <strong>Tagebau</strong>ebeeinflußten Gebietes wurde durch das Bergbauunternehmen das geohydrologi sche Modell„Ostlausitz“ erstellt. Dabei erfolgte die Simulation der Grund wasserströmungs verhält nissegemeinsam für die <strong>Tagebau</strong>e <strong>Nochten</strong>, Bärwalde und Reichwalde. Anhand der Ergebnisse derMo dellrechnung und unter Beachtung der bisher gemachten Erfahrun gen bei der Entwässerungdes Gebirges ist die orts- und zeitdiskrete Planung der Entwäs serungsanlagen möglich.Durch die Optimierung aller Maßnahmen können die Absenkungs reichweite und die damitverbun denen Auswirkungen auf das umliegende Territorium auf das für eine sichere Betriebsführungnotwendige Maß beschränkt werden. Bei der Tage bauentwässerung kann der Vorlaufder Fil terbrunnen auf ein notwendiges Maß reduziert werden, so daß sich die Einwirkungender Grundwasserabsenkung in Grenzen halten. Die dennoch auftretenden Auswirkungen auf26 HeidenfelderInternetfassung
Ziele und Begründungen - Wasser 2.2die Umwelt sind durch die Bereitstellung von Sümpfungswasser als Ausgleichswasser minderbar.Ausgehend vom Jahr 1991 verlagert sich die Beeinflussung im wesentlichen nach Nord ostenund Osten sowie nach Nordwesten. Eine exakte Trennung der Verschiebung der Beeinflussungsliniein östlicher Richtung, aufgeschlüsselt auf die <strong>Tagebau</strong>e <strong>Nochten</strong> und Reichwalde,ist nicht möglich. Bis zum Jahr 2005 besitzt jedoch der <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong> den größeren Ein fluß.Die weitere Verschiebung ist im wesentlichen auf den <strong>Tagebau</strong> Reichwalde zurückzufüh ren.Die Beeinflussungslinie verschiebt sich insgesamt von 1991 bis zum Auslauf des Tage bauesum 6 km nach Osten und um 1 km nach Nordosten, bis vor die Lausitzer Neiße. Die Verschiebungin nordwestliche Richtung ist allein auf den Ta gebau <strong>Nochten</strong> zurückzuführen und beträgt2,5 km. Im Norden endet die Beeinflussung wie bereits 1991 an der äußeren Schuppedes Muskauer Faltenbogens. Hier kommt es je nach Wirksamkeit der Entwässerungsanlagenzu einer Absenkung im Hauptgrund wasserlei ter auf + 80 m HN.Der ständige Grundwasserwiederanstieg im Süd- und Südwestbereich führt zu einer Verlagerungder Aus wirkungslinie 1991 um 0,5 bis 5 km in nördliche Richtung und zum Zeit punktdes Auslaufens des <strong>Tagebau</strong>es sogar um ca. 7 km. Dabei wird ab 1995 durch die Einstellungder Wasserhe bung im Bereich des ehemaligen <strong>Tagebau</strong>es Bärwalde die Ver schiebung beschleunigt.In Karte 3 ist die Entwicklung der Grundwasserbeeinflussung für einzelne Zeitabschnittedarge stellt.Ziel: 7Das Sümpfungswasser soll vorrangig als Ersatz- und Ausgleichswasser bzw. für dieBereitstel lung der Mindestwassermenge der Vorflut verwendet werden. Es ist daraufhinzuwirken, die jeweils erfor derliche Qualität durch Aufbereitung zu gewährleisten.Begründung:Als „Ersatzwassermaßnahme“ wird das Bereitstellen und Liefern von Wasser für bergbau lichbeeinträchtigte Wasserversorgungs- und Betriebswasseranlagen bezeichnet; zu Er satzwassermaßnahmengehört auch das Wasser für Beregnungsmaßnahmen.Als „Ausgleichswassermaßnahme“ wird das Bereitstellen und direkte Liefern von geeigne temWasser zur Feuchthaltung eines bestimmten Feuchtbiotopes oder zum Erhalt ei ner bestimmtenWasserführung eines Gewässers bezeichnet.Die Gesamtsümpfungswassermengen werden 1994 bei rund 180 Mio m³/a liegen. Bis zumJahr 1996 ergibt sich eine fallende Tendenz auf rund 160 Mio m³/a, da nur Brunnen im engerenVor feld in Betrieb genommen werden. Die maximale Förderung wird im Jahr 2000 mitrund 185 Mio m³ erreicht. Danach gehen die Mengen bis Auslauf des Tage baues kontinuierlichzurück. Aufgrund von Versickerung und Verdunstung in den Vorflutern und Reinigungsanlagensowie technologischen Faktoren ist nur mit einer Bilanzmenge von 85 % des gesamtenSümpfungs wasseraufkommens zu rechnen.HeidenfelderInternetfassung27
Ziele und Begründungen - Wasser 2.2Die Sümpfungswasserbilanz entwickelt sich wie folgt:Dargebot- aus Sümpfung(Mio m³)(m³/min)- davon nutzbar(85 % der Förderung)(Mio m³)(m³/min)Abgabe / Bedarf- Eigenverbrauch(Mio m³)(m³/min)- LAUBAG StandortSchwarze Pumpe ab 1997(Mio m³)(m³/min)- Ausgleichswasser(Mio m³)(m³/min)- in Vorfluter Spree undWeißen Schöps(Mio m³)(m³/min)1994 2005 2018 2026181,3345,0154,1293,00,681,310,520,0142,9271,7157,7300,0134,1255,00,681,3: 39,475,013,125,080,9153,7107,7205,091,6174,00,681,337,571,413,125,049,995,042,481,00,681,337,571,413,125,040,376,3 :Durch den weiträumig wirkenden Sümpfungseinfluß sind öffentliche Wasserversorgungsunternehmen, private Wasserentnehmer und der Naturhaushalt selbst betroffen. Es ist deshalber forderlich, daß wegen der gezielten Entnahme des Grundwasservorrates nicht nur denWas sernutzern, sondern auch für den Eingriff in den Naturhaushalt Ausgleich und Er satz zuleisten ist.Die Wasser quali tät des geförderten Grubenwassers ist zu überwachen. Die Anforderun genan die Was serqualität richten sich nach den vorgegebenen Nutzungszielen. Bei Erfor dernissind Maß nahmen zur Verbesserung der Wasserbeschaffenheit in den Grubenwas serreinigungsanlagen einzuleiten.Ziel: 8Das Bergbauunternehmen hat sich im Einflußbereich der Grundwasserabsenkung inangemessener Form am Waldbrandschutz zu beteiligen.Begründung:Durch die bergbauliche Grundwasserabsenkung werden Waldgebiete in unterschiedlichemAusmaß beeinflußt. In Zeiten großer Trockenheit wird die Waldbrandgefahr in ehemals grundwassernahenWaldstandorten zusätzlich durch die Grundwasserabsenkung erhöht. Mit demZiel soll den Auswirkungen der Grundwasserabsenkung entgegen gewirkt werden.Ziel: 9Die Sicherung der öffentlichen und privaten Wasserversorgung in Menge und Güte istfür die Dauer der bergbaulichen Auswirkung auf das Grundwasser zu gewährleisten.28 HeidenfelderInternetfassung
Ziele und Begründungen - Wasser 2.2Begründung:Durch die bergbauliche Grundwasserabsenkung werden Wassergewinnungsanlagen inunter schiedlichem Ausmaß beeinflußt. Der Bergbautreibende ist verpflichtet, durch geeig neteMaß nahmen Ersatz für die Beeinträchtigung zu leisten. Im Untersuchungsgebiet wird nebender bergbaulichen Wasserhebung durch nachfolgend genannte Wasserwerke Grundwasserfür Trink- und Brauchwasserzwecke gehoben:WasserwerkeWeißkeißelSchleifeGrausteinPechernGroß DübenBad MuskauGablenzKrauschwitzBoxbergFördermenge in m³/d2450240010030020016108006968000Die Wasserwerke nutzen überwiegend die pleistozänen Grundwasserleiter. Der durch denBraunkohlenbergbau hervorgerufene Einfluß auf die Wasserfassungsanlagen ist sowohl vonder geographischen Lage zum <strong>Tagebau</strong> als auch von der jeweiligen hydrologischen Situationim Umfeld der Fassungsanlage abhängig. Die Wasserwerke Schleife und Weiß keißel werdendurch die Grundwasserabsenkung erfaßt. Deshalb müssen rechtzeitig Maß nahmen, wie dieInbetriebnahme von Zusatzbrunnen realisiert werden, um negative Aus wirkungen auf diesebeiden Wasserwerke auszuschließen.Ziel: 10Bei sümpfungsbedingten Grundwasserabsenkungen sollen die für die Wasserwirtschaftoder den Naturhaushalt bedeutsamen Oberflächengewässer erhalten werden.Die Abflüsse bzw. Was serstände sollen z. B. durch Direkteinspeisung von Sümpfungswasserbzw. durch Versicke rungsmaßnahmen rechtzeitig sichergestellt werden. EineVerschlechterung der Was serbeschaffenheit soll da bei vermieden werden. Die Oberflächenwassernutzungenmüssen weiterhin ohne Schaden für den Naturhaushalt ermöglichtwerden.Begründung:Die Hauptvorfluter im Untersuchungsgebiet sind die Lausitzer Neiße und die Spree. Als nachgeordneteVorfluter sind im Norden die Struga, im Osten der Rothwassergraben und derFloßgraben und im Süden der Weiße Schöps zu nennen. Die Struga fließt von Weiß wasserüber Schleife nach Neustadt der Spree zu. Bei Mulkwitz wird über den Breiten Gra ben Sümpfungswassereinge lei tet und über die Anlandebecken bei Neustadt den Reini gungsanlagender LAUBAG zuge führt. Im Südosten verläuft der Weiße Schöps, über den Sümpfungswasserdes Tage baues <strong>Nochten</strong> der Grubenwasserreinigungsanlage Kringels dorf zugeleitetwird. Das gerei nigte Sümpfungswasser fließt wieder in den Weißen Schöps und weiter inden Vereinigten Schöps und in die Spree. In der Grubenwasserreinigungsan lage Sprey wirdebenfalls Süm pfungs wasser des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> gereinigt und an schließend der Spreezugeführt.Im Einflußgebiet des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> besitzt die Wasserbereitstellung für den Rothwassergraben,den Floßgraben sowie die verbindenden Gräben besondere Bedeutung. Der Rothwassergrabenwird z. Z. mit Zuschußwasser versorgt und muß nach seiner teilweisen Inanspruchnahmeab 2000 bis zum Wiederanstieg des Grundwas sers mit ca. 20 m³/min be schicktwerden. Die Versickerung aus dem Rothwassergraben bewirkt gleichzei tig eine natürlicheGrundwasseranreicherung.HeidenfelderInternetfassung29
Ziele und Begründungen - Wasser 2.2Für den Bereich des Trebendorfer Tiergartens und des Einzugsgebietes der Struga ist eineWasserzuführung vorzubereiten. Für den Zeitpunkt ohne Beeinflussung ist eine Wasserzu führungvon 1 m³/min für niederschlagsarme Zeiten vorgesehen. Zum Zeitpunkt der Wirk samkeitder Filter brunnen in den in der Nähe liegenden Randriegelbereichen kann diese Menge erhöhtwerden.Ziel: 11Die Wiederauffüllung des abgesenkten Grundwasserkörpers soll gezielt beschleunigtwerden, wenn sich dies aus wasserwirtschaftlicher Sicht und unter Beachtung der geotechnischenSicherheit als möglich und zweckmäßig erweist.Die Flutung des Restloches sowie die Nutzung des Sees ist in Fortschreibung des<strong>Braunkohlenplan</strong>es <strong>Nochten</strong> zu regeln.Begründung:Nach den Berechnungen des Bergbautreibenden ist, um den Restsee auf einen Wasserspiegelvon +118 m HN zu heben und das Porenvolu men des angrenzenden Gebirges zufüllen, eine Wassermenge von 1 070 Mio m ³ notwendig. Hierzu stehen etwa 40 Mio m ³ /aaus der Grund wasserneubildung und 10 Mio m ³ /a Versicke rungswasser aus den Restlö chernLohsa und Bärwalde sowie der Spree zur Verfügung. Für das aufzufüllende Gesamt volumenergibt sich eine Auffüllzeit von ca. 22 Jahren. Bei einer Wasserzuführung von 30 Mio m ³ /a ausder Lausitzer Neiße könnte die Zeitdauer der Auffüllung auf we niger als 15 Jahre reduziertwerden. Detaillierte Angaben zur Fremdwasserzuführung sowie einer evtl. wasserwirtschaftlichenNutzung des Restsees sind gegenwärtig nicht möglich. Die Klärung dieser Fragen sollteentsprechend § 7 (8) SächsLPlG im Rahmen der Fortschreibung des <strong>Braunkohlenplan</strong>eserfolgen.Ziel: 12Die im Zusammenhang mit der bergbaulichen Grundwasserabsenkung bzw. mit demGrund wasseranstieg nach Beendigung der bergbaulichen Sümpfung entstehendenBergschäden sind vom Verursacher zu regulieren.Begründung:Aufgrund der geologischen Verhältnisse im Auswirkungsbereich des <strong>Tagebau</strong>es sind Bergschädenan Bauwerken durch Bodensenkung infolge Grundwasserentzuges in unterschiedlichemAusmaß möglich. Diese Schäden sind vom Schadensbetroffenen beim Verursacher anzumelden.Sie werden nach §§ 110 - 121 BBergG bewertet und bei Anerkennung geregelt.Umsetzung der Ziele:Die Umsetzung und Konkretisierung der im Punkt 2.2 genannten Ziele ist insbeson dere im- bergrechtlichen Betriebsplanverfahren,- Verfahren nach Wasserhaushaltsgesetz und Sächsischem Wassergesetzvorzunehmen.30 HeidenfelderInternetfassung
Ziele und Begründungen - Natur und Landschaft 2.32.3 Natur und LandschaftZiel: 13Bei der durchzuführenden Wiedernutzbarmachung und Oberflächengestaltung derBergbau folgelandschaft sollen sowohl die forstwirtschaftliche und landwirtschaftlicheNutzung als auch die Belange des Naturschutzes, der Bundeswehr sowie die gewerblicheund indu strielle Nutzung und die touristische Nachfolgenutzung berücksichtigtwerden. Erreicht werden soll die landschaftsge rechte Einbindung der Bergbaufolgelandschafteinschließlich des entstehenden Restloches in den umgebenden Naturraum.Für die Nutzung der Bergbaufolgelandschaft von 9467 ha sollen folgende Flächenanteileeingeordnet werden:- Bundeswehrersatzfläche = 33 %(Waldanteil davon 60 %)- landwirtschaftliche Nutzfläche = 3 %- Restsee = 19 %- Naturschutzfläche = 18 %(Waldanteil davon 40 %)- forstwirtschaftliche Nutzfläche = 21 %- sonstige Flächen, Wege, Hausmülldeponie u.a. = 6 %Die Bundeswehrersatzfläche ist als Vorranggebiet und die Ersatzfläche für den Naturschutzals Vorbehaltsgebiet in der Karte 4 dargestellt.Begründung:Das Ziel soll dem Zweck dienen eine umfassende Nutzung der Bergbaufolgelandschaft zugewährleisten. Der Abbaubereich von 4825 ha unterliegt vor der bergbaulichen Inanspruchnahmefolgender Flächennutzung:Landwirtschaft 9 %Forstwirtschaft (davon ca. 1 % Naturschutzfläche75 %= 370 ha)Wasserfläche -sonstige Fläche 16 %Summe 100 %vor Flächeninanspruchnahme(1.1.94 - Auslauf)Im Schreiben vom 22.03.1993 hat der Bundesminister der Verteidigung der RegionalenPlanungsstelle Oberlausitz-Niederschlesien seine gebietsmäßigen Vorstellungen zur Bereitstellungvon Ersatzflächen für die im Abbaufeld Reichwalde nach dem Jahre 2000 verlorengehendenTruppenübungsplatzflächen mitgeteilt. Die Bundeswehr geht davon aus, daßschrittweise, entsprechend der Inanspruchnahme durch den <strong>Tagebau</strong> Reichwalde, eine Ersatzflächeauf den Kippen des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> vorbereitet und bereitgestellt wird. Mitder Festlegung des Vorranggebietes Bundeswehrersatzfläche im <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong> wird dieseVoraussetzung für den Weiterbetrieb des <strong>Tagebau</strong>es Reichwalde geschaffen. Die Landschaftsgestaltungin der Bundeswehrersatzfläche soll naturnah erfolgen und auch den allgemeinenZielsetzungen der Forstwirtschaft und des Naturschutzes gerecht werden.HeidenfelderInternetfassung31
Ziele und Begründungen - Natur und Landschaft 2.3Die Wiedernutzbarmachung der gekippten Flächen wird unmittelbar nach der Abschlußver kippungdurchgeführt. Die Höhengestaltung soll einen weitgehend böschungsfreien An schluß andas unverritzte Gelände erreichen und eine dauerhaft gesicherte Oberflächen entwässerunggewährleisten.Neben den zu schüttenden Nachbildungen der in Anspruch genommenen Dünen werden dieAbschlußflächen in der Regel > 2m über dem sich später wieder einstellenden Grundwasserspiegelvorge sehen, um eine uneingeschränkte Nutzung zu garantieren.Grundwassernahe Feuchtstandorte sowie die Schaffung lokaler Flachwasserzonen und Inselnim ufernahen Bereich sind unter der Voraussetzung, daß für solche Strukturen im BetriebsplanverfahrenLösungen gefunden werden, die dem Ziel „Öffentliche Sicherheit“ nichtentgegenstehen, anzulegen.Ausgehend vom gegenwärtigen Erkenntnisstand ist mit Ausnahme der Jahresscheiben 2004- 2014 ausreichend pleistozänes Material vorhanden, um eine mindestens 2 m mäch tige Abschlußschüttungfür eine forstwirtschaftliche Nutzung herstellen zu können. Ab 2004 steht inmehreren Horizonten Flaschenton an und die Grenze Pleistozän-Tertiär liegt dort höher, sodaß die ausschließliche Verwendung pleistozänen Materials zur Herstellung von Abschlußflächennicht möglich ist. Der dann zur Verfügung stehende Mischboden pleistozä nen und tertiärenMaterials bedarf einer Tiefenmelioration von min destens 1 m. Der Schutz damm <strong>Nochten</strong>steht als Mutterbodendeponie zur Verfügung. Die Torfvorkommen im Abbau gebiet können alsBodenhilfe in der Rekultivierung Verwendung finden. Grundvoraussetzung für die Herstellungqualitativ hochwertiger Flächen ist die Ver kippung pleistozäner, karbonathaltiger bindiger Kippenrohbödenmit einer Mächtigkeit > 2 m an der Ober fläche und eine möglichst homogeneZusammensetzung der Substrate.Bei der weiteren technologischen Bearbeitung des Abbaues sind Möglichkeiten einer zielgerichtetenLagerung von zwischenzeitlich überschüssigen pleistozänen Böden und deren spätereRückgewinnung und Verwendung für die Wiedernutzbarmachung zu prüfen. Bei einempositiven Ergebnis der Untersuchung ist die Anwendung geboten.Grundlage der zukünftigen Flächennutzung sind die vom Bergbautreibenden erstellten bo dengeologischenVorfeld- und Kippengutachten. Aus den bodengeologischen Kippengut achtenwerden die Maßnahmen für die Melioration der Kippenflächen abgeleitet. In der Re gel sinddie im Vorfeld anstehenden ertragsarmen Böden nicht geeignet, leistungs- und damit wettbewerbsfähigelandwirtschaftliche Nutzflächen herzustellen. Deshalb wird nur bedingt auf dieHerstellung landwirtschaftlicher Nutzflächen orientiert. In Karte 4 sind die bereits hergestelltenbzw. noch zu erstellenden landwirtschaftlichen Nutzflächen dargestellt. Das Bergbauunternehmenhat trotzdem die Pflicht, durch entsprechende Verkippungstechnologien, die optimaleBodenqualität auf den Kippenflächen zu erzielen. Die Aufforstung und Mehrfachnutzungder entstehenden Wälder, die sowohl den Anforderun gen der Holzproduk tion, der Erholungund Ökologie entspricht, sollte aber den Vorrang haben. Mit der Aufforstung wird ein naturnaherartenreicher Wald geschaffen, wobei die Gehölze standort gerecht ausge wählt werden.Voraussetzung für die Schaffung dieser Forstflächen ist die Herstellung von Kippenflächen,die den forstwirtschaftlichen Anforderungen entsprechen.Es ist ein Verhältnis von Nadelwald zu Laubwald von 60 : 40 anzustreben. Das würde dem Charakterder Landschaft vor dem Bergbau entsprechen. Von Bedeutung ist, daß bewußt Ge röllundSukzessionsflächen sowie Strauchzonen vorgesehen werden, die in Verbin dung mit einergezielten Herstellung von dünenartigen Erhebungen neue Lebensräume für Pflanzen und Tiereschaffen. In den Bereichen, wo durch den extrem hohen Flaschentonanfall eine Teichlandschaftentstehen wird, bietet sich ein Reservat für die bisher hier vor kommende Lausitzer Tieflandfichtean. Durch die planmäßige Verkippung von bindigen Bö den in ausge wählten Bereichenist die Gestaltung einer möglichst großen Zahl von Feuchtbiotopen, in der allgemein durchgeotechnische Bedingungen (Mindestbodenüber deckung des künftigen Grundwasserspiegels2 m) trockenen Kippen landschaft gegeben. Diese Feuchtbiotope kön nen ihre ökologische32 HeidenfelderInternetfassung
Ziele und Begründungen - Natur und Landschaft 2.3Funktion mit Hilfe von Niederschlags- oder Ausgleichwasser unabhängig vom Grundwasserwiederanstiegauf nehmen.Als sonstige Nutzflächen werden Straßen und Wege sowie die Hausmülldeponie ausgewiesen.Neben den unter Pkt. 2.7 be schriebenen Maßnahmen der Straßenverlegung sind Wirtschaftswegeerforder lich.Die natürli chen Vorfluter Spree und Struga behalten auch in der Zukunft ihre Bedeu tung, wobeidurch eine gezielte Reliefgestaltung eine ordnungsgemäße Wasserableitung zu sichernist. In den Fachplanungen sind Untersuchungen zu führen, die die Renaturierung des altenSpreelaufes im Bereich der ehemaligen Dorflage Tzschelln zum Inhalt haben.Flächen, bei denen zwischen ihrer Herstellung und ihrer erneuten bergmännischen Nutzunglängere Zeiträume liegen, sind entsprechend den Erfordernissen des Immissionsschutzes mitZwischenbegrünung zu versehen.Im bergbaubedingten Restraum wird durch das Massendefizit ein See entstehen, dessenGröße bei einer Stauhöhe von +118 m HN ca. 1 767 ha betragen wird. Sein Anteil an der gesamtenWiedernutzbarmachungsfläche des Abbaufeldes <strong>Nochten</strong> beträgt damit etwa 19 %.Für den Restsee bietet sich eine Nutzung als Naherholungsgebiet für die Stadt Weißwasserund die umliegenden Gemeinden an. Die unter dem künftigen Wasserspiegel liegenden Flächenwerden zwischenbegrünt, da der Wasserspiegel nur sehr langsam an steigen wird.Die im <strong>Braunkohlenplan</strong> nach § 6 (1) i.V.m. § 7 (2), § 8 (1) SächsLPlG auf der Grundlage einerBewertung des Zustandes von Natur und Landschaft mit ihrer gewachsenen Siedlungstrukturaufgestellten Ziele für die Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft sind bei der Aufstellung desRegionalplanes zu beachten.Ziel: 14Die bergbaubedingten lang andauernden Eingriffe und deren Auswirkungen auf Naturund Landschaft im Abbaubereich sollen - soweit möglich - bereits während des Eingriffes,spätestens im Zuge der Wiedernutzbarmachung der Erdoberfläche ausgeglichenwerden, andernfalls sind sie durch entsprechende Maßnahmen zu ersetzen.Für den Naturschutz sind Ersatzflächen von ca. 18 % der wiedernutzbar gemachtenFläche vorzusehen.Es ist darauf hinzuwirken, das Wegenetz innerhalb der als Vorbehaltsgebiete - Naturschutzbezeichneten Flächen vorrangig als befestigte Wege auszuführen.Die im Vorfeld des fortschreitenden <strong>Tagebau</strong>es bestehenden ökologischen Funktionen,ins besondere der Naturschutzgebiete, sind möglichst lange zu erhalten.Begründung:Der erhebliche Eingriff des Braunkohlenabbaues in den Naturhaushalt, die Vernichtung ökologischerFunktionen und die Wiederherstellung des Naturhaushaltes nach dem Abbau undder Verkippung erfordern unter Berücksichtigung des § 8 BNatSchG sowie §§ 8 bis 12 desSächsNatSchG die Minde rung der durch den Bergbau verursachten negativen Auswirkungendieses Eingriffes durch Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen.Die notwendigen Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sind durch weiterzuführende ökologischeUntersuchungen zum Beeinflussungsgebiet des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> zu konkretisieren.Als landschaftsökologische Entscheidungsgrundlage für notwendige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmensind Biotopkartierungen und weitere Untersuchungen der betreffenden Gebietedurchzuführen. Die Maßnahmen und Standorte sind im einzelnen mit den Naturschutzbehördenzu bestimmen.Im Abbaugebiet vorkommende Pflanzen- und Tierarten, Lebensräume und Biotopstrukturensind für die Arterhaltung in der Region von grundlegender Bedeutung. Es ist erforderlich, alsErsatz für die im Abbaufeld verlorengehenden Lebensräume (u. a. vier Naturschutzge biete),Strategien zur Gestaltung neuer Naturschutzobjekte zu entwickeln.HeidenfelderInternetfassung33
Ziele und Begründungen - Natur und Landschaft 2.3In der Bergbaufolgelandschaft sind aufgrund des derzeitigen Arbeitsstandes drei ökologischeVorbehaltsgebiete für den Naturschutz ausgewiesen (siehe Karte 4), deren genaue örtlicheLage und Begrenzung mit der weiteren Bearbeitung zu präzisieren und zu Vorranggebietenfür den Naturschutz zu entwickeln sind.1. Sukzessionsfläche - (im Nordwestteil der bereits bestehenden Kippenfläche),vorgesehene Fläche: 70 haFunktion: Biotop- und Artenschutz;2. Populationsgebiet (Birkhuhn) (im Südostteil des Abbaufeldes)vorgesehene Fläche: ca. 750 ha Heide- und FeuchtbiotopFunktion: u. a. Erhalt der Flachlandpopulation des Birkhuhnes;3. ökologisches Vorbehaltsgebiet am Rand der Trebendorfer Hochfläche mit dem fürdie Wälder um Weißwasser typischen Arteninventar;vorgesehene Fläche: ca. 800 haFunktion: forstliches NaturschutzgebietZusätzlich müssen für die Wiederausbreitung der Calluna- und Zwergstrauchheide sowie vonBorstgrasrasen in der späteren Bergbaufolgelandschaft Initialstandorte geschaffen werden.Ziel: 15Die Funktionsfähigkeit der im Einwirkungsbereich der <strong>Tagebau</strong>e liegenden Natur- undLandschaftsschutzgebiete sowie der Flächennaturdenkmale soll gesichert werden.Zum Schutze seltener und geschützter Arten der Flora und Fauna sowie zur Aufnahmedieser Arten aus durch den Bergbau verlorengehenden Naturschutzgebieten sollen insbesonderedie einstweilig gesicherten Naturschutzgebiete im Südbereich des Braunsteichesund des Trebendorfer Tiergartens sowie andere wertvolle Land schaftsgebieteentwickelt werden.Begründung:Ziel ist es, die im Einwirkungsbereich des <strong>Tagebau</strong>es liegenden und im Punkt 1.5.2 aufgeführtenSchutzgebiete vor den Wirkungen des <strong>Tagebau</strong>es zu schützen.Besonders die Schutzgebiete Trebendorfer Tiergarten sowie Südbereich des Braunsteichessollen dem Erhalt und der Entwicklung Oberlausitzer Landschaftselemente und dem Schutzund der Aufnahme seltener und geschützter Arten aus dem Abbaubereich des <strong>Tagebau</strong>esdienen. Mit der Aufrechterhaltung des Wasserzuflusses in ausreichender Qualität zu denSchutzgebieten unter Berücksichtigung der Gewässer ökologie kann dieses Ziel erreicht werden.Umsetzung der Ziele:Die Umsetzung und Konkretisierung der im Punkt 2.3 genannten Ziele ist insbeson dere im- bergrechtlichen Betriebsplanverfahren,- Verfahren nach Bundesnaturschutzgesetz und Sächsischem Naturschutzgesetzvorzunehmen.34 HeidenfelderInternetfassung
Ziele und Begründungen - Staub- und Lärmimmission 2.4In Mühlrose sind keine Immissionswertüberschreitungen für Staubnieder schlag nach TA Luftim Be trachtungszeitraum zu verzeichnen. Für die weiteren im Abbau- und <strong>Tagebau</strong>rand gebietlie genden Orte Weißwasser, Trebendorf, Schleife, Rohne und Mulkwitz wird einge schätzt,daß gegenwärtig keine Überschreitungen der Immissionswerte auf treten.Der Immissionswert der 22. BImSchV für Schwebestaub beträgt 150 µg/m³ (arithmetischesMittel aller während des Jahres gemessenen Tagesmittelwerte) und 300 µg/m³ (95-Prozentwertder Summenhäufigkeit aller während des Jahres gemessenen Tagesmittelwerte).In Auswertung der Meßergebnisse und zur Beurteilung der zu erwartenden Belastung dero. g. Orte sind durch das Unternehmen zum jeweiligen Planstand zugelassene Institutionenmit der Erstellung aktueller und prognostischer Gutachten zu beauftragen. Diese Gutachtensind Grundlage für die Planung und Realisierung von Staubschutzmaßnahmen. Die Wirksamkeitder durchgeführten Maßnahmen wird meßtechnisch erfaßt und bewertet.In den betroffenen Orten wurden folgende Staubschutzmaßnahmen realisiert bzw. werdendem gegenwärtigen Erkenntnisstand entsprechend in Betracht gezogen:Mühlrose- Bisher wurden der bepflanzte Schutzdamm, die Beregnung bzw. die Besprühung desSchutzdammes der Kohleverladung (insbesondere des Bereiches des Grabenbunkers)und der Abwurfparabel des Haldenschüttgerätes, die Schutzbepflanzung und die Rekultivierungdes östlich Mühlrose liegenden Kopfböschungssystems der Förderbrückenkip perealisiert.- In der Ortslage Mühlrose müssen Schutzmaßnahmen in Form der weiteren Ortsbe grünung,des Erhaltes, der Pflege und Ergänzung der bestehenden Waldflächen wirk sam werden.<strong>Nochten</strong>- Bisher wurden die Schutzpflanzungen, der Schutzdamm und dessen Bepflanzung und Beregnungsowie die Ortsbegrünung realisiert.- Von Bedeutung für den Ort ist die technologisch frühestmögliche Abschlußverkippung unddie Nutzung des Schutzdammes zur Rekultivierung im Ortslagenbereich.Sprey- An der Ortslage Sprey werden die vorhandenen Lücken des Waldbestandes geschlos senund entsprechend den örtlichen Gegebenheiten neue Schutzpflanzungen durchge führt.Weißwasser- Die um 1985 am Stadtrand Weißwasser realisierte Grünschutzpflanzung entspricht nichtden Anforderungen an den Immissionsschutz.- Es sind weitere Klärungen zwischen dem Braunkohlenunternehmen, der Stadtverwaltungund dem Forstamt zu Ergänzungs- und Verdichtungspflanzungen im vorhandenen Waldbestandund optimalen Neupflanzungen in den Waldbrandflächen zwischen der Stadt Weißwasserund dem <strong>Tagebau</strong> unter Einbeziehung von Teilen der Sicherheitszo ne notwendig.- Den technologischen Möglichkeiten entsprechend wird eine maximale Annäherungder Abschlußverkippung mit anschließender Rekultivierung an die Förderbrückenkippean gestrebt, um den Anteil der mit hohen Aufwendungen verbundenen36 HeidenfelderInternetfassung
Ziele und Begründungen - Staub- und Lärmimmission 2.4Zwischenbegrünung der vorübergehend entstehenden Förderbrückenkippe auf ein Minimumzu beschränken.Trebendorf- Unter Einbeziehung der Sicherheitszone wird eine Schutzbepflanzung entlang der <strong>Tagebau</strong>oberkantein Betracht gezogen.- Die noch vorhandenen Forstflächen sollten erhalten und im Hinblick auf eine spätereSchutzwirkung ergänzt und bewirtschaftet werden.- Für den Ort wird eine Ortsbegrünung vorgesehen.Schleife, Rohne, Mulkwitz- Im entstehenden Restraum des <strong>Tagebau</strong>es wird mit Erreichen des ent sprechenden Abbaustandesmit der Gestaltung der Zwischenbegrünung begonnen.- Die noch vorhandenen Forstflächen sollten erhalten und im Hinblick auf eine spätereSchutzwirkung ergänzt werden.- Für die Orte wird eine Ortsbegrünung vorgesehen.Ziel: 17Im Jahre 1996 ist eine neue Kohleverladung auf der Innenkippe (Karte 1) mit einer Entfernungzum Ort Mühlrose von ca. 4 km zu errichten. Die Kohleverladung Mühlrose ist1997/98 zurückzubauen - die Fläche ist zu renaturieren - angrenzende Bereiche sind zubegrünen.Begründung:Ziel ist es, durch die Zwischenlagerung der Kohle, die Kohleverladung und den Kohle-Zugverkehrverursachte schädliche Einwirkungen auf die Bevölkerung des Ortes Mühlrose zuvermeiden.- LärmimmissionZiel: 18Die angrenzenden Ortslagen sind rechtzeitig vor dem Abbau durch geeignete Maßnahmenvor Lärmemissionen des <strong>Tagebau</strong>es nach dem Stand der Technik wirksam zuschützen; dabei sind die gebietsbezogenen Immissionsrichtwerte der TA Lärm einzuhalten.Die gebotenen Lärmschutzmaßnahmen sind vorrangig an der Quelle der Emission,insbesondere an den Hauptantrieben, Hauptbändern und Graborganen durchzuführen.Als Maßnahmen sollen insbesondere das Errichten von Immissionsschutzwällen, Bepflanzungen,Abstandsregelungen und Absenken der obersten Strosse entsprechendden technischen und bergsicherheitlichen Möglichkeiten zur Anwendung kommen.Nach dem Fortfall der Ursache sollen die erstellten Anlagen wieder entfernt werden, sofernund soweit sie nicht einem in anderen Planungen festgelegten Verwendungszweckzugeführt werden.Begründung:Nach den Vorschriften des § 22 (1) BImSchG sind alle durch die Bergbautätigkeit unmittelbarund mittelbar verursachten schädlichen Einwirkungen auf die Bevölkerung undHeidenfelderInternetfassung37
Ziele und Begründungen - Staub- und Lärmimmission 2.4auf die Umwelt, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind, zu verhindern; nach demStand der Technik unvermeidbare schädliche Einwirkungen sind auf ein Mindestmaß zu beschränken.Dabei können Immissionsschutzmaßnahmen des passiven Immissionsschutzeserforderlich werden (z.B. Schutzwälle und Anpflanzungen von Grüngürteln).Lärm läßt sich definieren als jede Art von Schall, durch den Menschen gestört, belästigt odergesundheitlich geschädigt werden (vgl. § 3 BImSchG). Der Betrieb eines Braunkohlentagebauesverur sacht z. T. erhebliche Lärmemissionen, die von ei ner Vielzahl unterschiedlicherLärmquel len ausgehen können.Der genannte Beginn der erhöhten Belastungen der Orte durch Staubimmis sionen trifft auchfür die Lärmimmission zu. Deshalb wird seit Januar 1993 im Einflußgebiet des Tage baues einImmissionsmeßnetz für Lärm errichtet. Das Immissionsmeßnetz für Lärm wird in enger Anlehnungan das bestehende Staubniederschlagsmeßnetz gestaltet. Diese Verfah rensweiseermöglicht die Bewertung eines einheitlichen Einwirkungsbereiches von Staub und Lärm. Esist vorgesehen, Meßpunkte in Ortslagen bis zu einer Entfernung von 2,5 km zum aktiven <strong>Tagebau</strong>einzurichten. Das Meßnetz ist entsprechend der <strong>Tagebau</strong>ent wick lung in Abstimmungmit dem Bergamt Hoyerswerda zu aktualisieren.Zur Bewertung der bestehenden Lärmbelastung der Orte Mühlrose und <strong>Nochten</strong> wurdenGut achten erarbeitet und Lärmimmissionsmessungen durchgeführt. Durch die Kohleverladungwerden z. Z. in Mühlrose nach einem Gutachten der Müller-BBM GmbH, Dresden,Ta gesrichtwertüberschreitungen bis 6 dB(A) und Nachtrichtwertüberschreitungen bis 18dB(A) verursacht. Die Tagesrichtwerte der TA Lärm betragen 60 dB(A), die Nachtrichtwerte45 dB(A).Für die Ortslage <strong>Nochten</strong> prognostizierte das Gutachten der Müller-BBM GmbH für den ZeitraumDezember 1991 bis Dezember 1992 Tagesrichtwertüberschreitungen bis 10 dB(A) undNachtrichtwertüberschreitungen bis 23 dB(A).Für Mühlrose und <strong>Nochten</strong> ist mit keiner weiteren Verschärfung der Lärmbelastung zu rechnen.Die Lärmbelastung wird durch weitere Schutzmaßnahmen reduziert und in <strong>Nochten</strong> verringertsie sich zusätzlich durch den zunehmenden Abstand des aktiven Ta ge baues von derOrtschaft.Die beschriebenen Maßnahmen des Staubimmissions schutzes (insbesondere Verlegung derKohleverladung) sind zum großen Teil auch Maß nahmen des Lärmimmis sionsschutzes.Für die durch eine erhöhte Lärmimmission betroffenen Ortschaften sind Schutzmaßnahmentechnischer, planerischer und organisatorischer Art vorzusehen.Die sich aus der vorgesehenen <strong>Tagebau</strong>weiterführung ergebenden Änderungen auftretenderLärmimmissionen sind in regelmäßigen Abständen gutachterlich zu bewerten.Umsetzung der Ziele:Die Umsetzung und Konkretisierung der im Punkt 2.4 genannten Ziele ist insbeson dere imbergrechtlichen Betriebsplanverfahren nach immissionsschutzrechtlichen Grundsätzen vorzunehmen.38 HeidenfelderInternetfassung
Ziele und Begründungen - Abfallwirtschaft, Abwässer und Bodenschutz 2.52.5 Abfallwirtschaft, Abwässer und BodenschutzZiel: 19Die im <strong>Tagebau</strong> anfallenden Reststoffe, Abwässer und Abfälle sind ordnungsgemäß zuent sorgen.Begründung:Wieder verwertbare Stoffe oder Reststoffe im Sinne des § 2 (3) AbfG sollen unter Be ach tunggesetzlicher Bestimmungen einer stofflichen Verwertung zugeführt werden.Abwässer (Sanitärabwässer, Hilfsgerätewaschplätze etc.) sind in Übereinstimmung mit denge setzlichen Anforderungen entweder in betriebseigenen oder kommunalen Abwasserbehandlungsanlagen zu reinigen.Alle nichtbergbaulichen Abfälle sind in dafür zugelassenen Anlagen und Einrichtungen zuentsorgen. Die Entsorgung von Abfällen im Sinne des § 2 (2) AbfG ist in Übereinstimmungmit § 11 (3) AbfG der zuständigen Behörde nachzuweisen. Bergbauspezifische Abfälle, fürdie die Vorschriften des § 1 (3) Ziffer 3 AbfG keine Anwendung finden, sind nach den Bestimmungendes Bundesberggesetzes zu behandeln. Nicht besonders überwachungsbedürftigeAbfälle sind auf dafür zugelassenen Deponien zu entsorgen, bergbauliche Reststoffe sind zuverwerten.Ziel: 20Deponien und Altlastenverdachtsflächen sollen nach der Zielhierarchie erfassen - bewerten- sichern (sanieren) behandelt werden.Altablagerungen, die im Abbaubereich liegen, sind zur Vermeidung negativer Einflüsseauf das Grundwasser nicht zusammen mit dem Abraum zu verkippen. Sie sind vor derbergbauli chen Inanspruchnahme zu entsorgen.Begründung:Die Erfassung und Bewertung der im Abbaubereich befindlichen Deponien und Altlastenverdachtsflächenist nach den Prinzipien des Sächsischen Altlasten - Programmes vorzunehmen.Für die vom Abbau betroffenen Altlasten werden vor der Inan spruch nahme durch dasUnternehmen Gefährdungsabschätzungen angefertigt. Die Sa nierung (einschließlich Sicherung)der Altlasten bzw. die Entsorgung dabei anfallender Abfälle ist zu veranlassen.Ziel: 21Auf den wiedernutzbargemachten Flächen des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> wird jeweils einVorbehaltsgebiet für eine Hausmülldeponie und ein Vorbehaltsgebiet für ein Gipsdepot- wie in Karte 4 dargestellt - ausgewiesen.Begründung:Mit dem Ziel wird die geordnete Ablagerung von Hausmüll für die Region gewährleistet unddie Deponierung der bei der Braunkohleverstromung anfallenden Reststoffe bis zu ihrer Verwertunggesichert.HeidenfelderInternetfassung39
Ziele und Begründungen - Archäologie und Denkmalpflege 2.6Im rückwärtigen Kippenbereich östlich der noch bestehenden Kohlebahn ist die Errichtungeiner geordneten Hausmülldeponie möglich. Der Standort ist in Karte 4 dargestellt. Die Nutzungdieses Standortes hängt vom Ergebnis der Standortsuche für eine geordnete Haus- undSiedlungsmülldeponie des Regionalen Abfallverbandes Oberlausitz-Niederschlesien (RA-VON) ab.Im Südwesten der Innenkippe ist ein Gipsdepot (REA-Gips, REA-Ab wasser und Asche) mitInbetriebnahme 1995 geplant. Der Standort ist als Vorbehaltsflä che in Karte 4 dargestellt. Fürdie Errichtung und das Betreiben dieser Deponie ist ein gesondertes Genehmigungsverfahrendurchzuführen.Zur zeitlich begrenzten Überlagerung des Vorranggebietes Bundeswehrersatzfläche unddes Gipsdepots wurde im Verfahren zwischen dem Bergbautreibenden und der BundeswehrÜbereinstimmung erzielt.Umsetzung der Ziele:Die Umsetzung und Konkretisierung der unter Punkt 2.5 genannten Ziele ist insbe sondere imbergrechtlichen Betriebsverfahren sowie im Verfahren nach dem Abfallge setz und dem ErstenGesetz zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz im Freistaat Sachsen vorzunehmen.2.6 Archäologie und DenkmalpflegeZiel: 22Die fachgerechte Untersuchung und Bergung von vorhandenen Kulturdenkmalen imSinne § 2 des SächsDSchG im Abbaubereich soll vom Bergbautreibenden ermögli chtwerden.Begründung:Es ist zu erwarten, daß im Abbaubereich kulturgeschichtliche Bodendenkmale vorhandensind. Den zuständigen Behörden ist rechtzeitig Gelegenheit zur wissenschaftlichen Untersuchungund zur Bergung zu geben. Bergbaulich bedingte negative Auswirkungen auf Kulturdenkmaleaußerhalb des Abbaubereiches sollten weitestgehend vermieden werden. Vor derInanspruchnahme von Ortschaftsteilen ist eine vollständige Dokumentation der Einzelobjekteunter Einbeziehung des Sorbischen Institutes, Bautzen, vorzunehmen. Entsprechend demSächsDSchG vom 03.03.93 unterstützt das Bergbauunternehmen diese Arbeiten der Behörden.Umsetzung des Zieles:Die Umsetzung und Konkretisierung des Zieles ist insbesondere im- bergrechtlichen Betriebsplanverfahren,- Verfahren nach dem Sächsischen Denkmalschutzgesetzvorzunehmen.40 HeidenfelderInternetfassung
Ziele und Begründungen - Siedlungswesen, Bevölkerung und Infrastruktur 2.72.7 Siedlungswesen, Bevölkerung und InfrastrukturZiel: 23Die durch den Weiterbetrieb des <strong>Tagebau</strong>es unvermeidbaren Umsiedlungen sollenfür die da von betroffenen Menschen sozialverträglich gestaltet werden. Eine sozialverträgli che Umsiedlung beinhaltet eine Minimierung aller möglichen Belastungen fürdie Bür ger und soll durch kon krete Angebote zur Kompensation bzw. durch Ideenangebotefür eine zukunftsorientierte Ge staltung des neuen Lebensraumes erreicht werden.Von Umsiedlung betroffene Menschen müssen die Chance bekommen, in neuer Siedlungsgemeinschaftzusammenzufinden. Es müssen geeignete Entschädigungslösungenangeboten werden, die die Schaffung vergleich baren Lebensraumes ermögli chen.Unvermeidbare Umsiedlungen sind in Fortschreibung des <strong>Braunkohlenplan</strong>es <strong>Nochten</strong>zu regeln.Begründung:Neben der Wirtschaftlichkeit und der Umweltverträglichkeit stellt die Sozialverträglichkeit einweiteres Abwägungskriterium zur raumordnerischen Beurteilung von Braunkohlentagebauendar. In diesem Zusammen hang wird darunter u. a. die Verträglichkeit einer Umsiedlung mitden sozialen und indivi duellen Ver hältnissen der Betroffenen zum jetzigen Zeitpunkt und inabsehbarer Zukunft verstanden. D. h., es ist zu prüfen, wie die geplante Maßnahme und ihreDurchführung sich mit den sozialen und individuellen Verhältnissen verträgt und welche Lösungengefunden werden müssen, damit die Umsiedlung von der überwiegenden Mehrheitder Umsiedler als sozialverträglich akzeptiert werden kann. Aus der Sicht der Umsiedler sozialverträglichwird eine Umsiedlung nur dann sein können, wenn sie von einer Idee getragenwird, die weit über die bloße Bewältigung des Neubaus und des Umzugs hinausgeht. „Sozialverträglichkeit“wird erreicht durch die Mini mierung materieller und immaterieller Be lastungen,durch konkrete Angebote zur Kompensa tion, aber auch durch das Angebot von Ideen für einezukunftsorientierte Gestaltung des Lebensraumes. Die Umsiedlung eröffnet auch die Chance,die Zukunft zu gestalten.Deshalb sollte immer von dem Prinzip der gemeinsamen oder geschlossenen Umsiedlung derim Abbaugebiet wohnenden Bevölkerung ausgegangen werden.Innerhalb der Sicherheitslinie des <strong>Tagebau</strong>es befindet sich Wohnbebauung der GemeindenTrebendorf, Rohne, Mulkwitz und Mühlrose. Die Innenbereiche dieser Gemeinden werdenvon der Sicherheitszone nicht betroffen.Nach Ermittlungen des Bergbauunternehmens (teilweise mit Schätzungen - März 1993) istder in der nachfolgen den Tabelle angegebene Umfang von Umsiedlungen für den Kohleabbauunumgänglich:AnzahlJahrOrt Einwohner Anwesen Abschluß der InanspruchnahmeVerlegungForsthaus Eichbergunbewohnt 1 2002Forsthaus Altteich 5 1 2003 2005Torhaus Schwerer unbewohnt 1 2003 2005BergRohne Ausbauten 39 13 2021 2023 - 2025Trebendorf Ausbauten123 35 2017 2019 - 2023Mulkwitz Aufbauten9 2 2024 2026Mühlrose 40 11 2020 2022 - 2026HeidenfelderInternetfassung41
Ziele und Begründungen - Siedlungswesen, Bevölkerung und Infrastruktur 2.7Da abgesehen vom Forsthaus Altteich eine Umsiedlung erst nach dem Jahr 2017 notwen digwird, sollten die für die Umsiedlung erforderlichen sozialen Rahmenbedingungen erst mit dertatsächlich betroffenen Generation, ca. 10 Jahre vor Beginn der Umsiedlung, in ei nem gesondertenTeilplan geklärt werden.Bei entsprechendem Bedarf ist es prinzipiell möglich, Kippenflächen für Gewerbeneuansiedlungenvor zusehen. Grundlage einer eventuellen Bebauung von Kippenflächen ist dieeindeutige Erfas sung und die theoretische Bewertung von Setzungen und Sackungen infolgevon Eigen last und Grundwasseranstieg an definierten Standorten. Hierbei ist besondersauf unter schiedliches Verhalten der Kippenoberfläche zu achten. Erst nach hinreichenderBegutach tung können bei positiven Ergebnissen massive Bebauungen von Kippenflächen inErwä gung gezogen werden.Ziel: 24Siedlungsgebiete, die innerhalb des Abbaubereiches nordwestlich der in der Karte 1dargestellten Linie A/B liegen, sind im Rahmen der Förderprogramme und bei Maßnahmender Infrastruktur den außerhalb des Abbaubereiches liegenden Siedlungsgebietengleichzusetzen.Begründung:Die bergbauliche Inanspruchnahme des Gebietes nordwestlich der in Karte 1 dargestelltenLinie A/B erfolgt bei der gegenwärtigen Abbaukonzeption nach 2015.Für das Gebiet sollen keine Nachteile bezüglich der Einbeziehung in Förderprogramme undMaßnahmen der infrastrukturellen Entwicklung eintreten.Ziel: 25Die einstmals im Bergbaugebiet vorgefundenen soziokulturellen Gegebenheiten sollenin sachgerechter Weise wieder verwurzelt werden.Begründung:Vor dem Hintergrund der historischen Entwicklung des Gebietes ist in Zusammenarbeit undausgehend von den Interessen der umliegenden Gemeinden gleichfalls die prägende Eigenartder deutsch-sorbischen Mentalität widerzuspiegeln. Dies kann z.B. durch gezielte Verwendungvon ehemaligen Flur-, Wege- und Gewässernamen, bei Neubesiedlung auch durchcharakteristische Bauweise oder durch Nachbildung von Bodendenkmalen erfolgen.Ziel: 26Das um den <strong>Tagebau</strong> verbleibende Straßennetz soll dem Bedarf entsprechend so ergänztwerden, daß seine Leistungsfähigkeit erhalten bleibt und seine Konzeption inVer bindung mit den Er satzstraßen eine sinnvolle Funktion ergibt.Das beinhaltet, daß für die Trassenführung der geplanten Verbindungsstraße zwischenWeißwasser und Hoyerswerda (B 156a) die Abbaubegrenzung des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong>zu beachten ist.Die Verbindungsstraße zwischen Neustadt/Spree -- Sprey -- Anschluß B 156 ist in Anlehnungan die vorhandene Betriebsstraße der LAUBAG auszubauen und in den Regionalplanaufzunehmen.Nach Abschluß der Rekultivierung ist die B 156 zwischen Weißwasser und Boxbergüber die verkippten Flächen des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> zurückzuverlegen.42 HeidenfelderInternetfassung
Ziele und Begründungen - Siedlungswesen, Bevölkerung und Infrastruktur 2.7Begründung:Das Linienbestimmungsverfahren zur Planung der B 156a wurde noch nicht durchgeführt,so daß die Linienführung vom Bundesverkehrsministerium noch nicht festgesetzt wurde.Der vom Straßenbauamt Bautzen bisher untersuchte Trassenkorridor beinhaltet im RaumSchleife -- Trebendorf auch eine mögliche Trassenführung außerhalb der Abbaugrenze des<strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong>. Dabei ist die Möglichkeit der Führung der B 156a (Neubau) zwischendem nördlichen Rand der Sicherheitslinie gemäß Ziel 3 bzw. des Vorranggebietes für dieBraunkohlengewinnung gemäß Ziel 2 und der Eisenbahnstrecke Spremberg/Hoyerswerda--Weißwasser zu gewährleisten.Mit dieser Straßenverbindung werden die deutsch-sorbischen Gemeinden (z.B. Mühlrose,Neustadt/Spree), die am Rande des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> liegen, an das überregionale Straßennetzin Richtung Bautzen und Görlitz angebunden. Gleichzeitig kann eine leistungsfähigeStraßenverbindung zwischen den Industriestandorten und Einpendlerzielen KraftwerkBoxberg und Schwarze Pumpe die wirtschaftlichen und arbeitsräumlichen Verflechtungenaufwerten, da mit dieser direkten Verbindung Fahrzeiten und Umwege verkürzt werden.Im Jahr 2015 sind die Voraussetzungen für eine Rückverlegung der B 156 über die verkipptenFlächen des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> gegeben. Mit der Rückverlegung verkürzt sich die Streckenlängevon gegenwärtig 14,9 km auf 9,5 km zwischen Boxberg und Weißwasser. Die Karte 1enthält einen Trassenvorschlag für die Rückverlegung der B 156.Ziel: 27Mit der Wiedernutzbarmachung soll ein Rad- und Wanderweg zwischen Mühlrose undNeustadt - wie in Karte 1 dargestellt - angelegt werden.Die durch die Inanspruchnahme der Straße Schleife -- Mühlrose entstehende Verschlechterungder Infrastruktur soll durch eine Straße Mühlrose -- „rückverlegte“ B 156(Karte 1) ausgeglichen werden.Begründung:Infrastrukturelle Defizite, die durch die Unterbrechung bestehender Verbindungen verursachtwurden oder werden, können mit diesen Straßen ausgeglichen werden.Nach Abschluß der Wiedernutzbarmachung können beide Maßnahmen realisiert werden.Durch die Lage des Restsees nördlich von Mühlrose bietet sich eine Streckenführung Mühlroseüber die B 156 nach Weißwasser und Boxberg an.Umsetzung der Ziele:Die Umsetzung und Konkretisierung der unter Punkt 2.7 genannten Ziele ist insbe sondere- im Bauleitplanverfahren,- im Planfeststellungsverfahrenvorzunehmen.HeidenfelderInternetfassung43
Ziele und Begründungen - Leitungen und Bandanlagen 2.82.8 Leitungen und BandanlagenZiel: 28Bevor durch den Abbaufortschritt des <strong>Tagebau</strong>es Versorgungsleitungen unterbro chenwerden, ist die jeweilige Versorgung durch geeignete Ersatzmaßnahmen recht zeitigsicherzustellen.Begründung:Im Abbaugebiet des <strong>Tagebau</strong>es verlaufen Fernmeldekabel der TELEKOM. Für diese Leitungenist Ersatz zu schaffen.Für die Energieversorgung des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> wird bis 2006 auf der Innenkippe nordwestlichdes Kraftwerkes Boxberg ein 110-kV-Umspannwerk mit einer Maximalleistung von160 MW errichtet. Mit seiner Inbetriebnahme wird die Übergabestelle der ESSAG im Umspannwerk<strong>Nochten</strong> überflüssig und zurückgebaut.Die im Abbaugebiet liegenden Wohnhäuser, die Tagesanlagen des <strong>Tagebau</strong>es und die TongrubeMühlrose sind an das Trinkwassernetz angeschlossen. Die Trinkwasserleitungen werdenaufgrund der bergbaulichen Inanspruchnahme der entsprechenden Objekte ohne Schaffungvon Ersatzleitungen zurückgebaut.Die zwischen den Forsthäusern Eichberg und Weißwasser liegende Ferngasleitung ist außerBetrieb und wird in Abstimmung mit dem Rechtsträger zurückgebaut. Betriebliche Ver sorgungsleitungenund Verkehrswege liegen in der Regel gebündelt in der Sicherheitszone oderim offenen <strong>Tagebau</strong> bzw. auf der Innenkippe. Die Verbindung zwischen der neuen Kohleverladungmit der vorhandenen Kohlebahn (Karte 1) wird auf kürzestem Wege hergestellt. Dasbetrifft auch eine eventuelle Bandverbindung zum KW Boxberg.Umsetzung des Zieles:Die Umsetzung und Konkretisierung des Zieles ist insbesondere- im bergrechtlichen Betriebsplanverfahrenvorzunehmen.44 HeidenfelderInternetfassung
Quellenverzeichnis3 QuellenverzeichnisVerzeichnis der Gesetze und Verordnungen:AbfGGesetz über die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (Abfallgesetz)i.d.F. der Bekanntmachung vom 27.08.1986 (BGBl. IS.1410, ber. durch BGBl. 1986 I S. 1501/BGBl. III 2129-15),zuletzt geändert durch Art. 6 Investitionserleichterungs- undWohnbauland G vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)BBergG Bundesberggesetz vom 13.08.1980 (BGBI. I S. 1310,BGBl. III 750-15), zuletzt geändert durch Art 3 Zweites G zurÄnderung des Gerätesicherheits G vom 26.08.1992BImschGBNatSchGEGABROGSächsLPIGGesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durchLuftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnlicheVorgänge (Bundes-Immissionschutzgesetz) i.d.F. der Bekanntmachungvom 14.05.1990 (BGBI. I S. 880), zuletzt geändertdurch Art. 8 Investitionserleichterungs- und Wohnbauland G vom22.04.1993 (BGBl. I S. 466)Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz) i.d.F. der Bekanntmachung vom 12.03.1987(BGBI. I S. 889), zuletzt geändert durch Art. 5 Investitionserleichterungs- und Wohnbauland G vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 466)Erstes Gesetz zur Abfallwirtschaft und zum Bodenschutz imFreistaat Sachsen vom 12.08.1991 (Sächs GVBl. 306)Raumordnungsgesetz vom 08.04.1965 i.d.F. der Bekanntmachungvom 28.04.1993 (BGBl. I S. 630), zuletzt geändert durch Art. 4Investitionserleichterungs- und Wohnbauland G vom 22.04.1993(BGBl. I S. 466)Gesetz zur Raumordnung und Landesplanung des FreistaatesSachsen vom 24.06.1992 (SächsGVBl. S. 259)Gesetz über die Vorläufigen Grundsätze und Ziele zur Siedlungsentwicklung und Landschaftsordnung im Freistaat Sachsen vom20.06.1991 (SächsGVBl. S. 164)SächsDSchG Sächsisches Denkmalschutzgesetz vom 03.03.1993(SächsGVBl. S. 229)SächsNatSchGSächsisches Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege(Sächsisches Naturschutzgesetz) vom 16.12.1992 (SächsGVBl.S. 571)WHG Wasserhaushaltsgesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.09.1986(BGBl. I S. 1529)SächsWG Sächsisches Wassergesetz vom 23.02.1993(SächsGVBl. S. 201)TA Lärm Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm vom 16.07.1968(Beil. BAnz. Nr. 137)HeidenfelderInternetfassung45
QuellenverzeichnisTA Luft Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft vom 27.02.1986(GMBl. S. 95, ber. S. 202)Verordnung über Zweiundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionswerte Immissionsschutzgesetzes vom 26.10.1993 (BGBl. I, S. 1819)- 22. BImSchVFStrGBundesfernstraßengesetz i.d.F. der Bekanntmachung vom08.08.1990 (BGBl. I S. 1714)SächsStrG Sächsisches Straßengesetz vom 21.01.1993(SächsGVBl. S. 93)SächsWaldG Sächsisches Waldgesetz vom 10.04.1992(SächsGVBl. S. 137)Sonstige Quellen:Brecht et al.Jahrbuch 1992 - Bergbau, Öl und Gas, Elektrizität, Chemie(1992) 99. Jahrgang.-EssenLausitzer Braun- „Zuarbeit zum <strong>Braunkohlenplan</strong> für das Vorhaben Weiterführungkohle AG (LAUBAG) des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> 1994 bis Auslauf“ vom 01.12.1992.-(1992) SenftenbergLausitzer Braun- „Ergänzung zur Zuarbeit zum <strong>Braunkohlenplan</strong> für das Vorhabenkohle AG (LAUBAG) Weiterführung des <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> 1994 bis Auslauf“ vom(1993) 15.01.1993.-SenftenbergLausitzer Braun- <strong>Tagebau</strong> <strong>Nochten</strong> - Bestandsaufnahme für ein soziales Anforderungskohle AG profil vom März 1993(LAUBAG) (1993)PCE Consultec „Ökologische Untersuchungen zum Beeinflussungsgebiet desGmbH Berlin<strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> einschließlich Vorschlag zur Bergbaufolgeland-(1993) schaft“ vom Februar 1993.-BerlinRegierungsprä- Raumordnerische Beurteilung zum Vorhaben „Weiterführung dessidium Dresden <strong>Tagebau</strong>es <strong>Nochten</strong> in den Jahren 1992/93“ vom 11.09.1992.-(1992) DresdenSächsische Staats- Leitlinien zur künftigen Braunkohlenpolitik in Sachsenregierung (1992) vom 02.06.1992.-DresdenSächsisches StaatsministeriumfürWirtschaft undArbeit (1993)Energieprogramm Sachsen vom 06.04.1993.-Dresden46 HeidenfelderInternetfassung
Abkürzungen und Kartenverzeichnis4 AbkürzungenLAUBAGESAGESSAGGuD-KWRAVONREALausitzer Braunkohle AGEnergieversorgung Sachsen Ost AGEnergieversorgung Spree - Schwarze Elster AGGas und Dampf-Kraftwerk<strong>Regionaler</strong> Abfallverband Oberlausitz-NiederschlesienRauchgasentschwefelungsanlage5 KartenverzeichnisKarte Bezeichnung Maßstab1 Zielkarte Abbaubereich und Sicherheitslinie 1 : 50 0002 Begründungskarte Abbauentwicklung in Zeitetappen 1 : 100 0003 Zielkarte Einwirkungsbereich der 1 : 100 000Grundwasserabsenkung4 Zielkarte Gestaltung der Bergbaufolgelandschaft 1 : 50 000im EndzustandHeidenfelderInternetfassung47