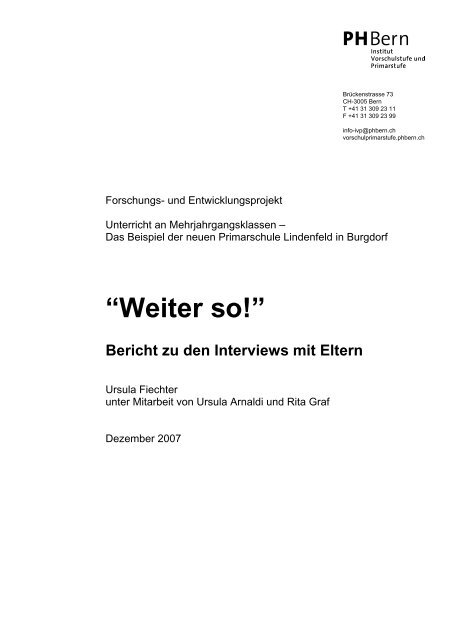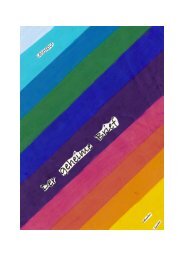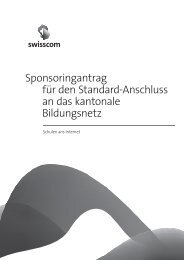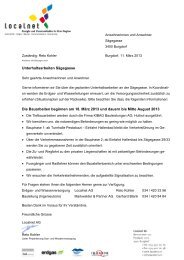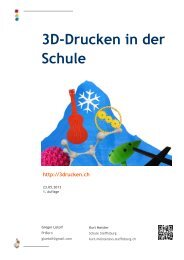âWeiter so!â - Primarschule Lindenfeld
âWeiter so!â - Primarschule Lindenfeld
âWeiter so!â - Primarschule Lindenfeld
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Brückenstrasse 73CH-3005 BernT +41 31 309 23 11F +41 31 309 23 99info-ivp@phbern.chvorschulprimarstufe.phbern.chForschungs- und EntwicklungsprojektUnterricht an Mehrjahrgangsklassen –Das Beispiel der neuen <strong>Primarschule</strong> <strong>Lindenfeld</strong> in Burgdorf“Weiter <strong>so</strong>!”Bericht zu den Interviews mit ElternUrsula Fiechterunter Mitarbeit von Ursula Arnaldi und Rita GrafDezember 2007
Inhalt1 Ausgangslage 12 Fragestellungen 13 Erste Projektphase: Elterninterviews 24 Informationen über die befragten Haushaltungen 35 Resultate der Interviewauswertung 55.1 Befindlichkeit 55.1.1 Befindlichkeit in der Klasse/Schulgemeinschaft 55.1.2 Befindlichkeit mit der Lehrper<strong>so</strong>n, den Lehrper<strong>so</strong>nen 55.1.3 Befindlichkeit im Mehrjahrgangsklassenunterricht 65.1.4 Befindlichkeit mit dem Schulwechsel 65.1.5 Fazit: „Ich kann mein Kind gehen lassen, ich habe Vertrauen, dassalles gut läuft.“ (IP 15) 75.2 Die neue <strong>Primarschule</strong> <strong>Lindenfeld</strong> 75.2.1 Die neue <strong>Primarschule</strong> <strong>Lindenfeld</strong> muss sich bewähren 75.2.2 Das neue Kollegium 85.2.3 Der Aufbau der Schulgemeinschaft in der neuen Schule 85.2.4 Fazit: „Da ist viel positive Energie vorhanden.“ (IP 01) 95.2.5 Schule <strong>Lindenfeld</strong>: Gebäude und Umschwung 95.2.6 Die Schule <strong>Lindenfeld</strong> als Quartierschule 95.2.7 Be<strong>so</strong>nderheiten der Schule <strong>Lindenfeld</strong> 95.2.8 Fazit: „Wir sind froh, haben wir jetzt eine Quartierschule.“ (IP 12) 105.2.9 Schule <strong>Lindenfeld</strong>: Die Zuteilung 105.2.10 Fazit: „Alle, die geschrien haben, schrien nach einem halben Jahrnicht mehr.“ (IP 08) 115.3 Unterricht an Mehrjahrgangsklassen 115.3.1 Anforderungen an die Lehrper<strong>so</strong>n im Mehrjahrgangsklassenmodell 115.3.2 Erwartungen und Vorstellungen der Eltern zu Unterricht anMehrjahrgangsklassen 115.3.3 Unterricht an Mehrjahrgangsklassen: Wahrnehmungen und Beobachtungender Eltern 135.3.4 Fazit: Hohe Erwartungen – vielfältiger Schulalltag 155.4 Zusammenarbeit mit den Eltern 155.4.1 Information und Kommunikation zwischen Schule und Elternhaus 155.4.2 Die Beurteilung 155.4.3 Fazit: „Das Bewertungsmosaik, das ist mustergültig, eine ganzheitlicheBeurteilung.“ (IP 09) 165.4.4 Die Behörden 165.4.5 Fazit: „Die einzelnen Mitglieder des Elternrats sind sehr engagiert undmotiviert.“ (IP 11) 175.5 Wünsche für die Zukunft 175.5.1 Fazit: „Ich wünsche mir, dass es <strong>so</strong> weiterläuft wie bis jetzt.“ (IP 07) 175.6 Motivation für das Interview/Erwartungen an das Projekt 175.6.1 Fazit: „Man kann auch mal über Gutes berichten.“ (IP 14) 186 Zusammenfassung 187 Nachtrag: Elternabend vom 11. September 2007 19Anhang: Kodierleitfaden 20
1 AusgangslageDas von der neuen <strong>Primarschule</strong> <strong>Lindenfeld</strong> initiierte und gemeinsam mit dem InstitutVorschulstufe und Primarstufe der PHBern (IVP PHBern) durchgeführte ForschungsundEntwicklungsprojekt trägt den Titel „Unterricht an Mehrjahrgangsklassen – DasBeispiel der neuen <strong>Primarschule</strong> <strong>Lindenfeld</strong> in Burgdorf“. Es hat zum Ziel, den altersgemischtenUnterricht der Schule <strong>Lindenfeld</strong> aus verschiedenen Perspektiven zu beschreibenund zu dokumentieren. Damit werden einerseits Grundlagen für die Entwicklungdes Modells in der Schule <strong>Lindenfeld</strong> erarbeitet. Andererseits werden Materialienfür die Ausbildung von Lehrper<strong>so</strong>nen der Vorschulstufe und Primarstufe an der PHBernim Bereich Mehrjahrgangsklassen entwickelt.2 FragestellungenFür das Projekt sind folgende Fragestellungen leitend• welche Inhalte und Lernsituationen sind typisch für den Unterricht an Mehrjahrgangsklassen?• Wie erfahren und bewältigen Kinder die altersheterogenen Schul- und Unterrichtssituationen?• Wie beurteilen die Eltern die Schul- und Unterrichtssituation im <strong>Lindenfeld</strong>?Die Fragestellungen werden von den Lehrper<strong>so</strong>nen des Kollegiums konkretisiert und fürdie eigene Schul- und Unterrichtssituation verfeinert.Das Projekt umfasst drei Phasen• Eine erste Phase, in der Interviews mit Eltern durchgeführt werden. Die Resultatewerden im vorliegenden Bericht vorgestellt. Der Bericht richtet sich primär an Schulleitungund Kollegium der Schule <strong>Lindenfeld</strong>.• Eine zweite Phase, in der Unterricht in der neuen <strong>Primarschule</strong> <strong>Lindenfeld</strong> von unsbeobachtet, aufgezeichnet und mit den Lehrper<strong>so</strong>nen diskutiert wird.• Eine dritte Phase, in der mit den Schülerinnen und Schülern über ausgewählte aufgezeichneteUnterrichtssituationen gesprochen wird.1
3 Erste Projektphase: ElterninterviewsUm Interviews mit Eltern zum Thema Mehrjahrgangsklassenunterricht durchzuführen,haben wir in Zusammenarbeit mit der Schulleitung und dem Kollegium einen Interviewleitfadenentwickelt. Der Leitfaden wurde in einem Testinterview erprobt.Wir haben uns für die Form eines face-to-face Interviews entschieden, da wir möglichstoffen an die Eltern herangehen wollten. Die Eltern <strong>so</strong>llten Raum für die Schilderung ihrerErfahrungen und Erwartungen erhalten, im Gespräch eigene Schwerpunkte setzen können.Wir orientierten uns an einem qualitativen methodischen Vorgehen, das für <strong>so</strong>lcheSituationen in den Sozialwissenschaften üblich ist. 1 In einem Leitfadeninterview werdenverschiedene Themenbereiche angesprochen. Es wird eine Einstiegsfrage formuliert,die den interviewten Per<strong>so</strong>nen Raum für Erzählungen gibt. Um das Gespräch – fallsnötig – etwas zu lenken, sind mögliche Nachfragen formuliert.Interviewleitfaden Eltern1. Themenbereich: BefindlichkeitIhr Kind wurde einer Mehrjahrgangsklasse der Schule <strong>Lindenfeld</strong> zugeteilt. Was erzähltIhr Kind zuhause von der Schule?• Haben Sie den Eindruck, Ihr Kind fühlt sich in der Schule wohl?• Welche Erwartungen haben Sie an die Schule?• Haben Sie gegen die Zuteilung etwas unternommen, wenn ja, was und warum?• Was denken Sie heute über die Zuteilung?2. Themenbereich: Schule <strong>Lindenfeld</strong>Jetzt möchte ich mit Ihnen über die Schule <strong>Lindenfeld</strong> sprechen. In welchen Bereichenunterscheidet sich aus Ihrer Sicht die Schule <strong>Lindenfeld</strong> von anderen Schulen?• Was betrachten Sie als das Be<strong>so</strong>ndere / Spezielle dieser Schule?• Schwachpunkte – was gefällt Ihnen an der Schule nicht? Was würden Sie verändernwollen?• Haben Sie Kinder, die eine andere Schule in Burgdorf besuchen? Können Sie diezwei Schulmodelle vergleichen? Wo sehen Sie Vor-/Nachteile?• Gibt es für Sie Probleme, wenn die Kinder nicht im gleichen System unterrichtetwerden?3. Themenbereich: Unterricht an MehrjahrgangsklassenWas denken Sie, was muss eine Lehrper<strong>so</strong>n be<strong>so</strong>nders beachten, die an einer Mehrjahrgangsklasseunterrichtet?• Nehmen die Lehrper<strong>so</strong>nen/nimmt die Lehrper<strong>so</strong>n die Bedürfnisse Ihres Kindeswahr?• Was gefällt Ihrem Kind am Unterricht be<strong>so</strong>nders gut?• Worüber ärgert sich Ihr Kind?• Gibt es aus Ihrer Sicht auch Schwierigkeiten in Bezug auf den Unterricht?• Was sind aus Ihrer Sicht die Stärken oder Schwächen dieser Unterrichtsform?1 Vgl. z.B. Mayring, Philipp (2007): Qualitative Inhaltsanalyse, Grundlagen und Techniken. BeltzVerlag: Weinheim und Basel; Flick, Uwe et al. (2000): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. RowohltTaschenbuch Verlag: Reinbek bei Hamburg; Lamnek, Siegfried (1993): Qualitative Sozialforschung.Band 1 Methodologie, Band 2 Methoden und Techniken. Beltz PsychologieVerlags-Union: Weinheim.2
4. Themenbereich: Zusammenarbeit mit den ElternWie beurteilen Sie die Zusammenarbeit Schule – Elternhaus?• Beurteilungsgespräch im Januar: wie haben Sie das Gespräch erlebt?• Machen Sie bei Schulanlässen, Schulveranstaltungen mit: in welcher Form?• Sind Sie selber aktiv z.B. im Elternrat, in der Schulkommission, ... ?• Was wäre Ihrer Meinung nach an der Zusammenarbeit zu verbessern?5. Themenbereich: ZukunftsvisionenWenn Sie sich in Bezug auf die Schule <strong>Lindenfeld</strong> für die Zukunft etwas wünschenkönnten, was wäre das für ein Wunsch, Anliegen, für eine Anregung?6. AbschlussWas hat Sie motiviert, bei diesem Interview mitzumachen?Was erhoffen Sie sich von den Ergebnissen?Um die Interviews durchzuführen, wurde nach einer Vorinformation durch die Schulleitungtelefonisch Kontakt mit Eltern aufgenommen. Die Auswahl der Eltern geschah anhandder Klassenlisten nach dem Zufallsprinzip. Es wurde darauf geachtet, dass in jederKlasse jeder Jahrgang berücksichtigt wurde. Auch <strong>so</strong>llten etwa gleichviele Elternvon Mädchen wie Knaben angefragt werden. Es wurden al<strong>so</strong> insgesamt 15 Interviewsdurchgeführt. Zusätzlich wurden die Interviewten gebeten, ein paar Angaben zu ihremHaushalt zu machen.18 telefonische Anfragen wurden vorgenommen, es gab al<strong>so</strong> nur drei Absagen. DieBereitschaft an den Interviews teilzunehmen war sehr hoch! Dem kommt entgegen,dass bei sehr vielen Familien tagsüber ein Elternteil zuhause anwesend ist, in der Regeldie Mutter der Kinder.4 Informationen über die befragten HaushaltungenIn den von uns befragten Haushaltungen leben insgesamt 67 Per<strong>so</strong>nen, 29 Erwachseneund 38 Kinder. Die Grösse der Haushalte reicht von drei bis sechs Per<strong>so</strong>nen. Die häufigsteHaushaltsgrösse ist der 4-Per<strong>so</strong>nen-Haushalt.Tabelle 1: HaushaltgrössenHaushaltgrösse Anzahl Haushalte Total Per<strong>so</strong>nen3-Per<strong>so</strong>nen-Haushalte 1 34-Per<strong>so</strong>nen-Haushalte 9 365-Per<strong>so</strong>nen-Haushalte 2 106-Per<strong>so</strong>nen-Haushalte 3 18Total 15 673
Drei Elternteile sind alleinerziehend, zwei Interviews wurden mit fremdsprachigen Elternteilendurchgeführt. In einem Fall war die Familie nicht eingebürgert. Interviewt wurden14 Frauen und ein Mann.Die erwachsenen Haushaltsmitglieder sind zwischen 27 und 52 Jahren alt. Die in diesenHaushaltungen lebenden Kinder zwischen 3 und 16 Jahren.Von den insgesamt 38 Kindern besuchen 19 die <strong>Primarschule</strong> <strong>Lindenfeld</strong>. Diese 19Kinder verteilen sich wie folgt auf die Klassen.Tabelle 2: Kinder der interviewten Eltern in den Klassen der <strong>Primarschule</strong> <strong>Lindenfeld</strong>Besuchte KlasseAnzahl Kinder1. Klasse 32. Klasse 43. Klasse 54. Klasse 45. Klasse 3Total 19Es waren alle Jahrgänge pro Klasse mit mindestens einem Kind abgedeckt.Die erwachsenen Per<strong>so</strong>nen der von uns befragten Haushalte haben folgenden Schulabschluss.Tabelle 3: Schulabschluss der erwachsenen HaushaltsmitgliederBildungsstand der 25-64jährigen Per<strong>so</strong>nenBefragte Haushalte<strong>Lindenfeld</strong> (2007)In ProzentGemeinde Burgdorfin Prozent (2000) 2Ohne nachobligatorischeAusbildung4 13.8 22.5Sekundarstufe II 13 44.8 52.4Tertiärstufe 11 37.9 20.3Keine Angabe 1 3.4 4.8Total 29 100.0 100.02 http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/regionen/regionalportraets/gemeindesuche.html[2.11.07]4
Die Vergleichszahlen mit der Gemeinde Burgdorf zeigen, dass das Umfeld der Schule<strong>Lindenfeld</strong> von vielen tertiär gebildeten Eltern bewohnt ist. Umgekehrt gibt es nur wenigeEltern, die ohne nachobligatorische Ausbildung geblieben sind.5 Resultate der InterviewauswertungIm Folgenden werden die Resultate der Interviewauswertung dargestellt. Die durchgeführtenInterviews wurden in einem ersten Schritt transkribiert, al<strong>so</strong> verschriftlicht. Siedauerten zwischen 33 Minuten und 1 Stunde 12 Minuten. Die auf diese Weise vorliegendenTexte wurden anschliessend anhand eines Kodierleitfadens gegliedert. In einemnächsten Durchgang wurden die Textstellen nach Unterkategorien weiter differenziert,stichwortartig zusammengefasst und miteinander verglichen. Schliesslich wurden die <strong>so</strong>erhaltenen Informationen in einem Text dargestellt. Dieses Vorgehen nennt man in denSozialwissenschaften qualitative Inhaltsanalyse. 3 Ziel ist es, Sachverhalte aus Sicht derInterviewten zusammenfassend darzustellen und auf einer allgemeineren Ebene, d.h.anonymisiert und abgelöst von den interviewten Per<strong>so</strong>nen, zu beschreiben.5.1 Befindlichkeit5.1.1 Befindlichkeit in der Klasse/SchulgemeinschaftGemeint ist damit das Wohlbefinden des Kindes im <strong>so</strong>zialen Gefüge der Schule und derKlasse. Die Eltern berichten, dass ihre Kinder sich <strong>so</strong>zial durchwegs wohl fühlen. Be<strong>so</strong>ndershervorgehoben werden die familiäre Atmosphäre und die Überschaubarkeit derSchulgemeinschaft. Dies hilft, dass sich die Kinder gegenseitig kennen, auch über dieJahrgänge und über die Klassen hinweg. Einige Eltern stellen fest, dass ihre Kinderoffener geworden sind. Konflikte werden von den Kindern in der Regel gut gelöst: Auchauf dem Pausenhof funktioniert das Schulleben bis auf die üblichen Reibereien unterKindern gut. Die meisten Kinder orientieren sich an gleichaltrigen, gleichgeschlechtlichenoder älteren Kindern. Es gibt aber auch <strong>so</strong>lche, die gerade das Zusammensein mitjüngeren Kindern – <strong>so</strong>wohl in der Klasse als auch in der Schule insgesamt – geniessen.Bedauert wird, dass die Auswahl an gleichaltrigen und gleichgeschlechtlichen Kindern inder Klasse aufgrund der kleinen Zahl von Kindern in den Jahrgängen der Klassen undder insgesamt kleinen Schule eher gering ist.5.1.2 Befindlichkeit mit der Lehrper<strong>so</strong>n, den Lehrper<strong>so</strong>nenDie Beziehungen der Lehrper<strong>so</strong>nen zu den Kindern kommt einerseits in der Zuneigungoder <strong>so</strong>gar Bewunderung der Kinder für die Lehrper<strong>so</strong>n zum Ausdruck, zeigt sich andererseitsan der Freude der Kinder zur Schule zu gehen. Die Rückmeldungen dazu sindsehr positiv.Die wenigen kritischen Äusserungen betreffen:• Die Bevorzugung jüngerer Kinder, die von älteren Kindern als ungerecht empfundenwird.• Die unklaren und unverständlichen Anforderungen der Lehrper<strong>so</strong>n.• Die fehlende Chemie zwischen Lehrper<strong>so</strong>n und Kind.3 Mayring, Philipp (2007): Qualitative Inhaltsanalyse, Grundlagen und Techniken. Beltz Verlag:Weinheim und Basel.5
• Jene Kinder, die das Modell Mehrjahrgangsklassen aus ihrer bisherigen Schulerfahrungnicht kannten, hätten zu Beginn besser an das neue System herangeführt werdenmüssen.Aus Sicht der Eltern werden ihre Kinder von den meisten Lehrper<strong>so</strong>nen sehr treffendeingeschätzt und gut unterstützt. Es besteht in der Regel ein Vertrauensverhältnis. Geschätztwerden von Kindern und Eltern die klaren Regeln, Strenge, Konsequenz unddas grosse Engagement der Lehrper<strong>so</strong>nen. Be<strong>so</strong>nders hervorgehoben werden die regelmässigenRückmeldungen zu den Lernstandserhebungen der einzelnen Kinder.5.1.3 Befindlichkeit im MehrjahrgangsklassenunterrichtDieser Kategorie wurden Aussagen zugeordnet und differenziert, die die Sicht des Kindesauf den Unterricht im Mehrjahrgangsklassenmodell wiedergeben.So zeigt sich, dass für viele Kinder die altersdurchmischten Klassen <strong>so</strong> selbstverständlich(geworden) sind, dass sie dies zu Hause gar nicht näher erwähnen. Andere Kinderfinden die Altersmischung eine spannende Sache. Sie interessieren sich für ältere Kinder,aber auch für deren Aktivitäten und deren Stoff. Die älteren Kinder sind Vorbild undAnsporn. Ältere erzählen, dass sie ihren jüngeren Kameradinnen und Kameraden etwaszeigen konnten. Dies erfüllt sie mit Stolz. Die Eltern begrüssen, dass ihre Kinder lernenmüssen, auf ältere und jüngere Kinder einzugehen.Weiter erzählen die Kinder zuhause von Gruppenarbeiten, davon, dass sie viel selbständigarbeiten und dass sie manchmal warten müssen, weil die Lehrper<strong>so</strong>n gerademit einer anderen Gruppe beschäftigt ist.Aufgrund der Erzählungen der Kinder denken Eltern auch, dass ihre Kinder wenigerunter Leistungsdruck stehen. Da die Klassen sehr heterogen sind, fällt das Vergleichenmit Gleichaltrigen schwerer. Einzelne Kinder haben durch das viele selbständige Lernenkaum noch Hausaufgaben, das empfinden Eltern und Kinder als Vorteil. Insgesamt fühlensich die Kinder im Mehrjahrgangsklassenmodell nach einer Angewöhnungszeit wohl.Als kritische Punkte werden von den Kindern berichtet:• Manche Kinder langweilen sich gelegentlich. Entweder sind sie mit (zu) einfachenAufgaben beschäftigt, während die Lehrper<strong>so</strong>n mit anderen Gruppen arbeitet. Odersie haben ihre Aufträge bereits erledigt, und wissen nicht, was sie nun tun <strong>so</strong>llen.• Einige Kinder lassen sich von anderen Kindern oder dem, was andere Kinder machenmüssen, ablenken.• Einzelne Kinder, die sich nicht ruhig verhalten, stören andere beim selbständig arbeiten,vor allem auch ausserhalb des Klassenzimmers. Dies führt bei einzelnen Kindern,die ihre Aufgaben möglichst effizient lösen möchten, zu Frustrationen.• Zu Beginn war einigen Kindern jeweils nicht klar, was jetzt von ihnen erwartet wurde,weil sie das System noch nicht gut genug kannten.• Einige Kinder haben Mühe, sich mit jüngeren Kindern abzugeben oder finden diesenicht <strong>so</strong> interessant.5.1.4 Befindlichkeit mit dem SchulwechselAuch hier geht es um die Sicht und das Empfinden der Kinder, wie sie uns die Elternberichten.Längst nicht alle Kinder (und Eltern) waren gegen einen Schulwechsel eingestellt. Einigesahen in der Möglichkeit, die Schule zu wechseln, die Chance für einen Neuanfang.Sie hatten am alten Ort mit Lehrper<strong>so</strong>nen oder in der Klasse schlechte Erfahrungengemacht. Diese Kinder besuchen die Schule heute wieder mit viel mehr Motivation.Manche Kinder waren stolz, in ein neues, modernes, quartiereigenes Schulhaus eingeschultzu werden. Andere liessen sich beim Start der neuen Schule <strong>so</strong>fort dafür begeistern.6
Für viele Kinder hat sich auch der Schulweg verkürzt, was sie als Vorteil wahrnehmen.Der Umstand, nach dem Schulwechsel mit Nachbarskindern die gleiche Schule besuchenzu können, wird als Vorteil gesehen.Für einige war der Verlust alter Klassenkameradinnen und -kameraden ein Problem.Der Abschied fiel schwer. Der Kontakt zu ehemaligen Kameradinnen und Kameradenhat sich inzwischen meist aufgelöst. Es gab auch Enttäuschungen darüber, dass nurwenige Kinder der alten Klassen in die neue Schule mitgekommen sind. Wie bereitserwähnt, realisieren einige Kinder auch, dass die Auswahl an gleichaltrigen, gleichgeschlechtlichenSpielkameradinnen und –kameraden im <strong>Lindenfeld</strong> nicht mehr <strong>so</strong> grossist.Einige Kinder reagierten auf den Wechsel gestresst, weil alles neu war: das System, dieKlassenkameradinnen und –kameraden, die Lehrper<strong>so</strong>nen, das Schulhaus, das Quartier,der Schulweg.5.1.5 Fazit: „Ich kann mein Kind gehen lassen, ich habe Vertrauen, dass allesgut läuft.“ (IP 15)Die Befindlichkeit ihres Kindes in der Schule ist für die Eltern sehr wichtig, sie möchtensich darauf verlassen können, dass ihr Kind seinen Eigenschaften und Fähigkeiten entsprechendvon den Lehrper<strong>so</strong>nen wahrgenommen und gefördert wird. Sie wünschensich, dass es in der Klasse und in der Schulgemeinschaft Anschluss findet und sichwohl fühlt. Das Echo der von uns interviewten Eltern auf diese Grundanliegen fällt sehrpositiv aus. Die Schwierigkeiten des Schulwechsels beschränkten sich meist auf denVerlust von Kameradinnen und Kameraden. Für viele Kinder war der Schulwechselauch eine Möglichkeit, mit der Schule nochmals neu zu starten. Sie hatten am altenSchulort schlechte Erfahrungen gemacht. Vor allem zwei Punkte gelten bis heute alsSchwächen:• Die kleinere Auswahl an Kameradinnen und Kameraden, die insbe<strong>so</strong>ndere durch dieGrösse der Schule und den kleinen Anteil gleichaltriger Kinder in derselben Klassebedingt ist.• Der Umstand, dass sich die Kinder von den Inhalten und Aufgaben der anderenJahrgänge in der Klasse ablenken lassen und dadurch Schwierigkeiten haben, sichauf ihren Stoff und ihre Aufgaben zu konzentrieren. Dies stellt hohe Anforderungenan die Selbständigkeit der Kinder und gelingt nicht allen und immer gleich gut.5.2 Die neue <strong>Primarschule</strong> <strong>Lindenfeld</strong>5.2.1 Die neue <strong>Primarschule</strong> <strong>Lindenfeld</strong> muss sich bewährenDie Schule <strong>Lindenfeld</strong> ist eine neue <strong>Primarschule</strong>, ihr Modell wurde gegen vielerlei Bedenkenund Widerstände durchgesetzt. Entsprechend muss die Schule nun den Nachweiserbringen, dass sie all jene Erwartungen erfüllen kann, die im Vorfeld von den Befürworterinnenund Befürwortern des Modells geweckt wurden. Sie muss nachweisen,dass die vielen geäusserten Bedenken, mit denen gegen das Modell argumentiert wurde,unbegründet waren. Einige Eltern kennen das System aus eigener Erfahrung odervon anderen Schulen, stehen ihm positiv gegenüber oder liessen sich von den Argumentenfür das Modell überzeugen. Viele Eltern standen dem Modell auch skeptischgegenüber.Heute lässt sich feststellen: Die Schule <strong>Lindenfeld</strong> hat sich bewährt, wenn auch nocheinige Punkte offen geblieben sind. Die meisten Bedenken konnten im Verlauf des erstenSchuljahres zerstreut werden.Bewährt haben sich insbe<strong>so</strong>ndere die Grösse der Schule und das neue Kollegium. Vielesehen auch den Nutzen der Altersdurchmischung, insbe<strong>so</strong>ndere im <strong>so</strong>zialen Bereichder Schulgemeinschaft. Für einige ist das Modell heute deshalb kein Thema mehr.7
Wo sich die Schule in den nächsten Jahren noch bewähren muss, ist beim Anschlussan die Sekundarstufe und bezüglich der grossen Heterogenität in den drei Jahrgängenumfassenden Mehrjahrgangsklassen. In diesem Zusammenhang werden folgende kritischePunkte in den Interviews angesprochen:Der hohe Notendruck in der Mittelstufe, der mit dem Anschluss der Fünft- und Sechstklässlerin die Oberstufe in Verbindung gebracht wird. Es wird befürchtet, dass die jüngerenJahrgänge sich zu stark den älteren anpassen müssen und <strong>so</strong>mit überfordertsind. Für andere Eltern ist gerade die umgekehrte Frage offen: Sie verfolgen aufmerksam,ob ihre Kinder mit dem Schulstoff genügend weit kommen, um den Anschluss andie Oberstufe problemlos zu schaffen. Auf der Unterstufe wird sich der Schulbetrieb mitdrei Jahrgängen, der erst im aktuellen Schuljahr (07/08) gestartet ist, zuerst einmal bewährenmüssen.Ob sich das Modell in einem städtischen Umfeld bewährt und bewähren <strong>so</strong>ll, ist für einigeEltern offen geblieben. Niemand der von uns interviewten Eltern lehnt das Modelljedoch grundsätzlich ab, da alle für ihr Kind derzeit auch Vorteile sehen. Welche Unterrichtsformennun dem Modell Mehrjahrgangsklassen, welche der Professionalität derLehrper<strong>so</strong>nen geschuldet sind, ist für einige Eltern unklar geblieben.5.2.2 Das neue KollegiumDas Kollegium der Schule wurde neu zusammen- und angestellt. Rund die Hälfte derLehrper<strong>so</strong>nen kam von anderen Gemeinden dazu. Die Lehrper<strong>so</strong>nen mussten sich bewerbenund durchliefen ein Auswahlverfahren. Ein wichtiges Kriterium für die Neuanstellungenwar Erfahrungen im Unterricht mit Mehrjahrgangsklassen.Der Eindruck, den die Eltern vom Kollegium haben, ist sehr positiv. Sie empfinden esals Vorteil, wenn in einer Schule ein Kollegium neu zusammengesetzt wird und ein neuesTeam eine gemeinsame Herausforderung annimmt. Die Eltern spüren, dass im Kollegiumzusammengearbeitet wird, dass ein gemeinsamer Prozess gestartet wurde, dassjene Lehrper<strong>so</strong>nen, die da angestellt wurden, Althergebrachtes überdenken und weiterentwickelnwollen.Kritisch angemerkt wurde zu Beginn, dass das Kollegium ausschliesslich aus Frauenbesteht. 4 Dies ist allerdings momentan kein Thema mehr. Die rein weibliche Zusammensetzungdes Kollegiums wurde vorerst akzeptiert, denn <strong>so</strong>wohl Kinder als auchEltern sind mit den Lehrper<strong>so</strong>nen überwiegend sehr zufrieden.Einige Eltern befürchteten, dass Lehrper<strong>so</strong>nen dazu verpflichtet wurden, Mehrjahrgangsklassenzu führen, obwohl sie dies gar nicht wünschten. Diese Bedenken konntenschon im Vorfeld des Schulbeginns ausgeräumt werden.Die Schulleitung gilt als präsent, aktiv und engagiert. Als Vorteil gilt auch, dass sie vonauswärts neu dazugekommen ist. Die Schule wird als gut organisiert und strukturiertwahrgenommen. Es gelten klare Regeln. Der Stundenplan wird als durchdacht angesehen.Insgesamt fühlen sich die verschiedenen Gremien und die Eltern von der Schulleitunggut unterstützt.5.2.3 Der Aufbau der Schulgemeinschaft in der neuen SchuleVerschiedene Aktivitäten der Schule zielen ab auf eine Stärkung der Schulgemeinschaftüber die Mehrjahrgangsklassen und Jahrgänge hinweg. Dies wird von den Eltern positivwahrgenommen und viele Eltern sind überzeugt, dass diese Aktivitäten mancherlei Konfliktenauf dem Pausenhof und dem Schulweg vorbeugen. In diesem Zusammenhangerwähnt werden die Schulhauseröffnung; das Adventssingen; die Projekte am Ende desQuartals, wo die Klassen sich gegenseitig etwas vorführen; Besuche von Unterstufen-4 Mit Beginn des Schuljahres 07 wurde ein Teilpensenlehrer angestellt.8
klassen im Kindergarten, damit sich die Kinder kennen lernen; Aktivitäten, die Parallelklassengemeinsam unternehmen; das gegenseitige Beaufsichtigen der Kinder beibe<strong>so</strong>nderen Anlässen, z.B. der Veloprüfung; die Landschulwoche; der Stadtlauf u.a.m.5.2.4 Fazit: „Da ist viel positive Energie vorhanden.“ (IP 01)Der Start der Schule <strong>Lindenfeld</strong> ist gut geglückt. Viele Bedenken konnten im ersten Jahrdes Schulbetriebes ausgeräumt werden. Kollegium und Schulleitung werden als engagiertwahrgenommen. Die Kinder fühlen sich in der Schule wohl. Offen bleibt, wie sichauf der Unterstufe das System mit drei Jahrgängen bewährt und wie gut der Anschlussdes Modells an die Sekundarstufe gelingt.Eine neue Schule eröffnet aus Sicht der Interviewten viele Möglichkeiten, was sehr vieleEltern als Chance sehen. Der Betrieb ist nicht festgefahren, Veränderungen sind möglich.Dieses Innovationspotential wird sehr geschätzt, das Modell Mehrjahrgangsklassenakzeptiert, <strong>so</strong>lange die Eltern den Eindruck haben, es sei zum Wohl und zur Förderungihrer Kinder.5.2.5 Schule <strong>Lindenfeld</strong>: Gebäude und UmschwungDie Architektur, der Bau der Schule <strong>Lindenfeld</strong> stösst auf sehr positive Rückmeldungen.Das viele Glas, die Holzböden, die zweckmässigen, hellen Räume, die Pausenhalle, dieRaumaufteilung, die farbigen Toiletten: all dies gefällt Eltern und Kindern. Bemängeltwird die fehlende Lüftung, die dazu führt, dass es zwischendurch im Gebäude unangenehmwarm wird. Auch wünschen sich die Eltern eine ansprechendere Umgebungsgestaltung(Pausenplatz, Spielplatz).5.2.6 Die Schule <strong>Lindenfeld</strong> als QuartierschuleViele Eltern schätzen, dass im Quartier eine Schule gebaut wurde. Die Kinder haben <strong>so</strong>einen kürzeren Schulweg, sie besuchen mit Kindern aus dem Quartier die gleiche Schule.Eine Quartierzugehörigkeit ist entstanden. Das Quartier ist belebter geworden. DieKinder treffen sich gerne und oft auf dem Schulhausplatz/roten Platz. Auch die Kontakteder Eltern untereinander sind häufiger geworden. Durch die Grösse der Schule bleibtalles familiär und überschaubar.Zu wenig beachtet wurde beim Schulhaus die Verkehrssicherheit. Es gibt im Quartierzuviel Durchgangsverkehr. Auch kommen Kinder aus anderen Quartieren auf denSchulhausplatz/roten Platz.5.2.7 Be<strong>so</strong>nderheiten der Schule <strong>Lindenfeld</strong>Als Be<strong>so</strong>nderheiten der Schule <strong>Lindenfeld</strong> gelten:• Das Modell Mehrjahrgangsklassen, das inzwischen auch von Eltern anderer Schulenwahrgenommen wird, die sich für die Erfahrungen interessieren.• Das Angebot Mittagstisch, das baulich ins Schulhaus integriert ist, d.h. bereits bei derPlanung mitbedacht wurde.• Ein Angebot für Aufgabenhilfe drei Mal pro Woche.• Die Spielkiste in der Pausenhalle. Sie enthält Spielsachen, mit denen die Kinder inder Pause spielen können.• Der Pausenkiosk der Kleinklasse.• Der sehr aktive Elternrat.• Das Quartier, das als <strong>so</strong>zial gut durchmischt bezeichnet wird. 55 Stienen (2006) diskutiert die Vorstellung, es könne <strong>so</strong> etwas wie eine <strong>so</strong>zial gute Durchmischunggeben, als Vorstellung einer Normalität, die sich an die Werteorientierungen bestimmterBevölkerungsgruppen anlehnt. Soziodemographischer Wandel in einem Quartier wird damit alsproblematisch gesetzt. Vgl. Stienen, Angela (Hrsg.) (2006): Integrationsmaschine Stadt? InterkulturelleBeziehungsdynamiken am Beispiel von Bern. Bern: Haupt.9
5.2.8 Fazit: „Wir sind froh, haben wir jetzt eine Quartierschule.“ (IP 12)Planung und Bau des Schulhauses stossen auf viel positives Feedback. Die Schuleetabliert sich als Quartiertreffpunkt für die Kinder und entwickelt Ausstrahlung über dasQuartier hinweg. Dies wirkt sich in der Wahrnehmung einiger Eltern positiv auf die Quartierzusammengehörigkeitaus. Handlungsbedarf besteht aus Sicht der Eltern vor allemim Bezug auf die Lüftung des Schulhauses, die eingespart wurde, <strong>so</strong>wie hinsichtlich derUmgebungsgestaltung des Schulhauses. Dies sind Themen, mit denen sich u.a. derElternrat befasst (vgl. Kapitel 5.4.4).5.2.9 Schule <strong>Lindenfeld</strong>: Die ZuteilungDie Frage der Zuteilung der Kinder zur Schule <strong>Lindenfeld</strong> oder der Verbleib in anderenSchulen, gab im Vorfeld des Schulstarts viel zu reden. Von den Eltern und Kindern wurdedie Zuteilung sehr unterschiedlich erlebt.Von den 15 Haushaltungen, die von uns erfasst wurden, verteilen sich die 38 Kinder wiefolgt auf die Schule <strong>Lindenfeld</strong> und weitere Schulen:• In vier Haushalten besuchen alle Kinder die Schule <strong>Lindenfeld</strong>.• Sieben Haushaltungen haben Kinder in verschiedenen Schulen, davon vier in Oberstufenschulenund vier in anderen <strong>Primarschule</strong>n in Burgdorf. Dass die Kinder verschiedeneSchulhäuser besuchen, wird von einigen organisatorisch als Nachteil erlebt,andere stören sich daran nicht. Eine Interviewte wünschte sich, dass auch ihrjüngeres Kind ins <strong>Lindenfeld</strong> umgeteilt würde.• Acht Haushalte haben jüngere Kinder, die theoretisch ins <strong>Lindenfeld</strong> eingeschult werdenkönnten. Sieben Interviewte wünschen sich explizit, dass dies der Fall sein möge.Was einige Eltern hören ist, dass neuerdings auch andere Eltern versuchen würden,ihre Kinder ins neue Schulhaus <strong>Lindenfeld</strong> um- oder einteilen zu lassen. Dies nachdemsie jetzt sehr viel Positives über die Schule gehört haben. Allgemein wird festgestellt,dass die skeptischen und negativen Stimmen gegenüber der Schule im Verlauf desersten Jahres verstummt sind.Die Kriterien der Zuteilung für das erste Schuljahr (06/07) konnten von einigen Elternnachvollzogen werden, für andere blieben sie unklar oder <strong>so</strong>gar willkürlich. Als wichtigsteKriterien wurden von den Eltern wahrgenommen:• die Kinder kennen sich aus der gleichen Klasse;• sie wohnen im Einzugsgebiet/Quartier.Für einige Eltern und Kinder ist der damit verbundene, kürzere Schulweg ein Vorteil,andere schätzen ihren neuen Schulweg als gefährlicher und komplizierter ein.Kritisiert wird vor allem, dass zwar Kriterien für die Zuteilung kommuniziert, aber in denAugen verschiedener betroffener Eltern nicht eingehalten wurden. So konnten die Elternein Gesuch um Umteilung einreichen, es blieb jedoch unklar, welche Gesuche weshalbberücksichtigt wurden und welche nicht. Von den 15 interviewten Per<strong>so</strong>nen, geben zweian, ein Gesuch gegen die Zuteilung formuliert zu haben.Vor allem die Eltern von Kindern der sechsten Klassen, wehrten sich gegen den Schulwechsel.Darauf wurde schliesslich eingetreten, indem die Schule mit 1. bis 5. Klassenstartete, al<strong>so</strong> nicht im Vollausbau. Mit diesem Entscheid wurde bereits viel Oppositionberuhigt.Obwohl sich die Wogen inzwischen geglättet haben, wird auch im Nachhinein die Kommunikationspolitikvon Schulkommission und Behörden kritisiert. Der Entscheid zur Umteilungsei z.B. nicht positiv – als Chance oder Privileg in ein neues Schulhaus umgeteiltzu werden – kommuniziert worden. Bei den Begründungen für die abgelehnten Gesuchefühlten sich einige Eltern nicht ernst genommen. Angemerkt wird auch, dass dieElternräte der lokalen Schulen zu wenig einbezogen worden seien. Auch hätten einige10
Eltern mehr Mitspracherechte erwartet, während andere es wiederum richtig finden,dass Eltern in <strong>so</strong>lchen Fällen nicht mitentscheiden können.5.2.10 Fazit: „Alle, die geschrien haben, schrien nach einem halben Jahr nichtmehr.“ (IP 08)Von Beginn weg gab es Eltern, die sich darauf freuten, dass ihre Kinder der Schule<strong>Lindenfeld</strong> zugeteilt wurden. Nicht alle sahen die Zuteilung negativ, viele betrachtetenes als Vorteil oder <strong>so</strong>gar Chance, ihre Kinder nun in eine nahe, neue Quartierschuleschicken zu können (s.o.).Im Nachhinein wird vor allem die Kommunikation der Behörden und der Schulkommissionkritisiert. Die Kriterien seien nicht klar gewesen oder nicht eingehalten worden, dieElternräte zu wenig einbezogen und auf die Gründe der Gesuche um Umteilung zu wenigeingegangen worden. Mit dem Resultat sind die Eltern heute zufrieden, da sie mitder Schule sehr zufrieden sind. Viele wünschen sich, dass auch ihre übrigen oder zukünftigenPrimarschulkinder in die Schule <strong>Lindenfeld</strong> eingeteilt werden.5.3 Unterricht an Mehrjahrgangsklassen5.3.1 Anforderungen an die Lehrper<strong>so</strong>n im MehrjahrgangsklassenmodellDie Eltern sind sich einig, dass der Unterricht an Mehrjahrgangsklassen hohe Anforderungenan die Lehrper<strong>so</strong>nen stellt. Dies wird wie folgt begründet:Die Unterrichtsinhalte müssen für zwei bis drei Jahrgänge vorbereitet werden. Die Lehrper<strong>so</strong>nmuss mit einer grossen Bandbreite von Schulstoff umgehen können. Aufgabeder Lehrper<strong>so</strong>n ist es, die Inhalte zu vermitteln, damit die Kinder zuhause – falls nötig –üben können. Es darf nicht sein, dass die Eltern Unterrichtsinhalte vermitteln müssen.Die Lehrper<strong>so</strong>n muss sich für kindliche Entwicklungsprozesse interessieren. Die verschiedenenGruppen, aber auch die einzelnen Kinder müssen an ihren Lernstand angemesseneAufträge erhalten, damit sie selbständig arbeiten können ohne über- oderunterfordert zu sein. Die Lehrper<strong>so</strong>n muss den Unterricht für alle <strong>so</strong> gestalten, dass siegerne folgen und gut arbeiten können. Nur <strong>so</strong> kann bei dieser Unterrichtsform und derdamit verbundenen grossen Heterogenität ein Unterricht stattfinden, der auf alle Schülerinnenund Schüler zugeschnitten ist.Planung und Organisation des Schulalltags müssen aufgehen, damit alle Kinder undGruppen gleichzeitig sinnvoll arbeiten können. Die Lehrper<strong>so</strong>n muss für die Kinder ansprechbarsein, gerade weil sie sehr viel selbständig arbeiten müssen. Für alle Jahrgängemuss der Unterricht interessant gestaltet werden. Die Klassen <strong>so</strong>llten nicht mehrals 20 Kinder umfassen. Idealerweise hätte ein <strong>so</strong>lches Modell wohl zwei Lehrper<strong>so</strong>nenpro Mehrjahrgangsklasse.Es braucht Autorität, Ausstrahlung, Geduld, Ruhe und klare Vorgaben. Die Kinder müssenmerken, dass sie zwischendurch für sich arbeiten müssen, dann wieder mit anderenzusammen. Sie müssen merken, wann sie Hilfe beanspruchen können und wann undwie sie sich selber organisieren müssen. Die Lehrper<strong>so</strong>n muss der Gefahr entgegenwirken,dass sich die Kinder ablenken lassen. Disziplin ist wichtig, denn im Mehrjahrgangsklassenunterrichthat es wenig Platz für Störungen.5.3.2 Erwartungen und Vorstellungen der Eltern zu Unterricht an MehrjahrgangsklassenDer gleichzeitige Unterricht von verschiedenen Jahrgängen in derselben Klasse bringtjüngere und ältere Kinder zusammen, die mit dem Schulstoff unterschiedlich fortgeschrittensind. Von diesem Umstand versprechen sich die Eltern verschiedene Vorteile,die im Folgenden nach Stichworten gruppiert ausgeführt sind.11
AltersheterogenitätDie Eltern gehen davon aus, dass die jüngeren/schwächeren Kinder von den älteren/besserenprofitieren können, indem letztere den jüngeren/schwächeren als Vorbilderdienen oder <strong>so</strong>gar bei einzelnen Aufgaben helfen können. Eine weitere Erwartung indiesem Zusammenhang ist, dass die Kinder bei den oberen oder unteren Jahrgängenmithören können. Die relativ gesehen jüngeren Kinder erfahren auf diese Weise, wasauf sie zukommt. Die relativ gesehen älteren Kinder können durch die Wiederholungdes Stoffes schulische Lücken füllen. Als Vorteil sehen Eltern auch den Umstand, dassKinder, die repetieren müssen, in derselben Klasse bleiben können.Soziales LernenViele Erwartungen beziehen sich auf <strong>so</strong>ziale Aspekte des Schullebens. Rücksichtnahmeauf Kleinere und Jüngere, Rücksichtnahme darauf, dass die Lehrper<strong>so</strong>n Zeit anderenKindern widmet und sie warten müssen. Es wird davon ausgegangen, dass die grosseHeterogenität in den Mehrjahrgangsklassen Raum für die Akzeptanz von Unterschiedenschafft und der Leistungsvergleich zwischen den Kindern in der Mehrjahrgangsklasseauf diese Weise etwas in den Hintergrund tritt. Dies ist z.B. für Kinder ein Vorteil, dierepetieren müssen. Damit wird auch <strong>so</strong>zialen Schwierigkeiten in der Schule oder aufdem Schulweg vorgebeugt.Förderung von Selbständigkeit und KonzentrationEltern erwarten, dass ihre Kinder im Mehrjahrgangsklassenmodell lernen, selbständigzu arbeiten und sich zu konzentrieren, obwohl andere Klassenkameradinnen und-kameraden gerade etwas anderes machen. Dazu gehört auch, dass die Kinder lernen,sich auszutauschen und sich gegenseitig zu helfen. Die Kinder müssen sich die Arbeiteinteilen lernen, sich selber beurteilen lernen und merken, wo sie mehr arbeiten <strong>so</strong>llen.Dafür brauchen sie genügend Material, das die Lehrper<strong>so</strong>n ihnen zur Verfügung stellenmuss (s.o.).Bessere und individuellere Unterstützung durch die Lehrper<strong>so</strong>nDie Jahrgänge bestehen in einer Mehrjahrgangsklasse aus deutlich weniger Kindern alsin einer Jahrgangsklasse. Dadurch können die Kinder in den Jahrgängen durch dieLehrper<strong>so</strong>n individueller begleitet und gefördert werden. Die Erwartung besteht, dassdie Lehrper<strong>so</strong>n in der Arbeit mit den kleineren Jahrgangsgruppen schneller und besserfeststellen kann, wo ein Kind noch Unterstützung benötigt. So kann sie schliesslich dieBesseren gezielt fördern und die Schwächeren gezielt unterstützen. Bei jedem Kindkann an Stärken und Schwächen gearbeitet werden. Dadurch dass die Jahrgänge dreiJahre bei derselben Lehrper<strong>so</strong>n bleiben, kann diese über einen längeren Zeitabschnitthinweg mit den Kindern etwas aufbauen und sie begleiten.Es werden auch Bedenken gegenüber dem Modell Mehrjahrgangsklassen formuliert.Angezweifelt wird zum Beispiel, ob das Mehrjahrgangsklassensystem alle Erwartungenerfüllen kann und ob die Lehrper<strong>so</strong>nen langfristig tatsächlich ein <strong>so</strong> hohes Engagementerbringen können. Viele Vorteile des Systems können eben<strong>so</strong> gut als Nachteile gesehenwerden.So besteht durch die Altersheterogenität zwar die Möglichkeit, dass Kinder sich gegenseitighelfen, sich nacheifern oder dank der Wiederholungen ihre Lücken füllen. Derparallele Unterricht mit anderen Gruppen kann sich jedoch eben<strong>so</strong> gut negativ auswirken,indem die Kinder zu wenig Ruhe haben, um zu arbeiten, sich stark ablenken lassenund ihr eigenes Programm resp. ihren eigenen Stoff vernachlässigen. In diesem Zusammenhangbefürchtet wird auch, dass sich der Unterricht zu stark an den Stärkerenund Älteren oder an den Schwächeren und Jüngeren orientiert. Im ersten Fall wären diejüngeren Kinder überfordert und zu wenig unterstützt, im zweiten Fall wären die älterenKinder vom Schulstoff her unterfordert und gleichzeitig nicht für den Anschluss an dieSekundarstufe gewappnet.12
Wo Selbständigkeit und Konzentrationsfähigkeit der Kinder fehlen, profitieren diese inder Schule nicht genug und können nicht die notwendige Leistung erbringen. In Fragegestellt wird in diesem Zusammenhang, ob die Lehrper<strong>so</strong>nen in dieser anspruchsvollenUnterrichtssituation den Überblick über alle Kinder behalten und alle Kinder ausreichendindividuell unterstützen und fördern können. Ob die Lehrper<strong>so</strong>n für alle Kinder das angemesseneArbeitsmaterial zur Verfügung stellen kann, wird in Frage gestellt. Eben<strong>so</strong>,ob das Modell auch für jene Kinder geeignet ist, die mehr Unterstützung und Begleitungbenötigen, um im Unterricht mitzuhalten.Jemandem ist aufgefallen, dass in Zusammenhang mit der Einführung des Modells nieargumentiert wurde, dass sich Mehrjahrgangsklassen positiv auf die Schulleistungender Kinder auswirken würden. Gerade dies wäre jedoch ein wichtiges Argument für dasModell.5.3.3 Unterricht an Mehrjahrgangsklassen: Wahrnehmungen und Beobachtungender ElternWie werden nun die Erwartungen der Eltern durch die Schule <strong>Lindenfeld</strong> erfüllt? Wienehmen diese die Realität der Mehrjahrgangsklassen wahr? Einige Eltern haben Unterrichtsbesuchegemacht, um sich ein Bild der Schule und des Unterrichts zu machen.Andere konstruieren ihre Eindrücke auf der Basis der Schilderungen ihrer Kinder. Darausergibt sich ein vielfältiges Bild des Unterrichts.So lässt sich feststellen, dass es Fächer gibt, in denen alle Kinder zusammen am gleichenThema arbeiten. Dafür eignen sich NMM und Deutsch, gelegentlich auch Mathematik.Die Kinder sehen auf diese Weise, was ihr Jahrgang kann und was noch auf ihnzukommt. Einzelne Kinder bekommen <strong>so</strong> auch den Stoff der jüngeren mit, und könnenihn repetieren. So verfolgen einige Kinder den Stoff des aktuellen und des letzten Schuljahres.Bei den Arbeitsblättern wird dann für die Jahrgänge das Anspruchsniveau differenziertund/oder es werden für die schnelleren und ambitionierteren Kinder, die ihre Aufgabengut gelöst haben, Zusatzaufgaben zur Verfügung gestellt. Das Anspruchsniveau wirdauch <strong>so</strong> differenziert, dass die älteren Kinder zum gleichen Thema zusätzliche Aufgabenlösen müssen, z.B. haben alle dieselbe Lektüre, die Kinder haben dann aber verschiedeneArbeitsblätter. Ein anderes Beispiel wird aus dem Mathematikunterricht erzählt.Differenziert wird auch, indem die fortgeschrittenen Kinder Zusatzaufgaben lösenmüssen.Häufig arbeiten die Lehrper<strong>so</strong>nen mit einer Gruppe, während die übrigen Gruppen selbständigarbeiten müssen. Wenn sie in Gruppen arbeiten, schaut die Lehrper<strong>so</strong>n zwischendurchnach den Gruppen. Weil es im Schulhaus Gruppenräume hat, könnenGruppen jeweils in diesen separiert werden. Wenn die Kinder ohne Anwesenheit derLehrper<strong>so</strong>n arbeiten, ist abgemacht, was zu tun ist, wenn die Gruppen nicht ruhig arbeiten.Im Bezug auf die Gruppenzusammensetzung gibt es unterschiedliche Vorgehensweisen.So werden nach den Schilderungen von Eltern im Sport die Gruppen über dieJahrgänge hinweg gemischt, in anderen Fächern können die Kinder auswählen, wo siemitarbeiten möchten. Ein anderes Beispiel: Zwei Jahrgänge haben für sich Aufträgeerhalten, nicht genau dieselben, aber im selben Fach. Mit der dritten Gruppe führt dieLehrper<strong>so</strong>n etwas Neues ein. Diese Gruppe nimmt sie nach vorne. Es kommt auch vor,dass in jahrgangsgemischten Gruppen gearbeitet wird. Kinder berichten davon, dass sieJüngeren etwas zeigen konnten, umgekehrt, dass sie von den Grösseren lernen konnten.Gruppen werden auch nach bestimmten Bedürfnissen zusammengestellt. So lerntz.B. die Lehrper<strong>so</strong>n mit den fremdsprachigen Kindern Deutsch oder nimmt einige Kinderzusammen, die Schwierigkeiten haben, um ihnen den Stoff nochmals zu erläutern.13
Das selbständige Arbeiten der Kinder wird mit folgenden Hilfsmitteln gefördert:• Wochenplanunterricht, bei dem die Lehrper<strong>so</strong>n jede Woche in einer Lektion gezieltam Stoff arbeitet, die Kinder sich die Zeit selbständig einteilen müssen und jene, dieschneller sind, Zusatzaufgaben zu lösen bekommen.• Werkstattunterricht, bei dem die Kinder wissen, welche Posten sie zu bearbeiten habenund diese selbständig erledigen.• Listen, auf denen die Kinder (und die Lehrper<strong>so</strong>nen) nachschauen können, was siearbeiten <strong>so</strong>llen und woran sie gerade sind.Berichtet wird auch von Unterrichtsformen über die Klassen hinweg. So ist es schonvorgekommen, dass Parallelklassen dasselbe Thema bearbeiten und einzelne Kinder inder jeweils anderen Klasse etwas dazu vorstellen konnten.Beobachtet wurde weiter:• dass die Hierarchie zwischen den Jahrgängen klar gegeben ist: Jüngere, Mittlere,Ältere;• die Kinder im Schulzimmer altersgemischt sitzen;• der Unterricht sich auch an den Interessen der Knaben orientiert;• der Unterricht abwechslungsreich gestaltet ist;• alle Kinder viel arbeiten müssen;• die Kinder gefordert sind;• die Kinder von den Unterrichtsinhalten her recht weit sind;• klar definiert ist, was erledigt werden muss.So haben die Eltern den Eindruck, dass die Lehrper<strong>so</strong>nen bemüht sind, den einzelnenJahrgängen und ihren Bedürfnissen und schulischen Vorgaben gerecht zu werden. Siedenken, dass die Kinder individuell und die Jahrgangsgruppen mit ihren Bedürfnissenvon den Lehrper<strong>so</strong>nen wahrgenommen werden.Der Unterricht an Mehrjahrgangsklassen gelingt nicht immer und nicht allen Lehrper<strong>so</strong>nengleichermassen gut. So haben verschiedene Eltern auch Kritisches zum Mehrjahrgangsklassenunterrichtan der Schule <strong>Lindenfeld</strong> geäussert.So wurde festgestellt, dass die Unterrichtsmethoden von Lehrper<strong>so</strong>n zu Lehrper<strong>so</strong>nsehr variieren können, wobei auch die Qualität des Unterrichts und der Aufträge für dieKinder unterschiedlich eingeschätzt wird. Es gibt Kinder, die auf der Unterstufe unterfordertsind. Der Eindruck ist entstanden, dass jene Gruppen, die gerade nicht mit derLehrper<strong>so</strong>n arbeiten, unruhig sind und sich <strong>so</strong>mit gegenseitig stören oder auch zu weniganspruchsvolle Aufträge erledigen müssen. Problematisiert wird auch hier die Erwartungan die Kinder, dass sie sehr viel selbständig arbeiten müssen. Teilweise fehlen die nötigen(wenn auch nur kleinen) Hilfestellungen seitens der Lehrper<strong>so</strong>n, teilweise die nötigeDisziplin der Kinder.Problematisiert werden auch konkrete Anforderungen:So stören sich einige Eltern daran, dass sie zuhause nachhelfen müssen, weil aus ihrerSicht in der Schule zu wenig Zeit da war, neue Unterrichtsinhalte einzuführen. Die Stoffvermittlungsehen Eltern klar nicht als ihre Aufgabe. Festgestellt wird auch, dass zuwenig Zeit für die Wochenplanarbeit oder auch für die jüngeren Kinder auf der Mittelstufevorgesehen ist. Einige Eltern sind darüber be<strong>so</strong>rgt, dass ihre Kinder über-, andere,dass sie unterfordert sind. Einige denken, dass die Heterogenität zu wenig berücksichtigtist. Dies verweist darauf, dass es recht anspruchsvoll ist, in jedem Bereich die Alters-und Leistungsheterogenität in den Mehrjahrgangsklassen angemessen zu berücksichtigen.Auch ist für einige Eltern offen, ob ein <strong>so</strong>lches Modell in der Lage ist, fremdsprachigeKinder zu integrieren.Einige Eltern wünschen sich mehr Klarheit darüber, was das Mehrjahrgangsklassenmodelltatsächlich auszeichnet.14
5.3.4 Fazit: Hohe Erwartungen – vielfältiger SchulalltagDer Schulbetrieb im <strong>Lindenfeld</strong> wird von vielen Eltern sehr positiv beurteilt. Falls Bedenkengegen Mehrjahrgangsklassen vorhanden waren, werden diese durch die alltäglichenErfahrungen von Kindern und Eltern mit der Schule im Verlauf des ersten Schuljahresweitgehend ausgeräumt. Aus den Schilderungen der Eltern geht hervor, dassvieles, was als Vorteil des Mehrjahrgangsklassenmodells gilt, gleichzeitig auch Nachteilehaben kann. Dass sich das Modell im <strong>Lindenfeld</strong> bislang bewährt, führen die Elternauf die Professionalität und das Engagement der Lehrper<strong>so</strong>nen zurück. Die praktiziertenUnterrichtsformen, insbe<strong>so</strong>ndere wenn es darum geht, dass die Kinder selbständig undruhig für sich arbeiten <strong>so</strong>llen, werden von den Eltern unterschiedlich eingeschätzt. Eingrosses Anliegen und eine Bewährungsprobe für die Schule (vgl. Kapitel 5.2.1) bleibtdabei der problemlose Anschluss an die Sekundarstufe I nach der sechsten Klasse unddie ausreichende individuelle Förderung und Unterstützung ihrer Kinder.5.4 Zusammenarbeit mit den Eltern5.4.1 Information und Kommunikation zwischen Schule und ElternhausDie Aussagen dazu sind sehr positiv. Ein guter Einstieg ist der Schulleitung und demKollegium gelungen, als die Schule von Kindern und Eltern erstmals besichtigt werdenkonnte. Dieser Anlass ist vielen Eltern in guter Erinnerung geblieben. Auch im weiterenVerlauf der Zusammenarbeit zwischen Schule und Elternhaus gelingt die Informationund Kommunikation sehr gut. Geschätzt wird, dass Termine sehr lange im Voraus angesagtund für die Kinder und Eltern günstig gelegt werden. Die Planung fällt den Elterndamit leichter. Der Stundenplan wird gelobt, eben<strong>so</strong> die Kommunikation der Schulregeln,die die Eltern den Kindern vorlesen mussten. Planung und Organisation der Schulewirken sehr gut strukturiert, die Eltern bezeichnen sich als gut informiert. Sie fühlensich mit ihren Anliegen ernst genommen und haben den Eindruck, jederzeit in der Schulewillkommen zu sein. Abmachungen zwischen Lehrper<strong>so</strong>n, Kind und Eltern werdenschriftlich getroffen und erhalten damit eine hohe Verbindlichkeit. Der Austausch überdie Arbeitsweise und die Unterstützung der Kinder wird gelobt. Seit Start der Schulewird die Information und Kommunikation als deutlich transparenter empfunden als imVorfeld der Schuleröffnung (vgl. Kapitel 5.2.9). Es gibt zwischen Lehrper<strong>so</strong>nen und Elternein gutes, von gegenseitigem Respekt geprägtes Vertrauensverhältnis. EinigeLehrper<strong>so</strong>nen bieten regelmässige Sprechstunden an, zu denen sich Eltern anmeldenkönnen, wenn sie das Bedürfnis nach Austausch haben. Andere bieten Gesprächszeitennach telefonischer Vereinbarung flexibel an. Sind Kinder krank, wird schnell nachLösungen gesucht, damit sie die Unterrichtsinhalte nacharbeiten können. Geschätztwerden die verschiedenen verwendeten Kommunikationsmittel wie Kontaktheft, Beurteilungsbogen,Quartalsbrief, Sprechstunden u.a.m.Kritisiert wird einzig, dass sich am ersten Elternabend nicht alle Lehrper<strong>so</strong>nen vorgestellthaben, <strong>so</strong>ndern nur die Klassenlehrper<strong>so</strong>nen.5.4.2 Die BeurteilungBe<strong>so</strong>nders geschätzt wird von den Eltern, dass ihre Kinder nach jedem Quartal differenziertbeurteilt werden. Die Rückmeldungen für Eltern und Kinder geben ein recht genauesBild über den Lernstand der Kinder in allen Schulfächern. So ist es denn auch beiden Beurteilungsgesprächen im Januar zu keinen Überraschungen gekommen. An denBeurteilungsgesprächen waren fast alle Kinder anwesend, was von den Eltern geschätztwurde. Einige der Lehrper<strong>so</strong>nen besprachen die Beurteilung denn auch weitgehendmit den Kindern, die Eltern konnten sich einbringen. Bei anderen waren eher dieEltern Ansprechper<strong>so</strong>nen, und die Kinder wurden jeweils gefragt, was sie über das Besprochenedenken. Für einzelne Kinder war das Beurteilungsgespräch gewöhnungsbedürftig,andere fühlten sich in diesem Setting sehr wohl und trugen konstruktiv zu Lö-15
sungen bei. Auch die terminliche Organisation der Beurteilungsgespräche wird gelobt.Die Eltern haben den Eindruck, dass die Kinder im Hinblick auf eine optimale Förderungund Unterstützung von den Lehrper<strong>so</strong>nen aufmerksam beobachtet werden.Generell erwarten die Eltern von den Lehrper<strong>so</strong>nen, dass sie bei Problemen oderSchwierigkeiten des Kindes, die zuhause nicht unbedingt spürbar sind, von sich aus<strong>so</strong>fort mit den Eltern Kontakt aufnehmen.Kritisch nachgefragt wurde, wie die Elterngespräche mit den fremdsprachigen Elternwohl verlaufen sind. Auch denken einige Eltern, dass es nicht immer geschickt ist, wenndie beurteilten Kinder beim Beurteilungsgespräch dabei sind, da die Erwachsenen mitden Lehrper<strong>so</strong>nen nach Lösungen suchen möchten, die den Kindern möglicherweisenicht zusagen. Betont wird zudem, dass <strong>so</strong>fern beim Beurteilungsgespräch Schwierigkeitenangesprochen werden, Eltern und Kind im Voraus darüber informiert sein <strong>so</strong>llten.5.4.3 Fazit: „Das Bewertungsmosaik, das ist mustergültig, eine ganzheitlicheBeurteilung.“ (IP 09)Die Zusammenarbeit von Schulleitung, Lehrper<strong>so</strong>nen und Eltern wird sehr positiv beurteilt.Die Eltern fühlen sich sehr gut und transparent darüber informiert, was in der Schuleläuft. Sie schätzen die offene Atmosphäre und den Umstand, jederzeit willkommen zusein.Hervorgehoben wird die ganzheitliche und regelmässige Beurteilung der Kinder durchdie Lehrper<strong>so</strong>nen (Bewertungsmosaik). Dass in der Schule alles gut läuft, und dass beiProblemen oder Schwierigkeiten <strong>so</strong>fort mit den Eltern Kontakt aufgenommen wird, ist füralle Eltern sehr wichtig. Sie verlassen sich diesbezüglich auf die Schule und schätzenes, wenn ihre Anliegen ernst genommen werden. Es kann davon ausgegangen werden,dass die Zusammenarbeit mit den Eltern in Bezug auf Leistung und Beurteilung sehrviel zur Etablierung der Schule <strong>Lindenfeld</strong> beiträgt. Das Engagement der Lehrper<strong>so</strong>nenund der Schulleitung in diesem Bereich ist wesentlich für das Vertrauensverhältnis zwischenSchule und Elternhaus.5.4.4 Die BehördenIn diesem Kapitel fassen wir die Aussagen der Eltern zur Schulkommission, zum Elternratund zur Schuldirektion zusammen, <strong>so</strong>fern wir sie nicht bereits in Zusammenhang mitder Zuteilung berücksichtigt haben.Von den Eltern wahrgenommen wird, dass eine Vertreterin der Schulkommission jeweilsan den Elternabenden und an weiteren Schulanlässen anwesend ist. Der Kontakt zurSchulkommission steht allerdings für die meisten Eltern nicht im Vordergrund. Für siesind die (Klassen)Lehrper<strong>so</strong>nen und für bestimmte Fragen der Elternrat Ansprechpartnerund -partnerinnen.Als sehr aktiv und engagiert wird der Elternrat der Schule eingeschätzt. Es wird ihmattestiert, er nehme die Interessen von Kindern und Eltern wahr. Erwähnt wird, dass dieSchulleitung sich bemüht hat, den Elternrat frühzeitig zu organisieren. So besteht er seitdem ersten Schultag. Die meisten Eltern kennen die Aktivitäten und Themen des Elternratesund können aufzählen, welche Projekte verfolgt werden. Elternrat und andereinitiative Gruppen ermöglichten, dass Mittagstisch, Bibliothek und Aufgabenhilfe schnellihren Betrieb aufnehmen konnten. Auch bei der offiziellen Schulhauseröffnung hat derElternrat mitgeholfen. Weitere Themen sind die Verkehrssicherheit, Sicherheitsmassnahmenbeim Biotop, die Schulhausplatzgestaltung oder auch die nahe Gewerbeschule,d.h. das Zusammentreffen von Primarschul- und Kindergartenkindern mit Jugendlichender Gewerbeschule, was einigen Eltern Sorgen bereitet.Verschiedene Anlässe wurden organisiert, damit sich die Eltern gegenseitig kennenlernen konnten. Nicht alle Eltern konnten – trotz Interesse – teilnehmen.16
Bislang gab es zwischen Schule und Elternrat wenige Meinungsverschiedenheiten. DerElternrat wird – <strong>so</strong> die Wahrnehmung der Eltern – von der Schulleitung mehrheitlichunterstützt.Manchmal scheinen die Zuständigkeiten nicht ganz klar zu sein. Es wird erwartet, dasssich die Zusammenarbeit und die Position des Elternrates im Gefüge der verschiedenenInstitutionen mit der Zeit besser einspielen wird. Erwartet wird, dass der Elternrat inallen wichtigen Fragen zumindest angehört wird. Seine Aufgabe ist es, die Interessender Schulklassen und nicht die Interessen von Einzelper<strong>so</strong>nen zu vertreten. Für letzteresind – <strong>so</strong> der Tenor – die Lehrper<strong>so</strong>nen oder die Schulleitung die Ansprechpartnerinnen.Auch zwischen Schulkommission, Schulbehörden, Gesamtelternrat und Elternrat derSchule <strong>Lindenfeld</strong> scheinen die Zuständigkeiten noch nicht eingespielt und nicht immerklar zu sein. Dies führt aus Sicht von Eltern zu unnötigen Verzögerungen von sinnvollenProjekten und demotiviert die engagierten Eltern. Die Schulbehörden und die Stadt werdenals sehr zurückhaltend empfunden.5.4.5 Fazit: „Die einzelnen Mitglieder des Elternrats sind sehr engagiert undmotiviert.“ (IP 11)5.5 Wünsche für die ZukunftVerschiedene Eltern wünschen sich, dass es einfach <strong>so</strong> gut weitergeht wie bisher: motivierteund initiative Lehrper<strong>so</strong>nen, eine straff geführte Schule, weiterhin aussagekräftigeRückmeldungen zu den Leistungen der Kinder nach jedem Quartal. Es ist ihnen einAnliegen, dass sich die Kinder weiterhin in der Schule wohl fühlen, menschlich und leistungsmässigausreichend gefordert und gefördert werden.Einige Eltern äussern den Wunsch nach der Realisierung von konkreten Projekten. erwähntwerden:• Projektwochen über die Mehrjahrgangsklassen hinweg;• eine „Samstagsschule“ organisiert von Eltern für Kinder;• ein schön gestalteter Pausenplatz.Weitere Wünsche sind, dass der Mehrjahrgangsklassenunterricht auf der Unterstufeauch mit drei Jahrgängen <strong>so</strong> harmonisch verlaufen wird. 150 Stellenprozente pro Mehrjahrgangsklasse- <strong>so</strong> eine Anregung – würden sicherstellen, dass die schwächeren undjüngeren Kinder optimal unterstützt werden könnten.Verschiedene Eltern wünschen sich, dass sich andere Schulen an den Lehrper<strong>so</strong>nenund am Beurteilungsbogen der Schule <strong>Lindenfeld</strong> ein Vorbild nehmen. Sie wünschensich, dass das Kollegium weitergebildet, gestärkt und wo nötig unterstützt wird. EinWunsch ist auch, dass das Spezifische am Modell Mehrjahrgangsklassen klarer definiertund herausgearbeitet wird.Andere wünschen sich einfach, dass ihre Kinder gut durch die Schule kommen und fürdie Zukunft etwas lernen können.5.5.1 Fazit: „Ich wünsche mir, dass es <strong>so</strong> weiterläuft wie bis jetzt.“ (IP 07)5.6 Motivation für das Interview/Erwartungen an das ProjektDie meisten Eltern haben sich an dem Interview beteiligt, weil sie gerne ihre Meinungäussern, Einfluss nehmen und als Eltern etwas zum Gelingen und zur Entwicklung derSchule <strong>Lindenfeld</strong> beitragen möchten. Sie helfen gerne, das Bild der Schule aus ihrerSicht zu ergänzen. Viele erzählen gerne ihre positiven Erfahrungen mit der Schule und17
mit dem Mehrjahrgangsklassenmodell, das sie in der Praxis der Schule <strong>Lindenfeld</strong> ü-berzeugt. Auch interessiert, wie die anderen Eltern das Modell heute einschätzen.Einige heben hervor, dass sich die Schule einer Aussenperspektive öffnet und attestierenden Lehrper<strong>so</strong>nen Mut, sich dem auszusetzen. Vom Projekt erhoffen sie sich eineklarere Definition von Mehrjahrgangsklassenunterricht, Informationen über Vor- undNachteile dieser Unterrichtsform, fachkompetente Betreuung, Begleitung und Weiterbildungdes Kollegiums. Es interessiert, ob Mehrjahrgangsklassen in einem städtischenUmfeld Zukunft haben, ob <strong>so</strong>lche Modelle vermehrt eingeführt werden <strong>so</strong>llen oder nicht.5.6.1 Fazit: „Man kann auch mal über Gutes berichten.“ (IP 14)6 Zusammenfassung• Die neue <strong>Primarschule</strong> <strong>Lindenfeld</strong> Burgdorf hat sich als Quartierschule etabliert.Heute wehrt sich niemand mehr gegen die Zuteilung in die Schule <strong>Lindenfeld</strong>. DieEltern wünschen sich, dass auch ihre jüngeren Kinder ins <strong>Lindenfeld</strong> eingeschultwerden.• Die Eltern wünschen sich, dass der Schulalltag weiterhin <strong>so</strong> zufriedenstellend verläuftwie bisher.• Der Nutzen der Altersdurchmischung für die schulische Entwicklung und die Motivationder Kinder wird gesehen.• Es wird als Vorteil gesehen, dass ein Kollegium für ein <strong>so</strong>lches Projekt neu zusammengestelltwird. Dadurch werden Innovationsprozesse begünstigt.• Die Schule wird als dem Quartier zugehörig empfunden. Ihr Pausenhof/der rotePlatz ist zu einem Treffpunkt für Kinder geworden. Kinder aus dem Quartier besuchengemeinsam die Schule.• Als Gebäude findet das Schulhaus sehr viel Anklang. Bemängelt werden die Pausenplatzgestaltung,die fehlende Lüftung und die Verkehrssicherheit.• Der Elternrat wird als sehr aktiv und den Anliegen der Eltern verpflichtet wahrgenommen.• Die Schule hat die an sie gestellten Erwartungen übertroffen, viele Eltern sind heutevon der Schule <strong>Lindenfeld</strong> und vom Modell überzeugt. Im aktuellen Schuljahr wirdsich zeigen, ob der Anschluss an die Sekundarstufe gelingt und ob auch auf der Unterstufemit drei Jahrgängen in einer Klasse gearbeitet werden kann.• Die grosse Heterogenität der Schülerinnen und Schüler im Modell Mehrjahrgangsklassenwird als Chance, aber auch als grosse Herausforderung gesehen. Befürchtetwird, dass sich der Unterricht einseitig an den schwächsten oder den stärkstenKindern orientiert und <strong>so</strong>mit die übrigen Kinder entweder unter- oder überfordertsind.• Kollegium und Schulleitung erhalten für ihr Engagement sehr viel Anerkennung undRespekt. Be<strong>so</strong>nders hervorgehoben wird, dass die Eltern über den Lernstand ihrerKinder sehr gut informiert sind (Beurteilung pro Quartal). Dies wird sehr geschätztund gibt den Eltern Sicherheit, dass ihre Kinder in der Schule ausreichend gefördertund gefordert werden.• Die Kinder fühlen sich in der Schule <strong>Lindenfeld</strong> wohl. Viele Aktivitäten in der Schulezielen auf die Bildung einer Schulgemeinschaft ab. Die Schule wird als familiär undüberschaubar geschildert. Die Kinder nehmen aufeinander Rücksicht – über die Al-18
tersgruppen hinweg. Nachteil der kleinen Schule und der Mehrjahrgangsklassenbleibt, dass die Auswahl an gleichaltrigen, gleichgeschlechtlichen Spielkameradinnenund –kameraden begrenzt ist.• Die grosse Akzeptanz der Schule und des Modells ist dem Engagement und derProfessionalität der Lehrper<strong>so</strong>nen zu verdanken. Die Zusammenarbeit zwischenSchule und Elternhaus verläuft transparent und trägt viel zum Vertrauen in dieSchule bei. Der Umstand, dass im <strong>Lindenfeld</strong> das Modell Mehrjahrgangsklassenpraktiziert wird, hat vor diesem Hintergrund an Brisanz verloren.• Eltern möchten, dass ihre Kinder optimal unterstützt und gefördert werden. DiesenAnspruch löst der Unterricht an der <strong>Primarschule</strong> <strong>Lindenfeld</strong> ein. Offen bleibt dabeifür einige Eltern, ob <strong>so</strong>lche Unterrichtsformen nicht auch in Jahrgangsklassen praktiziertwerden könnten, resp. was denn nun das Spezifische am Mehrjahrgangsklassenunterrichtsein <strong>so</strong>ll.• Festgestellt wird von Eltern auch, dass sich der Unterricht von Lehrper<strong>so</strong>n zu Lehrper<strong>so</strong>ndeutlich unterscheiden kann – auch im Modell Mehrjahrgangsklassen.• Der Klärungsbedarf dessen, was Mehrjahrgangsklassenunterricht in der Praxisausmacht, wurde von Schulleitung und Lehrper<strong>so</strong>nen erkannt. Dieses Bedürfnisspiegelt sich auch in den Aussagen einiger Eltern wieder.7 Nachtrag: Elternabend vom 11. September 2007Die Resultate der Elternbefragung <strong>so</strong>wie die weiteren Projektschritte wurden am 11.September 2007 an einer Elterninformation rund 15 interessierten Eltern, einzelnenBehördenmitgliedern und dem Kollegium der Schule <strong>Lindenfeld</strong> vorgestellt. Einerseitswar die Stimmung an diesem Abend sehr positiv, einzelne Eltern haben den Lehrper<strong>so</strong>nenund der Schulleiterin für ihr Engagement gedankt. Es gab dann auch kritischeStimmen. So wies jemand darauf hin, dass im Vorfeld der Schuleröffnung versprochenworden war, die Klassen würden klein gehalten. Nun seien in die Klassen jedoch grösserals teilweise in anderen Burgdorfer Schulhäusern. Eine weitere Per<strong>so</strong>n meint, eswäre sinnvoll, in zwei Jahren die Eltern nochmals zu befragen. Dann habe man auchErfahrungen mit den Sekundarstufenübertritten und dem Vollausbau der Schule. Esgäbe auch weiterhin Eltern, die dem Modell gegenüber skeptisch eingestellt seien.19
Anhang: KodierleitfadenKategorie [Kode] Definition Ankerbeispiele Kodierregeln(Abgrenzung zu anderenKategorien [Kodes])A BefindlichkeitA01A02Befindlichkeit in derKlasse / SchulgemeinschaftBefindlichkeit mit Lehrper<strong>so</strong>n(en)Kind fühlt sich in der Klasse gutintegriertKind hat Freundinnen und Freundein der KlasseKind fühlt sich wohlKind geht gern zur Schule<strong>so</strong>wie negative Aussagen zu diesenPunktenKind hat Vertrauen zu Lehrper<strong>so</strong>n(en)Kind fühlt sich gerecht behandeltKind fühlt sich im Lernen unterstütztLehrper<strong>so</strong>n mag die KinderLehrper<strong>so</strong>n nimmt Kind gut wahr<strong>so</strong>wie negative Aussagen zu diesenPunkten„Mein Kind fühlt sich wohl, es geht jedenfallsgern zur Schule.“ (IP 01, 86)„Und mein Kind sagt: ‚Wir haben den Frieden,wir haben es schön, wir kennen alle einander.’Es freut sich auch, dass es die anderen Lehrerinnenkennt und sagt: ‚Das ist diejenige vondieser Klasse.’ Al<strong>so</strong> ich glaube, es geniesst das,dieses Familiäre, das Überschaubare. (IP 02,22)„Das ist im Turnen, da hat mein Kind immer dasGefühl, die Jüngeren werden bevorzugt von derLehrerin, gegenüber den Älteren.“ (IP 01, 34)„Mein Kind sagt auch ab und zu: ‚Frau x ist meineLieblingslehrerin’. Es erzählt auch sehr vielvon ihr.“ (IP 03, 240)Was Kinder zuhause erzählenWas Kinder zuhause erzählen20
A03 Befindlichkeit MJK-Unterricht Befindlichkeit des Kindes in Zusammenhangmit MJK-Unterricht,positive und negative AspekteA04 Befindlichkeit Schulwechsel Aussagen zum Wechsel der Lehrper<strong>so</strong>n,der Klasse und der Schule„Mein Kind erzählt vor allem von dem, was siemachen, dass dies irgendwie gemischte Klassensind ist für mein Kind überhaupt nichts Speziellesmehr, das ist einfach normal.“ (IP 07, 38)„Mein Kind hat zum Beispiel schon erzählt,wenn sie Grüppchen gemacht haben (…), wennein Auftrag war, wo sie Grössere gebrauchthaben, die geholfen haben. Wenn es ein bisschenspeziell ist, wenn etwas anders ist, als inder Schule, die es vorher besucht hat.“ (IP 09,22)„Wir haben herausgefunden, dass es unserKind stresst, weil es weiss, es will diese Aufgabein der Schule erledigen, es will nachher nichtalles zu Hause machen müssen, und es hateinfach gemerkt, <strong>so</strong> komme ich nicht vorwärts,ich möchte das jetzt machen und es geht nichtwegen dem anderen Kind, das stört. Und eskann ihm sagen, ‚sei still’ und es nützt nichts.“(IP 11, 34)„Unser Kind wollte wechseln, sah den Wechselals Chance.“ (IP 15, 32)„Und <strong>so</strong> hat man sich damit abgefunden, dieKinder dann auch, als es bestimmt war und dasist jetzt problemlos, unser Kind geht sehr gernzur Schule.“ (IP 07, 13)Was Kinder zuhause erzählenAussagen über Wechsel derLehrper<strong>so</strong>n, Klasse und/oder Schulwechsel allgemein,Wahrnehmung derEltern und Kinder, wie esihnen in der neuen Schulegeht (keine Aussagen zuAuswahlverfahren und Zuteilungdurch Behörden)21
Kategorie [Kode] Definition Ankerbeispiele KodierregelnB Schule <strong>Lindenfeld</strong>B01 Schule <strong>Lindenfeld</strong>:BewährungsprobeB02Schule <strong>Lindenfeld</strong>:Kollegium / SchulleitungSchule im Fokus der PolitikSchule unter Erfolgsdruck (MJK)Leistung / SelektionNeue SchuleWeibliches KollegiumEngagierte Lehrper<strong>so</strong>nenZusammenarbeit unter den Lehrper<strong>so</strong>nenSchulleitungKlarer Rahmen, klare Regeln undKonsequenzenPlanung und OrganisationWeiterbildung(sprojekt)Erfahrung mit MJKGemeinsame Vorstellung von MJKKlare Definition von MJK„Weil dieses System war politisch nicht sehrwillkommen am Anfang in Burgdorf. Und wahrscheinlichwird ein gewisser Druck vorhandensein gegenüber der Schulvorsteherin und denSchulper<strong>so</strong>nen.“ (IP 01, 102)„Al<strong>so</strong> was mir gleich zuvorderst ist, einfachÄngste, sie kommen fachlich dann weniger weit,sie kommen mit dem Stoff nicht durch, sie erwischenden Anschluss an die Sekundarschulenicht, weil sie Rücksicht nehmen müssen aufJüngere oder Ältere, vielleicht auch wenigerAufmerksamkeit von der Lehrerin haben.“ (IP15, 38)„Al<strong>so</strong> ich habe das Gefühl, es ist eine starkeLeitung da und es ist der Wille da, gemeinsamvorzugehen zu einem gemeinsamen Ziel.“ (IP01, 223)„Dass es extrem engagierte Lehrper<strong>so</strong>nen sind,al<strong>so</strong> ich habe wirklich durchs Band weg, eigentlicheinen ganz guten Eindruck von allen.“ (IP09, 511)„Eine kleinere Schule, ein total motiviertes Lehrerteam,weil sie ja frisch angefangen haben (..)und dann kommen diese Frauen, die wollen, dieinteressiert sind, die sich Mühe geben, totalandere Bücher, andere Geschichten, einfachganz, ganz anders.“ (IP 02, 66)Geäusserte Vorurteile, Ängsteund Erwartungen, Skepsisgegenüber dem System MJKAussagen zum Kollegiumund zur Schulleitung22
B03B04B05Schule <strong>Lindenfeld</strong>:Aufbau der SchulgemeinschaftSchule <strong>Lindenfeld</strong>:Gebäude und UmschwungSchule <strong>Lindenfeld</strong>:QuartierschuleAktivitäten (Eröffnung, Singen)Klassenübergreifende ProjekteZusammenhaltSchulhausgebäudeRäumeUmgebungsgestaltungLüftungDas Quartier hat ein eigenesSchulhausKurzer SchulwegPausenplatz als Treffpunkt„… dass man wirklich mit neuen Kräften etwasNeues aufbaut. Und zwar nicht nur schulisch,<strong>so</strong>ndern auch vom Sozialen her.“ (IP 01, 202)„Am Anfang zur Eröffnung mussten alle Kindereinen faustgrossen Emmestein mitbringen,dann bemalte jede Klasse diese Steine mit einerbestimmten Farbe. Dann ordneten sie dieseSteine klassenweise in der Eingangshalle an.(…) da ordneten sie die Steine <strong>so</strong> an, das gabein sehr farbiges Gebilde, das war sehr schön.Solche Sachen. Ich habe das Gefühl, es istschon ein Projekt da, dieser Schule eine Einheitzu geben und etwas Gemeinsames aufzubauen.Auch mit diesen Kindern, ihnen das Verständniszu übermitteln, dass sie zu dieserSchule gehören und dass sie eigentlich einKollegium sind, alle Schüler zusammen.“ (IP 01,197)„Mich dünkt, es ist wirklich etwas karg um dasSchulhaus herum.“ (IP 02, 215)„Ich finde es ein schönes Schulhaus, sie habensich dort wirklich etwas einfallen lassen, dieRäume sind schön.“ (IP 03, 457)„Ich höre, dass sie ein Problem haben mit derHitze und wegen der Lüftung. Dort ist die Architekturfür mich ein wenig fraglich.“ (IP 08, 103)„Unsere Kinder gingen eigentlich auch nie aufdiesen Sportplatz und seit dieses Schulhaus daist, ist das einfach der Treffpunkt. Man geht aufden roten Platz.“ (IP 05, 127)„Es ist natürlich super, wir haben hier im Quartierdas Schulhaus, das ist natürlich wunderschön.“(IP 08, 107)Aktivitäten, die die Schulgemeinschaftfördern und allenin Erinnerung geblieben sindAussagen zu Gebäude undUmschwungSchule als Teil des Quartiers23
B06B07Schule <strong>Lindenfeld</strong>:Be<strong>so</strong>nderheitenSchule <strong>Lindenfeld</strong>:ZuteilungSpielsachen im EingangsbereichPausenkioskMittagstischAufgabenhilfeMJK-SystemAktiver ElternratErfahrungen in Zusammenhang mitder ZuteilungBeurteilung des Ablaufs und desVorgehens der Behörden„Es werden drei Mittage angeboten. Es gibteinen eigenen Raum, das ist halt ideal, das hates <strong>so</strong>nst noch nirgends in Burgdorf, in keinemSchulhaus. Die Mittagstische müssen <strong>so</strong>nst alleirgendwo ausweichen.“ (IP 05, 208)„Und auch der Eingangsbereich, da haben siedie Möglichkeit, etwas zu spielen, es hat Bälle,es hat Frisbees, es hat alles Mögliche, das sienehmen können.“ (IP 04, 139)„Ja, sie achteten darauf, dass die Kinder, die indiesem Quartier wohnen auch in dieses neueSchulhaus kommen und in dieselbe Klasse.“ (IP01, 98)„Man konnte schon ein Gesuch machen, abersie schrieben auch klar, dass sie nicht allenGesuchen entsprechen werden.“ (IP 05, 66)„Dies war einfach ein Entscheid der Schulkommissionund wie genau dies zu Stande gekommenist, weiss ich auch nicht.“ (IP 07, 30)Aussagen zu Angebotenoder Be<strong>so</strong>nderheiten derSchuleAuch Aussagen zum MJK-System, die sich aber nichtauf den Unterricht beziehen.Aussagen betreffend Zuteilung24
CC01C02Kategorie [Kode] Definition Ankerbeispiele KodierregelnUnterricht an MehrjahrgangsklassenUnterricht an MJK:Lehrper<strong>so</strong>nenUnterricht an MJK:Erwartungen / Vorstellungder ElternGrosser AufwandViel EngagementRisikenGute Planung, Vorbereitung undOrganisationIndividualisieren/individuelle PlanungDifferenzierenThemen nach Niveau ausweitenÜber- / unterfordernBeschäftigenGruppenunterrichtSelbständiges ArbeitenIntegration von fremdsprachigenKindernSoziales Lernen„Es braucht viel Vorbereitung, weil alle Gruppengenug Stoff brauchen.“ (IP 01, 388).„Ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach auchdas Gefühl, dieses Schulsystem, das steht undfällt mit dem Lehrer. Al<strong>so</strong> wenn sich dort derLehrer nicht wahrscheinlich zu 200 Prozenteinsetzt, dann kommt es vielleicht nicht <strong>so</strong> gut,habe ich das Gefühl.“ (IP 14, 78)„Ich denke, dass es wirklich gut ist, wenn mandas Kind individueller fördern kann und wenn essich vielleicht nicht immer mit 18 anderen messenmuss. Man hat dort das kleinere Grüppchen.Und ich habe das Gefühl, dass wenn dieLehrkraft dann für das Grüppchen Zeit hat,merkt sie eben dann vielleicht schneller, wo esklemmt, als wenn sie alles immer mit allenmacht.“ (IP 06, 90)„Aber mein Kind kann einfach für sich selberetwas aufholen, wo es vielleicht etwas Defizitehätte. Weil es sieht wie die anderen arbeiten,oder wie es gemacht wird, und dann kann esdas speichern, und nachher wenn eine <strong>so</strong>lcheRechnung käme oder irgendetwas <strong>so</strong>, dannweiss es, aha, das habe ich schon gesehen,das kann ich dann.“ (IP 13, 186)Aussagen der Eltern zu Vorstellungenüber Anforderungenan Lehrper<strong>so</strong>nen, die aneiner MJK unterrichten.Aussagen der Eltern darüber,wie sie sich das Lernenund den Unterricht in derMehrjahrgangsklasse vorstellen.25
C03Unterricht an MJK:Wahrnehmung / Beobachtungder ElternIndividualisieren/individuelle PlanungDifferenzierenThemen nach Niveau ausweitenÜber- / unterfordernGruppenunterrichtSelbständiges ArbeitenIntegration von fremdsprachigenKindernSoziales Lernen„Bei x ist es <strong>so</strong> gelaufen, wenn ein Jüngeresfertig ist mit seinen Matheaufgaben und daswirklich aus dem Effeff gemacht hat, dann kannes schwierigere Sachen machen und das findeich sinnvoll.“ (IP 01, 295)„Jedes Kind konnte selber mit der Lehrper<strong>so</strong>nfestlegen, welche Art Aufgabe es lösen <strong>so</strong>ll.Dort hat sie eben wirklich individuelle Sachengemacht für jedes.“ (IP 11, 182)Aussagen der Eltern darüber,wie sie den MJK-Unterricht wahrnehmen(durch Schulbesuche) und /oder was sie davon mitbekommen(durch Lehrmittel,Hausaufgaben, Erzählungender Kinder).26
DD01D02D03Zusammenarbeit mit denEltern: BeurteilungZusammenarbeit mit denEltern: Elternmitarbeit undBehördenKategorie [Kode] Definition Ankerbeispiele KodierregelnZusammenarbeit mit denElternZusammenarbeit mit denEltern: Information/ KommunikationInformationsveranstaltungen/-schreibenBedürfnisse der Eltern werdenwahrgenommen (Planung, Information)Beurteilungsgespräch (kindbezogen,elternbezogen)QuartalsberichtBewertungsmosaikTests werden unterschriebenElternrat, GesamtelternratProjekteSchulkommissionBildungsdirektionGemeinderat„Man wird gut informiert, was läuft und frühzeitig,das ist für die Eltern sehr wertvoll. Man wirdklar und transparent informiert, wie sie washandhaben.“ (IP 12, 83)„Die Kollegiumstage werden jetzt seit diesemJahr semesterweise vorausgesagt.“ (IP 01, 257)„Und die Lehrerin richtete sich an x, wir warenda und verfolgten das natürlich mit. Aber imMittelpunkt stand das Kind, das empfand ichsehr positiv und das störte x. gar nicht.“ (IP 01,S. 18)„Das Bewertungsmosaik ist mustergültig. Weil,klar unterschreiben wir jede Lernkontrolle, die<strong>so</strong>nst nach Hause kommt, das finde ich auch inOrdnung, auf dieser Stufe. Aber wirklich, dassman dann diese Rückmeldung erhält, fachspezifischund wirklich auch zum Arbeitsverhaltenjeweils, wirklich periodisch Rückmeldung erhältund nicht einfach dann nach einem Jahr, erstmals<strong>so</strong> ein Papier nach Hause bekommt, damuss ich sagen mustergültig. Das könnte manüberall einführen.“ (IP 09, 560)„Es hatte genügend Freiwillige für den Elternrat,Leute, die sich gerne engagieren und das auchwirklich gut machen.“ (IP 12, 281)Aussagen der Eltern zu Informationund Kommunikationmit Schule und Lehrper<strong>so</strong>nenAussagen der Eltern zurBeurteilung und zum ElterngesprächAussagen zu den Schulgremienund -behörden27
Kategorie [Kode] Definition Ankerbeispiele KodierregelnE ZukunftsvorstellungenE01 Wunsch für die Zukunft Leitfaden „Was vielleicht noch wünschenswert wäre - und Frage im Leitfadendas ist wahrscheinlich auch das Ziel Ihres Projektes- ist, dass man dieselbe Auffassung vonMehrjahrgangsklassenunterricht hat. Dass manwirklich auch gleich vorgehen kann und dass esdasselbe bewirkt.“ (IP 01, 275)E02 Motivation für TeilnahmeInterviewLeitfaden„Weil ich es gut finde, wenn einmal jemand anderesnoch ein wenig hineinschaut und es etwasbeleuchtet.“ (IP 06, 714)Frage im Leitfaden28