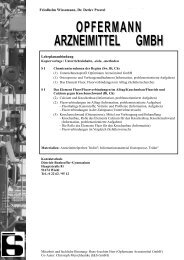Duales System Deutschland GmbH - Portal Schule Wirtschaft
Duales System Deutschland GmbH - Portal Schule Wirtschaft
Duales System Deutschland GmbH - Portal Schule Wirtschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Vollmer: KIS Köln <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> Seite 1<br />
I&S Gesellschaft<br />
für partnerschaftliche<br />
Beziehungen<br />
zwischen Industrie<br />
und<br />
<strong>Schule</strong>/Öffentlichkeit<br />
Bonn 1997<br />
Willi Schroer<br />
Kopiervorlage 1<br />
DUALES SYSTEM<br />
DEUTSCHLAND GMBH<br />
Lehrplananbindung<br />
Kopiervorlage / Unterrichtsinhalte, -ziele, -methoden<br />
S I <strong>Duales</strong> <strong>System</strong>/Grüner Punkt/Abfall - Wertstoffe (Sw, Bi, Ek, Ch)<br />
(1) Unternehmensprofil <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> (Information)<br />
(1) Aufgaben und Fragen zum Dualen <strong>System</strong> (problemorientierter Einstieg)<br />
(2) Entwicklung der Abfallmengen und Wertstofferfassung im Raum Rhein-Sieg<br />
(Information, problemorientierte Aufgaben)<br />
(2) Abfallerhebung in den Familien der Schüler, Fragebogen<br />
(handlungs- und problemorientiert)<br />
S I Stofftrennung/Abfallsortierung/Sortieranlage (Sw, Bi, Ek, Ch)<br />
(3) Kommunale Abfallentsorgung und <strong>Duales</strong> <strong>System</strong>: Erfassung, Entsorgung und<br />
Verwertung der unterschiedlichen Abfallsorten (handlungs- und problemorientiert)<br />
(4) Abfälle in der <strong>Schule</strong>: Differenzierte Beleuchtung der unterschiedlichen Abfallquellen<br />
und Suche nach Verbesserungen bei der Müllvermeidung und -entsorgung<br />
(handlungs- und problemorientiert)<br />
(5) Abfalltrennung in der Sortieranlage, Erarbeitung unterschiedlicher Trennverfahren<br />
(Information, problemorientierte Aufgaben)<br />
S I/S II Kunststoffabfälle/rohstoffliche und werkstoffliche Verwertung (Ch)<br />
(6) Gegenüberstellung der rohstofflichen und werkstofflichen Verwertungsverfahren<br />
von Kunststoffabfällen (Information, problemorientierte Aufgaben)<br />
Materialien: Informations- und Unterrichtsmaterialien<br />
Kontaktschule<br />
Albert Einstein Gymnasium<br />
St. Augustin - Niederpleis<br />
Tel.: 02241/3993-0, -25<br />
Mitarbeit und fachliche Beratung: Vera Becher-Andre, Hansjörg Nieß<br />
(<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong>)<br />
Co-Autoren: Hansjörg Nieß (<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong>),<br />
Christoph Merschhemke (I&S <strong>GmbH</strong>)
Seite 2<br />
<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> Vollmer: KIS Köln<br />
Kopiervorlage 1<br />
‘Der Grüne Punkt - <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> Gesellschaft für<br />
Abfallvermeidung und Sekundärrohstoffgewinnung mbH’: So<br />
lautet der genaue Firmenname des bundesweit tätigen und rund<br />
300 Mitarbeiter zählenden Unternehmens mit Sitz in Köln-<br />
Porz. Du findest es, wenn du vom Autobahnkreuz Gremberghoven<br />
aus auf der Frankfurter Straße in Richtung Köln-Porz<br />
fährst. Nach etwa 1000 m siehst du auf der linken Straßenseite<br />
ein modernes, etwas schmuckloses Ziegelsteingebäude. Von hier<br />
aus werden die Aktivitäten des Unternehmens bundesweit gesteuert.<br />
Übrigens befindet sich die Unternehmenszentrale erst seit etwa<br />
2 Jahren an dieser Stelle in Köln-Porz. Angefangen hat im Jahre<br />
1991 alles viel bescheidener, als etwa 10 Mitarbeiter in Bonn in<br />
einem kleinen Büro ihre Aktivitäten aufnahmen.<br />
Die <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> entstand auf der Grundlage<br />
der 1991 erlassenen Verpackungsverordnung, die u.a. besagt,<br />
daß der Handel verpflichtet ist, die Verpackungen der von<br />
ihm verkauften Produkte zurückzunehmen und der Verwertung<br />
zuzuführen. Damit sollte für die Verpackungen ein gut funktionierendes<br />
Kreislaufsystem in Gang gesetzt werden, um zu verhindern,<br />
daß <strong>Deutschland</strong> in seiner Verpackungsflut erstickt.<br />
Um den Handel aber nicht mit einer Aufgabe zu belasten, die er<br />
nicht leisten kann, hat der Gesetzgeber neben der kommunalen<br />
Der „Grüne Punkt“ und was er kostet<br />
Unternehmen, die daran interessiert sind, daß das Duale <strong>System</strong><br />
für sie die Entsorgung und Verwertung ihrer Verpackungen übernimmt,<br />
müssen dafür an das Duale <strong>System</strong> ein sogenanntes<br />
Lizenzentgelt entrichten. Im Gegenzug dürfen dann die Verpakkungen<br />
des neuen Lizenznehmers mit dem Grünen Punkt versehen<br />
werden. Auf diese Weise ist mittlerweile ein Großteil der<br />
abfüllenden Industrie Lizenznehmer beim Dualen <strong>System</strong>, das<br />
als sogenanntes Non-Profit-Unternehmen keine Gewinne erzielen<br />
darf.<br />
Das Duale <strong>System</strong> regelt einerseits die Lizenzvergabe zur Nutzung<br />
des Grünen Punktes und verhandelt andererseits mit den<br />
Kommunen oder mit privaten Entsorgungsunternehmen über die<br />
Durchführung der Erfassung und Sortierung der Wertstoffe mit<br />
dem Grünen Punkt.<br />
Wie teuer der „Grüne Punkt“ für die Unternehmen ist, kannst du<br />
den nebenstehenden Angaben entnehmen.<br />
<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong>, Köln-Porz<br />
Entsorgung ein privatwirtschaftliches Entsorgungssystem<br />
zugelassen, das für den Handel die Entsorgung der Verpackungen<br />
regelt. Der Begriff „Dual“ weist darauf hin, daß auf diese<br />
Weise zwei Entsorgungssysteme nebeneinander existieren.<br />
Was kostet der Punkt auf der Dose?<br />
Für jeden Grünen Punkt auf jeder Verpackung müssen<br />
Lizenzentgelte ans Duale <strong>System</strong> gezahlt werden, das daraus<br />
die Verwertung finanziert. In welcher Höhe die Hersteller<br />
diese Kosten an die Kunden weitergeben, ist unterschiedlich.<br />
Die Lizenzentgelte (das sind nicht die Produktions- oder Rohstoffkosten)<br />
sind für unterschiedliche Materialien unterschiedlich<br />
hoch und betragen für:<br />
� einen Becher (150 g Inhalt): 2,6 Pfennig<br />
� einen Becher (250 g Inhalt): 2,7 Pfennig<br />
� einen Getränkekarton (ein Liter): 5,9 Pfennig<br />
� eine 0,7-Liter-Flasche: zwischen 5,3 und 6,2 Pfennig<br />
� eine 500-Gramm-Packung Kaffee: 3,8 Pfennig<br />
� Papier für ein 750-Gramm-Brot: 0,8 Pfennig<br />
� eine Weißblechdose (800 Gramm Inhalt): 6,1 Pfennig<br />
� eine Kunststoffflasche (250 Milliliter Inhalt,<br />
47 Gramm Kunststoff): 14,6 Pfennig<br />
� eine Kunststoffflasche (500 Milliliter Inhalt,<br />
32 Gramm Kunststoff): 10,3 Pfennig<br />
Aufgaben<br />
1. Welche Aufgaben hat die „<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong><br />
<strong>GmbH</strong>“?<br />
2. Was bedeutet in diesem Zusammenhang der Begriff<br />
„Dual“?<br />
3. Was ist der „Grüne Punkt“?<br />
4. Informiere dich. Wie führen die Verbraucher die Verpakkungen<br />
mit dem „Grünen Punkt“ der Entsorgung und Verwertung<br />
zu?<br />
5. Beschreibe das Schema auf der linken Seite mit deinen<br />
Worten.
Vollmer: KIS Köln <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> Seite 1 3<br />
Kopiervorlage 12<br />
Schluß mit „Ex und Hopp“, damit die höchsten Berge auf der Erde nicht die Müllberge sind<br />
Über vierzig Millionen Tonnen Hausmüll fallen pro Jahr in<br />
<strong>Deutschland</strong> an. Vor etwa vier Jahrzehnten waren es noch<br />
zwanzig Millionen Tonnen. In den vergangenen 40 Jahren hat<br />
sich das Gewicht des jährlich anfallenden Hausmülls verdop-<br />
Die Entwicklung der Abfallmengen in Sankt Augustin und im Rhein-Sieg-Kreis<br />
Gesamtabfallmengen in Tonnen 1. Hj 1995 2. Hj 1995 1. Hj 1996<br />
Sankt Augustin 9576 9836 10472<br />
Rhein-Sieg-Kreis 107611 108970 111602<br />
Verwertete Mengen in Tonnen 1. Hj 1995 2. Hj 1995 1. Hj 1996<br />
Sankt Augustin 3114 4060 5082<br />
Rhein-Sieg-Kreis 47103 52113 56465<br />
Restabfallmengen in Tonnen 1. Hj 1995 2. Hj 1995 1. Hj 1996<br />
Sankt Augustin 6482 5776 5390<br />
Rhein-Sieg-Kreis 60508 56857 55127<br />
Geändert hat sich in den letzten Jahren die Beteiligung der Bürgerinnen<br />
und Bürger an der Entsorgung ihres Hausmülls. In den<br />
fünfziger und sechziger Jahren sammelten private Schrotthändler<br />
wertvolle Metalle; in den siebziger Jahren begann man, Glas<br />
in speziell dafür entwickelten Containern, die flächendeckend<br />
im Stadtgebiet aufgestellt wurden, zu sammeln. 1990 wurden<br />
Papiertonnen an private Haushalte verteilt, 1992 die Gelben Säkke<br />
bzw. Container, und 1995 wurden schließlich die Biotonnen<br />
eingeführt.<br />
Fragebogen: Wieviel Müll produzieren wir selbst?<br />
Damit wir eine bessere Vorstellung davon bekommen, mit welchen<br />
Abfallmengen wir selbst zum Abfallaufkommen beitragen,<br />
soll der folgende Fragebogen zu Hause ausgefüllt und in der<br />
Fragebogen zur pro Woche anfallenden Abfallmenge<br />
Biotonne (braun) 120 l:.........................................................<br />
Anzahl der Gelben Säcke: ....................................................<br />
Hausmülltonne (schwarz) 120 l:...........................................<br />
Papiertonne (blau) 240 l ......................................................<br />
Summe Gesamtvolumen: ....................................................<br />
pelt, das Müllvolumen stieg in diesem Zeitraum sogar um 500<br />
Prozent. Immer größere Abfallberge sind auch in Sankt Augustin<br />
und im Rhein-Sieg-Kreis zu beobachten:<br />
Abfallmengen<br />
in Tonnen<br />
1. Hj<br />
1995<br />
2. Hj<br />
1995<br />
1. Hj<br />
1996<br />
Entwicklung der Abfallmengen<br />
in Sankt Augustin (vgl. Aufgabe 3)<br />
Aufgaben<br />
1. Versuche Gründe für die Entwicklung der Gesamtabfallmengen<br />
zu finden.<br />
2. Beschreibe die Entwicklung der Abfallmengen in Sankt<br />
Augustin und im Rhein-Sieg-Kreis.<br />
3. Stelle die Entwicklung der Abfallmengen in Sankt Augustin<br />
in einer Grafik (siehe rechts oben) dar.<br />
nächsten Stunde ausgewertet werden. Ihr sollt das Volumen der<br />
in eurem Haushalt anfallenden Abfallmengen ungefähr abschätzen.<br />
Aufgaben<br />
4. Berechne das gesamte Abfallvolumen der Familien deiner<br />
Klasse in einer Woche.<br />
- Ermittle das Volumen des Klassenraumes und berechne<br />
die Zeit, in der dieser Raum mit dem gesamten Abfall<br />
aus den Familien gefüllt sein würde.<br />
- Berechne das gesamte Restabfallvolumen der Familien<br />
deiner Klasse in einer Woche.<br />
- Berechne die Zeit, in der der Klassenraum mit dem<br />
Restabfall gefüllt sein würde.<br />
- Berechne den Prozentanteil der verwertbaren Abfälle<br />
am gesamten Abfallaufkommen.<br />
5. Welche Auswirkungen hat die Wertstofferfassung<br />
(Verwertung) für die Deponien?
Seite 4<br />
<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> Vollmer: KIS Köln<br />
Kopiervorlage 13<br />
Wie funktioniert die Abfallentsorgung in deiner Stadt oder Gemeinde ?<br />
Bei der Abfallentsorgung arbeiten <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong><br />
<strong>GmbH</strong> als privatwirtschaftliches Unternehmen und die Kommune<br />
als öffentlicher Entsorger Hand in Hand. Die verschlungenen<br />
Wege der unterschiedlichen Abfallarten sind manchmal nur<br />
"Gelber Sack"<br />
Informiere dich! Was geschieht mit den Abfällen in deiner Gemeinde?<br />
Versuche, die nachfolgend genannten Abfallarten in das Schema<br />
„Wege des Abfalls“ einzuordnen, das du unten auf der Seite<br />
findest. Informiere dich anhand des Müllkalenders deiner Stadt<br />
oder Gemeinde oder informiere dich bei der Gemeindeverwaltung,<br />
wie die folgenden Abfälle entsorgt werden:<br />
Öffentliche Entsorgung<br />
Privatwirtschaftliche Entsorgung<br />
RSAG<br />
<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Eine Arbeitsgemeinschaft privater Unternehmen entsorgt im Auftrag von RSAG und Dualem <strong>System</strong> die privaten Haushalte<br />
Verbrennung in ...............................<br />
Endlagerung in ...............................<br />
Wege des Abfalls (Privathaushalte)<br />
Abfallwirtschaft in ..........................................<br />
Sonderabfälle<br />
schwer zu durchschauen. Anhand des Abfallkalenders deiner<br />
Gemeinde sollst du diese Wege des Abfalls einmal nachvollziehen.<br />
Recycling<br />
Papier<br />
Informiere dich<br />
Versuche herauszufinden, was es mit<br />
dem Gelben Sack auf sich hat und welche<br />
Abfälle in den Gelben Sack hineingehören.<br />
Glas<br />
Sonderabfall<br />
Bio- / Grünabfälle<br />
weiße / braune Waren<br />
Sperrmüll<br />
Bauschutt<br />
Leichtverpackungen (Gelber Sack)<br />
Papier<br />
Restabfall<br />
Sortieranlage in<br />
..........................<br />
Wertstoffe<br />
Sortierreste<br />
Verbrennung in ...............................<br />
Endlagerung in ...............................
Vollmer: KIS Köln <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> Seite 15<br />
Kopiervorlage 14<br />
☺ Fächer:<br />
Aufgaben<br />
1. Mache Vorschläge zur Abfallvermeidung und besseren<br />
Trennung von Abfallarten in deiner <strong>Schule</strong>.<br />
2. Nutze zur Beantwortung der folgenden Fragen den Abfallkalender.<br />
Wann werden in der Straße deiner <strong>Schule</strong> die<br />
Auch Kleinvieh macht Mist - Abfall aus der <strong>Schule</strong><br />
Albert Einstein<br />
Gymnasium<br />
Die Abfälle aus der <strong>Schule</strong> belasten die Stadtkasse<br />
Den insgesamt größten Anteil am Abfallaufkommen, bezogen<br />
auf die Masse des Abfalls, produzieren die privaten Haushalte.<br />
Aber auch die vielen kleinen und großen Unternehmen tragen<br />
einen beträchtlichen Anteil am Abfallaufkommen. Bei diesen<br />
kommt erschwerend hinzu, daß gewerblicher Abfall häufig<br />
Sonderabfall ist, der besonders aufwendig und kostenintensiv<br />
entsorgt werden muß. Nicht zu unterschätzen ist schließlich die<br />
Masse und Giftigkeit der Abfälle aus der <strong>Schule</strong>. Die Abfallentsorgung<br />
der <strong>Schule</strong>n belastet die Kassen der Gemeinden in starkem<br />
Maße.<br />
Kakao<br />
Zutaten: Wasser, Zucker<br />
Kohlensäure,<br />
Farbstoff Zuckerkulör,<br />
Säuerungsmittel Phosphorsäure<br />
Aroma, Koffein<br />
Lösemittel<br />
Zutaten: Wasser, Zucker<br />
Kohlensäure,<br />
Farbstoff Zuckerkulör,<br />
Säuerungsmittel Phosphorsäure<br />
Aroma, Koffein<br />
- Sprachen: ..................................................................................................................................................................................<br />
- Naturwissenschaften: ................................................................................................................................................................<br />
- Kunst/Musik: ............................................................................................................................................................................<br />
- Gesellschaftswissenschaften: ....................................................................................................................................................<br />
- Sport: ........................................................................................................................................................................................<br />
☺ Schüler und Lehrer: .................................................................................................................................................................<br />
☺ Gebäude/Technik: .....................................................................................................................................................................<br />
☺ Schulhof und Grünflächen: ......................................................................................................................................................<br />
☺ Schulfeiern (Klassenfeste): ......................................................................................................................................................<br />
☺ Verwaltung: ...............................................................................................................................................................................<br />
☺ Schulkiosk: ................................................................................................................................................................................<br />
Kakao<br />
Lösemittel<br />
Beispiel:Abfallmengen aus dem Schulzentrum Sankt Augustin<br />
Jede Woche holt der Müllwagen 5500 Liter Restmüll aus dem<br />
Schulzentrum ab. Dazu kommen einmal im Monat rund 2200<br />
Liter Abfall aus der Gelben Tonne und 3300 l Papierabfälle.<br />
Alle 2 bis 3 Jahre müssen die 8000-10000 Neonröhren und 160<br />
Energiesparlampen, die das Schulzentrum beleuchten, ausgewechselt<br />
werden.<br />
Nachgedacht und mitgemacht<br />
Informiere dich über das Abfallaufkommen in deiner<br />
<strong>Schule</strong> und erstelle eine Liste über die im Laufe eines<br />
Jahres in der <strong>Schule</strong> produzierten Abfallmengen.<br />
Abfall in deiner <strong>Schule</strong>: Schreibe die dir bekannten Abfälle (geordnet nach Abfallquellen) auf und trage sie in die Liste ein!<br />
Papiertonnen geleert? Welches Glas aus deiner <strong>Schule</strong> gehört<br />
nicht in den Glascontainer? Was gehört in die<br />
Biotonne? Wie entsorgt man den defekten Videorekorder?
Seite 6<br />
<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> Vollmer: KIS Köln<br />
Kopiervorlage 15<br />
Vor der Verwertung müssen die Abfälle aus dem Gelben Wertstoffsack<br />
oder der Gelben Wertstofftonne getrennt werden. Mittlerweile<br />
arbeiten über 300 Sortierbetriebe für Leichtverpackungen<br />
in ganz <strong>Deutschland</strong> für das Duale <strong>System</strong>. Eine<br />
dieser Sortieranlagen befindet sich beispielsweise in Troisdorf.<br />
Im Auftrag des Dualen <strong>System</strong>s werden dort, wie auch in den<br />
anderen Sortieranlagen, „Wertstoffe“ getrennt und zur Verwertung<br />
verschickt.<br />
In der Sortieranlage in Troisdorf werden die Leichtverpackungen<br />
auf eine Bandstraße gegeben. Sie gelangen anschließend<br />
zunächst in ein Trommelsieb, das die Wertstoffe<br />
nach unterschiedlichen Größen trennt. Die Abbildung zeigt die<br />
weiteren Schritte für die kleineren Teile. Durch einen Magne-<br />
T<br />
Abfälle aus den<br />
Wertstoffsäcken<br />
Blick in die Sortieranlage Troisdorf<br />
Wege der Wertstoffe mit dem Grünen Punkt<br />
1. Stofftrennung<br />
M<br />
S<br />
ten werden die eisenhaltigen Wertstoffe von dem übrigen Material<br />
getrennt. Anschließend sortieren die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen<br />
einen Teil der Kunststoffe von Hand aus. Hierbei<br />
werden z.B. auch die Getränkekartons gesondert aussortiert. Mit<br />
Hilfe einer Wirbelstromanlage werden die verbliebenen Nichteisen-Metalle<br />
durch elektrische „Wirbelströme“ beschleunigt<br />
und dadurch von den übrigen Bestandteilen abgetrennt.<br />
Die getrennten Wertstoffe werden zwischengelagert und später<br />
von verschiedenen Industriebetrieben weiterverarbeitet. Die Materialien,<br />
die am Ende des Sortiervorganges übrigbleiben und<br />
von keinem Trennverfahren erfaßt wurden, kommen auf die<br />
Restmülldeponie bzw. in eine Verbrennungsanlage.<br />
großvolumige Teile /Folien<br />
Wertstoffsortierung in der Sortieranlage Troisdorf. Die Darstellung zeigt einen Teil der Abläufe in schematischer Form.<br />
Eisen<br />
Nichteisen-Metalle<br />
Kunststoffe<br />
Getränkekartons<br />
T Trommelsieb<br />
M Magnet<br />
S<br />
Sortierband<br />
W Wirbelstromanlage<br />
W<br />
Aufgaben<br />
1. Warum ist eine möglichst genaue Stofftrennung sinnvoll?<br />
2. Beschreibe die in der Abbildung dargestellte Sortierung<br />
der Wertstoffe mit eigenen Worten.<br />
3. Welche Eigenschaften der Stoffe hat man an den verschiedenen<br />
Stellen der Sortieranlage (Trommelsieb,<br />
Sortierband, Magnet, Wirbelstromanlage) zur Trennung<br />
genutzt?<br />
4. Erinnere dich an Trennvorgänge, die du schon im Unterricht<br />
kennengelernt hast. Welche dieser Trennvorgänge<br />
könnten sich auch in einer Sortieranlage zur Stofftrennung<br />
eignen? Mach eigene Vorschläge für die Trennung unterschiedlicher<br />
Abfälle.<br />
5. Wenn man von Abfällen spricht, dann meint man etwas<br />
Schlechtes, Überflüssiges, etwas, das keinen Wert mehr<br />
hat. Warum ist es eigentlich eher zutreffend, wenn man<br />
den Inhalt in den Gelben Säcken als Wertstoffe und nicht<br />
als Abfall bezeichnet?
Vollmer: KIS Köln <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> Seite 17<br />
Jeder Bürger <strong>Deutschland</strong>s verbraucht Verkaufsverpackungen<br />
aus Aluminium, Weißblech, Glas, Verbundstoffen, Kunststoffen<br />
sowie Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton. Diese<br />
Einzelverpackungen summierten sich im Jahre 1995 zu<br />
1.400.000 t Papier, 837.000 t Kunststoff, 3.100.000 t Glas,<br />
407.000 t Weißblech, 45.000 t Aluminium und 581.000 t<br />
Schema: Kunststoffrecycling rohstofflich<br />
(z.B. Reduktionsverfahren)<br />
Werkstoffliche Kunststoffverwertung: Bei dieser Methode<br />
der Kunststoffverwertung steht die Mechanik im Vordergrund.<br />
Altkunststoffe werden zerkleinert, geschmolzen und neu geformt<br />
- z.B. zu Brettern für Gartenmöbel.<br />
Rohstoffliche Kunststoffverwertung: Hierbei stehen chemische<br />
Prozesse zur Zerlegung der Kunststoffabfälle in ihre<br />
Grundbausteine im Vordergrund. Die angewendeten Verfahren<br />
sind häufig teuer und aufwendig. Das zur Zeit aus Kostengründen<br />
favorisierte Verfahren der rohstofflichen Verwertung von<br />
Kunststoffabfällen ist das sogenannte Klöckner-Verfahren.<br />
Dieses bei Klöckner in Bremen entwickelte Verfahren wird zur<br />
Gewinnung von Eisen aus Eisenerz eingesetzt. Die eingesetzten<br />
Aufgaben<br />
1. Welche Vorteile hat die Verwertung von Kunststoffabfällen<br />
gegenüber der bisher üblichen Deponierung oder<br />
Verbrennung.<br />
2. Erläutere die Begriffe „rohstofflich“ und „werkstofflich“<br />
anhand des Ablaufschemas zum Kunststoffrecycling.<br />
3. Wie unterscheiden sich die „rohstoffliche“ und „werkstoffliche“<br />
Verwertung von Kunststoffabfällen und wel-<br />
Wege der Wertstoffe mit dem Grünen Punkt<br />
2. Verwertung<br />
Kopiervorlage 61<br />
Verbundstoffen. Durch die Stofftrennung von Verpackungsmaterialien<br />
kann man Rohstoffe und Werkstoffe zurückgewinnen<br />
sowie Energie einsparen.<br />
Am Beispiel Kunststoffrecycling soll dir die Verwertung von<br />
Kunststoffen verdeutlicht werden. Man unterscheidet zwischen<br />
einem werkstofflichen und einem rohstofflichen Recycling:<br />
Schema: Kunststoffrecycling werkstofflich<br />
Eisenerze sind Sauerstoffverbindungen des Eisens. Bei diesem<br />
neuen Verfahren ersetzen Kunststoffabfälle die ansonsten zur<br />
Reduktion der Eisenoxide eingesetzten Schweröle.<br />
Dazu wird Eisenerz (Fe 2 O 3 ) bei etwa 2000 °C im Hochofen zum<br />
Schmelzen gebracht. Zu dieser Schmelze werden die Kunststoffabfälle<br />
gegeben. Bei den hohen Temperaturen vergasen diese<br />
schlagartig. Dabei werden u.a Kohlenmonoxid und reiner Kohlenstoff<br />
(Ruß) gebildet. Kohlenmonoxid, aber auch der feinverteilte<br />
Kohlenstoff, reagieren mit den Eisenoxiden unter Bildung<br />
von elementarem Eisen. Bei dem beschriebenen Vorgang<br />
handelt es sich um eine Redoxreaktion. Welcher der Partner<br />
oxidiert und welcher reduziert wird, wirst du sicherlich wissen.<br />
che Vor- und Nachteile haben beide Wege der Kunststoffverwertung?<br />
4. Welche Rolle übernehmen die Kunststoffabfälle beim<br />
Klöckner-Verfahren? Formuliere die Umsetzung von<br />
Kohlenmonoxid (CO) oder von reinem Kohlenstoff (C)<br />
mit Eisenoxid (Fe 2 O 3 ). Welcher der Reaktionspartner wird<br />
oxidiert und welcher wird reduziert?
Seite 8<br />
<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> Vollmer: KIS Köln<br />
Kopiervorlage Didaktische Bemerkungen<br />
71<br />
Einsatzmöglichkeiten der Kopiervorlagen im „Normalunterricht“ und Anbindung an die Lehrpläne<br />
Die vorgestellte Sequenz „<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong>“ ist einzuordnen<br />
in die große Anzahl von Unterrichtsreihen mit fächerübergreifendem<br />
Inhalt. Sie unterscheidet sich aber von den verfügbaren<br />
Materialien durch eine konsequente Behandlung<br />
„schülernaher Abfallsituationen“ und den damit verbundenen<br />
Problemen vor der „Haustür des Schülers“. Durch den konkreten<br />
Bezug zur Abfallsituation im „Dunstkreis“ der Schüler und<br />
Schülerinnen soll deren Betroffenheit und die Motivation, sich<br />
mit den Problemen auseinanderzusetzen, gesteigert werden. Die<br />
Informationen und Aufgabenstellungen auf den Arbeitsblättern<br />
sind mit dem Ziel formuliert, zu sensibilisieren, soweit wie möglich<br />
die Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler einzubeziehen.<br />
Auf kritische Fragestellungen zum Entsorgungskonzept in<br />
<strong>Deutschland</strong> und die Darlegung der erzielten Recyclingquoten<br />
wurde aus diesem Grund in der vorgestellten Reihe bewußt<br />
verzichtet.<br />
Die Materialien sind schwerpunktmäßig für den Einsatz in der<br />
Sekundarstufe I entwickelt worden, insbesondere für die<br />
Jahrgangsstufe 7. Die Arbeitsblätter mit der Überschrift „Wege<br />
der „Wertstoffabfälle“ mit dem Grünen Punkt“ (Kopiervorlagen<br />
5 und 6) sind dagegen auch geeignet für einen Einsatz in den<br />
Jahrgangsstufen 9/10 (Chemie), z.B. im Anschluß an die unterrichtliche<br />
Behandlung des Hochofenprozesses.<br />
Schließlich sollte nicht unerwähnt bleiben, daß das Thema „Abfallentsorgung“<br />
viele Möglichkeiten bietet, die Schüler zur<br />
Selbsttätigkeit anzuregen. Hierbei sollte auch die Durchführung<br />
einer fächerübergreifenden Projektwoche in Erwägung gezogen<br />
werden. Die vorliegenden Arbeitsblätter könnten dabei eine<br />
Bereicherung sein.<br />
Das nachstehende Fließschema gibt einen Überblick über die Einsatzmöglichkeiten und die mögliche Abfolge der Kopiervorlagen:<br />
Informationen, Bemerkungen, Lösungen<br />
A. Bemerkungen zu den Kopiervorlagen<br />
Kopiervorlage 6<br />
Zur Demonstration des werkstofflichen Kunststoffrecyclings<br />
wird folgender Demonstrationsversuch empfohlen: Ein Joghurtbecher<br />
oder Ähnliches aus Polypropen oder Polyethen wird mit<br />
einem Heißluftgebläse so stark erhitzt, bis er seine Form verliert,<br />
weich wird und schrumpft. Auf diese Weise kann man auch<br />
einen Kunststoffgegenstand mit einer neuen Form erzeugen, indem<br />
man unter den zu erhitzenden Kunststoffgegenstand ein<br />
Formteil plaziert, z.B. einen Porzellantiegel. Die nachfolgenden<br />
Fotos zeigen einige Versuche hierzu, die am Albert Einstein<br />
Gymnasium in St. Augustin - Niederpleis durchgeführt wurden.
Vollmer: KIS Köln <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> Seite 19<br />
B. Hilfen und Hinweise zur Beantwortung der Fragen und Aufgaben<br />
Kopiervorlage 3<br />
Aufgabe 1<br />
In der Gelben Tonne und in dem Gelben Sack<br />
werden Kunststoffe, Aluminium, Weißblech<br />
und Verbundstoffe (wie z.B. Milchtüten) gesammelt.<br />
Aufgabe 2: Für die lokale Situation Sankt Augustin<br />
gilt, bezogen auf die Privathaushalte,<br />
das rechts abgebildete Entsorgungskonzept.<br />
Kopiervorlage 6<br />
Aufgabe 1<br />
Rohstoffe werden geschont, die Umweltbelastungen durch Deponierung<br />
oder Verbrennen werden reduziert.<br />
Aufgabe 2<br />
Beim rohstofflichen Recycling werden die Kunststoffabfälle<br />
durch chemische Prozesse in ihre Grundbausteine zerlegt. Beim<br />
werkstofflichen Recycling werden die Kunststoffgegenstände zu<br />
neuen Werkstoffen aufbereitet.<br />
Hintergrundinformationen zu . . .<br />
Wirbelstromverfahren: Die Wirbelstromanlage trennt die Nichteisen-Metalle<br />
von den noch verbliebenen Abfallbestandteilen in der Sortieranlage. Zwei grundlegende<br />
Aussagen der Elektrotechnik haben hierfür besondere Bedeutung:<br />
1. Ein stromdurchflossener Leiter baut ein magnetisches Feld auf. Betroffen sind<br />
alle Metalle.<br />
2. Magnetische Wechselfelder können in stromleitenden Stoffen (z.B. Aluminiumfolie)<br />
elektrische Ströme erzeugen.<br />
Bewegt sich ein Leiter in einem magnetischen Feld, fließt in dem Metall ein Strom,<br />
weil sich die Größe des magnetischen Feldes ändert. Die so induzierten „Wirbelströme“<br />
bauen ihrerseits ein magnetisches Feld auf, das dem ursprünglichen Feld<br />
entgegengesetzt ist. Die Felder stoßen sich wie die zwei Pole von Permanentmagneten<br />
ab.<br />
Der Nichteisen-Metallabscheider besteht im wesentlichen aus zwei Gurttrommeln,<br />
die ein Förderband tragen und von denen eine angetrieben ist. In der vorderen<br />
Trommel rotiert das exzentrisch gelagerte Magnetsystem mit wesentlich höherer<br />
Drehzahl als die Gurttrommel. Das Magnetsystem besteht aus einem Rohr, auf dem<br />
Permanentmagnete mit wechselnder Polarität angeordnet sind. Dieser rotierende<br />
Multimagnetkörper erzeugt in der darüber vorbeigeführten Aluminiumfolie Wirbelströme.<br />
Dadurch daß sich die Magnetfelder gegenseitig abstoßen, wird die Aluminiumfolie<br />
am Bandende im Gegensatz zu den verbleibenden nichtleitenden<br />
Bestandteilen beschleunigt und von diesen Stoffen getrennt.<br />
Hintergrundinformationen<br />
Kopiervorlage 81<br />
Öffentliche Entsorgung<br />
Privatwirtschaftliche Entsorgung<br />
RSAG<br />
<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Eine Arbeitsgemeinschaft privater Unternehmen entsorgt im Auftrag von RSAG und <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> die privaten Haushalte<br />
Sperrmüll Restabfall Weiße/<br />
braune<br />
Waren<br />
Sonderabfälle<br />
Bauschutt Bio/Grünabfälle<br />
Recycling<br />
Papier<br />
Sortieranlage in<br />
..........................<br />
Troisdorf<br />
Verbrennung in .............................<br />
Bonn Verbrennung in ...............................<br />
Bonn<br />
Endlagerung in ..............................<br />
Mechernich Endlagerung in ..............................<br />
Mechernich<br />
rohstoffliches Recycling: Kunststoffe müssen nicht sortenrein<br />
sein, der Verwendung der Rohstoffe sind keine Grenzen gesetzt,<br />
Verfahren sind aber häufig aufwendig und teuer.<br />
werkstoffliches Recycling: Kunststoffabfälle sollten möglichst<br />
sortenrein sein, Produkte sind häufig nicht so hochwertig wie<br />
Kunststoffgegenstände vor der Verwertung; die Aufarbeitung ist<br />
nicht so energieaufwendig wie die Zerlegung in die Grundbausteine.<br />
Eisenoxid + Kohlenstoffmonoxid → Eisen + Kohlenstoffdioxid<br />
Fe 2 O 3 + 3 CO → 2 Fe + 3 CO 2<br />
Glas<br />
Leichtverpackungen<br />
(Gelber Sack)<br />
Wertstoffe<br />
Sortierreste<br />
Das Foto zeigt ein Schulmodell einer Wirbelstromanlage.<br />
Bei Einschalten des Gerätes wird<br />
ein Magnetfeld erzeugt, der aufgesetzte Aluminiumring<br />
weggeschleudert.
Seite 10<br />
<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> Vollmer: KIS Köln<br />
Kopiervorlage Hintergrundinformationen<br />
91<br />
<strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong>: Die <strong>Duales</strong> <strong>System</strong><br />
<strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> entstand auf der Grundlage der<br />
Verpackungsverordnung (VerpackV), einem Verordnungswerk,<br />
mit dem der Gesetzgeber bereits im Jahre 1991 die ersten Weichen<br />
für eine Kreislaufwirtschaft gestellt hat. Die VerpackV<br />
schreibt unter anderem eine Rücknahme- und Verwertungspflicht<br />
für Verpackungen vor, legt Sammel- und Sortierquoten<br />
fest und formuliert ausdrücklich den Schutz von Mehrwegsystemen.<br />
Alternativ zur Rücknahmeverpflichtung für Verkaufsverpackungen<br />
durch den Handel sieht die VerpackV die Rücknahme<br />
gebrauchter Verkaufsverpackungen durch ein zweites<br />
(duales) Entsorgungssystem neben der öffentlichen Abfallentsorgung<br />
vor.<br />
Das Unternehmen ist als Partner von Handel, Konsumgüterindustrie,<br />
Kommunen und privaten Entsorgungsunternehmen für<br />
die Erfassung und Sortierung von Verkaufsverpackungen mit<br />
dem Finanzierungs- und Beteiligungszeichen ‘Der Grüne Punkt’<br />
zuständig.<br />
Verpackungen, die dieses Zeichen erhalten, müssen zwei Voraussetzungen<br />
erfüllen: Erstens muß für das Verpackungsmaterial<br />
eine ‘Abnahme- und Verwertungsgarantie’ der jeweils zuständigen<br />
Industrie bzw. Gesellschaft vorliegen. Zweitens muß<br />
der Hersteller oder Vertreiber der jeweiligen Ware mit der <strong>Duales</strong><br />
<strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> einen Vertrag über die Nutzung<br />
des Zeichens ‘Der Grüne Punkt’ geschlossen haben und ein<br />
Lizenzentgelt dafür entrichten.<br />
Die <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong> vergibt die Lizenzen zur<br />
Nutzung des Grünen Punktes und überträgt bundesweit das operative<br />
Geschäft der Wertstofferfassung und Wertstoffsortierung<br />
an die sogenannten Leistungsvertragspartner. Dies sind Kommunen<br />
oder private Entsorgungsunternehmen, die neben der Bereitstellung<br />
von geeigneten Erfassungssystemen auch für Abfuhr<br />
und Sortierung der Wertstoffe zuständig sind. Die<br />
gängigsten Erfassungssysteme sind: Depotcontainer für die<br />
farbgetrennte Glaserfassung; Depotcontainer oder blaue Tonne<br />
für die Erfassung von Papier und Kartonagen; Gelbe Tonne oder<br />
Gelber Sack für die Erfassung der sog. Leichtverpackungen<br />
(Kunststoffe, Metalle, Verbundstoffe). Finanziert wird diese Arbeit<br />
durch die Einnahmen, die durch die Vergabe des Zeichens<br />
‘Der Grüne Punkt’ erzielt werden.<br />
Das Unternehmen hat die Erfüllung der in der VerpackV vorgegebenen<br />
Sammel- und Sortierquoten für die einzelnen Verpakkungsmaterialien<br />
nachzuweisen und den Umweltministerien der<br />
Länder jährlich zu dokumentieren. Hierfür werden Daten über<br />
Sammel- und Sortiermengen aus ganz <strong>Deutschland</strong> zentral zusammengeführt<br />
und datentechnisch verarbeitet.<br />
Außerdem sorgt das Unternehmen für eine bundesweit möglichst<br />
einheitliche Öffentlichkeitsarbeit und bietet seinen Vertragspartnern<br />
Unterstützung bei der lokalen Kommunikation.<br />
Verfahren zum rohstofflichen Recycling von Kunststoffabfällen:<br />
Neben dem auf der Kopiervorlage 6 angesprochenen<br />
Klöckner-Verfahren werden weitere Verfahren angewandt. Beim<br />
sogenannten Hydrierverfahren z.B. werden aus den unsortierten<br />
Kunststoffabfällen jeglicher Art gesättigte Kohlenwasserstoffe<br />
gewonnen. Die Eignung dieses Verfahrens hat die Kohleöl-Anlage<br />
Bottrop im Frühjahr 1992 in einem Großversuch unter Beweis<br />
gestellt. Bei 300 bar und Temperaturen von etwa 470 °C<br />
werden die Kohlenwasserstoffketten in einer Wasserstoff-Atmosphäre<br />
gespalten. Die aufgespaltenen Moleküle werden<br />
durch Wasserstoff in gesättigte Kohlenwasserstoffe überführt.<br />
Es entstehen Öle und Gas. Die Hydrierung hat eine entgiftende<br />
Wirkung auf verschiedene kontaminierte Reststoffe wie z.B.<br />
chlorhaltige Öle. Chlor wird dabei in Salzsäure überführt. Großtechnisch<br />
hat sich dieses Verfahren bisher allerdings noch nicht<br />
durchgesetzt. Zur Zeit setzt man verstärkt auf das beschriebene<br />
Klöckner-Verfahren.<br />
Literatur:<br />
Umfangreiches Informationsmaterial zum Thema<br />
Abfallwirtschft wird von verschiedenen Stellen angeboten:<br />
- <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong> <strong>GmbH</strong>, 51170 Köln,<br />
Tel.: 0 22 03 / 937-0<br />
- Rhein-Sieg-Abfallgesellschaft mbH, Pleiser Hecke 4,<br />
Tel.: 0 22 41 / 30 60<br />
Die RSAG bietet u.a. komplette Unterrichtsreihen zur<br />
Ausleihe an. Abfallberater stehen nach Absprache für<br />
Unterrichtsbesuche zur Verfügung.<br />
Weitere Informationsquellen:<br />
- Umweltamt der Stadt Sankt Augustin,<br />
53757 Sankt Augustin, Tel.: 0 22 41 / 24 30<br />
- Verband der Chemischen Industrie e.V., Karlstraße 21,<br />
60329 Frankfurt<br />
- Bundesverband für Sekundärrohstoffe und Entsorgung e.V.,<br />
Hohe Straße 73, 53119 Bonn<br />
- Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit,<br />
Referat Öffentlichkeitsarbeit, Kennedyallee 5,<br />
53175 Bonn<br />
- Umweltbundesamt, Fachgebiet III 2.5, Bismarkplatz 1,<br />
14193 Berlin<br />
- BDE Bundesverband der Deutschen Entsorgungswirtschaft<br />
e.V., Schönhauser Straße 3, 50968 Köln,<br />
Tel.: 02 21 / 93 47 00-0<br />
- DKR Deutsche Gesellschaft für Kunststoff-Recycling mbH,<br />
Frankfurter Straße 720-726, 51145 Köln,<br />
Tel.: 0 22 03 / 93 17-0<br />
Kontaktinformationen<br />
1. Ansprechpartner<br />
Hansjörg Nieß, <strong>Duales</strong> <strong>System</strong> <strong>Deutschland</strong><br />
<strong>GmbH</strong>, 51170 Köln, Tel.: 02203 / 937-247,<br />
Fax: 02203 / 937-192<br />
2. Unterrichtsmaterialien,<br />
2. Informationsmaterialien<br />
Umfangreiches Informationsmaterial, zum Teil<br />
auch Unterrichtsmaterial zum Thema Abfallwirtschaft<br />
kann unter der angegebenen Adresse (siehe<br />
oben) angefordert werden.<br />
3. Betriebsbesichtigungen und Betriebspraktika<br />
Betriebsbesichtigungen in verschiedenen Sortierund<br />
Verwertungsanlagen - auch im Raum Köln -<br />
sind nach Absprache möglich.<br />
4. Ausbildungsplätze, berufliche Möglichkeiten<br />
Ausbildung zu Datenverarbeitungs- und Bürokaufleuten.<br />
Weitere Ausbildungsberufe sind zur Zeit in<br />
Planung.








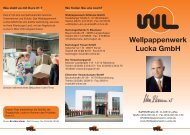
![KURS 21 Einstiegsmaterialien [PDF] - Portal Schule Wirtschaft](https://img.yumpu.com/24141248/1/190x239/kurs-21-einstiegsmaterialien-pdf-portal-schule-wirtschaft.jpg?quality=85)