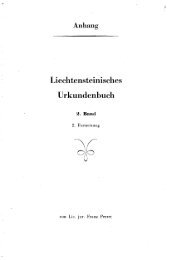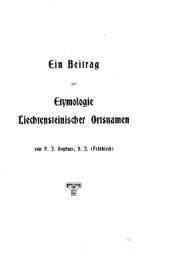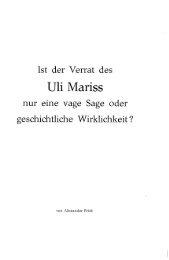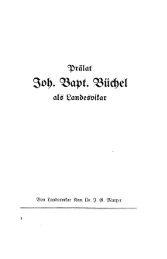V - eLiechtensteinensia
V - eLiechtensteinensia
V - eLiechtensteinensia
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
DER MÜNZSCHATZ<br />
FUND VOM<br />
«SCHELLENBERGER<br />
WALD», VERGRABEN<br />
NACH 1460<br />
DANIEL SCHMUTZ
Inhalt<br />
EINLEITUNG 39<br />
AUFFINDUNG UND ÜBERLIEFERUNG 42<br />
Das geographische und historische Umfeld 42<br />
Fundort und Fundumstände 43<br />
Die Überlieferung des Fundes 45<br />
Das Fundgefäss 46<br />
DIE HERKUNFT DER MÜNZEN 47<br />
Überblick 47<br />
Bodenseeraum 47<br />
Deutschschweiz 49<br />
Ober- und Mittelrhein, Elsass, Lothringen 50<br />
Mittel- und Norddeutschland 52<br />
Böhmen 52<br />
Tirol 56<br />
Italien 57<br />
NOMINALSTRUKTUR UND WERT<br />
DES FUNDES 60<br />
ALTERSSTRUKTUR UND VERGRABUNGS-<br />
ZEITPUNKT 61<br />
DER BESITZER UND DIE UMSTÄNDE<br />
DER VERGRABUNG 63<br />
DER FUND ALS QUELLE<br />
ZUM GELDUMLAUF 64<br />
SCHLUSSBETRACHTUNG 68<br />
VORBEMERKUNG ZUM KATALOG 69<br />
38<br />
KATALOG 70<br />
Im Katalog verwendete Abkürzungen 70<br />
Bodenseeraum 70<br />
Schweiz 75<br />
Oberrhein/Mittelrhein 77<br />
Lothringen 80<br />
Mittel- und Norddeutschland 81<br />
Böhmen 82<br />
Tirol 86<br />
Italien 90<br />
Unbestimmte Münzherrschaft 99<br />
BILDTAFELN 100<br />
ANHANG 133<br />
Abkürzungen 133<br />
Verzeichnis der abgekürzt<br />
zitierten Literatur 133<br />
Konkordanz mit dem Katalog von<br />
Kittelberger (inkl. Nachtrag von Krusy) 136<br />
Alphabetisches Verzeichnis der<br />
Gegenstempel auf den Prager Groschen 137
Einleitung<br />
Der Fund von Schellenberg 1<br />
ist der bedeutendste<br />
Münzschatzfund des 15. Jahrhunderts im Alpenrheintal.<br />
2<br />
Als Quelle für die Erforschung des Geldumlaufs<br />
nimmt er eine ähnlich wichtige Stellung<br />
ein wie der Münzschatzfund von Vaduz für das<br />
14. Jahrhundert. 3<br />
Seiner Bedeutung entsprechend<br />
wird er in der numismatischen Literatur immer<br />
wieder zitiert. 4<br />
Das Fundgefäss wurde schon mehrfach<br />
in Untersuchungen zur Keramik des süddeutschen<br />
wie auch des österreichischen Raumes herangezogen.<br />
5<br />
Bereits kurz nach der Auffindung 1930/31 publizierte<br />
Karl Kittelberger den Hauptanteil des Fundes.<br />
6<br />
Seine Publikation enthält einen ausführlichen<br />
Katalog mit genauen Stückzahlen. Sämtliche in diesem<br />
Fundanteil vorkommenden Typen sind abgebildet.<br />
Dank Kittelbergers Sorgfalt und der reich-<br />
1) Die Bezeichnung «Schatzfund von Schellenberg» ist nicht ganz<br />
korrekt, liegt doch der Fundort auf dem Territorium der Gemeinde<br />
Ruggell FL. Diese Bezeichnung hat sich jedoch in der Literatur<br />
durchgesetzt. Um Verwechslungen vorzubeugen, wird sie auch in<br />
dieser Arbeit verwendet.<br />
2) Die vorliegende Arbeit entstand im Auftrag der Fachstelle Archäologie<br />
des Fürstentums Liechtenstein (AFL). Für die gute Zusammenarbeit<br />
danke ich Hansjörg Frommelt, Eva Pepic-Helferich und Ulrike<br />
Mayr von der Fachstelle ganz herzlich. Das Schweizerische Landesmuseum<br />
in Zürich erlaubte mir freundlicherweise, den Fund in den<br />
Räumen des Münzkabinetts zu bearbeiten. Anregungen und Unterstützung<br />
verdanke ich ferner: Rahel Ackermann, Bern; Michael<br />
Alram, Wien; Claudia Konzett, Triesen; Jose Diaz Tabernero, Zürich;<br />
Stephen Doswald, Männedorf; Karl Fischer, Dornbirn; Helfried Fussenegger,<br />
Dornbirn; Hans-Ulrich Geiger, Zürich; Doris Klee, Zürich;<br />
Ulrich Klein, Stuttgart; Peter Hugo Martin, Karlsruhe; Helmut Rizzolli,<br />
Bozen; Hortensia von Roten, Zürich; Renata Windler, Zürich;<br />
Benedikt Zäch, Winterthur.<br />
3) Zäch, Vaduz.<br />
4) Zuletzt Klein, Karte 3, Nr. 43, und Zäch, Fremde Münzen, S. 434.<br />
5) Lobbedey, Uwe: Untersuchungen mittelalterlicher Keramik vornehmlich<br />
aus Südwestdeutschland. Berlin, 1968. (Arbeiten zur Frühmittelalterforschung<br />
3), S. 49 und 117-118, Nr. 39; Steininger, Hermann:<br />
Die münzdatierte Keramik in Österreich 12. bis 18. Jahrhundert.<br />
Fundkatalog. Wien, 1985, S. 68-69, Nr. 88.<br />
6) Kittelberger. Besprechung seines Artikels durch J[ulius] C[ahn] in:<br />
Frankfurter Münzzeitung NF 3 (1932), S. 387. Kittelberger, von Beruf<br />
Buchhalter, war selber Münzsammler. 1931 wurde er zum Vorstand<br />
des neu gegründeten «Vereins der Münzfreunde des Bodenseegebietes»<br />
gewählt. Lanzl. Helmut: Numismatiker des Bodenseegebietes.<br />
In: JbVLM 131 (1987), S. 137-146, hier S. 144-145.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Abb. 1: Überlingen, Stadt,<br />
Schilling (ab 1436),<br />
Vs. (Nr. 25)<br />
Abb. 2: Zürich, Stadt,<br />
Plappart nach dem Vertrag<br />
von 1424, Rs. (Nr. 129)<br />
Abbildungen im<br />
Massstab 2:1<br />
39
Abb. 3: Pfalz-Zweibrücken,<br />
Grafschaft, Ludwig, Pfennig<br />
(ab 1453?), Münzstätte<br />
Veldenz? (Nr. 194)<br />
Abb. 4: Nürnberg, Reichsmünzstätte,<br />
Kg. Sigismund,<br />
Goldgulden (1414-<br />
1419), Vs. (Nr. 215).<br />
Abb. 5: Böhmen, Königreich,<br />
Wenzel IV, Groschen<br />
(1378-1419 und<br />
später), Münzstätte Kuttenberg,<br />
Rs. mit Gegenstempel<br />
des Riedlinger<br />
Bundes und von Feldkirch<br />
(Nr. 275)<br />
Abb. 6: Tirol, Grafschaft,<br />
Friedrich IV, Vierer<br />
(1406-1439), Münzstätte<br />
Meran, Vs. (Nr. 294)<br />
Abb. 7: Mailand, Herrschaft,<br />
Galeazzo IL, Pegione<br />
(1354-1378), Vs.<br />
(Nr. 413)<br />
Abbildungen im<br />
Massstab 2:1<br />
40<br />
11<br />
i' I !<br />
*
haltigen Bebilderung ist sein Aufsatz auch heute<br />
noch verwendbar. Als Mängel der Arbeit können<br />
einige Fehlbestimmungen gelten, die ihm besonders<br />
bei den italienischen Münzen unterlaufen<br />
sind. Auch ist die von Kittelberger vorgenommene<br />
Verknüpfung der Vergrabung des Fundes mit dem<br />
Schwabenkrieg respektive Schweizerkrieg von 1499<br />
falsch. Leider wurde diese Datierung lange Zeit in<br />
der Literatur weitergetragen und hat auch schon<br />
zu Fehlinterpretationen geführt. 7<br />
Seit der Publikation von Kittelberger sind weitere<br />
Fundanteile bekannt geworden. Rund ein Viertel<br />
des Fundes befindet sich in Privatbesitz. Diese<br />
Münzen liegen zwar in Form einer Liste publiziert<br />
vor, die Zusammenstellung ist jedoch unvollständig<br />
und fehlerhaft. Sie wurde zudem häufig von der<br />
Forschung übersehen. 8<br />
Ein erst vor wenigen Jahren<br />
entdeckter Anteil besteht vorwiegend aus relativ<br />
schlecht erhaltenen Kleinmünzen, die Kittelberger<br />
wohl als nicht bestimmbar betrachtet hatte und<br />
die nicht in seinem Katalog erschienen. Erst in<br />
jüngster Zeit wurde eine Zusammenstellung veröffentlicht,<br />
die alle drei Fundanteile berücksichtigt,<br />
allerdings nur in Regestform.''<br />
Aufgrund dieser Situation drängte sich eine<br />
Neubearbeitung des Fundes auf. Der vorliegende<br />
Katalog erfasst erstmals alle drei Fundanteile nach<br />
den heute gängigen Kriterien der Fundmünzenbearbeitung.<br />
An einer ausgewählten Münzgruppe<br />
konnten zusätzlich Stempeluntersuchungen vorgenommen<br />
werden.<br />
Im Textteil wird versucht, den Schellenberger<br />
Fund in einem etwas breiteren Rahmen zu würdigen,<br />
als dies Kittelberger möglich gewesen war.<br />
Nach der Beschreibung der Fundumstände folgen<br />
Überlegungen zur Herkunft der Münzen, zur Nominal-<br />
und Altersstruktur sowie zum Wert des Fundes.<br />
Über den ursprünglichen Besitzer und die Vergrabungsumstände<br />
konnten nur Vermutungen angestellt<br />
werden. Am Schluss gibt der Vergleich mit<br />
anderen Funden Aufschluss über die Bedeutung<br />
des Schellenberger Fundes als Quelle zum spätmittelalterlichen<br />
Geldumlauf.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
7) Schüttenhelm weist auf den hohen Anteil an italienischen Münzen<br />
im Schellenberger Fund hin, was für die Zeit um 1500 tatsächlich<br />
aussergewöhnlich wäre. Schüttenhelm, S. 416.<br />
8) Krusy, S. 377-378. Nicht berücksichtigt wurde dieser Fundanteil<br />
etwa bei Nau, Münzumlauf, S. 156, Nr. 142: sowie Schüttenhelm,<br />
S. 573, Nr. 248.<br />
9) Zäch, Alpenrheintal. S. 234, Nr. 6.<br />
41
Auffindung und Überlieferung<br />
DAS GEOGRAPHISCHE UND HISTORISCHE<br />
UMFELD<br />
Der langgestreckte Höhenzug des Schellenberges,<br />
der auch als Eschnerberg bezeichnet wird, erstreckt<br />
sich im liechtensteinischen Unterland vom<br />
Rhein aus in nordöstlicher Richtung bis in die Nähe<br />
von Feldkirch. Seit der Jungsteinzeit war die im<br />
ehemals versumpften Rheintal gelegene Erhebung<br />
ein bedeutendes Siedlungsgebiet.<br />
Der Ort Schellenberg, auf dem gleichnamigen<br />
Höhenrücken gelegen, besteht aus den drei Ortsteilen<br />
Vorder-, Mittel- und Hinterschellenberg. 10<br />
Der<br />
Name Schellenberg wird auf die seit dem Ende des<br />
12. Jahrhunderts in diesem Gebiete erwähnten<br />
Herren von Schellenberg zurückgeführt. Gemäss<br />
Johann Baptist Büchel war dieses Rittergeschlecht<br />
ursprünglich im bayerischen Raum ansässig und<br />
Abb. 8: Der mutmassliche<br />
Fundort<br />
42<br />
wurde hier in staufischer Zeit zur Sicherung und<br />
zur Bewachung der Zufahrtsstrassen zu den Alpenpässen<br />
eingesetzt. 11<br />
Auf dem Gebiet der Gemeinde Schellenberg stehen<br />
zwei Burgruinen, die mit den Herren von<br />
Schellenberg in Verbindung gebracht werden. Die<br />
«Obere Burg» liegt östlich von Mittelschellenberg,<br />
die «Untere Burg» nordwestlich dieses Ortsteils<br />
über dem steil abfallenden Nordwestabhang des<br />
Eschnerberges. 12<br />
Die rechtsrheinische Hauptverkehrsachse durch<br />
das Alpenrheintal verlief im Mittelalter wie auch<br />
heute noch südöstlich des Eschnerberges. Der übliche<br />
Handelsweg im Spätmittelalter, wie er aus zwei<br />
Verzeichnissen der Zoll- und Suststellen von 1388<br />
und 1390 fassbar wird, führte von Chur über die<br />
St. Luzisteig nach Balzers und Vaduz. Bei Schaan<br />
wurde der Rhein auf einer Fähre überquert und
der Weg auf der anderen Flusseite nach Werdenberg<br />
und Rheineck fortgesetzt. 13<br />
Unterhalb von<br />
Schaan war die rechtsrheinische Route mindestens<br />
bis Feldkirch, wo die Strasse über den Arlberg abzweigte,<br />
ebenfalls von Bedeutung. Bei Bendern und<br />
Ruggell überquerten Fähren den Rhein, welche die<br />
Verbindung Richtung Toggenburg gewährleisteten.<br />
14<br />
Durch seine erhöhte Lage lag Schellenberg<br />
etwas abseits dieser Verkehrsachsen.<br />
FUNDORT UND FUNDUMSTÄNDE<br />
Die Fundumstände wurden von Kittelberger in seinem<br />
Aufsatz ausführlich dargestellt:<br />
Im Winter 1930/31 fand der Bewohner Johann<br />
Kirschbaumer von Mauren, wohnhaft in Schellenberg,<br />
beim Holzsammeln am Schellenberg im Ruggeller<br />
Wald im Fürstentum Liechtenstein, ca. 500<br />
Meter von der Ruine Altschellenberg [-Untere<br />
Burg] entfernt, 13 alte Silbermünzen, die er mit<br />
nach Hause nahm. Im August 1931 setzte er seine<br />
Nachgrabungen an demselben Platze fort und [es]<br />
kamen weitere 50 Münzen zum Vorschein. In dankeswerter<br />
Weise brachte Kirschbaumer dann bei<br />
der fürstlich liechtensteinischen Regierung den<br />
Fund zur Anzeige und Ablieferung. Unter der Leitung<br />
des historischen Vereins für das Fürstentum<br />
Liechtenstein wurden die Nachgrabungen am 24.<br />
und 26. August 1931 fortgesetzt und zwar mit vollem<br />
Erfolg, denn weitere 320 Silbermünzen konnten<br />
geborgen werden. Etliche 20 Münzen sind dann<br />
noch im September von einigen jugendlichen<br />
«Schatzsuchern» beigebracht worden. Zur Ablieferung<br />
kamen insgesamt 423 Münzen und etliche<br />
Bruchstücke. An der Fundstelle lagen verschiedene<br />
Tonscherben, offenbar von dem Gefäss herrührend,<br />
in dem der Münzschatz geborgen war. Die Münzen<br />
lagen zerstreut auf einer 6 bis 8 Meter grossen<br />
Fläche, ca. 30-35 cm unter der Erde. Dieser Umstand<br />
samt den umherliegenden Scherben lässt mit<br />
Bestimmtheit darauf schliessen, dass der Schatz<br />
nicht am Fundort selbst vergraben wurde. Etwa<br />
6 Meter oberhalb des Fundortes befindet sich eine<br />
kleine Felsspalte, in der der Schatz jedenfalls ur<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
sprünglich verborgen wurde. Im Lauf der Zeit löste<br />
sich dann wahrscheinlich ein Teil des Gesteines los<br />
und riss Topf und Münzen mit in die Tiefe. Nachfolgender<br />
Schutt deckte die Münzen zu, bis sie nach<br />
einer mehr als 400jährigen Grabesruh durch genannten<br />
glücklichen Zufall an das Tageslicht kamen.<br />
15<br />
Gemäss den Angaben von Kittelberger befindet<br />
sich der Fundort des Schatzes im Ruggeller Wald,<br />
zirka 500 m von der «Unteren Burg» («Alt-Schellenberg»)<br />
entfernt. Die in seinem Fundbericht erwähnten<br />
Felsen können sich nur auf den nordwestlichen<br />
Abhang des Eschnerberges beziehen, der an<br />
dieser Stelle steil und felsig ist. Sehr wahrscheinlich<br />
liegt die Fundstelle nordöstlich der Ruine<br />
(Abb. 8). 16<br />
In diesem Bereich führte vielleicht be-<br />
10) Eine Ortsgeschichte von Schellenberg existiert nicht. Zur mittelalterlichen<br />
Geschichte Schellenbergs vgl. Büchel, Johann Baptist:<br />
Geschichte der Herren von Schellenberg. In: JBL 7 (1907). S. 5-101;<br />
JB1. 8 (1908), S. 1-98; JBL 9 (1909), S. 27-99; Büchel, Johann<br />
Baptist: Geschichte des Eschnerberges. In: JBL 20 (1920). S. 5-36.<br />
Zu den historischen Bauten vgl. Poeschel, Erwin: Die Kunstdenkmälcr<br />
des Fürstentums Liechtenstein. Die Kunstdenkmälor der<br />
Schweiz. Sonderband. Basel, 1950, S. 274-284; Bill, Jakob: Ergrabene<br />
Geschichte. Die archäologischen Ausgrabungen im Fürstentum<br />
Liechtenstein 1977-1984. Ausstellung im Liechtensteinischen Landesmuseum<br />
Vaduz, 31. März bis 31. Oktober 1985. Vaduz, 1985,<br />
S. 22-33 (zur «Unteren Burg»); Beck, David: Neu-Schellenberg.<br />
Grabungsbericht. In: JBL 62 (1962), S. 3-49 (zur «Oberen Burg»).<br />
11) Büchel, Schellenberg (wie Anm. 10). JBL 7 (1907), S. 14.<br />
12) Die traditionelle Bezeichnung «Alt-Schellenberg» für die «Untere<br />
Burg» und «Neu-Schellenberg» für die «Obere Burg» hat sich als<br />
falsch erwiesen. Die archäologische Untersuchung der «Unteren<br />
Burg» von 1978-1980 hat gezeigt, dass diese Anlage erst Mitte des<br />
14. Jahrhunderts Bedeutung erlangte. Die Ausgrabung der «Oberen<br />
Burg» 1960/61 hat hingegen bedeutend mehr ältere Funde zu Tage<br />
gebracht als diejenige der «Unteren Burg». Das Fundspektrum reicht<br />
von der Mitte des 12. bis zum 16. Jahrhundert mit einem Höhepunkt<br />
im 13. und 14. Jahrhundert. Zusammenfassung der Grabungsergebnisse<br />
der «Unteren Burg» bei Bill (wie Anm. 10); der «Oberen Burg»<br />
bei Beck (wie Anm. 10). S. 41-44.<br />
13) Zäch, Alpenrheintal, S. 206.<br />
14) Schulte, Aloys: Geschichte des mittelalterlichen Handels und<br />
Verkehrs zwischen Westdeutschland und Italien mit Ausschluss von<br />
Venedig. 2 Bde. Leipzig, 1900, hier Bd. 1. S. 382.<br />
15) Kittelberger, S. 115-116.<br />
16) Ungefähr bei Landeskoordinate 759 600/233 900.<br />
43
H l<br />
'Jitfi/i^ießlBlf/f-<br />
5. Q'i- ,v>" t<br />
Iis? "^^ ><br />
^®M z<br />
' //<br />
^ /?<br />
'• rl >,.fi'//,/„% V ! 1 » W^a-.^<br />
• ;V- *n,- ; v ->5»<br />
/<br />
/<br />
>(,t i » «<br />
Abb. 9: Ausschnitt aus der reits im Spätmittelalter ein Weg vorbei, der von<br />
Kolleffel-Karte von 1756 Ruggell aus den steilen Abhang des Schellenberges<br />
überwand und direkt nach Mittelschellenberg führte.<br />
Jedenfalls ist ein solcher Weg auf der Kolleffel-<br />
Karte von 1756 eingetragen (Abb. 9). 17<br />
Dieser Weg<br />
war möglicherweise eine Variante von eher lokaler<br />
Bedeutung zur wichtigeren Verbindung, die von<br />
Ruggell über Vorderschellenberg nach Mittelschellenberg<br />
führte. 18<br />
Kittelbergers Angaben bezüglich der Fundumstände<br />
sind - soweit überprüfbar - richtig, aber<br />
nicht vollständig. 19<br />
Entgegen den Angaben des Finders<br />
waren nicht alle Münzen des Fundes den<br />
Behörden übergeben worden. Einen beachtlichen<br />
44<br />
/»US<br />
^» t c l
Eine weitere pfälzisch-mainzische Vertragspfennigsgruppe<br />
kann in die letzten Regierungsjahre<br />
Ludwigs IV. (1442-1449) datiert werden, obwohl<br />
sich ein entsprechender Vertrag nicht erhalten<br />
hat. 45<br />
Die dazugehörigen Pfennige illustrieren den<br />
Sachverhalt jedoch eindeutig. Während die mainzischen<br />
Stücke einen gespaltenen Schild Mainz/Pfalz<br />
mit dem darüberstehenden Buchstaben «m» zeigen<br />
(Nr. 206-207; Münzstätte Miltenberg), ist auf<br />
den pfälzischen Stücken der Schild genau umgekehrt<br />
angeordnet (Pfalz/Mainz) und weist darüber<br />
ein «h» auf (Nr. 181-182; Münzstätte Heidelberg).<br />
Zwei pfälzische Pfennige gehören zu den jüngsten<br />
Prägungen des Schellenberger Fundes. Beide<br />
zeigen als Münzbild den pfälzischen Weckenschild,<br />
darüber ein Beizeichen, das bei beiden Stücken<br />
sehr ähnlich aussieht. Beim älteren Stück (Nr. 193)<br />
kann dieses Beizeichen gemäss Buchenau als<br />
Buchstabe «C» gedeutet werden, welcher auch auf<br />
Goldgulden Stephans von Simmern (1410-1453)<br />
an Stelle des «S» vorkommt. Bezüglich der Gravur<br />
des Schildes ist dieses Stück verwandt mit den<br />
übrigen Pfennigen Stephans aus der Münzstätte<br />
Wachenheim. Das zweite Stück weist hingegen eine<br />
andere Schildform auf. Der Weckenschild ist zudem<br />
viel flächiger und roher geschnitten. Der darüberstehende<br />
Buchstabe ist eindeutig ein «1». Aufgrund<br />
der Machart kann dieses Stück kaum aus der<br />
Münzstätte Wachenheim stammen, vielmehr wird<br />
Veldenz als Entstehungsort vermutet. Buchenau<br />
nimmt an, dass die frühere Prägung mit dem Buchstaben<br />
«C» noch von Stephan stammt und dass<br />
sein Sohn Ludwig von Zweibrücken (1453-1489)<br />
diesen Buchstaben später durch ein «1» ersetzte. 46<br />
Daher wird die Prägung Ludwigs wohl in seiner<br />
frühen Regierungszeit anzusetzen sein.<br />
Eine recht problematische Gruppe stellen die<br />
Strassburger Lilienpfennige und ihre Beischläge<br />
dar. Im Fund vertreten sind drei Pfennige mit der<br />
Lilie über dem Schild mit Schrägbalken (Nr.<br />
152-154). Weil sich das strassburgerische und das<br />
badische Wappen auf Münzen nicht unterscheiden,<br />
ist eine Zuweisung nicht eindeutig. 47<br />
Da bisher keine<br />
zwingenden Argumente für eine Zuweisung an<br />
Baden vorhanden sind, scheint es ratsam, diesen<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Typ vorerst in Strassburg, also in der ursprünglichen<br />
Heimat dieser Pfennige, zu belassen.<br />
Zur selben Gruppe gehört ein Beischlag mit der<br />
Lilie über einem fünfspeichigen Rad, das auf eine<br />
mainzische Münzstätte hinweist. Dieser Pfennig<br />
wird der Münzstätte Neckarsulm zugewiesen (Nr.<br />
202). Dagegen ist für den Typ mit Lilie und dem<br />
Buchstaben V noch keine befriedigende Zuweisung<br />
gefunden worden (Nr. 155). 48<br />
Ein kleine Gruppe von vier Tournosgroschen<br />
stammt aus dem lothringischen Raum. Diese Münzen<br />
sind Imitationen des Groschens von Tours in<br />
37) Datierung gemäss freundlicher Mitteilung von H.-U. Geiger. Zur<br />
Berner Münzgeschichte vgl. zuletzt Geiger. Hans-Ulrich: Berns<br />
Münzprägung im Mittelalter. Ein Forschungsbericht. In: Berner<br />
Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 59 (1997), S. 309-323.<br />
38) Zuweisung zum Münzvertrag von 1417: Schwarz, Zürich,<br />
S. 102-104; Hürlimann. S. 49.<br />
39) Gemäss Zäch, Alpenrheintal, S. 228, ist dieser Plappart eine<br />
Prägung zum Vertrag Zürichs mit den Innerschweizer Orten von<br />
1425. Die Datierung von Mildenberg (nach 1450) ist sicher zu spät<br />
angesetzt (Kat. Rechberg. S. 19. Nr. 65). In Zürich wurden von etwa<br />
1430/40 bis 1470/80 keine Münzen geprägt. Zäch, Benedikt: Die<br />
Fundmünzen aus der Kapelle. In: Hoek. Florian et al.: Burg - Kapelle<br />
- Friedhof. Rettungsgrabungen in Nänikon bei Uster und Bonstetten.<br />
Zürich und Egg, 1995. (Monographien der Kantonsarchäologie<br />
Zürich 26), S. 50. Die «Krähenplapparte» müssen vor dieser Prägepause<br />
entstanden sein.<br />
40) Zäch, Alpenrheintal, S. 230. Zur Fundverbreitung dieser Münzen<br />
vgl. die Kartierungen bei Zäch. Benedikt: Kirchenfunde als Quellen<br />
zum Kleingeldumlauf im 15. Jahrhundert. In: Archäologie der<br />
Schweiz 15 (1992), S. 144-151.<br />
41) Zur Zuweisung dieses Pfennigs nach Heilbronn vgl. Buchenau,<br />
Heilbronn, Sp. 5177.<br />
42) Interessanterweise sind die Prägungen des Rappenmünzbundes<br />
- mit Ausnahme der beiden Basler Plapparte (Nr. 150-151) - nicht<br />
im Fund vertreten.<br />
43) Schüttenhelm, S. 300. Zum Vertrag von Heidelberg 1409 vgl.<br />
Jesse. S. 19; Wielandt, Baden, S. 21-27.<br />
44) Schüttenhelm, S. 317.<br />
45) Buchenau. Untersuchungen, BfM 51 (1916), S. 162.<br />
46) Noss. S. 217. Anm. 1 (eingefügt von der Redaktion, 11. Buchenau).<br />
Noss weist hingegen beide Prägungen Ludwig zu.<br />
47) Vgl. Wielandt, Baden, S. 19-21.<br />
48) Schwarzkopf widerlegt die ältere Zuweisung an die Herren von<br />
Usenberg, ohne jedoch eine Alternative vorzuschlagen. Schwarzkopf,<br />
S. 73-87.<br />
51
Frankreich, der in vielen westeuropäischen Münzstätten,<br />
besonders in den Niederlanden und am<br />
Niederrhein nachgeahmt wurde. Drei Stücke stammen<br />
von Herzog Karl II. von Lothringen (1390-1431)<br />
aus der Münzstätte Nancy. Ein Tournosgroschen<br />
aus der Münzstätte St. Mihiel wurde unter Rene<br />
d'Anjou als Herzog von Bar (1419-1453) geprägt. 49<br />
Tournosgroschen kommen im Gebiet der heutigen<br />
Schweiz in Schriftquellen häufiger vor als in<br />
Funden. Aus dem 15. Jahrhundert sind wenige<br />
Schatzfunde bekannt, die lothringische Tournosgroschen<br />
enthielten. Wie auch im Schellenberger<br />
Fund machen diese Prägungen jeweils nur einen<br />
geringen Anteil aus. 50<br />
Im südwestdeutschen Raum<br />
waren lothringische Münzen im 15. Jahrhundert<br />
noch kaum von Bedeutung, sie gewannen erst im<br />
folgenden Jahrhundert an Einfluss, besonders am<br />
Oberrhein. 51<br />
MITTEL- UND NORDDEUTSCHLAND<br />
Eine kleine Gruppe stellen die fünf Münzen aus<br />
Mittel- und Norddeutschland dar. Zu dieser Gruppe<br />
gehört die einzige Goldmünze des Schellenberger<br />
Fundes (Nr. 215), ein Goldgulden mit dem Namen<br />
von König Sigismund (1410-1437). Dieser entstand<br />
in der Reichsmünzstätte Nürnberg, wo in den Jahren<br />
1414 bis 1419 Goldgulden - alle vom selben<br />
Typ - ausgegeben wurden. Diese Prägungen kommen<br />
zwar gelegentlich in süddeutschen und<br />
schweizerischen Schatzfunden vor, sie stellten jedoch<br />
in diesem Raum im Vergleich mit den rheinischen<br />
Goldgulden nur einen sehr geringen Anteil<br />
am Geldumlauf dar. 52<br />
Zwei Münzen stammen von den Burggrafen von<br />
Nürnberg (Nr. 216-217). Diese Prägungen kamen,<br />
abgesehen vom Schellenberger Fund, bisher noch<br />
nie im Alpenrheintal zum Vorschein. 53<br />
Das Vorkommen<br />
von drei Nürnberger Prägungen im Fund<br />
kann wohl mit dem auch sonst im Schatzfund deutlich<br />
fassbaren Einfluss aus dem fränkischen und<br />
böhmischen Raum erklärt werden. Neben den<br />
Nürnberger Münzen sind darin auch drei Nürnberger<br />
Gegenstempel auf Prager Groschen enthalten. 54<br />
52<br />
Der Altenburger Heller (Nr. 218) kann einer<br />
Gruppe von mittel- und zum Teil auch norddeutschen<br />
Kleinmünzen aus der zweiten Hälfte des<br />
15. Jahrhunderts zugerechnet werden, die in<br />
schweizerischen Kirchenfunden häufig auftauchen.<br />
In der Regel kommen diese jedoch nicht in Schatzfunden<br />
vor. 55<br />
Allenfalls kann auch der Lüneburger<br />
Pfennig (Nr. 219) zu dieser Gruppe gezählt werden.<br />
BÖHMEN<br />
Den numismatisch wohl interessantesten Teil des<br />
Schellenberger Fundes bilden die Prager Groschen<br />
mit ihren zahlreichen Gegenstempeln (Abb. 12). Der<br />
Beginn der Ausprägung dieser Münzen in der<br />
Münzstätte Kuttenberg (Kutnä Hora) im Jahre<br />
1300 war durch die kurze Zeit zuvor gefundenen<br />
Silbervorkommen möglich geworden und leitete<br />
eine neue Epoche im böhmischen Münzwesen<br />
ein. 56<br />
Die Prager Groschen Wenzels II. (1278-1305)<br />
wie auch seiner Nachfolger Karl I. (1346-1378) 57<br />
und Wenzel IV. (1378-1419) 58<br />
gelangten wegen der<br />
stets passiven Handelsbilanz Böhmens in grossen<br />
Mengen ins Ausland.<br />
Unter der Herrschaft Wenzels IV. war es wie<br />
auch schon unter seinen Vorgängern mehrfach zur<br />
Herabsetzung des Silbergehalts gekommen. Nach<br />
seinem Tod wurden unter hussitischer Leitung<br />
wahrscheinlich weiterhin Prager Groschen mit seinem<br />
Namen hergestellt, die nur noch einen geringen<br />
Silbergehalt aufwiesen und in der Regel sehr<br />
unsorgfältig geprägt waren. 59<br />
Die Verbreitung dieser<br />
minderwertigen Prägungen führte zu Klagen<br />
und provozierte Gegenmassnahmen. In den zwanziger<br />
und dreissiger Jahren des 15. Jahrhunderts<br />
wurden in weiten Teilen Süddeutschlands, in Franken<br />
und in Westfalen die umlaufenden Groschen<br />
von der Obrigkeit geprüft und die guten mit einem<br />
Gegenstempel versehen, um ihnen die lokale Kursfähigkeit<br />
zu sichern. 60<br />
Die Gegenstempel stammen<br />
in der Regel von Städten und zeigen entweder das<br />
Stadtwappen oder ein sonstiges für die jeweilige<br />
Stadt charakteristisches Symbol. Sind auf einer<br />
Münze nacheinander die Stempel verschiedener
Städte angebracht worden, kann der «Reiseweg»<br />
einer Münze über mehrere Stationen verfolgt werden<br />
(Tab. 3).<br />
49) Rene d'Anjou war Herzog von Anjou, Graf von Maine, Herzog<br />
von Lothringen und Bar, Graf von Provence. König von Neapel und<br />
König von Jerusalem. Er war eine schillernde Gestalt und als Graf<br />
von Provence ein bedeutender Kunstförderer. Lexikon des Mittelalters.<br />
Bd. VII. München, 1995, Sp. 727-730.<br />
50) Zäch, Fremde Münzen, S. 420, mit einer Auflistung der betreffenden<br />
Funde (Anm. 122).<br />
51) Schüttenhelm, S. 299.<br />
52) Schüttenhelm, S. 261. Ein Goldgulden der Reichsmünzstätte<br />
Nürnberg war im Schatzfund von Büsserach SO, 1904 (um 1444),<br />
enthalten, ein städtischer Goldgulden im Fund von Baisthal, 1929<br />
(um 1465/70). Fundberichte in: ASA Bd. 7 (1905/6), S. 173 und SNR<br />
12 (1904), S. 537-538 (zum Fund Büsserach). Wegeli, Rudolf:<br />
Münzfund von Balsthal. In: SNR 25 (1930), S. 94-95. Im Alpenrheintal<br />
wurden abgesehen vom Nürnberger Goldgulden aus dem Schellenberger<br />
Fund und einer französischen Goldmünze bisher nur<br />
rheinische Gulden gefunden. Zäch, Alpenrheintal, S. 226,<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
53) Nürnberger Kleinmünzen - in der Regel Heller - sowohl der<br />
Stadt wie auch der Burggrafschaft, kommen dagegen in der zweiten<br />
Hälfte des 15. Jahrhunderts in Siedlungsfunden vor. Zäch, Fremde<br />
Münzen, S. 423; beispielsweise in der Stadtkirche Winterthur: von<br />
Roten, Hortensia: Münzen. In: Jäggi, C; Meier, H.-R.; Windler, R.;<br />
Uli, M.: Die Stadtkirche St. Laurentius in Winterthur. Ergebnisse der<br />
archäologischen und historischen Forschungen. Zürich und Egg.<br />
1993. (Zürcher Denkmalpflege. Archäologische Monographien 14),<br />
S. 94-110 und 263-273 (Katalog), hier S. 270, Nr. 734-739.<br />
54) Vgl. unten Kapitel Böhmen.<br />
55) Zu dieser Gruppe gehören neben Altenburger Hellern eine ganze<br />
Reihe von fränkischen, ostbayerischen, thüringisch-meissischen,<br />
sächsischen und böhmischen Kleinmünzen. Zäch, Fremde Münzen,<br />
S. 423.<br />
56) Zu den Prager Groschen vgl. Castelin.<br />
57) Als deutscher König Karl IV. (1347-1378).<br />
58) Wenzel bezeichnet sich selbst auf Münzen als Wenzel III. Als<br />
deutscher Kaiser Wenzel I. (1378-1400).<br />
59) Castelin, S. 33-34.<br />
60) Verbreitungskarte der gegenstempelnden Städte bei Castelin,<br />
Anhang.<br />
Abb. 12: Die gegenstempelnden<br />
Städte auf Prager<br />
Groschen des Schellenberger<br />
Fundes. Die Punktgrösse<br />
entspricht der Anzahl<br />
der vorkommenden<br />
Gegenstempel.<br />
1 Feldkirch; 2 Konstanz;<br />
3 Schaffhausen; 4 Radolfzell;<br />
5 Ravensburg; 6 Lindau;<br />
7 Wangen; 8 Isny;<br />
9 Kempten; 10 Memmingen;<br />
11 Ulm; 12 Augsburg;<br />
13 Salzburg; 14 Regensburg;<br />
15 Eichstätt; 16 Nördlingen;<br />
17 Schwäbisch<br />
Gmünd; 18 Göppingen;<br />
19 Urach; 20 Esslingen;<br />
21 Heilbronn; 22 Weinsberg;<br />
23 Schwäbisch Hall;<br />
24 Nürnberg; 25 Bayreuth;<br />
26 Frankenberg; 27 Marburg;<br />
28 Attendorn; ohne<br />
Signatur: Riedlinger Bund<br />
• Kuttenberg<br />
it Schellenberg<br />
53
Insgesamt 66 der 72 Prager Groschen im Schellenberger<br />
Fund weisen Gegenstempel von 28 Städten<br />
und von einem Münzbund auf (Abb. 12). 61<br />
Gemäss<br />
Schüttenhelm strömten die böhmischen Groschen<br />
über Regensburg entlang der Donau nach Ulm und<br />
von dort weiter nach Oberschwaben, dem zu dieser<br />
Zeit wegen seiner Textilerzeugung bedeutendsten<br />
südwestdeutschen Gewerbegebiet. 62<br />
Das Fundmaterial<br />
von Schellenberg bestätigt diese These im<br />
Grossen und Ganzen. Ulm ist mit 28 Gegenstempeln<br />
die mit Abstand am häufigsten vertretene<br />
Stadt. Die Groschen gelangten aber in der Regel<br />
nicht über Regensburg nach Ulm, sondern über<br />
Augsburg (zehn Gegenstempel). Die Kombination<br />
Tab. 3: Gegenstempel auf<br />
Prager Groschen mit bestimmbarer<br />
Reihenfolge<br />
* Reihenfolge unsicher<br />
54<br />
Augsburg-Ulm ist in dieser Reihenfolge auf vier<br />
Groschen nachzuweisen. 63<br />
Dagegen ist Regensburg<br />
nur mit einem Gegenstempel vertreten. Der Weg,<br />
den die Münzen vor Augsburg zurücklegten, ist unbekannt,<br />
da der Augsburger Gegenstempel stets als<br />
erster eingeschlagen wurde. Weniger bedeutende<br />
«Einfallstore» nach Südwestdeutschland waren dagegen<br />
Nördlingen (sechs Gegenstempel), Salzburg<br />
und Nürnberg (je drei Gegenstempel), Eichstätt<br />
(zwei Gegenstempel) und Bayreuth (ein Gegenstempel).<br />
Von Ulm aus flössen die Groschen in den Bodenseeraum.<br />
Hier liegen von zehn Städten Gegenstempel<br />
vor. Mit zehn Stempeln ist dabei Konstanz am<br />
1. Gegenstempel 2. Gegenstempel 3. Gegenstempel 4. Gegenstempel Katalog Nr.<br />
Attendorn<br />
Augsburg<br />
Augsburg<br />
Augsburg<br />
Augsburg<br />
Augsburg<br />
Augsburg<br />
Eichstätt<br />
Esslingen<br />
Frankenberg<br />
Kempten<br />
Kempten<br />
Kempten<br />
Konstanz?<br />
Nördlingen<br />
Nördlingen<br />
Nördlingen<br />
Nürnberg<br />
Ravensburg<br />
Ravensburg<br />
Riedlinger Bund<br />
Riedlinger Bund*<br />
Riedlinger Bund<br />
Salzburg<br />
Schwäb. Gmünd*<br />
Ulm*<br />
Ulm<br />
Ulm<br />
Ulm<br />
Ulm*<br />
Weinsberg<br />
Attendorn<br />
Konstanz<br />
Nürnberg<br />
Radolfzell<br />
Riedlinger Bund<br />
Ulm<br />
Ulm<br />
Ulm<br />
Ulm<br />
Ulm<br />
Feldkirch<br />
Ulm<br />
Urach<br />
Ulm<br />
Salzburg<br />
Ulm<br />
unbestimmt<br />
Schwäbisch Hall<br />
Feldkirch<br />
Konstanz<br />
Feldkirch<br />
Riedlinger Bund*<br />
unbestimmt<br />
Nördlingen<br />
Schaffhausen*<br />
Bayreuth*<br />
Feldkirch<br />
Ravensburg<br />
Riedlinger Bund<br />
Urach*<br />
unbestimmt<br />
Ulm<br />
Ulm<br />
Feldkirch<br />
Radolfzell<br />
Ulm<br />
Feldkirch<br />
Göppingen<br />
Ulm<br />
Konstanz<br />
Konstanz<br />
Ulm<br />
Marburg<br />
Ulm<br />
290<br />
247; 248<br />
249<br />
271<br />
272<br />
250;251;<br />
288<br />
273<br />
252;253<br />
254<br />
256<br />
257<br />
258<br />
259<br />
260<br />
261<br />
220<br />
280<br />
262<br />
264<br />
265<br />
274<br />
275<br />
291<br />
266<br />
276<br />
267<br />
268<br />
289<br />
277<br />
278<br />
279
häufigsten vertreten, was aufgrund der wirtschaftlichen<br />
Stellung dieser Stadt nicht weiter erstaunt. 64<br />
Die beachtliche Anzahl von neun Feldkircher Gegenstempeln<br />
kann mit der kurzen Distanz zwischen<br />
dieser Stadt und dem Fundort erklärt werden. Erwartungsgemäss<br />
sind diese stets zuletzt auf den<br />
Prager Groschen eingestempelt worden. 65<br />
Die übrigen<br />
Städte des Bodenseeraums sind mit deutlich<br />
weniger Gegenstempeln (ein bis vier Stück) im<br />
Schellenberger Fund vertreten (Ravensburg, Kempten,<br />
Lindau, Isny, Radolfzell, Schaffhausen, Wangen,<br />
Memmingen).<br />
Als Sonderfall kann der Riedlinger Bund gelten,<br />
der - soweit bekannt - als einziger Münzbund Prager<br />
Groschen gegenstempelte. Gemäss Krusy geschah<br />
dies vor 1428 mit einem Adler, zwischen<br />
1428 und 1431 mit einem Stern. 66<br />
Neben der Gegenstempelung<br />
des Bundes sind von den meisten<br />
am Bund teilnehmenden Städten aber auch eigene<br />
Gegenstempel bekannt. 67<br />
Ob die eigene Stempelung<br />
der zum Bund gehörenden Städte zeitweise zugunsten<br />
derjenigen des Bundes aufgehört hat, ist unsicher.<br />
Im Fund sind zwei Stücke enthalten, die neben<br />
einem Gegenstempel des Bundes auch einen<br />
Stempel eines Bundesgenossen aufweisen. 68<br />
Diese<br />
Münzen können jedoch nicht zwingend als Beweis<br />
für eine gleichzeitige Stempelung gelten. Es gibt<br />
Hinweise darauf, dass Münzen zwischen zwei Gegenstempelungen<br />
längere Zeit zirkulierten. So waren<br />
auf einem Stück gleich beide Stempel des Riedlinger<br />
Bundes (Adler und Stern) eingeschlagen, die<br />
nicht gleichzeitig in Gebrauch waren (Nr. 275).<br />
Eine ganze Gruppe von Städten, die nur durch<br />
wenige Gegenstempel im Schellenberger Fund vertreten<br />
sind (ein bis drei Stück), liegt zwischen Donau<br />
und Neckar (Urach, Göppingen, Heilbronn,<br />
Esslingen, Schwäbisch Gmünd, Schwäbisch Hall,<br />
Weinsberg). Drei Städte liegen noch weiter nördlich<br />
in Hessen (Frankenberg, Marburg) und in Westfalen<br />
(Attendorn 69<br />
). Interessanterweise wurden die<br />
meisten der entsprechenden Prager Groschen auf<br />
ihrem Weg nach Süden in Ulm ein zweites Mal gestempelt.<br />
70<br />
Ulm war also auch für diese Prägungen<br />
das «Einfallstor» in den Bodenseeraum.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Wenn auch die meisten Gegenstempel den aufgezeichneten<br />
Tendenzen folgen, belegen doch einige<br />
«Irrläufer», dass die Verbreitung der Prager<br />
Groschen keineswegs immer geradlinig verlief. 71<br />
Bei genügend grosser Stückzahl, wie sie der Schellenberger<br />
Fund aufweist, lassen sich die groben<br />
Tendenzen dennoch gut ablesen.<br />
Einer der insgesamt 72 im Fund enthaltenen<br />
Prager Groschen stammt von Karl L, die übrigen<br />
61) Insgesamt konnten 120 Gegenstempel nachgewiesen werden.<br />
62) Schüttenhelm. S. 392.<br />
63) Nr. 250, 251. 273. 288.<br />
64) Der Stadt Konstanz können wahrscheinlich drei verschiedene<br />
Gegenstempel zugewiesen werden. Sicher gehört derjenige mit dem<br />
Bischofskopf (Krusy, K 5,1-12) nach Konstanz. Bei den anderen ist<br />
die Zuweisung umstritten. Vom Gegenstempel mit dem Kreuzschild<br />
(Krusy. X 73) ist bisher nur das Stück aus dem Schellenberger Fund<br />
bekannt geworden (Nr. 232). Der andere, runde Gegenstempel<br />
(Nr. 260) zeigt ebenfalls ein Kreuz, im Winkel rechts oben ein Stern,<br />
im Winkel links unten ein Halbmond (Krusy, X 66,4). Bei beiden<br />
Stempeln hat Krusy Bedenken, sie Konstanz zuzuweisen. Krusy,<br />
S. 306 und 307. Seine Argumente gegen Konstanz sind jedoch nicht<br />
stichhaltig. Der Konstanzer Stadtschild erscheint auf den Münzen<br />
des Riedlinger Bundes immer ohne Schildhaupt. Somit muss auch<br />
der Schild des Gegenstempels nicht unbedingt ein Schildhaupt<br />
aufweisen, wie Krusy behauptet. Auch die Beizeichen Mond und<br />
Stern, die auf Konstanzer Münzen schon seit dem 13. Jahrhundert<br />
vorkamen, sprechen eher für Konstanz als dagegen. Mangels einer<br />
besseren Alternative schlage ich vor, diese beiden Gegenstempel in<br />
Konstanz zu belassen (wie Nau, Oberschwaben, S. 25, Nr. 6 und 8).<br />
65) Gegenstempel von Feldkirch, dem südlichsten Ort, der Prager<br />
Groschen gegenstempelte, sind eine grosse Seltenheit. Krusy kann<br />
zu den neun Stücken des Schellenberger Schatzfundes nur gerade<br />
drei weitere anfügen. Krusy. S. 88. Zur Zuweisung dieses Gegenstempels<br />
an die Stadt Feldkirch vgl. Fussenegger, Kurt: Feldkirch als<br />
Münzstätte? In: JbVLM 117 (1973), S. 126-144.<br />
66) Krusy. S. 224.<br />
67) Krusy, S. 24.<br />
68) Nr. 277 (Riedlinger Bund, Ulm und Konstanz); Nr. 291 (Riedlinger<br />
Bund und Ulm). Zu dieser Frage vgl. auch Krusy, Gegenstempel,<br />
S. 224.<br />
69) Ein Prager Groschen (Nr. 290) wurde mit demselben Attendorner<br />
Stempel gleich zweifach gegengestempelt, ein Phänomen, das in<br />
Westfalen häufig vorkommt. Krusy. S. 28.<br />
70) Nr. 254 (Esslingen-Ulm): Nr. 256 (Frankenberg-Ulm); Nr. 269<br />
(Urach-Ulm); Nr. 279 (Weinsberg-unbest. Gegenstempel-Ulm);<br />
Nr. 290 (Attendorn-Ulm).<br />
71) So etwa Nr. 258 (zuerst Kempten, dann Ulm).<br />
55
wohl alle von König Wenzel IV. 72<br />
Gegengestempelte<br />
Groschen mit dem Namen Karls sind sehr selten. 73<br />
Diese älteren Stücke sind vermutlich unbemerkt<br />
zusammen mit den Groschen Wenzels zirkuliert.<br />
TIROL<br />
Die ältesten Tiroler Prägungen des Schellenberger<br />
Fundes sind die fünf Vierer der Grafen Leopold IV.<br />
(1395-1406) 74<br />
und Friedrich IV. (1406-1439). Von<br />
Sigismund (1439-1490, fl496) ist ein Exemplar<br />
dieses Nominals im Wert eines Fünftelkreuzers<br />
vorhanden. Tiroler Vierer sind bisher schon mehrfach<br />
in Funden des Alpenrheintals zum Vorschein<br />
gekommen, abgesehen vom Schellenberger Fund<br />
allerdings ausschliesslich in Siedlungsfunden. 75<br />
Die Hauptmasse der Tiroler Münzen im Schellenberger<br />
Fund machen die Kreuzer aus. Diese<br />
Prägungen haben schon im 14. Jahrhundert den<br />
Weg ins Alpenrheintal gefunden. Der rund hundert<br />
Jahre vor dem Schellenberger Fund vergrabene<br />
Schatzfund von Vaduz ist einer der frühesten Belege<br />
für diese Münzen nördlich der Alpen. 76<br />
Danach<br />
sind sie erst zur Zeit Sigismunds wieder im Alpenrheintal<br />
nachgewiesen. Kreuzer dieses Herrschers<br />
kommen abgesehen vom Fund von Schellenberg<br />
auch in Siedlungsfunden vor. 77<br />
Die Sigismundskreuzer sind in mehreren Varianten<br />
im Schellenberger Fund vertreten. Nach einer<br />
kürzlich vorgenommenen Gliederung gehören die<br />
fünf Stücke der Variante la, die einen groben Stern<br />
als Legendentrenner aufweisen, an den Anfang der<br />
Kreuzeremission Sigismunds (Nr. 297-301). 78<br />
Bei<br />
den zwei Stücken der Variante lb treten zwei über-<br />
Abb. 13: Stempelkopplungen<br />
bei den Kreuzern der<br />
Variante lc<br />
56<br />
einanderstehende Ringel an die Stelle des Sterns<br />
(Nr. 302-303). Diese Variante ist mit ziemlicher Sicherheit<br />
ebenfalls den frühen Sigismundskreuzern<br />
zuzurechnen.<br />
Die Hauptmasse besteht aus 97 Kreuzern der<br />
Variante lc, die auf der Vorderseite zwei, auf der<br />
Rückseite ein blitzähnliches Beizeichen aufweisen<br />
(Nr. 304-400). Gemäss der erwähnten Gliederung<br />
folgt diese Variante unmittelbar auf die im Fund<br />
nicht enthaltene Gruppe, die unter dem Adler die<br />
Zahl 60 trägt, die wahrscheinlich als Jahrzahl<br />
(14)60 interpretiert werden kann. Zu diesem Zeitpunkt<br />
setzte im Tirol eine «engagierte» Kreuzerprägung<br />
ein. 79<br />
Die Sigismundskreuzer der Variante<br />
lc sind somit unmittelbar nach 1460 entstanden.<br />
Aufgrund der Fundzusammensetzung handelt es<br />
sich um die letzten Münzen, die in den Fund gelangten.<br />
80<br />
Auffällig an den Stücken der Variante lc ist ihre<br />
ausgezeichnete Erhaltung. Fast alle Stücke sind<br />
nicht abgegriffen, weshalb diese Münzen nur sehr<br />
kurze Zeit im Umlauf gewesen sein können. Die an<br />
diesem Ensemble vorgenommenen Stempeluntersuchungen<br />
haben ergeben, dass diese Münzen nur<br />
mit sehr wenigen Stempeln geschlagen wurden. Insgesamt<br />
konnten sieben Vorder- und fünf Rückseitenstempel<br />
unterschieden werden (Abb. 13). 81<br />
49 Münzen<br />
wurden dabei mit ein und demselben Stempelpaar<br />
(Vs. Stempel 1/Rs. Stempel 1) geschlagen. Bis<br />
auf eine Ausnahme sind alle Stempel miteinander<br />
verhängt. Bei sechs der sieben Vorderseitenstempel<br />
konnte je eine Verbindung mit dem Rückseitenstempel<br />
2 festgestellt werden.<br />
Als Vergleich kann der Fund von St. Valentin in<br />
Niederösterreich herangezogen werden (vergraben<br />
nach 1482), der insgesamt 156 Stücke derselben<br />
Variante enthielt. Als Ergebnis der Stempeluntersuchungen<br />
an dieser Gruppe konnten die Bearbeiter<br />
des Fundes nur vier Stempelkombinationen<br />
feststellen. 82<br />
In diesem deutlich nach dem Schellenberger<br />
Fund vergrabenen Schatz war wegen des<br />
späteren Vergrabungszeitpunkts offensichtlich eine<br />
viel grössere Anzahl von Stempeln vertreten.<br />
Die geringe Abgegriffenheit der Stücke der Variante<br />
lc im Schellenberger Fund und die enge Ver-
indung der Stempel deuten daraufhin, dass diese<br />
Münzen kaum einzeln dem Geldumlauf entnommen<br />
worden sein können. Sie sind wahrscheinlich<br />
als Ensemble in die Hände des Besitzers gelangt.<br />
Somit kann diese Gruppe auf ihrem Weg von der<br />
Münzstätte Meran bis zum Fundort nicht durch beliebig<br />
viele Hände gegangen sein. Das Ensemble<br />
gelangte wohl auf direktem Weg aus der Münzstätte<br />
in den Fund.<br />
Der Besitzer fügte diese Stücke als letzte zu seinen<br />
Ersparnissen hinzu und vergrub diese wohl<br />
nur kurze Zeit später.<br />
Als Importroute für die Tiroler Kreuzer kommt<br />
neben den Bündner Pässen auch der Arlberg in<br />
Frage. Das weitgehende Fehlen von tirolischen<br />
Fundmünzen in Graubünden spricht für eine Einfuhr<br />
über diesen Pass. 83<br />
ITALIEN<br />
Die italienischen Münzen machen mengenmässig<br />
einen Anteil von 34 Prozent des Fundinhaltes aus.<br />
Wertmässig ist dieser Anteil jedoch bedeutend<br />
höher, nämlich auf rund 48 Prozent zu veranschlagen.<br />
Dieser Unterschied ist darauf zurückzuführen,<br />
dass der italienische Fundanteil aus grösseren Silbermünzen<br />
besteht. Die Kleinmünzen hingegen<br />
fehlen.<br />
Der mit Abstand grösste Anteil entfällt auf die<br />
mailändischen Münzen (199 Stück), wozu auch die<br />
Prägungen aus den mailändischen Nebenmünzstätten<br />
Pavia und Verona gezählt werden (Tab. 4).<br />
Die übrigen italienischen Münzen fallen im Vergleich<br />
mit den mailändischen kaum ins Gewicht.<br />
Sieben Münzen stammen aus Venedig, je ein Einzelstück<br />
aus Genua und aus Bologna.<br />
Das Spektrum der Mailänder Prägungen umfasst<br />
die erstaunlich grosse Zeitspanne von beinahe<br />
hundert Jahren. Die ältesten Münzen stammen von<br />
Barnabö und Galeazzo II. Visconti. Die jüngste, die<br />
als einzige nicht von einem Visconti geprägt wurde,<br />
ist in der Zeit der zweiten mailändischen Republik<br />
hergestellt worden. Innerhalb dieses Spektrum<br />
sind die Münzen sehr ungleichmässig verteilt. Der<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
älteste Anteil mit Prägungen von Barnabö und Galeazzo<br />
II. umfasst 35 Stück (inkl. Gemeinschaftsprägungen).<br />
84<br />
Diese Münzen sind gleichzeitig auch<br />
die ältesten Prägungen des Fundes.<br />
Den Hauptanteil der Mailänder Münzen prägte<br />
jedoch Gian Galeazzo (155 Stück). Der grösste Anteil<br />
(132 Stück) stammt aus seiner Zeit als Herzog<br />
12) Insgesamt elf Stücke konnten Wenzel IV. nicht sicher zugeordnet<br />
werden. Bei all diesen Stücken waren zwar Teile des Namens<br />
(WENCEZLAVS) lesbar, nicht aber die Ordnungszahl (TERCIVS).<br />
Da Gegenstempel auf Präger Groschen von Wenzel II. (1278-1305)<br />
extrem selten sind - Krusy kennt nur ein einziges Stück - sind diese<br />
elf Stücke mit grösster Wahrscheinlichkeit ebenfalls Wenzel IV.<br />
zuzuorden. Vgl. Krusy. Maus: Gegengestempelte Prager Groschen,<br />
die nicht den Namen Wenzels III. tragen. In: HBN Bd. 6/2, Heft 20<br />
(1966). S. 525-530, hier S. 527.<br />
73) Krusy, Prager Groschen (wie Anm. 72), S. 527, verzeichnet nur<br />
gerade 16 weitere Stücke. Das Schellenberger Stück weist Gegenstempel<br />
von Nördlingen und Ulm auf. Offenbar ist dies der einzige<br />
bekannte Nördlinger Stempel auf einem Groschen Karls.<br />
74) Zur Unterscheidung der Vierer Leopolds III. und Leopold IV.<br />
vgl. Diaz Tabernero, S. 18 mit Anm. 86.<br />
75) Bendern; Gretschins. Zäch, Alpenrheintal, S. 229, Anm. 141.<br />
76) Zäch, Alpenrheintal, S. 222.<br />
77) Kreuzer Sigismunds wurden in Bendern und Vaduz gefunden,<br />
ein Sechser Sigismunds auf der «Oberen Burg» in Schellenberg.<br />
Zäch. Alpenrheintal. S. 229. Anm. 141.<br />
78) Zur Gliederung der Sigismundskreuzer vgl. Alram. u. a..<br />
S. 124-131.<br />
79) Alram u. a., S. 129-130. Gemäss den Forschungen von Rizzolli<br />
hat sich 1461 die Prägetätigkeit gegenüber dem Vorjahr verdreifacht.<br />
Seiner Ansicht nach steht die Variante 1 c am Beginn einer<br />
1461 vehement einsetzenden Münzproduktion. Freundliche Mitteilung<br />
von Helmut Rizzolli, Bozen.<br />
80) Vgl. unten Kapitel Altersstruktur und Vergrabungszeitpunkt.<br />
81) Obwohl das Verhältnis der Stempelzahlen von Vorder- und<br />
Rückseitenstempel für eine Bezeichnung der Seite mit dem Adler als<br />
Vorderseite spricht, wurde in der vorliegenden Arbeit traditionell die<br />
mit dem Namen des Münzherrn (SIGISMUVNDVS ) versehene Seite<br />
als Vorderseite bezeichnet.<br />
82) 1x2 Stücke aus einem Vs.-Stempel (hier Adlerseite), 3x2 Ex. aus<br />
einem Rs. Stempel (hier Kreuzseite). Alram u.a., S. 146-147, Nr. 41.<br />
83) Zäch vermutet, dass die Kreuzer des Fundes von Vaduz ebenfalls<br />
über den Arlberg importiert wurden. Zäch, Fremde Münzen, S. 421.<br />
Anm. 123.<br />
84) In Bezug auf die Datierung der Prägungen der beiden Brüder<br />
sind immer noch Fragen offen. Schärli. Mailändisches Geld. S. 283.<br />
Anm. 22.<br />
57
(1395-1402). 85<br />
Die nachfolgenden, nur noch spärlich<br />
im Fund vertretenen Münzen stammen von<br />
Giovanni Maria und Filippo Maria sowie aus der<br />
zweiten Republik.<br />
Die meisten Mailänder Münzen sind Pegioni<br />
(156 Stück). Dieses Nominal ist in der Regel auch in<br />
anderen Funden dieser Zeit nördlich der Alpen die<br />
am häufigsten vertretene Mailänder Münze. 86<br />
In<br />
den schriftlichen Quellen werden die Pegioni Gian<br />
Galeazzos mit der Natter als «alte Plapparte» oder<br />
seltener auch als «Schlangenplapparte» bezeichnet,<br />
die meist schlechter bewerteten Pegioni mit<br />
dem Blumenkreuz auf der Vorderseite als «Kreuzplapparte».<br />
87<br />
Diese beiden Typen kommen auch im<br />
Schellenberger Fund mit Abstand am häufigsten<br />
vor: der «Schlangenplappart» mit 44 Stücken<br />
(Nr. 460-503), der «Kreuzplappart» mit 74 Stücken<br />
(Nr. 504-577).<br />
Im Vergleich zu anderen Funden sind die Sesini<br />
als kleinstes im Fund enthaltenes mailändisches<br />
Nominal (35 Stück) überdurchschnittlich stark vertreten.<br />
88<br />
Sie stammen mit einer Ausnahme alle von<br />
Gian Galeazzo und wurden in der Münzstätte Mailand<br />
geprägt. Ein einziges Stück ist Filippo Maria<br />
zuzuweisen.<br />
Die acht Mailänder Grossi des Fundes stammen<br />
alle aus der Zeit nach 1412. Davon ist das späteste<br />
Stück aus der Zeit der zweiten Republik offenbar<br />
nur selten nördlich der Alpen zu finden. 89<br />
Neben den Münzen aus der Münzstätte Mailand<br />
kommen im Fund auch Prägungen der Mailänder<br />
Nebenmünzstätten Pavia und Verona vor. Insgesamt<br />
21 Pegioni stammen aus Pavia, wo Galeaz<br />
Tab. 4: Die mailändischen<br />
Münzen: Pegioni und<br />
Grossi (Sesini in Klammern)<br />
58<br />
zo II. ab 1365 residierte (Nr. 414-434). Anstelle<br />
des heiligen Ambrosius ist auf den Rückseiten dieser<br />
Münzen der Stadtheilige von Pavia, der heilige<br />
Sirus, abgebildet. Diese Gruppe zeichnet sich durch<br />
einen unerhörten Reichtum an Varianten aus. Bei<br />
der Bearbeitung konnten anhand der 21 Stücke<br />
nicht weniger als zwölf Varianten unterschieden<br />
werden. Ob dieser Umstand auf eine andere Arbeitsweise<br />
der Stempelschneider in Pavia zurückzuführen<br />
ist oder ob diese Variantenvielfalt auf<br />
grosse Stempelzahlen und damit auch auf eine<br />
grosse Emission schliessen lässt, müsste abgeklärt<br />
werden.<br />
Drei Pegioni von Gian Galeazzo wurden in dem<br />
1387 eroberten Verona geprägt. Anstelle des heiligen<br />
Ambrosius ist bei diesen Prägungen der Veroneser<br />
Stadtheilige, der heilige Zeno, getreten<br />
(Nr. 578-580).<br />
Ein «Schlangenplappart» Gian Galeazzos verdient<br />
eine besondere Erwähnung (Nr. 494). Auf der<br />
Vorderseite dieses Stücks ist ein Gegenstempel eingeschlagen,<br />
der einen Straussenhals mit einem<br />
Hufeisen im Schnabel zeigt. Dieser Gegenstempel<br />
konnte bisher keiner Stadt sicher zugewiesen werden.<br />
Das Vorkommen auf Prager Groschen und auf<br />
Mailänder Pegioni, das Fundvorkommen und die<br />
mitstempelnden Städte weisen nach Schwaben. 90<br />
Mailänder Münzen mit Gegenstempeln sind eine<br />
grosse Seltenheit. Offensichtlich bestand bei diesen<br />
Münzen kein Bedürfnis nach Gegenstempelung wie<br />
bei den Prager Groschen. 91<br />
Die übrigen italienischen Münzen sind im Vergleich<br />
zur Masse der Mailänder Prägungen nur von<br />
Prägeherr Mailand Pavia<br />
Barnabö/Galeazzo II. (1354-1378) 10<br />
Galeazzo II. (1354-1378) 2 21<br />
Barnabö (1354-1385) 2<br />
Gian Galeazzo (1378-1402) 118 (34)<br />
Giovanni Maria (1402-1412) 4<br />
Filippo Maria (1412-1447) 3 (1)<br />
Zweite Republik (1447-1450) 1<br />
Total 140 (35) 21<br />
Verona Total<br />
10<br />
23<br />
2<br />
121 (34)<br />
4<br />
3(1)<br />
1<br />
164 (35)
geringer Bedeutung. Die sieben Münzen aus Venedig<br />
wurden alle unter dem Dogen Francesco Foscari<br />
(1423-1457) geprägt. Die Grossi respektive Grossetti<br />
tragen auf der Vorderseite das Monogramm<br />
des Münzmeisters. Dank diesem Umstand lassen<br />
sich zwei dieser Münzen auf die Zeit ab 1452 datieren.<br />
Sie gehören damit zu den jüngsten Prägungen<br />
im Fund. Das Vorkommen venezianischer Münzen<br />
im Schellenberger Fund ist bemerkenswert und<br />
kann wohl mit der Lage des Fundortes an den Zufahrtsstrassen<br />
zu den Alpenpässen erklärt werden.<br />
Venezianische Silbermünzen haben sonst im Geldumlauf<br />
nördlich der Alpen kaum eine Rolle gespielt.<br />
92<br />
Die beiden Münzen aus Genua (Nr. 601) und Bologna<br />
(Nr. 609), der zeitweise wichtigsten Münzstätte<br />
des Kirchenstaates in Norditalien, sind eingesprengte<br />
Einzelstücke, die ebenfalls für den Geldumlaufnördlich<br />
der Alpen untypisch sind. 93<br />
85) Auffallend gering ist die Zahl der Fundmünzen in der Schweiz<br />
aus der Regierungszeit Gian Galeazzos als Herr von Mailand (vor<br />
seiner Erhebung zum Herzog 1 395). Schärli, Mailändisches Geld.<br />
S. 283, Anm. 22, hat darauf hingewiesen, dass dieser Umstand<br />
allenfalls auf Datierungsprobleme zurückzuführen ist.<br />
86) Schärli, Mailändisches Geld. S. 283. Pegioni gelten in der zweiten<br />
Hälfte des 14. Jahrhunderts eineinhalb Soldi. die Grossi dagegen<br />
zwei Soldi. Schärli, Mailändisches Geld, S. 283. Anm. 22. Hier auch<br />
Informationen zur Herkunft des Ausdrucks «Pegioni».<br />
87) Die Bezeichnungen «alter Plappart» und «Kreuzplappart» linden<br />
sich etwa in der Tarifierung des Riedlinger Vertrags, der Ausdruck<br />
«Schlangenplappart» in der Würzburger Valvation von 1496. Cahn,<br />
Konstanz, S. 250; Klein, S. 293. Weitere Beispiele aus Schweizer<br />
Quellen bei Schärli, Mailändisches Geld, S. 286-290.<br />
88) Die Zusammenstellung bei Schärli, Mailändisches Geld, S. 295,<br />
Beilage 3 und S. 310, nennt nur wenige Funde, die Sesini enthielten.<br />
Funde mit einem aussergewöhnlich hohen Anteil an Sesini sind die<br />
Schatzfundevon Küttigen/Kirchberg AG, 1877 (nach 1412), und<br />
Trimbach SO, 1860 (um 1410). Schärli, Beatrice: Mittelalterliche<br />
Münzen aus Mailand im Aargau. Der Fund von Kirchberg. In:<br />
Münzen und Medaillen aus Mittelalter und Neuzeit. Die numismatische<br />
Sammlung des Kantons Aargau. Hrsg. vom Historischen<br />
Museum Schloss Lenzburg. Lenzburg, 1997, S. 62-71. Hier S. 66,<br />
Anm. 14, Hinweis auf den Fund von Trimbach. K. M[eisterhans|:<br />
Grössere Münzfunde aus dem Ct. Solothurn. In: ASA 22. 1889.<br />
S. 232-233 (zum Fund von Trimbach). Ein Sesino entspricht in<br />
Italien sechs Denaren. Ein Pegone hat dort somit den dreifachen<br />
Wert eines Sesino.<br />
89) Schärli, Mailändisches Geld, S. 294, Beilage 1, verzeichnet<br />
jedenfalls kein einziges Stück aus dem Gebiet der heutigen Schweiz.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
90) Für diesen Gegenstempel kommen weder eine Zuweisung nach<br />
Rheinau ZH noch nach Leoben in der Steiermark und auch nicht<br />
nach Ungarn in Frage. Vgl. die Diskussion bei Krusy, S. 301-302.<br />
91) Klein. S. 287, mit der Erwähnung eines «Schlangenplapparts»<br />
Gian Galeazzos mit zwei ULmer Gegenstempeln (Taf. 5.m). Ein<br />
weiteres Exemplar desselben Typs mit einem Überlinger Gegenstempel<br />
befand sich im Fund von Aufhofen, Lkr. Biberach, 1962 (nach<br />
1436): Krusy, Hans: Der Fund von Aufhofen, Krs. Biberach Riss<br />
vergraben 1435-40. In: HBN Bd. 6, Heft 18-20 (1964/66),<br />
S. 95-110, hier S. 109, Nr. 129. Die Liste bei Krusy, S. 418, nennt<br />
auch nur diese drei Stücke.<br />
92) Im Alpenrheintal sind bisher ausser aus dem Fund von Schellenberg<br />
keine Fundmünzen aus Venedig bekannt. Vgl. die Fundregosten<br />
bei Zäch, Alpenrheintal, S. 233-238. Der «Vorarlberger Fund»<br />
enthält einen Soldino des Francesco Dandolo. Klein, S. 294 mit Taf.<br />
4. m. Zu den venezianischen Goldmünzen vgl. hingegen Klein,<br />
5. 290-291.<br />
93) Eine Ausnahme bildet der Fund von Kadelburg, Lkr. Waldshut,<br />
1921 (um 1450), der 29 Genueser Grossi enthielt. Schüttenhelm,<br />
S. 416. Die Genueser Münze des Schellenberger Fundes wurde von<br />
Kittelberger falsch bestimmt. Sie stammt vom Dogen Tommaso di<br />
Campofregoso (1436-1443) und nicht von Simone Boccanegra<br />
(1339-1344). Sie ist somit auch nicht die älteste Münze des Fundes,<br />
wie von ihm behauptet wurde. Kittelberger, S. 128.<br />
59
Nominalstruktur<br />
und Wert des Fundes<br />
Die starke Durchmischung des Schellenberger Fundes<br />
zeigt sich besonders deutlich bei der Untersuchung<br />
seiner Nominalstruktur (Tab. 5). 94<br />
Der Goldgulden<br />
ist als grösstes Nominal nur mit einem Exemplar<br />
im Fund vertreten. Dennoch macht dieses<br />
Einzelstück allein knapp fünf Prozent des Gesamtwertes<br />
aus.<br />
Den wertmässig grössten Teil stellen die 448<br />
grösseren Silbermünzen dar (90,7 Prozent). In dieser<br />
Gruppe nehmen die mailändischen Grossi und<br />
Pegioni den Spitzenplatz ein, die allein 42 Prozent<br />
des Fundwertes ausmachen. Deutlich darunter liegen<br />
mit 18,3 Prozent die Prager Groschen und mit<br />
11,8 Prozent die Tiroler Kreuzer. Die süddeutschen<br />
Schillinge und die schweizerischen Plapparte machen<br />
wertmässig nur gerade 5,1 bzw. 7,0 Prozent<br />
aus. Die übrigen grösseren Silbermünzen fallen ab-<br />
Tab. 5: Nominalstruktur Nominal<br />
und geschätzter Wert in<br />
Pfennigen<br />
(>()<br />
gesehen von den Sesini (4 Prozent) kaum ins Gewicht.<br />
Die in grosser Zahl im Fund vertretenen<br />
Klein- und Kleinstnominale im Wert eines ganzen<br />
oder eines halben Pfennigs erreichen nicht einmal<br />
fünf Prozent.<br />
Der Gesamtwert des Fundes lässt sich auf rund<br />
3 532 Pfennige schätzen, was nach mittelalterlicher<br />
Rechnung knapp 15 Pfund entspricht. 95<br />
Gemäss<br />
den von Elisabeth Nau in Südwestdeutschland vorgenommenen<br />
Untersuchungen liegt der Wert des<br />
Schellenberger Fundes im Vergleich mit anderen<br />
Funden im obersten Drittel.<br />
Der Betrag von 15 Pfund entsprach in der zweiten<br />
Hälfte des 15. Jahrhunderts etwa einem guten<br />
Ochsen. Ein Tagelöhner musste im Sommer rund<br />
100 Tage arbeiten, um diesen Betrag zu verdienen,<br />
ein Zimmermann etwa 82 Tage. 96<br />
Anzahl<br />
Goldgulden 1<br />
Grosso/Pegione 165<br />
Groschen 72<br />
Tournose 4<br />
Grossone 4<br />
Plappart 31<br />
Schilling 30<br />
Grossetto 3<br />
Kreuzer 104<br />
Sesino 35<br />
Pfennig/Angster 147<br />
Vierer/Quattrino 7<br />
Haller/Stebler/Heller 6<br />
unbestimmt 2<br />
Total 611<br />
Bewertung in Wert in Wert in<br />
Pfennigen Pfennigen Prozent<br />
168 168 4,8<br />
9 1485 42,0<br />
9 648 18,3<br />
9 36 1,0<br />
9 36 1,0<br />
8 248 7,0<br />
6 180 5,1<br />
6 18 0,5<br />
4 416 11,8<br />
4 140 4,0<br />
1 147 4,2<br />
1 7 0,2<br />
0,5 3 0,1<br />
3532 100
Altersstruktur und<br />
Vergrabungszeitpunkt<br />
Der Schatzfund von Schellenberg ist nicht nur in<br />
Bezug auf die Herkunft der Münzen und seine Nominalstruktur<br />
ein ausgesprochener Mischfund, sondern<br />
auch wegen seiner Altersstruktur (Tab. 6).<br />
Der älteste Anteil des Fundes besteht aus italienischen<br />
Münzen, von denen der grösste Teil noch<br />
aus dem 14. Jahrhundert stammt. Alle vor 1400<br />
entstandenen italienischen Münzen sind mailändische<br />
Prägungen (190 Stück). Diese setzen sich aus<br />
Münzen von Barnabö und Galeazzo II. (inkl. Gemeinschaftsprägungen)<br />
und Gian Galeazzo Visconti<br />
aus den Münzstätten Mailand, Pavia und Verona<br />
zusammen, die für Schatzfunde des ersten Drittels<br />
des 15. Jahrhunderts nördlich der Alpen typisch<br />
sind. 97<br />
In der Regel sind Funde mit Münzen von<br />
Barnabö und Galeazzos II. spätestens um 1435 abgeschlossen.<br />
98<br />
Der Anteil dieser frühen Mailänder<br />
Prägungen im Schellenberger Fund ist somit ungewöhnlich.<br />
Das breite Spektrum der italienischen<br />
Münzen wird daher kaum als geschlossenes Ensemble<br />
in den Schellenberger Fund gelangt sein.<br />
Die frühen Prägungen des 14. Jahrhunderts bildeten<br />
wohl eher einen Grundstock, zu dem später<br />
einzelne Münzen aus Mailand, Genua, Venedig und<br />
Bologna hinzugefügt wurden.<br />
Zu Beginn des 15. Jahrhunderts machen die ältesten<br />
süddeutschen und deutschschweizerischen<br />
Münzen den Hauptteil des Fundes aus. Diese sind<br />
jedoch zur Zeit vor dem Abschluss des Riedlinger<br />
Bundes von 1423 erst mit kleinen Stückzahlen vertreten.<br />
Prägungen der Münzbünde vor 1423 wie<br />
der Münzvertrag der Bodenseestädte mit Zürich<br />
von 1417 oder der Vertrag von 1409 am Oberrhein<br />
waren zahlenmässig nur schwach bemerkbar.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
94) Den Bewertungen in Tabelle 5 liegen die Angaben für die<br />
Zeitspanne von 1423 bis 1475 bei Schüttenhelm, S. 135, zugrunde.<br />
Die dort angegebenen Werte fussen teils auf überlieferten Tarifierungen,<br />
teils auf nur ungefähren Durchschnittswerten. Schüttenheims<br />
Tabelle stellt somit eine starke Vereinfachung der in Wirklichkeit viel<br />
komplizierteren Verhältnisse mit ihren oft räumlich und zeitlich<br />
schwankenden Kursen dar. Dennoch ist seine Tabelle ein sinnvolles<br />
Arbeitsinstrument, wenn man sich dieses Sachverhalts bewusst ist.<br />
Für Tabelle 5 bedeutet dies, dass die dort angegebenen Bewertungen<br />
als blosse Schätzungen zu gelten haben. Diese lassen aber dennoch<br />
interessante Vergleiche zu. Die bei Schüttenhelm nicht erwähnten<br />
Nominale, v.a. die venezianischen Silbermünzen, von denen nördlich<br />
der Alpen keine Tarifierungen zu erwarten sind, wurden aufgrund<br />
ihres Gewichts mit den übrigen Nominalen verglichen und entsprechend<br />
bewertet.<br />
95) Die Schätzungen von Nau, Münzumlauf, S. 118, Anm. 120 (zirka<br />
2 010 Pfennige), und Schüttenhelm, S. 573, Nr, 248 (2 113 Pfennige),<br />
beziehen sich nur auf den von Kittelberger publizierten Hauptanteil<br />
des Fundes.<br />
96) Beispiele nach Zürcher Quellen gemäss den Angaben bei:<br />
Quellen zur Zürcher Wirtschaftsgeschichte. Von den Anfängen bis<br />
1500. Bearbeitet von Werner Schnyder. 2 Bände. Zürich und Leipzig,<br />
1937, Bd. 2, S. 1 061. und Zäch, Benedikt; von Kaenel, Hans-<br />
Markus. Zürcher Geld. 950 Jahre zürcherische Münzprägung.<br />
[Zürich, 1986J, S. 39. Für das Alpenrheintal stehen im Moment<br />
keine entsprechenden Preis- oder Lohnangaben zur Verfügung.<br />
Vgl. Zäch, Vaduz, S. 20, Anm. 39.<br />
97) Einen ähnlichen Anteil von mailändischen Münzen wie der<br />
Schellenberger Fund enthielt etwa der Fund von Aufhofen (Krusy,<br />
Aufhofen (wie Anm. 91)), der Fund von Osterfingen (Henking, K.:<br />
Der Münzfund von Osterfingen im Jahre 1897. In: SNR 17 (1911),<br />
S. 307-311), und der «Vorarlberger Fund» (Klein, S. 292 mit Anm.<br />
50 und Tf. 4). Der dem Schellenberger Fund am nächsten gelegene<br />
«Vorarlberger Fund» enthielt folgende Mailänder Prägungen:<br />
Barnabö und Galeazzo II. (31 Stück), Galeazzo II. (48 Stück, davon<br />
41 aus Pavia), Barnabö (21 Stück), Gian Galeazzo (92 Stück). Wegen<br />
des früheren Vergrabungszeitpunktes sind in diesem Fund noch<br />
keine Prägungen des Riedlinger Bundes enthalten. Aus demselben<br />
Grund sind wohl die früheren Mailänder Prägungen proportional<br />
stärker vertreten als im Schellenberger Fund. Die Angaben zu<br />
diesem Fund verdanke ich Ulrich Klein, Stuttgart.<br />
98) Für die Schweiz aufgearbeitet bei Schärli, Mailändisches Geld,<br />
S. 294, Beilage 1.<br />
Süddeutschland/ Tab. 6: Altersstruktur<br />
des Fundes<br />
Zeitspanne Italien Deutschschweiz Böhmen Tirol Rest Total<br />
1350-1400 190 1 191<br />
1400-1423 4 48 5 5 62<br />
1423-1450 12 161 72 8 2 255<br />
nach 1450 2 1 97 1 101<br />
unbestimmt 2 2<br />
Total 611<br />
61
Um 1423/25 setzte im Bodenseeraum, in der<br />
Schweiz und am Oberrhein, verbunden mit einer<br />
ganzen Reihe von Münzverträgen, eine umfangreiche<br />
Prägetätigkeit ein, die sich deutlich im Fund<br />
niederschlug. Die Zahl der süddeutschen und<br />
deutschschweizerischen Prägungen in der Zeitspanne<br />
von 1423 bis 1450 hat sich im Vergleich zu<br />
den vor 1423 hergestellten Münzen mehr als verdreifacht.<br />
Im Zeitabschnitt zwischen 1423 und 1450 sind<br />
auch jene Prager Groschen mitgezählt, die in Süddeutschland<br />
etwa von 1420 bis 1440 gegengestempelt<br />
wurden. 99<br />
Ihre Anzahl ist zwar nicht einmal<br />
halb so gross wie die der gleichzeitigen süddeutschen<br />
und deutschschweizerischen Gepräge, sie<br />
sind jedoch wertmässig höher zu veranschlagen.<br />
In der letzten Periode (nach 1450) haben die Tiroler<br />
Prägungen die Überhand. Während die früheren<br />
Münzen aus dem Tirol, die Vierer und die<br />
frühen Kreuzer Sigismunds, mengenmässig kaum<br />
eine Rolle spielen, fallen die 97 wohl kurz nach<br />
1460 geprägten Sigismundskreuzer (Variante lc)<br />
umso entscheidender ins Gewicht. Die jüngsten<br />
Münzen im Fund neben diesen Kreuzern sind der<br />
Altenburger Heller (ab 1451), die beiden Venezianer<br />
Grossi respektive Grossetti mit den Münzmeistermonogrammen<br />
von Benedetto Soranzo und Natale<br />
Corner (ab 1452) und der Pfennig Ludwigs von<br />
Pfalz-Zweibrücken (ab 1453?).<br />
Diese letztere Münze gehört zur erwähnten<br />
Gruppe der süddeutschen Pfennige. Die insgesamt<br />
142 dieser häufig schüsseiförmigen Prägungen mit<br />
grobem Perlkreis sind sich trotz ihrer langen Prägedauer<br />
(um 1400 bis nach 1453) von der Machart<br />
her sehr ähnlich. Das Vorkommen eines derartig<br />
grossen, in sich so einheitlichen Ensembles von<br />
Kleinmünzen ist für Schatzfunde dieser Zeit im Bodenseegebiet<br />
einmalig. 100<br />
Es ist daher zu vermuten,<br />
dass diese ganze Gruppe mit einer einzigen Zahlung<br />
wahrscheinlich in der zweiten Hälfte der fünfziger<br />
Jahre in den Fund gekommen ist. 101<br />
Zusammenfassend lässt sich die Entstehungsgeschichte<br />
des Schellenberger Fundes etwa so vorstellen-.<br />
Der älteste Teil des Fundes, bestehend aus<br />
mailändischen Prägungen der zweiten Hälfte des<br />
62<br />
14. Jahrhunderts, wird spätestens in der Zeit um<br />
1435 zusammen gekommen sein. Vor allem in den<br />
zwanziger und dreissiger Jahren des 15. Jahrhunderts<br />
wurde ein weiterer Teil mit vorwiegend aus<br />
dem süddeutschen und dem deutschschweizerischen<br />
Raum stammenden Münzen dem lokalen<br />
Geldumlauf entnommen. Dazu stiessen wohl zur<br />
selben Zeit die Prager Groschen. Nach 1440 kamen<br />
nur noch wenige, vorwiegend italienische Stücke<br />
hinzu. Gegen Ende der fünfziger Jahre gelangte<br />
vermutlich der aus südwestdeutschen Pfennigen<br />
bestehende Anteil in den Fund und zuletzt, wohl<br />
kurz nach 1460, das Ensemble der jüngsten Sigismundskreuzer.<br />
Mit diesen letzten Prägungen war<br />
der Fund abgeschlossen. Die Barschaft wurde<br />
wahrscheinlich bald darauf dem Boden anvertraut.
Der Besitzer und die Umstände<br />
der Vergrabung<br />
Der Fundinhalt, das Fundgefäss und der Fundort<br />
geben gewisse Flinweise auf den ehemaligen Besitzer<br />
des Fundes. Die Zusammensetzung des Schellenberger<br />
Fundes mit seinen Anteilen an italienischen,<br />
böhmischen, tirolischen und süddeutschen<br />
Münzen ist typisch für den südwestdeutschen<br />
Raum. Die eher lokal zirkulierenden Schweizer<br />
Plapparte, das ungewöhnlich frühe Auftreten von<br />
Sigismundskreuzern und besonders die Gegenstempel<br />
von Feldkirch sprechen jedoch dafür, dass<br />
der Fund im Alpenrheintal selbst geäufnet wurde.<br />
Auch das Fundgefäss, das eine für Süddeutschland<br />
und die nördliche Schweiz typische Form aufweist,<br />
spricht für diese These. Der etwas abseits der<br />
Fernhandelsstrasse durch das Alpenrheintal gelegene<br />
Fundort deutet auf einen in dieser Gegend beheimateten<br />
Besitzer hin. Ob das Geld allenfalls den<br />
Bewohnern der «Unteren Burg» gehörte oder ob<br />
der Besitzer unter der ländlichen Bevölkerung zu<br />
suchen ist, muss offen bleiben. 102<br />
Der Beginn der 1460er Jahre war für das Alpenrheintal<br />
eine sehr unruhige Zeit. Nach den Zerstörungen<br />
durch den Toggenburger Erbschaftskrieg<br />
(1436-1450) folgte 1460 bereits das nächste<br />
kriegerische Ereignis. Im September dieses Jahres<br />
eroberten die Eidgenossen den vormals habsburgischen<br />
Thurgau. Gleichzeitig zog eine zweite eidgenössische<br />
Streitmacht entlang des Walensees ins<br />
Alpenrheintal und verheerte die Herrschaften Vaduz<br />
und Schellenberg. 103<br />
Da der Vergrabungszeitpunkt des Schellenberger<br />
Fundes gemäss seiner Zusammensetzung kurz<br />
nach 1460 liegen muss, ist eine direkte Verbindung<br />
zwischen den kriegerischen Ereignissen dieses<br />
Jahres und der Verbergung des Münzschatzes<br />
nicht möglich. Die Angst vor dem Krieg war im Mittelalter<br />
keineswegs der einzige Grund zum Vergraben<br />
von Münzen, wenn auch im vorliegenden Falle<br />
die Furcht vor weiteren kriegerischen Auseinandersetzungen<br />
als Motivation nicht ganz auszuschliessen<br />
ist. Mangels anderer Aufbewahrungsmöglichkeiten<br />
diente der Boden aber auch in Friedenszeiten<br />
als «natürlicher Tresor». 104<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
99) Krusy, S. 25. Zäch, Alpenrheintal, S. 228 (1410/20-1430/40). Die<br />
Prager Groschen wurden in Tabelle 6 sinnvollerweise jener Epoche<br />
zugewiesen, in der die Gegenstempelung erfolgte und nicht der<br />
Epoche ihrer Entstehung.<br />
100) Aus dem Gebiet der oberen Donau ist dagegen der Fund von<br />
Langenau zu erwähnen, der 112 Pfennige aus Mainz und der Pfalz<br />
enthielt. Im Gegensatz zum Schellenberger Fund sind die Prager<br />
Groschen (1 Stück), die mailändischen Münzen (11 Stück) und die<br />
tirolischen Münzen (10 Stück) dagegen im Fund deutlich weniger<br />
stark vertreten (Gesamtzahl: 134 Stück).<br />
101) Auch Zäch vermutet, dass diese Pfennige alle aus einer Zahlung<br />
stammen. Zäch, Alpenrheintal, S. 228.<br />
102) Unter den im 15. Jahrhundert vergrabenen Schatzfunden in<br />
Südwestdeutschland stammt der grösste Anteil aus dem ländlichen<br />
Bereich (80,5 %). Nau, Münzumlauf, S. 117.<br />
103) Bilgeri, Benedikt: Politik, Wirtschaft, Verfassung der Stadt<br />
Feldkirch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts. In: Geschichte der<br />
Stadt Feldkirch. Bd. 1. Sigmaringen, 1987, S. 75-387. S. 197. Zur<br />
Eroberung des Thurgaus vgl. Schaufelberger, Walter: Spätmittelalter.<br />
In: Handbuch der Schweizer Geschichte. Bd. 1. Zürich, 1980,<br />
S. 239-388, hierS. 310-312.<br />
104) Nau. Münzumlauf, S. 107.<br />
63
Der Fund als Quelle zum<br />
Geldumlauf<br />
Der Schatzfund von Schellenberg ermöglicht dank<br />
seiner vielfältigen Zusammensetzung einen profunden<br />
Einblick in die Währungsverhältnisse im Alpenrheintal<br />
während des 15. Jahrhunderts. Bezüglich<br />
des lokalen Geldumlaufs war dieses Gebiet wie<br />
schon im vorhergehenden Jahrhundert ganz auf<br />
den Bodenseeraum ausgerichtet. Im Schellenberger<br />
Fund besteht dieser lokale Anteil vorwiegend<br />
aus Riedlinger Prägungen.<br />
Ausserhalb des Alpenrheintales wird die Bedeutung<br />
dieser Vertragsmünzen eher gering eingeschätzt.<br />
Nach den Untersuchungen von Schüttenhelm<br />
beträgt ihr Anteil inklusive Ravensburg am<br />
südwestdeutschen Geldumlauf zwischen 1423 und<br />
1475 nur 0,6 Prozent. 105<br />
Im eigentlichen Konventionsgebiet<br />
wird dieser Anteil etwas höher zu veranschlagen<br />
sein. In der Forschung zuwenig berücksichtigt<br />
sind allerdings die Siedlungs- und Einzelfunde,<br />
die Schüttenheims allein auf Schatzfunden<br />
beruhendes Bild korrigieren könnten. Offenbar<br />
spielen besonders die Pfennige des Bundes im süd-<br />
Abb. 14: Schatzfunde des<br />
15. Jahrhunderts mit<br />
Prager Groschen, Mailänder<br />
Groschen und Tiroler<br />
Kreuzern<br />
• Prager Groschen<br />
A Mailänder Groschen<br />
• Tiroler Kreuzer<br />
64<br />
1 Schellenberg; 2 «Vorarlberg»;<br />
3 Liebenau; 4 Beuren;<br />
5 Konstanz; 6 Elgg;<br />
7 Zürich, Altstetten; 8 Küttigen;<br />
9 Niedergösgen;<br />
10 Trimbach; 11 Rickenbach;<br />
12 Basel; 13 Allschwil;<br />
14 Kadelburg; 15 Osterfingen;<br />
16 Neunkirch;<br />
17 Blumberg; 18 Immendingen;<br />
19 Nusplingen;<br />
20 Sulz; 21 Tübingen;<br />
22 Steingebronn; 23 Sontheim;<br />
24 Aufhofen; 25 Dietenheim;<br />
26 Wiblingen;<br />
27 Mönstetten; 28 Günzburg;<br />
29 Langenau; 30 Winterbach;<br />
31 Welzheim;<br />
32 Baden-Baden; 33 Oberbühlertal;<br />
34 Mundingen;<br />
35 Vogelbach; 36 Kandern<br />
deutschen Raum eine wichtigere Rolle, als dies die<br />
Schatzfunde vermuten lassen. 106<br />
Im Vergleich mit anderen Funden zeigt sich,<br />
dass der Schellenberger Fund mit seinen 113 Münzen<br />
aus dem Umkreis des Riedlinger Bundes (inkl.<br />
Ravensburg und Überlingen) der mit Abstand bedeutendste<br />
Fund dieser Prägungen überhaupt ist.<br />
In keinem anderen Schatzfund waren diese Münzen<br />
auch nur annähernd so zahlreich und vollständig<br />
vertreten. 107<br />
Dies ist insofern überraschend, als<br />
der Fund von Schellenberg der südlichste Schatzfund<br />
des 15. Jahrhunderts mit Prägungen des Bodenseeraumes<br />
ist. Die weiter südlich in Graubünden<br />
gelegenen Schatzfunde enthalten in der Regel<br />
keine entsprechenden Münzen. 108<br />
Das an den Bodenseeraum angrenzende Währungsgebiet<br />
der Deutschschweiz ist mit 37 Stücken<br />
im Fund vertreten. Die Schweizer Münzen spielten<br />
im Alpenrheintal keine so bedeutende Rolle, wie<br />
dies der Schatzfund von Osterfingen im Kanton<br />
Schaffhausen für die Nordostschweiz bezeugt. 109
Der relativ geringe Einfluss aus dem westlich angrenzenden<br />
Währungsgebiet ist auch aus dem vollständigen<br />
Fehlen der St. Galler Münzen im Schellenberger<br />
Fund erkennbar.<br />
Das Verbreitungsgebiet der ober- und mittelrheinischen<br />
Pfennige liegt schwerpunktmässig am<br />
Rhein. Vereinzelt sind sie auch im schwäbischen<br />
Raum anzutreffen, sowohl in Einzel- als auch in<br />
Schatzfunden. 110<br />
Aus dem Alpenrheintal sind Einzelfunde<br />
ober- und mittelrheinischer Pfennige bekannt.<br />
111<br />
Dennoch ist die grosse Anzahl dieser<br />
Münzen (59 Stück) im Schellenberger Fund aussergewöhnlich<br />
und wohl nur durch die Entstehungsgeschichte<br />
des Fundes zu erklären. Diese Münzen<br />
haben im Alpenrheintal kaum eine so prominente<br />
Rolle gespielt, wie aufgrund des Schellenberger<br />
Fundes vermutet werden könnte.<br />
Den entscheidenden Anteil am Geldumlauf im<br />
Alpenrheintal wie auch im südwestdeutschen und<br />
im deutschschweizerischen Raum machten im<br />
15. Jahrhundert fremde Münzen aus (Abb. 14). 112<br />
Aus Nordosten strömten seit dem frühen 15. Jahrhundert<br />
die Prager Groschen in den südwestdeutschen<br />
Raum. Von den 28 in der Karte erfassten<br />
Funden des 15. Jahrhunderts enthielten zwölf Prager<br />
Groschen. Der grösste Teil liegt in der östlichen<br />
Hälfte des untersuchten Gebietes. Einen deutlichen<br />
Schwerpunkt bildet der Bereich des oberen Do<br />
los) Schüttenhelm. S. 193.<br />
106) Die Riedlinger Pfennige und Heller und sogar ein Schilling sind<br />
in nicht unbedeutender Zahl unter den Fundmünzen der Stadtkirche<br />
St. Dionysius in Esslingen vertreten. Nau, Elisabeth: Die Münzen. In:<br />
Fehring, G. P: Scholkmann, B.: Die Stadtkirche St. Dionysius in<br />
Esslingen a. N. Archäologie und Baugeschichte 1. Die archäologische<br />
Untersuchung und ihre Ergebnisse. Stuttgart. 1995. (Forschungen<br />
und Berichte der Archäologie des Mittelalters in Baden-Württemberg<br />
13/1). S. 269-298, hier S. 292. Pfennige sind abgesehen vom<br />
Schellenberger Fund auch in Einzelfünden des Alpenrheintals<br />
nachgewiesen. Zäch, Alpenrheintal, S. 229. Anm. 146.<br />
107) Schatzfünde mit Prägungen aus dem Umkreis des Riedlinger<br />
Bundes:<br />
Aufhofen, Lkr. Biberach, 1962 (nach 1436): 1 Ravensburger Schilling<br />
(Krusy, Aufhofen (wie Anm. 91); Nau, Münzumlauf, S. 151, Nr. 90);<br />
Baden-Baden. Stkr. Baden-Baden, 1887 (nach 1470): 2 Pfennige und<br />
2 Schillinge von Ravensburg, 4 Überlinger Pfennige (Joseph, Paul:<br />
Ein badischer Münzfund. In: Berliner Münzblätter 9 (1888),<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Sp. 841-846 und 861-862; Schüttenhelm, S. 220; Nau, Münzumlauf,<br />
S. 153, Nr. 112);<br />
Benningen, Lkr. Ludwigsburg, 1912 (nach 1478): 2 Ulmer Heller,<br />
1 Konstanzer Pfennig (Goessler, [Peter]: Neue Münzfunde aus<br />
Württemberg (1912-1918). In: WVI.g NF 28 (1919), S. 24-31, hier<br />
S. 25; Nau, Münzumlauf, S. 147, Nr. 44);<br />
Beuren, Lkr. Überlingen, 1851 (nach 1436): 1 Ravensburger Schilling<br />
(Schüttenhelm, S. 220; Nau. Münzumlauf, S. 152, Nr. 96);<br />
Bopfingen, Lkr. Aalen, 1928 (nach 1441): 1 Konstanzer Schilling,<br />
1 Württemberger Pfennig (Fundakten WLM; Schüttenhelm. S. 216;<br />
Nau, Münzumlauf, S. 148, Nr. 57);<br />
Kusterdingen, Lkr. Tübingen, 1864 (nach 1423): 3 Konstanzer<br />
Pfennige, je 1 Pfennig aus Ulm und Württemberg, 1 Ulmer Schilling<br />
(Fundakten WLM, Schüttenhelm, S. 216; Nau, Münzumlauf, S. 150,<br />
Nr. 77).<br />
Memprechtshofen, Lkr. Kehl, 1853 (nach 1478): 1 Ravensburger<br />
Schilling (Schüttenhelm, S. 220; Nau, Münzumlauf, S. 153, Nr. 110);<br />
Neuburg a. d. Kammel, Lkr. Krumbach, 1909 (um 1490): 1 Ravensburger<br />
Schilling (Buchenau, Heinrich: Fund von Neuburg an der<br />
Kammel. In: MBNG 28 (1910), S. 132-134; Nau, Münzumlauf.<br />
S. 145, Nr. 24);<br />
Nusplingen, Lkr. Balingen. 1965 (nach 1433): 1 Ulmer Schilling,<br />
1 Württemberger Schilling (Fundakten WLM, Schüttenhelm, S. 221<br />
und 225; Nau, Münzumlauf, S. 151, Nr. 87);<br />
Osterfingen SH, 1897 (um 1435/40): 1 Württemberger Pfennig<br />
(Henking (wie Anm. 97); Nau, Münzumlauf, S. 152, Nr. 100);<br />
Sontheim, Lkr. Münsingen, 1877 (nach 1472): Ulm, Schilling, nicht<br />
bestimmbar ob Nau, Oberschwaben, S. 68, Nr. 5 oder 7 (Fundakten<br />
WLM; Nau, Münzumlauf, S. 149. Nr. 67);<br />
Welzheim, Lkr. Waiblingen, 1822 (nach 1469): Konstanz, Schillinge<br />
(Fundakten WLM; Nau, Münzumlauf, S. 147, Nr. 47).<br />
108) Zum Geldumlauf im mittelalterlichen Graubünden vgl. zuletzt<br />
Diaz Tabernero, S. 42-59.<br />
109) Unter den 110 grösseren Silbermünzen des Schatzfundes von<br />
Osterfingen befinden sich 21 Schweizer Plapparte. Von den 946<br />
einseitigen Pfennigen des Fundes stammen 796 aus der Schweiz.<br />
Henking (wie Anm. 97), S. 309-311.<br />
110) Schüttenhelm, S. 207 (für Baden), S. 306 (für Strassburg).<br />
S. 327 (für Mainz), S. 330-331 (für Kurpfalz). Vgl. auch Esslingen.<br />
Stadtkirche St. Dionysius (Nau, Esslingen (wie Anm. 106),<br />
S. 291-292). Zum Schatzfund von Langenau s. oben, Anm. 100.<br />
111) Zäch. Alpenrheintal, S. 228.<br />
112) Abb. 14 nach Vorlage von Nau, Münzumlauf, Karte III: Aufhofen,<br />
Nr. 90; Baden-Baden, Nr. 112; Basel, Nr. 137; Beuren, Nr. 96;<br />
Blumberg, Nr. 99; Dietenheim, Nr. 91; Günzburg, Nr. 22; Immendingen,<br />
Nr. 98; Kadelburg, Nr. 101; Kandern, Nr. 104; Nusplingen,<br />
Nr. 87; Langenau, Nr. 63; Liebenau, Nr. 93; Mönstetten. Nr. 23;<br />
Mundingen, Nr. 107; Oberbühlertal, Nr. 111; Osterfingen, Nr. 100;<br />
Schellenberg, Nr. 142; Sontheim. Nr. 67; Steingebronn, Nr. 69;<br />
Tübingen, Nr. 74; Vogelbach, Nr. 105; Welzheim, Nr. 47; Wiblingen.<br />
Nr. 66; Winterbach, Nr. 46. Nachträge nach Klein, Karte 3: Konstanz,<br />
Nr. 38; Sulz, Nr. 20; «Vorarlberg», Nr. 42. Nachträge nach<br />
Schärli, Mailändisches Geld: Allschwil, Nr. 38; Neunkirch, Nr. 48;<br />
Elgg, Nr. 33; Niedergösgen, Nr. 35: Rickenbach, Nr. 28; Trimbach,<br />
Nr. 34; Zürich, Altstetten. Nr. 32. Küttigen: Schärli, Aargau (wie<br />
Anm. 88).<br />
65
nautales. Gegen Südwesten dünnen die Funde<br />
merklich aus. Die westlichsten Ausläufer bilden die<br />
Funde Vogelbach und Osterfingen. Aus dem Bodenseegebiet<br />
im engeren Sinne sind nur die Funde von<br />
Beuren und Schellenberg zu nennen. Diese Fundarmut<br />
um den Bodensee steht in eigentümlichem<br />
Widerspruch zur Vielzahl der in diesem Raum gegenstempelriden<br />
Städte.<br />
Von allen in der Karte festgehaltenen Funden ist<br />
der Schellenberger der südlichste mit Prager Groschen.<br />
Dieser Fund, ein Einzelfund aus Vaduz mit<br />
Feldkirch als gegenstempelnder Stadt stellen die<br />
südlichsten numismatischen Belege für die Verbreitung<br />
von Prager Groschen überhaupt dar. 113<br />
Der Höhepunkt in der Verbreitung des Prager<br />
Groschens in Südwestdeutschland fällt zeitlich zusammen<br />
mit der Zeitspanne der Gegenstempelung<br />
(zirka 1420 bis 1440). Ab der Jahrhundertmitte<br />
geht ihr Anteil am Geldumlauf in Südwestdeutschland<br />
stark zurück und sinkt im Laufe des 16. Jahrhunderts<br />
zur völligen Bedeutungslosigkeit ab. 114<br />
Von den zwölf kartierten Funden mit Prager Groschen<br />
wurden nur noch vier in der zweiten Hälfte<br />
des 15. Jahrhunderts vergraben (Schellenberg,<br />
Sontheim, Vogelbach, Langenau). Der kurz nach<br />
1460 abgeschlossene Schellenberger Fund kam somit<br />
zu einem Zeitpunkt in die Erde, als die Prager<br />
Groschen ihren Höhepunkt im Geldumlauf schon<br />
hinter sich hatten.<br />
Seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts<br />
tauchen im Alpenrheintal und in der Schweiz grössere<br />
italienische Silbermünzen auf. Seit dem Ende<br />
des 14. Jahrhunderts kommen solche auch in süddeutschen<br />
Schatzfunden vor. 115<br />
Im untersuchten<br />
Gebiet liegt der Höhepunkt dieser fast ausschliesslich<br />
aus mailändischen Münzstätten stammenden<br />
Prägungen in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts.<br />
In Süddeutschland fällt er zeitlich mit demjenigen<br />
der Verbreitung der Prager Groschen zusammen.<br />
Zehn der zwölf in Abbildung 14 verzeichneten<br />
Funde mit Prager Groschen enthalten auch<br />
mailändische Münzen. In der Schweiz tritt diese<br />
Kombination nur beim Schatzfund von Osterfingen<br />
auf. Für das Gebiet südlich des Bodensees ist der<br />
Schellenberger Fund das einzige Beispiel.<br />
66<br />
In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts ging<br />
die Menge der italienischen Prägungen in Süddeutschland<br />
und in der Deutschschweiz wieder<br />
zurück. 116<br />
Im 16. Jahrhundert waren noch einzelne<br />
stark abgegriffene Stücke als Relikte einer vergangenen<br />
Zeit im Umlauf, die ab der Mitte des<br />
16. Jahrhunderts vollends verschwanden. 117<br />
Der<br />
Schellenberger Fund wurde somit zu einem Zeitpunkt<br />
verborgen, als nicht nur die Prager Groschen,<br />
sondern auch die Mailänder Münzen ihren<br />
Zenit bereits überschritten hatten.<br />
Tiroler Kreuzer erschienen seit der zweiten<br />
Hälfte des 14. Jahrhunderts in Funden nördlich der<br />
Alpen. Im Alpenrheintal sind diese Münzen durch<br />
den Fund von Vaduz (vergraben um 1360/65) bereits<br />
zu einem sehr frühen Zeitpunkt belegt, was<br />
wohl mit der verkehrstechnischen Bedeutung des<br />
Tales erklärt werden kann. 118<br />
Ein entscheidender<br />
Faktor für den Geldumlauf wurden die Kreuzer<br />
nördlich der Alpen aber erst in der zweiten Hälfte<br />
des 15. Jahrhunderts. Wahrscheinlich im Jahr<br />
1460 setzte unter Sigismund in der Münzstätte Meran<br />
eine «engagierte» Kreuzerprägung ein. In<br />
Österreich tauchten die ersten Sigismundskreuzer<br />
um 1460 in Schatzfunden auf, liy<br />
in Südwestdeutschland<br />
um 1460/70. 120<br />
Im letzten Viertel des<br />
15. Jahrhunderts und zu Beginn des 16. Jahrhunderts<br />
flössen die Kreuzer dann in grossen Mengen<br />
nach Süddeutschland. 121<br />
Der Schellenberger Fund ist einer der frühesten<br />
Funde mit Sigismundskreuzern im untersuchten<br />
Raum. 122<br />
Ähnlich wie hundert Jahre früher beim<br />
Fund von Vaduz war wohl die Lage des Fundortes<br />
an den Zufahrtsstrassen zu den Alpenpässen für<br />
das frühe Vorkommen verantwortlich.<br />
Das Alpenrheintal lag somit im Einflussbereich<br />
verschiedener ausländischer Münzsorten. Die grösste<br />
Bedeutung hatten hier die aus Süden einströmenden<br />
italienischen Münzen. Aber auch der Einfluss<br />
der Prager Groschen reichte von Nordosten<br />
her bis ins Alpenrheintal. Die dritte wichtige Münzsorte,<br />
die Tiroler Kreuzer, standen zum Zeitpunkt<br />
der Vergrabung des Fundes in einer Phase der Expansion,<br />
weshalb sie sich relativ früh, aber noch<br />
nicht in grosser Menge im Fund niederschlugen.
Der Schellenberger Fund ist nicht nur für das Alpenrheintal,<br />
sondern darüber hinaus ein wichtiges<br />
Zeugnis für das spätmittelalterliche Währungsgeflecht<br />
aus einer lokalen Unterwährung und einer<br />
aus überregional zirkulierenden Münzen bestehenden<br />
Oberwährung. 123<br />
Dies lässt sich im Vergleich<br />
mit dem sehr ähnlich zusammengesetzten Fund<br />
von Osterfingen (Kt. Schaffhausen) aufzeigen. Dieser<br />
um 1435/1440 vergrabene Fund enthielt 1 056<br />
Münzen, zum grössten Teil einseitige Prägungen<br />
aus der Deutschschweiz und Süddeutschland, daneben<br />
Goldgulden, Mailänder, Prager und Metzer<br />
Groschen, Schweizer Plapparte und Tiroler Kreuzer.<br />
Die beiden Schatzfunde sind sich in ihrer Zusammensetzung<br />
verblüffend ähnlich (Tab. 7). Gemeinsam<br />
ist ihnen der kleine Anteil an Goldmünzen.<br />
Das Verhältnis der Mailänder Prägungen zu<br />
den Prager Groschen ist in beiden Funden ungefähr<br />
drei zu eins, auch die Schweizer Plapparte<br />
machen etwa den gleichen Anteil unter den grösseren<br />
Silbermünzen aus. Deutlich höher ist im Osterfinger<br />
Fund der Anteil der Metzer Groschen, was<br />
mit dem weiter westlich gelegenen Fundort erklärt<br />
werden kann. Die viel grössere Anzahl der Kreuzer<br />
im Schellenberger Fund ist auf den späteren Ver-<br />
Osterfingen Schellenberg<br />
(um 1435/40) (kurz nach 1460)<br />
Goldgulden 2 1<br />
Mailänder Münzen 54 199<br />
Prager Groschen 18 72<br />
Schweizer<br />
Plapparte 10 31<br />
Metzer Groschen 9 4<br />
Süddeutsche<br />
Schillinge 0 28<br />
Kreuzer 4 104<br />
Kleinmünzen 946 160<br />
andere 13 12<br />
Total 1056 611<br />
Tab. 7: Vergleich der<br />
Funde von Osterfingen<br />
und Schellenberg<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
grabungszeitpunkt zurückzuführen. Der grösste<br />
Unterschied zwischen den beiden Funden ist bei<br />
den Pfennigen festzustellen. In Osterfingen dominieren<br />
die einheimischen deutschschweizerischen<br />
113) Einzelfund: Vaduz, Wildschloss/Schalun, Archäologische<br />
Untersuchung 1982 bis 1985: Prager Groschen mit Gegenstempel<br />
von Augsburg, Staubing und einer unbekannten Stadt. Zäch, Alpenrheintal,<br />
S. 236, Nr. 27. Die Erwähnungen von Prager Groschen in<br />
schriftlichen Quellen sind nicht aufgearbeitet und können daher für<br />
diese Fragestellung nicht berücksichtigt werden.<br />
114) Schüttenhelm, S. 393-394.<br />
115) Für die Schweiz: Zäch, Fremde Münzen, S. 421, für Südwestdeutschland:<br />
Klein, S. 292.<br />
116) In die Westschweiz scheinen die Mailänder Münzen mit einiger<br />
zeitlicher Verzögerung gelangt zu sein. Zäch, Fremde Münzen,<br />
S. 421.<br />
117) Klein, S. 294.<br />
118) Angedeutet bei Zäch, Vaduz, S. 19.<br />
119) Alram u. a., S. 129.<br />
120) Funde mit Sigismundskreuzern um 1460/70:<br />
Baden-Baden, Stkr. Baden-Baden, 1887 (um 1470): 22 Sigismundskreuzer<br />
(Joseph (wie Anm. 107); Schüttenhelm, S. 281, Nau, Münzumlauf,<br />
S. 153, Nr. 112);<br />
Kadelburg, Lkr. Waldshut, 1921 (nach 1472): Tiroler Kreuzer: unklar<br />
ob von Sigismund (Nau, Münzumlauf, S. 152, Nr. 101);<br />
Kandern, Lkr. Müllheim, 1903 (nach 1472): 1 Sigismundskreuzer<br />
(Fundakten BLM; Nau, Münzumlauf, S. 152, Nr. 104);<br />
Langenau, Stkr. Ulm, 1945 (nach 1460): 10 Sigismundskreuzer<br />
(Fundakten WLM, Nau, Münzumlauf, S. 149. Nr. 63);<br />
Sontheim, Lkr. Münsingen, 1877 (nach 1472): Sigismundskreuzer,<br />
Anzahl unbekannt (Fundakten WLM; Nau, Münzumlauf, S. 149,<br />
Nr. 67);<br />
121) Schüttenhelm, S. 281-282. Schatzfunde mit hohem Anteil an<br />
Sigismundskreuzern:<br />
Neuburg an der Kammel, Lkr. Krumbach, 1909 (um 1490): 254<br />
Sigismundskreuzer von insgesamt zirka 300 Münzen (Buchenau,<br />
Neuburg (wie Anm. 107); Nau, Münzumlauf, S. 145, Nr. 24);<br />
Vogelbach, Lkr. Müllheim, 1922 (um 1500): zirka 300 Kreuzer:<br />
wahrscheinlich von Sigismund? (Badische Heimat 1949, S. 52;<br />
Schüttenhelm, S. 282; Nau, Münzumlauf, S. 152, Nr. 105).<br />
122) Etwa zeitgleich ist der Fund von Langenau anzusetzen, der eine<br />
ähnliche Zusammensetzung wie der Schellenberger Fund aufweist<br />
(Prager Groschen, Mailänder Münzen, Pfennige aus Mainz und<br />
Pfalz). Die Schlussmünzen bilden fünf Exemplare der Sigismundskreuzer<br />
der Variante lc des vorliegenden Katalogs, welche auch in<br />
Schellenberg die jüngsten Münzen des Fundes bilden. Die Datierung<br />
bei Nau, Münzumlauf, S. 149, Nr. 63 (nach 1439), ist dagegen zu<br />
früh angesetzt.<br />
123) Geiger, Hans-Ulrich: Quervergleiche. Zur Typologie spätmittelalterlicher<br />
Pfennige. In: ZAK 48, 1991, S. 108-123, hier S. 108.<br />
67
Prägungen mit Schwerpunkt Zürch und Schaffnausen,<br />
während die Riedlinger Prägungen mit einer<br />
Ausnahme fehlen. In Schellenberg überwiegen dagegen<br />
diese Konventionspfennige und die mit ihnen<br />
verwandten ober- und mittelrheinischen Pfennige.<br />
In den kleinen Nominalen zeigt sich somit am<br />
deutlichsten die Regionalität der beiden Funde,<br />
während die grösseren, überregional zirkulierenden<br />
Nominale in beiden Funden praktisch identisch<br />
sind.<br />
68<br />
Schlussbetrachtung<br />
Der 1930/31 im Schellenberger Wald in der Gemeinde<br />
Ruggell aufgefundene Münzschatz ist für<br />
die Erforschung der Währungsverhältnisse im Alpenrheintal<br />
zur Zeit des Spätmittelalters von entscheidender<br />
Bedeutung. Wie schon im 14. Jahrhundert<br />
richtete sich dieses Gebiet auch während<br />
des 15. Jahrhunderts währungspolitisch nach dem<br />
Bodenseegebiet aus. Die Bedeutung dieser lokalen<br />
Ausrichtung zeigt sich im verhältnismässig grossen<br />
Anteil von Riedlinger Prägungen im Schellenberger<br />
Fund. Das angrenzende Währungsgebiet der Nordostschweiz<br />
war dagegen von deutlich geringerer<br />
Bedeutung. Die zahlreichen Pfennige des Fundes<br />
aus dem Ober- und Mittelrheingebiet sind wohl auf<br />
eine einzelne Zahlung zurückzuführen. Im Alpenrheintal<br />
werden sie kaum einen so grossen Stellenwert<br />
eingenommen haben, wie die Zusammensetzung<br />
des Fundes vermuten lässt.<br />
Anzahlmässig wie auch wertmässig machen die<br />
lokalen Prägungen aber nur einen relativ bescheidenen<br />
Anteil am Geldumlauf aus. Die wirtschaftlich<br />
bedeutenden Münzen dieser Zeit waren fremde<br />
Münzen. Das Alpenrheintal lag in einem Gebiet, wo<br />
sich die Einflüsse überregionaler Zahlungsmittel<br />
aus dem Süden (Italien), dem Nordosten (Böhmen)<br />
und dem Südosten (Tirol) überschnitten. Wie auch<br />
im benachbarten schweizerischen Raum waren im<br />
Alpenrheintal die italienischen Münzen die wichtigste<br />
fremde Währung. Für die aus Nordosten einströmenden<br />
Prager Groschen stellt der Schellenberger<br />
Fund den südlichsten Fundpunkt dar. Die<br />
Tiroler Kreuzer im Vaduzer wie im Schellenberger<br />
Fund sind Belege dafür, dass neue Münzsorten<br />
dank den hier vorbeiführenden Handelsströmen<br />
bereits sehr früh im Alpenrheintal Eingang fanden.<br />
Bezüglich seiner Zusammensetzung ist der<br />
Schellenberger Fund ein ausgesprochener Mischfund.<br />
Dies trifft nicht nur für die Herkunft der Münzen<br />
zu, sondern auch für die Nominal- und die Altersstruktur.<br />
Von der Goldmünze bis zum Heller<br />
sind alle spätmittelalterlichen Währungsstufen im<br />
Fund vertreten. Das ersparte Vermögen stellt einen<br />
beachtlichen Betrag dar. Der Wert des Fundes ist<br />
im Vergleich mit anderen Schatzfunden überdurchschnittlich<br />
gross. Das Vermögen wurde mindestens
während eines Vierteljahrhunderts zusammengespart.<br />
Kurz nach 1460 kamen zum Schluss 97 beinahe<br />
prägefrische Sigismundskreuzer hinzu. Wohl<br />
bald darauf wurden die Münzen vergraben. Der<br />
Fundort, das Fundgefäss und die Fundzusammensetzung<br />
lassen darauf schliessen, dass der ehemalige<br />
Besitzer aus dem Alpenrheintal selbst stammte.<br />
Ob der Topfallenfalls einem Bewohner der nahegelegen<br />
«Unteren Burg» oder einem Angehörigen der<br />
ländlichen Bevölkerung gehörte, lässt sich nicht<br />
entscheiden. Der Zeitpunkt der Verbergung kann<br />
nicht mit dem Zug der Eidgenossen ins Alpenrheintal<br />
von 1460 in Verbindung gebracht werden, da<br />
der Fund erst kurz nach diesem Zeitpunkt vergraben<br />
wurde.<br />
Aufgrund seiner Bedeutung bietet der Schellenberger<br />
Fund vielfältige Anregungen für zukünftige<br />
Untersuchungen. Dies gilt nicht nur für Arbeiten<br />
über die Währungsverhältnisse im Alpenrheintal<br />
selbst. In diesem Rahmen wurde er bereits gebührend<br />
gewürdigt. Auch für entsprechende Untersuchungen<br />
in den angrenzenden Gebieten der<br />
Schweiz und Südwestdeutschlands muss der Fund<br />
als wichtiger Eckstein in währungsgeschichtliche<br />
Überlegungen einbezogen werden. Wer sich in Zukunft<br />
mit typologischen Fragen bezüglich der Riedlinger<br />
Prägungen, mit Gegenstempeln auf Prager<br />
Groschen oder mit der Chronologie der Sigismundskreuzer<br />
beschäftigen will, wird an diesem<br />
wichtigen Schlüsselfund ebenfalls nicht vorbeikommen.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Vorbemerkung zum Katalog<br />
Der Katalog wurde nach den Richtlinien des Inventars<br />
der Fundmünzen der Schweiz angelegt, 124<br />
wobei<br />
folgende Elemente aufgenommen wurden: Katalognummer,<br />
Gewicht; max./min. Durchmesser,<br />
Stempelstellung, Metall, Abgegriffenheit, Korrosion,<br />
125<br />
Bemerkungen und Inventarnummer AFL.<br />
Die Anordnung der Münzen im Katalog erfolgt<br />
nach währungsgeschichtlichen Räumen. Innerhalb<br />
dieser Räume wurden die einzelnen Münzherrschaften<br />
in einer geographisch sinnvollen Reihenfolge<br />
aufgeführt. Die Typen innerhalb einer Münzherrschaft<br />
wurden chronologisch oder nach Nominal<br />
(von gross nach klein) angeordnet. Innerhalb<br />
eines Typs wurden aufgrund von unterschiedlichen<br />
Beizeichen oder Verzierungen verschiedene Varianten<br />
definiert (z. B. Variante 1). Für zusätzliche<br />
Abweichungen in den Legenden wurden zusätzlich<br />
Untervarianten eingeführt (z.B. Variante la). Innerhalb<br />
derselben Variante erfolgt die Reihenfolge<br />
absteigend nach Gewicht. Eine Ausnahme bilden<br />
die Prager Groschen, die zuerst nach der Anzahl<br />
der Gegenstempel und sodann alphabetisch nach<br />
den gegenstempelnden Städten geordnet wurden.<br />
Die Legenden werden stets für eine ganze Gruppe<br />
von Münzen angegeben. Konnte bei einer Münze<br />
ein Teil der Legende nicht gelesen werden, wurden<br />
die entsprechenden Wörter (nicht die ganze<br />
Legende!) mit den durch eckige Klammern gekennzeichneten<br />
Fehlstellen unter der Rubrik «Bemerkungen»<br />
hinzugefügt. Die Bezeichnung «Typ» bei<br />
den Referenzzitaten bedeutet, das für die jeweilige<br />
Variante kein genaues Zitat gefunden werden<br />
konnte, das die genaue Schreibweise der Legenden<br />
wiedergibt. Die Münzen, deren Inventarnummer<br />
mit K 0611 beginnen, werden bei der Fachstelle<br />
Archäologie FL aufbewahrt. Die Münzen mit den<br />
mit K 1305 beginnenden Inventarnummern befinden<br />
sich in Privatbesitz.<br />
124) Inventar der Fundmünzen der Schweiz, Bd. 1, Lausanne, 1993,<br />
S. 26-27.<br />
125) Abgegriffenheit und Korrosion: Wert zwischen 1 (nicht abgegriffen/korrodiert)<br />
und 5 (stark abgegriffen/korrodiert). Vgl. Abnutzung<br />
und Korrosion. Bestimmungstafeln zur Bearbeitung von<br />
Fundmünzen. Bulletin IFS 2. 1995, Supplement.<br />
69
Katalog<br />
IM KATALOG VERWEN<br />
DETE ABKÜRZUNGEN<br />
Vs.<br />
Vorderseite<br />
Rs.<br />
Rückseite<br />
AU<br />
Gold<br />
AR<br />
Silber<br />
Bl<br />
Billon<br />
Bz.<br />
Beizeichen<br />
5bl.<br />
fünfblättrig<br />
5z.<br />
fünfzackig<br />
1-1<br />
ungelesener<br />
Buchstabe/Beizeichen<br />
1-1<br />
zwei ungelesene Buchstaben/Beizeichen<br />
1-1<br />
drei oder mehr ungelesene<br />
Buchstaben/Beizeichen<br />
n.l.<br />
nach links<br />
e<br />
einseitig<br />
70<br />
BODENSEERAUM<br />
KONSTANZ, STADT<br />
Schiläng nach dem Vertrag von 1417 (ab 1417),<br />
Münzstätte Konstanz<br />
Vs. + mOnETA ° CIVITATIS ° COnSTAn; Stadtschild in<br />
Sechspass.<br />
Rs. S CVnRAD - E[P]VS 'STAn; Thronender hl. Konrad,<br />
die Rechte segnend erhoben, die Linke hält den Krummstab.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 25, Nr. 11 Typ.<br />
1 1,680 g; 23,5/22,9 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0125.<br />
Schilling nach dem Riedlinger Vertrag von 1423<br />
(ab 1423), Münzstätte Konstanz<br />
Variante la<br />
Vs. • M014ETA: CIVITATIS: COWST' •; Stadtschild, darüber<br />
Adler in unverziertem Vierpass.<br />
Rs. • - S'. CVOHRA - • EPS'. COMST'; Thronender hl. Konrad,<br />
die Rechte segnend erhoben, die Linke hält den<br />
Krummstab.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 26, Nr. 18-20 Typ; Cahn, Konstanz,<br />
S. 436, Nr. 90-91 Typ.<br />
2 1,461 g; 21,5/20,7 mm; 170°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0133.<br />
Variante lb<br />
Vs. : MOMETA. CIVITATIS:COWST':<br />
Rs. S'. CONRADVS - EPS. CONStA<br />
Nau, Oberschwaben, S. 26, Nr. 18-20 Typ.<br />
3 1,208 g; 22,6/21,5 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0134.<br />
Variante 2a<br />
Vs. • MONEtA. CIVItAtlS: 9StANCIENS' ; Stadtschild,<br />
darüber Adler im Vierpass; in dessen oberen Winkeln<br />
Ringel, in den unteren Flüge.<br />
Rs. S'. CONRADV - EPS: CONStA; Thronender hl. Konrad,<br />
die Rechte segnend erhoben, die Linke hält den<br />
Krummstab.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 26, Nr. 18-20 Typ.<br />
4 1,555 g; 22,3/21,3 mm; 60°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0126.<br />
5 1,355 g; 22,5/21,8 mm; 130°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rand leicht ausgebrochen. Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0131.<br />
6 1,340 g; 23,1/21,7 mm; 240°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. MONEltlA;<br />
Rs. [S'L CONRiADV'l; Rs. Doppelschlag. Rand leicht<br />
ausgebrochen. K 1305/0151.
Variante 2b<br />
Vs. • MONEtA: CIVItAtlS: 9StANCIENS'<br />
Rs. S'. CONRADVS - EPS[:] CONStA<br />
Nau, Oberschwaben, S. 26, Nr. 18-20 Typ.<br />
7 1,543 g; 22,2/21,4 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0127.<br />
Variante 2c<br />
Vs. • MONEtA: CIVItAtlS: 9StANCIENS' (wie Var. 2b)<br />
Rs. S'. CONRADV - EPS: CONStA (wie Var. 2a)<br />
Nau, Oberschwaben, S. 26, Nr. 18-20 Typ.<br />
8 1,540 g; 22,3/21,3 mm; 250°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0153.<br />
Variante 2d<br />
Vs. MONEtA: CIVItAtlS: 9StANCIENS'<br />
Rs. S'. CONRADVS - EPS: CONStA<br />
Nau, Oberschwaben, S. 26, Nr. 18-20 Typ.<br />
9 1,450 g; 22,4/21,5 mm; 180°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0128.<br />
Variante 2e<br />
Vs. MONEtA: CIVItAtlS: 9StANCIENS' (wie Var. 2d)<br />
Rs. S'. CONRADV - EPS: CONStA (wie Var. 2a)<br />
Nau, Oberschwaben, S. 26, Nr. 18-20 Typ.<br />
10 1,479 g; 22,5/21,4 mm; 120°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0129.<br />
Variante 2f<br />
Vs. • MONEftA ClIVItAtlS 9StANCIENS'<br />
Rs. S'. CONRADV - [EP]S: CONStA' (wie Var. 2a)<br />
Nau, Oberschwaben, S. 26, Nr. 18-20 Typ.<br />
11 1,387 g; 23,0/21,5 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2. Rand<br />
leicht ausgebrochen. Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 1305/0152.<br />
Variante 2g<br />
Vs. MONETA. CIVITATIS: CONST'<br />
Rs. S': CONRA - EPS: CONST'<br />
Nau, Oberschwaben, S. 26, Nr. 18-20 Typ.<br />
12 1,591 g; 22,0/20,8 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2. Vs.<br />
und Rs. Doppelschlag. Rs. Tiefer Kratzer. K 0611/0130.<br />
Variante 2h<br />
Vs. MONETA • CIVITATIS • CONSTA<br />
Rs. S' (5bl. Rosette) CONRAD' - EPS (5bl. Rosette) CONST'<br />
Nau, Oberschwaben, S. 26, Nr. 18-20 Typ.<br />
13 1,438 g; 21,5/20,5 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0132.<br />
Pfennig nach dem Riedlinger Vertrag von 1423 (ab 1423),<br />
Münzstätte Konstanz<br />
Variante 1<br />
Einfacher Stadtschild ohne Schildhaupt, darüber Stern;<br />
Perl- und Fadenkreis.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 25, Nr. 15 Typ; Cahn, Konstanz-.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
14 0,234 g; 14,4/13,3 mm; e; BI. A 2, K 2. Riss, dezentrierte<br />
Prägung, aufgebogener Rand. K 0611/0137.<br />
Variante 2<br />
Einfacher Stadtschild ohne Schildhaupt, darüber Stern;<br />
nur Perlkreis.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 25, Nr. 15 Typ.<br />
15 0,238 g; 13,8/13,0 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 1305/0155.<br />
16 0,237 g; 13,7/11,9 mm; e; BI. A 3, K 2. Stark<br />
zerkratzt, ausgebrochen. K 0611/0141.<br />
17 0,236 g; 14,3/13,5 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen, dezentrierte Prägung. K 0611/0142.<br />
18 0,234 g; 14,2/13,6 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung, Riss. K 0611/0138.<br />
19 0,228 g; 14,0/12,4 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen, dezentrierte Prägung. K 0611/0139.<br />
20 0,219 g; 14,1/13,1 mm; e; BI. A 2, K 2. Falz.<br />
K 0611/0140.<br />
21 0,216 g; 13,6/12,8 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung. K 0611/0135.<br />
22 0,200 g; 14,1/13,7 mm; e; BI. A 2, K 2. Riss, leicht<br />
ausgebrochen. K 0611/0136.<br />
23 0,188 g; 14,5/12,0 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand zu ca.<br />
Vi abgebrochen. K 1305/0154.<br />
24 (0,309 g); 14,6/12,5 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen. Auf Objektträger montiert. K 0611/0427.<br />
ÜBERLINGEN, STADT<br />
Schilling (ab 1436), Münzstätte Überlingen<br />
Variante 1<br />
Vs. + MOnEtA + VBERLInGEnSIS; Schreitender gekrönter<br />
Löwe n.l. in unverziertem Achtpass, ohne Flüge.<br />
Rs. + + In + DEI + nOmlnE x AmEn +; Einköpfiger Adler<br />
n.l. in Achtpass.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 49, Nr. 9 Typ; Lebek, S. 46,<br />
Nr. 17 Typ.<br />
25 1,550 g; 23,3/22,8 mm; 140°; AR. A 3/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0090.<br />
Variante 2<br />
Vs. + MOnEtA x V-BERLInGEnSIS; Schreitender<br />
gekrönter Löwe n.l. in verziertem Achtpass, in den<br />
äusseren Winkeln Flüge.<br />
Rs. + + In + EEI + nOmlnE + AmEn +; Einköpfiger Adler<br />
n.l. in Achtpass.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 49, Nr. 9 Typ; Lebek, S. 46,<br />
Nr. 1 7 Typ.<br />
26 1,550 g; 23,6/22,5 mm; 240°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0089.<br />
71
Pfennig (ab 1436), Münzstätte Überlingen<br />
Schreitender gekrönter Löwe n.l. in Perlkreis.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 49, Nr. 13; Lebek, S. 46, Nr. 19.<br />
27 0,262 g; 13,6/12,5 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 1305/0156.<br />
28 0,228 g; 14,9/12,6 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige, dezentrierte Prägung, ovaler Schröding,<br />
zwei Einhiebe. K 0611/0149.<br />
29 0,217 g; 13,1/12,5 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 0611/0148.<br />
30 0,207 g; 13,7/13,1 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand leicht<br />
aufgebogen. K 0611/0143.<br />
31 0,203 g; 14,2/12,8 mm; e; BI. A 2, K 2. Ovaler<br />
Schröding, dezentrierte Prägung. K 0611/0151.<br />
32 0,195 g; 14,0/12,3 mm; e; BI. A 2, K 2. Dezentrierte<br />
Prägung. K 1305/0157.<br />
33 0,193 g; 13,5/12,8 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand leicht<br />
aufgebogen. K 0611/0147.<br />
34 0,193 g; 15,1/13,2 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 0611/0152.<br />
35 0,189 g; 13,8/12,6 mm; e; BI. A 2, K 2. Leicht<br />
ausgebrochen, Risse. K 0611/0146.<br />
36 0,188 g; 14,5/13,5 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 0611/0145.<br />
37 0,185 g; 14,8/13,6 mm; e; BI. A 2, K 2. Einstich,<br />
dezentrierte Prägung. K 0611/0144.<br />
38 0,181 g; 12,7/11,4 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand leicht<br />
ausgebrochen. K 0611/0150.<br />
39 0,158 g; 13,1/12,0 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 0611/0155.<br />
40 0,157 g; 14,0/12,5 mm; e; BI. A 2, K 2. Vs des<br />
Randes abgebrochen. K 0611/0153.<br />
41 0,143 g; 14,1/11,4 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen. K 0611/0154.<br />
42 0,128 g; 13,5/10,0 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment,<br />
ca. V? der Münze erhalten. Dezentrierte Prägung.<br />
K1305/0109.<br />
43 (0,316 g); 13,9/13,7 mm; e; BI. A 2, K 2. Leicht<br />
ausgebrochen, Falze. Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0461.<br />
44 (0,280 g); 14,7/12,5 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen, Falze. Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0426.<br />
45 (0,268 g); 13,5/10,4 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand zu Vi<br />
abgebrochen. Auf Objektträger montiert. K 0611/0449.<br />
46 (0,251 g); 14,5/9,9 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment,<br />
ca. % der Münze intakt. Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0425.<br />
47 (0,218 g); 11,0/9,5 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand zu Vi<br />
abgebrochen. Auf Objektträger montiert. K 0611/0448.<br />
48 (0,162 g); 8,3/8,0 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand ganz<br />
weggebrochen oder beschnitten? Auf Objektträger<br />
montiert. K 0611/0450.<br />
72<br />
49 (0,151 g); 4,7/3,5 mm (kleineres Fragment);<br />
(0,167 g); 8,3/4,3 mm (grösseres Fragment); e; BI. A 2,<br />
K 2. Doppelschlag. Zwei Fragmente, auf dem kleineren<br />
nur ein Teil eines Hinterbeines, Ansatz und eine Biegung<br />
des Schwanzes erkennbar, auf dem grösseren anpassenden?<br />
Fragment vier Perlen eines Perlkreises. Beide Fragmente<br />
je auf Objektträger montiert. K 0611/0463.<br />
RAVENSBURG,STADT<br />
Schilling (ab 1426), Münzstätte Ravensburg<br />
Variante la<br />
Vs. + mOnEta X RAVEnSPVRGEnS; Stadtschild in<br />
Vierpass.<br />
Rs. + X GLORIA X tIBI X DOmlnE; Adler in Achtpass, in<br />
den äusseren Winkeln Punkte.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 97, Nr. 10-14 Typ; Lanz, S. 181,<br />
Nr. 44 Typ.<br />
50 1,583 g; 22,1/20,8 mm; 340°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0161.<br />
51 1,539 g; 23,0/21,9 mm; 340°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0166.<br />
52 1,535 g; 22,3/20,6 mm; 200°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag, Risse. K 0611/0164.<br />
53 1,517 g; 22,2/21,7 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0160.<br />
54 1,464 g; 22,6/21,8 mm; 230°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0163.<br />
55 1,400 g; 22,2/21,7 mm; 10°; AR. A 3/2, K 2/2.<br />
Verbogen. Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0165.<br />
Variante lb<br />
Vs. + mOnEta X RAVEnSPVRGEnS'<br />
Rs. + X GLORIA X tIBI X DOmlnE (wie Var. la)<br />
Nau, Oberschwaben, S. 97, Nr. 10-14 Typ.<br />
56 0,274 g; 22,4/21,9 mm; 270°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Riss. Rand an zwei Stellen leicht abgebrochen.<br />
K 1305/0162.<br />
57 1,478 g; 22,5/21,7 mm; 90°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0163.<br />
Variante lc<br />
Vs. + mOnEtA • RA[VEn]SPVRGEnS<br />
Rs. + X GLORIA X tIBI X DOmlnE (wie Var. la)<br />
Nau, Oberschwaben, S. 97, Nr. 10-14 Typ.<br />
58 1,302 g; 22,7/20,4 mm; 360°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. Ausgebrochen. Restauriert: aus zwei<br />
Fragmenten zusammengeklebt. K 0611/0424.<br />
Variante ld<br />
Vs. + mOnEtA X RAVEnSPVRGEnSIS<br />
Rs. + X GLORIA X tIBI X DOmlnE (wie Var. la)<br />
Nau, Oberschwaben, S. 97, Nr. 12.
59 1,516 g; 22,1/21,5 mm; 200°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0162.<br />
Pfennig (ab 1426), Münzstätte Ravensburg<br />
Stadtschild in Perlkreis.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 97, Nr. 15; Lanz, S. 181,<br />
Nr. 48 Typ.<br />
60 0,328 g; 13,7/13,3 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung. K 0611/0181.<br />
61 0,295 g; 13,8/13,1 mm; e; BI. A 2, K 2. Leicht<br />
verbogen. Unter dem Schild Spuren einer zweiten<br />
Prägung (zwei Perlen). K 0611/0168.<br />
62 0,290 g; 14,0/12,5 mm; e; BI. A 2, K 2. Leicht<br />
ausgebrochen. K 0611/0174.<br />
63 0,261 g; 14,2/13,9 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung. K 0611/0169.<br />
64 0,256 g; 14,3/13,8 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung. K 0611/0184.<br />
65 0,246 g; 14,0/12,6 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung. K 1305/0006.<br />
66 0,240 g; 13,4/11,8 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand zu %<br />
abgebrochen. K 1305/0002.<br />
67 0,232 g; 14,7/13,9 mm; e; BI. A 2, K 2. Risse.<br />
K 0611/0188.<br />
68 0,227 g; 14,4/13,1 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 0611/0170.<br />
69 0,225 g; 14,7/13,6 mm; e; BI. A 2, K 2. Dezentrierte<br />
Prägung, Rand leicht aufgebogen. K 0611/0177.<br />
70 0,225 g; 14,4/13,7 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung. K 0611/0189.<br />
71 0,222 g; 14,2/13,8 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 0611/0185.<br />
72 0,218 g; 13,0/11,8 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 0611/0171.<br />
73 0,217 g; 14,2/13,0 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung. K 0611/0178.<br />
74 0,216 g; 14,2/13,3 mm; e; BI. A 2, K 2. Dezentrierte<br />
Prägung. K 0611/0182.<br />
75 0,213 g; 14,3/12,6 mm; e; BI. A 2, K 2. Dezentrierte<br />
Prägung. Rand unten rechts abgebrochen. K 1305/0003.<br />
76 0,209 g; 14,5/13,5 mm; e; BI. A 2, K 2. Riss.<br />
K1305/0005.<br />
77 0,208 g; 14,3/13,2 mm; e; BI. A 2, K 2. Riss.<br />
K 0611/0180.<br />
78 0,205 g; 13,5/12,3 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Doppelschlag, leicht ausgebrochen, dezentrierte Prägung.<br />
K 0611/0186.<br />
79 0,204 g; 14,8/13,7 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung, leicht ausgebrochen.<br />
K 0611/0190.<br />
80 0,200 g; 13,5/12,0 mm; e; BI. A 2, K 2. Leicht<br />
ausgebrochen. K 0611/0173.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
81 0,200 g; 14,0/13,2 mm; e; BI. A 2, K 2. Zwei Risse<br />
im Rand. K 1305/0001.<br />
82 0,196 g; 13,9/12,8 mm; e; BI. A 2, K 2. Falz,<br />
ausgebrochen. K 0611/0434.<br />
83 0,191 g; 14,3/13,4 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Doppelschlag, dezentrierte Prägung. K 0611/0187.<br />
84 0,184 g; 13,5/13,0 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 0611/0176.<br />
85 0,181 g; 14,3/13,2 mm; e; BI. A 2, K 2. Falz, Delle.<br />
K 0611/0172.<br />
86 0,178 g; 14,9/14,3 mm; e; BI. A 2, K 2. Falz, Rand<br />
rechts nach hinten gebogen. K 1305/0004.<br />
87 0,159 g; 14,0/13,5 mm; e ; BI. A 2, K 2. Unterhalb<br />
des Schildes Spuren einer zweiten Prägung (zwei Perlen).<br />
K 0611/0183.<br />
88 0,158 g; 14,1/13,1 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 0611/0175.<br />
89 0,096 g; 11,2/7,2 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment, ca.<br />
Vi der Münze erhalten. K 0611/0191.<br />
90 (0,313 g); 13,4/11,9 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen, Risse. Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0460.<br />
91 (0,321 g); 14,9/12,4 mm; e; BI. A 2, K 2. Risse,<br />
ausgebrochen, über dem Schild Spuren einer zweiten<br />
Prägung (zwei Perlen). Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0435.<br />
92 (0,303 g); 13,6/13,0 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Restauriert: aus drei Fragmenten zusammengesetzt. Auf<br />
Objektträger montiert. K 0611/0179.<br />
93 (0,275 g); 14,0/9,5 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment,<br />
ca. % der Münze erhalten. Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0433.<br />
94 (0,272 g); 13,0/10,4 mm; e; BI. A 2, K 2. Münzbild<br />
nur halb ausgeprägt, dezentrierte Prägung, ausgebrochen.<br />
Auf Objektträger montiert. K 0611/0432.<br />
95 (0,166 g); 7,7/7,0 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand entlang<br />
der Rundung des Schilds vollständig abgebrochen, oberhalb<br />
des Schildes scharfe Kante (beschnitten?). Auf<br />
Objektträger montiert. K 0611/0431.<br />
Heller (ab 1426), Münzstätte Ravensburg<br />
Vs. Stadtschild in Fadenkreis.<br />
Rs. Adler in Fadenkreis.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 97, Nr. 16; Lanz, S. 181, Nr. 46.<br />
96 0,194 g; 11,7/10,5 mm; 300°; BI. A 2/2, K 3/3.<br />
Ovaler Schröding. K 0611/0167.<br />
73
ULM, STADT<br />
Schilling nach dem Riedlinger Vertrag von 1423 (ab<br />
1423), Münzstätte Ulm<br />
Variante 1<br />
Vs. + FACtA + ESt + mOnEtA + nOVA + ISLA; Stadtschild<br />
zwischen V - L - m - E in Vierpass, in dessen äusseren<br />
Winkeln Dreiblätter.<br />
Rs. + X In i ChRIStl t nOmlnE X AmEn; Einköpfiger Adler<br />
nach links in unverziertem Achtpass.<br />
Nau, Oberschwaben. S. 68, Nr. 7 Typ.<br />
97 1,412 g; 23,1/22,3 mm; 220°; AR. A 2/2, K 2/2. Vs.<br />
Hieb. Rs. Doppelschlag. Verbogen, Riss. K 0611/0193.<br />
Variante 2<br />
Vs. + FACtA + ESt + mOnEtA + nOVA + IStA (wie Var. 1);<br />
Stadtschild zwischen V - L - m - E in Vierpass, in dessen<br />
äusseren Winkeln Dreiblätter.<br />
Rs. + | In X ChRIStl X nOmlnE t AmEn i; Einköpfiger<br />
Adler nach links in Achtpass, in den äusseren Winkeln<br />
Punkte.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 68, Nr. 7 Typ.<br />
98 1,312 g; 22,4/21,8 mm; 320°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag, Vs. Hieb. K 0611/0192.<br />
Pfennig nach dem Riedlinger Vertrag von 1423 (ab 1423),<br />
Münzstätte Ulm<br />
Halbrunder Stadtschild, oberes Feld geschacht mit<br />
Punkten.<br />
Nau, Oberschwaben, S. 69, Nr. 8.<br />
99 0,301 g; 15,0 14,2 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Doppelschlag. K 1305/0007.<br />
100 0,201 g; 15,3/14,0 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung. Rand an zwei Stellen<br />
abgebrochen. Verbogen, flaue Prägung. K 0611/0194.<br />
101 0,189 g; 14,9/12,7 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand oben<br />
abgebrochen. K 1305/0008.<br />
102 0,159 g; 13,6/11,8 mm; e; BI. A 3, K 2. Rand zu V 3<br />
abgebrochen. Flaue Prägung. K 0611/0195.<br />
103 0,119 g; 12,3/7,5 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment, ca.<br />
Vz der Münze erhalten (unterer Teil des Schildes und<br />
Teile des Perlkreises). Doppelschlag. K 1305/0115.<br />
104 0,066 g; 11,6/5,9 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment, ca.<br />
V-i der Münze erhalten (linker Teil des Schildes und Teil<br />
des Perlkreises). K 1305/0074.<br />
105 (0,459 g); 15,1/9,6 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment,<br />
ca. Vz der Münze erhalten, Doppelschlag. Auf<br />
Objektträger montiert. K 061.1/0459.<br />
106 (0,314 g); 14,5/10,8 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung. Fragment, ca. % der Münze<br />
erhalten. Auf Objektträger montiert. K 0611/0438.<br />
74<br />
107 (0,249 g); 13,2/11,5 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand zu :i<br />
/ 4<br />
abgebrochen. Risse, flaue Prägung. Auf Objektträger<br />
montiert. K 0611/0451.<br />
WÜRTTEMBERG, GRAFSCHAFT<br />
LUDWIG I. (1419-1450)<br />
Schilling nach dem Riedlinger Vertrag von 1423<br />
(ab 1423), Münzstätte Stuttgart<br />
Variante 1<br />
Vs. + LVDWIC • COME • DE • WIRTB; Schild mit den drei<br />
Hirschstangen in Zehnpass mit Punkten, innerhalb des<br />
obersten Bogens ebenfalls ein Punkt.<br />
Rs. + MOHETA • VA • STVGGARTEH; Blumenkreuz mit<br />
Punkten und Röschen.<br />
Klein/Raff, S. 29, Nr. 11.4. Var. (Vs. DE • WIRTB).<br />
108 1,406 g; 22,6/21,5 mm; 150°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0156.<br />
Variante 2<br />
Vs. + LVDWIC • COME • DE • WIRTEB; Schild mit den<br />
drei Hirschstangen in Zwölfpass ohne Punkte, innerhalb<br />
des obersten Bogens ein Röschen.<br />
Rs. + • MOHETA • IH • STVGGARTEH •; Blumenkreuz mit<br />
Punkten und Röschen.<br />
Klein/Raff, S. 29, Nr. 13.<br />
109 1,454 g; 22,0/21,5 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0158.<br />
Pfennig nach dem Riedlinger Vertrag von 1423 (ab 1423),<br />
Münzstätte Stuttgart<br />
Jagdhorn mit Band in Perlkreis, im Feld drei Punkte.<br />
Klein/Raff, S. 31, Nr. 16; Binder/Ebner I, S. 29, Nr. 23.<br />
110 0,243 g; 14,3/14,0 mm; e; BI. A 2, K 2. Riss.<br />
K 1305/0161.<br />
111 0,239 g; 14,1/13,2 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 1305/0159.<br />
112 0,235 g; 14,9/14,1 mm; e; BI. A 2, K 2. Risse, Rand<br />
unten rechts aufgebogen. K 1305/0160.<br />
113 (0,315 g); 14,3/12,7 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Restauriert, aus zwei Fragmenten zusammengesetzt, auf<br />
Objektträger montiert. K 0611/0157.<br />
114 (0,288 g); 14,7/10,3 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment,<br />
ca. % der Münze intakt. Auf Objektträger montiert.<br />
K0611/0452.
SCHWEIZ<br />
ZÜRICH, STADT<br />
Stehler (um 1400), Münzstätte Zürich<br />
Brustbild der Äbtissin von vorne mit Schleier, Perldiadem<br />
und Perlkette.<br />
Hürlimann, S. 156, Nr. 68.<br />
115 0,115 g; 12,5/9,3 mm (anpassendes Fragment:<br />
0,016 g; 7,0/5,0 mm): e; BI. A 2, K 2. Flaue Prägung.<br />
K1305/0100.<br />
116 (0,202 g) ; 13,6/10,2 mm; e; BI. A 2, K 3.<br />
Restauriert, aus fünf Fragmenten zusammengesetzt (ca.<br />
'A der Münze fehlt). Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0454.<br />
Plappart um 1417, Münzstätte Zürich<br />
Variante la<br />
Vs. + MOHETA (6bl. Rosette) HO' (6bl. Rosette)<br />
ThVRICEHSIS; Zürichschild, darüber Adler, um beide<br />
Vierpass.<br />
Rs. SAHTTVS - KAROLVS; Thronender Karl der Grosse<br />
mit Nimbus und Krone, hält Schwert quer über den<br />
Knien.<br />
Hürlimann, S. 157, Nr. 76; Kat. Rechberg, S. 19, Nr. 62.<br />
117 2,132 g; 25,8/25,1 mm; 160°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0096.<br />
118 2,035 g; 26,0/25,1 mm; 130°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0092.<br />
119 1,927 g; 25,9/25,5 mm; 340°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0089.<br />
Variante 1b<br />
Vs. + MOHETA (6bl. Rosette) MO' (6bl. Rosette)<br />
ThVRICEHSIS (wie Var. la)<br />
Rs. SAHTVS - KARLVS<br />
Hürlimann, S. 157, Nr. 76 Typ.<br />
120 1,944 g; 25,8/25,5 mm; 40°; AR. A 2/2, K 2/2. Riss.<br />
K 0611/0090.<br />
Variante lc<br />
Vs. + MOHETA (6bl. Rosette) HO' ThVRICEHSIS<br />
Rs. SAHTVS - KARLVS (wie Var. lb)<br />
Hürlimann, S. 157, Nr. 76 Typ.<br />
121 2,089 g; 25,5/25,2 mm; 210°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 1305/0143.<br />
122 1.783 g; 25,8/25,4 mm; 360°; AR. A 1/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0093.<br />
Variante Id<br />
Vs. + MOnETA (Blumenkreuz) nO' (Blumenkreuz)<br />
ThVRICEnSIS<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Rs. (5bl. Rosette) SAnCTVS - KAROLVS (5bl. Rosette)<br />
Hürlimann, S. 157, Nr. 76 Typ.<br />
123 2,125 g; 25,5/24,7 mm; 60°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0094.<br />
124 1,839 g; 26,0/24,7 mm; 140°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. tiefer Kratzer, Riss. Rs. Doppelschlag. K 0611/0091.<br />
Variante le<br />
Vs. + MOnETA (Blumenkreuz) nO' (Blumenkreuz)<br />
ThVRICEnSIS (wie Var. ld)<br />
Rs. (5bl. Rosette) SAnTTVS - KAROLVS (5bl. Rosette)<br />
Hürlimann, S. 157, Nr. 76 Typ.<br />
125 1,983 g; 25,5/24,7 mm; 100°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0095.<br />
Variante lf<br />
Vs. + MOnETA (Blumenkreuz) nO' (Blumenkreuz)<br />
ThVRICEnSIS (wie Var. ld)<br />
Rs. (5bl. Rosette) SAnTTVS - KAROLVS<br />
Hürlimann, S. 157, Nr. 76 Typ.<br />
126 1,863 g; 26,0/24,8 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 1305/0144.<br />
Plappart nach dem Vertrag von 1424 (1424/25),<br />
Münzstätte Zürich<br />
Vs. + (6bl. Rosette) MOHETA (6bl. Rosette) ThVRICEHSIS<br />
(6bl. Rosette); Zürichschild auf Blumenkreuz in Vierpass.<br />
Rs. • SAHTTVS - KAROLVS •; Thronender Karl der Grosse<br />
mit Nimbus und Krone, hält Schwert quer über den<br />
Knien.<br />
Hürlimann, S. 157, Nr. 78; Kat. Rechberg, S. 19, Nr. 63.<br />
127 1,914 g; 23,7/23,2 mm; 210°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0146.<br />
128 1,769 g; 24,3/23,9 mm; 360°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0111.<br />
129 1,731 g; 24,7/23,6 mm; 140°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0147.<br />
Plappart, sogen. Krähenplappart (ab 1425), Münzstätte<br />
Zürch<br />
Variante la<br />
Vs. + mOnETA (Stern) ThVRICEnSIS (5bl. Rosette);<br />
Zürichschild in Vierpass.<br />
Rs. + CIVITATIS (Stern) ImPERIALIS (5bl. Rosette);<br />
Adler.<br />
Hürlimann, S. 157, Nr. 81 Typ; Kat. Rechberg, S. 19,<br />
Nr. 65.<br />
130 2,246 g; 24,7/24,3 mm; 340°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0106.<br />
131 2,198 g; 24,5/24,2 mm; 150°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0107.<br />
132 2,194 g; 25,0/24,6 mm; 200°; AR. A 2/2, K 1/1.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0098.<br />
75
133 2,188 g; 24,5/24,0 mm; 360°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0097.<br />
134 2,040 g; 24,3/23,8 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Kratzer. K 0611/0103.<br />
135 2,020 g; 24,4/24,1 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag, Kratzer. K 0611/0108.<br />
Variante lb<br />
Vs. + mOnETA (Stern) ThVRICEnSIS (5bl. Rosette) (wie<br />
Var. la)<br />
Rs. + CIVITATIS (Stern) ImPERIALIS (Stern)<br />
Hürlimann, S. 157, Nr. 81 Typ.<br />
136 2,191 g; 24,8/24,0 mm; 150°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0105.<br />
137 2,174 g; 24,5/24,1 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0106.<br />
138 2,172 g; 24,4/24,0 mm; 140°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0100.<br />
139 2,140 g; 24,4/23,8 mm; 20°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0145.<br />
140 2,114 g; 24,0/23,6 mm; 260°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag, Kratzer. K 0611/0102.<br />
141 2,093 g; 24,5/23,9 mm; 270°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0104.<br />
142 2,055 g; 24,4/23,3 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Kratzer. K 0611/0099.<br />
143 2,049 g; 24,3/23,8 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Kratzer. Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0101.<br />
144 2,016 g; 24,2/23,4 mm; 230°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K0611/0109.<br />
Angster (nach 1425), Münzstätte Zürich<br />
Kopf der Äbtissin von vorne zwischen Z - VI, darunter<br />
Linie mit je einer Kugel an den Enden.<br />
Hürlimann, S. 156, Nr. 64; Slg. Wüthrich, S. 32, Nr. 222.<br />
145 0,169 g; 15,9/14,8 mm; e; BI. A 1, K 2. Risse.<br />
K0611/0088.<br />
146 0,142 g; 14,3/13,0 mm; e; BI. A 1, K 2. Rand zu %<br />
abgebrochen. K 0611/0087.<br />
LUZERN, STADT<br />
Angster (1430/40), Münzstätte Luzern<br />
Bischofskopf von vorne.<br />
Zäch, Luzern, S. 336, Nr. A 3.4; Wielandt, Luzern, S. 94,<br />
Nr. 28a. 1.<br />
147 0,153 g; 14,7/12,3 mm; e; BI. A 1, K 2.<br />
Ausgebrochen. K 0611/0086.<br />
76<br />
BERN, STADT<br />
Plappart (1425-1435), Münzstätte Bern<br />
Vs. + (4bl. Rosette) mOnETA (4bl. Rosette) BERnEnSIS<br />
(4bl. Rosette); Bär n. 1., darüber Adler.<br />
Rs: + (4bl. Rosette) SAnCTVS (4bl. Rosette) VInCEnCIVS<br />
(4bl. Rosette); Blumenkreuz.<br />
Geiger, Bern, S. 147, Nr. 14a; Lohner, S. 113, Nr. 498.<br />
148 1,807 g; 25,6/25,3 mm; 10°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0085.<br />
SOLOTHURN, STADT<br />
Haller (1. Viertel 15. Jh.), Münzstätte Solothurn<br />
Kopf des hl. Ursus zwischen S - 0. Über dem Kopf eine<br />
Perle. Zweiteilige LIalsschleife.<br />
Vgl. Simmen, S. 48, Nr. 16 (Angster).<br />
149 (0,209 g); 13,4/8,4 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment,<br />
ca. % der Münze erhalten. Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0446.<br />
BASEL, STADT<br />
Plappart nach dem Vertrag von 1425 (ab 1425),<br />
Münzstätte Basel<br />
Vs. + MOnETA 8 nO' ° BASILIEnSIS; Baslerwappen in<br />
doppeltem Sechspass.<br />
Rs. (5bl. Rosette) ° AVE ° MARI - A ° GRACL ° P\<br />
Stehende gekrönte Madonna mit Kind.<br />
Geigy, S. 85, Nr. 489; Cahn, Rappemnünzbund, S. 72,<br />
Nr. 1 (Tf. 1, Nr. 18) Typ.<br />
150 1,880 g; 23,1/22,4 mm; 60°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0084.<br />
151 1,719 g; 23,5/23,0 mm; 140°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0083.
OBERRHEIN/MITTELRHEIN<br />
STRASSBURG,STADT<br />
Pfennig (um 1400), Münzstätte Strassburg<br />
Lilie zwischen vier Punkten, auf gerade gestelltem<br />
Stadtschild; Perlkreis.<br />
Cahn, Strassburg, Nr. 17; Wielandt, Baden, S. 365,<br />
Nr. 29a; Engel/Lehr, S. 187, Nr. 331 (Tf. 32, Nr. 21).<br />
152 (0,228 g); 15,1/9,3 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment,<br />
ca. Vz der Münze erhalten. Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0445.<br />
Pfennig (um. 1400), Münzstätte Strassburg<br />
Lilie zwischen vier Punkten, auf schräg gestelltem<br />
Stadtschild; Perlkreis.<br />
Cahn. Strassburg-; Wielandt, Baden, S. 365, Nr. 29b;<br />
Engel/Lehr -.<br />
153 0,256 g; 16,1/14,1 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung. Stempelbeschädigung. Rand<br />
zu 'A abgebrochen. K 0611/0200.<br />
154 (0,230 g); 14,3/9,8 mm; e; BI. A 3, K 2. Fragment,<br />
ca. % der Münze erhalten. Flaue Prägung. Auf Objektträger<br />
montiert. K 0611/0453.<br />
UNBESTIMMTE MÜNZHERRSCHAFT<br />
(OBER-/MITTELRHEIN)<br />
Pfennig nach Strassburger Art (um 1400-1410),<br />
unbestimmte Münzstätte<br />
Lilie mit kreuzartig gestaltetem Mittelblatt, über linkem<br />
Blatt Ringel, über rechtem Buchstabe V. Die äusseren<br />
Blätter enden je in einem Ringel; Perlkreis.<br />
Schwarzkopf, Tf. 1, Nr. 28 Var. (Ringel); Cahn,<br />
Strassburg -; Engel/Lehr -; Wielandt, Baden -.<br />
155 0,266 g; 16,5/15,0 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand leicht<br />
ausgebrochen. Risse. K 0611/0201.<br />
BADEN, MARKGRAFSCHAFT<br />
BERNHARD I. (1372-1431)<br />
Pfennig nach dem Vertrag von 1409 (ab 1409), Münzstätte<br />
Pforzheim<br />
Variante 1<br />
Badisches Wappen, darüber Buchstaben BP; Perlkreis.<br />
Wielandt, Baden, S. 365, Nr. 30b.<br />
DER MÜNZSCHATZ FUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
156 0,216 g; 15,1/12,9 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand zu ca.<br />
x<br />
k abgebrochen. K 1305/0148.<br />
157 0,203 g; 15,2/13,8 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand<br />
ausgebrochen. K 0611/0113.<br />
158 0,202 g; 15,1/14,2 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
K 0611/0119.<br />
159 0,195 g; 15,5/15,2 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand leicht<br />
ausgebrochen. K 0611/0112.<br />
160 0,178 g; 14,9/12,9 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen, Rand aufgebogen. K 0611/0123.<br />
161 0,141 g; 14,1/10,5 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen, ca. % der Münze erhalten, verbogen,<br />
Risse. K 1305/0149.<br />
162 (0,305 g); 14,8/1.3,0 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand<br />
leicht ausgebrochen. Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0115.<br />
163 (0,299 g); 15,5/11,8 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen. Auf Objektträger montiert. K 0611/0122.<br />
164 (0,245 g); 12,6/11,3 mm; e; BI. A 2. K 2. Sehr<br />
kleiner Schild. Restauriert: aus zwei Fragmenten zusammengesetzt.<br />
Auf Objektträger montiert. K 061.1/0124.<br />
Variante 2<br />
Badisches Wappen, darüber Buchstaben BP, Schild<br />
zwischen zwei Punkten; Perlkreis.<br />
Wielandt, Baden, S. 365, Nr. 30b Typ.<br />
165 0,253 g; 15,2/14,3 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand leicht<br />
ausgebrochen. K 0611/0114.<br />
166 0,238 g; 15,6/14,9 mm; e; BI. A 2, K 2. BP nicht<br />
erkennbar (flaue Prägung). K 1305/0150.<br />
167 0,232 g; 14,9/14,5 mm; e; BI. A 2, K 2. Riss, Rand<br />
aufgebogen. K 0611/0121.<br />
168 0,219 g; 15,2/12,8 mm; e; BI. A 3, K 2. Rand<br />
ausgebrochen. K 0611/0118.<br />
169 0,169 g; 14,4/11,9 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen. K 0611/0120.<br />
170 (0,321 g); 14,7/11,3 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment,<br />
ca. % der Münze intakt. Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0116.<br />
171 (0,319 g); 14,8/12,1 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment,<br />
ca. % der Münze intakt. Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0117.<br />
Heller (ab 1409), Münzstätte Pforzheim<br />
Badisches Wappen ohne Buchstaben; Perlkreis.<br />
Wielandt, Baden, S. 366, Nr. 31a.<br />
172 (0,199 g); 11,9/8,5 mm (grösseres Fragment);<br />
(0,139 g); 8,1/3,8 mm (kleineres Fragment); e; BI. A 2,<br />
K 2. Zwei Fragmente, je auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0437.<br />
77
HEILBRONN?, REICHSMÜNZSTÄTTE? LUDWIG IV. (1436-1449)<br />
KG. SIGISMUND (1410-1437)?<br />
Pfennig (um 1423/24?), Münzstätte Heilbronn?<br />
Einköpfiger Adler zwischen h - n in Perlkreis.<br />
Buchenau, Heilbronn, Sp. 5177.<br />
173 0,220 g; 14,7/12,4 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Doppelschlag, ausgebrochen, dezentrierte Prägung.<br />
K0611/0158.<br />
174 0,174 g; 14,0/11,2 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen. K 0611/0159.<br />
175 (0,314 g); 14,3/11,2 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand zu V 3<br />
abgebrochen. Auf Objektträger montiert. K 0611/0447.<br />
PFALZ, KURFÜRSTENTUM<br />
RUPRECHT III. (1398-1410)<br />
Pfennig (vor 1409), Münzstätte Heidelberg<br />
Weckenschild ohne Beizeichen. Buchenau,<br />
Untersuchungen, S. 112, Nr. 81 (Tf. 226, Nr. 26).<br />
176 0,210 g; 14,6/13,4 mm; e; BI. A 2, K 2. Flaue,<br />
dezentrierte Prägung. K 0611/0214.<br />
177 0,146 g; 13,7/12,3 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand mit<br />
Perlkreis zu ca. V2 abgebrochen. K 1305/0105.<br />
178 (0,294 g); 14,6/10,5 mm; e ; BI. A 2, K 2. Rand zu l<br />
/z<br />
abgebrochen. Auf Objektträger montiert. K 0611/0441.<br />
RUPRECHT III. (1398-1410) ODER LUDWIG III.<br />
(1410-1436)<br />
Pfennig nach Vertrag von 1409 (ab 1409 bis 1420),<br />
Münzstätte Heidelberg<br />
Variante 1<br />
Weckenschild, darüber Löwe, Punkt links des Schildes.<br />
Buchenau, Untersuchungen, S. 125, Nr. 83 (Tf. 226,<br />
Nr. 33) Var. (Punkt links statt rechts des Schildes).<br />
179 0,198 g; 16,2/13,4 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen, ca. % der Münze intakt. Dezentrierte<br />
Prägung. K 0611/0216.<br />
Variante 2<br />
Weckenschild, darüber Löwe, ohne Punkt.<br />
Buchenau, Untersuchungen, S. 125, Nr. 83 (Tf. 226,<br />
Nr. 31-32).<br />
180 0,232 g; 15,7/14,4 mm ; e; BI. A 2, K 2. Risse,<br />
unsorgfältiger Stempelschnitt. K 0611/0215.<br />
78<br />
Pfennig, Vereinsprägung Pfalz-Mainz (um 1444-1449?),<br />
Münzstätte Heidelberg<br />
Gespaltener Schild (Pfalz/Mainz), darüber Buchstabe h;<br />
Perlkreis.<br />
Buchenau, Untersuchungen, S. 163, Nr. 101 (Tf. 226,<br />
Nr. 51-52).<br />
181 0,199 g; 15,3/13,5 mm; e; BI. A 2, K 3.<br />
Doppelschlag. Rand teilweise abgebrochen. Oberfläche<br />
blättert ab. K 1305/0101.<br />
182 0,121 g ; 13,1/11,8 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand zu %<br />
abgebrochen. Falz, Risse. K 1305/0110.<br />
PFALZ-SIMMERN, GRAFSCHAFT<br />
STEPHAN (1410-1453)<br />
Pfennig, Münzstätte Wachenheim<br />
Variante 1 (vor 1439)<br />
Weckenschild, darüber Buchstabe S zwischen zwei<br />
Ringeln; Perlkreis.<br />
Noss, S. 186, Nr. 4 (Tf. 228, Nr. 4).<br />
183 0,243 g; 15,3/13,7 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Doppelschlag, Riss, Rand leicht abgebrochen.<br />
K 0611/0210.<br />
184 (0,315 g) ; 15,9/15,5 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand an<br />
zwei Stellen abgebrochen. Risse. Auf Objektträger<br />
montiert. K 0611/0444.<br />
185 (0,312 g); 15,6/12,3 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand zu Vi<br />
abgebrochen, Risse. Auf Objektträger montiert.<br />
K 0611/0443.<br />
Variante 2 (ab 1439)<br />
Weckenschild, darüber Buchstabe S, ohne Ringel, unter<br />
Schild drei Punkte im Dreieck (2/1); Perlkreis.<br />
Noss, S. 187, Nr. 6 (Tf. 228, Nr. 6).<br />
186 0,236 g; 15,2/14,7 mm; e; BI. A 2, K 2. Restauriert:<br />
lackiert. K 0611/0211.<br />
Variante 3 (ab 1439)<br />
Weckenschild, darüber Buchstabe S ohne Ringel. Unter<br />
Schild drei Punkte im Dreieck (1/2); Perlkreis.<br />
Noss, S. 187, Nr. 5 (Tf. 228, Nr. 5).<br />
187 0,118 g; 15,4/10,9 mm; e,- BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen, ca. % der Münze intakt. Beizeichen über<br />
Schild ausgebrochen. K 0611/0428.<br />
Variante unbestimmt<br />
188 0,176 g; 14,7/12,0 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Ausgebrochen, ca. % der Münze intakt. Risse. Beizeichen<br />
ausgebrochen. K 0611/0212.
189 0,151 g; 15,4/12,5 mm; e; BI. A 2, K 2. Dezentrierte<br />
Prägung. Rand unten entlang des Schildes abgebrochen.<br />
S ohne Ringel, Punkte unter Schild abgebrochen.<br />
K 1305/0010.<br />
190 (0,205 g); 12,5/10,5 mm; e ; BI. A 2, K 2. Rand zu %<br />
abgebrochen, Risse. S ohne Ringel, Punkte unter Schild<br />
ausgebrochen. Auf Objektträger montiert. K 0611/0430.<br />
191 (0,171 g); 9,0/7,8 mm; e; BI. A2.K2. Fragment,<br />
nur Schild erhalten, Beizeichen abgebrochen. Auf<br />
Objektträger montiert. K 0611/0429.<br />
192 (0,056 g); 11,0/4,6 mm; e; BI. A 2, K 2. Fragment.<br />
Wurde auf Papier aufgeklebt belassen; auf Papier Spuren<br />
eines weiteren verlorenen Fragments. Beizeichen nicht<br />
sichtbar. K 0611/0442.<br />
Pfennig (vor 1453?), Münzstätte Wachenheim<br />
Weckenschild, darüber Buchstabe c und ein Sternchen;<br />
Perlkreis.<br />
Noss. S. 218, Nr. 16e (Tafel 228, Nr. 16).<br />
193 0,222 g; 15,9/14,0 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand leicht<br />
ausgebrochen. K 1305/0103.<br />
PFALZ-ZWEIBRÜCKEN, GRAFSCHAFT<br />
LUDWIG (1453-1489)<br />
Pfennig (ab 1453?), Münzstätte Veldenz?<br />
Weckenschild, darüber Buchstabe I; Perlkreis.<br />
Noss, S. 218, Nr. 18 (Tafel 228, Nr. 18 e-f).<br />
194 0,214 g; 15,1/13,4 mm; e ; BL A 2, K 2.<br />
K 1305/0104.<br />
SPEYER, BISTUM<br />
RABAN VON HELMSTÄDT (1396-1439)<br />
Pfennig nach dem Vertrag von 1409 (ab 1409),<br />
Münzstätte Speyer<br />
Variante 1<br />
Gespaltener Schild (Speyer (Kreuz)/Helmstädt (Krähe)),<br />
darüber Buchstabe R, Halbmond rechts des Schildes;<br />
Perlkreis.<br />
Ehrend, S. 142, Nr. 5/13 Var. (Halbmond); Buchenau,<br />
Untersuchungen, Tf. 226, Nr. 50 Var. (Halbmond).<br />
195 0,240 g; 15,0/12,9 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand zu Vi<br />
abgebrochen. Dezentrierte Prägung. K 0611/0219.<br />
196 0,188 g; 15,9/14,4 mm; e ; BL A 2, K 2. Risse.<br />
Beschnitten? Dezentrierte Prägung. K 0611/0218.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Variante 2<br />
Gespaltener Schild (Speyer (Kreuz)/Helmstädt (Krähe)),<br />
darüber Buchstabe R, Punkt links des Schildes; Perlkreis.<br />
Ehrend, S. 142, Nr. 5/13 Var. (Punkt links des Schildes).<br />
197 0,238 g; 16,6/15,6 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand leicht<br />
abgebrochen. K 0611/0217.<br />
Variante unbestimmt<br />
198 0,090 g; 13,6/6,4 mm (grösseres Fragment);<br />
0,021 g; 6,0/5,4 mm (kleineres Fragment); e; BL A 2,<br />
K 2. Zwei Fragmente. Erhalten: rechter Teil des Schildes<br />
und Teile des linken, R über dem Schild und ein Teil des<br />
Perlkreises. Beizeichen nicht erhalten. K 1305/0113.<br />
199 0,040 g; 13,1/4,9 mm (grösseres Fragment);<br />
0,032 g; 10,6/5,9 mm (kleineres Fragment); e; BI. A 2,<br />
K 2. Zwei Fragmente, ca. % der Münze erhalten.<br />
Beizeichen nicht erhalten. K 1305/0073.<br />
200 (0,336 g); 14,7/11,4 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Doppelschlag, ausgebrochen, ca. % der Münze erhalten.<br />
Risse. Kein Punkt links des Schildes. Auf Objektträger<br />
montiert. K 0611/0439.<br />
201 (0,170 g); 11,2/9,1 mm (grösseres Fragment);<br />
(0,174 g) 10,3/4,5 mm (kleineres Fragment); e; BI. A 2,<br />
K 2. Zwei Fragmente. Grösseres Fragment: linke Seite<br />
des Schildes und Teil des Perlkreises erhalten, kein Punkt<br />
links des Schildes. Auf kleinerem Fragment drei Perlen<br />
des Perlkreises, dazwischen Buchstabe R. Beide<br />
Fragmente je auf Objektträger montiert. K 0611/0440.<br />
MAINZ, ERZBISTUM<br />
JOHANN IL, GRAF VON NASSAU (1397-1419)<br />
Pfennig nach Strassburger Art (um 1410), Münzstätte<br />
Neckarsulm<br />
Lilie mit kreuzartig gestaltetem Mittelblatt über<br />
fünfspeichigem Rad; Perlkreis.<br />
Schwarzkopf, Tf. 1, Nr. 18; Buchenau, Untersuchungen,<br />
S. 88 (Erwähnung).<br />
202 0,208 g; 16,1/13,8 mm ; e ; BL A 2, K 2. Dezentrierte<br />
Prägung. Rand leicht abgebrochen. K 0611/0202.<br />
KONRAD III., RHEIN- UND WILDGRAF ZU DAUN<br />
(1419-1434)<br />
Pfennig nach der Aschaffenburger Konvention von 1424<br />
(ab 1424), Münzstätte Miltenberg<br />
Mainzer Wappenschild, darüber Buchstabe m; Perlkreis.<br />
Buchenau, Untersuchungen, S. 130, Nr. 84a (Tf. 226,<br />
Nr. 34).<br />
79
203 0,217 g; 14,8/12,0 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand zu Vs<br />
abgebrochen. K 0611/0203.<br />
204 0,173 g; 15,4/12,6 mm; e; BI. A 2, K 2. Vi ausgebrochen,<br />
Risse. K 0611/0204.<br />
Hohlringheller (1428-1434), Münzstätte Bingen<br />
Links sechsspeichiges Rad, rechts zweischwänziger<br />
wildgräflicher Löwe. Unten im Feld Punkt; Wulstreif.<br />
Diepenbach, Tf. B, Nr. 15 Var. (Punkt unten im Feld).<br />
205 0,163 g; 14,4/13,1 mm; e ; BI. A 2, K 2. Flaue<br />
Prägung, Rand zu Vi abgebrochen. K 0611/0209.<br />
DIETRICH L, SCHENK ZU ERBACH (1434-1459)<br />
Pfennig, Vereinsprägung Mainz-Pfalz (um 1444-1449?),<br />
Münzstätte Miltenberg<br />
Gespaltener Schild (Mainz/Pfalz), darüber Buchstabe m;<br />
Perlkreis.<br />
Buchenau, Untersuchungen, S. 163, Nr. 99 (Tf. 226,<br />
Nr. 54-55).<br />
206 0,206 g; 15,3/13,9 mm; e; BI. A 2, K 2. Sehr flaue<br />
Prägung. K 0611/0206.<br />
207 0,152 g; 13,6/10,9 mm; e; BI. A 2, K 2. Risse. Rand<br />
zu ca. Vi abgebrochen. K 1305/0102.<br />
Pfennig (1434-1459), Münzstätte Bingen<br />
Variante 1<br />
Mainzer Wappenschild, darüber Buchstabe B. Rechts von<br />
B Ringel. Unter Schild Stern; Perlkreis.<br />
Diepenbach, Tf. B, Nr. 17.<br />
208 0,206 g; 14,3/12,9 mm; e; BL A 2, K 2. Rand oben<br />
abgebrochen. K 1305/0009.<br />
209 0,205 g; 14,9/13,9 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsseiförmige Prägung. K 0611/0207.<br />
Variante 2<br />
Mainzer Wappenschild, darüber Buchstabe B. Ohne<br />
Ringel. Unter Schild Stern; Perlkreis.<br />
Diepenbach, Tf. B, Nr. 16.<br />
210 0,174 g; 15,1/12,2 mm; e; BI. A 2, K 2.<br />
Schüsselförmige Prägung. Vi ausgebrochen, verbogen.<br />
K 0611/0205.<br />
80<br />
LOTHRINGEN<br />
LOTHRINGEN, HERZOGTUM<br />
KARL II. (1390-1431)<br />
Tournosgroschen (1390-1431), Münzstätte Nancy<br />
Vs. KAROLVS (5bl. Rosette) DVX - LOThOR' (5bl. Rosette)<br />
Z (5bl. Rosette) m'; Herzog stehend, in rechter LIand<br />
Schwert, linke Hand in die Hüfte gestützt,<br />
Rs. Äussere Legende: + BNDICTV (Stern) SIT (zwei<br />
übereinanderstehende Sterne) nOmE' (Stern) DNL (Stern)<br />
nRL (Stern) IhV (Stern) XPL (Stern);<br />
Innere Legende: mOn - ETA - (5bl. Rosette) DE (5bl.<br />
Rosette) n - AnCI; Kreuz, innere Legende durchbrechend.<br />
Saulcy, Tf. 9, Nr. 18 Var. (Rs. äussere Legende:<br />
Buchstaben- und Beizeichenvarianten, innere Legende:<br />
n - AnCI).<br />
211 2,061 g; 24,9/23,6 mm; 240°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. IhPv" (Stern) XPL] (Stern); Vs. Doppelschlag.<br />
K 1305/0011.<br />
212 1,782 g; 24,2/23,4 mm; 20°: AR. A 2/2. K 2/2.<br />
K 0611/0221.<br />
213 1,565 g; 25,3/24,7 mm; 180°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Drei Risse im Rand (Schrötlingsfehler). K 0611/0222.<br />
BAR, HERZOGTUM<br />
RENATUS I. (1419-1453)<br />
Tournosgroschen (1424-1431), Münzstätte Saint-Mihiel<br />
Vs. REn[AT'] - D - BAR x m' x P' CO (R von BAR ohne<br />
schrägen Abstrich); Herzog stehend, in rechter Hand<br />
Schwert, in Linker Schild haltend.<br />
Rs. Äussere Legende: SIT nOMEn $ DOmlnl SBEnEDIC;<br />
Innere Legende: MON - ETA - S MI - CHA; Kreuz, innere<br />
Legende durchbrechend.<br />
Saulcy, Tf. 10, Nr. 10 Typ; Wendling, Tf. 24, Nr. F/XVI/7<br />
Typ.<br />
214 2,077 g; 24,8/23,9 mm; 360°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0223.
MITTEL- UND NORDDEUTSCHLAND<br />
NÜRNBERG, REICHSMÜNZSTÄTTE<br />
KG. SIGISMUND (1410-1437)<br />
Goldgulden (1414-1419), Münzstätte Nürnberg<br />
Vs. 2IGI2MVnDV8 RO RX; Gekröntes Brustbild des<br />
Königs mit Schwert und Reichsapfel.<br />
Rs. + MOnETA nOVA nVREMG; Adler n.l., auf Brust<br />
Schild mit Doppelkreuz.<br />
Erlanger, S. 153, Nr. 105 Typ.<br />
215 3,463 g; 22,1/21,3 mm; 110°; AU. A 2/2, K 1/1.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0072.<br />
NÜRNBERG, BURGGRAFSCHAFT<br />
FRIEDRICH V. (1361-1397)<br />
Schilling nach dem Münzverein mit Bischof Lambert von<br />
Brun zu Bamberg (nach 1390), Münzstätte unbestimmt<br />
Vs. + mOnETA (6z. Stern) mAIOR (6z. Stern) [FRID]E;<br />
Gespaltener Schild (Brun/Bamberg) zwischen drei<br />
Ringeln.<br />
Rs. + BVRGGRAFFI (6z. Stern) nVRmBBE; Zollernschild<br />
zwischen zwei Ringeln, darauf Brackenkopf zwischen<br />
zwei Beizeichen.<br />
Schrötter I, S. 36, Nr. 143 Var. (Legende Vs. und Rs.)<br />
216 1,691 g; 25,6/24,5 mm; 190°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0196.<br />
JOHANN III. (1404-1420)<br />
Pfennig fränkischer Art (1404-1420), Münzstätte<br />
Neustadt a.d. Aisch<br />
Zollernschild zwischen I - n (über und unter den<br />
Buchstaben je ein Punkt), darüber Buchstabe I (zwischen<br />
zwei Punkten), unter dem Schild ein Punkt.<br />
Schrötter I, S. 47, Nr. 211.<br />
217 0,287 g; 15,1/14,7 mm; e; BI. A 2, K 2. Punkte<br />
unter n und unter Schild nicht sicher erkennbar.<br />
K 0611/0197.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
ALTENBURG, STADT<br />
Heller nach fränkischer Art (ab 1451), Münzstätte<br />
Aldenburg<br />
Vs. Löwenschild auf Gabelkreuz (Emissionszeichen<br />
unkenntlich).<br />
Rs. Hand mit fünfblättriger Rosette.<br />
Krug, Groschen, S. 147, Nr. 839 Typ; Steguweit/Stoll,<br />
S. 53, Nr. 24-26 Typ.<br />
218 0,158 g; 12,6/11,0 mm; 30°; BI. A 2/2, K 4/4.<br />
Ausgebrochen, Riss. K 0611/0199.<br />
LÜNEBURG, STADT<br />
Hohlpfennig (15. Jh.), Münzstätte Lüneburg<br />
Löwenschild. Strahlenrand.<br />
Jesse, S. 233, Nr 198; Berger, S. 74. Nr. 552-553.<br />
219 0,179 g; 14,3/13,2 mm; e; BI. A 2, K 2. Rand zu '/t<br />
abgebrochen oder beschnitten? K 0611/0220.<br />
81
BÖHMEN<br />
BÖHMEN, KÖNIGREICH<br />
KARL I. (1346-1378)<br />
Groschen (1346-1378), Münzstätte Kuttenberg<br />
Vs. Innere Legende: + KAROLVS (Bz.) PRIMVS;<br />
Äussere Legende: + DEI (Bz.) GRATIA (Bz.) REX (Bz.)<br />
BOEMIE; Krone in Perlkreis.<br />
Rs. + (6z. Stern) GROSSI (Bz.) PRAGENSES (6z. Stern);<br />
Böhmischer Löwe.<br />
Slg. Donebauer, S. 84, Nr. 836 Typ.<br />
Mit 2 Gegenstempeln<br />
220 1,824 g; 28,1/26,5 mm; 360°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + KAROLVS £ PRIMVS; [- DE]I i G[RATIA —<br />
BO]EM[IE];<br />
Rs. [— G]ROS[SI —]; Vs. Hieb.<br />
Gegenstempel: Rs. (1) Nördlingen (Krusy, N 3,16),<br />
Vs. (2) Ulm (Krusy, U 2,5). K 0611/0258.<br />
WENZEL IV. (1378-1419)<br />
Groschen (1378-1419 und später), Münzstätte Kuttenberg<br />
Vs. Innere Legende: + WEnCEZLAVS (Bz.) TERCIVS;<br />
Äussere Legende: + DEI (Bz.) GRATIA (Bz.) REX (Bz.)<br />
BOEMIE; Krone in Perlkreis.<br />
Rs. + (6z. Stern) GROSSI (Bz.) PRAGENSES (6z. Stern);<br />
Böhmischer Löwe.<br />
Slg. Donebauer, S. 85, Nr. 850 Typ.<br />
Ohne Gegenstempel<br />
221 2,469 g; 27,6/26,5 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2,<br />
Vs. + WEnCEZLAVS 8 TERCIVS; [— GRJATIA (4bl.<br />
Rosette) R[EX — ];<br />
Rs. [— PRAGENS1ES [-]; K 0611/0225.<br />
222 2,345 g; 26,6/25,7 mm; 170°; AR. A 2/2. K 2/2.<br />
Vs. + WEnCEZLAVS: TERCIVS; [— GRATRA (4hl. Rosette)<br />
1—1;<br />
Rs. + (6z. Stern) GR[0SSI —]; K 0611/0224.<br />
223 2,263 g; 27,5/25,1 mm; 220°; AR. A 4/3, K 2/2.<br />
Vs. [- WElnCEZLLAVS]: TER[CIVS] ; [— GRA]TIA [—];<br />
Rs. + (6z. Stern) GROfSSI - P]RAGEN[SES] (6z. Stern);<br />
K 0611/0227.<br />
224 2,110 g; 27,5/25,8 mm; 90°; AR. A 3/3, K 3/2.<br />
Vs. [- WENCEZLAjVS: TERCIVS; [— RE]X £ BOEMIE;<br />
Rs. + (6z. Stern) [— PRAGENJSES (6z. Stern);<br />
K 0611/0226.<br />
82<br />
225 1,759 g; 27,8/27,2 mm; 360°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + W[EN]CEZLAVS 8 TERCIVS; + DEI [- GRATJIA (4bl.<br />
Rosette) [— BOEMIJE;<br />
Rs. + (6z. Stern) [—] PRA[GENSE]S (6z. Stern); Risse, Vs.<br />
und Rs. dezentrierte Prägung, Vs. tiefe Kratzer, Hieb oder<br />
unbestimmter Gegenstempel? Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0277.<br />
Mit 1 Gegenstempel<br />
226 2,409 g; 28,7/26,9 mm; 320°; AR. A 3/3, K 3/2.<br />
Vs. + WEnCEZLAVS 8 TERCIVS; + DEI S GRfATIA -<br />
RE]X£B[OEMIE];<br />
Rs. + (6z. Stern) G[ROSSI - PRAGJENSES (6z. Stern);<br />
Stempelschaden zwischen den beiden letzten Buchstaben<br />
der Rs.-Legende.<br />
Gegenstempel: Rs. Isny (Krusy, I 3,1). K 0611/0230.<br />
227 2,460 g; 26,7/26,4 mm; 80°; AR. A 3/3, K 3/3.<br />
Vs. + W[ENCEZLAVS - TER1CIVS; + D[EI — BOEMIJE;<br />
Rs. [— PR]AGEN[SES -];<br />
Gegenstempel: Vs. Isny (Krusy, I 3,2). K 0611/0231.<br />
228 2,384 g; 28,5/27,8 mm; 90°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WE[NCE]ZLAfVS -] TERfCIVS];<br />
[- D]EI SGR[A]TI[A —];<br />
Rs. [— PRA]G[ENSES -]; Riss (Schrötlingsfehler),<br />
Vs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Rs. Kempten (Krusy, K 3,2). K 0611/0233.<br />
229 2,817 g; 28,5/26,5 mm; 220°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WE[NCEZL]AVS 8 TERCIVS; [- D]EI Z [— R]EX<br />
[- BOE1MIE;<br />
Rs. [— PRAG]ENSE[S -]; Rs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Vs. Konstanz (Krusy, K 5,6). K 0611/0237.<br />
230 2,108 g; 27,1/25,4 mm; 350°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WE[N]CEZLAVS 8 TERCIVS; [— G]RATIA (4bl.<br />
Rosette) RE[X —];<br />
Rs. [— GR01SSI (4bl. Rosette) PRAGEN[SES -];<br />
Gegenstempel: Rs. Konstanz (Krusy, K 5,6). K 0611/0236.<br />
231 2,355 g; 26,7/25,9 mm; 45°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WEnCEZLLAVS - TE]RC[IV]S; [—];<br />
Rs. [—]; Rand leicht ausgebrochen.<br />
Gegenstempel: Rs. Konstanz (Krusy, K 5,9). K 1305/0091.<br />
232 2,456 g; 28,0/27,5 mm; 80°;'AR. A 2/2, K 3/2.<br />
Vs. + WEnCEZLAVS 8 TE[RC1VS]; + DEI £GRATI[A —];<br />
Rs. + (6z. Stern) G[ROSSI -] PRAGENS1ES -];<br />
Gegenstempel: Vs. Konstanz? (Krusy, X 73).<br />
K 0611/0235.<br />
233 2,470 g; 26,4/25,2 mm; 30°; AR, A 3/3, K 3/2.<br />
Vs. + W1ENCEZ1LAVS: TERCIVS; [— R]EX iB0EM[IE];<br />
Rs. + (6z. Stern) GROfSSI —] (6z. Stern);<br />
Gegenstempel: Vs. Lindau (Krusy, L 2,3). K 0611/0239.<br />
234 2,348 g; 27,5/26,2 mm; 360°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. [- WENJCEZLAVS: T[ERCIVS]; [— GRATI]A (4bl.<br />
Rosette) REX [—];<br />
Rs. [—]; Vs. u. Rs. dezentrierte Prägung.<br />
Gegenstempel: Rs. Lindau (Krusy, L 2,3). K 0611/0240.
235 1,674 g; 25,7/22,8 mm; 210°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. [- WE]HCEZ[L]AVS [-] TERCIV[S]; [—] GRfATIA —<br />
B]OEM[IE] ;<br />
Rs. [— PRA]GENSE[S -];<br />
Gegenstempel: Vs. Memmingen (Krusy, M 3,3).<br />
K1305/0099.<br />
236 2,506 g; 26,8/26,0 mm; 160°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + [W]En[CEZL]AV[S - TER]C[I]VS; [—];<br />
Rs. [— GROSSR (4bl. Rosette) [—]; Vs. Doppelschlag,<br />
dezentrierte Prägung.<br />
Gegenstempel:-Vs. Nördlingen (Krusy, N 3,16).<br />
K 0611/0249.<br />
237 2,163 g; 28,4/27,0 mm; 110°; AR. A 2/2, K 2/3.<br />
Vs. + WEnClEZLAVS] g TERCIVS: + DE[I — RE]X £<br />
BOEMIE;<br />
Rs. + (6z. Stern) G[ROSSI - PRAG1ENSES (6z. Stern);<br />
Gegenstempel: Rs. Nördlingen (Krusy, N 3,16).<br />
K1305/0094.<br />
238 2,144 g; 27,2/26,3 mm; 300°; AR. A 4/4, K 2/2.<br />
Vs. [- WENCEZLA]VS: TE[RCIVS] ; [— R]EX £ BOEMflE];<br />
Rs. [-- GROS]SI (6z. Stern) PRAGENSES [-];<br />
Gegenstempel: Rs. Nürnberg (Krusy, N 5,7).<br />
K 0611/0251.<br />
239 2,304 g; 28,2/25,9 mm; 225°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WENCEZLAVS: T[ERC]IVS: + DEI £ GRA[T]IA (4bl.<br />
Rosette) REX £ BOE[MI]E:<br />
Rs. + (6z. Stern) GROSSI [- PRAGENS]ES (6z. Stern); Falz,<br />
Rand ausgebrochen, Vs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Vs. Ravensburg (Krusy, R 3,3).<br />
K 0611/0253.<br />
240 2,402 g; 27,8/27,1 mm; 340°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WENCEZLAVS g TER1CIVS]; [-] DEI £ GRATIA (4bl.<br />
Rosette) REX [—];<br />
Rs. + [— PRAGEN]SES (6z. Stern);<br />
Gegenstempel: Vs. Regensburg (Krusy, R 4,1).<br />
K 1305/0084.<br />
241 2,139 g; 27,1/25.8 mm; 200°; AR. A 2/2, K 3/2.<br />
Vs. + WEHCEIZLAVS - TERCRVS; [- DE]I £GRAT[1A —];<br />
Rs. [—] GROSS[I —]; Vs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Rs. Salzburg (Krusy, S 1,3). K 0611/0254.<br />
242 2,454 g; 27,0/26,4 mm; 270°; AR. A 3/3, K 3/3.<br />
Vs. [- WENC1EZLAVS g TERC[IVS]; [— GR]ATIA (4bl.<br />
Rosette) REX [-] BOEMDE];<br />
Rs. + [- GR0S]SI (4bl. Rosette) PRAGENSES (6z. Stern);<br />
Gegenstempel: Vs. Riedlinger Bund (Krusy, S 5,7).<br />
K 0611/0255.<br />
243 2,419 g; 26,7/26,1 mm; 300°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. [- WENCEZIJAVS [-] TE[RCLVS] ; [— GRA]TIA (4bl.<br />
Rosette) [RE]X £B|.0EMIE] ;<br />
Rs. [— PRAG]ENSE[S -]; Vs. und Rs. dezentrierte<br />
Prägung.<br />
Gegenstempel: Vs. Ulm (Krusy, U 2,5). K 0611/0260.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
244 2,388 g; 29,8/28.6 mm; 160°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. [- W]EnCEZLA[VS -] T[ERC]IVS; [— G]RATLA (4bl.<br />
Rosette) REX £ BOEMIE:<br />
Rs. + (6z. Stern) GROSSI (4bl. Rosette) PRA[GEN]SES<br />
(6z. Stern); Vs. tiefe Kratzer.<br />
Gegenstempel: Rs. Ulm (Krusy, U 2,8). K 1305/0096.<br />
245 2,561 g; 27,5/27,0 mm; 45°; AR. A 4/4, K 2/2.<br />
Vs. + WENCEZLAVIS - TER]CIfV]S; [—];<br />
Rs. [— PRAGENS1ES (6z. Stern); Rs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Rs. Wangen (Krusy, W 1,4). K 0611/0257.<br />
Mit 2 Gegenstempeln<br />
246 2,168 g; 27,3/26,6 mm; 220°; AR. A 3/3, K 3/3.<br />
Vs. [- W]EnCEZ[L]ArV]S: TER1CIVS]; [—] GRATIA [—];<br />
Rs. + (6z. Stern) GROSSI [- PRAG]E[NSES] (6z. Stern);<br />
Gegenstempel: Rs. Augsburg (Krusy, A 6,2), Heilbronn<br />
(Krusy, H 4,2). K 0611/0229.<br />
247 2,316 g; 26,2/25,4 mm; 270°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WEZfCEZLJAVS 8 TERC[IV]S; [— GRATRA (4bl.<br />
Rosette) REX £B[0EMIE] ;<br />
Rs. + (6z. Stern) G[R0SS1 - P]RAGENS[ES -];<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Augsburg (Krusy, A 6,1),<br />
(2) Konstanz (Krusy, K 5,9). K 0611/0234.<br />
248 2,401 g; 26.7/25,5 mm; 350°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WEHCEZ1LAVS - TEJRCIVS; [— RE]X £B0E[MIE] ;<br />
Rs. + (6z. Stern) GROSSI (4bl. Rosette) P[RAGE]NSES [-]:<br />
Gegenstempel: Rs. (1) Augsburg (Krusy, A 6,2), Vs.<br />
(2) Konstanz (Krusy, K 5,9). K 1305/0092.<br />
249 2,548 g; 27,2/25,8 mm; 200°; AR, A 2/3, K 2/2.<br />
Vs. + [- WENCEZLJAVS: TERCIVS; [— RE]X £ B0[EMIE] ;<br />
Rs. [— PRA]GEN[SES -];<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Augsburg (Krusy, A 6,2),<br />
(2) Nürnberg (Krusy, N 5,7). K 0611/0252.<br />
250 2,172 g; 27,3/26,3 mm; 140°; AR. A 3/3, K 3/2.<br />
Vs. + WEnCEZLAVS g TER[CIV]S; [- D]EI £ GRATIA (4bl.<br />
Rosette) RE[X] £ BIOEMIE];<br />
Rs. + (6z. Stern) GROSSI [-] PR[AGENSES -];<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Augsburg (Krusy, A 6,1), (2) Ulm<br />
(Krusy, U 2,11). K 0611/0264.<br />
251 2,358 g; 28,8/27,3 mm; 70°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. [—] g TERCIVS; [— RE]X £B0EM[IEJ;<br />
Rs. + (6z. Stern) GR[0S]SI [- PRAGENSE]S (6z. Stern);<br />
Rs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Rs. (1) Augsburg (Krusy, A 6,3), (2) Ulm<br />
(Krusy, U 2,6). K 0611/0262.<br />
252 1,958 g; 27,3/27,0 mm; 80°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WEnCEZLAVS 8 [T]ERCIVS; [- DER £ GRATIA [—];<br />
Rs.[—] PRAGEN[SES -]; Vs. und Rs. dezentrierte<br />
Prägung.<br />
Gegenstempel: Rs. (1) Eichstätt (Krusy, E 1,4), (2) Ulm<br />
(Krusy, U 2,6). K 0611/0274.<br />
253 2,338 g; 28,4/27,1 mm; 360°; AR. A 3/3, K 2/3.<br />
Vs. + WENCEZLAVIS - ] TERCIVS; [— RE]X £ B[0EMIE];<br />
83
Rs. + (6z. Stern) G[ROSSI - PRAGENJSES (6z. Stern);<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Eichstätt (Krusy, E 1,6), (2) Ulm<br />
(Krusy, U 2,8). K 0611/0270.<br />
254 2,333 g; 27,4/26,7 mm; 220°; AR. A 4/4, K 2/2.<br />
Vs. + W[ENCEZLAVS - T]ER[CIVS]; + DE[I — B]OE[MIE] ;<br />
Rs. [— GROSS1I (6z. Stern) P[R]AGE[NSES -];<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Esslingen (Krusy, E 5,1),<br />
Rs. (2) Ulm (Krusy, U 2,13): Doppelschlag. K 0611/0242.<br />
255 2,771 g; 28,3/27,8 mm; 340°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [- WENCEJZLAVS g TERCRVS]; [- DER £G[RATIA -<br />
RE]X£B[OEMIE];<br />
Rs. [— GR0SS1I (4bl. Rosette) PRAG[ENSES -];<br />
Vs. Kratzer, Rs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Vs. Feldkirch (Krusy, F 1,1), Heilbronn<br />
(Krusy, H 4,2). K 0611/0244.<br />
256 2,289 g; 26,5/25,2 mm; 180°; AR. A 3/3, K 3/2.<br />
Vs. [- WENJCEZLAVS g TERCIVfS]; [— GR]ATIA (4bl.<br />
Rosette) REX £ B0E[MIE] ;<br />
Rs. + (6z. Stern) GR10SSI - PRJAGENSES (6z. Stern);<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Frankenberg (Krusy, F 2,1),<br />
Rs. (2) Ulm (Krusy, U 2,6). K 0611/0275.<br />
257 2,291 g; 27,0/25,8 mm; 70°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [- W]ENCEZLAV[S - T]ERCIV[S]; [- D]EI £ GRATIA [—];<br />
Rs. [— GROJSSI (4bl. Rosette) PRAG1ENSES -];<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Kempten (Krusy, K 3,2), (2)<br />
Feldkirch (Krusy, F 1,1). K 0611/0248.<br />
258 2,549 g; 27,8/26,7 mm; 110°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WEnC[EZL]AVS [- T]ERCIVS; [-] DEI [— RE]X £<br />
B0EM[IE];<br />
Rs. + (6z. Stern) GROfSSI - PRA]GENSES (6z. Stern);<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Kempten (Krusy, K 3,3),<br />
Rs. (2) Ulm (Krusy, U 2,5). K 1305/0086.<br />
259 2,288 g; 27,8/27,1 mm; 20°; AR. A 3/3, K 3/2.<br />
Vs. + WEnCEZLAVS 8 T[ER]C[IVS]; [— GRATRA [-] REX<br />
[--];<br />
Rs. [—] P1RAGENSES (6z. Stern); Vs. stark dezentrierte<br />
Prägung.<br />
Gegenstempel: Rs. (1) Kempten (Krusy, K 3,1 Var.: andere<br />
Buchstabenform), Vs. (2) Urach (Krusy, U 4,1).<br />
K 0611/0276.<br />
260 2,427 g; 27,4/26,5 mm; 160°; AR. A 3/3, K 3/3.<br />
Vs. + W[ENCEZL]AVS g TERCIVS; + D[EI —] (4bl.<br />
Rosette) R[EX — ];<br />
Rs. [— PRAGEN1SES (6z. Stern);<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Konstanz? (Krusy, X 66,4), (2) Ulm<br />
(Krusy, U 2,6). K 0611/0269.<br />
261 2,445 g; 28,4/27,0 mm; 360°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WEfNCEZLJAVS [- TERCRVS; + DEI [— B0E1MIE;<br />
Rs. + (6z. Stern) GR10SSI -] PRA[GENS]ES (6z. Stern);<br />
Rs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Nördlingen (Krusy, N 3,9),<br />
(2) Salzburg (Krusy, S 1,4). K 1305/0085.<br />
84<br />
262 2.290 g; 27,5/25,7 mm; 220°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + [- WENCEZ1LAVS: TERCIVS; [— GRATRA (4bl.<br />
Rosette) REX [—];<br />
Rs. [— PRAGE]NSE[S -];<br />
Gegenstempel: Rs. (1) Nürnberg (Krusy, N 5,7),<br />
(2) Schwäbisch Hall (Krusy, S 7,1). K 0611/0232.<br />
263 2,318 g; 27,6/27,0 mm; 180°; AR. A 3/3, K 3/2.<br />
Vs. + WEHCEIZLAVS -] TERCIVS; + DEI £ [—] BOEMIE;<br />
Rs. + (6z. Stern) GROSSI (4bl. Rosette) PRAGE[NSES] (6z.<br />
Stern); Vs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Rs. Ravensburg (Krusy, R 3,3), Feldkirch<br />
(Krusy, F 1,2). K 1305/0083.<br />
264 2,006 g; 28,6/27,2 mm; 300°; AR. A 2/3, K 3/3.<br />
Vs. [- WENCEZLA1VS g TERCIVfS]; [—] REX £ BOEfMIE];<br />
Rs. [— PRA]GENSE[S -];<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Ravensburg (Krusy R 3,3),<br />
Rs. (2) Feldkirch (Krusy, F 1,2). K 0611/0246.<br />
265 2,616 g; 27,5/26,8 mm; 360°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. [- WENCEZL]AVS g TERCIVfS]; [— R]EX £ B01EMIE];<br />
Rs. [— GRO]SSI (6z. Stern) PRfAGENSES -];<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Ravensburg (Krusy, R 3,1),<br />
(2) Konstanz (Krusy, K 5,9). K 1305/0081.<br />
266 2,526 g; 27,3/26,1 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. + WEHCEZLAVS g TER[CIVS]; [— GRATRA (4bl.<br />
Rosette) REX £B0[EM]IE;<br />
Rs. + (6z. Stern) GROSSI (4bl. Rosette) PR[AG]E[N]SES [-];<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Salzburg (Krusy, S 1,3),<br />
(2) Nördlingen (Krusy, N 3,3). K 0611/0250.<br />
267 1,851 g; 26,1/24,8 mm; 220°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. [- WENCEZIJAVS g TERCMS]; [— R]EX £ BOEfMIE];<br />
Rs. [— PRA]GENSES (6z. Stern); Vs. tiefe Kratzer.<br />
Gegenstempel: Vs. (1?) Ulm (Krusy, U 2,8), (2?) Bayreuth<br />
(Krusy, B 2,1). K 0611/0268.<br />
268 2,258 g; 27,5/26,9 mm; 190°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WEnCEZLAVS g TERCIVS; [— GR]AT[IA — ];<br />
Rs. [—]; Vs. und Rs. dezentrierte Prägung.<br />
Gegenstempel: Rs. (1) Ulm (Krusy, U 2,8), (2) Feldkirch<br />
(Krusy, F 1,1). K 0611/0245.<br />
269 2,099 g; 26,9/24,2 mm; 270°; AR. A 3/3, K 3/2.<br />
Vs. [-] WEMCEZLAVS g TE[RCIVS] ; [— GRATJIA [- R]EX £<br />
B[OEMIE] ;<br />
Rs. [— PRAGEN]SE[S -]; ein Stück des Randes<br />
ausgebrochen.<br />
Gegenstempel: Rs. Urach (Krusy, U 4,1), Ulm, doppelte<br />
Stempelung, um 90° gedreht (Krusy, U 2,8).<br />
K 0611/0265.<br />
270 2,239 g; 28,2/27,0 mm; 290°; AR. A 3/3, K 2/3.<br />
Vs. [- WENCEZL]A[V]S: TERCIVS; [—] BOEMflE];<br />
Rs. [— GR0S]SI (4bl. Rosette) PRA[GENSES -]; Rand<br />
ausgebrochen.<br />
Gegenstempel: Vs. (1) unbest. runder Gegenstempel mit<br />
Wulstreif, (2) Ulm (Krusy, U 2,5). K 0611/0259.
Mit 3 Gegenstempeln<br />
271 2,419 g; 27,2/26,8 mm: 180°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + [WENCEZ1LAVS [- TERJCIVS; + [— RE]X i<br />
B[OEM]IE;<br />
Rs. [—];<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Augsburg (Krusy, A 6,2),<br />
(2) Radolfzell (Krusy, R 1,2), (3) Ulm (Krusy, U 2,3).<br />
K 1305/0087.<br />
272 2,041 g; 27,3/25,2 mm ; 150°; AR. A 3/3, K 3/2.<br />
Vs. [- WENC]EZLA[V]S g TER[CIVS] ; [—] 5 BOE[MIE];<br />
Rs. + [— GR]OSS[I - PRAGENJSES (6z. Stern); Vs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Augsburg (Krusy, A 6,2).<br />
(2) Riedlinger Bund (Krusy, S 5,5), (3) Feldkirch (Krusy,<br />
F 1,1). K 0611/0243.<br />
273 2,452 g; 26,3/25,8 mm ; 180°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. + WEV1CEZLAVS [- TERJCIVS; + DEI £ GRATIA [—<br />
BOEJMIE;<br />
Rs. [—] PRAGEN[SES -]; Rs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Rs. (1) Augsburg (Krusy, A 6,2 Var.:<br />
«Fuss» des Pyr anders gestaltet), Vs. (2) Ulm (Krusy, U 2,<br />
6-8), (3) Radolfzell (Krusy, R 1,2). K 0611/0272.<br />
274 2,626 g; 27,0/25,0 mm; 90°; AR. A 3/3, K 3/2.<br />
Vs. + [- WEN1CEZLAVS g TERCIVS; [—];<br />
Rs. [— GR10SSI (4bl. Rosette) PRA[GENSES -]; Riss, nach<br />
Prägung entstanden (bei Gegenstempelung?).<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Riedlinger Bund (Krusy, S 5,7),<br />
(2) Feldkirch (Krusy, F 1,1), Göppingen (Krusy, G 1,1).<br />
K 0611/0247.<br />
275 2,217 g; 27,4/26,6 mm; 190°; AR. A 4/4, K 2/2.<br />
Vs. + WENCEZ[LAVS - TJERCIVS; [—1;<br />
Rs. + (6z. Stern) GROSSI [-] PRAGENSES (6z. Stern);<br />
Gegenstempel: Rs. (1?) Riedlinger Bund (Krusy, S 5,6),<br />
Vs. (2?) Riedlinger Bund (Krusy, S 5,2), Rs. (3) Feldkirch<br />
(Krusy, F 1,2). K 1305/0082.<br />
276 2,043 g; 27,2/25,5 mm; 150°; AR. A 3/3, K 2/3.<br />
Vs. + WIENCEZLAVS - TEJRCIVS; [—];<br />
Rs. [— PR]AGENS[ES -];<br />
Gegenstempel: Vs. (1?) Schwäbisch Gmünd (Krusy,<br />
S 6,3), Rs. (2?) Schafihausen (Krusy, S 3,1), Vs. (3) Ulm<br />
(Krusy, U 2,3). K 1305/0088.<br />
277 2,287 g; 27,3/26,3 mm; 120°; AR. A 3/3, K 3/3.<br />
Vs. + WEnCEZLALVS - TERJCIVS; [-1 DEI [-] GRATIA [—];<br />
Rs. [— G]RO[S]SI [-] PRAGENSE[S -]; leicht ausgebrochen.<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Ulm (Krusy, U 2,10), (2) Riedlinger<br />
Bund (Krusy, S 5,7); Rs. (3) Konstanz (Krusy, K 5,4).<br />
K 0611/0238.<br />
278 2,414 g; 28,0/26,6 mm; 45°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + [WENCEZLAVS - TE1RCIVS; [---];<br />
Rs. + (6z. Stern) G[ROSSI] (4bl. Rosette) P[RAGENSE]S<br />
(6z. Stern);<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Gegenstempel: Rs. (1?) Ulm (Krusy. U 2,6), (2?) Urach<br />
(Krusy, U 4,1), (3) Konstanz (Krusy, K 5,9). K 1305/0097.<br />
279 2,371 g; 27,2/25,9 mm; 280°; AR. A 3/3, K 3/3.<br />
Vs. + WE[NC]EZLAVS g TE[RCIV]S; + DEI i [GRATIA -]<br />
REX [- BOEMRE:<br />
Rs. [-] (6z. Stern) GROSSI [- PRA]GENS[ES -];<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Weinsberg (Krusy, W 3,1),<br />
(2) unbest. Gegenstempel, (kleiner, runder Gegenstempel<br />
mit breitem Wulstreif, Wangen?), (3) Ulm (Krusy, U 2,3).<br />
K 0611/0273.<br />
Mit 4 Gegenstempeln<br />
280 1,970 g; 28,2/26,9 mm; 60°; AR. A 3/3, K 3/3.<br />
Vs. [- WE]N[C]EZLAV[S - T]ER[CIVS]; + [— B]OEMI[E] ;<br />
Rs. + (6z. Stern) GR[OSSI - PRAGENSE]S (6z. Stern);<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Nördlingen (Krusy, N 3,3),<br />
(2) unbest. runder Gegenstempel (nur Wulstreif sichtbar),<br />
(3) Ulm (Krusy, U 2,11), (4) Marburg (Krusy, M 1,1).<br />
K 0611/0241.<br />
WENZEL IV?<br />
Groschen (1378-1419 und später?), Münzstätte<br />
Kuttenberg<br />
Vs. Innere Legende: + WEnCEZLAVS (Bz.) TERCIVS;<br />
Äussere Legende: + DEI (Bz.) GRATIA (Bz.) REX (Bz.)<br />
BOEMIE; Krone in Perlkreis.<br />
Rs. + (6z. Stern) GROSSI (Bz.) PRAGENSES (6z. Stern);<br />
Böhmischer Löwe.<br />
Slg. Donebauer, S. 85, Nr. 850 Typ.<br />
Ohne Gegenstempel<br />
281 2,324 g; 27,6/26,9 mm; 10°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WEn[CEZLAVS —]; [—]; Rs. [—]; K 0611/0228.<br />
Mit 1 Gegenstempel<br />
282 2,320 g; 27,1/25,8 mm; 60°; AR. A 4/4, K 2/2.<br />
Vs. + WENCEfZLAVS -][—]S; [— BOEMJ1E;<br />
Rs. + (6z. Stern) [— PRAGENS1ES (6z. Stern);<br />
Gegenstempel: Rs. Feldkirch (Krusy, F 1,1). K 1305/0098.<br />
283 2,214 g; 27,8/26,3 mm; ca. 360°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. [- WENCJEZLAfVS —]; [— GRATRA (4bl. Rosette) [---];<br />
Rs. [— GROSSR [-] PRAG[ENSES -];<br />
Gegenstempel: Vs. Lindau (Krusy. L 2,3). K 1305/0093.<br />
284 2,305 g; 25.8/26,5 mm; 80°; AR. A 3/3, K 3/3.<br />
Vs. + WENCEZLAVS [—]: [- DER i GRATIA [— |;<br />
Rs. [- GROS1SI (4bl. Rosette) PRAG[ENSES -];<br />
Gegenstempel: Rs. Riedlinger Bund (Krusy, S 5,4).<br />
K 0611/0256.<br />
285 2,189 g; 29,3/28,5 mm; 270°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. + WENCEZ1LAVS -] [—]VS; [- DER i G1RATIA —];<br />
Rs. + (6z. Stern) G[ROSSI —];Vs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Rs. Riedlinger Bund (Krusy, S 5,6),<br />
zweiter Gegenstempel oder Hieb? K 1305/0095.<br />
85
286 2,392 g; 27,1/26,1 mm; 360°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. [- WE]NC[EZ]LA[VS —]; [—];<br />
Rs.[—];<br />
Gegenstempel: Rs. Ulm (Krusy, U 2,2): Doppelschlag.<br />
K 0611/0261.<br />
287 1,195 g; 28,3/15,7 mm; ca. 90°; AR. A 3/3, K 3/3.<br />
Vs. [- WE]ZCEZ[LAVS — ]; [—] £GRATI[A —];<br />
Rs. [— GR0S1SI [-] PRA[GENSES -]; Fragment, knapp Vz<br />
der Münze erhalten, zusammengesetzt aus zwei<br />
Fragmenten.<br />
Gegenstempel: Rs. Ulm (Krusy, U 2,6). K 0611/0462.<br />
Mit 2 Gegenstempeln<br />
288 2,383 g; 27,7/26,9 mm; 80°; AR. A 4/4, K 2/2.<br />
Vs. + WEnCEZL[AVS —]; + DEI £ GRAITIA — BOEMIJE;<br />
Rs. [— PRAG]EN[SES -]; Vs. stark dezentrierte Prägung.<br />
Gegenstempel: Vs. (1) Augsburg (Krusy, A 6,1), (2) Ulm<br />
(Krusy, U 2,1). K 0611/0263.<br />
289 2,281 g; 27,0/26,6 mm; 270°; AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. [-] WEnCEZLAVtS —]; [-] DEI £ GR[ATIA —];<br />
Rs. [---]; Vs. leichter Doppelschlag, Rs. Hieb.<br />
Gegenstempel: Rs. (1) Ulm (Krusy, U 2,8), (2) Ravensburg<br />
(Krusy, R 3,3). K 0611/0267.<br />
Mit 3 Gegenstempeln<br />
290 2,177 g; 26,8/26,0 mm; 60°; AR. A 3/3, K 3/2.<br />
Vs. [- WENCE]ZL[AVS —]; [— GR]AT[IA —];<br />
Rs. [—]; Hieb im Rand, Vs. dezentrierte Prägung.<br />
Gegenstempel: Rs. (1, 2) Attendorn, zweimal derselbe<br />
Stempel, der eine vom Ulmer Gegenstempel überdeckt<br />
(Krusy, A 4,12), (3) Ulm (Krusy, U 2,3). K 0611/0271.<br />
Mit 4 Gegenstempeln<br />
291 2,353 g; 26,4/25,5 mm; 310°: AR. A 3/3, K 2/2.<br />
Vs. [- WE]NCEZL[AVS —]; [—];<br />
Rs. [—]; Riss.<br />
Gegenstempel: Rs. (1) Riedlinger Bund (Krusy, S 5,1-4),<br />
(2) unbest. Gegenstempel (kleiner, runder Gegenstempel<br />
mit Buchstabe R?), Vs. (3) Göppingen (Krusy, G 1,9),<br />
(4) Ulm (Krusy, U 2,5). K 0611/0266.<br />
86<br />
TIROL<br />
TIROL, GRAFSCHAFT<br />
LEOPOLD IV. (1395-1406)<br />
Vierer (1395-1406), Münzstätte Meran<br />
Variante 1<br />
Vs. + LVPO (5bl. Rosette) LDVS; Kreuz, in den Winkeln je<br />
eine fünfhlättrige durchstossene Rosette.<br />
Rs. + CONES (5bl. Rosette) T[IR]0L (5bl. Rosette);<br />
Adler.<br />
CNA I, S. 357, Nr. J 40 Typ; Rizzolli, S. 56, Nr. 12d Typ;<br />
CNI VI, S. 125, Nr. 29.<br />
292 0,335 g; 15,0/13,8 mm; 30°; BI. A 2/2, K 3/3.<br />
K 0611/0001.<br />
Variante 2<br />
Vs. + LVPO (5bl. Rosette) LDVS (wie Var. 1); Kreuz, in den<br />
Winkeln je eine fünfblättrige nicht durchstossene Rosette.<br />
Rs. +1CONES (5bl. Rosette) TRROL •; Adler.<br />
CNA I, S. 357, Nr. J 40 Typ; CNI VI, S. 125, Nr. 30.<br />
293 0,331 g; 15,1/13,9 mm; 210°; BL A 1/1, K 3/3.<br />
K 0611/0002.<br />
FRIEDRICH IV. (1406-1439)<br />
Vierer (1406-1439), Münzstätte Meran<br />
Vs. + DX (Bz.) FRIDRICVS; Bindenschild auf Kreuz<br />
liegend.<br />
Rs. + COMES (Bz.) TIROL; Adler.<br />
CNA I, S. 358, Nr. J 43; Rizzolli, S. 56, Nr. 13 Bb.<br />
294 0,425 g; 16,2/15,1 mm; 330°; BI. A 2/2, K 3/3.<br />
Vs. + DX [-] FRIDRICVS;<br />
Rs. + COMES • TIROL; K 1305/0107.<br />
295 0,387 g; 14,9/13,7 mm; 220°; BI. A 2/2, K 3/3.<br />
Vs. + DX • FRIDRICVS;<br />
Rs. COMES (Rosette) TIROL; K 1305/0116.<br />
296 0,242 g; 14,9/13,5 mm; 30°; BI. A 2/2, K 3/3.<br />
Vs. + [DX - F]R1DRICVS;<br />
Rs. + COMES (Rosette) TIROL; unregelmässiger Schrötling.<br />
K 0611/0006.
Anteil, darunter die einzige Goldmünze, verkaufte<br />
dieser wohl noch im Sommer oder im Herbst 1931<br />
an einen privaten Sammler. Aus der Korrespondenz<br />
zwischen dem Finder und dem Käufer geht<br />
hervor, dass auch später noch Münzen zum Vorschein<br />
kamen, die der Finder dem Sammler in<br />
mehreren Etappen zum Kauf anbot. 2<br />
" Da der Finder<br />
immer wieder an dieselbe Person gelangte, die<br />
ihm offenbar durch persönliche Beziehungen bekannt<br />
war, kann vermutet werden, dass er wohl<br />
keinen weiteren Privatpersonen Münzen des Fundes<br />
verkaufte. 21<br />
Glücklicherweise blieb dieser 157 Münzen umfassende<br />
Anteil des Fundes in Privatbesitz auch<br />
nach dem Tod des Sammlers in seiner Gesamtheit<br />
erhalten. 22<br />
Die heutigen Besitzer der Sammlung erlaubten<br />
freundlicherweise die Bearbeitung auch<br />
dieses Fundanteils.<br />
DIE ÜBERLIEFERUNG DES FUNDES<br />
Der Hauptanteil der Münzen des Schatzfundes gelangte<br />
nach der Auffindung an den Historischen<br />
Verein für das Fürstentum Liechtenstein, der seine<br />
Sammlungen dem Liechtensteinischen Landesmuseum<br />
in Vaduz übergab. Dort war ein kleiner Teil<br />
der Münzen seit 1972 ausgestellt. Ende der 1980er<br />
Jahre wurden die Fundmünzen aus dem Museum<br />
ausgeschieden und in die Fachstelle Archäologie in<br />
Triesen gebracht. Dieser Hauptanteil des Fundes<br />
besteht heute noch aus 414 Münzen gegenüber der<br />
von Kittelberger erwähnten Anzahl von 423 Stücken.<br />
23<br />
Neun Münzen müssen derzeit als verschollen<br />
gelten. 24<br />
Anfang der 1990er Jahre fand sich in der Münzsammlung<br />
des Liechtensteinischen Landesmuseums<br />
ein weiterer Teil des Fundes bestehend aus<br />
11) Zur Karte von Kolleffel vgl. Frick. Alexander: Von zwei Liechtenstein-Karten<br />
in Schweizer Archiven und einer alten Rheinmarke. In:<br />
JBL 53 (1953). S. 179-188 (mit einer Reproduktion der Karte).<br />
18) Dieser Weg entspricht dem Verlauf der heutigen Strasse. Im<br />
Gegensatz zu diesem zweiten Weg ist die direkte Verbindung auf der<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Heber-Karte von 1721 nicht eingetragen. Zur Karte von Jacob Heber<br />
vgl. Fischer, Joseph: Die älteste Karte vom Fürstentum Liechtenstein<br />
mit einem Faksimile der Karte. In: JBL 10 (1910), S. 163-172.<br />
19) Seine Angaben werden bestätigt durch den Jahresbericht des<br />
Historischen Vereins des Fürstentums Liechtenstein von 1931. In:<br />
JBL 31 (1931), S. 151-154, sowie durch den Briefwechsel Kittelbergers<br />
mit dem Historischen Verein (Archiv AFL).<br />
20) Briefe Kirschbaumers an den Sammler vom 26. November 1931<br />
und 25. Oktober 1932. Korrespondenz in Familienbesitz. Fotokopien<br />
im Archiv AFL. Dem zweiten Brief liegt ein Blatt mit je einem Abrieb<br />
der entsprechenden Münzen bei. Es handelt sich um die Nr. 130,<br />
235 und 294 des vorliegenden Katalogs. Wohl auch zu diesen von<br />
Kirschbaume!' nachgelieferten Stücken gehört die folgende, nicht<br />
zum Fund gehörige Münze: Konstanz, Stadt, Kreuzer aus der Zeit<br />
Leopolds (1657-1705), Münzstätte Konstanz; Vs. Einköpfiger Adler,<br />
belegt mit Bindenschild; Rs. Stadtschild auf Doppelkreuz über 0:<br />
Nau, Oberschwaben, S. 38. Nr. 245; 0,486 g; 15,2/14,6 mm; 360°;<br />
BI. A 0/0, K 4/4; AFL, K 1305/0108.<br />
21) Nicht ganz ausgeschlossen werden kann hingegen, dass der<br />
Sammler nur einen Teil der Münzen für sich behielt und andere<br />
weiterverkaufte. Interessanterweise sind nämlich in seinem Anteil<br />
alle wichtigen Münztypen des Fundes vertreten. Es entsteht der<br />
Eindruck, die Stücke seien von einem Kenner bewusst aus einer<br />
grösseren Fundmasse ausgelesen worden. Dies ist aber gemäss der<br />
Schilderung Kittelbergers gar nicht möglich, da der grösste Anteil<br />
des Fundes erst bei den Grabungen des Historischen Vereins zum<br />
Vorschein kam und dieser somit nicht in die Hände Kirschbaumers<br />
gelangt sein kann.<br />
22) Dieser Fundanteil ist erwähnt bei: Diepenbach, Wilhelm: Ein<br />
Beitrag zur Geschichte der Prager-Groschen-Stempelung. In: Frankfurter<br />
Münzzeitung NF 3 (1932). S. 430-434, hier S. 430. Anm. 1.<br />
Krusy hat ihn in Listenform nach brieflichen Angaben von Kittelberger<br />
publiziert (Krusy. S. 377-378). Die Liste ist jedoch in Bezug auf<br />
Stückzahlen wie auch auf die Bestimmungen fehlerhaft. Krusy listet<br />
139 Münzen auf, tatsächlich sind jedoch 157 Münzen vorhanden.<br />
9 Pfennige wurden offensichtlich wegen ihres schlechten Erhaltungszustandes<br />
nicht mitgezählt. Die restliche Differenz von 9 Münzen ist<br />
wohl auf Fehler beim Auszählen zurückzuführen.<br />
23) Die von Kittelberger aufgeführten Stückzahlen sind mit zwei<br />
Ausnahmen korrekt. Von Kittelberger. Nr. 9 (Zürich, Angster, im<br />
vorliegenden Katalog Nr. 145-146). sind zwei Exemplare vorhanden,<br />
nicht nur eines; bei Kittelberger, Nr. 46, fehlt in seinem Katalog die<br />
Stückzahl (1 Exemplar). Die von Kittelberger genannte Gesamtanzahl<br />
von 423 dürfte stimmen.<br />
24) Für diese verschollenen Münzen wurden wie für die vorhandenen<br />
Inventarnummern vergeben. Es handelt sich um je zwei Tiroler<br />
Vierer von Leopold IV. (Kittelberger. Nr. 1: AFL, K 0611/0003-<br />
K 0611/0004) und Friedrich IV. (Kittelborger, Nr. 3: AFL,<br />
K 0611/0007-K 0611/0008), einen Zürcher Plappart (Kittelberger,<br />
Nr. 11: AFL, K 0611/0110), einen Mainzer Pfennig (Kittelberger,<br />
Nr. 34: AFL, K 0611/0208), einen Pfälzer Pfennig (Kittelberger,<br />
Nr. 36: AFL, K 0611/0213), einen Mailänder Grosso (Kittelberger,<br />
Nr. 85: AFL, K 0611/0401) sowie um eine von Kittelberger als<br />
«unbestimmt, schlecht erhalten, unkenntlich» bezeichnete Münze<br />
(Kittelberger, Nr. 91: AFL, K 0611/0422).<br />
45
Abb. 11: Die im Fund<br />
vertretenen Münzstätten<br />
1 Konstanz; 2 Überlingen;<br />
3 Ravensburg; 4 Ulm;<br />
5 Stuttgart; 6 Zürich;<br />
7 Luzern; 8 Bern; 9 Solothurn;<br />
10 Basel; 11 Strassburg;<br />
12 Pforzheim;<br />
13 Heilbronn?; 14 Heidelberg;<br />
15 Wachenheim;<br />
16 Veldenz; 17 Speyer;<br />
18 Neckarsulm; 19 Miltenberg;<br />
20 Bingen; 21 Nancy;<br />
22 Saint-Mihiel;<br />
23 Nürnberg; 24 Neustadt<br />
a.d. Aisch; 25 Altenburg;<br />
26 Lüneburg; 27 Kuttenberg;<br />
28 Meran; 29 Mailand;<br />
30 Pavia; 31 Verona;<br />
32 Genua; 33 Venedig;<br />
34 Bologna.<br />
*k Schellenberg<br />
48
Münzvertrag ein. 32<br />
Der auf fünf Jahre abgeschlossene<br />
Bund sah die Prägung von Schillingen, Pfennigen<br />
und Hellern vor. Schillinge wurden nur in geringem<br />
Umfang geprägt. Dieser Umstand mag erklären,<br />
dass nur ein entsprechendes Exemplar dieses<br />
Nominals im Fund vorhanden ist.<br />
Abgesehen von diesem Konstanzer Schilling stehen<br />
alle übrigen Münzen aus dem Bodenseegebiet<br />
mit dem Riedlinger Münzbund von 1423 in direkter<br />
Verbindung. 33<br />
An diesem Vertrag nahmen die Grafschaft<br />
Württemberg und die meisten oberschwäbischen<br />
Städte teil, jedoch keine Schweizer Städte<br />
mehr. Der Riedlinger Münzbund war während gut<br />
50 Jahren für das Münzwesen im Bodenseeraum<br />
von entscheidender Bedeutung. Laut den Vertragsbestimmungen<br />
wurde die Zahl der Münzstätten auf<br />
drei reduziert (Konstanz, Ulm, sowie Stuttgart für<br />
Württemberg), als Nominale waren Schillinge,<br />
Pfennige und Heller vorgesehen. Überlingen schied<br />
1436 aus dem Bund aus und prägte nach Riedlinger<br />
Art selber diese Nominale, aber nach verringertem<br />
Münzfuss (Moneta Parva). 34<br />
Ravensburg<br />
nahm nicht am Vertrag teil, schlug jedoch ab 1426<br />
selbständig Münzen nach dem Vorbild der Riedlinger<br />
Prägungen.<br />
Im Schellenberger Fund sind die Schillinge und<br />
Pfennige des Riedlinger Bundes wie auch der<br />
Münzstätten in seinem Umkreis (Überlingen und<br />
Ravensburg) vollständig vertreten (Tab. 2). Bei den<br />
zwölf Konstanzer Schillingen zeugt der Reichtum<br />
an Umschriftenvarianten von der langen Prägedau<br />
Schilling Pfennig Heller Total<br />
Konstanz 12 11 23<br />
Ulm 2 9 11<br />
Württemberg 2 5 7<br />
Überlingen 2 23 25<br />
Ravensburg 10 36 1 47<br />
Total 28 84 1 113<br />
Tab. 2: Prägungen aus<br />
dem Umkreis des Riedlinger<br />
Vertrags im Fund<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
er dieser Münzen und von hohen Emissionszahlen<br />
(Nr. 2-13). Dasselbe gilt in etwas reduziertem Masse<br />
auch für die zehn Ravensburger Schillinge (Nr.<br />
50-59). Die Schillinge der übrigen drei Prägestätten<br />
sind nur mit einem oder zwei Stücken vertreten.<br />
Interessanterweise sind die geringhaltigeren<br />
Pfennige von Überlingen und Ravensburg in bedeutend<br />
grösserer Anzahl im Fund vertreten als ihre<br />
mehr Silber enthaltenden Vorbilder. Die Vielzahl<br />
der für diese Prägungen verwendeten Stempel von<br />
teilweise sehr schlechtem Stempelschnitt deutet auf<br />
hohe Emissionszahlen hin. Der einzige Heller aus<br />
dem Umkreis des Riedlinger Vertrages stammt aus<br />
Ravensburg (Nr. 96). Die auffällige Lücke bei den<br />
Hellern ist vermutlich auf geringe Prägezahlen<br />
zurückzuführen. 35<br />
DEUTSCHSCHWEIZ<br />
Die Münzen aus dem Gebiet der heutigen Schweiz<br />
sind relativ schwach im Fund vertreten (37 Stück).<br />
Der grösste Anteil davon (30 Stück) entfällt auf<br />
Zürich, während die übrigen Münzstätten Basel,<br />
Bern, Solothurn und Luzern nur mit einer oder<br />
zwei Prägungen vertreten sind.<br />
Der Hauptanteil dieser Gruppe besteht aus Plapparten.<br />
In der Zeit um 1420 begannen die meisten<br />
münzprägenden Städte der Deutschschweiz mit<br />
der Prägung dieses Nominals im Wert von rund<br />
zwölf bis 15 Hallern. 36<br />
Basel prägte 1425 erstmals<br />
32) Zum Vertrag von 1417 vgl. Cahn, Konstanz, S. 236-241 und<br />
400- 401 (Vertragsurkunde); Schwarz, S. 102-104.<br />
33) Zum Vertrag von 1423 vgl. Cahn, Konstanz, S. 244-254 und<br />
401- 409 (Vertragsurkunde).<br />
34) Nau, Oberschwaben, S. 47.<br />
35) Diesen Schluss zieht Zäch aus den Funden des Alpenrheintals,<br />
wo Pfennige aus dem Umkreis des Riedlinger Vertrages zwar<br />
vorkommen, die Heller aber auch in Siedlungsfunden weitgehend<br />
fehlen. Zäch, Alpenrheintal, S. 228-229.<br />
36) Bern 1421 (nach einer kurzen Emission von 1388), Zürich um<br />
1417, Luzern um 1420?, St. Gallen 1424, Basel 1425, Solothurn um<br />
1460.<br />
49
Plapparte nach den Vorschriften des Rappenmünzbundes,<br />
wovon zwei Stücke im Fund vorhanden<br />
sind (Nr. 150-151). Der Berner Plappart kann der<br />
Prägephase von 1425 bis 1435 zugeordnet werden<br />
(Nr. 148). 37<br />
Von den Zürcher Plapparten sind drei Typen im<br />
Fund vertreten. Der älteste (Nr. 117-126) wurde in<br />
der Zeit um 1417 geprägt. Diese Münze wird in der<br />
Literatur mit den im Vertrag von 1417 erwähnten<br />
Schillingen gleichgesetzt. 38<br />
Diese Zuweisung ist jedoch<br />
nicht gesichert. Auffällig ist die im Vergleich<br />
zu Konstanz grosse Anzahl von zehn Stücken im<br />
Fund und die grosse Vielfalt an Varianten, die auf<br />
eine nicht unbedeutende Prägemenge schliessen<br />
lässt. Sollte diese Zuweisung wirklich zutreffen,<br />
wäre Zürich die einzige Stadt, die in grösserem<br />
Masse nach diesem Vertrag prägte.<br />
Die Zugehörigkeit des zweiten Zürcher Plapparttyps<br />
(Nr. 127-129) zum Münzvertrag von 1424 mit<br />
den Städten St. Gallen und Schaffhausen ist durch<br />
das gemeinsame Münzbild (Blumenkreuz) der Vertragsprägungen<br />
und durch die Datierung des St.<br />
Galler Plapparts gesichtert. Der wegen seiner Adlerdarstellung<br />
als «Krähenplappart» bezeichnete<br />
dritte Typ ist allenfalls schon 1425 oder bald danach<br />
entstanden (Nr. 130-144). 39<br />
Die wenigen im Fund enthaltenen Kleinmünzen<br />
aus dem Schweizer Mittelland unterscheiden sich<br />
in ihrer Machart deutlich von den süddeutschen<br />
Pfennigen mit Perlkreis. Von den in der ersten Hälfte<br />
des 15. Jahrhunderts überregional zirkulierenden<br />
Kleinmünzen von Zürich (Nr. 145-146), Luzern<br />
(Nr. 147) und Solothurn (Nr. 149) kommen die Luzerner<br />
und Zürcher auch in anderen Funden des<br />
Alpenrheintales vor. 40<br />
OBER- UND MITTELRHEIN, ELSASS,<br />
LOTHRINGEN<br />
Die Gruppe der 59 ober- und mittelrheinischen<br />
Pfennige aus der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts<br />
ist bezüglich ihrer Machart sehr einheitlich,<br />
obwohl diese Prägungen aus zehn verschiedenen<br />
Münzstätten stammen. Solche teilweise schüssei<br />
50<br />
förmigen, meist mit einem groben Perlkreis versehenen<br />
Pfennige prägte ab 1423 auch der Riedlinger<br />
Bund, wodurch diese Prägungen im Bodenseegebiet<br />
ebenfalls heimisch wurden. Pfennige dieser<br />
Machart waren somit in ganz Süddeutschland und<br />
im Elsass verbreitet.<br />
Die im Schellenberger Fund enthaltenen Pfennige<br />
decken nahezu das ganze Herkunftsgebiet dieser<br />
Münzen ab. Den grössten Anteil dieser Gruppe<br />
machen die 19 pfälzischen Pfennige aus, worunter<br />
sich Prägungen der Kurpfalz, der Grafschaft Pfalz-<br />
Simmern und der Grafschaft Pfalz-Zweibrücken<br />
befinden. Die zweitgrösste Gruppe, die badischen<br />
Münzen, sind mit 16 Pfennigen und mit einem Heller<br />
im Fund vertreten. In etwas geringerer Zahl liegen<br />
Pfennige aus Speyer und Mainz vor, wenige<br />
Einzelstücke stammen aus Strassburg und wohl<br />
aus Heilbronn. 41<br />
Mehrere dieser ober- und mittelrheinischen<br />
Pfennige lassen sich verschiedenen Münzverträgen<br />
zuweisen. 42<br />
Vom Heidelberger Münzvertrag von<br />
1409 sind alle drei beteiligten Münzherrschaften<br />
vertreten: die Markgrafschaft Baden (Nr. 156-171;<br />
Münzstätte Pforzheim), die Kurpfalz (Nr. 179-180;<br />
Münzstätte Heidelberg) und das Bistum Speyer<br />
(Nr. 195-201). Dieser Münzbund, der als einziges<br />
Nominal den Pfennig ausprägte, sorgte für eine<br />
grössere Verbreitung des mittelrheinischen Pfennigs.<br />
Besonders die badischen und speyerischen<br />
Konventionsmünzen kommen häufig gemeinsam in<br />
Funden vor. 43<br />
Mit der Aschaffenburger Konvention von 1424<br />
zwischen dem Erzbistum Mainz, der Kurpfalz, den<br />
Grafschaften Pfalz-Simmern und Pfalz-Mosbach,<br />
dem Bistum Speyer und der Grafschaft Wertheim<br />
wurde wiederum der Schüsselpfennig zur alleinigen<br />
Vereinsmünze. Im Festhalten an der ausschliesslichen<br />
Prägung von Pfennigen zeigt sich eine gewisse<br />
Rückständigkeit des südlichen Teils des mittelrheinisch-hessischen<br />
Gebietes, das im Gegensatz zu<br />
den umliegenden Gebieten zu diesem Zeitpunkt<br />
noch keine grösseren Silbermünzen prägte. 44<br />
Diesem<br />
Münzvertrag lassen sich zwei mainzische Pfennige<br />
des Fundes aus der Münzstätte Miltenberg zuweisen<br />
(Nr. 203-204).
SIGISMUND DER MÜNZREICHE<br />
(1439-1490, t 1496)<br />
Kreuzer (1439-1477), Münzstätte Meran<br />
Variante la (1439 - vor 1460)<br />
Vs. (5z. Stern) SI - GIS - mVn - DVS; Doppelkreuz, die<br />
Umschrift teilend.<br />
Rs. + COmES (5z. Stern) TIROL; Gekrönter Adler.<br />
CNA I, S. 358, Nr. J 45, 39; Alram u. a. -.<br />
297 1,095 g; 19,1/18,0 mm; 130°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0009.<br />
298 1,092 g; 18,1/17,0 mm; 60°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0117.<br />
299 1,049 g; 18,5/18,1 mm; 320°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0010.<br />
300 0,824 g; 18,5/17,3 mm; 340°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0118.<br />
301 0,962 g; 18,6/17,9 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0011.<br />
Variante lb (1439 - vor 1460)<br />
Vs. SIG - ISm - VnD - VS 8<br />
Rs. + COmES 8 TIROL<br />
CNA I, S. 358, Nr. J 45, 33; Alram u. a. -.<br />
302 0,927 g; 18,9/18,2 mm; 310°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0082.<br />
303 0,916 g; 18,9/18,1 mm; 210°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0142.<br />
Variante lcfnach 1460)<br />
Vs. + SI - GIS - mVn - DVS (zwei übereinanderstehende<br />
«Blitze»)<br />
Rs. + COmES • (5bl. Rosette) • TIROL («Blitz»)<br />
CNA I, S. 358, Nr. J 45, 31; Alram u. a., S. 146, Nr. 41.<br />
Vs. Stempel 1/Rs. Stempel 1<br />
304 1,038 g; 18,4/17,4 mm; 220°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Unregelmässiger Schrötling.<br />
K 0611/0059.<br />
305 1,002 g; 18,5/17,8 mm; 190°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0029.<br />
306 0,975 g; 18,4/17,7 mm; 170°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0013.<br />
307 0,973 g; 18,8/17,8 mm; 260°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0072.<br />
308 0,963 g; 18,3/17,8 mm; 200°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0067.<br />
309 0,960 g; 18,8/18,5 mm; 310°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0043.<br />
310 0,941 g; 18,4/17,6 mm; 220°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0051.<br />
311 0,938 g; 18,6/18,2 mm; 250°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0131.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
312 0,933 g; 18,4/18,1 mm; 250°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0057.<br />
313 0,929 g; 18,4/17,7 mm; 220°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0128.<br />
314 0,924 g; 18,5/17,6 mm; 260°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0039.<br />
315 0,916 g; 18,5/17,2 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0038.<br />
316 0,915 g; 18,5/17,7 mm; 220°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0060.<br />
317 0,915 g; 18,3/17,8 mm; 170°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0076.<br />
318 0,915 g; 18,4/17,9 mm; 200°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0134.<br />
319 0,900 g; 18,4/17,9 mm; 200°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0121.<br />
320 0,896 g; 18,3/18,0 mm; 200°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K0611/0063.<br />
321 0,894 g; 18,3/17,7 mm; 190°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0073.<br />
322 0,892 g; 18,6/18,1 mm; 200°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0079.<br />
323 0,882 g; 18,6/17,5 mm; 210°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0026.<br />
324 0,877 g; 18,3/17,7 mm; 190°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0037.<br />
325 0,871 g; 18,3/17,8 mm; 190°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0071.<br />
326 0,865 g; 18,5/17,5 mm; 280°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Rand leicht ausgebrochen.<br />
K 1305/0126.<br />
327 0,853 g; 18,5/17,6 mm; 240°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0052.<br />
328 0,852 g; 18,4/17,4 mm; 160°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0028.<br />
329 0,850 g; 18,5/18,1 mm; 280°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0020.<br />
330 0,850 g; 18,1/16,8 mm; 170°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0032.<br />
331 0,846 g; 18,4/18,2 mm; 190°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag, Kratzspuren. K 0611/0017.<br />
332 0,835 g; 18,3/18,0 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 1305/0120.<br />
333 0,834 g; 18,4/18,0 mm; 290°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 1305/0132.<br />
334 0,825 g; 18,6/17,6 mm; 260°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0047.<br />
335 0,824 g; 18,0/17,4 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0124.<br />
336 0,823 g; 18,2/17,5 mm; 190°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0031.<br />
337 0,814 g; 18,2/17,9 mm; 250°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 1305/0130.<br />
87
338 0,809 g; 18,5/17,6 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0078.<br />
339 0,808 g; 18,6/17,8 mm; 250°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0129.<br />
340 0,807 g; 18,3/17,3 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. Rand ausgebrochen, verbogen.<br />
Restauriert: Zwei Fragmente zusammengeklebt.<br />
K 0611/0456.<br />
341 0,800 g; 18,4/18,1 mm; 190°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0054.<br />
342 0,797 g; 18,2/17,6 mm; 190°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K0611/0061.<br />
343 0,788 g; 18,3/17,9 mm; 250°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0021.<br />
344 0,781 g; 18,4/18,1 mm; 270°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0135.<br />
345 0,776 g; 18,3/17,6 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0123.<br />
346 0,754 g; 18,3/17,9 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0119.<br />
347 0,725 g; 18,4/17,9 mm; 240°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0035.<br />
348 0,687 g; 18,3/17,7 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rand leicht abgebrochen. K 0611/0025.<br />
349 0,686 g; 18,7/17,8 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0065.<br />
350 0,672 g; 18,8/18,3 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0041.<br />
351 0,638 g; 18,4/17,7 mm; 270°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0081.<br />
352 0,601 g; 18,8/17,9 mm; 200°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Riss. Wenig ausgebrochen. K 0611/0040.<br />
353 0,574 g; 18,5/14,8 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Rand zu ca. Vi abgebrochen<br />
K1305/0138.<br />
Vs. Stempel 1/Rs. Stempel 2<br />
354 0,992 g; 18,2/17,9 mm; 260°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0014.<br />
355 0,878 g; 18,4/17,8 mm; 190°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0019.<br />
Vs. Stempel 2/Rs. Stempel 2<br />
356 1,059 g; 18,6/18,1 mm; 100°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 1305/0127.<br />
357 1,056 g; 18,5/17,8 mm; 90°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0080.<br />
358 0,943 g; 18,4/17,7 mm; 120°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 1305/0139.<br />
359 0,867 g; 18,5/1.7,8 mm; 110°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0044.<br />
360 0,860 g; 18,5/18,1 mm; 130°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. Riss. K 0611/0033.<br />
88<br />
361 0,851 g; 18,4/18,1 mm; 90°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0050.<br />
362 0,845 g; 18,5/18,1 mm; 110°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0074.<br />
363 0,756 g; 18,6/17,9 mm; 100°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0056.<br />
364 0,740 g; 18,5/17,6 mm; 130°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0048.<br />
365 0,663 g; 18,4/16,5 mm; 140°; AR. A 1/1, K 3/2.<br />
Rand zu ca. Vi abgebrochen. K 1305/0141.<br />
Vs. Stempel 3/Rs. Stempel 2<br />
366 0,938 g; 18,5/17,4 mm; 240°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. Münze leicht gebogen. K 0611/0027.<br />
367 0,799 g; 18,5/17,9 mm; 40°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0055.<br />
Vs. Stempel 3/Rs. Stempel 3<br />
368 0,981 g; 18,6/17,6 mm; 45°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. starke Kratzspuren. K 0611/0045.<br />
369 0,949 g; 18,6/18,1 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0030.<br />
370 0,945 g; 18,5/18,0 mm; 240°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0042.<br />
371 0,918 g; 18,4/16,9 mm; 90°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0058.<br />
372 0,901 g; 18,5/18,2 mm; 320°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0070.<br />
373 0,893 g; 18,7/18,0 mm; 90°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0122.<br />
374 0,882 g; 18,3/17,6 mm; 210°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 1305/0133.<br />
375 0,876 g; 18,8/17,9 mm; 60°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0012.<br />
376 0,857 g; 18,6/18,2 mm; 120°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0046.<br />
377 0,833 g; 19,0/18,3 mm; 230°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Restauriert: 2 Fragmente zusammengeklebt.<br />
Zerschnitten? K 0611/0455.<br />
378 0,827 g; 18,5/18,1 mm; 190°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rand leicht ausgebrochen. K 0611/0064.<br />
379 0,809 g; 18,5/17,9 mm; 110°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0068.<br />
380 0,790 g; 18,8/17,9 mm; 20°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. Rand leicht ausgebrochen.<br />
K 0611/0049.<br />
Vs. Stempel 4/Rs. Stempel 2<br />
381 0,805 g; 18,4/17,6 mm; 20°; AR. A 1/1, K 2/2. Falz.<br />
K 1305/0137.<br />
Vs. Stempel 4/Rs. Stempel 4<br />
382 0,884 g; 18,4/17,6 mm; 140°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0023.
383 0,868 g; 18,3/17,7 mm; 170°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0053.<br />
384 0,864 g; 18,3/16,8 mm; 20°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0140.<br />
385 0,818 g; 18,3/17,9 mm; 180°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 1305/0125.<br />
386 0,695 g; 18,6/17,9 mm; 30°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Rand leicht ausgebrochen.<br />
K 0611/0075.<br />
Vs. Stempel 5/Rs. Stempel 2<br />
387 1,068 g; 18,3/18,0 mm; 250°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0034.<br />
388 1,042 g; 18,2/17,2 mm; 250°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0022.<br />
389 0,918 g; 19,0/18,0 mm; 250°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 1305/0136.<br />
390 0,830 g; 18,5/17,9 mm; 270°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0036.<br />
391 0,805 g; 18.5/17,9 mm; 250°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. Rand leicht ausgebrochen.<br />
K 0611/0062.<br />
392 0,308 g; 17,5/9,1 mm (grösseres Fragment);<br />
0,219 g; 14,2/9,0 mm (kleineres Fragment); 270°; AR.<br />
A 1/1, K 2/2. Zwei Fragmente: Münze zerschnitten?,<br />
ca. Vi ausgebrochen.<br />
Vs. + SI - GIS - mV[n - DVS] (zwei übereinanderstehende<br />
«Blitze»);<br />
Rs. + COMES [- TRROL («Blitz»); Rs. Doppelschlag.<br />
K 1305/0112.<br />
Vs. Stempel 6/Rs. Stempel 2<br />
393 1,078 g; 18.7/17,5 mm; 280°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0016.<br />
394 0,871 g; 18,4/17,8 mm; 290°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0069.<br />
395 0,857 g; 18,7/18,1 mm; 300°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0018.<br />
396 0,779 g; 18,6/17,9 mm; 120°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
K 0611/0015.<br />
397 0.719 g; 18.5/18,0 mm; 220°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0077.<br />
Vs. Stempel 6/Rs. Stempel 4<br />
398 0,843 g; 19,9/18,1 mm; 220°; AR. A 1/1, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0024.<br />
Vs. Stempel 7/Rs. Stempel 5<br />
399 0,810 g; 18,4/17,2 mm; 120°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. stark zerkratzt. K 0611/0066.<br />
Stempel unbestimmt<br />
400 0,051 g; 7,5/4,0 mm; Stempelstellung unbest.; AR.<br />
A 1/1, K 2/2. Fragment. Erhalten: Vs. Ende eines<br />
Kreuzarmes und Buchstabe S, Rs. Schwanz des Adlers.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Aufgrund der Form des Kreuzes und des Adlerschwanzes<br />
ist die Zuweisung zu Var. lc eindeutig. K 1305/0077.<br />
Vierer (1439-1477), Münzstätte Meran<br />
Vs. + SlGlSMVn[DVS]; Kreuz mit aufgelegtem S.<br />
Rs. [+] COMES ° TRROL]; Gekrönter Adler.<br />
CNA I, S. 360, Nr. J 48; Rizzolli, S. 56, Nr. 14 Bc.<br />
401 0,436 g; 15,4/13,9 mm; 120°; BI. A 2/2, K 3/3.<br />
K 0611/0005.<br />
89
ITALIEN<br />
MAILAND, HERRSCHAFT (AB 1395 HERZOGTUM)<br />
BARNABÖ UND GALEAZZO II. (1354-1378)<br />
Pegione/Grosso (1354-1378), Münzstätte Mailand<br />
Variante 1<br />
Vs. + BERMABOS • 3 • GALEAZ • VICECOMITES;<br />
Natter zwischen B - G, darüber Reichsadler, in Vierpass,<br />
in den äusseren Winkeln des Vierpasses je eine Rosette<br />
aus drei Ringeln.<br />
Rs. o - S • AMBROSI' - MEDIOLAMV » (V mit<br />
Abkürzungszeichen); Hl. Ambrosius sitzend mit Mitra<br />
und Nimbus, in der Rechten Peitsche, in der Linken<br />
Krummstab.<br />
Crippa, S. 52, Nr. 4/B; CNI V, S. 78, Nr. 36 Var. (Vs. und<br />
Rs. alle N retrograd).<br />
402 2,315 g; 24,3/22,6 mm; 200°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0282.<br />
403 2,290 g; 23,7/22,6 mm; 20°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. BE[RNA]B0S; VICECOMIT1ES];<br />
Rs. [o -]S •; MEDIOLAMpV °] ; Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0279.<br />
404 2,269 g; 25,4/24,0 mm; 130°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Risse im Rand. K 0611/0285.<br />
405 2,257 g; 23,5/22,9 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. S [•] AMBROSI'; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K1305/0013.<br />
406 2,158 g; 24,7/23,9 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Vs. zwei Einhiebe.<br />
K1305/0014.<br />
407 2,126 g; 24,1/22,8 mm; 20°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [o - S •] AMBROSI' - MEDIOITANV °] ; Vs. Doppelschlag.<br />
Zwei Risse im Rand. K 0611/0281.<br />
408 2,042 g; 25,2/23,4 mm; 360°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0280.<br />
409 1,760 g; 23,7/22,8 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. VICECOMI[T]ES;<br />
Rs. AM1B1R0SL; Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0012.<br />
Variante 2<br />
Vs. + BERMABOS • 3 • GALEAZ • VICECOMITES<br />
(wie Var. 1); Natter zwischen B - G, darüber Reichsadler,<br />
in Vierpass, in den äusseren Winkeln des Vierpasses je<br />
ein Ringel mit Kugel in der Mitte.<br />
Rs. o - S • AMBROSI' - MEDIOLAMV ° (V mit Abkürzungszeichen)<br />
(wie Var. 1); Hl. Ambrosius sitzend mit<br />
Mitra und Nimbus, in der Rechten Peitsche, in der<br />
Linken Krummstab.<br />
90<br />
Crippa, S. 52, Nr. 4/A; CNI V, S. 78, Nr. 38 Var. (Vs. und<br />
Rs. alle N retrograd).<br />
410 2,354 g; 24,0/22,0 mm; 120°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. ME[DIOLA]NV (V mit Abkürzungszeichen); Vs und<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0283.<br />
411 2,136 g; 23,7/23,0 mm ; 340°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K0611/0284.<br />
GALEAZZO II. (1354-1378)<br />
Pegione (1354-1378), Münzstätte Mailand<br />
Variante la<br />
Vs. + GALEAZ • VICECONES • D • MEDIOLAMI • PP • 3C<br />
(PP mit Abkürzungsstrich); Vollwappen der Visconti mit<br />
Schild, Helm und Helmzier, links und rechts je eine<br />
brennende Fackel mit je zwei angehängten Kesseln, in<br />
Vierpass mit acht Ringeln in den äusseren Winkeln.<br />
Rs. • S • AMBR'VS • - • MEDIOLM °; Hl. Ambrosius<br />
sitzend mit Mitra und Nimbus, in der Rechten Peitsche,<br />
in der Linken Krummstab.<br />
Crippa, S. 60, Nr. 2; CNI V, S. 81, Nr. 11 Typ.<br />
412 2,560 g; 24,8/23,3 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Schrötlingsfehler: Loch. Rs. Doppelschlag, tiefer Kratzer.<br />
K 0611/0286.<br />
Variante lb<br />
Vs. + GALEAfZ • VICJECOMES • D • MEDIOLAMI • PP • 3C<br />
(PP mit Abkürzungsstrich)<br />
Rs. [• S • AM1BRVS • - • MEDIOLAM<br />
CNI V, S. 81, Nr. 9 Var. (Legende Vs. und Rs.).<br />
413 1,894 g; 25,3/23,3 mm; 210°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. Rand ausgebrochen. K 1305/0054.<br />
Pegione/Grosso (1359-1378), Münzstätte Pavia<br />
Variante la<br />
Vs. + GALEAZ • VICECOMES • D • MEDIOLAMI • PP • 3C<br />
(PP mit Abkürzungsstrich); Vollwappen der Visconti mit<br />
Schild, Helm und Helmzier, links und rechts je eine brennende<br />
Fackel mit je zwei angehängten Kesseln, in Vierpass<br />
mit acht Rosetten in den Winkeln.<br />
Rs. • S • S1RVS (Rosette) - (Rosette) PAPIA (zwei Rosetten);<br />
Hl. Sirus sitzend mit Mitra und Nimbus, Rechte segnend<br />
erhoben, in der Linken Krummstab.<br />
CNI IV, S. 498, Nr. 1 Var. (Vs. N retrograd).<br />
414 2,381 g; 24,7/23,5 mm; 260°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 1305/0053.<br />
415 2,375 g; 23,9/22,7 mm; 120°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [+ GAJLEAZ; PP [• 3C];<br />
Rs. [• S •] SIRVS (Rosette) - [(Rosette) PA]PIA (2 Rosetten);<br />
Variante la?<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0050.
416 2,312 g; 25,0/23,5 mm; 270°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. VICE[COM]ES;<br />
Rs. [(Rosette) P]API[A — ]; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
Variante la? K 0611/0407.<br />
417 2,165 g; 25,4/24,3 mm; 90°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. VIC[ECOM]ES; Rand leicht ausgebrochen.<br />
K 0611/0410.<br />
418 2,160 g; 24,5/23,0 mm; 110°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0409.<br />
419 2,071 g; 25,1/24,3 mm; 250°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [(Rosette) P]APIA ; Rs. Doppelschlag. K 0611/0412.<br />
Variante 1b<br />
Vs. + GALEAZ • VICECOMES • D • MEDIOLAMI • PP • 3C<br />
(PP mit Abkürzungsstrich) (wie Var. la)<br />
Rs. o S • SIRVS (Rosette) - (Rosette) PAPIA (zwei Rosetten)<br />
CNI IV, S. 498, Nr. 1 Typ.<br />
420 2,069 g; 24,3/23,0 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. PAPUA]; Vs. Doppelschlag. K 0611/0416.<br />
421 1,801 g; 25,2/24,3 mm; 260°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K1305/0052.<br />
Variante lc<br />
Vs. + GALEAZ • VICECOMES • D • MEDIOLAMI • PP • 3C<br />
(PP mit Abkürzungsstrich) (wie Var. la)<br />
Rs. • S • SIRVS (Rosette) - (Rosette) PAPIA (Rosette) •<br />
(Rosette)<br />
CNI IV, S. 498, Nr. 1 Typ.<br />
422 2,276 g; 23,9/23,1 mm; 60°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [•] D [•];<br />
Rs. [(Rosette) PAPRA; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K0611/0405.<br />
423 2,272 g; 24,1/23,1 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [• S • SRRVS;<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0415.<br />
Variante ld<br />
Vs. + GALEAZ • VICECOMES • D • MEDIOLAMI • P • 3C<br />
(P mit Abkürzungsstrich)<br />
Rs. • S • SIRVS (Rosette) - (Rosette) PAPIA (zwei Rosetten)<br />
(wie Var. la)<br />
CNI IV, S. 498, Nr. 1 Typ.<br />
424 2,183 g; 26,9/25,1 mm; 330°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0414.<br />
Variante le<br />
Vs. + GALEAZ • VICECO[M]ES [•] D [•] MEDIOLAMI • PP •<br />
C (PP mit Abkürzungsstrich)<br />
Rs. • S • SIRVS (Rosette) - (Rosette) PAPIA (zwei Rosetten)<br />
(wie Var. la)<br />
CNI IV, S. 498, Nr. 1 Typ.<br />
425 1,863 g; 23,5/22',0 mm; 270°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Riss im Rand. K 0611/0406.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Variante If<br />
Vs. + GALEAZ • VICECOMES • D • MDIOLAMI • PP • 3C (PP<br />
mit Abkürzungsstrich)<br />
Rs. • S • SIRVS (Rosette) - (Rosette) PAPIA (zwei Rosetten)<br />
(wie Var. la)<br />
CNI IV, S. 498, Nr. 1 Typ.<br />
426 2,295 g; 25,2/23,1 mm; 130°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 1305/0047.<br />
Variante lg<br />
Vs. + GALEAZ • VICECOMES • D • MEDIOLAMI • PP C (PP<br />
mit Abkürzungsstrich)<br />
Rs. • S • SIRVS (Rosette) - (Rosette) PAPIA (2 Rosetten)<br />
(wie Var. la)<br />
CNI IV, S. 498, Nr. 1 Typ.<br />
427 2,381 g; 24,6/23,7 mm; 280°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 1305/0048.<br />
Variante lh<br />
Vs. + GALEAZ • VICECOMES • D • MEDIOLAMI • PP • 3C •<br />
(PP mit Abkürzungsstrich)<br />
Rs. [•] S [•] SIRVS (Rosette) - (Rosette) PAPIA (zwei<br />
Rosetten) (wie Var. la?).<br />
CNI IV, S. 498, Nr. 1 Typ.<br />
428 2,080 g; 25,2/23,5 mm; 180°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 1305/0051.<br />
Variante 2a<br />
Vs. + GALEAZ • VICECOMES • D • MEDIOLAMI • PP • 3C<br />
(PP mit Abkürzungstrich) (wie Var. la); Vollwappen der<br />
Visconti mit Schild, Helm und Helmzier, links und rechts<br />
je eine brennende Fackel mit je zwei angehängten<br />
Kesseln, in Vierpass mit acht Ringeln in den Winkeln.<br />
Rs. • S • SIRVS (Rosette) - (Rosette) PAPPIA (Rosette); Hl.<br />
Sirus sitzend mit Mitra und Nimbus, Rechte segnend<br />
erhoben, in der Linken Krummstab.<br />
CNI IV, S. 499, Nr. 6 Var. (Vs.-Legende).<br />
429 2,390 g; 23,5/22,0 mm; 170°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [3C];<br />
Rs. [•] S • SIRVS; Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0408.<br />
Variante 2b<br />
Vs. + GALEAZ • VICECOMES • D • MEDIOLAMI • PP • C<br />
(PP mit Abkürzungsstrich)<br />
Rs. o S o SIRVS (Rosette) - (Rosette) PAPPIA (Rosette)<br />
CNI IV, S. 499, Nr. 8.<br />
430 2,152 g; 24,6/23,0 mm; 120°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. VICECO[M]ES; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0411.<br />
Variante 3a.<br />
Vs. + GALEAZ • VICECOMES • D • MEDIOLAMI • PP • 3C<br />
(PP mit Abkürzungsstrich) (wie Var. la); Vollwappen der<br />
Visconti mit Schild, Helm und Helmzier, links und rechts<br />
je eine brennende Fackel mit je zwei angehängten<br />
91
Kesseln, in Vierpass mit sieben Rosetten und einem<br />
Ringel (rechts unten) in den Winkeln.<br />
Rs. ° S • SIRVS (Rosette) - (Rosette) PAPIA (zwei Rosetten)<br />
(wie Var. lb); Hl. Sirus sitzend mit Mitra und Nimbus,<br />
Rechte segnend erhoben, in der Linken Krummstab.<br />
CNI -.<br />
431 2,270 g; 25,0/22,0 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [+ GALJEAZ;<br />
Rs. [(Rosette) PAPRA (zwei Rosetten); Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0413.<br />
432 2,164 g; 24,5/23,9 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [(Rosette)] PAPIA; Rs. Doppelschlag. K 1305/0049.<br />
433 2,163 g; 24,4/23,3 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 1305/0046.<br />
Variante 3b<br />
Vs. + GALEAZ • VICECOMES • D • MEDIOLAMI • P • 3C<br />
(P mit Abkürzungsstrich) (wie Var. ld)<br />
Rs. [•] S • SIRVS (Rosette) - [(Rosette) P]APIA (zwei<br />
Rosetten) (wie Var. la?)<br />
CNI -.<br />
434 2,090 g; 24,1/22,0 mm; 70°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0404.<br />
BARNABÖ (1354-1385)<br />
Pegione (1354-1385), Münzstätte Mailand<br />
Vs. + DOMIn' - BMABOS (erstes B mit Abkürzungszeichen);<br />
Helm mit Helmzier der Visconti.<br />
Rs. + DOMIn' - MEDIOLI (Abkürzungszeichen über LI);<br />
Natter.<br />
Crippa, S. 66, Nr. 2/A; CNI V, S. 85, Nr. 17.<br />
435 2,106 g; 24,9/23,6 mm; 270°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0068.<br />
Pegione (1354-1385), Münzstätte Mailand<br />
Vs. D' • B'MABOS • VICECOMES • MEDIO[L]AMI • 3 • C;<br />
Vollwappen der Visconti mit Schild, Helm und Helmzier<br />
zwischen D' - B' in Vierpass, in den Winkeln je drei<br />
Ringel.<br />
Rs. o - • S • AMBROSI' - MEDIOLANV ° ; Hl. Ambrosius<br />
sitzend mit Mitra und Nimbus, in der Rechten Peitsche,<br />
in der Linken Krummstab.<br />
Crippa, S. 68, Nr. 4; CNI V, S. 85, Nr. 20 Typ.<br />
436 1,847 g; 26,0/24,9 mm; 110°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. Risse, Rand leicht ausgebrochen.<br />
K1305/0080.<br />
92<br />
GIAN GALEAZZO ALS HERR VON MAILAND<br />
(1378-1395)<br />
Sesino (1378-1395), Münzstätte Mailand<br />
Variante la<br />
Vs. + • GALEAZ • COMES • VIRtVtVM •; Mit.Perlen besetztes<br />
Kreuz, in den Winkeln vier Lilien.<br />
Rs. + • DOMIMVS • MEDIOLAMI • 3C; Natter zwischen G - Z.<br />
Crippa, S. 78, Nr. 2 Typ; CNI V, S. 88, Nr. 6 Typ.<br />
437 0,747 g; 19,4/17,9 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. VI[Rt]VtVM;<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0387.<br />
Variante lb<br />
Vs. + • GALEAZ • COMES • VIRtVtVM • (wie Var. la)<br />
Rs. + • DOMIMVS • MEDIOLAMI • 3C •<br />
CNI V, S. 88, Nr. 9 Var. (Vs. und Rs. alle N retrograd).<br />
438 0,869 g; 18,9/18,0 mm; 90°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K1305/0064.<br />
439 0,864 g; 18,9/17,7 mm; 170°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. VIRtVttVM •];<br />
Rs. ME[DIO]LAMI; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0397.<br />
440 0,787 g; 19,4/17,6 mm; 190°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. VI[Rt]VtVM; Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0388.<br />
441 0,758 g; 19,1/17,9 mm; 140°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K1305/0059.<br />
442 0,756 g; 17,9/16,6 mm; 60°; AR. A 2/2, K 3/3.<br />
Vs. [• Vl]RtVtVM;<br />
Rs. [MEDI01LAMI [• 3C •]; Rs. Doppelschlag. Variante lb?<br />
(ev. la). K 0611/0396.<br />
443 0,750 g; 19,7/18,9 mm; 200°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0394.<br />
444 0,740 g; 18,2/16,9 mm; 270°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. COME[S • VI]RtVtVM; K 1305/0060.<br />
445 0,714 g; 18,9/16,7 mm; 160°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [+ •] GALEAZ • COMES • VIRtVtPVM •];<br />
Rs. ME[DI]OLAMl; Rand leicht ausgebrochen.<br />
K 1305/0063.<br />
446 0,662 g; 19,1/17,0 mm; 170°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rand leicht ausgebrochen. K 0611/0391.<br />
Variante 2<br />
Vs. + • GALEAZ • COMES • VIRtVtVM • (wie Var. la)<br />
Mit Perlen besetztes Kreuz, in den Winkeln vier Lilien,<br />
unter dem Kreuz ein Punkt.<br />
Rs. + • DOMIHVS • MEDIOLAMI • 3C • (wie Var. lb)<br />
Natter zwischen G - Z.<br />
CNI V, S. 89, Nr. 13 Var. (Vs. und Rs. alle N retrograd).<br />
447 0,833 g; 19,0/17,4 mm; 90°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Vs. und Rs. dezentrierte<br />
Prägung.K 1305/0061.<br />
448 0,811 g; 18,5/17,7 mm; 200°; AR. A 2/2, K 1/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0398.
449 0,808 g; 18,7/17,7 mm; 270°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [+ • GLALEAZ; VIRtpVtVM •];<br />
Rs. MEDIO[LAHI • 3C •]; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0384.<br />
450 0,808 g; 17,4/16,4 mm; 90°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [+ • GA]LEAZ; VlRtVtLVM •];<br />
Rs. [—] MEDIOL[A]Zll; K 0611/0385.<br />
451 0,792 g ; 18,7/17,7 mm; 45°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. MEDIOLA[ZII • 3C']; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 1305/0058.<br />
452 0,778 g; 19,1/16,4 mm; 260°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. COM[ES • VI]RtVtVM;<br />
Rs. MEDIO[LA]VlI; Vs. und Rs. Doppelschlag. Riss.<br />
K 0611/0386.<br />
453 0,765 g; 19,2/16,2 mm; 90°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. GA[LEA]Z;<br />
Rs. MEDIOLAHU • 3C] •; Rand ausgebrochen. Leicht verbogen.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0395.<br />
454 0,754 g; 19,4/17,5 mm; 260°; AR. A 2/2, K 2/2. Riss<br />
im Rand.K 0611/0392.<br />
455 0,740 g; 19,2/18,4 mm; 270°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0383.<br />
456 0,734 g; 19,1/18,0 mm; 310°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. C10ME1S;<br />
Rs. MEDROLAWI •]; Verbeult, Riss. K 1305/0062.<br />
457 0,705 g; 19,3/18.5 mm; 260°; AR. A 2/2, K 3/3.<br />
K 0611/0389.<br />
458 0,687 g; 19,5/18,5 mm; 220°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0393.<br />
Variante 3<br />
Vs. + • GALEAZ • COMES • VIRtVtVM • (wie Var. la);<br />
Mit Perlen besetztes Kreuz, in den Winkeln vier Lilien,<br />
über und unter dem Kreuz je ein Punkt.<br />
Rs. + • DOM1Z1VS • MEDIOLAZII • 3C • (wie Var. lb);<br />
Natter zwischen G - Z.<br />
CNI V, S. 89, Nr. 14 Var. (Vs. und Rs. alle N retrograd).<br />
459 0,801 g; 18,8/16,7 mm; 45°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0390.<br />
GIAN GALEAZZO ALS HERZOG (1395-1402)<br />
Pegione/Grosso (1395-1402), Münzstätte Mailand<br />
Variante la<br />
Vs. + • GALEAZ • VICECOES • D • MEDIOLAHI • 3C •;<br />
Natter zwischen G - 3 in Vierpass, ohne Beizeichen.<br />
Rs. • S • ABROS1V • - • MEDIOLAH; Hl. Ambrosius sitzend<br />
mit Mitra und Nimbus, in der Rechten Peitsche, in der<br />
Linken Krummstab.<br />
Crippa, S. 80, Nr. 4/A; CNI V, S. 90, Nr. 23.<br />
460 2,333 g; 24,8/23,9 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0019.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
461 2,327 g; 25,0/23,5 mm; 140°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0318.<br />
462 2,285 g; 24,4/23,3 mm; 250°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0018.<br />
463 2,281 g; 24,7/23,4 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0308.<br />
464 2,250 g; 24,1/22,7 mm; 45°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0293.<br />
465 2,242 g; 26,1/23,5 mm; 150°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Leicht verbogen. K 0611/0319.<br />
466 2,240 g; 24,0/22,3 mm; 160°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [•] S • ABROSUV •]; Vs. Doppelschlag. K 0611/0295.<br />
467 2,238 g; 23,9/23,0 mm; 90°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0310.<br />
468 2,237 g; 24,5/23,7 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag, Stempelverletzungen (in der Legende).<br />
K 0611/0305.<br />
469 2,232 g; 25,0/24,4 mm; 240°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Riss im Rand. K 0611/0292.<br />
470 2,217 g; 24,9/23,9 mm; 190°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0017.<br />
471 2,215 g; 23,7/22,8 mm; 170°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. leichter Doppelschlag. K 0611/0315.<br />
472 2,199 g; 23,1/22,3 mm; 45°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0316.<br />
473 2,193 g; 24,5/23,7 mm; 320°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0313.<br />
474 2,192 g; 25,2/24,5 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0290.<br />
475 2,191 g; 24,1/22,5 mm; 200°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0023.<br />
476 2,184 g; 24,5/22,5 mm; 160°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. GALEA[Z • VIC1EC0ES; Rs. Doppelschlag; fünfeckiger<br />
Schröding. K 0611/0294.<br />
477 2,165 g; 25,1/23,8 mm; 360°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. Drei Risse im Rand. K 0611/0423.<br />
478 2,163 g; 24,6/22,8 mm; 350°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [•] S • ABROSUV •]; Rs. Doppelschlag. K 0611/0288.<br />
479 2,163 g; 24,3/23,1 mm; 350°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0317.<br />
480 2,160 g; 25,6/23,8 mm; 210°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0311.<br />
481 2,146 g; 25,4/23,3 mm; 160°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0020.<br />
482 2,139 g; 24,5/23,9 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0296.<br />
483 2,131 g; 23,9/22,4 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0306.<br />
484 2,104 g; 24,3/23,5 mm; 310°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Tiefer Kratzer. K 0611/0297.<br />
485 2,092 g; 24,2/23,1 mm; 320°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0289.<br />
93
486 2,090 g; 24,4/23,1 mm; 250°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag, grosse Stempelverletzung zwischen<br />
Natter und 3. K 0611/0312.<br />
487 2,080 g; 25,0/24,0 mm; 170°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0314.<br />
488 2,028 g; 25,9/23,6 mm; 240°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0309.<br />
489 1,994 g; 24,6/22,7 mm; 180°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0291.<br />
490 1,981 g; 23,7/22,8 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0287.<br />
491 1,960 g; 23.4/22,5 mm; 330°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. GA[LEA]Z;<br />
Rs. MEDIOLAIM]; Variante la? Rand oben leicht ausgebrochen.<br />
Vs. Doppelschlag. K 1305/0015.<br />
492 1,954 g; 23,8/22,0 mm; 350°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [• S] • ABROSIV; K 1305/0021.<br />
493 1,953 g; 25,2/24,5 mm; 340°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Schrötlingsfehler (Riss im<br />
Schröding). K 0611/0320.<br />
Mit Gegenstempel<br />
494 2,071 g; 24,7/23,6 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
Gegenstempel: Vs. unbestimmter süddeutscher<br />
Gegenstempel (Straussenhals nach rechts, im Schnabel<br />
ein Hufeisen, Krusy, X 51,3). K 0611/0321.<br />
Variante lb<br />
Vs. + • GALEAZ • VICEC0ES • D • MEDIOLAMI • 3C •; (wie<br />
Varl)<br />
Rs. • S • ABROSIV • - • MEDIOLAM •<br />
Crippa, S. 80, Nr. 4/A; CNI V, S. 90, Nr. 23 Typ.<br />
495 2,137 g; 24,7/23,1 mm; 360°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 1305/0016.<br />
Variante 2a<br />
Vs. + • GALEAZ • VICECOES • D • MEDIOLAMI • 3C • (wie<br />
Var. la); Natter zwischen G - 3 in Vierpass, über Natter<br />
Rosette aus drei Ringeln.<br />
Rs. • S • ABROSIV • - • MEDIOLAM (wie Var. la); Hl. Ambrosius<br />
sitzend mit Mitra und Nimbus, in der Rechten<br />
Peitsche, in der Linken Krummstab.<br />
Crippa, S. 80. Nr. 4/B; CNI V, S. 90, Nr. 25 Typ.<br />
496 1,902 g; 23,8/22,5 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. ABRO[SIV •]; Vs. Doppelschlag, Rs. tiefe Kratzer.<br />
K 0611/0298.<br />
Variante 2b<br />
Vs. + • GALEAZ : VICECOES • D • MEDIOLAMI • 3C<br />
Rs. • S • ABROSIV • - • MEDIOLAM (wie Var. la)<br />
Crippa, S. 80, Nr. 4/B; CNI V, S. 90, Nr. 25 Typ.<br />
497 1,968 g; 24,9/23,4 mm; 50°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Risse in der Oberfläche. Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0299.<br />
94<br />
Variante 3a<br />
Vs. + • GALEAZ • VICECOES • D • MEDIOLAMI • 3C • (wie<br />
Var. la); Natter zwischen G - 3 in Vierpass, über Natter<br />
Ringel.<br />
Rs. • S • ABROSIV • - • MEDIOLAM (wie Var. la); Hl. Ambrosius<br />
sitzend mit Mitra und Nimbus, in der Rechten<br />
Peitsche, in der Linken Krummstab.<br />
Crippa, S. 81, Nr. 4/C; CNI V, S. 91, Nr. 27 Typ.<br />
498 2,296 g; 24,7/23,2 mm; 10°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0302.<br />
499 2,183 g; 25,1/23,5 mm; 110°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0304.<br />
500 2,146 g; 24,5/23,6 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. 3C [' •]; Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0303.<br />
Variante 3b<br />
Vs. + • GALEAZ • VICECOES • D • MEDIOLAMI • 3C • (wie<br />
Var. la)<br />
Rs. • S • ABROSIV • - • MEDIOLAM • (wie Var. lb)<br />
Crippa, S. 81, Nr. 4/C; CNI V, S. 91, Nr. 27 Typ.<br />
501 2,119 g; 24,9/23,7 mm; 45°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0300.<br />
502 2,207 g; 25,6/24,6 mm; 60°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0301.<br />
503 2,008 g; 25,3/23,9 mm; 360°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Kleines Stück ausgebrochen.<br />
K 1305/0022.<br />
Pegione/Grosso con la. croce (1395-1402), Münzstätte<br />
Mailand<br />
Variante la.<br />
Vs. (Natter) • COMES • VIRtVtVM • D • MEDIOLAMI • 3C •;<br />
Blumenkreuz mit je einem Punkt in den Winkeln, in<br />
einem doppelten Vierpass mit je einem Dreiblatt an den<br />
Spitzen.<br />
Rs. • S • ABROSIV • - • MEDIOLAM; Hl. Ambrosius sitzend<br />
mit Mitra und Nimbus, in der Rechten Peitsche, in der<br />
Linken Krummstab.<br />
Crippa, S. 84, Nr. 7 Typ; CNI V, S. 93, Nr. 47 Var.<br />
(Vs. 3C •).<br />
504 2,411 g; 23,7/22,2 mm; 180°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Riss im Rand. K 0611/0349.<br />
505 2,367 g; 24,0/22,2 mm; 110°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0025.<br />
506 2,350 g; 23,3/22,3 mm; 310°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. • S • ABROSRV •]: Rs. Doppelschlag. Drei Risse im<br />
Rand. K 0611/0324.<br />
507 2,321 g; 24,1/22,4 mm; 45°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0347.<br />
508 2,321 g; 23,3/22.4 mm; 200°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0043.<br />
509 2,305 g; 24,1/22,5 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0367.
510 2,279 g; 22,7/21,5 mm; 320°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 0611/0322.<br />
511 2,258 g; 24,1/22,9 mm; 310°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0342.<br />
512 2,258 g; 23,6/21,3 mm; 160°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0040.<br />
513 2,257 g; 24,4/23,1 mm; 250°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. Leicht verbeult. K 0611/0373.<br />
514 2,250 g; 23,9/22,2 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. • S • AfBROSIV •]; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K1305/0027.<br />
515 2,250 g; 24,4/23,3 mm; 260°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0033.<br />
516 2,230 g; 23,1/21,3 mm; 360°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [•] S [•] ABROSUV • - •]; Riss im Rand.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0329.<br />
517 2,214 g; 23,8/23,0 mm; 140°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [(Natter) • C0M1ES; MEDIOLAMI • 3[C •];<br />
Rs. [• MEJDIOLAM; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 1305/0028.<br />
518 2,206 g; 24,7/23,0 mm; 270°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [• S •] ABROSIV; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0348.<br />
519 2,204 g; 23,8/22,8 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. ABR0[SI]V; Vs. Doppelschlag. K 0611/0360.<br />
520 2,196 g; 24,5/22,8 mm; 180°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [•] 3C; Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0346.<br />
521 2,188 g; 24,7/23,6 mm; 260°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0366.<br />
522 2,187 g; 24,0/23,5 mm; 320°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [•] D [•] MEDIOLAMI; Vs. und Rs. Doppelschlag. Riss.<br />
K 1305/0044.<br />
523 2,185 g; 23,4/22,0 mm; 330°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [•] MEDIOLAM; Vs. Doppelschlag. K 0611/0341.<br />
524 2,180 g; 24,3/22,7 mm; 280°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 1305/0039.<br />
525 2,174 g; 23,9/22,7 mm; 360°; AR. A 2/2, K 2/2. Riss<br />
im Rand. Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0372.<br />
526 2,172 g; 22,7/21,0 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [— VIRltVtVM • D • MEDIOLAM[I —]; Vs. und Rs.<br />
Doppelschlag. K 0611/0356.<br />
527 2,164 g; 24,0/21,6 mm; 320°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0368.<br />
528 2,148 g; 25,2/22,7 mm; 110°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0353.<br />
529 2,147 g; 22,8/21,4 mm; 160°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. (Natter) [•] C0ME[S • VIRtVtVM •] D [•];<br />
Rs. [•] S [•] ABROSIV; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0363.<br />
530 2,144 g; 24,2/22,8 mm; 150°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [•] S • ABROSIV; Vs. und Rs. Doppelschlag. Rs. tiefer<br />
Kratzer. K 1305/0029.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
531 2,140 g; 22,8/21,6 mm; 320°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. MEDROLAM]; Schrötlingsfehler (Riss im Schrötling).<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0323.<br />
532 2,131 g; 24,3/22,5 mm; 60°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. MED[IOL]AMI;<br />
Rs. [• S • A1BR0SLV; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0334.<br />
533 2,125 g; 23,4/21,4 mm; 220°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0364.<br />
534 2,124 g ; 24,1/22,5 mm; 150°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0369.<br />
535 2,123 g; 23,5/20,3 mm; 200°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. C0ME1S • VIRtVtVM;<br />
Rs.L S • ABRJOSIV; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0335.<br />
536 2,116 g; 24,2/22,7 mm; 250°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0024.<br />
537 2,107 g; 23,6/22,1 mm; 130°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Leicht verbogen. K 0611/0345.<br />
538 2,104 g; 23,7/22,7 mm; 10°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0327.<br />
539 2,100 g; 24,6/23,4 mm; 280°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [(Natter) • C01MES; Vs. Doppelschlag. K 1305/0034.<br />
540 2,089 g; 24,5/22,4 mm; 260°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. VI[RtVtV]M; Vs. und Rs. Doppelschlag. Rand leicht<br />
ausgebrochen. K 0611/0332.<br />
541 2,085 g ; 23,5/21,6 mm; 10°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. VIRltVtVM • D •]; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0326.<br />
542 2,069 g; 25,0/22,9 mm; 210°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0350.<br />
543 2,057 g; 23,4/22,3 mm; 110°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. K 0611/0375.<br />
544 2,051 g; 22,6/21,5 mm; 170°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. VIRtVtVM [—];<br />
Rs. • S • ABR[0SIV •]; Vs. und Rs. Doppelschlag. Riss im<br />
Rand. K 0611/0338.<br />
545 2,044 g; 22,7/22,4 mm; 180°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. ABROSIV [•]; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0370.<br />
546 2,042 g ; 24,1/23,1 mm; 50°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0038.<br />
547 2,033 g; 24,5/23,1 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [•] S • ABROSIV; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0359.<br />
548 2,025 g; 23,9/22,8 mm; 50°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. 3C [' •]; Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0357.<br />
549 2,024 g; 23,4/22,2 mm; 190°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0354.<br />
550 2,017 g; 24,4/22,1 mm; 10°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0340.<br />
551 2,004 g; 24,7/22,6 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0352.<br />
95
552 1,982 g ; 23,2/21,9 mm; 150°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [•] S [•]; Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0336.<br />
553 1,976 g; 22,9/21,6 mm; 240°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [• D • ME1DI0LAHI; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 1305/0031.<br />
554 1,974 g; 24,1/22,9 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Riss. Hieb. K 1305/0037.<br />
555 1,969 g; 24,8/23,0 mm; 60°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. VIRRVtlVM; Vs. und Rs. Doppelschlag. Leicht<br />
verbogen. K 0611/0365.<br />
556 1,951 g; 24,2/22,2 mm ; 180°; AR. A 2/2, K 2/2. Riss<br />
im Rand, leicht verbeult. Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0331.<br />
557 1,927 g; 24,3/22,6 mm ; 45°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0045.<br />
558 1,920 g; 23,7/22,1 mm; 350°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. (Natter) • C[0M]ES • V[IRtV]tVM • D • MEDROLAHR •<br />
3C •;<br />
Rs. • S • AB[R0SIV •] - • MLEDIOILAH; Vs. und Rs.<br />
Doppelschlag. K 0611/0362.<br />
559 1,884 g; 22,2/21,5 mm ; 10°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0325.<br />
560 1,873 g; 22,5/21,0 mm; 160°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. VIRtVtLVM •];<br />
Rs. [• S • A1BROSIV; MEDIOL[AzR; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0330.<br />
561 1,873 g; 22,8/22,0 mm; 180°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [• D •];<br />
Rs. [• S •] ABROSIV; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K1305/0026.<br />
562 1,873 g; 23,8/22,4 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. MEDIOLAHU • 3]C •;<br />
Rs. [• S •] ABR01SIV •]; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K1305/0030.<br />
563 1,857 g; 23,8/21,3 mm; 150°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0351.<br />
564 1,854 g; 22,5/21,3 mm; 340°; AR. A 2/2. K 2/2.<br />
Rs. ABROSRV • - •]; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0328.<br />
565 1,854 g; 22,7/21,6 mm; 260°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 1305/0041.<br />
566 1,811 g; 22,7/21,4 mm; 270°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0355.<br />
567 1,788 g; 22,7/20,9 mm ; 260°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 0611/0344.<br />
568 1,788 g; 22,3/21,4 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. • MEDROLAM]; Variante 1?; Vs. Doppelschlag.<br />
K1305/0036.<br />
569 1,786 g; 22,5/21,7 mm ; 350°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [•] D [•];<br />
Rs. ABROSILV •]; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 1305/0042.<br />
96<br />
570 1,704 g; 23,2/21,6 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [•] S [•] A[B]R0SIV; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0337.<br />
571 1,699 g; 22,5/21,3 mm; 310°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [— C0ME1S • VIRtVtV[M • D • MJEDIOLAHI [• 3C •];<br />
Rs. [• S • ABR01SIV; Vs. und Rs. Doppelschlag. Falz. Hieb<br />
im Rand. K 0611/0343.<br />
Variante lb<br />
Vs. (Natter) • COMES • VIRtVtVM • D • MEDIOLAMI • 3C •<br />
(wie Var. la)<br />
Rs. • S • ABROSIV • - • MEDIOLAM •<br />
Crippa, S. 84, Nr. 7 Typ.<br />
572 2,249 g; 23,7/22,2 mm; 360°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. V[IRt]VtVM; Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0339.<br />
573 2,133 g; 24,4/23,2 mm; 120°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. 3CL •]; Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0361.<br />
574 2,097 g; 23,9/22,3 mm; 290°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [• S • A)BROSIV; Vs. und Rs. Doppelschlag. Rs. tiefer<br />
Kratzer. K 0611/0358.<br />
575 2,048 g; 24,2/23,1 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. ABROSILV •]; Rs. Doppelschlag. K 1305/0035.<br />
576 2,019 g; 24,6/22,6 mm; 130°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. C0M[ES • V]IRt[VtV]M; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K1305/0032.<br />
577 1,970 g; 23,6/22,0 mm; 200°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Leicht verbogen. Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0371.<br />
Pegione/Grosso (1395-1402), Münzstätte Verona<br />
Variante la<br />
Vs. (Natter) COMES • VIRtVtVM • D • MEDI0LAH1 • 3C;<br />
Blumenkreuz in einem doppelten Vierpass mit je einem<br />
Dreiblatt an den Spitzen und je einer Kugel in den<br />
Winkeln.<br />
Rs. • S • 3EIIO • - • D • VEROnA; Hl. Zeno sitzend mit<br />
Mitra und Nimbus, Rechte segnend erhoben, in der<br />
Linken Krummstab.<br />
CNI VI, S. 276, Nr. 3.<br />
578 2,279 g; 23,8/22,1 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. Risse im Rand. K 0611/0376.<br />
Variante lb<br />
Vs. (Natter) CONES • VIRtVtVM • D • MEDIOLAMI • 3C<br />
Rs. • S • 3EIIO • - • D • VEROnA (wie Var. la)<br />
CNI VI. S. 276, Nr. 3 Typ.<br />
579 2.322 g; 24,2/21,7 mm; 280°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [•] D [•]; Rs. Doppelschlag. K 0611/0333.<br />
Variante lc<br />
Vs. (Natter) COMES • VIRtVtVM • D • IED10LA/III • VO •<br />
3C (V von VO mit Abkürzungsstrich)<br />
Rs. - S • 3EHO • - • D • VERONA<br />
CNI VI, S. 276, Nr. 3 Typ.
580 2,119 g; 24,7/23,6 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Risse im Rand. K 0611/0374.<br />
Sesino (1395-1402), Münzstätte Mailand<br />
Variante 1<br />
Vs. + • GALEAZ • COMES • VIRtVtVM •; Mit Perlen besetztes<br />
Kreuz.<br />
Rs. • D • MEDIOLAHI • VEROHE • 3C •; Natter zwischen<br />
G - 3.<br />
Crippa, S. 86, Nr. 11; CNI V, S. 96, Nr. 82 Var. (N von<br />
VERONE retrograd).<br />
581 0,843 g; 20,2/19,2 mm; 210°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Riss. K 0611/0377.<br />
582 0,791 g; 19,1/17,7 mm; 310°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [+ • GALJEAZN COMES • VTRt[VtVM •]; Vs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0380.<br />
583 0,761 g; 18,8/17,8 mm; 130°: AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. GALEA[Z • COM1ES;<br />
Rs. M[EDIO]LAHl; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0378.<br />
584 0,621 g; 19,1/17,5 mm; 220°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Leicht verbogen. K 0611/0382.<br />
585 0,515 g; 19,1/16,9 mm; 10°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. COM[E]S;<br />
Rs. MEDIO[LA]HI [• VER10HE; Rand ausgebrochen, Risse,<br />
leicht verbogen. K 0611/0458.<br />
Variante 2<br />
Vs. + • GALEAZ • COMES • VIRtVtVM • (wie Var. 1);<br />
Mit Perlen besetztes Kreuz, vier Punkte in den Winkeln<br />
des Kreuzes.<br />
Rs. • D • MEDIOLAHI • VEROHE • 3C • (wie Var. 1);<br />
Natter zwischen G - 3.<br />
Crippa, S. 86, Nr. 10; CNI V, S. 96, Nr. 77.<br />
586 0,954 g; 16,7/15,2 mm; 70°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [+ • GALJEAZ • COME[S • VIRtVtVM •];<br />
Rs. V[ER0HE •] 3C •; Rs. Doppelschlag. K 1305/0057.<br />
587 0,819 g; 17,5/16,7 mm; 150°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. + [• D • MED]10LAMI [•]; Vs. Einstich (mit Messerspitze?).<br />
K0611/0379.<br />
588 0,801 g; 20,3/18,2 mm; 210°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [+ •] GALEAZ;<br />
Rs. [+] • D • MEDIOLAHI • VEROHE [• 3C •]; K 1305/0056.<br />
589 0,768 g; 19,8/17,9 mm; 130°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. MEDIOLA[HI); Rs. Doppelschlag. Riss (ein Stück des<br />
Randes fast abgebrochen). K 0611/0381.<br />
590 0,643 g; 19,6/17,3 mm; 80°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. 1+ •] GALEAZ • COMES • VlRtVRVM •];<br />
Rs. VEROIHE • 3C •]; Falz. Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0457.<br />
591 0,596 g; 18,4/17,1 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [+ • GALEAZ •] COMES • VIRtVtVM •;<br />
Rs. [• D • ME]DIOLAHI • VE[ROHE • 3C •] K 1305/0055.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
GIOVANNI MARIA (1402-1412)<br />
Grosso/Pegione (1402-1412), Münzstätte Mailand-<br />
Variante la<br />
Vs. (vierblättrige Rosette) IOhAHES • MARIA • DVX •<br />
MEDIOLAHI • 3C •; Gekrönte Natter zwischen I - M,<br />
darum Vierpass mit vier Blumen in den Winkeln. Ringel<br />
über Krone der Natter.<br />
Rs. • S ABROSIV - MEDIOLA/1; Hl. Ambrosius sitzend mit<br />
Mitra und Nimbus, in der Rechten Peitsche, in der<br />
Linken Krummstab.<br />
Crippa, S. 99, Nr. 2/C; CNI V, S. 104, Nr. 5 Var.<br />
(Legende Rs.).<br />
592 2,214 g; 23,7/22,3 mm; 140°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
K 1305/0065.<br />
593 2,201 g; 22,9/22,1 mm; 180°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [• S ABROSIV]; Vs. und Rs. Doppelschlag. Riss im<br />
Rand.K 0611/0399.<br />
594 2,130 g: 24,0/22,9 mm; 45°; AR. A 2/2. K 2/2.<br />
Rs. [•] S ABROSIV; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K 0611/0400.<br />
Variante lb<br />
Vs. (vierblättrige Rosette) IOhAHES • MARIA • DVX •<br />
MEDIOLAHI • 3C:<br />
Rs. [•] S ABROSIV - MEDIOLAH (wie Var. la?)<br />
Vs. CNI V, S. 103, Nr. 2.<br />
595 2,074 g; 24,1/22,5 mm; 300°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 061.1/0307.<br />
FILIPPO MARIA (1412-1447)<br />
Grosso da 2 soldi (1412-1447), Münzstätte Mailand<br />
Vs. + [FILI]PVS o MARIA ° [DVX ME]DIOLAHI ° 3C;<br />
Viergeteilter Schild (Adler/gekrönte Natter), über dem<br />
Schild ein Ringel.<br />
Rs. S - ABROSIV - MEDIOLAI; Hl. Ambrosius sitzend mit<br />
Mitra und Nimbus, in der Rechten Peitsche, in der Linken<br />
Krummstab.<br />
Crippa, S. 122, Nr. 3/A; CNI V, S. 125, Nr. 61 Var. (Rs.-<br />
Legende ohne Punkte).<br />
596 2,063 g; 25,7/22,1 mm; 45°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Riss im Rand. K 0611/0402.<br />
Grosso da 2 soldi (1412-1447), Münzstätte Mailand<br />
Variante la<br />
Vs. FILIPV MARIA • AHGLVS • - • D • M •; Viergeteilter<br />
Schild (Adler/Natter), darüber Krone mit Palmen- und<br />
Olivenzweigen.<br />
97
Rs. • S - • ABROSIV - MEDIOLAH[I]; Hl. Ambrosius<br />
sitzend mit Mitra und Nimbus, in der Rechten Peitsche,<br />
in der Linken Krummstab; Sonne auf der Brust.<br />
Crippa, S. 124, Nr. 4; CNI V, S. 129, Nr. 104 Typ.<br />
597 2,090 g; 23,3/21,6 mm ; 270°; AR. A 2/2. K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0069.<br />
Variante lb<br />
Vs. FIL1PV MARIA • AHGLVS • - D • M •<br />
Rs. • S • - • ABROSIV • - MEDIOLAI •<br />
Crippa, S. 124, Nr. 4: CNI V, S. 129, Nr, 104 Typ.<br />
598 2,189 g; 23,1/22,5 mm ; 180°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Doppelschlag. K 1305/0070.<br />
Sesino (1412-1447), Münzstätte Mailand<br />
Vs. + • FILIP' • MA • DVX • MEDIOLI •; Gekrönte Natter<br />
zwischen F - M.<br />
Rs. + (Blumenkreuz) COMES (Blumenkreuz) PAPIE<br />
(Blumenkreuz) 3C (Blumenkreuz); Mit Perlen besetztes<br />
Kreuz, in den Winkeln vier Lilien.<br />
Crippa, S. 131, Nr. 13; CNI V, S. 138, Nr. 194.<br />
599 0,866 g; 19,7/18,8 mm ; 10°; BI. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0403.<br />
MAILAND, ZWEITE REPUBLIK (1447-1450)<br />
Grosso (1447-1450), Münzstätte Mailand<br />
Vs. + • COMVHITAS • MEDIOLAHI •; Blumenkreuz.<br />
Rs. • S • AMROSIV • - MEDIOLA/II •; Hl. Ambrosius<br />
sitzend mit Mitra und Nimbus, in der Rechten Peitsche,<br />
in der Linken Krummstab; Sonne auf der Brust.<br />
Crippa. S. 143, Nr. 2; CNI V, S. 143, Nr. 5 Typ.<br />
600 2,048 g; 25,3/23,0 mm; 170°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0071.<br />
GENUA, REPUBLIK<br />
TOMMASO DI CAMPOFREGOSO, DOGE (1436-1442)<br />
Soldino (1436-1442), Münzstätte Genua<br />
Vs. + : T : C : DVX : IA[II]VEIIS : XXI; Stadttor in<br />
Sechspass mit sechs Punkten an den Spitzen.<br />
Rs. [+ : C10IIRADVS : REX : RO : Y :; Kreuz in Sechspass<br />
mit sechs Punkten an den Spitzen.<br />
CNI III. S. 122, Nr. 67.<br />
601 1,379 g; 20,8/18,6 mm ; 140°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Hieb. K 0611/0278.<br />
98<br />
VENEDIG, REPUBLIK<br />
FRANCESCO FOSCARI, DOGE (1423-1457)<br />
Grossone (1423-1457), Münzstätte Venedig<br />
Vs. • FRANCISCVS • FOSCARI • DVX-; Doge stehend n.l.,<br />
hält Banner.<br />
Rs. + • SANCTVS • MARCVS • VENETI •; Hl. Markus mit<br />
Heiligenschein und Evangelium, die Rechte segnend<br />
erhoben.<br />
Papadopoli I, S. 269, Nr. 3 Typ; CNI VII, S. 133, Nr. 79<br />
Var. (Vs. DVX •)•<br />
602 3,029 g; 24,9/24,3 mm; 140°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. K 1305/0067.<br />
603 2,980 g; 26,5/24,9 mm; 270°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. horizontale Streifen im Bildhintergrund, zwei tiefe<br />
Kratzer. Vs. und Rs. Doppelschlag. K 0611/0420.<br />
604 2,689 g; 24,1/22,9 mm; 110°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. [• F]RANC1SCPVS • F01SCAR1 (•] DVX [•];<br />
Rs. + [•] SANCTVS • MARCfVS —] : Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
K0611/0421.<br />
605 2,594 g; 24,6/23,3 mm; 200°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. [• MARCVS [•] VENETI •; Vs. und Rs. Doppelschlag.<br />
Streifen im Bildhintergrund: Vs. vertikal, Rs. horizontal.<br />
K0611/0419.<br />
Grosso/Grossetlo (ab 1445), Münzstätte Venedig,<br />
Münzmeister Francesco Lando (gewählt 1445)<br />
Vs. FRA • FOSCAR[I] - • [S •] M • VENETI; Der Hl. Markus<br />
übergibt dem stehenden Dogen Banner, links des<br />
Banners von oben nach unten D/V/X, im Feld F - L.<br />
Rs. + - TIBI • LAVS • - • 3 • GLORI - A; Thronender<br />
Christus.<br />
Papadopoli 1, S. 270, Nr. 5 Typ; CNI VII. S. 126, Nr. 23<br />
Var. (Rs.- Legende).<br />
606 1,362 g; 20,4/18,7 mm; 30°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Rs. Stempelbeschädigungen. K 1305/0066.<br />
Grosso/Grossetto (ab 1452), Münzstätte Venedig,<br />
Münzmeister Benedetto Soranzo (gewählt 1452)<br />
Vs. FRA FOSCARI -SM- VENETI; Der Hl. Markus<br />
übergibt dem stehenden Dogen Banner, links des<br />
Banners von oben nach unten D/V/X, im Feld B - S.<br />
Rs. • + • TIBI • LAVS • - ET • GLORIA •; Thronender<br />
Christus.<br />
Papadopoli I, S. 270, Nr. 5 Typ; CNI VII, S. 129, Nr. 44<br />
Typ.<br />
607 1,373 g; 19,8/19,1 mm; 100°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. und Rs. Doppelschlag. Rs. vertikale Streifen im<br />
Bildhintergrund. K 0611/0418.
Grosso/Grossetto (ab 1452), Münzstätte Venedig,<br />
Münzmeister Natale Corner (gewählt 1452)<br />
Vs. [F]RA FOSCARI - S • M • VENETI; Der Hl. Markus<br />
übergibt dem stehenden Dogen Banner, links des<br />
Banners von oben nach unten D/V/X, im Feld N - C.<br />
Rs. + [TIBI LAVS] - • GLORI - A; Thronender Christus.<br />
Papadopoli I, S. 270, Nr. 5 Typ; CNI VII, S. 129, Nr. 47<br />
Typ.<br />
608 1,379 g; 18,8/18,3 mm; 170°; AR. A 2/2, K 2/2.<br />
Vs. Doppelschlag. Zwei Risse im Rand, horizontale<br />
Streifen im Bildhintergrund. K 0611/0417.<br />
KIRCHENSTAAT<br />
Quattri.no, anonyme Prägung (2. Hälfte 14. Jh./l. Hälfte<br />
15. Jh.), Münzstätte Bologna<br />
Vs. (Peitsche) ° D[E BONONLjA °; Zwei gekreuzte<br />
Schlüssel, durch eine Schnur verbunden, daran Ring.<br />
Rs. ° S o P[ETR] - ONIVS (Peitsche); Hl. Petrus mit<br />
Nimbus und Mitra, die Rechte segnend, in der Linken<br />
Stadtmodell haltend.<br />
CNI X, S. 27, Nr. 45 Var. (Rs. Peitsche statt g).<br />
609 0,565 g; 17,2/16,0 mm; 150°; BI. A 2/2, K 3/3.<br />
Vs. Dezentrierte Prägung. K 0611/0198.<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
UNBESTIMMTE MÜNZHERRSCHAFT<br />
610 0,011 g; 7,7/2,8 mm; e; BI. A 0, K 3. Fragment<br />
eines Hohlpfennigs mit Perlkreis. Süddeutschland?,<br />
15. Jh.? Ansatz eines Schildes (Weckenschild?). Starker<br />
Doppelschlag. K 1305/0078.<br />
611 (0,164 g); e; BI. A 2, K 2. Zwei Fragmente eines<br />
Hohlpfennigs mit glattem Wulstrand. Süddeutschland?<br />
1. Hälfte 15. Jh.? Sichtbar: Glatter Wulstrand, eine Kugel,<br />
zwei angeschnittene Kugeln (zu Perlkreis?). Auf Objektträger<br />
montiert.<br />
K 0611/0436.<br />
99
Bildtafeln<br />
100
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ
Tafel 2: Überlingen, Stadt (Nr. 25-49); Ravensburg, Stadt (Nr. 50-54)<br />
102<br />
25 26 27<br />
30 31 32<br />
35 36 37<br />
40 41 42<br />
& % m<br />
28 29<br />
33 34<br />
38 39<br />
43 44<br />
45 46 47 4
Tafel 3: Ravensburg, Stadt (Nr. 55-89)<br />
55<br />
60<br />
65<br />
70<br />
#<br />
75<br />
80<br />
85<br />
56<br />
(»1<br />
% w ®<br />
66<br />
67 68<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
• #<br />
71<br />
72 73<br />
74<br />
• # • •<br />
76<br />
77 78<br />
7')<br />
82 83<br />
84<br />
86<br />
57 58<br />
62 63<br />
87<br />
59<br />
64<br />
69<br />
89<br />
103
Tafel 4: Ravensburg, Stadt (Nr. 90-96); Ulm, Stadt (Nr. 97-107); Württemberg, Grafschaft (Nr. 108-114)<br />
104<br />
mm)<br />
90 91 92 9:; 94<br />
95<br />
100<br />
96<br />
101<br />
97<br />
102<br />
105<br />
106<br />
#<br />
107<br />
•<br />
108<br />
#<br />
109<br />
110 111 112 113 114<br />
98<br />
103<br />
9')<br />
104
Tafel 5: Zürich, Stadt (Nr. 115-131)<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
105
Tafel 6: Zürich, Stadt (Nr. 132-146)<br />
106<br />
132 133 134 135 136<br />
142 143 144 145 146
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Tafel 7: Luzern, Stadt (Nr. 147); Bern, Stadt (Nr. 148); Solothurn, Stadt (Nr. 149); Basel, Stadt (Nr. 150-<br />
151); Strassburg, Stadt (Nr. 152-154); Unbestimmte Münzherrschaft (Nr. 155); Baden, Markgrafschaft<br />
(Nr. 156-172); Heilbronn?, Reichsmünzstätte? (Nr. 173-175); Pfalz, Kurfürstentum (Nr. 176-181)<br />
147<br />
152<br />
9^<br />
157<br />
162<br />
167<br />
172<br />
148<br />
153<br />
158<br />
163<br />
168<br />
173<br />
149<br />
154<br />
159<br />
164<br />
177 178 179<br />
150<br />
155<br />
9<br />
1» -i v<br />
160<br />
165<br />
151<br />
156<br />
161<br />
166<br />
# • •<br />
169<br />
170<br />
171<br />
174<br />
175<br />
176<br />
180 181<br />
107
Tafel 8: Pfalz, Kurfürstentum (Nr. 182); Pfalz-Simmern, Grafschaft (Nr. 183-193); Pfalz-Zweibrücken,<br />
Grafschaft (Nr. 194); Speyer, Bistum (Nr. 195-201); Mainz, Erzbistum (Nr. 202-210); Lothringen,<br />
Herzogtum (Nr. 211-213); Bar, Herzogtum (Nr. 214); Nürnberg, Reichsmünzstätte (Nr. 215)<br />
108<br />
182<br />
187<br />
192<br />
197<br />
202<br />
207<br />
183<br />
193<br />
198<br />
% I<br />
203<br />
208<br />
184<br />
% m<br />
189<br />
194<br />
199<br />
Mm<br />
204<br />
190<br />
195<br />
200<br />
dl<br />
205<br />
209 210<br />
211 212 213 214 215<br />
186<br />
191<br />
196<br />
201<br />
206
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Tafel 9: Nürnberg, Burggrafschaft (Nr. 216-217); Altenburg, Stadt (Nr. 218); Lüneburg, Stadt (Nr. 219);<br />
Böhmen, Königreich (Nr. 220-230)
Tafel 10: Böhmen, Königreich (Nr. 231-245)
Tafel 11: Böhmen, Königreich (Nr. 246-260)<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
256 257 258 259 260<br />
111
Tafel 12: Böhmen, Königreich (Nr. 261-275)<br />
112<br />
261 262 263 264 265<br />
271 272 273 274 275
Tafel 13: Böhmen, Königreich (Nr. 276-290)<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
113
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
115
116
Tafel 17: Tirol, Grafschaft (Nr. 351-370)<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
366 367 368 369 370<br />
117
Tafel 18: Tirol, Grafschaft (Nr. 371-390)<br />
371 372 373 374 375<br />
376 377 378 379 380<br />
381 382 383 384 385
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Tafel 19: Tirol, Grafschaft (Nr. 391-401); Mailand, Herrschaft/Herzogtum (Nr. 402-410)<br />
119
Tafel 20: Mailand, Herrschaft/Herzogtum (Nr. 411-425)<br />
120<br />
411 412 413 414 415<br />
416 417 418 419 420<br />
421 422 423 424
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ
Tafel 23: Mailand, Herrschaft/Herzogtum (Nr. 461-475)<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
471 472 473 474 475<br />
123
Tafel 24: Mailand, Herrschaft/Herzogtum (Nr. 476-490)<br />
124
Tafel 25: Mailand, Herrschaft/Herzogtum (Nr. 491-505)<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
501 502 503 504 505<br />
125
Tafel 26: Mailand, Herrschaft/Herzogtum (Nr. 506-520)<br />
126<br />
506 507 508 509 510<br />
511 512 513 514<br />
516 517 518 519
Tafel 27: Mailand, Herrschaft/Herzogtum (Nr. 521-535)<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
521 522 523 524 525<br />
531 532 533 534 535<br />
127
Tafel 28: Mailand, Herrschaft/Herzogtum (Nr. 536-550)<br />
128<br />
541 542 543 544 545<br />
546 547 548 549<br />
540
Tafel 29: Mailand, Herrschaft/Herzogtum (Nr. 551-565)<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
561 562 563 564 565<br />
129
Tafel 30: Mailand, Herrschaft/Herzogtum (Nr. 566-580)<br />
130<br />
566 567 568 569 570<br />
571 572 573 574<br />
576 577 578 579
Tafel 31: Mailand, Herrschaft/Herzogtum (Nr. 581-595)<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
131
Tafel 32: Mailand, Herrschaft/Herzogtum (Nr. 596-599); Mailand, Zweite Republik (Nr. 600); Genua,<br />
Republik (Nr. 601); Venedig, Republik (Nr. 602-608); Kirchenstaat (Nr. 609); Unbestimmte Münzherrschaft<br />
(Nr. 610-611)<br />
132
Anhang<br />
ABKÜRZUNGEN<br />
AFL<br />
Fachstelle Archäologie des<br />
Fürstentums Liechtenstein<br />
ASA<br />
Anzeiger für Schweizerische<br />
Altertumskunde<br />
BfM<br />
Blätter für Münzfreunde<br />
BLM<br />
Badisches Landesmuseum,<br />
Karlsruhe<br />
BNF<br />
Berliner Numismatische<br />
Forschungen<br />
CNA<br />
Corpus Nummorum<br />
Austriacorum<br />
CNI<br />
Corpus Nummorum<br />
Italicorum<br />
HBN<br />
Hamburger Beiträge zur<br />
Numismatik<br />
HMZ<br />
Helvetische Münzenzeitung<br />
IFS<br />
Inventar der Fundmünzen<br />
der Schweiz<br />
JBL<br />
Jahrbuch des Historischen<br />
Vereins für das Fürstentum<br />
Liechtenstein<br />
JbVLM<br />
Jahrbuch Vorarlberger<br />
Landesmuseumsverein<br />
MBNG<br />
Mitteilungen der Bayerischen<br />
Numismatischen<br />
Gesellschaft<br />
NF<br />
Neue Folge<br />
NZ<br />
Numismatische Zeitschrift<br />
SNR<br />
Schweizerische Numismatische<br />
Rundschau<br />
WLM<br />
Württembergisches<br />
Landesmuseum, Stuttgart<br />
WVLg<br />
Württembergische<br />
Vierteljahreshefte für<br />
Landesgeschichte<br />
ZAK<br />
Zeitschrift für schweizerische<br />
Archäologie und<br />
Kunstgeschichte<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
VERZEICHNIS DER<br />
ABGEKÜRZT ZITIERTEN<br />
LITERATUR<br />
Alram u. a.<br />
Alram, Michael; Winter,<br />
Heinz; Metlich, Michael:<br />
Ein mittelalterlicher Münzschatz<br />
des 15. Jahrhunderts<br />
aus St. Valentin iii<br />
Niederösterreich. In: NZ<br />
104/105 (1997),<br />
S. 109-185.<br />
Berger<br />
Berger, Frank: Die mittelalterlichen<br />
Brakteaten im<br />
Kestner-Museum Hannover.<br />
1. Teil. Hannover,<br />
1993. (Sammlungskatalog<br />
12).<br />
Binder/Ebner<br />
Binder, Christian; Ebner,<br />
Julius: Württembergische<br />
Münz- und Medaillen-<br />
Kunde von Christian Binder,<br />
neu bearbeitet von<br />
Julius Ebner. 2 Bde. Stuttgart,<br />
1910/1912.<br />
Buchenau, Heilbronn<br />
Buchenau, Heinrich: Die<br />
Heilbronner Pfennigmünze<br />
des Königs Siegmund. In:<br />
BfM 47 (1912),<br />
Sp.5176-5182.<br />
Buchenau,<br />
Untersuchungen<br />
Buchenau, Heinrich:<br />
Untersuchungen zu den<br />
spätmittelalterlichen<br />
Münzreihen von Pfalz,<br />
Mainz, Elsass, Hessen und<br />
anderen Gebieten. In: BfM<br />
51 (1916), S. 1-11, 23-34,<br />
41-54, 66-72,81-91,<br />
102-113, 122-132,<br />
141-151, 161-165 und BfM<br />
60 (1925), S. 225-231,<br />
241-250, 275-284,<br />
289-302, 310-313.<br />
Cahn, Konstanz<br />
Cahn, Julius: Münz- und<br />
Geldgeschichte von Konstanz<br />
und des Bodenseegebietes<br />
im Mittelalter bis<br />
zum Reichsmünzgesetz<br />
von 1559. Heidelberg,<br />
1911. (Münz- und Geldgeschichte<br />
der im Grossherzogtum<br />
Baden vereinigten<br />
Gebiete 1).<br />
Cahn, Rappenmünzbund<br />
Cahn, Julius: Der Rappenmünzbund.<br />
Eine Studie<br />
zur Münz- und Geldgeschichte<br />
des oberen<br />
Rheinthaies. Heidelberg,<br />
1901.<br />
Cahn, Strassburg<br />
Cahn, Julius: Münz- und<br />
Geldgeschichte der Stadt<br />
Strassburg im Mittelalter.<br />
Diss. Strassburg, 1895.<br />
Castelin<br />
Castelin, Karel: Grossus<br />
Pragensis 1300-1547. Der<br />
Prager Groschen und seine<br />
Teilstücke. 2. Aufl. Braunschweig,<br />
1973.<br />
CNA<br />
Corpus Nummorum Austriacorum<br />
(CNA). Bd. 1.<br />
Mittelalter. Verfasst und<br />
zusammengestellt von<br />
Bernhard Koch. Wien,<br />
1994.<br />
CNI<br />
Corpus Nummorum Italicorum.<br />
20 Bde. Rom,<br />
1910-1943.<br />
Crippa<br />
Crippa, Carlo: Le Monete<br />
di Milano dai Visconti agli<br />
Sforza dal 1329 al 1535.<br />
Mailand, 1986.<br />
Diaz Tabernero<br />
Diaz Tabernero, Jose: Die<br />
Fundmünzen aus dem<br />
Kloster St. Johann in Müstair<br />
(GR). Die Grabungs-<br />
133
kampagnen 1969-1995.<br />
Unpubl. Lizentiatsarbeit<br />
an der Universität Zürich.<br />
Zürich, 1998.<br />
Diepenbach<br />
Diepenbach, Wilhelm:<br />
Geldwesen und Münzprägung<br />
in Bingen. Frankfurt<br />
a. M., 1924. (Sonderdruck<br />
mit eigener Paginierung<br />
aus: Rheinhessen in seiner<br />
Vergangenheit 4. Mainz,<br />
1924, S. 89 ff).<br />
Ehrend<br />
Ehrend, Helfried: Speyerer<br />
Münzgeschichte. Münzen,<br />
Medaillen, Marken und<br />
Banknoten. Speyer, 1976.<br />
Engel/Lehr<br />
Engel, Arthur; Lehr, Ernest:<br />
Numismatique de<br />
l'Alsace. Paris, 1887.<br />
Erlanger<br />
Erlanger, Herbert L: Die<br />
Reichsmünzstätte in Nürnberg.<br />
Nürnberg, 1979.<br />
(Nürnberger Forschungen<br />
22).<br />
Geiger, Bern<br />
Geiger, Hans-Ulrich: Der<br />
Beginn der Gold- und<br />
Dickmünzenprägung in<br />
Bern. Ein Beitrag zur<br />
bernischen Münz- und<br />
Geldgeschichte des<br />
15. Jahrhunderts. Bern.<br />
1968.<br />
Geigy<br />
Geigy, Alfred: Katalog der<br />
Basler Münzen und Medaillen<br />
der im Historischen<br />
Museum zu Basel<br />
deponierten Ewig'schen<br />
Sammlung. Basel, 1899.<br />
Hürlimann<br />
Hürlimann, Hans: Zürcher<br />
Münzgeschichte. Zürich,<br />
1966.<br />
134<br />
Jesse<br />
Jesse, Wilhelm: Der wendische<br />
Münzverein. 2.<br />
Aufl. Braunschweig, 1967.<br />
Kat. Rechberg<br />
Mildenberg, Leo: Zürcher<br />
Münzen und Medaillen.<br />
Ausstellung im Flaus zum<br />
Rechberg. Zürich, 1969.<br />
Kittelberger<br />
Kittelberger, Karl: Der<br />
Schellenberger Münzfund.<br />
In: JBL 31 (1931),<br />
S. 113-145.<br />
Klein<br />
Klein, Ulrich: Bemerkungen<br />
zum Anteil italienischer<br />
Münzen des Mittelalters<br />
am Geldumlauf in<br />
Südwestdeutschland. In:<br />
Travaini, Lucia (Hrsg.):<br />
Moneta locale, moneta<br />
straniera: Italia ed Europa<br />
Xl-XV secolo. Local coins,<br />
foreign coins: Italy and<br />
Europe llth-15th centuries:<br />
The Second Cambridge<br />
Numismatic Symposium.<br />
Mailand, 1999,<br />
S. 285-310.<br />
Klein/Raff<br />
Klein, Ulrich; Raff, Albert:<br />
Die Württembergischen<br />
Münzen von 1374-1693.<br />
Ein Typen-, Variantenund<br />
Probenkatalog. Stuttgart,<br />
1993. (Süddeutsche<br />
Münzkataloge 4).<br />
Krug<br />
Krug, Gerhard: Die meissnisch-sächsischenGroschen<br />
1338-1500. Berlin,<br />
1974. (Veröffentlichungen<br />
des Landesmuseums für<br />
Vorgeschichte, Dresden<br />
13).<br />
Krusy<br />
Krusy, Hans: Gegenstempel<br />
auf Münzen des Spätmittelalters.<br />
Frankfurt<br />
a. M., 1974.<br />
Lanz<br />
Lanz, Otto: Die Münzen<br />
und Medaillen von Ravensburg.<br />
Stuttgart, 1927.<br />
Lebek<br />
Lebek, Walter: Die Münzen<br />
der Stadt Überlingen.<br />
Halle/S., 1939.<br />
Lohner<br />
Lohner, Carl: Die Münzen<br />
der Republik Bern. Zürich,<br />
1846.<br />
Nau. Münzumlauf'<br />
Nau, Elisabeth: Münzumlauf<br />
im ländlichen<br />
Bereich mit besonderer<br />
Berücksichtigung Südwest-<br />
Deutschlands. In: Hans<br />
Patze (Hrsg.): Die Grundherrschaft<br />
im späten<br />
Mittelalter. Bd. 1. Sigmaringen,<br />
1983. (Vorträge<br />
und Forschungen 27),<br />
S. 97-156.<br />
Nau, Oberschwaben<br />
Nau, Elisabeth: Die Münzen<br />
und Medaillen der<br />
oberschwäbischen Städte.<br />
Freiburg i. Br, 1964.<br />
Noss<br />
Noss, Alfred: Zur simmerschen<br />
und zweibrückischen<br />
Münzkunde. In: BfM<br />
51 (1916), S. 181-188 und<br />
216-220.<br />
Papadopoli<br />
Papadopoli, Nicolö: Le<br />
Monete di Venezia. 3 Bde.<br />
Venedig, 1893-1919.<br />
Rizzolli<br />
Rizzolli, Helmut: Die Tiroler<br />
Münzprägungen in Meran.<br />
Bozen, 1979. (Sonderdruck<br />
aus.- Beiträge zur<br />
Wirtschaftsgeschichte<br />
Südtirols. Festschrift zum<br />
125-jährigen Bestehen der<br />
Südtiroler Landessparkasse.<br />
Bozen, 1979).<br />
Saulcy<br />
Saulcy, F. de: Recherches<br />
sur les monnaies des ducs<br />
hereditaires de Lorraine.<br />
Metz, 1841.<br />
Schärli,<br />
Mailändisches Geld<br />
Schärli, Beatrice: Mailändisches<br />
Geld in der mittelalterlichen<br />
Schweiz. In:<br />
Gorini, Giovanni (Hrsg.):<br />
La Zecca di Milano. Atti<br />
del Convengno internazionale<br />
di studio, Milano 9-14<br />
maggio 1983. Mailand,<br />
1984, S. 277-310.<br />
Schrötter<br />
Schrötter, Friedrich v.:<br />
Brandenburg-Fränkisches<br />
Münzwesen. 2 Teile. Halle,<br />
1927/1929.<br />
Schüttenhelm<br />
Schüttenhelm, Joachim:<br />
Der Geldumlauf im südwestdeutschen<br />
Raum vom<br />
Riedlinger Münzvertrag<br />
1423 bis zur ersten Kipperzeit<br />
1618. Eine statistische<br />
Münzfundanalyse<br />
unter Anwendung der<br />
elektronischen Datenverarbeitung.<br />
Stuttgart, 1987.<br />
(Veröffentlichungen der<br />
Kommission für geschichtliche<br />
Landeskunde in Baden-Württemberg,<br />
Reihe<br />
B: Forschungen 108).<br />
Schwarz<br />
Schwarz, Dietrich W. H.:<br />
Münz- und Geldgeschichte<br />
Zürichs im Mittelalter.<br />
Diss. Zürich, 1940.<br />
Schwarzkopf<br />
Schwarzkopf, E.: Der Tübinger<br />
Münzfund. In: Beiträge<br />
zur süddeutschen<br />
Münzgeschichte. Festschrift<br />
zum 25-jährigen<br />
Bestehen des württembergischen<br />
Vereins für Münzkunde.<br />
Stuttgart, 1927,<br />
S. 73-87.
Simmen<br />
Solothurn. Nach J. und H.<br />
Simmen neu bearbeitet<br />
und ergänzt durch die<br />
Helvetische Münzenzeitung<br />
HMZ. Bern, 1972.<br />
(Schweizerische Münzkataloge<br />
7).<br />
Slg. Donebauer<br />
Fiala, Eduard: Beschreibung<br />
der Sammlung böhmischer<br />
Münzen und Medaillen<br />
des Max Donebauer.<br />
Prag, 1988.<br />
Slg. Wüthrich<br />
Sammlung Gottlieb Wüthrich.<br />
Münzen und Medaillen<br />
der Schweiz und ihrer<br />
Randgebiete. Münzen und<br />
Medaillen AG, Basel,<br />
Auktion 45, 25.-27. November<br />
1971. Basel, 1971.<br />
Steguweit/Stoll<br />
Steguweit, Wolfgang; Stoll,<br />
Hans Joachim: Der Münzfund<br />
von Kleinröda, Kr.<br />
Altenburg (1988), verborgen<br />
um 1460. Zur meissnisch-thüringischenMünzgeschichte<br />
in der Mitte des<br />
15. Jahrhunderts. In: BNF<br />
5 (1991), S. 47-60.<br />
Wendling<br />
Wendling, Edgar: Sylloge<br />
Nummorum Lotharingiae.<br />
Kapitel F. Die Münzen der<br />
Grafen und Herzöge von<br />
Bar (1177-1600). Metz,<br />
1980.<br />
Wielandt, Baden<br />
Wielandt, Friedrich: Badische<br />
Münz- und Geldgeschichte.<br />
2. neu bearb.<br />
Aufl. Karlsruhe, 1973.<br />
Wielandt, Luzern<br />
Wielandt, Friedrich:<br />
Münz- und Geldgeschichte<br />
des Standes Luzern. Luzern,<br />
1969.<br />
Zäch, Alpenrheintal<br />
Zäch, Benedikt: Münzfunde<br />
und Geldumlauf im<br />
mittelalterlichen Alpenrheintal.<br />
In: JBL 92 (1994),<br />
S. 201-240.<br />
Zäch, Fremde Münzen<br />
Zäch, Benedikt: Fremde<br />
Münzen im Geldumlauf<br />
der mittelalterlichen<br />
Schweiz (11.-15. Jh.):<br />
Beobachtungen, Fragen,<br />
Perspektiven. In: Travaini,<br />
Lucia (Hrsg.): Moneta<br />
locale, moneta straniera:<br />
Italia ed Europa XI-XV<br />
secolo. Local coins, foreign<br />
coins: Italy and Europe<br />
llth-15th centuries: The<br />
Second Cambridge Numismatic<br />
Symposium. Mailand,<br />
1999, S. 401-442.<br />
Zäch, Luzern<br />
Zäch, Benedikt: Die Angster<br />
und Haller der Stadt<br />
Luzern. Versuch einer<br />
lypologie. In: SNR 67<br />
(1988), S. 311-355.<br />
Zäch, Vaduz<br />
Zäch, Benedikt: Der Vaduzer<br />
Münzschatzfund von<br />
1957 als Quelle zum Geldumlauf<br />
im 14.Jahrhundert.<br />
In: 1342 - Zeugen<br />
des späten Mittelalters.<br />
Festschrift 650 Jahre<br />
Grafschaft Vaduz. Hrsg.<br />
von Hansjörg Frommelt.<br />
Vaduz, 1992, S. 114-139<br />
(zitiert nach dem Sonderdruck<br />
mit eigener Paginierung).<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
135
KONKORDANZ MIT<br />
DEM KATALOG VON<br />
KITTELBERGER (INKL.<br />
NACHTRAG VON<br />
KRUSY)<br />
136<br />
Katalog Kittelberger Katalog<br />
Nr. Nr. Nr.<br />
1 14 226-227<br />
2-3 15a 228<br />
4-13 15 229-230<br />
14-24 16 231<br />
25-26 92 232<br />
27-49 17/18 233<br />
50-59 21 234<br />
60-95 23 235<br />
96 22 236<br />
97-98 24 237<br />
99-107 25 238<br />
108-109 19 239<br />
110-114 20 240<br />
115-116 94 241<br />
117-126 10 242<br />
127-129 12 243<br />
130-144 11 244<br />
145-146 9 245<br />
147 8 246<br />
148 7 247<br />
149 - 248<br />
150-151 6 249<br />
152 - 250-251<br />
153-154 30 252<br />
155 31 253<br />
156-171 13 254<br />
172 - 255<br />
173-175 20a 256<br />
176-178 36a 257<br />
179-180 36b 258<br />
181-182 96 259<br />
183-192 36 260<br />
193-194 261<br />
195-201 37 262<br />
202 32 263<br />
203-204 33 264<br />
205 35 265<br />
206-207 95 266<br />
208-210 34 267<br />
211-213 39 268<br />
214 40 269<br />
215 93 270<br />
216 26 271<br />
217 27 272<br />
218 29 273<br />
219 38 274<br />
220 67 275<br />
221-224 41 276<br />
225 77 277<br />
Kittelberger Katalog Kittelberger<br />
Nr. Nr. Nr.<br />
43/44 278 113<br />
46 279 75b<br />
49 280 52<br />
102 281 41<br />
48 282 104<br />
50 283 103<br />
51 284 65<br />
115 285 110<br />
58 286-287 67<br />
107 288 68<br />
60 289 71<br />
62 290 75<br />
108 291 70<br />
63 292-293 1<br />
64 294-296 3<br />
67 297-301 4<br />
111 302-303 5a<br />
66 304-400 5<br />
42 401 2<br />
47 402-411 79<br />
102 412-413 80<br />
61 414-434 88<br />
68 435 97<br />
75c 436 99<br />
74 437-459 84<br />
52a 460-493 81<br />
54 494 81a<br />
75c 495-503 81<br />
57 504-577 82<br />
112 578-580<br />
76 581-591 83<br />
73 592-595 85<br />
109 596 86<br />
45 597-598 98<br />
106 599 87<br />
56 600 100<br />
101 601 78<br />
59 602-605 90<br />
72 606-608 89<br />
55 609 28<br />
69 610-611<br />
67<br />
114<br />
53<br />
75a<br />
56a<br />
105<br />
116<br />
49a
ALPHABETISCHES<br />
VERZEICHNIS DER<br />
GEGENSTEMPEL<br />
AUF DEN PRAGER<br />
GROSCHEN<br />
Gegenstempel<br />
Attendorn<br />
Augsburg<br />
Bayreuth<br />
Eichstätt<br />
Esslingen<br />
Feldkirch<br />
Frankenberg<br />
Göppingen<br />
Heilbronn<br />
Isny<br />
Kempten<br />
Konstanz<br />
Konstanz?<br />
Lindau<br />
Marburg<br />
Memmingen<br />
Nördlingen<br />
Nürnberg<br />
Radolfzell<br />
Ravensburg<br />
Regensburg<br />
Riedlinger Bund<br />
Salzburg<br />
Schaffhausen<br />
Schäbisch Gmünd<br />
Schwäbisch Hall<br />
Ulm<br />
Urach<br />
Wangen<br />
Weinsberg<br />
unbestimmte Gegenstempel<br />
DER MÜNZSCHATZFUND VOM «SCHELLENBERGER WALD»<br />
VERGRABEN NACH 1460 / DANIEL SCHMUTZ<br />
Katalog Nr.<br />
290.<br />
246; 247<br />
267.<br />
252; 253<br />
254.<br />
255;257<br />
256.<br />
274; 291<br />
246;255<br />
226;227<br />
228;257<br />
229; 230<br />
232; 260<br />
233;234<br />
280.<br />
235.<br />
220;236<br />
238; 249<br />
271;273<br />
239;263<br />
240.<br />
242; 272<br />
241; 261<br />
276.<br />
276.<br />
262.<br />
220; 243<br />
267;268<br />
286;287<br />
259;269<br />
245.<br />
279.<br />
270;279<br />
248; 249; 250; 251; 271; 272; 273; 288.<br />
263; 264; 268; 272; 274; 275; 282.<br />
258; 259.<br />
231; 247; 248; 265; 277; 278.<br />
; 283.<br />
237; 261; 266; 280.<br />
262.<br />
264; 265; 289.<br />
274; 275; 277; 284; 285; 291.<br />
266.<br />
244; 250; 251; 252; 253; 254; 256; 258; 260;<br />
269; 270; 271; 273; 276; 277; 278; 279; 280;<br />
288; 289; 290; 291.<br />
278.<br />
280; 291.<br />
137
ABBILDUNGS<br />
NACHWEIS<br />
Abb. 8: Ausschnitt aus der<br />
Landeskarte der Schweiz<br />
1:25 000, Blätter 1115/<br />
1116. Reproduziert mit<br />
Bewilligung des Bundesamtes<br />
für Landestopographie,<br />
Bern (BA002536).<br />
Abb. 9: Zentralbibliothek<br />
Zürich. Fotoreproduktion<br />
LLA<br />
Abb. 10: Myriam Bargetze-<br />
Köysürenbars, AFL<br />
Abb. 11-14: Daniel<br />
Schmutz, Bern<br />
Alle übrigen Abb.:<br />
Hansjörg Frommelt, AFL<br />
138<br />
ANSCHRIFT DES AUTORS<br />
lic. phil. Daniel Schmutz<br />
Bernisches Historisches<br />
Museum<br />
Münzkabinett<br />
Helvetiaplatz 5<br />
CH-3000 Bern 6