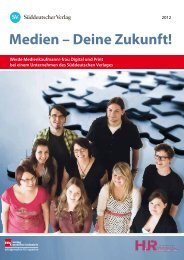dl_strobl_griesmeier405.pdf
dl_strobl_griesmeier405.pdf
dl_strobl_griesmeier405.pdf
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Strobl/Griesebner (Hrsg.)<br />
geoGovernment<br />
Öffentliche Geoinformations-Dienste zwischen Kommune und Europa
Josef Strobl/Gerald Griesebner (Hrsg.)<br />
geoGovernment<br />
Öffentliche Geoinformations-Dienste<br />
zwischen Kommune und Europa<br />
Herbert Wichmann Verlag • Heidelberg
Alle in diesem Buch enthaltenen Angaben, Daten, Ergebnisse usw. wurden von den Autoren<br />
nach bestem Wissen erstellt und von ihnen und dem Verlag mit größtmöglicher Sorgfalt<br />
überprüft. Dennoch sind inhaltliche Fehler nicht völlig auszuschließen. Daher erfolgen die<br />
Angaben usw. ohne jegliche Verpflichtung oder Garantie des Verlags oder der Autoren. Sie<br />
übernehmen deshalb keinerlei Verantwortung und Haftung für etwa vorhandene inhaltliche<br />
Unrichtigkeiten.<br />
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung<br />
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des<br />
Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,<br />
Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.<br />
ISBN 3-87907-405-4<br />
© 2003 Herbert Wichmann Verlag, Hüthig GmbH & Co. KG, Heidelberg<br />
Titelbildentwurf: Ruben R. Baumgartner<br />
Druck: J. P. Himmer GmbH & Co. KG, Augsburg<br />
Printed in Germany
Vorwort<br />
geoGovernment – Geoinformation im Dienst der Öffentlichkeit!<br />
Der öffentliche Sektor spielt traditionell wie auch in verstärktem Ausmaß ganz aktuell eine<br />
zentrale Rolle in gesellschaftlich relevanten Geoinformatik-Anwendungen. Ob es nun um<br />
administrative Abläufe im engeren Sinn, um Bürgerbeteiligung, Notfalldienste, räumliche<br />
Planungsaspekte oder auch „governance“ im weiteren Sinn geht: eGovernment ist ohne ein<br />
breites solides Fundament der Geoinformatik nicht mehr denkbar!<br />
Vor dem Hintergrund des allgegenwärtigen Slogans „weniger Staat, mehr privat“ tun wir<br />
uns manchmal schwer, für eine signifikante Rolle der öffentlichen Verwaltung im Geoinformations-Sektor<br />
einzutreten. eGovernment ist ja durchaus ein positiv besetzter Begriff,<br />
klingt nach Effizienzsteigerung, besserem Bürgerservice und moderner Verwaltung.<br />
geoGovernment ist ein neuer Begriff, klingt sehr nach einem neuen Betätigungsfeld des<br />
öffentlichen Sektors – was steht wirklich dahinter?<br />
Wie in vielen Wirtschaftssektoren bringt die explizite Verortung von Informationen im<br />
Raum einen ganz beträchtlichen Gewinn an Integrationspotenzial mit sich. Informationen in<br />
georeferenzierten Datenbeständen können direkt miteinander in Bezug gesetzt werden und<br />
erlauben effizientes Arbeiten nicht nur in traditionellen Anwendungsbereichen wie Raumplanung,<br />
Umwelt, Verkehr und Infrastrukturwirtschaft, sondern auch weit darüber hinaus.<br />
Gerade das aktuelle Thema des Katastrophenmanagements bzw. der Koordination von Notfalldiensten<br />
demonstriert ganz deutlich, wie wichtig ein universeller, räumlich organisierter<br />
Zugriff auf „alle“ relevanten Datenbestände ist. Ein einheitliches und gut dokumentiertes<br />
Schema für die Georeferenzierung potenziell benötigter Daten ist unentbehrlich, wenn im –<br />
meist dringenden – Bedarfsfall rasch eine bisher nie benötigte konkrete Zusammenschau<br />
von Daten benötigt wird. Notfälle und Katastrophen haben häufig die Eigenschaft nicht oder<br />
nur teilweise vorhersehbarer Konstellationen: „Applikationen“ für „emergency management“<br />
können daher nur Plattformen zum Zugriff auf vereinbarte Schnittstellen sein, vorgefertigte<br />
Datenbestände werden den akuten Informationsbedarf in Krisensituationen nie<br />
gänzlich abdecken können – „das Unvorhergesehene“ ist ein wohl unvermei<strong>dl</strong>icher Bestandteil<br />
solcher Ereignisse.<br />
Über dieses Beispiel hinaus ist auf allen Ebenen der öffentlichen Verwaltung der einheitliche<br />
Lage- und Ortsbezug ein zentraler Baustein für die effektive Organisation von Verwaltungsabläufen.<br />
Nur wenige Themen weisen keinen geographischen Bezug auf, viele Informationen<br />
sind nur über die gemeinsame Lage im Raum miteinander zu verknüpfen. Georeferenzierung<br />
als ein zentrales Zugangs-Paradigma und universelle Leitdimension für Arbeitsabläufe?<br />
Ja, in der öffentlichen Verwaltung trifft dies sicherlich zu! Aus diesem Grund<br />
stellten in abgestimmten Schwerpunkten sowohl der österreichische Dachverband AGEO im<br />
Rahmen seiner Jahrestagung in Wien als auch die AGIT 2003 in Salzburg das Thema geo-<br />
Government in den Mittelpunkt.<br />
Öffentliche Dienste erfahren durch die Unterstützung mittels georeferenzierten, interoperablen<br />
„web services“ einen ganz wesentlichen Innovationsschub. Die Beiträge in diesem<br />
Band bilden daher wichtige Meilensteine auf dem Weg zur breiten Etablierung Geographischer<br />
Informations-Infrastrukturen (GII) – und damit einem neuen Verständnis „öffentlicher
VI<br />
Vorwort<br />
Dienste“ ganz allgemein! Der verstärkt auftretende Begriff der GI-Infrastruktur weist auf<br />
zwei wichtige Facetten hin: Zum einen ist „Infrastruktur“ grun<strong>dl</strong>egender Bestandteil von<br />
Wertschöpfungsketten, aufbauend auf Infrastrukturen werden Mehrwert-Dienste erbracht.<br />
Davon ausgehend und darüber hinaus erfordert „Infrastruktur“ Koordination und ist „Dienst<br />
an der Allgemeinheit“; ein völliger Rückzug des Staates aus dem Bereich der Geoinformation<br />
wird daher nicht sinnvoll sein. Vielmehr beinhaltet geoGovernment das Ziel der Bereitstellung<br />
zentraler Geoinformations-Dienste als Kernstücke von Wirtschaft und effizienter<br />
Verwaltung!<br />
„AGIT 2003 – geoGovernment“ setzte über die Darstellung des Standes von Technik und<br />
Anwendungen hinaus neue Akzente im öffentlichen Sektor und in der Bürgerbeteiligung –<br />
der vorliegende Band kann daher der Fachöffentlichkeit als zentrale Referenz präsentiert<br />
werden. Besonderer Dank seitens der Herausgeber gilt den Autoren, die nach der Präsentation<br />
der Beiträge bereit waren neue Erkenntnisse und Diskussionsergebnisse einzuarbeiten,<br />
und dem Herbert Wichmann Verlag für die rasche und effiziente Herstellung dieses Bandes!<br />
Salzburg, im August 2003 Josef Strobl und Gerald Griesebner
Inhaltsverzeichnis<br />
AXMANN, A.: Internetportal für die österreichische Geoinformations-<br />
Infrastruktur (AGEO-IS)........................................................................................................ 1<br />
CHRISTL, A.: Digitale Stadtplandienste – ein Schritt zum virtuellen Rathaus ................... 5<br />
DÜSTER, H.: OpenSource GIS – das alternative geoGovernment?................................... 17<br />
EBNER, M.: Bewertung von Nutzenpotenzial des geoGovernment................................... 25<br />
FEIX, C., SCHAEFER, O. und EULITZ, S.: easyGovernment –<br />
Wahlinformationssysteme mit GIS-Technologie am Beispiel der<br />
Bundestagswahl 2002 .......................................................................................................... 33<br />
GASPER, M. und GUHSE, B.: Informations- und Managementsysteme für<br />
Gewerbeflächen auf der Basis von Open-Source-Technologien.......................................... 41<br />
GISSING, R.: geo-Government als Teil der österreichischen Geodatenpolitik.................. 51<br />
KANONIER, J. und SCHREILECHNER, P.: GeoKatalog –<br />
Metadatenverwaltung in den GIS der österreichischen Bundesländer................................. 61<br />
KRAUSE, K.-U., BAUER, O. und HOFFMANN, N.: Verteilte Geo- und<br />
Planungsdienste für das Portal www.metropolregion.hamburg.de mit Hilfe der<br />
CoreMedia© Content Application Platform ........................................................................ 67<br />
PEYKE, G. und ZAUNSEDER, S.: Skalierbares GeoGovernment via Internet<br />
und Intranet mit w³GIS ........................................................................................................ 77<br />
RIEDL, M.: Konzept und Umsetzung einer österreichischen Geodatenpolitik .................. 83<br />
SCHENNACH, G.: Vernetztes Europa – GI-Initiativen in der EU .................................... 89<br />
ENGESSER-SCHRÖDER, H. und SCHRÖDER, D.: geoGovernment im<br />
Schwarzwald-Baar-Kreis – eine Bestandsaufnahme............................................................ 97<br />
STAHL, R.: eGovernment und gEoGovernment – Synergien und Potenziale.................. 107<br />
STORCH, H.: Balanced gEo-Government ....................................................................... 119<br />
WILMERSDORF, E.: Ein Fall für e-GEOgovernment – Aufgrabungen im<br />
Straßenbereich und zentraler Leitungskataster am Beispiel von Wien .............................. 129<br />
Autorenverzeichnis .......................................................................................................... 139
Internetportal für die österreichische Geoinformations-<br />
Infrastruktur (AGEO-IS)<br />
Zusammenfassung<br />
Axel AXMANN<br />
Der Österreichische Dachverband für Geographische Information (AGEO) plant die Einrichtung<br />
eines „Internetportals für die österreichische Geoinformations-Infrastruktur“. Dafür<br />
wurde das Österreichische Institut für Raumplanung (ÖIR) mit der Durchführung einer<br />
Machbarkeitsstudie beauftragt. Die Studie wurde im Juni 2003 abgeschlossen und das Ergebnis<br />
liegt vor. Der Autor ist Vorstandsmitglied des AGEO und begleitete diese Studie als<br />
Projektkoordinator.<br />
1 Einleitung<br />
Der Österreichische Dachverband für Geographische Information führt in seinen Statuten<br />
als Ziele unter anderem die „Förderung von Initiativen zur technischen und methodischen<br />
Weiterentwicklung“ und die „Einbindung der österreichischen GI-Landschaft in die Europäische<br />
Spatial Data Infrastructure (ESDI)“ und ist damit um eine Belebung der Wirtschaft<br />
durch vermehrte Anwendung von Geodaten und der Geoinformationstechnologie bemüht.<br />
Unter dieser Prämisse wurde bald nach der Gründung im Jahr 2000 ein Arbeitskreis „Geodateninfrastruktur“<br />
gebildet, der einen Aktionsplan zur Erreichung dieses Zieles ausarbeitete.<br />
Dieser beinhaltet unter anderem die Einrichtung eines „Internetportals für die österreichische<br />
Geoinformations-Infrastruktur“.<br />
Mit Beginn des Jahres 2002 wurde das Österreichische Institut für Raumplanung (ÖIR) mit<br />
der Durchführung einer Machbarkeitsstudie beauftragt (Projektleiter: Fr. Mag. Cornelia<br />
Krajasits). Die Arbeit wurde durch das BMWA zu ca. 55 % gefördert. Nach Klarheit der<br />
Finanzierung durch BMWA und AGEO wurde die Arbeit etwa im Mai 2002 in Angriff<br />
genommen.<br />
Das Internetportal wurde in den Arbeitsgesprächen oft als „Metadatenserver“ oder „Metadatenservice“<br />
bezeichnet. Im Titel der vorliegenden Studie findet sich die Bezeichnung<br />
„Metadaten- und Dienstleistungsserver“. Als Abkürzung wird dafür gerne „MDS“ verwendet.<br />
Es hat sich jedoch während der Bearbeitung dieser Studie herausgestellt, dass diese<br />
Begriffe das Vorhaben nur unklar und nicht umfassend genug beschreiben und daher irreführend<br />
sind und zu Fehlinterpretationen führen. Daher werden im Weiteren die Bezeichnung<br />
„Internetportal für die österreichische Geoinformations-Infrastruktur“ und die Abkürzung<br />
„AGEO-IS“ verwendet.
2<br />
2 Ergebnisse der Studie<br />
A. Axmann<br />
Auf Basis einer Angebots- und Nachfrageanalyse ergaben sich zunächst die Ausrichtungen<br />
für den Aufbau einer Geodateninfrastruktur.<br />
1. Der Aufbau einer nationalen Geoinfrastruktur und damit die Errichtung von umfassenden<br />
Geo-Informationsdiensten sind sowohl von hohem administrativ-politischen als<br />
auch von wirtschaftlichem Interesse. Ziel sollte es ein, sowohl verwaltungsinterne Effizienzsteigerungen<br />
als auch eine Belebung der Wirtschaft und der Geoinformationsbranche<br />
im speziellen zu erreichen.<br />
2. Ein Geo-Informationsdienst sollte – in Abstimmung von öffentlichen und privaten Interessen<br />
– dazu beitragen, einen umfassenden Zugang zu relevanten politischen und ökonomischen<br />
Informationen der Geoinformationsbranche zu ermöglichen. Als branchenintern<br />
relevante Informationen werden jene angesehen, die für die Erfassung, Wartung,<br />
Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Geoinformationsprodukten und<br />
Dienstleistungen notwendig und interessant sind (z. B. Metadaten, Normen, Standards,<br />
internationale Entwicklungen, Forschung und Entwicklung, laufende Projekte, Förderungen,<br />
…).<br />
3. Ein Geo-Informationsdienst sollte weiterhin die Möglichkeit eröffnen, auch für potenziellen<br />
(neue) Kundengruppen und Interessierte einen kompakten, übersichtlichen Zugang<br />
zur umfassenden Angebotspalette der Geoinformationsbranche zu schaffen.<br />
Die zunächst in einem Grobkonzept geplanten Inhalte und Informationsangebote des Portals<br />
gliedern sich:<br />
• Informationen über relevante österreichische und internationale (EU) Projekte aus Forschungseinrichtungen<br />
sowie über Fördermöglichkeiten, rechtliche Grun<strong>dl</strong>agen, Standards<br />
und Normen.<br />
• Informationen über Geodaten, Metadaten, Dienste und abgeleitete Produkte, abfragbar<br />
unter anderem nach Themen, Regionen und Anbietern.<br />
• Angebote von Softwarefirmen, Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen.<br />
• Raum für den Mitgliederbereich, Kooperations- und Jobbörse, Prüfdienste.<br />
Als Dachverband für Geographische Information und damit als Interessensvertretung der<br />
„Geoinformationsbranche“ mit einem breiten Mitgliederspektrum, das sowohl die Interessen<br />
der öffentliche Verwaltung auf Bundes- sowie auf Länderebene, sowie Private und andere<br />
Interessensvertretungen umfasst, scheint der AGEO prädestiniert dafür, sich entsprechend<br />
seiner Statuten aktiv am Aufbau der österreichischen Geoinformations-Infrastruktur zu<br />
beteiligen. Der AGEO wird bereits jetzt als zentrale Anlaufstelle und Informationsdrehscheibe<br />
der Branche verstanden. Dementsprechend können die bestehenden Strukturen der<br />
Informationsvermittlung (Organisation, Webauftritt, Veranstaltungen, Publikationen, ...)<br />
und scheint daher als Interessens- bzw. Lobby-Organisation der Geoinformationsbranche<br />
prädestiniert diese Aufgabe zu übernehmen und als Betreiber solch einer umfassenden<br />
„Branchen-Informationsdrehscheibe“ bzw. „Informationsplattform“ zur Belebung der Wirtschaft<br />
zu fungieren.
Internetportal für die österreichische Geoinformations-Infrastruktur 3<br />
Für die Errichtung und den laufenden Betrieb eines solchen umfassenden Geo-Informationsdienstes<br />
sind finanzielle Mittel erforderlich, die das Budget eines Mitgliederverbandes in<br />
der Größenordnung des AGEO (ca. 40 Mitglieder) bei weitem überschreiten. Der Erfolg<br />
eines solchen Projektes erscheint nur dann nachhaltig gesichert, wenn die Umsetzung sowie<br />
die Finanzierung in enger Kooperation zwischen öffentlicher Hand, Interessensvertretungen<br />
und Privaten erfolgt.<br />
Im Zuge der Studie wurden österreichische und internationale Projekte, die thematisch mit<br />
dem gegenstän<strong>dl</strong>ichen Vorhaben verwandt sind, analysiert. Die bereits in Betrieb befin<strong>dl</strong>ichen<br />
Lösungen wie z. B. die Geodaten- und Dienst-Angebote der österreichischen Bundesländer<br />
sollen in das Portal AGEO-IS selbstverstän<strong>dl</strong>ich eingebunden werden. Auf internationaler<br />
Ebene wird in den weiteren Schritten eine Koordination stattfinden, soweit diese<br />
ökonomisch sinnvoll und in technischer Hinsicht nötig ist.<br />
Die Schlussfolgerungen und Han<strong>dl</strong>ungsempfehlungen werden in der Studie auf verschiedenen<br />
Ebenen in Form von Thesen zusammengefasst:<br />
• Um dem Anspruch einer weitgehenden Vollständigkeit des „AGEO-IS“ in einer mittelbis<br />
längerfristigen Perspektive gerecht zu werden, sind eine eindeutige politische Willensbildung<br />
und ein Auftrag an die jeweiligen (öffentlichen) Daten erhebenden, Daten<br />
führenden und Dienste anbietenden Stellen notwendig/erforderlich.<br />
• Für die Entwicklung und Errichtung eines „AGEO-IS“ ist die Einbettung in bzw. die<br />
Koordinierung mit den laufenden Aktivitäten auf politischer bzw. institutioneller Ebene<br />
unabdingbar.<br />
• Für ein Projekt dieser Dimension ist die Bereitstellung öffentlicher Ressourcen (Budget,<br />
Personal) notwendig. Kooperationen mit Privaten bei Entwicklung, Umsetzung<br />
usw. sind wünschenswert.<br />
• Mit der Errichtung eines „AGEO-IS“ soll nicht nur dazu beigetragen werden eine verwaltungsinterne<br />
Effizienzsteigerung zu erzielen, sondern auch eine Belebung der österreichischen<br />
Wirtschaft und der Geoinformationsbranche im speziellen erreicht werden.<br />
Um dies zu sichern, ist eine Abstimmung der öffentlichen und privaten Interessen und<br />
Anforderungen wichtig.<br />
• Der AGEO wird bereits jetzt als zentrale Anlaufstelle und Informationsdrehscheibe der<br />
Branche verstanden. Dementsprechend können die bestehenden Strukturen der Informationsvermittlung<br />
(Organisation, Webauftritt, Veranstaltungen, Publikationen...) in<br />
Hinblick auf die im Rahmen dieses Projektes erhobenen Anforderungen weiterentwickelt<br />
werden.<br />
Etwa zeitgleich mit der Bearbeitung der Machbarkeitsstudie intensivierte sich auch die<br />
öffentliche politische Diskussion um die Konzeption einer österreichischen Geodatenpolitik,<br />
die auch den Aufbau einer Geoinformationsinfrastruktur zum Thema hat. Im Rahmen<br />
dieser Machbarkeitsstudie wurden diese Initiativen und Aktivitäten ebenfalls aufgegriffen<br />
und berücksichtigt. Dementsprechend wurde bei den Überlegungen hinsichtlich der<br />
Ausrichtung eines Geodaten- und Dienstleistungsservers darauf Bedacht genommen, die<br />
größtmöglichen Synergien mit bestehenden und laufenden Aktivitäten zu erreichen, Doppelgleisigkeiten<br />
zu vermeiden und Ressourcen schonend zu agieren.
Zusammenfassung<br />
Digitale Stadtplandienste – ein Schritt<br />
zum virtuellen Rathaus<br />
Nutzung Freier Software aus der Sicht einer Firma<br />
Arnulf CHRISTL<br />
Dieser Beitrag versteht sich als Fortführung des Vortrags „Digitale Stadtplandienste – ein<br />
Schritt zum virtuellen Rathaus“ in der Vortragsreihe geoGovernment vom Donnerstag, 04.<br />
Juli 2003, auf der AGIT in Salzburg. Wir entschuldigen uns dafür, nicht den gleichen Vortrag<br />
in Schriftform wiederzugeben.<br />
Angespornt durch Anregungen aus dem Publikum und umfangreichen Diskussionen an<br />
unserem Stand, beschreiben wir den Weg, auf dem wir zusammen mit unseren Kunden<br />
Freie Software gefunden haben.<br />
Dabei ist ein Erfahrungsbericht unserer Arbeit mit Kunden über die letzten Jahre entstanden.<br />
Das Ziel des Beitrags ist, die Idee hinter dem Konzept Freie Software allgemeinverstän<strong>dl</strong>ich<br />
vorzustellen und in bekannte Kontexte zu setzen.<br />
Das Thema ist so vielschichtig, dass wir keinen durchgehenden roten Faden ziehen können.<br />
Wir hoffen, dass das folgende Sammelsurium an Erfahrungen, Meinungen und Hinweisen<br />
Ihnen bei der Entdeckung der Freiheit wird helfen können.<br />
Unser hier vorgestellter fiktiver Kunde ist die Synthese unserer Erfahrungen mit öffentlichen<br />
Verwaltungen, Institutionen und unseren Firmenkunden.<br />
1 Einleitung<br />
Unser Kunde möchte ein GIS aufbauen. In unserem fiktiven Fall ist die Vermessungsabteilung<br />
der Initiator. Der Impuls könnte aber genauso gut aus der Stadtplanung, dem Umweltamt,<br />
dem Referat Tiefbau, dem Denkmalschutz, dem Bauhof, Presseamt oder sonst einer<br />
Abteilung kommen. Auch bei Firmen entsteht der erste Bedarf nach einem GIS auf sehr<br />
heterogene Weise, er kann sich zuerst in der Marketingabteilung, der Logistik, des Wartungsteams<br />
oder z. B. bei der Planung von Filialstellen manifestieren.<br />
Exkurs: Letzten<strong>dl</strong>ich ist es nicht ausschlaggebend woher die Idee kommt, sondern viel wichtiger<br />
ist, dass dort ein Mensch sitzt, der ein geo-relevantes Problem hat und aktiv lösen möchte.<br />
Nur dann kann die Einführung eines GIS funktionieren.<br />
Die erste Zielsetzung ist die digitale Aufbereitung der ALK (Grunddaten) und der Aufbau<br />
einer kleinräumigen Gliederung (Planungsdaten). Ein weiterer Meilenstein ist die Erstellung<br />
eines interaktiven digitalen Online-Stadtplandienstes. In der dritten Ausbaustufe wird das<br />
Online-Angebot um interne Inhalte erweitert, die als zusätzliche Ebenen im Intranet in den
6<br />
A. Christl<br />
Stadtplandienst geladen werden können. GIS als interaktiver Online-Dienst im Internet ist<br />
zu Beginn diesen Projektes nicht denkbar, die ersten Kartenserver stecken gerade mal in<br />
den Kinderschuhen.<br />
2 Die GIS-Einführung<br />
Mit dem Know-how einiger Jahre Programmierung, Beratung und Training mit der Desktop<br />
GIS-Software des Herstellers SICAD Geomatics und guten Kontakten zu der Entwicklungsabteilung<br />
(wer kann das heutzutage schon noch von sich behaupten) und viel Elan gehen wir<br />
das Projekt an.<br />
Aufbau des Systems<br />
Zunächst werden zwei Lizenzen des Desktop GIS SICAD/SD gekauft (in etwa vergleichbar<br />
mit ArcView 3.x für alle, die SICAD/SD nicht kennen). Von der zuständigen Landesstelle<br />
werden ALK-Daten erworben und mit reichlich Aufwand in das proprietäre SICAD-Format<br />
C60 konvertiert. Während der Konvertierung und in den folgenden Monaten treten immer<br />
wieder gravierende Fehler in der ALK-Grun<strong>dl</strong>age auf. Diese können (bzw. dürfen) nicht<br />
durch den Kunden selbst behoben werden, so dass eine intensive Korrektur-Korrespondenz<br />
mit der Landesstelle entsteht.<br />
Auf Basis dieser Daten wird die kleinräumige Gliederung digitalisiert, eine Synthese aus<br />
diesen Daten wird in die Karte des Stadtplandienstes einfließen. Für die Digitalisierung der<br />
Geometrien implementieren wir einige zusätzliche Werkzeuge. Die Werkzeuge setzen auf<br />
der API-Schnittstelle der Basissoftware SICAD/SD auf und werden in Visual Basic V6.0<br />
programmiert.<br />
Exkurs: Einen Teil der Programme und Werkzeuge können wir auch bei anderen Kunden einsetzen<br />
und umgekehrt nutzen wir Software, die in anderen Projekten entstanden ist. Jede Applikation<br />
wird deshalb zu einem eigenständigen Produkt ausgebaut und in unser Lizenzmodell<br />
aufgenommen. Es werden Wartungsverträge, Hotline und ein Servicemodell aufgebaut.<br />
Der Arbeits- und Kostenaufwand, der in die Werkzeuge und Applikationen fließt, steht dabei in<br />
keinem Verhältnis zu den erzielten Erlösen. In den meisten Fällen ist die Anzahl verkaufter<br />
Lizenzen nicht ausreichend, um die Investition zu decken. Die Finanzierung erfolgt dann über<br />
die Projektarbeit.<br />
Schulung und Training<br />
Rückblickend stellen wir fest, dass sowohl wir als auch der Kunde sich in einigen Punkten<br />
nicht klar darüber waren was bei diesem Vorhaben auf uns zukommt. Als ein großes Problem<br />
stellte sich fehlendes Know-how beim Kunden heraus. Wir werden die erste Schulung<br />
nicht vergessen: der Kunde ist überfordert, der Trainer ist erschöpft. So schlecht kann Software<br />
doch nicht sein? Sie ist es doch!<br />
Exkurs: Bitte beziehen Sie das nicht auf die konkrete Software SICAD/SD – unserer Ansicht<br />
nach noch immer ein gutes Desktop GIS – sondern auf Software prinzipiell. Dazu gehören auch<br />
das Betriebssystem, nicht-druckende Drucker, Dokumentvorlagen mit fehlenden Schriftarten,<br />
etc. Die Liste ist en<strong>dl</strong>os.
Digitale Stadtplandienste – ein Schritt zum virtuellen Rathaus 7<br />
Systemadministration und Betrieb<br />
Bereits bei dem ersten Termin vor Ort wird deutlich, dass die EDV-Abteilung das „Projekt<br />
GIS“ mit Argwohn betrachtet. Immerhin werden für dieses Projekt recht gut ausgestattete<br />
Rechner beschafft, der hochwertigste Plotter der gesamten Verwaltung angeschafft. In der<br />
Vermessungsabteilung wird ein Mitarbeiter zum GIS-Administrator ernannt – er soll die<br />
Schnittstelle zwischen System und Anwender herstellen.<br />
Schnell gibt es Vorbehalte, Diskussionen und Kompetenzfragen werden auf wenig professionellem<br />
Niveau diskutiert. Die nicht öffentlich formulierte, aber doch sehr deutliche Befürchtung<br />
ist, das eine nicht kontrollierbare Instanz im eigenen Haus entsteht, einem Virus<br />
nicht unähnlich. Aus sicherheitstechnischen Gründen ein nicht zu unterschätzendes Argument.<br />
Solche Befürchtungen müssen ernst genommen werden und können bei unserem<br />
Kunden durch eine offene Informationspolitik und uneingeschränkte Beteiligung aller Akteure<br />
weitgehend ausgeräumt werden.<br />
Exkurs: Diese Problematik kann leider auch beliebig kompliziert werden. Hier liegt es wieder<br />
an einzelnen Menschen, ob es klappt oder nicht – die verwendete Technik ist dabei oft sogar<br />
sekundär. Sich nicht mit dem Problem auseinander zu setzen kann das gesamte Projekt in Gefahr<br />
bringen, eine EDV-Abteilung ist meist auf unauffällige Art sehr mächtig.<br />
Zwischenziel: Architektur für einen druckbaren Stadtplan<br />
Nach Aufbereitung der Daten und weitgehend abgeschlossenen Digitalisierarbeiten wird mit<br />
der aktualisierten Adressdatenbank ein Straßenverzeichnis aufgebaut, das letzte Modul, das<br />
für das Zwischenziel benötigt wird. Bis hier ist ausschließlich proprietäre Software zum<br />
Einsatz gekommen und hat sich gut bewährt.<br />
Tabelle 1 zeigt die eingesetzte Technik bei unserem Kunden – vom Betriebssystem bis zur<br />
verwendeten Programmierumgebung. Stellen Sie sich in den Feldern einfach Ihre eigenen<br />
Softwarepakete vor, letzten<strong>dl</strong>ich ähneln sich alle GIS Architekturen, die Komponenten sind<br />
eigentlich austauschbar.<br />
Tabelle 1: Eingesetzte Software Komponenten<br />
Betriebssystem Windows 2000 Workstation<br />
Desktop GIS SICAD/SD V 5.1 mit dateibasierter Datenhaltung<br />
und ODBC Kopplung<br />
Konstruktionswerkzeug: High Level API VB Applikation für<br />
SICAD/SD<br />
Diverse High Level API VB Applikation Fachapplikationen für<br />
SICAD/SD werden eingesetzt<br />
VBA für SICAD/SD High Level API Skripte mit Serien Word-<br />
Dokumenten, Excel Tabellen, etc.
8<br />
A. Christl<br />
Verfeinerung zur digitalen Stadtgrundkarte<br />
Nach und nach wird die ALK in den Stadtplan eingearbeitet, es gibt lange Diskussionen um<br />
die Aktualisierung der ALK, bis sich herausstellt, dass die nächste wirklich umfangreiche<br />
Aktualisierung in frühestens zwei Jahren zu erwarten ist. Aktualisierungsfragen werden<br />
deshalb mit niedriger Priorität behandelt, wer weiß schon was in diesen zwei Jahren sonst<br />
noch passiert. Möglicherweise steht die ALK dann schon online zur Verfügung.<br />
Eine Kopplung zu den ALB-Daten wird implementiert, wie gehabt als Visual Basic-Lösung<br />
für SICAD/SD. Gleichzeitig wird eine Navigationskomponente implementiert, um sich<br />
besser in dem Online-Kartenwerk positionieren können.<br />
3 Erweiterung des Systems<br />
Inzwischen gehören verschiedene Aufgaben zum täglichen Brot der Mitarbeiter der GIS<br />
Abteilung. Neben der aktiven Wartung und Pflege der Daten wird nach und nach das System<br />
aufgerüstet. Es gibt dabei keine vorgegebene Richtung in der weitergearbeitet werden<br />
soll, sondern es entsteht eine vollständig problemorientierte Eigendynamik.<br />
Exkurs: Während dieses Prozesses entsteht auch die neue Identität der GIS-Abteilung als<br />
„Dienstleister“: Die Fachämter werden als „Kunden“ bezeichnet und auch als solche wahrgenommen.<br />
Die GIS-Abteilung erweitert die Funktionalität, entweder indem neue Werkzeuge<br />
beauftragt und fertige Produkte hinzugekauft werden oder einfach dadurch, dass die Mitarbeiter<br />
dazulernen.<br />
Die Stadtplanung hat für ein größeres Projekt Gelder für eine flächendeckende Befliegung<br />
eingestellt, um die Daten einem Ingenieurbüro zur Verfügung zu stellen. Postwendend steht<br />
selbiges Ingenieurbüro auf der Matte und fordert weitere Daten, vor allem geometrisch<br />
korrekte. Die GIS-Abteilung kann inzwischen Daten in mehreren Standardformaten abgeben<br />
und liefert zeitnah den gewünschten Bereich. Nach Abschluss des Projektes werden die<br />
Planungsdaten des Ingenieurbüros in das GIS übernommen und es steht wieder eine neue<br />
Ebene zur Verfügung.<br />
Weitere Arbeitsgebiete<br />
Da die Stadtplanung über kein eigenes GIS verfügt und mitverfolgt hat, welchen Aufwand<br />
es bedeutet das selbst zu tun, werden kurzerhand die Luftbilddaten in SICAD/SD integriert.<br />
Für die Stadtplanung wird eine weitere Desktop-Lizenz angeschafft. Das ist die erste referatübergreifende<br />
Investition und wird von allen als großer Erfolg gefeiert.<br />
Relativ bald kann die Stadtplanung sogar eine neue Mitarbeiterin einstellen, deren Aufgabenbereich<br />
weitgehend in der Koordination der GIS Belange der Stadtplanung liegt. Es<br />
entsteht eine Baulückenkarte, grobe Planungen erfolgen jetzt bereits digital. Es wird ein<br />
erster Versuch gestartet, einen FNP aufzustellen. Ein Großteil der Daten kann aus dem GIS<br />
übernommen werden und muss lediglich neu attributiert werden. Die zeichenkonforme<br />
Aufbereitung des FNP übernimmt ein externes Planungsbüro, da die internen Personalressourcen<br />
nicht reichen – und möglicherweise auch, weil ein digitaler FNP doch so ein paar<br />
Tücken haben kann.
Digitale Stadtplandienste – ein Schritt zum virtuellen Rathaus 9<br />
Exkurs: Ganz nebenbei wächst der Haushalt des GIS-Teams an. Für die inzwischen sieben<br />
Lizenzen werden brav Wartungsverträge bezahlt und jede weitere Software verursacht neben<br />
den Lizenzkosten zusätzlichen Schulungs- und Wartungsaufwand.<br />
Schulung und Training II<br />
Das Training kann inzwischen durch interne Mitarbeiter durchgeführt werden, deren Arbeitskraft<br />
dadurch natürlich auch gebunden wird. Es gibt sogar einen Vertretungsplan, der<br />
greift, wenn der GIS-Administrator krank oder im Urlaub ist. Bei der Einführung einer ganz<br />
neuen Version werden wir nachgefragt, um bei ersten Startschwierigkeiten zu helfen. Die<br />
GIS-Abteilung adelt sich selbst zum „GIS-Team“, das System ist über den Berg.<br />
Exkurs: Ab hier ist der Kunde ohne weitere Hilfe von uns han<strong>dl</strong>ungsfähig. Unser Aufgabenbereich<br />
als Firma konzentriert sich mehr und mehr auf die Verfeinerung unserer Produkte. Es<br />
wird zunehmend schwieriger die durch Produktentwicklung verursachten Kosten wieder einzunehmen.<br />
Ein eigener Vertrieb kümmert sich darum, doch auch der will finanziert werden. Inzwischen<br />
geht es nicht mehr darum Probleme zu lösen, sondern fertige Problemlösungen zu verkaufen<br />
– und zu hoffen, dass der Kunde seine Probleme damit auch lösen kann.<br />
4 Der digitale Online-Stadtplandienst<br />
Bereits seit längerem fordert das Presseamt, das auch für Tourismus zuständig ist, einen<br />
interaktiven Online-Stadtplan. Allerdings wird „erwartet“, dass das einfach nur eine weitere<br />
selbstverstän<strong>dl</strong>iche Dienstleistung der GIS-Abteilung ist. Es wird beraten, wie das zu bewerkstelligen<br />
sei.<br />
Datentechnisch ist das kein Problem mehr, alle Daten liegen digital vor, das Know-how für<br />
die Weiterverarbeitung ist inzwischen ebenfalls vorhanden. Die meisten Arbeitplätze sind<br />
vernetzt und viele Arbeitsprozesse werden bereits analog vom GIS-Team betreut.<br />
Systemerweiterung<br />
Wir werden vom Kunden beauftragt die Architektur für das Online-System zu erarbeiten.<br />
Wir konzipieren ein System auf Basis der bewährten SICAD-Technik mit dem WMS SD-<br />
IMS (in etwas vergleichbar mit dem alten ArcView-IMS, für alle die das SICAD-System<br />
nicht kennen).<br />
Exkurs: Die Web Mapping Software SICAD/SD-IMS wurde von uns im Auftrag von SICAD<br />
Geomatics als Entwicklungspartner konzipiert, programmiert, gewartet und gepflegt, so dass<br />
wir die Technik sehr gut kennen.<br />
Im Lieferumfang der SICAD/SD-IMS Software werden auch mehrere Clients ausgeliefert, allerdings<br />
fehlen dort sowohl dynamisches Projektmanagement als auch Benutzer- und Rechteverwaltung.<br />
Deshalb verwenden wir in der Architektur unsere eigene Client Suite, die wir ebenfalls<br />
als lizenziertes Produkt mit allem Schnickschnack (Wartung, Service, Pflege, Hotline) anbieten.
10<br />
A. Christl<br />
Ein Angebot für den Online-Stadtplandienst<br />
Die folgende Tabelle zeigt die Komponenten des Online-Stadtplandienstes. Wir geben hier<br />
die Preise in fiktiven Währungseinheiten an, da die genauen Zahlen je nach eingesetzter<br />
Software stark variieren können.<br />
Tabelle 2: Kostenaufstellung Online-Stadtplandienst (Beispiel)<br />
Posten Währungseinheiten<br />
Beratung 5.000,-<br />
Betriebssystem 1.500,-<br />
Datenmodell 3.500,-<br />
Datenbanksystem 10.000.-<br />
Webserver 1.000,-<br />
Online GIS Server 15.000,-<br />
Installation 3.000,-<br />
Client Suite 7.000,-<br />
Schulung 5.000,-<br />
Summe 51.000,-<br />
davon Lizenzkosten 27.500,davon<br />
Dienstleistung 23.500,-<br />
Software Wartungsverträge 6.325,-<br />
5-Jahres-Vorausplanung 31.625,-<br />
In dem Angebot, dass wir dem Kunden schicken, haben wir unsere Clientsoftware nicht mit<br />
aufgenommen, weil das Angebot dadurch noch mal gut 15 % teuerer geworden wäre. Das<br />
ist die einzige Möglichkeit wie wir die Gesamtkosten drücken können, da wir die Kosten<br />
der Basissoftware-Lizenzen direkt an den Hersteller abführen müssen.<br />
Obwohl der Kunde in den letzten Jahren gut das Achtfache von diesem Betrag in das System<br />
investiert hat, ist bei der aktuellen Finanzlage die Summe unter diesem Angebot das<br />
sofortige, absolute und unwiderrufliche Ausschlusskriterium. Ist nicht finanzierbar. Ende<br />
der Diskussion.<br />
Nach eingehender Beratung finden sich doch noch Möglichkeiten der flexiblen Umschichtung<br />
eines Teils der Kosten (vor allem Dienstleistung) auf andere Abteilungen, aber es fehlt<br />
das notwendige Geld für die Lizenzen der Basissoftware.<br />
Das Budget der GIS-Abteilung ist darauf ausgelegt das laufende System zu betreuen und<br />
kleinere Aufträge zu finanzieren, gleiches gilt für die Anzahl der Mitarbeiter. Die Stadtkasse<br />
ist inzwischen aber so leer, dass es völlig undenkbar ist, für den Luxus eines dynamischen<br />
Stadtplandienstes so viel Geld bereitzustellen, wenn gleichzeitig Spielplätze dichtgemacht<br />
werden und die Bibliothek aufgelöst werden muss.<br />
Exkurs: Die Fremdübernahme „unseres“ GIS-Herstellers SICAD Geomatics ist nicht ganz<br />
unerwartet aber dennoch ein ordentlicher Schock. Bis dahin mussten wir uns nicht mit allzu
Digitale Stadtplandienste – ein Schritt zum virtuellen Rathaus 11<br />
vielen Mitbewerbern herumschlagen, da die erlesene Gruppe der SICAD/SD-Nutzer nicht allzu<br />
groß, dafür aber sehr kompetent und treu ist.<br />
Die postwendende Ankündigung der neuen Geschäftsleitung, dass die eigene Software nicht<br />
mehr weitergeführt wird, zieht einen deutlichen Schlussstrich auch unter das GIS unseres Kunden.<br />
In Zukunft soll statt SICAD ESRI-Software eingesetzt werden – so der Plan unseres Softwarepartners.<br />
Nichts leichter als das. Allein schon aus professionellem Interesse haben wir in den letzten<br />
Jahren immer sehr genau die Entwicklungen bei den Mitbewerbern verfolgt, um gute Argumente<br />
zu haben, warum die eigene Lösung viel besser ist.<br />
Jetzt sollen wir also zu unserem Kunden gehen und sagen: „Entschuldigung, aber wir haben<br />
uns die letzten Jahre geirrt und stellen gerade schlagartig fest, dass die andere Software doch<br />
die bessere ist.“<br />
Nun gut, wir schlucken unseren Stolz herunter, lassen uns auf der neuen Plattform ausbilden,<br />
kaufen für unsere eigene inzwischen beträchtliche Palette an proprietären Applikationen Entwicklungslizenzen<br />
– und spätestens da stellen wir fest, dass alles doch sehr anders ist. Vor<br />
allem teurer.<br />
Scheinbare Alternativen<br />
Wir sehen uns zusammen mit dem Kunden intensiv nach anderen Anbietern um. Viele versprechen<br />
viel und vieles ist auch sehr interessant, doch recht bald holen uns (sowohl Kunde<br />
als auch Dienstleister) die Zahlen ein, wir bekommen Verträge vorgelegt und dürfen plötzlich<br />
vieles nicht mehr. Wir stellen fest:<br />
1. Die bisher eingesetzte Software ist verglichen mit den jetzigen Alternativen vergleichsweise<br />
nicht zu teuer gewesen.<br />
2. Wir haben offensichtlich bisher immer zu billig angeboten, die Kunden für die gebotene<br />
Leistung der Software zuviel bezahlt.<br />
3. Egal welche proprietäre Software eingesetzt wird, man liefert sich dem Wohl und Wehe,<br />
den Launen und marktwirtschaftlichen Kalkül des Herstellers aus.<br />
4. Egal auf welche Software man umsteigt – es gibt genau die gleichen Einschränkungen<br />
bei der Nutzung.<br />
5. Wir (als Firma) werden von den großen GIS-Herstellern ausschließlich als Lizenzvermittler<br />
(wo ist die Melkkuh???) zu unseren Kunden wahrgenommen. Ausschließlich die<br />
Dicke unserer Auftragsbücher mit Lizenzverkäufen ist relevant.<br />
Das sind nicht wirklich rosige Aussichten. Egal mit welchem proprietären kommerziellen<br />
Hersteller wir und befassen, es wird schnell klar, dass das gleiche Konzept greift wie bei<br />
alle anderen auch. Es gibt durchaus Detailunterschiede in den Verträgen, aber das primäre<br />
Interesse eines großen Herstellers kann nur die möglichst effektive Bevormundung des<br />
Kunden sein.<br />
Exkurs: Der proprietäre Hersteller, der uns eines besseren belehren kann, ist herzlich eingeladen<br />
das zu tun.<br />
Spätestens jetzt ist die Geschichte wirklich zu Ende – könnte man meinen. Aber es gibt uns<br />
immer noch, und unseren Kunden auch – samt GIS.
12<br />
5 Freiheit für Software<br />
A. Christl<br />
Angekommen an diesem Tiefpunkt entdecken wir Freie Software. Es ist eine ganz neue und<br />
befreiende Erfahrung. Wenn man das erste Mal von einer wildfremden Wissensgemeinschaft<br />
bereitwillig, kostenfrei und ohne kommerzielle Hintergedanken Software zur Verfügung<br />
gestellt bekommt die einfach nur funktioniert, dann ist das sehr beeindruckend.<br />
Exkurs: „Freie Software“ hat etwas mit Freiheit zu tun, nicht mit dem Preis. Um das Konzept<br />
zu verstehen, ist an „frei“ wie in „freier Rede“, und nicht wie in „Freibier“ zu denken. „Freie<br />
Software“ bedeutet die Freiheit des Benutzers, die Software zu benutzen, zu kopieren, sie zu<br />
vertreiben, zu studieren, zu verändern und zu verbessern.<br />
Quelle: http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.de.html<br />
Ein Vorwurf<br />
Ein Vorwurf, den wir uns als kleine, feine Softwareschmiede machen müssen, ist, dass wir<br />
nicht früher gemerkt haben, welches Potenzial in Freier Software steckt. Wie konnte es<br />
passieren, dass wir uns mit ISO-Normen rumschlagen, die OGC-Architekturen rauf und<br />
runterbeten können, sechs verschiedene Entwicklungsumgebungen und Programmiersprachen<br />
beherrschen, seit Jahren GI-Systeme implementieren und Architekturen entwerfen und<br />
dabei nicht gemerkt haben, dass es echte Alternativen zu proprietärer Software gibt?<br />
Die Antwort ist ganz einfach: weil Freie Software keine Lobby hat! Es gibt keine klassischen<br />
Vertreter (in der Art eines Staubsaugerverkäufers – ohne diese Berufsgruppe verunglimpfen<br />
zu wollen) für Freie Software, da es keine finanziellen Anreize gibt. Es gibt auf<br />
den großen GIS-Messen keinen 600 m 2 großen Stand, der Werbung für die neuesten Projekte<br />
macht. Mehr noch, außer dem Linuxtag gibt es überhaupt keine große wirklich auf<br />
diesen Bereich abgestimmte Veranstaltung. Der Linuxtag ist die einzige bekannte Veranstaltung,<br />
auf der Freie Software vorgestellt, diskutiert und weitergeführt wird. Aber bereits<br />
schon der Name „disqualifiziert“ die Veranstaltung für die GIS-Gesellschaft, weil es hier<br />
offensichtlich um Linux geht und das ist ein Betriebssystem aber kein GIS. Der Linuxtag ist<br />
derzeit tatsächlich die einzige große, messeartige Veranstaltung, die zu den Themen Freie<br />
Software – auch für GIS-Fragestellungen – Informationen und Kontakte liefern kann.<br />
Echte Alternativen<br />
Wir gehen in Klausur und fangen an uns in diesem Bereich zu engagieren und werden<br />
schnell mit Erfolgen belohnt. Der Kunde profitiert direkt davon, da er uns für Testzwecke<br />
einen Teil seines Datenbestandes überlassen hat und jetzt sofort sämtliche Ergebnisse nutzen<br />
kann, da die Nutzung der Software keine Lizenzkosten verursacht.<br />
Der UMN MapServer<br />
Wir möchten hier die UMN MapServer Software vorstellen, sie steht symbolisch für all die<br />
anderen Komponenten, die ebenfalls frei sind und gute Dienste leisten – aber z. T. noch<br />
unbekannter sind.<br />
Der Start mit dem UMN MapServer ist vergleichsweise einfach. Vor allem für ESRI-<br />
Kunden ist es auch schwer den Einsatz des UMN MapServer nicht zu empfehlen – auch
Digitale Stadtplandienste – ein Schritt zum virtuellen Rathaus 13<br />
daran erkenntlich, dass viele Dienstleister diese Software gerne dann aus der Schublade<br />
ziehen, wenn der Kunde deutlich gemacht hat, dass ihm die ArcIMS Software zu teuer ist.<br />
Nebenbei funktioniert diese Software sogar richtig gut.<br />
Mit einer Hand voll Freier Software Produkten haben wir uns zusammen mit dem Kunden<br />
noch mal hingesetzt, den Stadtplandienst in eine offene Architektur gesteckt und erneut<br />
durchkalkuliert. Das Ergebnis ist einleuchtend und zeigt auch, wieso wir (als Firma) auch<br />
mit Freier Software Geld verdienen können.<br />
Tabelle 3: Kostenaufstellung II Online-Stadtplandienst (Beispiel)<br />
Posten Proprietäre Software Freie Software<br />
Beratung 5.000,- 5.000,-<br />
Betriebssystem 1.500,- 0,-<br />
Datenmodell 3.500,- 3.500,-<br />
Datenbanksystem 10.000.- 0.-<br />
Webserver 1.000,- 0,-<br />
Online GIS Server 15.000,- 15.000,-<br />
Installation 3.000,- 3.000,-<br />
Anpassung & Erweiterung 7.000,- 7.000,-<br />
Schulung 5.000,- 5.000,-<br />
Summe 51.000,- 23.500,-<br />
davon Lizenzkosten 27.500,- 0,davon<br />
Dienstleistung 23.500,- 23.500,-<br />
Software Wartungsverträge 6.325,- 0,-<br />
5-Jahres Vorausplanung 31.625,- 0,-<br />
Inzwischen verfügt der GIS-Administrator auch über genügend vertieftes Know-how, um<br />
den Serverbetrieb tatsächlich zu gewährleisten.<br />
Exkurs: Oft wird genau dieser Punkt als Argument verwendet, um einen Vorteil proprietärer<br />
Software herauszustellen. Das würde bedeuten, dass für den Einsatz proprietärer Software kein<br />
Know-how erforderlich ist – und das ist nicht richtig, wie uns wohl jeder bestätigen kann. Richtig<br />
ist, dass der Kunde sich vielleicht bereits tief in einer Abhängigkeit von „seinem“ Softwarehersteller<br />
befindet – dann verkehrt sich allerdings das gut gemeinte Argument der Sicherung<br />
bestehenden Know-hows in eine Schlinge der Abhängigkeit, die sich immer weiter zuzieht.<br />
6 Software in einer freien Zielarchitektur<br />
Exemplarisch für viele andere Kombinationsmöglichkeiten stellen wir hier die Lösung vor,<br />
die auch bei dem Vortrag auf der AGIT 2003 gezeigt wurde. Sie entspricht in weiten Teilen<br />
unserem Entwicklungs- und Demoserver der unter http://wms.ccgis.de/ erreichbar ist.
14<br />
A. Christl<br />
Tabelle 4: Freie Software für den Online-Stadtplandienst (ein Beispiel unter vielen)<br />
Freies Betriebssystem:<br />
• Free BSD (ein echtes UNIX)<br />
Freier Web Server:<br />
• Apache<br />
Freier Kartenserver:<br />
• UMN MapServer<br />
Freie Datenbank<br />
• PostgreSQL<br />
Freie räumliche Erweiterung für PostgreSQL:<br />
• PostGIS -<br />
Freie Skriptsprache<br />
• PHP<br />
Freie WMS Client Suite mit Benutzer- und Projektverwaltung:<br />
• Mapbender<br />
Der Einsatz dieser Software-Komponenten reduziert die Lizenzkosten um genau die Lizenzkosten,<br />
die Ihnen von proprietären Herstellern angeboten werden. Das gilt nicht nur für<br />
die GIS Software, sondern genauso für Betriebssystem, Webserver, vor allem aber auch<br />
Datenbanken. Gerade hier ist auch bei großen Lösungen mit großen Datenmengen eine<br />
echte Einsparmöglichkeit und wesentlich höhere Flexibilität gegenüber proprietären Lösungen<br />
gegeben.<br />
Unter „höhere Flexibilität“ verstehen wir u.a. die Möglichkeit, mehrfache Instanzen ohne<br />
zusätzliche Lizenzkosten zu installieren, keine Beschränkung der Anzahl der Client Zugriffe<br />
und die Möglichkeit Probleme direkt an die Entwicklung melden zu können. Pflege- und<br />
Wartungskosten können sogar direkt in die Lösung von Problemen investiert werden und<br />
landen nicht in einer „großen Kasse“ auf deren weitere Verwendung keinerlei Einfluss genommen<br />
werden kann bzw. deren Verwendung (für den Kunden) undurchsichtigen markwirtschaftlichen<br />
Überlegungen unterliegt.<br />
An der Dienstleistung ändert sich dagegen nichts. Wir können das inzwischen aus Erfahrung<br />
sagen und auch unsere Kunden können das bestätigen. Es fällt sowieso eine nicht zu unterschätzende<br />
Menge an Arbeit bei der Implementierung eines solch umfangreichen Systems<br />
an, ob die auf proprietärer Software aufsetzt oder nicht ist dabei irrelevant.<br />
Exkurs: Für uns als Firma besteht die größte Problematik darin, dass für eine Software, die<br />
70.000,- kostet, niemand in Frage stellt, dass zusätzliche I U (LQULFKWXQJ ,QVWDOODWion<br />
und den Betrieb berechnet werden.<br />
Wenn aber die Basislizenz der Software nichts kostet (Freie Software, z. B. PostgreSQL), dann<br />
wird erwartet, dass die Software auch sofort ohne weiteres funktioniert und es wird nicht verstanden,<br />
dass zusätzliche I U (LQULFKWXQJ ,QVWDOODWLRQ XQG GHQ %HWULHE EHUHFKQHW<br />
werden.
Digitale Stadtplandienste – ein Schritt zum virtuellen Rathaus 15<br />
Die wartbaren Komponenten eines Client-Server-Systems werden sowieso meistens ausschließlich<br />
von Administratoren betreut, es gibt auch hier keinen Unterschied zum Einsatz<br />
proprietärer Software.<br />
7 Ein Problem der Verwaltung<br />
In bundesdeutschen öffentlichen Verwaltungen werden pro Tag 10.000 Stunden Entwicklungsleistung<br />
erbracht. Das ist eine Zahl, die wir uns einfach ausgedacht haben weil sich das<br />
beeindruckend anhört.<br />
Wenn wir annehmen, dass in jeder der mindestens 10.000 Verwaltungen in Deutschland nur<br />
ein Mensch eine Stunde lang irgendetwas Sinnvolles mit Software implementiert, dann ist<br />
das wohl nicht übertrieben. Wahrscheinlicher ist, dass mehrere 10.000 Stunden Entwicklungsleistung<br />
pro Tag geleistet werden.<br />
Klassicherweise würde man fordern, dass eine einheitliche Verwaltungsverordnung diese<br />
Entwicklungen koordinieren soll. Gleichzeitig würde man sofort erkennen, dass das ein<br />
völlig utopisches Unterfangen ist.<br />
Eine Vision als Lösung<br />
Mit den Konzepten, die Freie Software ermöglichen, steht eine selbstregelnde Organisationsstruktur<br />
zur Verfügung, die genau das leisten kann. In diesem Kontext ist es völlig<br />
„normal“, dass sich zwei wildfremde Menschen zu einem Problem austauschen. Technisch<br />
verwandte Probleme, auch wenn sie inhaltlich in ganz anderen Bereichen auftreten, können<br />
von völlig unterschie<strong>dl</strong>ichen Nutzergemeinschaften identifiziert und auch gemeinsam gelöst<br />
werden.<br />
Proprietäre Software-Lösungen sind der Versuch, Wissen geheim zu halten. Zu welchem<br />
Zweck soll das bei der öffentlichen Verwaltung gut sein? Konkurrenz zwischen einzelnen<br />
Instanzen der öffentlichen Verwaltungen – ein Argument, das man in der freien Wirtschaft<br />
anführen könnte – sollte hier kein gültiges Argument für die Geheimhaltung von Softwarelösungen<br />
sein.<br />
Es ist unsere Vision, dass sich langfristig die schleichende Einführung von Freier Software<br />
Konzepten in der öffentlichen Verwaltung durchsetzen wird. Das frühzeitig zu erkennen<br />
und zu unterstützen, ist aktiv betriebener Investitionsschutz für die öffentliche Verwaltung.<br />
Auf Bundesebene gibt es bereits eine Infrastruktur an Empfehlungen und eine Reihe von<br />
Veröffentlichungen, die diese Bereiche fördern und unterstützen. Auf kommunaler Ebene<br />
können diese Konzepte und Organisationsformen aber nur durch den persönliche Einsatz<br />
eines entscheidungsbefugten Menschen eingeführt werden.<br />
Die Antivision dazu ist das Versprechen der großen Hersteller, dass Sie durch Ihre schiere<br />
Größe einen echten Investitionsschutz gewährleisten können. Was sich dahinter verbirgt ist<br />
der Versuch den Kunden in eine Abhängigkeit zu manövrieren. Euphemistisch wird das als<br />
„Kundenbindung“ umschrieben, es hat aber eher mit (un)freiwilliger Knebelung zu tun.
16<br />
A. Christl<br />
Vorbehalte gegen Freie Software werden oft damit begründet werden, dass man bereits so<br />
viel Geld, Know-how und Personalressourcen in das eigene, proprietäre GIS investiert hat,<br />
das man deshalb jetzt nicht mehr umsteigen kann. Zum Glück gibt es genügend interessierte<br />
und offene Menschen in der öffentlichen Verwaltung, die langfristig diese Konzepte durchsetzen<br />
werden.<br />
Nachwort<br />
Willkommen in der Welt der Freien Software. Das Konzept ist übrigens älter und bewährter<br />
als jedes Software-Unternehmen dieser Welt. Als Computer erfunden wurden waren Programme<br />
immer und ausschließlich öffentlich, da sie immer auch wissenschaftliche Arbeiten<br />
waren. Erst recht spät kam in einer kleinen Garage in den USA ein findiger Mensch darauf,<br />
dass man durch eine einfache Änderung dieser Grundregel der reichste Mensch der Welt<br />
werden kann. Respekt.<br />
Falls wir Ihr Interesse geweckt haben (oder Sie sich als einen potenziellen Kunden widerentdeckt<br />
haben), dann nehmen Sie doch Kontakt mit uns auf. Wir zeigen Ihnen gerne wie<br />
Freie Software in Ihrer Architektur eingesetzt werden kann und auch, dass das nicht bedeutet,<br />
dass Sie alles wegwerfen müssen, was Sie sich bisher mühsam aufgebaut haben. Wir<br />
informieren auch über die rechtlichen Aspekte, wie Sie bei der Erstellung von BVB- und<br />
EVB-Verträgen zum Tragen kommen.<br />
Links<br />
http://www.bsi-fuer-buerger.de/druck/kap_11.pdf<br />
http://freegis.org/<br />
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.de.html<br />
http://www.ccgis.de/links.html<br />
http://dict.leo.org/?search=gates&searchLoc=0&relink=on&spellToler=std§Hdr=on&t<br />
ableBorder=1&cmpType=relaxed&lang=de<br />
Literatur<br />
GRASSMUCK, V. (2001): Freie Software. Zwischen Privat- und Gemeineigentum. Bundeszentrale<br />
für politische Bildung. Bonn
OpenSource GIS – das alternative geoGovernment?<br />
1 Einleitung<br />
Horst DÜSTER<br />
Das Thema OpenSource ist seit geraumer Zeit in aller Munde. In verschiedenen Staaten<br />
Europas wird inzwischen laut über die Ablösung von Windows durch LINUX als Betriebssystemplattform<br />
nachgedacht, bzw. sind bereits erste Schritte unternommen worden. Dies<br />
führt dazu, dass auch die Frage nach OpenSource GIS gestellt werden muss. Welche Möglichkeiten<br />
bestehen, einzelne Komponenten oder gar komplette Systemumgebungen in der<br />
öffentlichen Verwaltung durch OpenSource GIS-Software zu ersetzen und konzeptionell in<br />
die Strukturen des Unternehmens einzubinden? Welche Risiken entstehen dadurch?<br />
Der Beitrag ist ein Bericht aus der Praxis im Schweizer Kanton Solothurn. Er soll eine<br />
Übersicht über die derzeit verfüg- und operationell einsetzbaren OpenSource GIS-Komponenten<br />
geben und Möglichkeiten skizzieren diese in bestehende GIS-Strukturen einer<br />
Verwaltung einzubinden.<br />
1.1 OpenSource Lizenz – General Public License<br />
Mit Ausnahme des UMN MapServers werden die in diesem Beitrag angesprochenen Open-<br />
Source Softwarekomponenten unter der sogenannten General Public License (GPL) betrieben.<br />
Das auf den ersten Blick prominenteste Merkmal dieser Lizenz – sie ist gratis. Ist dies<br />
kurzfristig gesehen von Bedeutung, so muss die rechtliche Situation der GPL langfristig<br />
betrachtet werden. Die GPL garantiert das unbeschränkte Recht die Software zu nutzen und<br />
den Source Code zu analysieren, da dieser grundsätzlich offen zur Verfügung steht. Weiterhin<br />
ist es erlaubt, den Source Code der Software jederzeit zu modifizieren, den Code oder<br />
die Software beliebig zu verteilen und den Code oder die Software zu publizieren, unter der<br />
Voraussetzung, dass die Urheber des Codes genannt werden. Eine Vorgehensweise, wie sie<br />
bei wissenschaftlichen Publikationen die Regel ist.<br />
1.2 Vorteile von OpenSource/OpenSource GIS-Software<br />
Die Vorteile, die sich aus der GPL ergeben liegen auf der Hand. Durch den offenen Quellcode<br />
ist die Weiterentwicklung oder die Anpassung der Software nach den eigenen Bedürfnissen<br />
möglich. Da die Software in der Regel von einer breiten Entwicklergemeinde gepflegt<br />
wird, kann sehr schnell auf Bedürfnisse der Benutzergemeinschaft und auf die allgemeine<br />
Entwicklung des GIS reagiert werden, ohne dass die Anwender selber über fundierte<br />
Programmierkenntnisse verfügen müssen.<br />
OpenSource Software hält sich in der Regel streng an offene Spezifikationen. Im Bereich<br />
OpenSource GIS werden konsequent die Spezifikationen des Open GIS Consortiums<br />
(OGC) umgesetzt. Dies führt, ganz im Sinne der OGC, zu einem system übergreifenden Set<br />
von Funktionalitäten der OpenSource GIS-Komponenten.
18<br />
H. Düster<br />
Die Kommunikation zwischen den Beteiligten, sowohl Entwickler als auch Anwender der<br />
OpenSource GIS-Komponenten, erfolgt über das Internet. Über Mailing Lists ist es möglich<br />
an der Diskussion über die weitere Entwicklung der Systeme teilzunehmen, Bugs zu melden<br />
oder direkt mit den jeweiligen Entwicklern persönlich in Kontakt zu treten. Dies ist ein<br />
nicht zu unterschätzender Vorteil gegenüber proprietären Systemen. Jede der betrachteten<br />
OpenSource GIS-Komponenten verfügt über eine eigene Mailing List über die, in der Regel,<br />
Problemlösungen außerordentlich schnell abgewickelt werden können.<br />
1.3 Professioneller Support<br />
Eine häufig geäußerte Angst ist, dass es keinen professionellen Support für OpenSource<br />
GIS-Systeme gibt und das die Anwender über große Programmiererfahrung verfügen müssen.<br />
Weiterhin wird befürchtet, dass OpenSource GIS nicht der hohen Qualität proprietäter<br />
Systeme gerecht werden kann, da es nicht sein kann, dass etwas, was nichts kostet, Qualität<br />
hat.<br />
Genauer betrachtet können diese Befürchtungen entkräftet werden. Mit zunehmender<br />
Verbreitung von OpenSource GIS-Komponenten entsteht auch professioneller Support, der<br />
in verschiedenen Formen angeboten wird. Diese Support Angebote reichen vom generellen<br />
Supportvertrag über die Entwicklung von Komplettlösungen auf OpenSource GIS-Basis bis<br />
hin zur Erweiterung von vorhandenen OpenSource GIS-Lösungen um spezielle Komponenten,<br />
die durch die allgemeine Entwicklung der Software nicht gedeckt sind. Allerdings<br />
ist das Angebot z. B. in der Schweiz zzt. noch in der Entwicklung. Mit zunehmendem Einsatz<br />
und Nachfrage von OpenSource GIS wird sich auch hier der Markt entwickeln. Das<br />
Interesse ist groß, aber es müssen noch Hemmschwellen abgebaut werden. Im Moment sind<br />
insbesondere Kanadische Firmen stark vertreten, und aus der Sicht des Kantons Solothurn<br />
ist die Zusammenarbeit mit diesen Firmen sehr erfolgreich.<br />
1.4 Interoperabilität<br />
OpenSource GIS-Komponenten bieten sich an zur Kombination verschiedener verteilter<br />
und proprietärer Systeme. Da kein Interesse der Entwickler und User besteht die Software<br />
an ein proprietäres System zu binden, wird eine große Offenheit angestrebt. Das Fundament<br />
dazu bilden u. a. die Spezifikationen der OGC. Die genannte Offenheit bezieht sich insbesondere<br />
auf das breite Spektrum der unterstützten Datenformate. Standardisierte Datenschnittstellen<br />
ermöglichen diese Offenheit. Die zentrale Library dazu stellt die GDAL/OGR<br />
Library dar, die eine Vielzahl von Raster und Vektordaten austauscht und konvertiert (siehe<br />
unten). OpenSource GIS-Komponenten unterstützen direkt eine breite Anzahl von offenen<br />
Spezifikationen wie z. B. OGC, WebMapService (WMS), MapServer, GeoTools, OGC<br />
Simple Features und OGC Simple Features for SQL, OGR und PostGIS. Mit diesen sowohl<br />
Spezifikationen als auch Software Komponenten lassen sich praktisch sämtliche geoGovernment<br />
Anforderungen auf der Basis OpenSource GIS realisieren.
OpenSource GIS – das alternative geoGovernment? 19<br />
2 OpenSource GIS-Komponenten im strategischen Einsatz<br />
Die im folgendem beschriebenen OpenSource GIS-Komponenten können sowohl auf<br />
UNIX/LINUX als auch auf Windows Systemen betrieben werden. Sie werden neben den<br />
proprietären Systemen ArcGIS und ArcView, operationell im Kanton Solothurn eingesetzt.<br />
Zur Datenhaltung und GIS-Analyse wird PostgreSQL mit der Erweiterung PostGIS betrieben.<br />
Der Datenaustausch zwischen den Systemen erfolgt mit der GDAL/OGR Library und<br />
visualisiert werden die Informationen über eine Anwendung auf der Basis des UMN<br />
MapServers. Die Bewirtschaftung der einzelnen GIS-Informationsebenen wird über die<br />
Systeme ArcGIS und ArcView geleistet.<br />
2.1 PostGIS<br />
Die zentrale und redundanzfreie Speicherung raumbezogener Informationen ist eines der<br />
zentralen Probleme in einem Geo Informationsnetzwerk. Werden, wie immer noch weit<br />
verbreitet, raumbezogene Informationen File basiert gehalten, z. B. als Shapes, ist eine<br />
Redundanzfreiheit nicht zu erreichen. In einer Vielzahl von Informationslayern werden<br />
Informationen wie z. B. die Gemeindezugehörigkeit eines Objektes, parallel abgelegt. Eine<br />
umfassende Nachführung bei einer Änderung der Gemeindegrenzen ist praktisch nicht<br />
möglich. Es entsteht das, was GIS grundsätzlich beseitigen soll, Entscheidungsunsicherheit.<br />
Werden die räumlichen Informationsebenen auf einem relationalen Datenbank Management<br />
Server (RDBMS) zentral gehalten, kann die Redundanzfreiheit realisiert werden. Dazu<br />
muss das RDBMS in der Lage sein sowohl Geometrien zu speichern, als auch funktional zu<br />
verwalten. Im proprietären Sektor werden Systeme wie ArcSDE oder ORACLE Spatial<br />
angeboten. Mit OpenSource GIS-Komponenten kann das Objektrelationale RDBMS PostgreSQL<br />
verwendet werden. Mit der Erweiterung PostGIS können von PostgreSQL geographische<br />
Objekte verwaltet werden. Die beliebige Kombination der Objekte erfolgt via SQL<br />
und über den Raum selber.<br />
PostGIS hält sich streng an die Spezifikation „OGC Simple Features for SQL (Project Document<br />
99-049)“. Diese definiert einerseits das Geometrie Objekt Modell und andererseits<br />
die funktionalen Komponenten, um mit dem Geometrie Objekt Modell zu arbeiten. PostGIS<br />
hat in der aktuellen Version 0.7.3 noch nicht den vollen Funktionsumfang der Spezifikation.<br />
PostGIS nutzt außerordentlich effiziente räumliche Indizes, die einen sehr schnellen Zugriff<br />
auch auf große Datenmengen ermöglicht. Von der PostGIS development group ist angekündigt,<br />
dass bis Mitte 2003 die OGC Spezifikation der räumlichen Operatoren zur GIS-<br />
Analyse über SQL fertig gestellt ist. Die Algorithmen stehen in der Java Topology Suite<br />
(JTS) bereits heute zur Verfügung und werden nach C++ übertragen.<br />
2.2 Geospatial Data Abstraction Library (GDAL/OGR)<br />
Der Wert einer OpenSource GIS-Datenbank Konfiguration steigt mit der Anzahl zu importierender<br />
externer Datenformate. Unterstützen proprietäre Systeme in erster Linie ihre eigenen<br />
proprietären Formate können OpenSource GIS-Komponenten aus oben erwähnten<br />
Gründen wesentlich offener sein.<br />
Eine zentrale Schnittstelle zwischen der PostGIS DB und den Clients ist die GDAL/OGR<br />
Library. Die in C++ geschriebene Library ermöglicht einen transparenten Zugriff auf eine
20<br />
H. Düster<br />
Vielzahl verschiedener Vektor- (12) und Rasterformate (37), die gelesen und geschrieben<br />
werden können. Über diese Library werden sowohl Daten in die PostGIS DB überspielt als<br />
auch extrahiert. Die GDAL/OGR Library unterstützt zzt. 12 Vektorformate zum Import. Als<br />
die wichtigsten sind zu nennen: Arc/Info Binary Coverage, ESRI Shapefile, FMEObjects<br />
Gateway, Mapinfo File, Microstation DGN, Oracle Spatial, PostGIS, GML etc. Bis auf<br />
Arc/Info Binary Coverage und Microstation DGN können alle Formate auch gegeneinander<br />
geschrieben werden. Die Transparenz dieser Schnittstelle ermöglicht eine einfache Integration<br />
in übergeordnete Anwendungen wie Browser oder High End GIS-Systeme.<br />
2.2 WebClient, GIS-Browser, WebMapping<br />
Die beschriebene Konfiguration stellt Methoden zur Datenhaltung sowie für den Großteil<br />
der in der Verwaltung geforderten Anwendungen ausreichende Analysefunktionen zur Verfügung.<br />
Die Schnittstelle und damit die Kommunikation zwischen den Komponenten ist<br />
definiert. Bisher haben die Anwender/Kunden des Systems noch keinen Nutzen daraus<br />
ziehen können. Zum Abschluss muss deshalb die Schnittstelle zwischen den Anwendern und<br />
dem beschriebenen System definiert werden.<br />
Da die raumbezogenen Informationen in einem RDBMS abgelegt sind und funktional verwaltet<br />
werden, ist zur Abfrage und einfachen Analyse keine weitere spezielle GIS-Software<br />
notwendig. Die Informationen aus der Datenbank können von jedem beliebigen Client, der<br />
in der Lage ist mit dem RDBMS via SQL zu kommunizieren, abgefragt werden. Deshalb ist<br />
es nicht zwingend nötig einen GIS-Client zu verwenden. Abfragen wie z. B. „wie weit liegt<br />
die nächstgelegene Mobilfunkantenne bezogen auf eine ausgewählte Adresse entfernt?“<br />
enthalten im Kern eine GIS-Analyse, sind aber für den Anwender rein numerischer Natur.<br />
Mit den beschriebenen Komponenten ist diese Frage ohne weiteres zu beantworten. Vielmehr<br />
sind solche Clients sehr einfach gehalten, da sie ausschließlich die Größen einer Frage<br />
aufnehmen, via SQL an den Server weiterleiten und das vom RDBMS produzierte Ergebnis<br />
wieder darstellen sollen.<br />
Karten und visuelle räumliche Interaktionen können auf Grun<strong>dl</strong>age des UMN MapServers<br />
im Intra-/Internet realisiert werden (siehe Abbildung 1). Grundsätzlich ist der UMN<br />
MapServer in der Lage alle durch GDAL/OGR unterstützte Datenformate und ArcSDE zu<br />
lesen und darzustellen. Dies stellt eine enorme Offenheit dar, wenn man im Vergleich die<br />
Möglichkeiten proprietärer Systeme mit gleicher Zielsetzung betrachtet.
OpenSource GIS – das alternative geoGovernment? 21<br />
Abb. 1: Die Gewässerschutzkarte im SO!GIS MapServer<br />
2.2 Strategischer Einsatz der OpenSource GIS-Komponenten<br />
im Kanton Solothurn<br />
Im Kanton Solothurn begann vor rund zwei Jahren mit der Abkehr von einem monolithischen<br />
System eines Herstellers hin zu einer Komponenten basierten Architektur die Entwicklung<br />
und Umsetzung einer neuen GIS-Strategie auf der Grun<strong>dl</strong>age von OpenSource<br />
GIS-Komponenten. Durch diesen Schritt stehen heute sehr vielfältige Möglichkeiten offen.<br />
Ausgehend von einem heterogenen Datenraum, in dem mit verschiedenen Systemen, ob<br />
proprietär oder OpenSource GIS, Daten produziert und gepflegt werden, wird über die<br />
GDAL/OGR Schnittstelle eine OGC Kompatible RDBM Server Farm beliefert (siehe Abbildung<br />
2). Den Kern dieser Datenbank bilden sowohl PostgreSQL/Postgis als auch<br />
ORACLE Datenbank Server.<br />
Die Clients werden über zwei funktionale Ebenen mit Informationen beliefert. Mit<br />
PHP/Java können via SQL reine Sach-/Raumdatendatenabfragen erfolgen und im Web<br />
Browser dargestellt werden. Räumliche Abfragen, Visualisierungen und Interaktionen werden<br />
ebenfalls über SQL kommuniziert und mit einer UMN MapServer Applikation dem<br />
Anwender im Web Browser angeboten. Die zweite funktionale Ebene ist die Kommunikation<br />
proprietärer Systeme, wie z. B. ArcView, mit dem Datenstamm. Hier erfolgt der Austausch<br />
der Geometrie Informationen über GDAL/OGR.
22<br />
H. Düster<br />
Gekoppelt an diese strategische Ausrichtung wird GIS im Kanton Solothurn zunehmend<br />
prozessorientiert eingesetzt. Den Anwendern wird nicht mehr ArcView in die Hand gedrückt<br />
und dann „friss oder stirb“, sondern es werden Applikationen zur Prozessunterstützung<br />
– geoGovernment – entwickelt. Dies sind funktional konfektionierte DB Anwendungen<br />
auf der Grun<strong>dl</strong>age des Intranets, die neben der reinen Sachdatenauskunft auch Auskünfte<br />
zum betreffenden Raum erteilen können und diese funktional verarbeiten. Spezielle<br />
GIS oder Software Kenntnisse sind in den aller meisten Fällen für die allgemeinen Anwender<br />
nicht mehr erforderlich.<br />
Abb. 2: Strategisches Konzept des GIS im Kanton Solothurn<br />
3 Schlussfolgerungen<br />
Die Erfahrungen der letzten zwei Jahre im Kanton Solothurn zeigen, dass Open Source<br />
GIS-Komponenten heute für den operationellen Einsatz sowohl verfüg- als auch brauchbar<br />
sind. Insbesondere zeigt sich, das die konsequente Anwendung von offenen Standards wie<br />
OGC oder WMS zielführend und zukunftssicher ist. Die Risiken, die im Einsatz dieser<br />
Komponenten liegen sind unseres Erachtens nicht größer, als dies beim Einsatz von proprietären<br />
Systemen der Fall wäre.<br />
Entscheidend für die Auswahl der Open GIS-Komponenten ist deren Verbreitung sowie der<br />
professionelle Support. Professionelle Open GIS-Komponenten wie PostGIS, GDAL/OGR<br />
und UMN MapServer verfügen heute über eine sehr große, weltweite Verbreitung und Anwendung.<br />
Es besteht also ein breites Interesse diese Systeme auch Zukunftsgerichtet weiter<br />
zu entwickeln und zu betreiben. Die Gefahr, dass diese Produkte einfach vom Markt ver-
OpenSource GIS – das alternative geoGovernment? 23<br />
schwinden ist nicht größer als dies bei proprietären Systemen der Fall ist. Auch ESRI versucht<br />
ArcView 3.x vom Markt zu nehmen, scheiterte aber mit diesem Vorhaben bisher an<br />
der weiten Verbreitung dieser Software.<br />
Die Befürchtung, dass keiner bis ungenügender professioneller Support existiert ist ebenfalls<br />
unbegründet. Einerseits bietet das Internet und der direkte Kontakt zum jeweiligen<br />
Entwickler schnellen und ausgezeichneten Support, andererseits entwickeln sich, entsprechend<br />
der Marktentwicklung, zunehmend Firmen, die diesen professionellen Support anbieten.<br />
Links<br />
OpenSource.org: www.opensource.org<br />
Open GIS Consortium www.opengis.org<br />
FreeGIS.org: www.freegis.org<br />
PostgreSQL: www.postgresql.org<br />
PostGIS: postgis.refractions.net<br />
GDAL/OGR: www.remotesensing.org/gdal<br />
UMN MapServer: mapserver.gis.umn.edu<br />
Der SO!GIS MapSever: www.sogis.so.ch<br />
DM Solutions Kanada: www.dmsolutions.ca
Bewertung von Nutzenpotenzial des geoGovernment 1<br />
Zusammenfassung<br />
Matthias EBNER<br />
Das Anwendungsspektrum des geoGovernment ist extrem breit und verknüpft zahlreiche<br />
Fachgebiete. Entsprechend ist die Aufgabe, das Nutzenpotenzial des geoGovernment nachvollziehbar<br />
zu bewerten, sehr komplex. Die vorliegende Arbeit stellt einen Beitrag dar, um<br />
diese bisher ungelöste Aufgabe zu systematisieren. Dabei zeigt sich, dass ein großer Teil<br />
des Nutzenpotenzials für einzelne Kunden durchaus monetär bewertet werden kann. Das<br />
wesentliche und am besten nachvollziehbar monetär bewertbare Nutzenpotenzial sind die<br />
Zeiteinsparungen, die im Rahmen des geoGovernment durch den Einsatz des Produkts<br />
Geoinformation (GI) bei einzelnen direkten Kunden erzielt werden können. Für die Ermittlung<br />
der Zeiteinsparungen sind die Prozesse der direkten Kunden zu analysieren und die<br />
elementaren Arbeitsschritte zu identifizieren.<br />
1 Einleitung<br />
Durch das eGovernment bietet sich für Kommunen und Gemeinden ebenso wie für die<br />
öffentlichen Behörden der Länder und des Bundes die Chance ihre Leistungen zu verbessern<br />
und zu erweitern. Unter geoGovernment soll im weiteren der Teil des eGovernment<br />
verstanden werden, zu dessen Umsetzung geografische, d. h. raumbezogene Informationen<br />
benötigt werden. Insbesondere die Integration eines Geoinformationssystems (GIS) kann<br />
den Unternehmen des öffentlichen Sektors bei den vielfältigen raumbezogenen Fragestellungen,<br />
die im Rahmen des geoGovernment auftreten, als Unterstützung dienen.<br />
Durch das geoGovernment – d. h. insbesondere durch<br />
den Einsatz eines GIS – sollen wichtige Informationen<br />
zeitnah innerhalb von Behörden ausgetauscht oder<br />
einem Wirtschaftsunternehmen bzw. dem Bürger bereit<br />
gestellt werden. Angesichts der finanziellen Situation<br />
vieler Bereiche des öffentlichen Sektors ist heute im<br />
Zusammenhang mit dem geoGovernment nicht die<br />
technische Machbarkeit, sondern die Frage der Wirtschaftlichkeit<br />
von besonderem Interesse. Zur Ermittlung<br />
der Wirtschaftlichkeit einer Investition sind den Kosten<br />
stets der Nutzen, d. h. im vorliegenden Fall das monetär<br />
bewertete Nutzenpotenzial des GIS, gegenüber zu stellen.<br />
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit gilt das in der<br />
Literatur, z. B. bei (BEHR 2000), formulierte Nutzenpo-<br />
1 Teilweise Vorveröffentlichung der Dissertation.<br />
������������<br />
�����������������<br />
�������������������<br />
���������������<br />
���������������<br />
������<br />
Abb. 1: Abgrenzung der Begriffe<br />
Nutzen und Nutzenpotenzial
26<br />
M. Ebner<br />
tenzial des GIS erst als Nutzen, wenn es, wie in Abbildung 1 dargestellt, im konkreten Fall<br />
im Unternehmen realisiert und zudem auch monetär bewertet wird.<br />
Nach Einschätzung in der Literatur (PIETSCH 2003) ist die Information heute weithin als<br />
Ressource anerkannt und wächst das Bewusstsein, dass sich diese – wie jede Ressource –<br />
dem Grundprinzip der Wirtschaftlichkeit unterwerfen muss. In der Vergangenheit wurden<br />
im Rahmen von Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen oft nur unvollständige oder schwierig<br />
nachvollziehbare Wirtschaftlichkeitsanalysen durchgeführt, um die Einführung eines GIS zu<br />
rechtfertigen. Für eine zuverlässige Wirtschaftlichkeitsbetrachtung muss dagegen das vorhandene<br />
Nutzenpotenzial eines GIS systematisch analysiert und dessen monetäre Bewertbarkeit<br />
untersucht werden.<br />
2 Sichtweise<br />
Wegen der komplexen Situation, die sich bei der Bewertung des Nutzenpotenzials eines<br />
GIS ergibt, wird dieses Thema sowohl in der Praxis als auch in der Literatur auf Basis unterschie<strong>dl</strong>icher<br />
Sichtweisen sehr unterschie<strong>dl</strong>ich behandelt. Bereits bei den im Zusammenhang<br />
mit Nutzenbetrachtungen von Informationssystemen in der Literatur verwendeten<br />
Begriffen (s. Abbildung 2) spiegeln sich diese unterschie<strong>dl</strong>ichen Sichtweisen wider.<br />
1XW]HQYRUWHLOH<br />
3RVLWLYH 0HUNPDOH<br />
��������������<br />
1XW]XQJVSRWHQ]LDO<br />
�����������<br />
)UDJHVWHOOXQJHQ<br />
������������������<br />
1XW]HQDVSHNWH<br />
�����������<br />
�������������<br />
��������������<br />
$QZHQGXQJHQ<br />
1XW]HIIHNWH<br />
�������������������<br />
1XW]HIIHNWH<br />
��������������<br />
1XW]HQIDNWRUHQ<br />
�������������� :HUW<br />
������������<br />
1XW]HQNRPSRQHQWHQ<br />
����������������<br />
3RVLWLYH (UIROJVNRPSRQHQWHQ<br />
�������������<br />
/HLVWXQJVHIIHNWH<br />
��������������<br />
2SWLPLHUXQJVSRWHQ]LDO<br />
�����������<br />
3RVLWLYH (IIHNWH<br />
9RUWHLOH<br />
��������������<br />
XQ PLWWHOEDUHU 1XW]HQ<br />
�������������<br />
3UHLV<br />
������������<br />
��������������<br />
1XW]HQNDWHJRULHQ<br />
�����������<br />
LP PDWHULHOOHU 1XW]HQ<br />
��������������<br />
Abb. 2: Das Babylon der Begriffe im Rahmen von Nutzenbetrachtungen von Informationssystemen<br />
Der vorliegenden Arbeit liegt ebenfalls eine konkrete Sichtweise zugrunde, die im Folgenden<br />
kurz dargestellt wird.
2.1 Das Produkt GI<br />
Bewertung von Nutzenpotenzial des geoGovernment 27<br />
Während die Einführung eines GIS als Projekt und der Betrieb eines GIS als Prozess angesehen<br />
werden kann, wird die aus einem GIS erzeugte Geoinformation (GI) im folgenden<br />
konsequent als Produkt behandelt. Das GIS besteht im Kern aus einem digitalen Geometrieund<br />
Sachdatenbestand, aus dem mit Hilfe von Hard- und Softwaretechnologie die gewünschten<br />
Informationen, das Produkt GI, ausgegeben werden. Im Falle des geoGovernment<br />
wird das Produkt GI i. a. von einer bestimmten Abteilung innerhalb einer Behörde<br />
bereit gestellt. Diese Abteilung kann als Anbieter des Produkts GI angesehen werden und<br />
stellt den Nutzern, d. h. den Kunden des Produkts GI, die Informationen aus dem GIS in der<br />
gewünschten Form zur Verfügung. Während dem einen Kunden ggf. der gesamte Datenbestand<br />
in digitaler Form zur Verfügung gestellt wird, kann ein anderer Kunde die GI in Form<br />
einer Plotausgabe bevorzugen. Den einzelnen Kunden werden also unterschie<strong>dl</strong>iche Ausprägungen<br />
des Produkts GI zur Verfügung gestellt (Produktdifferenziation).<br />
Im Rahmen der vorliegenden Arbeit ist die Unterscheidung<br />
zu treffen zwischen Nutzenpotenzial,<br />
��������������������<br />
das durch den Einsatz eines Produkts GI allgemein<br />
������������������<br />
entstehen kann, und dem, welches durch ein be-<br />
������������������<br />
stimmtes Produkt GI und für einen bestimmten<br />
���������<br />
Kunden entsteht. Die beschriebene Sichtweise ist<br />
in Abbildung 3 grafisch dargestellt.<br />
Es sei angenommen, dass der Anbieter des Produkts<br />
GI, wie auch bei anderen Produkten üblich,<br />
für alle Tätigkeiten zuständig ist, die bei der Erstellung,<br />
Bereitstellung und Wartung des Produkts<br />
erforderlich sind. Beispielsweise ist der Anbieter<br />
demnach neben der hard- und softwaretechnischen<br />
Realisierung des Produkts GI vor allem zuständig<br />
bzw. verantwortlich für<br />
• die Erhebung der benötigten Daten, z. B. durch Einmessungen vor Ort<br />
• die Erfassung der erhobenen Daten im digitalen Datenbestand<br />
• die Verwaltung des digitalen Datenbestandes<br />
• die Auswerte- und Ausgabemöglichkeiten der digitalen Daten sowie<br />
• die Qualität der bereitgestellten Daten<br />
Die einzelnen Kunden beziehen vom Anbieter das Produkt GI in genau der Form, die in<br />
ihren Anwendungen gefordert ist.<br />
2.2 Nutzen für die direkten Kunden des Produkts GI<br />
��������������������<br />
��������������������<br />
������������������<br />
�������������������<br />
Abb. 3: Nutzenpotenzial allgemein<br />
und im speziellen<br />
Die Kunden des Produkts GI können im Falle des geoGovernment sehr zahlreich sein. Zu<br />
den Kunden können andere Abteilungen einer Behörde oder andere Behörden ebenso zählen,<br />
wie Wirtschaftsunternehmen und einzelne Bürger. Aus Gründen der Übersichtlichkeit<br />
werden im folgenden nur die direkten Kunden des Anbieters des Produkts GI betrachtet.<br />
Direkte Kunden verwenden das Produkt GI, um den Wirtschaftsunternehmen und Bürgern<br />
ihre Leistungen anbieten zu können. Bürger und Wirtschaftsunternehmen sind demnach erst<br />
die Endkunden der Information. Beispielsweise bezieht die Abteilung Baugenehmigung –
28<br />
M. Ebner<br />
als direkter Kunde des Anbieters – das Produkt GI, um ihr Kerngeschäft, d. h. die Anfragen<br />
von Bürgern zu bearbeiten, betreiben zu können.<br />
Ähnlich wie die Abteilung Baugenehmigung bewältigen die meisten direkten Kunden mit<br />
Hilfe des Produkts GI überwiegend Aufgaben, die in der Vergangenheit bereits existierten.<br />
Die direkten Kunden profitieren durch den Einsatz des Produkts GI ggf. von Material- v. a.<br />
aber von Zeiteinsparungen, die sie in ihren Arbeitsabläufen (Prozessen) erzielen können.<br />
Gelingt es neben der relativ einfach errechenbaren Material- auch die Zeiteinsparung zu<br />
ermitteln, ist deren monetäre Bewertung möglich. Direkte Kunden werden nachvollziehbar<br />
ermittelte Zeiteinsparungen, die durch den Einsatz des Produkts GI in ihren Prozessen entstehen,<br />
als monetär bewertbares Nutzenpotenzial, d. h. Nutzen, akzeptieren. Die Zeiteinsparung<br />
ist für viele direkte Kunden das bedeutendste und, im Vergleich zu anderen Auswirkungen<br />
des Produkts GI, zudem das Nutzenpotenzial, dessen monetäre Bewertung am besten<br />
nachzuvollziehen ist. Damit stellen monetär bewertete Zeiteinsparungen einen wesentlichen<br />
Bestandteil von aussagekräftigen Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen dar bzw. ermöglichen<br />
eine am Kundennutzen orientierte Preisfindung für das Produkt GI zwischen Anbieter<br />
und einzelnen direkten Kunden.<br />
3 Methodik zur Bewertung<br />
Das Bewerten kann im Anschluss an ein Messen oder Schätzen als zweite Stufe des Quantifizierens<br />
angesehen werden (PIETSCH, 2003). Zunächst stellt sich im Zusammenhang mit der<br />
Bewertung der Nutzenpotenziale des geoGovernment die Frage nach dem Bewertungsziel.<br />
Es ist das Ziel, die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung für das geoGovernment systematisiert<br />
und nachvollziehbar durchzuführen, um auf diese Weise die Wirtschaftlichkeit der Investition<br />
in das geoGovernment für Anbieter und Kunden zuverlässig ermitteln zu können. Aus<br />
dem Bewertungsziel ergeben sich die fünf in Abbildung 4 dargestellten Fragen, d. h. Anforderungen<br />
an die Bewertung im Einzelfall.<br />
Bewertungszeitpunkt<br />
Wann soll bewertet werden?<br />
Bewertungsträger<br />
Wer soll bewerten?<br />
Bewertungsobjekt<br />
Was soll bewertet werden?<br />
Bewertungsmaßstab<br />
Womit soll bewertet werden?<br />
Bewertungsverfahren<br />
Wie soll bewertet werden?<br />
Abb. 4: Aus dem Gesamtzusammenhang der Bewertungssituation ergeben sich nach<br />
PIETSCH (2003) die Anforderungen an die Bewertung im Einzelfall<br />
Bewertungsobjekt: In der vorliegenden Arbeit handelt es sich bei dem Bewertungsobjekt<br />
um den Nutzen, der durch geoGovernment für einzelne direkte Kunden entsteht. Nur reali-
Bewertung von Nutzenpotenzial des geoGovernment 29<br />
sierte und nachvollziehbar monetär bewertete Nutzenpotenziale stellen Nutzen dar. Deshalb<br />
ist im vorliegenden Fall insbesondere die Differenz der Durchlaufzeiten von Prozessen, die<br />
vor und nach Einführung des Produkts GI erzielt werden, zu bewerten.<br />
Bewertungsmaßstab: Bool‘sche (z. B. gut/schlecht) bzw. ordinale (z. B. Note 1 bis 6)<br />
Bewertungen reichen im Zusammenhang mit dem o.g. Bewertungsobjekt nicht aus. Weit<br />
verbreitet und bei sorgfältiger Anwendung eine gute Entscheidungshilfe sind mehrdimensionale<br />
Bewertungen, wie z. B. durch eine Nutzwertanalyse. Dabei werden v.a. die qualitativen<br />
Auswirkungen des Einsatzes eines Produkts GI gemessen oder geschätzt, die Ergebnisse<br />
der Analyse gemäß ihrer Bedeutung gewichtet und auf einer Skala (Bewertungsmaßstab)<br />
vereinheitlicht.<br />
Grundsätzlich können sämtliche Nutzenpotenziale des Produkts GI auf eine Skala mit monetären<br />
Einheiten transformiert werden. Allerdings unterscheiden sich die Ergebnisse von<br />
monetären Bewertungen einzelner Nutzenpotenziale entscheidend in ihrer Nachvollziehbarkeit.<br />
Bewertungsverfahren: Einer nachvollziehbaren Bewertung der Nutzenpotenziale des<br />
Produkts GI muss ein anerkanntes Bewertungsverfahren zugrunde liegen. In der betriebswirtschaftsnahen<br />
Literatur (PIETSCH 2003) existieren eine Vielzahl von Verfahren zur Bewertung<br />
von Informations- und Kommunikationssystemen, die – ggf. leicht modifiziert –<br />
auf das Produkt GI angewendet werden können. Speziell für die Zwecke einer monetären<br />
Bewertung von Zeiteinsparungen existieren das<br />
• Times Savings Times Salary Verfahren (TSTS) sowie das<br />
• Hedonic Wage Model<br />
Die beiden Verfahren unterscheiden sich im wesentlichen darin, dass unterschie<strong>dl</strong>ich komplexe<br />
mathematische Modelle verwendet werden, mit denen die ermittelte Zeiteinsparung in<br />
einen monetären Wert umgerechnet wird.<br />
Bewertungsträger: Im Rahmen des geoGovernment ist entscheidend, dass jeweils die<br />
einzelnen Kunden zusammen mit dem Anbieter die monetäre Bewertung der Zeiteinsparung<br />
vornehmen bzw. nachvollziehen können. Nur wenn Anbieter und Kunde ermittelte Zeiteinsparungen<br />
nachvollziehen können, werden sie diesen Nutzen als Grun<strong>dl</strong>age zur Ermittlung<br />
der Wirtschaftlichkeit des Produkts GI akzeptieren.<br />
Bewertungszeitpunkt: Im Sinne eines professionellen Projektmanagements ist die beschriebene<br />
Sicht- und Vorgehensweise (s. auch Abschnitt 4) im Rahmen der Planungsphase<br />
des geoGovernment anzuwenden. Änderungen die das Produkt GI in den Arbeitsschritten<br />
der direkten Kunden verursacht, müssen in diesem Fall abgeschätzt bzw. simuliert werden.<br />
Die Sicht- und Vorgehensweise ist darüber hinaus auch zu jedem Zeitpunkt während oder<br />
nach Einführung des Produkts GI oder im Laufe der Zeit auch mehrmals anwendbar. Je<br />
später die Analysen statt finden, desto zuverlässigere Ergebnisse sind von der Vorgehensweise<br />
zu erwarten.<br />
4 Voraussetzung zur Bewertung<br />
Eine vollständige monetäre Bewertung des Nutzenpotenzials Zeiteinsparung im Sinne der<br />
vorliegenden Arbeit ist erst möglich, wenn die direkten Kunden identifiziert und deren
30<br />
M. Ebner<br />
Prozesse zuverlässig und ausreichend detailliert analysiert wurden. Im Falle des geoGovernment<br />
können die Unternehmen des öffentlichen Sektors in Gruppen eingeteilt werden<br />
(z. B. Gemeinde-, Städte-, Landesbehörde) innerhalb derer die Unternehmen zu einem<br />
Großteil ähnliche oder gleiche Aufgaben wahrnehmen. Bis zu einem bestimmten Grad ist es<br />
möglich Referenzprozesse für die Unternehmen des öffentlichen Sektors in einem Modell<br />
zu beschreiben. Das Ziel von Referenzprozessmodellen ist es, die Prozesse von beteiligten<br />
Unternehmen so detailliert wie möglich zu beschreiben, und damit gleichzeitig für eine<br />
große Anzahl von Unternehmen Gültigkeit zu erreichen. Für Unternehmen der Gas- und<br />
Wasserversorgung z. B. existiert ein praxiserprobtes (EBNER 2002 und EBNER 2003) Referenzmodell,<br />
in dem die einzelnen Arbeitsschritte von Prozessen dargestellt und beschrieben<br />
sind (DVGW 2000). Bei Bedarf, z. B. zum Zwecke der Messung von veränderten Durchlaufzeiten,<br />
die aus dem Einsatz des Produkts GI resultieren, sind innerhalb einzelner Arbeitsschritte<br />
vom Unternehmen die individuellen elementaren Arbeitsschritte zu erarbeiten<br />
(s. Abbildung 5).<br />
Arbeitsschritte eines<br />
Prozesses eines<br />
direkten Kunden<br />
Elementare Arbeitsschritte<br />
vor Einsatz des<br />
Produkts GI<br />
Element. Arbeitsschritte<br />
bei Einsatz<br />
des Produkts GI<br />
Abb. 5: Beispielhafte und schematische Darstellung von Arbeitsschritten eines Prozesses<br />
eines direkten Kunden und daraus erarbeitete elementare Arbeitsschritte vor und<br />
nach Einsatz des Produkts GI<br />
Referenzprozessmodelle sind eine geeignete Grun<strong>dl</strong>age für die monetäre Bewertung des<br />
Nutzenpotenzials Zeiteinsparung. Für die vielfältigen Aufgaben des geoGovernment insgesamt<br />
gibt es heute in der Bundesrepublik Deutschland noch kein Referenzprozessmodell. Im<br />
Rahmen der eGovernment-Initiative BundOnline 2005 jedoch hat sich die deutsche Bundesregierung<br />
verpflichtet, dass „die Bundesverwaltung bis zum Jahre 2005 alle internetfähigen<br />
Dienstleistungen online bereit stellen wird“ (SCHRÖDER 2000). Das gelingt nur, wenn die<br />
Bundesregierung alle Arbeitsschritte der direkten Kunden, d. h. ein Referenzprozessmodell,<br />
erarbeiten lässt. Auf Basis eines vollständigen Referenzprozessmodells werden auch sämtli-
Bewertung von Nutzenpotenzial des geoGovernment 31<br />
che Arbeitsschritte der deutschen Bundesverwaltung erkennbar sein, in denen das Produkt<br />
GI eingesetzt wird. Durch Anwendung der beschriebenen Sicht- und Vorgehensweise, d. h.<br />
nach der Erarbeitung von elementaren Arbeitsschritten, kann die deutsche Bundesregierung<br />
den Nutzen des eGovernment bzw. des geoGovernment, der aus dem Nutzenpotenzial Zeiteinsparung<br />
resultiert, monetär bewerten.<br />
5 Fazit<br />
Die Ermittlung der Wirtschaftlichkeit des geoGovernment bzw. des Produkts GI ist im<br />
Gegensatz zu Fragen der technischen Realisierbarkeit zunehmend von Interesse und nur auf<br />
Basis von nachvollziehbar monetär bewertetem Nutzenpotenzial durchzuführen.<br />
Mit der vorliegenden Arbeit soll zur Lösung des bisher in der Literatur ungelösten Problems<br />
beigetragen werden: Ermittlung des Nutzens der direkten Kunden.<br />
Durch Trennung der Kosten und Nutzen des Anbieters und der einzelnen direkten Kunden<br />
des Produkts GI wird eine Nutzenbetrachtung systematisiert.<br />
Insbesondere der Nutzen durch Zeiteinsparungen ist für die direkten Kunden von wesentlicher<br />
Bedeutung und kann außerdem nachvollziehbar monetär bewertet werden.<br />
Bei allen Aufgaben, die bereits in der Vergangenheit bewältigt wurden, können die direkten<br />
Kunden durch den Einsatz des Produkts GI Zeiteinsparungen erzielen.<br />
In der Literatur genanntes Nutzenpotenzial ist unterschie<strong>dl</strong>ich konkret, in jedem Fall aber zu<br />
allgemein formuliert und kann deshalb nicht zu einer nachvollziehbaren monetären Bewertung<br />
führen. Durch die Betrachtung von realisierten Nutzenpotenzialen in den elementaren<br />
Arbeitsschritten der einzelnen direkten Kunden wird eine Nutzenbetrachtung systematisiert.<br />
Im Rahmen der Initiative BundOnline 2005 wird eine geeignete Grun<strong>dl</strong>age (Referenzprozessmodell)<br />
für die Erarbeitung elementarer Arbeitsschritte und damit für die monetäre<br />
Bewertung von Zeiteinsparungen, die durch das geoGovernment erzielt werden, geschaffen.<br />
Die Sicht- und Vorgehensweise der vorliegenden Arbeit ist übertragbar auf weitere Kunden-<br />
Lieferanten-Beziehungen des geoGovernment bzw. auf Informationssysteme generell.<br />
Literatur<br />
BEHR, F.-J. (2000): Strategisches GIS-Management – Grun<strong>dl</strong>agen, Systemeinführung und<br />
Betrieb. 2., überarbeitete Auflage, Wichmann Verlag.<br />
Deutsche Vereinigung des Gas- und Wasserfaches e.V. (DVGW) (2000): DVGW-<br />
Referenzmodell für GIS-gestützte Geschäftprozesse. Abschlussbericht des DVGW-<br />
Projekts.<br />
EBNER, M. (2002): Nutzen, Wert und Preis von Netzinformation in Versorgungsunternehmen.<br />
Posterbeitrag zur AGIT-Postersession im Rahmen des 14. AGIT-Symposiums im<br />
Juli 2002.<br />
EBNER, M. (2003): Qualitätsmanagement der NIS-Daten bei der Thüga AG Bad Waldsee.<br />
Unveröffentlichte Folien-Präsentation von Projekt-Ergebnissen am 29.4.2003.
32<br />
M. Ebner<br />
PIETSCH, T. (2003): Bewertung von Informations- und Kommunikationssystemen. 2. neu<br />
bearbeitete und erweiterte Auflage, Erich Schmidt Verlag.<br />
SCHRÖDER, G. (2000): Rede des deutschen Bundeskanzlers anlässlich des Kongresses der<br />
D21 Initiative am 18. Sept. 2000 in Hannover.<br />
http://www.bsi.de/fachthem/egov/6.htm (eGovernment-Handbuch für der Initiative Bund-<br />
Online 2005; Online-Version)<br />
http://www.bundonline2005.de/ bzw. http://www.bundonline2005.com/ (Homepage zur<br />
eGovernment-Initiative der Bundesregierung)<br />
http://www.mediakomm.net/index.phtml (Kommunikations- und Informationsportal zu den<br />
Projekten und Aktivitäten im Rahmen von eGovernment in der Bundesrepublik)
easyGovernment – Wahlinformationssysteme<br />
mit GIS-Technologie am Beispiel<br />
der Bundestagswahl 2002<br />
Zusammenfassung<br />
Claudia FEIX, Oliver SCHAEFER und Sven EULITZ<br />
easyGovernment ist mehr als nur eGovernment, mehr als nur der Einsatz elektronischer<br />
Informationstechnologien im Amt. easyGovernment bedeutet, dass Verwaltung einfacher<br />
wird, schneller, effektiver. easyGovernment ist es, Behördengänge über das Internet zu erledigen,<br />
anstatt Wartemarken zu ziehen. Ämter mobil zu machen, anstatt die Bürger einzubestellen.<br />
Parlamentswahlen zu automatisieren, statt Stimmzettel `per Hand` auszuzählen.<br />
Die Daten laufen zu lassen, nicht den Bürger. Verwaltungsverfahren im Internet transparent<br />
und einsehbar zu machen, statt Akten zu schleppen. Dadurch Kosten zu sparen, statt immer<br />
weiter an der Gebührenschraube zu drehen, Behörden zu Service-Centern und Ämter mit<br />
ihren Kunden zu verbinden – den Bürgern. Bei all diesen Services spielen Geodaten eine<br />
wichtige Rolle. Anhand eines eindringlichen Beispiels wird hier aufgezeigt, wie sehr easy-<br />
Government mit GeoGovernment zusammenhängt.<br />
Es wird auf die Neuentwicklung des webbasierten Wahlabwicklungssystem eingegangen,<br />
das online für die letzten Bundestagswahlen im Herbst 2002 im Einsatz war. In diesem<br />
System wurde erstmals für den öffentlichen Bereich im großen Umfang auf die SVG-<br />
Technologie gesetzt. Damit ist es möglich, eine dynamische Visualisierung aller Zwischenund<br />
Endergebnisse der Bundestagswahl zu gewährleisten. Die Wahlergebnisse werden<br />
sowohl grafisch in Karten und Diagrammen als auch übersichtlich in Tabellen dargestellt.<br />
1 Das Wahlinformationssystem zur Bundestagswahl<br />
So spannend wie am 22. September 2002 lief noch keine Bundestagswahl in der deutschen<br />
Nachkriegsgeschichte ab. Am Ende lag die SPD nur mit einem hauchdünnen Vorsprung vor<br />
der Union. Ein weiteres Novum war das erstmals eingesetzte Computersystem zur Durchführung<br />
und Auswertung der Wahl. Anders als bei allen bisherigen deutschen Urnengängen<br />
setze der Bundeswahlleiter auf ein automatisches Wahlabwicklungssystem, das von der IVU<br />
Traffic Technologies AG (www.ivu.de) in Kooperation mit dem Statistischen Bundesamt<br />
entwickelt wurde.<br />
Innerhalb eines engen Projektplans entstand ein System, dass in der Wahlnacht zur Ermittlung<br />
des vorläufigen amtlichen Ergebnisses sowie zwei Wochen später auch zur Berechnung<br />
des amtlichen Endergebnisses diente.<br />
Die webbasierte Lösung mit GIS-Technologie steuerte den gesamten Wahlprozess nach<br />
Auszählung der Stimmen. Am Wahlabend erfasste das System zunächst bei den sechzehn
34<br />
C. Feix, O. Schaefer und S. Eulitz<br />
Landeswahlleitern die Ergebnisse aller 299 Wahlkreise und übermittelte diese über verschlüsselte<br />
und gesicherte Verbindungen an das Statistische Bundesamt in Wiesbaden,<br />
dessen Präsident gleichzeitig der Bundeswahlleiter ist. Nach verschiedenen Plausibilitätskontrollen<br />
berechnete das System die Wahlergebnisse auf Landes- und Bundes-Ebene inklusive<br />
der Sitzverteilung des neuen Bundestags einschließlich der Überhangmandate und<br />
den Namenslisten der Abgeordneten. Die Ergebnisse wurden zur Wahlnacht so aufbereitet,<br />
dass sie von den Wahlleitern, der Presse und der Öffentlichkeit auf unterschie<strong>dl</strong>ichen Medien<br />
genutzt werden konnten.<br />
1.1 Systemarchitektur<br />
Der dreistufige Aufbau des Gesamtsystems folgt den Anforderungen durch das Statistische<br />
Bundesamt: Das Kernsystem basierend auf Java-Technologie (EJB) regelt den Zugriff auf<br />
eine Datenbank und wird gleichzeitig von Web-Clients zur Datenerfassung und Ergebnispräsentation<br />
sowie für Anwendungen zum Datenimport und zur Druckaufbereitung genutzt<br />
(siehe Abbildung 1). Alle Komponenten, Zugriffe und Datentransfers sind – entsprechend<br />
der Bedeutung der Bundestagswahl – auf höchste Sicherheit, Leistungsfähigkeit und ständige<br />
Verfügbarkeit ausgelegt.<br />
Abb. 1: Dreistufiger Aufbau des Gesamtsystems<br />
Das System basiert zum großen Teil auf Open-Source-Technologien. Besonders innovativ<br />
ist hier die Verwendung von XML und des neuen Internet-Grafikformates SVG 1 . SVG ist<br />
ein Datenformat zur Speicherung und Übertragung von Vektorgrafiken und seit 2001 vom<br />
World Wide Web Consortium (W3C) als Standard verabschiedet. Es ermöglicht die Darstellung<br />
von statischen und animierten Grafiken und erlaubt zusätzlich die hybride Einbindung<br />
von Vektor- und Rastergrafiken in einer Datei. SVG ist eine XML-basierte Sprache<br />
und ermöglicht es, die Grafiken durch den Einsatz von Scriptsprachen im hohen Maße interaktiv<br />
zu gestalten. Ein entscheidender Vorteil von SVG gegenüber der Verwendung<br />
herkömmlicher Rastergrafiken besteht darin, dass das SVG-Dokument über das sogenannte<br />
Document Objekt Modell (DOM) 2 nachträglich verändert werden kann 3 .<br />
1 Vgl. W3C, WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (2003a).<br />
2 Vgl. FIBRINGER (2002).<br />
3 Vgl. u. a. HELD (2003), SCHAEFER (2002).
easyGovernment – Wahlinformationssysteme mit GIS-Technologie 35<br />
1.2 Ergebnispräsentation mit SVG<br />
Zur Bundestagswahl 2002 erfolgte die Präsentation der Wahlergebnisse im Reichstag an<br />
über 20 Terminals und mehreren Präsentationsleinwänden, an denen sich Politiker, Journalisten<br />
und Gäste über die aktuellsten Zwischen- und Endergebnisse informieren konnten.<br />
Als Präsentationsansichten stellt das System verschiedene thematische Karten, Diagramme<br />
und übersichtliche Tabellen zur Verfügung, die einerseits interaktiv vom Nutzer ausgewählt<br />
werden können oder über eine „Slideshow“ in wechselnder Ansicht präsentiert werden. Die<br />
Wahlergebnisse werden sowohl für das ganze Bundesgebiet als auch für die einzelnen Bundesländer<br />
thematisch aufbereitet. Als Ansichten stehen u.a. die Wahlbeteiligung in den<br />
Wahlkreisen und den Ländern, Wahlkreissieger, Zweitstimmenanteile der einzelnen Parteien,<br />
Gewinne und Verluste bei den Zweitstimmen, die Sitzverteilung im Bundestag, Gewinne<br />
und Verluste bei den Sitzen im Bundestag oder eine Übersicht über die zuletzt eingegangenen<br />
Wahlkreise zur Verfügung (siehe Abbildung 2).<br />
Abb. 2: Präsentation der Wahlergebnisse über verschiedene Ansichten<br />
Während der Stimmenauszählung werden durch die Landeswahlleiter laufend neue Wahlergebnisse<br />
aus den einzelnen Wahlkreisen in das Wahlabwicklungssystem eingespeist. Um<br />
immer den aktuellen Stand der Auszählung präsentieren zu können, muss also eine dynamische<br />
Visualisierung aller Zwischen- und Endergebnisse über alle Ansichten erfolgen. Hierbei<br />
kommen die Vorteile von SVG zum tragen.<br />
Die einzelnen Ansichten stehen als „leere“ Rohansicht im SVG-Format auf dem Präsentationsserver<br />
und werden zu Beginn der Präsentation einmalig übertragen. Alle SVG-Grafiken<br />
sind im GZIP-Format komprimiert, wodurch die Dateigröße um bis zu 80 % verringert<br />
wird 4 . Neu eintreffende Wahlergebnisse werden sofort als XML-Datei an die einzelnen<br />
Terminals übertragen und direkt in die SVG-Grafiken eingebunden (siehe Abbildung 3).<br />
4 Vgl. FIBRINGER (2002), S. 330.
36<br />
C. Feix, O. Schaefer und S. Eulitz<br />
Abb. 3: Konzept der Präsentation der Wahlergebnisse in SVG-Grafiken<br />
Die eigentliche Integration der Wahlergebnisse, z. B. in einer thematischen Karte, erfolgt<br />
durch clientseitig ausgeführte Scripte (JavaScript). Die eintreffenden Daten der Wahlkreise<br />
werden über das DOM in die SVG-Grafik eingetragen. Die Berechnung der neuen Zwischenergebnisse<br />
und die entsprechende Visualisierung in der SVG-Grafik erfolgt durch<br />
Scripte und Stylesheets (CSS) ebenfalls automatisiert.<br />
Die XML-Dateien sind so strukturiert, dass die Wahlergebnisse der einzelnen Wahlkreise<br />
automatisch in alle thematischen Ansichten gleichzeitig integriert werden. Das bedeutet,<br />
dass sowohl die Basisgeometrien und auch alle Wahlergebnisse jeweils nur ein einziges mal<br />
auf die Terminals übertragen werden müssen. Gegenüber einer konventionellen Webmapping-Lösungen,<br />
bei der für jede Ansicht bei Eintreffen neuer Daten ein neues Rasterbild<br />
erstellt und übertragen werden muss, wird hierdurch eine redundante Datenübertragung<br />
vermieden und die Übertragungsmenge erheblich reduziert.<br />
Abb. 4: Darstellung der Zwischenergebnisse zu einzelnen Zeitpunkten im Verlauf des<br />
Wahlabends<br />
Es wurde also ein System entwickelt, mit dem der Nutzer im Laufe des Wahlabends in<br />
„Echtzeit“ verfolgen kann, wie die Ergebnisse der einzelnen Wahlkreise eintreffen und mit
easyGovernment – Wahlinformationssysteme mit GIS-Technologie 37<br />
dem er jederzeit nachvollziehen kann, wie weit der Stand der Auszählung schon vorangeschritten<br />
ist (siehe Abbildung 4).<br />
1.3 Bewertung des Einsatzes von SVG im Wahlinformationssystem<br />
Der Einsatz von SVG in der digitalen Kartographie und der Geoinformatik wurde aus wissenschaftlicher<br />
Sicht schon oft untersucht und vielfach bewertet. Für den Einsatz in einem<br />
kommerziellen Produkt sind aber Kriterien entscheidend, die über die Frage, was alles mit<br />
SVG „möglich“ ist, hinausgehen.<br />
Zunächst ist festzuhalten, dass die Präsentation der Wahlergebnisse im Reichtag von den<br />
Nutzern sehr gut angenommen wurde. Die Qualität der grafischen Darstellungen ist durch<br />
den Einsatz von Vektorgrafiken sehr hoch, und auch die Funktionalität, d. h. die zeitnahe<br />
Visualisierung von Zwischen- und Endergebnissen bei Vermeidung redundanter Datenübertragung,<br />
ist in dieser Form durch den Einsatz von SVG besonders gut erreichbar. In<br />
Abstimmung mit dem Auftraggeber wurde konsequent auf Open-Source-Software gesetzt.<br />
Das System ist somit weitgehend plattformunabhängig und nicht auf Formate und Standards<br />
anderer kommerzieller Hersteller angewiesen. Das bedeutet, dass auch keine Lizenzkosten<br />
zu entrichten sind und das System unabhängig von Fremdentwicklungen bleibt. SVG selbst<br />
ist ein neuer Grafik-Standard und arbeitet sehr gut mit anderen Standard-Technologien des<br />
Internets zusammen. So war es möglich, die Programmkomponente der Ergebnispräsentation<br />
im Reichstag in sehr kurzer Zeit zu konzipieren und umzusetzen.<br />
Ein nicht zu unterschätzendes Problem zeigt sich bei der Erstellung der SVG-Grafiken.<br />
Obwohl sich namhafte Software-Firmen aus der Grafik-Branche als Mitglieder des W3C an<br />
der Entwicklung von SVG beteiligt haben, gibt es immer noch Defizite bei den Werkzeugen<br />
zur Konvertierung von Vektorgrafiken in das SVG-Format 5 . Leider mussten alle Grafiken<br />
manuell mittels Texteditor nachbearbeitet werden, wodurch allein rund 50 % des Arbeitsaufwandes<br />
und damit ein erheblicher finanzieller Anteil zur Erstellung der Rohansichten<br />
aufgewendet wurde.<br />
Für den Bürger stellt sich die Frage, inwieweit eine solche „Echtzeit“-Ergebnispräsentation<br />
über das Internet präsentiert werden könnte. Dazu ist anzumerken, dass trotz konsequenter<br />
Verwendung von Vektorgrafiken immer noch erhebliche Datenmengen übertagen werden<br />
müssen, was mit herkömmlichen Modems oder per ISDN nur schwer bewältigt werden<br />
kann. Zusätzlich sind zur Betrachtung von SVG-Grafiken Plug-Ins notwendig, die auf dem<br />
Client-Rechner installiert werden müssen. Dies stellt für viele Bürger noch immer eine<br />
große Hemmschwelle bei der Nutzung von Internet-Angeboten dar. Eine Weiterentwicklung<br />
der Wahlinfo-Präsentationskomponente konzentriert sich daher u.a. auf die Optimierung der<br />
SVG-Grafiken und des XML-Datenschemas, um auch in Zukunft immer bessere easyGovernment-Lösungen<br />
anbieten zu können.<br />
5 Zum Stand der Implementierung von SVG siehe W3C (2003b).
38<br />
2 Ausblick<br />
C. Feix, O. Schaefer und S. Eulitz<br />
Die nächsten Landeswahlen stehen an. Insbesondere aber steht die Europawahl im Juni<br />
2004 vor der Tür. Auch hier wird auf Open-Source-Technologie gesetzt. Die Kartenpräsentationen<br />
haben bei der Ergebnisdarstellung weiterhin eine große Bedeutung. Vor allem<br />
sind Bilder schnell lesbar, lassen die räumlichen Zusammenhänge erkennen und unterstützen<br />
so die vielen Datenzeilen. Die SVG-Technologie könnte, nachdem sie die Feuertaufe<br />
bei den deutschen Bundestagswahlen erfolgreich bestanden hat, auch bei weiteren Wahlen<br />
eine wichtige Rolle einnehmen.<br />
Ein weiterer Schritt wird die Erstellung eines „Wahlportals“ sein (siehe Abbildung 5). Hier<br />
geht es darum, nicht nur die aktuellen Wahlen zu präsentieren, sondern prinzipiell auch<br />
historische Wahldaten zu verwalten und eine komplexe Wahldatenbank aufzubauen, um so<br />
Vergleichsberechnungen automatisiert anzuzeigen. Die kartografische Unterstützung ist<br />
dabei unentbehrlich.<br />
Abb. 5: Vom automatisierten Wahlprozess zum Wahlportal<br />
Mit dem Fortschritt in den grafischen Techniken auf Open-Source-Ebene wird es z. B. auch<br />
möglich sein, dem Bürger in Zukunft Informationen auf Handhelds nicht nur in Textform,<br />
sondern auch in kartographische Präsentationen, als Wegbeschreibung mit Karte zum<br />
nächsten Amt, Verfolgung und Darstellung der Wahlergebnisse etc. zu präsentieren. Mit<br />
dem Ziel das Alltagsleben mit Behörden hoffentlich zu vereinfachen – easyGovernment.<br />
Referenzen<br />
Der Bundeswahlleiter: http://www.bundeswahlleiter.de<br />
FIBRINGER, I. (2002): SVG – Scalable Vector Graphics. Praxiswegweiser und Referenz für<br />
den neuen Vektorgraphikstandard. München<br />
HELD, G. (2003): Anforderungen an einen kartographischen Viewer für Business Intelligence<br />
Systeme.<br />
http://www.carto.net/papers/georg_held/diplomarbeit_georg.pdf (16.06.03)
easyGovernment – Wahlinformationssysteme mit GIS-Technologie 39<br />
SCHAEFER, O. (2002): Einsatzmöglichkeiten von Scalable Vector Graphics für kartographische<br />
Fahrgastinformationssysteme im Internet – Entwicklung eines Mapservers zur dynamischen<br />
Generierung von interaktiven Karten im SVG-Format. Unveröffentlichte<br />
Diplomarbeit an der Freien Universität Berlin<br />
SCHWARTZENBERG von M. & GEIERT, C. (2002): Grun<strong>dl</strong>agen und Daten zur Wahl zum 15.<br />
Deutschen Bundestag am 22. September 2002. Statistisches Bundesamt, Wirtschaft und<br />
Statistik (WiStat 08/2002). Wiesbaden. S. 639-653<br />
W3C, World Wide Web Consortium (2003a): Scalable Vector Graphics – SVG.<br />
http://www.w3.org/graphics/svg/overview.htm8 (01.07.2003)<br />
W3C, World Wide Web Consortium (2003b): SVG Implementations.<br />
http://www.w3.org/Graphics/SVG/SVG-Implementations.htm8 (01.07.2003)
Informations- und Managementsysteme für Gewerbeflächen<br />
auf der Basis von Open-Source-Technologien<br />
Zusammenfassung<br />
Marc GASPER und Birgit GUHSE<br />
Die Unterstützung von Flächenmanagement und Flächenmarketing durch GIS im Internet ist<br />
eine zwar nicht mehr ganz neue, aber noch nicht sehr intensiv genutzte Möglichkeit die<br />
vorhandenen Informationen und Potenziale der Kommunen und Wirtschaftsförderern effektiver<br />
zu nutzen und zielgerichtet einzusetzen. Die vorliegende Arbeit befasst sich mit einem<br />
Forschungsprojekt, dessen Ziel es ist ein internetgestütztes Informations- und Managementsystems<br />
auf der Basis von frei verfügbaren Softwarekomponenten, wie dem Internet<br />
Mapserver der University of Minnesota (UMN Mapserver), eines freien Datenbankmanagementsystems<br />
(MySQL) sowie der Scriptsprache PHP und dem Apache Webserver zu<br />
entwickeln. In enger Kooperation mit der Wirtschaftsförderung Kaiserslautern, der<br />
ARCADIS Consult GmbH sowie der Universität Kaiserslautern konnte ein erster Prototyp<br />
am Beispiel des „Industriegebiet Nord (IG NORD)“ umgesetzt werden.<br />
1 Problemstellung<br />
Ganz im Trend der sogenannten „Informationsgesellschaft“ (IT-Generation) ist das Vorhandensein,<br />
Abfragen und die Verfügbarkeit von Informationen als eines der, bzw. das wichtigste<br />
Gut der Gesellschaft, Wirtschaft und der Kommunalverwaltungen. Im Aktionsprogramm<br />
der deutschen Bundesregierung zur „Innovation und Arbeitsplätze in der Informationsgesellschaft<br />
des 21. Jahrhunderts“ heißt es im Kapitel 6.1: „Die Verwaltungsmodernisierung<br />
kann nur dann gelingen, wenn direkt beim Umgang mit Wissen und Information<br />
angesetzt wird. Information ist einerseits der eigentliche Rohstoff (Produktionsfaktor) des<br />
Verwaltungshandelns, denn Produktionsprozesse in der Verwaltung bestehen wesentlich im<br />
Finden und Auswerten von bestehenden Informationen. Andererseits ist Information das<br />
Produkt des Verwaltungshandelns, das mit für die Informationsgesellschaft geeigneten<br />
Mitteln präsentiert und Kunden zur Verfügung gestellt werden muss“.<br />
Mit dem Start der eGovernment-Initiative hat der Bund Städte und Gemeinden auf absehbare<br />
Zeit vor eine immense Herausforderung gestellt. Einerseits bietet sich durch den Einsatz<br />
neuer Informations- und Kommunikationstechnologien ein großes Potenzial zur Vereinfachung<br />
und Effizienzsteigerung verwaltungsinterner Vorgänge sowie zur Verbesserung der<br />
Kommunikation mit Bürgern und Gewerbetreibenden. Andererseits müssen die Verwaltungen<br />
ihre Vorgänge und Prozesse an die neuen Anforderungen anpassen und geeignete Wege<br />
und Formen des Geschäftsverkehrs mit ihren „Kunden“ finden.<br />
Der Anspruch der ubiquitären Verfügbarkeit von Daten und Informationen in nahezu allen<br />
Bereichen des privaten und öffentlichen Lebens ist im gleichen Kontext zu sehen wie die
42<br />
M. Gasper und B. Guhse<br />
Erkenntnis der Tatsache, dass dem weitaus größten Teil aller Daten in Behörden und Unternehmen<br />
in irgendeiner Weise ein direkter oder auch indirekter räumlicher Bezug zugrunde<br />
liegt. Raumbezogene Daten dienen als Grun<strong>dl</strong>age für die unterschie<strong>dl</strong>ichsten Abläufe in der<br />
Telekommunikation, Wirtschaft und Verwaltung, insbesondere Investitions- und Standortentscheidungen<br />
werden nach räumlichen Kriterien getroffen.<br />
Durch die neuen Möglichkeiten der Informationsbeschaffung für den Einzelnen, wie auch<br />
für Betriebe und Unternehmen, hat man Zugriff auf eine viel größere und weitreichendere<br />
Produktpalette und kann einfach und bequem die unterschie<strong>dl</strong>ichsten Angebote vergleichen.<br />
Dadurch entbrennt ein viel härterer Wettbewerb, der sich für die Kommunen im Hinblick<br />
auf die Bindung und Neuwerbung von Investoren zusätzlich noch durch die Verschiebung<br />
der Bedeutung von Standortfaktoren potenziert.<br />
Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass viele Städte und Gemeinden zum einen großes<br />
Interesse daran haben, durch den Einsatz von eGovernment ihr eigenes Image zu optimieren,<br />
zum anderen möchten sie ihr vorhandenes Potenzial und Kapital im Sinne vorliegender<br />
Datenbestände nach außen repräsentativ einsetzen, um konkurrenzfähig zu bleiben. Ein<br />
Beispiel hierfür ist die Erleichterung der Kontaktaufnahme und umfassende Information<br />
über freie Gewerbe- und Industrieflächen oder auch Immobilien für Investoren, Handel und<br />
Gewerbe.<br />
Mögliche Werkzeuge hierfür sind beispielsweise browserbasierte Web-GIS Applikationen<br />
in Form sogenannter Internet-Map-Server (IMS). Werden diese Applikationen mit entsprechenden<br />
Informationen angebundener Datenbanken kombiniert und diese zielgerichtet abgefragt,<br />
so kann einer breiten Nutzergruppe Zugang zum Informations- und Wissenspool der<br />
Kommunen geboten werden. Diese Systeme haben sich mittlerweile immer mehr von der<br />
fachspezifischen Insellösung zu universell einsetzbaren Produkten gewandelt. Während<br />
bislang die bei der Anfrage eines möglichen Investors benötigten Informationen oft erst<br />
mühevoll zusammengetragen werden mussten, besteht mit den modernen Medien die Möglichkeit<br />
stets auf die aktuellsten Datenbestände zuzugreifen, wo auch immer diese im Netzwerk<br />
der Verwaltung vorgehalten werden. Zudem ist der Zugriff, sofern erforderlich und<br />
gewünscht auch über das Internet oder über mobile Applikationen auf Handhelds oder ähnlichen<br />
Systemen möglich.<br />
2 Ziele und Anforderungen<br />
Nach den inhaltlichen Anforderungen der Wirtschaftsförderungsgesellschaft von Stadt und<br />
Landkreis Kaiserslautern (WFK) sollte im Rahmen einer Diplomarbeit an der Universität<br />
Kaiserslautern und in Zusammenarbeit mit der ARCADIS Consult GmbH ein internettaugliches<br />
Informations- und Managementsystem für Gewerbeflächen entwickelt werden, dass ein<br />
hohes Maß an Dynamik und Interaktivität bietet, intuitiv in der Handhabung ist und eine<br />
einfache, schnelle und zielgerichtete Kontaktaufnahme vom Investor/Interessenten zur Wirtschaftsförderung<br />
ermöglicht.<br />
Das Managementsystem soll eine schlanke und homogene Programmstruktur aufzeigen, die<br />
sich von den vorhandenen Applikationen absetzt und dennoch deren positive Features integriert.<br />
Zudem soll das System großräumig agierende Flächensuchsysteme durch entsprechen-
Informations- und Managementsysteme für Gewerbeflächen 43<br />
des Platzieren bzw. Verlinken der Applikation aus den Webseiten von Stadt, Landkreis und<br />
Wirtschaftsförderung auf der lokalen Ebene ergänzen.<br />
Nachfolgend eine Aufzählung der wichtigsten Ziele und Inhalte:<br />
• Integration von Informationen zu Infrastruktur (Verkehr, Ver- und Entsorgung, Energie,<br />
Telekommunikation) zu Planungsrecht (Bebauungspläne, Flächennutzungspläne),<br />
zu Flurstücken, geplante Parzellen, Topographie und Orthophotos.<br />
• Informationen über bereits angesiedelte Firmen (Integration der bei der WFK eingesetzten<br />
Firmendatenbank) zur Charakterisierung des vorhandenen Milieus, Branchenkategorisierungen,<br />
Herausstellen von sowohl harten als auch weichen Standortfaktoren,<br />
Informationen zu Steuern, Flächenpreisen, Leistungen.<br />
• Einstieg über Suchformulare oder über die Suche in der Karte.<br />
• Integrationsfähigkeit der Lösung in bestehende Internetauftritte, aber auch möglicher<br />
Einsatz als Stand-alone-Lösung.<br />
• Offene Architektur, Vielfalt an Schnittstellen, einfache Anpassbarkeit.<br />
• Beispielhafte Umsetzung anhand eines bestehenden Gewerbegebietes, die Erweiterung<br />
auf das komplette Flächenangebot der WFK soll ohne größeren Aufwand möglich sein.<br />
3 Konzeption<br />
Das Gesamtprojekt gliedert sich in drei Module (siehe Abbildung 1), wobei für jedes Modul<br />
Inhalte, Funktionsumfang und Abfragemöglichkeiten vordefiniert wurden. Die Module<br />
fügen sich additiv zusammen, sie sind in ihrer Funktionsweise voneinander unabhängig, so<br />
dass Entwicklung und Einsatz sukzessiv erfolgen kann.<br />
Abb. 1: Projektaufbau/Konzept (Quelle: GASPER)
44<br />
M. Gasper und B. Guhse<br />
3.1 Modul 1: Internet Informations- und Managementsystem<br />
Zentrales Element der Arbeit ist die Entwicklung des Internet Informations- und Managementmoduls.<br />
Darin sind standardmäßige Mapserver(GIS)-Funktionalitäten wie stufenloses<br />
Zoomen, Selektionsmöglichkeiten, Infoabfragen, etc. mit Datenbankabfragen und Kommunikationsfunktionen<br />
kombiniert. Diese Funktionen werden um dynamische Features, wie die<br />
Anzeige abgefragter Flächengrößen ergänzt. Der Interessent kann sich auf diese Weise<br />
anzeigen lassen, wie eine angefragte Fläche mit der Größe „x“m 2 in der Kartendarstellung<br />
aussehen könnte. Das Ergebnis wird dynamisch aus MySQL-Abfragen generiert. Hat der<br />
Interessent Fragen bezüglich bestimmter Flächen, so soll er auf unkomplizierte Weise über<br />
Formulare mit der Wirtschaftsförderung in Kontakt treten können.<br />
Abb. 2: Gewerbeflächen-Auskunftssystem auf der Basis des UMN-Mapserver (Quelle:<br />
GASPER)<br />
3.2 Modul 2: Intranet Verwaltungssystem<br />
Das Verwaltungsmodul dient einerseits zu Administrationszwecken und andererseits der<br />
Unterstützung der Arbeit der Wirtschaftsförderung durch interne Bereitstellung von tagesaktuellen<br />
Informationen. Änderungen können direkt von den Mitarbeitern der WFK in die<br />
Datenbank eingearbeitet werden. Zudem können Flächen direkt ein- oder ausgebucht werden,<br />
weiterhin besteht die Möglichkeiten, mit Hilfe von Datenbankeinträgen Informationen<br />
mit allen relevanten Stellen auszutauschen.
Informations- und Managementsysteme für Gewerbeflächen 45<br />
Abb. 3: Eingabemaske im Admin-Tool (Quelle: GASPER)<br />
3.3 Modul 3: Immobilienmanagementsystem<br />
Dieses Modul ist eine Erweiterung des Grundmoduls (Modul 1), das auf Anregung von der<br />
WFK entstanden ist. Es bestand der Wunsch, neben den freien Gewerbeflächen ebenfalls<br />
leerstehende innerstädtische Immobilien anbieten zu können und diesen Dienst auch für<br />
ortsansässige Makler zur Verfügung zu stellen.<br />
Abb. 4: Formular zur Flächensuche in der Abb. 5: Detailergebnis der Datenbank-<br />
Datenbank (Quelle: GASPER) suche (Quelle: GASPER)
46<br />
4 Umsetzung<br />
4.1 Eingesetzte Software<br />
M. Gasper und B. Guhse<br />
Seitens der Projektbeteiligten waren keinerlei Softwaresysteme vorgegeben. In der ersten<br />
Phase des Projektes war angedacht, die Produktpalette von ESRI mit ArcIMS und ArcSDE<br />
einzusetzen, da hier schon eingehende Erfahrungen mit den Produkten im Vorfeld bestanden.<br />
Aus Kostengründen, als auch aus Gründen der aktuellen Diskussion um Open-Source-<br />
Softwareeinsatz z. B. bei Bundesbehörden, wurden in einem nächsten Schritt alternative<br />
Möglichkeiten geprüft. Im Rahmen dieser Prüfung entschied man sich für die Umsetzung<br />
mit Hilfe des frei erhältlichen UMN-Mapserver (University of Minnesota) und einem<br />
DBMS auf MySQL Basis.<br />
4.1.1 UMN Mapserver<br />
Der UMN-Mapserver wurde mit Unterstützung der NASA an der University of Minnesota<br />
entwickelt. Er hebt sich deutlich von anderen frei erhältlichen Applikationen ab, da es sich<br />
hierbei um einen umfassenden Internet Mapserver (IMS) handelt, dessen Funktionalität und<br />
Leistungsumfang sich an kommerzieller Software orientiert und im Hinblick auf die Qualität<br />
des Han<strong>dl</strong>ings und der Ergebnisse keine Nachteile gegenüber kommerziellen Lösungen<br />
vorhanden sind.<br />
Der UMN Mapserver kann auf nahezu allen Plattformen (Windows/Unix) eingesetzt werden.<br />
Der Zugriff ist unter anderem mit verschiedenen Programmiersprachen wie Perl, Java,<br />
Python und PHP möglich.<br />
4.1.2 Open Source<br />
Der UMN Mapserver, ebenso wie die eingesetzte MySQL Datenbank, ist ein Open Source<br />
Produkt, dass heißt er ist frei erhältlich (ohne Lizenzgebühren) und kann direkt aus dem<br />
Internet heruntergeladen werden. Die Zeiten in denen Open Source Produkte zwar frei erhältlich,<br />
aber aufgrund der „kryptischen Benutzeroberflächen“, der fehlenden Dokumentation,<br />
der eingeschränkten Nutzbarkeit auf einzelnen Plattformen etc. nur einem sehr kleinen<br />
Benutzerkreis vorbehalten waren, sind lange vorbei. Spätestens seit der Offensive des Bundesinnenministeriums<br />
zum verstärkten Einsatz von Open Source Software in der Verwaltung<br />
(eine Empfehlung, die inzwischen leider wieder relativiert und zum Teil zurückgenommen<br />
worden ist) wird die Alltagstauglichkeit der Produkte erkannt, da diese vor allem<br />
auf nahezu allen Plattformen lauffähig sind.<br />
Die Zukunftsfähigkeit der Entwicklung und die Fortführung und Pflege der Software ist hier<br />
im Gegensatz zu kommerzieller Software nicht durch ein Unternehmen, sondern durch eine<br />
Vielzahl an Entwicklern und Programmierern aus unterschie<strong>dl</strong>ichen Unternehmen und Universitäten<br />
gesichert, die immer wieder Aktualisierungen, Erweiterungen und Anpassungen<br />
an die unterschie<strong>dl</strong>ichsten Anforderungen und Fragestellungen im Internet bereitstellen.<br />
Gerade am Beispiel des UMN Mapservers zeigt sich auch der vorhandene hohe Standard<br />
der Programmierung in dem die Version 3.5 die Anforderungen des OpenGIS Consortiums<br />
(OGC) erfüllt.
4.1.3 Komponenten<br />
Informations- und Managementsysteme für Gewerbeflächen 47<br />
Die Umsetzung erfolgt im Wesentlichen auf den Komponenten Mapserver, Datenbankmanagementsystem,<br />
Datenbankschnittstelle, Benutzeroberfläche und Webserver. Eingesetzte<br />
Komponenten:<br />
• PHP Mapscript in der Version 3.6 der kanadischen Firma DMSolutions<br />
• MYSQL als Datenbankmanagementsystem, da der MySQL Standard-Tabellentyp My<br />
ISAM nicht transaktionsfähig ist wurden InnoDB Tabellen verwendet, da dieser Typ<br />
die Anforderungen für Transaktionen erfüllt.<br />
• PHP4 als Scriptsprache und Datenbankschnittstelle<br />
• Betriebssystem ist zur Zeit Win2000 und Win2000 Server<br />
• Das System läuft testweise parallel auf Apache Webservern und auf dem Internet Information<br />
Server (IIS) von Microsoft<br />
4.1.4 Daten<br />
Das System liest sowohl Raster- als auch Vektordaten. Zum jetzigen Zeitpunkt des Projektes<br />
(Stand Juli 2003) greift der Mapserver auf lokal liegende Daten (ESRI-Shapefiles und<br />
Rasterdaten) zurück. In Zukunft soll das System auf eine PostgreSQL- Datenbank transferiert<br />
werden worin auch die geografischen Informationen abgelegt werden können. In Version<br />
4.1 von MySQL kam eine Erweiterung für räumliche Informationen hinzu. Sie erlaubt<br />
das erzeugen, speichern und analysieren geographischer Daten. Funktionen zur räumlichen<br />
Beziehung von Objekten sind noch nicht implementiert<br />
Es ist weiterhin geplant, bei einer Umsetzung für alle Gewerbe-Industrie und Bauflächen<br />
der WFK direkt auf heute schon teilweise bei der Stadtverwaltung Kaiserslautern und der<br />
WFK digital auf verschiedenen Servern gespeicherten Daten zuzugreifen. Damit könnte der<br />
Aktualisierungsaufwand wesentlich minimiert und auch die Fehlerquellen durch redundante<br />
Datenhaltung etc. vermieden werden.<br />
4.2 Technischer Aufbau<br />
Die Anwendung ist Schichten-orientiert (n-tier-architecture) aufgebaut. Im Laufe der Bearbeitung<br />
wurde das eigentliche Aufgabenspektrum bei Bedarf immer wieder angepasst.<br />
Um die vielfältigen Einsatz- und Kombinationsmöglichkeiten von Mapserver und Datenbankmanagementsystem<br />
zu zeigen, wurde der Mapserver sowohl in seiner CGI-Variante, als<br />
auch in der PHP Mapscriptvariante eingesetzt Im sogenannten Mapfile befinden sich die<br />
Informationen über die Lage der Daten und die Darstellung in der fertigen Karte. Der<br />
Mapserver liefert lediglich Pixelbilder an WebClient, in diesem Fall PNG-Bilder, so dass<br />
keine datenschutzrechtlichen Bestimmungen verletzt werden. Außerdem ist die zu übertragene<br />
Datenmenge derart gering, dass selbst bei der Darstellung von (im Originaldatensatz)<br />
hochauflösenden Orthofotos eine hohe Performance gewährleistet werden kann.
48<br />
M. Gasper und B. Guhse<br />
Abb. 6: n-tier architecture (Quelle: übernommen von Mapmedia/eigene Darstellung)<br />
Um die Benutzung komfortabler zu gestalten und den Umfang an Funktionalitäten erhöhen<br />
zu können, wurde das ROSA-Applet der kanadischen Firma DMSolutions eingesetzt.<br />
ROSA ermöglicht z. B. das Aufziehen von Zoomboxen, das dynamische Zoomen oder auch<br />
die Auswahl von Flächen mit Hilfe eines Rechteckes. Weitere Funktionalitäten können<br />
selbst hinzuentwickelt werden.<br />
Als Datenbankschnittstelle wird die Scriptsprache PHP eingesetzt, welche die Verbindung<br />
zwischen Mapserver und Datenbank herstellt. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, mit<br />
PHP die vordefinierten Funktionen um weitere Eigenentwicklungen zu ergänzen.<br />
5 Fazit/Ausblick<br />
Das System soll die Wirtschaftsförderung in die Lage versetzen bei Anfragen kurzfristig<br />
gezielt und fundiert Auskunft zu jeder einzelnen Fläche geben zu können und auch die Zusammenstellung<br />
von Materialien und Karten zu angefragten Flächen per Knopfdruck zu<br />
erledigen. Damit wird nicht nur der Aufwand für den einzelnen Mitarbeiter gesenkt, sondern<br />
auch und vor allem die Reaktionszeiten und damit die Wirkung nach außen verbessert.<br />
Es hat sich im Laufe des Projektes herausgestellt, dass den Funktionalitäten und der Interaktivität,<br />
sowie dem Detaillierungsgrad von Informationen weniger technische, denn inhaltliche<br />
Grenzen gesetzt sind. Das System wird nie den persönlichen Kontakt zwischen Wirtschaftsförderung,<br />
Stadt und Investoren ersetzen, das soll es auch nicht. Es soll vielmehr den<br />
Anreiz erhöhen, sich unverbin<strong>dl</strong>ich mit den Beteiligten in Verbindung zu setzen, bzw. offene<br />
Fragen direkt zu klären. Die Eröffnung von Han<strong>dl</strong>ungsspielräumen und Varianten bei<br />
auftretenden Problemen bei Kauf, Miete oder Pacht von Flächen oder Immobilien lassen<br />
sich nur im persönlichen Kontakt/Gespräch klären.<br />
Inzwischen ist die prototypische Umsetzung des Projektes abgeschlossen und es hat sich in<br />
Einzelbereichen gezeigt, dass das ein oder andere gesteckte Ziel im beschränkten Zeitrah-
Informations- und Managementsysteme für Gewerbeflächen 49<br />
men einer Diplomarbeit in dieser Form nicht erreichbar war. In anderen Bereichen erfolgte<br />
eine detailliertere Umsetzung als in der Konzeptphase vorgesehen wurde.<br />
Insbesondere die Arbeit an der Weiterentwicklung der GIS-Funktionalitäten des Mapservers<br />
wurde teilweise zurückgestellt oder eingeschränkt. Stattdessen wurde der Aufwand zur<br />
Erstellung eines leistungsfähigen Datenbank-Management-Systems erhöht. Zum jetzigen<br />
Zeitpunkt sind alle wesentlichen Informationen der Wirtschaftsförderung in die Datenbank<br />
integriert bzw. ist die Struktur darauf ausgelegt die noch fehlenden Informationen zu übernehmen.<br />
In das Informationssystem sind momentan nur die für den Status Quo notwendigen<br />
Teile der Datenbank eingebunden, die Schnittstellen für die vollständige Integration der<br />
Datenbank sind allerdings bereits vorhanden.<br />
Da insbesondere auf die Interaktionsmöglichkeiten Wert gelegt wurde, existiert beispielsweise<br />
die Möglichkeit die Suche zu personalisieren. Ähnlich eines Shop-Systems, kann ein<br />
Interessent sein Suchergebnis abspeichern und über Formulare mit der Wirtschaftsförderung<br />
in Kontakt treten. Demgegenüber wurden bei den Komponenten Immobilien-Management-<br />
Modul und Intranet-Verwaltungsmodul lediglich Lösungswege aufgezeigt. Die Funktionsweise<br />
dieser Komponenten ist bislang nicht in vollem Umfang umgesetzt.<br />
Im Rahmen dieses Pilotprojektes ist es aber gelungen, der Wirtschaftsförderungsgesellschaft<br />
im Ansatz ein Instrument an die Hand zu geben, mit dem sich die vorhandenen Flächenpotenziale<br />
einer Stadt entsprechend platzieren lassen und das die Kommunikation zwischen<br />
potenziellen Interessenten und der Stadt wesentlich vereinfacht.<br />
Als Fazit des Projektes ist festzustellen, dass eine Kombination aus Open-Source-<br />
Komponenten wie dem UMN Mapserver und MySQL oder PostgreSQL Datenbanken eine<br />
hervorragende und technisch qualitativ ausgereifte Alternative zu den teilweise sehr teuren,<br />
kommerziellen Systemen darstellt. Die offenen Architekturen erleichtern die Einbindung<br />
weiterer Komponenten erheblich. Die Tatsache, dass weltweit eine Vielzahl von Usern und<br />
Entwicklern an der Weiterentwicklung der Applikation arbeiten, sichern die Zukunftsfähigkeit<br />
und die Verlässlichkeit der Software. Probleme oder Fragen können innerhalb kürzester<br />
Zeit mit Hilfe des hervorragend funktionierenden Userforums behoben werden.<br />
Inzwischen hat man sich darauf verständigt die Entwicklung gemeinsam fortzusetzen und<br />
den Prototypen zur vollen Einsatzfähigkeit weiterzuentwickeln.<br />
Links<br />
Apache-Webserver: http://apache.org<br />
MapMedia: http://www.mapmedia.de<br />
FreeGIS-Software: http://www.freegis.org<br />
UMN Mapserver: http://mapserver.gis.umn.edu<br />
DMSolutions Free PHP Mapscript<br />
– ROSA Applet: http://www.dmsolutions.ca<br />
MySQL Datenbank: http://mysql.com<br />
PHP: http://www.php.net
50<br />
Literatur<br />
M. Gasper und B. Guhse<br />
FRITSCHE, A. & SPRING, M. (2001): Webmapping und XMLContent Server mit Free Software<br />
– Portalkonzept Digitaler Regionatlas München DREAM; in CORP2001, Band 1,<br />
Wien, S. 83-86<br />
GASPER, M. (2002) Unveröffentlichte Diplomarbeit: Entwicklung eines interaktiven Informations-<br />
und Managementsystem für Gewerbeflächen am Lehrgebiet “Computergestützte<br />
Planungs- und Entwurfsmethoden in Architektur und Raumplanung – cpe”, Universität<br />
Kaiserslautern<br />
GUHSE, B. & LAHR, W. (2003): Unveröffentlichte Materialien zu UniGIS Modul: Kommunale<br />
Geographische Informationssysteme. Zentrum für Geographische Informationsverarbeitung<br />
Salzburg, Institut für Geographie und Angewandte Geoinformatik, Universität<br />
Salzburg
geo-Government als Teil der österreichischen<br />
Geodatenpolitik<br />
Zusammenfassung<br />
Reinhard GISSING<br />
Da geo-Government maßgeblich auf einer funktionierenden nationalen Geodaten-Infrastruktur<br />
(NGDI) aufbaut, wird zunächst die diesbezügliche aktuelle Situation in Österreich<br />
kurz beleuchtet. In weiterer Folge werden die unterschie<strong>dl</strong>ichen Aspekte des geo-Government<br />
näher angesprochen, wobei insbesondere auf die drei wesentlichsten Interessensgruppen<br />
eingegangen wird: die öffentliche Verwaltung, Bürger und Kunden sowie die Privatwirtschaft.<br />
Eine Betrachtung wesentlicher Voraussetzungen für erfolgreiches e-Government<br />
im Bereich der Geoinformation und ein kurzer Ausblick beschließen den Beitrag.<br />
1 Einleitung<br />
Wenn man von geo-Government spricht, ist damit die Ausweitung des Begriffes e-Government<br />
auf den Bereich der Geodaten / Geoinformation gemeint. In Hinblick auf die – mittlerweile<br />
zum Stehsatz mutierte – Aussage, dass 80 Prozent aller Informationen einen Raumbezug<br />
haben, ist die damit verbundene Hervorhebung der Bedeutung von Geoinformation<br />
auch sicherlich berechtigt. geo-Government sollte jedoch nicht bloß als Ergänzung von e-<br />
Government Lösungen angesehen werden, denn zahlreiche Verwaltungsverfahren, Bürgerservices<br />
und Informationsdienste sind ohne Integration von Geoinformation nicht möglich.<br />
Als Voraussetzung für die synergetische Verwendung von Geoinformation im Rahmen von<br />
geo-Government ist die Schaffung einer entsprechenden Basis unerlässlich: eine nationale<br />
Geodaten-Infrastruktur. Die Bemühungen dazu werden in Österreich im Begriff „Geodatenpolitik“<br />
zusammengefasst.<br />
2 Die österreichische Geodatenpolitik<br />
2.1 Bisherige Entwicklung<br />
Über die unbefriedigende Geodaten-Situation wurde bereits ausführlich berichtet (GISSING<br />
2001), wobei als wesentlichste Problembereiche nicht kompatible Datenbestände, ungeklärte<br />
Zuständigkeiten, divergierende Vorgehensweisen bei Bund, Ländern und Gemeinden<br />
sowie ungeeignete Vertriebs- und Preispolitik erkannt wurden. Die Folgen daraus sind unter<br />
anderem Mehrgleisigkeiten bei der Erfassung von Geodaten und der Entwicklung von<br />
Applikationen sowie der Aufbau teurer Parallelsysteme, die Gefahr der Verbreitung von<br />
nicht authentischen Informationen, die Nicht-Nutzung vorhandener Daten durch die Ver-
52<br />
R. Gissing<br />
waltung, unzureichende Nutzungsmöglichkeiten der wertvollen Datenbestände für die<br />
Wirtschaft – allgemein: es entsteht volkswirtschaftlicher Schaden !<br />
Aus diesem Grund entwickelte das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen (BEV)<br />
bereits ab dem Jahr 2000 ein gesamtstaatliches Konzept für eine „Geodatenpolitik in Österreich“,<br />
das im Juli 2001 dem Wirtschaftsminister übergeben wurde. In weiterer Folge wurde<br />
das BEV beauftragt, mit den zuständigen Stellen von Bund, Ländern und Gemeinden in<br />
Verhan<strong>dl</strong>ungen zu treten. In diesem Zusammenhang wurde bis September 2002 in einer Arbeitsgruppe<br />
der Länder unter Beteiligung des BEV ein „Konzept für eine österreichische<br />
Geodatenpolitik“ erarbeitet, das im Oktober 2002 von der Landeshauptmännerkonferenz<br />
zustimmend zur Kenntnis genommen wurde. Eine beabsichtigte Beschlussfassung auf Bundesebene<br />
wurde durch die vorzeitigen Neuwahlen zum Nationalrat verzögert, wodurch auch<br />
die geplante Konstituierung einer Verhan<strong>dl</strong>ungsplattform mit bevollmächtigten Vertretern<br />
aller Gebietskörperschaften (Geodaten-Plattform) vorerst verhindert wurde.<br />
2.2 Koordinierungsstelle für Geoinformation auf Bundesebene<br />
Mittlerweile liegt auch ein Beschluss des Ministerrates vor, in dem die Notwendigkeit der<br />
Neugestaltung der Geodatenpolitik und die zentrale Rolle des BEV in diesem Prozess<br />
betont wird. Ein darauf basierender Auftrag des zuständigen Wirtschafts- und Arbeitsministers<br />
erging vor wenigen Tagen im Juni 2003 an den Leiter des BEV.<br />
Damit wird eine Koordinierungsstelle für Geoinformation auf Bundesebene eingerichtet.<br />
Deren Leitung übernimmt auftragsgemäß der Leiter des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen,<br />
welches seinerseits als Geschäftsstelle der Koordinierungsstelle fungieren<br />
wird. Darüber hinaus wird ein Beirat ins Leben gerufen, der die Einbeziehung aller anderen<br />
Gebietskörperschaften, der Wirtschaft, der freien Berufe sowie der Interessens- und Berufsverbände<br />
ermöglicht. Wesentliche Aufgabenschwerpunkte der Koordinierungsstelle sind<br />
unter anderen:<br />
• Sicherstellung der permanenten Verfügbarkeit der erforderlichen öffentlichen Geodaten/<br />
Geoinformationen in entsprechender Qualität und Flächendeckung<br />
• Erhöhung der Nutzungsmöglichkeiten von Geodaten für Bürger, Wirtschaft und<br />
Verwaltung<br />
• Realisierung von e-Government-Lösungen im Bereich der Geodaten / Geoinformation<br />
• Unterstützung des Verwaltungsreformprozesses auch im Bereich Geodaten in Bund,<br />
Ländern und Gemeinden<br />
• Verbesserung des Bürgerservice durch Geoinformationsdienste<br />
• Senkung der Aufwendungen aller Gebietskörperschaften im Bereich Geodaten<br />
• Erschließung des hohen Wertschöpfungspotenzials der öffentlichen Geodaten zur Steigerung<br />
der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft und der Chancen für den österreichischen<br />
Arbeitsmarkt<br />
• Einheitliche Vertretung der österreichischen Geoinformationsinteressen auf internationaler,<br />
insbesondere auf EU-Ebene<br />
Auf Grun<strong>dl</strong>age dieses Auftrages wird in einem nächsten Schritt die Entwicklung konkreter<br />
Maßnahmen im Sinne der Geodatenpolitik erfolgen.
geo-Government als Teil der österreichischen Geodatenpolitik 53<br />
2.3 Themenbereiche der Geodatenpolitik<br />
Abbildung 1 veranschaulicht, dass die – hier stichwortartig zusammengefassten – Zielsetzungen<br />
der Geodatenpolitik nicht nur den Themenbereich „GI-Infrastruktur“ betreffen. Vielmehr<br />
sind auch die Themenbereiche „Verwaltungsreform“, „Stärkung der (GI-) Wirtschaft“<br />
und „e-Government“ gleichrangig zu berücksichtigen.<br />
Verwaltungsreform<br />
Geoinformation-Infrastruktur<br />
Verfügbarkeit / Qualität / Meta-IS<br />
Eindeutige Verantwortlichkeiten<br />
Modelle und Standards<br />
Bürgerservice / Geoinformationsdienste<br />
Nutzung in der Verwaltung<br />
Wertschöpfung durch die Wirtschaft<br />
Preis- / Nutzungsmodelle<br />
Österreichische Interessen<br />
Kommunikation / Kooperation<br />
Stärkung der GI-Wirtschaft<br />
Abb. 1: Zielsetzungen der österreichischen Geodatenpolitik<br />
Daraus wird die Komplexität der Han<strong>dl</strong>ungsfelder der Geodatenpolitik deutlich, was auch<br />
erklärt, warum sich Gespräche und Verhan<strong>dl</strong>ungen zu diesen Fragen mitunter sehr schwierig<br />
gestalten. Dennoch wäre es verfehlt, nur den einen oder den anderen Themenbereich (vorzugsweise<br />
natürlich den aus der jeweils eigenen Position wichtigsten) voranzutreiben.<br />
Da zwischen den einzelnen Zielen der Geodatenpolitik Abhängigkeiten und kausale Zusammenhänge<br />
bestehen, würde eine einseitige Vorgehensweise das gesamte Zielsystem in Frage<br />
stellen. Die Konsequenz daraus ist, dass in allen Phasen der Planung und Umsetzung der<br />
Geodatenpolitik auf die Auswirkungen von beabsichtigten Maßnahmen aus der Sicht aller<br />
(vier) Themenbereiche zu bedenken sind. Dies ist einer der Gründe einen Beirat für<br />
Geoinformation einzurichten, in dem alle Stakeholder der Geodatenpolitik vertreten sind.<br />
3 geo-Government innerhalb der öffentlichen Verwaltung<br />
Der Umgang mit Geoinformation im öffentlichen Bereich stellt sich in verschiedenen Ausprägungen<br />
dar und wird im Folgenden kurz umrissen.<br />
e-Government
54<br />
R. Gissing<br />
3.1 Optimierung von Verwaltungsverfahren<br />
geo-Government beginnt bei der Verbesserung von Verwaltungsverfahren in einzelnen<br />
Dienststellen durch den Einsatz von Geoinformation. Da aber Verwaltungsverfahren grundsätzlich<br />
nicht als Selbstzweck betrieben werden, bestehen in den meisten Fällen daran<br />
anknüpfende andere Verfahren und Schnittstellen, sodass bereits bei der Prozessgestaltung<br />
darauf Rücksicht genommen werden muss. Am Häufigsten wird es im Zusammenhang mit<br />
geo-Government um die Neugestaltung von Abläufen im Zusammenwirken mehrerer<br />
Dienststellen – oft auch über Gebietskörperschaftsebenen hinaus – gehen. Die Herausforderung<br />
zur optimalen Nutzung von Geoinformation bietet dabei die Chance, eingefahrene<br />
und aufwendige Verwaltungsverfahren völlig neu zu definieren und damit wesentlich effizienter<br />
zu machen. Besonders in der grundsätzlichen Auseinandersetzung mit den in Rede<br />
stehenden Verfahren liegt der Vorteil, diese bezüglich ihrer Zielsetzungen und Sinnhaftigkeit<br />
zu untersuchen und gegebenenfalls zu revidieren oder im Extremfall zu eliminieren.<br />
Umgekehrt ist damit zu rechnen, dass zahlreiche zusätzliche Vorteile (z. B. verbesserte Informationsausbeute,<br />
neue Servicemöglichkeiten) entdeckt werden und ohne großen Mehraufwand<br />
lukriert werden können.<br />
3.2 Bereitstellung und Nutzung von Geodaten<br />
Da der Raumbezug von vielen Verwaltungseinrichtungen unabhängig von deren fachlichen<br />
Zuständigkeit in vergleichbarer Form benötigt wird, bestehen hohe Rationalisierungsmöglichkeiten<br />
bei der Bereitstellung derartiger Geoinformation. Ähnlich ist die Situation bei der<br />
Entwicklung von Anwendungsprogrammen für die bedarfsgerechte Nutzung (z. B.<br />
Analysen, Visualisierung) von Geodaten. Auch hier können Kosten dadurch eingespart<br />
werden, indem gleichartige oder vergleichbare Verwaltungsverfahren auch in einheitlichen<br />
Abläufen und GI-Applikationen abgebildet werden. Derzeit existieren beispielsweise auf<br />
kommunaler Ebene eine Fülle unterschie<strong>dl</strong>icher geographischer Informationssysteme mit<br />
individuellen Anwendungsprogrammen, obwohl der Bedarf in vielen Fällen doch eher<br />
gleichartig sein sollte. Abgesehen von den erhöhten Gesamtkosten durch Mehrfachentwicklungen<br />
entstehen dadurch Datenbestände, die nicht oder nur mit zusätzlichem Aufwand<br />
miteinander verknüpft werden können.<br />
3.3 Application Service Providing<br />
Sowohl für die Bereitstellung als auch für die Anwendung von öffentlichen Geodaten bietet<br />
sich das Prinzip der verteilten Datenführung als das effizienteste und effektivste an. Daten<br />
werden jeweils von der Stelle erhoben und in voller Verantwortung geführt, die dazu sowohl<br />
die sachliche und regionale Zuständigkeit als auch die notwendige Kompetenz besitzt<br />
(In Zweifelsfällen ist eine dementsprechende Bereinigung herbeizuführen). Unabhängig von<br />
der Frage der Zuständigkeit und des Ortes der Bearbeitung ist die Frage der physischen<br />
Datenspeicherung zu betrachten – hier sind technisch optimale Lösungen gefordert. Alle<br />
anderen Verwaltungseinrichtungen sind berechtigt (bzw. im Sinne einer wirtschaftlichen<br />
Vorgehensweise verpflichtet), die bereitgestellten Daten und Informationen im Rahmen<br />
ihrer Aufgabenerfüllung zu nutzen.
geo-Government als Teil der österreichischen Geodatenpolitik 55<br />
Dabei sind vorrangig Systeme zu nutzen, bei denen die Anwender auf zentral verfügbare<br />
Applikationen zugreifen und somit auf lokale (Eigen-) Entwicklungen verzichten können.<br />
Die Realisierung dieses Application Service Providing (ASP)-Modells auf breiter Basis<br />
könnte also die Datenmengen durch Vermeidung von redundanten Datenbanken sowie die<br />
Gesamtaufwendungen in der öffentlichen Verwaltung für die Beschaffung von Anwendungssoftware<br />
minimieren.<br />
Einen Vorteil stellt auch – speziell im engeren Sinn des geo-Government – die durch die<br />
Vermeidung von Parallelsystemen leichter erzielbare Authentizität der verwendeten Geodaten<br />
dar. Die zugreifende Dienststelle oder der einzelne Anwender wird sich darauf verlassen<br />
können, verlässliche und aktuelle Informationen zu erhalten. Weiterhin kann die zentrale<br />
Verfügbarkeit von GI-Applikationen zur Einsparung von teurem IT- und Geoinformatikpersonal<br />
bzw. deren Einsatz für die eigentlichen Fachaufgaben führen.<br />
3.4 Staatliches Krisen- und Katastrophenmanagement<br />
Nicht zuletzt auf Grund der jüngsten Elementarereignisse werden sowohl der Vorsorge als<br />
auch den Maßnahmen in Katastrophen- und Krisenfällen verstärkte Aufmerksamkeit gewidmet.<br />
Besonders auf diesem Gebiet sind raumbezogene Informationen von höchster Bedeutung.<br />
Geodaten werden beim Aufbau eines umfassenden Emergency Service Systems zur<br />
Identifizierung von potenziellen Gefahren und zur vorsorglichen Erstellung von Maßnahmenkatalogen<br />
ebenso benötigt wie im unmittelbaren Einsatz im Katastrophenfall. Um den<br />
dabei gestellten Anforderungen gerecht zu werden, sind die in den vorherigen Punkten genannten<br />
Grundsätze einzuhalten. In Kombination mit geeigneten Ablauforganisationen kann<br />
dadurch die geforderte „on-demand“-Verfügbarkeit von Geodaten und Informationsdiensten<br />
gewährleistet werden.<br />
4 geo-Government für Bürger und Kunden<br />
Viele der Vorteile, die durch geo-Government innerhalb der Verwaltungseinrichtungen erzielt<br />
werden können (siehe oben), kommen auch den Bürgern und Kunden zugute. Entsprechend<br />
dem allgemeinen e-Government-Ansatz stehen erhöhte Bürgernähe, verbesserte Serviceeinrichtungen<br />
und hohe Verfügbarkeit der elektronischen Kommunikation im Vordergrund.<br />
Für den „Geo-Bereich“ bedeutet dies die Integration von relevanten Geodaten in<br />
Behördenverfahren und Bürgerinformationen. Dass dieser Teil des Leistungsangebotes<br />
höheren Aufwand verursachen wird, hängt mit der dazu notwendigen teureren technischen<br />
Infrastruktur und den relativ großen Datenmengen zusammen. Ziel muss es auch für das<br />
„geo“ im e-Government sein, dass die Kommunikation zwischen Behörde und Bürger ohne<br />
Medienbrüche, d. h. auf rein elektronischem Weg erfolgen kann. Denn ohne entsprechenden<br />
Komfort der angebotenen Lösungen wird deren Akzeptanz nicht ausreichen, um geo-<br />
Government beim Bürger zum Durchbruch zu verhelfen.<br />
Die Möglichkeit, räumliche Zusammenhänge durch elektronische Einsichtnahme – zu jeder<br />
Tages- und Nachtzeit und bequem am Arbeitsplatz oder zu Hause – in öffentliche Pläne und<br />
Unterlagen zu erkennen, ist eine wesentliche Voraussetzung für eine stärkere Integration der<br />
Menschen z. B. in Bürgerbeteiligungsverfahren. Die verstärkte Mitsprache und Mitwirkung
56<br />
R. Gissing<br />
bei Fragestellungen im allgemeinen Interesse wie etwa Flächenwidmungen oder Bauvorhaben<br />
im Planungsstadium kann im Sinne von e-Democracy damit gefördert werden. Außer<br />
den unmittelbar verwaltungsbezogenen elektronischen Dienstleistungen sind für den Bürger<br />
und Privatkunden auch allgemeine Informationen und Services von Interesse, die im Rahmen<br />
des geo-Government angeboten werden. Als Beispiel dafür möge die interaktive Darbietung<br />
der staatlichen Landkarten über Internet durch das BEV dienen (www. austrianmap.<br />
at).<br />
Neben der erhöhten Bürgerorientierung zielt geo-Government natürlich auf eine Reduktion<br />
der Verwaltungskosten durch die Entlastung der Dienststellen von Routinetätigkeiten im so<br />
genannten „Parteienverkehr“ ab. Die ortsunabhängige, weil elektronische Verfügbarkeit von<br />
öffentlichen Dienstleistungen wird außerdem generell eine Neubewertung von Behördenstandorten<br />
mit sich bringen (Stichwort: One Stop Shop-Services), sodass auch in diesem<br />
Zusammenhang Verwaltungsreform passieren wird. Angesichts der Tatsache, dass die intensivsten<br />
Kontakte zur Bevölkerung und die meisten Bürgerservices auf kommunaler Ebene<br />
erfolgen, ist dabei darauf zu achten, dass die Gemeinden in dieser Aufgabe unterstützt werden.<br />
Die elektronischen Dienste müssen dahin gehend genutzt werden, dass die Gemeinden<br />
in die Lage versetzt werden, einen möglichst hohen Anteil der Bürgeranliegen vor Ort zu<br />
befriedigen. Gemeinsam mit den Gemeinden optimierte Standardapplikationen wären daher<br />
zu entwickeln.<br />
Um möglichst viele Bürger zur Nutzung des geo-Government zu motivieren und damit die<br />
angesprochenen Synergien zu erzielen, werden die dafür zu entrichtenden Gebühren sehr<br />
niedrig gehalten werden müssen. Die Investitionskosten für „elektronisches Regieren“ sollten<br />
daher nicht auf die „Kundschaft“ überwälzt werden, die das System ja bereits durch<br />
Steuerleistungen finanziert hat. Vielmehr sollten dadurch künftig mögliche Verwaltungseinsparungen<br />
in Form von niedrigeren Gebühren weiter gegeben werden.<br />
5 geo-Government für die Wirtschaft<br />
Elektronische Kommunikation und Dienstleistungen der öffentlichen Verwaltung werden<br />
auch im Bereich der Geoinformation für die privatwirtschaftlich orientierten Unternehmen<br />
Vorteile bringen. Neben der damit verbundenen allgemeinen Aufwertung des Wirtschaftsstandortes<br />
Österreich werden wesentlich raschere Verfahrensabwicklungen und damit erhöhte<br />
Flexibilität für die Unternehmen erwartet. Die Verfügbarkeit von raumbezogenen<br />
Grun<strong>dl</strong>ageninformationen kann beispielsweise bei der Auswahl von Firmenstandorten unterstützen,<br />
die elektronische Abwicklung der erforderlichen Genehmigungsverfahren eine<br />
rasche Aufnahme der Geschäftstätigkeit ermöglichen.<br />
Im Zusammenhang mit der Einführung von geo-Government und in weiterer Folge mit dem<br />
Betrieb der dafür erforderlichen Infrastruktur entsteht für die in diesen Branchen tätigen<br />
Unternehmen ein weites, langfristig wachsendes Betätigungsfeld. Dieses umschließt neben<br />
IT-Komponenten und -Dienstleistungen vor allem Aufträge zur Beschaffung und Verarbeitung<br />
von Geodaten, zur Entwicklung von Applikationen sowie den Betrieb intelligenter Providinglösungen.<br />
In diesem Zusammenhang erscheinen auch auf den jeweiligen Zweck angepasste<br />
Public-Private-Partnership-Modelle sinnvoll.
geo-Government als Teil der österreichischen Geodatenpolitik 57<br />
Die oben angesprochene Neugestaltung von verwaltungsinternen Abläufen im Zusammenhang<br />
mit Beschaffung, Verarbeitung und Bereitstellung von Geodaten und Geo-Anwendungen<br />
im Sinne der Prozessoptimierung hat u.a. zum Ziel, Mehrfachvergaben nahezu identer<br />
Dienstleistungen durch verschiedene Gebietskörperschaften zu vermeiden. Dass dies nicht<br />
unbedingt Begeisterung bei den betroffenen Anbietern hervorruft, ist verstän<strong>dl</strong>ich. Andererseits<br />
ist es aus volkswirtschaftlichen Überlegungen nicht vertretbar, öffentliche Mittel unkoordiniert<br />
einzusetzen. Es geht dabei in erster Linie nicht darum, weniger Budgetmittel zu<br />
verwenden, sondern um deren zielgerichteten Einsatz. Bedarfsorientierte Qualität und auf<br />
zukünftige Anforderungen ausgerichtete Innovationsleistungen sind dabei die Schlagworte<br />
für Verwaltung und Wirtschaft!<br />
Mit der Realisierung von geo-Government stehen öffentliche Geodaten und Geoinformationen<br />
auch für die Unternehmen zur Verfügung. Einfacher und transparenter Zugriff, hohe<br />
Verfügbarkeit, gesicherte Qualität und Aktualität der Datenbestände werden deren wirtschaftliche<br />
Nutzung entscheidend verstärken. Dies sowohl für die ausschließlich interne<br />
Nutzung z. B. im Rahmen von Geomarketing oder Logistikunterstützung als auch für die<br />
Herstellung von added value-Produkten und Dienstleistungen. Unabdingbare Voraussetzung<br />
dafür ist eine Abkehr von den bisherigen uneinheitlichen und durchwegs zu hoch angesetzten<br />
Preisen und komplizierten Lizenzregelungen für öffentliche Geodaten. Erst die Festsetzung<br />
marktfördernder Preise und die Schaffung kundenfreun<strong>dl</strong>icher Nutzungsbedingungen<br />
ermöglicht die Erschließung des Wertschöpfungspotenzials der Datenbestände. Einen nicht<br />
unwesentlichen Aspekt stellt dabei die Sicherstellung der kontinuierlichen und langfristigen<br />
Datenbereitstellung zum Schutz der Investitionen der Unternehmen dar.<br />
Die Nutzbarmachung öffentlicher Daten zu deren wirtschaftlicher Verwertung ist im Übrigen<br />
eine Forderung der EU, die in Form der PSI- (Public Sector Information) Direktive ab<br />
dem Jahr 2005 in nationales Recht übergeführt werden wird.<br />
6 Voraussetzungen für erfolgreiches geo-Government<br />
Die verantwortungsbewusste Umsetzung von geo-Government bietet zweifellos ein enormes<br />
Einsparungspotenzial an öffentlichen Mitteln sowie die Chance zu Verfahrensbeschleunigung,<br />
benutzerfreun<strong>dl</strong>ichen Serviceleistungen für die Bürger und zur Förderung der (Geoinformations-)<br />
Wirtschaft. Da zwischen den drei angesprochenen Interessengruppen –<br />
Wirtschaft, Bürger und Verwaltung – keine grundsätzliche Wettbewerbssituation besteht,<br />
sollte es gelingen, die Ziele von geo-Government zu erreichen. Die sich daraus entwickelnde<br />
„geo-Government Community“ würde sowohl für jede einzelnen Gruppe von großem<br />
Vorteil sein, als auch insgesamt zu volkswirtschaftlichem Nutzen führen (Abbildung 2).
58<br />
öffentliche<br />
Verwaltung<br />
R. Gissing<br />
Volkswirtschaftlicher Erfolg: geo-Government Community<br />
Effizienzsteigerung<br />
Kostensenkung<br />
Optimales<br />
Bürgerservice<br />
Bürger und<br />
Kunden<br />
Erhöhte<br />
Wirtschaftsleistung<br />
Privatwirtschaft<br />
Abb. 2: Anzustrebende Synergien durch Zusammenwirken aller Interessensgruppen bei<br />
der Umsetzung der Ziele von geo-Government<br />
Voraussetzungen dafür sind die ernsthafte Analyse bzw. Hinterfragung der bestehenden<br />
Verfahren und Abläufe, die Bereitschaft zu notwendigen Veränderungen sowie erforderlichenfalls<br />
der Verzicht auf bestehende Insellösungen. Ein Beispiel dafür sind die (geocodierten)<br />
Adressen, die nahezu von allen Gebietskörperschaften benötigt werden. Die<br />
Schwächen der bisherigen Vorgangsweisen – Adressen werden von verschiedenen Verwaltungen<br />
für die jeweils eigenen Zwecke erhoben und geführt – sind hinlänglich bekannt,<br />
ebenso die damit verbundenen hohen, vermeidbaren Kosten bei Führung und Nutzung. Eine<br />
zentrale Datenbank, dezentral von den dafür zuständigen Gemeinden online aktuell geführt,<br />
online mit anderen Datenregistern automatisch abgeglichen und online für alle autorisierten<br />
Anwender nutzbar, würde sich rasch amortisieren.<br />
Ein weiteres Kriterium für die Realisierung von geo-Government stellen die Preise, Gebühren<br />
und Nutzungskonditionen von öffentlichen Geodaten und Geoinformationsdiensten dar.<br />
Diese dürfen weder in der Verwaltung noch bei Bürgern und Unternehmen die Nutzung der<br />
Geodaten erschweren oder gar verhindern. Dazu gehört die Erkenntnis, dass die Aufwendungen<br />
für die Bereitstellung der öffentlichen Geodaten als staatliche Infrastruktur im Allgemeinen<br />
nicht auf dem Weg über Datenverkäufe oder Lizenzgebühren refinanziert werden<br />
können. Der volkswirtschaftliche Gesamtnutzen entsteht erst mittelbar durch höhere Wertschöpfung<br />
aus den Geodaten durch die Wirtschaft und damit höherem Steueraufkommen<br />
sowie durch effizientere Verwaltungsprozesse und optimiertes Bürgerservice. Hier ist noch<br />
viel an Überzeugungsarbeit, speziell dort zu leisten, wo unter dem Titel „Kostenwahrheit“<br />
die vollständige Abdeckung der jeweiligen öffentlichen Aufwendungen angestrebt wird.<br />
Weiterhin wird im Bestreben, über entgeltliche Dienstleistungen zusätzliche Finanzmittel<br />
einzunehmen, oft übersehen, dass die eigene Gebietskörperschaft nicht nur Dienstleistungen<br />
erbringt, sondern auch Empfängerin umfangreicher öffentlicher Leistungen ist.<br />
Innerhalb aller Dienststellen der öffentlichen Verwaltung wäre es angebracht, Geodaten und<br />
GI-Applikationen kostenlos bzw. gegen Erstattung der Distributionskosten zur Verfügung<br />
zu stellen. Nur durch eine derartige freie Verfügbarkeit von Daten und Diensten kann dem<br />
derzeit bestehenden Bestreben, alle Daten selbst vor Ort im Zugriff zu haben, begegnet und<br />
damit der Betrieb von Parallelsystemen verhindert werden. Dennoch sind im Sinne einer<br />
effizienten und zweckmäßigen Verwaltung die erbrachten Leistungen bzw. Inanspruch-
geo-Government als Teil der österreichischen Geodatenpolitik 59<br />
nahmen im Rahmen der Kosten-/Leistungsrechnung zu dokumentieren und als Basis für ein<br />
durchgreifendes Controlling zu verwenden. Damit können auch nicht gerechtfertigte Datentransfers<br />
und Dienstleistungen („willkürliche Inanspruchnahme“) vermieden werden.<br />
Eine der wesentlichsten Voraussetzungen für funktionierendes geo-Government ist die<br />
Bereitstellung der dafür notwendigen technischen Infrastruktureinrichtungen. Dies umfasst<br />
u.a. die Einrichtung von Datenbanken für die redundanzfreie Führung von Geobasisdaten in<br />
homogenen und kompatiblen Strukturen. Nur auf Grun<strong>dl</strong>age derart konsistenter Datenbestände<br />
sind die angesprochenen Zielsetzungen und Synergien realisierbar.<br />
7 Ausblick<br />
Die Integration von Geoinformation in die Welt des e-Government wird bei den Dienststellen<br />
der öffentlichen Verwaltung, die zur Erfüllung ihrer Aufgaben Geodaten benötigen,<br />
mittelfristig ein Umdenken zur Folge haben. Statt der wie bisher möglichst umfassenden<br />
Verwaltung von (voraussichtlich) benötigten Geodaten in eigenen IT-Systemen und der<br />
Entwicklung von individuellen Anwendungsprogrammen für den unmittelbaren Eigenbedarf<br />
werden vernetzte Datenbestände, gemeinsam genutzte und betriebene Applikationen treten.<br />
Komplexe Auswertungen von Geodaten werden zunehmend wirtschaftlicher durch Inanspruchnahme<br />
von Geoinformationsdiensten anderer Dienststellen oder privater Unternehmen<br />
erhalten. Viele bisher selbst erstellte oder in Auftrag gegebene Geodaten sind entweder<br />
unmittelbar verfügbar oder können kostengünstiger durch Kooperation mit anderen Bedarfsträgern<br />
erhalten werden. GIS-Funktionalitäten werden dermaßen in Verwaltungsverfahren<br />
integriert werden, dass der/die Bearbeiter/in keinerlei spezielles Wissen mehr<br />
dafür benötigt. Aufwendungen für IT- und GI-Fachpersonal sowie Hard- und Softwarekomponenten<br />
werden daher in vielen Fällen reduziert und für die Erfüllung der eigentlichen<br />
Fachaufgabe eingesetzt werden können. Es wird zweifellos eine Herausforderung sein, die<br />
sich dadurch ergebenden Einsparungspotenziale auch wirklich zu lukrieren.<br />
Themen des e-Government wie z. B. Einführung des elektronischen Aktes, die sichere<br />
Identifizierung und Authentifizierung von Personen, Dokumenten und Diensten, die<br />
gesetzeskonforme elektronische Zustellung von Bescheiden oder die Sicherstellung des<br />
Datenschutzes werden künftig auch im Geodatenbereich an Bedeutung gewinnen. Es ist<br />
aber anzunehmen, dass viele dieser Herausforderungen bereits im Zusammenhang mit nichtraumbezogenen<br />
Daten gelöst werden. Umgekehrt wird den Entwicklern von e-Government-<br />
Lösungen bewusst werden, dass in vielen Fällen durchgängig elektronische Verfahren nur<br />
durch Integration von Geoinformation realisiert werden können.<br />
Das BEV ist derzeit dabei, die infrastrukturellen Voraussetzungen zu schaffen, um die Anforderungen<br />
als der größte österreichische Geobasisdaten-Lieferant zu erfüllen. Die eingangs<br />
erwähnte Einrichtung einer Koordinierungsstelle für Geoinformation auf Bundesebene<br />
sowie eines Beirates zur Einbeziehung aller Stakeholder der Geoinformationslandschaft<br />
in Österreich bietet in Verbindung mit der eindeutigen politischen Willenserklärung<br />
der Länder zu einer gesamtösterreichischen Geodatenpolitik eine vielversprechende Basis<br />
zur Realisierung der darin formulierten Ziele. Eines dieser Ziele heißt geo-Government!
60<br />
Literatur<br />
R. Gissing<br />
BARR, R. (2002): When more is less. GEO:connexion, issue 7/2002, 32<br />
BUNDESKANZLERAMT (2003): e-Government in Österreich. Informationsbroschüre für<br />
Wirtschaft und Verwaltung<br />
EUROPÄISCHE KOMMISSION (2001): Schaffung europäischer Rahmenbedingungen für die<br />
Nutzung der Informationen des öffentlichen Sektors. EC-Mitteilung<br />
GISSING, R. (2001): Definierte Geodatenpolitik – eine volkswirtschaftliche Notwendigkeit.<br />
Österreichische Zeitschrift für Vermessung & Geoinformation, 4/2001<br />
IMAGI (2000): Konzeption eines effizienten Geodatenmanagements des Bundes. Interministerieller<br />
Ausschuss für Geoinformationswesen (IMAGI) der Bundesrepublik<br />
Deutschland<br />
IMAGI (2003): Geoinformation und moderner Staat. Informationsschrift, herausgegeben<br />
vom Bundesamt für Kartographie und Geodäsie<br />
KOGIS (2003): Umsetzungskonzept zur Strategie für Geoinformation beim Bund.<br />
Herausgegeben von der Geschäftsstelle Koordination GI+GIS (KOGIS)<br />
KOGIS (2001): Verschiedene Rollen der Geoinformation in der Informationsgesellschaft.<br />
Publikation von KOGIS, der Koordination der Geoinformation und geographischen<br />
Informationssysteme, Schweizer Bundesamt für Landestopographie<br />
PIRA INTERNATIONAL LTD. (2000): Commercial exploitation of Europe‘s public sector<br />
information. EC-Paper<br />
ROPER, CH. (2002): Public sector information: resource or commodity ?. GEO:connexion,<br />
Issues 2-6/2002<br />
STAHL, R. (2003): Frischer Wind in den Amtsstuben – E-Government und Geo-<br />
Dienstleistungen als Motor der Reformpolitik. GeoBIT, 5/2003, 10-13<br />
USGS (2001): The National Map. Draft of the U.S.Geological Survey<br />
VOGEL, F.M. (2002): Geodateninfrastruktur in Deutschland – Positionspapier der AdV.<br />
Zeitschrift für Vermessungswesen, 2/2002, 90-96
Einleitung<br />
GeoKatalog – Metadatenverwaltung in den GIS<br />
der österreichischen Bundesländer<br />
Johannes KANONIER und Paul SCHREILECHNER<br />
Vor rund 15 Jahren wurde in den Landesverwaltungen der österreichischen Bundesländer<br />
mit dem Aufbau von GIS begonnen. Der Vielzahl der unterschie<strong>dl</strong>ichen Aufgaben und<br />
Fachbereichen entsprechend decken die Länder-GIS eine breite Themenvielfalt ab und<br />
halten zahlreiche und umfangreiche Datensätze vor. Dabei nehmen sie über die eigentliche<br />
Landesverwaltung hinaus eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Führung von Geodateninfrastrukturen<br />
ein, wie etwa in der Zusammenarbeit mit den kommunalen Verwaltungen<br />
oder mit den unterschie<strong>dl</strong>ichen Institutionen der Bundesverwaltung.<br />
Die Notwendigkeit der Daten-Dokumentation war damit mehrfach und bereits frühzeitig<br />
gegeben. So wurden in fast allen Bundesländern, zum Teil von Anbeginn an, Metadaten mit<br />
unterschie<strong>dl</strong>ichen technischen Werkzeugen geführt. In Vorarlberg wurde zum Beispiel seit<br />
ca. 1995 eine einfache Lösung auf Basis MS Excel und Hypertext-Dokumenten eingesetzt.<br />
Die dynamische Entwicklung der Systeme und die zunehmende Außenwirksamkeit der<br />
Länder-GIS brachten auch Anforderungen an die Metadatenverwaltung mit sich, denen mit<br />
den vorhandenen Werkzeugen nicht oder nur unzureichend entsprochen werden konnte:<br />
• Bestmögliche Unterstützung bei Erfassung/Aktualisierung<br />
• Einbettung in bestehende Systeme/Strukturen<br />
• Effiziente Such- und Abfragemöglichkeiten<br />
• Skalierbare, benutzerorientierte Darstellung der Metainformationen<br />
Die hier vorgestellte Lösung wurde mit dem Anspruch entwickelt die genannten Forderungen<br />
weitestgehend zu erfüllen. Ausgangspunkt war ein Projekt, das in Kooperation des<br />
Landes Niederösterreich mit der Fa. BioGIS Consulting 1997 realisiert wurde. Die Metadaten<br />
wurden mit Hilfe einer ArcView3.x-Erweiterung erfasst und in einer MS-Access<br />
Datenbank verwaltet. 1999 wurde die Lösung mit ASP-Seiten ergänzt, die zum ersten Mal<br />
die Veröffentlichung über das Web ermöglichten. Zur gleichen Zeit begannen sich andere<br />
Bundesländer für das Projekt zu interessieren und beteiligten sich von nun an der<br />
Entwicklung. Zunächst wurde 2000 die Datenbank auf Oracle und MS-SQLServer portiert.<br />
Mit der Entwicklung des Metadatenservers für ArcGIS 8.x wurde 2001 die gesamte<br />
Applikation auf den aktuellsten technischen Stand gebracht.<br />
Die nachfolgend im Detail beschriebene Metadatenapplikation ist heute in den GIS der<br />
Landesverwaltungen von Niederösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg und im<br />
Einsatz.
62<br />
J. Kanonier und P. Schreilechner<br />
1 Komponenten und Funktionsweise<br />
1.1 Zentrale versus dezentrale Metadatenhaltung<br />
Für die Verwaltung von Metadaten gibt es zwei grundsätzlich unterschie<strong>dl</strong>iche Zugangsweisen:<br />
Einerseits die Datenhaltung in Form von zentralen Katalogen, andererseits die dezentrale<br />
Speicherung der Metadaten direkt bei den Primärdaten. In ArcGIS erfolgt die Metadatenverwaltung<br />
über XML-Dateien, die zu jedem Geodatenbestand abgespeichert werden. Dies<br />
entspricht dem Prinzip der dezentralen Metadatenverwaltung. Um zusätzlich eine zentrale<br />
Sicht auf die Metadaten zu ermöglichen wurde in Geokatalog eine hybride Lösung<br />
implementiert.<br />
Als zentrale Komponente zur Erfassung von Metadaten wurde ein eigener Metadateneditor<br />
für ArcGIS entwickelt. Dieser nutzt die ArcObjects-Funktionen zur automatischen<br />
Ableitung von immanenten Metadaten sowie deren Speicherung in XML-Strukturen.<br />
Darüber hinaus legt er sämtliche Metadatenattribute in einer SQL-Datenbank, die als<br />
zusätzliche Komponente entwickelt wurde, ab. Somit ist sowohl die dezentrale als auch die<br />
für eine Einbindung dieser Daten in den Gesamt-Workflow einer Organisation notwendige<br />
zentrale Haltung der Metainformationen gewährleistet.<br />
Im Einzelnen setzt sich GeoKatalog aus folgenden Komponenten zusammen: Einem<br />
Metadateneditor für ArcGIS 8.x, einer SQL-Datenbank sowie ASP-Seiten zur gezielten<br />
Suche und Anzeige von Metadatendetails.<br />
Abb. 1: Zusammensetzung eines GeoKatalogs
GeoKatalog – Metadatenverwaltung in den GIS der österreichischen Bundesländer 63<br />
1.1.3 Metadateneditor für ArcGIS inkl. Stylesheet<br />
ArcGIS bietet die Möglichkeit eigene Metadateneditoren einzubinden. Diese können auf die<br />
Funktionalität der ArcObjects zugreifen und um eigene Funktionen erweitert werden:<br />
Abb. 2: Biogis GeoKatalog Metadateneditor<br />
Verwaltung von Teildatenbeständen<br />
Um die Metadatenerfassung zu vereinfachen wurde ein spezielles Konzept für Datenbestände<br />
integriert, die in Form von Teildatensätzen verwaltet werden, z. B. Orthophotos,<br />
digitale Katastralmappe, Biotopkartierungen usw. Hier wird zuerst der Hauptdatenbestand<br />
dokumentiert und dann die Teildatensätze hinzugefügt. Dabei wird für jeden Teildatensatz<br />
eine eigene XML-Datei angelegt und die bereits dokumentierten Informationen aus dem<br />
Hauptdatensatz übernommen.<br />
Referenz zu externen Dokumenten<br />
Für jeden Datensatz können Pfade als Referenz zu externen Dokumenten gespeichert werden.<br />
Diese können mit der jeweiligen Standardapplikation geöffnet werden.<br />
Automatische Ableitung von Attributen und deren Ausprägungen<br />
Zusätzlich zu der in ArcObjects vorgesehenen Speicherung von Attributinformationen können<br />
deren Ausprägungen (Nominalwerte oder Maximum-Minimumwerte) automatisch<br />
abgeleitet werden.
64<br />
J. Kanonier und P. Schreilechner<br />
1.1.2 SQL-Datenbank (MS SQL-Server oder Oracle)<br />
Die Speicherung der Metadaten in einer SQL-Datenbank bietet folgende Vorteile:<br />
• Effektive Erfassung der Metadaten durch Einbindung bestehender Datenbanken, z. B.<br />
Adressdatenbanken.<br />
• Integration in bestehende Datenmodelle für eGovernment-Lösungen oder Bestellsysteme<br />
Zur Administration und Wartung der SQL-Datenbank wurde eine eigen Benutzeroberfläche<br />
in MS-Access integriert. Diese Ermöglicht beispielsweise die Erfassung von Vorgabewerten<br />
für Auswahllisten, das Löschen von Datensätzen oder die Einbindung von Adressdaten.<br />
1.1.3 ASP-Seiten für Abfragen über Web-Browser<br />
Abb. 3: Abfrage über Web-Browser<br />
Zur gezielten Suche innerhalb der Metadaten über Standardwebbrowser wurde ein Benutzerinterface<br />
auf Basis von Active Server Pages entwickelt. Dies umfasst folgende Funktionalität:
GeoKatalog – Metadatenverwaltung in den GIS der österreichischen Bundesländer 65<br />
• Suche nach Geodatensätzen über Stichwort oder Thema<br />
• Anzeige des Suchergebnisses als Liste<br />
• Anzeige von Metadatendetails zu jedem Geodatensatz<br />
• Individuelle Designanpassungen der ASP Seiten über Stylesheets<br />
2 GeoKatalog in der Praxis<br />
2.1 Datenerfassung und -aktualisierung<br />
Die Kombination von zentraler und dezentraler Haltung ermöglicht einen effizienten Workflow<br />
für die verteilte Erfassung und Aktualisierung der Metadaten durch die GIS-Sachbearbeiter<br />
in den Fachabteilungen bei Einhaltung von vorgegebenen Qualitätsstandards, die an<br />
zentraler Stelle überprüft werden. Im VoGIS (GIS der Vorarlberger Landesverwaltung)<br />
wird folgende Vorgehensweise angewendet:<br />
Bei der Neuerfassung/Aktualisierung eines Datensatzes werden Metadaten beim Datensatz<br />
im XML-File angelegt/aktualisiert. Dabei hat der zuständige Sachbearbeiter lesenden Zugriff<br />
auf die zentrale Metadatenbank und kann die vorhandenen organisationsinternen Informationen<br />
einbinden. Abschließend wird Datensatz vom GIS-Datenadministrator einer<br />
Qualitätskontrolle unterzogen und auf den zentralen GIS-Datenserver gestellt. Bei diesem<br />
Vorgang werden die Metadaten in der GeoKatalog-Datenbank eingetragen/aktualisiert.<br />
2.1.1 Datenerfassung und -aktualisierung<br />
Die Veröffentlichung der Metadaten im Web über ASP-Seiten erschließt mit geringem Aufwand<br />
einen breiten Interessentenkreis wobei durch einfache Anpassungen auf die Bedürfnisse<br />
der unterschie<strong>dl</strong>ichen Benutzergruppen – angefangen vom unbedarften Laien bis<br />
hin zum GIS-Experten – eingegangen werden kann und auch die Forderungen der Dateneigentümer<br />
berücksichtigt werden können. Da die Internet-Auftritte der Bundesländer in<br />
Content-Management-Systeme abgewickelt werden sind die gestalterischen Anforderungen<br />
an Webseiten sehr spezifisch und müssen auch für die GeoKatalog-Seiten berücksichtigt<br />
werden, wobei sich der Einsatz von Stylesheets besonders hier bewährt.<br />
3 Ausblick<br />
Zusammenfassend stellt die Applikation GeoKatalog ein effizientes Werkzeug für die<br />
Erfassung, Verwaltung und Publikation von GIS-Metadaten dar, das in einer beispielhaften<br />
Kooperation von mehreren Landesverwaltungen und der Fa. BioGIS Consulting entstanden<br />
ist und ständig weiter entwickelt wird. Folgende Schwerpunkte stehen für die Weiterentwicklung<br />
auf dem Programm:<br />
• Standardisierung: die nun gültige Norm ISO19115 soll in einem nächsten Schritt auch<br />
im GeoKatalog als Metadatenstandard implementiert werden.<br />
• Weiterentwicklung der Datenbank: die Datenbank wird kontinuierlich erweitert und an<br />
die jeweiligen Bedürfnisse der Verwaltungen angepasst.
66<br />
J. Kanonier und P. Schreilechner<br />
• Integration in Fachapplikationen: Die Einbindung der Metadatenverwaltung in verschiedenste<br />
Applikationen soll den Zugang zu und die Führung von Metatinformationen<br />
weiter erleichtern (z. B. Abfrage in Webapplikationen oder Update-Funktion<br />
für Fachapplikationen, in denen Daten erfasst und verändert werden).<br />
• Anbindung an nationale Geodateninfrastrukturen: durch die neue formulierte „österreichweite<br />
Geodatenpolitik“ werden in naher Zukunft nationale Geodateninfrastrukturen<br />
und Informationsverbünde entstehen in die lokale und regionale und<br />
landesweite Ressourcen über verschiedene Schnittstellen (Z39.50, HTTP/XML)<br />
einzubinden sind.<br />
Links<br />
Landesverwaltungen:<br />
http://www.vorarlberg.at/geokatalog_internet/index.htm<br />
http://www01.noel.gv.at/scripts/bd/bd5/noegis/geokatalog/suche.asp<br />
http://www.kagis.ktn.gv.at/kagis/<br />
http://www.salzburg.gv.at/sagis/<br />
Fa. BioGIS Consulting:<br />
http://www.biogis.at/
Verteilte Geo- und Planungsdienste für das Portal<br />
www.metropolregion.hamburg.de mit Hilfe der<br />
CoreMedia © Content Application Platform<br />
Zusammenfassung<br />
Kai-Uwe KRAUSE, Olaf BAUER und Niels HOFFMANN<br />
Aufgrund des räumlichen Bezugs vieler Portalinhalte stellt die Erweiterung von Internetportalen<br />
durch Geodatendienste einen entscheidenden Mehrwert dar. Durch eine geeignete<br />
Mid<strong>dl</strong>eware kann der notwendige Integrationsaufwand zwischen heterogenen GIS-<br />
Applikationen und Content Management System entscheidend reduziert werden. Ziel des<br />
hier vorgestellten Projektes ist die generische Verknüpfung zwischen verschiedenen GIS-<br />
Produkten und der Content Application Plattform der CoreMedia © AG, Hamburg, mittels<br />
des OpenSource-Produktes deegree als kaskadierendem Web Map Server.<br />
1 Einleitung<br />
Das Projekt „Internetportal für die Metropolregion Hamburg“ ist eine Projektkooperation<br />
zwischen dem Arbeitsbereich Softwaresysteme und dem Arbeitsbereich Stadt-, Regionalund<br />
Umweltplanung der Technischen Universität Hamburg-Harburg. Die Metropolregion<br />
Hamburg (MRH) setzt sich aus der Freien und Hansestadt Hamburg, den fünf schleswigholsteinischen<br />
Landkreisen, dem Wirtschaftsraum Brunsbüttel sowie acht niedersächsischen<br />
Landkreisen zusammen. Hauptaufgaben der MRH sind die Erarbeitung und Fortschreibung<br />
des „Regionalen Entwicklungskonzeptes“, die Definition von Han<strong>dl</strong>ungsfeldern, Festlegung<br />
von Leitprojekten, sowie die Entscheidung über Fördermaßnahmen im Rahmen bilateraler<br />
Förderfonds (Hamburg – Niedersachsen & Hamburg – Schleswig–Holstein). Die Portalkonzeption<br />
soll unter der Internetadresse „http://www.metropolregion.hamburg.de“ nach Abstimmung<br />
mit der Senats- bzw. den Staatskanzleien der beteiligten Bundesländer veröffentlicht<br />
werden. Ziel ist es, mit der Internetpräsenz ein Portal für die Metropolregion zu etablieren,<br />
in dem unterschie<strong>dl</strong>iche Lebenslagen Berücksichtigung finden und weiterführende<br />
Dienste verschiedener Akteure aus der Metropolregion nutzbar sind. Im Idealfall soll so ein<br />
Netzwerk entstehen, welches die verschiedenen administrativen Ebenen, Verbände und<br />
Institutionen sowie private Initiativen in der Region in einem „Dachportal“ zusammenfasst.<br />
Über die reine Informationsebene hinausgehend, soll die zu schaffende Infrastruktur die<br />
interkommunale Kooperation über die politischen und administrativen Grenzen hinaus<br />
fördern, das Regionalbewusstsein in der Metropolregion stärken, Zugang zu eGovernment<br />
Anwendungen bereitstellen und als globales Aushängeschild im Sinne einer repräsentativen<br />
Außendarstellung dienen.<br />
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei sowohl auf einer „Content Syndication“ unterschie<strong>dl</strong>icher<br />
räumlich abgegrenzter Portale: Kommune (Seevetal), Kreis (Harburg), Land<br />
(Hamburg, Schleswig-Holstein), Metropolregion Hamburg, Bund, Handelskammern der
68<br />
K.-U. Krause, O. Bauer und N. Hoffmann<br />
Region, als auch einer Integration, Kommunikation bzw. Visualisierung verteilter Geodatenbestände<br />
der Region auf der Basis offener Standards (OGC konform). Weiterhin arbeiten<br />
wir in dieser Konstellation in Kooperation mit der Kommune Seevetal an einem Modul<br />
„Bauleitplanung / Beteiligung“, welches nach erfolgreicher Bewährung, auch anderen<br />
Kommunen zur Verfügung gestellt werden soll und schrittweise zu einem Planungsserver<br />
ausgebaut werden soll.<br />
Das MRH-Portal soll aufgrund der bestehenden Infrastruktur bei den Firmen hamburg.de,<br />
schleswig-holstein.de und der Kommune Seevetal, welche mit ihrem Internetauftritt „rathaus-seevetal.de“<br />
als Pilotprojektpartner fungiert, mit dem Content Management System<br />
„Content Application Platform“ der Firma CoreMedia realisiert werden.<br />
2 eGovernment für die Metropolregion<br />
Um die Anforderungen an verstärkte Standortkonkurrenzen in einem globalen Wettbewerb<br />
besser bewältigen zu können, besteht eine Strategie von Städten und zunehmend auch Stadtregionen<br />
in der Etablierung interkommunaler Kooperationsformen (z. B. interkommunale<br />
Bauleitplanung) und Serviceangebote an Bürger, Gewerbetreibende (eGovernment – „one<br />
stop agency“) sowie an die Verwaltung („best practicies“-Börsen). Umfassende marktgerechte<br />
Informations-, Beratungs- und Serviceangebote der Kommunen werden zu einem<br />
Standortfaktor. Die Verwaltung definiert sich als Dienstleister für die Belange ihrer Klienten<br />
bzw. Kunden. Gleichzeitig ändern sich die Anforderungen von Bürgern und Wirtschaft<br />
an den Staat. Kommunen sollen in einem partnerschaftlichen Dialog Bürger sowie Unternehmen<br />
bei ihren Belangen unterstützen. Verwaltungsdienstleistungen sollen über verschiedene<br />
Informations- und Serviceknoten (z. B. Internet, Servicebüro oder Callcenter) 24<br />
Stunden ortsunabhängig angeboten werden. Die technische Vorraussetzung für diese Serviceleistungen<br />
ist jedoch ein Zugang bzw. die Möglichkeit einer Recherche in kommunalen<br />
Geschäftsprozessen. In diesem Zusammenhang entstehen gänzlich neue Anforderungen an<br />
das verwaltungsweite Informationsmanagement (Zugriff auf verschiedene Datenbestände,<br />
Benutzerrechte).<br />
Die Bereitstellung von Serviceangeboten darf sich dabei nicht mehr ausschließlich an den<br />
administratorisch definierten Gemeindegrenzen orientieren. Bei den Serviceangeboten kann<br />
man zwischen verschiedenen Integrationstiefen von eGovernment-Anwendungen unterscheiden.<br />
Anwendungen können von reinen Informationsangeboten über Interaktions-,<br />
Transaktions- bis zu Partizipationsverfahren reichen. Diese unterscheiden sich hinsichtlich<br />
der Tiefe ihrer Integration in kommunale Geschäftsprozesse. Die Serviceangebote unterscheiden<br />
sich ebenfalls in den Anforderungen an raumbezogene Dienste, welche von einfachen<br />
Auskunfts- und Mappingdiensten über Ad-hoc-Anfragen auf unterschie<strong>dl</strong>ichen Datenquellen<br />
bis hin zu rückkanalfähigen Internet-GIS-Anwendungen z. B. für „digitize on<br />
screen“ Anwendungen im Rahmen von Beteiligungsanwendungen (Bürgerbeteiligung bzw.<br />
Beteiligung der Träger öffentlicher Belange in Bauleitplanverfahren) reichen können.<br />
Um sich möglichst frühzeitig seitens der Verwaltung auf die Anforderungen von Bürgern<br />
bzw. Unternehmen einstellen bzw. auf diese reagieren zu können, bedarf es der Beobachtung<br />
der Beziehung zwischen den Partnern, analog den Funktionalitäten eines Constumer<br />
Relationship Management (CRM). CRM steht dabei als Synonym für die Fähigkeit einer
Verteilte Geo- und Planungsdienste für das Portal www.metropolregion.hamburg.de 69<br />
Organisationseinheit ihre Kundenbeziehungen nachhaltig zu gestalten und kontinuierlich<br />
entlang der tatsächlichen Bedürfnisse, Präferenzen der Kunden zu verbessern. Die Einführung<br />
nachfrage- bzw. kundenorientierter CRM Strategien ermöglicht es der Verwaltungsführung,<br />
ein ganzheitliches Bild ihrer Clienten zu erstellen. Dabei geht es nicht um die<br />
Durchleuchtung von Bürgern, Institutionen oder Unternehmen im Sinne von George Orwell,<br />
sondern um die Darbietung bedarfsorientierter Serviceleistungen.<br />
CRM Systeme in der Verwaltung sollten u.a. die Kommunikation zwischen den Partnern<br />
raumbezogen abbilden können. Dies bedeutet zum einen, dass Planungs-, Beratungs- und<br />
Kommunikationsprozesse mit unterschie<strong>dl</strong>ichen Sachbezügen einen eindeutigen Raumbezug<br />
bekommen. Zum anderen sollte es möglich sein, über den Raumbezug alle bisherigen<br />
Sachbezüge und Kommunikationsprozesse (Unternehmensentwicklung, Gewerbeflächenund<br />
Gewerbeimmobilienangebote, -gesuche, etc.) abzubilden.<br />
3 Geo- und Planungsdienste für die Metropolregion<br />
Der Zugang zu Wissen innerhalb einer Region, über eine Region und zu administrativen<br />
Verwaltungsprozessen muss über verschiedene Kanäle (Endgeräte: Browser, PDA, Papier…)<br />
und unterschie<strong>dl</strong>iche Portale im Netz (Contentsyndication) ermöglicht werden. Eine<br />
Lösung besteht nicht darin, eine einzige neue Adresse im WWW zu platzieren (z. B.<br />
www.wirtschaftsfoerderung-in-der-Metropolregion.de). Dieser Internetadresse wäre sicherlich<br />
kein Erfolg beschieden, da sie nicht in ein Gesamtkonzept für den Internetauftritt der<br />
Metropolregion eingebunden ist. Analog zu dem Konzept eines „one stop government“ gilt<br />
ebenso für kommunale / regionale Web-Angebote die Definition einer Einstiegsadresse im<br />
Internet über die man sämtliche Angebote zu einem geografischen Namensraum (z. B. der<br />
Name der Stadt oder Region) abrufen kann. Sollen Informationen im Netz zur Verfügung<br />
gestellt werden, die für mehrere Kommunen bzw. eine Region gelten, wäre es technologisch<br />
möglich, z. B. identische Informationen zu Gewerbeflächenstandorten in einem Portal der<br />
Metropolregion als auch unter einer kommunalen Internetadresse zu veröffentlichen. Die<br />
Metropolregion Hamburg bietet dafür eine gute technische Infrastruktur, da eine Vielzahl<br />
von Portalen (z. B. hamburg.de, schleswig-holstein.de sowie kommunale Webauftritte in<br />
der Region) über ein einheitliches Content Management System (CMS) auf der Basis der<br />
Software CoreMedia Content Application Platform (CAP) gepflegt werden. Content kann<br />
von einem Redakteur für unterschie<strong>dl</strong>iche Webauftritte zentral gepflegt und verteilt werden.<br />
Eine Kommune könnte sich bereit erklären, ebenfalls Gewerbeflächen benachbarten Gemeinden<br />
für eine Recherche zur Verfügung zu stellen.<br />
Der Content in einer Region wird von den verschiedenen Akteuren dezentral gepflegt. Um<br />
die Aktivitäten in einer Region möglichst breit zu dokumentieren, ist es notwendig, neben<br />
administrativen Informationen den Aktivitäten von Interessensvertretungen bzw. NGOs<br />
Raum für eine Selbstdarstellung zu geben. Diese Arbeitsgruppen verfügen über Wissen,<br />
jedoch teilweise über keine geeignete eigene technische Infrastruktur ihr Wissen intern zu<br />
kommunizieren bzw. extern zu veröffentlichen.
70<br />
Geodatendienste<br />
K.-U. Krause, O. Bauer und N. Hoffmann<br />
Gemeinde Seevetal Kreis Harburg<br />
WMS Dienste<br />
Replikation<br />
redaktioneller<br />
Prozess<br />
Rathaus Auftritt<br />
Marktplatz Auftritt<br />
Abb. 1: Diensteintegration für die Metropolregion<br />
Um diese Aufgabe erfolgreich bewältigen zu können, bedarf es der Etablierung einer Kommunikationsplattform<br />
für eine Vielzahl von regionalen Akteuren, die außer einem Netzanschluss<br />
keine weitere technische Basis benötigt. Das Ergebnis interner Kooperations- bzw.<br />
Abstimmungsprozesse ist gleichsam der „Content“, der die Wettbewerbsfähigkeit nach<br />
außen hin demonstriert. Als Beispiel dafür mögen Planungsprozesse dienen. Nicht erst seit<br />
der Erkenntnis, dass ein Großteil der Daten in kommunalen Zusammenhängen einen Raumbezug<br />
(Adresse, Koordinaten, Kleinräumige Gliederung, etc.) aufweisen, liegt es auf der<br />
Hand, dass georeferenzierten Informationen beim Aufbau von Portalen eine besondere<br />
Rolle zukommt. Auf der regionalen Ebene werden diese, gestützt auf Verwaltungsprozesse<br />
mit unterschie<strong>dl</strong>ichen administrativen Ebenen, verteilt aktuell gehalten. Es gilt, gemäß dem<br />
Lebenslagenmodell, die jeweils wichtigen raumbezogenen Daten zur Verfügung zu stellen.<br />
Die Anforderungen können dabei vom einheitlichen Zugang zu administrativen, rechtsverbin<strong>dl</strong>ichen<br />
Daten und Karten bis hin zu Freizeitkarten variieren.<br />
4 Dienstearchitektur<br />
Client / „hamburg.de“<br />
„Metropolregion“<br />
Metropolregion<br />
Gazetteer Dienst<br />
WMS Dienste<br />
Geodatendienste<br />
Replikation<br />
redaktioneller<br />
Prozess<br />
Replikation<br />
redaktioneller<br />
Prozess<br />
Kreishaus Auftritt<br />
Marktplatz Auftritt<br />
Schnittstelle<br />
bzw. Link<br />
Geodatendienste<br />
4.1 Verteilte Geodatenservices in der Metropolregion<br />
z. B. Leitprojekte (NGO)<br />
u.a.<br />
WMS Dienste<br />
Geodatendienste<br />
Die Konzeption von Geodatendiensten für die MRH muss von Beginn an auf Interoperabilität<br />
bzw. offenen Standards aufbauen, um eine Kommunikation über die Systemgrenzen<br />
WMS Dienste<br />
WMS Geodatendienste<br />
der Landesvermessungsämter
Verteilte Geo- und Planungsdienste für das Portal www.metropolregion.hamburg.de 71<br />
hinaus zu gewährleisten. Um eine breite Nutzung der Dienste sowie die Entwicklung von<br />
Mehrwertdiensten zu ermöglichen, ist es notwendig, die Daten unterschie<strong>dl</strong>ich aufzubereiten.<br />
Eine barrierefreie Grundversorgung von Geodatendiensten über zwei- und dreidimensionale<br />
Visualisierungen, welche keine Plug-Ins benötigen, ist eine Grundvorrausetzung. Als<br />
Grun<strong>dl</strong>age dafür können Dienste gemäß den OGC Standards: Web Map Service (WMS,<br />
2D) sowie Web Terrain Service (WTS, 3D) dienen. Trotzdem müssen erweiterte GIS<br />
Funktionalitäten (rückkanalfähig, z. B. „digitize on screen“) bzw. raumbezogene Auswertungen<br />
auf der Basis von Plug-Ins (z. B. Autodesk MapGuide) angeboten werden. Um Daten<br />
auch auf der Seite des Clients weiterbearbeiten zu können, ist es notwendig, die Daten in<br />
einem neutralen Dateiformat anzubieten. Als Dateiformat würden sich eventuell in Zukunft<br />
„GML3“ aus dem Bereich der Standardisierungsbemühungen im Bereich Geoinformatik<br />
bzw. „IFC“ aus denen im Bereich des Bauwesens anbieten. Die Daten sind so vorzuhalten,<br />
dass diese multimedial, eventuell von Mehrwertdienste-Anbietern, aufbereitet werden können.<br />
Dazu zählt z. B. die Möglichkeit, raumbezogene Daten in „Flash Animationen“ einzubinden,<br />
um neue Nutzerkreise (z. B. Jugen<strong>dl</strong>iche) zu erschließen. Eine weitere Anforderung<br />
eines barrierefreien Zugangs besteht in der Aufbereitung von Daten und Informationen für<br />
Behinderte. Dazu müssen diese je nach körperlicher Einschränkung in Bild, Ton oder als<br />
Papier (z. B. in Blindenschrift) unterschie<strong>dl</strong>ich medial aufbereitet werden.<br />
Die Datenbasis für die Entwicklung von Geodatendiensten sind unterschie<strong>dl</strong>iche Fachinformationssysteme.<br />
Zum einen die Geobasisdaten, die in Zukunft auf der Fachanwendung<br />
„Amtliches Liegenschaftskataster Informationssystem“ (ALKIS) basieren. Ende letzten<br />
Jahres haben die Unternehmen „ibR Ingenieurbüro Riemer – Gesellschaft für Geoinformation<br />
mbH“ und Intergraph eine gemeinsame ALKIS-Auschreibung der fünf Bundesländer<br />
Schleswig-Holstein, Hamburg. Niedersachsen, Rheinland-Pfalz sowie Baden-Württemberg<br />
gewonnen. Dies bedeutet, dass in Zukunft die Geobasisdaten für die MRH auf Basis einer<br />
einheitlichen Fachanwendung erhoben bzw. weitergeführt werden.<br />
Zum anderen werden Geobasisdaten der „Freien und Hansestadt Hamburg“ bereits aktuell<br />
im Intranet der Hansestadt und im Internet 1 als Fachanwendung „Geoinfo.online“ einer<br />
(Fach-) Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Zukünftig sollen Umweltdaten aus dem „Hamburger<br />
Umweltinformationssystem“ (HUIS) in Kartenform aufbereitet und als Fachanwendung<br />
„umweltinfo.online“ im Intranet der Hansestadt bzw. im Internet visualisiert werden.<br />
Der sü<strong>dl</strong>ich an Hamburg angrenzende Landkreises Harburg betreibt zur Zeit die Internet-<br />
GIS-Anwendung REGIS 2 .<br />
4.2 Verteilte Portalinfrastruktur<br />
Die Inhalte des MRH-Portals setzen sich zum einen Teil aus redaktionellen Inhalten der<br />
Metropolregion und zum anderen Teil aus Inhalten der regionalen Portale und Dienstanbieter<br />
zusammen. Es wird den Redakteuren der regionalen Portale möglich sein, für die von<br />
ihnen verfassten Inhalte festzulegen, ob die Inhalte auch auf den Webseiten der MRH publiziert<br />
werden sollen. Diese Inhalte werden zum MRH-Portal (halb-) automatisch repliziert.<br />
Für diese Replikation muss entsprechend das Datenformat und die Übertragungstechnik<br />
spezifiziert werden. Zusätzlich muss für verschiedene Anwendungsfälle festgelegt werden,<br />
1 http://www.geonord.de/geo/start.cfm<br />
2 http://www.lkharburg.de/Kreishaus/Verwaltung/regis/index.htm
72<br />
K.-U. Krause, O. Bauer und N. Hoffmann<br />
ob ein zusätzlicher redaktioneller Prozess stattfinden soll, oder die Begrenzung der Lebenszeit<br />
der replizierten Daten auf dem MRH-Portal automatisch definiert wird. Um Dienste von<br />
Drittanbietern integrieren zu können, müssen geeignete Schnittstellen zur Verfügung stehen,<br />
die eine Präsentation dieser auf dem MRH-Portal ermöglichen.<br />
WMS Client<br />
Metadatennaviagtion<br />
Open Source WTS<br />
WMS Client<br />
png, jpg GML<br />
Open Source WFS<br />
Open Source WMS<br />
z. B. deegree<br />
shp<br />
PostGIS<br />
png, jpg<br />
Ora 9i<br />
CoreMedia CAP<br />
Cascading WMS Service z. B. deegree<br />
ESRI ArcIMS 4.0<br />
ESRI ArcIMS 4.0 WMS<br />
Fachinformationssystem<br />
Abb. 2: Konzeption einer verteilen Geobasisinfrastruktur<br />
shp<br />
SDE<br />
Ora 9i<br />
REGIS<br />
UmweltInfo.online / HH<br />
Webserver<br />
generierte Website<br />
Edi-<br />
Konfiguration<br />
GIS-CMS Integrationswerkzeug<br />
Einbindung von Layer und Features in CMS<br />
Plugin Client ( Mulimedia: flash, svg..)<br />
Die in Kapitel 3.1 genannten Geodatendienste basieren auf unterschie<strong>dl</strong>ichen GIS-<br />
Produkten, was die Verknüpfung dem Content Management System des Portals erschwert.<br />
Im einzelnen wird bei Geoinfo.online die Internet GIS Anwendung „Autodesk MapGuide<br />
6“ und bei HUIS und REGIS „ESRI ArcIMS 4.0“ eingesetzt. Im Falle von ALKIS ergibt<br />
sich Aufgrund der gewonnen Ausschreibung die Möglichkeit, dass Produkte der Firma<br />
Intergraph (z. B. GeoMedia WebMap 5) zum Einsatz kommen. Das Autodesk-System hat<br />
den Vorteil, dass Bauleitpläne, die in der Hansestadt mit Hilfe der AutoCAD Map Applikation<br />
„WS Landcad“ erstellt werden, als DWG-Dateien verlustfrei im Netz visualisiert werden<br />
können. Diese können alternativ mit einem Plugin bzw. mit einer serverseitigen Aufbereitung<br />
als PNG-Dateien (MapGuide Lite View) im Netz dargestellt werden. Weiterhin<br />
stellt diese technische Lösung die Möglichkeit bereit, Geobasisdaten als DWG-Datei auf<br />
einen Client zu laden. Nach Angaben der Firma Autodesk soll „MapGuide Lite View 6.3“<br />
gemäß dem OGS Standard WMS konform sein.<br />
Um den Aufwand zur Integration dieser unterschie<strong>dl</strong>ichen Produkte in CoreMedia CAP zu<br />
reduzieren, bietet es sich an, eine geeignete Mid<strong>dl</strong>eware zu benutzen, welche die verschiedenen<br />
GIS-Systeme als einen einzelnen Geodatendienst erscheinen lässt. Um diese Mid<strong>dl</strong>eware<br />
möglichst investitionssicher zu machen, sollte sie, soweit möglich, konform zu den<br />
Standards des OpenGIS Konsortiums sein. Als solche Middelware bietet sich das Produkt<br />
Metadatennaviagtion<br />
Application<br />
GeoMedia WebMAP 5.0<br />
GeoMedia WebMAP 5.0<br />
WMS<br />
Ora 9i<br />
ALKIS<br />
HH / SH/ NS<br />
Plugin Client (GIS: „digitise on screen“)<br />
Metadatennaviagtion<br />
pdf, svg, flash<br />
oder z. B. shp<br />
Autodesk MapGuide 6.0<br />
Autodesk MapGuide Lite<br />
View 6.0 (WMS)<br />
shp<br />
dwg<br />
Ora 9i<br />
tif<br />
GeoInfo.online /HH<br />
dwg
Verteilte Geo- und Planungsdienste für das Portal www.metropolregion.hamburg.de 73<br />
deegree 3 an, welches initial von dem Geographischen Institut der Universität Bonn, Bereich<br />
GIS & Fernerkundung 4 und der Firma lat/lon 5 entwickelt wurde und jetzt als OpenSource-<br />
Projekt 6 der Allgemeinheit zur Verfügung steht. Deegree stellt sich als ein Framework dar,<br />
welches ermöglicht, Anwendungen mit georeferenzierten Inhalten zu erstellen und enthält<br />
zu Demonstrationszwecken auch Beispielimplementationen. Es ermöglicht die Entwicklung<br />
von Desktop-Lösungen ebenso wie von Infrastrukturen mit stark verteilten, dienstebasierten<br />
Komponenten, welche über wohldefinierte Schnittstellen im Sinne des OGC interagieren.<br />
Die derzeitige Version von deegree implementiert unter Anderem die OGC-Spezifikationen<br />
Web Map Service (WMS) 1.0.0 (und teilweise WMS 1.1.1), Web Feature Service 1.0.0 und<br />
Geography Markup Language (GML) 2.11. Mitgeliefert werden auch Klassen, die es ermöglichen,<br />
auf Geodaten in Form von ESRI-Shape-Dateien, GML-Dateien, Rasterdateien,<br />
OracleSpatial-Datenbanken, ODBC/JDBC-Datenbanken, sowie weiterer OGC-konformer<br />
Web Map Server zuzugreifen. Gerade diese letztere Eigenschaft ermöglicht es, deegree als<br />
kaskadierenden WMS einzusetzen und macht dessen Einsatz in diesem Szenario sinnvoll.<br />
Es ist eine Entwicklung der proprietären Produkte hin zu der Unterstützung der OGC-<br />
Standards zu beobachten 7 , welche es ermöglichen, werden oder schon jetzt ermöglichen,<br />
Dienste auf Basis dieser Produkte zu integrieren. Gleichzeitig ist mit deegree ein Zugriff auf<br />
die Originaldaten in Dateisystemen oder Datenbanken realisierbar, um die Grun<strong>dl</strong>age für<br />
weiterverarbeitende Dienste zu schaffen.<br />
4.3 Integration von Geodatendiensten in CoreMedia© CAP<br />
Wie zuvor erwähnt, soll für die Verwaltung der Inhalte des MRH-Portals CoreMedia CAP<br />
eingesetzt werden. Den Redakteuren soll es möglich sein, sowohl einzelnen Geodatensammlungen<br />
(z. B. Bauleitpläne) als auch einzelnen graphischen Elementen, Inhalte zuzuordnen<br />
und diese pflegen zu können. Diese Inhalte sollen dann gemeinsam mit den entsprechenden<br />
graphischen Darstellungen der Geodaten im Internet/Intranet abrufbar sein. Um<br />
dies zu erreichen, ist eine Funktionalität notwendig, welche eine Relation zwischen den in<br />
CoreMedia CAP gepflegten Inhalten und Geodatenelementen herstellt. Für den Benutzer<br />
stellt sich die Verknüpfung von Geodaten und Webcontent, wie in Abbildung 3 zu sehen,<br />
transparent dar. Je nach Einsatzgebiet bieten sich unterschie<strong>dl</strong>iche Varianten für die Benutzerführung<br />
an. Entweder kann der Benutzer über die Karte zum Content oder von dem<br />
Content zur Karte navigieren:<br />
Die erste Variante führt den Benutzer über den räumlichen Bezug an die gespeicherte Information<br />
zu diesem Ort. Er kann auf beliebige Bereiche in der Karte klicken und bekommt<br />
danach die Feature Infos und eventuell vorhandenen Annotationen des Ortes anzeigt. Dies<br />
wäre zum Beispiel sinnvoll, wenn nicht der annotierte Content im Vordergrund stehen soll,<br />
sondern die Feature Info, beispielsweise bei einem Flurplan, bei dem es eher darum geht,<br />
welche Elemente welche Bedeutung haben.<br />
3 http://www.deegree.org<br />
4 http://katla.giub.uni-bonn.de<br />
5 http://www.lat-lon.de/<br />
6 http://deegree.sourceforge.net/<br />
7 http://www.intergraph.com/gis/ogc/faq.asp
74<br />
Webbrowser<br />
Webseite<br />
CM Inhalt<br />
Karte (Pixelgra-<br />
Feature<br />
Pixelgrafik und Featureliste<br />
Layer<br />
Abb. 3: Web-Frontend<br />
K.-U. Krause, O. Bauer und N. Hoffmann<br />
Feature-Selektion<br />
deegree<br />
FeatureInfo<br />
Feature Info<br />
CM Inhalt<br />
Abruf des dem<br />
Feature<br />
zugeordneten<br />
CM-Dokuments<br />
CoreMedia CAP<br />
Bei der zweiten Variante werden dem Benutzer aller Annotationen der Karte textuell angezeigt<br />
und nach deren Auswahl der entsprechende Kartenausschnitt angezeigt. Dies wäre<br />
zum Beispiel sinnvoll, um bei einer Veranstaltung schnell eine bestimmte Lokation zu finden.<br />
Eine Kombination dieser Varianten wäre eine Webseite, welche annotierenden Content<br />
beinhaltet und zusätzlich eine Karte enthält. Innerhalb dieser Karte kann der Benutzer nun<br />
mit den bekannten Funktionen (zoom, pan, etc.) navigieren. Um annotierte Elemente (Features)<br />
auswählen zu können, wäre, wie die Grafik illustriert, eine Imagemap eine elegante<br />
Lösung, da dem Benutzer durch den sich verändernden Mauszeiger sofort ersichtlich wird,<br />
welche Bereiche der Karte annotiert sind. Ein Klick auf die Karte öffnet dann eine Webseite,<br />
die den annotierenden Content und die Feature Info zum gewählten Bereich kombiniert<br />
anzeigt. Hier steht also die annotierten Features im Vordergrund, was zum Beispiel für<br />
einen Sehenswürdigkeitenführer eingesetzt werden könnte.<br />
Mit Hilfe des Backends soll dem Redakteur die Möglichkeit zur Integration der Karten in<br />
die von CoreMedia CAP generierten Webseiten gegeben werden. Einerseits muss es möglich<br />
sein, Karten komplett auszuwählen und deren Verknüpfung im CoreMedia-System<br />
verfügbar zu machen. Diese Kartenreferenzen können dann einem CoreMedia-Dokument<br />
zugeordnet werden und im Frontend, wie zuvor beschrieben, zusammen mit dem Content<br />
angezeigt werden. Neben diesem trivialen Fall muss es auch möglich sein, einem oder mehreren<br />
Features der Karte ein CoreMedia-Dokument zuzuordnen.<br />
Doku-<br />
generierte<br />
Webseiten
Verteilte Geo- und Planungsdienste für das Portal www.metropolregion.hamburg.de 75<br />
Konfigurationswerkzeug: Flash- oder Java-basiert<br />
Konfiguration von Server und Layer<br />
Anfrage von<br />
Server und Layer<br />
Karte (Pixelgrafik)<br />
Feature<br />
Layer<br />
Karte (Pixelgrafik)<br />
und Feature-Liste<br />
deegree<br />
FeatureInfo<br />
Auslieferung<br />
der Featureinfo<br />
Abb. 4: Backend für den Redakteur<br />
Layer<br />
Neues Feature<br />
Erzeugen / bearbeiten<br />
von Features / Filtern<br />
evtl. erzeugen von Layern<br />
Auswahl von<br />
Geodatenelementen<br />
Integration in CoreMedia CAP<br />
Ausgewählte Features<br />
CoreMedia CAP Editor<br />
Auch hier sind mehrere Varianten denkbar. Die in der Grafik illustrierte benötigt dazu ein<br />
dynamisches Werkzeug für den Redakteur, welches ihm ermöglicht, Features zu definieren<br />
und zu verändern, die annotiert werden sollen. Dazu könnte ein neuer Layer erzeugt werden,<br />
der über die eigentliche Karte gelegt wird und die zu annotierenden Features beinhaltet.<br />
In diesem neuen Layer könnten die Features dann bearbeitet werden und in Form und<br />
Größe an die Erfordernisse angepasst werden. Jedes Feature bekommt dazu eine eindeutige<br />
Kennung, die ebenfalls als Referenz an CoreMedia CAP übergeben werden kann. Optional<br />
kann mittels der zugeordneten Dokumente und einer entsprechenden Abfrage des WFS,<br />
eine entsprechende Imagemap (vgl. Abbildung 4) generiert werden. Zusätzlich kann der<br />
Redakteur ein CoreMedia-Dokument erstellen, welches von ihm ausgewählte Featurekennungen<br />
enthält, um dem Benutzer eine textuelle Auswahl bzw. Suche zu ermöglichen.<br />
Weiterhin muss ein geeignetes CoreMedia-Dokumentenmodell entwickelt werden, um die<br />
so verknüpften Inhalte und Geodaten innerhalb der Webseitenstruktur darzustellen.<br />
Die Konzeption und Entwicklung des Projektes „Internetportal für die Metropolregion<br />
Hamburg“ wird sich an den Anforderungen der Projektbeteiligten und neuer technischen<br />
Möglichkeiten orientieren und dabei den Einsatz offener Standards, wie zum Beispiel SVG,<br />
forcieren.<br />
Layer<br />
Verknüpfung mit CM-Inhalten:<br />
- Feature ID<br />
- WMS Layer ID<br />
- Filter Encoding<br />
- Style Layer Descriptor
Zusammenfassung<br />
Skalierbares GeoGovernment via Internet<br />
und Intranet mit w³GIS<br />
Gerd PEYKE und Stefan ZAUNSEDER<br />
Die groß- bis mittelmaßstäbigen Geodaten, wie sie für kommunale eGovernment-<br />
Anwendungen gebraucht werden, beinhalten in der Regel komplexe Strukturen (z. B. ALK,<br />
ATKIS), sind vom Datenvolumen her oft groß (Landkreisebene) und es sollen im Praxiseinsatz<br />
Redundanzen sowie Aktualisierungsprobleme vermieden werden.<br />
Daraus ergeben sich Anforderungen, die zu neuen Konzepten führen: die Geodaten sind<br />
jeweils an (möglichst) nur einer Stelle vorzuhalten, das GIS sollte in der Lage sein, auf dem<br />
Client die Daten unterschie<strong>dl</strong>icher Server zusammen mit lokalen Daten zu verarbeiten.<br />
Somit ist eine weit gehende Berücksichtigung von Standards sinnvoll (Vorschläge des<br />
OpenGIS-Konsortiums), vor allem in Bezug auf die Kommunikation von Clients mit Web-<br />
Map-Servern.<br />
1 Architektur<br />
Aus diesen Anforderungen wurde folgende Architektur abgeleitet (bis dato die weltweit<br />
einzige, die abgehend von konventionellen Client/Server-Architekturen durchgehend von<br />
Auskunft bis Erfassung rein auf Web-Technologie aufsetzt und dabei keine Zusatzsoftware<br />
voraussetzt):<br />
1. Durchgängiger Einsatz von Web-Technologie mit entsprechenden Optimierungen: System<br />
aus Web-Client (mit voller GIS-Funktionalität integriert in den Web-Browser) und<br />
Web-Server.<br />
2. Am Server stehen für die Verwaltung auch größter Vektor- und Rasterdatenmengen ein<br />
Geodatenserver und für die hierarchische Datenorganisation mit Metadaten und<br />
Zugriffsrechten ein Geodatenportal zur Verfügung.<br />
3. Ebenfalls am Server laufen kommunale Fachschalen (z. B. Kanal, Wasser, Strom) als<br />
Web-Applikationen.
78<br />
Lokales Netz (Intranet)<br />
�����Ã���� �����Ã���� w³GIS Web- ������ ������ Server<br />
�����Ã���� �����Ã���� w³GIS Web- Client ������ ������<br />
��<br />
1<br />
G. Peyke und S. Zaunseder<br />
Intranet Extranet<br />
Abb. 1: w³GIS-Einsatzszenario „Intranet“<br />
2 Vorteile<br />
�����Ã��� �����Ã��� �����Ã��� w³GIS Web -Client ������� ������� �������<br />
��<br />
��<br />
�������������<br />
�������������<br />
�������������<br />
[ lokale Daten ]<br />
�����Ã��� �����Ã��� w³GIS Web -Client ������� �������<br />
in �� ��<br />
Außenstelle<br />
�����������<br />
�����������<br />
���� ���� Web- Kartenserver<br />
������������<br />
������������<br />
���� ���� z.B.<br />
���������������<br />
���������������<br />
Nachbargemeinde<br />
���� ���� Web- Kartenserver<br />
������������<br />
������������<br />
���� ���� z.B.<br />
�����������<br />
�����������<br />
Landratsamt<br />
Daraus ergibt sich Skalierbarkeit vom Einzelplatz bis hin zu Intranet und Internet einerseits<br />
sowie von der Auskunft über die Analyse bis zur Erfassung andererseits. Die Eigenschaften<br />
heutiger PCs, nämlich u.a. hohe Prozessorleistung, sehr gute Grafikperformance und große<br />
Hauptspeicher, qualifizieren sie als „Fat Clients“ und bieten damit die o.a. Möglichkeiten.<br />
Als Nebeneffekt entsteht die gewünschte deutliche Reduzierung hinsichtlich der Serverlast<br />
und zusätzlich auch eine geringere Beanspruchung von Netzwerkbandbreite. Wenn die<br />
Software dann Flexibilität bietet in Hinsicht auf die Speicherung von Rasterbildern (Kacheltechnik,<br />
ferner Bereitstellung einer einmal zu generierenden sog. Rasterpyramide) ebenso<br />
wie im Vektorbereich (basierend auf R-Bäumen, die extrem schnell die betroffenen Geoobjekte<br />
ermitteln helfen; bzw. die indirekt dazu beitragen können, den Datenverkehr betreffend<br />
eines Ausschnitts bzw. dessen Umgebung zu optimieren), insgesamt dann je nach<br />
Bandbreitensituation angepasste Kompressionstechniken (in mehreren Stufen) verwendet<br />
werden sowie Caching und Proxy-Server unterstützt werden, so ist „maßgeschneiderte Optimierung“<br />
für kleine wie große, schnelle wie langsame Netze verfügbar. Bei extrem ungünstiger<br />
Netzanbindung kann auch auf Replikation zurückgegriffen werden, d. h. dass<br />
Geodaten in benötigten Ausschnitten lokal gehalten und Änderungen bzw. Ergänzungen<br />
entsprechend zeitgesteuert automatisch eingespielt werden (z. B. nachts oder am Wochenende<br />
unter Nutzung günstiger Datentransfertarife).
3 Integration<br />
Skalierbares GeoGovernment via Internet und Intranet mit w³GIS 79<br />
Gerade im eGovernment zeigt sich, dass GIS keine Insel sein kann und darf, sondern mit<br />
vorhandenen Verfahren und Anwendungen in der existierenden IT-Landschaft integriert<br />
werden muss, teilweise sogar durch Einbettung in vorhandene Software und Datenbanken<br />
zum selbstverstän<strong>dl</strong>ichen und kaum mehr als eigenes System wahrgenommenen, alltäglichen<br />
Werkzeug werden kann. Erst dadurch entsteht eine Lösung für das GeoGovernment.<br />
Daher integriert w³GIS u.a. mit:<br />
• OpenGIS Web Map Services (w³GIS als WMS-Client),<br />
• der TERA-Produktfamilie (TEchnisches Rathaus, teilweise direkt eingebettet): Automatisiertes<br />
Liegenschaftsbuch (ALB)/ Bauantragsvorbehan<strong>dl</strong>ung/ Beitragswesen / Liegenschaftsverwaltung/<br />
Straßenbestandsverzeichnis/ Ökokonto/ Bauleitplan-Verfahren<br />
usw.,<br />
• Baugenehmigungslösungen für Landratsämter bzw. kreisfreie Städte,<br />
• Webportal- und Content-Management-Systemen,<br />
• Office-Lösungen (Einbettung z. B. in Microsofts Desktop-Datenbank Access) sowie<br />
• (fast) beliebigen vorhandenen Datenbanken, z. B. Einwohnermeldewesen/ Automatisiertes<br />
Liegenschaftsbuch (ALB)/ Grundstücks-Kaufpreissammlung/ digitales Archiv.<br />
Dazu wurde ein entsprechendes Tool im Rahmen einer Diplomarbeit am Institut für<br />
Geographie der Universität Augsburg konzipiert und implementiert (Diplomand: Stefan<br />
Schnitzhofer), das frei konfigurierbar die Anbindung von ODBC-Datenquellen ermöglicht,<br />
wobei Webseiten für die Daten-Anzeige und auch -Suche automatisch aus der angebundenen<br />
Datenbankstruktur generiert werden.<br />
Weitere Fachanwendungen im kommunalen Bereich wie z. B. Umweltinformationssysteme<br />
werden darüber hinaus ebenso abgedeckt wie GIS-Randbereiche (z. B. Facility Management).<br />
4 Fazit<br />
Der Architekturansatz von w³GIS bietet<br />
• unübertroffene Skalierbarkeit: in einer durchgängigen (Web-) Technologie von der<br />
Auskunft über die Analyse bis zur Erfassung, gleichzeitig vom Einzelplatz über das lokale<br />
Netz/ Intranet bis zum Internet ohne zusätzliche CAD- oder GIS-Software,<br />
• höchste Flexibilität bzgl. Datenhaltung und Systemarchitektur: die Technik macht hier<br />
keine Vorgaben, vielmehr passt sie sich den Gegebenheiten und Anforderungen an (so<br />
ist z. B. die Anbindung von Außenstellen oder mobilen Arbeitsplätzen problemlos<br />
möglich),<br />
• Offenheit sowie Daten- und System-Integration ohne Bindung an spezielle Datenlieferanten<br />
oder (externe) Datenhalter sowie<br />
• Einbettbarkeit nicht nur im Internet-Browser, sondern auch in Office- und andere Systeme.
80<br />
5 Beispiele<br />
G. Peyke und S. Zaunseder<br />
Einige praktische Beispiele, hier als Screenshots wiedergegeben, sollen dies im Folgenden<br />
deutlich machen.<br />
Abb. 2: Landkreis-GIS im Intranet: Landkreisweite digitale Flurkarte und digitale Orthophotos,<br />
dazu Bebauungsplan überlagert mit landesweiten Geodaten; die einzelnen<br />
Layer können von verschiedenen Servern auf dem Client auch mit lokalen<br />
Geodaten überlagert und analysiert werden; w³GIS fungiert dabei auch als<br />
OpenGIS WMS-Client.
Skalierbares GeoGovernment via Internet und Intranet mit w³GIS 81<br />
Abb. 3: w³GIS-Fachschale Kanal (ISYBAU), implementiert als Web-Applikation. Alle<br />
Fachschalendaten in der Grafik werden bei Bedarf „on-the-fly“ aus der Datenbank<br />
generiert (redundanzfreie Speicherung); Einbettung beliebiger Dokumente,<br />
Bilder und Filme.<br />
Abb. 4: w³GIS-Einbettung in die TERA-Produktfamilie (TEchnisches RAthaus). Hier:<br />
EXPERTplus mit dem Automatischen Liegenschaftsbuch (ALB).
82<br />
G. Peyke und S. Zaunseder<br />
Abb. 5: w³GIS im Einsatz als Internet-Auskunftssystem. Hier: Bebauungsplan-Auskunft<br />
in der Wirtschaftsförderung; aus einer Diplomarbeit der Universität Würzburg<br />
(Diplomand: Michael Weiss).<br />
Abb. 6: w³GIS eingebettet in Office-Programme. Hier: in Microsoft Access mit der Anwendung<br />
Baumkataster.
Zusammenfassung<br />
Konzept und Umsetzung<br />
einer österreichischen Geodatenpolitik<br />
Manfred RIEDL<br />
Die Bedeutung und Anwendung der Geoinformation hat auf Ebene aller Gebietskörperschaften<br />
Österreichs zwischenzeitlich eine Intensität erreicht, welche die bisherigen Gepflogenheiten<br />
des öffentlichen Geodatenmanagements in Frage stellen. Die österreichischen<br />
Gebietskörperschaften vereinbaren in einem „Konzept für eine Österreichische Geodatenpolitik“<br />
(2002) ihre Leistungen zu harmonisieren und die Zusammenarbeit zu intensivieren,<br />
um die Verfügbarkeit öffentlicher Geodaten und den Zugang zu Geoinformationen auf nationaler<br />
Ebene deutlich zu verbessern.<br />
1 Orientierung<br />
Maßgebliche öffentliche Aufgaben werden auf Grun<strong>dl</strong>age von EU-Richtlinien, Bundes- und<br />
Landesgesetzen unter Verwendung von Geoinformationen ausgeführt. Auf allen Ebenen der<br />
Verwaltung und in Wirtschaftsbetrieben der öffentlichen Hand sind geographische Informationssysteme<br />
eingerichtet und umfangreiche öffentliche Geodaten (z. B. verortete Gebäudeadressen,<br />
Digitale Katastralmappe, Schutzgebiete nach verschiedenen Gesetzesmaterien,<br />
Raumordnungspläne, Verkehrs- und Leitungsnetze, usw.) verfügbar. Diese öffentlichen<br />
Geoinformationen stellen eine tragende Säule unserer Informationsgesellschaft dar.<br />
Trotz mancher legislativer Ansätze einer thematisch übergreifenden Informationspolitik<br />
(z. B. Umweltinformationsgesetze, einzelne Raumordnungsgesetze, usw.) bleibt die Verpflichtung<br />
und die Umsetzung zur Erhebung und Anwendung von Daten überwiegend den<br />
spezifischen Materiengesetzen (z. B. Landesgesetze zur Festlegung der Namen von Verkehrsflächen<br />
und der Nummerierung von Gebäuden, Vermessungsgesetz, Wasserrecht,<br />
Naturschutz- und Raumordnungsgesetze der Länder, usw.) überlassen. Durch das Fehlen<br />
geeigneter rechtlicher Rahmenbedingungen entstanden Mehrgleisigkeiten, sowie Unzulänglichkeiten<br />
in der Erfassung und Führung, in der Qualität, in der Flächendeckung und in den<br />
Zugangs- und Nutzungsbedingungen von und zu öffentlichen Geoinformationen.<br />
Die Geodatenpolitik hat das Ziel, die umfassende Verfügbarkeit von öffentlichen Geodaten<br />
in Zusammenarbeit aller Gebietskörperschaften sicherzustellen und dadurch die Zugänge zu<br />
öffentlichen Geoinformationen für Bürger , Wirtschaft und Verwaltung zu verbessern.
84<br />
M. Rie<strong>dl</strong><br />
2 Verfügbarkeit öffentlicher Geodaten<br />
Öffentliche Geodaten sind in marktwirtschaftlicher Verwertung nicht refinanzierbar, müssen<br />
aber in öffentlichem Auftrag und unabhängig von temporären, wirtschaftlichen Interessen<br />
flächendeckend und authentisch verfügbar gestellt werden.<br />
Der generelle Begriff der öffentlichen Verfügbarkeit gliedert sich bei einer auf die tatsächliche<br />
Anwendung orientierten, näheren Betrachtung in mehrere Bereiche auf, welche untereinander<br />
in Form einer Kette von notwendigen Han<strong>dl</strong>ungsfeldern in enger Beziehung stehen.<br />
• Die Zuständigkeit der Erfassung und Führung ist zwischen den Gebietskörperschaften<br />
eindeutig zu regeln.<br />
• Die Erzeugung und Aktualisierung der Daten ist von der zuständigen Stelle eigenständig<br />
oder durch Beauftragung sicher zu stellen.<br />
• Die Vorhaltung der Daten kann im eigenen System vorgenommen, kann aber auch an<br />
andere Datenverarbeiter überantwortet oder vergeben werden.<br />
• Ein Angebot der verfügbaren Daten (im Original, als Folgeprodukte) ist in beschreibender<br />
Form (Metadaten) zu veröffentlichen.<br />
• Die Nutzung der Daten ist anderen Datenverarbeitern offline oder im Netz zu ermöglichen.<br />
• Informationsdienste können durch Zugriff auf verschiedene Datenquellen eingerichtet<br />
und in gegenseitiger Abstimmung betrieben werden.<br />
Geobasisdaten (z. B. verortete Adressen, Digitale Katastralmappe, digitale Höhenmodelle,<br />
Orthophoto, kartografische Modelle) sollen allgemein und besonders effizient verfügbar<br />
gestellt werden, da sie vielfach zur Orientierung und Identifikation verwendet werden. Geobasisdaten<br />
stellen die kartografischen Grun<strong>dl</strong>agen für darauf aufbauende Fachinformationen<br />
dar.<br />
Obwohl die Zuständigkeit für jeden öffentlichen Geobasisdatenbestand grundsätzlich definiert<br />
ist, gibt es dennoch weitere untereinander unkoordinierte Erzeuger, Vorhalter und<br />
Anbieter von Daten sowie von Informationsdiensten. Durch die in vielen Fällen in uneinheitlicher<br />
und nicht bedarfsgerechter Form vorliegenden Geobasisdaten ist derzeit oft eine<br />
Vorhaltung bei den einzelnen Nutzern nötig. Oft muss bei einer Aktualisierung der Gesamtdatenbestand<br />
neu eingespielt werden, weil eine ausschließliche Lieferung der geänderten<br />
Inhalte nicht möglich ist.<br />
Geofachdaten (aus den Bereichen Katastrophenschutz, Land- und Forstwirtschaft, Raumplanung,<br />
Umwelt, Verkehr u.a.) sollen für fachlich und organisatorisch übergreifende Nutzungen<br />
verfügbar gestellt werden.<br />
Generell ist der Koordinierungsbedarf bei den Geofachdaten wesentlich höher, als bei Geobasisdaten.<br />
Eine Ursache dafür liegt in der komplexen Verteilung der Zuständigkeiten:<br />
Die Vielfalt der Geofachdaten in Hinsicht auf Qualität und Verfügbarkeit ist im Zuständigkeitsbereich<br />
der Gemeinden in Folge unterschie<strong>dl</strong>icher Struktur und Ausstattung besonders<br />
groß. Dadurch ist die Nutzung solcher Daten über die Gemeindegrenzen hinaus oftmals<br />
kaum möglich. Wenn Geodaten von Gemeinden (z. B. Flächenwidmung) in anderen Berei-
Konzept und Umsetzung einer österreichischen Geodatenpolitik 85<br />
chen verwendet werden sollen, kommt es daher oft zur Mehrfacherfassungen von ein und<br />
derselben Daten oder zu hohem Konvertierungsaufwand.<br />
Geofachdaten im Zuständigkeitsbereich der Länder sind im Hinblick auf Zuständigkeit,<br />
Erzeugung, Vorhaltung und Angebot (auch von Informationsdiensten) eindeutig geregelt.<br />
Unterschie<strong>dl</strong>iche Ausprägungen der Landesgesetze führen zu unterschie<strong>dl</strong>ichen Datenführungsmodellen.<br />
Grenzüberschreitende Anwendungen werden dadurch erschwert, sind aber<br />
prinzipiell möglich.<br />
Besondere Ineffizienz herrscht bei jenen Geofachdaten vor, die in mittelbarer Bundesverwaltung<br />
bei Ländern und Bund geführt werden. Des weiteren bei Geofachdatensätzen, die<br />
von privatwirtschaftlich agierenden Einrichtungen mit öffentlichen Aufgaben wahrgenommen<br />
werden. So ist beispielsweise nicht umfassend feststellbar, wo und nach welchem Datenführungsmodell<br />
Verkehrsnetze erzeugt und vorgehalten werden. Letzten<strong>dl</strong>ich werden<br />
solche Daten nicht nur bei vielen Stellen geführt, erstellt und vorgehalten, sondern die Daten<br />
liegen auch in derart unterschie<strong>dl</strong>ichen Datenführungsmodellen und für unterschie<strong>dl</strong>iche<br />
Regionen vor, dass es für den Nutzer unmöglich ist, diese Daten für seine Zwecke zu beziehen<br />
und zu verwenden. Kommerzielle Firmen erfassen vielfach an sich schon vorliegende<br />
öffentliche Geofachdatensätze erneut, aber nach temporären und marktwirtschaftlichen<br />
Erfordernissen.<br />
3 Umsetzungsschritte<br />
Am Ausgangspunkt der gegenstän<strong>dl</strong>ichen Initiative im Jahre 2001 stand die Unzufriedenheit<br />
der GIS- und Vermessungsexperten der Länder mit den Datenaustauschbeziehungen zum<br />
Bund. Die vorhandenen Bestände an Geobasisdaten von Bundesstellen waren zwar grundsätzlich<br />
zugänglich, die Nutzungsbedingungen (Entgeltlichkeit, keine Weitergaberechte)<br />
und technischen Bezugsmöglichkeiten waren verbesserungswürdig. Dem gegenüber standen<br />
Wünsche anderer Bundesstellen nach möglichst unentgeltlicher Überlassung landeseigener<br />
Datenbestände.<br />
Im September 2001 erging der Auftrag der Konferenz der Landesamtsdirektoren in einer<br />
Expertengruppe der Länder in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen<br />
BEV ein Konzept zur Verbesserung der Situation zu entwickeln. Im Folgejahr<br />
wurde von Experten des BEV, der Verbindungsstelle und der Länder Kärnten, Oberösterreich,<br />
Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien das „Konzept für eine Österreichische<br />
Geodatenpolitik“ entwickelt. Der Langtext des gegenstän<strong>dl</strong>ichen Konzeptes ist unter<br />
http://www.ageo.at veröffentlicht.<br />
Im September 2002 wurde das gegenstän<strong>dl</strong>iche Konzept von der Konferenz der Landesamtsdirektoren<br />
angenommen und mit der ergänzenden Forderung nach kostenfreiem<br />
Datenaustausch zwischen den Gebietskörperschaften an die Konferenz der Landeshauptleute<br />
weiter geleitet.<br />
Die Konferenz der Landeshauptleute hat am 16. Oktober 2002 das Konzept zur Kenntnis<br />
genommen und die nachstehende Zusammenfassung beschlossen. Damit hat sich erstmals in<br />
Österreich ein politisches Gremium zur Ausübung einer aktiven Geodatenpolitik bekannt.
86<br />
M. Rie<strong>dl</strong><br />
Der Bund, der Städte- sowie der Gemeindebund wurden zur Setzung gemeinsamer Maßnahmen<br />
im Sinne des Konzeptes eingeladen.<br />
Im Januar 2003 wurden in Umsetzung des Konzeptes die Bundesministerien und weitere<br />
Einrichtungen des Bundes wie das Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen und das<br />
Umweltbundesamt, der Städte- sowie der Gemeindebund, sowie alle Länder zur Gründung<br />
der Plattform Geodatenpolitik eingeladen. Die konstituierende Sitzung dieses gesamtstaatlichen<br />
Gremiums fand im März 2003 in Wien in den Räumen der Österreichischen Raumordnungskonferenz<br />
statt, ein weiteres Zusammentreffen im Juni 2003 in Innsbruck. Der Vorsitz<br />
im Kalenderjahr wurde dem Land Tirol übertragen.<br />
Die vorerst als besonders wichtig angesehene inhaltliche Detailarbeit der Plattform Geodatenpolitik<br />
wurde 4 Arbeitsgruppen übertragen:<br />
• AG Adressen hat sich intensiv mit dem geplanten Aufbau des nationalen Gebäude- und<br />
Wohnungsregister durch die Statistik Austria beschäftigt, insbesondere mit dem Vorhaben<br />
der zentralen Zusammenführung, Überprüfung und Ergänzung verorteter Adressen<br />
mittels einer Web-Anwendung. Dabei wurde vor allem auf die unentgeltliche Bereitstellung<br />
von Geobasisdaten für die Gemeinden und die ergänzende Berücksichtigung<br />
von Datenübergaben aus städtischen GI-Anwendungen gedrängt. Die Länder sollen in<br />
den Datenfluss integriert werden. Weitere Kontakte betrafen die Zusammenhänge zur<br />
eGovernment Initiative des Bundes und der Länder, in welcher der Aufbau eines zentralen<br />
Adressregisters als Projekt aufscheint.<br />
• AG Kataster hat in Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Eich- und Vermessungswesen<br />
einen umfangreichen Fragenkatalog über Verbesserungen der Datenbereitstellung<br />
behandelt.<br />
• AG Orthophoto hat mit Bundesstellen die technischen Parameter der Befliegungen und<br />
die längerfristige Flugplanung vereinbart.<br />
• AG Metadaten hat die Notwendigkeit der harmonisierten Erstellung und gemeinsamen<br />
Publikation von Beschreibungen öffentlicher Geodaten diskutiert.<br />
Die Länder befürworten eine organisatorische Eingliederung der Plattform Geodatenpolitik<br />
in die Österreichische Raumordnungskonferenz ÖROK. Diese Institution weist dieselbe<br />
Zusammensetzung wie die Plattform auf, verfügt über eine organisatorische und finanzielle<br />
Grundausstattung und hat mit der ÖROK Empfehlung 51 zur Führung Geografischer Informationssysteme,<br />
einsehbar unter http://www.oerok.gv.at, ihre inhaltliche Kompetenz aufgezeigt.<br />
Im April 2003 fasste der Ministerrat der Bundesregierung den Beschluss die Koordinierung<br />
der Geodatenpolitik auf Bundesebene dem Wirtschaftsminister zu übertragen, welcher im<br />
Juni 2003 den Präsidenten des Bundesamtes für Eich- und Vermessungswesen mit der<br />
Durchführung dieser Aufgabe beauftragt. Die organisatorischen Beziehungen zur Plattform<br />
Geodatenpolitik sind vorerst nicht geklärt.
Konzept und Umsetzung einer österreichischen Geodatenpolitik 87<br />
4 Beschlusstext der Konferenz der Landeshauptleute<br />
Zur Erfüllung maßgeblicher öffentlicher Aufgaben, wie zum Beispiel in den Bereichen<br />
Raumordnung, Verkehr, Wirtschaft, Umweltschutz, Katastrophenschutz, Land- und Forstwirtschaft<br />
ist die Verwendung von Geodaten Voraussetzung.<br />
Geodaten stellen EU-weit 1 eine tragende Säule der Informationen des öffentlichen Sektors<br />
dar und sind für Verwaltungsreform und eGovernment integrierender Bestandteil.<br />
In allen Ebenen der österreichischen Verwaltung werden seit über 10 Jahren Geodaten erfasst<br />
und in Geografischen Informationssystemen (GIS) geführt.<br />
Durch das Fehlen geeigneter Rahmenbedingungen für Kooperationen in dieser neuen Verwaltungsmaterie<br />
entstanden Mehrgleisigkeiten, sowie Unzulänglichkeiten in der Erfassung<br />
und Führung, in der Qualität, in der Flächendeckung und in den Zugangs- und Nutzungsbedingungen.<br />
Dies führt zu Ineffizienz, erhöhten Kosten und damit zu nicht vertretbaren volkswirtschaftlichen<br />
Verlusten.<br />
Zur Umsetzung der Geodatenpolitik ist es notwendig, dass Bund, Länder und Gemeinden<br />
inhaltlich übereinstimmende Vereinbarungen treffen, die nachstehende Punkte umfassen<br />
und für alle Institutionen mit öffentlichen Aufgaben im Geodatenbereich verbin<strong>dl</strong>ich sind:<br />
(1) Die Verfügbarkeit der „öffentlichen Geodaten“ ist flächendeckend, authentisch und in<br />
definierter Qualität sicherzustellen.<br />
(2) Die Verantwortlichkeiten für den Aufbau, die Führung und Bereitstellung der „öffentlichen<br />
Geodaten“ sind eindeutig zu definieren.<br />
(3) Die Datenführungsmodelle (Inhalt, Struktur, Führung, Metadaten) für die „öffentlichen<br />
Geodaten“ sind zu vereinheitlichen und verbin<strong>dl</strong>ich festzulegen.<br />
(4) Der Zugriff auf und die Nutzung von „öffentlichen Geodaten“ sind klar und eindeutig<br />
zu regeln, insbesondere sollen innerhalb und zwischen den Gebietskörperschaften<br />
„öffentliche Geodaten“ mit möglichst geringem Kosten- und Bearbeitungsaufwand<br />
verfügbar sein.<br />
(5) Die Einrichtung und der Betrieb von „öffentlichen Geo-Informationsdiensten“ soll die<br />
Nutzung von „öffentlichen Geodaten“ erleichtern und verstärken.<br />
(6) Das Wertschöpfungspotenzial der Geodaten ist für Wirtschaft und Forschung zu mobilisieren.<br />
(7) Die Kommunikation und Kooperation zwischen den mit öffentlichen Aufgaben betrauten<br />
Bereichen ist zu erleichtern und zu vertiefen.<br />
1 Grünbuch der Europäischen Kommission über die Informationen des öffentlichen Sektors in der<br />
Informationsgesellschaft (KOM(1998)585).
88<br />
M. Rie<strong>dl</strong><br />
Die Gebietskörperschaften setzen auf Basis dieser verbin<strong>dl</strong>ichen Vereinbarungen folgende<br />
Maßnahmen:<br />
Im eigenen Verantwortungsbereich<br />
• garantieren sie die Erfassung, Vorhaltung und Weitergabe ihrer Geodatenbestände,<br />
insbesondere durch nachhaltige Sicherstellung der personellen und finanziellen Ressourcen;<br />
• erklären sie sich bereit, im Konsens vereinbarte Standards von Datenführungsmodellen<br />
(Inhalt, Struktur, Führung, Metadaten) zu übernehmen;<br />
• bekennen sie sich zu gemeinsam vereinbarten Nutzungsrechten und Weitergabebedingungen<br />
(Preispolitik) gegenüber Dritten;<br />
• sorgen sie für eine transparente, rasche und Kunden orientierte Abgabe eigener bzw.<br />
Weitergabe fremder Geodaten an Gebietskörperschaften und Private;<br />
• richten sie (im Sinne verteilter Datenzugriffe) vernetzte Geo-Informationsdienste ein,<br />
welche dem Bürger oder auch anderen Gebietskörperschaften eine grenzüberschreitende,<br />
dokumentierte und nachvollziehbare Betrachtung von öffentlichen Geoinformationen<br />
ermöglichen und<br />
• sie verpflichten sich, die entsprechenden rechtlichen Normen laufend anzupassen.<br />
In der Zusammenarbeit untereinander und mit anderen Einrichtungen<br />
• regeln sie die tatsächliche Durchführung von Erzeugung, Aktualisierung und Vorhaltung<br />
von öffentlichen Geodatenbeständen;<br />
• ermöglichen sie die Mehrfachnutzung von Datenbeständen, insbesondere durch<br />
• die Vereinbarung zum Datenaustausch mit geringem Kosten- und Bearbeitungsaufwand<br />
zwischen den Gebietskörperschaften,<br />
• die Einräumung von Nutzungs- und Weitergaberechten gegenüber Dritten und<br />
• die Freischaltung von verteilten Datenbeständen und Geo-Informationsdiensten.<br />
Durch die Zusammenarbeit im Rahmen einer einzurichtenden „Plattform Geodatenpolitik“<br />
• sichern sie den periodischen Informationsaustausch,<br />
• ermöglichen sie die Weiterentwicklung einer abgestimmten Geodatenpolitik,<br />
• fördern sie die Schaffung gemeinsamer Standpunkte und Vorhaben zwischen den Gebietskörperschaften<br />
und<br />
• unterstützen sie die Festlegung von Datenführungsmodellen, Standards, Nutzungsrechten<br />
und Weitergabebedingungen.<br />
Wesentlich ist die Anerkennung dieser „Plattform Geodatenpolitik“ durch alle Einrichtungen,<br />
die mit öffentlichen Geodaten und Geoinformationsdiensten betraut sind, insbesondere<br />
die Gebietskörperschaften.<br />
Durch die vorgeschlagenen Maßnahmen sind innerhalb des öffentlichen Sektors massive<br />
Einsparungen und Rationalisierungseffekte zu erzielen. Zusätzlich wird durch diese Maßnahmen<br />
ein wesentlicher Beitrag zur Realisierung des Vorhabens eGovernment in Österreich<br />
geleistet.<br />
Weiterhin wird das vorhandene Wertschöpfungspotenzial der Geodaten des öffentlichen<br />
Sektors für die Wirtschaft verstärkt nutzbar.
Vernetztes Europa – GI-Initiativen in der EU<br />
Zusammenfassung<br />
Gerda SCHENNACH<br />
Die zunehmende Vernetzung von Aktivitäten innerhalb der Europäischen Union und die<br />
wachsende Notwendigkeit für georeferenzierte Entscheidungsgrun<strong>dl</strong>agen haben die Bedeutung<br />
der Geographischen Information GI auch in fachfremden Bereichen sichtbar gemacht<br />
und zu einer Reihe von GI Initiativen auf europäischer Ebene geführt. Österreichische Institutionen<br />
sind an laufenden Aktivitäten im GI Bereich aktiv beteiligt und es sind von den<br />
laufenden Initiativen Impulse für GI Aktivitäten innerhalb Österreichs zu erwarten.<br />
1 Einleitung<br />
Die Führung und Verwaltung der Europäischen Union in einem komplexen Umfeld stellen<br />
alle Beteiligten zunehmend vor große Herausforderungen. Vor dem Hintergrund globalen<br />
Wettbewerbs ist es für die EU und ihre Mitgliedsländer notwendig, als Einheit aufzutreten<br />
und zu agieren. Daraus resultiert die Notwendigkeit, für wirtschaftliche, politische und<br />
strategische Entscheidungen Grun<strong>dl</strong>agen bereitzuhalten, die länderübergreifend interpretierbar<br />
sind und regional spezifische Zusammenhänge in einen gesamteuropäischen Kontext<br />
bringen.<br />
Europaweit vergleichbare Entscheidungsgrun<strong>dl</strong>agen sind aber auch für die innere Verwaltung<br />
der EU, die, um effektiv zu sein, zumindest unter einem gesamteuropäischen Rahmen<br />
erfolgen muss, unverzichtbar.<br />
2 Rahmenbedingungen<br />
Die bevorstehende Erweiterung der EU von 15 auf 25 Mitgliedsländer, die von kultureller<br />
und historisch gewachsener Vielfalt geprägt sind, benötigt für die Sicherstellung einer geordneten<br />
Verwaltung und einer durchgängigen Koordination von europaweiten Aktivitäten<br />
geeignete Infrastrukturen, die alle Beteiligten unter Einhaltung des Subsidiaritätsprinzips<br />
bestmöglich einbinden. Weiterhin gilt es den unverhältnismäßig gestiegenen Verwaltungsaufwand<br />
in einer wachsenden Gemeinschaft mit einer zunehmenden Zahl von einzubindenden<br />
Interessensgebieten, zu minimieren und für den einzelnen Bürger transparenter und<br />
effektiver zu gestalten. Moderne Kommunikationsmöglichkeiten und Vernetzung von Abläufen<br />
sollen dies unterstützen. Subsidiär gestaltete Verwaltungsabläufe geben auch die<br />
Richtung für technologische Lösungen vor.<br />
Als einer der Hauptnutzer der Infrastrukturen tritt die Europäische Kommission mit spezifischen<br />
Anforderungen auf. Fachübergreifende Planungen und überregionale Koordination
90<br />
G. Schennach<br />
von gemeinschaftlichen Aktivitäten wie z. B. für Transport, Verkehr, Telekommunikation,<br />
Krisen- und Katastrophenmanagement etc. bedürfen als Grun<strong>dl</strong>age Informationen, die fachübergreifend<br />
für den gesamteuropäischen Raum zur Verfügung stehen müssen.<br />
Die bereitgestellten Daten werden mittels e-Dienstleistungen anwendungsorientiert verfügbar<br />
gemacht und dienen als Grun<strong>dl</strong>age für Entscheidungsfindungen, aber auch zur Dokumentation<br />
von Zuständen und Abläufen und helfen, die Effektivität von Umsetzungsmaßnahmen<br />
zu evaluieren.<br />
Die vielfältigen fachübergreifenden Anwendungen unter Einbeziehung aller Mitgliedsländer<br />
und der Anspruch auf permanente Verfügbarkeit aller Informationen macht die Bereithaltung<br />
von großen Datenmengen und den Einsatz neuer Kommunikationstechnologien notwendig.<br />
Dazu kommen von der EU erhobene Ansprüche auf einen möglichst offenen Zugang zu den<br />
Daten, ohne Einschränkungen durch soziale, technologische oder finanzielle Barrieren und<br />
unter gleichen Bedingungen für alle Amtssprachen der EU. Für den Datenbereitsteller bestehen<br />
Verpflichtungen zur Einhaltung vorgegebener Qualitätsmerkmale und zur Wahrung<br />
der Aktualität der authentisch geführten Daten und somit zur Wahrnehmung der Verantwortlichkeit<br />
für die ihm zugeordneten Datenbestände.<br />
3 eEurope 2005<br />
Mit dem Aktionsplan eEurope 2005, den der Europäische Rat im Juni 2002 auf dem Gipfel<br />
von Sevilla beschlossen hat, soll ein Umfeld geschaffen werden, das private Investitionen<br />
und die Schaffung von Arbeitsplätzen begünstigt sowie zu einer Steigerung der Produktivität<br />
und moderneren öffentlichen Dienstleistungen führt und jedem EU Bürger die Möglichkeit<br />
zur Teilnahme an der globalen Informationsgesellschaft gibt. Die Förderung sicherer<br />
Dienste, Anwendungen und Inhalte auf der Grun<strong>dl</strong>age einer allgemein zugänglichen Breitband-Infrastruktur<br />
ist daher vorrangiges Ziel von eEurope 2005.<br />
eEurope 2005 folgt auf den Aktionsplan eEurope 2002, der bereits 2000 beim Gipfel in<br />
Feira beschlossen worden war und der bislang nennenswerte Erfolge zeigt:<br />
• Verdoppelung der Zahl privater Internetanschlüsse<br />
• Beschluss einer Telekom-Rahmenrichtlinie<br />
• Preissenkung für den Internetzugang<br />
• Anschluss fast aller Unternehmen und Schulen an das Internet<br />
• Europa besitzt nun das schnellste Forschungsgrundnetz der Welt<br />
• Rechtsrahmen für den elektronischen Geschäftsverkehr weitgehend in Kraft<br />
• Abwicklung von zahlreichen Behördendienste über das Netz<br />
• Aufbau einer Infrastruktur für intelligente Chipkarten<br />
• Zugangsrichtlinien für Web-Inhalte durch die Mitgliedstaaten angenommen und empfohlen<br />
eEurope 2002 setzte den Schwerpunkt auf der Verbreitung von Internetanschlüssen in Europa<br />
als Vorbedingung für die Schaffung einer wissensgestützten Wirtschaft.
Vernetztes Europa – GI-Initiativen in der EU 91<br />
eEurope 2005 konzentriert sich auf die Förderung von Diensten, Anwendungen und Inhalten,<br />
um neue Märkte zu schaffen und Kosten zu verringern, um schließlich die Produktivität<br />
der gesamten Wirtschaft zu erhöhen. Wesentlicher Teil des Aktionsplanes ist die Schaffung<br />
eines günstigen Umfelds für private Investitionen.<br />
4 PSI Direktive<br />
Im Jahre 2000 hat die Generaldirektion IST Technologien für die Informationsgesellschaft<br />
eine Studie zur Untersuchung des Wirtschaftspotentiales von Daten des öffentlichen Sektors<br />
in Auftrag gegeben. Das Ergebnis bezifferte den wirtschaftlichen Wert öffentlicher Daten,<br />
das sind Daten, die von öffentlichen Institutionen oder in deren Auftrag von privaten Institutionen<br />
erstellt wurden, mit 68 Mrd. EUR jährlich. Mit 35,8 Mrd. EUR entfallen mehr als<br />
die Hälfte davon auf den Bereich der Geographischen Information. Obwohl die PIRA Studie<br />
den Wert der PSI deutlich niedriger einstuft als dies vergleichbare Studien in den USA<br />
tun, hat das Ergebnis bewirkt, dass der Wirtschaftsfaktor PSI und Geographische Information<br />
als Teil davon erkannt und deren Auswirkungen auf Steuereinnahmen und Arbeitsplatzbeschaffung<br />
bewusst wurden. Es wurde aber durch die Studie auch deutlich, wie weit bestehende<br />
Nutzungsmodelle für Daten des öffentlichen Sektors deren wirtschaftliche Nutzung<br />
behindern und den Wirtschaftsfaktor nicht voll ausnützen lassen. Diese Situation kann nur<br />
durch Maßnahmen einer dringend notwendigen Datenpolitik geändert werden.<br />
Die Europäische Kommission hat aufgrund der Ergebnisse der PIRA Studie im Jänner 2002<br />
die Vorbereitung einer Rahmenrichtlinie zur wirtschaftlichen Nutzung von Daten des öffentlichen<br />
Sektors vorbereitet. Geographische Information ist ein wesentlicher Teil dieser<br />
Daten und daher wird auch die Umsetzung dieser Richtlinie Auswirkungen auf den GI<br />
Sektor zeigen.<br />
Nach dem derzeitigen Stand der Verhan<strong>dl</strong>ungen im Europäischen Rat und Europäischen<br />
Parlament, das im Herbst 2003 die Rahmenrichtlinie beschließen sollte, ist grundsätzlich die<br />
webbasierte Bereitstellung von Daten des öffentlichen Sektors vorgesehen, zu einer von den<br />
Mitgliedsländern gewählten richtlinienkonformen Preisgestaltung, die die wirtschaftliche<br />
Nutzung in keiner Weise beeinträchtigt. Von der ursprünglich vorgesehenen nahezu kostenlosen<br />
Abgabe von Daten in Anlehnung an die Preispolitik der USA ist im Zuge der Diskussionen<br />
des Richtlinientextes in den verschiedenen Gremien nun eine moderate Preisgestaltung,<br />
die unwesentliche Gewinne für den (öffentlichen) Datenbereitsteller gestattet, möglich.<br />
Die ausschließliche Einsichtnahme in Datenbestände soll für den Einzelbenutzer weitgehend<br />
kostenfrei erfolgen. Der Richtlinienentwurf enthält wesentliche Forderungen für die<br />
Bereitstellung von Metadatendiensten, die jedenfalls auch kostenfrei gestaltet werden sollen<br />
und die das Auffinden und die Qualifizierung von Daten erleichtern sollen. Metadaten werden<br />
als wesentlich für die umfassende Nutzbarmachung der Daten angesehen.<br />
Die Umsetzung der Maßnahmen aus der Rahmenrichtlinie erfordert von den Mitgliedsländern<br />
einerseits eine Vernetzung bestehender Infrastruktureinrichtungen, die Einrichtung von<br />
integrierten Systemen und eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Einrichtungen des<br />
öffentlichen Sektors und zwar sowohl fachübergreifend als auch zwischen den einzelnen<br />
Verwaltungsebenen eines Staates. Die notwendigen Schritte bedürfen einer verstärkten
92<br />
G. Schennach<br />
Koordination auf nationaler Ebene, gegebenenfalls gestärkt durch legistischen Begleitmaßnahmen.<br />
Im Falle einer Beschlussfassung der Rahmenrichtlinie im Europäischen Parlament sind die<br />
einzelnen Mitgliedsstaaten aufgrund ihrer Beitrittsverträge verpflichtet, das Rahmenwerk<br />
innerhalb einer festzusetzenden Frist in nationales Recht umzusetzen bzw. bestehende nationale<br />
Rechtsvorschriften, die der Rahmenrichtlinie entgegenstehen, zu adaptieren.<br />
Bei Beschlussfassung im Herbst 2003 ist die Frist für die Umsetzung durch die Mitgliedsländer<br />
bis 2005 zu erwarten, ein Zeitraum, der die laufenden Aktivitäten auf dem GI Sektor<br />
positiv beeinflussen hilft.<br />
5 INSPIRE<br />
Das Bestreben nach einer gemeinsamen Umweltpolitik in der EU sowie die Notwendigkeit,<br />
dem einzelnen Bürger den Zugang zu Informationen der Umwelt zu ermöglichen, hat die<br />
Europäische Kommission im Jahre 2001 dazu veranlasst, über den Aufbau eines gesamteuropäischen<br />
Umweltinformationssystems zu diskutieren und die Möglichkeiten für einen<br />
Aufbau zu ermitteln. Die Initiative wurde von der Generaldirektion Umwelt gestartet und<br />
aufgrund ihrer politischen und auch wirtschaftlichen Bedeutung von weiteren Generaldirektionen<br />
unterstützt, ein wesentlicher Faktor zur Vorbereitung einer Rahmenrichtlinie.<br />
Die Ausgangslage für die Initiative zur Bereitstellung von Umweltdaten stellte sich ähnlich<br />
wie bei Aufgabenstellungen für Geographische Informationen dar: zwischen den betroffenen<br />
Institutionen mangelt es sowohl grenz- wie auch bereichsüberschreitend an Koordination,<br />
die einzelnen Verwaltungsebenen bauen z. T. singuläre Systeme auf, die sich für eine<br />
zukunftsweisende Infrastruktur als nicht ausbaufähig erweisen, die Verfügbarkeit von Daten<br />
ist durch technische oder rechtliche Barrieren erschwert. Auffällig ist eine starke Fragmentierung<br />
von Daten in den einzelnen Ebenen und Bereichen und das Auftreten starker Redundanzen<br />
zwischen den Datenbeständen, die zudem ähnlich wie die einzelnen Systeme<br />
nicht kompatibel sind. Letztlich finden sich immer wieder wesentliche Beschränkungen<br />
durch ungünstige Preispolitik für die Nutzer, durch Einschränkungen durch benutzerfein<strong>dl</strong>iche<br />
Nutzungsrechte oder Lizenzregelungen.<br />
Bald nach Beginn der Diskussionen zeigte sich die unbedingte Notwendigkeit, die Umweltinformationen<br />
in einem geographischen Referenzsystem zu bearbeiten und durch eine<br />
Rahmenrichtlinie in eine europäische Infrastruktur INSPIRE (Europäische Infrastruktur für<br />
Geographische Information) einzubetten.<br />
Die erste Phase der Vorbereitung für eine Rahmenrichtlinie war durch eine intensive Bestandsaufnahme<br />
der Ausgangssituation in den einzelnen Mitgliedsländern zur Abschätzung<br />
notwendiger Maßnahmen für eine Infrastruktur und der Definition einer grun<strong>dl</strong>egenden<br />
Arbeitsrichtung gekennzeichnet. In einer von der Europäischen Kommission DG Umwelt in<br />
Auftrag gegebenen Studie hat die Universität Leuwen die Geodateninfrastrukturen in 32<br />
europäischen Ländern untersucht und in einem weiteren Schritt eine detaillierte Bestandsaufnahme<br />
in 9 repräsentativen Ländern durchgeführt. Aus den vergleichenden Analysen<br />
wurde festgestellt, dass das Vorhandensein einer Infrastruktur wesentlich mit der staatlichen<br />
Struktur eines Landes zusammenhängt, da Kompetenzregelungen für eine derartige
Vernetztes Europa – GI-Initiativen in der EU 93<br />
Koordinationsaufgabe mitbestimmend wirken. Weiters zeigte sich deutlich, dass die Einrichtung<br />
einer Infrastruktur für Geographische Information als Aufgabe der öffentlichen<br />
Hand zu sehen ist und der Betrieb eines solchen Systems bzw. die Finanzierung eines laufenden<br />
Systems durch geeignete PPP Modelle erfolgen kann. Einrichtung und Betrieb erfordern<br />
die Zusammenarbeit aller Beteiligter aus dem öffentlichen und privaten Bereich,<br />
wodurch wiederum die Notwendigkeit für eine Koordinierungsstelle entsteht, die auf breiter<br />
Basis agiert.<br />
Unabhängig von der Studie über die Situation in den europäischen Staaten wurden von<br />
unabhängigen Arbeitsgruppen sechs Grundprinzipien für die weiterführende Arbeit evaluiert,<br />
diese geben die Situation und Anforderungen gut wieder:<br />
• Daten sollen nur einmal gesammelt und nur dort verwaltet werden, wo dies am effektivsten<br />
geschehen kann.<br />
• Räumliche Informationen aus verschiedenen Quellen müssen innerhalb Europas nahtlos<br />
kombinierbar sein und von vielen Benutzern und Anwendungen gemeinsam verwendet<br />
werden können.<br />
• Es muss möglich sein, Daten, die in einer Ebene erstellt worden sind, in all den anderen<br />
Ebenen ebenfalls zu nutzen, z. B. detaillierte Daten für genaue Untersuchungen,<br />
Übersichtsdaten für planerische Zwecke.<br />
• Geographische Information, die für eine effektive Verwaltung in allen Ebenen benötigt<br />
wird, sollte unter Bedingungen, die weitreichende Anwendungen ermöglichen, verfügbar<br />
und zugänglich sein.<br />
• Geographische Information muss leicht ausfindig gemacht werden können, erkennen<br />
lassen, welchen Anforderungen sie gerecht werden kann und unter welchen Bedingungen<br />
sie erhältlich ist und weiterverarbeitet werden kann.<br />
• Geographische Daten müssen leicht verstän<strong>dl</strong>ich und im entsprechenden Kontext leicht<br />
interpretierbar sein sowie mittels benutzerfreun<strong>dl</strong>ichen Visualisierungsmethoden auswählbar<br />
gemacht werden.<br />
Für die Bereitstellung der Daten wurden 17 Hauptkategorien und 60 Subkategorien mit<br />
definierten Qualitätsmerkmalen definiert.<br />
1. Geographische Lage<br />
2. Verwaltungseinheiten<br />
3. Eigentum, Gebäude und Adressen<br />
4. Höhe<br />
5. Geo-physikalische Daten<br />
6. Luft und Klimadaten<br />
7. Hydrographie<br />
8. Meere und Gewässer<br />
9. Biologie/Naturvielfalt<br />
10. Geländedaten / Nutzung<br />
11. Naturreserven<br />
12. Transport<br />
13. Nutzung und Einrichtungen<br />
14. Raumplanung<br />
15. Naturgefahren und Umweltgefahren
94<br />
G. Schennach<br />
16. Belastete Gebiete<br />
17. Gesellschafts- und Bevölkerungsdaten<br />
Es war von Anfang an erklärtes Ziel der Europäischen Kommission, INSPIRE auf einer<br />
möglichst breiten Basis zu erstellen und alle Beteiligten bereits in der Vorbereitungsphase<br />
für die Rahmenrichtlinie einzubinden. Die Möglichkeit einer aktiven Einbringung von Beiträgen<br />
wurde im Rahmen eines öffentlichen Online-Stellungnahmeverfahrens geboten, über<br />
einschlägige Fachorganisationen und Interessensvertretungen wurde versucht, möglichst<br />
viele Beteiligte für eine Mitarbeit zu animieren. Die zahlreichen Beiträge in dem Online-<br />
Verfahren zeigen einerseits eine Beteiligung aus allen Bereichen der Umweltagenden und<br />
der Geographischen Information sowie aus verschiedenen Interessensbereichen außerhalb<br />
der direkt Beteiligten. Insgesamt wurde die vorgeschlagene Zielrichtung sehr positiv beurteilt<br />
und unterstützt. Einzelne Bedenken gab es zu den aus der Umsetzungsanalyse resultierenden<br />
Kosten, die dem Umfang des Vorhabens entsprechend für die einzelnen EU Mitgliedsländer<br />
hohe finanzielle Investitionen notwendig machen und aufgrund einer erst mittelfristig<br />
wirksamen Rendite für die Wirtschaft und die Staatshaushalte möglicherweise<br />
nicht mitgetragen werden, wodurch der Umsetzungsprozess gefährdet werden könnte.<br />
Sämtliche Stellungnahmen wurden in dem derzeit in Ausarbeitung befin<strong>dl</strong>ichen Entwurf für<br />
die Rahmenrichtlinie berücksichtigt, bis Oktober 2003 soll die Rahmenrichtlinie der Europäischen<br />
Kommission vorliegen, um noch im Jahre 2003 an den Europäischen Rat und das<br />
Europäische Parlament zur Beschlussfassung zu gehen. Für den Begutachtungsprozess in<br />
diesen beiden Gremien werden ca. 18 Monate kalkuliert, damit könnte die Rahmenrichtlinie<br />
2005 in Kraft treten.<br />
6 EU Projekt GINIE<br />
Das EU Projekt GINIE wird aus Mitteln des Technologieprogramms der EU finanziert und<br />
soll eine einheitliche Strategie für den Bereich der Geographischen Information auf europäischer<br />
Ebene bewirken. Das Projekt läuft von November 2001 bis Oktober 2003 und<br />
bindet nationale und paneuropäische Fachorganisationen, die Europäische Kommission und<br />
die Industrie mit ein. Vor dem Hintergrund unterschie<strong>dl</strong>icher Rahmenbedingungen in den<br />
einzelnen EU Mitgliedsländern für den Zugang, die Verarbeitung und die Verteilung von GI<br />
innerhalb und außerhalb Europas soll GINIE zur Bewusstseinsbildung und zum Aufbau von<br />
Fachkompetenz beitragen und durch gezielte Informationskampagnen Entscheidungsträger<br />
auf nationaler und internationaler Ebene für das Thema GI sensibilisieren, um die Interessen<br />
der europäischen Wirtschaft auf diesem Gebiet nachhaltig zu sichern.<br />
GINIE empfiehlt zur Umsetzung einer europaweiten GI Strategie die Einrichtung eines<br />
Beirates für Geographische Information ABGI, dem Vertreter aus Regierungsstellen, Industrie,<br />
Forschungseinrichtungen und der Europäischen Kommission angehören. Der Beirat<br />
sollte weiterhin mit einer finanziellen und administrativen Struktur ausgestattet sein, um die<br />
Koordination der GI relevanten Angelegenheiten sicherzustellen.<br />
Als Empfehlungen für die Einrichtung einer europäischen Dateninfrastruktur werden vor<br />
allem politische und finanzielle Nachhaltigkeit genannt, d. h. langfristige Unterstützungsmaßnahmen<br />
sind notwendig, um Infrastrukturen einzurichten und zu betreiben. Als Be-
Vernetztes Europa – GI-Initiativen in der EU 95<br />
gleitmaßnahmen sind rechtliche Rahmenwerke zu schaffen, die die Nachhaltigkeit der Maßnahmen<br />
absichern und regeln. Untersuchungen im Zuge des Projektes haben ergeben, dass<br />
durch eine schrittweise Umsetzung einer Infrastruktur wesentlich bessere Erfolge erzielt<br />
werden können, da die Beteiligten im Sinne der Subsidiarität in die Lösungen eingebunden<br />
werden und die Möglichkeit einer laufenden Anpassung der Vorgangsweise günstig auf das<br />
Gesamtergebnis wirkt.<br />
7 Ausblick<br />
Die vielfältigen Aktivitäten auf europäischer Ebene, die zunehmend das Gebiet Geographische<br />
Information berühren, lassen mit einiger zeitlicher Verzögerung positive Signale für<br />
den GI Bereich in den EU Mitgliedsländern erwarten. Direktiven wie PSI oder INSPIRE<br />
sind geeignet, GI als fixen Bestandteil zu installieren und am Markt zu verankern. Die Einbindung<br />
der Mitgliedsländer und relevanter Fachinstitutionen bei der Vorbereitung von GI<br />
Initiativen gibt den Beteiligten die Möglichkeit, aktiv an der Gestaltung der Zukunft mitzuarbeiten.<br />
Links<br />
eEurope 2005 und Referenzdokumente siehe unter http://europa.eu.int/eeurope<br />
PSI Direktive, Informationen siehe unter www.cordis.lu/pub/econtent/docs<br />
INSPIRE, Arbeitsmaterialien und online-Konsultation siehe unter www.ec-gis.org/inspire<br />
INSPIRE Datenkategorien, Informationsfluss<br />
GINIE Zwischenergebnisse, Han<strong>dl</strong>ungsempfehlungen siehe www.ec-gis.org/ginie
geoGovernment im Schwarzwald-Baar-Kreis –<br />
eine Bestandsaufnahme<br />
Zusammenfassung<br />
Hannelore ENGESSER-SCHRÖDER und Dietrich SCHRÖDER<br />
Im Sommer letzten Jahres wurde vom Arbeitskreis „Mehr Demokratie“ im Schwarzwald-<br />
Baar-Kreis eine Untersuchung der Internetauftritte der Gemeinden und der Kreisverwaltung<br />
bezüglich ihres Beitrages zur politischen Meinungsbildung und Beteiligungsmöglichkeiten<br />
der Bürger durchgeführt. Diese Umfrage wurde im Frühjahr 2003 von den Autoren im Hinblick<br />
auf die Unterstützung des Informationsangebotes durch Geoinformationen und der<br />
Partizipationsmöglichkeiten der Bürger bei räumlichen Planungsprozessen durch das Internet<br />
erweitert. Während die Ergebnisse des ersten Teils der Untersuchung durchaus Anlass<br />
zum vorsichtigem Optimismus geben, dass sich mit Hilfe des Internets die Einbindung des<br />
Bürgers in die Politik seiner Gemeinde verbessern wird, zeigt der zweite Teil der Untersuchung,<br />
dass die Unterstützung durch Geoinformation erst in den Anfängen steckt.<br />
1 Einleitung<br />
Ohne Zweifel hat das Internet in den letzten Jahren auf dem Medienmarkt zu einer Revolution<br />
geführt. „Kein Stein wird auf dem anderen bleiben!“ prognostizierte der Unternehmensberater<br />
Roland Berger im Hinblick auf die Entwicklung der neuen Informations- und<br />
Kommunikationstechnologien im 21. Jahrhundert 1998 vor dem Deutschen Bundestag<br />
(DEUTSCHER BUNDESTAG 1998). Für viele Menschen ist das Internet heute selbstverstän<strong>dl</strong>icher<br />
Bestandteil des Alltags, die Verbreitung mit ca. 40 % der Haushalte mit Internet-Anschluss<br />
in Deutschland (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2002) entspricht dabei dem europäischen<br />
Durchschnitt. Die rasante technologische Entwicklung der letzten Jahre kann nicht<br />
ohne Auswirkung auf Verwaltung und Politik bleiben. Es ergeben sich neue Chancen im<br />
Hinblick auf elektronische Demokratie (e-Democracy) bzw. auf virtuelles Regieren (e-<br />
Government). Chancen insofern, dass das Internet im Prinzip in der Lage ist, politische<br />
Gleichheit zu fördern und zu einer Stärkung der politischen Informations-, Diskussions- und<br />
Partizipationsmöglichkeiten der Bürgerinnen und Bürger beizutragen. Untersuchungen des<br />
Angebots der öffentlichen Verwaltungen im Hinblick auf diese Kriterien gibt es zahlreiche,<br />
die sich allerdings meist mit dem Angebot einzelner Kommunen oder herausragender Pilotprojekte<br />
beziehen, z. B. DRÜKE 2003.<br />
Der Arbeitskreis „Mehr Demokratie“ im Schwarzwald-Baar-Kreis führte dagegen eine<br />
Bestandsaufnahme des Angebots der öffentlichen Verwaltung flächendeckend im Kreisgebiet<br />
durch. Untersucht wurden dabei die Informations-, Diskussions-, und Partizipationsmöglichkeiten<br />
über das Internet, soweit sie sich dem Bürger bieten. Sicherlich ist dies nur<br />
ein kleiner Ausschnitt aus dem sehr komplexen Thema e-Government. Nicht berücksichtigt<br />
bleibt bei der Bestandsaufnahme die interne Sicht, eine konsequente Anwendung des e-
98<br />
H. Engesser-Schröder und D. Schröder<br />
Government wird ohne Zweifel auch große Auswirkung auf die interne Struktur der Verwaltung<br />
haben. „Nicht die Homepage im Internet ist E-Government, sondern die technikinduzierte<br />
Verwaltungsreform“ (WULFF 2003) ist die andere Seite der Medaille, die hier<br />
außer Acht bleiben soll. Am Erfolg versprechendsten ist wohl der Ausgleich dieser beiden<br />
Extrempositionen, das so genannte „Balanced-e-Government: Ein effizientes Angebot wird<br />
nur möglich, wenn der Nutzer tatsächlich einen Nutzen sieht. Auch Partizipationsmöglichkeiten<br />
stellen einen solchen Nutzen dar, können aber nur dann sinnvoll genutzt werden,<br />
wenn Prozesse und Strukturen transparent dargeboten werden. Transparenz erleichtert die<br />
Orientierung, bringt Akzeptanz und schafft größere Effizienz an der Staat/Bürger-Schnittstelle.<br />
Ziel muss es sein, mit einer ganzheitlichen Strategie durch die elektronischen Medien<br />
eine Balance herzustellen zwischen der Steigerung der Verwaltungseffizienz und der Stärkung<br />
der bürgerschaftlichen Partizipation (FRIEDRICHS, HART & SCHMIDT 2002).<br />
Im Markt der modernen Informationsgesellschaft sind Geoinformationen zu einem festen<br />
Bestandteil geworden. Es gilt als allgemein anerkannt, dass ca. 80 % aller Entscheidungen<br />
im öffentlichen und privaten Leben einen raumbezogenen Charakter aufweisen bzw. durch<br />
Situationen mit Raumbezug beeinflusst werden (BUNDESAMT FÜR KARTOGRAPHIE 2002).<br />
Wenn dem so ist, dann stellt sich die Frage, welche Rolle heute bereits Geoinformation im<br />
Angebot der öffentlichen Verwaltung spielt. Ist es bereits zur Unterstützung des Informations-<br />
und Kommunikationsangebots einbezogen? Erfolgt bereits eine Einbeziehung des<br />
Bürgers in raumbezogene Planungsprozess über das Internet?<br />
Abb. 1: Der Schwarzwald-Baar-Kreis im Bundesland Baden-Württemberg
geoGovernment im Schwarzwald-Baar-Kreis – eine Bestandsaufnahme 99<br />
2 Der Schwarzwald-Baar-Kreis<br />
Der Schwarzwald-Baar-Kreis ist ein eher län<strong>dl</strong>ich geprägter Landkreis mit 210.000 Einwohnern<br />
und einer Fläche von ca. 1000 km 2 im Südwesten der Bundesrepublik Deutschland.<br />
Die Größe seiner 2 Großen Kreisstädte und 18 kreisangehörigen Städte und Gemeinden<br />
ist sehr unterschie<strong>dl</strong>ich, sie reicht von 82.000 in der Großen Kreisstadt und Sitz des<br />
Landratsamtes Villingen-Schwenningen bis hin zu kleinsten selbständigen Gemeinde mit<br />
1.400 Einwohnern. Zwischen sü<strong>dl</strong>ichem Schwarzwald und Schwäbischer Alb gelegen ist<br />
neben der Landwirtschaft und mittelständiger Industrie der Tourismus von großer Bedeutung.<br />
Insgesamt 8 der kreisangehörigen Kommunen besitzen Stadtrecht, einer davon (St.<br />
Georgen) sind außerdem noch weitere Aufgaben der kommunalen Selbstverwaltung übertragen.<br />
Daneben existieren zur Abwicklung bestimmter Verwaltungsaufgaben Gemeindeverbände,<br />
im Hinblick auf Wirtschaft und Gewerbe spielt die Zugehörigkeit zur Region<br />
Schwarzwald-Baar-Heuberg eine Rolle.<br />
3 Die Umfrage des Arbeitskreises „Mehr Demokratie“ und ihre<br />
Ergebnisse<br />
Der Verein „Mehr Demokratie“ wurde 1988 von politisch engagierten Bürgern in Deutschland<br />
gegründet. Er hat heute ca. 4000 Mitglieder und Förderer, organisiert in 11 Landesverbänden.<br />
Der Verein ist politisch neutral, er äußert sich nicht speziell zu einzelnen politischen<br />
Sachthemen. Er setzt sich vielmehr für die direkte Demokratie auf allen politischen<br />
Ebenen ein. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über Spenden und Mitgliedsbeiträge,<br />
zur Gewährleistung der Unabhängigkeit wird auf staatliche Unterstützung verzichtet<br />
(DIREKTE DEMOKRATIE 2003). Ziel ist die Mitgestaltung der Politik von Bürgerinnen und<br />
Bürgern unter anderem durch Volksabstimmungen, Bürgerbegehren und anderen Partizipationsmöglichkeiten.<br />
In dieser Hinsicht bietet das Internet ein großes Potenzial, angefangen<br />
von einer verbesserten Informationsmöglichkeit bis hin zur Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen.<br />
Nicht zuletzt aus diesem Grunde führte der Arbeitskreis „Mehr Demokratie“<br />
im Schwarzwald-Baar-Kreis eine Untersuchung der Internetauftritte der Gemeinden<br />
durch.<br />
Im Sommer 2002 erarbeitete der Arbeitskreis im Schwarzwald-Baar-Kreis einen Fragebogen<br />
„Transparenz in der Kommunalpolitik“ und untersuchte im Anschluss die 21 Homepages<br />
der Gemeinden und des Landkreises. Nachdem den untersuchten Gemeinden Gelegenheit<br />
gegeben wurde, die Ergebnisse zu überprüfen, stellte der Arbeitskreis in diesem<br />
Frühjahr die Ergebnisse vor und zeichnete die Gemeinden aus, die am besten bewertet wurden<br />
(ZEITSCHRIFT FÜR DIREKTE DEMOKRATIE 2003).<br />
Die Untersuchung der Homepages erfolgte insbesondere im Hinblick auf ihren Beitrag zur<br />
politischen Willensbildung und auf die Beteiligungsmöglichkeiten des Bürgers. Der Arbeitskreis<br />
sieht in den Internetauftritten der Gemeinden nicht nur die Möglichkeit sich vielfältig<br />
zu präsentieren und dem Bürger etliche Gänge ins Rathaus zu ersparen, sondern die<br />
Homepage könne ebenso helfen, die Politikmüdigkeit zu bekämpfen. Letztlich kann eine gut<br />
gestaltete Internet-Seite der Gemeinden durch stärkere Einbeziehung der Bürgerinnen und<br />
Bürger zu mehr „Mitmach-Demokratie“ führen.
100<br />
H. Engesser-Schröder und D. Schröder<br />
Im Einzelnen wurden folgende Punkte abgefragt:<br />
Allgemeine Informationen<br />
Gemeinderat<br />
Ortsrecht (Ortssatzungen / Haushalt)<br />
Verwaltung (Ämter, elektronische Formulare, Links zu anderen Behörden)<br />
Bürgerservice<br />
Veranstaltungen<br />
Öffentliche Ausschreibungen<br />
Bauplätze<br />
Möglichkeiten der politischen Meinungsbildung (Protokolle, Tagesordnungen)<br />
Gemeinderat<br />
Ausschüsse<br />
Protokolle<br />
Gemeinderat<br />
Ortsrecht<br />
Links zu weiteren Ämtern/Behörden<br />
Ämter<br />
Öffnungszeiten<br />
elektronische Formulare<br />
Veranstaltungen<br />
öffentliche Ausschreibungen<br />
Gästebuch<br />
Sitzungsprotokolle<br />
Archiv<br />
Tagesordnungen<br />
0 5 10 15 20<br />
Anzahl der Gemeinden<br />
Abb. 2: Die Untersuchungsergebnisse von „Mehr Demokratie“ im Detail<br />
Abbildung 2 gibt einen Überblick, welche der untersuchten Themen überhaupt auf den<br />
Homepages der Gemeinden vorhanden waren. Darüber hinaus wurde die Qualität der einzelnen<br />
Themenbereiche über eine Bewertungsmatrix gewichtet und eine Gesamtbewertung<br />
vorgenommen.<br />
Die Ergebnisse der Untersuchung und die Reaktion der Gemeinden geben Anlass zu vorsichtigem<br />
Optimismus darüber, dass das elektronische Medium des Internets die Einbindung<br />
des Bürgers in seine Gemeinde verbessern wird. Alle Gemeinden verfügen über eine<br />
eigene Homepage, allerdings variiert die Qualität stark. Nur fünf der 20 Gemeinden erreichten<br />
mehr als die Hälfte der maximal möglichen Punktzahl.<br />
Positiv fällt auf, dass drei Viertel der Gemeinden die Hälfte der maximal möglichen Punkte<br />
im Bereich „Allgemeine Informationen“ erreicht hat. Erhebliche Defizite gibt es dagegen<br />
noch beim „Bürgerservice“. Nur vier Gemeinden waren hier zufrieden stellend. Ähnlich<br />
auch die Ergebnisse im Bereich „politische Meinungsbildung“. Bemerkenswert ist, dass
geoGovernment im Schwarzwald-Baar-Kreis – eine Bestandsaufnahme 101<br />
Vorreiter keineswegs die größeren Gemeinden sind. Immerhin eröffnen acht Gemeinden<br />
und der Kreis dem Bürger ein elektronisches Forum für Meinungsäußerungen. Insgesamt<br />
lässt sich feststellen, dass die Internetauftritte der untersuchten Gemeinden, um zur politischen<br />
Meinungsbildung beizutragen und den Bürgern Beteiligungsmöglichkeiten zu eröffnen,<br />
noch einen starken Wandel erfahren müssen.<br />
Die besten Ergebnisse erzielte die Gemeinde Mönchweiler. Mit nur 3000 Einwohnern weist<br />
sie eine überdurchschnittliche Anzahl von Internetanschlüssen auf. Grund hierfür ist sicherlich<br />
die aktive Förderung der e-Community durch die Gemeinde in Form von kostenlosen<br />
Internet-Schulungen, ehrenamtlichen Online-Beratern, kostenlosen e-Mail-Adressen der<br />
Form xxx@moenchweiler.de, regelmäßigen Newslettern, kostenlosen Content-Modulen für<br />
Vereine, Themenforen, Online-Meinungsumfragen, usw. sein. Ein weiterer Ausbau insbesondere<br />
der e-Partizipation ist geplant.<br />
Die Qualität des Angebots im Schwarzwald-Baar-Kreis entspricht damit weitgehend der<br />
durchschnittlichen Nutzung von e-Government in Deutschland. So liegt nach einer EU-<br />
Untersuchung die Nutzung von e-Government-Angeboten zur Suche nach Information bei<br />
ca. 30 %, das Ausfüllen von Formularen bei ca. 19 % und die Möglichkeit e-Mail-Anfragen<br />
zu senden bei ca. 17 % (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2001).<br />
4 Erweiterung der Untersuchung<br />
4.1 geoGovernment zur Unterstützung von e-Government<br />
Wie bereits erwähnt, weisen 80 % aller Entscheidungen im öffentlichen und privaten Leben<br />
einen raumbezogenen Charakter bzw. werden durch Situationen mit Raumbezug beeinflusst.<br />
Es stellt sich daher die Frage, inwieweit heute Geoinformation zur Unterstützung des e-<br />
Government herangezogen wird. Durch die Autoren wurde daher die Bestandsaufnahme in<br />
diesem Sinne erweitert, und die Homepages der Gemeinden des Landkreises im Frühjahr<br />
2003 nochmals untersucht. Prinzipiell sind eine Reihe von möglichen Anwendungen zur<br />
Unterstützung der Information der Bürgerinnen und Bürger denkbar. Einige seien hier beispielhaft<br />
aufgezählt:<br />
Stadtplan mit Touristik, Öffentlichen Einrichtungen, Sport und Freizeit<br />
Flächennutzungsplan<br />
Landschaftspläne<br />
Bebauungspläne (Information / Beteiligung)<br />
Information zu Baugrundstücken (Wohnen, Gewerbe)<br />
städtisches Grundstücksangebot<br />
Kanalpläne<br />
Baustellenübersicht<br />
Bodenrichtwerte<br />
Schutzgebiete (Natur-, Landschaftsschutz, Biotope)<br />
Umweltinformationssysteme<br />
3D-Visualisierung mit Stadtmodell und Landschaftsmodell
102<br />
H. Engesser-Schröder und D. Schröder<br />
Diese Liste lässt sich sicher noch fortsetzen. Neben den reinen Informationsangeboten treten<br />
außerdem noch Möglichkeiten der Partizipation der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere<br />
an raumbezogenen Planungen. So ist z. B. im Aufstellungsverfahren eines Bebauungsplanes<br />
in Deutschland eine mehrstufige Bürgerbeteiligung vorgesehen, die in Pilotprojekten<br />
auch schon die Möglichkeiten des Internets miteinbezogen (TRÉNEL, MÄRKER &<br />
HAGEDORN 2001).<br />
Da eine erste Durchsicht der Homepages schnell zeigte, dass komplexe raumbezogene Anwendungen<br />
bisher kaum Eingang in das Internetangebot der untersuchten Gemeinden gefunden<br />
hatten, wurde die Untersuchung auf jegliche Verwendung von Geoinformation, auch<br />
in einfachster Form, ausgedehnt.<br />
4.2 Die Ergebnisse der erweiterten Umfrage<br />
Abbildung 3 enthält eine Zusammenfassung der Ergebnisse der erweiterten Umfrage. Es<br />
zeigt sich sehr deutlich, dass die Möglichkeiten der Unterstützung des Informationsangebotes<br />
durch Geoinformation bisher erst ansatzweise ausgenutzt werden. Selbst eine minimaler<br />
Service in Form der Bereitstellung eines Stadt- oder Ortsplanes war nur auf der Hälfte der<br />
Homepages zu finden. Die Qualität war hier sehr unterschie<strong>dl</strong>ich, sie reichte vom fast unbrauchbaren<br />
Thumb-nail bis zum ausgereiften Stadtinformationssystem (siehe Abschnitt<br />
4.3).<br />
Stadt-/Ortsplan<br />
mit Adressensuche<br />
mit erweiterter Suchfunktion<br />
Information zu Baugebieten<br />
Wohngrundstücke<br />
gewerbliche Grundstücke<br />
rechtsverbin<strong>dl</strong>icher Bebauungsplan<br />
Baustellenkataster<br />
Flächennutzungsplan<br />
Bürgerbeteiligung Bebauungsplan<br />
Landschaftspläne<br />
Bodenrichtwerte<br />
Umweltinformation<br />
0 5 10 15 20<br />
Anzahl der Gemeinden<br />
Abb. 3: Die Untersuchungsergebnisse der erweiterten Umfrage im Detail<br />
Ein zweiter Bereich der zumindest ebenfalls ansatzweise vorhanden war, ist Informationen<br />
über Baugrundstücke zur Verfügung zu stellen. Auch hier ist die Qualität sehr unterschie<strong>dl</strong>ich.<br />
Das Angebot reicht von der Vermarktung städtischer Baugrundstücke bis zur detaillierten<br />
Darstellung der rechtsverbin<strong>dl</strong>ichen Bebauungspläne zur Information der potentiellen<br />
Bauherrn.
geoGovernment im Schwarzwald-Baar-Kreis – eine Bestandsaufnahme 103<br />
Darüber hinausgehende Ansätze sind nur auf einer einzigen Homepage zu finden. So bietet<br />
die Stadt Villingen-Schwenningen eine Baustellenauskunft an. Ansätze zur Partizipation<br />
sind dagegen auf keiner der Homepages zu finden, obwohl sich zum Untersuchungszeitpunkt<br />
mehrere Aufstellungsverfahren im Bereich der Bebauungspläne in Bearbeitung fanden.<br />
Auskünfte über Flächennutzungspläne, Landschaftspläne, Bodenrichtwerte oder relevante<br />
Umweltinformationen, die in unserer Gesellschaft einen immer wichtigeren Stellenwert<br />
einnehmen, fehlen gänzlich.<br />
Insgesamt ist die Bilanz der erweiterten Umfrage daher sehr ernüchternd. Raumbezogene<br />
Informationen werden kaum zur Verfügung gestellt, Partizipationsmöglichkeiten fehlen<br />
vollständig. Im Gegensatz zu den Ergebnissen des ersten Teils sind die führenden Gemeinden<br />
in diesem Bereich die größeren Städte. Daher sei der Schluss erlaubt, dass eine Integration<br />
der Geoinformation in das allgemeine Main-stream-computing noch nicht gelungen ist.<br />
Die Bereitstellung von Geoinformation im Internet ist immer noch mit einem sehr großen<br />
Aufwand verbunden und wird daher nur unterstützt, wenn ein entsprechendes Potential bei<br />
den Gemeinden vorhanden ist.<br />
Kommunikation<br />
Beschaffungswesen<br />
Formelle und informelle Beteiligung<br />
Kultur- und Freizeit<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
Soziale Hilfen<br />
Melde- und Registerwesen<br />
Liegenschaften, Wohnen, Planen<br />
Abb. 4: Entwicklungsstand Online-Anwendungen in Städten mit 50.000 bis 100.000 Einwohnern<br />
(nach DRÜKE 2003)<br />
Dieser Befund deckt sich auch weitgehend mit anderen Untersuchungen. So zeigt Abbildung<br />
4 eine Bestandaufnahme für Mittelstädte. Vorrangig raumbezogene Anwendungen<br />
(Liegenschaften, Wohnen und Planen) sowie der formellen und informellen Beteiligung der<br />
Bürgerinnen und Bürger wird nur eine geringe Priorität beigemessen.
104<br />
4.3 Beispiele<br />
H. Engesser-Schröder und D. Schröder<br />
Abb. 5: Beispiel Orts-/Stadtpläne: Vom Thumbnail (Dauchingen) über die gescannte<br />
Karte (Schönwald) und dem externen Dienstleister mit einfacher (Vöhrenbach)<br />
bzw. erweiterter Suchfunktion (Donaueschingen) bis zum komplexen Stadtinformationssystem<br />
(Villingen-Schwenningen).
geoGovernment im Schwarzwald-Baar-Kreis – eine Bestandsaufnahme 105<br />
Abb. 6: Beispiel: Information zu Baugrundstücken: Vom Gestaltungsplan als PDF-Download<br />
(Donaueschingen) über Auszüge aus rechtsverbin<strong>dl</strong>ichen Bebauungsplänen<br />
als Übersichten (Triberg und Königsfeld) bis zu detaillierten Bebauungsplänen<br />
(Brigachtal).<br />
Links<br />
http://www.badduerrheim.de<br />
http://www.brigachtal.de<br />
http://www.braeunlingen.de<br />
http://www.dauchingen.de
106<br />
http://www.donaueschingen.de<br />
http://www.furtwangen.de<br />
http://www.guetenbach.de<br />
http://www.huefingen.de<br />
http://www.koenigsfeld.de<br />
http://www.moenchweiler.de<br />
http://www.niedereschach.de<br />
http://www.schoenwald.de<br />
http://www.schonach.de<br />
http://www.schwarzwald-baar-kreis.de<br />
http://www.st-georgen.de<br />
http://www.stadt-blumberg.de<br />
http://www.triberg.de<br />
http://www.tuningen.de<br />
http://www.unterkirnach.de<br />
http://www.villingen-schwenningen.de<br />
http://www.voehrenbach.de<br />
(alle besucht im Mai 2003)<br />
Literatur<br />
H. Engesser-Schröder und D. Schröder<br />
Bundesamt für Kartographie, Hrsg. (2003): Geoinformation und moderner Staat. Eine Informationsschrift<br />
des Interministeriellen Ausschusses für Geoinformationswesen (IMA-<br />
GI) im Jahr der Geowissenschaften 2002. Frankfurt am Main<br />
Deutscher Bundestag, Hrsg. (1998): Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft.<br />
Bericht der Enquete-Kommission „Zukunft der Medien in Wirtschaft und Gesellschaft“,<br />
Bonn, 5<br />
Direkte Demokratie (2003): Argumente, Praxis, Vorschläge. Mehr Demokratie e.V.<br />
DRÜKE, H. (2003): E-Government in Deutschland – Profile des virtuellen Rathauses. Deutsches<br />
Institut für Urbanistik, MEDIA@Komm<br />
Europäische Kommission (2002): Internet and the Public at large. Flash Eurobarometer<br />
135. EOS Gallup im Auftrag der Europäischen Kommission<br />
FRIEDRICHS, S., T. HART & O. SCHMIDT (2002): „Balanced E-Government“: Visionen und<br />
Prozesse zwischen Bürgernähe und Verwaltungsmodernisierung. In: Aus Politik und<br />
Zeitgeschichte. Beilage zur Wochenzeitung Das Parlament. B 39-40<br />
TRÉNEL, M., O. MÄRKER & H. HAGEDORN (2001): Bürgerbeteiligung im Internet — Das<br />
Esslinger Fallbeispiel. Discussion Paper FS II 01 - 308, Wissenschaftszentrum Berlin<br />
für Sozialforschung<br />
WULF, M. (2003): Nicht die Homepage im Internet ist E-Government, sondern die technikinduzierte<br />
Verwaltungsreform. Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,<br />
Köln<br />
zeitschrift für direkte demokratie (2003): Mit dem Internet zu mehr Bürgerbeteiligung.<br />
zeitschrift für direkte demokratie, 58 1/03, 19.
Zusammenfassung<br />
eGovernment und gEoGovernment –<br />
Synergien und Potenziale<br />
Roland STAHL<br />
eGovernment Initiativen und Projekte wie eEurope, BundOnline 2005, Deutschland Online,<br />
Media@Komm und andere sind die zentralen Schrittmacher im Reformpaket der Verwaltungen<br />
aller Ebenen zum Bürokratieabbau. Geo-Dienstleistungen spielen dabei eine zunehmend<br />
wichtige Rolle. Ob es nun um Administration im engeren Sinn, um Bürgerbeteiligung,<br />
Notfalldienste oder räumliche Planungsaspekte geht: viele eGovernment Dienstleistungen<br />
sind ohne ein breites solides Fundament der Geoinformatik nicht denkbar. Folgerichtig<br />
etabliert sich derzeit gEoGovernment als neuer Begriff für diesen speziellen Aspekt des<br />
eGovernment. Und darunter ist weit mehr zu verstehen als „nur“ das bekannt WebMapping.<br />
Doch die gegenseitigen Synergiepotenziale zwischen eGovernment und gEoGovernment<br />
werden von beiden Seiten bisher noch zu wenig erkannt und genutzt. Der folgende Beitrag<br />
gibt daher einen Überblick über die entscheidenden Aspekte und Lösungen von eGovernment<br />
und gEoGovernment, um am Ende darauf aufsetzend Vorschläge für die Überwindung<br />
der Synergieblockade zu entwickeln.<br />
1 Einleitung<br />
„Unter Electronic Government verstehen wir die Abwicklung geschäftlicher Prozesse im<br />
Zusammenhang mit Regieren und Verwalten (Government) mit Hilfe von Informations- und<br />
Kommunikationstechniken über elektronische Medien“ (REINERMANN & LUCKE 2002).<br />
Diese Definition macht die Breite des eGovernment-Ansatzes gleich mehrfach deutlich. Sie<br />
betont ausdrücklich den prozessbezogenen Schwerpunkt, also ein Ansatz, der über die reine<br />
Informationsbereitstellung – sei sie nun statisch oder dynamisch wie beim Web Mapping<br />
aus Geodatenbanken – weit hinausgeht. Sie beinhaltet die Aspekte der klassischen Verwaltungsaufgaben<br />
aber auch das „Regieren“. Gemeint sind damit Beteiligungsprozesse der<br />
eDemocracy wie elektronische Wahlen aber auch Beteiligung an politischen Entscheidungen,<br />
Gesetzgebungsverfahren und räumlichen Planungen. Und schließlich wird klargestellt,<br />
dass eGovernment nicht ausschließlich http-basierte Internetverfahren sein müssen, sondern<br />
die Kommunikation über elektronische Medien ganz allgemein gemeint ist.
108<br />
R. Stahl<br />
„Die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, aber auch die Lebensqualität<br />
der Bürgerinnen und Bürger hängen davon ab, wie gut und wie schnell<br />
der Staat Dienstleistungen erbringen kann. ...<br />
Die Bundesregierung will alle internetfähigen Dienstleistungen der<br />
Bundesverwaltung bis zum Jahr 2005 online bereitstellen. Sie wird<br />
gemeinsam mit den Ländern die Einführung elektronischer Dienstleistungen<br />
auf Bund-, Länder- und Gemeindeebene beschleunigen.“<br />
Bundeskanzler Schröder auf der Expo 2000<br />
EGovernment ist also das Zusammenwirken von Verwaltung mit der Wirtschaft (Government<br />
to Business, G2B), dem Bürger (Government to Citizen, G2C) und anderen Verwaltungen<br />
(Government to Government, G2G). Teilweise wird auch noch das Zusammenwirken<br />
der Verwaltungen mit Ihren Angestellten (Government to Employee, G2E)<br />
genannt.<br />
eGovernment ist derzeit in aller Munde und wird verbunden mit Hoffnungen nach Abbau<br />
von Bürokratie und in der Folge von Investitionshemmnissen und Arbeitslosigkeit. Auch für<br />
Geo-Anwendungen und Geodaten-Anbieter spielt eGovernment eine zunehmend wichtige<br />
Rolle, weshalb das Thema auf der Intergeo 2002 aufgenommen und für die AGIT 2003 und<br />
die Intergeo 2003 sogar als Schwerpunktthema gesetzt wurde.<br />
eGovernment ist bereits heute zu einer wichtigen Standortfrage geworden. Folgerichtig ist<br />
es dann auch die Wirtschaft, die vehement die Einführung von eGovernment einfordert. So<br />
erwarten laut einer Umfrage der CSC Ploenzke AG vom Sommer 2002 fast 89 % der 500<br />
größten deutschen Wirtschaftsunternehmen eine deutliche Beschleunigung der Verwaltungsverfahren,<br />
fast 65 % rechnen mit Kosteneinsparung und 35 % wären aufgrund der<br />
erwarteten Einsparungen sogar bereit, die Behörden beim Aufbau entsprechender Dienstleistungen<br />
finanziell zu unterstützen.<br />
Vor diesem Hintergrund wurden seit Mitte der 90er Jahre viele Initiativen zum eGovernment<br />
gestartet. Auf der Expo 2000 gab Bundeskanzler Schröder auch für Deutschland den<br />
Startschuss. In der Folge entstanden richtungweisende Initiativen wie BundOnline 2005,<br />
Media@Komm, KommuneOnline 2004 und aktuell die Bund-Länder-Kommunen eGovernment<br />
Partnerschaft unter dem Titel Deutschland Online.<br />
Im Geo Bereich wird der eGovernment Begriff seit Ende 2002 intensiv aufgenommen. Der<br />
Begriff gEoGovernment entstand als eine Art Kunstbegriff, angelehnt an eGovernment, der<br />
den speziellen räumlichen Aspekt innerhalb des eGovernment hervorheben soll, aber vermutlich<br />
auch als Sammelbegriff für die „GIS Community“, um deren Identifikation mit dem<br />
Thema zu verbessern. Wichtige Voraussetzung für gEoGovernment Dienstleistungen sind<br />
die Geodaten Infrastrukturen. Hierzu gab es bereits vor 2002 wichtige Ansätze in vielen<br />
Bundesländern (z. B. GDI-NRW), auf Bundesebene (GDI-DE) und auch bei der EU (s.<br />
Beitrag von SCHENNACH 2003). Die Entwicklungen des gEoGovernment basieren daher<br />
vielfach auf Lösungen und Standards der GDI Initiativen.<br />
In der vorliegenden Arbeit werden die wichtigsten eGovernment Initiativen mit Ihren Lösungen,<br />
Basiskomponenten, Standards und Rahmenbedingungen vorgestellt. Anschließend<br />
folgt der Schwenk zu den gEoGovernment und GDI Initiativen und einigen Beispielen für
eGovernment und gEoGovernment – Synergien und Potenziale 109<br />
geo-basierte Dienstleistungen. Der Beitrag endet mit Vorschlägen für eine Überwindung der<br />
noch bestehenden Kommunikationsdefizite zwischen den Treibern und Betreibern von<br />
eGovernment und gEoGovernment.<br />
2 BundOnline 2005: eGovernment Leitprojekt der<br />
Bundesregierung<br />
Nach dem Startschuss von Bundeskanzler Gerhard Schröder auf der Expo 2000 wurde im<br />
Jahr 2001 die Initiative BundOnline 2005 nach den Vorbildern aus den USA und Großbritannien<br />
ins Leben gerufen. Nach einer Vorbereitungsphase 2001/2002 sind derzeit unter der<br />
Leitung einer zentralen Stabstelle beim Bundesinnenministerium (BMI) über 20 sogenannte<br />
CATALYSTs mit zentralen Koordinationsaufgaben und der Unterstützung der Ressorts<br />
beschäftigt, damit die über 400 bisher identifizierten Dienstleistungen termingerecht online<br />
bereitgestellt werden können.<br />
Darüber hinaus arbeiten weitere Teams mit externer Unterstützung an der Entwicklung von<br />
Basiskomponenten, die für viele Dienstleistungsprojekte eine wiederverwendbare, technische<br />
Grun<strong>dl</strong>age bilden sollen. Zentral finanziert werden darüber hinaus sogenannte EfA<br />
Projekte (Einer für Alle). Die individuell entwickelten Lösungsteile stehen gemäß den sogenannten<br />
Kieler Verträgen den Verwaltungen des Bundes aber auch der Länder und Kommunen<br />
praktisch kostenfrei zur Nutzung zur Verfügung. Schließlich unterstützen Kompetenzzentren<br />
die Ressort bei verschiedenen eGovernment Kernaufgaben wie Vorgangsbearbeitung,<br />
Content Management, ePayment und Datensicherheit.<br />
Gemeinsame<br />
Prioritäten<br />
Wiederverwendbarkeit<br />
Gemeins.<br />
Standards<br />
Einer Einer für für Alle Alle Dienstleistungen Dienstleistungen (EfA)<br />
(EfA)<br />
Projektförderungs-Informationssystem Projektförderungs-Informationssystem (profi)<br />
(profi)<br />
eVergabe<br />
eVergabe<br />
Elektronischer Elektronischer Rechtsverkehr<br />
Rechtsverkehr<br />
Personalwerbung Personalwerbung und und -gewinnung<br />
-gewinnung<br />
Vorber. Vorber. politisch politisch regulativer regulativer Entscheidungen<br />
Entscheidungen<br />
Basiskomponenten<br />
Basiskomponenten<br />
Content Content Management Management System<br />
System<br />
Datensicherheit Datensicherheit / / Virtuelle Virtuelle Poststelle<br />
Poststelle<br />
Zahlungsverkehrsplattform<br />
Zahlungsverkehrsplattform<br />
Portal<br />
Portal<br />
Formularserver<br />
Formularserver<br />
Call Call Center<br />
Center<br />
OSCI<br />
"Online Services Computer<br />
Interface"<br />
Abb. 1: Aufgabenbereiche, Ziele und zentrale Elemente von BundOnline 2005
110<br />
R. Stahl<br />
2.1 BundOnline wird Deutschland Online<br />
Wie internationale Studien belegen, liegt Deutschland beim Thema eGovernment aber<br />
trotzdem oft nur im unteren Mittelfeld. Und das obwohl Deutschland mit über 5 Mio. Web-<br />
Adressen (*.de) führend ist und den Standortvorteil vergleichsweise niedriger Zugangskosten<br />
zum Internet hat.<br />
Schuld an den schlechten Platzierungen ist wesentlich die föderale Struktur der Bundesrepublik,<br />
die zu einer Zerstückelung der eGovernment Dienstleistungen der Bundes-, Landes-<br />
und Kommunalebene führt sowie Mehrfachentwicklungen und Insellösungen verursacht.<br />
Aus Nutzersicht ist diese Situation sehr ärgerlich, denn es ist häufig weder transparent,<br />
woher eine gerade benötigte Dienstleistung zu beziehen ist, noch ist es für den Nutzer<br />
von Bedeutung, ob die Dienstleistungen von der einen oder anderen Behörde angeboten<br />
wird. Erwartet wird vielmehr ein einheitlicher und übersichtlicher Zugang zu den Dienstleistungen<br />
der unterschie<strong>dl</strong>ichen Lebenslagen bzw. Nachfragesituationen.<br />
Folgerichtig steht das Jahr 2003 für die Initiative BundOnline nach den Erfolgen auf der<br />
Bundesebene nun im Zeichen der Stadt-Land-Bund Koordination; so auch das Motto des<br />
diesjährigen eGovernment Forums auf der CeBIT. Ziel ist es, Insellösungen zu vermeiden,<br />
gemeinsame Standards zu etablieren und die Entwicklungen zentraler Lösungen abzustimmen<br />
und gegenseitig nutzbar zu machen.<br />
Und so forderte Bundesinnenminister Otto Schily auf der CeBIT 2003 die Überwindung der<br />
Kleinstaaterei: „Verwaltungs- und Zuständigkeitsgrenzen dürfen wirtschaftliches Handeln<br />
im föderalen Staat nicht behindern. ... Deshalb will die Bundesregierung Länder und Kommunen<br />
beim Aufbau von eGovernment unterstützen. ... Bund Online muss Deutschland<br />
Online werden.“<br />
Um dies zu erreichen, bot Schily den Ländern und Kommunen eine eGovernment Partnerschaft<br />
an, bestehend aus vier Maßnahmenpaketen:<br />
1. Bereitstellung von zentralen eGovernment Komponenten durch den Bund<br />
2. Einladung zur Nutzung und zur Beteiligung an der Weiterentwicklung des SAGA Standards<br />
(s. u.)<br />
3. Priorisierte Umsetzung von übergreifenden Bund-Länder und Bund-Kommune Dienstleistungen<br />
4. Verbesserung der Rahmenbedingungen für eGovernment auch in Ländern und Kommunen,<br />
beispielsweise durch Forcierung der elektronischen Signatur<br />
Im Juni 2003 wurde daraufhin von der Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) eine gemeinsame<br />
Strategie für integriertes eGovernment unter dem Titel DeutschlandOnline beschlossen.<br />
Noch in diesem Sommer werden die DeutschlandOnline-Partner gemeinsam festlegen,<br />
welche Vorhaben als erste online zur Verfügung stehen sollen. Die gemeinsame Strategie<br />
wird beständig fortentwickelt. Auch das Thema Geoinformation wurde in die Agenda für<br />
Deutschland Online aufgenommen.
eGovernment und gEoGovernment – Synergien und Potenziale 111<br />
3 Zentrale Komponenten und Rahmenbedingungen für eGovernment<br />
Lösungen<br />
Wesentliche Schritte in Richtung der eGovernment Partnerschaft wurden bereits getätigt.<br />
Wiederverwendbare Lösungen und Leitfäden in verschiedenen Themenbereichen sind auf<br />
den Weg gebracht oder bereits heute nutzbar. Hierzu zählen die Basiskomponenten und EfA<br />
Projekte (Einer für Alle) aus Abbildung 1 sowie ein Wissensmanagement-System zu Bund-<br />
Online 2005, die SAGA Sammlung von eGovernment Standards (Standards und Architekturen<br />
für eGovernment Anwendungen, http://foren.kbst.bund.de/) und das eGovernment<br />
Handbuch (www.e-government-handbuch.de) als modular aufgebaute Sammlung von „Best<br />
Practices“ des eGovernment von der Strategie über die Planung bis zur Implementierung.<br />
Methoden<br />
Prozesse<br />
Modelle<br />
E-Government Client (Browser + web-basierte Applikationen)<br />
Workflow<br />
DMS<br />
E-Government Applikationen<br />
(Business Logik, Verarbeitung, Präsentation)<br />
optional: Customer Relationship Management (CRM)<br />
Sicherheit<br />
CMS<br />
Abb. 2: eGovernment-Architektur (nach SAGA)<br />
3.1 Sicherheit & digitale Signatur<br />
e-Government Service Plattform<br />
Formular Srv., eVergabe Srv.,<br />
ePayment Plattform, Web Map Server...<br />
optional: Data Warehouse<br />
Datenbank<br />
Kommunikation (Protokoll, Mid<strong>dl</strong>eware)<br />
Betriebssystem<br />
Netzwerk / Infrastruktur<br />
Als Knackpunkt im eGovernment werden die Themen Sicherheit und digitale Signatur angesehen.<br />
Im Gegensatz zum privatwirtschaftlichen Geschäftsverkehr besteht im Rahmen<br />
vieler Prozesse der öffentlichen Verwaltung das Schriftlichkeitsprinzip, welches eine sogenannte<br />
qualifizierte digitale Signatur konform zu den Vorgaben des kürzlich angepassten<br />
Signaturgesetzes (SigG) erforderlich macht. Obwohl technische Lösungen bereits verfügbar<br />
sind (z. B. das jSign Plug In der Firma CSC für Adobe Acrobat aus dem e-Vergabe Projekt)<br />
und – zumindest in der Wirtschaft – grundsätzlich eine hohe Bereitschaft zur Einführung zu<br />
verzeichnen ist, ist die Anzahl der Signaturkarteninhaber bisher viel zu gering.<br />
Aus diesem Grund wurde ein Signaturbündnis bestehend aus Vertretern der Wirtschaft und<br />
der Verwaltung eingesetzt. Ziel ist es, dass Online-Banking, elektronische Einkäufe und<br />
Behördengänge über das Internet mit ein und derselben elektronischen Unterschrift einfach<br />
und sicher möglich werden. Gemeinsam mit den Banken wurde hier kürzlich ein Durch-
112<br />
R. Stahl<br />
bruch erzielt, wie Bundeskanzler Gerhard Schröder in seiner Eröffnungsrede zur CeBIT<br />
2003 ausführte. Ab Anfang 2004 soll diese Lösung über die Bankkarten eine weite<br />
Verbreitung finden.<br />
Notwendig, nicht zuletzt auch um das Vertrauen in und damit die Akzeptanz von eGovernment<br />
zu erreichen ist es, neben der eigentlichen Signatur auch die gegenseitige Identifikation<br />
und Authentisierung von Nutzer und Behörde sicherzustellen.<br />
Die behördenseitige Bereitstellung derartiger Basistechnologie wird aber kleine Behörden<br />
gerade in den Kommunen überfordern, weshalb derzeit neben behördenübergreifenden<br />
Kooperationen auch Outsourcing Lösungen entstehen, wie beispielsweise von der deutschen<br />
Telekom, dem Partner der Initiative KommuneOnline 2004 des deutschen Städte- und Gemeindebundes.<br />
Aus dem Projekt BundOnline 2005 heraus soll dies durch die Entwicklung<br />
der Basiskomponente „virtuelle Poststelle“ umgesetzt werden.<br />
Für die Bereitstellung von Geoinformationen in Form von intelligenten, dynamischen Karten<br />
stellt die Anforderung „digitale Signatur“ jedoch ein Problem dar. Grundsätzlich können<br />
nämlich nur Dokumente digital signiert werden, deren Darstellung nicht manipulierbar ist,<br />
wie etwa bei TIFF oder PDF. Selbst Map-Dokumente wie etwa die in Anlehnung an PDF<br />
von der Firma ESRI entwickelten PMF Karten für den ArcReader erfüllen diese Anforderung<br />
(noch) aufgrund ihrer Dynamik bei der Darstellung nicht.<br />
PDF<br />
PDF<br />
Dokument<br />
Dokument<br />
(zu<br />
(zu<br />
signieren)<br />
signieren)<br />
Signatur<br />
Signatur<br />
New<br />
New<br />
PDF<br />
PDF<br />
doc<br />
doc<br />
Public Zertifikat<br />
Public<br />
key<br />
Zertifikat key<br />
Signierter<br />
Signierter<br />
Inhalt<br />
Inhalt<br />
Signatur<br />
Signatur<br />
Zertifikat<br />
Zertifikat<br />
Hashwertbildung<br />
Hashwertbildung<br />
Hashwertbildung<br />
Hashwertbildung<br />
Entschlüsselung<br />
Entschlüsselung<br />
Hashwert<br />
Hashwert<br />
Signatur<br />
Signatur<br />
Signaturerstellung<br />
Signaturerstellung<br />
Signaturüberprüfung<br />
Signaturüberprüfung<br />
Neuer Hashwert<br />
Neuer Hashwert<br />
Alter<br />
Alter<br />
Hashwert<br />
Hashwert<br />
PIN ?<br />
Prüfung<br />
Integritätscheck<br />
Gültigkeit<br />
Verschlüsselung<br />
Verschlüsselung<br />
PIN<br />
PIN<br />
Private<br />
Private<br />
key<br />
key<br />
Signature card<br />
Zertifikat<br />
Zertifikat<br />
Public<br />
Public<br />
key<br />
key<br />
TC Zertifikat<br />
Key store<br />
Trust Center<br />
validation<br />
service<br />
Abb. 3: Prinzip der digitalen Signatur bei jSign (Quelle: CSC Ploenzke AG)
eGovernment und gEoGovernment – Synergien und Potenziale 113<br />
4 Vom eGovernment zum gEoGovernment<br />
Es ist unbestritten, dass viele eGovernment Dienstleistungen ohne ein breites Fundament<br />
der Geoinformatik kaum denkbar sind. Diese Einschätzung wird mehr als deutlich unterstrichen<br />
durch die Tatsache, dass beim dritten eGovernment Wettbewerb der Firmen Bearing-<br />
Point und Cisco, unter der Schirmherrschaft von Otto Schily, zwei der vier Preisträger der<br />
Kategorie gEoGovernment unmittelbar und mittelbar zuzurechnen sind. Es handelt sich um<br />
• das Projekt „WaGIS – Wasserstraßen Geoinformationssystem des Verkehrsministeriums“<br />
und<br />
• das Projekt „Virtuelles Bauamt“ Esslingen aus der Initiative Media@Komm.<br />
Selbst im Portal www.bund.de der Initiative BundOnline 2005 existiert eine Geo-Suche.<br />
Insgesamt sind im Rahmen der Initiative BundOnline gut ein Dutzend Geo-Dienstleistungen<br />
bzw. Meta-Systeme für Zugang zu Geoinformationen gemeldet, darunter<br />
• deNIS, das deutsche Notfallvorsorgeinformationssystem,<br />
• GeoMIS.Bund, das Geo Metainformationssystem des Bundesamtes für Geodäsie und<br />
Kartographie (BKG), Geoportal.Bund und das Geodatenzentrum,<br />
• GEIN, das German Environmental Information Network des Umweltbundesamtes,<br />
• IMIS, das Integrierte Mess- und Informationssystem zur Überwachung der Umweltradioaktivität<br />
des Bundesamtes für Strahlenschutz,<br />
• verschiedene Angebote des deutschen Wetterdienstes und viele weitere.<br />
Einige GIS-Projekte des Bundes stellen ihre Inhalte aber noch nicht online bereit – weder<br />
der Öffentlichkeit, noch geschlossenen Benutzergruppen der Wirtschaft oder anderer Behörden.<br />
Tatsächlich hat der IMAGI 48 Bundeseinrichtungen identifiziert, die über Geoinformationen<br />
verfügen. In einer Studie der Firma Micus (FORNEFELD 2003) ist sogar von<br />
288 Behörden auf Bundes- und Landesebene die Rede.<br />
Andererseits sieht man vielen der 400 BundOnline Dienstleistungen ihre GIS-Relevanz auf<br />
den ersten Blick gar nicht an. So etwa die „Tollwut Surveillance“ des Bundesministeriums<br />
für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft (BMVEL) oder die Dienstleistung<br />
„Immobiliencontrolling und Bedarfskoordinierung für Liegenschaften des Bundes“<br />
(www.bundesliegenschaften.de). Und wieder andere, wie etwa das „Geographische Informationssystem<br />
Umwelt“ (GISU), das „Wasserstraßen-Geoinformationssystem“ (WaGIS)<br />
oder der „digitale Hydrologische Atlas von Deutschland“ (dHAD) verbergen sich hinter<br />
Dienstleistungen mit so allgemein gehaltenen Titeln wie „Fachinformationen bereitstellen“<br />
oder „Dienstleistungsportal“.<br />
Darüber hinaus schöpfen viele Geo-Dienstleistungen ihr tatsächliches Potenzial noch gar<br />
nicht aus. Insbesondere die Geo-Suche im Portal www.bund.de könnte in Verbindung mit<br />
GeoMIS.Bund und/oder Geoportal.Bund in Richtung eines umfassenden Zugangs zu raumbezogenen<br />
Informationen für Nutzer aus allen Bereichen vom Naturschutz und Raumplanung<br />
über Notfallvorsorge bis hin zur regionalen Wirtschaftsförderung ausgebaut werden.<br />
Hier besteht aus Sicht der GIS Branche noch Nachhol- und Koordinierungsbedarf.
114<br />
R. Stahl<br />
4.1 IMAGI Koordiniert GIS Aktivitäten auf Bundesebene<br />
Die notwendige Koordinierung und Zusammenführung von Geo-Datenbeständen und<br />
Dienstleistungen nimmt der Interministerielle Ausschuss für Geoinformationswesen<br />
(www.imagi.de) wahr. Der IMAGI ist wie BundOnline als politische Initiative entstanden<br />
und betreibt mittlerweile eine eigene Geschäfts- und Koordinierungsstelle im Bundesamt für<br />
Geodäsie und Kartographie (BKG) in Frankfurt.<br />
Aktuelle Kernaktivitäten sind der Aufbau einer Geodaten Infrastruktur Deutschland (GDI-<br />
DE ® ). Als wichtiger Bestandteile der GDI-DE ® wird das GeoPortal.Bund angesehen, das<br />
mit der Geo-Suchmaschine GeoMIS.Bund und weiteren online Diensten zentraler Zugang<br />
zur GDI-DE ® werden soll.<br />
Der IMAGI stellt damit das Bindeglied zwischen eGovernment und gEoGovernment dar.<br />
Die Zusammenarbeit mit BundOnline soll weiter verstärkt werden. Ziel muss es dabei wiederum<br />
sein, Insellösungen zu vermeiden, Standards zu setzen und gemeinsame Entwicklungen<br />
(Einer für Alle, EfA) von Geo-Dienstleistungen oder Geo-Basiskomponenten<br />
für die Nutzung bei den Bundesbehörden, aber auch bei den Ländern und Kommunen anzustoßen.<br />
Wie wichtig diese Koordinationsarbeit ist, zeigt die Tatsache, dass die Geo-Dienstleistungen<br />
im Rahmen von BundOnline bisher nicht gesondert betrachtet werden (im Gegensatz zu<br />
beispielsweise Beschaffungsdienstleistungen oder allgemeinen Antragsverfahren). Immerhin<br />
sind in SAGA auch GIS Standards wie etwa die Geography Markup Language (GML)<br />
des Open GIS Consortium (OGC) aufgeführt.<br />
4.2 Länder und Kommunen<br />
Wie auch Otto Schily bei seiner Rede zur Eröffnung des enac Forums auf der CeBIT festgestellt<br />
hat, gibt es auch auf Landes- und Kommunalebene einige sehr innovative und richtungweisende<br />
Entwicklungen im eGovernment. Dabei ist insbesondere die Initiative Media@Komm<br />
erwähnenswert, weil sich hier Entwicklungen andeuten, die auch für Geo<br />
Dienstleistungen von Bedeutung sind. Besondere Beachtung aus Sicht der GIS-Branche<br />
findet dabei die Entwicklung des virtuellen Bauamtes in Esslingen sowie der hierzu entwickelte<br />
XML-basierte Standard XBau, der auf dem allgemeinen eGovernment Kommunikationsprotokoll<br />
OSCI (Online Services Computer Interface) aufsetzt.<br />
Neben Esslingen haben sich aber auch schon eine Reihe weiterer Kommunen am „virtuellen<br />
Bauamt“ oder zumindest der Dienstleistung „Bauantrag“ bzw. „Baufreigabe“ versucht; so<br />
etwa der Kreis Borken, der Landkreis Osnabrück und das Eisenbahnbundesamt.<br />
Als weiterer Schwerpunkt von eGovernment-Lösungen im Geo Bereich kann derzeit der<br />
Bezug von Auszügen aus dem Liegenschaftskataster identifiziert werden, wie etwa im<br />
Landkreis Havelland oder bei der Stadt Dortmund.<br />
4.3 gEoGovernment Beispiele<br />
Vielfach steht der GIS-Aspekt aber gar nicht so sehr im Vordergrund der Dienstleistung,<br />
sondern entsteht durch Nutzung des GIS im Rahmen des Gesamtprozesses, ohne dass der<br />
Benutzer jemals eine Karte zu Gesicht bekommt. Beispiel hierfür ist die Hochwassermail
eGovernment und gEoGovernment – Synergien und Potenziale 115<br />
Saarbrücken. Nach Eintrag in die Adressatenliste eines Newsletters, erhalten die Nutzer im<br />
Gefahrenfall eine "Hochwassermail" als Vorwarnung, die sie über aktuelle Pegelstände und<br />
Trends der Hochwasserentwicklung informiert. Die Information erfolgt (personalisiert)<br />
bezogen auf die aktuelle Gefährdungssituation der einzelnen Liegenschaften. Es ist leicht<br />
vorstellbar, dass diese Information durch Verschneidungsalgorithmen eines GIS (Flurstück<br />
mit Gewässerverlauf und Pegelstandorten) entstehen können.<br />
Wenn die gern zitierte Behauptung, dass 80 % aller Informationen einen Raumbezug besitzen,<br />
richtig ist, zeigen diese Beispiele, welche Bedeutung Geoinformation für die Bereitstellung<br />
von eGovernment Dienstleistungen haben bzw. haben könnten. Könnten deshalb,<br />
weil viele Dienstleistungen diesen Aspekt – obwohl sinnvoll – noch nicht für sich entdeckt<br />
haben, wie z. B. der Roomscout (www.roomscout. nrw.de) in NRW.<br />
Besonders interessante gEoGovernment Angebote findet man derzeit vorwiegend in den<br />
USA. Kein Wunder, denn die USA investierten mehrere Milliarden Dollar jährlich in den<br />
Aufbau von Geodateninfrastrukturen. Als Beispiele seinen hier die Angebot des Staates<br />
Texas (www.texasonline.com) genannt. Texas Online ist als Public Private Partnership<br />
(PPP) Initiative entstanden und führt seit Anfang 2002 zu erheblichen finanziellen Erfolgen<br />
durch die sogenannten Conveniance Fees (Bequemlichkeitsgebühren) für die verschiedenen<br />
Dienstleistungen, über die sich die Realisierungspartner aus der Wirtschaft ihren Return on<br />
Invest (ROI) erwirtschaften. Als Geo Dienstleistungen bietet Texas in der sogenannten<br />
„Mapping Area“ folgende Dienste:<br />
• vorgefertigte Karten (PDF)<br />
• Download von Geodatabase, Shapefiles und Metadata<br />
• interaktiv: SVG und Map Services<br />
• Aufbereitung und Bereitstellung auf CD gegen (geringes) Entgelt<br />
900,000<br />
800,000<br />
700,000<br />
600,000<br />
500,000<br />
400,000<br />
300,000<br />
200,000<br />
100,000<br />
-<br />
9,859 18,549 25,286<br />
276,980<br />
654,070 669,457<br />
752,912 782,798 764,285 765,405<br />
848,117 808,653<br />
SEP OCT NOV DEC JAN FEB MAR APR MAY JUN JUL AUG<br />
Abb. 4: Anzahl Finanztransaktionen mit Bezahldienstleistungen insgesamt auf Texas<br />
Online (Quelle: Bearingpoint)<br />
Dass auch kleine Verwaltungen in der Lage sind, Geo Dienstleistungen anzubieten beweist<br />
das Johnston County (www.johnstonnc.com/gis) mit seinen preisgekrönten GIS Angeboten.<br />
Als Beispiel aus Europa sei das Angebot der Südtiroler Landesregierung vorgestellt. Ebenfalls<br />
preisgekrönt für seine Lösungen besticht das Angebot durch den (kosten-)freien Zugang<br />
sowie seine flächendeckend verfügbaren Datenbestände (www.provinz.bz.it/<br />
kartografie).
116<br />
R. Stahl<br />
Abschließend soll noch das Virtuelle Bauamt Esslingen erwähnt werden (www.bauen.<br />
esslingen.de). Hier wurde Ende 2002 erstmals ein Bebauungsplan digital signiert. Interessant<br />
für die Geo Branche ist neben dem Virtuellen Bauamt selbst vor allem der dort entwickelte<br />
und auf OSCI basierende Standard XBau. Auf Grun<strong>dl</strong>age dieses Standards können<br />
Antragsdaten von Kunde zu Behörde und zwischen Behörden ausgetauscht werden. Die<br />
Schnittstelle legt die Grundsyntax bundesweit fest und sollte nach Vorstellung der Initiatoren<br />
normativen Charakter haben.<br />
XBau könnte somit Vorbild für weitere eGovernment Standards in der Geo-Branche (z. B.<br />
XKataster, XNotfall, XUmwelt, XPlanung etc.) sein.<br />
4.4 GDI-NRW setzt Standards für gEoGovernment<br />
Neben den stärker prozessorientierten X-Standards werden nach derzeitiger Einschätzung<br />
die gEoGovernment Standards der PPP Initiative GDI-NRW (Geodateninfrastruktur NRW)<br />
Bedeutung erlangen. Folgende, an die Vorgaben des Open GIS Consortium (OGC) angelehnte<br />
Geo-Service Standards wurden bisher definiert:<br />
• Feature Service<br />
• Coverage Service<br />
• Map Service<br />
• Catalog Service<br />
• Gazetteer Service<br />
• Pricing and Ordering Service<br />
• Coordinate Transformation Service<br />
• Authentication and Authorisation Service<br />
• NAS Service (standards based exchange interface service)<br />
• Lookup Service<br />
5 Zusammenfassung und Maßnahmenvorschläge<br />
eGovernment ist eine zentrale Säule der Verwaltung der Zukunft. Verwaltungseinheiten mit<br />
Geo-bezogenen Aufgabenstellungen sind gehalten, sich der Entwicklung nicht nur mit eigenen<br />
Dienstleistungen anzuschließen, sondern durch Nutzung der Basiskomponenten, EfA-<br />
Lösungen und Standards von ihr zu profitieren und anschließend ihre Geoinformationen in<br />
die unterschie<strong>dl</strong>ichsten Verwaltungsprozesse einzubringen. Dieser, über die aktuellen, mehr<br />
oder minder komplexen Web Mapping Dienstleistungen hinausgehende Schritt wird erst die<br />
vollen Potenziale zur Steigerung der Effizienz und Qualität des Verwaltungshandelns sowie<br />
zur Zeit- und Kosteneinsparung auf Seiten der Bürger und ganz besonders der Wirtschaft<br />
zur Entfaltung bringen. Das Potenzial ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft, wie aktuelle<br />
Marktstudien zu der Thematik eindeutig belegen (z. B. FORNEFELD 2003).<br />
5.1 Erfolgsfaktoren des eGovernment<br />
Aufgrund der übergreifenden Anforderungen und Rahmenbedingungen ist es notwendig mit<br />
entsprechenden übergreifenden Strategien zu reagieren, um Insellösungen zu vermeiden.
eGovernment und gEoGovernment – Synergien und Potenziale 117<br />
Vom Deutschen Institut für Urbanistik wurde ein entsprechendes Erfolgmodell für eGovernment<br />
entwickelt (GRABOW 2002):<br />
1. Leitbild und Strategie<br />
2. Organisation, Projekt- und Change-Management<br />
3. Anwendungen<br />
4. Nutzen und Kosten<br />
5. Angepasste Technologien und Organisation des Technikeinsatzes<br />
6. Kompetenzen, Motivation und Qualifizierung<br />
7. Schaffung von Akzeptanz, Marketing<br />
8. Kooperation und Partnerschaften<br />
9. Nachhaltige Sicherung der Ressourcen<br />
10. Rechtmäßigkeit<br />
eGovernment ist also nicht die Verwaltungsmodernisierung, sondern setzt diese voraus. Das<br />
bedeutet transparente und einheitliche Prozesse.<br />
5.2 Defizite und Maßnahmenvorschläge<br />
Für das gEoGovernment lassen sich daraus eine Reihe von Forderungen ableiten, wie etwa:<br />
• Auflösung der Zersplitterung und Inkompatibilität von Geo Dienstleistungen die aufgrund<br />
der föderalen Struktur entstanden sind oder derzeit entstehen z. B. im Rahmen<br />
der Initiative Deutschland Online,<br />
• Verbesserung der mangelhaften Aufmerksamkeit und des schlechten Marketing für<br />
Geo-Dienste bei eGovernment Verantwortlichen und Projektleitern,<br />
• Abbau der fehlenden Bereitschaft vieler erzeugenden Stellen, ihre Geoinformationen<br />
über gEoGovernment Dienste anzubieten; durch (politischen) Druck auf die Anbieter,<br />
z. B. im Rahmen der eGovernment Initiativen BundOnline 2005 und Deutschland Online,<br />
• Vermeidung von Parallelentwicklungen der eGovernment und GDI Initiativen durch<br />
Bildung von Arbeitskreisen und/oder Foren ,<br />
• Förderung der Entwicklung von Geo Basiskomponenten und EfA Lösungen<br />
• Verbesserung der Nutzung allgemeiner eGovernment Basislösungen durch gEoGovernment<br />
Verantwortliche und Vermeidung eigener Insellösungen durch Abbau von Informationsdefiziten,<br />
• Vereinheitlichung von Kommunikationsflüssen und Prozessen im Geo Bereich nach<br />
dem Vorbild der OSCI-basierten XStandards (z. B. XKataster, XFNP, ...),<br />
• Einarbeitung von Geo Standards in SAGA,<br />
• Verbesserung der gesetzlichen Rahmenbedingungen (Informationsfreiheitsgesetz),<br />
• und weitere Maßnahmen.<br />
Als Fazit bleibt festzuhalten, dass bereits viele Initiativen der Verantwortlichen Behörden,<br />
des IMAGI, des DDGI und der Initiative D21 angestoßen wurden, die genannten Defizite<br />
abzubauen. Probleme wie z. B. das Fehlen von Preismodellen wurden erkannt und angegangen.<br />
Dennoch bleiben viele Probleme weiter ungelöst. Als Konsequenz wäre die Forderung<br />
nach einem umfassen „MASTRETPLAN“ gEoGovernment aufzustellen.
118<br />
Literatur<br />
R. Stahl<br />
BLASCHKE, P., KARRLEIN, W. & ZYPRIES, B. (2002): E-Public. Springer Verlag<br />
FORNEFELD, M., OEFINGER, P. & RAUSCH, U. (2003): Der Markt für Geoinformationen:<br />
Potenziale für Beschäftigung, Innovation und Wertschöpfung, Micus Management Consulting,<br />
im Auftrag des Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit<br />
GRABOW, B., DRÜKE, H. & SIEGFRIED, C. (2002): Raster für Rathäuser. In: Kommune 21,<br />
Ausgabe 09/2002<br />
REINERMANN, H. & von LUCKE, J. (2002): Electronic Government in Deutschland. Speyerer<br />
Forschungsberichte, Nr. 226.<br />
SCHENNACH, G. (2003): Vernetztes Europa – GI Initiativen in der EU. In: STROBL, J. &<br />
GRIESEBNER, G. (Hrsg.): geoGovernment, 72-78. Herbert Wichmann verlag, Heidelberg
Abstract<br />
Balanced gEo-Government<br />
Harry STORCH<br />
Zur Unterstützung aller E-Tools im Rahmen des „Electronic-Government“ mit Geoinformationen<br />
wird als zentrales Projekt der Aufbau einer nationalen Geodateninfrastruktur<br />
gesehen. Eine marktoffene Geodateninfrastruktur auf der Basis international akzeptierter<br />
Standards (OGC, ISO) bildet hierbei die Voraussetzung für neue Wertschöpfungsketten bei<br />
der Gewinnung, Auswertung und Anwendung von Geoinformationen für Nutzer und Anbieter<br />
in den Verwaltungen, der Wirtschaft und Wissenschaft. Kernthese ist, dass in der<br />
neuen Wissens- und Informationsgesellschaft, auch Geoinformationen eine bedeutende<br />
Ressource darstellen. Eine Geoinformationsgesellschaft kann es sich nicht leisten, dass<br />
dieses bedeutende Wirtschaftsgut ineffektiv, d. h. in administrativen Strukturen, gemanagt<br />
wird. Es ist vielleicht nicht untypisch für ein Projekt „Geodateninfrastruktur“, dass es in der<br />
Initialphase von teilweise blindem technologischer Positivismus und einer unkritischen<br />
Marktideologie geprägt ist. Ohne das Auseinanderklaffen von Anspruch und Realität jedoch<br />
an Extrempositionen festzumachen, werden im Folgenden die wesentlichen Widersprüche<br />
des wertfreien Infrastrukturansatzes zur Erschließung der Ressource Geoinformation aufgezeigt.<br />
1 Leitbild Balanced E-Government<br />
Die zentrale Rolle von Geoinformationen in Anwendungen des 'Electronic Government' ist<br />
unbestritten. Hierbei umfasst E-Government als Oberbegriff folgende drei Bereiche<br />
(GISLER/SPAHNI 2001):<br />
• Fragen der internen und externen Verwaltungseffizienz (E-Administration), wobei neben<br />
dem klassischen organisationsinternen Einsatz von GIS-Technologie zur Unterstützung<br />
von Verwaltungsabläufen (E-Workflow) zunehmend die Dienstleistungsfunktion einer<br />
bürgernahen Verwaltung auf der Basis einer serviceorientierten Vereinfachung und Rationalisierung<br />
von Verwaltungsabläufen (E-Service) betont wird.<br />
• Den Bereich der markttransparenten und -effektiven Organisation des Vergabe- und<br />
Beschaffungswesens der Öffentlichen Verwaltung, d. h. Errichtung elektronischer<br />
Marktplätze für ihre Geschäftsbeziehungen zur freien Wirtschaft (E-Procurement).<br />
Während E-Adminstration und E-Procurement in der Grundintention auf eine Effizienzsteigerung<br />
des administrativen Systems ausgerichtet sind, zielt die dritte Säule auf die Steigerung<br />
der Transparenz und Akzeptanz von Entscheidungen des politisch-administrativen<br />
Systems:<br />
• Durch den Einsatz von Internettechnologie, definiert als breit verfügbares Informationsund<br />
Kommunikationsmedium, soll auf Basis einer offenen Bereitstellung von Informationen<br />
(one-way) sowie von interaktiven Kommunikationslösungen (two-way) die Steige-
120<br />
H. Storch<br />
rung der Transparenz, Akzeptanz und der aktiven Beteilungsmöglichkeiten innerhalb<br />
der neuen politisch-administrativen E-Strukturen sichergestellt werden (E-Democracy).<br />
Tabelle 1: Balanced „E-Government“ – Balance zwischen konträren Zielsetzungen<br />
(nach: BERTELSMANN STIFTUNG 2001, 6-7)<br />
Planungs- und Implementierungsprozess<br />
Nutzen<br />
Qualität und Quantität der Dienstleistungen<br />
• Nutzerfreun<strong>dl</strong>ichkeit und<br />
• Bandbreite<br />
. . . der umgesetzten Dienstleistungen<br />
Effizienz<br />
IT-Infrastruktur und Plattformtechnologien<br />
• Prozess-, System- u. Datenbankarchitektur<br />
• Finanz- und Ressourcenplanung<br />
• Schulung- und Qualifizierung<br />
B<br />
A<br />
L<br />
A<br />
N<br />
C<br />
E<br />
Partizipation<br />
Polit. Kommunikation u. Bürgerbeteiligung<br />
• Berücksichtigung von Nutzerwünschen<br />
• Einflussnahme und Konsultation des<br />
Bürgers bei Entscheidungsprozessen<br />
• Möglichkeiten zur öffentlichen Debatte<br />
Transparenz<br />
„gläserner Staat“<br />
• Informationen über exekutive und legislative<br />
Prozesse<br />
• Nachvollziehbarkeit der Bearbeitung von<br />
Anfragen/Anträgen<br />
• Aktualität von Informationen<br />
Innerhalb der internationalen Vergleichsstudie von E-Government-Realisierungen der<br />
BERTELSMANN STIFTUNG (2001) wird als Referenzsystem das Leitbild eines „Balanced E-<br />
Government” formuliert. Die Grundthese dieses Ansatzes ist, dass nur eine ausgewogene<br />
Balance zwischen den im Kern konträren Zielsetzungen der Bereiche E-Administration und<br />
E-Demokratie (Tabelle 1) nachhaltig die Qualität und Akzeptanz von E-Government-<br />
Anwendungen sichern kann. Eine zentrale Forderung dieses Ansatzes ist, dass bereits in der<br />
Planungs- und Implementierungsphase von E-Government-Strategien, die notwendige Balance<br />
zwischen administrativer Effizienz und bürgernaher Demokratie gesucht werden sollte<br />
(BERTELSMANN STIFTUNG 2001, 6-7).<br />
2 Leitbild offenes Geoinformationsnetz<br />
Innerhalb der aktuellen Diskussion über die Konstitution von Geodateninfrastrukturen, wird<br />
das Leitbild „offenes Geoinformationsnetz“ auf der Basis von Public-Private-Partnerships<br />
zwischen Staat, Wirtschaft und Wissenschaft formuliert. Die Kernthese dieses Ansatzes ist,<br />
dass ein so genannter „Geoinformationsmarkt“ als Basis für marktwirtschaftliche Wertschöpfungsketten<br />
etabliert werden sollte. Nur die überfällige Marktöffnung ermöglicht den<br />
barrierefreien Bezug und die effiziente Nutzung von administrativen und privaten Geodaten/-informationsdiensten<br />
und erlaubt es, das wirtschaftliche Potential eines freien Geodatenhandels<br />
für alle Marktteilnehmer, d. h. die Produzenten, Vere<strong>dl</strong>er sowie Nutzer von<br />
Geodaten(-diensten), zu erschließen (GDI NRW 2002). Mittlerweile ist es in der Geoinformations-Community<br />
allgemeiner Konsens, dass die Realisierung einer offenen Internetverfügbarkeit<br />
aller relevanten Geoinformationen der Behörden, Kommunen und privaten Anbieter<br />
auf einer standardisierten technologischen Basis (OGC, ISO) sichergestellt werden
Balanced gEo-Government 121<br />
könnte. Technologische Fragen spielen somit bei der Etablierung eines offenen Geodatenmarktes<br />
eine untergeordnete Rolle, entscheidend ist die Beseitigung von administrativen<br />
und strukturellen Barrieren.<br />
2.1 Marktbarrieren für administrative Geoinformationen<br />
Aus der Sicht der Marktöffnungsthese manifestiert die bisherige Praxis administrativer<br />
Geoinformationsstrukturen entscheidende Barrieren für die Nutzung des wirtschaftlichen<br />
Potentials von Geodaten:<br />
• Heterogener Content: Administrative Geodaten sind nicht interoperabel und beruhen<br />
nicht auf Standards.<br />
• Nutzungsentgelte (Preise): Mangelnde Transparenz und Konsistenz der Nutzungsentgelte<br />
für den Bezug von administrativen Geodaten.<br />
• Administrative Rahmenbedingungen: Uneinheitliche Vorgaben für den Bezug von Geodaten,<br />
d. h. unterschie<strong>dl</strong>iche Auslegung des Gebots der Zweckbindung von Geodaten<br />
und der Prämisse eines öffentlichen Interesses an der Nutzung von Geodaten.<br />
Abb. 1: Geodateninfrastrukturen das Instrument zur Überwindung von Nutzungsbarrieren<br />
(verändert nach GUBLER 2003, 4)<br />
Die Kernthese des offenen und marktgerechten Geodateninfrastrukturansatzes ist, dass die<br />
Beseitigung der o.g. Barrieren eine positive (markt-)öffnende Wirkung entfaltet und den<br />
volkswirtschaftlichen Nutzen von (administrativen) Geodaten für Verwaltung, Wirtschaft,<br />
Wissenschaft und den einzelnen Bürger zwangsläufig erhöht (Abbildung 1). Somit sollte E-<br />
Government im Rahmen dieser Argumentationskette eher „als eine neue Form der Wirtschaftsförderung“<br />
(MP-NRW 2002, 3) verstanden werden. Die propagierten Lösungswege<br />
für das Heterogenitätsproblem und die Problematik der Nutzungsgebühren, werden durch<br />
technologische Standardisierungs- und marktwirtschaftliche Deregulierungsargumente abgesichert:<br />
• „Standardisierter Content“: Bereitstellung standardisierter bundesweit flächendeckender<br />
Geodaten (vertikale/horizontale Integrationsmöglichkeit) als zentrale Anforderung der<br />
Geoinformationswirtschaft (MP-NRW 2002, 3 u. 40)<br />
• „Marktgerechte Preise“ für den Bezug von administrativen Geodaten: Gefordert werden<br />
im ersten Schritt zumindest transparente und konsistente (politische) „Preise“. In der<br />
Diskussion über politische Preismodelle ist eine tendenzielle Abkehr vom traditionellen
122<br />
H. Storch<br />
’Europäischen Modell’ (Partial Return on Investment), und eine stärkere Orientierung in<br />
Richtung des ’Amerikanischen Modells’ (Marginal Cost), festzustellen (INFRAS 2001 /<br />
MP-NRW 2002, 3 u. 40).<br />
Mit dem Aufbau der Infrastruktur für einen funktionierenden Markt für Geoinformationen<br />
eröffnet der politisch-administrative Bereich somit neue Freiräume indem er seine administrative<br />
Steuerungsfunktion minimiert und die Selbstregulierungskräfte eines sich entwickelnden<br />
Marktes für Geoinformationen fördert. Hauptmotivation für die Teilhabe am Markt für<br />
Geoinformationen ist entweder Informationen zu nutzen (= kaufen) oder bereitzustellen<br />
(= verkaufen) (KUHN et al. 2000, 9). Diese Nutzer bestimmen die Entwicklungsrichtung, d.<br />
h. zuletzt entscheidet der Markt.<br />
Erste Begründungsschwierigkeiten treten bei der Vereinfachung der Regelungen von Nutzungsrechten<br />
auf, um „Unternehmen grundsätzlich das Recht auf Datenbezug ein(zu)räumen,<br />
unabhängig von Branche oder Einsatzzweck“ (NRW-MP 2002, 3). Hierzu wird eine<br />
neue Art von Balance zwischen klassischer Bürgerorientierung und der Sicherstellung von<br />
Wettbewerbsvorteilen für Unternehmen anvisiert. Auch Unternehmen fordern das gleiche<br />
Recht beim Zugang zu administrationsinternen Informationsbeständen, wie sie der einzelne<br />
Bürger durch das Informationsfreiheitsgesetz (IFG) schon besitzt. Das Recht auf Akteneinsicht<br />
zur Sicherstellung der Transparenz staatlichen Handelns, soll als „rechtliche Basis“<br />
dienen, “um die ungehinderte Nutzung öffentlichen Contents durch Unternehmen rechtlich<br />
zu verankern. (…) Auf den Geodatenmarkt übertragen geht es nicht darum, Einzelfallinformationen<br />
zu erhalten, sondern umfassende, anonymisierte Informationen zu beziehen“<br />
(NRW-MP 2002, 40). Diese skurrile und rechtlich fragwürdige Argumentation zeigt die<br />
Schwächen der Deregulierungsthese, wenn es um die politische Frage nach dem Sinn einer<br />
Zweckbindung von Geodatenbeständen der öffentlichen Verwaltung sowie der Definition<br />
eines öffentlichen Interesses an der Nutzung von Geodaten geht. Somit darf bezweifelt<br />
werden, ob der Aufbau einer offenen Geodateninfrastruktur wirklich nur ein wertneutrales<br />
„Win-Win-Projekt“ darstellt.<br />
Beim freien Zugang der Öffentlichkeit wird im neuen Geodatenmarkt bald die Frage gestellt<br />
werden, ob Privatpersonen, die Geodaten kostenlos in Anspruch nehmen, ebenfalls berücksichtigt<br />
werden sollen (KUHN et al. 2000, 14). Schon in ersten administrativen E-<br />
Commerce-Konzepten wird versucht, eine feine Trennlinie zwischen gesetzlichen Pflichtbzw.<br />
Grun<strong>dl</strong>eistungen (= unentgeltlich) und darüber hinaus gehenden (nicht gesetzlich vorgeschriebenen)<br />
Zusatzleistungen (= kostenpflichtig) zu ziehen (KRAMER et al. 2000,<br />
4.4.1/HLUG 2002). Von einer Kommerzialisierung sollte man nicht blühende Beteiligungslandschaften<br />
erwarten, sondern eine wachsende Konkurrenz politisch-administrativer 'Unternehmer',<br />
die den allgemeinen Kommerzialisierungstrend der Neuen Medien auch in den<br />
Bereich des bürgerschaftlichen Engagements hineintragen. Bürger müssen in einer Kultur<br />
des „pay-per-view“ akzeptieren, dass immer mehr outgesourcte administrative Informationsdienste<br />
kostenpflichtig werden.<br />
3 gEo-Government – „Re-invent the Federal Government“<br />
Wie gezeigt, fokussiert sich die aktuelle deutsche Diskussion auf das Wirtschaftspotential<br />
von Geoinformationen. Zur Überwindung von Barrieren, die einen offenen Geoinformati-
Balanced gEo-Government 123<br />
onsmarkt behindern, ist der Aufbau von Geodateninfrastrukturen, möglichst ohne politischadministrative<br />
Kontrolle, das Instrument der Wahl (GREVE 2002, 121-123).<br />
Tabelle 2: Meilensteine auf dem Weg zur National Spatial Data Infrastructure der USA<br />
(nach TOSTA 1997 und TOSTA/DOMARATZ 1997)<br />
1990 Federal Geographic Data Committee (FDGC)<br />
Inter-agency committee of Federal agencies that collect, manage, or make use of geospatial<br />
data.<br />
1993 National Spatial Data Infrastructure (NSDI) – Projektidee<br />
Zentrales Realisierungsprojekt als Ergebnis der von Albert GORE (1993) initiierten „National<br />
Performance Review“ (Effizienz-Studie).<br />
1994 National Spatial Data Infrastructure (NSDI) – Umsetzung<br />
Clinton Executive Order: Coordinating Geographic Data Acquisition and Access: Entwicklung<br />
von Standards, Aufbau einer Clearingstelle, Koordination der Datenerstellung in Partnerschaft<br />
zwischen Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft (CLINTON 1994).<br />
Die Geschichte des Aufbaus einer nationalen “ Spatial Data Infrastructure“ (NSDI) in den<br />
Vereinigten Staaten zeigt dagegen, dass Geoinformationen in E-Government-Anwendungen<br />
eine überaus wichtige politische Bedeutung im Rahmen einer effektiven Modernisierung<br />
von Steuerungsmodellen in Politik und Verwaltung besitzen. Nach Darstellung von TOSTA<br />
(1997), die von 1992 bis 1996 maßgeblich an der Konzeption der NSDI beteiligt war, wäre<br />
die rasante Etablierung einer Geodateninfrastruktur (Tabelle 2) ohne die massive Unterstützung<br />
durch die Clinton-Administration nicht denkbar gewesen. Entscheidend für die politische<br />
Unterstützung für das Projekt Geodateninfrastruktur, war nicht die besondere Leistungsfähigkeit<br />
von Geoinformationen zur Unterstützung von raumbezogenen Entscheidungen<br />
aller Art, sondern vielmehr die Erkenntnis des damaligen Vize-Präsidenten Albert Gore,<br />
dass ein Projekt NSDI eine hohe Kompatibilität mit der politischen Agenda der Clinton<br />
Administration aufwies (TOSTA/DOMARATZ 1997, 21). Das Programm “Re-invent the Federal<br />
Government” zur Modernisierung von Politik und Verwaltung hatte das politische Ziel,<br />
“establishing accountability and control at lower levels in organizations, as well as at lower<br />
levels within the Federal-State-local Government infrastructure“ (TOSTA 1997).<br />
Diese Theorie des “New Public Management“ – in Deutschland seit Mitte der 90er unter<br />
dem Namen “Neues Steuerungsmodell“ eingeführt – zieht eine klare Trennung (Tabelle 3)<br />
zwischen politischen und administrativen Steuerungsaufgaben. Geoinformationen in Form<br />
von standardisierten Präsentationen eignen sich in hervorragender Weise für die notwendigen<br />
Controllingaufgaben im Rahmen des neuen Steuerungsmodells, da sie eine „circulation<br />
and centralization of „facts“ (JONASSE 1999) ermöglichen. Daher verspricht der Einsatz<br />
eines standardisierten Geoinformationsnetzes, die Effektivität der politischen Zielformulierung<br />
sowie die administrative Effizienz bei der politischen Zielerreichung bis in die vertikalen<br />
und horizontalen Tiefen komplexer politisch-administrativer Organisationsstrukturen<br />
kontrollieren zu können.
124<br />
H. Storch<br />
Tabelle 3: New Public Management – Neues Steuerungsmodell (nach BUDÄUS/<br />
BUCHHOLZ 1997)<br />
Politische Steuerung<br />
– die richtigen Dinge tun –<br />
Administrative Steuerung<br />
– die Dinge richtig tun –<br />
Effektivität<br />
(Leistung zu Wirkung)<br />
Effizienz<br />
(Input zu Output)<br />
Verhältnis von Leistung zu eingetretener<br />
Wirkung<br />
(politische Zielereichung)<br />
Wirtschaftlichkeit: Verhältnis von<br />
Mitteleinsatz und unmittelbarem<br />
Ergebnis (Leistung, Output).<br />
Da eine klare Orientierung am Modell der rationalen Entscheidung mit seiner Zweck-<br />
Mittel-Rationalität gegeben ist, wäre dieses Politikmodell prinzipiell – im Sinne eines “Balanced<br />
gEo-Government“ – um Elemente zur Sicherstellung einer öffentlichen Transparenz<br />
sowie entsprechender Partizipationsmöglichkeiten erweiterbar. Die Berichtsinstrumente,<br />
müssten dazu öffentlich zugänglich sein. Darüber hinaus wäre es erforderlich, die Verantwortung<br />
dezentraler/zentraler und lokaler/globaler Zuständigkeiten und Strukturen zu kommunizieren.<br />
3.1 One-Stop-Government – Integrierte Datenbestände<br />
In der zweiten Hälfte der 90er Jahre hat sich die Verwaltung durch die Einführung von<br />
Kosten- und Leistungsrechnungen zunehmend an den Effizienzkriterien der freien Wirtschaft<br />
orientiert, was sich in Kosteneinsparungen bei der administrativen Leistungserstellung<br />
niederschlägt. Mit dem Projekt E-Government soll nun die Effizienzdividende einer<br />
konsequenten E-Business-Strategie eingefahren werden. Die bedeutendste Erkenntnis des<br />
E-Business ist, dass sich Effizienzgewinne nur realisieren lassen, wenn die Produktivitätsvorteile<br />
von E-Tools auch zu einer technologisch bedingten und damit notwendigen Änderung<br />
der internen Organisationsstruktur führen.<br />
So genannte “One-Stop-Government“-Lösungen sind das dominierende Organisationsideal<br />
eines modernen E-Government (Tabelle 4). Zur Realisierung werden integrierte, bereichsübergreifende<br />
Datenbestände angelegt, um Verwaltungsdienstleistungen an einer zentralen<br />
Stelle oder mit einem elektronischen Verfahren anbieten zu können. Als Vorteil von integrierten<br />
Datenbeständen ist für die Öffentlichkeit eine Realisierung des so genannten „Lebenslagenkonzeptes“<br />
sichtbar, d. h. unterschie<strong>dl</strong>ichste Anliegen müssen nur noch über ein<br />
einziges Fenster an die Verwaltung herantragen werden. One-Stop-Government“-Lösungen<br />
sind daher sowohl im Interesse der „Kunden“ als auch der Verwaltung, denn sie ermöglichen<br />
eine Trennung von wirtschaftlicher (zentraler) Produktion und bürgerfreun<strong>dl</strong>ichem<br />
(dezentralem) Vertrieb von Verwaltungsleistungen. Klassische administrative Modernisierungshemmnisse,<br />
wie Zuständigkeitsgrenzen, Aufgabenverteilungen und Ortsgebundenheit,<br />
können ihre Bedeutung verlieren.<br />
Administrative Geodatenbestände sind aufgrund ihres „neutraleren“ Charakters gut für<br />
technologische One-Stop-Modellprojekte geeignet. Der Aufbau eines NSDI in den USA<br />
sowie die aktuelle Realisierungstendenz von Geodateninfrastrukturen zeigt, dass gEo-<br />
Government (fast) immer in „Geospatial One-Stop“-Strategien (http://www.geo-onestop.gov)<br />
münden wird.
Balanced gEo-Government 125<br />
Tabelle 4: „One-Stop-Government“-Lösungen (verändert nach OMB 2002, 13)<br />
Government to Citizen (G2C)<br />
Konzentration von Dienstleistungen<br />
• „Die Daten müssen laufen – nicht der Bürger<br />
• Dienstleistungsorientierung am „Lebenslagenprinzip“<br />
• Service-Konzentration bei einer Anlaufstelle<br />
Government to Business (G2B)<br />
Standortförderung und -pflege<br />
• Informations-, Leistungs- und Verfahrenstransparenz<br />
und die zügige Erteilung von beantragten<br />
Genehmigungen.<br />
• “digital communication with businesses using<br />
the language of E-business (XML)”.<br />
Government to Government (G2G)<br />
Integrierte Datenbestände<br />
… um Verwaltungsdienstleistungen an<br />
• einer zentralen Stelle oder mit<br />
• einem elektronischen Verfahren anbieten zu<br />
können.<br />
Interne Effizienz und Effektivität (IEE)<br />
Ressourcennutzung<br />
• Effizienter IT-Einsatz: horizontale und vertikale<br />
Daten-Integration:<br />
• Vorbild E-Business: „bring commercial best<br />
practices to key government operations“<br />
3.2 gEo-integriertes E-Government: „Privacy und Security Policies“<br />
Nur wenn die Informationsbeziehung zwischen Staat und Bürger durch ein Vertrauen des<br />
Bürgers gegenüber dem administrativen Empfänger seiner Informationen gekennzeichnet<br />
ist, können E-Government-Anwendungen überhaupt Erfolg haben. Es ist daher erforderlich<br />
transparente Sicherheitsregeln (sog. Privacy Policies und Security Policies) öffentlich zu<br />
formulieren, um “Bedenken über Datenmissbrauch durch die Behörde (Steuerfahndung,<br />
Strafverfolgung) aus(zu)räumen“ (BERTELSMANN STIFTUNG 2001, 16/17). Die wichtigste<br />
Schutzfunktion für das Vertrauen des Bürgers in die administrative Praxis der Informationsverarbeitung<br />
stellt die Zweckbindung von Datenbeständen dar. “Nur in für den Bürger klar<br />
überschaubaren Grenzen, nämlich aufgrund einer ausdrücklichen gesetzlichen Erlaubnis<br />
oder mit Einwilligung des Betroffenen, dürfen Daten auch für andere Zwecke verwendet<br />
werden “ (AG DATENSCHUTZ 2002).<br />
Von über Behördengrenzen hinweg integrierten Geoinformationen, ist es nur ein kleiner<br />
Schritt zur Optimierung der Kontrolle des Bürgers. So ist ein effektiverer Verwaltungsvollzug<br />
mit Hilfe von geo-integrierten Datenbeständen für einige schon erreicht, “wenn die<br />
Finanzbehörden mittels abgerufener Liegenschaftskarte besser die Konsistenz von Grundeigentum<br />
und Steuererklärungen überprüfen können” (REINERMANN 2002). Aus diesem<br />
Grund sieht die „Arbeitsgruppe der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes und<br />
der Länder“ (AG DATENSCHUTZ 2002) in integrierten bzw. zentralisierten Datenbeständen<br />
von E-Government One-Stop-Lösungen folgende Bedrohungen:<br />
• Gefährdung der Zweckbindung gespeicherter Datenbestände,<br />
• Gefährdung der „informationellen Gewaltenteilung“,<br />
• mangelnde Transparenz für Betroffene (wer greift zu welchem Zweck auf Daten zu) und<br />
• unzulässiges Aufspüren unbekannter Zusammenhänge mit „Data Mining“.<br />
Während das analytische Leistungspotential der Geoinformationstechnik bei der Integration<br />
von Geodaten für positiv besetzte Aufgaben z. B. im Bereich des Umweltschutzes gerne<br />
hervorgehoben wird, werden die potentiellen Gefahren einer unkontrollierten Integration<br />
von administrativen, ökonomischen und sozialen Geodaten für den Bereich des Schutzes<br />
der Privatsphäre nicht deutlich genannt (BURROUGH et al. 1997). Es ist zumindest nicht
126<br />
H. Storch<br />
unumstritten, ob Datenschutzregelungen, die sich primär auf einzelne Datenbestände beziehen,<br />
die Integrationsleistung von GI-Systemen ausreichend würdigen (BURROUGH et al.<br />
1997) und ob Integrationslimitierungen, wie sie für den administrativen Bereich gelten, in<br />
kommerziellen Anwendungsumgebungen überhaupt realisierbar sind. In offenen Geodateninfrastrukturen<br />
löst sich tendenziell die Grenze zwischen administrativen und privatwirtschaftlichen<br />
Geodaten auf. Eine logische Schlussfolgerung wäre, dass im privatwirtschaftlichen<br />
Bereich die Regelungen für Datenschutz und Sicherheit sowie die Anforderungen an<br />
die Transparenz der Informationsverarbeitung (Zwecke, Verfahren, Daten) den strengeren<br />
Anforderungen des administrativen Bereichs angeglichen werden müssten. SCHROEDER<br />
(1999) wagt einen Versuch, diese Angleichung zu definieren: „Two access standards, if<br />
established, may lead to adequate and just access across all sectors, public and private:<br />
1. All data that has been collected from or about any named entity, whether as an individual<br />
or as a community, must be available for inspection and correction.<br />
2. All system methods and rules that guide the aggregation or combination of data toward<br />
any system work output (representation) must be of open access“ (SCHROEDER 1999).<br />
Eine Erfüllung dieser Anforderungen würde für die herrschende privatwirtschaftliche Verarbeitungsstrategie<br />
auf der Basis von pseudo-anonymisierten Geoinformationen (InfasGE-<br />
Odaten 2003) eine unüberwindbare Marktbarriere für den Zugriff auf administrative Geodaten<br />
darstellen. Daher führt eine gEo-Government-Strategie mit dem Ziel einer offenen<br />
Geodateninfrastruktur zwangsläufig zu einer sich widersprechenden Praxis der Informationsverarbeitung<br />
im öffentlichen und privaten Bereich. Da die Zwecke der Informationsverarbeitung<br />
im privatwirtschaftlichen Bereich intransparent bleiben werden, kann kein akzeptables<br />
Privacy-Statement mehr formuliert werden. Eine marktoffene administrative Geodateninfrastruktur<br />
beraubt sich daher tendenziell ihrer eigenen Legitimationsgrun<strong>dl</strong>age. Die<br />
Bürger sind nicht nur Kunde der Verwaltung, sondern ihr (lokales) Wissen fließt zunehmend<br />
in Geoinformationsprodukte und -dienstleistungen des administrativen Sektors aktiv<br />
ein, d. h. es existiert auch eine Beratung der Politik durch die Bürger selbst. Diese Doppelstellung<br />
der Öffentlichkeit als Konsument und Produzent (Prosument) von Geoinformationen<br />
gilt besonders im Bereich der räumlichen Planung (STORCH 2000), sowie für administrative<br />
und sozial-statistische Daten. Diese kooperative Informationskultur wird in einem für<br />
kommerzielle Zwecke geöffneten administrativen Geodatenmarkt ohne klare Zweckbindung<br />
der Informationsverarbeitung sowie Schutzregelungen für die Privatsphäre tendenziell ausgehöhlt.<br />
4 Zusammenfassung<br />
Die aktuelle Diskussion über das Thema Geodateninfrastruktur ist hochgradig ideologischnormativ<br />
besetzt. Im Prinzip stützen sich die Promotoren einer (markt-)offenen Geodateninfrastruktur<br />
auf eine Kombination von drei Argumentationsblöcken:<br />
• Internationale Standardisierungsthese (OGC – Metadaten – Interoperabilität)<br />
• Marktüberlegenheitsthese (Deregulierungsthese)<br />
• Politisch/Administratives Steuerungsmodell (Zentralisierte Kontrolle und Steuerung)<br />
Diese Argumentationsblöcke suggerieren beim Aufbau von Organisationsstrukturen einen
Balanced gEo-Government 127<br />
natürlichen Interessenpakt zwischen Wissenschaft (Internationale OGC-Forschung), Wirtschaft<br />
(Marktpotential) und Politik („Re-Invent Government“). Die Probleme derartiger<br />
Public-Private-Partnership-Modelle zum Aufbau von Geodateninfrastrukturen sind durch<br />
den zu verzeichnenden Trend zur Verselbstständigung bedingt. Als Motiv ist die gewollte<br />
Flucht aus starren öffentlichen Anwendungs- und Rechtsstrukturen dominant, was zu einer<br />
frühzeitigen Entpolitisierung von Entscheidungen führt. Wird das zentrale Projekt 'Geodateninfrastruktur'<br />
primär als technologisches marktorientiertes Entwicklungsprojekt verstanden,<br />
d. h. konzentriert sich der öffentlichen GI-Sektor in seiner Steuerungsfunktion (E-<br />
Governance) ausschließlich auf die Implementierung elektronischer Marktplätze für GI-<br />
Dienstleistungen so wird die notwendige Integration kooperativer und partizipatorischer<br />
Elemente in die Praxis von gEo-Government fast unmöglich.<br />
Literatur<br />
AG Datenschutz (Arbeitsgruppe der Konferenz der Datenschutzbeauftragten des Bundes<br />
und der Länder) (2002): Handreichung „Datenschutzgerechtes eGovernment“.<br />
http://www.bfd.bund.de/information/eGovernment.pdf<br />
BERTELSMANN STIFTUNG, mit BOOZ, ALLEN & HAMILTON (2001): Balanced E-Government<br />
– Elektronisches Regieren zwischen administrativer Effizienz und bürgernaher Demokratie<br />
BUDÄUS, D. & BUCHHOLZ, K. (1997): Konzeptionelle Grun<strong>dl</strong>agen des Controlling in öffentlichen<br />
Verwaltungen. In: Die Betriebswirtschaft, 57, 322-337<br />
BURROUGH, P.; CRAGLIA, M.; MASSER, I. & SALGÉ, F. (1997): Geographic Information:<br />
The European Dimension. Position Statement from the European Science Foundation’s<br />
GISDATA Scientific Programme<br />
www.shef.ac.uk/uni/academic/D-H/gis/policy.html<br />
GDI NRW (Initiative Geodateninfrastruktur des Landes NRW) (2002): GDI NRW Testbed<br />
II (Flyer)<br />
www.aed-graphics.de/news/GDI_NRW_Testbed_II_flyer_020729.pdf<br />
GISLER, M. & SPAHNI, D. (2001): eGovernment – Eine Standortbestimmung. Paul Haupt,<br />
Bern<br />
GREVE, K. (2002): Vom GIS zur Geodateninfrastruktur. In: Standort – Zeitschrift für angewandte<br />
Geographie, 26 (3), 121-125<br />
GUBLER, E. (2003): Geoinformationen: ein politisches Thema? In: Newsletter e-geo.ch<br />
geoinformation 1/2003<br />
http://www.e-geo.ch/docu/Newsletter_2003_1.pdf<br />
HLUG (2002): Abschlussprotokoll: 3. Workshop WAP-Dienste für die Umweltinformationssysteme<br />
Baden-Württemberg und Hessen (14.11.2002), Wiesbaden<br />
http://www.lfu.baden-wuerttemberg.de/lfu/uis/info/workshops/20021114/protokoll.pdf<br />
InfasGEOdaten (2003): GEOscore – Erfolgsprognose bei Neukunden und Kunden mit mikrogeographischen<br />
Scorewerten<br />
http://asp.infas-geodaten.de/geoscore/info.html<br />
Infras (SIK – Arbeitsgruppe GIS) (2001): Tarifierungsstrategien für Geodaten. Schlussbericht<br />
(Zusammenfassung 23.11.01)<br />
http://infras.domainserver.ch/htdocs/downloads/B7039a-03a_Zusammenfassung.pdf
128<br />
H. Storch<br />
JONASSE, R J. (1999): Landscapes of facts: GIS, formalisms, and the topography of power.<br />
Online-Proceedings: GISOC'99 – International Conference on Geographic Information<br />
and Society, June 20-22, 1999, University of Minnesota, Minneapolis, USA<br />
http://www.socsci.umn.edu/~bongman/gisoc99/jonasse.htm<br />
KRAMER, R., TOMCZYK, P., K. TOCHTERMANN, K., SCHWARTZ, S., RAINBOLD, E., WEIDE-<br />
MANN, R., GEIGER, W. & ZILLY, G. (2000): EC-UIS – Electronic Commerce für das<br />
Umweltinformationssystem Baden-Württemberg.<br />
www.lfu.baden-wuerttemberg.de/lfu/uis/globus_direkt/globus6/10-ec-uis/gl0610.html<br />
KUHN, W., BASEDOW, S., BROX, C., RIEDEMANN, C., ROSSOL, H., SENKLER, K. & ZENS, K.<br />
(2001): Referenzmodell 3.0 – GDI Geodaten-Infrastruktur Nordrhein-Westfalen. In:<br />
media NRW: Band 26. 2001. Hrsg.: Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-<br />
Westfalen<br />
MP-NRW (Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen) (Hrsg.) (2002): Produktkonzept<br />
zur Öffnung des Geodatenmarktes (Autoren: Dr. Martin Fornefeld, Peter<br />
Oefinger MICUS Management Consulting GmbH) – NRW MEDIEN GMBH<br />
http://www.newmedianrw.de/downloads/Geodatenmarkt_MICUS_NRW_2002.pdf<br />
OMB (Executive Office of the President Office of Management and Budget) (2002):<br />
Implementing the President’s Management Agenda for E-Government: E-Government<br />
Strategy. Simplified Delivery of Services to Citizens. (February 27, 2002). Washington,<br />
D.C. 20503<br />
http://www.whitehouse.gov/omb/inforeg/egovstrategy.pdf<br />
REINERMANN, H. (2002): D21-Kongress Geoinformationswirtschaft 2002: Ergebnisse des<br />
Workshops e-Government<br />
http://www.geoinformationswirtschaft.de/media/D21-Ergebnisse-eGovernment.pdf<br />
SCHROEDER, P. (1999): Asserting New Rights to Know, Toward Community Self-Discovery<br />
(http://www.ncgia.ucsb.edu/varenius/ppgis/papers/schroeder.html)<br />
STORCH, H. (2000): Öffentliche Umweltberichterstattung auf der Grun<strong>dl</strong>age von offenen<br />
und internetbasierten Geografischen Umweltinformationssystemen – Technologische<br />
Eignungsbewertung aus Sicht der Umweltplanung, Berlin: Pro BUSINESS<br />
TOSTA, N. (1997): Building National Spatial Data Infrastructures: Roles and Responsibilities.<br />
In: Online-Proceedings: GIS/GPS Conference March 2-4 1997 Doha-Qatar<br />
http://www.gisqatar.org.qa/conf97/links/g1.html<br />
TOSTA, N. & DOMARATZ, M. (1997): The U.S. National Spatial Data Infrastructure. In:<br />
Craglia M. and Couclelis H. (Hrsg.): Geographic Information Research: Bridging the<br />
Atlantic. London: Taylor & Francis, 19-27
Ein Fall für e-GEOgovernment – Aufgrabungen im Straßenbereich<br />
und zentraler Leitungskataster<br />
am Beispiel von Wien<br />
Zusammenfassung<br />
Erich WILMERSDORF<br />
Tiefbauarbeiten im Straßenbereich sind ein Musterbeispiel für einen vielseitigen geografischen<br />
Informationsaustausch innerhalb der Stadtverwaltung und nach außen. Aus der Sicht<br />
der Stadtverwaltung bedarf der Straßenbereich einer akribischen Bewirtschaftung, um das<br />
öffentliche Interesse an diesem Raum zu vertreten. Aus der Sicht der Privatwirtschaft sollen<br />
möglichst rasch Freiräume offengelegt werden, in denen geplant und ausgeführt werden<br />
kann. Von der Idee bis zur Ausführung werden in einem wechselseitig beeinflussten Arbeitsprozess<br />
Entscheidungen getroffen, die nach einer intensiven informationstechnischen<br />
Zusammenarbeit mittels GIS ruft. In der vorliegenden Arbeit wird das eGEOgovernment<br />
Projekt vorgestellt, das die Stadt Wien zur rationellen Lösung dieser komplexen Aufgabenstellung<br />
realisiert. Es wird dabei eine Geoinformationsinfrastruktur von der Stadt zur Verfügung<br />
gestellt, die weit mehr abdeckt als für die Bewilligung der Trasse notwendig ist, aber<br />
insgesamt den Gesamtablauf auf beiden Seiten unterstützt.<br />
1 Einleitung<br />
Die Erhebung für unterirdisch errichtete Leitungen und Bauwerke gleicht einem mühsamen<br />
Hindernislauf. Zuerst müssen die planlichen Dokumentationen von einer Vielzahl von<br />
Betreibern eingesammelt werden, das sind in Wien über 30 verschiedene Stellen. Dann<br />
beginnt erst die arbeitsintensive Integration der einzelnen Operate, um aus verschiedensten<br />
Plänen (verschiedene Maßstab, Ausschnitte, Inhalt, Zeichenschlüssel) ein zweckentsprechendes<br />
geografischen Gesamtwerk für ein Projektgebiet zu erzeugen. Erst dann kann z. B.<br />
eine Trassenplanung für eine neue Leitung beginnen.. Die Gesamtkosten für diese Erhebungen<br />
sind demnach äußerst kosten- und zeitintensiv und behindern eine rasche Projektierung.<br />
Beide Partner, die Verwaltung und der Projektant sind mit Aufwänden belastet, die durch<br />
immer wiederkehrende Such- und Erhebungsarbeiten verursacht werden. Somit sind sowohl<br />
die öffentliche Hand als auch private Stellen daran interessiert, eine volkswirtschaftlich<br />
günstigere Abwicklung zu finden. Dies war der Auslöser für den Start des GIS-Projekts<br />
„digitaler Leitungskataster (dZLK)“. In diesem Projekt soll die Lage (dreidimensional) und<br />
die charakteristischen Merkmale von unterirdischen Objekten dauerhaft digital dokumentiert<br />
werden. Es soll der verbrauchte unterirdische Raum geografisch komplett dokumentiert<br />
werden. Themen des Projekts sind daher nicht nur Leitungen sondern sämtliche unterirdischen<br />
Objekte, also U-Bahntunnel, Tiefgaragen, aber auch „tote“ im Erdreich verbliebene<br />
stillgelegte Leitungen. Damit die kosten- und zeitintensive Einbautenerhebung vor einer<br />
Trassenfestlegung entfallen kann, wird eben diese Gesamtdokumentation benötigt. Weiters
130<br />
E. Wilmersdorf<br />
dient diese umfassende Dokumentation der Sicherung unterirdischer Objekte, die für Entund<br />
Versorgung im öffentlichen Interesse sind.<br />
Dies setzt eine enge Kooperation aller handelnden Personen und organisatorischen Einheiten<br />
– öffentlicher und privater Stellen – voraus. Hier setzt das eGEOgovernment Projekt<br />
ein. An Stelle aufwändigen „Nachlaufens“ soll den InteressentInnen die Lieferung ins<br />
„Haus“ angeboten werden. Voraussetzung dafür ist eine konsequente Sammlung der an<br />
verschiedenen Stellen untergebrachten und verschiedenartigen Dokumentationen in einer<br />
zentralen Datenbank. Die Stadt Wien verpflichtete deshalb alle Projektanten, ab Stichtag 1.<br />
Juni 1999 alle unterirdischen Objekte digital zu dokumentieren und der Stadtverwaltung zur<br />
Verfügung zu stellen. Bei der Einbindung des Altbestandes in das Informationssystem ist<br />
die Stadt allerdings auf die freiwillige Kooperationsbereitschaft der Betreiber angewiesen.<br />
2 GeoInformationsinfrastruktur<br />
2.1 GIS Verbund<br />
Für die Bereitstellung aktueller Geodaten hat die Stadtverwaltung einen „GIS-Verbund“<br />
eingerichtet. Er ermöglicht den Zugriff auf aktuelle Daten und unterstützt mit Analysesoftware<br />
die Kombination verschiedener geocodierter Themen aus örtlich verteilten Datenbanken<br />
und die Gewinnung von Informationen am PC Arbeitsplatz. Es handelt sich dabei um<br />
Arbeitsplätze mit GIS Lizenzen, die überwiegende Zahl wird allerdings mit webbasierten<br />
interaktiven Auskunftssystemen versorgt. Ohne zusätzliche Software können mit der Browsersoftware<br />
im interaktiven Dialog aufgabenspezifische Informationen abgerufen werden.<br />
Für das GIS-Projekt „Aufgrabungen“ stehen mehrere Datenbanken für den Informationsaustausch<br />
zur Verfügung:<br />
2.2 dZLK Datenbank<br />
2.2.1 Inhalt<br />
Von zentraler Bedeutung für dieses e-GEOgovernment Projekt ist die Datenbank des digitalen<br />
Zentralen Leitungskatasters (dZLK). Diese Datenbank ist so ausgelegt, dass sie nicht<br />
nur die Leitungen der städtischen Betriebe aufnimmt, sondern dass sie auch Daten von unterirdischen<br />
Objekten der öffentlichen Hand, privaten Leitungsbetreibern und von Privatpersonen<br />
abbildet. Sie fußt daher auf einer Zusammenarbeit zwischen all diesen Teilnehmern.<br />
Es sind zwei Typen von Datenimporten zu unterscheiden: Altbestand und Neubauten. Für<br />
Neuverlegungen hat die Stadt Wien 1999 eine gesetzliche Verpflichtung geschaffen. Bei<br />
Errichtung von unterirdischen Objekten sind seither Geometrie und technische Kenndaten<br />
der Objekte digital zu liefern. Lediglich privaten Einzelpersonen wird eine Ausnahme gewährt:<br />
es genügt ein analoger Plan, der die digitale Rekonstruktion des Objektes in einer<br />
Qualität ermöglicht, wie sie die dZLK Datenbank verlangt. Die Digitalisierung des Einmaßplanes<br />
übernimmt in diesem Fall die Stadtverwaltung selbst.
Ein Fall für e-GEOgovernment – Aufgrabungen im Straßenbereich 131<br />
Den Aufbau des dZLK DB nur auf neue Objekte zu beschränken, hätte eine lange Anlaufphase<br />
für die praktische Nutzung der dZLK DB gebracht. Deshalb wurde schon vor dem<br />
Zeitpunkt der gesetzlich verankerten Lieferverpflichtung begonnen, den Altbestand in die<br />
dZLK DB einzugliedern. Für die Übernahme der Altbestandsdaten werden Exportformate<br />
der Betreibersysteme akzeptiert. Die Trassendaten werden von der Stadt mittels Konvertierprogrammen<br />
in die einheitliche Struktur der dZLK DB gebracht. So entsteht ein homogener<br />
Gesamtbestand über alle unterirdischen Objekte.<br />
Die dZLK Datenbank ist daher ein Produkt einer systematischen Zusammenarbeit einer<br />
Interessengemeinschaft von öffentlicher Verwaltung, privatwirtschaftlichem und privaten<br />
Bereich.<br />
2.2.2 Qualitätsmerkmale<br />
Damit über die Zuverlässigkeit der dZLK-Daten jederzeit Auskunft gegeben werden kann,<br />
gibt es standardmäßig eine Qualitätskennzeichnung der Punkte getrennt nach Lage und<br />
Tiefe. Während für Neuverlegungen eine Genauigkeit im Zentimeterbereich vorgeschrieben<br />
ist, mussten für den Altbestand zusätzliche Verortungsqualitäten zugelassen werden:<br />
Grobverortung Straßenabschnittsweise<br />
Diese Qualitätsstufe stellt das Mindesterfordernis dar. Diese generalisierte Kennzeichnung<br />
ist als Überbückung für jene Leitungsdaten gedacht, für die noch keine digitalen Trassendaten<br />
verfügbar sind. Dieses Qualitätskennzeichen – nur in einigen Fällen erforderlich –<br />
erlaubt jedoch nur den Kreis der zu befragenden Stellen einzugrenzen.<br />
Die Verortung auf Straßenabschnittsbasis übernahm die Stadt Wien, in dem sie<br />
• Pläne mit Versorgungsgebietsgrenzen digitalisierten<br />
• oder Kundenadressen dem Straßenabschnitt zuordnete<br />
Diese Qualitätsstufe stellt lediglich ein geografisches Inhaltsverzeichnis pro Straßen- abschnitt<br />
dar.<br />
Rekonstruktionsgenauigkeit<br />
Weitere Verortungsqualitäten sind für Objektdaten vorgesehen, die durch digitale Rekonstruktionen<br />
aus Plänen gewonnen wurden, die eine Zentimeter genaue Verortung nicht zulassen,<br />
wie sie bei einer Neueinmessung verlangt wird.<br />
2.3 Baustelleninformationssystem<br />
Das Baustellenmeldesystem ermöglicht eine generalisierte geografische Verortung geplanter,<br />
in Arbeit befin<strong>dl</strong>icher und abgeschlossenen Baustellen. Verursacher und Zeitraum der<br />
Arbeiten ist abfragbar. Dieses System stellt ein „Frühwarnsystem“ dar und dient der Verwaltung<br />
zur zeitlichen und räumlichen Koordination der Bauarbeiten, um die Zahl der Aufgrabungen<br />
durch Zusammenlegung zu reduzieren und flankierend die verkehrsmäßigen<br />
Begleitmaßnahmen abstimmen zu können.
132<br />
Abb. 1: Grafische Baustelleninformation<br />
2.4 Mehrzweckstadtkarte<br />
E. Wilmersdorf<br />
Die Stadt Wien hat durch eine systematische Neuvermessung des gesamtem Stadtgebiets<br />
mittels digitaler Verfahrens der Photogrammetrie und Tachymetrie eine geografische Inventur<br />
der Objekte der Stadtlandschaft vorgenommen. Für Aufgrabungen ist vor allem der<br />
terrestrisch vermessene Straßenbereich von Interesse, wo alle Punkte dreidimensional im<br />
Zentimeterbereich eingemessen sind. Damit gibt es eine detaillierte Festlegung z. B. der<br />
Höhenlage im Straßenabschnitt und die genaue Lage der Hindernisse für die Aufgrabung,<br />
wie Hydranten, Lichtmasten aber auch der Standorte von Bäumen.<br />
2.5 Straßeninformationssystem (SIS)<br />
Auf Basis der flächendeckenden Straßenvermessung der Mehrzweckstadtkarte der Stadt<br />
Wien hat die Straßenverwaltung eine detaillierte Datenbank für die Bewirtschaftung des<br />
Straßenraums aufgebaut. Sie dokumentiert geografisch die Oberfläche des Straßenbereichs<br />
nach verschiedenen Gesichtspunkten. Das Straßeninformationssystem ist aber auch für jede<br />
Tiefbauarbeit von großem Nutzen. Die SIS-Datenbank beinhaltet:<br />
2.5.1 Geografische Belagsflächenstatistik<br />
Die Flächen gleicher Belagsarten sind digital erfasst (Gussasphalt, Hartgussasphalt, Asphaltbeton,<br />
Zementbetonplatten, Großsteinpflaster, usw.) . Der Straßenkonstruktion ist<br />
ebenfalls abrufbar.
Ein Fall für e-GEOgovernment – Aufgrabungen im Straßenbereich 133<br />
Abb. 2: Belagsflächenstatistik mit Straßenkonstruktion<br />
2.5.2 Geografische Nutzungsflächenbilanz<br />
Der Straßenraum wurde nach der verkehrsmäßigen Nutzung systematisch kategorisiert:<br />
z. B. Fahrbahn, Verkehrsinsel, Parkflächen auf Fahrbahn oder Gehsteig, Gleiskörper, Gehsteig<br />
mit Flächen für Einfahrt (Abbildung 3). Alle wichtigen Informationen, die bei der<br />
Projektierung von Aufgrabungen berücksichtigt werden müssen.<br />
Abb. 3: Grafische Nutzungsflächenbilanz
134<br />
3 Prozesskette Aufgrabung<br />
3.1 Meldesystem<br />
E. Wilmersdorf<br />
Für die Reservierung der Arbeiten ist die Meldung an die Koordinationsstelle der Stadt<br />
Wien erforderlich. Großen Einbautenträger steht ein Online-Anschluss zur Verfügung, der<br />
es ihnen ermöglicht direkt in der Meldedatenbank ihre Projekte örtlich zu definieren und<br />
Terminwünsche abzusetzen, ohne die Einreichstelle der Straßenverwaltung aufzusuchen.<br />
Die textliche Ortsangabe, ein adressmäßig oder straßenabschnittsweise definierter Bereich,<br />
wird mittels der geocodierten Adressen in geografische Daten des Straßennetzes (siehe<br />
Abbildung 1) übersetzt. Zur Kontrolle der Meldungen wird den großen Einbautenträgern<br />
vor Beginn der Bausaison ein Übersichtsplan zur Verfügung gestellt, damit sie die Vollständigkeit<br />
ihrer Meldungen und die Ortslage jeder einzelnen Baustellenmeldung kontrollieren<br />
können. Nach Abschluss von Aufgrabungsarbeiten wird eine zweijähriges Aufgrabungsverbot<br />
verhängt. Deshalb treffen in dem Meldesystem Bauvorhaben bis zu zwei Jahre<br />
im Vorhinein ein.<br />
3.2 Koordinierung und Bewilligung<br />
Durch den Gesamtüberblick aller Vorhaben kann die Verwaltung eine zeitliche Abstimmung<br />
mit Bauvorhaben in ihrer Umgebung vornehmen und fixiert die Bereiche, in denen<br />
das zweijährige Aufgrabungsverbot verhängt wird. In dem grafischen Baustelleninformationssystem<br />
(s. 2.3) sind sowohl Baustellenvorhaben als auch Aufgrabungsverbote geografisch<br />
abrufbar.<br />
3.3 Trassenauswahl<br />
Dem Projektanten werden für die Detailplanung aus dem GeoDatenhaushalt der Stadt weitere<br />
Daten zur Verfügung gestellt:<br />
• die gesamte Leitungsübersicht des Interessensgebiets mit den Qualitätsstufen<br />
• die grafische Belagsflächenstatistik<br />
• die Straßenflächennutzung<br />
Mit diesen Daten steht dem Projektanten eine aussagekräftige Grun<strong>dl</strong>age für die Detailplanung<br />
zur Verfügung. Er kann günstige Freiräume erkennen, aber auch im vorhinein die<br />
Kosten für die Aufgrabung in Abhängigkeit des Straßenbelags, seiner Konstruktion und der<br />
Flächennutzung (z. B. die Untertunnelung eines Gleiskörpers, die Überbrückung einer Einfahrt)<br />
ermitteln.<br />
3.4 Geografische Dokumentation und Datenlieferung<br />
Die ausführenden Stellen sind verpflichtet, die räumliche Ausdehnung der neuen unterirdischen<br />
Objekte digital zu liefern. Es sind verschiedene Datenlieferformate zulässig:<br />
• ÖNORM 2261/3 Leitungskataster<br />
• DXF Schnittstelle Leitungskataster, die sich an die ÖNOM Inhalte anlehnt<br />
• Datenbankauszüge von jenen Betreibern, die ihr Gesamtnetz liefern
Ein Fall für e-GEOgovernment – Aufgrabungen im Straßenbereich 135<br />
Spätestens zwölf Wochen nach Bauende ist die Dokumentation der neuen Einbauten digital<br />
zu liefern. Dieses temporäre Aktualitätsdefizit der dZLK DB wird mit den Aufgrabungsinformationssystem<br />
überbrückt, das alle Baustellenbereiche anzeigt, die in dieser Warteperiode<br />
abgeschlossen worden sind.<br />
3.5 Eingangsprüfung<br />
Bei Erhalt der Lieferung wird sie einer Eingangsprüfung unterzogen, die formale Fehler<br />
aufzeigt und die auch die Plausibilität kontrolliert. Abschließend wird geografisch die Vollständigkeit<br />
geprüft, wobei ein Vergleich mit den Ausmaßen der gemeldeten Baustelle angestellt<br />
wird. Zur Absicherung wird die Originallieferung archiviert, bevor die Daten in die<br />
dZLK DB überführt werden.<br />
4 Auskunftsdienste<br />
4.1 Webbasierende Auskunftsdienste<br />
Neben dem elektronischen Datenaustausch ist die Stadt Wien bestrebt, Auskunftsdienste<br />
anzubieten, die maßgeschneiderte Information in den einzelnen Arbeitsschritten des Aufgrabungsverfahrens<br />
anbieten.<br />
Damit diese Dienste ohne besonderen technische Voraussetzungen genutzt werden können,<br />
wurden webbasierte Auskunftsdienste entwickelt, die mit Standardbrowsern in Anspruch<br />
genommen werden können. Die Dienste greifen auf aktuell geführte Datenbanken zu und<br />
bieten geografische Informationen an, die vom Anwender im Dialog ausgewählt werden<br />
können.<br />
Die Aktualität der Daten verlangt schließlich nach einer automatischen Visualisierung mittels<br />
Echtzeitkartografie. Aus den ausgewählten Objektmodelldaten (Beschreibungen der<br />
Geometrie und Kenndaten) wird für die Einzelanforderung ein Kartenbild erzeugt, das Detaillierungsgrad,<br />
räumlichen Ausschnitt und damit automatisch eine maßstabsgerechte am<br />
Bildschirm lesbare Darstellung auswählt.<br />
4.2 dZLK Auskünfte<br />
Neben den Datenauslieferungen in digitaler und analoger Form für Projekte (Pkt. 4.4) ist ein<br />
umfangreicher Auskunftsdienst in Entwicklung, der vorerst nur in der Einreichstelle der<br />
Stadtverwaltung angeboten wird. Da es sich beim Zentralen Leitungskataster um durchaus<br />
schützenswerte Daten handelt, sind noch vor einer Öffnung der Webdienste nach außen<br />
Absicherungen gegen Raubkopien oder gegen einen großflächigen Einblick in die Netzdaten<br />
der Konkurrenz zu schaffen. Es wird dafür eine geografische Log-Datenbank der räumliche<br />
Abfragen entstehen, um Missbrauch zu verhindern.<br />
In der ersten Ausbaustufe ist nun dieser Intranetdienst in der Informationszentrale der Straßenverwaltung<br />
eingerichtet, der Auskunft über alle oder einzelne ausgewählte Objektklassen<br />
(z. B. Gasleitungen, Kabeltrassen, Bauwerke, usw.) anbietet.
136<br />
E. Wilmersdorf<br />
Neben dem Betreiber wird Material und Dimension ausgewiesen. Insbesondere im derzeitigen<br />
Anfangsstadium ist die Klassifizierung der Genauigkeit getrennt nach Lage und Tiefe<br />
von Bedeutung. Mit Eingabe einer Adresse oder einer Grundstücksnummer wird in einem<br />
vorgegeben Umkreis die Umgebung nach unterirdischen Hindernissen untersucht.<br />
Abb. 4: Auskunft Zentraler Leitungskataster
Ein Fall für e-GEOgovernment – Aufgrabungen im Straßenbereich 137<br />
Die dZLK DB ermöglicht durch die Gesamtschau in die unterirdische Stadtlandschaft Analysen,<br />
die bei neuen Projekten aber auch im Katastrophenfall genutzt werden können. In<br />
dem Projekt ist die Entwicklung von komplexen räumliche Analysen mittels GIS geplant,<br />
welche z. B. die Sondierung von unterirdischen Freiräumen erleichtert:<br />
z. B. Nachbarschaftsanalyse mit Berücksichtigung von Sicherheitsabständen (zu einer<br />
380 kV Leitung) und Toleranzzonen wegen minderer Qualität der Genauigkeit in<br />
Grundriss und Tiefe.<br />
Die Vorteile der Auskunftsdienste liegen auf der Hand. Ohne die einzelnen Stellen aufzusuchen,<br />
wird sich der Projektant ein Bild verschaffen können, wo noch Platz für seine Trasse<br />
ist. Besonders wertvoll ist die rasche Information, wenn im Gebrechensfall der Bereitschaftsdienst<br />
rund um die Uhr Einblick in die unterirdische Situation erhält.<br />
4.2 Baustelleninformationsdienst<br />
Für die Öffentlichkeit wurde ein Internetauskunftsdienst eingerichtet, der die Baustellenbereiche<br />
kartografisch präsentiert aber auch Auskunft über die Verkehrsumleitungen gibt.<br />
Abb. 5: Grafischer Baustellen-Internetdienst
138<br />
E. Wilmersdorf<br />
4.3 Analoger und digitaler Datenexport<br />
Die Detailplanung benötigt die geometrischen Daten aller unterirdischen Objekte in der<br />
Nachbarschaft. Zur Unterstützung für den Projektanten werden verschiedene Produkte von<br />
der Stadt für den Datenexport angeboten. Neben einer Auszeichnung wird überwiegend in<br />
digitaler Form ein Datenbankauszug ausgeliefert.<br />
Mit diesen vielfältigen Auskunftsdiensten während des gesamten Verfahrens von der Planung<br />
bis zur Ausführung soll der Informationsfluss innerhalb den Abteilungen der Stadtverwaltung,<br />
zu den Projektanten und zur betroffenen Bevölkerung sichergestellt werden.
Autorenverzeichnis<br />
AXMANN, Axel ( 6<br />
AGEO bzw. Fa. Axmann<br />
Geoinformation, Gänserndorf<br />
axel@axmann.at<br />
BAUER, Olaf ( 6<br />
Arbeitsbereich Softwaresysteme,<br />
TU Hamburg-Harburg<br />
ol.bauer@sun1.sts.tu-harburg.de<br />
CHRISTL, Arnulf ( 6<br />
Fa. CCGIS GbR, Bonn<br />
arnulf.christl@ccgis.de<br />
DÜSTER, Horst ( 6<br />
Abt. SO!GIS Koordination, Solothurn<br />
horst.duester@bd.so.ch<br />
EBNER, Matthias ( 6<br />
Institut für Geoinformation und<br />
Landentwicklung, Universität der<br />
Bundeswehr, München<br />
matthias.ebner@unibw-muenchen.de<br />
ENGESSER-SCHRÖDER,<br />
Hannelore ( 6<br />
EULITZ, Sven ( 6<br />
IVU Traffic Technologies AG, Berlin<br />
se@ivu.de<br />
FEIX, Claudia ( 6<br />
IVU Traffic Technologies AG, Berlin<br />
cf@ivu.de<br />
GASPER, Marc ( 6<br />
Universität Kaiserslautern<br />
m.gasper@arcadis.de<br />
GISSING, Reinhard ( 6<br />
Bundesamt für Eich- und<br />
Vermessungswesen, Wien<br />
reinhard.gissing@bev.gv.at<br />
GUHSE, Birgit ( 6<br />
ARCADIS Consult GmbH,<br />
Kaiserslautern<br />
b.guhse@arcadis.de<br />
HOFFMANN, Niels ( 6<br />
TU Hamburg-Harburg<br />
KANONIER, Johannes ( 6<br />
Amt der Vorarlberger Landesregierung,<br />
Bregenz<br />
johannes.kanonier@vlr.gv.at<br />
KRAUSE, Kai-Uwe ( 6<br />
Arbeitsbereich Stadt-, Regional- und<br />
Umweltplanung, TU Hamburg-Harburg<br />
k.krause@tu-harburg.de<br />
PEYKE, Gerd ( 6<br />
Fa. GISCAD-Institut, Eurasburg<br />
pcmap@t-online.de<br />
RIEDL, Manfred ( 6<br />
Amt der Tiroler Landesregierung,<br />
Innsbruck<br />
m.rie<strong>dl</strong>@tirol.gv.at<br />
SCHAEFER, Oliver ( 6<br />
IVU Traffic Technologies AG, Berlin<br />
SCHENNACH, Gerda ( 6<br />
AGEO bzw. Bundesamt für Eich- und<br />
Vermessungswesen, Innsbruck<br />
gerda.schennach@bev.gv.at<br />
SCHREILECHNER, Paul ( 6<br />
Fa. Biogis Consulting, Wals-Siezenheim<br />
paul.schreilechner@mail.biogis.at<br />
SCHRÖDER, Diedrich ( 6<br />
Hochschule für Technik, Stuttgart<br />
schroeder.fbv@fht-stuttgart.de
140<br />
STAHL, Roland ( 6<br />
Fa. CSC Ploenzke<br />
rstahl2@csc.com<br />
STORCH, Harry ( 6<br />
Lehrstuhl Umweltplanung, BTU Cottbus<br />
storch@tu-cottbus.de<br />
Autorenverzeichnis<br />
WILMERSDORF, Erich ( 6<br />
Magistrat der Stadt Wien<br />
wil@adv.magwien.gv.at<br />
ZAUNSEDER ( 6<br />
Fa. GISCAD-Institut, Eurasburg<br />
sz@giscad.de