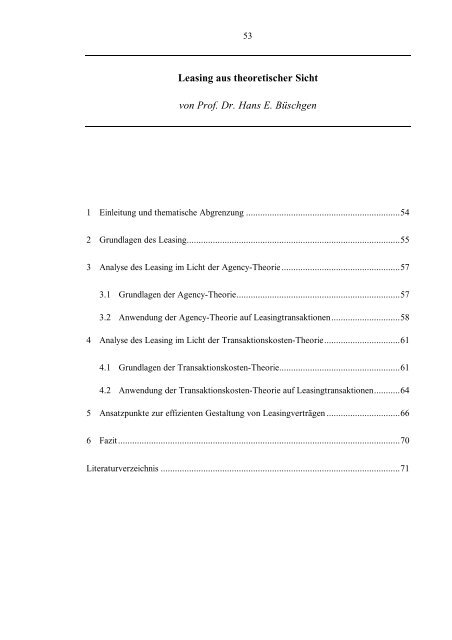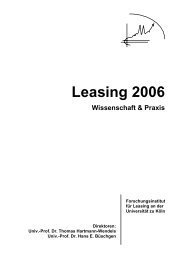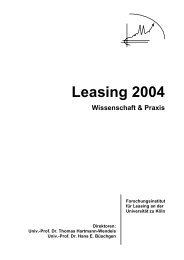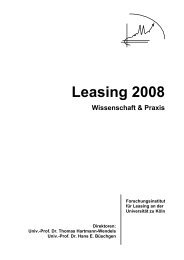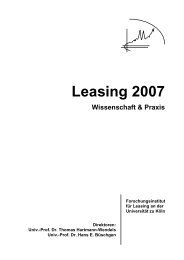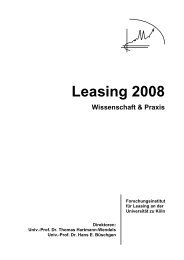Download der PDF-Datei - Forschungsinstitut für Leasing ...
Download der PDF-Datei - Forschungsinstitut für Leasing ...
Download der PDF-Datei - Forschungsinstitut für Leasing ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
58ergebnissen abzuleiten sind, entsteht für den Agent ein Handlungsspielraum zurMaximierung seines eigenen Nutzens. Besteht die Gefahr, daß die Handlungen des Agentdie Nutzenmaximierung des Principal negativ beeinflussen, wird dies als "moral hazard"bezeichnet.3.2 Anwendung <strong>der</strong> Agency-Theorie auf <strong>Leasing</strong>transaktionenAufbauend auf diesem Ansatz wird im folgenden <strong>der</strong> Versuch unternommen, die im<strong>Leasing</strong>bereich auftretenden Principal-Agent-Beziehungen unter beson<strong>der</strong>er Berücksichtigung<strong>der</strong> hieraus resultierenden Risiken zu analysieren.Grundsätzlich weisen wirtschaftliche und vertragliche Konstruktionen ein Geflecht vonwechselseitigen Principal-Agent-Beziehungen auf. Die Alternative des <strong>Leasing</strong> betrachten<strong>der</strong>scheint somit eine Unterteilung in eine insbeson<strong>der</strong>e die Investition fokussierendeKomponente <strong>der</strong> Objekterstellung sowie eine speziell die Finanzierung in den Mittelpunktstellende Komponente <strong>der</strong> Objektnutzung sinnvoll.Bei erstgenannter Komponente, die insbeson<strong>der</strong>e Gültigkeit für diejenigen <strong>Leasing</strong>artenaufweist, bei denen <strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>geber in die Erstellung des <strong>Leasing</strong>objektes involviert ist -hier seien insbeson<strong>der</strong>e das Immobilienleasing wie auch das herstellerabhängige <strong>Leasing</strong>angeführt -, tritt <strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>nehmer als Principal an die <strong>Leasing</strong>gesellschaft als Agent mitdem Ersuchen um Erstellung eines <strong>Leasing</strong>objektes heran. Die <strong>Leasing</strong>gesellschaft alsAgent weist hierbei einen Informationsvorsprung gegenüber dem <strong>Leasing</strong>nehmer auf, <strong>der</strong>zum einen die Situation vor Vertragsabschluß betreffend bspw. auf spezifischem Wissendes Agent hinsichtlich Preis- o<strong>der</strong> Qualitätseigenschaften des <strong>Leasing</strong>objektes basiert.Hieraus resultiert für den <strong>Leasing</strong>nehmer als Principal die Gefahr einer Verschleierungwesentlicher Eigenschaften des Transaktionsgegenstandes, die im <strong>Leasing</strong>bereich insbeson<strong>der</strong>edie Beschaffenheit des <strong>Leasing</strong>gutes hinsichtlich versteckter Qualitätsmängeldes dem <strong>Leasing</strong>nehmer zur Verfügung gestellten <strong>Leasing</strong>objektes (hidden information)betreffen.Zum an<strong>der</strong>en kann dieser Informationsvorsprung aber auch die Situation nach Vertragsabschlußbetreffend auf nicht o<strong>der</strong> zumindest nicht kostenlos beobachtbarem Verhaltendes <strong>Leasing</strong>gebers basieren; Probleme ergeben sich hier insbeson<strong>der</strong>e hinsichtlich <strong>der</strong> beiErstellung des <strong>Leasing</strong>objektes einzuholenden und anschließend auszuwählenden Angebote.Unterstellt man hierbei dem besser informierten <strong>Leasing</strong>geber eigennutzen-
59maximierendes Verhalten unter Mißachtung <strong>der</strong> Nutzenentwicklung des Principal, so istbspw. die Benachteiligung des <strong>Leasing</strong>nehmers durch eine Verschleierung von Rabattendenkbar. Desweiteren ist es möglich, daß die <strong>Leasing</strong>gesellschaft bei <strong>der</strong> Wahl <strong>der</strong> ausführendenFirmen nicht die unter Berücksichtigung qualitativer Aspekte das günstigsteAngebot offerierende Firma wählt, da sie in dieser Phase nicht notwendigerweise einenAnreiz sieht, die Investitionskosten so gering wie möglich zu halten (hidden action undmoral hazard).Die für sämtliche <strong>Leasing</strong>formen Gültigkeit aufweisende Komponente <strong>der</strong> Objektnutzungbeinhaltet eine Principal-Agent-Konstellation an<strong>der</strong>er Art. So nimmt <strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>geber indieser, insbeson<strong>der</strong>e die Finanzierung des Objektes betrachtenden Komponente die Stellungdes Principal ein, <strong>der</strong> das Verhalten des <strong>Leasing</strong>nehmers als Agent nicht im vorhineinkennt und auch nicht kostenlos beobachten kann. Die Beziehung zwischen denbeiden Vertragsparteien wird hier quasi getauscht.Für den <strong>Leasing</strong>geber als Principal treten aufgrund dieser Konstellation die im <strong>Leasing</strong>gemeinhin bekannten Risiken auf. Angeführt sei hier insbeson<strong>der</strong>e das aus <strong>der</strong> spezifischenVerteilung <strong>der</strong> Vermögensrechte resultierende Wartungs- und Instandhaltungsrisiko,das die Gefahr einer mangelhaften Wartung und Überbeanspruchung des <strong>Leasing</strong>objektesim Produktionsprozeß seitens des <strong>Leasing</strong>nehmers beinhaltet. Auch wird -neben den Preisrisiken, die grundsätzlich die Gefahr <strong>der</strong> sich än<strong>der</strong>nden Kosten nachVertragsabschluß, etwa im Bereich <strong>der</strong> Objekterstellung und <strong>der</strong> Finanzierung umfassen -das <strong>Leasing</strong>nehmerbonitätsrisiko in dieser Konstellation bedeutsam. Es umfaßt dieGefahr einer mangelnden Zahlungswilligkeit o<strong>der</strong> auch Zahlungsfähigkeit z.B. aufgrundrisikoreicher Investitionen o<strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Kapitalstruktur seitens des <strong>Leasing</strong>nehmers;bei weiter Auslegung des Begriffs kann diesem auch die Gefahr einer außerordentlichenKündigung seitens des <strong>Leasing</strong>nehmers subsumiert werden.Schon vor Vertragsabschluß kann das <strong>Leasing</strong>nehmerbonitätsrisiko für den <strong>Leasing</strong>geberz.B. in <strong>der</strong> Verschleierung <strong>der</strong> finanziellen Situation seitens des <strong>Leasing</strong>nehmers virulentwerden und ihn somit aufgrund realitätsfrem<strong>der</strong> Annahmen zu einer Zustimmung zumVertragsabschluß veranlassen (hidden information). Auch nach Vertragsabschluß trägt<strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>geber das Risiko <strong>der</strong> nicht beobachtbaren Aktionen des Agent, das bspw. dasRisiko <strong>der</strong> nicht fristgerechten Ratenzahlung des <strong>Leasing</strong>nehmers, einer außerordentlichen,nicht von <strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>gesellschaft zu vertretenden Vertragsauflösungseitens des <strong>Leasing</strong>nehmers o<strong>der</strong> auch <strong>der</strong> mangelhaften fachgerechten Wartung bzw. <strong>der</strong>übermäßigen Beanspruchung des <strong>Leasing</strong>objektes seitens des <strong>Leasing</strong>nehmers erfaßt.
63Bedeutung. Die Häufigkeit in Form von Wie<strong>der</strong>holungsfrequenzen <strong>der</strong> durchzuführendenTransaktionen als weitere Dimension zeigt für die folgenden Ausführungen insbeson<strong>der</strong>eaufgrund ihres Einflusses auf die Auslastung spezialisierter Beherrschungs- und ÜberwachungssystemeRelevanz. Die dritte Dimension von Transaktionen ist die Unsicherheit,die sich zum einen speziell auf die Unsicherheit resultierend aus dem Verhalten <strong>der</strong>Individuen wie auch zum an<strong>der</strong>en auf weitere Unsicherheiten des ökonomischen Umfeldesbezieht. Sie wird im folgenden als genügend hoch angenommen, um adaptive sequentielleEntscheidungen erfor<strong>der</strong>lich zu machen.Basierend auf <strong>der</strong> unterschiedlichen dimensionalen Ausgestaltung <strong>der</strong> Transaktionen sindverschiedene Vertragskategorien - im einzelnen: klassische, neoklassische und relationaleVerträge - zu spezifizieren und mit diesen korrelierend verschiedene Beherrschungs- undÜberwachungssysteme als effizient zu charakterisieren. So bedürfen standardisierteTransaktionen aller Häufigkeitsgrade keiner spezialisierten Beherrschungs- und Überwachungssysteme;sie bedienen sich klassischer Verträge, bei denen die Marktkontrolle alseffizientes Beherrschungs- und Überwachungssystem dient. Hierbei berücksichtigenklassische Verträge zahlreiche Umweltzustände und Ereignisfolgen und legen mittelssorgfältig ausgestalteter Vertragswerke entsprechend erfor<strong>der</strong>liche Anpassungen seitens<strong>der</strong> Vertragspartner verbindlich fest. Die Identität <strong>der</strong> Vertragspartner ist bei diesenVerträgen aufgrund <strong>der</strong> ihnen zugrundeliegenden unspezifischen, standardisierten Transaktionenals irrelevant zu erachten. Alternative Kauf- o<strong>der</strong> Liefervereinbarungen werdenfolglich leicht zu treffen sein; dementsprechend gering sind die Anreize zur Aufrechterhaltung<strong>der</strong> Vertragsbeziehung.Bei langfristig angelegten Verträgen dagegen scheidet eine Vorwegnahme allerEventualitäten schon aus Kostenaspekten aus; zudem kann bei dieser Konstellation eineUmsetzung aus Praktikabilitätsaspekten als nicht durchführbar erachtet werden. Da diediesen Verträgen zugrundeliegenden Transaktionen in <strong>der</strong> Regel eine gemischte bis hoheSpezifität aufweisen, bestehen hier große Anreize zur Aufrechterhaltung <strong>der</strong> Vertragsbeziehung.Demnach ist es bei dieser Situation Ziel <strong>der</strong> Vertragsgestaltung, die Tauschbeziehungenüber den Markt zwar aufrecht zu erhalten, aber zusätzliche Kontrollmechanismenzum Schutz vor Verhaltensunsicherheiten wie auch Umweltunsicherheiteneinzuführen, die Anreize zur Fortführung <strong>der</strong> Vertragsbedingungen schaffen. Die fürdiesen Zweck als effizient anzuführende dreiseitige Kontrolle bedient sich - statt z.B.direkt ein Streitverfahren vor Gericht zu provozieren, was typischerweise zum Abbruch<strong>der</strong> Transaktion führen würde - <strong>der</strong> Hinzuziehung Dritter als Schiedspartei zur Beurteilung<strong>der</strong> Vertragserfüllung wie auch zur Beilegung weiterer Streitigkeiten.
64Bei wachsen<strong>der</strong> Häufigkeit <strong>der</strong> den langfristig angelegten, unvollständigen Verträgenzugrundeliegenden gemischtspezifischen Transaktionen kann die zweiseitige Kontrolleals Ausprägung <strong>der</strong> zweiseitigen Beherrschungs- und Überwachungssysteme als effizientcharakterisiert werden. Denn die aufgrund transaktionsspezifischer Ausgestaltung anfallendenhohen Kosten dieses Beherrschungs- und Überwachungssystemes können hierdurch die Vielzahl gleichgearteter Transaktionen gerechtfertigt werden. Entgegen <strong>der</strong>sog. vereinheitlichten Kontrolle als <strong>der</strong> zweiten Ausprägung <strong>der</strong> zweiseitigen Beherrschungs-und Überwachungssysteme wird bei dieser Konstellation die rechtliche Selbständigkeit<strong>der</strong> Vertragsparteien beibehalten. Auch entzieht die für hochspezifischeInvestitionen als effizient zu charakterisierende vereinheitlichte Kontrolle (VertikaleIntegration) die Transaktionen dem Markt und glie<strong>der</strong>t sie in eine hierarchische Strukturein. Doch haben beide Ausprägungen gemeinsam, daß nicht die ursprüngliche vertraglicheVereinbarung, son<strong>der</strong>n die gesamte Beziehung <strong>der</strong> Kooperationsparteien denBezugspunkt ihres Verhältnisses darstellt.4.2 Anwendung <strong>der</strong> Transaktionskosten-Theorie auf <strong>Leasing</strong>transaktionenBemüht man sich um eine Einordnung des <strong>Leasing</strong> in die dem Transaktionskostenansatzentsprechenden ökonomischen Organisationsformen, so lassen sich hier sowohl Elemente<strong>der</strong> Marktorganisation als auch solche <strong>der</strong> Hierarchie wie<strong>der</strong>finden, so daß eine Positionierungdes <strong>Leasing</strong> zwischen den beiden Extrempunkten Markt und Hierarchie sinnvollerscheint. Zwar liegt im <strong>Leasing</strong> <strong>der</strong> Schwerpunkt in <strong>der</strong> Nutzung des Marktmechanismus,doch wird die bei isoliertem Markttausch typischerweise anfallende Vielzahlvon Marktvorgängen in <strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>gesellschaft internalisiert, indem die <strong>Leasing</strong>gesellschaftals zentraler Agent die Koordination <strong>der</strong> Faktoren übernimmt. Die Vielzahl<strong>der</strong> ansonsten benötigten Verträge wird durch ein einziges, umfangreiches Vertragswerkzwischen <strong>Leasing</strong>geber und <strong>Leasing</strong>nehmer ersetzt.Die ökonomischen Organisationsformen als Beherrschungs- und Überwachungssystemedefinierend lassen sich diese <strong>Leasing</strong>vertragswerke grundsätzlich als langfristig angelegteund - berücksichtigt man die aus dem ökonomischen Umfeld wie auch speziell aus demVerhalten <strong>der</strong> Vertragspartner resultierenden Unsicherheiten - schon aus Kostenaspektenals unvollständige Konstellationen kennzeichnen. Zur Bestimmung des für <strong>Leasing</strong>verträgeals effizient zu charakterisierenden Beherrschungs- und Überwachungssystems,das die Verifizierbarkeit wie auch die Durchsetzbarkeit solcher langfristig ausgerichteter,unvollständiger Verträge sicherstellt, bedarf es <strong>der</strong> Konkretisierung oben erläuterter
65Dimensionen <strong>der</strong> den <strong>Leasing</strong>transaktionen zugrundeliegenden <strong>Leasing</strong>objekte, hier insbeson<strong>der</strong>eentsprechen<strong>der</strong> Faktorspezifitäten.Da eine pauschale Einordnung des <strong>Leasing</strong> in die von Williamson gewählte Systematikschon aufgrund <strong>der</strong> Vielfalt <strong>der</strong> Ausprägungen in diesem Bereich nicht möglich ist - soweisen die dem <strong>Leasing</strong>vertrag zugrundeliegenden Investitionen unterschiedliche Spezifitätsgradeauf -, scheint für die Präzision <strong>der</strong> folgenden Ausführungen eine Eingrenzungauf das <strong>Leasing</strong>geschäft mit Investitionsgütern hilfreich. Dem Konsumgüterbereich zusubsumierende <strong>Leasing</strong>geschäfte, hier vornehmlich <strong>Leasing</strong> im privaten Bereich - z.B. inForm von <strong>Leasing</strong> privater Kraftfahrzeuge o<strong>der</strong> multimedialer Kommunikationssysteme,und damit lediglich geringe Spezifität aufweisende Objekte - sind demnach nicht Gegenstand<strong>der</strong> folgenden Ausführungen. Auch hochspezifische Objekte finden im folgendenaufgrund <strong>der</strong> hier möglicherweise auftretenden Problematik des Spezialleasing keineBerücksichtigung. Abgesehen davon aber sind sie auch nicht Gegenstand <strong>der</strong> Betrachtung,da den transaktionskostentheoretischen Ausführungen Williamson's folgend aus <strong>der</strong>in dieser Konstellation zu konstatierenden hohen Abhängigkeit zwischen <strong>Leasing</strong>geberund <strong>Leasing</strong>nehmer entsprechende vertragliche Schutzmechanismen zur anreizoptimalenGestaltung <strong>der</strong> Transaktion nicht ausreichen und demnach die Abwicklung solcherTransaktionen über die Vertikale Integration (Hierarchie) zu präferieren ist.Gemäß dieser thematischen Eingrenzung kann den im folgenden zum Untersuchungsgegenstan<strong>der</strong>hobenen <strong>Leasing</strong>transaktionen eine gemischte Spezifität bescheinigtwerden. Dies impliziert eine eingeschränkte alternative Verwendungsfähigkeit <strong>der</strong><strong>Leasing</strong>objekte, da diese gemischt-spezifischen Investitionen bei alternativerVerwendung geringere Opportunitätskosten aufweisen und auch eine Übertragungsolcher Investitionsgüter auf einen Geschäftsnachfolger Bewertungsschwierigkeitenimplizieren; exemplarisch seien speziell für bestimmte Unternehmen errichtete Betriebsgebäudeo<strong>der</strong> Anlagen angeführt wie auch ein von einem Unternehmen geleaster Fuhrparkmitsamt <strong>der</strong> im Rahmen des <strong>Leasing</strong>vertrages abgeschlossenen Zusatzdienstleistungen.Die von Williamson entwickelten Beherrschungs- und Überwachungssysteme betrachtendkönnen für <strong>Leasing</strong>transaktionen, abhängig von <strong>der</strong> auftretenden Häufigkeit<strong>der</strong> jeweiligen Transaktion, somit die folgenden Beherrschungs- und Überwachungssystemeals effizient charakterisiert werden: Zum einen ist dies die den zweiseitigen Beherrschungs-und Überwachungssystemen zu subsumierende transaktionsspezifische,zweiseitige Kontrolle, die sich z.B. in vertraglich vereinbarten Anpassungsmechanismenkonkretisiert. Zum an<strong>der</strong>en ist hier die dreiseitige Kontrolle anzuführen, die sich häufig
66einer Drittpartei zur Beurteilung <strong>der</strong> Vertragserfüllung bedient. Bei beidenBeherrschungs- und Überwachungssystemen bestehen für die Vertragsparteien, insbeson<strong>der</strong>eden als <strong>Leasing</strong>geber fungierenden Principal, starke Anreize zur Aufrechterhaltung<strong>der</strong> Vertragsbeziehung bis zum Vertragsablauf. Hierzu bedarf es aber <strong>der</strong> Verwendungvon oftmals nicht standardisierten Vertragsregelungen zum Zwecke <strong>der</strong> Erzielungglaubhafter Vertragstreue und einer Ausgestaltung des <strong>Leasing</strong>vertrages mit entsprechendenAnreiz-, Sanktions- und Kontrollmechanismen. Sie dienen dem Zweck <strong>der</strong>Einsparung von Transaktionskosten, da in den Vertrag Absicherungen integriert werden,die einen effizienteren Tausch begünstigen.5 Ansatzpunkte zur effizienten Gestaltung von <strong>Leasing</strong>verträgenDiese explizit wie auch implizit vertraglich zu vereinbarenden Anreiz-, Sanktions- undKontrollmechanismen sind Ansatzpunkte für eine effiziente Gestaltung von <strong>Leasing</strong>transaktionen,so daß sie im folgenden, unter Berücksichtigung <strong>der</strong> im <strong>Leasing</strong>bereich existentenRisiken, Gegenstand <strong>der</strong> Betrachtung sind.Hinsichtlich <strong>der</strong> primär in <strong>der</strong> Phase <strong>der</strong> Objekterstellung auftretenden Informationsasymmetrienzugunsten des <strong>Leasing</strong>gebers seien zur Einschränkung <strong>der</strong> Möglichkeiteiner Verschleierung von Rabatten wie auch von wesentlichen Eigenschaften des Transaktionsgegenstandesseitens des <strong>Leasing</strong>gebers als disziplinierende Maßnahmen das im<strong>Leasing</strong> angewendete offene Kostenprinzip (bonding/signaling) sowie die insbeson<strong>der</strong>ebei großen Objekten vorzufindende explizite Einbeziehung des <strong>Leasing</strong>nehmers in diePhase <strong>der</strong> Objekterstellung angeführt. Auf vertraglicher Ebene sind zudem insbeson<strong>der</strong>esanktionelle Regelungen <strong>der</strong> zweiseitigen Kontrolle in Form von Termin-, Preis- undQualitätsgarantien existent, die wesentlich zum Abbau <strong>der</strong> hier auftretenden opportunistischenVerhaltensspielräume insbeson<strong>der</strong>e in Form <strong>der</strong> Kalkulations- und Qualitätsrisikenbeitragen. Relativierend ist aber anzumerken, daß die bei Erstellung des <strong>Leasing</strong>objektesauftretenden negativen Anreizeffekte schon aufgrund <strong>der</strong> langfristigen Eigentümerposition<strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>gesellschaft lediglich geringe Bedeutung aufweisen.Für die weiteren in <strong>der</strong> Investitionsphase auftretenden Informationsasymmetrienzugunsten des <strong>Leasing</strong>gebers sind zwar grundsätzlich keine typischen leasingvertraglichenRegelungen vorgesehen, so daß die Ausnutzung von Ex-ante Informationsasymmetrienhier grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden kann. Doch ist diese Proble-
67matik aufgrund <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Praxis gängigen Usancen, z.B. durch Einbringung von AngebotenDritter als Vergleichsmaßstab, aber weitgehend als unproblematisch zu bewerten.Weitreichende Möglichkeiten des opportunistischen Verhaltens bieten die in <strong>der</strong> Phase<strong>der</strong> Objektnutzung auftretenden Informationsasymmetrien zugunsten des <strong>Leasing</strong>nehmers,die insbeson<strong>der</strong>e aus <strong>der</strong> oben bereits dargestellten leasingtypischen Situationbezüglich <strong>der</strong> Verteilung von Verfügungsrechten und dem hieraus resultierenden Wartungs-bzw. Instandhaltungsrisiko resultieren. Entscheidend bei dieser Konstellation ist,daß <strong>der</strong> Wie<strong>der</strong>verkaufswert des im Eigentum des <strong>Leasing</strong>nehmers stehenden <strong>Leasing</strong>objektesvon Wartungs- und Instandhaltungsleistungen durch den das <strong>Leasing</strong>objekt nutzenden<strong>Leasing</strong>nehmer beeinflußt wird. Da <strong>der</strong> Umgang des <strong>Leasing</strong>nehmers mit dem<strong>Leasing</strong>objekt aber aufgrund asymmetrischer Informationsverteilung we<strong>der</strong> vom<strong>Leasing</strong>geber noch von weiteren Externen unmittelbar beobachtet werden kann, gelingteine direkte Durchsetzung des vom <strong>Leasing</strong>geber gewünschten Wartungsniveaus nicht.Es besteht jedoch die Möglichkeit mittels einer vertraglich integrierten anreizorientiertenFestlegung des Restwertes von <strong>Leasing</strong>objekten die Erbringung von Wartungsleistungendem Eigeninteresse des <strong>Leasing</strong>nehmers zu unterwerfen. Entsprechend ist die Ausgestaltungvon <strong>Leasing</strong>verträgen mit spezifischen Optionsvereinbarungen so vorzunehmen,daß dem <strong>Leasing</strong>nehmer die Annahme einer hohen Wahrscheinlichkeit <strong>der</strong> Optionsausübungglaubhaft gemacht wird, <strong>der</strong>zufolge dieser am Ende <strong>der</strong> Grundmietzeit dieEigentümerposition des <strong>Leasing</strong>objektes übernimmt.Untersuchungen Krahnens zu diesem Themengebiet folgend trägt bei Vollamortisationsverträgendie Vereinbarung einer Kaufoption mit möglichst niedrigem Optionspreis zueiner anreizverträglichen Vertragsgestaltung bei, da hier die negativen Anreizeffekte <strong>der</strong>Optionszahlung minimiert werden. Entsprechend sinkt mit steigen<strong>der</strong> Höhe <strong>der</strong> vereinbartenoptionalen Abschlußzahlung die Wahrscheinlichkeit <strong>der</strong> tatsächlichen Optionsausübung.Dem <strong>Leasing</strong>nehmer wird hierdurch <strong>der</strong> Anreiz zur adäquaten Wartung des<strong>Leasing</strong>objektes genommen, da die Möglichkeit seiner Partizipation an <strong>der</strong> durch seineWartung ermöglichten Restwertsteigerung des <strong>Leasing</strong>objektes von ihm nicht wahrgenommenwerden kann und somit <strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>geber in den Genuß <strong>der</strong> durch dieWartung des <strong>Leasing</strong>nehmers bedingten Restwertsteigerung kommt.Bei Teilamortisationsverträgen mit Andienungsrecht dagegen trägt insbeson<strong>der</strong>e einhoher Optionspreis zu einer effizienten Vertragsgestaltung bei, die die negativenAnreizeffekte <strong>der</strong> Optionszahlung minimiert und den Vertragsparteien eine hohe Wahrscheinlichkeit<strong>der</strong> Optionsausübung vermittelt. Mittels dieser hohen Wahrscheinlichkeit
68<strong>der</strong> Optionsausübung muß <strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>nehmer die von seiner Seite zu erfüllendenWartungsaufgaben seinem Eigeninteresse zurechnen, da bei mangelhafter Erfüllungseiner Aufgaben die Gefahr <strong>der</strong> Andienung des <strong>Leasing</strong>objektes zu einem weit über demMarktwert liegenden Preis virulent wird.Diese vertraglichen Konstellationen zur Regulierung des im <strong>Leasing</strong>bereich auftretendenWartungs- bzw. Instandhaltungsrisikos können gemäß den Ausführungen Williamson'sden zweiseitigen Beherrschungs- und Überwachungssystemen subsumiert werden undentsprechen grundsätzlich <strong>der</strong> Leistung eines Unterpfandes zur Absicherung vonTauschvorgängen. Mittels impliziter Verhaltensanreize wird die Durchführung <strong>der</strong>vertraglich vereinbarten Wartungsaufgabe und somit die Absicherung des <strong>Leasing</strong>objektesgegen überdurchschnittliche Qualitätsmin<strong>der</strong>ungen dem Eigeninteresse des<strong>Leasing</strong>nehmers <strong>der</strong>art unterstellt, daß dieser bei Zuwi<strong>der</strong>handlung mit einer finanziellen"Bestrafung" in Form eines Kapitalverlustes rechnen muß, <strong>der</strong> größer ist als die Einsparungen,die durch Unterlassung vertraglich vereinbarter Wartungs- und Instandhaltungsleistungenrealisierbar sind. Auf diese Weise können die Interessenlagen <strong>der</strong>Vertragsparteien einan<strong>der</strong> angeglichen und negative Anreizeffekte weitgehend kompensiertwerden.Hinsichtlich <strong>der</strong> Beschränkung des Wartungsrisikos sind zudem, insbeson<strong>der</strong>e unterBerücksichtigung <strong>der</strong> bei mit Kaufoptionen ausgestatteten <strong>Leasing</strong>verträgen fakultativenInanspruchnahme für den <strong>Leasing</strong>nehmer, weitere vertragliche Regelungen denkbar.Angeführt seien hier z.B. die <strong>der</strong> nach Williamson definierten zweiseitigen Kontrolle zusubsumierenden expliziten Sanktionsmaßnahmen in Form einer Zahlung bei Überbeanspruchungdes <strong>Leasing</strong>objektes, im Kfz-<strong>Leasing</strong> bspw. als Mehrkilometerpauschale. Aberauch die den Kontrollmechanismen zuzuordnenden Maßnahmen z.B. in Form <strong>der</strong> Beauftragungeiner externen Wartungsgesellschaft zur Instandhaltung des <strong>Leasing</strong>objekteseinschließlich <strong>der</strong> Weiterleitung <strong>der</strong> hierfür anfallenden Kosten im Rahmen <strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>ratensind denkbar. Auch besteht die Möglichkeit <strong>der</strong> Einbeziehung Dritter zur Begutachtungdes vertragsgemäßen Zustandes des <strong>Leasing</strong>objektes. Im Bereich des Immobilienleasingwerden bspw. in regelmäßigen Abständen Inspektionen des <strong>Leasing</strong>objektesunter Einbeziehungen von Fachgutachtern vereinbart; im Bereich des Mobilienleasingerfolgt die Einschätzung des <strong>Leasing</strong>objektes mittels <strong>der</strong> nach Williamson definiertendreiseitigen Kontrolle in <strong>der</strong> Regel am Ende <strong>der</strong> Vertragslaufzeit.Auch zur Absicherung des <strong>Leasing</strong>nehmerbonitätsrisikos und insbeson<strong>der</strong>e <strong>der</strong> hierausresultierenden potentiellen Zahlungsausfälle können vertragliche Regelungen angeführtwerden, die das opportunistischen Handeln des <strong>Leasing</strong>nehmers reduzieren. Zu nennen
69ist hier die in <strong>Leasing</strong>verträgen enthaltene außerordentliche Kündigungsklausel im Falleeines Zahlungsverzugs des <strong>Leasing</strong>nehmers, die als sanktionell ausgestaltetes Vertragselementden nach Williamson entwickelten zweiseitigen Beherrschungs- und Überwachungssystemenzu subsumieren ist. Doch sei hier auf die aus Dauerschuldverhältnissenresultierende Problematik <strong>der</strong> außerordentlichen Kündigung hingewiesen,wonach ein einfacher Verzug des <strong>Leasing</strong>nehmers nicht ausreicht, ein fristloses Kündigungsrechtzu begründen.Zudem bleibt dem <strong>Leasing</strong>geber das bereits in den AGB - die einen Bestandteil des<strong>Leasing</strong>vertrages darstellen - geregelte Sicherstellungsrecht des <strong>Leasing</strong>gutes, das den<strong>Leasing</strong>geber berechtigt, zur Sicherstellung seines Zahlungsanspruchs das <strong>Leasing</strong>gut beiVerzug des <strong>Leasing</strong>nehmers mit <strong>der</strong> vertragsgemäßen Zahlung <strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>raten an sichzu nehmen. Desweiteren sind im Rahmen des <strong>Leasing</strong>nehmerbonitätsrisikos, hier insbeson<strong>der</strong>edie mangelnde Zahlungsfähigkeit aufgrund risikoreicher Investitionen o<strong>der</strong>Kapitalrestrukturierungen seitens des <strong>Leasing</strong>nehmers fokussierend, vertragliche Regelungenhinsichtlich <strong>der</strong> jährlichen Vorlegung entsprechen<strong>der</strong> Unterlagen z.B. in Formvon Finanzplänen o<strong>der</strong> Bilanzen denkbar.Die für den <strong>Leasing</strong>geber bestehende Gefahr einer vorzeitigen außerordentlichen Aufhebungdes Vertragsverhältnisses durch den <strong>Leasing</strong>nehmer aufgrund nicht seitens <strong>der</strong><strong>Leasing</strong>gesellschaft zu vertreten<strong>der</strong> Gründe kann in <strong>Leasing</strong>verträgen durch sanktionelle,den zweiseitigen Kontrollmechanismen zuzuordnende Ausgestaltung in Form vonSchadenersatzklauseln eingeschränkt werden. Solche, negative Anreizmechanismen einschränkendeKlauseln reduzieren zudem das finanzielle Risiko <strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>gesellschaftund räumen dieser einen Anspruch auf Schadenersatz in Höhe <strong>der</strong> Summe des Barwertesaller ausstehenden <strong>Leasing</strong>raten, des Barwertes des Restbuchwertes abzüglich des erzieltenVerwertungserlöses nach Ablauf <strong>der</strong> Grundmietzeit, einer Verwaltungskostenpauschalesowie einer Vorfälligkeitsentschädigung des refinanzierenden Instituts ein.Zudem bedarf eine effiziente Gestaltung <strong>der</strong> langfristig ausgelegten, unvollständigenVertragstypen im <strong>Leasing</strong>bereich einer Regelung, die die Möglichkeit zur Anpassung anverän<strong>der</strong>te Rahmenbedingungen gewährt. Dementsprechend können vertraglicheRegelungen im <strong>Leasing</strong>bereich die Vereinbarung von Gleitklauseln vorsehen, die sichnach den Verän<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> allgemeinen Wirtschaftslage richten und in <strong>Leasing</strong>verträgenzur Absicherung von Preisrisiken insbeson<strong>der</strong>e Verwendung in Form vonZinsanpassungsklauseln finden. Diese, auf exogenen Ereignissen des Kapitalmarktesbasierende Anpassung macht die quantifizierbaren Auswirkungen auf die Kosten des<strong>Leasing</strong>gebers deutlich und kann aufgrund ihrer von beiden Vertragsparteien nach-
70vollziehbaren Gestaltung - die Anpassung des Zinssatzes orientiert sich an öffentlichbekanntgegebenen Referenzzinssätzen - als von beiden Seiten akzeptierbares Vertragselementeingeschätzt werden.6 FazitZusammenfassend bleibt zu konstatieren, daß die hier dargelegten Ansatzpunkte zurGestaltung von <strong>Leasing</strong>verträgen umfassende Möglichkeiten bieten, effiziente <strong>Leasing</strong>transaktionenfür die beteiligten Vertragspartner zu kreieren. Hierbei wird realitätsnahenRestriktionen in Form <strong>der</strong> Existenz langfristig angelegter unvollständiger Verträge, <strong>der</strong>beschränkten Rationalität <strong>der</strong> Individuen einschließlich <strong>der</strong>en opportunistischen Verhaltenswie auch weiteren, das ökonomische Umfeld betreffenden Unsicherheiten, z.B.hinsichtlich rechtlicher o<strong>der</strong> marktlicher Rahmenbedingungen, Rechnung getragen. Dieanreizoptimale Gestaltung von <strong>Leasing</strong>verträgen des Investitionsgüterbereichs bedientsich hierbei spezifischer vertraglicher Regelungen in Form impliziter und expliziterVerhaltensanreize sowie Kontroll- und Sanktionsmaßnahmen, um die Interessen <strong>der</strong>Vertragsparteien in Einklang zu bringen und effiziente Kooperationen <strong>der</strong> <strong>Leasing</strong>partnerzu ermöglichen.
71LiteraturverzeichnisBüschgen, Hans E.: <strong>Leasing</strong>verfahren im Hochschulbau, Mitteilungen und Berichte des<strong>Forschungsinstitut</strong>s für <strong>Leasing</strong> an <strong>der</strong> Universität zu Köln, hrsg. von Büschgen, HansE., Nr. 21, 1996Büschgen, Hans E.: <strong>Leasing</strong> als Finanzierungsalternative. Grundlagen und Formen des<strong>Leasing</strong>, in Österreichisches Bank-Archiv, 1989, Nr. 4, S. 344 - 359.Büschgen, Hans E.: <strong>Leasing</strong> als Finanzierungsalternative. Kriterienorientierte Beurteilungdes <strong>Leasing</strong>, in Österreichisches Bank-Archiv, 1989, Nr. 5, S. 470 - 488Dietz, Albrecht: Die betriebswirtschaftlichen Grundlagen des <strong>Leasing</strong>, in Zeitschrift fürBetriebswirtschaft, 1990, S. 1139 - 1158Feldmann, Horst: Eine institutionalistische Revolution? Zur dogmenhistorischenBedeutung <strong>der</strong> mo<strong>der</strong>nen Institutionenökonomik, Berlin 1995Krahnen, Jan P.: Sunk Costs und Unternehmensfinanzierung, Wiesbaden 1991, S. 145 ff.Krahnen, Jan P.: Objektfinanzierung und Vertragsgestaltung - Eine theoretischeErklärung <strong>der</strong> Struktur langfristiger <strong>Leasing</strong>verträge, in Zeitschrift für Betriebswirtschaft,1990, S. 21 - 38Schenk, K. E.: Die neue Institutionenökonomie - Ein Überblick über wichtige Elementeund Probleme <strong>der</strong> Weiterentwicklung, in Zeitschrift für Wirtschafts- undSozialwissenschaften, 1992, S. 337 - 378Westphalen, Friedrich Graf von: Der <strong>Leasing</strong>vertrag, 4. Auflage, Köln 1992Wilhelm, Jochen: <strong>Leasing</strong> aus finanztheoretischer Sicht, in Mitteilungen und Berichte des<strong>Forschungsinstitut</strong>s für <strong>Leasing</strong> an <strong>der</strong> Universität zu Köln, hrsg. von Büschgen, HansE., Nr. 7, 1989, S. 11 - 33Williamson, Oliver E.: Die ökonomischen Institutionen des Kapitalismus: Unternehmen,Märkte, Kooperationen, Tübingen 1990