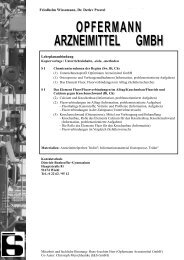VEGLA - Vereinigte Glaswerke GmbH - Portal Schule Wirtschaft
VEGLA - Vereinigte Glaswerke GmbH - Portal Schule Wirtschaft
VEGLA - Vereinigte Glaswerke GmbH - Portal Schule Wirtschaft
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
I&S Gesellschaft<br />
für partnerschaftliche<br />
Beziehungen<br />
zwischen Industrie<br />
und<br />
<strong>Schule</strong>/Öffentlichkeit<br />
Bonn 1997<br />
Helmut Horstmeier, Dr. Margarete Himmrich, Wolfgang Lehmann,<br />
Dr. Christoph Merschhemke<br />
<strong>VEGLA</strong> - <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong><br />
<strong>GmbH</strong> (Porz)<br />
Lehrplananbindung<br />
Kopiervorlage / Unterrichtsinhalte, -ziele, -methoden<br />
SI/II Industrieunternehmen der Region (Sw, Ek, Ch, Ph)<br />
(1) Unternehmensprofil der <strong>VEGLA</strong> <strong>GmbH</strong> (Information)<br />
(1) Wärmeschutzglas, Glas in der Lebenswelt der Schüler (Aufgaben, Recherche)<br />
S I Glasrohstoffe/Floatglasverfahren/Wärmedurchgangswert/Elektromagnetische<br />
Strahlung (Ch, Ph)<br />
(2) Glasherstellung aus den Rohstoffen (Information, Aufgaben)<br />
(2) Glasherstellungsverfahren, historische Entwicklung (Information, Aufgaben)<br />
(3) Typen von Wärmedämmverglasungen im Vergleich (Information, Aufgaben)<br />
(3) Definition Infrarot- oder Wärmestrahlung als unsichtbares „Licht“ (Information,<br />
Aufgaben)<br />
(4) Vergleich der Wärmedämmeigenschaften verschiedener Glastypen im Unterricht<br />
(Versuche)<br />
- qualitativ (Durchlässigkeit verschiedener Glastypen für Infrarotlicht, Berechnung<br />
Innenraumtemperatur unter Verwendung verschiedener Glastypen<br />
- quantitativ (Berechnung des k-Wertes von Isolier-Doppelglas anhand vorgegebener<br />
Meßdaten)<br />
S I/II Elektromagnetische Strahlung/Transmission/Reflexion/Destruktive Interferenz<br />
(Ch, Ph)<br />
Kontaktschule<br />
Gesamtschule Köln-Porz<br />
Stresemannstraße 36<br />
51149 Köln<br />
Tel.: 02203 / 3 20 40<br />
(5) Vertiefung: Edelmetallbeschichtung als Wärmeschutz, Auswirkungen auf den<br />
Wärmedurchgangswert und die Lichtdurchlässigkeit von Fensterglas (Information,<br />
Aufgaben)<br />
(6) Erhöhung der Lichtdurchlässigkeit mittels reflexionsmindernder Beschichtungen<br />
(Information, Aufgaben)<br />
Mitarbeit und fachliche Beratung:<br />
Hans-Peter Hoheisel <strong>VEGLA</strong> <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong>, Köln-Porz
Seite 2 <strong>VEGLA</strong> - <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> Vollmer: KIS Köln<br />
Kopiervorlage 1<br />
Vegla <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong><br />
Das Werk Porz der Vegla <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> liegt an<br />
der Poststraße in Köln Porz. Die Straßen in der näheren Umgebung<br />
- „Glasstraße“, „Germaniastraße“ oder „Rezagstraße“ deuten<br />
an, daß Glasherstellung in Porz eine lange Tradition hat. Bis<br />
in die 70er Jahre hinein produzierten Firmen wie die „Germania“,<br />
„Rezag“ oder „Erste Deutsche Float“ in Porz täglich tausende Quadratmeter<br />
Spiegel- und Fensterglas und später auch Autoglas.<br />
Zeitweilig waren in der „Porzer Glasindustrie“ insgesamt mehrere<br />
tausend Mitarbeiter beschäftigt.<br />
In den letzten Jahren hat ein starker Konzentrationsprozeß auf<br />
dem Glasmarkt eingesetzt. Das hat unter anderem dazu geführt,<br />
daß die Aktivitäten der alten <strong>Glaswerke</strong> von der Vegla, der <strong>Vereinigte</strong>n<br />
<strong>Glaswerke</strong> übernommen wurden, deren Hauptsitz in Aachen<br />
liegt. Auf dem 70 ha großen Industriegelände des Porzer Werkes<br />
der Vegla arbeiten in Folge starker Rationalisierungsmaßnahmen<br />
inzwischen nur noch etwa 800 Mitarbeiter. Das Unternehmen gehört<br />
zur deutschen Gruppe des französischen Weltkonzerns<br />
Compagnie de Saint Gobain.<br />
Das Firmenmotto „Kompetenz in Glas“, das Porzer von der Aufschrift<br />
der Transporter kennen, die das Unternehmen täglich in<br />
großer Zahl anfahren, bezieht sich auf zwei Produktlinien: Glas<br />
für den Automobilmarkt und für den Hochbau. Fast jede zweite<br />
Autoscheibe in deutschen Kraftfahrzeugen stammt von der Vegla<br />
und führt nach dem französischen Mutterkonzern den Markennamen<br />
Sekurit Saint Gobain. Sekurit steht für Sicherheit und bezeichnet<br />
einen Glastyp mit erhöhter Bruchfestigkeit, der im Falle<br />
eines Bruches in viele ungefährliche und stumpfe Krümel zerbricht.<br />
Floatglas-Verfahren: Ein Meilenstein in der Glasherstellung war<br />
die Erfindung des sogenannten „Float-Verfahrens“ im Jahre 1959<br />
in England. Float stammt aus dem englischen und bedeutet fließen.<br />
Bei diesem Verfahren wird das Glas aus der Glasschmelze<br />
über ein Bad aus flüssigem Zinn gezogen. Das zunächst noch flüssige<br />
Glas schwimmt auf dem ideal ebenen Metall und härtet nach<br />
und nach zu einer ebenfalls ideal ebenen Fläche aus. Die erste<br />
deutsche Floatglasanlage wurde ab 1965 in Porz von der Vegla<br />
betrieben. In den 80er Jahren investierte das Unternehmen etwa<br />
200 Millionen DM in die Modernisierung ihrer Floatglasanlage.<br />
Mittlerweile wird Flachglas weltweit fast ausschließlich nach diesem<br />
Verfahren produziert.<br />
In den 90er Jahren spezialisierte sich die Vegla auf die Herstellung<br />
von Bauglas und seine Veredelung. Ihre Autoglasherstellung<br />
gab sie an das von ihr gegründete Tochterunternehmen, die Sekurit<br />
Saint-Gobain Deutschland <strong>GmbH</strong> & Co. KG ab. Seither wird<br />
auch im Werk Porz Glas ausschließlich für den Bausektor produziert.<br />
Magnetron-Anlage zur Beschichtung von Glas mit Edelmetallen:<br />
Mit dem Bau einer sogenannten Magnetron-Anlage haben<br />
die Porzer 1995 ihren bislang letzten Schritt in Richtung eines<br />
hochmodernen High-Tech Unternehmens unternommen.<br />
Bei diesem Verfahren wird das Glas in einer separaten Anlage unter<br />
Hochvakuum mit einer hauchdünnen, lichtdurchlässigen<br />
Edelmetallschicht überzogen. Das so hergestellte Glas hat hervorragende<br />
Wärme- und Sonnenschutzeigenschaften.<br />
In Porz rechnete man sich beste Marktchancen für das neue Produkt<br />
aus, weil ab Mitte der neunziger Jahre eine verschärfte<br />
Wärmeschutzverordnung in Kraft trat, wonach Fensterglas nur so<br />
wenig an Wärmeenergie hindurchlassen darf, daß fast nur noch<br />
aufwendig veredeltes Fensterglas den hohen Anforderungen genügt.<br />
Floatglasanlage<br />
Schmelzofen<br />
Sand (SiO 2), Soda (Na 2CO 3) und Kalk (CaCO 3) sind die wesentlichen<br />
Zutaten zur Herstellung von Glas im riesigen Schmelzofen der<br />
Vegla am Standort Köln-Porz. Die Luftaufnahme zeigt eine langgezogene<br />
Halle, in der sich ein Schmelzofen und die Floatglasanlage<br />
zur Herstellung von Flachglas befindet.<br />
Mit neuen Glasbauten wie hier am Mediapark in Köln werden städtebauliche<br />
Akzente gesetzt. Das verwendete Bauglas muß den hohen<br />
Anforderungen der Wärmeschutzverordnung genügen.<br />
Aufgaben:<br />
1. Was weißt du über Glas? Recherchiere mit Hilfe deines Schulbuches<br />
oder eines Lexikons.<br />
2. Was weißt du über Wärmedämmglas? Wie wird eine höhere<br />
Wärmedämmung bei Fensterscheiben erreicht? Was weißt<br />
du über Sicherheitsglas im Auto. Wie unterscheiden sich Autosicherheitsglas<br />
und normales Fensterglas im Bruchverhalten?<br />
3. Im Werk Porz hat man sich nach der 1995 in Kraft getretenen<br />
verschärften Wärmeschutzverordnung für Fensterglas auf<br />
die Herstellung von veredeltem Fensterglas mit besonderen<br />
Wärmedämmeigenschaften spezialisiert?<br />
- Wovon hängt der Erfolg einer solchen Strategie ab? Welche<br />
Chancen und Risiken sind damit verbunden?
Vollmer: KIS Köln <strong>VEGLA</strong> - <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> Seite 3<br />
Sand, Soda oder Pottasche und Kalk sind nach wie vor die Hauptrohstoffe<br />
für einfaches Fensterglas.<br />
Sand ist mit etwa 70 bis 75 % der wichtigste Ausgangsstoff. Fast<br />
die Hälfte der festen Erdoberfläche besteht aus Siliciumdioxid,<br />
SiO2, dem Hauptbestandteil der Sande und Gesteine. Um die hohe<br />
Schmelztemperatur von Sand, die bei immerhin 1700 °C liegt herabzusetzen,<br />
werden sogenannte Flußmittel benötigt.<br />
Die wesentlichen Flußmittel seit dem Altertum sind Soda<br />
(Natriumcarbonat) und Pottasche (Kaliumcarbonat), weiße, in<br />
Wasser leicht lösliche Salze. Kalk (Calciumcarbonat) wird der<br />
Glasschmelze dagegen zugesetzt, weil es das Glas beständiger,<br />
fester und härter macht.<br />
Heute sind die drei Hauptbestandteile - Sand, Soda oder Pottasche<br />
und Kalk - einfach und billig zu beschaffen. Früher war das<br />
anders. Soda und Pottasche wurden aufwendig und teuer aus der<br />
Herstellung von Flachglas<br />
Gußverfahren der alten Römer<br />
Flachglas, das zu Fenster- oder Autoscheiben verarbeitet wird, ist<br />
trotz seiner allgegenwärtigen Selbstverständlichkeit, einer der erstaunlichsten<br />
Werkstoffe unserer Zeit. Im Unterschied zu Hohlglas<br />
hat es einige Jahrtausende länger gedauert, bis es den Glasmachern<br />
im Mittelalter gelang, flache Glastafeln zu erzeugen, die<br />
für Fenster verwendet werden konnten. Diese Scheiben waren lange<br />
nicht so transparent, wie wir das heute für Fenster erwarten.<br />
Zwar hatten die alten Römer bereits ein einfaches Verfahren entwickelt,<br />
um Flachglas im Gußverfahren herzustellen, aber die von<br />
ihnen produzierten Gläser waren völlig undurchsichtig. Bei dem<br />
römischen Gußverfahren, das mit dem Untergang des römischen<br />
Reiches verlorenging, wurde die Glasschmelze in eine flache, nasse<br />
Holzform gegossen und ausgebreitet. Die Größe der auf diese<br />
Weise produzierten Scheiben betrug immerhin bis zu 70 x 100 cm<br />
bei einer Dicke von 4-5 mm.<br />
Modernes Floatglasverfahren<br />
Die Entwicklung des sogenannten Floatglasverfahrens im Jahre<br />
1959 war der bislang letzte Meilenstein in der Flachglasherstellung.<br />
„Float“ heißt auf deutsch soviel wie obenauf schwimmen oder<br />
treiben. Das Neuartige am Float-Verfahren besteht in dem sogenannten<br />
„Float-Band“. Es besteht aus geschmolzenem Zinn. Dieses<br />
Zinnbad ist etwa 4-8 m breit und bis zu 60 m lang. Als führender<br />
deutscher Spiegelglashersteller errichtete Vegla in Porz die<br />
erste deutsche Floatglasanlage, die 1966 in Betrieb genommen<br />
wurde. Bei diesem Verfahren schwimmt das flüssige Glas auf dem<br />
ideal ebenen Metall. Wenn die Glasmasse aus dem Schmelzofen<br />
auf das Zinnbad gezogen wird, hat das Zinn eine Temperatur von<br />
1000 °C. Am Ende des Zinnbades, wenn das jetzt erstarrte Glasband<br />
die Zinnwanne verläßt, liegt die Zinntemperatur bei 600°C.<br />
Zinn ist das einzige Metall, das die Voraussetzungen erfüllt, bei<br />
600 °C bereits flüssig zu sein und bei 1000 °C noch keinen störenden<br />
Dampfdruck zu entwickeln.<br />
Flachglas - Rohstoffe und Herstellung<br />
Kopiervorlage 21<br />
Asche von verbrannten Pflanzen isoliert. Im Mittelalter wurden<br />
aus diesem Grunde riesige Waldgebiete zu Asche verarbeitet.<br />
Heute werden Pottasche und Soda dagegen weit umweltfreundlicher<br />
und billiger produziert. Ein einfaches technisches Verfahren<br />
zur Soda- und Pottascheherstellung ist beispielsweise das Durchleiten<br />
von Kohlenstoffdioxid-reichen Abgasen durch Natron- oder<br />
Kalilauge (siehe Materialien zu Hüls AG in diesem Band).<br />
Übrigens: Glas ist eine amorphe, erstarrte Schmelze, also eine<br />
sehr zähe Flüssigkeit. Amorph bedeutet, daß die Atome und Moleküle<br />
keine feste Anordnung aufweisen. Daß es sich um eine Flüssigkeit<br />
handelt, erkennt man beispielsweise daran, daß sich sehr<br />
alte Fensterscheiben in mittelalterlichen Bauten nach unten hin<br />
verdicken und daß Teleskopspiegel älterer Bauweise ständig gedreht<br />
werden mußten, damit sie nicht „zerfließen“.<br />
Gußverfahren der alten Römer<br />
Modernes Float-Verfahren<br />
Aufgaben:<br />
1. Informiere dich in deinem Schulbuch über Quarz, Quarzglas und Sand und fasse die wesentlichen Unterschiede zusammen.<br />
2. Vergleiche die beiden dargestellten Verfahren zur Glasherstellung und beschreibe die Unterschiede.<br />
3. Begründe, warum die Eigenschaften von Zinn (bei 600 °C bereits flüssig und bei 1000 °C niedriger Dampfdruck) günstig für<br />
die Flachglasherstellung sind.
Seite 4 <strong>VEGLA</strong> - <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> Vollmer: KIS Köln<br />
Kopiervorlage 13<br />
Wärmedämmeigenschaften verschiedener Fensterverglasungen im Vergleich<br />
Hohe Anforderungen an moderne Fensterverglasungen<br />
Mit Erstaunen stellen wir heute fest, daß Mehrscheiben-Isolierglas<br />
schon 1885 zum Patent angemeldet wurde und zwar von dem US-<br />
Amerikaner T.D. Stedson.<br />
In den 70er Jahren haben vor allem die schweren Ölkrisen gezeigt, wie<br />
notwendig es auch im privaten Wohnbereich ist Energie einzusparen. In der<br />
Zwischenzeit wurden Wärmeschutzverordnungen erlassen, die strenge<br />
Anforderungen an die Qualität von Fensterverglasungen stellen. Die letzte<br />
Verordnung aus dem Jahre 1995 legt für Verglasungen in öffentlichen<br />
Gebäuden einen sogenannten Wärmedurchgangswert (k) von maximal<br />
k = 1,8 W/m2 K fest.<br />
Das bedeutet: Ein Quadratmeter Fensterverglasung darf pro Grad Temperaturunterschied<br />
zwischen außen und innen maximal 1,8 W an Wärmeleistung<br />
hindurchlassen.<br />
Methoden der Wärmedämmung<br />
Für die Verglasung in Wohn- und Büroräumen werden heutzutage schon<br />
lange keine Einfachverglasungen mehr verwendet. An ihre Stelle sind<br />
Isoliergläser getreten, sogenannte 2- oder 3-fach-Scheiben-Wärmeschutzisolierverglasungen.<br />
Doppelglas besteht aus zwei Glasscheiben, die so verbunden sind, daß der<br />
Zwischenraum zwischen den Gläsern gasdicht abgeschlossen ist.<br />
Eine noch bessere Wärmedämmung wird erzielt, wenn man Isolierglas mit<br />
einer dünnen Schicht aus den Edelmetallen Gold, Silber oder Kupfer (siehe<br />
rechts) beschichtet. Hierbei nutzt man die besonderen Eigenschaften dieser<br />
Edelmetalle, die in extrem dünner Schicht von nur 10 nm (= 0,000000001 m)<br />
für den sichtbaren Teil des Lichtspektrums durchlässig sind, die Wärmestrahlung<br />
aus dem Innenraum aber gut reflektieren.<br />
Einmal aufgenommene Wärme wird von einer Silberoberfläche ca. 40 mal<br />
schlechter abgegeben als von einer Glasoberfläche. Beträgt beispielsweise<br />
die Innenraumtemperatur + 20°C und die Außentemperatur -15°C, so ist<br />
die Fensterscheibe zum Innenraum mit Edelmetallbeschichtung etwa 6°C<br />
wärmer als ohne Beschichtung (+ 13°C gegenüber + 7°C).<br />
Infrarotlicht<br />
Infrarotes Licht wird auch als Wärmestrahlung bezeichnet. Während unser<br />
Auge diese Strahlung nicht wahrnehmen kann, erkennen die Wärmefühler<br />
in der Haut infrarotes Licht als Wärmestrahlung. Wenn wir also davon<br />
sprechen, daß uns die Sonnenstrahlen die Frühjahrsmüdigkeit nach einem<br />
langen, dunklen und kalten Winter aus den Knochen vertreibt, dann wird<br />
unsere Stimmung durch die Sonnenstrahlen auf zwei Arten angeregt. Die<br />
Intensität der Sonnenstrahlen nimmt insgesamt zu, das betrifft sowohl die<br />
Lichtwellen, die zum sichtbaren Teil des Spektrums gehören, als auch die<br />
Wellen, die für uns unsichtbar sind, wie z.B. die Infrarotstrahlen. Aus<br />
diesem Grunde nimmt die Helligkeit und die Wärme im Frühjahr zu.<br />
Aufgaben:<br />
1. Warum isoliert Isolier-Doppelglas besser als Einfachglas?<br />
2. Warum sollte der Zwischenraum zwischen den Glasscheiben gasdicht verschlossen sein, um eine optimale Dämmwirkung zu<br />
erreichen?<br />
3. Wieviel g Gold befindet sich auf einer 10 m 2 großen Glasfläche aus beschichtetem Isolierglas (Dichte Gold = 19,3 g / cm 3 )?<br />
Lohnt sich die Rückgewinnung der Edelmetalle nach dem Gebrauch der Glasscheiben?<br />
4. Nehmen wir an, daß sich die Menschen in einem heißen Wüstenstaat nach kühlen Räumen sehnen. Diskutiere die Eignung von<br />
metallbeschichteten Isolierglasscheiben für diesen Zweck. An welcher Stelle der Doppelverglasung würdest du die Edelmetallschicht<br />
auftragen?
Vollmer: KIS Köln <strong>VEGLA</strong> - <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> Seite 5<br />
V<br />
Untersuchung der Wärme- und Lichtdurchgangswerte für verschiedene Glastypen<br />
a) Eine mit Dämmmaterial ausgekleidete offene Holzkiste enthält<br />
ein elektrisches Thermometer mit Außenanzeige sowie<br />
eine Heizquelle (Elektroofen, IR-Lampe, Glühbirne etc.). Die<br />
Kiste wird mittels geeignetem Befestigungsmaterial mit einer<br />
Glasscheibe verschlossen (Klebeband, Gummidichtung, etc.).<br />
Die abgebildete Anordnung eignet sich besonders für schon<br />
eingebaute Scheiben (Fenster).<br />
Wir ermitteln den Wärmeduchgang durch verschiedene Glastypen<br />
durch folgenden Versuch:<br />
Messung:<br />
Miß den Temperaturverlauf in der Kiste in Abhängigkeit von<br />
der Zeit (>30 min.) bei verschiedenen Glastypen und fertige<br />
ein Diagramm zum Meßverlauf an.<br />
b) Zwischen einer Infrarotlichtquelle und einem Meßgerät zur<br />
Erfassung der Lichtintensität, die im Abstand von 20 cm zueinander<br />
angeordnet sind, wird in die Mitte eine Doppelglas-<br />
Isolierscheibe angebracht.<br />
Messung:<br />
1. Miß die Lichtintensität nach Einschalten der Lichtquelle.<br />
2. Wiederhole die Messung mit einer beschichteten Doppelglas-Isolierscheibe.<br />
Kopiervorlage 41<br />
Versuche und Gedankenexperimente zur Wärmedämmung mit Glas<br />
(Glasproben für die Versuche in einer Größe von 20 x 30 cm können über das Glasmusterlager der Vegla bezogen werden)<br />
Aufgabe: Deute die Versuchsergebnisse<br />
Berechnung des k-Wertes von Fensterglas an einem Beispiel<br />
In ein kleines Modell-Wohnhaus wurde in einem <strong>Schule</strong>xperiment<br />
Einfach-Fensterglas mit einer Fläche von 28 cm x 28 cm<br />
eingelassen. Bei einer Außentemperatur von 24 °C wurde das<br />
Modellhaus mit einem kleinen Elektroofen auf gleichbleibend<br />
40 °C beheizt.<br />
Dazu mußte der Ofen auf 12,5 V (bei 1,63 Ampère Stromstärke)<br />
eingeregelt werden. Die zugeführte Wärmeenergie gleicht den<br />
Verlust an Wärmeenergie aus, der gleichzeitig über die<br />
Hausflächen - Fußboden, Wände, Dach und Fenster - abgegeben<br />
wird.<br />
Anschließend wurde das Einfach-Fensterglas durch Isolier-<br />
Doppelglas ersetzt und das Modellhaus wurde ebenfalls auf<br />
konstant 40 °C beheizt. In diesem Fall mußte der Ofen auf<br />
10 V (bei 1,5 Ampère Stromstärke) eingeregelt werden.<br />
Die Unterschiede in der benötigten Wärmezuführung durch den<br />
Ofen ergeben sich ausschließlich dadurch, daß die Wärmeverluste<br />
durch die verwendeten Glastypen unterschiedlich groß sind. Der<br />
k-Wert des Einfach-Fensterglases beträgt 6 W /m2 K.<br />
Temperaturunterschiede werden mit K (Kelvin) statt °C<br />
bezeichnet.<br />
Aufgabe:<br />
Zeige, daß der k-Wert des Isolierglases ca. 1,7 W /m2 K<br />
beträgt.<br />
Hinweise zu Lösung:<br />
1. Berechne zuerst die aufgebrachte Wärmeleistung in Watt (W)<br />
für das Aufheizen des Modellhauses. (W=V�A)<br />
2. Berechne die eingesparte Wärmeleistung durch den Einbau<br />
der Isolier-Fensterverglasung. (Angabe in Watt)<br />
3. Die eingesparte Wärmeleistung bezieht sich auf eine Glasfläche<br />
von A = 0,28 m x 0,28 m. Berechne die eingesparte<br />
Wärmeleistung bei einer Glasfläche von 1 m2 . (W/m2 )<br />
4. Die eingesparte Wärmeleistung bezieht sich auch auf die gegebene<br />
Temperaturdifferenz zwischen außen und innen von<br />
24°C zu 40°C. Berechne die eingesparte Wärmeleistung bei<br />
einer Temperaturdifferenz von nur 1 °C. (Angabe in W/m2 K)<br />
5. Der Wärmedurchgangswert durch das verwendete Isolierglas<br />
ist um den errechneten Betrag kleiner als der Wärmedurchgangswert<br />
des Einfachglases. (k = 6 W/m2 K)
Seite 6 <strong>VEGLA</strong> - <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> Vollmer: KIS Köln<br />
Kopiervorlage 51<br />
Ursachen für Wärmeverluste<br />
Wärmeschutzschichten auf Verglasungen haben die Aufgabe, die<br />
Energieabgabe vom Innenraum nach außen zu vermindern. Sie<br />
sollen für den sichtbaren Bereich des Lichtes durchlässig sein,<br />
die Wärmestrahlung (Infrarotbereich) des Innenraumes jedoch<br />
gut reflektieren.<br />
Insgesamt wird der Wärmefluß vom (wärmeren) Innenraum in<br />
die (kühlere) Umgebung durch drei Größen bestimmt: Wärmeleitung,<br />
Wärmestrahlung und Konvektion. Die nebenstehende Abbildung<br />
verdeutlicht die Zusammenhänge. Gezeigt wird die Wärmeflußverteilung<br />
bei gewöhnlicher 2-fach-Isolierverglasung.<br />
Die Kurvenverläufe rechts zeigen<br />
die Durchlässigkeit (Transmission)<br />
von 2-fach-Isolierverglasung und<br />
edelmetallbeschichteter Isolierverglasung<br />
für elektromagnetische<br />
Strahlung.<br />
Die Abbildung deutet auf einen<br />
Nachteil edelmetallbeschichteter<br />
Isolierverglasungen hin. Um hier<br />
Abhilfe zu schaffen, werden zusätzliche<br />
Schichten aus Metalloxiden<br />
aufgetragen, die den erstaunlichen<br />
Effekt hervorrufen, daß die Reflexion<br />
im sichtbaren Bereich der Strahlung<br />
deutlich verringert wird. Mehr<br />
darüber erfährst du auf der nächsten<br />
Kopiervorlage.<br />
Frage: Welcher Nachteil ist gemeint?<br />
Aufgaben:<br />
Wärmeschutz durch Edelmetallbeschichtung<br />
Wärmeflußverteilung bei gewöhnlicher 2-fach-Isolierverglasung<br />
Aufgaben:<br />
1. Betrachte die Skizze zur Wärmeflußverteilung von gewöhnlicher<br />
2-fach-Isolierverglasung (oben).<br />
a. Wie wirkt sich das Auftragen einer Wärmeschutzschicht aus<br />
Edelmetall auf die Wärmeflußverteilung aus? Fertige eine<br />
Skizze an.<br />
b.Beschreibe die Unterschiede, die sich hinter den Begriffen<br />
„Wärmeleitung“ und „Wärmestrahlung“ verbergen. Welche<br />
Zusammenhänge bestehen zwischen den Größen?<br />
2. Betrachte die linksstehende Skizze. Beschreibe und interpretiere<br />
die Zahlenangaben zu den Oberflächentemperaturen<br />
der Glasinnen- und -außenseiten der verschiedenen Glastypen.<br />
1. Beschreibe den Unterschied in der Transmission für 2-fach-Isolierglas und edelmetallbeschichtetes Isolierglas. Welche Auswirkungen<br />
auf das Raumklima in Bürogebäuden kann man aus den Kurvenverläufen ableiten?<br />
2. Diskutiere die Eignung von beschichtetem Glas für Gewächshäuser, Wintergärten und Bürogebäude.
Vollmer: KIS Köln <strong>VEGLA</strong> - <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> Seite 7<br />
Kopiervorlage 61<br />
Reflexionsmindernde Beschichtungen erhöhen die Lichtdurchlässigkeit<br />
Auf der Kopiervorlage 3 konnten Sie erkennen, daß edelmetallbeschichtetes<br />
Glas verbesserte Wärmedämmeigenschaften aufweist.<br />
Der Nachteil einer solchen Beschichtung liegt aber darin,<br />
daß sie zu einer deutlichen Verringerung der Lichtdurchlässigkeit<br />
im sichtbaren Bereich des Spektrums führt. Das bedeutet,<br />
daß auf einen Großteil des eingestrahlten Tageslichtes verzichtet<br />
werden muß. Eine derartige Wärmeschutzverglasung fände<br />
keine Abnehmer.<br />
Die Welleneigenschaften des Lichtes machen jedoch eine Verbesserung<br />
der Lichtdurchlässigkeit möglich, die zunächst einmal<br />
phantastisch klingt: Weitere Beschichtungen bewirken eine<br />
extreme Verbesserung der Transmission auf über 95%. Solche<br />
Schichten werden als „Vergütungsschichten“ oder kurz als „Vergütung“<br />
bezeichnet. In der Praxis werden dazu in der Regel sehr<br />
dünne Schichten aus Magnesiumfluorid (MgF ) oder Zinnoxid<br />
2<br />
(SnO) aufgetragen.<br />
Die dadurch erzielte erhöhte Lichtdurchlässigkeit läßt sich<br />
folgendermaßen erklären: Die an den Grenzflächen Luft/Vergütungsschicht<br />
und Vergütungsschicht/Glas reflektierten Anteile<br />
der Lichtwellen löschen sich aus, wenn der Gangunterschied ∆ ∆ s<br />
ein Vielfaches der halben Wellenlänge beträgt. Dieser Vorgang<br />
wird als destruktive Interferenz bezeichnet. Aus Gründen der<br />
Energieerhaltung vergrößert sich die Intensität des durchgehenden<br />
Lichts in gleichem Maße.<br />
Damit eine solche Schicht auf diese Art wirksam sein kann,<br />
muß sie eine Dicke von ca. λ/4 haben, da der an der unteren<br />
Grenzfläche Vergütungsschicht/Glas reflektierte Anteil die<br />
Schicht zweimal durchläuft. Aus dieser Überlegung wird deutlich,<br />
daß eine einzige Schicht nur eine Vergütung für eine(n)<br />
einzige(n) Wellenlänge(n-Bereich) bedeutet. Damit auch für<br />
weitere Wellenlängen aus dem sichtbaren Bereich eine erhöhte<br />
Reflexminderung erzielt werden kann, werden zusätzliche<br />
Schichten aufgetragen. Destruktive Interferenz führt also dazu,<br />
daß durch das Auftragen einer oder mehrerer reflexmindernder<br />
Schichten mit geeigneter Schichtdicke der Lichtdurchlaß durch<br />
die Verglasung erhöht wird.<br />
Aufgaben:<br />
Eine MgF 2-Vergütungsschicht soll den Durchlaß für Licht der<br />
Wellenlänge 550 nm (Zitronengelb) verbessern.<br />
1. Zeigen Sie, daß die Schicht eine Dicke von genau<br />
99,64 nm aufweisen muß.<br />
2. Wie groß müßte die Dicke der Vergütungsschicht sein,<br />
wenn sämtliche Medien den gleichen Brechungsindex<br />
aufweisen würden?<br />
Daten: Brechungsindizes<br />
MgF2: n (Verg.) = 1,38<br />
Luft: n (Luft) = 1,00<br />
Formeln: Lichtgeschwindigkeit<br />
c = λ f<br />
(Die Frequenz f bleibt medienunabhängig immer<br />
gleich, die Lichtgeschwindigkeit c ist medienabhängig<br />
variabel)<br />
Ansatz:<br />
Fragen<br />
Brechungsindex Medium<br />
c (Verg.)<br />
c (Luft)<br />
Gangunterschied<br />
=<br />
n (Luft)<br />
n (Verg.)<br />
∆s = λ/2 = 2d (destruktive Interferenz)<br />
c (Verg.)<br />
c (Luft)<br />
n (Luft)<br />
= n<br />
⇒ d = ......<br />
(Verg.)<br />
λ(Luft)<br />
4n (Verg.)<br />
1. Zwei Lichtwellen der gleichen Wellenlänge löschen sich gegenseitig<br />
aus, wenn ihr Gangunterschied dem Vielfachen der<br />
halben Wellenlänge entspricht. Was ist mit dem Begriff<br />
„Gangunterschied“ gemeint? Fertigen Sie eine Skizze an.<br />
2. Weil Photoobjektive zur Reflexminderung mit einer etwa<br />
99,6 nm dicken Magnesiumfluorid-Schicht überzogen werden,<br />
nehmen sie eine purpur-blaue Färbung an. (Purpur-blau<br />
ist die Komplementärfarbe von Zitronengelb, siehe „Aufgaben“!)<br />
Begründen Sie diese Aussage.<br />
3. Wenn die Vergütungsschicht eine Dicke von λ/4 hat, haben<br />
die an den Grenzflächen Luft/Vergütungsschicht und<br />
Vergütungsschicht/Glas reflektierten Anteile der entsprechenden<br />
Lichtwellen Gangunterschiede, die einem Vielfachen<br />
ihrer halben Wellenlänge entsprechen. Warum ist das so?<br />
4. Wieso erhöht sich die Lichtdurchlässigkeit, wenn sich die an<br />
den Grenzflächen der Schichten reflektierten Lichtwellen<br />
durch destruktive Interferenz löschen?
Seite 8 <strong>VEGLA</strong> - <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> Vollmer: KIS Köln<br />
Didaktische Kopiervorlage Bemerkungen 1<br />
Einsatzmöglichkeiten der Kopiervorlagen im Unterricht und Anbindung an die Lehrpläne<br />
Die Arbeitsblätter sprechen schwerpunktmäßig den Physikunterricht an.<br />
KV 3: Wärmelehre, Wärmetransportarten, Wärmedämmung; ab Jgst. 6 (Physik), speziell auch Wahlpflichtbereich NW, auch Jgst.<br />
10-13 /elektromagnetische Strahlung)<br />
KV 4: oben: Wärmelehre, Temperaturdiagramme + Interpretationen (ab Jgst. 6 (Physik) a., ab Jgst. 8 b.)<br />
unten: Wärmeschutz = Umweltschutz (ab Jgst. 8 speziell WP NW, Jgst. 10, Energiebilanzen)<br />
KV 5: Wärmefluß und Strahlung (ab Jgst. 10 (Physik) besonders Jgst. 12 (Physik)<br />
KV 6: Vergütung (Jgst. 12 Physik)<br />
Informationen, Bemerkungen, Lösungen zu den Kopiervorlagen<br />
Vorbemerkung<br />
Die vorliegende Einheit befaßt sich schwerpunktmäßig mit der<br />
Herstellung von Flachglas und seiner Veredelung zu Wärmedämmglas.<br />
Das Thema „Wärmedämmung“ ist zur Zeit aus ökologischen<br />
und energiewirtschaftlichen Gründen hochaktuell. Der Lebensweltbezug<br />
des Themas schafft einen weiteren Grund für seine prioritäre<br />
unterrichtliche Behandlung.<br />
Vertiefende Informationen zum Thema „Glas“ findet man in den<br />
gleichnamigen Themenheften, erschienen in den Fachzeitschriften<br />
„Naturwissenschaften im Unterricht Chemie“ und „Praxis der<br />
Naturwissenschaften Chemie“ (NiU-Chemie (1996), PdN-Ch 1/46<br />
Jg.1997).<br />
Die verschiedenen Aspekte zum Thema „Glas“ lassen sich im<br />
Rahmen des Chemie- sowie des Physikunterrichtes behandeln.<br />
Hierbei bietet sich eine ideale Gelegenheit, das Themenfeld fächerübergreifend<br />
oder als Projekt zu unterrichten. Besonders motivierend<br />
ist ein Besuch des Werkes Köln-Porz der <strong>VEGLA</strong>, weil<br />
die Ausmaße der Anlagen zur Herstellung von Flachglas aus der<br />
Schmelze (Floatglasverfahren) und zur Produktion von Wärmedämmglas<br />
(Magnetron-Verfahren) mit einer Gesamtlänge von<br />
mehreren hundert Metern beeindruckende Dimensionen aufweist.<br />
Kopiervorlage 2<br />
Die Schüler sollen erkennen, daß die Glasherstellung einerseits<br />
eine lange Tradition hat, daß aber andererseits Glasqualitäten, wie<br />
wir sie heute kennen, erst seit wenigen Jahrzehnten realisierbar<br />
sind, weil die entsprechenden Produktionsverfahren erst spät entwickelt<br />
worden sind.<br />
Die dargestellten Beispiele fordern die Schüler auf, die Glasherstellung<br />
zur Zeit der Römer mit dem aktuellen Stand der Technik<br />
auf diesem Gebiet zu vergleichen. Dabei wird vor allem deutlich,<br />
daß zunächst nicht die Rezeptur der Ausgangsstoffe, die sich über<br />
die Jahrtausende nicht wesentlich verändert hat, die Qualität bestimmt,<br />
sondern daß es vor allem darauf ankommt, daß die Glasflächen<br />
optimal glatt und eben sind, damit eine möglichst hohe<br />
Lichtdurchlässigkeit erzielt wird.<br />
Zur besseren Veranschaulichung dieses Zusammenhanges bietet<br />
sich der Vergleich einer unbehandelten Glasscheibe mit einer gesandstrahlten<br />
oder entsprechend behandelten Glasfläche an. Die<br />
Glasherstellung nach dem Gußverfahren, das zur Zeit der Römer<br />
praktiziert wurde, läßt sich im Unterricht experimentell leicht<br />
durchführen. Nähere Informationen hierzu siehe unter Literaturund<br />
Kontaktadressen.<br />
Kopiervorlage 3<br />
Die Schüler lernen neben der ihnen bereits bekannten Methode<br />
der Wärmedämmung durch Doppelverglasung als weitere<br />
Wärmedämmmaßnahme das Überziehen von Fensterglas mit einer<br />
hauchdünnen Edelmetallschicht kennen. Dabei dürfte die Tatsache<br />
überraschen, daß ein Überzug aus Edelmetallen transparent<br />
ist. Durch eine einfache Rechenaufgabe kann man zeigen, daß<br />
diese Edelmetallschicht außerordentlich dünn ist. Dazu läßt man<br />
beispielsweise die Silbermasse berechnen, die sich auf einem<br />
silberbeschichteten Fensterglas einer definierten Fläche befindet.<br />
Die Eigenschaft der Edelmetallbeschichtung, Infrarotstrahlung, die<br />
von einer Wärmequelle im Raum ausgeht, zu reflektieren, bietet<br />
eine geeignete Möglichkeit, den Schülern den Unterschied zwischen<br />
Licht- und Wärmestrahlung zu verdeutlichen.<br />
Unbeschichtetes und beschichtetes Glas lassen Strahlung aus dem<br />
sichtbaren Teil des Spektrums passieren, während das unsichtbare<br />
Infrarotlicht vom edelmetallbeschichteten Glas stärker reflektiert<br />
wird als vom unbeschichteten Glas. Der Effekt spielt sich für<br />
uns unsichtbar ab, ist aber durch geeignete Maßnahmen wie z.B.<br />
durch eine Temperaturerfassung meßbar.<br />
Kopiervorlage 4<br />
Mit einfachen schulischen Mitteln lassen sich Versuche zur<br />
Wärmedämmung und zur Lichtdurchlässigkeit verschiedener Glastypen<br />
durchführen. Glasproben von beschichteten und<br />
unbeschichteten Wärmeschutzverglasungen können dazu beispielsweise<br />
über das Glasmusterlager der <strong>VEGLA</strong> bezogen werden<br />
(siehe Literatur- und Kontaktadressen).<br />
Ergänzend zu den beschriebenen Versuchen bietet sich folgender<br />
Versuchsansatz an (die Autoren, die die Versuche entwickelt und<br />
in der <strong>Schule</strong> erprobt haben, geben hierzu gerne weitere Informationen):<br />
Ergänzung zu Kopiervorlage 4:<br />
Stehen gleich große Glasproben unterschiedlicher Glastypen zur<br />
Verfügung, bietet sich der Bau eines „Doppelhauses“ an, bei dem<br />
die Größe und die Wärmedämmung der Haushälften identisch ist.<br />
Unterschiede ergeben sich in der Verwendung unterschiedlicher<br />
Glastypen für die Fensterverglasung. In unserem Beispiel sind die<br />
Dachflächen verglast. Als Wärmequellen für die Haushälften dienen<br />
zwei gleichkonfektionierte Glübirnen. Die Temperatur wird<br />
über Innenfühler außen angezeigt.
Vollmer: KIS Köln <strong>VEGLA</strong> - <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> Seite 9<br />
1. Zum direkten Vergleich der Wärmedämmwirkung der unterschiedlichen<br />
Glastypen werden die aktuellen Innentemperaturen<br />
der Haushälften zeitgleich gegenübergestellt.<br />
Sehr anschaulich läßt sich nebenbei die Tatsache vermitteln,<br />
daß sich z.B. die einfache Verglasung außen wärmer anfühlt<br />
als eine Wärmeschutzverglasung.<br />
2. Die Ermittlung der Wärmedurchgangskoeffizienten (k-Werte)<br />
läßt sich wie in dem Rechenbeispiel auf Kopiervorlage 4 dargestellt<br />
durchführen. Die gewählten Werte entsprechen tatsächlich<br />
gemessenen Werten aus den Versuchen in der <strong>Schule</strong>.<br />
Hintergrundinformationen<br />
Das Unternehmen <strong>VEGLA</strong> <strong>GmbH</strong><br />
<strong>VEGLA</strong> <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> ist ein kundenorientiertes,<br />
modernes Unternehmen, das zu den größten deutschen Produzenten<br />
von Flachglas für den Hochbau zählt. Der Firmensitz der<br />
<strong>VEGLA</strong> lag seit seiner Gründung in Aachen. Weitere Werke betreibt<br />
das Unternehmen in Herzogenrath (Floatglas), Stolberg<br />
(Floatglas, Spiegel), Mannheim (Gußglas) und in Köln- Porz<br />
(Floatglas, beschichtetes Glas).<br />
Die Anfänge des Unternehmens liegen in der Mitte des vorigen<br />
Jahrhunderts: 1853 gründet der französische Glashersteller<br />
SAINT-GOBAIN eine Spiegelmanufaktur in Mannheim und pachtet<br />
1857 eine weitere in Aachen. Achtzig Jahre später gehen diese<br />
zusammen mit zwei anderen Glashütten in einem neuen Unternehmen<br />
auf: <strong>VEGLA</strong> <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong>, Zweigniederlassung<br />
von SAINT-GOBAIN. Schnell wurde das Unternehmen zu einem<br />
Markführer in den Sektoren Bau- und Autoglas. Eine letzte große<br />
Umstrukturierung fand 1994 mit der Trennung der Geschäftsfelder<br />
Bau- und Autoglas statt. Als Tochtergesellschaft der <strong>VEGLA</strong> hat<br />
die SEKURIT SAINT-GOBAIN Deutschland <strong>GmbH</strong> & Co. KG<br />
ab diesem Zeitpunkt die Autoglasaktivitäten übernommen.<br />
Das Kölner Werk der <strong>VEGLA</strong> ist in der Unternehmensgeschichte<br />
häufig Vorreiter für innovative und bahnbrechende Entwicklungen<br />
gewesen. 1966 wurde hier die erste deutsche Floatglasanlage<br />
errichtet, ein Verfahren, das heute dem allgemeinen Stand der<br />
Technik entspricht. Im Jahre 1986 wurde eine weiterentwickelte<br />
Floatglasanlage mit einer Tagesleistung von 750 t in Betrieb genommen.<br />
Das Werk nimmt mittlerweile eine europäische Spitzenposition<br />
auf dem Gebiet der Herstellung von beschichteten<br />
Gläsern und Wärmedämmgläsern ein. 1983 wurde in Porz eine<br />
Magnetron-Anlage in Betrieb genommen, in der neutrale<br />
Interferenzschichten auf Silberbasis für Wärmedämmglas im<br />
Hochvakuum aufgetragen werden. Die letzte große Investition auf<br />
diesem Sektor wurde 1995 mit der Errichtung einer neuen, 35 Millionen<br />
Mark teuren Anlage getätigt, mit deren Inbetriebnahme dem<br />
erwarteten sprunghaften Anstieg in der Nachfrage nach hochwertigen<br />
Wärmedämm- und Sonnenschutzgläsern begegnet werden<br />
soll.<br />
Didaktische Kopiervorlage Bemerkungen<br />
1<br />
Meßreihe zur Ermittlung der Innentemperatur in den Haushälften<br />
in Abhängigkeit von den verwendeten Glastypen (Klasse 6.1<br />
Physik an der Gesamtschule Köln-Porz)<br />
1853<br />
1857<br />
1936<br />
1945-50<br />
1950-65<br />
1965<br />
1971<br />
1977<br />
1978<br />
1982-83<br />
1990<br />
1993<br />
1994<br />
1995<br />
SAINT-GO<br />
BAIN<br />
unterzei<br />
chnet<br />
den<br />
Vertrag<br />
zur<br />
Grün-<br />
dung<br />
der<br />
Spiegelm<br />
anufaktur<br />
Waldhof<br />
in<br />
Mannheim<br />
SAINT-GO<br />
BAIN<br />
pachtet<br />
die<br />
Aachener<br />
Spiegelm<br />
anufaktur<br />
AG<br />
und<br />
erwirbt<br />
sie<br />
1864<br />
Durch<br />
Zusamme<br />
nschluß<br />
von<br />
vier<br />
Glashüt<br />
ten<br />
entsteht<br />
<strong>VEGLA</strong><br />
Verein<br />
igte<br />
<strong>Glaswerke</strong>,<br />
Zweigni<br />
ederlassung<br />
der<br />
Compagnie<br />
des<br />
SAINT-GO<br />
BAIN,<br />
mit<br />
Sitz<br />
in<br />
Aachen<br />
Die<br />
völ<br />
l ig<br />
zerstörten<br />
Produktionsanl<br />
agen<br />
werden<br />
wieder<br />
aufgebaut<br />
<strong>VEGLA</strong><br />
wächst<br />
mit<br />
der<br />
Bautätig<br />
keit<br />
und<br />
der<br />
Entwic<br />
klung<br />
des<br />
Automobil<br />
baus<br />
in<br />
Deutschla<br />
nd.<br />
Beginn<br />
des<br />
Floatgla<br />
szeitalt<br />
ers:<br />
<strong>VEGLA</strong><br />
nimm<br />
dt.<br />
Floatgla<br />
sanlage<br />
in<br />
Köln-<br />
Porz<br />
in<br />
Betrieb<br />
t die<br />
<strong>VEGLA</strong><br />
wird<br />
als<br />
100%<br />
ige<br />
Tochter<br />
von<br />
SAINT-<br />
GOBAIN<br />
zur<br />
<strong>GmbH</strong><br />
erste<br />
Einbrin<br />
gung<br />
der<br />
dt.<br />
Flachgla<br />
saktivit<br />
äten<br />
der<br />
Glacerie<br />
s<br />
de<br />
Saint-<br />
Roch<br />
in<br />
die<br />
<strong>VEGLA</strong><br />
Vegla<br />
faßt<br />
al<br />
l e Verkaufs-<br />
und<br />
Verwalt<br />
ungsstel<br />
l en<br />
in<br />
ihren<br />
neuen<br />
Firmens<br />
itz<br />
in<br />
Aachen<br />
zusamme<br />
n.<br />
Abwicklung<br />
eines<br />
anspruchsvo<br />
l<br />
en<br />
Investit<br />
ionsprogra<br />
mms<br />
und<br />
kostenint<br />
ensiven<br />
<strong>VEGLA</strong><br />
übernimm<br />
t die<br />
Glasind<br />
ustrie<br />
AG<br />
in<br />
Torgau,<br />
Sachsen,<br />
das<br />
ehemali<br />
ge<br />
Flachgla<br />
skombinat<br />
nebst<br />
einige<br />
n Betriebsstät<br />
ten<br />
in<br />
den<br />
Neuen<br />
Ländern<br />
<strong>VEGLA</strong><br />
nimmt<br />
in<br />
Torgau<br />
eine<br />
zweite<br />
Magnetron-<br />
Anlage<br />
zur<br />
Floatgla<br />
sbeschicht<br />
ung<br />
in<br />
Betrieb<br />
Das<br />
gesamte<br />
Geschäftsfe<br />
ld<br />
Autogla<br />
s wird<br />
von<br />
der<br />
neugegr<br />
ündeten<br />
Tochterge<br />
sel<br />
l schaft<br />
SEKURIT<br />
SAINT-<br />
GOBAIN<br />
Deutschla<br />
nd<br />
übernomme<br />
n.<br />
<strong>VEGLA</strong><br />
konzentrie<br />
rt<br />
sich<br />
auf<br />
den<br />
Bereich<br />
Baugla<br />
s.<br />
Eine<br />
dritte<br />
Hochvakuumanl<br />
age<br />
für<br />
beschichte<br />
entsteht<br />
in<br />
Köln-<br />
Porz<br />
te<br />
Gläser
Seite 10 <strong>VEGLA</strong> - <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> Vollmer: KIS Köln<br />
Hintergrundinformationen<br />
Kopiervorlage 1<br />
Beschichtetes Glas<br />
Durch die Verwendung unterschiedlich beschichteter Gläser lassen<br />
sich heute Verglasungen einsetzen, die das eingestrahlte Sonnenlicht<br />
je nach Bedarf in verschiedene Anteile aufspalten, und<br />
die Transmission oder die Reflexion bestimmter Wellenlängenbereiche<br />
verstärken oder verringern. Auf diese Weise lassen sich<br />
auf die jeweiligen Anforderungen hin maßgeschneiderte Verglasungen<br />
herstellen. Die Energiekrise von 1973, in deren Folge in<br />
der Bundesrepublik Deutschland 1976 das Energieeinsparungsgesetz<br />
erlassen wurde, beschleunigte die Weiterentwicklung des<br />
Mehrscheibenisolierglases zu Funktionsgläsern hohen Wirkungsgrades.<br />
Dabei brachte die Entwicklung von reflektierenden Metallbeschichtungen<br />
erhöhten Wärme- und Sonnenschutz. Durch das<br />
Auftragen von Magnesiumfluorid oder Zinnoxidschichten wurde<br />
die Durchlässigkeit durch Fensterglas für verschiedene<br />
Wellenlängenbereiche deutlich erhöht.<br />
Literatur und Kontaktadressen<br />
Literatur:<br />
MagnetronVerfahren<br />
Edelmetallschichten werden durch Kathodenzerstäubung (engl.<br />
Sputter) auf die Glasschichten aufgetragen. Nach dem Evakuieren<br />
einer Kammer auf Hochvakuum wird ein Arbeitsgas, in den<br />
meisten Fällen gereinigtes Argon, bis zu einem Druck von 10-1 bis 10-2 bar eingelassen. In der Dioden-Anordnung wird zwischen<br />
der geerdeten Anode, die das Substrat trägt, und der Kathode, die<br />
mit dem zu beschichtenden Material, also dem Glas belegt ist,<br />
eine Gasentladung gezündet. Durch den Stoß mit den beschleunigten<br />
Gas-Ionen (z.B. Ar + ) wird die Kathode zerstäubt und die<br />
dabei ausgelösten neutralen Teilchen schlagen sich auf den Wänden<br />
und dem Substrat nieder. Optimale Ergebnisse erzielt man,<br />
wenn das Plasma vor der Kathode durch ein Magnetfeld<br />
konzentriet wird. Daher stammt der Name Magnetron-Verfahren.<br />
Themenheft Glas: PdN-Ch 1/46 Jg. 1997, Aulis Verlag Deubner & Co, Köln<br />
Themenheft Glas: NiU-Chemie 7 (1996) Nr. 35, Pädagogische Zeitschriften bei Friedrich in Velber in Zusammenarbeit mit Klett,<br />
30926 Seelze<br />
Verschiedene Schriften zum Thema herausgegeben vom Bundesverband Glasindustrie und Mineralfaserindustrie e.V., Postfach<br />
101753, 40008 Düsseldorf, Tel.: 0211 / 16894-0, Fax: 0211 / 8587686<br />
Informationsschriften zum Thema Glas können auch über <strong>VEGLA</strong> <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> bezogen werden: <strong>VEGLA</strong> Marketing-Service,<br />
c/o mlt <strong>GmbH</strong>, Carl-Zeiss-Straße 3, D-52477 Alsdorf, Tel.: 02404 / 21904, Fax: 02404 / 82931<br />
Glasproben für die Versuche:<br />
Glasproben für Unterrichtsversuche (20 cm x 30 cm) können über das Zentrale Glasmusterlager der <strong>VEGLA</strong> bezogen werden:<br />
Unter der Fax. Nr. 02404 / 82931 erhalten Sie Glasproben innerhalb von 2 Tagen nach Bestelleingang.<br />
E-mail-Adressen der Autoren:<br />
Helmut Horstmeier: hhorstme@gsporz.k.nw.schule.de<br />
Dr. Margarete Himmrich: mhimmric@gsporz.k.nw.schule.de<br />
Kontaktinformationen zum Unternehmen<br />
1. Ansprechpartner<br />
Hans-Peter Hoheisel, Werkleiter am Standort Köln-Porz<br />
Poststraße 103, 51143 Köln, Tel.: (0 22 03) 859-100<br />
2. Unterrichts- und Informationsmaterialien<br />
Informationsschriften zum Thema Glas können auch über <strong>VEGLA</strong>, <strong>Vereinigte</strong> <strong>Glaswerke</strong> <strong>GmbH</strong> bezogen werden:<br />
<strong>VEGLA</strong> Marketing-Service, c/o mlt <strong>GmbH</strong>, Carl-Zeiss-Straße 3, D-52477 Alsdorf<br />
Tel.: 02404 / 21904, Fax: 02404 / 82931, Homepage: www.vegla.de<br />
3. Betriebsbesichtigungen und Betriebspraktika<br />
Betriebsbesichtigungen sind nach Absprache mit dem Werkleiter möglich<br />
4. Ausbildungsplätze und berufliche Möglichkeiten<br />
Das Unternehmen bildet in dreijähriger Ausbildungszeit zum Industrieglasfertiger, Schwerpunkt Steuerungs- und<br />
Regelungstechnik aus. Ansprechpaertnerin in Fragen der Ausbildung ist Frau Höferer (Tel.: (0 22 03) 859-154








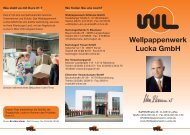
![KURS 21 Einstiegsmaterialien [PDF] - Portal Schule Wirtschaft](https://img.yumpu.com/24141248/1/190x239/kurs-21-einstiegsmaterialien-pdf-portal-schule-wirtschaft.jpg?quality=85)