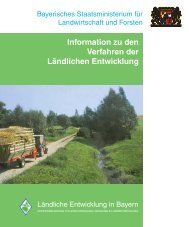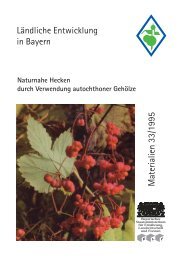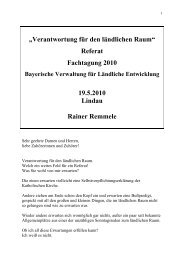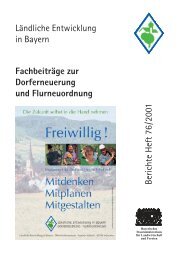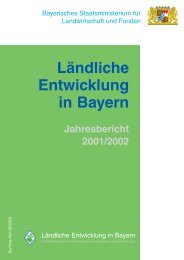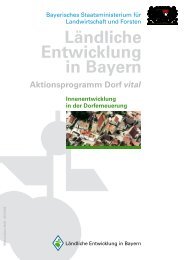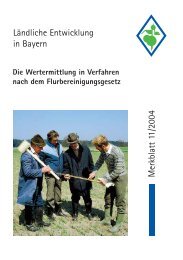Fachtagung 1994 in Ansbach, Ländliche Entwicklung dient Stadt ...
Fachtagung 1994 in Ansbach, Ländliche Entwicklung dient Stadt ...
Fachtagung 1994 in Ansbach, Ländliche Entwicklung dient Stadt ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>in</strong> Bayern<br />
<strong>Fachtagung</strong> <strong>1994</strong> <strong>Ansbach</strong><br />
»<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong><br />
<strong>Stadt</strong> und Land«<br />
Bayerisches Staatsm<strong>in</strong>isterium<br />
für Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Forsten<br />
Berichte 70/<strong>1994</strong>
Impressum:<br />
Herausgeber: Bayerisches Staatsm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten ©<br />
<strong>1994</strong> — ISSN 0943-7622<br />
Schriftleitung: Prof. Dr.-Ing. Holger Magel, Ludwigstraße 2, 80539 München<br />
Claus Hager, Infanteriestraße 1, 80797 München<br />
Gestaltung und Satz: Bereich Zentrale Aufgaben der Bayerischen Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
Fotos: Thomas Geiger — Fotografie und Bildjournalismus, 91217 Hersbruck<br />
Druck: Druckhaus Kastner GmbH, 85280 Wolnzach<br />
Diese Broschüre ist auf 100 % Altpapier gedruckt.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 71/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
1
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 71/<strong>1994</strong><br />
Dem Begründer dieser<br />
Schriftenreihe und<br />
langjährigen Leiter der<br />
Bayerischen Verwaltung für<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
Herrn M<strong>in</strong>isterialdirigenten<br />
Günther Strößner<br />
zum dienstlichen Abschied<br />
gewidmet.<br />
Die Schriftleitung<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
1
Inhaltsverzeichnis<br />
Der Schirmherr der <strong>Fachtagung</strong><br />
Dr. Edmund Stoiber<br />
Bayerischer M<strong>in</strong>isterpräsident<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong> <strong>Stadt</strong> und Land 11<br />
Eröffnungsveranstaltung<br />
Günther Strößner<br />
M<strong>in</strong>isterialdirigent im Bayerischen Staatsm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
Begrüßung und E<strong>in</strong>führung 13<br />
Ralf Felber<br />
Oberbürgermeister der <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong><br />
Grußwort 19<br />
Dr. Walter Eykmann<br />
Mitglied des Bayerischen Landtags und Vorsitzender des Ausschusses für Fragen des öffentlichen Dienstes<br />
Grußwort 21<br />
Re<strong>in</strong>hold Bocklet<br />
Bayerischer Staatsm<strong>in</strong>ister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> für Bayern und Europa 23<br />
Podiums- und Plenumsdiskussion 33<br />
Leitung: Dr. Gertrud Helm<br />
Bayerischer Rundfunk<br />
Empfang der Bayerischen Staatsregierung<br />
Marianne Deml<br />
Staatssekretär<strong>in</strong> im Bayerischen Staatsm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
Grußwort 35<br />
Teobald Belec<br />
Slowenisches M<strong>in</strong>isterium für Landwirtschaft und Forsten, Ljubljana<br />
Dank der Gäste 37<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
5
Schlußveranstaltung<br />
Berichte über die Arbeitskreise<br />
Johann Huber<br />
Bauoberrat an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Krumbach (Schwaben)<br />
Bericht über den Arbeitskreis 1:<br />
Möglichkeiten und Grenzen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 39<br />
Robert Bromma<br />
Bauoberrat an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Würzburg<br />
Bericht über den Arbeitskreis 2:<br />
Sicherung und Ausbau regionaler Infrastruktur 41<br />
Erich Sperle<strong>in</strong><br />
Bauoberrat an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Bamberg<br />
Bericht über den Arbeitskreis 3:<br />
Land- und Forstwirtschaft 45<br />
Dr.-Ing. Peter Jahnke<br />
Bauoberrat am Bereich Zentrale Aufgaben der Bayerischen Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
Bericht über den Arbeitskreis 4:<br />
Dorfentwicklung 49<br />
Dr. agr. Mart<strong>in</strong> Hundsdorfer<br />
Baurat an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Regensburg<br />
Bericht über den Arbeitskreis 5:<br />
Landschaftsgestaltung 51<br />
Karl Braumiller<br />
Bauoberrat am Bereich Zentrale Aufgaben der Bayerischen Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
Bericht über den Arbeitskreis 6:<br />
Informationstechnik 53<br />
Helene Stegmann<br />
Bauoberrät<strong>in</strong> an der Staatlichen Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Landshut<br />
Bericht über den Arbeitskreis 7:<br />
Aus- und Fortbildung 55<br />
Günter Bschor<br />
Bauoberrat an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Krumbach (Schwaben)<br />
Bericht über den Arbeitskreis 8:<br />
Unternehmenskultur 59<br />
6 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Schlußvorträge<br />
Marianne Deml<br />
Staatssekretär<strong>in</strong> im Bayerischen Staatsm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
Hilfe zur Selbsthilfe — <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> mit den Menschen für die Menschen 61<br />
Günther Strößner<br />
M<strong>in</strong>isterialdirigent im Bayerischen Staatsm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten<br />
Schlußwort 67<br />
Charles Konnen<br />
Präsident des Nationalen Flurbere<strong>in</strong>igungsamtes <strong>in</strong> Luxemburg<br />
Dank der Gäste 71<br />
E<strong>in</strong>führungsreferate <strong>in</strong> den Arbeitskreisen<br />
siehe gesondertes Inhaltsverzeichnis nächste Seite<br />
Bisher erschienene Berichte 207<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
7
E<strong>in</strong>führungsreferate <strong>in</strong> den Arbeitskreisen<br />
Arbeitskreis 1: Möglichkeiten und Grenzen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
Dipl.-Ing. Johann Huber<br />
Bauoberrat an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Krumbach (Schwaben)<br />
E<strong>in</strong>führung 73<br />
Dr. agr. Balthasar Huber<br />
Europäische Kommission GD VI, Brüssel<br />
Die Zukunft ländlicher Räume – <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> aus der Sicht der Europäischen Kommission 75<br />
Dr.-Ing. Karl-Friedrich Thöne<br />
Regierungsdirektor im Bundesm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Bonn<br />
Möglichkeiten und Grenzen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 85<br />
Arbeitskreis 2: Sicherung und Ausbau regionaler Infrastruktur<br />
Dipl.-Ing. Robert Bromma<br />
Bauoberrat an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Würzburg<br />
E<strong>in</strong>führung 99<br />
Emil Schneider<br />
F<strong>in</strong>anzreferent, Bayerischer Geme<strong>in</strong>detag, München<br />
Die Geme<strong>in</strong>den auf dem Weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzkrise? 101<br />
Dipl.-Ing. Bernhard Böckeler<br />
1. Bürgermeister des Marktes Allersberg<br />
Strukturelle Probleme und Lösungswege am Rande e<strong>in</strong>es Ballungsraumes 107<br />
Dr. Walter Lohmeier<br />
Geschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Würzburg–Schwe<strong>in</strong>furt<br />
<strong>Ländliche</strong> Räume – <strong>in</strong>novative Wirtschaftsstandorte mit Zukunft? 109<br />
Dr. Karl-He<strong>in</strong>z Röhl<strong>in</strong><br />
Landjugendpfarrer und Leiter der Evangelischen Landvolkshochschule Pappenheim<br />
Lust auf’s Land – Erwartungen und Forderungen junger Menschen 115<br />
Gottfried Wieselhuber<br />
Gutsverwalter des Klosters Maria Bildhausen, Münnerstadt<br />
Regionale Interessengeme<strong>in</strong>schaft Maria Bildhausen (RIM) – E<strong>in</strong>e Initiative von unten! 119<br />
8 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Arbeitskreis 3: Land- und Forstwirtschaft<br />
Dipl.-Ing. agr. Erich Sperle<strong>in</strong><br />
Bauoberrat an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Bamberg<br />
E<strong>in</strong>führung 123<br />
Prof. Dr. agr. Otmar Seibert<br />
Fachhochschule Weihenstephan, Abteilung Triesdorf, Fachgebiet Agrarökonomie<br />
Strategien für e<strong>in</strong>e zukunftsorientierte Landwirtschaft 129<br />
Dipl.-Ing. agr. Walter Danner<br />
Unternehmens- und Market<strong>in</strong>gberater, Ruhstorf<br />
Umsetzung von Market<strong>in</strong>gkonzepten für die Land- und Forstwirtschaft <strong>in</strong> Verfahren<br />
der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 135<br />
Arbeitskreis 4: Dorfentwicklung<br />
Dr.-Ing. Peter Jahnke<br />
Bauoberrat am Bereich Zentrale Aufgaben der Bayerischen Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>, München<br />
Neue Wege <strong>in</strong> der Dorfentwicklung — von der Expertenplanung zur Moderation 141<br />
Professor Dipl.-Ing. Fritz Auweck<br />
Landschaftsarchitekt, Flurwerkstatt Auweck/Koetter, München<br />
Dorfentwicklung im Verbund 143<br />
Dipl.-Ing. Günter Naumann<br />
Architekt, Regensburg<br />
Der Architekt / Planer als Moderator 145<br />
Dipl.-Ing. Leonhard Rill<br />
Bauoberrat an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> München<br />
Neue Anforderungen an die Flurentwicklung 147<br />
Gruppenergebnisse 149<br />
Arbeitskreis 5: Landschaftsgestaltung<br />
Dipl.-Ing. (FH) Anne Wendl<br />
landimpuls GmbH, Mangold<strong>in</strong>g<br />
Dipl.-Ing. Michael Sch<strong>in</strong>dler<br />
Bauoberrat an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Regensburg<br />
Neue Aufgabenschwerpunkte <strong>in</strong> der Landschaftsentwicklung 157<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
9
Dipl.-Ing. Thomas Gollwitzer<br />
Bauoberrat an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Regensburg<br />
Dipl.-Ing. Karl Sp<strong>in</strong>dler<br />
Landschaftsarchitekt, Kastl<br />
Von der Bürgerbeteiligung zur Bürgerplanung<br />
Flurwerkstatt Fuhrn – e<strong>in</strong> Modell 163<br />
Arbeitskreis 6: Informationstechnik<br />
Dipl.-Ing. Karl Braumiller<br />
Bauoberrat am Bereich Zentrale Aufgaben der Bayerischen Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>, München<br />
E<strong>in</strong>führung 169<br />
Dipl.-Math. Holger Schellhaas<br />
CAPdebis, Bereich Telekommunikation, München<br />
Aktuelle <strong>Entwicklung</strong>en der Informations- und Kommunikationstechnik 173<br />
Prof. Dr. Jörg Maier<br />
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie und Regionalplanung, Universität Bayreuth<br />
Telekommunikation im ländlichen Raum —<br />
Möglichkeiten und Grenzen der Errichtung von Telestuben 177<br />
Arbeitskreis 7: Aus- und Fortbildung<br />
Dipl.-Ing. Helene Stegmann<br />
Bauoberrät<strong>in</strong> an der Staatlichen Führungsakademie für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Landshut<br />
E<strong>in</strong>führung 183<br />
Dipl.-Soz. Rudolf Bögel<br />
Lehrstuhl für Organisations- und Wirtschaftspsychologie, Ludwig-Maximilians-Universität München<br />
Systematische Personalentwicklung 185<br />
Arbeitskreis 8: Unternehmenskultur<br />
Dipl.-Ing. Günter Bschor<br />
Bauoberrat an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Krumbach (Schwaben)<br />
E<strong>in</strong>führung 189<br />
Dr. Norbert Hagemann<br />
Sietec Consult<strong>in</strong>g GmbH & Co. OHG, München<br />
Unternehmensstrategie und Unternehmenskultur –<br />
der Schlüssel zum Unternehmenserfolg 191<br />
10 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Edmund Stoiber<br />
Schirmherr der <strong>Fachtagung</strong><br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong> <strong>Stadt</strong> und Land *<br />
Im Jahr 1989 hat sich <strong>in</strong> Freis<strong>in</strong>g nach jahrelangen<br />
Vorbereitungen auf Anregung Bayerns und<br />
Österreichs e<strong>in</strong>e Europäische Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Landentwicklung und Dorferneuerung konstituiert,<br />
deren Ziel die möglichst umfassende Verbesserung<br />
der ländlichen Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Erholungsbed<strong>in</strong>gungen<br />
ist. Maßnahmen wie Sanierung<br />
und <strong>Entwicklung</strong> der Dörfer, ökonomische und<br />
ökologische Flurgestaltung, ländlicher Wegbau etc.<br />
sollen helfen, den Standort ländlicher Raum als<br />
gleichberechtigten und unverzichtbaren Partner der<br />
städtischen Ballungszentren zu stärken. Diese Aufgabe<br />
stellt sich <strong>in</strong> Bayern und Österreich ebenso wie<br />
<strong>in</strong> den neuen deutschen Ländern oder gar <strong>in</strong> den<br />
Reformländern Osteuropas.<br />
Inzwischen fördert die Europäische Union auf<br />
Grundlage ihrer reformierten Strukturpolitik im<br />
großen Stil und mit erheblichem f<strong>in</strong>anziellen Mittele<strong>in</strong>satz<br />
die ländlichen Regionen Europas. Bayern<br />
hat <strong>in</strong> der soeben aufgelegten zweiten Tranche<br />
der Struktur-fonds <strong>1994</strong> bis 1999 e<strong>in</strong>e erhebliche<br />
Flächen- und Mittelaufstockung für die sogenannten<br />
5b-Programme erreicht. Aus den drei Fonds für<br />
Landwirtschaft (EAGFL), Wirtschaft (EFRE) und<br />
Soziales (ESF) sollen vielfältige Maßnahmen <strong>in</strong> ländlichen<br />
Gebieten <strong>in</strong>itiiert und gefördert werden. Aber<br />
auch außerhalb der bayerischen 5b-Gebiete (knapp<br />
die halbe Landesfläche) wollen und müssen wir ohne<br />
EU-Hilfe gute Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für gute Lebensbed<strong>in</strong>gungen<br />
schaffen. Die Stärkung der ländlichen<br />
Räume ist und bleibt e<strong>in</strong> Schwerpunkt bayerischer<br />
Landes- und Agrarpolitik. Eigenart und Schönheit<br />
Bayerns s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> hohem Maße von se<strong>in</strong>en Dörfern<br />
und Fluren geprägt.<br />
Die Aufgaben der Flurbere<strong>in</strong>igung haben sich<br />
entscheidend geändert<br />
Um die Schönheit und Lebensfähigkeit unserer<br />
Dörfer und Fluren zu erhalten, bedienen wir uns seit<br />
langem <strong>in</strong>sbesondere der Erfahrungen und Kompetenz<br />
e<strong>in</strong>er Verwaltung, die über e<strong>in</strong> Jahrhundert lang<br />
den Namen Flurbere<strong>in</strong>igungsverwaltung trug.<br />
Entsprechend den politischen Vorgaben und ökonomischen<br />
Aufgabenstellungen der Vor- und Nach-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
kriegszeiten hatte sie lange Zeit vor allem die Aufgabe,<br />
unsere Bauern bei der rationelleren Erzeugung<br />
möglichst vieler Nahrungsmittel zu unterstützen.<br />
Die Aufgaben der Flurbere<strong>in</strong>igung haben sich<br />
<strong>in</strong>zwischen entscheidend gewandelt und erweitert:<br />
Im Vordergrund stehen die Sorge um die Aufrechterhaltung<br />
umweltverträglicher und eigentumssichernder<br />
Landbewirtschaftung und vitaler Dörfer<br />
sowie das Bemühen um die Steuerung und den<br />
gerechten Ausgleich von mite<strong>in</strong>ander konkurrierenden<br />
Ansprüchen der öffentlichen und privaten Hand<br />
an die Nutzung von Grund und Boden.<br />
Die Flurbere<strong>in</strong>igungsverwaltung hat sich mehr<br />
und mehr von e<strong>in</strong>er Hoheitsverwaltung zu e<strong>in</strong>er<br />
Dienstleistungsbehörde für die Bauern, Bürger und<br />
Geme<strong>in</strong>den des ländlichen Raumes entwickelt. Ihr<br />
E<strong>in</strong>satz reicht von den<br />
— planerischen, strukturellen und bodenordnerischen<br />
Hilfen für die Land- und Forstwirtschaft<br />
und vom Landzwischenerwerb über die<br />
— Erstellung und den Vollzug von Landschaftspflegekonzepten<br />
und die Anlage von Biotopverbundsystemen<br />
zur<br />
— Dorferneuerung sowie Infrastrukturhilfen und<br />
Baulandumlegungen für die Geme<strong>in</strong>den bis h<strong>in</strong><br />
zur<br />
— unverzichtbaren Mithilfe bei der eigentümerfreundlichen<br />
Umsetzung von Großbauvorhaben<br />
wie Autobahnen, neuen Bahn-Trassen, Schifffahrtsstraßen,<br />
Ortsumgehungen etc. durch sog.<br />
Unternehmensverfahren.<br />
Gerade die deutsche Wiedervere<strong>in</strong>igung und die<br />
Öffnung der Grenzen zum Osten haben e<strong>in</strong>en besonderen<br />
Auftragsschub an Unternehmensverfahren für<br />
staatliche Großprojekte gebracht. Ich weiß, daß diese<br />
Arbeit wegen der unvermeidbaren E<strong>in</strong>griffe <strong>in</strong><br />
privates Eigentum den Mitarbeitern der Direktionen<br />
für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> besonders viel F<strong>in</strong>gerspitzengefühl<br />
abverlangt.<br />
* Veröffentlicht <strong>in</strong> der Bayerischen Staatszeitung Nr. 19 vom 13. Mai <strong>1994</strong><br />
Geleit<br />
11
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> setzt auf Selbsthilfe und<br />
Geme<strong>in</strong>s<strong>in</strong>n<br />
Der bayerische Weg <strong>in</strong> Verfahren der <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> setzt durch konsequente Beachtung des<br />
Genossenschaftspr<strong>in</strong>zips auf ehrenamtlich tätige,<br />
dem Geme<strong>in</strong>s<strong>in</strong>n verpflichtete Bürger. Dies s<strong>in</strong>d jene,<br />
die seit vielen Jahren bereit s<strong>in</strong>d, <strong>in</strong> den Vorständen<br />
der Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaften mitzuarbeiten; es<br />
s<strong>in</strong>d aber zunehmend auch Bürger, die sich mit ihren<br />
Ideen, Kenntnissen und Fertigkeiten <strong>in</strong> dörfliche<br />
Arbeitskreise e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen. Diese Arbeitskreise werden<br />
zur Stärkung der lokalen Kompetenz <strong>in</strong> jeder Dorferneuerung<br />
und zunehmend auch bei der Flurentwicklung<br />
e<strong>in</strong>gerichtet. Die Erfahrungen s<strong>in</strong>d<br />
äußerst positiv: sie zeigen <strong>in</strong> ermutigender Weise,<br />
daß unsere Bürger nach wie vor bereit s<strong>in</strong>d, sich für<br />
ihre Heimat e<strong>in</strong>zusetzen, wenn sie dar<strong>in</strong> S<strong>in</strong>n und<br />
Möglichkeiten der Selbstentfaltung sehen.<br />
Der neue Name entspricht den tatsächlichen<br />
Aufgaben besser<br />
Bei allen Gesprächen, Planungen und Maßnahmen<br />
geht es um <strong>in</strong>tegrale und ke<strong>in</strong>eswegs sektorale<br />
Vorgehensweisen und Lösungspakete. Diesen Weg<br />
der ganzheitlichen Sicht hat bereits das novellierte<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz von 1976 zugrundegelegt. Es<br />
war deshalb nur konsequent, daß der Bayerische<br />
M<strong>in</strong>isterrat im Herbst 1992 der Bayerischen Flurbere<strong>in</strong>igungsverwaltung<br />
e<strong>in</strong>en neuen Namen<br />
gegeben hat, der ihren tatsächlichen Aufgaben<br />
besser entspricht und Mißverständnisse ausschließt.<br />
Mit dem neuen Namen »Verwaltung für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong>« wurde die Mithilfe bei der Stärkung der<br />
ländlichen Lebens-, Wohn-, Arbeits- und Erholungsbed<strong>in</strong>gungen<br />
anerkannt.<br />
Hoher Beschäftigungseffekt durch Dorf- und<br />
Flurentwicklung<br />
Die Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> ist<br />
hauptsächlich mit dem Vollzug des Programms<br />
»<strong>Ländliche</strong> Neuordnung« auf der Grundlage der<br />
Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe »Verbesserung der Agrarstruktur<br />
und des Küstenschutzes« und des Bayerischen<br />
Dorferneuerungsprogramms beauftragt.<br />
Zusätzlich ist sie nun auch <strong>in</strong> die Umsetzung der 5b-<br />
EU-Programme auf dem Gebiet der Dorferneuerung<br />
und Flurentwicklung e<strong>in</strong>gebunden. Immerh<strong>in</strong> hat die<br />
Verwaltung 1993 über 250 Mio. DM Fördermittel<br />
umgesetzt und damit viele weitere öffentliche und<br />
private Investitionen und Impulse ausgelöst. Das<br />
Münchener ifo-Institut hat den Maßnahmen der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>en besonders hohen<br />
Beschäftigungs- und Multiplikatoreffekt (6- bis<br />
7fach) besche<strong>in</strong>igt.<br />
Mit Aufmerksamkeit verfolge ich auch die <strong>in</strong> jüngster<br />
Zeit von der Verwaltung <strong>in</strong>itiierten Ansätze<br />
geme<strong>in</strong>deüberschreitender Zusammenarbeit mit dem<br />
Ziel e<strong>in</strong>er ländlichen Regionalentwicklung. Angesichts<br />
e<strong>in</strong>er zurückgehenden F<strong>in</strong>anzausstattung können<br />
und müssen die Kommunen auf manche E<strong>in</strong>richtungen<br />
verzichten, die künftig der Nachbar im<br />
Rahmen dieser neuen Partnerschaft für sie bereithält.<br />
Nur e<strong>in</strong> selbstbewußter ländlicher Raum kann<br />
ernstgenommener Partner der Ballungsräume se<strong>in</strong>,<br />
nur eigen-bewußte Vertreter der ländlichen Räume<br />
können den Dialog mit den Städten führen. <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong> nicht nur den Bewohnern<br />
und Geme<strong>in</strong>den im ländlichen Raum selbst, sondern<br />
erfüllt durch Schaffung e<strong>in</strong>er leistungsfähigen ländlichen<br />
Infrastruktur und Bewahrung schöner Dorfund<br />
Landschaftsbilder auch die Bedürfnisse und<br />
Lebens<strong>in</strong>teressen der Städte. Aus dieser Erkenntnis<br />
heraus habe ich gerne die Schirmherrschaft zur diesjährigen<br />
<strong>Fachtagung</strong> <strong>1994</strong> übernommen, bei der sich<br />
traditionell nahezu alle europäischen Experten der<br />
ländlichen Räume e<strong>in</strong> Stelldiche<strong>in</strong> geben. Das Motto<br />
dieses Kongresses »<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong><br />
<strong>Stadt</strong> und Land« soll nicht nur me<strong>in</strong>en bayerischen<br />
Mitarbeitern, sondern auch den Gästen aus unseren<br />
Nachbarländern dar<strong>in</strong> Bestärkung geben, daß die<br />
Aufgabe der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> von großer<br />
Bedeutung für die Gesellschaft von heute und<br />
morgen ist.<br />
12 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Eröffnungsveranstaltung<br />
Günther Strößner<br />
Begrüßung und E<strong>in</strong>führung<br />
Sehr geehrter Herr Staatsm<strong>in</strong>ister,<br />
me<strong>in</strong>e sehr geehrten Damen und Herren<br />
Abgeordneten und Senatoren, sehr geehrte Gäste,<br />
liebe Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter!<br />
Zu unserer diesjährigen <strong>Fachtagung</strong> unter dem<br />
Motto »<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong> <strong>Stadt</strong> und Land«<br />
heiße ich Sie <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong> sehr herzlich willkommen.<br />
Es freut mich, daß auch heuer wieder so viele Gäste<br />
aus ganz Deutschland und aus dem Ausland zu uns<br />
nach Bayern gekommen s<strong>in</strong>d. Wir werten Ihren<br />
Besuch als Interesse an unserer Arbeit, sicher aber<br />
auch als Interesse an dem schönen und gastfreundlichen<br />
Frankenland. Ich sage Ihnen allen e<strong>in</strong> herzliches<br />
Grüß Gott.<br />
Zwei Jahre s<strong>in</strong>d seit unserer letzten Tagung <strong>in</strong><br />
Bamberg vergangen, e<strong>in</strong>e kurze Zeitspanne und doch<br />
e<strong>in</strong>e Zeit, <strong>in</strong> der sich für unsere Verwaltung sehr viel<br />
ereignet hat. Sie gestatten, daß ich mich e<strong>in</strong>leitend<br />
auf unsere Verwaltung beschränke; die große L<strong>in</strong>ie<br />
wird sicher Herr Staatsm<strong>in</strong>ister Bocklet aufzeigen.<br />
Drei negative Nachrichten rufe ich zunächst <strong>in</strong><br />
Er<strong>in</strong>nerung.<br />
1. Wirbel hat die Bekanntgabe des Gutachtens der<br />
Kommission »Zukunft des öffentlichen Dienstes«,<br />
der sog. Badura-Kommission, verursacht. Danach<br />
sollten unsere sieben Direktionen aufgelöst und<br />
ihre Aufgaben auf derzeit 68 Landwirtschaftsämter<br />
und auf die sieben Regierungen, also auf<br />
über 70 Behörden, verteilt werden. Uns ist nicht<br />
klar geworden, wor<strong>in</strong> der Vorteil der Zersplitterung<br />
von sieben hochtechnisierten, mit kosten<strong>in</strong>tensiven<br />
Geräten ausgestatteten Behörden, deren<br />
schwerpunktmäßiger E<strong>in</strong>satz heute flexibel gehandhabt<br />
werden kann, auf e<strong>in</strong>e solch große Zahl<br />
von Stellen liegen soll. Die unwirtschaftlichen und<br />
sozialen Auswirkungen dieses Vorschlags haben<br />
schließlich zu e<strong>in</strong>er Welle von Protesten, u. a.<br />
auch zu e<strong>in</strong>er Resolution des Bayerischen Geme<strong>in</strong>detages<br />
geführt, wonach die Direktionen<br />
bestehen bleiben sollen. Ich gehe davon aus, daß<br />
es auch nach der Wahl dabei bleibt.<br />
2. Weiteren Wirbel hat die Untersuchung e<strong>in</strong>er<br />
Unternehmensberatungs-Firma erzeugt. Hier<br />
waren es die Bestandsaufnahme und die Vorstellung<br />
des Grobkonzepts, die zu heftiger Dis-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
kussion mit der Firma Anlaß gaben. Die Wirbel<br />
haben sich noch nicht beruhigt. Aber wir hoffen,<br />
daß <strong>in</strong> guter Zusammenarbeit zwischen Verwaltung<br />
und Firma sachdienliche Vorschläge erarbeitet<br />
werden. Das hoffen wir im Interesse der Verwaltung,<br />
die e<strong>in</strong>er weiteren Effizienzsteigerung<br />
äußerst aufgeschlossen gegenübersteht. Wir me<strong>in</strong>en,<br />
realisierbare Ergebnisse müßten auch im<br />
Interesse der Firma liegen.<br />
3. Die dritte schlechte Nachricht s<strong>in</strong>d die Personale<strong>in</strong>sparungen<br />
nach dem Haushaltsgesetz und die<br />
Personalaushilfe bei den Landwirtschaftsämtern<br />
für den Vollzug der EU-Agrarreform. Dies führt<br />
zu e<strong>in</strong>er Reduzierung der Personalkapazität bei<br />
den Direktionen und verh<strong>in</strong>dert, daß der große<br />
Arbeitsüberhang rasch abgebaut wird. Wir müssen<br />
deshalb restriktive Regelungen zur E<strong>in</strong>leitung<br />
neuer Verfahren erlassen und bitten die betroffenen<br />
Geme<strong>in</strong>den und Bürger um Verständnis für<br />
die Verzögerungen. Das hat auch zur Folge, daß<br />
wir unsere Personalaushilfe bei der sächsischen<br />
Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> Neuordnung überdenken<br />
müssen. Die Kollegen aus Sachsen mögen<br />
verzeihen, daß ich das hier erwähne.<br />
Eröffnungsveranstaltung<br />
13
Nun aber drei andere Nachrichten <strong>in</strong> chronologischer<br />
Folge:<br />
1. Seit 1. November 1992 heißen wir nicht mehr<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsverwaltung, sondern »Bayerische<br />
Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>«, die<br />
Direktionen »Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>«.<br />
Damit ist mit Zustimmung des Bayerischen<br />
M<strong>in</strong>isterrats e<strong>in</strong>e Bezeichnung e<strong>in</strong>geführt worden,<br />
die dem heutigen Aufgabenfeld dieser Verwaltung<br />
gerecht wird. Wir verstehen diese Namensänderung<br />
als Aufforderung und Motivation, für<br />
den ländlichen Raum und die dort lebenden<br />
Menschen vollen E<strong>in</strong>satz zu leisten.<br />
2. Seit 17. Juni 1993 haben wir e<strong>in</strong>en neuen M<strong>in</strong>ister:<br />
Re<strong>in</strong>hold Bocklet. E<strong>in</strong>en M<strong>in</strong>ister, der Politiker<br />
und Experte ist. Wenn ich Experte sage, me<strong>in</strong>e<br />
ich europäische Gesellschafts- und Agrarpolitik<br />
bis h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> <strong>in</strong> bayerische Detailfragen. Ich begrüße<br />
Sie, Herr Staatsm<strong>in</strong>ister, sehr herzlich und darf<br />
Ihnen sagen, daß unsere Gäste, aber vor allem<br />
natürlich die Mitarbeiter unserer Verwaltung<br />
gespannt s<strong>in</strong>d auf Ihre anschließenden Ausführungen<br />
zu aktuellen Fragen <strong>in</strong> Bayern und<br />
Europa.<br />
3. Die dritte Nachricht: Erstmals <strong>in</strong> der langen Reihe<br />
der <strong>Fachtagung</strong>en hat e<strong>in</strong> Bayerischer M<strong>in</strong>isterpräsident,<br />
Dr. Edmund Stoiber, die Schirmherrschaft<br />
über die <strong>Ansbach</strong>er <strong>Fachtagung</strong> übernommen.<br />
Wir s<strong>in</strong>d sehr dankbar für diese Schirmherrschaft.<br />
Sehen wir dar<strong>in</strong> doch e<strong>in</strong>e gewisse Anerkennung<br />
für die geleistete Arbeit, aber auch e<strong>in</strong>e<br />
Herausforderung für die Zukunft, die Probleme<br />
des ländlichen Raumes nachhaltig zu lösen. Auf<br />
den Artikel des Bayerischen M<strong>in</strong>isterpräsidenten<br />
<strong>in</strong> der Bayerischen Staatszeitung vom letzten<br />
Freitag darf ich h<strong>in</strong>weisen.<br />
Zum Motto der Tagung gestatten Sie mir bitte<br />
e<strong>in</strong>ige Vorbemerkungen.<br />
Agrarpolitik im weiteren S<strong>in</strong>ne ist Gesellschaftspolitik.<br />
Die Agrarpolitik wäre schlecht beraten, wenn<br />
sie sich auf die Betriebsberatung alle<strong>in</strong> und die<br />
term<strong>in</strong>gerechte Auszahlung der EU-Prämien<br />
beschränken würde, und dies bei e<strong>in</strong>er ständig<br />
abnehmenden Zahl landwirtschaftlicher Betriebe.<br />
In Bayern z. B. gibt es gerade noch etwas über<br />
200 000 Betriebe, und zwar mehr Nebenerwerbs-<br />
als Vollerwerbsbetriebe. Agrarpolitik muß diesem<br />
Strukturwandel Rechnung tragen, die landschaftlichen,<br />
siedlungsstrukturellen, aber vor allem die<br />
soziostrukturellen Folgen <strong>in</strong>s Kalkül ziehen.<br />
Agrarpolitik muß nach Problemlösungen suchen, die<br />
für die Menschen, für Dorf und Flur e<strong>in</strong>e Perspektive<br />
bieten. Und damit s<strong>in</strong>d wir unmittelbar bei der ländlichen<br />
<strong>Entwicklung</strong> als e<strong>in</strong>er gesellschaftspolitischen<br />
Aufgabe, die <strong>Stadt</strong> und Land <strong>dient</strong>.<br />
Über die Verflechtungen zwischen <strong>Stadt</strong> und Land<br />
gibt es vielfältige Literatur und gescheite Vorträge,<br />
so daß ich mir Ausführungen hierüber ersparen<br />
kann, zumal während dieser Tagung sicher noch viel<br />
dazu beigetragen wird. Deutlich möchte ich darauf<br />
h<strong>in</strong>weisen, daß die Verwaltung bei der Behandlung<br />
dieser Verflechtungen nicht im rechtsfreien Raum<br />
operieren kann. Sie hat die Gesetze und Verordnungen<br />
zu vollziehen, <strong>in</strong> denen sich politischer Wille<br />
zu diesem Themenkreis dokumentiert. Die Verwaltung<br />
hat dabei die Rechtsvorschriften zu transformieren,<br />
für den Bürger verständlich zu machen und<br />
beim Vollzug die gegebenen Ermessensspielräume zu<br />
nutzen. Und sie muß darüber h<strong>in</strong>aus alles tun, um<br />
das Mite<strong>in</strong>ander von <strong>Stadt</strong> und Land zu fördern und<br />
etwa vorhandene Gegensätze abzubauen.<br />
Als Beispiel nenne ich die Verordnung über das<br />
Landesentwicklungsprogramm Bayern vom<br />
25. Januar <strong>1994</strong> (GVBl S. 25), die am 1. März <strong>1994</strong><br />
<strong>in</strong> Kraft getreten ist. Die besondere politische Bedeutung<br />
dieser Verordnung der Bayerischen Staatsregierung<br />
liegt dar<strong>in</strong>, daß sie mit Zustimmung des<br />
Bayerischen Landtags ergangen ist. Gestatten Sie<br />
mir, daß ich aus den für die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
bedeutsamen Abschnitten auszugsweise — sehr<br />
trocken — zitiere (LEP B III 3):<br />
»Die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> Dorf und Flur soll<br />
zur Zukunftssicherung des ländlichen Raumes und<br />
der ländlich strukturierten Teile der Verdichtungsräume<br />
beitragen. Sie soll der Land- und Forstwirtschaft<br />
die Anpassung an die sich ändernden<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen erleichtern und die ökologischen,<br />
sozialen, siedlungsstrukturellen sowie wirtschaftlichen<br />
Belange des ländlichen Raumes und der<br />
ländlich strukturierten Teile der Verdichtungsräume<br />
unterstützen.«<br />
Es ist dann die Rede von jenen Gebieten, <strong>in</strong> denen<br />
Maßnahmen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> mit hoher<br />
Priorität angestrebt werden sollen, sowie vom Landauffang<br />
und dessen Verwendung z. B. für Naturschutz,<br />
Landschaftspflege und öffentliche Planungen.<br />
Weiter heißt es:<br />
»Die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> soll die Geme<strong>in</strong>den bei<br />
der Umsetzung der Bauleitplanung und der Bereitstellung<br />
von preiswertem Bauland unterstützen.<br />
Maßnahmen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> sollen<br />
zur Verbesserung der Struktur <strong>in</strong> den ländlichen<br />
Gebieten beitragen. Insbesondere sollen<br />
14 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
— die Dörfer <strong>in</strong> ihrem gewachsenen, eigenständigen<br />
Charakter erhalten sowie die Herstellung und<br />
Erneuerung bedarfsgerechter dorfgemäßer E<strong>in</strong>richtungen<br />
unterstützt<br />
— e<strong>in</strong> Beitrag zur Stärkung der Wirtschaftskraft<br />
geleistet<br />
— die Identifikation der Bürger mit ihrem heimatlichen<br />
Lebensraum gestärkt werden.«<br />
Wird diese Verordnung mit Leben erfüllt — und<br />
das muß für die zitierten Passagen <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />
durch unsere Mitarbeiter sowie durch ihre Partner<br />
Geme<strong>in</strong>de und Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaft vor Ort<br />
geschehen — dann ist damit für unsere Direktionen<br />
e<strong>in</strong> Aufgabenfeld beschrieben, das <strong>in</strong> der Tat <strong>Stadt</strong><br />
und Land <strong>dient</strong>, ohne daß ich hier näher darauf e<strong>in</strong>gehen<br />
kann.<br />
Soweit Zweifel auftauchen, ob dieses Aufgabenfeld<br />
<strong>in</strong> Gänze mit dem Instrumentarium des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes<br />
erfüllt werden kann, müßten gegebenenfalls<br />
die gesetzlichen Grundlagen entsprechend<br />
geändert werden. Bayern hat <strong>in</strong> der ArgeFlurb<br />
beantragt, diese Frage durch e<strong>in</strong>e Projektgruppe<br />
prüfen zu lassen. Zwischenergebnisse liegen vor.<br />
E<strong>in</strong>e erste Initiative unseres Nachbarlandes Baden-<br />
Württemberg zur Gesetzesänderung wurde bereits<br />
gestartet; von Bayern aus ist Unterstützung angekündigt.<br />
Sie sehen: Es wird nicht langweilig.<br />
Me<strong>in</strong>e sehr geehrten Damen und Herren, zu unserer<br />
<strong>Fachtagung</strong> möchte ich nun e<strong>in</strong>e Reihe hoher<br />
Gäste begrüßen:<br />
Ihnen, Herr Staatsm<strong>in</strong>ister Re<strong>in</strong>hold Bocklet, darf<br />
ich nochmals e<strong>in</strong>en Gruß entbieten. Ich bedanke<br />
mich, daß Sie den ganzen Tag aktiv bei uns se<strong>in</strong> werden<br />
und damit dieser Tagung besondere Bedeutung<br />
verleihen.<br />
Bundesm<strong>in</strong>ister Dr. Theo Waigel hat uns mitteilen<br />
lassen, daß er wegen dicht gedrängter Term<strong>in</strong>lage<br />
nicht teilnehmen könne. Er wünscht der Veranstaltung<br />
e<strong>in</strong>en guten und erfolgreichen Verlauf und<br />
bittet, allen Anwesenden se<strong>in</strong>e besten Grüße zu<br />
übermitteln, was ich hiermit tue.<br />
Dankbar b<strong>in</strong> ich, daß so viele Abgeordnete des<br />
Bayerischen Landtags zu uns gekommen s<strong>in</strong>d. Sie<br />
schaffen die Grundlagen für die Hilfen, die wir im<br />
ländlichen Raum geben können. Ich bedanke mich<br />
bei Ihnen deshalb auch namens der Bürger und<br />
Teilnehmer an unseren Verfahren und begrüße die<br />
Damen und Herren Abgeordneten<br />
— an erster Stelle Staatsm<strong>in</strong>ister a. D. Hans Maurer,<br />
unseren früheren Ressortm<strong>in</strong>ister, sodann<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
— Friedrich Bauereisen,<br />
— Klaus Dieter Breitschwert,<br />
— Kurt Eckste<strong>in</strong>,<br />
— Dr. Walter Eykmann,<br />
— Lothar Hübner,<br />
— Dr. Christoph Maier,<br />
— Rudolf Kl<strong>in</strong>ger,<br />
— Fritz Loscher-Frühwald,<br />
— Sophie Rieger,<br />
— Klaus Sommerkorn,<br />
— Wilhelm Wenn<strong>in</strong>g,<br />
und ich darf hier mit besonderer Freude anfügen<br />
den früheren Landtagsvizepräsidenten<br />
— Ernst Lechner.<br />
Der Vorsitzende des Ausschusses für Fragen<br />
des öffentlichen Dienstes, Herr Abgeordneter<br />
Dr. Eykmann, hat sich freundlicherweise bereit<br />
erklärt, zu uns e<strong>in</strong> Grußwort zu sprechen. Ich darf<br />
mich dafür bereits jetzt herzlich bedanken.<br />
Ich begrüße das Mitglied des Bayerischen Senats,<br />
Herrn Senator Heribert Thallmair, Präsident des<br />
Bayerischen Geme<strong>in</strong>detages. Herr Thallmair ist letzte<br />
Woche zum Präsidenten des Deutschen Städte —<br />
und Geme<strong>in</strong>debundes gewählt worden. Ich darf<br />
Ihnen von dieser Stelle aus sehr herzlich gratulieren<br />
und b<strong>in</strong> sicher, daß die Lösung von <strong>Stadt</strong>-Land-<br />
Problemen bei Ihnen <strong>in</strong> guten Händen liegt.<br />
Am Nachmittag stoßen zu uns noch die Herren<br />
Senatoren<br />
— Josef Deimer, Präsident des Bayerischen<br />
Städtetages,<br />
— Gerd Sonnleitner, Präsident des Bayerischen<br />
Bauernverbandes,<br />
— Ludwig D<strong>in</strong>kel, Präsident des BBV Oberbayern, und<br />
— Jürgen Ströbel, Präsident des BBV Mittelfranken.<br />
Die Anwesenheit der Herren Senatoren und<br />
Präsidenten möchte ich als Beleg für die guten Beziehungen<br />
zwischen ihren Verbänden und unserer<br />
Verwaltung werten. Wir wünschen, daß diese erfolgreiche<br />
Zusammenarbeit im Interesse unserer Bauern<br />
und des gesamten ländlichen Raumes fortgesetzt<br />
wird. Mit diesen Wünschen begrüße ich gleichzeitig<br />
die Repräsentanten Ihrer Verbände auf Bezirks-,<br />
Landkreis- und Geme<strong>in</strong>deebene und danke auch<br />
Ihnen sehr herzlich.<br />
Den Herren Senatoren Deimer, Sonnleitner und<br />
Thallmair danke ich vorweg schon für ihre Mitwirkung<br />
an der Podiumsdiskussion am heutigen Nachmittag.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
15
Me<strong>in</strong> besonderer Gruß gilt dem Oberbürgermeister<br />
der gastgebenden <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong>, Herrn Ralf Felber.<br />
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Oberbürgermeister,<br />
für die enge Zusammenarbeit zwischen der <strong>Stadt</strong><br />
und unserer Direktion <strong>Ansbach</strong>, die auch bei der<br />
Vorbereitung dieser Tagung deutlich wurde. Ich bitte,<br />
diesen Dank an Ihre Mitarbeiter weiterzugeben. Ich<br />
freue mich, daß Sie, Herr Oberbürgermeister, anschließend<br />
zu uns e<strong>in</strong> Grußwort sprechen.<br />
Sehr herzlich begrüße ich den Regierungspräsidenten<br />
von Mittelfranken, Herrn He<strong>in</strong>rich von<br />
Mosch, geme<strong>in</strong>sam mit den anwesenden Leitern der<br />
Abteilungen und Sachgebiete der Regierung. In den<br />
Gruß schließe ich e<strong>in</strong> die anwesenden Leiter und<br />
Vertreter der Ihnen nachgeordneten Behörden. Ich<br />
bedanke mich aufrichtig für die bisherige gute<br />
Zusammenarbeit und bitte auch <strong>in</strong> Zukunft darum.<br />
Trotz Badura!<br />
Me<strong>in</strong>e Damen und Herren, viele Landräte s<strong>in</strong>d<br />
heute unter uns. Sie bestätigen mit ihrer Anwesenheit<br />
die seit jeher bestehenden guten Verb<strong>in</strong>dungen<br />
zwischen den Landkreisen und unseren Direktionen,<br />
um die ich weiterh<strong>in</strong> bitte. Mit besonderer Freude<br />
begrüße ich die Herren Landräte<br />
— Dr. Anton Dietrich (Dill<strong>in</strong>gen),<br />
— Rudolf Handwerker (Haßberge),<br />
— Klaus Hartmann (Nürnberger-Land),<br />
— Dr. Traugott Scherg (Pfaffenhofen),<br />
— Dr. Hermann Schreiber (<strong>Ansbach</strong>), der erst mittags<br />
zu uns kommen kann,<br />
— Dr. Karl Friedrich Z<strong>in</strong>k (Weißenburg-Gunzenhausen)<br />
und<br />
— Herrn stellvertr. Landrat He<strong>in</strong>rich Zörntle<strong>in</strong> (Roth).<br />
E<strong>in</strong> herzliches Willkommen sage ich allen anwesenden<br />
Damen und Herren Oberbürgermeistern und<br />
Bürgermeistern sowie den Bezirks-, Kreis- und<br />
Geme<strong>in</strong>deräten. Stellvertretend nennen möchte ich<br />
den Vorsitzenden des Bayerischen Kommunalen<br />
Prüfungsverbandes, Herrn Bürgermeister Willi Hilpert<br />
aus Gunzenhausen und den stellvertretenden<br />
Vorsitzenden unseres Landesverbandes für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> Bayern, Herrn Bürgermeister Werner<br />
Herzog, <strong>Stadt</strong> Herrieden, zugleich <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Eigenschaft<br />
als stellvertretender Landrat von <strong>Ansbach</strong>. Im<br />
gesamten Freistaat arbeiten Geme<strong>in</strong>den, Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaften<br />
und Direktionen vertrauensvoll<br />
zusammen. Ich bedanke mich dafür und bitte um<br />
Fortsetzung dieser guten Zusammenarbeit, die ich<br />
von unserer Seite gerne zusage.<br />
Die Wechselbeziehungen zwischen Naturschutz<br />
und <strong>Ländliche</strong>r <strong>Entwicklung</strong> wurden oft beschrieben.<br />
Das Zusammenwirken beider Partner wird seit langer<br />
Zeit <strong>in</strong>tensiv gefördert durch enge Kontakte zwischen<br />
<strong>Ländliche</strong>r <strong>Entwicklung</strong> und dem Bund Naturschutz<br />
auf Landes-, Kreis- und Ortsebene, auch<br />
wenn es manchmal kontroverse Me<strong>in</strong>ungen gibt.<br />
Ich begrüße sehr herzlich den Vorsitzenden des<br />
Bund Naturschutz <strong>in</strong> Bayern und des BUND, Herrn<br />
Hubert We<strong>in</strong>zierl, bei unserer Tagung; ich danke<br />
Ihnen, Herr We<strong>in</strong>zierl, auch für die Teilnahme an der<br />
Podiumsdiskussion.<br />
E<strong>in</strong> herzliches Grüß Gott sage ich den Akteuren<br />
dieser Tagung, den Leitern, Referenten und sonstigen<br />
Mitwirkenden der morgigen Arbeitskreise sowie den<br />
Organisatoren der Fachexkursionen. E<strong>in</strong> besonderes<br />
Dankeschön sage ich den vielen Bürgermeistern,<br />
die bei den Exkursionen am Mittwoch Gastgeber<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Me<strong>in</strong>e Damen und Herren, unsere <strong>Fachtagung</strong> hat<br />
wieder e<strong>in</strong>e große Zahl von Fachleuten aus verschiedensten<br />
Bereichen zusammengeführt. Es würde zu<br />
weit führen, auch nur die wichtigsten Namen zu<br />
nennen. Ich bitte Sie hierfür um Verständnis. Ich<br />
begrüße sehr herzlich die Herren Abteilungsleiter<br />
und weitere Vertreter aus M<strong>in</strong>isterien bei Bund und<br />
Ländern und danke Ihnen, vor allem den bayerischen<br />
Kollegen, für die vertrauensvolle Zusammenarbeit;<br />
dabei darf ich e<strong>in</strong>schließen die anwesenden Herren<br />
Präsidenten der Landeszentral- und Mittelbehörden<br />
sowie die Leiter und Vertreter der nachgeordneten<br />
Behörden und Dienststellen aller Fachrichtungen<br />
e<strong>in</strong>schließlich der Bundeswehr, der Schulen und der<br />
Bezirke. Namentlich begrüße ich Herrn M<strong>in</strong>isterialdirigent<br />
Dr. Horst Menz<strong>in</strong>ger aus Wiesbaden, den<br />
derzeitigen Vorsitzenden der Bund-Länder-Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung, unserer ArgeFlurb.<br />
Wieder haben sich — wie auch bereits bei unseren<br />
letzten beiden <strong>Fachtagung</strong>en — viele Vertreter der<br />
neuen Bundesländer bei uns e<strong>in</strong>gefunden. Ich freue<br />
mich sehr, daß unsere Tagung Ihr Interesse f<strong>in</strong>det,<br />
und heiße Sie herzlich willkommen. Sie verstehen<br />
bitte, wenn ich besonders unsere »Bayern <strong>in</strong><br />
Sachsen«, die Leiter der Ämter für <strong>Ländliche</strong> Neuordnung<br />
<strong>in</strong> den Regierungsbezirken Chemnitz,<br />
Dresden und Leipzig begrüße. Wir haben ja bekanntlich<br />
<strong>in</strong> den letzten Jahren viele tüchtige Kollegen im<br />
Zuge der Aufbauhilfe nach Sachsen entsandt.<br />
Me<strong>in</strong>e Damen und Herren, e<strong>in</strong>e große Zahl von<br />
Vertretern der Rechtssprechung aus dem Bayerischen<br />
Verwaltungsgerichtshof und den Oberverwaltungsgerichten<br />
der Länder, der bayerischen<br />
Spruchausschüsse und der für Mittelfranken zuständigen<br />
Gerichtsbarkeit ist zu uns gekommen. Seien<br />
16 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Sie bei unserer Tagung willkommen. Wir nehmen<br />
ihre Urteile als Maßstab für unsere künftige Arbeit,<br />
wollen jedoch Ihre Arbeitsbelastung von unserer<br />
Seite aus möglichst niedrig halten.<br />
Ich freue mich über die Anwesenheit von prom<strong>in</strong>enten<br />
Vertretern aus Lehre und Forschung. Sie liefern<br />
uns wissenschaftliche Erkenntnisse, durch deren<br />
Umsetzung wir unsere Arbeit an neue <strong>Entwicklung</strong>en<br />
anpassen können. Ich begrüße viele Vertreter deutscher<br />
Universitäten, Hochschulen und Akademien<br />
sowie Professoren und Dozenten aus den<br />
Universitäten<br />
— Hels<strong>in</strong>ki,<br />
— Prag,<br />
— Preßburg,<br />
— Riga,<br />
— Straßburg,<br />
— Taichung (Taiwan),<br />
— Trient,<br />
— Warschau und<br />
— Wien.<br />
Me<strong>in</strong>e Damen und Herren, zahlreiche Verbände<br />
und Organisationen, die unsere Verwaltung bei ihrer<br />
Arbeit unterstützen oder mit denen wir auf vielerlei<br />
Weise zusammenwirken, erweisen uns die Ehre Ihrer<br />
Anwesenheit. Ich begrüße die Vertreter<br />
— der Europäischen Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft<br />
Landentwicklung und Dorferneuerung mit Sitz <strong>in</strong><br />
Wien,<br />
— der Bayerischen Architektenkammer,<br />
— der Industrie- und Handelskammern Mittelfranken<br />
und Würzburg-Schwe<strong>in</strong>furt,<br />
— der Handwerkskammer für München und<br />
Oberbayern,<br />
— des Fränkischen We<strong>in</strong>bauverbandes,<br />
— des Bayerischen Landesverbandes für Gartenbau<br />
und Landespflege,<br />
— des Landschaftspflegeverbandes Mittelfranken,<br />
— des Landesverbandes landwirtschaftlicher<br />
Fachschulabsolventen Bayern,<br />
— des Verbandes der Landwirtschaftsmeister Bayern,<br />
— der Evangelischen Landvolkshochschulen<br />
Hesselberg und Pappenheim,<br />
— der Evangelischen Landjugend <strong>in</strong> Bayern,<br />
— der Katholischen Landvolkbewegung <strong>in</strong> Bayern,<br />
— der Bayerischen Akademie <strong>Ländliche</strong>r Raum,<br />
— der drei bayerischen Schulen der Dorf- und<br />
Landentwicklung,<br />
— der Bahn-AG,<br />
— der Bayerischen Landessiedlung,<br />
— der Landeswohnungs- und Städtebaugesellschaft<br />
Bayern,<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
— des Bayerischen Sparkassen- und Giroverbandes,<br />
— der Deutschen Genossenschaftsbank Bayern,<br />
— der regionalen Banken und Sparkassen,<br />
— der BayWa und<br />
— der Bayern-Zement.<br />
Willkommen bei unserer Tagung!<br />
E<strong>in</strong> herzliches »Grüß Gott« sage ich den freischaffenden<br />
Architekten und Landschaftsarchitekten<br />
ebenso wie den Vertretern der Ingenieurbüros und<br />
Firmen. Wir haben lange vor der derzeitigen Privatisierungsdiskussion<br />
konsequent Arbeiten auf den<br />
freien Berufsstand übertragen und beste Erfahrungen<br />
gemacht. Diesen Weg wollen wir fortsetzen. Ich<br />
danke Ihnen für die gute Zusammenarbeit.<br />
Me<strong>in</strong>e Damen und Herren, die Bayerische Verwaltung<br />
für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> war immer<br />
bestrebt, <strong>in</strong>novative <strong>Entwicklung</strong>en aus anderen<br />
Ländern <strong>in</strong> ihre eigene Arbeit aufzunehmen. Unsere<br />
ausländischen Partner haben wir an unseren Erfahrungen<br />
<strong>in</strong>tensiv teilhaben lassen, wenn daran Interesse<br />
bestand. Diese Kontakte dienen im H<strong>in</strong>blick<br />
auf das Zusammenwachsen Europas auch der Vertrauensbildung<br />
und Vertiefung freundschaftlicher<br />
Beziehungen. Das wird dadurch bestätigt, daß wir<br />
heute fast 100 Gäste aus 17 Ländern begrüßen dürfen.<br />
Ich wünsche Ihnen <strong>in</strong> Bayern, hier <strong>in</strong> Mittelfranken,<br />
e<strong>in</strong>en angenehmen Aufenthalt und begrüße<br />
Gäste aus Belgien, Estland, F<strong>in</strong>nland, Italien, Kroatien,<br />
Lettland, Litauen, Luxemburg, aus den Niederlanden,<br />
Österreich, Polen, der Schweiz, Slowakei, Slowenien<br />
und der Tschechischen Republik.<br />
Die weiteste Anreise haben drei Gäste aus der<br />
Volksrepublik Ch<strong>in</strong>a und sieben Experten aus Taiwan<br />
h<strong>in</strong>ter sich. Ich darf Sie besonders herzlich begrüßen<br />
und willkommen heißen.<br />
Ich begrüße sehr herzlich die Vertreter der Medien<br />
und bitte Sie, über diese Tagung für Experten der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> aus Bayern und vielen anderen<br />
Ländern ausführlich zu berichten.<br />
Stellvertretend für alle begrüße ich namentlich<br />
Frau Dr. Gertrud Helm, die anstelle der erkrankten<br />
Frau K<strong>in</strong>dhammer heute Nachmittag die Moderation<br />
der Podiumsdiskussion übernimmt. Gleichzeitig<br />
danke ich Ihnen und allen Vertretern der Presse für<br />
die stets objektive Berichterstattung über die<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> den letzten Jahren.<br />
Für die musikalische Gestaltung dieser<br />
Eröffnungsveranstaltung bedanke ich mich beim<br />
Blechbläserensemble der Berufsfachschule für Musik<br />
D<strong>in</strong>kelsbühl unter Leitung von Herrn Kircheis.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
17
Me<strong>in</strong>e Damen und Herren, me<strong>in</strong> besonderer Gruß<br />
gilt schließlich den Präsidenten unserer Direktionen<br />
und allen Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeitern unserer<br />
Verwaltung e<strong>in</strong>schließlich der Repräsentanten der<br />
Personalvertretungen, Berufsverbände und Gewerkschaften.<br />
Ich weiß, daß unsere Mitarbeiter immer<br />
bestrebt s<strong>in</strong>d, durch gute Arbeit den Menschen auf<br />
dem Lande zu dienen. Die Diskussionen der letzten<br />
Monate über die Verwaltungsreform, über die<br />
schwierige Situation im Personalbereich und die<br />
damit verbundene Verunsicherung der Mitarbeiter<br />
haben Ihre Arbeit nicht leichter gemacht. Ich bitte<br />
Sie dennoch, auch künftig Ihre Aufgaben engagiert<br />
und mit Freude wahrzunehmen. Ich hoffe sehr, daß<br />
uns diese Tagung Motivation und Orientierung für<br />
die künftige Arbeit geben wird.<br />
Vielleicht hilft der Blick zurück: Es gab immer wieder<br />
Wandel und Verunsicherung. Und immer wieder<br />
gab es auch Perspektiven für die Zukunft. Das weiß<br />
niemand besser, als die anwesenden Pensionisten,<br />
die ich alle sehr herzlich begrüße. Namentlich nenne<br />
ich drei ehemalige Kollegen, mittelfränkische Kollegen,<br />
die jahrzehntelang für erfolgreiche Arbeit zum<br />
Wohle des ländlichen Raumes bürgten. Es s<strong>in</strong>d dies<br />
me<strong>in</strong> langjähriger Stellvertreter, Herr Ltd. M<strong>in</strong>isterialrat<br />
a. D. Kurt Zippelius, Herr Präsident a. D.<br />
Friedrich R<strong>in</strong>gler, und me<strong>in</strong> Freund, Regierungsvizepräsident<br />
a. D. Dr. Elmar Schuegraf. Herzlich<br />
willkommen!<br />
Me<strong>in</strong>e Damen und Herren, alle, die ich vergessen<br />
habe oder nicht persönlich nennen konnte, mögen<br />
mir bitte verzeihen: Ich begrüße Sie besonders<br />
herzlich!<br />
E<strong>in</strong>e Tagung ist nur so gut, wie ihre Organisation.<br />
Große Mühen auf sich genommen haben Präsident<br />
Bischoff und se<strong>in</strong>e Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter.<br />
Ich danke sehr herzlich; ich b<strong>in</strong> überzeugt, daß sich<br />
Ihr E<strong>in</strong>satz lohnen wird.<br />
Me<strong>in</strong>e sehr verehrten Damen und Herren, die<br />
<strong>Fachtagung</strong> soll deutlich machen, daß <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>Stadt</strong> und Land und damit der gesamten<br />
Gesellschaft <strong>dient</strong>. Ich bitte Sie alle, bei der<br />
Podiumsdiskussion, <strong>in</strong> den Arbeitskreisen und bei<br />
den Exkursionen Ihre Erfahrungen e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen. Der<br />
Me<strong>in</strong>ungsaustausch über Fachbereiche und<br />
Ländergrenzen h<strong>in</strong>weg soll für uns alle bereichernd<br />
se<strong>in</strong>.<br />
Ich eröffne hiermit die <strong>Fachtagung</strong> <strong>1994</strong> der<br />
Bayerischen Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
und wünsche der Tagung e<strong>in</strong>en guten Verlauf.<br />
18 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Ralf Felber<br />
Grußwort *<br />
Sehr geehrter Herr Staatsm<strong>in</strong>ister Bocklet,<br />
me<strong>in</strong>e sehr geehrten Damen und Herren<br />
aus dem Bayerischen Landtag,<br />
sehr geehrte Herren Senatoren,<br />
Herr Regierungspräsident,<br />
sehr geehrte Kolleg<strong>in</strong>nen und Kollegen,<br />
sehr geehrter Herr Präsident Bischoff,<br />
verehrte Gäste aus nah und fern,<br />
ich darf Sie recht herzlich <strong>in</strong> unserer schönen<br />
<strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> zu Ihrer <strong>Fachtagung</strong> begrüßen.<br />
Wenn e<strong>in</strong> Oberbürgermeister bei so e<strong>in</strong>er Tagung<br />
e<strong>in</strong> Grußwort spricht, dann könnte es z. B. zur<br />
Geschichte der <strong>Stadt</strong>. Ich möchte dies nicht tun,<br />
denn es gibt hier sicherlich Berufenere, die das tun<br />
können.<br />
Wenn e<strong>in</strong> Oberbürgermeister <strong>in</strong> der heutigen Zeit<br />
e<strong>in</strong> Grußwort über die Gegenwart se<strong>in</strong>er <strong>Stadt</strong><br />
spricht, dann er<strong>in</strong>nert es sehr häufig an das Sprichwort<br />
der Kaufleute. Ich glaube, da haben die<br />
Bürgermeister sehr viel gelernt <strong>in</strong> letzter Zeit:<br />
Man sagt ja »Jammern ist der Gruß des Kaufmanns«<br />
und heute kann man vielleicht manchmal sagen<br />
»Jammern ist der Gruß der Bürgermeister«. Ich<br />
möchte heute aber auch nicht jammern, obwohl<br />
es sicherlich das e<strong>in</strong>e oder das andere <strong>in</strong> unserer<br />
<strong>Stadt</strong> gäbe.<br />
Ich kann Ihnen sagen, daß wir <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong> bei all<br />
den Problemen und Aufgaben, die es gibt, zufrieden<br />
s<strong>in</strong>d. Wir s<strong>in</strong>d zufrieden mit der <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong><br />
unserer <strong>Stadt</strong>, wir s<strong>in</strong>d zufrieden mit der <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>in</strong> unserem Raum, obwohl wir selbstverständlich<br />
auch große Aufgaben zu bewältigen haben, z. B.<br />
die Verkraftung e<strong>in</strong>es Truppenabzugs der Amerikaner<br />
und die damit entstehenden Aufgaben bei der neuen<br />
Nutzung der Kasernenareale. Aber ich me<strong>in</strong>e, daß<br />
uns das <strong>in</strong> unserer <strong>Stadt</strong> ganz gut gel<strong>in</strong>gt.<br />
Wir haben auch die Realität sehen müssen bei uns<br />
<strong>in</strong> der <strong>Stadt</strong>verwaltung und haben Sparmaßnahmen<br />
e<strong>in</strong>geleitet. So konnten wir schon <strong>in</strong> den letzten<br />
Jahren — im Jahr <strong>1994</strong> wird es noch gravierender<br />
ausfallen — ganz erhebliche E<strong>in</strong>sparungen verzeichnen<br />
und außerdem den städtischen Haushalt im Jahr<br />
1993 mit e<strong>in</strong>em Überschuß von ca. 4 Mio. DM<br />
abschließen. Ich me<strong>in</strong>e, das kann man auch e<strong>in</strong>mal<br />
sagen, bei all den negativen D<strong>in</strong>gen, bei all den<br />
Problemen, die es ja gibt.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Deshalb freue ich mich auch, wie ich e<strong>in</strong>gangs<br />
gehört habe, daß die Direktionen für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> erhalten bleiben. Dennoch verkenne ich<br />
nicht, daß man auch im öffentlichen Dienst alles<br />
was man tut, h<strong>in</strong>terfragen muß. Und es ist nicht so,<br />
daß e<strong>in</strong> Gutachten von vornhere<strong>in</strong> etwas Schlechtes<br />
oder etwas Negatives ist. Ich habe das Vertrauen <strong>in</strong><br />
die Politik, daß damit vernünftige Lösungen gefunden<br />
werden können und geme<strong>in</strong>sam getragen werden.<br />
Wir werden allerd<strong>in</strong>gs nicht mehr alles so<br />
machen können, wie es <strong>in</strong> den zurückliegenden<br />
10 oder 20 Jahren geschehen ist.<br />
Die Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> ist mit<br />
über 300 Beschäftigten e<strong>in</strong> wichtiger Arbeitgeber für<br />
unsere <strong>Stadt</strong>. Es ist heute besonders wichtig, qualifizierte<br />
Arbeitsplätze zu haben. Dieses Grußwort sollte<br />
auch e<strong>in</strong>mal e<strong>in</strong> Wort des Dankes se<strong>in</strong>, e<strong>in</strong> Wort des<br />
Dankes an die Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>;<br />
denn wenn ich das Thema der Tagung sehe »<strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong> <strong>Stadt</strong> und Land«, so können<br />
wir das aus der Sicht der <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> nur unterstreichen.<br />
Die Arbeit der Direktion für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> war für unseren Raum und für unsere<br />
<strong>Stadt</strong> eigentlich Wirtschaftsförderung — Wirtschaftsförderung<br />
im umfassenden S<strong>in</strong>ne. Zum e<strong>in</strong>en<br />
natürlich vor allem für die Landwirtschaft, aber auch<br />
für den gesamten Raum, <strong>in</strong> dem wichtige Infrastrukturmaßnahmen<br />
geschaffen werden konnten.<br />
* Redigierte Tonbandaufzeichnung<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
19
Ich denke hier an Autobahn-, an Verkehrswegeverb<strong>in</strong>dungen,<br />
aber auch an Gewerbegebiete <strong>in</strong><br />
unserer <strong>Stadt</strong>, z. B. das Industriegebiet <strong>in</strong><br />
Brodsw<strong>in</strong>den. Ich denke aber auch an die Leistungen,<br />
die für den Naturschutz erreicht worden s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong><br />
Paradebeispiel dafür ist das Gebiet um den<br />
Scheerweiher <strong>in</strong> Schalkhausen. Die Aufgaben, die<br />
noch anstehen, s<strong>in</strong>d sicher sehr umfassend. Ich b<strong>in</strong><br />
deshalb überzeugt, daß unsere Direktion hier <strong>in</strong><br />
<strong>Ansbach</strong> noch bis weit über das Jahr 2 000 genügend<br />
zu tun haben wird.<br />
Ich wünsche Ihnen bei Ihrer Tagung <strong>in</strong>teressante<br />
Gespräche und gute Ergebnisse! Ich wünsche Ihnen,<br />
daß Sie sich wohl fühlen <strong>in</strong> unserer <strong>Stadt</strong>. Schließlich<br />
haben wir extra e<strong>in</strong> großartiges <strong>Stadt</strong>fest arrangiert<br />
für diese <strong>Fachtagung</strong>. Ich hoffe, Sie besuchen unser<br />
<strong>Stadt</strong>fest und gehen mit dem E<strong>in</strong>druck nach Hause,<br />
daß <strong>Ansbach</strong> e<strong>in</strong>e freundliche und fröhliche <strong>Stadt</strong><br />
ist. Alles Gute für Ihre Tagung!<br />
Eröffnungsveranstaltung im Konzertsaal der markgräflichen Orangerie<br />
20 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Walter Eykmann<br />
Grußwort *<br />
Sehr gerne überbr<strong>in</strong>ge ich Ihnen die Grüße des<br />
Bayerischen Landtages. Ich b<strong>in</strong> selten <strong>in</strong> der glücklichen<br />
Lage, dies mit e<strong>in</strong>er solchen Schubkraft tun zu<br />
können. In der ersten Reihe sitzen auf der rechten<br />
Seite nur Abgeordnete des Bayerischen Landtages.<br />
Damit wünsche ich Ihnen also auch <strong>in</strong> deren Namen<br />
zu Beg<strong>in</strong>n Ihrer <strong>Fachtagung</strong> alles Gute für die<br />
gesamte Veranstaltung.<br />
Es ist heute e<strong>in</strong> sympathischer Zufall für mich,<br />
daß die literarische Welt e<strong>in</strong>es Mannes gedenkt, der<br />
just am 16. Mai im vorigen Jahrhundert <strong>in</strong> Unterfranken<br />
geboren wurde, <strong>in</strong> Oberfranken starb und<br />
von dem ich Ihnen e<strong>in</strong> Zitat nach Mittelfranken mitgebracht<br />
habe. Friedrich Rückert hat e<strong>in</strong>mal gesagt:<br />
»E<strong>in</strong> Hund, der sich regt, jagt mehr als e<strong>in</strong> Löwe, der<br />
sich legt«. Haben Sie ke<strong>in</strong>e Angst, daß ich jetzt die<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> mit e<strong>in</strong>em Hund vergleiche;<br />
aber ich denke mir — wenn ich mir Ihre Arbeit vor<br />
Ort anschaue — »Sie regen mehr, br<strong>in</strong>gen mehr fertig<br />
und jagen mehr als mancher Löwe, der <strong>in</strong> München<br />
liegt«. Sie merken, ich pirsche mich so langsam an<br />
Ihr Tagungsthema heran, zu dem ich von Herrn<br />
M<strong>in</strong>isterialdirigent Strößner zu e<strong>in</strong>em Grußwort e<strong>in</strong>geladen<br />
wurde.<br />
Daß ich aus der Sicht des Parlamentes zur<br />
Badurakommission heute etwas sage, haben Sie<br />
sicherlich auch erwartet. Dieser Bericht ist ja<br />
bekanntermaßen am 25. 1. <strong>1994</strong> <strong>in</strong> me<strong>in</strong>em Ausschuß,<br />
im Ausschuß für Fragen des öffentlichen<br />
Dienstes, der Öffentlichkeit vorgestellt worden. Als<br />
Mann des öffentlichen Dienstes darf ich nicht die<br />
Augen davor verschließen, daß sich der öffentliche<br />
Dienst generell <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er schwierigen Situation bef<strong>in</strong>det.<br />
Ich denke, man wäre e<strong>in</strong> <strong>in</strong>tellektueller Scharlatan,<br />
wenn man dieses nicht zur Kenntnis nähme<br />
und auch zum Ausdruck brächte. Die problematische<br />
F<strong>in</strong>anzsituation der öffentlichen Haushalte — Stichwort<br />
Personalquote — zeigt an, daß hier begonnen<br />
werden muß, nachzudenken. E<strong>in</strong>e Anpassung an die<br />
veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen<br />
Erfordernisse ist notwendig. Von daher kann sich<br />
ke<strong>in</strong> <strong>in</strong>tellektueller, redlicher Mensch der Tatsache<br />
versagen, daß das Parlament — ich lege Wert darauf,<br />
daß es das Parlament war — e<strong>in</strong>e Kommission e<strong>in</strong>gerichtet<br />
hat, die sich mit der Zukunft des öffentlichen<br />
Dienstes beschäftigen sollte. Kurz genannt: Badurakommission.<br />
Und diese Kommission hat nun ver-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
schiedene Verwaltungsstrukturen analysiert und ist<br />
auch zu verschiedenen Ergebnissen gekommen. Sie<br />
hat befriedigende, und sie hat unbefriedigende<br />
Ergebnisse gebracht. Ich möchte e<strong>in</strong> befriedigendes<br />
und zufriedenstellendes Ergebnis besonders hervorheben,<br />
zu dem me<strong>in</strong> Ausschuß schon vorher gekommen<br />
ist: Es sollte e<strong>in</strong>en prüfungsfreien Verwendungsaufstieg<br />
vom mittleren <strong>in</strong> den gehobenen<br />
Dienst geben. Diesen wird es demnächst geben! Ich<br />
möchte bei dieser Gelegenheit auch mal ganz deutlich<br />
hervorheben, daß die Politik etwas Positives<br />
erwirkt hat. Me<strong>in</strong>e sehr geehrten Damen und Herren,<br />
was zu den weniger befriedigenden Teilen <strong>in</strong> diesem<br />
Badurabericht gehört, ist die Feststellung, daß die<br />
Direktionen für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> aufgelöst<br />
werden sollten.<br />
Alle<strong>in</strong>e wenn ich — und Sie gestatten mir das<br />
sicherlich als Unterfranke — den unterfränkischen<br />
Bezirk betrachte, so kann ich ganz deutlich feststellen,<br />
daß hier e<strong>in</strong> sehr großer Andrang h<strong>in</strong>sichtlich<br />
der Dorferneuerung besteht. Daß die Flurentwicklung,<br />
ökologische Flurbere<strong>in</strong>igung — z. B. Schwebheim<br />
<strong>in</strong> Unterfranken —, die Unternehmensverfahren,<br />
die Landnutzungsfragen sehr wohl im<br />
Mittelpunkt ihrer Arbeit stehen, ist sehr offenkundig.<br />
E<strong>in</strong>e Verlagerung an die Landwirtschaftsämter wäre<br />
e<strong>in</strong> schwerer, sehr schwerer Fehler. Me<strong>in</strong>e Damen<br />
und Herren, wir leben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Zeit, <strong>in</strong> der immer<br />
* Redigierte Tonbandaufzeichnung<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
21
wieder von Synergie- und Integrationseffekten gesprochen<br />
und geschrieben wird. Ich me<strong>in</strong>e, gerade<br />
die Direktionen für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> br<strong>in</strong>gen<br />
sehr wohl Synergieeffekte, und mit e<strong>in</strong>er Auflösung<br />
der Direktionen würde man genau das Gegenteil<br />
erreichen. Man darf also nicht Fremdwörter aufgreifen<br />
und sie dann falsch umsetzen; offensichtlich tat<br />
das mancher <strong>in</strong> der Kommission.<br />
Dennoch, auch wenn ich das so deutlich formuliere,<br />
glaube ich, darf man se<strong>in</strong>en Blick nicht davon<br />
abwenden, daß es natürlich Möglichkeiten für<br />
Verbesserungen gibt und diese auch gefunden werden<br />
sollten. Hier denke ich mir aber und sage das<br />
auch völlig unverblümt: Es kann nicht immer richtig<br />
se<strong>in</strong>, alle Untersuchungen auf dem Gebiet der<br />
Effektivitätssteigerung von Wirtschaftsunternehmen<br />
durchführen zu lassen. Ich habe den E<strong>in</strong>druck und<br />
freue mich eigentlich darüber, daß <strong>in</strong> der veröffentlichten<br />
Me<strong>in</strong>ung — endlich mal was Positives über<br />
die Presse — sehr wohl die Kritik an den flotten<br />
Unternehmensberatern zunimmt. Denn die tun das<br />
nämlich nicht für ´nen Appel und ´n Ei, sondern sie<br />
kassieren ganz hohe, sehr hohe Summen. Da muß<br />
ich die Kommission unter Professor Badura loben,<br />
die hat es nämlich umsonst gemacht.<br />
Me<strong>in</strong>e sehr geehrten Damen und Herren, dennoch<br />
me<strong>in</strong>e ich, wir alle — ob Verwaltung, ob Personalvertretung,<br />
ob Gewerkschaft, ob Politik — müssen uns<br />
nach Verbesserungen umsehen, und ich kann Sie nur<br />
alle e<strong>in</strong>laden, sich selbst aktiv und konstruktiv bei<br />
notwendigen Veränderungen auf dem Gebiet der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> und anderen Bereichen e<strong>in</strong>zuschalten.<br />
Nun möchte ich noch e<strong>in</strong>en abschließenden<br />
Gedanken vortragen. Und Sie gestatten mir sicherlich,<br />
daß ich dies mit e<strong>in</strong>er Begründung, die sich<br />
nicht spontan, sondern aus me<strong>in</strong>er früheren Tätigkeit<br />
als Late<strong>in</strong>lehrer ableitet, tue. Die Investitionsmittel<br />
für Dorferneuerung und Flurentwicklung <strong>in</strong> Bayern<br />
s<strong>in</strong>d Ausdruck dessen, daß wir uns e<strong>in</strong>en Kulturstaat<br />
nennen können und Bayern e<strong>in</strong> Kulturstandort ist.<br />
Was hat das aber mit Late<strong>in</strong> zu tun? Bekanntlich<br />
kommt das Wort Kultur von »colere« und heißt: bebauen,<br />
pflegen, bilden. Me<strong>in</strong>e sehr geehrten Damen<br />
und Herren, »colere« wurde ursprünglich im landwirtschaflichen<br />
Sprachgebrauch verwendet! Es war<br />
also ke<strong>in</strong> Wort der Philosophen, sondern Kultur<br />
kommt schlicht und e<strong>in</strong>fach aus dem Bereich der<br />
Landwirtschaft. Und dieses sollte man sich bei der<br />
Gelegenheit wieder mal vor Augen führen. Dazu<br />
auch noch e<strong>in</strong> Sprichwort aus Spanien: »Wenn die<br />
Felder ke<strong>in</strong>e Frucht tragen, ernten auch die Heiligen<br />
nichts«. Ich will die <strong>in</strong> München nicht heilig sprechen,<br />
aber: »Wenn die Felder ke<strong>in</strong>e Frucht tragen,<br />
ernten auch die Heiligen <strong>in</strong> München nichts«. Also<br />
muß die Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
bestehen bleiben.<br />
Me<strong>in</strong>e sehr geehrten Damen und Herren. Solange<br />
ich und me<strong>in</strong>e beiden Ausschußkollegen, die<br />
Herren Abgeordneten Wilhelm Wenn<strong>in</strong>g und Klaus<br />
Sommerkorn, im Parlament se<strong>in</strong> werden, werden wir<br />
gegen die Auflösung der Direktionen für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> stimmen.<br />
Sie haben gemerkt, daß es mir bei dem Grußwort<br />
Freude machte, manches mit Zitaten zu würzen.<br />
Jetzt schließe ich mit dem Zitat e<strong>in</strong>es Mannes, der<br />
unbestritten der Politiker des letzten Jahrhunderts<br />
schlechth<strong>in</strong> war, nämlich Bismarck. Bismarck hat<br />
e<strong>in</strong>mal gesagt: »Mit schlechten Gesetzen und guten<br />
Beamten läßt sich immer noch regieren. Bei schlechten<br />
Beamten aber helfen uns die besten Gesetze<br />
nichts«. Wir <strong>in</strong> Bayern haben beste Beamte und gute<br />
Gesetze, so soll es bleiben!<br />
Ich bedanke mich für Ihr Zuhören und wünsche<br />
Ihnen e<strong>in</strong>e gute Tagung.<br />
22 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Re<strong>in</strong>hold Bocklet<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> für Bayern und Europa<br />
Ich freue mich, daß Sie so zahlreich zu dieser<br />
Tagung gekommen s<strong>in</strong>d; gerne darf ich Ihnen<br />
zunächst die herzlichen Grüße des Schirmherrn<br />
unserer Veranstaltung, Herrn M<strong>in</strong>isterpräsident<br />
Dr. Edmund Stoiber, übermitteln. Se<strong>in</strong>e wohlwollende<br />
E<strong>in</strong>stellung zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> hat er ja<br />
anläßlich dieser Tagung <strong>in</strong> der Bayerischen Staatszeitung<br />
deutlich zum Ausdruck gebracht.<br />
Es ist jetzt ziemlich genau acht Jahre her, daß<br />
ich — zum 100jährigen Jubiläum Ihrer Verwaltung<br />
1986 — Gelegenheit hatte, zu Ihnen zu sprechen.<br />
Me<strong>in</strong> damaliges Thema »Probleme der Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
und Agrarstruktur <strong>in</strong> den EG-Staaten« hat seither<br />
an Aktualität nichts e<strong>in</strong>gebüßt.<br />
Geänderte Rahmenbed<strong>in</strong>gungen —<br />
neue Perspektiven<br />
Dennoch: Heute, acht Jahre später, leben wir <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em völlig veränderten Europa.<br />
Die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen haben sich gewandelt<br />
durch<br />
— den Zusammenbruch des Kommunismus und das<br />
Verschw<strong>in</strong>den des Ost-West-Gegensatzes,<br />
— die außenpolitische Neuorientierung <strong>in</strong> Mittelund<br />
Osteuropa,<br />
— die E<strong>in</strong>heit Deutschlands,<br />
— die Zusammenführung der Volkswirtschaften von<br />
EFTA und EG im Europäischen Wirtschaftsraum,<br />
— den Vertrag von Maastricht sowie die geplante<br />
Erweiterung der Europäischen Union.<br />
Das Zusammenwachsen von seit Jahrzehnten<br />
getrennten Wirtschaftsräumen führt zur Wiederbelebung<br />
alter Kultur-, Verkehrs- und Handelsbeziehungen<br />
und eröffnet neue Perspektiven. Wenn<br />
wir von e<strong>in</strong>em positiven Ausgang der anstehenden<br />
Volksabstimmungen <strong>in</strong> Österreich und Skand<strong>in</strong>avien<br />
e<strong>in</strong>mal ausgehen, dann wird sich das »Europa der<br />
12« schon bald zum »Europa der 16« erweitern.<br />
Föderalismus und Subsidiarität s<strong>in</strong>d die Grundsätze,<br />
die die Union <strong>in</strong> Zukunft bestimmen sollen.<br />
Dies ist auch e<strong>in</strong> wesentlicher Verdienst deutscher<br />
und nicht zuletzt bayerischer Europapolitik.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Die Union der 12 oder bald 16 Staaten ist längst<br />
zum Gravitationszentrum geworden, auf dessen<br />
Kraftl<strong>in</strong>ien h<strong>in</strong> sich vor allem die Staaten Mittel- und<br />
Osteuropas ausrichten.<br />
GATT-Abkommen<br />
Diese europäischen <strong>Entwicklung</strong>en s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den<br />
Kontext der globalen Zusammenhänge e<strong>in</strong>geordnet.<br />
Es würde zu weit führen, an dieser Stelle den<br />
gesamten Kontext auszubreiten. Ich will vielmehr<br />
e<strong>in</strong>en Komplex ansprechen, der sich auch <strong>in</strong> unserem<br />
Land bis <strong>in</strong> das kle<strong>in</strong>ste Dorf, bis <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen<br />
landwirtschaftlichen Betrieb h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> auswirkt.<br />
Nach siebenjährigen Verhandlungen wurde die<br />
Uruguay-Runde des Allgeme<strong>in</strong>en Zoll- und Handelsabkommens<br />
(GATT) im Dezember 1993 abgeschlossen<br />
und im April <strong>1994</strong> <strong>in</strong> Marrakesch feierlich<br />
schriftlich besiegelt.<br />
Die EG-Agrarreform hat die Zustimmung der EU<br />
zum GATT-Abschluß erst ermöglicht. Umgekehrt wird<br />
die EG-Agrarreform <strong>in</strong> ihren wesentlichen Elementen<br />
durch das GATT-Abkommen <strong>in</strong>ternational festgeschrieben<br />
und abgesichert. Damit können nur noch<br />
Details der Reform verändert werden. EG-Agrarreform<br />
und GATT-Abkommen bilden die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
für die Landwirtschaft bis zum<br />
Jahr 2000 und darüber h<strong>in</strong>aus.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
23
Bei e<strong>in</strong>em Urteil über das GATT-Abkommen müssen<br />
wir mehrere Aspekte berücksichtigen.<br />
Unser Land nimmt im Welthandel e<strong>in</strong>e herausragende<br />
Stellung e<strong>in</strong>. E<strong>in</strong> offener Weltmarkt ist<br />
besonders für die exportorientierte deutsche Wirtschaft<br />
lebenswichtig. Jeder dritte Arbeitsplatz <strong>in</strong><br />
Deutschland ist vom Export abhängig. Der weltweite<br />
Abbau von Handelshemmnissen wird der Konjunktur<br />
neue Impulse geben; erste Anzeichen dafür s<strong>in</strong>d<br />
nach den neuesten Wirtschaftsgutachten bereits<br />
erkennbar.<br />
Aufgrund ihrer engen Verflechtungen mit den<br />
übrigen Wirtschaftsbereichen hängt aber auch die<br />
Landwirtschaft von der gesamtwirtschaft-lichen<br />
<strong>Entwicklung</strong> ab.<br />
Deutschland ist außerdem nicht nur der Welt<br />
größter Agrarimporteur, vielmehr s<strong>in</strong>d wir weltweit<br />
auch der viertgrößte Agrarexporteur. Der GATT-<br />
Abschluß ist ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>bahnstraße. Im Gegenteil: die<br />
USA und e<strong>in</strong>ige andere kaufkräftige Länder wie<br />
Japan, die ihre Agrarmärkte bislang gegen Konkurrenten<br />
von außerhalb abgeschottet haben, müssen<br />
diese jetzt auch für europäische Agrarerzeugnisse<br />
öffnen. Aufgrund ihres vielfältigen Angebots an<br />
ausgezeichneten Spezialitäten hat die bayerische<br />
Agrar- und Ernährungswirtschaft Chancen, von<br />
dieser Marktöffnung zu profitieren.<br />
GATT-Folgen für den ländlichen Raum und die<br />
Landwirtschaft<br />
Die Sicherung der EG-Agrarreform durch das<br />
GATT-Abkommen hat durch den ertragsunabhängigen<br />
E<strong>in</strong>kommenssockel und die flankierenden<br />
Maßnahmen zur Förderung der extensiven Bewirtschaftung<br />
die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die bäuerliche<br />
Landwirtschaft erheblich verändert. Mehr<br />
denn je kommt es jetzt darauf an<br />
— die unternehmerische Leistungsfähigkeit jedes<br />
e<strong>in</strong>zelnen Landwirts zu stärken;<br />
— höchste Qualität zu produzieren;<br />
— die Vertragslandwirtschaft als Stabilitätsanker<br />
auszubauen;<br />
— den Markt für nachwachsende Rohstoffe auszuweiten<br />
und<br />
— die Leistungen der Bauern für die Erhaltung der<br />
Kulturlandschaft gerecht zu entlohnen.<br />
Agrarpolitik — Politik für den gesamten<br />
ländlichen Raum<br />
Das s<strong>in</strong>d aber nur die unmittelbaren Auswirkungen.<br />
Die durch das GATT-Abkommen zu erwartende<br />
Stärkung der Wirtschaft und die Steigerung<br />
des Wohlstandes unserer Gesellschaft kommen auch<br />
<strong>in</strong>direkt der Landwirtschaft zugute. Sie ist auf e<strong>in</strong>e<br />
kaufkräftige Nachfrage angewiesen. Das setzt e<strong>in</strong>e<br />
florierende Wirtschaft und e<strong>in</strong> entsprechendes E<strong>in</strong>kommen<br />
voraus. E<strong>in</strong>e expandie-rende Wirtschaft<br />
schafft auch zusätzliche außerlandwirtschaftliche<br />
Arbeitsplätze, wodurch der Strukturwandel <strong>in</strong> der<br />
Landwirtschaft abgefedert und die E<strong>in</strong>kommenschancen<br />
<strong>in</strong>sgesamt verbessert werden. Die Nebenerwerbslandwirtschaft<br />
und die Bauerntöchter und<br />
Bauernsöhne, die nicht den Hof übernehmen, profitieren<br />
von e<strong>in</strong>em Zuwachs an Arbeitsplätzen. Mehr<br />
als die Hälfte der landwirtschaftlichen Haushalte <strong>in</strong><br />
Bayern erwirtschaftet bereits den überwiegenden Teil<br />
ihres E<strong>in</strong>kommens außerhalb der Landwirtschaft.<br />
Die Agrarpolitik kann sich angesichts dieser<br />
<strong>Entwicklung</strong> nicht auf e<strong>in</strong>e Politik für den Berufsstand<br />
beschränken, sondern sie muß e<strong>in</strong>e umfassende<br />
Politik für den ganzen ländlichen Raum<br />
se<strong>in</strong>.<br />
EU-Strukturpolitik<br />
Agrarpolitik als umfassende Strukturpolitik für das<br />
Land — <strong>in</strong> dieser Aufgabe unterstützt uns auch die<br />
EU. Die Europäische Kommission verfolgt seit Jahren<br />
e<strong>in</strong>e gezielte Strukturpolitik zur <strong>Entwicklung</strong> der<br />
ländlichen Räume.<br />
Wachsende regionale Disparitäten und die zunehmende<br />
Gefahr der Entleerung vor allem der peripheren<br />
ländlichen Räume zwangen zum Handeln.<br />
Zudem konzentrierte sich die Wirtschaftsentwicklung<br />
<strong>in</strong> der EG mehr und mehr auf die sogenannte<br />
»Wachstumsbanane«, die von London über die Benelux-Länder,<br />
das Pariser Becken und Westdeutschland<br />
bis Norditalien reicht; sie wird heute bereits überlagert<br />
von e<strong>in</strong>er neuen <strong>Entwicklung</strong>sachse von Norditalien<br />
über Südfrankreich bis <strong>in</strong> den Nordosten<br />
Spaniens h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>.<br />
Reform der Strukturfonds 1988<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund wurde mit der Reform<br />
der Strukturfonds im Jahre 1988 e<strong>in</strong> eigener strukturpolitischer<br />
Schwerpunkt festgelegt: die Politik<br />
zur <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume. Im Westen<br />
24 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Deutschlands ist diese Politik <strong>in</strong> Form der sog.<br />
Ziel 5 b-Förderung bekannt geworden, im Osten<br />
Deutschlands seit Anfang dieses Jahres als Ziel1-<br />
Programm.<br />
Die EU-Ziele der <strong>Entwicklung</strong> ländlichen Räume<br />
s<strong>in</strong>d dabei vor allem:<br />
— die Verbesserung der Lebensqualität <strong>in</strong> den<br />
Dörfern;<br />
— die Erhaltung e<strong>in</strong>er flächendeckenden Landwirtschaft<br />
und ihre Stärkung durch das Angebot<br />
neuer E<strong>in</strong>kommenschancen;<br />
— die Erhaltung und Schaffung von Arbeitsplätzen.<br />
Subsidiarität <strong>in</strong> der Strukturpolitik<br />
Bayern unterstreicht diese Ziele und verweist aus<br />
Erfahrung mit großem Nachdruck auf die Feststellung<br />
der Europäischen Kommission, daß mit der<br />
Planung und Durchführung der Strukturmaßnahmen<br />
— <strong>in</strong>sbesondere im Bereich des ländichen Raums —<br />
die regionalen und lokalen Ebenen eigenverantwortlich<br />
befaßt werden müssen. Die Delegation der Verantwortung<br />
auf die unteren Ebenen ist erklärtes Ziel<br />
der Politik der Staatsregierung. Bei der Reform der<br />
Strukturfonds wurden diese Vorstellungen weitgehend<br />
berücksichtigt.<br />
Erfolgreiche Partnerschaft setzt Gleichberechtigung<br />
voraus. Die Konzepte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
dürfen deshalb auch nicht <strong>in</strong> Brüssel, sondern<br />
müssen <strong>in</strong> den Regionen selbst entwickelt werden<br />
und zwar geme<strong>in</strong>sam mit den Menschen und<br />
Institutionen, die dort leben und wirken, und die die<br />
Konzepte auch überzeugt mittragen sollen.<br />
Neben diesem konsequent verwirklichten Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zip<br />
ist der »<strong>in</strong>tegrierte« Ansatz e<strong>in</strong> weiteres<br />
Wesensmerkmal der neuen und von uns mitgetragenen<br />
europäischen Strukturpolitik. Darunter ist<br />
die <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre und <strong>in</strong>tegrierende Vernetzung<br />
aller Lebens- und Strukturbereiche des ländlichen<br />
Raumes zu verstehen.<br />
EU-Politik entspricht bayerischen Zielen<br />
Diese neuen Bestrebungen der EU-Kommission<br />
fügen sich somit fast nahtlos e<strong>in</strong> <strong>in</strong> die Strukturpolitik,<br />
die Bayern seit vielen Jahren für den ländlichen<br />
Raum betrieben hat. Gerade <strong>in</strong> der <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> ist das Pr<strong>in</strong>zip der umfassenden<br />
und bürgernahen Konzepte seit langem e<strong>in</strong>e<br />
Selbstverständlichkeit. Bund und Freistaat haben<br />
vor allem im Rahmen der Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
»Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes«<br />
die entsprechenden Mittel bereitgestellt<br />
und die Konzepte von lokalen Verantwortlichen,<br />
nämlich den Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaften Flurbere<strong>in</strong>igung,<br />
erstellen lassen. Ich muß auch nicht eigens<br />
betonen, daß wir <strong>in</strong> den beiden zentralen Bereichen<br />
der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong>, <strong>in</strong> der Flurgestaltung<br />
und <strong>in</strong> der Dorfentwicklung, seit Jahren <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är<br />
und <strong>in</strong>tegrierend planen und handeln.<br />
Ich me<strong>in</strong>e, daß diese spezielle Ausprägung der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>e ausgezeichnete Voraussetzung<br />
für die Anwendung der entsprechenden EU-<br />
Programme und die Umsetzung ihrer Fördermittel<br />
war und ist.<br />
Man würde die EU-Förderung gründlich mißverstehen,<br />
wollte man sie als enge Landwirtschaftsförderung<br />
<strong>in</strong>terpretieren. Sie ist vielmehr e<strong>in</strong>e<br />
globale Förderung des ländlichen Raumes. Am<br />
Beispiel der bayerischen 5 b-Programme wurde und<br />
wird dies künftig noch deutlicher.<br />
5 b-Förderung<br />
Bekanntlich ist es uns gelungen, den Förderumfang<br />
für die Bundesrepublik und für Bayern auszuweiten.<br />
Nunmehr kommen mit 3,5 Mio. Menschen<br />
31 % der E<strong>in</strong>wohner Bayerns und mit knapp 4 Mio.<br />
ha 57 % des Staatsgebietes <strong>in</strong> den Genuß der 5 b-<br />
Förderung.<br />
Landwirtschaft<br />
Die Bedeutung der Landwirtschaft für die ländlichen<br />
Räume ist unbestritten; sie hat bis vor wenigen<br />
Jahrzehnten Gesicht und Wohlergehen des ländlichen<br />
Raums bestimmt. Steigende Produktivität <strong>in</strong><br />
der Landwirtschaft und stagnierende Nachfrage<br />
haben dazu geführt, daß im Zuge des Generationenwechsels<br />
immer mehr Erwerbstätige aus der Landwirtschaft<br />
ausgeschieden s<strong>in</strong>d.<br />
Unsere Landwirte sehen sich heute mit e<strong>in</strong>em<br />
völlig geänderten Berufsbild konfrontiert. Seit die<br />
ersten Menschen seßhaft wurden und begannen<br />
Ackerbau zu treiben, war die Erzeugung möglichst<br />
großer Nahrungsmittelmengen oberstes Ziel der<br />
Bauern. Heute wird den Landwirten ihre hohe Produktivität<br />
be<strong>in</strong>ahe zum Vorwurf gemacht. Machen<br />
wir uns bewußt: Erstmals <strong>in</strong> der Geschichte der<br />
Menschheit ist <strong>in</strong> unserer Zeit <strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen Regionen<br />
dieser Welt landwirtschaftliche Überproduktion zum<br />
Problem geworden.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
25
Nahrungsmittel — Lebens-Mittel<br />
Unsere Gesellschaft braucht aber mehr als e<strong>in</strong>e<br />
ausreichende Versorgung mit Nahrung. Bauern müssen<br />
heute nicht mehr nur Nahrungsmittel produzieren,<br />
sondern Lebensmittel, Über-Lebens-Mittel:<br />
Dazu gehören außer Essen und Tr<strong>in</strong>ken auch sauberes<br />
Wasser und gesunde Böden; dazu gehören e<strong>in</strong>e<br />
bäuerlich geprägte artenreiche Kulturlandschaft und<br />
dörfliches Leben.<br />
Die gesellschaftliche und ökonomische Bedeutung<br />
der Landwirtschaft geht weit über ihren Anteil am<br />
Bruttosozialprodukt h<strong>in</strong>aus.<br />
Marktchancen nützen<br />
Landwirte müssen heute mehr denn je alle<br />
Marktchancen nützen. Ich nenne hier die Möglichkeiten<br />
der E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ation; Stichworte s<strong>in</strong>d<br />
Direktvermarktung, Urlaub auf dem Bauernhof,<br />
Übernahme von Dienstleistungen für die Kommunen<br />
etc. Zukünftige Märkte, wie den Anbau nachwachsender<br />
Rohstoffe, darf die bayerische Landwirtschaft<br />
nicht der Konkurrenz überlassen.<br />
E<strong>in</strong>e Nachfrage besteht heute allerd<strong>in</strong>gs auch<br />
nach der Erhaltung unserer überlieferten Kulturlandschaft.<br />
Die Landwirtschaft muß bereit se<strong>in</strong>, auch<br />
diese Nachfrage zu befriedigen.<br />
Wirtschaftsstandort ländlicher Raum<br />
Die Sicherung des Wirtschaftsstandortes<br />
Bayern, und dazu zählt auch der ländliche Raum,<br />
sieht die Bayerische Staatsregierung als derzeit<br />
wichtigste Aufgabe ihrer Politik an. Aufgabe des<br />
Staates ist es, optimale Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für<br />
Investitionen zu schaffen. Dadurch erst können auch<br />
im ländlichen Raum Arbeitsplätze gesichert bzw. neu<br />
geschaffen werden.<br />
E<strong>in</strong>e wichtige Voraussetzung für Neu-Investitionen<br />
der Wirtschaft stellt e<strong>in</strong>e ausreichende Ausstattung<br />
mit Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen dar; hier<br />
me<strong>in</strong>e ich vor allem gute Verkehrsverb<strong>in</strong>dungen. E<strong>in</strong><br />
weiterer Schwerpunkt ist die möglichst flächendeckende<br />
Nutzung neuer Technologien für den ländlichen<br />
Raum.<br />
Die E<strong>in</strong>richtung von Telekommunikationsnetzen<br />
auch <strong>in</strong> schwach besiedelten ländlichen Räumen<br />
kann nach Ansicht vieler Experten e<strong>in</strong>en wesentlichen<br />
Beitrag zur Dezentralisierung e<strong>in</strong>es qualifizierten<br />
Arbeitsplatzangebotes leisten. Durch die Nutzung<br />
dieser Technik kann die Abwanderung mancher<br />
gutausgebildeter junger Menschen aus den Dörfern<br />
gebremst werden.<br />
Stärkung von dörflichem Handwerk und<br />
Gewerbe<br />
Die Ansiedlung großer Betriebe im ländlichen<br />
Raum, wie es z. B. bei der Firma BMW <strong>in</strong> D<strong>in</strong>golf<strong>in</strong>g<br />
der Fall war, wird die Ausnahme se<strong>in</strong>. Wir müssen<br />
unser Hauptaugenmerk auf die Erhaltung bestehender<br />
Handwerks- und Gewerbebetriebe und die kle<strong>in</strong>eren<br />
und mittleren Unternehmen (KMU) im ländlichen<br />
Raum richten bzw. die Neuansiedlung solcher<br />
Betriebe anstreben. Gerade dieser Mittelstand hat<br />
sich <strong>in</strong> der Vergangenheit als sehr krisen-sicher<br />
erwiesen. Er bildet das Rückgrat des Arbeitsplatzangebotes<br />
im ländlichen Raum. Dies gilt vor allem<br />
auch für die Möglichkeiten zur E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ation<br />
für Landwirte. Arbeitsplätze im ländlichen<br />
Raum verh<strong>in</strong>dern das Abwandern der Menschen <strong>in</strong><br />
die Ballungsräume.<br />
Zukunftsmarkt Dienstleistungen<br />
E<strong>in</strong>e wichtige Chance der derzeitigen wirtschaftlichen<br />
<strong>Entwicklung</strong> liegt im Ausbau des Zukunftsmarktes<br />
Dienstleistungen. Für die ländlichen Räume<br />
stellt sich die Aufgabe, die hier sich bietenden<br />
Möglichkeiten offensiv und kreativ zu nützen.<br />
Ich denke vor allem an den Ausbau des naturnahen<br />
Tourismus mit regionaler Wertschöpfung.<br />
Dabei reicht es nicht mehr aus, den Urlaubern lediglich<br />
komfortable Unterkunftsmöglichkeiten anzubieten.<br />
Es ist vielmehr e<strong>in</strong> Erlebniskonzept erforderlich,<br />
das sich geme<strong>in</strong>deübergreifend u. a. mit den<br />
Fragen Ausbau der Infrastruktur, Anbieten der regionalen<br />
Attraktionen und verbraucherorientiertes<br />
Market<strong>in</strong>g beschäftigt. In diesen Konzepten und<br />
Strategien stellt e<strong>in</strong>e wohlgeordnete, bäuerlich<br />
gepflegte Kulturlandschaft die Voraussetzung für<br />
Attraktivität und Akzeptanz der Landschaft dar. Der<br />
Landwirtschaft kommt also e<strong>in</strong>e besondere Bedeutung<br />
zu; immer mehr Tourismusmanager wissen<br />
darum und schließen e<strong>in</strong>en Pakt mit ihren Bauern.<br />
E<strong>in</strong> anschauliches Beispiel für den erfolgreichen<br />
Ausbau des ländlichen Dienstleistungssektors ist<br />
»Das Neue Fränkische Seenland«. Landwirte haben<br />
den nötigen Strukturwandel, der mit dem Verlust<br />
vieler Flächen verbunden war, als Chance erkannt.<br />
Sie pflegen Flächen im Umfeld der Seen und bieten<br />
den Urlaubern Unterkunftsmöglichkeiten an. Alle<br />
26 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
notwendigen Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen wurden<br />
vielfach mit Unterstützung von flächendeckenden<br />
Flur- und Dorfentwicklungsvorhaben neu geschaffen.<br />
Attraktiv erneuerte Dörfer ziehen die Gäste an.<br />
Das Neue Fränkische Seenland ist e<strong>in</strong> überzeugendes<br />
Beispiel dafür, wie der ländliche Raum die Bedürfnisse<br />
der Städte zu erfüllen hilft: die neuen Seen<br />
s<strong>in</strong>d längst attraktiver Naherholungsraum für die<br />
Nürnberger Großstadtbevölkerung geworden. Die<br />
Leistungen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> im Seenland<br />
wurden mit dem Staatspreis für vorbildliche Neuordnungen<br />
ausgezeichnet.<br />
Von der Flurbere<strong>in</strong>igung zur <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong><br />
Me<strong>in</strong>e sehr geehrten Damen und Herren, damit<br />
b<strong>in</strong> ich endgültig beim Anlaß unserer Tagung und<br />
Ihres Zusammenkommens: Im Grunde habe ich mit<br />
dem erweiterten Rahmen <strong>in</strong> wesentlichen Bereichen<br />
Ihren, d. h. den heutigen Tätigkeitsbereich der <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> bereits skizziert. Es ist längst e<strong>in</strong>e<br />
imponierende und ebenso anspruchsvolle wie<br />
schwierige Aufgabe, die Bereitschaft zum Wandel<br />
und zur Anpassung althergebrachter Instrumentarien<br />
abverlangt. Mit dem Schritt von der Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> hat sich Ihre Verwaltung<br />
nicht nur namensmäßig diesen Anforderungen<br />
früh und — wie ich me<strong>in</strong>e — rechtzeitig<br />
gestellt. Bei dieser Gelegenheit darf ich mich bei<br />
me<strong>in</strong>em Vorgänger Hans Maurer herzlich bedanken,<br />
daß er im Jahre 1992 die Konsequenzen aus dieser<br />
<strong>Entwicklung</strong> gezogen und die Umbenennung erreicht<br />
hat. Sprachstrategisch war dies sicher e<strong>in</strong> wichtiger<br />
Schritt, um die heutige Bedeutung der Verwaltung<br />
für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> heraus- und für die<br />
Zukunft sicherzustellen. Sicher ist dies e<strong>in</strong> entscheidender<br />
Schritt, um den Menschen die vielseitigen<br />
Anforderungen an die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> deutlich<br />
zu machen.<br />
Die Verbesserung der Arbeits- und Produktionsbed<strong>in</strong>gungen<br />
der Landwirtschaft war ursprünglich<br />
das Hauptziel der Flurbere<strong>in</strong>igung. Im Laufe der Zeit<br />
haben sich die Schwerpunkte verlagert; die Steigerung<br />
der Produktion wurde abgelöst vom Ziel der<br />
Produktivitätsverbesserung. Dadurch auch entstanden<br />
Raum und Bereitschaft für die stärkere Verfolgung<br />
der Ziele der Landeskultur und Landentwicklung.<br />
Längst geht es heute um<br />
— wirksame Hilfen für e<strong>in</strong>e stärker unternehmerisch<br />
ausgerichtete Landwirtschaft,<br />
— die Erhaltung und Gestaltung e<strong>in</strong>er ökologisch<br />
und ästhetisch ansprechenden Kulturlandschaft,<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
— die zukunftsorientierte <strong>Entwicklung</strong> der Dörfer<br />
und<br />
— die aktive Mitwirkung der Bürger an der<br />
Gestaltung ihres dörflichen und landschaftlichen<br />
Lebensumfeldes.<br />
Dies s<strong>in</strong>d die Schwerpunkte Ihrer Arbeit für die<br />
ländlichen Räume <strong>in</strong> Bayern. Im vom Bayerischen<br />
Landtag geforderten und gebilligten Programm<br />
<strong>Ländliche</strong> Neuordnung durch Flurbere<strong>in</strong>igung und<br />
Dorferneuerung von 1989 haben wir sie festgeschrieben.<br />
Die neuen Dorferneuerungsrichtl<strong>in</strong>ien und<br />
die F<strong>in</strong>anzierungsrichtl<strong>in</strong>ien <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
führen diese vorgenommene Schwerpunktsetzung<br />
der letzten Jahre konsequent fort.<br />
Bayerisches Programm <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>in</strong> der nächsten Legislaturperiode<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergrund der veränderten europäischen<br />
und nationalen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen und<br />
Aufgabenstellungen und deren Konsequenzen für die<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> ist e<strong>in</strong>e Fortschreibung des<br />
Programms <strong>Ländliche</strong> Neuordnung erforderlich. Dazu<br />
hat der Bayerische Landtag bereits aufgerufen. Die<br />
Fortschreibung wird e<strong>in</strong> Schwerpunkt der nächsten<br />
Legislaturperiode se<strong>in</strong>. Die angestrebte Novellierung<br />
der gesetzlichen Grundlagen <strong>in</strong> Richtung mehr<br />
Landentwicklung sollte Sie zu <strong>in</strong>novativen Vorschlägen<br />
ermuntern. Ich denke, daß gerade diese <strong>Fachtagung</strong><br />
e<strong>in</strong>e hervorragende Gelegenheit bietet, <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e solche Diskussion e<strong>in</strong>zusteigen; ja, ich me<strong>in</strong>e, es<br />
liegt sogar ihre besondere Berechtigung dar<strong>in</strong>, dies<br />
zu tun. Auch das ist für mich e<strong>in</strong> wichtiges Stück<br />
Unternehmenskultur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er öffentlichen<br />
Verwaltung.<br />
Das künftige Bayerische Programm <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> sollte e<strong>in</strong> Grundsatzprogramm se<strong>in</strong>, <strong>in</strong><br />
dem die schon angesprochenen Zukunftsperspektiven<br />
pragmatisch und realisierbar konkretisiert<br />
werden.<br />
Bürger gestalten Dorf und Flur<br />
Ob es nun um den Schwerpunkt Landwirtschaft<br />
und Landbewirtschaftung, Dorf- und Landentwicklung<br />
oder um Hilfen für öffentliche Maßnahmen<br />
geht — e<strong>in</strong> primäres unternehmerisches Leit- und<br />
Führungspr<strong>in</strong>zip müssen die Sorge um den Bürger<br />
und das Ernstnehmen se<strong>in</strong>er Ansprüche und<br />
Me<strong>in</strong>ungen se<strong>in</strong>. Ich sage dies vor dem H<strong>in</strong>tergrund<br />
der aktuellen Diskussionen um mehr Demokratie <strong>in</strong><br />
den Geme<strong>in</strong>den.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
27
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> ist heute und morgen nur<br />
möglich und effizient, wenn die Bürger selbst sich<br />
<strong>in</strong>tensiv mit ihrem Lebensraum beschäftigen und zu<br />
verantwortlichem Handeln angeregt werden.<br />
Planungen und Maßnahmen <strong>in</strong> der <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> sollen von der Basis aus unterstützt und<br />
bee<strong>in</strong>flußt werden. Diese Grundforderung ist bei der<br />
Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> längst geübte<br />
Praxis; das bayerische Genossenschaftspr<strong>in</strong>zip<br />
sichert seit jeher Mitbestimmung und Mitverantwortung<br />
der Teilnehmer vor Ort. Die Delegation von<br />
Zuständigkeiten auf die untere Ebene wird bei Ihnen<br />
ebenso vollzogen wie die Privatisierung vieler<br />
Planungsleistungen.<br />
Mit der E<strong>in</strong>richtung von Arbeitskreisen <strong>in</strong> den<br />
Dörfern haben Sie das Fundament für Planerstellung<br />
und nachfolgende Projekte noch zusätzlich und<br />
erfolgreich verbreitert. Es ist damit gewährleistet,<br />
daß alle Bürger vor Ort ihre Ideen e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen und<br />
sich mit den Projekten identifizieren können.<br />
Wie erfolgreich dies im Rahmen der Dorferneuerung<br />
geschieht, konnte ich erst am Samstagabend <strong>in</strong><br />
Kickl<strong>in</strong>gen bei der Verleihung des Staatspreises erleben.<br />
Hier ist e<strong>in</strong>e lebendige Geme<strong>in</strong>schaft entstanden<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Dorf, das vor 10 oder 15 Jahren noch<br />
als letztes »Kaff« bezeichnet worden ist und <strong>in</strong> dem<br />
die Bürger kaum mite<strong>in</strong>ander kommuniziert haben;<br />
das ist schon erstaunlich! Manche Demokratietheoretiker<br />
sollte dies zum Nachdenken bewegen, ob die<br />
Formen unserer Demokratie immer geeignet s<strong>in</strong>d,<br />
mehr Gespräche und e<strong>in</strong> offeneres Mite<strong>in</strong>ander der<br />
Menschen bei der Bewältigung der Probleme des<br />
Dase<strong>in</strong>s zu erreichen.<br />
<strong>Ländliche</strong> Bildungsstätten fördern lebendige<br />
Demokratie<br />
Um die Vorbereitungs- oder Startphase möglichst<br />
effizient zu gestalten und die Information und Beratung<br />
der Bürger zu optimieren, wollen wir uns verstärkt<br />
der sog. Schulen der Dorf- und Landentwicklung<br />
sowie der Landvolkshochschulen bedienen.<br />
Diese Bildungse<strong>in</strong>richtungen sollen die <strong>in</strong>teressierten<br />
Multiplikatoren und Bürger befähigen, komplexe<br />
Zusammenhänge besser zu erkennen, eigenständige<br />
Lösungen und Alternativen zu erarbeiten und zu diskutieren<br />
sowie e<strong>in</strong>em Konsens zuzuführen. Dadurch<br />
erwächst Identifikation mit den Lösungen und dem<br />
eigenen Lebensraum.<br />
Auch oder gerade die Bewohner der ländlichen<br />
Räume sollen im zusammenwachsenden Europa<br />
Identität bewahren. Gerade <strong>in</strong> diesem Zusammen-<br />
hang ist die Dorferneuerung besonders gefordert.<br />
Die Nähe unserer Verwaltungen zu den Menschen <strong>in</strong><br />
den Dörfern und deren Problemen und ihre besondere<br />
Kompetenz s<strong>in</strong>d me<strong>in</strong>es Erachtens auch <strong>in</strong><br />
Zukunft zuverlässiger Garant dafür, daß die Dorferneuerung,<br />
wie <strong>in</strong> allen anderen deutschen<br />
Flächenstaaten, im Bereich des Agrarressorts angesiedelt<br />
bleibt. Die Betreuung der Maßnahmen durch<br />
Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaft, Amt für Landwirtschaft<br />
und Ernährung und die Direktion für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> hat sich bewährt.<br />
Dorfentwicklung bleibt vorrangige Aufgabe der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
Die Bayerische Staatsregierung und der Bayerische<br />
Landtag sehen <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der Dorferneuerung<br />
e<strong>in</strong> überragendes Instrument zur<br />
Stärkung der ländlichen Räume. Deshalb hat der<br />
Landtag <strong>in</strong> den letzten Jahren die Mittel für die<br />
Dorferneuerung konsequent angehoben und den<br />
<strong>in</strong>haltlichen Ausbau der Dorferneuerungsrichtl<strong>in</strong>ien<br />
bewirkt. Inzwischen setzen wir auch Mittel der<br />
Europäischen Union <strong>in</strong> der Dorferneuerung e<strong>in</strong>, da<br />
auch die Europäische Kommission die Dorferneuerung<br />
als zentrale Maßnahme zur Erhaltung der dörflichen<br />
Siedlungen sieht.<br />
Trotz dieser positiven Perspektiven b<strong>in</strong> ich nicht<br />
ohne Sorge: Viele bayerische Dörfer stehen auf der<br />
Warteliste und können bei der derzeitigen Personalund<br />
F<strong>in</strong>anzsituation nicht <strong>in</strong> das Programm aufgenommen<br />
werden. Die Bürgermeister dieser Dörfer<br />
drängen bei mir auf die E<strong>in</strong>leitung von Maßnahmen.<br />
Ich lege deshalb großen Wert darauf, daß bei den<br />
<strong>in</strong> Bearbeitung stehenden Dorferneuerungen die<br />
f<strong>in</strong>anzielle Hilfe auf die wichtigsten strukturellen<br />
Maßnahmen beschränkt bleibt. Es darf ke<strong>in</strong>e Luxussanierungen<br />
oder Endloserneuerungen von Dörfern<br />
geben. Mit Hilfe der neuen Startphase wollen wir<br />
schneller zur Prioritätensetzung und Realisierung<br />
der Maßnahmen kommen.<br />
Gleichzeitig müssen wir noch mehr als bisher verdeutlichen,<br />
daß bauliche, <strong>in</strong>frastrukturelle und bodenordnerische<br />
Maßnahmen zwar unverändert wichtige<br />
Ausprägung e<strong>in</strong>er Dorferneuerung s<strong>in</strong>d, nicht<br />
aber ausschließlicher Inhalt e<strong>in</strong>er Dorfentwicklung<br />
se<strong>in</strong> können. Vielmehr sollen motivierte und unternehmerisch<br />
ges<strong>in</strong>nte Bürger wirtschaftlich und<br />
sozio-kulturell tragfähige Strategiekonzepte für die<br />
Zukunft nach der Dorferneuerung erarbeiten. Dazu<br />
gehören auch Konzepte zur Zukunftssicherung der<br />
landwirtschaftlichen Betriebe.<br />
28 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
All das erfordert neben dem nötigen Geld auch<br />
erheblichen beratenden, moderierenden und planerischen<br />
E<strong>in</strong>satz der Mitarbeiter unserer Verwaltung.<br />
Ich weiß, wie sehr Sie sich über Ihre normale Dienstzeit<br />
h<strong>in</strong>aus engagieren. Dafür danke ich Ihnen herzlich;<br />
ich bitte aber gleichwohl die anwesenden<br />
Bürgermeister um Verständnis dafür, daß wir neue<br />
Dorferneuerungsvorhaben nur noch e<strong>in</strong>leiten können,<br />
wenn die Personal- und F<strong>in</strong>anzsituation der<br />
Direktionen dies zuläßt<br />
Überörtliche Zusammenarbeit ist das Gebot<br />
der Stunde<br />
In der Vergangenheit hat sich immer wieder<br />
gezeigt, daß viele Probleme von e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de oder<br />
gar e<strong>in</strong>em Dorf, alle<strong>in</strong> schon aus f<strong>in</strong>anziellen Gründen,<br />
im Alle<strong>in</strong>gang nicht angepackt werden können.<br />
Das neue Bayerische Landesentwicklungsprogramm<br />
fordert deshalb ebenso wie der Bundesraumordnungsm<strong>in</strong>ister<br />
neue Wege der Partnerschaft und<br />
überörtlichen Handelns. Wir fördern <strong>in</strong> zwei Modellversuchen<br />
die landkreis- und regierungsbezirksübergreifende<br />
Zusammenarbeit von mehreren Geme<strong>in</strong>den.<br />
Die bisherigen Reaktionen der Geme<strong>in</strong>den und<br />
die ersten planerischen Erfahrungen s<strong>in</strong>d positiv.<br />
Unternehmensverfahren zum Wohle<br />
der Allgeme<strong>in</strong>heit haben Vorrang<br />
Ich habe bereits darauf h<strong>in</strong>gewiesen, daß die<br />
Sicherung des Wirtschafts- und Arbeitsplatzstandortes<br />
Bayern e<strong>in</strong> großes Anliegen der Bayerischen<br />
Staatsregierung ist. Derzeit stehen im ganzen Freistaat<br />
wichtige Verkehrsprojekte zur Verwirklichung<br />
an, darunter besonders die Verkehrsprojekte<br />
Deutsche E<strong>in</strong>heit.<br />
Bei den Unternehmensverfahren handelt es sich<br />
um e<strong>in</strong>e politisch vordr<strong>in</strong>gliche Aufgabe der Verwaltung<br />
für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>. Die geplanten Vorhaben<br />
s<strong>in</strong>d für unsere Wirtschaftskraft und den<br />
Standort ländlicher Raum äußerst wichtig. Aufgabe<br />
der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> ist es, Enteignungen zu<br />
vermeiden. Nachteile, die mit der Durchschneidung<br />
von Feld und Flur für die Landwirtschaft wie auch<br />
für die Kulturlandschaft verbunden s<strong>in</strong>d, sollen<br />
gemildert werden. Ich appelliere an die Öffentlichkeit<br />
und <strong>in</strong>sbesondere auch an die Vertreter des Naturschutzes,<br />
die unverzichtbare Arbeit der <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> bei den Unternehmensverfahren als<br />
besonders sozial verträgliche Hilfe zu sehen und<br />
mehr als bisher anzuerkennen.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Ich will nicht versäumen, allen Mitarbeitern, die<br />
bei den sehr schwierigen Unternehmensverfahren<br />
mitgearbeitet haben, für ihre engagierte, bürgernahe<br />
und umsichtige Arbeit zu danken.<br />
Wege der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> zu mehr<br />
Bauland<br />
Von großer Bedeutung für den Wirtschaftsstandort<br />
Deutschland ist derzeit auch der Faktor Baulandmobilisierung.<br />
Bekanntlich fehlen Millionen Wohnungen<br />
<strong>in</strong> unserem Land, zugegebenermaßen vor<br />
allem <strong>in</strong> den Verdichtungsräumen. Aber auch im<br />
ländlichen Raum muß im S<strong>in</strong>ne der Schaffung neuer<br />
Arbeitsplätze und der Versorgung der Bürger entschlossen<br />
gehandelt werden. Wohnungen und<br />
Bauland können vielfach durch Innenverdichtung<br />
und Umnutzung leerstehender landwirtschaftlicher<br />
Gebäude z. B. im Rahmen von Dorferneuerung<br />
geschaffen werden. Aber auch neues, planvoll<br />
geschaffenes Bauland auf der grünen Wiese bleibt<br />
unverzichtbar.<br />
Dies sollte verstärkt e<strong>in</strong>e Aufgabe der <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> se<strong>in</strong>. Immerh<strong>in</strong> wurden <strong>in</strong> den letzten<br />
10 Jahren <strong>in</strong> Neuordnungsverfahren nach dem<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz und bei Umlegungsverfahren,<br />
bei denen die Befugnis zur Durchführung der<br />
Umlegung auf die Direktionen für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> übertragen war, über 7 000 Baugrundstücke<br />
ausgewiesen. Es ist leider immer noch viel zu<br />
wenig bekannt, daß Landwirte von den bodenordnerischen<br />
Wegen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> zum<br />
Bauland besonders profitieren. Sie stehen nicht vor<br />
der Alternative »verkaufen oder behalten«, sondern<br />
können im Zuge der Bodenordnung tauschen und an<br />
anderer Stelle mit landwirtschaftlichen Flächen<br />
abgefunden werden. Gew<strong>in</strong>ner s<strong>in</strong>d die Landwirte<br />
und die baulandsuchende Geme<strong>in</strong>de und Öffentlichkeit.<br />
Den Geme<strong>in</strong>den biete ich ausdrücklich die<br />
Hilfe der Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
an. Möglichkeiten dazu werden dankenswerter<br />
Weise <strong>in</strong> dem neuen Buch »Wege zum Bauland« aufgezeigt,<br />
das der Fraktionsvorsitzende Alois Glück<br />
unter Mitwirkung vieler Experten vor kurzem herausgegeben<br />
hat.<br />
Zukunft des Landes nur durch Stärkung der<br />
Landwirtschaft und Erhaltung der Kulturlandschaft<br />
Vielleicht hat sich schon mancher unter Ihnen<br />
gefragt, ob denn die Aufgaben der Stärkung der<br />
Landwirtschaft und Erhaltung der Kulturlandschaft<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
29
nun schon so nachrangig geworden s<strong>in</strong>d, daß sie gar<br />
nicht mehr an vorderster Stelle erwähnt werden. Ich<br />
kann Sie beruhigen: E<strong>in</strong>e der unverändert wichtigen<br />
Haupt-, ja Zukunftsaufgaben der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
ist und bleibt die Erhaltung und Gestaltung<br />
unserer bäuerlich bewirtschafteten Kulturlandschaft<br />
und damit untrennbar verbunden die Stärkung e<strong>in</strong>er<br />
unternehmerisch orientierten Landwirtschaft. Nirgendwo<br />
als hier im bäuerlich geprägten Westmittelfranken<br />
ist diese Aussage mehr berechtigt.<br />
Heute muß ke<strong>in</strong> Naturschützer mehr e<strong>in</strong>e Ausräumung<br />
der Landschaft befürchten; längst ist die<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung dank ihrer allseits anerkannten<br />
hohen ökologischen Kompetenz und dank e<strong>in</strong>er pionierhaften<br />
Landschaftsplanung zu e<strong>in</strong>er echten<br />
Flurbereicherung geworden. Naturschutz und Landwirtschaft<br />
können sich ke<strong>in</strong>en besseren Partner und<br />
Mittler wünschen, der für den gerechten Ausgleich<br />
der Interessen und bei allen ökologischen Maßnahmen<br />
für die Wahrung der bäuerlichen Interessen<br />
sorgt. Die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> ist e<strong>in</strong> ehrlicher<br />
Makler der Grundstückseigentümer. Diese hohe<br />
Verantwortung bitte ich Sie auch künftig gerecht<br />
wahrzunehmen.<br />
Schnellere Hilfen für die Landwirtschaft<br />
Ich sage es zwar ungern, aber im Interesse von<br />
uns allen muß ich es deutlich aussprechen: Bei der<br />
Wahrnehmung dieser bedeutenden Aufgaben müssen<br />
wir für die nächste Zeit Prioritäten setzen bei der<br />
Annahme und Erledigung neuer Aufträge und Aufgaben.<br />
Hier ist <strong>in</strong> der Vergangenheit wohl aufgrund<br />
des heftigen Drängens verschiedenster Stellen e<strong>in</strong> zu<br />
großer Arbeitsüberhang entstanden. Ihn gilt es nun<br />
konsequent und rasch abzubauen. Wir müssen <strong>in</strong><br />
nächster Zeit deshalb bei der E<strong>in</strong>leitung neuer Regelverfahren<br />
sehr restriktiv vorgehen, sie praktisch<br />
überhaupt nicht mehr anwenden, um wieder flexibler<br />
zu werden und Handlungsspielräume rückzugew<strong>in</strong>nen.<br />
Absolute Priorität haben e<strong>in</strong>fachere<br />
Verfahren mit der Aufgabe der schnellen Hilfe für<br />
unsere bäuerlichen Betriebe und Familien. Es ist e<strong>in</strong><br />
Gebot der Stunde, die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die<br />
Landwirte wirkungsvoll zu verbessern. Die <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> ist hierfür e<strong>in</strong> erprobtes und nach wie<br />
vor hochgeschätztes Instrument. Sie senkt die<br />
Produktionskosten und sorgt dafür, daß die Bauern<br />
weniger Arbeitszeit aufwenden müssen, um die<br />
Felder zu bestellen. Das ist neben dem wirtschaftlichen<br />
auch e<strong>in</strong> sozialer Faktor. Unsere Landwirte<br />
haben extrem hohe Arbeitszeiten.<br />
Ich bitte die Direktionen, auf der Grundlage des<br />
von unserem Hause zusammen mit dem Bayerischen<br />
Bauernverband erarbeiteten Merkblatts jeweils<br />
gründlich zu prüfen, wieweit mehr als bisher e<strong>in</strong>fachere<br />
Verfahren e<strong>in</strong>geleitet werden können. E<strong>in</strong>en<br />
gesetzlichen Etikettenschw<strong>in</strong>del soll es dabei aber<br />
nicht geben.<br />
Gesetzliche Grundlagen ausbauen<br />
E<strong>in</strong>e gewisse Erleichterung wird uns demnächst<br />
hoffentlich e<strong>in</strong>e Änderung des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes<br />
br<strong>in</strong>gen; Bayern hat bereits 1992 die Überarbeitung<br />
des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes zu e<strong>in</strong>em<br />
Landentwicklungsgesetz angeregt.<br />
Darauf b<strong>in</strong> ich im Vorjahr bei der Flurbere<strong>in</strong>igungsrichtertagung<br />
aller Bundesländer <strong>in</strong> Würzburg<br />
ausführlich e<strong>in</strong>gegangen. Ich halte e<strong>in</strong>e Fortentwicklung<br />
des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes <strong>in</strong> Richtung<br />
Landentwicklungsgesetz und e<strong>in</strong>e Erweiterung der<br />
rechtlichen Kompetenzen für Dorferneuerung und<br />
landschaftsgestaltende Maßnahmen für dr<strong>in</strong>gend<br />
erforderlich.<br />
E<strong>in</strong>e Projektgruppe der Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
beschäftigt sich <strong>in</strong>tensiv mit entsprechenden<br />
Vorschlägen. Zunächst ist aber e<strong>in</strong>e Novellierung<br />
des § 86 FlurbG das Ziel, um e<strong>in</strong>fachere Verfahren<br />
wirkungsvoller e<strong>in</strong>setzen zu können. E<strong>in</strong>e entsprechende<br />
Gesetzes<strong>in</strong>itiative wurde mit Unterstützung<br />
Bayerns im Bundesrat e<strong>in</strong>gebracht.<br />
Bisher gelten ja die Vere<strong>in</strong>fachungen des § 86 nur<br />
für e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>geschränkte Zielsetzung. Die Anwendungsmöglichkeiten<br />
sollen nun den geänderten<br />
strukturellen und gesellschaftlichen Anforderungen<br />
entsprechend auf allgeme<strong>in</strong>e Maßnahmen der<br />
Landentwicklung erweitert werden.<br />
Stichwort »e<strong>in</strong>facher und schneller«: Ich bitte<br />
Sie e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>glich, <strong>in</strong> allen Bereichen Ihrer Verwaltung<br />
den Planungsaufwand zu überdenken. Ich weiß, daß<br />
uns hierbei nicht nur gesetzliche, sondern auch<br />
gesellschaftliche Schranken gesetzt s<strong>in</strong>d. Wir wollen<br />
ke<strong>in</strong>en planerischen Kahlschlag. Gebot der Stunde<br />
s<strong>in</strong>d aber mögliche Entschlackungen und Verschlankungen.<br />
Zur Zukunft der Verwaltung<br />
Dieses notwendige und vernünftige Maß an<br />
Deregulierung und Entstaatlichung gilt auch für den<br />
Bereich, den ich abschließend ansprechen möchte.<br />
Nämlich den Bereich Reform der Bayerischen<br />
Verwaltung, Zukunft des öffentlichen Dienstes.<br />
30 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Dazu gibt und gab es ja <strong>in</strong> der letzten Zeit e<strong>in</strong>e<br />
Reihe von Aktivitäten. Ich nenne<br />
— den Bericht »Zukunft des öffentlichen Dienstes«<br />
der sog. Badura-Kommission,<br />
— die »Projektgruppe Verwaltungsreform« an der<br />
Staatskanzlei unter der politischen Leitung des<br />
Innenm<strong>in</strong>isters,<br />
— die Personale<strong>in</strong>sparungen nach Art. 6 a des<br />
Haushaltsgesetzes, von denen unser Haus, hierbei<br />
auch Ihre Verwaltung überproportional berührt<br />
s<strong>in</strong>d,<br />
— die derzeit laufende Untersuchung Ihrer Verwaltung<br />
durch e<strong>in</strong>en Unternehmensberater<br />
aufgrund e<strong>in</strong>es M<strong>in</strong>isterratsbeschlusses von<br />
1993. Ich möchte dem, was Herr Abgeordneter<br />
Dr. Eykmann zu Unternehmensberatern gesagt<br />
hat, nichts h<strong>in</strong>zufügen. Aus me<strong>in</strong>en eigenen<br />
Beobachtungen kann ich das nur voll unterstreichen<br />
und habe manchmal e<strong>in</strong> bißchen das Gefühl,<br />
daß mich das Geld reut, daß <strong>in</strong> diesem<br />
Zusammenhang ausgegeben wird.<br />
Ich habe Verständnis für die Sorgen, die Herr<br />
Strößner zum Ausdruck gebracht hat, und auch<br />
Verständnis für die Verunsicherung, die all das bei<br />
Ihnen bewirkt hat.<br />
Dazu möchte und kann ich heute nur sagen: Die<br />
Staatsregierung kann me<strong>in</strong>es Erachtens auf das<br />
hochwirksame Instrument <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
und damit auch auf die gleichnamige Verwaltung<br />
nicht verzichten. Kollege Dr. Eykmann hat soeben<br />
signalisiert, daß die Landtagsfraktion der CSU ähnlich<br />
denkt. Ich habe me<strong>in</strong>e klare Auffassung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em<br />
Schreiben an den Herrn M<strong>in</strong>isterpräsidenten dargelegt<br />
und gleichzeitig darauf verwiesen, daß die<br />
Bayerische Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong><br />
vielen Bereichen den Grundsätzen e<strong>in</strong>er modernen<br />
und effizienten Verwaltung entspricht. Um es klar zu<br />
sagen; ich b<strong>in</strong> e<strong>in</strong>deutig gegen die Zerschlagung und<br />
die Auflösung der Direktionen für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>.<br />
Die Gründe dafür hat Ihnen Herr Dr. Eykmann<br />
e<strong>in</strong>drucksvoll geschildert. Ich muß dem nichts h<strong>in</strong>zufügen;<br />
es ist genauso me<strong>in</strong>e Überzeugung.<br />
Gewisse Potentiale zur Vere<strong>in</strong>fachung und<br />
Straffung bestehen gleichwohl. Das Ziel e<strong>in</strong>er »lean<br />
adm<strong>in</strong>istration« muß uns allen geme<strong>in</strong>sam se<strong>in</strong>.<br />
Dafür bitte ich um Ihr Verständnis und Ihre Unterstützung.<br />
Es darf aber nicht soweit gehen, daß es<br />
zum Kahlschlag beim Personal, zur Auflösung der<br />
Direktionen oder zur vollständigen Privatisierung<br />
Ihrer Aufgaben kommt. Ich werde mich solchen<br />
Bestrebungen entschlossen entgegenstellen. Die vor-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
h<strong>in</strong> erwähnte Untersuchung der Unternehmensberatung<br />
soll <strong>in</strong> Kürze abgeschlossen se<strong>in</strong>; die Ergebnisse<br />
des Gutachtens werden wir dann auf allen<br />
Ebenen diskutieren müssen.<br />
Davon unabhängig zw<strong>in</strong>gt uns bereits jetzt schon<br />
der Art. 6 a Haushaltsgesetz zum Abbau von Personal.<br />
Ich weiß, daß dieser Abbau maßvoll erfolgen<br />
muß, weil er durch Vere<strong>in</strong>fachungen <strong>in</strong> Verwaltungsund<br />
Verfahrensabläufen nur begrenzt aufgefangen<br />
werden kann.<br />
Das Badura-Gutachten hat bereits e<strong>in</strong>e breite<br />
Welle der Unterstützung für Ihre Verwaltung ausgelöst.<br />
Der Bayerische Geme<strong>in</strong>detag hat sich e<strong>in</strong>stimmig<br />
gegen e<strong>in</strong>e Auflösung der Direktionen<br />
gewandt und die große Hilfe der Verwaltung für die<br />
<strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Geme<strong>in</strong>den betont. Für<br />
diese Unterstützung danke ich dem Bayerischen<br />
Geme<strong>in</strong>detag ebenso ausdrücklich wie allen anderen<br />
Stellen, die ihre Sympathie bekundet haben.<br />
Gleichwohl bitte ich Sie alle erneut um die<br />
Unterstützung bei dem politisch schwierigen Weg<br />
der Reform der Verwaltung und des öffentlichen<br />
Dienstes. An dieser Reform geht ke<strong>in</strong> Weg vorbei<br />
und das muß auch <strong>in</strong> Ihrem Interesse liegen. Ich<br />
kann Ihnen versichern: Ich werde dafür sorgen, daß<br />
trotz notwendigen Stellene<strong>in</strong>sparungen e<strong>in</strong> kont<strong>in</strong>uierlicher<br />
und organischer Personalaufbau auch mit<br />
E<strong>in</strong>stellungschancen gewährleistet bleibt.<br />
Nach den ersten Entwürfen zur Personale<strong>in</strong>sparung<br />
sollten <strong>in</strong> diesem Jahr überhaupt ke<strong>in</strong>e Berufsanfänger<br />
e<strong>in</strong>gestellt werden. Der M<strong>in</strong>isterpräsident<br />
hat dies nicht gebilligt. Daraufh<strong>in</strong> wurden maßvolle<br />
Neue<strong>in</strong>stellungen ermöglicht. So können nun junge<br />
Menschen nach ihrer Ausbildung e<strong>in</strong>en Arbeitsplatz<br />
f<strong>in</strong>den. Entscheidend daran ist, daß damit Vertrauen<br />
<strong>in</strong> die Politik und Zukunft geschaffen wird.<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> Bayern — Beispiel<br />
<strong>in</strong> Europa<br />
Ich fasse zusammen: Mit Genugtuung sehe ich,<br />
daß wir mit unserem Verständnis der <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> europaweit nicht nur im Trend liegen,<br />
sondern Vielen sogar als Beispiel dienen. Vertreter<br />
der Europäischen Kommission geben immer wieder<br />
zu erkennen, daß sie unsere Maßnahmen der<br />
Dorfentwicklung und Flurgestaltung als impulsgebend<br />
für die neue europäische Strukturpolitik erachten.<br />
Insbesondere die Reformstaaten, vor allem<br />
Polen, die Tschechische Republik, die Slowakische<br />
Republik, Ungarn, Kroatien und Slowenien erwarten<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
31
sich von bayerischen Experten Hilfe bei der Erhaltung<br />
und Gestaltung ihrer ländlichen Räume. Ich<br />
freue mich, daß e<strong>in</strong>e ganze Reihe hochrangiger<br />
Vertreter dieser Länder heute unter uns weilt.<br />
E<strong>in</strong> Instrument, das <strong>in</strong> Europa und darüber h<strong>in</strong>aus<br />
Vorbildcharakter hat, hat Zukunft. Wer e<strong>in</strong>e Zukunft<br />
für sich sieht, ist optimistisch und mobilisiert Kräfte<br />
und Energie zur Bewältigung der anstehenden<br />
Herausforderungen. Darum bitte ich Sie, me<strong>in</strong>e sehr<br />
geehrten Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter: Erhalten<br />
Sie sich Ihr außerordentliches Engagement, das Sie<br />
dankenswerter Weise bisher bei der Erfüllung Ihrer<br />
Dienstaufgaben zeigen. Ich appelliere an Sie, trotz<br />
allen Belastungen, die auf Sie und uns zukommen<br />
werden, auch künftig die gestellten Aufgaben mit<br />
Freude und Zuversicht zu erfüllen.<br />
Wenn Sie erfolgreich s<strong>in</strong>d, werden es <strong>in</strong> kurzer<br />
Zeit auch die ländlichen Räume und unsere Partner<br />
im europäischen Osten se<strong>in</strong>. Dies wiederum liegt<br />
nicht nur im Interesse der Idee der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong>,<br />
sondern im Interesse von uns allen, von<br />
Bayern, Deutschland und Europa.<br />
Lassen Sie mich am Schluß me<strong>in</strong>er Ausführungen<br />
noch e<strong>in</strong>en ganz besonderen Dank anfügen. Die<br />
Leistungen der Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
können sich sehen lassen. So e<strong>in</strong>e Leistung<br />
braucht natürlich auch e<strong>in</strong>e gute Führung über all<br />
die Jahre h<strong>in</strong>weg. M<strong>in</strong>isterialdirigent Günther<br />
Strößner hat mit se<strong>in</strong>er souveränen und kompetenten<br />
Leitung der Bayerischen Verwaltung für<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> viel zum Erfolg der Flurentwicklung<br />
und Dorferneuerung <strong>in</strong> Bayern beigetragen.<br />
Dafür möchte ich ihm an dieser Stelle den ausdrücklichen<br />
Dank der Bayerischen Staatsregierung aussprechen.<br />
Die Erfolge, die die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>in</strong> Bayern vorweisen kann, s<strong>in</strong>d sicherlich der größte<br />
Dank für Sie!<br />
32 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Podiums- und Plenumsdiskussion<br />
Leitung: Dr. Gertrud Helm<br />
Überraschende Harmonie zwischen dem Präsidenten des Bayerischen Städtetages Oberbürgermeister Josef Deimer, MdS<br />
und den Vertretern des ländlichen Raumes: Die Städte brauchen e<strong>in</strong>en gesunden ländlichen Raum. Es gilt aber auch<br />
umgekehrt: die Dörfer s<strong>in</strong>d auf starke zentrale Orte und Städte angewiesen. Deshalb gilt die Devise: <strong>Stadt</strong> und Land —<br />
Hand <strong>in</strong> Hand. Bei der Realisierung dieses partnerschaftlichen Gebens und Nehmens ist das Instrumentarium der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> hoch willkommen.<br />
Im Bild (v. l.) Präsident Deimer, MdS, BBV-Präsident Sonnleitner, MdS, Dr. Gertrud Helm, Staatsm<strong>in</strong>ister Bocklet, Präsident<br />
Thallmair, MdS, BUND-Vorsitzender We<strong>in</strong>zierl.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
33
Empfang der Bayerischen Staatsregierung<br />
Marianne Deml<br />
Grußwort<br />
Me<strong>in</strong>e sehr geehrten Damen und Herren!<br />
Im Namen der Bayerischen Staatsregierung und<br />
auch persönlich heiße ich Sie beim Staatsempfang<br />
im Prunksaal der Residenz <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong> herzlich willkommen.<br />
Ich überbr<strong>in</strong>ge Ihnen die Grüße unseres<br />
M<strong>in</strong>isterpräsidenten Dr. Edmund Stoiber, der Ihnen<br />
als Schirmherr dieser Veranstaltung angenehme<br />
Stunden, fruchtbare Gespräche und der <strong>Fachtagung</strong><br />
e<strong>in</strong>en erfolgreichen Verlauf wünscht.<br />
Liebe Gäste, versetzen Sie sich doch bitte e<strong>in</strong>mal<br />
mit mir weit <strong>in</strong> die Vergangenheit zurück, <strong>in</strong> die Zeit<br />
des höfischen Rokoko und stellen Sie sich vor, Sie<br />
haben als e<strong>in</strong>facher Bürger e<strong>in</strong>e Audienz hier am<br />
Hofe Markgraf Carl Wilhelm Friedrichs, im volksmund<br />
der »Wilde Markgraf« genannt.<br />
Begleitet von zwei livrierten Dienern schreiten Sie<br />
durch die elegante Pracht der markgräflichen<br />
Residenz, durch stuckverzierte Räume, vorbei an den<br />
2 800 bemalten Fliesen des Kachelsaales. Sie gelangen<br />
vom edelgetäfelten Braunen Kab<strong>in</strong>ett <strong>in</strong>s<br />
Marmorkab<strong>in</strong>ett und schließlich <strong>in</strong> das glitzernde<br />
Spiegelkab<strong>in</strong>ett der Markgräf<strong>in</strong> Friederike Louise,<br />
übrigens e<strong>in</strong>e Schwester Friedrichs des Großen.<br />
Dann öffnet sich die Tür zum prächtigen Audienzzimmer<br />
des Markgrafen. Ehrfürchtig treten Sie<br />
näher; und wenn Sie Ihr Anliegen dann vor Aufregung<br />
nocht nicht vergessen haben, beg<strong>in</strong>nen Sie mit<br />
»Euer hochfürstliche Durchlaucht . . .«.<br />
Empfang der Bayerischen Staatsregierung<br />
im Prunksaal der markgräflichen Residenz <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong><br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Nun, zweie<strong>in</strong>halb Jahrhunderte später, verlaufen<br />
die Gespräche zwischen dem Bürger und der staatlichen<br />
Repräsentanz etwas anders. Und das ist natürlich<br />
auch gut so. Der richtige Umgang mit dem<br />
Bürger verlangt heute auf staatlicher Seite ungleich<br />
mehr persönliches Engagement als früher. Die<br />
Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>, an deren<br />
<strong>Fachtagung</strong> Sie teilnehmen, hat sich me<strong>in</strong>es Erachtens<br />
gut auf diese Anforderungen e<strong>in</strong>gestellt und ist<br />
heute zu Recht stolz auf ihre <strong>Entwicklung</strong>, von e<strong>in</strong>er<br />
Hoheitsverwaltung h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er Dienstleistungsverwaltung<br />
für alle Bürger im ländlichen Raum.<br />
Die Arbeit der Verwaltung zusammen mit den<br />
Bürgern hat sich längst vom Anhören über das<br />
Mitreden und Mitwirken h<strong>in</strong> zum Mitbestimmen entwickelt,<br />
also zu e<strong>in</strong>er aktiven Partizipation der Bürger<br />
an Planung und Umsetzung<br />
In der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, als diese<br />
wunderbare Residenz durch die Architekten Gabrieli,<br />
Zocha und Retti ihre heutige Gestalt erhielt, lagen<br />
die Geschicke der <strong>Stadt</strong> und des Umlandes ausschließlich<br />
<strong>in</strong> der Hand des Markgrafen. Bürger und<br />
Bauern waren Untertanen. Ihr Schicksal war auf das<br />
engste mit dem des Herrschers verbunden. E<strong>in</strong>e <strong>Entwicklung</strong><br />
abseits des Regierungssitzes fand praktisch<br />
nicht statt, und die Menschen waren schon froh,<br />
wenn ihre kärgliche Habe nicht geplündert oder gebrandschatzt<br />
wurde.<br />
Noch heute haben die ländlichen Gebiete ihre<br />
Probleme, auch wenn diese nicht mehr unmittelbar<br />
lebensbedrohend s<strong>in</strong>d. Der Strukturwandel br<strong>in</strong>gt <strong>in</strong><br />
vielen europäischen Regionen erneut das Problem<br />
der Überalterung und der Entvölkerung. Probleme,<br />
die mittlerweile fast allen europäischen Regionen<br />
geme<strong>in</strong>sam s<strong>in</strong>d und die wir auch <strong>in</strong> bayerischen<br />
Landkreisen hatten und zum Teil auch noch haben.<br />
Die bayerische Politik für den ländlichen Raum trägt<br />
aber bereits Früchte. Der ländliche Raum hat <strong>in</strong> der<br />
Attraktivität mit den Verdichtungsräumen bereits<br />
gleichgezogen; abgesehen von e<strong>in</strong>em Nachholbedarf<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>igen wenigen Landkreisen.<br />
In allen Regierungsbezirken Bayerns können wir<br />
mittlerweile Bevölkerungszunahmen verzeichnen,<br />
auch wenn es noch »regionale Sorgenk<strong>in</strong>der«, wie<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
35
z. B. die Landkreise Wunsiedel, Hof und Kronach im<br />
nördlichen Oberfranken gibt. In anderen Landkreisen<br />
früherer Problemgebiete wie z. B. <strong>in</strong> Schwandorf und<br />
Cham hat die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> bereits dazu<br />
beigetragen, den Trend <strong>in</strong>s Positive umzukehren. Wir<br />
brauchen aber <strong>in</strong> allen Regionen lebens- und leistungsfähige<br />
ländliche Räume, nicht nur für die dort<br />
lebenden Bürger, sondern auch als Ausgleichs- und<br />
Erholungsraum für die Städter. Und so ist es geradezu<br />
selbstverständlich, daß sich die Europäische<br />
Union zu e<strong>in</strong>er neuen geme<strong>in</strong>schaftlichen Strukturpolitik<br />
zur Förderung und <strong>Entwicklung</strong> des ländlichen<br />
Raumes entschloß. Mittlerweile fördert die<br />
Europäische Union mit erheblichem Mittele<strong>in</strong>satz die<br />
ländlichen Regionen Europas. Mit f<strong>in</strong>anziellen<br />
Mitteln alle<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d die Schwierigkeiten aber nicht zu<br />
meistern. Notwendig s<strong>in</strong>d vor allem Perspektiven,<br />
d. h. e<strong>in</strong>e Vorstellung davon, wie die großen Aufgaben<br />
gemeistert und die Zeit des Umbruchs für die<br />
Zukunft gestaltet werden können. Denken wir nur<br />
daran, daß <strong>in</strong> Europa von den 45 Mio. Jugendlichen<br />
im Alter zwischen 15 und 25 Jahren nur 18 Mio.<br />
e<strong>in</strong>en Arbeitsplatz haben!<br />
Mit der Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> hat<br />
Bayern e<strong>in</strong> leistungsfähiges Instrument, um die politischen<br />
Initiativen zur Stärkung des ländlichen<br />
Raumes auch wirksam werden zu lassen und die<br />
Bürger anzuleiten, ihre Geschicke selbst <strong>in</strong> die Hand<br />
zu nehmen und eigene Zukunftsperspektiven zu entwickeln.<br />
Der Physiker und Philosoph Carl Friedrich von<br />
Weizsäcker fordert <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Buch »Die Zeit drängt«<br />
e<strong>in</strong>e Weltversammlung aller Gutges<strong>in</strong>nten zur<br />
Lösung der drängendsten Probleme unserer Zeit. Er<br />
verlangt länderübergreifend geme<strong>in</strong>sames Nachdenken<br />
und Handeln und mahnt die Teilnehmer an der<br />
Versammlung »zur Bereitschaft zum Gespräch, zum<br />
Zuhören, zum vernünftigen Kompromiß und zur<br />
selbstkritischen Vernunft«. Weizsäcker regte an, diese<br />
Versammlung »convocatio« zu nennen, das bedeutet<br />
»Zusammenruf«, denn es geht um e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same<br />
Sache. In diesem S<strong>in</strong>ne freue ich mich sehr, daß wir<br />
zu dieser Tagung hohe und höchste Vertreter von<br />
Politik, Wissenschaft und Verwaltung aus 18 Ländern<br />
begrüßen können; Gäste nicht nur aus der Europäischen<br />
Union und ihren Nachbarstaaten. Sogar aus<br />
der Volksrepublik Ch<strong>in</strong>a und aus Taiwan s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>teressierte<br />
Repräsentaten erschienen.<br />
Über das große Interesse an dieser Veranstaltung<br />
kann man spekulieren:<br />
— Zum e<strong>in</strong>en mag für Sie der besondere bayerische<br />
Weg von Interesse se<strong>in</strong>; mit dem Genossen-<br />
schaftspr<strong>in</strong>zip, der Bürgerpartizipation und der<br />
geme<strong>in</strong>samen Erarbeitung von Zukunftsperspektiven.<br />
— Zum anderen ist vielleicht auch der Vorsatz der<br />
Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong>teressant,<br />
sich mit ihrem Angebot, ihrer Dienstleistung<br />
sozusagen »am Markt« zu orientieren, d. h. eng an<br />
den Bedürfnissen ihrer »Kunden«. Das mag für<br />
das Selbstverständnis e<strong>in</strong>er staatlichen Verwaltung<br />
etwas neues, etwas ungewöhnliches se<strong>in</strong>;<br />
führt jedoch gleichwohl zu hoher Effizenz, zu<br />
großer Akzeptanz und Nachfrage.<br />
— Vor allem aber erkennen wir wohl, daß geme<strong>in</strong>same<br />
Probleme am besten auch geme<strong>in</strong>sam zu<br />
lösen s<strong>in</strong>d.<br />
Liebe ausländische Gäste!<br />
Mit den meisten von Ihnen pflegen wir seit Jahren<br />
<strong>in</strong>tensive und für beide Seiten gew<strong>in</strong>nbr<strong>in</strong>gende<br />
Beziehungen. Wir wollen aber unsere Erfahrungen<br />
und Kenntnisse <strong>in</strong> der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong><br />
Dorf und Flur während dieser Tage nicht nur weitergeben,<br />
sondern sie mit ihren eigenen auch zu unserem<br />
Nutzen vorteilhaft austauschen.<br />
Dies hier <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong> ist zwar ke<strong>in</strong>e Weltversammlung,<br />
aber e<strong>in</strong>e Versammlung vieler gutges<strong>in</strong>nter<br />
Europäer und dies bietet sicherliche e<strong>in</strong>e Chance,<br />
nicht nur e<strong>in</strong>e der üblichen Tagungen abzuhalten,<br />
sondern im S<strong>in</strong>ne von Carl Friedrich von Weizsäcker<br />
e<strong>in</strong>e echte »convocatio« zu den Problemen im ländlichen<br />
Raum.<br />
Me<strong>in</strong>e Damen und Herren, die <strong>Stadt</strong> <strong>Ansbach</strong> ist<br />
die <strong>Stadt</strong> des fränkischen Rokoko. Sie ist wegen ihrer<br />
Schönheit viel gerühmt. Und diese Schönheit verdankt<br />
sie übrigens auch e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>ternationalen<br />
Ensemble. Maler, Bildhauer, Stukkateure vor allem<br />
aus Italien und Frankreich verhalfen <strong>Ansbach</strong> zu se<strong>in</strong>em<br />
zauberhaften Charme. Und natürlich: Was wäre<br />
<strong>Ansbach</strong> ohne se<strong>in</strong>e Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>?<br />
Genießen Sie also <strong>in</strong> den nächsten Tagen nicht<br />
nur Fachliches, sondern auch die Schönheiten dieser<br />
<strong>Stadt</strong> und ihre Lebensart.<br />
Ich wünsche Ihnen anregende Gespräche <strong>in</strong> angenehmer<br />
Atmosphäre und ihrer »convocatio« e<strong>in</strong>en<br />
erfolgreichen Verlauf.<br />
36 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Teobald Belec<br />
Dank der Gäste<br />
Mir wird die angenehme Pflicht zuteil, beim<br />
Staatsempfang stellvertretend für die hier Anwesenden<br />
und auch für alle <strong>in</strong>- und ausländischen Gäste<br />
der <strong>Fachtagung</strong> zu den Veranstaltern sprechen zu<br />
können. Ich komme dieser Aufgabe mit großer<br />
Freude nach. Die <strong>Fachtagung</strong>en der Bayerischen<br />
Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> waren und<br />
s<strong>in</strong>d für uns alle immer wieder e<strong>in</strong> weiteres Erlebnis.<br />
Bei weitem fühle ich mich hier nicht <strong>in</strong> der Lage,<br />
schwerwiegende Urteile abzugeben. Doch mit<br />
Sicherheit kann ich feststellen, daß die <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> längst ke<strong>in</strong>e Alternative für den ländlichen<br />
Raum mehr ist; sie ist zur unumgänglichen<br />
Notwendigkeit aller europäischen Staaten geworden.<br />
An dieser <strong>Entwicklung</strong> ist dem Bayerischen Staatsm<strong>in</strong>isterium<br />
für Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Forsten und deren Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
e<strong>in</strong> großer Verdienst zuzuschreiben. So soll<br />
es auch nicht als unüberlegte Behauptung e<strong>in</strong>gestuft<br />
werden, wenn ich feststelle, daß Bayern e<strong>in</strong> Vorbild<br />
ist, wie <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> praktisch und politisch<br />
ausgestaltet werden kann, damit sie erfolgreich<br />
ist. Allen Damen und Herren, die die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>in</strong> Bayern personifizieren, sei unser aller<br />
Dank für diese Pionierleistungen und ihre harte<br />
Arbeit ausgesprochen.<br />
Nur mit Interesse — nicht mit Besorgnis — nehme<br />
ich das gegenwärtige Geschehen um die Bayerische<br />
Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> zur Kenntnis.<br />
Herr Staatsm<strong>in</strong>ister Bocklet und Herr M<strong>in</strong>isterialdirigent<br />
Strößner sprachen heute Vormittag <strong>in</strong> ihren<br />
Reden bei der Eröffnungsveranstaltung von möglichen<br />
Schwierigkeiten verwaltungswirtschaftlichen<br />
Ursprungs. In diesem Zusammenhang muß ich auf<br />
die führende Rolle Bayerns auf dem Gebiet der <strong>in</strong>tegralen<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> h<strong>in</strong>weisen, die den<br />
ehemaligen sozialistischen, jetzt freien und demokratischen<br />
Staaten, nicht entzogen werden darf.<br />
Me<strong>in</strong>e bisherigen Äußerungen s<strong>in</strong>d Grund genug,<br />
um etwaige Änderungen <strong>in</strong> unserem Musterstaat<br />
Bayern mit doppelter Aufmerksamkeit anzugehen.<br />
Me<strong>in</strong> Land — ich komme aus Slowenien — weiß<br />
die Vorteile aus der guten Zusammenarbeit mit<br />
Bayern voll zu schätzen. Denn auf dem geme<strong>in</strong>sam<br />
gefurchten Acker bleibt uns nur noch die Saat und<br />
die Ernte, unsere Anerkennung und unser Dank.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Die heurige <strong>Fachtagung</strong> steht unter dem Motto<br />
»<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong> <strong>Stadt</strong> und Land«. Es soll<br />
nicht als übertrieben betrachtet werden, wenn sie<br />
nach me<strong>in</strong>er bescheidenen Me<strong>in</strong>ung auch so kl<strong>in</strong>gen<br />
könnte: »<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong> der Menschheit«.<br />
Ich weiß, die bayerischen Kollegen halten die<br />
Grenze der Realität. Dennoch wage ich auch <strong>in</strong> diesem<br />
festlichen Moment die Äußerung, im S<strong>in</strong>ne me<strong>in</strong>es<br />
Freundes Holger Magel, e<strong>in</strong> realer Sp<strong>in</strong>ner zu<br />
se<strong>in</strong>.<br />
Den unermüdlichen Schöpfern auf dem Gebiet der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> der Bayerischen Verwaltung<br />
für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> gebührt unsere<br />
höchste Anerkennung für die geleistete erfolgreiche<br />
Arbeit <strong>in</strong> der Vergangenheit und <strong>in</strong> der Gegenwart.<br />
E<strong>in</strong> schlichtes »Danke«, das aus dem Herz kommt, soll<br />
symbolische Belohnung se<strong>in</strong>.<br />
Zum Abschluß: Wir wünschen auch diesmal unseren<br />
Gastgebern nicht mehr und nicht weniger als<br />
das, daß die heurige <strong>Fachtagung</strong> den gleichen Erfolg<br />
hat, wie alle bisherigen.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
37
Schlußveranstaltung<br />
Johann Huber<br />
Bericht über den Arbeitskreis 1:<br />
Möglichkeiten und Grenzen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
Bemerkenswert war das große Interesse der<br />
Tagungsteilnehmer, vor allem der ausländischen<br />
Gäste an diesem Thema. Im Arbeitskreis waren<br />
immerh<strong>in</strong> mehr als 150 Tagungsteilnehmer.<br />
Unsere Gesellschaft bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Phase<br />
grundlegender Neuorientierung. Die dadurch bed<strong>in</strong>gten<br />
vielfältigen Veränderungen wirken sich auch auf<br />
die ländlichen Räume und die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
aus. Unsere Verwaltung ist daher gefordert, Veränderungen<br />
frühzeitig wahrzunehmen und situationsgerecht<br />
darauf zu reagieren. Sie sollte daher<br />
genau wissen, welche Bedürfnisse die ländlichen<br />
Räume haben. Nur dann kann die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>Stadt</strong> und Land dienen und ihre Möglichkeiten<br />
ausschöpfen.<br />
Vor diesem H<strong>in</strong>tergrund referierte im Arbeitskreis<br />
zunächst Dr. Balthasar Huber von der Europäischen<br />
Kommission aus Brüssel. Dr. Huber skizzierte die<br />
Zukunft der ländlichen Räume und zeichnete e<strong>in</strong> Bild<br />
der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> aus der Sicht der Europäischen<br />
Kommission. Dr. Huber sieht e<strong>in</strong>en strukturellen<br />
Handlungsbedarf für die seit Jahrhunderten<br />
gewachsenen Kulturlandschaften <strong>in</strong> Europa. Im<br />
Vertrag von Maastricht werde erstmals auf die<br />
Notwendigkeit h<strong>in</strong>gewiesen, den unterschiedlichen<br />
<strong>Entwicklung</strong>sstand ländlicher und urbaner Zonen zu<br />
verr<strong>in</strong>gern. Diese Aufgabe solle durch den <strong>in</strong>tegrierten<br />
E<strong>in</strong>satz der drei Strukturfonds der Europäischen<br />
Union gemeistert werden. Ziel sei es, das regionale<br />
und lokale <strong>Entwicklung</strong>spotential optimal zur<br />
Entfaltung zu br<strong>in</strong>gen. Hierbei werde e<strong>in</strong>er<br />
<strong>Entwicklung</strong> von unten nach oben und e<strong>in</strong>er Beteiligung<br />
aller relevanten Wirtschafts- und Gesellschaftsgruppen<br />
große Bedeutung beigemessen. Die<br />
Kommission stelle zur <strong>in</strong>tegrierten <strong>Entwicklung</strong> der<br />
ländlichen Räume e<strong>in</strong> sehr flexibles Förder<strong>in</strong>strument<br />
zur Verfügung, das dem Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zip entspreche<br />
und den Regionen den notwendigen Entscheidungsspielraum<br />
belasse, den sie nutzen können.<br />
Dr. Karl-Friedrich Thöne vom Bundesm<strong>in</strong>isterium<br />
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aus Bonn<br />
referierte zum Thema: »<strong>Ländliche</strong>r Raum von morgen<br />
— Möglichkeiten und Grenzen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong>«.<br />
Dr. Thöne g<strong>in</strong>g dabei e<strong>in</strong> auf Aspekte<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
ländlicher <strong>Entwicklung</strong>, die unsere Verwaltung mit<br />
ihrem Gestaltungs<strong>in</strong>strumentarium bee<strong>in</strong>flussen<br />
kann.<br />
Dr. Thöne sieht die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> als<br />
Steuerungs<strong>in</strong>strument der Agrarstruktur. Wobei der<br />
Begriff Agrarstruktur unmittelbar verknüpft sei mit<br />
der Gesamtentwicklung ländlicher Räume. E<strong>in</strong>e<br />
Neudef<strong>in</strong>ition des Begriffes Agrarstruktur sei<br />
dr<strong>in</strong>gend erforderlich. <strong>Ländliche</strong> Räume müßten als<br />
Ganzes gesehen werden. Als geeignete Instrumente<br />
zur Umsetzung e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegralen Landentwicklung<br />
sieht Dr. Thöne e<strong>in</strong>e neu konzipierte agrarstrukurelle<br />
Vorplanung und die Verfahren nach dem Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz<br />
zur Flur- und Dorfentwicklung.<br />
Im H<strong>in</strong>blick auf Vere<strong>in</strong>fachungs- und Beschleunigungseffekte<br />
soll § 86 Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz<br />
geändert und e<strong>in</strong> vere<strong>in</strong>fachtes Verfahren zur<br />
Landentwicklung ausgestaltet werden. Um dem<br />
Vorwurf, die Verfahren dauern zu lange, den Boden<br />
zu entziehen, müsse die Verwaltung den Mut zur<br />
Beschränkung haben und den Ordnungsauftrag auf<br />
wichtige Ziele beschränken trotz des Bemühens um<br />
Ganzheitlichkeit.<br />
Dr. Huber und Dr. Thöne steckten mit ihren<br />
Referaten den Rahmen für die Diskussion im<br />
Anschluß an die Vorträge und am Nachmittag ab.<br />
Parallel zur Diskussion am Nachmittag gaben die<br />
Arbeitskreisteilnehmer <strong>in</strong> schriftlicher Form Antworten<br />
auf die Frage: »Welche Möglichkeiten und<br />
Grenzen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> sehen Sie?«<br />
Möglichkeiten<br />
Die Arbeitskreisteilnehmer sehen <strong>in</strong>sbesondere<br />
Möglichkeiten <strong>in</strong><br />
— der Förderung der wirtschaftlichen Tätigkeit <strong>in</strong><br />
den ländlichen Räumen mit dem Ziel, die lokale<br />
Wertschöpfung zu steigern,<br />
— e<strong>in</strong>er Dienstleistung für alle Bürger im ländlichen<br />
Raum,<br />
— der Erfahrung unserer Verwaltung bei der<br />
Auflösung von Nutzungskonflikten,<br />
Schlußveranstaltung<br />
39
— e<strong>in</strong>er eigenständig verfolgten Landschaftsentwicklung<br />
e<strong>in</strong>schließlich e<strong>in</strong>er umweltverträglichen<br />
Landbewirtschaftung,<br />
— e<strong>in</strong>er ganzheitlichen Dorfentwicklung,<br />
— der Gestaltung des ländlichen Umfeldes durch<br />
Bodenordnung und<br />
— der verstärkten Nutzung des Förder<strong>in</strong>strumentariums<br />
der Europäischen Union.<br />
Grenzen<br />
Die Arbeitskreisteilnehmer sehen Grenzen vor<br />
allem<br />
— <strong>in</strong> der Kompetenzvielfalt im ländlichen Raum,<br />
— die Komplexität der Thematik,<br />
— im Planungsaufwand,<br />
— <strong>in</strong> den Verfahrenslaufzeiten und<br />
— <strong>in</strong> der F<strong>in</strong>anzierung.<br />
Im Arbeitskreis wurde deutlich, daß die Möglichkeiten<br />
der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> gleichzeitig auch<br />
Grenzen be<strong>in</strong>halten und aus Grenzen auch Möglichkeiten<br />
werden können. Hubert We<strong>in</strong>zierl gab hierzu<br />
am Montag e<strong>in</strong> Beispiel: Weniger Geld könne mehr<br />
Kreativität bedeuten. Ich komme zum Schluß.<br />
Fazit<br />
Die <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume ist e<strong>in</strong><br />
bedeutendes gesellschaftspolitisches Thema, das wir<br />
— wie Dr. Thöne formulierte — durchaus an die<br />
Diskussion um den vielbeschworenen Wirtschaftsstandort<br />
Deutschland anhängen sollten.<br />
Wir arbeiten an der <strong>Entwicklung</strong> und Gestaltung<br />
ländlicher Räume. Das ist e<strong>in</strong>e reizvolle Aufgabe.<br />
Trotz aller augenblicklichen Widrigkeiten und negativen<br />
Nachrichten me<strong>in</strong>e ich: Es lohnt sich für die<br />
Zukunft der ländlichen Räume zu arbeiten und sich<br />
für die dort lebenden Menschen zu engagieren.<br />
40 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Robert Bromma<br />
Bericht über den Arbeitskreis 2:<br />
Sicherung und Ausbau regionaler Infrastruktur<br />
Ich habe mir erlaubt, dem Thema den Halbsatz<br />
»mit Hilfe von Geld, Arbeit und Menschen« h<strong>in</strong>zuzufügen,<br />
um den ausgewählten Teilaspekt klarer zu<br />
beschreiben.<br />
»Infrastruktur« wurde im Arbeitskreis nicht nur im<br />
klassischen S<strong>in</strong>ne def<strong>in</strong>iert, wie etwa Verkehrsverhältnisse,<br />
Ver- und Entsorgungsanlagen oder E<strong>in</strong>richtungen<br />
zur Dase<strong>in</strong>svorsorge. »Infrastruktur«<br />
wurde erheblich weiter gefaßt. Nämlich als Summe<br />
des öffentlichen Kapitals, d. h. es s<strong>in</strong>d auch Institutionen,<br />
Normen, Instrumentarien und Personen<br />
damit geme<strong>in</strong>t. Im Pr<strong>in</strong>zip alles, was dazu beiträgt,<br />
das Zusammenleben der Menschen zu regeln.<br />
Ziel des Arbeitskreises war es, sich mit regionalen<br />
Strukturfragen ause<strong>in</strong>anderzusetzen, Probleme aufzuzeigen<br />
und Erfahrungen bei Lösungswegen vorzustellen.<br />
Über diese Informationen soll zu eigenem<br />
Wirken und Handeln im Dienste von <strong>Stadt</strong> und<br />
Land angeregt werden.<br />
Bereichert wurde die Veranstaltung durch zwei<br />
Sketche me<strong>in</strong>er Kollegen aus Würzburg.<br />
Schwerpunkte<br />
Die Geme<strong>in</strong>den auf dem Weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
F<strong>in</strong>anzkrise?<br />
Herr Emil Schneider, F<strong>in</strong>anzreferent beim Bayer.<br />
Geme<strong>in</strong>detag, beleuchtete den Bereich Geld und<br />
Kommune mit der Fragestellung: »Die Geme<strong>in</strong>den<br />
auf dem Weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzkrise«.<br />
Er stellte die Problemfelder dar, welche die kommunalen<br />
Haushalte künftig besonders belasten werden<br />
und formulierte diverse Forderungen an die<br />
Staatsregierung. An die Geme<strong>in</strong>den appellierte er,<br />
das Wünschenswerte müsse h<strong>in</strong>ter das Notwendige<br />
zurückgestellt werden.<br />
In der Diskussion wurde daran er<strong>in</strong>nert, daß Not<br />
erf<strong>in</strong>derisch mache und die Chance biete, alte Wege<br />
zu verlassen. Die Kommunen müssen mehr Freiräume<br />
erhalten, aber auch Schwerpunkte setzen. Die<br />
Vorhaben der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> haben dabei<br />
unbestritten Vorrang.<br />
Strukturelle Probleme und Lösungswege am<br />
Rande e<strong>in</strong>es Ballungsraums<br />
Herr Bernhard Böckeler, bis vor Jahresfrist noch<br />
Referent an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
<strong>Ansbach</strong>, zeichnete <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em weiteren Vortrag als<br />
Bürgermeister des Marktes Allersberg die strukturellen<br />
Probleme und Lösungswege am Rande des<br />
Ballungsraumes Nürnberg auf.<br />
Se<strong>in</strong> E<strong>in</strong>blick <strong>in</strong> die beiden Seiten der Partnerschaft<br />
Geme<strong>in</strong>de und Verwaltung für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> eröffneten <strong>in</strong>teressante Parallelen. Der<br />
Schwerpunkt se<strong>in</strong>er Ausführungen lag bei der<br />
Darstellung der Dienstleistung der <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> durch den E<strong>in</strong>satz des unverzichtbaren<br />
Instrumentes Bodenordnung.<br />
Die Geme<strong>in</strong>den wünschen sich unsere Verwaltung<br />
als e<strong>in</strong> ständig präsentes Service- und Beratungsunternehmen,<br />
das mit unverstellten Blick <strong>in</strong> der Lage<br />
ist, als Mittler privater und öffentlicher, örtlicher und<br />
regionaler Interessen zu fungieren.<br />
<strong>Ländliche</strong> Räume — <strong>in</strong>novative Wirtschaftsstandorte<br />
mit Zukunft<br />
Herr Dr. Walter Lohmeier, Geschäftsführer bei der<br />
Industrie- und Handelskammer Würzburg–Schwe<strong>in</strong>furt,<br />
stellte beim letzten Beitrag des Vormittags ausgewählte<br />
E<strong>in</strong>sichten se<strong>in</strong>es Arbeits- und Zuständigkeitsbereiches<br />
vor. Die ländlichen Räume seien trotz<br />
hohem Erwerbsanteil im <strong>in</strong>dustriellen Sektor und<br />
günstiger weicher Standortfaktoren benachteiligt.<br />
Er forderte<br />
— <strong>in</strong>tensive Bemühungen der Geme<strong>in</strong>den um konsensfähige<br />
wirtschaftliche Leitbilder,<br />
— regionale runde Tische und den Abbau von kle<strong>in</strong>kariertem<br />
Konkurrenzdenken sowie<br />
— e<strong>in</strong> <strong>in</strong>novatives, standortspezifisches Projektmanagement.<br />
Das Dorf müsse das Heft mehr <strong>in</strong> die Hand nehmen,<br />
selbst viel stärker zum unternehmerischen<br />
Akteur werden und viele Verbündete suchen.<br />
Die Bereiche Wirtschaft, Handel, Gewerbe und<br />
neue Technologien s<strong>in</strong>d noch zu wenig <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
zukunfts-orientierte Landentwicklung <strong>in</strong>tegriert. E<strong>in</strong>e<br />
Zusammenarbeit im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>es ganzheitlichen<br />
Ansatzes dürfte für alle Beteiligten reiche Frucht<br />
br<strong>in</strong>gen.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
41
Lust auf’s Land — Erwartungen und<br />
Forderungen junger Menschen<br />
Herr Dr. Karl-He<strong>in</strong>z Röhl<strong>in</strong>, evang. Landjugendpfarrer<br />
und Leiter der Landvolkhochschule <strong>in</strong><br />
Pappenheim, sprach zum Thema: »Lust auf’s Land -<br />
Erwartungen und Forderungen junger Menschen«.<br />
Gerade <strong>in</strong> schwierigen Zeiten werden gesellschaftliche<br />
Gruppen mit schwacher Lobby oder M<strong>in</strong>derheiten<br />
schnell vernachlässigt. Dazu gehören die<br />
Bauern, aber natürlich auch die Frauen, die ältere<br />
und die junge Generation.<br />
Er zeigte die Lebensbed<strong>in</strong>gungen und die psychosoziale<br />
Situation der Jugend sowie deren Wertewandel<br />
von der Pflichtethik zur Selbstentfaltung auf.<br />
Gefordert seien mehr Anerkennung (auch <strong>in</strong> der<br />
Familie) und partnerschaftlicher Umgang mit den<br />
Jugendlichen.<br />
Die Dorferneuerung braucht dafür jugendliche<br />
Ansprechpartner mit Leitfunktion und neue Formen<br />
der Beteiligung. Aktion gehe vor Diskussion. Die Tat<br />
sei wichtiger als der wohlgeme<strong>in</strong>te Rat.<br />
Regionale Interessengeme<strong>in</strong>schaft<br />
Maria Bildhausen (RIM) - Initiative von unten<br />
Zu guter Letzt rundete Herr Gottfried Wieselhuber<br />
mit se<strong>in</strong>em Bericht über die regionale Interessengeme<strong>in</strong>schaft<br />
Maria Bildhausen das breit gefächerte<br />
Themenspektrum ab. Herr Wieselhuber ist ehrenamtlicher<br />
Vorsitzender dieser Interessengeme<strong>in</strong>schaft,<br />
e<strong>in</strong>em e<strong>in</strong>getragenen Vere<strong>in</strong> mit zur Zeit 75 Mitgliedern,<br />
davon 21 Geme<strong>in</strong>den, und mit 500 km 2<br />
Ausdehnung.<br />
Die Ziele dieses Vere<strong>in</strong>es könnten dem Programm<br />
zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> Dorf und Flur entnommen<br />
se<strong>in</strong>. So heißt es u. a.: Unterstützung der<br />
Mitglieder bei der Planung und Durchführung von<br />
Maßnahmen zur <strong>in</strong>tegrierten <strong>Entwicklung</strong> der<br />
Region, Erhaltung der Kulturlandschaft, Bildung von<br />
problemorientierten Arbeitskreisen. Herr Wieselhuber<br />
erläuterte die Zielsetzung der Initiative und legte<br />
se<strong>in</strong>e persönlichen Erfahrungen mit den verschiedenen<br />
staatlichen Fördertöpfen dar. Er kritisierte die<br />
unzureichende Kooperation und Koord<strong>in</strong>ation der<br />
unterschiedlichen Ressorts und betonte den Vorteil<br />
der Bündelung der Kräfte e<strong>in</strong>er Region.<br />
Fazit<br />
Die Vorträge und Diskussionsbeiträge am vorgestrigen<br />
Tag konnten nur Teilaspekte des Themas<br />
»Infrastruktur« anreißen.<br />
Die Ergebnisse des Arbeitskreises möchte ich <strong>in</strong> 4<br />
Thesen zusammenfassen:<br />
1. Komplexe, vernetzte Problemstellungen verlangen<br />
nach ressort- und grenzübergreifenden<br />
Innovationskoalitionen<br />
Die heutigen Probleme können nur durch überörtliche<br />
Zusammenarbeit, Stärkung des regionalen<br />
Bewußtse<strong>in</strong>s und Abbau von sektoralem Denken<br />
gelöst werden. Regionale <strong>Entwicklung</strong>skonzepte können<br />
die Koord<strong>in</strong>aten und Kooperation der regionalen<br />
und örtlichen Akteure verbessern, Stärken, Schwächen<br />
und Popentiale analysieren und Planungen und<br />
Maßnahmen bündeln helfen. Mit regionalen Entwickungsorganisationen,<br />
z. B. mit unserer Verwaltung,<br />
können Verzettelungen der Mittel und Kräfte<br />
vermieden und Synergien geschaffen werden.<br />
2. Soziale Verantwortung bedeutet auch für uns<br />
Sorge um die gesellschaftlich Schwachen im<br />
ländlichen Raum<br />
Als Dienstleistungsbehörde im ländlichen Raum<br />
haben wir uns auch unserer sozialen Infrastrukturaufgabe<br />
zu stellen, d. h. Hilfe für gesellschaftliche<br />
Randgruppen, M<strong>in</strong>derheiten oder benachteiligte<br />
Bereiche anbieten. Im Arbeitskreis wurde beispielhaft<br />
die Jugend vorgestellt. Ihr, wie vielen anderen,<br />
müssen wir im Rahmen unseres Zuständigkeitsbereiches<br />
und unserer Möglichkeiten erhöhte<br />
Aufmerksamkeit widmen. Das Sozialwesen Mensch<br />
muß bei unserer Arbeit noch mehr <strong>in</strong> den Mittelpunkt<br />
gestellt werden.<br />
3. Zukunftsorientierte Infrastrukturhilfe<br />
braucht uns als Spezialisten für Bodenordnung<br />
und als Koord<strong>in</strong>atoren <strong>in</strong> der Regionalentwicklung<br />
Die Stärkung und Schaffung e<strong>in</strong>er hochentwickelten<br />
Infrastruktur ist e<strong>in</strong>e zeitlose Zukunftsaufgabe.<br />
Wir von der Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
haben neben unseren bewährten Fähigkeiten als<br />
Spezialisten für die Bodenordnung auch unsere<br />
Kompetenz als Moderatoren und Koord<strong>in</strong>atoren für<br />
Landentwicklung e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen. Damit me<strong>in</strong>e ich<br />
aktive Begleitung bei der <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären und<br />
ganzheitlichen Planung aller Maßnahmen, die<br />
den ländlichen Raum fördern. E<strong>in</strong> überzogenes<br />
Selbstbewußtse<strong>in</strong> oder gar e<strong>in</strong>e Überheblichkeit im<br />
S<strong>in</strong>ne des Alleskönnens wäre hierbei jedoch fehl am<br />
Platz.<br />
42 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
4. Sicherung und Ausbau regionaler Infrastruktur<br />
erfordert Menschen mit Kreativität<br />
und Mut zum Risiko<br />
Zentrale Faktoren für e<strong>in</strong>e gesicherte Zukunft<br />
unseres Geme<strong>in</strong>wesens s<strong>in</strong>d Innovationsträger und<br />
Multiplikatoren; Menschen mit Mut und Visionen.<br />
Diese Menschen — und das haben wir im Arbeitskreis<br />
erleben können — erweisen sich als entscheidend bei<br />
der <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume.<br />
Vor kurzem me<strong>in</strong>te Herr Staatsm<strong>in</strong>ister Bocklet,<br />
wir müssen den Rohstoff Geist mehr fordern und<br />
fördern. Als moderne Dienstleistungsverwaltung<br />
sollen und wollen wir zeigen, daß jeder e<strong>in</strong>zelne von<br />
uns e<strong>in</strong> solcher Rohstofflieferant ist, und zwar trotz<br />
Unternehmensberatung e<strong>in</strong> Nachwachsender.<br />
Die f<strong>in</strong>anziellen Spielräume s<strong>in</strong>d überall sehr eng<br />
geworden. Gefragt s<strong>in</strong>d deshalb, mehr denn je,<br />
Fantasie, Kreativität und Mut zum Risiko. Konrad<br />
Adenauer prägte e<strong>in</strong>st den Satz »Kritiker haben wir<br />
genug. Was unsere Zeit braucht, s<strong>in</strong>d Menschen, die<br />
ermutigen«.<br />
Wenn wir die endogenen Kräfte mobilisieren und<br />
eigenen Mut beweisen, muß uns nicht bange um<br />
unsere Verwaltung und um die <strong>Entwicklung</strong> der<br />
<strong>Ländliche</strong>n Räume se<strong>in</strong>.<br />
Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
43
Erich Sperle<strong>in</strong><br />
Bericht über den Arbeitskreis 3:<br />
Land- und Forstwirtschaft<br />
Der Arbeitskreis tagte mit 58 Teilnehmern, darunter<br />
auch acht ausländische Gäste, <strong>in</strong> den vorbildhaft<br />
gestalteten Räumen der Oberforstdirektion<br />
<strong>Ansbach</strong>. Vorbildlichkeit ist <strong>in</strong>sofern gegeben, als<br />
e<strong>in</strong>heimisches Holz als konstruktiver und gestalterischer<br />
Werkstoff dom<strong>in</strong>iert. Die Räumlichkeiten<br />
schufen e<strong>in</strong> angenehmes Umfeld mit gutem Arbeitsklima.<br />
Das Anliegen des Arbeitskreises bestand dar<strong>in</strong>,<br />
zukunftsorientierte Aufgaben und Wege für die<br />
Land- und Forstwirtschaft aufzuzeigen, die es ihr<br />
ermöglichen,<br />
1. aus den derzeitigen ökonomischen Schwierigkeiten<br />
herauszukommen,<br />
2. e<strong>in</strong>e gesellschaftlich und politisch anerkannte,<br />
tragende Rolle für den ländlichen Raum zu übernehmen.<br />
Weiter sollte überlegt werden, wie die <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> mit ihrem derzeitigen Instrumentarium<br />
dabei unterstützend wirken kann und/oder ob sie<br />
dazu mit weiteren Kompetenzen ausgestattet<br />
werden müßte.<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
Der Arbeitskreisleiter zeigte <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>führungsreferat<br />
die schwierigen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
und die daraus resultierende krisenhafte Situation <strong>in</strong><br />
der Land- und Forstwirtschaft auf, wobei er als positiv<br />
herausstellte, daß<br />
— sich die Politik auf allen Ebenen bemüht, der<br />
Land– und Forstwirtschaft Perspektiven aufzuzeigen,<br />
— sich das Image der e<strong>in</strong>heimischen Landwirtschaft<br />
<strong>in</strong> der Öffentlichkeit während der letzten Jahre<br />
verbessert hat und e<strong>in</strong>e hohe Akzeptanz für sie<br />
vorhanden ist,<br />
— die Landwirtschaft nicht resigniert und zunehmend<br />
ihr Schicksal selbst <strong>in</strong> die Hand nimmt und<br />
<strong>in</strong> die Offensive geht.<br />
Zukunftsorientierte Landwirtschaft<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergrund dieser <strong>Entwicklung</strong> entwarf<br />
Professor Seibert von der Fachhochschule Weihenstephan,<br />
Abteilung Triesdorf, »Strategien für e<strong>in</strong>e<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
zukunftsorientierte Landwirtschaft«. Ausgangspunkt<br />
se<strong>in</strong>er Überlegungen war, daß die Landwirtschaft<br />
traditionell e<strong>in</strong> vielfältiges Gewerbe darstellt.<br />
Im Verlauf der letzten Dekaden hat sich jedoch<br />
ihr ökonomischer Beitrag, gemessen an Wertschöpfung<br />
und Beschäftigung, drastisch verr<strong>in</strong>gert; ihre<br />
positiven externen Effekte treten jedoch immer stärker<br />
<strong>in</strong> den Vordergrund. Ihre Bedeutung für die<br />
Lebensverhältnisse der Bevölkerung und die wirtschaftliche<br />
<strong>Entwicklung</strong> im ländlichen Raum<br />
steigt.<br />
Er nannte drei Faktorenbündel als Grundlage für<br />
die <strong>Entwicklung</strong> von Strategien zur künftigen Rolle<br />
der Landwirtschaft:<br />
1. Die Vorgaben der nationalen und <strong>in</strong>ternationalen<br />
Agrarpolitik, die wirtschaftlichen Verhältnisse im<br />
ländlichen Raum und den f<strong>in</strong>anziellen Rahmen<br />
für die Landwirtschaft;<br />
2. Die Anforderungen der Gesellschaft h<strong>in</strong>sichtlich<br />
Produktionsentwicklung, Produktqualität,<br />
Sicherung der natürlichen Umwelt, Erhaltung<br />
sozialer Netzwerke und bäuerlicher Werte;<br />
3. Das Anpassungsverhalten, die Innovationsfähigkeit<br />
und die Professionalität der Landwirte.<br />
Vier grobe Strategien s<strong>in</strong>d denkbar (aufgeführt<br />
nach steigender Bedeutung):<br />
1. Traditionelles Produktionswachstum,<br />
2. Abstockung und Aufgabe,<br />
3. Grundlegende Rationalisierung <strong>in</strong> allen Bereichen,<br />
4. Diversifizierung und E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ationen.<br />
Die Umsetzung der Strategien ist abhängig von<br />
Engagement und der Professionalität <strong>in</strong> der Nutzung<br />
aller Ressourcen von Haushalt und Betrieb, von der<br />
fachlichen und persönlichen Qualifikation der Haushaltsmitglieder<br />
und deren <strong>Entwicklung</strong>sperspektiven.<br />
In weiten Teilen Bayerns wird der Weg der E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ation<br />
zusammen mit der Ausschöpfung<br />
aller Möglichkeiten der E<strong>in</strong>sparung von<br />
Arbeitszeit und Kosten die e<strong>in</strong>zige Alternative se<strong>in</strong>,<br />
um Bauer bleiben zu können. Das Berufsbild des<br />
Bauern wird sich wesentlich erweitern, der »Ressourcenmanager«<br />
wird der Bauer der Zukunft se<strong>in</strong>.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
45
Intelligente Nutzstrategien<br />
Sehr praxisbezogen stellte der Unternehmensund<br />
Market<strong>in</strong>gberater Walter Danner vom »Team für<br />
angewandte Ökologie« die Umsetzung e<strong>in</strong>zelbetrieblicher<br />
Optimierungskonzepte im Rahmen von<br />
Verfahren der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> vor.<br />
Stichwort: Intelligente Nutzstrategien.<br />
Sie waren alle gekennzeichnet durch Berücksichtigung<br />
der persönlichen und betrieblichen Verhältnisse,<br />
die Kraft des positiven Denkens, Steigerung<br />
der Wertschöpfung des Betriebes durch Übernahme<br />
von Verarbeitungs- und Vermarktungsaufgaben,<br />
Entlastung der Familie und ökologische Wirtschaftsweisen<br />
auf möglichst 100 % der Betriebsfläche.<br />
Durch diese E<strong>in</strong>führungsvorträge vorbereitet,<br />
teilte sich das Plenum <strong>in</strong> 6 Gruppen, um nachstehend<br />
aufgeführte Teilaspekte mit der Methode der<br />
Moderationstechnik zu bearbeiten.<br />
1. Bäuerliche Waldwirtschaft<br />
2. Umweltleistungen der<br />
Landwirtschaft<br />
3. Erwerbsalternativen und<br />
Marktnischen<br />
4. Dienstleistungen durch die<br />
Landwirtschaft<br />
5. Landwirtschaft und Dorf<br />
6. Konventionelle Landwirtschaft –<br />
zukunftsorientiert<br />
Die ca. 2 1 / 4stündigen moderierten Gruppenarbeiten<br />
brachten e<strong>in</strong>e Fülle von E<strong>in</strong>zelerkenntnissen<br />
zur Aufgabenstellung des Arbeitskreises. Die E<strong>in</strong>zelergebnisse<br />
können zusammengeführt wie folgt wiedergegeben<br />
werden (siehe auch Grafik Seite 47):<br />
1. E<strong>in</strong>e eigenständige Land- und Forstwirtschaft ist<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er modernen Industrie- und Leistungsgesellschaft<br />
zur Ernährungssicherstellung, <strong>in</strong>sbesondere<br />
aber wegen ihrer ökologischen Leistungen<br />
im H<strong>in</strong>blick auf die Erhaltung der Lebensgrundlagen<br />
unverzichtbar.<br />
2. Die traditionell breit angelegten Aufgaben der<br />
Land- und Forstwirtschaft müssen noch an<br />
Vielfalt zunehmen. Es ist erforderlich, <strong>in</strong> neue<br />
Bereiche der Produktion vorzustoßen und auch<br />
auf dem Dienstleistungssektor landwirtschaftlich<br />
verwandte oder sogar nichtverwandte Funktionen<br />
zu übernehmen. Dabei ist es nötig, daß jedes<br />
wirtschaftliche Handeln sich an den Bedürfnissen<br />
des Marktes orientiert und umwelt- und sozialverträglich<br />
ausgerichtet wird. Sozialverträglich<br />
bedeutet, daß für eigene Freizeit, für Familienleben<br />
und für die Übernahme von kommunalen<br />
und gesellschaftlichen Ämtern noch Freiräume<br />
bleiben müssen.<br />
Der Übernahme von Erwerbsalternativen und<br />
Dienstleistungen zur E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ation<br />
muß e<strong>in</strong>e Situationsanalyse mit Prüfung der persönlichen<br />
Neigungen und Fähigkeiten, der betrieblichen<br />
und gesetzlichen Bed<strong>in</strong>gungen und<br />
des Marktes vorausgehen. Für neue Denk- und<br />
Handlungsalternativen sowie Fortbildungsaktivitäten<br />
s<strong>in</strong>d entsprechende Anforderungen an<br />
Geist, Kreativität, Persönlichkeit und entsprechender<br />
Mut notwendig; dazu muß die Aussicht auf<br />
materielle Hilfen kommen.<br />
3. Die Arbeit im Bereich der Landschaftspflege<br />
braucht e<strong>in</strong> Leistungsprofil, um bei der Gesellschaft<br />
e<strong>in</strong> echtes Leistungsentgelt e<strong>in</strong>fordern zu<br />
können und um den notwendigen E<strong>in</strong>kommenstransfers<br />
den Ruch von Almosen zu nehmen. Die<br />
Solidarität der gesamten Gesellschaft ist erforderlich,<br />
um der Landwirtschaft e<strong>in</strong>en entsprechenden<br />
Stellenwert im ländlichen Raum zuordnen zu<br />
können. Dies wird nur gel<strong>in</strong>gen, wenn auch die<br />
Landwirtschaft der Bevölkerung Ehrlichkeit und<br />
Transparenz ihrer Wirtschaftsweise vermitteln<br />
kann.<br />
4. Der Landwirtschaft kommt auch e<strong>in</strong>e tragende<br />
Rolle als Vorbild für die Gesellschaft zu. Die Vorbildwirkung<br />
besteht im Denken und Handeln von<br />
Kategorien, die unter dem Begriff »Bäuerlichkeit«<br />
zusammengefaßt s<strong>in</strong>d, wie zum Beispiel Vermittlung<br />
e<strong>in</strong>es ganzheitlichen Lebensgefühls, verantwortliches<br />
Umgehen mit Umwelt und den natürlichen<br />
Ressourcen usw.<br />
Die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> kann für die Zukunftsrolle<br />
der Landwirtschaft vielfältige Unterstützung<br />
bieten:<br />
1. Die Verbesserung der Agrarstruktur durch klassische<br />
Maßnahmen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> ist<br />
<strong>in</strong> vielen Regionen Bayerns zur flächendeckenden<br />
bäuerlichen Bewirtschaftung und zur Freisetzung<br />
von Arbeitsressourcen für E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ationen<br />
noch notwendig. Bei der Durchführung ist<br />
auf e<strong>in</strong>e Gleichrangigkeit von Ökonomie und Ökologie<br />
zu achten. E<strong>in</strong>fachere und schnellere Verfahren<br />
müssen verstärkt zum E<strong>in</strong>satz kommen.<br />
Ebenso ersche<strong>in</strong>t e<strong>in</strong>e Verbesserung der Hand-<br />
46 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
lungsfähigkeit der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> notwendig<br />
zu se<strong>in</strong>. Stichworte: Vielzahl der<br />
Verfahren je Gebietsreferent, Altlasten.<br />
2. E<strong>in</strong>e weit größere Bedeutung mißt der Arbeitskreis<br />
der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> bei der Aufrüstung<br />
der Landwirtschaft für weitere künftige<br />
Aufgaben zu. Diese Leistung kann sie alle<strong>in</strong> nicht<br />
erbr<strong>in</strong>gen, sondern sie bedarf dafür der Mitwirkung<br />
externer Fachleute, der Ämter für Landwirtschaft<br />
und Ernährung usw. E<strong>in</strong> <strong>in</strong>tegraler Ansatz<br />
für diese breite Aufgabenstellung ersche<strong>in</strong>t notwendig.<br />
Die Moderation und Koord<strong>in</strong>ation der<br />
Experten, der Bürger und Landwirte soll die <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> übernehmen. Sie hat sich<br />
bestens <strong>in</strong> diese Rolle e<strong>in</strong>gearbeitet.<br />
Zitat e<strong>in</strong>es Teilnehmers: »Wer denn, wenn nicht<br />
die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>«? Die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
hat für diese Rolle ihre Kompetenz bereits<br />
e<strong>in</strong>deutig unter Beweis gestellt.<br />
3. Ziel dieser <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ären Aktionen muß e<strong>in</strong>e<br />
klare Aufgabenformulierung und <strong>in</strong>dividuelle<br />
Leitbildentwicklung für Dorf, Flur und E<strong>in</strong>zelbetrieb<br />
se<strong>in</strong>. Die Pr<strong>in</strong>zipien der Freiwilligkeit und<br />
Selbstverantwortlichkeit sollten bei der Aufstellung<br />
von Landnutzungskonzepten und der<br />
Suche nach Innovationen mehr Beachtung f<strong>in</strong>den.<br />
Die beratende Begleitung bei der Umsetzung<br />
der Planungen muß genauso selbstverständlich<br />
�<br />
Geme<strong>in</strong>de<br />
�<br />
�<br />
Produktion<br />
— hochwertige Lebensmittel<br />
— nachwachsende Rohstoffe<br />
— Energieträger<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Multifunktionale Land- und Forstwirtschaft<br />
marktorientiert, umwelt- und sozialverträglich<br />
se<strong>in</strong>, wie die Bereitstellung der notwendigen<br />
öffentlichen Mittel, denn Umsetzung ist genauso<br />
wichtig wie Planung. Neue F<strong>in</strong>anzmodelle, wie<br />
zum Beispiel die Ausgabe von Verbandsaktien,<br />
wären dabei denkbar.<br />
Die Geme<strong>in</strong>den s<strong>in</strong>d unverzichtbare Partner der<br />
Landwirtschaft und der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong>. Ihr<br />
vermittelndes, koord<strong>in</strong>ierendes Engagement wird von<br />
beiden Seiten gebraucht.<br />
Die Wege des Mite<strong>in</strong>anderumgehens zeigen die<br />
Schulen der Dorf- und Land- bzw. Flurentwicklung<br />
auf.<br />
Nach Me<strong>in</strong>ung des Arbeitskreises s<strong>in</strong>d die Instrumente<br />
und Kompetenzen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
grundsätzlich ausreichend, um die Landwirtschaft<br />
für ihre Zukunftsrolle fit zu machen. Es ist<br />
jedoch notwendig, die Möglichkeiten voll auszuschöpfen<br />
und laufend auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen.<br />
Ich bedanke mich bei den Kollegen Karl-He<strong>in</strong>z<br />
Langguth und Wolfgang Maucksch von der DLE<br />
<strong>Ansbach</strong> für die technische Betreuung des Arbeitskreises,<br />
bei den Kollegen Richard Brunner, Matthias<br />
Ehrhardt, Klaus Em<strong>in</strong>ger, Wolfgang Kerl<strong>in</strong>g, Hans<br />
Mehr<strong>in</strong>ger und Ulrich Müller, alle DLE Bamberg, für<br />
die Übernahme e<strong>in</strong>er Kle<strong>in</strong>gruppenmoderation und<br />
bei Ihnen, me<strong>in</strong>e Damen und Herren, für Ihre<br />
Aufmerksamkeit<br />
Dienstleistungen<br />
— Direktvermarktung<br />
— Freizeit und Erholung<br />
— Landschafts- und<br />
Umweltpflege<br />
— Sozialer Bereich<br />
� <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
�<br />
�<br />
Dorf- und Flurentwicklung<br />
— externe Fachleute / AfLuE<br />
— Bürgerbeteiligung<br />
— Koord<strong>in</strong>ation und Moderation<br />
— Leitbilder für Dorf, Flur, E<strong>in</strong>zelbetrieb<br />
— Landnutzungskonzepte und Innovationen<br />
— Umsetzung der Planungen<br />
Bäuerlichkeit<br />
— Ganzheitlichkeit<br />
— Langfristigkeit<br />
— Verantwortlichkeit<br />
— Heimatverbundenheit<br />
�<br />
�<br />
Schulen der Dorf- und Landbzw<br />
Flurentwicklung (SDL/SDF)<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
47
Peter Jahnke<br />
Bericht über den Arbeitskreis 4:<br />
Dorfentwicklung<br />
»Neue Wege <strong>in</strong> der Dorfentwicklung, von der<br />
Expertenplanung zur Moderation«, war der Untertitel<br />
des Arbeitskreises »Dorfentwicklung«, der sehr <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är<br />
besetzt war. Wir hatten dort Architekten,<br />
Landschaftsarchitekten, Geodäten, Verwaltungsjuristen,<br />
Richter, Ökologen, Volkskundler, Kommunalbetreuer,<br />
Geographen, Landwirte aus der Verwaltung,<br />
als Freiberufler und aus dem Hochschulbereich<br />
und wir hatten e<strong>in</strong>e Anzahl von tatkräftigen Bürgermeistern<br />
mit dabei. Außer aus Bayern kamen sie aus<br />
Niedersachsen, aus Sachsen-Anhalt, aus Sachsen,<br />
aus Thür<strong>in</strong>gen, aus dem Saarland und aus Hessen<br />
und aus dem Ausland, aus Luxemburg, aus Kroatien,<br />
aus Slowenien, aus der Tschechischen Republik<br />
und aus Österreich. Bei dieser Vielfalt von Berufsgruppen<br />
und dieser <strong>in</strong>ternationalen Besetzung war<br />
die E<strong>in</strong>igkeit dieses sehr großen Arbeitskreises mit<br />
fast 60 Personen ganz erstaunlich. Auch die drei<br />
Referenten, die die kurzen E<strong>in</strong>führungsreferate<br />
gehalten haben, waren <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är zusammengestellt,<br />
so wie es das Berufsfeld der Dorfentwicklung<br />
verlangt:<br />
e<strong>in</strong> Architekt und Planer, der Herr Naumann aus<br />
Regensburg,<br />
e<strong>in</strong> Landschaftsarchitekt, Herr Prof. Auweck aus<br />
München und<br />
e<strong>in</strong> Geodät, Kollege Rill aus München.<br />
In der E<strong>in</strong>führung wurde über die veränderten<br />
Planungskulturen <strong>in</strong> Europa berichtet (wir haben<br />
davon vom Kollegen Huber schon aus dem Arbeitskreis<br />
1 gehört, die Planung von unten nach oben zu<br />
betreiben). Dieses Konzept, was mehr und mehr auch<br />
<strong>in</strong> der <strong>Stadt</strong> greift, nach dem Motto »Mitwirken<br />
lassen, mitwirken können und mitwirken wollen«,<br />
spiegelt sich bei uns <strong>in</strong> der Dorfentwicklung <strong>in</strong> den<br />
Arbeitskreisen wider.<br />
Wie ist die Situation?<br />
Die Politiker<br />
Es gibt e<strong>in</strong>e große Anzahl von Politikern, die<br />
me<strong>in</strong>en, die Arbeitskreisarbeit ist Bürger<strong>in</strong>itiative<br />
nicht gegen etwas, sondern Bürger<strong>in</strong>itiative für<br />
etwas. Es gibt aber auch e<strong>in</strong>ige Politiker, denen ist<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
diese Arbeit nicht ganz geheuer, sie haben Befürchtungen,<br />
daß die Arbeitskreise mißbraucht werden<br />
könnten als politische Plattform.<br />
Die Planer<br />
Es gibt Planer, die me<strong>in</strong>en, die Bürger s<strong>in</strong>d Experten.<br />
Deshalb müssen sie mitwirken und deshalb<br />
sollten wir sie ganz eng mit e<strong>in</strong>beziehen. Es gibt<br />
aber leider auch noch e<strong>in</strong>e große Anzahl von Planerkollegen,<br />
die me<strong>in</strong>en, die Bürger haben schlichtweg<br />
ke<strong>in</strong>e Ahnung und es besteht beim Mitwirken die<br />
Gefahr, daß die falschen Straßenlaternen ausgewählt<br />
werden.<br />
Die Kollegen <strong>in</strong> der Verwaltung für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong><br />
Sie müssen die öffentlichen Gelder verwalten;<br />
da gibt es e<strong>in</strong>en Teil, die sagen, der Wert der Planung<br />
muß bezahlt werden im richtigen Preis/Leistungsverhältnis.<br />
Es gibt aber auch welche, die sagen, wir<br />
müssen vorwiegend das Verhältnis Planungskosten/<br />
Ausbaukosten überdenken.<br />
Die E<strong>in</strong>führungsreferate behandelten folgende<br />
Schwerpunktthemen:<br />
— Die Rolle des Planers als Moderator.<br />
(Wie weit soll er sich <strong>in</strong> die Arbeitskreise e<strong>in</strong>mischen,<br />
wie weit darf er sich e<strong>in</strong>mischen?)<br />
— Initiativen im Ort, Eigenleistungen neuer Art,<br />
nicht nur Hand- und Spanndienste, sondern auch<br />
Eigenf<strong>in</strong>anzierung, z. B. <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>en BGB-Gesellschaften.<br />
— Dezentrale Lösungen s<strong>in</strong>d notwendig, besonders<br />
im H<strong>in</strong>blick auf die Kosten, z. B. im Bereich des<br />
technischen Umweltschutzes, Abwasserbeseitigung.<br />
— Kommunale Allianzen s<strong>in</strong>d notwendig, Dorfentwicklung<br />
im Verbund; es geht dabei um gegenseitige<br />
Ergänzung, z. B. bei der Mitnutzung von Versorgungse<strong>in</strong>richtungen,<br />
dabei s<strong>in</strong>d Steuerungsund<br />
Abstimmungsformen, z. B. durch überörtliche<br />
Arbeitskreise notwendig,<br />
— Dorf- und Flurentwicklung gehören zusammen. Ist<br />
es da nicht auch s<strong>in</strong>nvoll, sie flächendeckend für<br />
die Geme<strong>in</strong>de anzuwenden?<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
49
— E<strong>in</strong>e neue Flurentwicklung ist freiwillig.<br />
— E<strong>in</strong>e neue Flurentwicklung hat neue Aufgaben als<br />
Hilfe für den Natur- und Landschaftsschutz, als<br />
Hilfe für Freizeit und Erholung, als Hilfe für e<strong>in</strong>e<br />
neue Landwirtschaft, z. B. für die Flächenbereitstellung<br />
für Sonderkulturen.<br />
Dorfentwicklung im Jahre 2000<br />
Die Arbeit <strong>in</strong> den sechs Arbeitsgruppen stand<br />
unter dem Thema »Wie soll die Dorfentwicklung<br />
im Jahre 2000 aussehen?« Nach umfassender<br />
Stoffsammlung — auf 20 Stellwänden, die alle vollgesteckt<br />
waren — fand e<strong>in</strong>e Konzentration auf sechs<br />
Themen durch Punktebewertung statt:<br />
1. Planung:<br />
— Planung als Prozeß,<br />
— vernetzte Konzepte,<br />
— Dorfentwicklung im Verbund,<br />
— regionale Kooperation.<br />
2. Wirtschaft:<br />
— Dorf als Wirtschaftskraft,<br />
— Landwirte im Dorf nicht vergessen,<br />
— Arbeit im Dorf.<br />
3. Ökologie:<br />
— Ökologische und umweltorientierte<br />
Dorfentwicklung,<br />
— Dorf und Flur gehören zusammen,<br />
— alternative Energiekonzepte und das ganze<br />
Problemfeld des technischen Umweltschutzes.<br />
4. Identifikation:<br />
— Dörfliche Gestaltung,<br />
— stärkere lokale Identität.<br />
5. Geme<strong>in</strong>schaft/Dorfkultur:<br />
— Dorfgeme<strong>in</strong>schaft, Geme<strong>in</strong>schaft und<br />
Dorfbewußtse<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>es,<br />
— Kommunikation im Dorf.<br />
6. Mitwirkung/Mitverantwortung:<br />
— Dorfkonkrete Demokratie,<br />
— Eigenständigkeit bedeutet Eigenverantwortung,<br />
— Beschlußgeme<strong>in</strong>schaft, Geme<strong>in</strong>derat/Vorstand TG.<br />
Von diesen Themen erhielt bemerkenswerterweise<br />
e<strong>in</strong> Thema nur e<strong>in</strong>en Punkt von 300 zu vergebenden<br />
Punkten: nämlich die »f<strong>in</strong>anzielle Ausstattung«. Das<br />
heißt natürlich nicht, daß die f<strong>in</strong>anzielle Ausstattung<br />
nicht nötig wäre, sondern daß das ke<strong>in</strong> Diskussionsthema<br />
<strong>in</strong> diesen Arbeitsgruppen war.<br />
Diese sechs Themen wurden am Nachmittag<br />
vertieft weiterbearbeitet anhand der Frage<br />
»Wie ist es, wie wünsche ich es mir, was muß<br />
getan werden«?<br />
Interessant ist dabei, daß die Bearbeitung der<br />
E<strong>in</strong>zelthemen wieder zu geme<strong>in</strong>samen Kernaussagen<br />
zurückführte:<br />
— Von der Mono- zur Multistruktur, dadurch wieder<br />
neue Arbeitsplätze im Dorf,<br />
— Verantwortung für geme<strong>in</strong>same Aufgaben,<br />
— Aufgaben bedeuten Arbeit im Dorf.<br />
Sie sehen, der Komplex Arbeit wurde hier besonders<br />
angesprochen.<br />
— Geme<strong>in</strong>same Ziele erarbeiten, z. B. mit der<br />
Jugend, um wieder Vertrauen zu gew<strong>in</strong>nen, damit<br />
die Jugend im Dorf bleibt.<br />
— Wertebewußtse<strong>in</strong> erzeugen mit Fragen von<br />
Tradition und Wandel (Gibt es noch das alte Dorf<br />
mit den strengen engen sozialen Strukturen?).<br />
— Wertebewußtse<strong>in</strong> <strong>in</strong> ökologischen Fragen.<br />
— Eigenverantwortung wieder aufbauen.<br />
Alles Themen der »Identität« Die Schwerpunktthemenbereiche<br />
waren »Identität« und »Arbeit«!<br />
Das Fundament für alles war die Aussage:<br />
Es muß e<strong>in</strong>geme<strong>in</strong>sames Planungsdrehbuch im<br />
S<strong>in</strong>ne der Moderation, e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames<br />
Planungskonzept, geme<strong>in</strong>sam zwischen Bürger<br />
und Planer, erarbeitet werden.<br />
Fazit:<br />
1. Bürgeraktivitäten s<strong>in</strong>d Voraussetzung für Ent -<br />
wicklung <strong>in</strong> Dorf und Flur oder <strong>in</strong> der ländlichen<br />
Region.<br />
2. Bürger können und sollen an der Planung mitwirken<br />
(ich verweise auf die <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre<br />
Besetzung der Arbeitsgruppen — das haben auch<br />
Planer mitgetragen!).<br />
3. Geme<strong>in</strong>same Planung ist notwendig — Experten<br />
aus dem Dorf und Experten von außen.<br />
Zum Schluß noch e<strong>in</strong> wesentlicher H<strong>in</strong>weis e<strong>in</strong>er<br />
Arbeitsgruppe auf e<strong>in</strong>e grundsätzliche Voraussetzung<br />
für alles. Man muß Geduld haben, man muß<br />
viel Geduld haben!<br />
50 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Mart<strong>in</strong> Hundsdorfer<br />
Bericht über den Arbeitskreis 5:<br />
Landschaftsgestaltung<br />
In mehreren Vorbesprechungen haben Kollegen<br />
der Direktion Regensburg, Landschaftsplaner und der<br />
Verfasser den Arbeitskreis vorbereitet. Wir s<strong>in</strong>d dabei<br />
davon ausgegangen, daß die Verwaltung für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> mit ihrer Landschaftsplanung e<strong>in</strong><br />
sehr tragfähiges Fundament besitzt. Dies kann und<br />
muß genutzt werden, um den ländlichen Raum zeitgemäß<br />
unterstützten und entwickeln zu helfen.<br />
Das Thema des Arbeitskreises wurde deshalb<br />
konkretisiert:<br />
Landschaftsentwicklung<br />
Neue Aufgaben, neue Wege — neue Chancen<br />
und davon drei Fragen abgeleitet:<br />
1. Welche neuen Aufgaben kann die <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> im Rahmen ihres Instrumentariums<br />
übernehmen?<br />
2. Welche neuen Wege muß sie hierzu beschreiten?<br />
3. Welche Chancen ergeben sich daraus?<br />
Schwerpunkte<br />
Im Rahmen e<strong>in</strong>er Moderation haben wir potentielle<br />
Aufgabenbereiche ermittelt und davon sechs<br />
für die <strong>Fachtagung</strong> präferiert:<br />
— Bündnis zwischen <strong>Stadt</strong> und Land<br />
BOR Werner Stahl, Dipl.-Ing Anne Wendl<br />
— Leitbild Landschaft<br />
BOR Thomas Gollwitzer, Dipl.-Ing. Karl Sp<strong>in</strong>dler<br />
— Umsetzung ökologischer Planungen<br />
— BD Wolfgang von Schell<strong>in</strong>g, Dipl.-Ing. Helmut<br />
Wartner<br />
— Neue Landnutzungen<br />
BR Klaus Bergbauer, BOR Franz Göhler<br />
— Alternative E<strong>in</strong>kommensquellen<br />
BOR Werner Bothner, BOR Franz Sonnleitner<br />
— Market<strong>in</strong>g für den ländlichen Raum<br />
BOR Michael Sch<strong>in</strong>dler, BOR Josef We<strong>in</strong><br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Die Teilnehmer des Arbeitskreises 5 der <strong>Fachtagung</strong><br />
konnten sich also <strong>in</strong> sechs Moderationsgruppen,<br />
betreut von jeweils zwei Moderatoren, mit<br />
diesen Themen ause<strong>in</strong>andersetzen. Zur E<strong>in</strong>führung <strong>in</strong><br />
die Moderationstechnik wurde <strong>in</strong> je e<strong>in</strong>em Referat<br />
e<strong>in</strong> Beispiel für e<strong>in</strong>e neue Aufgabe und e<strong>in</strong> Beispiel<br />
für e<strong>in</strong>en neuen Weg vorgestellt:<br />
Im Verfahren Stefl<strong>in</strong>g ist es gelungen, das landschaftsökologische<br />
Konzept, nämlich die reich strukturierte<br />
Landschaft zu erhalten und zu entwickeln,<br />
auf e<strong>in</strong> solides ökologisches Fundament zu stellen.<br />
Es konnte unter dem Motto »Natur und Bauern erhalten«<br />
e<strong>in</strong>e gut funktionierende Selbstvermarktungsorganisation<br />
aufgebaut werden.<br />
Im Verfahren Fuhrn g<strong>in</strong>g man mit viel Engagement<br />
an die Leitbildentwicklung im Rahmen e<strong>in</strong>er<br />
Flurwerkstatt. Motto war hier: Von der Bürgerbeteiligung<br />
zur Bürgerplanung (siehe Teil E<strong>in</strong>führungsreferate<br />
<strong>in</strong> den Arbeitskreisen).<br />
Ergebnisse der Moderation<br />
Leitbild Landschaft<br />
Das Thema »Leitbild Landschaft« hat sich als von<br />
zentraler Bedeutung herausgestellt; es kann der<br />
Schlüssel zum Erfolg aller anderen vorgestellten<br />
Aufgabenbereiche se<strong>in</strong>.<br />
E<strong>in</strong>e Flurwerkstatt zur <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>es Leitbildes<br />
Landschaft wird als unabd<strong>in</strong>gbar angesehen: Das<br />
Wissen und die Erfahrung e<strong>in</strong>er breiten Basis können<br />
<strong>in</strong> die Planung mit e<strong>in</strong>fließen; auch die wichtige<br />
Indentifikation mit den Ergebnissen ist gewährleistet<br />
und die Bereitschaft, Verantwortung zu tragen,<br />
steigt. Daraus ergeben sich e<strong>in</strong>e Vielzahl von<br />
Chancen für die Landwirtschaft, für die Verwaltung,<br />
für die Planer und für die übrigen Bürger. Dies<br />
rechtfertigt nach Ansicht der Moderationsgruppe die<br />
zu erwartenden Nachteile, nämlich höherer Zeitaufwand,<br />
höhere Kosten, höhere Anforderungen an die<br />
Moderatoren und externen Experten. Die Größe der<br />
Verfahren könnte sich an der Realisierbarkeit von<br />
Flurwerkstätten orientieren. Methodisch kann dabei<br />
viel von den Erfahrungen der Dorferneuerung<br />
profitiert werden.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
51
Umsetzung ökologischer Planungen<br />
Bei der Umsetzung von ökologischen Planungen<br />
sollten extreme Positionen ebenso vermieden werden,<br />
wie bei der Bodenordnung. Vielmehr s<strong>in</strong>d ökologische<br />
und ökonomische Konzepte zu verknüpfen,<br />
d. h. Landschaftsökologen müssen die ökonomischen<br />
Probleme der Landwirte und diese wiederum die<br />
ökologischen Probleme der Kulturlandschaft ernst<br />
nehmen. Daß dies funktionieren kann und nicht<br />
bloße Theorie ist, die sich schön anhört, zeigt das<br />
Verfahren Stefl<strong>in</strong>g. Hier wurde mit viel Engagement<br />
des Vorsitzenden, des Landschaftsplaners und vor<br />
allem der Teilnehmer e<strong>in</strong>e gut funktionierende<br />
Selbstvermarktungsorganisation aufgebaut.<br />
Um den relativ hohen Planungsaufwand <strong>in</strong> Grenzen<br />
zu halten, sollte gezielt und flexibel, d. h. <strong>in</strong><br />
unterschiedlichen Intensitätsstufen geplant werden.<br />
Auch kann bei manchen neu h<strong>in</strong>zukommenden Aufgaben<br />
auf bestehende Planungen zurückgegriffen<br />
werden, z. B. der Umsetzung von kommunalen Landschaftsplänen,<br />
von Pflege- und <strong>Entwicklung</strong>skonzepten<br />
oder von Arten- und Biotopschutzprogramm-<br />
Projekten.<br />
Neue Landnutzungen<br />
Es wurden hier Wege und Chancen aufgezeigt, im<br />
Rahmen von Verfahren noch verstärkt den Naturschutz,<br />
Formen extensiver Landbewirtschaftung,<br />
Erholungsnutzung, Aufforstung und den Anbau von<br />
Sonderkulturen zu unterstützen. Neben gezielter<br />
Maßnahmenförderung ist dies vor allem durch<br />
Information und Bewußtse<strong>in</strong>sbildung im Rahmen<br />
der mehrjährigen Verfahren möglich.<br />
Alternative E<strong>in</strong>kommensquellen<br />
Zunächst wurde e<strong>in</strong>e Reihe von Möglichkeiten<br />
alternativer E<strong>in</strong>kommensquellen zusammengetragen.<br />
Dann hat die Moderationsgruppe die Kompostierung<br />
als exemplarisches Beispiel ausgewählt, um zu zeigen,<br />
daß und wie die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> von der<br />
Beratung, Bodenordnung, F<strong>in</strong>anzierung bis h<strong>in</strong> zum<br />
Market<strong>in</strong>g beitragen kann, um e<strong>in</strong> derartiges Projekt<br />
zum Erfolg zu führen.<br />
Market<strong>in</strong>g für den ländlichen Raum<br />
Ausgegangen wurde hier von den Erwartungen<br />
und Bedürfnissen der Gesellschaft an den ländlichen<br />
Raum, bei deren Verwirklichung wir beitragen bzw.<br />
mehr beitragen könnten, als wir dies bisher tun, z. B.<br />
bei neuen Umweltschutztechniken, wie Blockheizkraftwerken,<br />
Pflanzenkläranlagen, Solaranlagen und<br />
Abfallwirtschaftskonzepten. Dann wurde am Beispiel<br />
»der ländliche Raum als Arbeitsraum« aufgezeigt, wie<br />
unsere Verwaltung bei Market<strong>in</strong>gkonzeptionen mitwirken<br />
kann.<br />
Gerade diese Moderation zeigte deutlich, daß die<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> wertvolle Arbeit bei der Bewältigung<br />
neuer Aufgaben für den ländlichen Raum<br />
leisten kann. Dies ist Arbeit, die der Gesellschaft ansonsten<br />
verloren g<strong>in</strong>ge, da niemand <strong>in</strong> der Lage<br />
wäre, sie zu leisten. Es zeigte sich hier aber ebenso<br />
deutlich, daß häufig die Zusammenarbeit mit anderen<br />
Fachbehörden bzw. mit freiberuflich Tätigen notwendig<br />
ist.<br />
Die noch verbleibende Moderation »Bündnis<br />
zwischen <strong>Stadt</strong> und Land« wurde kurzfristig umdisponiert,<br />
um acht polnischen Teilnehmern am<br />
Arbeitskreis 5 die Gelegenheit zu e<strong>in</strong>er eigenen<br />
Moderationsgruppe zu geben. Thema war hier der<br />
Vergleich der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> von Polen<br />
und Bayern.<br />
Es gibt <strong>in</strong> Polen e<strong>in</strong>e Regionalplanung und e<strong>in</strong>e<br />
Bauleitplanung. Es gibt aber ke<strong>in</strong>e Landschaftsplanung<br />
<strong>in</strong> der Flurbere<strong>in</strong>igung. Es gibt auch ke<strong>in</strong>en<br />
Studiengang Landschaftspflege.<br />
Die polnischen Gäste brachten zum Ausdruck, daß<br />
sie e<strong>in</strong>e Landschaftsplanung für dr<strong>in</strong>gend erforderlich<br />
halten; deshalb haben sie den bayerischen Weg<br />
hier bei der <strong>Fachtagung</strong> e<strong>in</strong>gehend studiert.<br />
Schlußbetrachtung<br />
Moderationen machen »Arbeitskreise« zu arbeitenden<br />
Kreisen. Das geme<strong>in</strong>sam von allen getragene<br />
Arbeiten erhält diese Kreise kurzweilig — trotz ganztägiger<br />
Veranstaltung.<br />
Die erreichten Ergebnisse und die spürbare positive<br />
Stimmung am Ende dieser Veranstaltung s<strong>in</strong>d<br />
fachlicher und persönlicher Erfolg für die <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong>.<br />
52 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Karl Braumiller<br />
Bericht über den Arbeitskreis 6:<br />
Informationstechnik<br />
Zur E<strong>in</strong>stimmung auf den Arbeitskreis 6 — Informationstechnik<br />
— zeichnete Herr Schellhaas von der<br />
Firma CAPdebis <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>führungsvortrag e<strong>in</strong><br />
Bild der aktuellen <strong>Entwicklung</strong>en der Informationsund<br />
Kommunikationstechnik.<br />
So entstehen durch die Deregulierung im<br />
Telekommunikationsmarkt, d.h. E<strong>in</strong>schränkung der<br />
Telekom-Monopole, neue Infrastrukturen durch<br />
immer mehr private Dienstleistungs-Anbieter aus<br />
dem In- und Ausland. Von zentraler Bedeutung ist<br />
die damit e<strong>in</strong>hergehende rasante Weiterentwicklung<br />
und Standardisierung im Bereich der Übertragungsund<br />
Vermittlungstechniken. Im Bereich der Bürokommunikation<br />
wurden neue Trends und Erfahrungen<br />
aus der Umsetzung konkreter Projekte<br />
vorgestellt.<br />
Zu dem breiten Themenbereich Informationstechnik<br />
wurden durch e<strong>in</strong>e Kartenabfrage im Plenum<br />
Gedanken und Anregungen gesammelt und <strong>in</strong> vier<br />
Themenspeichern geordnet. Diese wurden <strong>in</strong> je<br />
e<strong>in</strong>em moderierten Workshop vertieft. Die Ergebnisse<br />
daraus lassen sich folgendermaßen zusammenfassen.<br />
Kommunikation mit anderen Behörden<br />
Nach Gewichtung mit Klebepunkte kristallisierten<br />
sich die Diskussionsschwerpunkte »Datenaustausch<br />
Vermessungsverwaltung — <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>«<br />
und »Kompatibilität von Datenstrukturen und<br />
Programmen zwischen unterschied-lichen<br />
Verwaltungen« heraus. Nach e<strong>in</strong>em Abgleich des<br />
aktuellen <strong>Entwicklung</strong>sstandes wurde festgestellt,<br />
daß die Abgabe des ALB an die Direktionen für<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> weitestgehend funktioniert,<br />
bei der Abgabe des Neuen Standes nach Abschluß<br />
e<strong>in</strong>es Verfahrens noch Leistungen zu erbr<strong>in</strong>gen s<strong>in</strong>d,<br />
die allerd<strong>in</strong>gs als handhabbar und im vorgegebenen<br />
Zeitrahmen realisierbar gelten. Größere Probleme<br />
bereiten Schnittstellen auf Software-Ebene zu den<br />
übrigen Verwaltungen, mit denen Datenaustausch<br />
wünschenswert wäre.<br />
Angeregt wurde, das »Ressortdenken« aufzugeben<br />
und <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>är <strong>in</strong>tensiver abzustimmen. E<strong>in</strong><br />
konkreter Vorschlag war die Installation e<strong>in</strong>es<br />
IT-Beauftragten mit den Aufgaben der Koord<strong>in</strong>ation<br />
der Datenspeicherung, Def<strong>in</strong>ition von Schnittstellen<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
und Sicherstellung des Datenzugriffs für andere<br />
Ressorts. Um die Handlungsfähigkeit zu gewährleisten,<br />
ist e<strong>in</strong>e entsprechende Personalausstattung<br />
erforderlich.<br />
Kommunikation mit dem Bürger<br />
— Oberstes Gebot für jede Verwaltung ist Bürgerfreundlichkeit.<br />
— Man sah <strong>in</strong> unserer Verwaltung e<strong>in</strong> Problem <strong>in</strong> der<br />
Erreichbarkeit des Vorsitzenden aufgrund der<br />
häufigen Außendienste. Es sollte deshalb auf<br />
jeden Fall e<strong>in</strong> persönlicher Ansprechpartner <strong>in</strong> der<br />
Gruppe oder zum<strong>in</strong>dest im Amt (Vermittlung)<br />
Auskunft erteilen können. Technische Voraussetzung<br />
ist e<strong>in</strong>e entsprechende Nebenstellenanlage<br />
bzw. bei der Vermittlung e<strong>in</strong> Auskunftssystem auf<br />
PC. Als nicht sehr zweckmäßig wurde der automatische<br />
Anrufbeantworter betrachtet.<br />
— Es wurde die Forderung nach hoher Informationsbereitschaft<br />
mit kompetenter und rascher Auskunftserteilung<br />
gestellt. Basis hierfür ist die permanente<br />
Laufendhaltung der Daten.<br />
— Der Bürger sollte vermehrt durch Bereitstellung<br />
von Karten und Eigentumsnachweisen <strong>in</strong>formiert<br />
werden.<br />
— FAX und BTX können mit zur Erhöhung der Auskunftsbereitschaft<br />
beitragen. Der direkte Zugriff<br />
für den Bürger über PC auf Auskunftssysteme<br />
bleibt jedoch der ferneren Zukunft vorbehalten.<br />
— Als Vision für die Zukunft wird auch die Möglichkeit<br />
gesehen, vor Ort auf Computersystemen <strong>in</strong><br />
3D-Darstellung die Planungen zu visualisieren<br />
und dadurch Abstimmungsarbeiten und die<br />
Kommunikation mit dem Bürger zu unterstützen.<br />
— Beste Bürgernähe ist und bleibt jedoch die Präsenz<br />
vor Ort (Darunter leidet allerd<strong>in</strong>gs wiederum<br />
die Erreichbarkeit <strong>in</strong> der Dienststelle).<br />
DV-Technik<br />
Die Gedanken wurden im Workshop nochmals<br />
nach den Gesichtspunkten Arbeitsersparnis,<br />
Arbeitsplatzwünsche, Datenschutz, E<strong>in</strong>fachheit und<br />
Schulung/Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>g zusammengefaßt. Mit Hilfe von<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
53
Klebepunkten wurden die beiden letzten Punkte herausgestellt<br />
und unter dem Begriff Benutzerfreundlichkeit<br />
mit folgenden Ergebnissen vertieft :<br />
— Es besteht e<strong>in</strong>e zu schnelle Fluktuation der Programme;<br />
künftig sollte auf mehr Kont<strong>in</strong>uität <strong>in</strong><br />
den Bedienungsoberflächen neuer Programmversionen<br />
geachtet werden.<br />
— Nicht immer ist die Bedienungsoberfläche von<br />
Programmen klar strukturiert. Hierauf ist künftig<br />
besonderer Wert zu legen.<br />
— Neue Programmversionen s<strong>in</strong>d vor ihrer Freigabe<br />
noch umfassender zu testen.<br />
— Als dr<strong>in</strong>gend erforderlich wird die Neue<strong>in</strong>führung<br />
von Programmen <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit e<strong>in</strong>er Anwender-Schulung<br />
gehalten. Gründliche Ausbildung<br />
gewährleistet e<strong>in</strong>en wesentlich effektiveren<br />
Umgang mit den Programmen.<br />
— Die <strong>in</strong>dividuelle Bereitschaft zur Arbeit am Bildschirm<br />
kann nicht bei allen Mitarbeitern vorausgesetzt<br />
werden, wofür allerd<strong>in</strong>gs auch Verständnis<br />
aufgebracht werden muß. Man sollte sich<br />
anfangs auf die <strong>in</strong>teressierten und motivierten<br />
Mitarbeiter konzentrieren und auf den Mitnahmeeffekt<br />
<strong>in</strong>nerhalb der Gruppe bauen.<br />
Bürokommunikation <strong>in</strong> der <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong><br />
Mit Hilfe der Klebepunktemethode entschied man<br />
sich für die schwerpunktmäßige Behandlung des<br />
Themenbereiches »Info-Service«, d. h. Übernahme<br />
von Vorschriften, LMS und Informationsmaterial aller<br />
Art (Rechtsprechung, lokale Probleme, Broschüren,<br />
Dias, Informationsbriefe, technische Regeldaten) <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e Info-Datenbank mit Bereitstellung für den<br />
Benutzer am Arbeitsplatz.<br />
Bei der Diskussion der Umsetzungsprobleme wurden<br />
die Fragen gestellt, bei welchen Informationen<br />
und bis zu welchem Umfang die Speicherung s<strong>in</strong>nvoll<br />
ist, ob das erforderliche Personal für die aufwendige<br />
Erfassung und Laufendhaltung vorgehalten<br />
werden kann und ob e<strong>in</strong>e Volltextrecherche erforderlich<br />
ist oder e<strong>in</strong>e Klassifizerung nach Schlagworten<br />
ausreicht, allerd<strong>in</strong>gs mit der Gefahr der sich im Laufe<br />
der Zeit ändernden Bedeutung von Schlagworten.<br />
Probleme werden weiter dar<strong>in</strong> gesehen, daß das<br />
Lesen über den Bildschirm nur <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren Ausschnitten<br />
möglich und gewöhnungsbedürftig ist. Im<br />
Außendienst kann das System nur unter technisch<br />
sehr hohem Aufwand zur Verfügung gestellt werden.<br />
Für die Speicherung wurde die Konzentration auf<br />
Kernbereiche und Gliederung <strong>in</strong> folgende drei Stufen<br />
vorgeschlagen :<br />
— Zentraler Bereich beim M<strong>in</strong>isterium oder Bereich<br />
Zentrale Aufgaben,<br />
— Direktionsbereich,<br />
— persönliche Ablage für e<strong>in</strong> Referat oder e<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>zelperson.<br />
Bei e<strong>in</strong>er Realisierung muß unbed<strong>in</strong>gt entsprechendes<br />
Personal abgestellt se<strong>in</strong>. Zw<strong>in</strong>gend notwendig<br />
ist die Beschaffung e<strong>in</strong>er benutzerfreundlichen<br />
Software und e<strong>in</strong>e permanente Schulung.<br />
Es darf ke<strong>in</strong>e Diskussion über Papier oder<br />
Speicherung geben, sondern es muß e<strong>in</strong> s<strong>in</strong>nvolles<br />
Nebene<strong>in</strong>ander beider Medien se<strong>in</strong>.<br />
Der erste Teil des Arbeitskreises bot den Teilnehmern<br />
die Möglichkeiten, sich über neueste<br />
Techniken zu <strong>in</strong>formieren, eigene Wünsche und<br />
Gedanken e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen und wertvolle Anregungen<br />
für künftige Projekte mit auf den Weg zu nehmen.<br />
Telematik<br />
Am Nachmittag befaßte sich der Arbeitskreis mit<br />
Telematik (entstanden aus Telekommunikation und<br />
Informatik) im ländlichen Raum. Hierzu äußerte sich<br />
auch Herr Staatsm<strong>in</strong>ister Bocklet <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Vortrag<br />
»<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> für Bayern und Europa« <strong>in</strong><br />
dem S<strong>in</strong>ne, daß Landwirte mehr denn je alle Marktchancen<br />
nutzen müßten. Daher läge e<strong>in</strong> Schwerpunkt<br />
der Agrarpolitik im verstärkten E<strong>in</strong>satz neuester<br />
Techniken im ländlichen Raum. In se<strong>in</strong>em E<strong>in</strong><br />
führungsvortrag beleuchtete Prof. Dr. Maier vom<br />
Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie und Regionalplanung<br />
der Universität Bayreuth zahlreiche Aspekte<br />
der Telekommunikation im ländlichen Raum und<br />
zeigte die Möglichkeiten und Grenzen der Errichtung<br />
von Telestuben auf.<br />
Ergebnisse<br />
Die Telematik im ländlichen Raum ist grundsätzlich<br />
positiv zu sehen. Sie ist zwar ke<strong>in</strong> Mittel, um<br />
Arbeitsmarkteffekte zu erzielen, kann jedoch die<br />
äußeren Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für Landwirte und<br />
Wirtschaftsbetriebe verbessern. Die E<strong>in</strong>richtung von<br />
Telestuben ist nur mehr s<strong>in</strong>nvoll <strong>in</strong> Gebieten mit<br />
schwacher IT-Infrastruktur, sofern ausreichend Bedarf<br />
bereits vorhanden ist und sich E<strong>in</strong>zelpersonen<br />
für die konsequente Durchsetzung des Projektes<br />
engagieren. Die Ausstattung muß auf die tatsächlichen<br />
Bedürfnisse abgestimmt, für die Hard- und<br />
Software muß e<strong>in</strong>e kompetente Betreuung sichergestellt<br />
se<strong>in</strong>. Mit dem weiter fortschreitenden Preisschwund<br />
bei Telekommunikationsgeräten ist mit<br />
zunehmender Ausstattung der e<strong>in</strong>zelnen Betriebe<br />
und Haushalte und damit e<strong>in</strong>hergehend mit e<strong>in</strong>em<br />
rückgehenden Bedarf an Telestuben zu rechnen.<br />
54 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Helene Stegmann<br />
Bericht über den Arbeitskreis 7:<br />
Aus- und Fortbildung<br />
Der Arbeitskreis 7 war mit 45 Teilnehmern, fast<br />
ausschließlich aus unserer Verwaltung, besetzt. Wir<br />
haben uns entgegen der Ankündigung mit e<strong>in</strong>em<br />
Thema befaßt, das über die Aus- und Fortbildung<br />
h<strong>in</strong>ausgeht. Es lautete Personalentwicklung. Der<br />
Arbeitskreis 8 trug den Titel Unternehmenskultur.<br />
Personalentwicklung ist e<strong>in</strong> Bereich der Unternehmenskultur<br />
und die Aus- und Fortbildung stellt wiederum<br />
e<strong>in</strong>en Teilaspekt der Personalentwicklung dar.<br />
Was ist Personalentwicklung?<br />
Unter Personalentwicklung versteht man alle<br />
betrieblichen und überbetrieblichen Maßnahmen, die<br />
sich e<strong>in</strong>erseits an den geschäftspolitischen Erfordernissen<br />
und andererseits am <strong>Entwicklung</strong>spotential<br />
der Mitarbeiter orientieren.<br />
Diese Maßnahmen zielen auf die Verbesserung der<br />
Qualifikation und der Motivation der Mitarbeiter ab.<br />
Personalentwicklung geht somit weit h<strong>in</strong>aus über die<br />
re<strong>in</strong> zahlenmäßige Verwaltung des Personals nach<br />
dem Stellenplan.<br />
Die Raupe Personalverwaltung entpuppt sich<br />
zum Schmetterl<strong>in</strong>g Personalentwicklung.<br />
Personalentwicklung bedarf e<strong>in</strong>es Gesamtkonzeptes.<br />
Bevor dieses erstellt weden kann, ist es<br />
wichtig, den vorhandenen Bedarf zu ermitteln:<br />
● Was brauchen Sie für Mitarbeiter, um die Ziele<br />
des Unternehmens bestmöglich zu erreichen?<br />
Hierzu ist e<strong>in</strong> Anforderungsprofil zu erstellen, das<br />
zusätzlich zu fachlichen Kriterien auch soziale<br />
Fähigkeiten und Managementkompetenz umfaßt.<br />
● Was haben Sie für Mitarbeiter? Welche Qualifikationen<br />
s<strong>in</strong>d vorhanden?<br />
Aus dem Vergleich Soll-Ist ergibt sich e<strong>in</strong> <strong>Entwicklung</strong>sbedarf.<br />
Die Maßnahmen, die nötig s<strong>in</strong>d,<br />
um von der Ist- zur Soll-Kompetenz zu gelangen,<br />
s<strong>in</strong>d im Personalentwicklungkonzept be<strong>in</strong>haltet.<br />
Personalentwicklung — E<strong>in</strong> Thema für unsere<br />
Verwaltung?<br />
Wir bef<strong>in</strong>den uns <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Umbruchphase. Unserer<br />
Verwaltung stehen Veränderungen bevor. Herr<br />
Staatsm<strong>in</strong>ister Bocklet hat am Montag von Lean<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Unternehmenskultur<br />
Personalentwicklung<br />
Aus- und<br />
Fortbildung<br />
Zusammenhang von<br />
Unternehmenskultur, Personalentwicklung und<br />
Aus- und Fortbildung<br />
Mitarbeiter<br />
Soll-Kompetenz<br />
(Anforderungen)<br />
Personalentwicklung<br />
Soll – Ist – Vergleich<br />
qualitativer<br />
Personalentwicklungsbedarf<br />
PE-Konzept<br />
Mitarbeiter<br />
Ist-Kompetenz<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
55
adm<strong>in</strong>istration — schlanker Verwaltung gesprochen.<br />
Das Personal steht somit besonders stark im<br />
Kreuzfeuer. Schließlich stellt es <strong>in</strong> unserem Dienstleistungsunternehmen<br />
den höchsten Kostenfaktor<br />
dar, birgt andererseits aber auch das größte<br />
Potential <strong>in</strong> sich. Das Gold <strong>in</strong> unserer Verwaltung<br />
steckt <strong>in</strong> unseren Mitarbeitern. Grund genug, um<br />
sich im Arbeitskreis 7 auf Schatzsuche zu begeben,<br />
und sich mit den Menschen <strong>in</strong> unserer Verwaltung<br />
zu befassen.<br />
Der Arbeitskreis startete mit e<strong>in</strong>em Kurzreferat<br />
von Rudolf Bögel zum Thema Systematische<br />
Personalentwicklung. Herr Bögel arbeitet am<br />
Lehrstuhl für Organisations- und Wirtschaftspsychologie<br />
der Ludwig-Maximilians-Universität<br />
München bei Prof. Dr. Rosenstiel. In se<strong>in</strong>em Referat<br />
zeigte Herr Bögel die wichtigsten Bereiche der<br />
Personalentwicklung auf. E<strong>in</strong> Kernsatz aus se<strong>in</strong>em<br />
Referat lautete: Personalentwicklung ist nicht<br />
delegierbare Führungsaufgabe.<br />
Anschließend wurden die Teilnehmer selbst aktiv<br />
und erschlossen sich das große Feld der Personalentwicklung<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em ersten Schritt anhand von<br />
E<strong>in</strong>zelbauste<strong>in</strong>en. Fünf Gruppen arbeiteten unter der<br />
Leitung von Moderatoren an folgenden Themen:<br />
Personalentwicklung durch<br />
1. Auswahl und E<strong>in</strong>arbeitung neuer Mitarbeiter<br />
2. Fachliche und außerfachliche Weiterbildung<br />
3. Mitarbeiterführung<br />
4. Arbeitsgestaltung<br />
5. Persönlichkeitsentwicklung<br />
In allen Gruppen wurde zunächst Bestandsaufnahme<br />
gemacht, danach der Soll-Zustand, die Idealvorstellung,<br />
das Ziel erarbeitet und anschließend noch<br />
Wege gesucht, um diesen Zielen näher zu kommen.<br />
Ergebnisse des Arbeitskreises<br />
Faktor Zeit<br />
Geme<strong>in</strong>sam durch alle fünf Gruppen zieht sich wie<br />
e<strong>in</strong> roter Faden der Begriff Zeit. Vorgesetzte haben<br />
zu wenig Zeit für ihre Mitarbeiter. Als Ursache<br />
kristallisierte sich heraus, daß Vorgesetzten häufig<br />
nicht bewußt ist, welche Auswirkungen ihr Führungsverhalten<br />
auf ihre Mitarbeiter hat. Aktivitäten<br />
zur Führung und zur Förderung der Mitarbeiter<br />
genießen demnach nur ger<strong>in</strong>gen Stellenwert;<br />
dafür habe ich ke<strong>in</strong>e Zeit, ich muß doch arbeiten,<br />
ist von vielen Vorgesetzten zu hören. Sie werden<br />
dafür nie Zeit haben. Erst wenn sie Führung als ihre<br />
vornehmste Aufgabe sehen, erst wenn ihnen ihre<br />
Mitarbeiter wichtig s<strong>in</strong>d, werden sie sich Zeit für sie<br />
nehmen.<br />
Auswahl und E<strong>in</strong>arbeitung neuer Mitarbeiter<br />
Die erste Gruppe stellte fest, daß die bisherigen<br />
Auswahlkriterien, die sich großenteils auf die<br />
Staatsprüfungsnote beschränken, nicht ausreichend<br />
s<strong>in</strong>d. Es wurde e<strong>in</strong>e Auswahl der Mitarbeiter nach<br />
e<strong>in</strong>em möglichst vollständigen Anforderungsprofil<br />
vorgeschlagen. Die geforderte Qualifikation ist<br />
weniger <strong>in</strong> schriftlichen Prüfungen, als <strong>in</strong> Auswahlgesprächen<br />
zu ermitteln.<br />
Im Bereich der E<strong>in</strong>arbeitung neuer Mitarbeiter<br />
wurde die Bedeutung des ersten Tages an der neuen<br />
Arbeitsstelle für den Mitarbeiter verdeutlicht. Stellen<br />
Sie sich die Verlorenheit des »Neuen« vor, wenn der<br />
Vorgesetzte an diesem Tag im Außendienst ist, weil<br />
er sich den Term<strong>in</strong> nicht vorgemerkt hat und sich<br />
die Kollegen ratlos fragen: »Wo setzten wir ihn bloß<br />
h<strong>in</strong>?« Wesentlich ist auch, daß für den neuen Mitarbeiter<br />
e<strong>in</strong> persönlicher Betreuer da ist, der für<br />
e<strong>in</strong>en längeren Zeitraum geme<strong>in</strong>sam mit dem E<strong>in</strong>steiger<br />
festlegt, wie die E<strong>in</strong>arbeitung ablaufen wird.<br />
Fachliche und außerfachliche Weiterbildung<br />
Die zweite Gruppe zog folgendes Fazit: Weiterbildung<br />
ist wichtig, um qualifizierte Mitarbeiter zu<br />
haben. Die Weiterbildung muß <strong>in</strong> den Köpfen der<br />
Vorgesetzten hohen Stellenwert bekommen, damit<br />
sich etwas verändert, damit e<strong>in</strong> direktionsübergreifendes<br />
Gesamtkonzept für die fachliche Aus- und<br />
Fortbildung entsteht. E<strong>in</strong> Gesamtkonzept ist auch für<br />
die außerfachliche Weiterbildung nötig. Beide s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
das Personalentwicklungskonzept e<strong>in</strong>zuarbeiten. Bei<br />
der Erstellung sollten Vertreter unserer Verwaltung,<br />
Personalvertretungen, die Führungsakademie und<br />
freie Experten mitwirken.<br />
Mitarbeiterführung<br />
Die dritte Gruppe erarbeitete, daß der Ist-Zustand<br />
— wie Führung derzeit erlebt wird — und das Idealbild<br />
des Vorgesetzten differieren. Viel Fachkompetenz<br />
und relativ wenig soziale Kompetenzen s<strong>in</strong>d<br />
vorhanden. Die Teilnehmer der Gruppe — die<br />
ja zugleich Mitarbeiter und Vorgesetzte s<strong>in</strong>d —<br />
stellten fest:<br />
Es wird sich etwas bewegen, wenn jeder bei sich<br />
selbst anfängt und sich auf den Weg begibt, <strong>in</strong><br />
56 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Richtung dieses idealen Vorgesetzten. Grundlage für<br />
Veränderungen dazu ist natürlich, die eigenen<br />
Stärken und Schwächen zu erkennen und sich zum<br />
eigenen Verhalten Rückmeldung von se<strong>in</strong>en Mitarbeitern<br />
zu holen. Wer andere führen will, kommt<br />
an sich selbst nicht vorbei.<br />
Arbeitsgestaltung<br />
Gruppe vier erschloß sich das Thema anhand der<br />
Begriffe wie Verantwortung, Selbstorganisation,<br />
Rückmeldung, Kreativität, Lernmöglichkeit und<br />
Arbeitsplatzgestaltung. Als Auszug hier das Ergebnis<br />
zum Aspekt Kreativität: Es ist e<strong>in</strong> hohes Ideenpotential<br />
vorhanden. Leider gestaltet sich die<br />
Umsetzung <strong>in</strong> die Realität schwierig. Folglich ist es<br />
grundlegend, e<strong>in</strong> Klima zu schaffen, das Ideen und<br />
Fragen zuläßt. Neues, ungewöhnliches, verrücktes<br />
Gedankengut sollte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Ideenpool e<strong>in</strong>gebracht<br />
werden und daraus entstehende Verbesserungsvorschläge<br />
über das jetzige Maß h<strong>in</strong>aus prämiert<br />
werden.<br />
Persönlichkeitsentwicklung<br />
Im Blickpunkt lagen persönliche Eigenschaften,<br />
die im beruflichen Umfeld für erfolgreiches Handeln<br />
ausschlaggebend s<strong>in</strong>d, wie z. B.<br />
— das Wertesystem, das wir <strong>in</strong> uns tragen,<br />
— unsere Überzeugungen,<br />
— die Tatkraft, die Energie, mit der wir agieren,<br />
— die Liebe zu unserer Arbeit aber auch<br />
— die Teamfähigkeit und die Kommunikation als<br />
Schlüssel zum anderen.<br />
Stellvertretend für die Vielzahl von Ergebnissen<br />
greife ich heraus, daß es Aufgabe der Vorgesetzten<br />
ist, die Fähigkeiten ihrer Mitarbeiter zu aktivieren,<br />
Leistungen zu fordern und positiv durch Lob zu verstärken,<br />
ihre Mitarbeiter nach Eignung und Neigung<br />
e<strong>in</strong>zusetzen. Es ist aber auch Aufgabe der Vorgesetzten,<br />
das eigenständige Denken ihrer Mitarbeiter<br />
zu fördern, anstatt »Mitschwimmer« zu protegieren.<br />
E<strong>in</strong> Schlußsatz aus dieser Gruppe lautete: »Wenn ich<br />
me<strong>in</strong>e Persönlichkeit optimal entwickeln könnte,<br />
dann hätte ich’s im Beruf und im Leben leichter«.<br />
Fazit<br />
Nach der genaueren Betrachtung der E<strong>in</strong>zelbauste<strong>in</strong>e<br />
waren die Teilnehmer des Arbeiskreises mehrheitlich<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
der Me<strong>in</strong>ung, daß die Notwendigkeit besteht, die <strong>in</strong><br />
unserer Verwaltung vorhandenen zaghaften Ansätze<br />
e<strong>in</strong>er Personalentwicklung neu zu überdenken, auszubauen<br />
und <strong>in</strong> e<strong>in</strong> Gesamtkonzept zu <strong>in</strong>tegrieren.<br />
Spontan erklärten sich zehn Teilnehmer aus dem<br />
Arbeitskreis bereit, die Idee des Personalentwicklungskonzeptes<br />
aktiv weiterzutragen, dafür zu<br />
sorgen, daß Personalentwicklung <strong>in</strong> unserer Verwaltung<br />
im Gespräch bleibt. Diese zehn Teilnehmer<br />
werden sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er geme<strong>in</strong>samen Besprechung —<br />
die bereits vere<strong>in</strong>bart wurde — darüber austauschen,<br />
welche Personen <strong>in</strong> die Erstellung e<strong>in</strong>er Konzeption<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen s<strong>in</strong>d und welche Vorbereitungsschritte<br />
nötig s<strong>in</strong>d, um mit der Konzepterstellung zu<br />
beg<strong>in</strong>nen.<br />
Ihre Aufgabe kann es aber nicht se<strong>in</strong>, dieses<br />
Personalentwicklungskonzept zu erstellen. Ausschlaggebend<br />
für die Umsetzung des Konzeptes ist,<br />
daß es sowohl von den Mitarbeitern als auch von<br />
der Führungsspitze unserer Verwaltung akzeptiert<br />
wird. Nur wenn beide Gruppen frühzeitig e<strong>in</strong>bezogen<br />
werden, bestehen berechtigte Aussichten, daß das<br />
Personalentwicklungskonzept ke<strong>in</strong> Papiertiger wird,<br />
sondern auch gelebt wird und damit der Mensch<br />
immer mehr an die Stelle rückt, die ihm gebührt:<br />
Der Mensch ist Mittelpunkt.<br />
Abschließend ist es mir e<strong>in</strong> Anliegen, der<br />
Moderator<strong>in</strong>, Frau Cornelia Reiff, und den Herren<br />
Moderatoren, Egon Ankenbrand, Rudolf Langmantl,<br />
Willi Perzl und Re<strong>in</strong>hard Reif, ganz herzlich für Ihren<br />
E<strong>in</strong>satz zu danken. Die Zusammenarbeit war für<br />
mich erfreulich und konstruktiv zugleich. Me<strong>in</strong> Dank<br />
gilt aber auch allen Teilnehmern des Arbeitskreises<br />
für die aktive und engagierte Mitarbeit und den<br />
Gastgebern für die perfekte Organisation.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
57
Günter Bschor<br />
Bericht über den Arbeitskreis 8:<br />
Unternehmenskultur<br />
Zum zweiten Mal nach 1992 <strong>in</strong> Bamberg beschäftigte<br />
sich e<strong>in</strong> Arbeitskreis mit unserer eigenen<br />
»Unternehmenskultur«.<br />
Wir bauten dabei nicht auf den sachlichen<br />
Erkenntnissen des Arbeitskreises von 1992 auf,<br />
sondern bearbeiteten neue Themen. Diese Ergebnisse<br />
wollen wir gewissermaßen als weitere Glieder e<strong>in</strong>er<br />
Stoffsammlung zum Thema »Unternehmenskultur«<br />
weitergeben. Dabei hoffen wir natürlich auf entsprechende<br />
Umsetzung der enthaltenen Visionen und<br />
Anregungen.<br />
Im Arbeitskreis 8 habe ich <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>leitung e<strong>in</strong>e<br />
Parallele zum Mittelalter gezogen:<br />
Damals pflegte sich jeder König e<strong>in</strong>en Hofnarren<br />
zu halten. Der Hofnarr hatte nicht<br />
nur die Aufgabe, den König mit Scherzen zu<br />
unterhalten. Er hatte außerdem die sprichwörtliche<br />
Narrenfreiheit, die ihn verpflichtete,<br />
die Politik des Königs scharf zu beobachten<br />
und — wenn auch mit dem berufseigenen<br />
Schalk im Nacken — massive Kritik zu<br />
äußern.<br />
In Zukunft wird wohl kaum mehr e<strong>in</strong> Unternehmen<br />
ohne e<strong>in</strong>en solchen Hofnarren auskommen,<br />
und der Arbeitskreis 8 hat am Dienstag e<strong>in</strong>en<br />
solchen für unser Unternehmen »Verwaltung für<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>« gespielt: Mit etwas weniger<br />
Schalk, dafür mit um so mehr Engagement.<br />
Gleich vorweg herzlichen Dank<br />
— an alle AK-Teilnehmer für ihren aktiven E<strong>in</strong>satz,<br />
— an unseren Fachreferenten, Herrn Dr. Norbert<br />
Hagemann der Firma Sietec Consult<strong>in</strong>g <strong>in</strong><br />
München<br />
— an die Moderator<strong>in</strong>nen und Moderatoren für die<br />
gute Vorbereitung und Durchführung der Moderation<br />
und an die Helfer im H<strong>in</strong>tergrund,<br />
— an die <strong>Ansbach</strong>er Kollegen für die gute Organisation<br />
(dieses Kompliment kann ich sicher auch<br />
im Namen der anderen Arbeitskreisleiter weitergeben).<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Fachreferat und Schwerpunkte<br />
Ins Thema führte uns Herr Dr. Hagemann mit se<strong>in</strong>em<br />
Fachreferat »Unternehmensstrategie und<br />
Unternehmenskultur — der Schlüssel zum Unternehmenserfolg«<br />
e<strong>in</strong>.<br />
In e<strong>in</strong>em Schaubild zeigte er u. a. auf, daß e<strong>in</strong><br />
Unternehmen dann erfolgreich wird, wenn das<br />
Leitbild des Unternehmens und die angestrebten<br />
Ziele mit der Strategie und den zugehörigen<br />
Elementen der Unternehmenskultur harmonieren.<br />
Die Unternehmenskultur wird im allgeme<strong>in</strong>en <strong>in</strong><br />
vier Ebenen e<strong>in</strong>geteilt:<br />
— Die Artefakte (die sichtbaren Ergebnisse und<br />
Produkte),<br />
— die Normen und Verhaltensweisen,<br />
— die Wertvorstellungen,<br />
— die Grundwerte bzw. das Weltbild.<br />
Aus e<strong>in</strong>er Vorauswahl von sechs Themen aus<br />
diesen vier Ebenen beschäftigte sich unser Arbeitskreis<br />
<strong>in</strong> jeweils zwei Kle<strong>in</strong>gruppen mit folgenden drei<br />
selbst gewählten Themen:<br />
● Aus dem Bereich der Artefakte die Identifikation,<br />
Market<strong>in</strong>g und Außenwirkung: Unsere Arbeit am<br />
Beispiel der gestalteten Landschaft.<br />
● Aus dem Bereich der Normen das Konflikt-, Informations-<br />
und Kooperationsverhalten <strong>in</strong> unserer<br />
Verwaltung.<br />
● Aus dem Bereich der Wertvorstellungen die E<strong>in</strong>stellung<br />
zu Innovationen und ihre Auswirkung<br />
auf unsere Arbeit.<br />
Aus der Fülle der Anregungen, Visionen und<br />
Umsetzungsvorschläge kann ich im Rahmen dieses<br />
Kurzberichtes nur e<strong>in</strong>en kle<strong>in</strong>en Auszug wiedergeben.<br />
In e<strong>in</strong>er pragmatischen, ergebnisorientierten<br />
Diskussion <strong>in</strong> den Kle<strong>in</strong>gruppen und jeweils anschließend<br />
im Gesamt-AK stellten wir u. a. fest:<br />
1. Unsere Unternehmenskultur braucht zur <strong>Entwicklung</strong><br />
mehr Freiräume. Hierfür müssen wir vordr<strong>in</strong>glich<br />
e<strong>in</strong>e Überfrachtung von Arbeit<br />
(»Altlasten« wurden genannt) und Verfahren<br />
abbauen.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
59
2. Wir müssen e<strong>in</strong> partnerschaftlich entwickeltes<br />
Leitbild mit Außen-, und aus der Sicht des<br />
Arbeitskreises noch vordr<strong>in</strong>glicher mit Innenbezug,<br />
aufstellen bzw. <strong>in</strong> Teilbereichen fortschreiben.<br />
Dazu e<strong>in</strong>ige Schlagworte:<br />
— Mitarbeiter- und Teamorientierung s<strong>in</strong>d<br />
gefragt (z. B. sollten die Referentenbesprechungen<br />
an unserem M<strong>in</strong>isterium fortgesetzt werden).<br />
Interessanterweise wurde die Personalvertretung<br />
<strong>in</strong> den Gruppenberichten nicht angesprochen.<br />
— Mehr Streitkultur ist gefragt: Konflikte offen<br />
angehen und ansprechen (nicht nur auf Abteilungs-<br />
und Referatsebene).<br />
— E<strong>in</strong>e bessere Informationskultur ist gefragt: E<strong>in</strong><br />
offener Informationsaustausch zwischen den verschiedenen<br />
Ebenen; e<strong>in</strong>e bessere Nutzung der<br />
Möglichkeiten unserer Bildschirmarbeitsplätze <strong>in</strong><br />
den Abteilungen, Referaten und Gruppen im<br />
Informationsbereich.<br />
— E<strong>in</strong> dynamisches Angehen unserer Aufgabe als<br />
Dienstleistungsunternehmen <strong>in</strong> Partnerschaft mit<br />
unseren Kunden.<br />
3. E<strong>in</strong>en weiteren Schwerpunkt bildete die<br />
Leistungsorientierung.<br />
Dazu wieder e<strong>in</strong>ige Schlagworte:<br />
— »Leistung« bedarf dr<strong>in</strong>gend der Def<strong>in</strong>ition;<br />
Anforderungsprofile bzw. Leistungskriterien müssen<br />
hierfür aufgestellt werden. U. a. wurde auch<br />
die Rotation von Führungskräften bzw. deren<br />
Wahlmöglichkeit diskutiert.<br />
— E<strong>in</strong> Stichwort fiel <strong>in</strong> fast allen Diskussionen: Der<br />
»Perfektionismus« <strong>in</strong> unserer Verwaltung (und im<br />
übrigen wohl Schicksal jeder Verwaltung im Laufe<br />
der Zeit). Mehr Mut zu Fehlern ist angesagt und<br />
Vere<strong>in</strong>fachung von Vorschriften bzw. Abläufen,<br />
Orientierungshilfen geben statt Vorschriften<br />
(Negativbeispiele dazu: UVP, Planfeststellungsrichtl<strong>in</strong>ien).<br />
— Weiterh<strong>in</strong>: Innovationen fördern – <strong>in</strong>tern und<br />
extern –, u. a. durch mehr Transparenz und<br />
Motivationsarbeit. E<strong>in</strong>e Def<strong>in</strong>ition der Anforderungen<br />
an unsere Produkte ersche<strong>in</strong>t vordr<strong>in</strong>glich:<br />
Für unser Unternehmen und auch unsere<br />
Kunden — vor allem Bürger und Geme<strong>in</strong>den.<br />
— Mehr Anreize <strong>in</strong>nerhalb der Verwaltung schaffen<br />
(Arbeitsklima, Belobigungen).<br />
Unternehmenskultur<br />
Ergebnisse (Auszug):<br />
1. Freiräume<br />
– Überfrachtung abbauen<br />
2. Leitbild<br />
– partnerschaftlicher Innenbezug<br />
– partnerschaftlicher Außenbezug<br />
3. Leistungsorientierung<br />
Unser Arbeitskreis 8 — es waren <strong>in</strong>sgesamt 42<br />
Teilnehmer e<strong>in</strong>schließlich der Moderatoren, darunter<br />
außer Kolleg<strong>in</strong>nen und Kollegen unserer Verwaltung<br />
und dem Fachreferenten e<strong>in</strong> Gast aus Holland vom<br />
dortigen Landwirtschaftsm<strong>in</strong>isterium, e<strong>in</strong>e Vertreter<strong>in</strong><br />
der ÖTV sowie e<strong>in</strong>e Kolleg<strong>in</strong> aus der Landwirtschaftsabteilung<br />
der Regierung von Mittelfranken —<br />
beauftragte mich als AK-Leiter, außer dieser Kurzfassung<br />
auch e<strong>in</strong>e Langfassung unserer Ergebnisse<br />
zur Weitergabe an unser M<strong>in</strong>isterium zu fertigen.<br />
Ich gehe diese Aufgabe gerne an.<br />
60 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Marianne Deml<br />
Hilfe zur Selbsthilfe — <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> mit den<br />
Menschen für die Menschen<br />
Me<strong>in</strong>e Damen und Herren, wir s<strong>in</strong>d fast am Ende<br />
e<strong>in</strong>er Veranstaltung, die sich vier Tage lang <strong>in</strong>tensiv<br />
mit dem ländlichen Raum befaßt hat. Die große<br />
Anzahl von 850 Teilnehmern, darunter die vielen<br />
außerbayerischen und ausländischen Gäste zeigen<br />
das zentrale Interesse an den ländlichen Räumen<br />
und ihrer notwendigen Weiterentwicklung e<strong>in</strong>drucksvoll<br />
auf.<br />
E<strong>in</strong>e, wenn nicht gar die Erklärung dafür gibt das<br />
neueste Gutachten <strong>1994</strong> des Sachverständigenrates<br />
für Umweltfragen der Bundesregierung. Der Rat<br />
führt dar<strong>in</strong> direkt zum Thema:<br />
»Durch die Rio-Konferenz der Vere<strong>in</strong>ten Nationen<br />
im Juni 1992 ist die umfassende politische Zielbestimmung<br />
»susta<strong>in</strong>able development« (entspricht<br />
nachhaltiger <strong>Entwicklung</strong>) als wegweisende Programmatik<br />
für die Bewältigung der geme<strong>in</strong>samen<br />
Zukunft der Menschheit für die <strong>in</strong>ternationale Völkergeme<strong>in</strong>schaft<br />
verb<strong>in</strong>dlich geworden. Mit diesem<br />
Leitbegriff wird kenntlich gemacht, daß ökonomische,<br />
ökologische und soziale <strong>Entwicklung</strong> notwendig<br />
als e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>nere E<strong>in</strong>heit zu sehen s<strong>in</strong>d.« Wenig<br />
später heißt es noch deutlicher: Der entscheidende<br />
Erkenntnisfortschritt, der mit dem Nachhaltigkeits-<br />
Konzept erreicht worden ist, liegt <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>sicht, daß<br />
ökonomische, ökologische und soziale <strong>Entwicklung</strong><br />
nicht vone<strong>in</strong>ander abgespalten und gegene<strong>in</strong>ander<br />
ausgespielt werden dürfen.<br />
Nun könnte man entgegenhalten, daß die<br />
<strong>Entwicklung</strong> bisher <strong>in</strong> weiten Bereichen genau umgekehrt<br />
verlaufen ist und noch vielfach verläuft: Wir<br />
leben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Zeit kaum dagewesenen materialistischen<br />
Denkens, wo z. B. das monetäre E<strong>in</strong>kommen<br />
mit zum wichtigsten Wertmaßstab überhaupt geworden<br />
ist.. Ökologische Gefahren und Erfordernisse<br />
werden zwar breit diskutiert, aber zwischen den<br />
Ansprüchen und Erwartungen an Gesellschaft und<br />
Politik e<strong>in</strong>erseits und dem persönlichen Verhalten<br />
andererseits besteht vielfach e<strong>in</strong>e große Diskrepanz.<br />
Die sozialen B<strong>in</strong>dungen <strong>in</strong> der Gesellschaft brechen<br />
immer mehr auf. Jeder von uns spürt e<strong>in</strong>e<br />
grundlegende Veränderung der Prioritäten der<br />
Werte. Selbstentfaltungswerte erhalten zunehmend<br />
mehr Gewicht für die Lebensorientierung, die<br />
Lebensrisiken und der soziale Bereich werden aber<br />
kollektiviert.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Gleichwohl haben wir gerade <strong>in</strong> Deutschland, <strong>in</strong><br />
Bayern noch gute Chancen, zu e<strong>in</strong>er solchen <strong>Entwicklung</strong>,<br />
wie sie im Sachverständigengutachten als<br />
Überlebensweg gefordert wird, zu kommen. Wir<br />
besitzen e<strong>in</strong> reiches und hochentwickeltes technisches<br />
Know how (z. B. im Bereich Umwelttechnik)<br />
und e<strong>in</strong>e entsprechende ökonomische Leistungskraft.<br />
Zudem ist e<strong>in</strong> Bewußtse<strong>in</strong>swandel unübersehbar<br />
geworden.<br />
Gerade der ländliche Raum kann und muß vielleicht<br />
sogar dabei Pionierfunktion übernehmen. Hier<br />
liegen e<strong>in</strong>deutig die besseren Voraussetzungen zu<br />
e<strong>in</strong>er <strong>Entwicklung</strong>, welche unter der Berücksichtigung<br />
ökonomischer, ökologischer und sozial-kultureller<br />
Aspekte auf Nachhaltigkeit und E<strong>in</strong>klang mit<br />
der Natur angelegt ist.<br />
<strong>Ländliche</strong>r Raum — dieser viel benutzte und doch<br />
irgendwie abstrakte Begriff beschreibt nämlich etwa<br />
80 % der Fläche Bayerns. Er ist Heimat für mehr als<br />
50 % der Bevölkerung. Doch damit nicht genug:<br />
In diesem ländlichen Raum verlaufen sämtliche<br />
Verb<strong>in</strong>dungswege zwischen den Städten, dort<br />
werden die Nahrungsmittel produziert, von dort<br />
Schlußveranstaltung<br />
61
kommt das Tr<strong>in</strong>kwasser, und dort entsteht der<br />
Sauerstoff. Darüber h<strong>in</strong>aus hat der ländliche Raum<br />
<strong>in</strong>teressanterweise <strong>in</strong> den letzten Jahren wieder an<br />
Zugkraft gewonnen. Nach e<strong>in</strong>er Langzeitstudie des<br />
Instituts für Demoskopie Allensbach wollen heute<br />
deutlich mehr Menschen im ländlichen Raum leben<br />
als z. B. 1970.<br />
Ich komme aus dem ländlichen Raum, mich überrascht<br />
dies nicht. In e<strong>in</strong>er Zeit, wo bewährte Strukturen<br />
starken Änderungen unterworfen s<strong>in</strong>d oder<br />
gleich ganz aufgelöst werden, wo hedonistischen<br />
Werten wie Genuß und egoistischer Selbstverwirklichung<br />
mit der Folge <strong>in</strong>nerer S<strong>in</strong>nleere immer<br />
höhere Bedeutung zugemessen wird, gibt es naturgemäß<br />
auch e<strong>in</strong>e starke Umkehrreaktion.<br />
Der Wunsch nach Orientierung, Heimat und<br />
Geborgenheit sowie unverfälschter Natur wird —<br />
vor allem auch seitens der nichtländlichen Bevölkerung<br />
— lauter. Zum Wesen des ländlichen Raums<br />
gehört nämlich neben der genannten ökonomischmateriellen<br />
noch e<strong>in</strong>e ganz andere Seite: Die immaterielle,<br />
geistig-kulturelle, die Gefühle ansprechende<br />
Seite. Für sehr viele Menschen steht der ländliche<br />
Raum für Begriffe wie Harmonie, Nachbarschaft,<br />
Geme<strong>in</strong>schaft, Zufriedenheit, Wärme, Identität.<br />
Dies mag mit Er<strong>in</strong>nerungen an e<strong>in</strong>e glückliche<br />
K<strong>in</strong>dheit zusammenhängen; es kann aber auch<br />
Ausdruck der gesellschaftlichen Krise der Städte<br />
se<strong>in</strong>; Ausdruck der Sehnsucht der Menschen. Doch<br />
der ländliche Raum ist ke<strong>in</strong>e heile Welt, sondern<br />
hat — trotz unverkennbar großer Fortschritte gerade<br />
<strong>in</strong> Bayern — mit großen Problemen zu kämpfen<br />
und bedarf weiterer Unterstützung.<br />
Kommissions-Präsident Jaques Delors wurde kürzlich<br />
mit den Worten zitiert: »Die Sicherung des<br />
ländlichen Raums ist e<strong>in</strong>es der lebenswichtigen<br />
Themen für die Zukunft unserer Gesellschaft«.<br />
Noch deutlicher wurde se<strong>in</strong> französischer Landsmann<br />
Edgar Faure, als er ebenso plastisch wie<br />
drastisch formulierte: »Wenn das Land nicht mehr<br />
atmet, ersticken die Städte«.<br />
Die Pflege und <strong>Entwicklung</strong> dieser Räume ist also<br />
von großer Bedeutung für <strong>Stadt</strong> und Land, wie ja<br />
auch das Motto der Tagung richtigerweise gewählt<br />
worden ist.<br />
Diese große Aufgabe kann auf Dauer weder alle<strong>in</strong><br />
von außen noch alle<strong>in</strong> von <strong>in</strong>nen heraus bewältigt<br />
werden. Die Hauptlast haben gleichwohl die Menschen<br />
im ländlichen Raum selbst zu tragen. Dies<br />
werden sie nur dann gerne tun und tun können,<br />
wenn sie dabei auch mitwirken und mitentscheiden<br />
können.<br />
In kle<strong>in</strong>en überschaubaren Lebensbereichen kann<br />
Demokratie <strong>in</strong> besonderem Maße gelebt und erlebt<br />
werden. Damit sie gute Entscheidungen treffen können,<br />
müssen die Menschen darauf vorbereitet se<strong>in</strong>.<br />
Dafür müssen Hilfe und Unterstützung von außen<br />
kommen.<br />
Hilfe zur Selbsthilfe muß mit Leben erfüllt<br />
werden<br />
Bei der Überlegung, was der Mensch im ländlichen<br />
Raum braucht, wo Unterstützung notwendig<br />
ersche<strong>in</strong>t, müssen wir die Bedürfnisse der Menschen<br />
unter den speziellen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen der ländlichen<br />
Gebiete kennen.<br />
Längst wissen wir, daß Zufriedenheit der Menschen<br />
sich nicht alle<strong>in</strong> <strong>in</strong> materiellem Besitz und<br />
Genuß gründet. Bei der <strong>Fachtagung</strong> der Bayerischen<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsverwaltung 1990 <strong>in</strong> Passau brachte<br />
der Schweizer Agrarsoziologe Theodor Abt dieses<br />
Problem auf den Punkt: Es geht um Speck und<br />
Blume. Der Mensch muß materiell die Möglichkeiten<br />
haben, im ländlichen Raum leben und arbeiten zu<br />
können, und er muß e<strong>in</strong> menschliches, e<strong>in</strong> soziales<br />
Umfeld vorf<strong>in</strong>den, um dort ausgeglichen und <strong>in</strong><br />
Harmonie zu leben.<br />
Zu ersterem zähle ich z. B.<br />
— qualifizierte Arbeitsplätze <strong>in</strong> Wohnortnähe,<br />
— ausreichende Infrastruktur,<br />
— menschenwürdige Wohnverhältnisse.<br />
Beim zweiten denke ich an Faktoren wie<br />
— soziale Dorfgeme<strong>in</strong>schaft,<br />
— zwischenmenschliche Kommunikation und<br />
Hilfen,<br />
— E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> Natur und Landschaft; manche<br />
sprechen gar von ›Seelenlandschaften‹ und<br />
me<strong>in</strong>en damit, daß der Mensch <strong>in</strong> geistig-seelischer<br />
Harmonie mit der Landschaft leben können<br />
muß.<br />
Dies ist ja auch der Grund dafür, daß es so viele<br />
Menschen h<strong>in</strong>aus <strong>in</strong> die Dörfer und Landschaften<br />
zieht, ob auf Dauer oder nur zeitweise im Urlaub<br />
oder am Wochenende.<br />
E<strong>in</strong> weiteres: Nirgendwo mehr als im ländlichen<br />
Raum s<strong>in</strong>d die Chance und Verpflichtung zur Selbsthilfe,<br />
zur Eigen<strong>in</strong>itiative gegeben. Dieses Pr<strong>in</strong>zip fand<br />
bekanntlich nach frühen Vorläufern im Mittelalter<br />
se<strong>in</strong>e klassische Formulierung <strong>in</strong> der päpstlichen<br />
Enzyklika »Quadragesimo anno« vom 15. Mai 1931.<br />
Ich darf sie kurz <strong>in</strong> Er<strong>in</strong>nerung rufen:<br />
62 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
»Es muß allzeit unverrückbar jener oberste sozialphilosophische<br />
Grundsatz festgehalten werden, an<br />
dem nicht zu rütteln noch zu deuteln ist: Wie dasjenige,<br />
was der E<strong>in</strong>zelmensch aus eigener Initiative<br />
und mit se<strong>in</strong>en eigenen Kräften leisten kann, ihm<br />
nicht entzogen und der Gesellschaftstätigkeit zugewiesen<br />
werden darf, so verstößt es gegen die<br />
Gerechtigkeit, das, was die kle<strong>in</strong>eren und untergeordneten<br />
Geme<strong>in</strong>wesen leisten und zum guten Ende<br />
führen können, für die weitere und übergeordnete<br />
Geme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> Anspruch zu nehmen«.<br />
Daß das Pochen auf dieses Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zip<br />
nicht nur Rechte, sondern auch Pflichten mit sich<br />
br<strong>in</strong>gt, möchte ich nachfolgend am Beispiel der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> deutlich machen. Das ist ja<br />
auch <strong>in</strong> der Formulierung me<strong>in</strong>es Themas »Mit den<br />
Menschen für die Menschen« enthalten.<br />
Der ländliche Raum kann so e<strong>in</strong>en überzeugenden<br />
Anspruch auf das Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zip geltend<br />
machen. Die nächstkle<strong>in</strong>e gesellschaftliche E<strong>in</strong>heit<br />
nach dem Individuum ist die Familie; sie ist nach wie<br />
vor die Keimzelle des Staates, und sie ist im ländlichen<br />
Raum noch bei weitem häufiger anzutreffen<br />
als <strong>in</strong> der <strong>Stadt</strong>. Dies gilt es zu nutzen und zu<br />
fördern.<br />
Die bayerische Politik unterstützt seit jeher die<br />
Familien <strong>in</strong> besonderem Maße, weil <strong>in</strong>takte Familien<br />
für die Zukunft e<strong>in</strong>er Gesellschaft unersetzlich<br />
s<strong>in</strong>d. Bayern gewährt deshalb auch Landeserziehungsgeld.<br />
Familien vermitteln menschliche Wärme,<br />
Ganzheit und Lebendigkeit <strong>in</strong> unserer kühler gewordenen<br />
und segmentierten Welt. Sie leisten e<strong>in</strong>en<br />
unbezahlbaren Sozialbeitrag im Zusammenleben der<br />
Generationen. Der Unterstützung und Stärkung<br />
bedarf aber auch die dörfliche Geme<strong>in</strong>schaft, um<br />
möglichst viele Aufgaben selbst erledigen zu können.<br />
Hilfe von außen schließlich muß dort kommen,<br />
wo die Familie, die Dorfgeme<strong>in</strong>schaft, die Geme<strong>in</strong>de<br />
überfordert s<strong>in</strong>d. Diese Hilfe muß vor allem die Rahmenbed<strong>in</strong>gungen<br />
schaffen, die es den Menschen<br />
ermöglichen aus eigener Kraft die weitere Zukunft<br />
zu meistern.<br />
Es sollte aber auch e<strong>in</strong>e Hilfe se<strong>in</strong>, welche die<br />
Menschen zusammenführt. Menschen, die gut mite<strong>in</strong>ander<br />
leben sollen, müssen vor allem mite<strong>in</strong>ander<br />
reden, mite<strong>in</strong>ander handeln und sich gegenseitig<br />
helfen. Dann erst können gelebte Nachbarschaft und<br />
Nachbarschaftshilfe entstehen.<br />
Ich sage ganz deutlich:<br />
Gerade im ländlichen Raum bestehen hervorragende<br />
Chancen für e<strong>in</strong>e ganzheitliche, auch<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
sozialen Aspekten entsprechende <strong>Entwicklung</strong>,<br />
wie sie die Rio-Konferenz gefordert hat.<br />
Ganzheitliche <strong>Entwicklung</strong>: nichts anderes auch<br />
will die bayerische Form der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>in</strong> Dorf und Flur. Sie besitzt e<strong>in</strong>en wesentlichen Vorteil:<br />
Das über 70 Jahre alte Genossenschaftspr<strong>in</strong>zip<br />
gewährt die Chance zur Selbsthilfe und Selbstbestimmung<br />
und entspricht <strong>in</strong> vielem dem christlichen<br />
Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zip. Der lokale Bezug, der direkte<br />
Kontakt von Mensch zu Mensch s<strong>in</strong>d ebenso gegeben<br />
wie Hilfe von außen. Es ist eigentlich nur darauf<br />
zu achten, daß von außen z. B. seitens der Behörden<br />
zwar Hilfestellung, aber nicht zuviel Dom<strong>in</strong>anz bei<br />
Planung, Diskussion und Realisierung e<strong>in</strong>fließt.<br />
Subsidiarität und Dezentralisierung s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der<br />
bayerischen Flurbere<strong>in</strong>igung schon lang geübte<br />
Praxis, sozusagen Tradition, be<strong>in</strong>ahe hätte ich gesagt<br />
»guter Brauch«.<br />
Ich möchte dies noch etwas konkretisieren:<br />
Zu den Mitwirkenden bei der »Menschen-<br />
Initiative Dorf- und Landentwicklung«<br />
Dem Vorstand der Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaft<br />
kommt <strong>in</strong> Bayern e<strong>in</strong>e besonders gewichtige Rolle<br />
zu. Ich habe die Flurbere<strong>in</strong>igung zu Hause selbst<br />
erlebt und weiß deshalb, wie wichtig es ist, daß dieser<br />
Vorstand richtig zusammengesetzt und dessen<br />
Wahl gut vorbereitet ist. Dazu <strong>dient</strong> e<strong>in</strong>e breite<br />
Information der wahlberechtigten Grundstückseigentümer<br />
sowie aller wählbaren Bürger über die<br />
Möglichkeiten von Dorferneuerung und Flurentwicklung<br />
sowie die Aufgaben des Vorstands dabei.<br />
Leider s<strong>in</strong>d nach wie vor zu wenig Frauen <strong>in</strong> den<br />
Vorständen der Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaften. Die<br />
Ursachen hierfür s<strong>in</strong>d vielfältig. Wir sollten daran<br />
arbeiten, daß sich der Anteil der Frauen erhöht.<br />
Denn: Frauen verbr<strong>in</strong>gen doch deutlich mehr Zeit im<br />
Dorf als die Männer, sie kennen die Probleme besser<br />
als die Männer! Sie s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> ihren Rollen als Betriebsund<br />
Haushaltsführer<strong>in</strong>, als Mutter und oft Pfleger<strong>in</strong><br />
der alten Generation besonders von Mängeln im<br />
Dorf betroffen; sie s<strong>in</strong>d von ihrer sozialen Kompetenz<br />
her hochqualifiziert, ihre Me<strong>in</strong>ung <strong>in</strong> die<br />
Diskussionsprozesse e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen.<br />
Es kann doch nicht se<strong>in</strong>, daß immer mehr pendelnde<br />
Männer sich für e<strong>in</strong>e Vorstandssitzung erst<br />
mühsam von der Arbeit fre<strong>in</strong>ehmen müssen,<br />
während ihre Ehefrauen ohneh<strong>in</strong> im Dorf und am<br />
Hof s<strong>in</strong>d. Ich b<strong>in</strong> sicher, die allermeisten Vorstände<br />
würden durch Frauen auch erheblich an Menschlichkeit<br />
und »alltagspraktischer Klugheit« gew<strong>in</strong>nen.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
63
Teilnehmer an e<strong>in</strong>em Verfahren s<strong>in</strong>d bekanntlich<br />
alle Grundstückseigentümer. Sie bilden die sogenannte<br />
Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaft. Eigentum ist e<strong>in</strong><br />
hohes Gut. Es muß jeden Grundeigentümer <strong>in</strong>teressieren,<br />
was mit und auf se<strong>in</strong>em Grund und Boden<br />
geschieht. Die Grundeigentümer sollten daher frühzeitig,<br />
<strong>in</strong> die Vorbereitungs- und Planungsphase e<strong>in</strong>bezogen<br />
werden. Gleiches gilt für die Realisierung.<br />
Dadurch läßt sich beizeiten mancher Ärger vermeiden;<br />
zudem entstehen Identifikation und Verantwortung<br />
für Projekte nur dann, wenn die Menschen<br />
umfassend mitgewirkt haben, auf das Erreichte stolz<br />
se<strong>in</strong> können. (»Du bist zeitlebens für das verantwortlich,<br />
was Du Dir vertraut gemacht hast«)<br />
Bei der Neue<strong>in</strong>teilung des Grundbesitzes ist die<br />
Beteiligung der Grundeigentümer ohneh<strong>in</strong> gesetzlich<br />
geregelt. In letzter Zeit gehen die Vorstände immer<br />
mehr dazu über, E<strong>in</strong>vernehmen durch freiwillige<br />
Lösungen zu erzielen. Ich begrüße das sehr — es<br />
hilft die Akzeptanz der so wichtigen wie schwierigen<br />
Aufgabe der Neuordnung der Grundstücke zu<br />
erhöhen.<br />
Viele Maßnahmen <strong>in</strong> Dorf und umgebender Flur<br />
berühren die Interessen aller. Neue bzw. verbesserte<br />
Verkehrswege oder Freizeite<strong>in</strong>richtungen werden<br />
z. B. von allen genutzt. Es sollten daher nicht nur<br />
die Grundeigentümer, sondern alle Bürger im<br />
Dorf <strong>in</strong>formiert und zur Mitarbeit animiert werden.<br />
Dem viel zitierten Verlust an Solidarität, den<br />
wachsenden Vere<strong>in</strong>samungen und dem entstehenden<br />
Frust kann hier Positives entgegengesetzt werden:<br />
Aufruf und reichlich gebotene Gelegenheit zur<br />
aktiven Mitarbeit.<br />
Dazu müssen die Dorfbewohner bereit se<strong>in</strong>, dazu<br />
müssen aber auch die leitenden Personen, die Bürgermeister<br />
und Angehörigen der Verwaltung ihren<br />
Teil beitragen; sie müssen diese Mitarbeit wollen und<br />
e<strong>in</strong>fordern. Die gewonnene Ideenvielfalt wird alle<br />
Mühen rechtfertigen.<br />
Die E<strong>in</strong>beziehung aller Bürger ist zudem e<strong>in</strong>e<br />
große Chance, daß die Menschen wirklich zue<strong>in</strong>ander<br />
f<strong>in</strong>den. Wenn Landwirt und Handwerker, alte<strong>in</strong>gesessene<br />
Dorfbewohner und Neubürger sich geme<strong>in</strong>sam<br />
der Probleme annehmen und mite<strong>in</strong>ander<br />
nach Lösungen suchen, werden sie diese später<br />
auch geme<strong>in</strong>sam tragen und umsetzen wollen. Das<br />
gegenseitige Verständnis steigt. Der Wert der bäuerlichen<br />
Kultur kann so neue Akzeptanz erfahren; und<br />
die Leistung der bäuerlichen Familien für den geme<strong>in</strong>samen<br />
Lebens- und Heimatraum gelangt stärker<br />
<strong>in</strong> das allgeme<strong>in</strong>e Bewußtse<strong>in</strong>.<br />
Der Kirche und ihren Organisationen kommt bei<br />
der Förderung dieser neuen Planungs- und Kommunikationskultur<br />
e<strong>in</strong>e bedeutende Rolle zu. Das<br />
Gedankengut der christlichen Soziallehre sollte gerade<br />
bei der Ause<strong>in</strong>andersetzung der Menschen mit<br />
ihrem Lebensraum stärker e<strong>in</strong>fließen. Ich kann aus<br />
eigener langjähriger Erfahrung nur wärmstens empfehlen,<br />
die Potentiale der kirchlichen Kreise zu nutzen.<br />
Auch hierbei gibt es e<strong>in</strong>e Hol- und e<strong>in</strong>e Br<strong>in</strong>gschuld.<br />
Die Mithilfe der Kirche für die Menschen<br />
muß nachgefragt werden; die Vertreter der kirchlichen<br />
Seite müssen dazu aber auch bereit se<strong>in</strong>.<br />
Information, Bildung und Motivation für die<br />
Menschen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> Gebot der Stunde<br />
Ich habe von Hilfe zur Selbsthilfe gesprochen: Um<br />
sich selber helfen, d. h. um mitreden und mitbestimmen<br />
zu können, muß e<strong>in</strong>em zuvor geholfen werden,d.<br />
h. es muß dafür gesorgt werden, daß man<br />
<strong>in</strong>formiert ist, entsprechende Kenntnisse besitzt und<br />
auch mitmachen will, also motiviert ist. Diese Hilfe<br />
kostet Zeit; aber es ist e<strong>in</strong>e gut <strong>in</strong>vestierte Zeit. Ich<br />
halte die Vorbereitungsarbeiten z. B. bei der Dorferneuerung<br />
für ausgesprochen nützlich und hilfreich.<br />
Besonders das erfolgreiche Wirken der<br />
Schulen der Dorf- und Landentwicklung ist hier<br />
hervorzuheben. Ich freue mich, daß auch <strong>in</strong> anderen<br />
Bundesländern solche Schulen gegründet wurden<br />
bzw. werden sollen. Sie vermitteln das wichtige<br />
geistige und technisch-planerische Rüstzeug für<br />
Dorferneuerung und Flurentwicklung. Mehr gefordert<br />
s<strong>in</strong>d hier auch die Landvolkshochschulen.<br />
Ich wünsche mir auch bei Flurentwicklungsverfahren<br />
e<strong>in</strong>e ähnlich <strong>in</strong>tensive Vorbereitung; auch für<br />
die künftige Landnutzung und Flurgestaltung brauchen<br />
wir geme<strong>in</strong>sam erarbeitete Leitgedanken. Dort<br />
s<strong>in</strong>d die Veränderungen am Eigentum eher noch<br />
stärker gegeben, dort gibt es auch mehr Beschwerdefälle,<br />
die vielfach auf Unwissenheit basieren.<br />
Männer, Frauen, Alt und Jung — alle brauchen<br />
Fürsorge und Mitsprache<br />
Die Dorferneuerung hat e<strong>in</strong>en ganzheitlichen<br />
Ansatz. Damit me<strong>in</strong>en wir nicht nur den Lebensraum,<br />
sondern auch den Menschen <strong>in</strong> all se<strong>in</strong>en Lebensphasen<br />
und <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em vielfältigen Wirken, sei es <strong>in</strong><br />
der Arbeit, auf sozialem Gebiet oder im kulturellen<br />
Bereich. Im Weltjahr der Familie möchte ich diese<br />
Ganzheitlichkeit zuallererst auf die Menschen angewendet<br />
wissen.<br />
64 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Vor allem die Frauen bilden, wie bereits erwähnt,<br />
das Rückgrat e<strong>in</strong>er Dorfgeme<strong>in</strong>schaft. Sie leisten den<br />
Großteil der Hausarbeit, sie s<strong>in</strong>d z. B. bei Nebenerwerbslandwirten<br />
meist die Leistungsträger des<br />
Hofes, ebenso bei zusätzlichen E<strong>in</strong>kommenszweigen<br />
wie Urlaub auf dem Bauernhof, Direktvermarktung<br />
oder ähnlichem. Sie pflegen häufig alte und pflegebedürftige<br />
Familienangehörige und s<strong>in</strong>d vielfach<br />
ehrenamtlich tätig.<br />
Die Bayerische Staatsregierung hat das Jahr <strong>1994</strong><br />
zum Jahr des Ehrenamtes erklärt. Für uns hat die<br />
freiwillige unentgeltliche Arbeit vieler e<strong>in</strong>zelner<br />
für andere Menschen oder Gruppen e<strong>in</strong>e hohe<br />
gesellschaftspolitische Bedeutung. Gerade das<br />
Lebensfeld Dorf wird durch den selbstlosen und<br />
engagierten E<strong>in</strong>satz von Frauen und Männern<br />
gestaltet. Aber gerade Frauen können aus dem täglichen<br />
Erleben heraus sagen, wo im Dorf oder <strong>in</strong> der<br />
Flur der Schuh drückt; es ist, wie erwähnt, e<strong>in</strong> wichtiges<br />
politisches Ziel von mir, die Frauen aufzurufen,<br />
auch bei Projekten der Dorferneuerung und Flurentwicklung<br />
noch aktiver mitzuwirken. Hier an dieser<br />
Stelle möchte ich jedoch Sie, me<strong>in</strong>e Damen und<br />
Herren von der Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>,<br />
auffordern, dabei offen zu se<strong>in</strong>, noch mehr auf<br />
das zu achten, was Frauen speziell aus ihrer Sicht<br />
e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen und deren Anliegen auch wirklich ernst<br />
zu nehmen.<br />
Auch die Erfahrung der Senioren, der alten<br />
Menschen sollte noch stärker genutzt werden. Im<br />
ländlichen Raum, im Dorf, leben <strong>in</strong> den Familien ja <strong>in</strong><br />
der Regel noch mehrere Generationen zusammen.<br />
Die Erfahrung und das Wissen der älteren Menschen<br />
s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> unwiederbr<strong>in</strong>gliches Kapital. Die Fragen,<br />
warum etwas früher so und nicht anders war oder<br />
gemacht worden ist, können nur von dieser Generation<br />
authentisch beantwortet werden. Die Berücksichtigung<br />
differenzierter sozialer Verhältnisse und<br />
der Brückenschlag von Ökonomie zur Ökologie wurden<br />
früher oft bewundernswert gut beachtet. Bei der<br />
Suche nach e<strong>in</strong>er nachhaltigen ländlichen <strong>Entwicklung</strong>,<br />
welche die ökonomischen, ökologischen und<br />
sozialen Belange zusammenführt, sollten wir deshalb<br />
öfters »Spurensuche« bei unseren alten Mitbürgern<br />
betreiben.<br />
Genauso wichtig ist die E<strong>in</strong>beziehung der K<strong>in</strong>der.<br />
Hier gibt es erfreuliche Ansätze, wenn ich nur an die<br />
neueste Broschüre »Unterrichtsmaterialien zur <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong>« zum Thema »Unsere Heimat:<br />
Dorf und Landschaft« denke, welche <strong>in</strong> Zusammenarbeit<br />
unserer Verwaltung mit der Akademie für<br />
Lehrerfortbildung Dill<strong>in</strong>gen erstellt worden ist. Ich<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
weiß, wie viele weitere bewundernswerte Aktionen<br />
Sie, me<strong>in</strong>e lieben Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeiter,<br />
mit K<strong>in</strong>dern und Schülern unternehmen. Dafür<br />
danke ich Ihnen sehr herzlich. Unsere K<strong>in</strong>der s<strong>in</strong>d<br />
unsere Zukunft. Wenn wir K<strong>in</strong>der für unsere Aufgabe<br />
gew<strong>in</strong>nen, gew<strong>in</strong>nen wir die Zukunft für die Dörfer!<br />
Bürgermeister, Geme<strong>in</strong>deräte, Planer und<br />
Berater<br />
Auf die wichtigen Säulen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong>,<br />
die Bürgermeister, Geme<strong>in</strong>deräte, kommunalen<br />
Verwaltungsangehörigen sowie die freien<br />
Planer und Berater möchte ich nur kurz e<strong>in</strong>gehen.<br />
Sie wissen, daß sie für die Menschen da s<strong>in</strong>d und<br />
nicht umgekehrt. Es gilt zu überzeugen und nicht zu<br />
überreden. Ergebnisse werden nur dann wirklich<br />
Bestand haben, wenn sie <strong>in</strong> offener und gleichberechtigter<br />
Zusammenarbeit erreicht worden s<strong>in</strong>d.<br />
Nötig s<strong>in</strong>d dabei Eigenschaften, wie sie von Moderatoren<br />
verlangt werden, nämlich die Eigenkräfte des<br />
Dorfes wecken und aktivieren zu können.<br />
Der Mensch »Mitarbeiter<strong>in</strong> und Mitarbeiter«<br />
braucht auch Zukunft und Lebenschancen<br />
Bisher g<strong>in</strong>g es um die uns anvertrauten Menschen<br />
vor Ort, <strong>in</strong> den Dörfern. E<strong>in</strong>e sozialgerechte nachhaltige<br />
<strong>Entwicklung</strong> kann aber nur gel<strong>in</strong>gen, wenn Sie<br />
diesen Menschen als Mitmensch begegnen und entgegenkommen.<br />
E<strong>in</strong>e gute Beziehung zwischen Ihnen<br />
und den Menschen draußen ist von ausschlaggebender<br />
Bedeutung. So wie Sie mit den Menschen sprechen,<br />
auf sie e<strong>in</strong>gehen und reagieren, so werden es<br />
Ihnen diese durch Aufgeschlossenheit, Eigen<strong>in</strong>itiative<br />
und Vertrauen danken. In den letzten Jahren haben<br />
Sie e<strong>in</strong> bewundernswertes Engagement an Bürgernähe<br />
und Transparenz des Handelns gezeigt; dafür<br />
danke ich Ihnen sehr herzlich.<br />
Soeben haben wir aus den Berichten der Arbeitskreisleiter<br />
gehört, woh<strong>in</strong> die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
steuert, welche zusätzlichen Anforderungen und<br />
Qualifikationen dabei auch Ihnen und Ihrer Verwaltung<br />
abverlangt werden müssen. Lassen Sie mich <strong>in</strong><br />
diesem Kontext mit fünf Feststellungen und Bitten<br />
schließen, die ich an Sie als die Führungskräfte der<br />
Verwaltung richten möchte:<br />
1. Unser geme<strong>in</strong>samer Freund Monsignore<br />
Dr. Walter Friedberger gibt den ethischen Rahmen<br />
für unser Handeln <strong>in</strong> der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
vor: Die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> hat zum Ziel, daß<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
65
Menschen ihre Lebenschancen f<strong>in</strong>den. Lebenschancen<br />
f<strong>in</strong>den darf nicht nur für die von Ihnen<br />
betreuten Menschen, sondern muß auch für Sie<br />
selbst gelten. Der Schirmherr dieser Tagung,<br />
M<strong>in</strong>isterpräsident Dr. Stoiber, besche<strong>in</strong>igt der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong>, daß sie e<strong>in</strong>e Aufgabe von<br />
großer Bedeutung fürdie Gesellschaft von heute<br />
und morgen sei. Dieser Aussage schließe ich mich<br />
une<strong>in</strong>geschränkt an; ich möchte daraus folgernd<br />
sagen, daß auch Ihre Tätigkeit <strong>in</strong> der Verwaltung<br />
Zukunft hat. In se<strong>in</strong>er Arbeit kann nur Erfüllung<br />
f<strong>in</strong>den, wer ohne Sorgen um Anerkennung dieser<br />
Arbeit ist, wer gesellschaftliche Zukunft für se<strong>in</strong>e<br />
Tätigkeit sieht. Sie können beruhigt <strong>in</strong> diese<br />
Zukunft sehen!<br />
2. Ich habe davon gesprochen, daß Sie den Menschen<br />
als Mensch und nicht als übergeordneter<br />
Behördenvertreter begegnen sollten. Das berührt<br />
die Frage, welches Menschenbild Sie <strong>in</strong> sich tragen<br />
und zur Grundlage Ihrer Arbeit machen. E<strong>in</strong>e<br />
sozialgerechte umweltverträgliche <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> verlangt von Ihnen nicht nur e<strong>in</strong>e<br />
hohe fachliche — wir haben die Forde-rungen der<br />
Arbeitskreise soeben gehört —, sondern auch e<strong>in</strong>e<br />
ebenso hohe soziale Kompetenz. Sie alle wissen,<br />
was ich damit me<strong>in</strong>e. Widmen Sie daher auch <strong>in</strong><br />
Zukunft Ihrer persönlichen Fort-bildung auf beiden<br />
Gebieten das notwendige Augenmerk.<br />
Höchstes Fachwissen nützt wenig, wenn es die<br />
Menschen <strong>in</strong> ihren Herzen nicht erreicht!<br />
3. Kürzlich lautete e<strong>in</strong>e Schlagzeile aus der ebenfalls<br />
um Lean Management und Erhöhung von Kreativität<br />
und Produktivität kämpfenden freien Wirtschaft:<br />
Die Zeit der E<strong>in</strong>zelkämpfer ist vorbei. Für<br />
die anstehenden Aufgaben seien mehr Integration<br />
und Teamarbeit gefragt. E<strong>in</strong>flußreiche Unternehmensberater<br />
sprechen dem ergänzenden Aufe<strong>in</strong>anderzugehen<br />
die größte Bedeutung im Alltag<br />
erfolgreicher Unternehmen und Verwaltungen zu.<br />
Teamarbeit muß jedoch erlernt und geübt werden.<br />
Die Berichte aus den Arbeitskreisen zeigen,<br />
daß sich Ihre Verwaltung dazu auf e<strong>in</strong>em guten<br />
Weg bef<strong>in</strong>det.<br />
Vielleicht kommen Sie damit auch zu e<strong>in</strong>em von<br />
allen getragenen Leitbild, zu e<strong>in</strong>er Unternehmensphilosophie<br />
und Unternehmenskultur. Dieses<br />
Leitbild sollte die Aufforderung und die Chance<br />
dazu geben, daß sich alle als zusammengehörig<br />
fühlen und daß jeder entsprechend se<strong>in</strong>en Fähigkeiten<br />
und Talenten e<strong>in</strong>gesetzt und anerkannt<br />
wird. Dazu gehört u. a. — nur als Beispiel — die<br />
Delegation von Verantwortung und Freiräumen<br />
an begabte Mitarbeiter. E<strong>in</strong>e »Vertrauensorgani-<br />
sation mit wenig Kontrolle« sollte das Leitbild<br />
se<strong>in</strong>. Gestiegenes Engagement und Verantwortungsbewußtse<strong>in</strong><br />
Ihrer Mitarbeiter werden Ihren<br />
Mut belohnen.<br />
4. <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> ist nur dann nachhaltig,<br />
wenn es gel<strong>in</strong>gt, e<strong>in</strong> »Wir-Gefühl« aller Beteiligten<br />
und Betroffenen zu erzeugen. Es stellt sich selten<br />
von vornehere<strong>in</strong> e<strong>in</strong>, sondern muß hart erarbeitet<br />
werden. Bedienen Sie sich bitte weiterh<strong>in</strong> der bewährten<br />
Techniken und Instrumente wie des<br />
E<strong>in</strong>satzes von Dorf- und Flurwerkstätten, Klausuren<br />
an den Dorferneuerungsschulen usw.<br />
Erweitern Sie den Kreis der Beteiligten; niemand,<br />
der <strong>in</strong>teressiert ist und mitwirken will, sollte beiseite<br />
stehen müssen. Arbeiten Sie, unterstützt von<br />
geschulten Moderatoren, an strategischen<br />
Visionen. Kreativität kann und muß vielfach<br />
tra<strong>in</strong>iert werden. Nichts verb<strong>in</strong>det mehr als<br />
geme<strong>in</strong>same Klausuren, Werkstätten, erarbeitete<br />
Träume und Visionen und — Erfolge. Beides können<br />
Sie <strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> der Dorferneuerung <strong>in</strong><br />
reichem Maße anbieten — dies bed<strong>in</strong>gt aber, daß<br />
Sie sich für diesen unverzichtbaren sozialkulturellen<br />
Bereich Zeit und Geld nehmen.<br />
5. Menschen haben materielle und immaterielle<br />
Bedürfnisse. In e<strong>in</strong>er technischen Verwaltung kann<br />
leicht die Gefahr bestehen, daß die immaterielle<br />
Seite, die geistig-kulturellen Grundbedürfnisse<br />
eher zu kurz kommen. Ich habe darauf h<strong>in</strong>gewiesen,<br />
wie sehr für e<strong>in</strong>e nachhaltige <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> auch der sozio-kulturelle Aspekt von<br />
Bedeutung ist. Es geht also um das Ernstnehmen<br />
der Gefühle, von Hoffnung, Freude und Ängsten<br />
oder seelischen B<strong>in</strong>dungen der Menschen an<br />
bestimmte Orte und Gegenstände <strong>in</strong> ihrem Dorf<br />
und <strong>in</strong> ihrer Landschaft. Ich sage Ihnen damit<br />
nichts Neues, denn auch hier war die Bayerische<br />
Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong> Pionier,<br />
wie mir die <strong>Fachtagung</strong>svorträge oder Untersuchungen<br />
von Erika Ha<strong>in</strong>dl, Theo Abt, Wilhelm<br />
Landzettel und Dieter Wieland zeigen.<br />
Dennoch bitte ich Sie abschließend nochmals e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>glich:<br />
Der »Umbau der Welt zur Heimat« durch<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> kann nur gel<strong>in</strong>gen, wenn<br />
die Menschen ihre materiellen und immateriellen<br />
Bedürfnisse erfüllen können. Sie wirken bei dieser<br />
wahrhaft humanen Aufgabe entscheidend mit.<br />
Dazu wünsche ich Ihnen auch für die Zukunft e<strong>in</strong>e<br />
glückliche Hand und viel Erfolg.<br />
66 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Günther Strößner<br />
Schlußwort<br />
Unsere <strong>Fachtagung</strong> <strong>in</strong> <strong>Ansbach</strong> geht zu Ende. Ich<br />
danke zunächst Ihnen, Frau Staatssekretär<strong>in</strong> Deml,<br />
sehr herzlich, daß Sie den abschließenden Vortrag<br />
übernommen haben. Ihr Vortrag war e<strong>in</strong> weiterer<br />
Höhepunkt dieser Tagung. Ihre Ausführungen haben<br />
die Bedeutung aufgezeigt, die Sie, gnädige Frau, der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong>, der Dorferneuerung und der<br />
Flurentwicklung, bei Ihrer politischen Arbeit zumessen.<br />
Für die Verwaltung, aber auch für die Menschen<br />
<strong>in</strong> den Dörfern ist das wichtig. Die wollen nämlich<br />
wissen, woran sie mit der Politik s<strong>in</strong>d. Und es ist<br />
umso wichtiger <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Zeit, <strong>in</strong> der vieles, ja fast<br />
alles <strong>in</strong> Frage gestellt, zum<strong>in</strong>dest durchleuchtet,<br />
untersucht, überprüft und kontrolliert werden soll.<br />
Hier vor Ihnen sitzt e<strong>in</strong> Auditorium, das als Multiplikator<br />
Ihrer Darlegungen draußen vor Ort wirken<br />
kann.<br />
Als wir uns bei der Vorbereitung dieser Tagung<br />
über das Thema Ihres Vortrags unterhalten haben,<br />
legten Sie Wert darauf, den Menschen <strong>in</strong> den<br />
Mittelpunkt zu stellen. Sie haben das getan, und Sie<br />
haben deutlich gemacht, daß die Menschen auf dem<br />
Lande nicht nur als Wählerpotential zu sehen s<strong>in</strong>d,<br />
sondern als Staatsbürger, denen zur Lösung der<br />
Probleme Hilfe zur Selbsthilfe gewährt werden muß.<br />
Daß es dabei nicht nur um materielle Hilfe gehen<br />
kann, habe ich Ihren Ausführungen entnommen.<br />
Wenn ich Sie so verstehen darf, daß über die Verwaltung<br />
für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> sowohl diese geistige<br />
wie die materielle Hilfe zur Selbsthilfe geboten<br />
werden muß, b<strong>in</strong> ich Ihnen, Frau Staatssekretär<strong>in</strong>,<br />
besonders dankbar. Wir danken Ihnen, daß Sie<br />
nochmals zu uns gekommen s<strong>in</strong>d.<br />
Ich danke sehr herzlich all den <strong>Ansbach</strong>er<br />
Kolleg<strong>in</strong>nen und Kollegen, an der Spitze Herrn<br />
Präsident Bischoff und se<strong>in</strong>em Vize, Herrn Abteilungsdirektor<br />
Metterle<strong>in</strong>, für die Organisation dieser<br />
Tagung. Sie haben vorbildliche Arbeit geleistet, trotz<br />
den externen Belastungen. Ich danke auch Herrn<br />
Kollegen Brumberg, der uns so elegant durch die<br />
Tagung geleitet hat. Die anerkennenden Kommentare<br />
und Äußerungen mögen Ihnen das bestätigen.<br />
Bitte, Herr Bischoff, geben Sie diesen Dank an<br />
alle weiter, die unmittelbar oder mittelbar mitgewirkt<br />
haben und heute nicht da s<strong>in</strong>d.<br />
Me<strong>in</strong> Dank gilt auch allen, die gestaltend und aktiv<br />
durch Vorträge, die Leitung von Arbeitskreisen und<br />
Exkursionen, Diskussionen oder auf sonstige Weise<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
zum Gel<strong>in</strong>gen dieser Tagung beigetragen haben.<br />
Dabei darf ich e<strong>in</strong>schließen, Herrn Dr. Magel und se<strong>in</strong>en<br />
fachlichen Mitarbeiter Herrn Betz. Schließlich<br />
danke ich allen Teilnehmer<strong>in</strong>nen und Teilnehmern an<br />
dieser Veranstaltung. Der Dank gilt vor allem den<br />
ausländischen und nichtbayerischen Gästen. Wir<br />
danken für Ihr Interesse und hoffen, daß Sie für die<br />
Arbeit <strong>in</strong> Ihrer Heimat e<strong>in</strong>ige Anregungen aus<br />
<strong>Ansbach</strong> mitnehmen können. Wir danken aber auch<br />
dafür, daß Sie diesen Tagen nicht nur <strong>in</strong>ternationales<br />
Flair verliehen, sondern e<strong>in</strong>en wertvollen Beitrag<br />
geleistet haben zur Verständigung zwischen den<br />
Menschen verschiedener Völker und Staaten. Mich<br />
freut es vor allem, daß wir heute fachlichen und persönlichen<br />
Gedanken und Me<strong>in</strong>ungsaustausch über<br />
Grenzen h<strong>in</strong>weg führen können, die bis vor kurzem<br />
noch unüberw<strong>in</strong>dbar schienen.<br />
Me<strong>in</strong>e Damen und Herren, heuer ist es das letzte<br />
Mal, daß ich als aktiver Beamter zur <strong>Fachtagung</strong> das<br />
Schlußwort zu sprechen habe. Gestatten Sie mir aus<br />
diesem Grunde aus me<strong>in</strong>er Sicht e<strong>in</strong>en kurzen Rückblick,<br />
e<strong>in</strong>e Beurteilung der gegenwärtigen Situation<br />
und e<strong>in</strong>ige Wünsche für die Zukunft.<br />
Rückblick<br />
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
<strong>in</strong> Bayern zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
von heute gewandelt, zu e<strong>in</strong>em Aufgabenfeld, das <strong>in</strong><br />
ländlichen Gebieten ziemlich umfassend zur Problemlösung<br />
e<strong>in</strong>gesetzt werden kann, wenn die Verantwortlichen<br />
es nur wollen. E<strong>in</strong>ige Markste<strong>in</strong>e, die<br />
<strong>in</strong> der jüngeren Geschichte gesetzt wurden, die ich<br />
miterlebt habe und zum Teil mitgestalten konnte,<br />
s<strong>in</strong>d<br />
— die E<strong>in</strong>führung des Bundesflurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes<br />
von 1953, mit dem der <strong>in</strong> Bayern geborene<br />
Begriff Flurbere<strong>in</strong>igung bundesweit e<strong>in</strong>geführt<br />
wurde;<br />
— das Europäische Naturschutzjahr 1970, seit dem,<br />
ausgehend von unserer damaligen Würzburger<br />
<strong>Fachtagung</strong>, ökologisches Gedankengut zunehmend<br />
unsere Arbeit bee<strong>in</strong>flußte;<br />
— die Dorferneuerung seit Anfang der 70er Jahre,<br />
die gedanklich befruchtet vom Städtebauförderungsgesetz<br />
1971, f<strong>in</strong>anziell gefördert vom<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
67
Zukunfts<strong>in</strong>vestitionsprogramm 1977bis 1980<br />
schließlich 1982 im Bayerischen Dorferneuerungsprogramm<br />
fest verankert wurde;<br />
— die Novellierung des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes<br />
1976, mit der e<strong>in</strong>e Weichenstellung zur Landentwicklung<br />
vollzogen und Grundlagen zum Ausgleich<br />
zwischen Ökonomie und Ökologie gegeben<br />
wurden;<br />
— 1983 die E<strong>in</strong>führung der dreistufigen Landschaftsplanung<br />
<strong>in</strong> der Flurbere<strong>in</strong>igung, die es uns<br />
ermöglichte;<br />
— 1984 den neuen Auftrag der Verfassung des<br />
Freistaates Bayern zu befolgen, Naturschutz nicht<br />
nur <strong>in</strong> Worten, sondern mit Taten zu betreiben;<br />
— das Bayerische Programm <strong>Ländliche</strong> Neuordnung<br />
vom Jahre 1989, das im wesentlichen heute noch<br />
Ziele und Grundsätze für unsere Arbeit liefert;<br />
— 1993 schließlich das geänderte bayerische Gesetz<br />
zur Ausführung des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes, <strong>in</strong><br />
dem u. a. der neue Name unserer Verwaltung<br />
nunmehr auch gesetzlich verankert ist.<br />
Diese Markste<strong>in</strong>e mögen reichen, und Sie mögen<br />
verzeihen, daß ich nicht e<strong>in</strong>gehe auf den technischen<br />
Fortschritt <strong>in</strong> Vermessung und Datenverarbeitung,<br />
unsere bedeutsamen Arbeiten auf dem<br />
Feld der angewandten Forschung, auf die Bemühungen<br />
um die nach me<strong>in</strong>er Beurteilung außerordentlich<br />
wichtige Pflege der Kontakte mit ausländischen<br />
Fachverwaltungen.<br />
Markste<strong>in</strong>e, das wissen die Geodäten, muß man<br />
pflegen, wieder gerade rücken, wenn sie <strong>in</strong> Schieflage<br />
geraten s<strong>in</strong>d, schützen, sicher auch erneuern,<br />
wenn es notwendig ist, ke<strong>in</strong>esfalls aber mutwillig<br />
zerstören. Markste<strong>in</strong>e eben!<br />
Gegenwart<br />
Die gegenwärtige Situation ist für unsere Verwaltung<br />
nicht recht erfreulich. Vielleicht liegt es am<br />
sogenannte Superwahljahr <strong>1994</strong>. Vielleicht liegt es<br />
auch an der Tatsache, daß schlechte Nachrichten,<br />
wie ich <strong>in</strong> me<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>führung am Montag e<strong>in</strong>ige<br />
genannt habe, meist die e<strong>in</strong>zigen s<strong>in</strong>d, die Interesse<br />
f<strong>in</strong>den und damit gute Absichten lähmen können.<br />
Negative Kritik, oft alle<strong>in</strong> um der Kritik willen, gehört<br />
ebenfalls zu dieser Kategorie. Stabile Faktoren <strong>in</strong> diesem<br />
Staat, wie die Verwaltung e<strong>in</strong>er ist, werden<br />
dadurch leider oft verunsichert.<br />
Da sche<strong>in</strong>t es mir mehr als wünschenswert, wieder<br />
stabilisierend und motivierend zu wirken, notwendiger<br />
jedenfalls als Kommissionen, externe Berater und<br />
Verwaltungsreformgruppen e<strong>in</strong>zusetzen. Wohltuend<br />
ist es, wenn <strong>in</strong> dieser Zeit von Partnern unserer<br />
Verwaltung Anerkennung und Wertschätzung zum<br />
Ausdruck gebracht werden, Resolutionen z.B. des<br />
Bayerischen Geme<strong>in</strong>detags gefaßt werden, die zur<br />
Weiterarbeit ermutigen, Forderungen z. B. des<br />
Bayerischen Bauernverbandes erhoben werden, mit<br />
denen wir uns identifizieren können. Wohltuend ist<br />
es auch, wenn die Politik sich wohltuend über unsere<br />
Arbeit äußert.<br />
Damit sehe ich <strong>in</strong> diesem Stimmungstief Licht am<br />
Horizont und Perspektiven für die Zukunft, für die<br />
ich e<strong>in</strong>ige Wünsche äußern möchte.<br />
Wünsche für die Zukunft<br />
Seit 28. November 1979 b<strong>in</strong> ich Leiter der Bayerischen<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsverwaltung, heute der<br />
Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>. Ich habe<br />
diese Arbeit stets gerne gemacht, und ich nutze die<br />
Gelegenheit, zunächst allen Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und<br />
Mitarbeitern sehr herzlich zu danken für die Unterstützung<br />
und die Hilfe, die Sie mir gewährt haben.<br />
Ohne diese kollegiale Zusammenarbeit, bei der jeder<br />
an se<strong>in</strong>em Platz Verantwortung zu tragen hatte,<br />
wären die anerkannten Leistungen unserer Verwaltung<br />
und der Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaften nicht<br />
möglich gewesen. Ich sage schlicht und e<strong>in</strong>fach:<br />
Danke.<br />
Me<strong>in</strong> erster Wunsch betrifft die Politik. Sie möge<br />
die Kraft haben, für stabile Rahmenbed<strong>in</strong>ungen zu<br />
sorgen. Sie möge bei allem Fortschritt Traditionen<br />
beachten, zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong>s Kalkül ziehen und bedenken,<br />
daß auch <strong>in</strong> der Vergangenheit gute Entscheidungen<br />
der Legislative und der Exekutive getroffen worden<br />
s<strong>in</strong>d, die man nicht alle über Bord werfen muß. Und<br />
die Politik möge nicht nur die Regularien der Verwaltung<br />
beklagen, sondern dafür sorgen, daß der<br />
Verwaltung mehr eigener Handlungsspielraum verbleibt.<br />
Damit b<strong>in</strong> ich bei der Verwaltung. Ihr wünsche ich<br />
diesen Handlungsspielraum, ohne daß Rechts- und<br />
Verwaltungsvorschriften aus Brüssel, Bonn oder<br />
München e<strong>in</strong>e weitere E<strong>in</strong>engung oder Beschneidung<br />
von Initiativen vor Ort br<strong>in</strong>gen. Subsidiarität<br />
und Innovation können nicht funktionieren ohne<br />
diesen Freiraum. Freiraum darf nicht mit Freistil verwechselt<br />
werden. Regeln muß es wie im Sport auch<br />
für die Verwaltung geben. Und wie im Sport müssen<br />
auch für die Verwaltung die Akteure geworben, tra<strong>in</strong>iert<br />
und ausgebildet werden. Ich wünsche, daß die<br />
jungen Bewerber, die sich für unsere Arbeit ernsthaft<br />
<strong>in</strong>teressieren, nach Abschluß ihres Studiums oder<br />
ihrer Ausbildung, auch e<strong>in</strong>e Stelle <strong>in</strong> der Verwaltung<br />
bekommen. Es kann doch ke<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n machen, daß<br />
68 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
die Sparmaßnahmen und die Rückführung der Personalquote<br />
soweit getrieben werden, daß die Zahl<br />
der arbeitslosen jungen Menschen auch auf unserem<br />
Sektor noch vergrößert wird, wo wir doch wissen,<br />
daß der Arbeitsüberhang ohne den Nachwuchs von<br />
Fachkräften nicht abzubauen ist.<br />
Schließlich wünsche ich der Verwaltung, daß<br />
etwaige Veränderungen <strong>in</strong> der Struktur nicht revolutionär,<br />
sondern — wie bisher auch — evolutionär<br />
angegangen werden. Und für ganz wichtig halte ich<br />
es, daß dabei auch die endogenen Kräfte der Verwaltung<br />
genutzt werden. Insider-Wissen darf nicht <strong>in</strong>s<br />
Abseits gestellt werden. Das know how aus Düsseldorf<br />
ist nicht das Nonplusultra. Aber auch hier wünsche<br />
ich, daß der Fortschritt auf Traditionen Rücksicht<br />
nehmen möge.<br />
Zum Dritten habe ich Wünsche für die Geme<strong>in</strong>de<br />
und die Menschen im ländlichen Raum. Trotz dem<br />
Strukturwandel <strong>in</strong> der Landwirtschaft, trotz dem<br />
Wandel im siedlungsstrukturellen und sozialen<br />
Gefüge unserer Dörfer wünsche ich, daß das Leben<br />
auf dem Lande lebenswert bleibt. Das breite Spektrum<br />
der angebotenen Hilfen <strong>in</strong> Verfahren der <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> möge dazu beitragen, das<br />
Heimat- und Selbstwertgefühl zu stärken.<br />
Von Bedeutung sche<strong>in</strong>t mir auch, daß der Schutz<br />
des Eigentums an Grund und Boden e<strong>in</strong> hohes Gut<br />
bleiben möge. Die Überlegungen zur Änderung des<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes dürfen den Grundsatz der<br />
wertgleichen Abf<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> Land <strong>in</strong> unseren Verfahren<br />
nicht verlassen. Sie müssen die Wertsteigerung,<br />
wenigstens die Werterhaltung durch die<br />
Neuordnung im Verfahren sicherstellen. Wenn ich<br />
diesen Wunsch artikuliere, weiß ich mich im E<strong>in</strong>klang<br />
mit dem Bayerischen Bauernverband ebenso wie mit<br />
dem Bayerischen Geme<strong>in</strong>detag. Ich wünsche im<br />
Interesse der an unseren Verfahren Beteiligten, daß<br />
die Zusammenarbeit mit diesen beiden Organisationen<br />
harmonisch fortgeführt, ja noch verbessert<br />
wird. Nur geme<strong>in</strong>sam wird es möglich se<strong>in</strong>, den<br />
ländlichen Raum als Partner der <strong>Stadt</strong> funktionsfähig<br />
zu erhalten und mit veränderten Funktionen<br />
den Wertewandel zu fördern.<br />
Diese Geme<strong>in</strong>samkeit im Planen und Handeln muß<br />
sich darüber h<strong>in</strong>aus auf alle Institutionen und Peronen<br />
erstrecken, die von ihrer Aufgabenstellung her<br />
mit Problemlösungen auf dem Lande befaßt s<strong>in</strong>d.<br />
Wenn ich Personen sage, me<strong>in</strong>e ich <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie<br />
die am Verfahren beteiligten Grundeigentümer und<br />
Bürger. Für sie wünsche ich mir, daß sie an unseren<br />
Vorhaben nicht nur <strong>in</strong>teressiert s<strong>in</strong>d, sondern aktiv<br />
mitwirken, mehr noch: die Projekte zu ihren eigenen<br />
machen.<br />
Unsere Arbeit kann und wird niemals Selbstzweck<br />
se<strong>in</strong>. Ich wünsche, daß auch die Verantwortlichen<br />
diese Aufgabe so sehen und das Potential nutzen,<br />
ohne traditionell gewachsene Strukturen zu zerschlagen.<br />
Dies wünsche ich für die Menschen im<br />
ländlichen Raum und im Interesse des Mite<strong>in</strong>anders<br />
von <strong>Stadt</strong> und Land. Dies wünsche ich aber vor allem<br />
den Mitarbeiter<strong>in</strong>nen und Mitarbeitern der Bayerischen<br />
Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>, die<br />
ich gleichzeitig bitte, optimistisch <strong>in</strong> die Zukunft zu<br />
blicken.<br />
Staatsm<strong>in</strong>ister Bocklet im Gespräch mit Prof. Liu, Universität Taipei, Taiwan; M<strong>in</strong>isterialdirigent Strößner rechts<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
69
Charles Konnen<br />
Dank der Gäste *<br />
Zum Abschluß dieser <strong>Fachtagung</strong> habe ich die<br />
große Ehre, im Namen aller ausländischen und<br />
nichtbayerischen Teilnehmer der Bayerischen Verwaltung<br />
für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong> herzliches<br />
»Danke schön« auszusprechen.<br />
Diesem »Danke schön« möchte ich als regelmäßiger<br />
Teilnehmer an diesen <strong>Fachtagung</strong>en die besonderen<br />
Glückwünsche me<strong>in</strong>es kle<strong>in</strong>en Heimatlandes<br />
Luxemburg für die aufs neue perfekt gelungene<br />
Organisation dieser <strong>Fachtagung</strong> entgegenbr<strong>in</strong>gen.<br />
Dieser herzliche Dank gilt natürlich auch den Repräsentanten<br />
der Bayerischen Staatsregierung, den<br />
Vertretern des Bayerischen Staatsm<strong>in</strong>isteriums für<br />
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und nicht<br />
zuletzt der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>Ansbach</strong>. Die Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
<strong>Ansbach</strong> hat vorzügliche Arbeit geleistet. Viele hochqualifizierte<br />
<strong>in</strong>terne und externe Experten und<br />
Mitarbeiter für die Organisation dieser <strong>Fachtagung</strong><br />
wurden bereitgestellt. Die Qualität der Organisation<br />
zog sich kont<strong>in</strong>uierlich durch die verschiedenen Teile<br />
der viertägigen Veranstaltung und zwar von der<br />
Begrüßung an über die Podiums- und Plenumsdiskussionen,<br />
die acht Arbeitskreise, die elf Fachexkursionen,<br />
die Schlußveranstaltung sowie »last but not<br />
least« bis zum vorzüglichen siebenteiligen Rahmenprogramm.<br />
Erlauben Sie mir, sehr verehrte Damen und<br />
Herren, e<strong>in</strong>e Anmerkung zu diesen bayerischen <strong>Fachtagung</strong>en<br />
aus luxemburgischer Sicht zu geben. Ich<br />
glaube, dies gilt auch für alle anderen ausländischen<br />
und nichtbayerischen Teilnehmer. Wir Luxemburger<br />
s<strong>in</strong>d später als Bayern zur Flurbere<strong>in</strong>igung oder<br />
besser zur Flurgestaltung e<strong>in</strong>erseits und zur Dorferneuerung<br />
respektive zur Dorfentwicklung gestoßen<br />
und haben ebenso wie andere Nationen sehr viel von<br />
dem Erfahrungsaustausch dieser Tagungen mit nach<br />
Hause nehmen können. Diesbezüglich e<strong>in</strong>en herzlichen<br />
Dank unsererseits für die kont<strong>in</strong>uierlichen und<br />
freundlichen E<strong>in</strong>ladungen sowie für das stetige<br />
wohlwollende Entgegenkommen sowohl des<br />
Bayerischen Staatsm<strong>in</strong>isteriums für Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Forsten als auch der Verwaltung<br />
für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>. Wir freuen uns jedes Mal,<br />
unseren bescheidenen Beitrag beim Austausch der<br />
Erfahrungen bei diesen <strong>Fachtagung</strong>en e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen zu<br />
dürfen.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
E<strong>in</strong> letzter Gedanke zum Schluß. Ich glaube, daß<br />
wir alle die bayerischen <strong>Fachtagung</strong>en brauchen, um<br />
uns <strong>in</strong> unserem notwendigen Elan und Positivdenken<br />
für die schöne Sache »<strong>Entwicklung</strong> des ländlichen<br />
Raumes« zu stärken und uns e<strong>in</strong>en Motivationsschub<br />
zur Fortsetzung unserer reizvollen Aufgabe europaweit,<br />
ja sogar weltweit zu geben. Wir wissen alle, es<br />
bleibt noch viel zu tun, und ich möchte mich auf<br />
bayerisch versuchen und sagen »Pack’ ma’s an«. In<br />
diesem S<strong>in</strong>ne nochmals vielen vielen Dank, Grüß<br />
Gott und auf Wiedersehen.<br />
* Redigierte Tonbandaufzeichnung<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
71
E<strong>in</strong>führungsreferate <strong>in</strong> den Arbeitskreisen<br />
Arbeitskreis 1:<br />
Möglichkeiten und Grenzen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
Johann Huber<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Ich begrüße Sie ganz herzlich hier im Grünen Saal der<br />
Orangerie zum Arbeitskreis 1. Der Arbeitskreis steht unter<br />
dem Motto der <strong>Fachtagung</strong> »<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong><br />
<strong>Stadt</strong> und Land«. Das Thema lautet: »Möglichkeiten und<br />
Grenzen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong>«. Es ist zwar leichter,<br />
»gegen« als »für« etwas zu se<strong>in</strong>. Wir sollten aber selbst bei<br />
diesem umfassenden Thema nicht <strong>in</strong> Schwierigkeiten,<br />
sondern vor allem <strong>in</strong> Möglichkeiten denken.<br />
Ich heiße willkommen unsere Gäste aus den deutschen<br />
Ländern. Me<strong>in</strong> besonderer Gruß gilt unseren ausländischen<br />
Gästen aus Belgien, F<strong>in</strong>nland, Kroatien, den<br />
Niederlanden, Österreich, Polen und Slowenien. Ich begrüße<br />
herzlich me<strong>in</strong>e Kolleg<strong>in</strong>nen und Kollegen aus der<br />
Bayerischen Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>. Me<strong>in</strong><br />
besonderer Gruß gilt den beiden Referenten des heutigen<br />
Vormittags. Ich begrüße Herrn Dr.-agr. Balthasar Huber<br />
von der Europäischen Kommission aus Brüssel und Herrn<br />
Dr. -Ing. Karl-Friedrich Thöne vom Bundesm<strong>in</strong>isterium für<br />
Ernährung, Landwirtschaft und Forsten aus Bonn. Beide<br />
Herren werde ich später noch vorstellen.<br />
Ziel des Arbeitskreises<br />
Es ist guter Brauch bei den <strong>Fachtagung</strong>en der Bayerischen<br />
Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> grundsätzliche<br />
Fragen zu diskutieren. Gerade die <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre<br />
Zusammensetzung des Arbeitskreises 1, auch mit Ver-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
tretern aus zahlreichen Verwaltungen anderer Länder und<br />
Gästen aus dem Ausland, bietet Gelegenheit, das Thema<br />
aus unterschiedlichen Blickrichtungen zu beleuchten. Wir<br />
sollten heute diese Chance nutzen, uns e<strong>in</strong> Bild von den<br />
veränderten Realitäten zu machen, neue <strong>Entwicklung</strong>en<br />
zu erkennen und Zukunftsfragen, also die Fragen von<br />
morgen, mite<strong>in</strong>ander zu diskutieren. Ich wünsche mir<br />
also heute e<strong>in</strong>en Tag des Nachdenkens über <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> — jedoch im S<strong>in</strong>ne von Vorausdenken. Ich b<strong>in</strong><br />
sicher, daß wir geme<strong>in</strong>sam erfolgreich se<strong>in</strong> werden.<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen für die <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong><br />
Unternehmensberater und Wirtschaftsfachleute fragen<br />
heute deutsche Unternehmen besonders e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>glich nach<br />
den firmeneigenen Visionen. Sie fragen nach den Zielen:<br />
Wo wollen Sie eigentlich h<strong>in</strong>? Dies ist e<strong>in</strong>e Frage, die sich<br />
auch ländliche Geme<strong>in</strong>den und auch die Verwaltung ständig<br />
stellen müssen. Gerade die Verwaltung für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> war bereits <strong>in</strong> der Vergangenheit immer<br />
gefordert, ihre Ziele deutlich zu machen und sich an veränderte<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen anzupassen. Davon war<br />
gestern mehrfach die Rede. Heute bietet sich Gelegenheit,<br />
an der Zielf<strong>in</strong>dung weiter zu arbeiten. Denn »Der<br />
Langsamste, der se<strong>in</strong> Ziel nicht aus den Augen verliert,<br />
geht noch immer geschw<strong>in</strong>der als jener, der ohne Ziel<br />
herumirrt«. Ich denke, Gotthold Ephraim Less<strong>in</strong>g hat recht.<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong> <strong>Stadt</strong> und Land. Dieses Motto<br />
br<strong>in</strong>gt auch zum Ausdruck, daß die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
sich nicht beschränken darf auf sektorale Betrachtungsweisen.<br />
Staatsm<strong>in</strong>ister Bocklet hat bei der Eröffnungsveranstaltung<br />
darauf h<strong>in</strong>gewiesen, daß sich Agrarpolitik<br />
nicht auf e<strong>in</strong>e Politik für den Berufsstand beschränken<br />
könne.<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> versteht sich als Dienstleistung<br />
für alle Bürger. Sie ist Partner ländlicher Geme<strong>in</strong>den.<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> befaßt sich heute mit nahezu allen<br />
Funktionen des ländlichen Raumes. Das zeitlose Betätigungsfeld<br />
ist und bleibt jedoch das ländliche Grundeigentum<br />
und damit der ländliche Grundeigentümer. Die<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong>nerhalb derer die Bürger leben<br />
und arbeiten, verändern sich sehr rasch. Die Lebensverhältnisse<br />
s<strong>in</strong>d komplex und kompliziert geworden. Das<br />
enorme Veränderungstempo fordert die Menschen. Sie<br />
können ihre Denkweise nicht ohne Verzug auf e<strong>in</strong>e immer<br />
schnellere Folge neuer Erkenntnisse ausrichten. Es gibt<br />
zwar e<strong>in</strong>e Reihe von Möglichkeiten, Zukunft zu gestalten<br />
und <strong>Entwicklung</strong>en zu steuern. Aber es ist offensichtlich,<br />
E<strong>in</strong>führungsreferate <strong>in</strong> den Arbeitskreis 1<br />
73
daß nicht mehr alles planbar ist, und wir nicht mehr alles<br />
<strong>in</strong> Griff bekommen können. Wir stecken sozusagen <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>stabilen System. Dieses hat die Eigenschaft, daß<br />
kle<strong>in</strong>e Ursachen große Wirkungen zeigen können. Aus<br />
kle<strong>in</strong>en Ansätzen , aus e<strong>in</strong>er irgendwo, z. B. <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er kle<strong>in</strong>en<br />
Firma auftauchenden Erf<strong>in</strong>dung, die zunächst niemand<br />
beachtet, können Wirkungen hervorgehen, die wir<br />
uns heute gar nicht vorstellen können.<br />
Nehmen sie als Beispiel die stürmische <strong>Entwicklung</strong> der<br />
Kommunikationstechnologie, die <strong>in</strong>zwischen standortunabhängiges<br />
Arbeiten ermöglicht. John Naisbitt schreibt <strong>in</strong><br />
Megatrends 2000: »Zum erstenmal <strong>in</strong> der Geschichte ist<br />
der Zusammenhang von Arbeitsplatz und Wohnort überflüssig<br />
geworden«. Der Werbespruch aus den 60er Jahren<br />
»Wohnen im Grünen, arbeiten <strong>in</strong> der <strong>Stadt</strong>« gilt nicht<br />
mehr. Wohnen und arbeiten im Grünen s<strong>in</strong>d möglich<br />
geworden. Dies wird Konsequenzen für die <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> haben. Genauso kann die fortschreitende<br />
europäische Integration Wirkungen zeigen, die heute noch<br />
nicht zu erkennen s<strong>in</strong>d. Wir müssen uns darauf e<strong>in</strong>stellen,<br />
daß es im anbrechenden Informationszeitalter und <strong>in</strong> der<br />
global gewordenen Wirtschaftswelt ke<strong>in</strong>e stabilen und<br />
verläßlich vorausberechenbaren <strong>Entwicklung</strong>en geben<br />
wird. Um Erfolg zu haben, hat es <strong>in</strong> der Vergangenheit<br />
vielfach genügt, grobe Fehler zu vermeiden. In der Zukunft<br />
wird es aber notwendig se<strong>in</strong>, <strong>Entwicklung</strong>en vor<br />
dem allgeme<strong>in</strong>en Wirkungse<strong>in</strong>tritt zu erkennen und im<br />
H<strong>in</strong>blick auf das hohe Veränderungstempo dann unverzüglich<br />
zu handeln. Also aktiv und rechtzeitig das Richtige<br />
zu tun. Dies gilt nicht nur für die Wirtschaft, sondern<br />
auch für unsere Verwaltung. Sie sorgt sich darum, die<br />
ländlichen Räume lebensfähig und lebenswert zu erhalten.<br />
Sie braucht hierzu die Sensibilität, Zukunftsentwicklungen<br />
frühzeitig wahrzunehmen und die Kraft, das Erkannte<br />
auch umzusetzten.<br />
Die <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume ist e<strong>in</strong> bedeutsames<br />
gesellschaftspolitisches Thema. Auch wenn dieses<br />
neben all den täglichen Problemen, die uns <strong>in</strong> der Presse<br />
und <strong>in</strong> den Medien vor Augen geführt werden, anders<br />
ersche<strong>in</strong>en mag. Die Zukunftsentwicklung <strong>in</strong> Deutschland<br />
und <strong>in</strong> Europa wird sicherlich auch davon abhängen, wie<br />
lebensfähig und lebenswert die ländlichen Räume se<strong>in</strong><br />
werden. Erfüllen sie <strong>in</strong> der Zukunft die Anforderungen<br />
nicht, ist e<strong>in</strong>e Migration vom Land <strong>in</strong> die Ballungsräume<br />
zu befürchten, die eigentlich niemand haben will.<br />
Nach dem Wandel von der Agrar- zur Industriegesellschaft<br />
stehen wir jetzt am Beg<strong>in</strong>n des Informationszeitalters.<br />
Walter Kroy, der Chef-Visionär von Daimler-Benz<br />
me<strong>in</strong>t, daß es <strong>in</strong> der Zukunft mit der Fertigungswirtschaft<br />
so gehen werde wie vorher mit der Landwirtschaft. Vielleicht<br />
10 % der Arbeitswilligen und -fähigen werden <strong>in</strong><br />
der Fertigungswirtschaft Arbeit f<strong>in</strong>den und doch soviel<br />
produzieren, wie der Markt braucht. Unsere Gesellschaft<br />
bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Phase grundlegender Neuorientierung.<br />
Der Strukturwandel <strong>in</strong> der Landwirtschaft und der<br />
gerade anbrechende Strukturwandel <strong>in</strong> der Fertigungswirtschaft<br />
werden sich erheblich auf die ländlichen<br />
Räume auswirken. Diese Veränderungen s<strong>in</strong>d bereits jetzt<br />
und werden auch künftig für das Aufgabenfeld <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> von größter Bedeutung se<strong>in</strong>. Was ist <strong>in</strong> dieser<br />
Phase für die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> wichtig? Ich denke,<br />
daß die Kräfte auf e<strong>in</strong>e Neuorientierung gerichtet werden<br />
müssen. Es gilt, e<strong>in</strong>e Urteilsfähigkeit zu entwickeln, die<br />
gewährleistet, daß wir <strong>in</strong> der Zukunft noch stärker als bisher<br />
herausspüren wo die Bedürfnisse der ländlichen<br />
Räume liegen. Unsere Idee ist , die ländlichen Räume im<br />
S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegrierten ländlichen <strong>Entwicklung</strong> zu unterstützen<br />
und damit für <strong>Stadt</strong> und Land wichtige Funktionen<br />
<strong>in</strong> den ländlichen Räumen besonders zu fördern.<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong> der Lebensfähigkeit der<br />
ländlichen Räume. Sie berührt alle Lebensbereiche. Sie<br />
muß daher auch von allen gesellschaftlich relevanten<br />
Kräften getragen werden. Die Frage ist also, was können<br />
wir, was müssen wir im Dorf und <strong>in</strong> der Landschaft<br />
zur <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume tun?<br />
Vorstellung der Referenten<br />
Diese Frage ist unser Thema: Möglichkeiten und<br />
Grenzen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong>. Ich freue mich, daß<br />
sich die Herren Dr. Huber und Dr. Thöne bereit erklärt<br />
haben, hier zu referieren und mit uns zu diskutieren. Ich<br />
stelle Ihnen zunächst Herrn Dr. Balthasar Huber vor.<br />
Dr. Huber ist Diplom-Agrar<strong>in</strong>genieur und Abteilungsleiter<br />
<strong>in</strong> der Europäischen Kommission. Se<strong>in</strong> Arbeitsschwerpunkt<br />
<strong>in</strong> Brüssel ist die <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume.<br />
Dr. Huber soll für uns heute die Zukunft ländlicher<br />
Räume skizzieren und die Integrierte <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
aus der Sicht der Europäischen Kommission darstellen.<br />
Ich danke Ihnen, daß Sie hierher nach <strong>Ansbach</strong><br />
gekommen s<strong>in</strong>d und die Politik der Europäischen Kommission<br />
zur <strong>Entwicklung</strong> ländlicher Räume aus erster Hand<br />
erläutern werden.<br />
Im Anschluß wird Dr. Karl-Friedrich Thöne referieren.<br />
Dr. Thöne ist Geodät und beim Bundesm<strong>in</strong>ister für Ernährung,<br />
Landwirtschaft und Forsten im Referat Landentwicklung<br />
tätig. Dr. Thöne ist aufgrund se<strong>in</strong>er Position im<br />
Bundeslandwirtschaftsm<strong>in</strong>isterium besonders prädest<strong>in</strong>iert,<br />
uns e<strong>in</strong> Bild vom <strong>Ländliche</strong>n Raum von morgen zu<br />
zeichnen und Möglichkeiten und Grenzen der <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> aufzuzeigen. Dr. Thöne befürwortet <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em<br />
Buch, »Die agrarstrukturelle <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> den neuen<br />
Bundesländern« sowohl <strong>in</strong> Ost wie auch <strong>in</strong> West e<strong>in</strong>e<br />
Integrierte <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>. Ich danke Ihnen, daß<br />
Sie nach Bayern gekommen s<strong>in</strong>d und uns die Bonner Sicht<br />
darstellen werden. Wir s<strong>in</strong>d gespannt, welche Möglichkeiten<br />
der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> Sie sehen. Beide Vorträge<br />
werden uns den Rahmen geben für die Diskussion<br />
am Nachmittag und ich hoffe, daß auch e<strong>in</strong> bißchen<br />
Zündstoff dabei se<strong>in</strong> wird.<br />
74 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Balthasar Huber<br />
Die Zukunft ländlicher Räume –<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> aus der<br />
Sicht der Europäischen<br />
Kommission<br />
Zunächst darf ich mich sehr herzlich für die freundlichen<br />
Worte der Begrüßung und für die E<strong>in</strong>ladung, vor<br />
diesem Forum zu sprechen, herzlich bedanken. Nun erwarten<br />
Sie nicht zuviel von der Kommission, weil dieses<br />
geradezu e<strong>in</strong> Widerspruch wäre, wenn die Kommission<br />
e<strong>in</strong>e Art detaillierter »guidel<strong>in</strong>es« für die ländlichen Räume<br />
geben würde. Je weniger die Kommission im Detail vorschreibt,<br />
um so besser ist es. Weil dieses ja auch total im<br />
Widerspruch stünde, zu e<strong>in</strong>er <strong>Entwicklung</strong> von unten nach<br />
oben, so wie wir sie sehen und präferieren und total im<br />
Widerspruch stünde zum Pr<strong>in</strong>zip der Subsidiarität, was<br />
Gottseidank im Vertrag von Maastricht festgehalten ist,<br />
auch wenn es sehr schwierig ist, den Begriff »Subsidiarität«<br />
zu def<strong>in</strong>ieren. Im Grunde genommen ist dieses<br />
e<strong>in</strong> ständiges R<strong>in</strong>gen um Kompetenz gegenüber e<strong>in</strong>er<br />
Zentralbürokratie und ich wünsche den Ländern nur, daß<br />
sie diesen Kampf oft für sich entscheiden. Es ist e<strong>in</strong><br />
großer Fortschritt, daß diese Art von Gedanken <strong>in</strong> der<br />
Kommission überhaupt Platz gegriffen haben.<br />
Wenn wir im europäischen Kontext über die ländliche<br />
<strong>Entwicklung</strong> sprechen, dann assoziiert jeder etwas<br />
anderes mit diesem Begriff.<br />
— S<strong>in</strong>d es die weiträumigen w<strong>in</strong>dzerzausten, ewig feuchten<br />
Hügel des schottischen Hochlandes?<br />
— S<strong>in</strong>d es die <strong>in</strong>tensiven Beregnungsgebiete unter der<br />
stechenden Sonne Thessaloniens, auf denen<br />
Kle<strong>in</strong>stbauern schmackhaftes Obst, Gemüse und<br />
Baumwolle produzieren?<br />
— S<strong>in</strong>d es die kargen, baumdurchsetzten, fast menschenleeren<br />
Gebiete Castillias, wo im Schatten der Korkeichen<br />
die »toros bravos« e<strong>in</strong>er ihr Leben beendenden<br />
Corrida entgegendösen?<br />
— S<strong>in</strong>d es die satten Weiden <strong>in</strong> der Hügellandschaft des<br />
Allgäus mit den e<strong>in</strong>gestreuten E<strong>in</strong>zelhöfen?<br />
— Oder s<strong>in</strong>d es die seendurchsetzten Sandböden mit<br />
riesigen Getreideschlägen und deprimierenden Stilllegungsflächen<br />
der Mecklenburgischen Seenplatte?<br />
All diese Schlaglichter s<strong>in</strong>d zutreffend, zeigen die enormen<br />
Gegensätze der Regionen der EU auf, belegen den<br />
strukturellen Handlungsbedarf für diese seit Jahrhunderten<br />
gewachsenen Kulturlandschaften, die sich plötzlich <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er neuen Konstellation bef<strong>in</strong>den, mit der sich die Kulturlandschaft<br />
und die dort lebenden Menschen ansche<strong>in</strong>end<br />
nicht mehr zurechtf<strong>in</strong>den können. E<strong>in</strong> lästiger<br />
Tümpel, e<strong>in</strong>e wuchernde Hecke bekommen e<strong>in</strong>e neue<br />
Qualität. Selbst das <strong>in</strong> der Bibel gleichnishaft zitierte<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Unkraut hat e<strong>in</strong>e Berechtigung, obwohl die Menschheit<br />
dieses Unkraut seit Jahrtausenden mit allen F<strong>in</strong>essen<br />
bekämpft. Der angebliche Irrweg e<strong>in</strong>er Landwirtschaft im<br />
Nebenerwerb wird e<strong>in</strong> wertvolles Element <strong>in</strong> der <strong>Entwicklung</strong><br />
der ländlichen Räume.<br />
Wie ist es bei dieser Vielfalt möglich, den ländlichen<br />
Raum zu def<strong>in</strong>ieren. Und wie ist es möglich, den dort<br />
angesiedelten Familienbetrieb zu def<strong>in</strong>ieren? Mit Sicherheit<br />
ist es richtig hier im Plural zu sprechen — also von<br />
den ländlichen Räumen. Klar dürfte auch se<strong>in</strong>, daß <strong>in</strong><br />
diesen Räumen Landwirtschaft e<strong>in</strong>schließlich des vor-<br />
und nachgelagerten Bereiches immer noch e<strong>in</strong>e wichtige,<br />
wenn auch rückläufige Rolle spielt. Auch die Hierarchie<br />
der Leistungen des multifunktionalen bäuerlichen Betriebes<br />
hat sich grundlegend geändert.<br />
Zugegebenermaßen auch die Agrarpolitik tappt etwas<br />
verworren und verfügt vielfach nicht über genügend<br />
geeignete Konzepte und effiziente Förder<strong>in</strong>strumente —<br />
viele fühlen sich für den ländlichen Raum zuständig,<br />
aber letztendlich kaum jemand richtig verantwortlich.<br />
Die Vielfalt von Kompetenzen und der bürokratische<br />
Wirrwarr stehen im krassen Gegensatz zu Handlungsbedarf<br />
und den prioritären Notwendigkeiten dieser<br />
Gebiete, nämlich über e<strong>in</strong>fache und transparente Förder<strong>in</strong>strumente<br />
zu verfügen, die bei den bescheidenen<br />
adm<strong>in</strong>istrativen Strukturen der ländlichen Geme<strong>in</strong>den<br />
auch handhabbar s<strong>in</strong>d.<br />
Im Vertrag von Maastricht wird neben der Notwendigkeit,<br />
den unterschiedlichen <strong>Entwicklung</strong>sgrad der<br />
Regionen im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er besseren ökonomischen Konvergenz<br />
<strong>in</strong> der Europäischen Union zu verr<strong>in</strong>gern, auch<br />
erstmalig auf die Notwendigkeit h<strong>in</strong>gewiesen, den unterschiedlichen<br />
<strong>Entwicklung</strong>sstand ländlicher und urbaner<br />
Zonen zu verr<strong>in</strong>gern (Art. 130 a). Diese Aufgabe soll über<br />
den gezielten E<strong>in</strong>satz der Strukturfonds gemeistert<br />
werden. Die Ballung der Fördermittel erfolgt über die<br />
sog. <strong>Entwicklung</strong>sschwerpunkte (Ziele 1 bis 6), die sich auf<br />
def<strong>in</strong>ierte nach objektiven Parametern festgelegte Gebiete<br />
beziehen (Ziele des Strukturfonds, s. S. 76). Trotz der Notwendigkeit<br />
e<strong>in</strong>er Globalstrategie zur <strong>in</strong>tegrierten <strong>Entwicklung</strong><br />
des ländlichen Raumes bleibt der sektorbezogene<br />
Ansatz des EAGFL nach Art. 43 des Vertrages von Rom<br />
erhalten (Art. 130 e).<br />
Der EAGFL wurde nicht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Fond zur <strong>Entwicklung</strong><br />
der ländlichen Räume umgewandelt, was die logische<br />
Konsequenz der veränderten Problemlage gewesen wäre,<br />
weil se<strong>in</strong>e Sektorbezogenheit den ökonomischen Erfordernissen<br />
e<strong>in</strong>er Politik zur <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume<br />
nicht mehr entspricht. Bei dieser rechtlichen Begrenzung<br />
des EAGFL ist e<strong>in</strong>e moderne Strukturpolitik für die ländlichen<br />
Räume nur möglich über den <strong>in</strong>tegrierten E<strong>in</strong>satz<br />
der 3 Strukturfonds, die <strong>in</strong> der Übersicht (s. S. 76) kurz<br />
zitiert s<strong>in</strong>d; nämlich durch das Zusammenwirken des<br />
Regionalfonds, des Sozialfonds und EAGFL, Abt. Ausrichtung,<br />
um das regionale oder lokale <strong>Entwicklung</strong>spotential<br />
optimal zur Entfaltung br<strong>in</strong>gen zu können.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
75
Ziel 1 Förderung der <strong>Entwicklung</strong> und<br />
der strukturellen Anpassung der<br />
Regionen mit <strong>Entwicklung</strong>srückstand<br />
(BIP pro E<strong>in</strong>wohner unter<br />
75 % des EG-Durchschnitts)<br />
Ziel 2 Umstellung der Regionen,<br />
Grenzregionen oder Teilregionen<br />
(e<strong>in</strong>schließlich Arbeitsmarktregionen<br />
und städtischer Verdichtungsräume),<br />
die von rückläufiger<br />
<strong>in</strong>dustrieller <strong>Entwicklung</strong> schwer<br />
betroffen s<strong>in</strong>d.<br />
Ziel 3 Bekämpfung der<br />
Langzeitarbeitslosigkeit (Arbeitnehmer<br />
über 25 Jahre, die länger<br />
als 12 Monate arbeitslos s<strong>in</strong>d).<br />
Erleichterung der E<strong>in</strong>gliederung<br />
von Jugendlichen und von vom<br />
Ausschluß aus dem Arbeitsmarkt<br />
bedrohten Personen.<br />
Ziele der Strukturfonds<br />
Zeitraum <strong>1994</strong> — 1999<br />
Ziel 4 Soll die neuen Aufgaben der ESF<br />
im Vertrag von Maastricht übernehmen:<br />
Erleichterung der<br />
Anpassung der Arbeitskräfte an<br />
die <strong>in</strong>dustriellen Wandlungsprozesse<br />
und an die Veränderungen<br />
der Produktionssysteme.<br />
Ziel 5 Gerichtet auf die <strong>Entwicklung</strong> des<br />
ländlichen Raums:<br />
— 5a Anpassung der Erzeugungs-,<br />
Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen<br />
<strong>in</strong> Land- und Forstwirtschaft.<br />
Modernisierung und<br />
Umstrukturierung der Fischerei.<br />
— 5b <strong>Entwicklung</strong> und strukturelle<br />
Anpassung des ländlichen Raums.<br />
Ziel 6 <strong>Entwicklung</strong> und strukturelle<br />
Anpassung der Regionen mit<br />
<strong>Entwicklung</strong>srückstand <strong>in</strong> Nördlichen<br />
Gebieten mit weniger als 8<br />
E<strong>in</strong>wohnern pro km 2<br />
.<br />
Hauptaufgaben der Strukturfonds<br />
Regionalfonds (EFRE)<br />
— F<strong>in</strong>anzierung von produktiven Investitionen zur Schaffung oder Erhaltung dauerhafter<br />
Arbeitsplätze<br />
— Investitionen zur Verbesserung der Infrastruktur (80 %) (<strong>in</strong>kl. wirtschaftsnahe Infrastruktur)<br />
— Erschließung des endogenen Potentials <strong>in</strong> den Regionen (Service, Technologietransfer,<br />
Zugang zu Kapitalmärkten)<br />
Sozialfonds (ESF)<br />
— Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit durch Erleichterung der beruflichen<br />
E<strong>in</strong>gliederung (Ziel 3)<br />
— Anpassung der von Arbeitslosigkeit bedrohten Personen an den <strong>in</strong>dustriellen Wandel<br />
und die Veränderungen der Produktionssysteme (neues Ziel 4)<br />
Agrarfonds (EAGFL) Abt. Ausrichtung<br />
— Anpassung und <strong>Entwicklung</strong> der Produktionsstrukturen für e<strong>in</strong>e wettbewerbsfähige und<br />
umweltfreundliche Landwirtschaft<br />
— Verbesserung der Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen für landwirtschaftliche<br />
Erzeugnisse<br />
— Förderung der <strong>in</strong>tegrierten <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume (Dorfentwicklung)<br />
— Landwirtschaft = Umwelt<br />
76 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Wie die f<strong>in</strong>anzielle Ausstattung der Fonds sich darstellt,<br />
ist <strong>in</strong> der obigen Übersicht gemessen am Jahr ‘93 beispielhaft<br />
erläutert. Die Sektorbestimmung des EAGFL, Abt.<br />
Ausrichtung, ist von der Hungersnot des zweiten Weltkriegs<br />
und vor allen D<strong>in</strong>gen nach dem zweiten Weltkrieg<br />
diktiert, wo die Erhöhung der Produktivität und Förderung<br />
des technischen Fortschritts <strong>in</strong> der Landwirtschaft im Vordergrund<br />
standen — Forderungen, die heute völlig konträr<br />
stehen zur Notwendigkeit der Produktionsbegrenzung<br />
durch Quoten und Stillegung. Dieser monofaktorielle,<br />
sektorbezogene Ansatz lag auch dem sogenannten<br />
Manshold-Plan zu Grunde, der als Hauptziel hatte, wettbewerbsfähige<br />
und lebensfähige landwirtschaftliche<br />
Betriebe zu schaffen, basierend auf der Nahrungsmittelproduktion.<br />
Daß dieses Konzept scheitern und <strong>in</strong> die<br />
Sackgasse führen mußte, ist klar, da die Multifunktionalität<br />
des landwirtschaftlichen Familienbetriebes außer<br />
Acht gelassen wurde.<br />
Außerdem wird die e<strong>in</strong>seitige Ausrichtung auf die<br />
Nahrungsmittelproduktion nicht den Anforderungen<br />
gerecht, die e<strong>in</strong>e moderne Wohlstands- und Freizeitgesellschaft<br />
an die Landwirtschaft und die von ihr so<br />
erfolgreich gepflegte Kulturlandschaft stellt. Die Realisierung<br />
dieser Politik hätte e<strong>in</strong>e katastrophale Entleerung<br />
des ländlichen Raumes zur Folge gehabt.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Welche Tendenzen<br />
s<strong>in</strong>d zu beachten<br />
<strong>in</strong> der Orientierung der<br />
Landwirtschaft?<br />
Nahrungsmittelproduktion<br />
Direktabsatz(Bauernmärkte),<br />
Nischenprodukte<br />
Frischprodukte aus kontrolliertem<br />
Anbau<br />
Umwelt, Kulturlandschaft,<br />
Erholung<br />
Non-food-Produktion<br />
Dienstleistung<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
77
Nachdem Erholungsfunktion und gesunde Landschaft<br />
nicht <strong>in</strong>dividualisierbare Ansprüche der Gesellschaft an die<br />
Landwirtschaft s<strong>in</strong>d, ist es auch mehrheitsfähig, hierfür<br />
öffentliche Beihilfen zu zahlen. Dies ist nicht zutreffend<br />
für Interventionskosten bei strukturellen Nahrungsmittelüberschußsituationen,<br />
die zu e<strong>in</strong>er erheblichen<br />
Resourcenvergeudung und Wohlstandsverlust führen<br />
<strong>in</strong>folge enormer Exportsubventionen, um auf dem Weltmarkt<br />
konkurrenzfähig zu se<strong>in</strong>.<br />
<strong>Entwicklung</strong><br />
der ländlichen Räume<br />
Vergangenheit:<br />
● Betriebsbezogene Strategie<br />
● Intensivierung der Landwirtschaft<br />
● Rekultivierung, Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
● Verstärkte <strong>in</strong>tensive Viehhaltung<br />
Gegenwart:<br />
● Raumbezogene Strategie<br />
● Naturnahe Produktion<br />
● Regionale Spezialitäten<br />
● Alternative E<strong>in</strong>kommensmöglichkeiten<br />
● Verbesserung der Lebensqualität<br />
● Ger<strong>in</strong>ge Standortb<strong>in</strong>dung des Tertiären<br />
Bereiches<br />
● Chancen der mobilen Wohlstandsgesellschaft<br />
bei leistungsfähiger Infrastruktur<br />
In diesen Spannungsfeldern<br />
— hohe Rationalisierungs- und Produktivitätsgew<strong>in</strong>ne <strong>in</strong><br />
der Landwirtschaft bei kaum steigendem Konsumzuwachs,<br />
— starker Strukturwandel,<br />
— hoher Stellenwert von Umwelt und Erholung,<br />
— Notwendigkeit der Aufrechterhaltung der<br />
Siedlungsstrukturen,<br />
— Notwendigkeit, weiteren Konzentrationstendenzen, die<br />
nach wie vor sehr stark bestehen, <strong>in</strong> Ballungsräumen<br />
entgegenzuwirken, denn die Slums nehmen nach wie<br />
vor zu,<br />
ist die Politik zur <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume als<br />
weiche <strong>Entwicklung</strong>spolitik e<strong>in</strong>gebettet.<br />
Moderne Agrarstrukturpolitik muß e<strong>in</strong>e Politik für alle<br />
Menschen <strong>in</strong> den ländlichen Räumen se<strong>in</strong>, die das Ziel<br />
verfolgt, vergleichbare E<strong>in</strong>kommens- und Lebensbed<strong>in</strong>gungen<br />
zu schaffen, und die Attraktivität der ländlichen<br />
Räume zu stärken. Auf europäischer Ebene werden die<br />
sogenannten horizontalen Maßnahmen der Strukturförderung<br />
des EAGFL, Abt. Ausrichtung, überall gleichartig<br />
angewandt. Ich erwähne hierbei die e<strong>in</strong>zelbetriebliche<br />
Förderung und die Investitionenförderung im Bereich der<br />
Verarbeitung und Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte,<br />
wobei gerade diese Industrie e<strong>in</strong>e sehr wichtige<br />
Komponente <strong>in</strong> der <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume ist,<br />
weil wir durch e<strong>in</strong>e gezielte Allokationspolitik außerlandwirtschaftliche<br />
Arbeitsplätze <strong>in</strong> den ländlichen Räumen<br />
zusätzlich schaffen können.<br />
Innovationen<br />
Im landwirtschaftlichen Betrieb<br />
— Nahrungsmittelproduktion (Nischenproduktion)<br />
— Nachwachsende Rohstoffe (Raps,<br />
Bitterlup<strong>in</strong>en<br />
— Service (Teleshop, Recycl<strong>in</strong>g, Tourismus)<br />
— Direktvermarktung<br />
Gruppe von Betrieben<br />
— lokale Initiativen<br />
— lokale Spezialitäten<br />
— Direktvermarktung<br />
— Service und Kommunalbereich<br />
Lokaler Bereich<br />
— Dorfentwicklung — »small is beautiful«<br />
— Infrastruktur<br />
— Kle<strong>in</strong>e Handwerksbetriebe<br />
— Dienstleitung, Teleshop<br />
— Gebäudeumwidmung<br />
— Dorfentwicklung <strong>in</strong> Gruppen<br />
— Kle<strong>in</strong>er Geldkreislauf<br />
Im S<strong>in</strong>ne der Konzentration zur Erreichung möglichst<br />
schneller Ergebnisse s<strong>in</strong>d die speziellen Förder<strong>in</strong>strumente<br />
auf europäischer Ebene auf die sog. Ziel 1 — wo wir ja<br />
den höchsten Anteil an landwirtschaftlicher Bevölkerung<br />
haben — und die sog. 5b-Regionen konzentriert. Künftig<br />
gehört <strong>in</strong> diese Kategorie auch das Ziel 6. Dies gilt auch<br />
für die spezielle Geme<strong>in</strong>schafts<strong>in</strong>itiative LEADER, wobei<br />
<strong>in</strong> der Konzeption LEADER II 10 % der Haushaltsmittel<br />
von <strong>in</strong>sgesamt 1,4 Milliarden ECU, für Maßnahmen verfügbar<br />
s<strong>in</strong>d, die außerhalb der Gebietskulisse liegen, was<br />
von besonderer Bedeutung ist. LEADER soll e<strong>in</strong>e Schulungs-<br />
und Ideenwerkstatt für neue Konzepte für die<br />
<strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume se<strong>in</strong>, wobei lokale<br />
Initiativgruppen gestärkt werden sollen und Innovationen<br />
der Vorrang gilt. Deshalb ist die große Flexibilität des<br />
Förder<strong>in</strong>struments unverzichtbar, was sicherlich auch das<br />
Risiko des Mißbrauches be<strong>in</strong>haltet. Ich sage immer, auch<br />
78 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
dieses ist e<strong>in</strong> Risikokapital. Deshalb muß im Rahmen dieser<br />
Geme<strong>in</strong>schafts<strong>in</strong>itiative der Innovation e<strong>in</strong>e absolute<br />
Priorität e<strong>in</strong>geräumt werden. Um e<strong>in</strong>e möglichst große<br />
Breitenwirkung und Mobilisierung zu erreichen, muß die<br />
Möglichkeit der Förderung im Rahmen des LEADER-Programms<br />
allen lokalen Initiatoren und <strong>Entwicklung</strong>strägern<br />
bekannt gemacht werden. Ich habe dafür Verständnis, daß<br />
e<strong>in</strong>e derartige Publizität viele Erwartungen und auch<br />
e<strong>in</strong>en gewissen politischen Druck hervorruft. Die Kommission<br />
kann aber nicht akzeptieren, daß e<strong>in</strong>e derartige<br />
Fördermöglichkeit — wie auch die 5b-Förderung — nur<br />
e<strong>in</strong>em gewissen elitären Zirkel bekannt wird oder dies zu<br />
e<strong>in</strong>er verwaltungs<strong>in</strong>ternen Veranstaltung verkommt.<br />
Dieses trifft zweifelsohne für die erste Phase auch für<br />
Bayern weitestgehend zu. Dies gilt auch für die Förderung<br />
von 5b, wo sich viele Leute darüber beschwert haben, daß<br />
ihr Gebiet zwar <strong>in</strong> die 5b-Kulisse aufgenommen wurde,<br />
ohne davon irgende<strong>in</strong>en praktischen Effekt zu spüren und<br />
ohne daß die daran <strong>in</strong>teressierten Kreise e<strong>in</strong>en E<strong>in</strong>fluß<br />
hätten geltend machen können, wie die Mittel am s<strong>in</strong>nvollsten<br />
e<strong>in</strong>gesetzt werden könnten. Bürgerbeteiligung<br />
gibt Motivationsschübe, hat katalysatorische Wirkung,<br />
fördert den Identifikationsgrad und hilft<br />
Demokratieverdrossenheit abzubauen. Auch wenn dieses<br />
natürlich für die Verwaltung, und ich weiß, was dieses<br />
bedeutet, zusätzlichen Ärger verursacht, weil man eben<br />
nicht mehr alle<strong>in</strong> entscheiden kann. Aber auch das ist<br />
Subsidiarität. Die Mitgliedstaaten können nicht nur von<br />
der Europäischen Geme<strong>in</strong>schaft mit Recht Subsidiarität<br />
e<strong>in</strong>fordern. Dieses muß soweit h<strong>in</strong>untergehen wie möglich<br />
und darf vor allen D<strong>in</strong>gen nicht auf Landesebene <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Zentralisierung enden. Warum scheuen wir uns eigentlich,<br />
diese Instrumente stärker e<strong>in</strong>zusetzen?<br />
Über LEADER wurde <strong>in</strong> verschiedensten Mitgliedstaaten<br />
beispielsweise e<strong>in</strong> Dorfentwicklungsprogramm als lokale<br />
Initiative angeschoben als — für diese Mitgliedstaaten —<br />
echte Innovationsmaßnahme, wie <strong>in</strong> Frankreich, Portugal<br />
und selbst <strong>in</strong> Griechenland. Ich stelle nunmehr fest, <strong>in</strong> der<br />
zweiten Phase bei den vorgelegten und e<strong>in</strong>gehenden<br />
operationellen Programmen, daß der Charme dieser<br />
Geme<strong>in</strong>schafts<strong>in</strong>itiative überschlägt und somit das Pilotprojekt<br />
zum normalen Förder<strong>in</strong>strument im operationellen<br />
Programm E<strong>in</strong>gang f<strong>in</strong>det.<br />
Durch das <strong>in</strong>tegrierte Zusammenwirken der 3 Strukturfonds<br />
der EU sowohl <strong>in</strong> den Ziel 1- als auch <strong>in</strong> den<br />
Ziel 5b-Gebieten können alle ökonomisch und ökologisch<br />
tragfähigen Konzepte für die ländlichen Räume e<strong>in</strong>schließlich<br />
der hierfür notwendigen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen,<br />
zur Stärkung des sog. Humanpotentials,<br />
gefördert werden, wobei natürlich auch hier die<br />
Innovation an erster Stelle stehen muß, ohne jedoch<br />
traditionelle Maßnahmen vernachlässigen zu wollen. Um<br />
der ernormen Vielfalt und den sehr unterschiedlichen<br />
Chancen optimal Rechnung tragen zu können, muß<br />
natürlich der Förderrahmen sehr sehr breit und flexibel<br />
konzipiert werden. Deshalb ist dieses Planungskonzept<br />
über 6 Jahre auch <strong>in</strong> gewisser Weise e<strong>in</strong> gefährliches<br />
Instrument, weil wir natürlich die wertvollsten Elemente<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
der <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume, nämlich den produktiven<br />
Bereich, nicht erfassen können, weil die E<strong>in</strong>zelentscheidung<br />
jedes Unternehmens bei ihm selber liegt<br />
und es sich nicht e<strong>in</strong>er Globalplanung unterordnet. Dies<br />
kann die Gefahr be<strong>in</strong>halten, daß aufgrund der Erfüllung<br />
dieses Plans eben öffentliche Ausgaben, e<strong>in</strong>e hohe Priorität<br />
haben, obwohl diese nur e<strong>in</strong>e sekundäre Priorität<br />
haben sollten. Vor allen D<strong>in</strong>gen für den ländlichen Raum<br />
müssen die produktiven Elemente <strong>in</strong> den Vordergrund<br />
stehen, um die ökonomische Basis zu verbreitern und<br />
außerlandwirtschaftliche Arbeitsplätze <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er weichen<br />
<strong>Entwicklung</strong>sstrategie zu schaffen. Außerdem muß natürlich<br />
<strong>in</strong> diesem Konzept e<strong>in</strong>e <strong>Entwicklung</strong> von unten nach<br />
oben und e<strong>in</strong>e Beteiligung aller relevanten Wirtschaftsund<br />
Gesellschaftsgruppen bei der Ausarbeitung der regionalen<br />
<strong>Entwicklung</strong>skonzepte sichergestellt se<strong>in</strong>. Dieses ist<br />
sogar <strong>in</strong> der Verordnung festgehalten, wobei <strong>in</strong> der Ratsgruppe<br />
über dieses Problem sehr sehr lange diskutiert<br />
wurde und dann e<strong>in</strong>e sehr vage Formulierung <strong>in</strong> der<br />
Verordnung fixiert wurde. Dabei ist auch bei der regionalen<br />
Wirtschaftsförderung e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>strukturierter Ansatz<br />
erforderlich, der <strong>in</strong> der jetzigen Form der deutschen<br />
Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe nicht sichergestellt ist. Wir müssen<br />
kritischer analysieren, wo denn die Hauptprobleme liegen<br />
und gezielte Lösungsstrategien def<strong>in</strong>ieren. Sie liegen bei<br />
den gewerblichen Kle<strong>in</strong>betrieben beispielsweise <strong>in</strong> den<br />
ersten 5 Jahren nach Gründung, so daß das E<strong>in</strong>greifen der<br />
Förderung bei Erreichen überregionaler Bedeutung, so wie<br />
es <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe festgehalten ist, an den<br />
prioritären Notwendigkeiten vorbeigeht. Und dieses ist<br />
gerade besonders fatal <strong>in</strong> den neuen Bundesländern, wo<br />
vor allem <strong>in</strong> den ländlichen Räumen e<strong>in</strong>e möglichst große<br />
Anzahl von Betriebsgründen <strong>in</strong>iziert werden soll, um neue<br />
außerlandwirtschaftiche Arbeitsplätze zu schaffen — ich<br />
erwähne hier nur den boomenden Bausektor. Bl<strong>in</strong>des<br />
Überstülpen der Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe ist sicherlich e<strong>in</strong>er<br />
kritischen Analyse zu unterziehen — vor allen D<strong>in</strong>gen <strong>in</strong><br />
den ländlichen Räumen. Gleiches gilt auch für e<strong>in</strong> bl<strong>in</strong>des<br />
Fördern von Gewerbegebieten auf der grünen Wiese<br />
ohne organisches An- und E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>den <strong>in</strong> entwickelbare<br />
Siedlungsstrukturen und ohne kritische Bedarfsanalyse.<br />
Wichtig ist auch e<strong>in</strong>e enge Zusammenarbeit zwischen den<br />
M<strong>in</strong>isterien. Auch hier haben sich sogar <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er so vorbildlichen<br />
Verwaltung wie <strong>in</strong> der bayerischen erhebliche<br />
Defizite gezeigt. Es bestehen zwar <strong>in</strong> Bayern nicht Sprachschwierigkeiten,<br />
aber so wie mir sche<strong>in</strong>t, erhebliche Verständigungsprobleme.<br />
Dabei komme ich schon auf die neue Phase der OP zu<br />
sprechen, nämlich dem Programmabschnitt <strong>1994</strong> bis<br />
1999, an dessen Beg<strong>in</strong>n wir stehen. Die Kommission wird<br />
<strong>in</strong> den nächsten Wochen e<strong>in</strong>e Reihe von geme<strong>in</strong>schaftlichen<br />
Beihilfekonzepten und OP genehmigen, <strong>in</strong> denen<br />
die globale <strong>Entwicklung</strong>spolitik, und damit der E<strong>in</strong>satz der<br />
Strukturfonds der Geme<strong>in</strong>schaft, für die nächsten 6 Jahre,<br />
entsprechend den Beschlüssen von Ed<strong>in</strong>burgh, festgehalten<br />
wird. In der Übersicht (s. S. 80) haben Sie den E<strong>in</strong>satz<br />
der Strukturmittel über diesen Zeitraum und die Mittelverteilung<br />
auf die e<strong>in</strong>zelnen Ziele e<strong>in</strong>schließlich der<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
79
Mio ECU — 1992 Preise<br />
STRUKTURFONDS<br />
<strong>in</strong>sgesammt<br />
● Ziel 1<br />
● Außerhalb Ziel 1<br />
Ziel 2<br />
Ziel 3/4<br />
Ziel 5 b<br />
Ziel 5 a im Ziel 5 b<br />
Regionen<br />
Ziel 5 a außerhalb<br />
Ziel 1—5 b<br />
Ziel 5 a Fische<br />
● Übergangszahlungen<br />
Ausgabenverteilung der Strukturfonds<br />
im Zeitraum <strong>1994</strong> — 1999<br />
Förderung von 5a. Sie sehen, wie die Dotierung über die<br />
Jahre h<strong>in</strong>weg <strong>in</strong> der mittelfristigen F<strong>in</strong>anzplanung läuft.<br />
Es handelt sich dabei, und das muß man sich immer vergegenwärtigen,<br />
um das dreifache F<strong>in</strong>anzvolumen des<br />
Marschall-Plans. Etwa 25 % der Mittel — mit starker Variation<br />
von Mitgliedstaat zu Mitgliedstaat und Region zu<br />
Region — werden für die <strong>in</strong>tegrierte <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen<br />
Räume verwendet. Denn die Kommission entscheidet<br />
nicht, für welche Sektoren und wie die Mittel e<strong>in</strong>gesetzt<br />
werden, sondern wir geben nur e<strong>in</strong>en F<strong>in</strong>anzrahmen<br />
vor und der Mitgliedstaat entscheidet, wo se<strong>in</strong>e Prioritäten<br />
liegen. Etwa 25 % werden für die <strong>Entwicklung</strong> der<br />
ländlichen Räume verfügbar se<strong>in</strong>. Dies ist gleichzeitig e<strong>in</strong><br />
enormer, aber auch e<strong>in</strong> bescheidener Betrag, wenn man<br />
bedenkt, daß diese Politik sich auf 80 % der Fläche und<br />
40 % der Bevölkerung erstreckt.<br />
Integrierte <strong>Entwicklung</strong> ist ke<strong>in</strong> Nebene<strong>in</strong>ander verschiedenster<br />
sektorieller Politikelemente, die <strong>in</strong> verwirrender<br />
Vielfalt über das Land gestreut s<strong>in</strong>d, mit teilweise<br />
widersprüchlichen Zielsetzungen arbeiten und damit auch<br />
gegenseitig sich neutralisierenden Effekten. Vielmehr<br />
muß hierfür zur Maximierung der Wohlfahrtsgew<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong><br />
gezieltes Zusammenwirken aller Politik<strong>in</strong>strumente sicher-<br />
<strong>1994</strong> 1995 1996 1997 1998 1999 <strong>1994</strong> — 1999<br />
20135<br />
13220<br />
6915<br />
2281<br />
2359<br />
866<br />
315<br />
626<br />
143<br />
305<br />
2140<br />
14300<br />
7180<br />
2372<br />
2452<br />
1065<br />
329<br />
574<br />
143<br />
245<br />
22740<br />
15330<br />
gestellt se<strong>in</strong>, um somit dauerhaft tragfähige Konzepte<br />
anzuschieben, aber ke<strong>in</strong>esfalls aufzuoktroieren. Anschieben<br />
heißt — der <strong>Entwicklung</strong>sprozeß von unten nach<br />
oben, um damit umfassende Verbesserung der ländlichen<br />
Lebens-, Arbeits- und Erholungsbed<strong>in</strong>gungen sicherzustellen.<br />
Wie ich schon sagte, dieses <strong>Entwicklung</strong>skonzept<br />
kann nur e<strong>in</strong>e weiche <strong>Entwicklung</strong> se<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em fragilen<br />
und teilweise auch sehr sensiblen humanen und ökologischen<br />
Umfeld, <strong>in</strong> dem sich e<strong>in</strong>e Fülle kle<strong>in</strong>er Aktivitäten,<br />
getragen von Hunderttausenden eigenverantwortlich handelnden<br />
Personen und Unternehmern, zu e<strong>in</strong>em von der<br />
Verwaltung locker gesteuerten Gesamtbild zusammenf<strong>in</strong>den<br />
— small is beautiful. Dies gilt vor allen D<strong>in</strong>gen hier,<br />
darauf können wir stolz se<strong>in</strong>, ist gleichzeitig aber auch<br />
gefährlich. Denn aufgrund dieser Kle<strong>in</strong>heit und des<br />
Mangels spektakulärer Maßnahmen wird diese Politik vielfach<br />
real vernachlässigt, weil es eben öffentlich wirksamer<br />
ist, das Eröffnungsband e<strong>in</strong>er großen Straße zu durchschneiden<br />
und weil dieses <strong>in</strong> der Presse überall rüberkommt.<br />
Diese Politik der <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen<br />
Räume darf sich nicht <strong>in</strong> Worthülsen oder l<strong>in</strong>guistischer<br />
Akrobatik erschöpfen, sondern muß von den Realitäten<br />
ausgehen: von den bestehenden Siedlungsstrukturen, von<br />
80 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
7410<br />
2510<br />
2595<br />
1075<br />
342<br />
500<br />
143<br />
245<br />
24026<br />
16396<br />
7630<br />
2610<br />
2699<br />
1080<br />
353<br />
500<br />
143<br />
245<br />
25690<br />
17820<br />
7870<br />
2716<br />
2810<br />
1090<br />
366<br />
500<br />
143<br />
245<br />
27400<br />
19280<br />
8120<br />
2828<br />
2924<br />
1100<br />
380<br />
500<br />
143<br />
245<br />
141471<br />
96346<br />
45125<br />
15316<br />
15840<br />
3296<br />
2085<br />
3200<br />
858<br />
1530
Kennzeichen e<strong>in</strong>er<br />
INTEGRIERTEN LÄNDLICHEN<br />
ENTWICKLUNG<br />
sollten se<strong>in</strong><br />
➊<br />
Ganzheitlichkeit und Individualität<br />
➋<br />
Integration und Kooperation<br />
➌<br />
Innovation und Investition<br />
➍<br />
Partizipation und Pluralität<br />
➎<br />
Information und Bildung<br />
➏<br />
Gelassenheit und Geduld<br />
der umgebenden Kulturlandschaft, von der Kultur, Tradition,<br />
den speziellen Stärken und Schwächen, von der<br />
Lage zu den urbanen Zonen, zu den bestehenden Infrastrukturen,<br />
<strong>in</strong> Relation zum landwirtschaftlichen Produktionspotential<br />
zu den gegebenen und neu zu schaffenden<br />
Absatzwegen, um nur die wichtigsten zu erwähnen.<br />
Ganz wesentlich ist das Humanpotential. Deshalb ist Abwanderung<br />
der Jugend aus den ländlichen Räumen das<br />
gefährlichste Phänomen, dem wirkungsvoll entgegengewirkt<br />
werden muß. Auch können örtlich ansässige clevere<br />
Unternehmer oder Führungspersönlichkeiten das <strong>Entwicklung</strong>skonzept<br />
wesentlich bee<strong>in</strong>flussen. Dieses s<strong>in</strong>d alles<br />
Faktoren die glasklar belegen, daß <strong>in</strong> dieser Politik die<br />
europäische Geme<strong>in</strong>schaft sehr wenig zentral zu steuern<br />
hat. Wenn wir <strong>in</strong> den meisten Regionen das Dorf als prägende<br />
Siedlungsstruktur haben und dieses gleichzeitig die<br />
kle<strong>in</strong>ste adm<strong>in</strong>istrative und demokratische E<strong>in</strong>heit ist, so<br />
ist dieses der logische und natürlichste Ansatzpunkt<br />
dieser <strong>Entwicklung</strong>skonzeption, wobei alle vorher zitierten<br />
Bed<strong>in</strong>gungen und Aspekte sich <strong>in</strong> unauffälliger, logischer<br />
und damit idealer Weise vere<strong>in</strong>igen lassen und wo leicht<br />
hohe Beteiligungs- und Identifizierungswerte erreichbar<br />
s<strong>in</strong>d. Ich spreche absichtlich nicht von Dorferneuerung<br />
— da mit diesem Begriff mehr retrovertierte, statische<br />
und <strong>in</strong> Richtung Verhübschungspolitik gerichtete Aspekte<br />
assoziiert werden. Dorfentwicklung, die <strong>in</strong> sich schlüssig<br />
ist als dynamisches Konzept, muß sich im Regionalkonzept<br />
e<strong>in</strong>ordnen, womit sich die <strong>Entwicklung</strong> von unten<br />
nach oben und die strategische Politik von oben nach<br />
unten treffen — nicht aufe<strong>in</strong>anderprallen, so daß hier wie<br />
die Engländer sagen, die cross compliance <strong>in</strong> idealer Weise<br />
sichergestellt ist. Entwickelte Dörfer mit ihren Betrieben<br />
haben bessere Chancen für Diversifizierung, Verbreiterung<br />
der ökonomischen Basis durch Schaffung alternativer<br />
E<strong>in</strong>kommensmöglichkeiten und geben e<strong>in</strong>e solide<br />
Ausgangsbasis für weitere Innovationen.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
nach Magel 1/93<br />
Wenn sich mehrere Dörfer <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Gruppenentwicklung<br />
zusammenschließen, dann gehen beide Systeme,<br />
nämlich Regionalpolitik und <strong>Entwicklung</strong>, von unten nach<br />
oben <strong>in</strong>e<strong>in</strong>ander auf. Deshalb spricht man <strong>in</strong> manchen<br />
deutschen Bundesländern, wie z. B. <strong>in</strong> Hessen, bereits von<br />
ländlicher Regionalentwicklung. Dieses sche<strong>in</strong>t mir e<strong>in</strong>e<br />
gewisse Idealkonzeption zu se<strong>in</strong>, weil nur so die notwendigen<br />
Infrastrukturen und der Dienstleistungsbereich <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er breiten Fächerung im ländlichen Raum erhalten<br />
werden können als Grundvoraussetzung zur Steigerung<br />
der Attraktivität und der Lebensqualität. Nur so läßt sich<br />
der sogenannte kle<strong>in</strong>e Geldkreislauf absichern, d. h. im<br />
ländlichen Raum ver<strong>dient</strong>es Geld wird dort auch ausgegeben<br />
und schafft damit Wohlfahrtsgew<strong>in</strong>ne und Multiplikationseffekte.<br />
Im Wege des Tourismus und im Dienstleistungsbereich<br />
für die urbanen Zonen, wozu entwickelte<br />
ländliche Räume <strong>in</strong> der Lage s<strong>in</strong>d, gel<strong>in</strong>gt es sogar, den<br />
Geldfluß umzuleiten, nämlich e<strong>in</strong>en Fluß von den urbanen<br />
<strong>in</strong> die ländlichen Regionen.<br />
Die Chancen hierfür s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er mobilen Wohlstandsgesellschaft,<br />
<strong>in</strong> der ja die Entfernungen stark zusammengeschrumpft<br />
s<strong>in</strong>d, sehr günstig. Man muß sich fragen,<br />
warum wir dabei bisher nicht erfolgreicher waren. British<br />
Airways läßt se<strong>in</strong>e Buchführung auf den Philipp<strong>in</strong>en<br />
machen und die Flugzeugwartung wird nunmehr <strong>in</strong> Indien<br />
vorgenommen — schlagende Beweise dafür, daß der<br />
Globus zusammengeschrumpft ist durch moderne<br />
Telekommunikationsmöglichkeiten und da muß es uns<br />
doch gel<strong>in</strong>gen, hier die Kommunikation ländlicher und<br />
urbaner Zonen zu verbessern und bessere Synergieeffekte<br />
zu erreichen.<br />
Ziel der <strong>Entwicklung</strong> der<br />
ländlichen Räume<br />
● ökonomische Basis stärken<br />
und verbreitern<br />
● Attraktivität und<br />
Lebensqualität erhöhen<br />
● Wohlstandsabfluß stoppen<br />
Für den Zeitraum <strong>1994</strong> — 1999 wurde die festgelegte<br />
Förderkulisse für die sog. 5b-Gebiete neu festgelegt. Sie<br />
wurde auch <strong>in</strong> Deutschland gegenüber der bisherigen<br />
erheblichen ausgeweitet und umfaßt nunmehr e<strong>in</strong>en<br />
Bevölkerungsanteil von 9,6 % bei e<strong>in</strong>em Gedamtdurchschnitt<br />
von 8,2 %. Die Förder<strong>in</strong>tensität pro E<strong>in</strong>wohner<br />
liegt <strong>in</strong> Deutschland deutlich unter dem europäischen<br />
Durchschnitt, so daß <strong>in</strong> der zweiten Phase e<strong>in</strong>e viel, viel<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
81
Bevölkerung <strong>in</strong> den förderfähigen Gebieten im Zeitraum <strong>1994</strong> — 1999<br />
Mitgliedstaat<br />
Ziel-5b-Gebiete noch nicht e<strong>in</strong>gearbeitet<br />
Belgien<br />
Dänemark<br />
Deutschland<br />
Spanien<br />
Frankreich<br />
Italien<br />
Luxemburg<br />
Niederlande<br />
Vere<strong>in</strong>igtes Königreich<br />
INSGESAMT<br />
gezieltere Mittelverwendung notwendig ist. Die Maßnahmen<br />
mit dem höchsten ökonomischen Input s<strong>in</strong>d prioritär<br />
zu bedienen. Das ist der e<strong>in</strong>zige entscheidende Parameter;<br />
nicht die Kompetenz der e<strong>in</strong>zelnen M<strong>in</strong>isterien oder nicht<br />
die Ausgabenbereiche, die den e<strong>in</strong>fachsten Mittelabfluß<br />
garantieren. Auch hier könnte ich e<strong>in</strong>e Reihe von Bei-<br />
Land<br />
BE<br />
DE<br />
DK<br />
EL<br />
ES<br />
FR<br />
LU<br />
IR<br />
IT<br />
NL<br />
PT<br />
UK<br />
Insges.<br />
Zuwendung<br />
(MECUS)<br />
730<br />
13.640<br />
13.980<br />
26.300<br />
2.190<br />
5.620<br />
14.860<br />
150<br />
13.980<br />
2.300<br />
93.810<br />
E<strong>in</strong>wohner<br />
00 448 059<br />
00 360 119<br />
07 725 000<br />
01 731 271<br />
09 759 427<br />
04 827 805<br />
00 029 972<br />
00 799 958<br />
02 840 997<br />
28 522 608<br />
prozentualer Anteil an der<br />
Landesbevölkerung<br />
spielen aus Bayern zitieren. Gemessen an den sogenannten<br />
Ziel-1-Regionen liegt der Mittele<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> den 5b-<br />
Gebieten oder die Förder<strong>in</strong>tensität gemessen pro E<strong>in</strong>wohner<br />
bei etwa 20 %, wobei man allerd<strong>in</strong>gs nicht<br />
vergessen darf, daß im 5b-F<strong>in</strong>anzvolumen die sog.<br />
5a-Instrumente nicht enthalten s<strong>in</strong>d.<br />
82 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
04,5<br />
07,0<br />
09,6<br />
04,4<br />
17,3<br />
08,4<br />
07,4<br />
05,4<br />
04,9<br />
08,2<br />
Zahlungsverpflichtungen zweite Phase<br />
Strukturfonds <strong>1994</strong>–1999 (Ziel 1 und 5 B) – <strong>1994</strong>–1996 (Ziel 2)<br />
ZIEL 1 (1) ZIEL 2 (2) ZIEL 5 B<br />
E<strong>in</strong>wohneranzahl<br />
(MILLIONEN)<br />
1,20<br />
16,00<br />
10,00<br />
23,8<br />
2,46<br />
3,50<br />
21,10<br />
0,25<br />
10,30<br />
3,33<br />
91,22<br />
Betrag pro<br />
E<strong>in</strong>wohner<br />
(ECUS)<br />
608<br />
853<br />
1.398<br />
1.140<br />
890<br />
1.606<br />
704<br />
600<br />
1.357<br />
690<br />
1.028<br />
(1) Ziel 1: Insgesamt GFK + IFOP<br />
(2) Ziel 2: Geme<strong>in</strong>schafts<strong>in</strong>itiative nicht mit<strong>in</strong>begriffen<br />
Zuwendung<br />
(MECUS)<br />
160<br />
733<br />
56<br />
1.130<br />
1.765<br />
7<br />
684<br />
300<br />
2.140<br />
6.977<br />
E<strong>in</strong>wohneranzahl<br />
(MILLIONEN)<br />
1,41<br />
7,02<br />
0,43<br />
7,90<br />
14,61<br />
0,13<br />
6,32<br />
2,60<br />
17,71<br />
58,13<br />
Betrag pro<br />
E<strong>in</strong>wohner<br />
(ECUS)<br />
113<br />
104<br />
130<br />
143<br />
121<br />
54<br />
108<br />
115<br />
121<br />
120<br />
Zuwendung<br />
(MECUS)<br />
77<br />
1.227<br />
54<br />
664<br />
2.238<br />
6<br />
901<br />
150<br />
817<br />
6.134<br />
E<strong>in</strong>wohneranzahl<br />
(MILLIONEN)<br />
0,44<br />
7,72<br />
0,36<br />
1,73<br />
9,75<br />
0,03<br />
4,82<br />
0,80<br />
2,84<br />
28,49<br />
Betrag pro<br />
E<strong>in</strong>wohner<br />
(ECUS)<br />
175<br />
159<br />
150<br />
384<br />
230<br />
200<br />
187<br />
188<br />
288<br />
215
Die neuen Bundesländer, die ja übergangsweise über<br />
e<strong>in</strong>e Sonderverordnung be<strong>dient</strong> wurden, s<strong>in</strong>d nunmehr<br />
offiziell sog. Ziel 1-Förderkulisse. In der Übersicht (s. S 82)<br />
haben sie die Fördermittel im Bereich der Strukturfonds <strong>in</strong><br />
der zweiten Phase für die e<strong>in</strong>zelnen Mitgliedstaaten und<br />
für die e<strong>in</strong>zelnen Förderziele ausgewiesen, wobei eben e<strong>in</strong><br />
Land sowohl <strong>in</strong> Ziel 1, wie <strong>in</strong> Ziel 2, wie <strong>in</strong> Ziel 5b figurieren<br />
kann. Wenn die vorh<strong>in</strong> zitierten Schwierigkeiten <strong>in</strong><br />
den nächsten Tagen ausgeräumt werden können, dann<br />
dürfte das geme<strong>in</strong>schaftliche Förderkonzept und die OP<br />
für die neuen Bundesländer <strong>in</strong> den nächsten Tagen e<strong>in</strong>vernehmlich<br />
beschlossen werden, so daß die offizielle Genehmigung<br />
durch die Kommission <strong>in</strong> etwa 3—4 Wochen<br />
erfolgen kann, damit die Zuschüsse <strong>in</strong> Form der Vorschüsse<br />
für die neuen Bundesländer ausgezahlt werden können.<br />
Dies ist sehr wichtig, weil e<strong>in</strong>e Reihe von Maßnahmen <strong>in</strong><br />
den neuen Bundesländern ohne Geme<strong>in</strong>schaftsf<strong>in</strong>anzierungen<br />
nicht mehr laufen, so hoch ist der Mittele<strong>in</strong>satz,<br />
nämlich 14 Mrd ECU für die Dauer von 6 Jahren. Im<br />
Bereich der ländlichen <strong>Entwicklung</strong> läuft ohne EAGFL-<br />
Beteiligung nichts. Es läuft ke<strong>in</strong>e Dorfentwicklung mehr,<br />
die ja e<strong>in</strong> Zentral<strong>in</strong>strument <strong>in</strong> der Förderung der ländlichen<br />
Räume <strong>in</strong> den neuen Bundesländern ist.<br />
Von den <strong>in</strong>sgesamt für die 5b-Politik verfügbaren<br />
Haushaltsmitteln von 6,1 Mrd ECU — also wenn Sie <strong>in</strong> DM<br />
umrechnen, multiplizieren Sie die ECU mit 2 — entfallen<br />
etwa 20 % auf die BRD, wovon wiederum 50 % auf den<br />
Freistaat Bayern entfallen. Der Verteilungsschlüssel für die<br />
erste Phase gilt auch für die zweite Phase.<br />
Mitgliedstaat Mittel Mittel<br />
Ziel-5b-Gebiete noch<br />
nicht e<strong>in</strong>gearbeitet<br />
Belgien<br />
Dänemark<br />
Deutschland<br />
Spanien<br />
Frankreich<br />
Italien<br />
Luxemburg<br />
Niederlande<br />
Vere<strong>in</strong>igtes Königreich<br />
TOTAL<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Es handelt sich also ke<strong>in</strong>esfalls, auch nicht für Bayern,<br />
um marg<strong>in</strong>ale Geldbeträge, die die Geme<strong>in</strong>schaft für diesen<br />
Politikbereich verfügbar macht. Dieses Moment wurde<br />
lange Zeit nicht erkannt, denn sonst wäre mit Sicherheit<br />
die Federführung nicht so gelaufen, wie sie gelaufen ist.<br />
Durch das Pr<strong>in</strong>zip der Additionalität haben die Gebiete<br />
und die von der EU-mitf<strong>in</strong>anzierten Politikbereiche e<strong>in</strong>e<br />
privilegierte Position und fallen nicht dem Rotstift der<br />
Sparpolitik zum Opfer. Das ist e<strong>in</strong> sehr, sehr wichtiger<br />
zusätzlicher Aspekt. Die Förderkonzepte s<strong>in</strong>d nunmehr von<br />
den deutschen Ländern der Kommission zur Prüfung und<br />
Genehmigung vorgelegt worden, und die Kommission<br />
muß <strong>in</strong>nerhalb der nächsten 6 Monate <strong>in</strong> partnerschaftlicher<br />
Zusammenarbeit mit den Regionen darüber bef<strong>in</strong>den.<br />
Partnerschaft ist sehr wichtig und ich würde Ihnen empfehlen,<br />
dieses Wort »Partnerschaft« auf jede Akte 3-mal zu<br />
schreiben. Durch die E<strong>in</strong>haltung der Fristen ist auch die<br />
Mitf<strong>in</strong>anzierung der Maßnahmen bereits im Jahre <strong>1994</strong><br />
sichergestellt, soweit die Kommissionsent-scheidung dieses<br />
Maßnahmenpaket abdeckt. Geld und öffentliche<br />
Förderung s<strong>in</strong>d zwar wichtig, aber nicht alles. Sie müssen<br />
begleitet werden von promotorischen und organisatorischen<br />
Akzenten, wie Informationsbörsen, Aus- und<br />
Fortbildungsaktionen, vielleicht auch schon im Vorgriff<br />
sozusagen auf Reserve, Erfahrungsaustausch, der nicht an<br />
den Landesgrenzen auch nicht an den Grenzen des Mitgliedstaates<br />
Halt machen darf. Durch die europäische<br />
Vernetzung wird vermieden, daß nicht jeder immer wieder<br />
neu das Rad erf<strong>in</strong>den muß; gleichzeitig wird durch diese<br />
Indikative Aufteilung der GFK-Mittel im Zeitraum <strong>1994</strong> — 1999<br />
<strong>in</strong> Mio. ECU<br />
Preise von <strong>1994</strong><br />
0077<br />
0054<br />
1227<br />
0664<br />
2238<br />
0901<br />
0006<br />
0150<br />
0817<br />
6134<br />
durchschn.<br />
Geme<strong>in</strong>schaftsbeteiligu<br />
prozentualer Anteil <strong>in</strong> ECU<br />
1,2<br />
0,9<br />
20,0<br />
10,8<br />
36,5<br />
14,7<br />
00,1<br />
02,4<br />
13,3<br />
100,0<br />
171,9<br />
150,0<br />
158,8<br />
383,5<br />
229,3<br />
186,6<br />
200,2<br />
187,5<br />
287,5<br />
215,1<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
83
Zusammenarbeit das europäische Bewußtse<strong>in</strong> gestärkt.<br />
Auch <strong>in</strong> diesem Bereich setzt LEADER II neue Akzente.<br />
Gerade die Strategie der globalen, <strong>in</strong>tegrierten Dorfentwicklung<br />
<strong>in</strong> se<strong>in</strong>er E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung <strong>in</strong> die regionale <strong>Entwicklung</strong>sstrategie<br />
wird <strong>in</strong> den nächsten Jahren, ich b<strong>in</strong><br />
sicher, e<strong>in</strong> <strong>in</strong> Europa beherrschendes Thema se<strong>in</strong>. Die<br />
deutschen Bundesländer, vor allen D<strong>in</strong>gen die Südachse,<br />
kann dabei wertvolle Ideen überbr<strong>in</strong>gen, <strong>in</strong>dem sie aus<br />
ihrem langjährigen Erfahrungsschatz schöpfen. Die Positionierung<br />
des Konzeptes Dorfentwicklung ist die Folge<br />
der revidierten Fassung des EAGFL, wo diese Maßnahme<br />
trotz Widerstand <strong>in</strong> der Verordnung festgehalten wurde.<br />
Als nützlich für die <strong>Entwicklung</strong>sbemühungen im ländlichen<br />
Raum ersche<strong>in</strong>en mir auch die neuen F<strong>in</strong>anztechniken,<br />
so wie sie <strong>in</strong> der EAGFL-Verordnung enthalten s<strong>in</strong>d.<br />
Ich erwähne als Stichworte Risikokapitalgesellschaften,<br />
Revolv<strong>in</strong>gfunds, Globalzuschüsse für spezielle Vorhaben,<br />
Startbeihilfen für Junghandwerker <strong>in</strong> den ländlichen<br />
Räumen. Dieses alles kann unter dem Anstrich »f<strong>in</strong>anzielle<br />
Techniken« f<strong>in</strong>anziert werden e<strong>in</strong>schließlich der Banksicherheiten<br />
beispielsweise auch <strong>in</strong> den neuen Bundesländern,<br />
wenn die Besitzverhältnisse nicht klar s<strong>in</strong>d.<br />
Hier glaube ich, sollte Bonn e<strong>in</strong>e bessere Führungsrolle<br />
übernehmen.<br />
Zusammenfassend darf ich feststellen, daß die Kommission<br />
für ihre Politik zur <strong>in</strong>tegrierten <strong>Entwicklung</strong> der<br />
ländlichen Räume über e<strong>in</strong> sehr flexibles Förder<strong>in</strong>strument<br />
verfügt, das dem Subsidiaritätspr<strong>in</strong>zip entsprechend, den<br />
Regionen e<strong>in</strong>en weiten Entscheidungsspielraum sicherstellt<br />
und überläßt, was ke<strong>in</strong>esfalls der Fall ist im Rahmen<br />
der sog. horizontalen Fördermaßnahmen. Die Subsidiarität<br />
darf nicht Halt machen bei den Regionen, sondern die<br />
Entscheidungsprozesse müssen so weit wie möglich an<br />
die Basis verlagert werden, damit alle Akteure spüren und<br />
auch davon überzeugt s<strong>in</strong>d, daß sie ihre eigene Zukunft<br />
selbst gestalten können; auch wenn das nicht immer so<br />
Realität ist. Das ist eben das Geschick e<strong>in</strong>er klugen Verwaltung,<br />
sich so e<strong>in</strong>zuschalten, daß jeder davon überzeugt<br />
ist, daß es se<strong>in</strong>e eigene Entscheidung und Idee ist.<br />
Viel Überzeugungskraft und politische Weitsicht ist<br />
erforderlich, um die derzeitige Kompetenzvielfalt zu reduzieren<br />
als Voraussetzung für e<strong>in</strong>fache und transparente<br />
Förderprogramme und Entscheidungsprozesse; das gilt<br />
sowohl für die Kommission, wie für die Mitgliedsstaaten<br />
und die Länder.<br />
Die Geme<strong>in</strong>schafts<strong>in</strong>itiative LEADER — hier haben wir<br />
so etwas wie e<strong>in</strong>en Fond zur <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen<br />
Räume — soll gezielt Innovationen fördern und soll e<strong>in</strong>e<br />
Denkfabrik verbunden mit praktischer Umsetzung für<br />
neue Konzepte zur <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume<br />
se<strong>in</strong> mit europaweitem know-how-Transfer <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er europäischen<br />
Vernetzung.<br />
<strong>Ländliche</strong> Räume können Gew<strong>in</strong>ner se<strong>in</strong> <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
modernen Wohlstandsgesellschaft, wenn wir ihre Neuplazierung<br />
durch e<strong>in</strong>e weitsichtige und kluge Förderpolitik<br />
unterstützen, die ke<strong>in</strong>esfalls von Partikular<strong>in</strong>teressen<br />
geprägt se<strong>in</strong> darf.<br />
Wenn wir erfolgreich s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> dieser Politik, dann kann<br />
sich der Spruch der beg<strong>in</strong>nenden Industrialisierung, daß<br />
nämlich <strong>Stadt</strong>luft frei macht, umkehren zur Feststellung,<br />
daß Landluft frei macht, <strong>in</strong>dem sie e<strong>in</strong>e Fülle von Entfatungsfreiräumen<br />
bietet <strong>in</strong> überschaubaren humanen<br />
Sozialstrukturen — e<strong>in</strong> Biotop, das dem menschlichen<br />
Wesen sehr gut angepaßt ist. Wir tragen dafür Verantwortung<br />
— e<strong>in</strong>e passionierende Aufgabe.<br />
Der Arbeitskreis hatte die<br />
meisten Teilnehmer<br />
84 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Karl-Friedrich Thöne<br />
Möglichkeiten und Grenzen der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
»Möglichkeiten und Grenzen der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong>«<br />
— »Ländlich« dabei mit e<strong>in</strong>em Großbuchstaben<br />
beg<strong>in</strong>nend —, so lautet das mir vorgegebene Vortragsthema.<br />
Ich habe dies als ganz bewußt e<strong>in</strong>grenzende Vorgabe<br />
für dessen Behandlung aufgefaßt. Es birgt ansonsten<br />
die Gefahr des sich Verlierens im Dickicht der vieldeutigen<br />
Begriffe »ländliche Räume — ländliche <strong>Entwicklung</strong>« <strong>in</strong><br />
sich. Folglich beschränke ich mich auf Aspekte ländlicher<br />
<strong>Entwicklung</strong>, von denen ich me<strong>in</strong>e, daß sie unsere Verwaltung<br />
mit ihrem Gestaltungs<strong>in</strong>strumentarium bee<strong>in</strong>flussen<br />
kann.<br />
Inhalt me<strong>in</strong>es Vortrags werden deshalb<br />
— neue Aufgabenfelder der Flurbere<strong>in</strong>igung,<br />
— der Weg von der Flurbere<strong>in</strong>igung zur Landentwicklung,<br />
— die Bestrebungen zur Novellierung des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes,<br />
— e<strong>in</strong> Exkurs zur agrarstrukturellen Vorplanung<br />
— und schließlich f<strong>in</strong>anzielle Perspektiven se<strong>in</strong>.<br />
Zum besseren Verständnis möchte ich vorerst am<br />
Begriff »Flurbere<strong>in</strong>igung« unter Verzicht auf neue<br />
Synonyme wie »Landentwicklung« oder »Flurneuordnung«<br />
oder »<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>« festhalten, weil er mit Blick<br />
auf den Gesetzestitel bundesweit noch den kle<strong>in</strong>sten<br />
geme<strong>in</strong>samen Nenner darstellt.<br />
1. E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong><br />
Verwaltung und Gesellschaft<br />
Lassen Sie mich als E<strong>in</strong>stieg zunächst den gesellschaftspolitischen<br />
Bezug der Flurbere<strong>in</strong>igung herstellen<br />
und damit die Standortfrage unserer Verwaltung beleuchten.<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung ist zu e<strong>in</strong>em wesentlichen Teil<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Tätigkeit e<strong>in</strong>er Verwaltungsbehörde. Dies gilt auch für das<br />
bayerische Genossenschaftspr<strong>in</strong>zip. Wir erheben den<br />
Anspruch, öffentlicher Dienstleistungsbetrieb zu se<strong>in</strong>. Dies<br />
ist als positive Abgrenzung geme<strong>in</strong>t. Zugleich s<strong>in</strong>d wir<br />
aber <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en Verwaltungsapparat e<strong>in</strong>gebunden. Und wir<br />
werden durch Gesetze, Richtl<strong>in</strong>ien, Organisationsstrukturen<br />
und vielfältige Abstimmungszwänge zu formalisiertem<br />
Handeln angehalten. Künftige Flurbere<strong>in</strong>igung und<br />
die sie betreibende Verwaltung können von dem gegenwärtigen<br />
gesellschaftspolitischen Wandel nicht unberührt<br />
bleiben. Flurbere<strong>in</strong>igung, nimmt sie ihren <strong>Entwicklung</strong>sauftrag<br />
für ländliche Räume ernst, hat viel mit dem<br />
vielbeschworenen »Wirtschaftsstandort Deutschland« zu<br />
tun. Hören wir uns also die Kritik aus der Wirtschaft an<br />
und lernen tunlichst daraus. Flurbere<strong>in</strong>iger s<strong>in</strong>d lernfähig<br />
und müssen es se<strong>in</strong>. Denn unsere Tätigkeit war gerade <strong>in</strong><br />
jüngerer Vergangenheit stets von Kritik begleitet.<br />
»Wir müssen entrümpeln«, befand der langjährige<br />
Vorstandsvorsitzende der deutschen Asea Brown Boveri<br />
AG, Eberhard von Koerber, vor kurzem <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Spiegel-<br />
Interview zur Strukturkrise der deutschen Wirtschaft. Er<br />
denkt dabei an e<strong>in</strong>e Reduzierung der Staatsquote, e<strong>in</strong>e<br />
stärkere Privatisierung im Bereich der öffentlichen Hand.<br />
Deutschland sei »potentiell unregierbar geworden, zu viele<br />
Ebenen, zu viele Kompetenzen«! Im verschärften Wettbewerb<br />
der Standorte seien »natürlich die Regionen im<br />
Nachteil, die überreguliert, überverwaltet und <strong>in</strong> ihren<br />
Entscheidungsabläufen zu kompliziert s<strong>in</strong>d« Beispiel:<br />
Ȇbersteigerte Individual<strong>in</strong>teressen durch den Rechtswegestaat,<br />
E<strong>in</strong>spruchsfristen, Genehmigungsverfahren, die<br />
Möglichkeit, daß e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>zelner Gesamt<strong>in</strong>teressen über<br />
E<strong>in</strong>sprüche auf Jahre blockieren kann«. Die lange Erfolgsperiode,<br />
so v. Koerber weiter, habe uns behäbig und satt<br />
gemacht. Das seien schlechte Voraussetzungen für Innovationen<br />
und Kreativität. Die Folgerungen daraus für se<strong>in</strong><br />
sehr erfolgreiches Unternehmen: »Wir haben Hierarchien<br />
reduziert, kle<strong>in</strong>ere E<strong>in</strong>heiten geschaffen und mehr Verantwortung<br />
<strong>in</strong> diese E<strong>in</strong>heiten verlagert. Das hat die<br />
Referent Thöne (Bildmitte),<br />
Referent Dr. Huber (l<strong>in</strong>ks),<br />
Arbeitskreisleiter Huber<br />
(rechts)<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
85
Motivation und die Identifikation erhöht so wie den<br />
Krankenstand reduziert. Das schafft Freiräume für<br />
Kreativität«.<br />
Delegation von oben nach unten wird nicht nur <strong>in</strong><br />
Ihrer Verwaltung gegenwärtig <strong>in</strong>tensiv diskutiert. Ich halte<br />
sie für e<strong>in</strong>en ganz wesentlichen Aspekt der Verwaltungsvere<strong>in</strong>fachung.<br />
Konzentration von Entscheidungen <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Hand ist e<strong>in</strong> weiterer Gesichtspunkt, auf den ich<br />
beim Thema Landentwicklung noch e<strong>in</strong>gehen werde.<br />
Die Schlußfolgerung <strong>in</strong> bezug auf die Delegation muß<br />
aber lauten: Es sollten alle Möglichkeiten des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes<br />
genutzt werden, direkt oder <strong>in</strong> Ausfüllung<br />
der Ermächtigung zu Ausführungsgesetzen,<br />
Kompetenzen auf die Ortsbehörde oder auch an die Teilnehmer<br />
zu verlagern und zu konzentrieren. Der Qualifikationsstand<br />
der Bediensteten <strong>in</strong> den Flurbere<strong>in</strong>igungsverwaltungen,<br />
wichtigste Voraussetzung für die Delegation<br />
von Kompetenz und Verantwortung, rechtfertigt es!<br />
Bürokratie-Kritik ist modern, mögen Sie entgegnen,<br />
<strong>in</strong>sbesondere <strong>in</strong> Zeiten leerer Kassen. Das Damoklesschwert<br />
des Stellenabbaus schwebt dann zumeist über<br />
Sonderbehörden. Die abgeschlossenen oder noch laufenden<br />
Organisationsuntersuchungen <strong>in</strong> den Flurbere<strong>in</strong>igungsverwaltungen<br />
der Bundesländer betreffen und treffen<br />
unseren Verwaltungszweig <strong>in</strong>sgesamt. Der Vollzug von<br />
E<strong>in</strong>sparungen geschieht zumeist über Wiederbesetzungssperren.<br />
Die Unkündbarkeit im öffentlichen Dienst sollte<br />
dabei ke<strong>in</strong> sanftes Ruhekissen se<strong>in</strong>.<br />
Abb. 1<br />
Das Agrarproblem besteht<br />
Behäbigkeit und Saturiertheit s<strong>in</strong>d schlechte Voraussetzungen<br />
für Innovationen und Kreativität — so<br />
v. Koerber <strong>in</strong> dem vorgenannten Spiegel-Gespräch. Bei der<br />
Lektüre kam mir unmittelbar der überaus große Personalbedarf<br />
, <strong>in</strong>sbesondere an Geodäten, <strong>in</strong> den jungen Flurbere<strong>in</strong>igungsverwaltungen<br />
der neuen Bundesländer <strong>in</strong> den<br />
S<strong>in</strong>n. Selbst hervorragend dotierte Stellenausschreibungen<br />
bleiben dort fast ohne Resonanz. Betrachtet man auf der<br />
anderen Seite den Stellenabbau und damit die mangelnden<br />
Perspektiven <strong>in</strong> den Flurbere<strong>in</strong>igungsverwaltungen<br />
der alten Länder, dann steckt e<strong>in</strong> Fehler im System, wenn<br />
derartige Möglichkeiten nicht genutzt werden. Der Vorwurf<br />
mangelnder Flexibilität ist nicht von der Hand zu<br />
weisen! Wir werden von Bundesseite geme<strong>in</strong>sam mit der<br />
Bund-Länder-Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
(ArgeFlurb) nach Lösungen suchen, um den notwendigen<br />
Personalfluß zusätzlich zu den Transfers im Rahmen der<br />
Verwaltungshilfe <strong>in</strong> Bewegung zu br<strong>in</strong>gen. Machen wir<br />
uns nichts vor! Die Aufgaben <strong>in</strong> den neuen Ländern s<strong>in</strong>d<br />
im Übermaß vorhanden. Werden sie nicht von unserem<br />
Berufsstand wahrgenommen, so stehen andere Diszipl<strong>in</strong>en<br />
bereit. E<strong>in</strong>e derartige <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> den neuen Ländern<br />
überholt uns über kurz oder lang auch <strong>in</strong> den Verwaltungen<br />
der alten Länder.<br />
Berufsständische Interessen — nicht nur der<br />
Geodäten, sondern qualifizierter Flurbere<strong>in</strong>iger <strong>in</strong>sgesamt<br />
— stehen auf dem Spiel!<br />
Dies gehört — so me<strong>in</strong>e ich — sehr wohl zum Thema<br />
»Möglichkeiten und Grenzen <strong>Ländliche</strong>r <strong>Entwicklung</strong>«. Die<br />
Möglichkeiten ländlicher <strong>Entwicklung</strong> auszuschöpfen,<br />
● für Laien <strong>in</strong> Form von Überschüssen, über deren steigende Größe und Kosten<br />
regelmäßig berichtet wird;<br />
● für Ökonomen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er unbefriedigenden Verteilung der Produktionsfaktoren;<br />
● für Bauern hauptsächlich <strong>in</strong> niedrigen und ungleichmäßigen E<strong>in</strong>kommen,<br />
trotz harter Arbeit, sorgfältiger Betriebsführung und oft großen<br />
Kapital<strong>in</strong>vestitionen;<br />
● für Parlamentarier <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Milliardenloch im Etat;<br />
● für Politiker <strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er Falle, die zunehmend e<strong>in</strong> vorzeitiges Ende ihrer<br />
politischen Karriere verspricht, dann nämlich, wenn sie gefangen s<strong>in</strong>d<br />
zwischen unzufriedenen Bauern und wütenden Steuerzahlern — mit wenig<br />
Hoffnung, e<strong>in</strong>en von beiden zufriedenzustellen, geschweige denn beide.<br />
(Hathaway, 1963)<br />
86 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Abb. 2<br />
bed<strong>in</strong>gt nämlich e<strong>in</strong>e hochmotivierte und effiziente<br />
Verwaltung, die sich nicht mit sich selbst im Park<strong>in</strong>son’schen<br />
S<strong>in</strong>n beschäftigt, sondern sich der Aufgabe und den<br />
Beteiligten verpflichtet fühlt.<br />
2. Agrarstruktur im Umbruch — Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
mit veränderten Aufgaben<br />
a) Flurbere<strong>in</strong>igung und ihr Bezug zur Landwirtschaft<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung ist und bleibt e<strong>in</strong> Instrument der<br />
Agrarstrukturpolitik. Das Aufgabenspektrum der Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
hat von Gesetzes wegen und politisch gewollt<br />
nach wie vor e<strong>in</strong>en landwirtschaftlichen Bezug. Die<br />
Landwirtschaft selbst bef<strong>in</strong>det sich <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em permanenten Strukturwandel mit<br />
krisenhaften Elementen!<br />
Zur E<strong>in</strong>stimmung e<strong>in</strong>e treffende und nach wie vor<br />
aktuelle Situationsbeschreibung von Hathaway aus dem<br />
Jahre 1963 zu den aus diesem Strukturwandel resultierenden<br />
Problemen (s. Abb. 1, S. 86).<br />
Betrachten wir e<strong>in</strong>ige Kennzahlen der landwirtschaftlichen<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> den letzten Jahrzehnten, setzen<br />
diese <strong>in</strong> Relation zur Flurbere<strong>in</strong>igungstätigkeit und ziehen<br />
daraus Schlüsse für e<strong>in</strong>e künftige Ausgestaltung unserer<br />
Aufgaben:<br />
Zunächst zur Produktivität <strong>in</strong> bezug auf §1 des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes<br />
— Verbesserung der Produktionsund<br />
Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> der Land- und Forstwirtschaft<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
(s. Abb. 2). Zur Produktivitätssteigerung hat<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung auftragsgemäß ihren Beitrag geleistet.<br />
Dies wird erkennbar, wenn man die Produktivitätssteigerung<br />
<strong>in</strong> Relation zur Flurbere<strong>in</strong>igungstätigkeit im<br />
alten Bundesgebiet setzt (s. Abb. 3, S. 88). Mag se<strong>in</strong>, daß<br />
wir überzogen haben. Wir bef<strong>in</strong>den uns aber <strong>in</strong> guter<br />
Gesellschaft. Nachher ist man immer schlauer!<br />
Apropos: Ohne die Flurbere<strong>in</strong>igung gäbe es heute die<br />
gesellschaftspolitisch so wichtige breite Eigentumsstreuung<br />
auf dem Lande nicht mehr. Sie wäre dem Rationalisierungszwang,<br />
dem »Wachse oder Weiche«! zum<br />
Opfer gefallen. Viele kle<strong>in</strong>ere Betriebe, die heute im<br />
Nebenerwerb geführt werden oder gut verpachtet s<strong>in</strong>d,<br />
hätten andernfalls aus ökonomischen Zwängen heraus<br />
verkaufen müssen. Daß dies verh<strong>in</strong>dert werden konnte,<br />
ist e<strong>in</strong> wesentliches Verdienst der Flurbere<strong>in</strong>igung. E<strong>in</strong><br />
Musterbeispiel dafür ist Bayern.<br />
Der Strukturwandel <strong>in</strong> der Landwirtschaft g<strong>in</strong>g und<br />
geht mit e<strong>in</strong>er erheblichen Abnahme der Anzahl der<br />
Betriebe und der <strong>in</strong> ihnen Beschäftigten e<strong>in</strong>her (s. Abb. 4<br />
S. 89). Dies führte <strong>in</strong> den westdeutschen Ländern — nach<br />
<strong>in</strong>zwischen schon veralteten Zahlen — zu e<strong>in</strong>er durchschnittlichen<br />
Betriebsgröße aller Betriebe von 17 ha.<br />
Damit liegt das alte Bundesgebiet im E G-Vergleich im<br />
Mittelfeld (s. Abb. 5 S. 89).<br />
Aus dieser Graphik (Abb. 5) wird aber bereits e<strong>in</strong><br />
Anpassungszwang nach oben erkennbar. Die durchschnittliche<br />
Betriebsgröße von Haupterwerbsbetrieben<br />
liegt <strong>in</strong> den alten Bundesländern gegenwärtig bei 30 ha<br />
LF. E<strong>in</strong> Indiz für die künftige <strong>Entwicklung</strong> ist die sog.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
87
Abb. 3<br />
88 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Abb. 4<br />
Abb. 5<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
89
Wachstumsschwelle. Das ist die Schwelle der Betriebsgröße,<br />
oberhalb derer die Zahl der Betriebe zunimmt und<br />
unterhalb derer sie zurückgeht. In der westdeutschen<br />
Landwirtschaft ist die Wachstumsschwelle nach neuesten<br />
Zahlen bereits bei 50 ha, im Vergleich zu 40 ha 1990,<br />
30 ha 1980 und 20 ha 1970. Die höchsten Werte verzeichnet<br />
Schleswig-Holste<strong>in</strong> mit 75 ha, Rhe<strong>in</strong>land-Pfalz<br />
liegt im Bundesdurchschnitt, Bayern und Baden-Württemberg<br />
liegen bei 40 ha. Diese Zahlen sprechen e<strong>in</strong>e<br />
deutliche Sprache und müssen sich zwangsläufig auf die<br />
Aufgabenstellung der Flurbere<strong>in</strong>igung auswirken.<br />
Maßnahmen zur Verbesserung der Agrarstruktur wie<br />
die Flurbere<strong>in</strong>igung waren <strong>in</strong> Deutschland bisher auf das<br />
agrarpolitische Leitbild des bäuerlichen Familienbetriebs<br />
ausgerichtet. (Kle<strong>in</strong>ster geme<strong>in</strong>samer Nenner se<strong>in</strong>er immer<br />
umstrittenen Def<strong>in</strong>ition: Im wesentlichen nach Intensität<br />
und Betriebsgröße von familieneigenen Arbeitskräften<br />
bewirtschaftet!)<br />
In den neuen Bundesländern ist aber schon heute<br />
offenkundig, daß aus dem Umstrukturierungsprozeß im<br />
wesentlichen nicht bäuerliche Familienbetriebe bisheriger<br />
westdeutscher Prägung hervorgeben. Betriebe im<br />
Haupterwerb werden dort m<strong>in</strong>destens 300 ha bewirtschaften<br />
und das mit entsprechenden Viehbeständen,<br />
weil nur ihnen e<strong>in</strong>e wirtschaftliche Existenz <strong>in</strong> der<br />
Europäischen Union zuerkannt wird. Gründe dafür s<strong>in</strong>d<br />
folgende:<br />
— Große Betriebe s<strong>in</strong>d aus dem Gesichtspunkt der<br />
Kostenm<strong>in</strong>imierung produktionstechnisch überlegen.<br />
Die Bewirtschaftung großer Flächen ist mit moderner<br />
Landtechnik wesentlich e<strong>in</strong>facher und damit nutzbr<strong>in</strong>gender<br />
zu bewerkstelligen.<br />
— In e<strong>in</strong>er Industriegesellschaft läßt sich ke<strong>in</strong> Zweig der<br />
Volkswirtschaft — und die Landwirtschaft ist Teil der<br />
Volkswirtschaft — auf Dauer von der Industrialisierung<br />
abkoppeln, wenn er <strong>in</strong>dustriell betrieben werden kann.<br />
Die Diskussion über Agrarsubventionen und GATT<br />
machen dies deutlich.<br />
Ich will hier mit dieser ökonomischen Betrachtungsweise<br />
nicht e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>dustrialisierten Landwirtschaft das<br />
Wort reden. Die Auswüchse des sozialistischen Agrarexperiments<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> jeder H<strong>in</strong>sicht selbstverständlich zu<br />
vermeiden. Das bedeutet heute vielmehr, ökonomisch<br />
optimierte Betriebsorganisationen mit agrarökologischen<br />
Belangen zu harmonisieren. Beides schließt e<strong>in</strong>ander nicht<br />
aus; entsprechend hat sich der Deutsche Rat für Landespflege<br />
geäußert.<br />
Nicht zuletzt ist aus der <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> den neuen<br />
Bundesländern aber abzuleiten, daß der bäuerliche Familienbetrieb<br />
im Haupterwerb als agrarpolitisches Leitbild<br />
aufgegeben wurde. Er wird se<strong>in</strong>en Platz lediglich <strong>in</strong> bestimmten<br />
Gebieten und Aufgabenfeldern behalten. Ich<br />
denke hier an Naturschutz, Erholung und Marktnischenproduktion.<br />
Dies ist ke<strong>in</strong>esfalls abwertend geme<strong>in</strong>t, sondern<br />
volkswirtschaftlich unbestritten notwendig.<br />
Ich b<strong>in</strong> mir sehr wohl der Gefahr bewußt, solches als<br />
Gast <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Bundesland zu äußern, das mit der Tradition<br />
des bäuerlichen Familienbetriebs sehr eng verbunden<br />
ist, scheue die Gefahr aber nicht, weil sie e<strong>in</strong>e<br />
notwendige Diskussion über <strong>Entwicklung</strong>sstrategien<br />
beflügeln kann.<br />
Insgesamt zeichnet sich als Ergebnis des Strukturwandels<br />
e<strong>in</strong>e Betriebsorganisation ab, deren Bandbreite<br />
— von großen Betriebse<strong>in</strong>heiten mit ausreichendem<br />
agrarischen E<strong>in</strong>kommen,<br />
— über verschiedene E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ationen,<br />
— bis h<strong>in</strong> zur Landbewirtschaftung unter Nutzungsauflagen<br />
beschrieben werden kann.<br />
Insofern s<strong>in</strong>d 300-ha-Betriebe, wie sie im Osten<br />
Deutschlands aus e<strong>in</strong>er voll kommen unterschiedlichen<br />
Ausgangsplage heraus entstanden s<strong>in</strong>d, sicherlich ke<strong>in</strong>e<br />
Perspektive für die agrarstrukturelle <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> den<br />
süddeutschen Bundesländern. Aber e<strong>in</strong> Indiz für den künftigen<br />
Weg e<strong>in</strong>er gesamtdeutschen Landwirtschaft s<strong>in</strong>d<br />
diese statistischen Daten allemal.<br />
Diese <strong>Entwicklung</strong> vollzieht sich zwar mit e<strong>in</strong>er hohen<br />
Eigendynamik, erfordert aber gerade deswegen ordnungspolitische<br />
Instrumente. Damit ist der Bezug zur Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
hergestellt. Die Flurbere<strong>in</strong>igung bietet sich deswegen<br />
an, weil sie schon jetzt über den engen landwirtschaftlichen<br />
Produktions- und Betriebsbezug h<strong>in</strong>aus angewendet<br />
werden kann. Flurbere<strong>in</strong>igung künftig also als<br />
e<strong>in</strong> Steuerungs<strong>in</strong>strument der Agrarstruktur!<br />
b) Agrarstrukturbegriff<br />
Der Begriff »Agrarstruktur« hat sich erheblich gewandelt.<br />
Er wird heute unmittelbar mit der Gesamtentwicklung<br />
ländlicher Räume verknüpft. Dazu hat die Diskussion<br />
um die Zukunft ländlicher Räume beiget ragen, die <strong>in</strong>folge<br />
des durch die deutsche E<strong>in</strong>heit ausgelösten Wandels neu<br />
belebt wurde. Wir stehen vollkommen neuen politischen,<br />
agrar- und wirtschaftsstrukturellen, ökologischen und<br />
demographischen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen gegenüber. Dies<br />
zw<strong>in</strong>gt zum vernetzten Denken!<br />
Visionen, wie ländliche Räume künftig auszusehen<br />
haben, gab es <strong>in</strong> der Vergangenheit zuhauf. Zumeist<br />
waren sie allerd<strong>in</strong>gs eher polarisierend. Jede Seite<br />
— Landwirtschaft, Ökologie, Fremdenverkehr, Infrastrukturträger<br />
— vertrat e<strong>in</strong>en »Alle<strong>in</strong>seligmachungsanspruch«.<br />
Es ist aber, zweifellos forciert durch die enormen Strukturpobleme<br />
im Osten Deutschlands, e<strong>in</strong> zunehmender<br />
Konsens darüber zu erkennen, daß die wesentlichen Funktionen<br />
ländlicher Räume <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em gesamtheitlich ausgerichteten<br />
<strong>Entwicklung</strong>sansatz berücksichtigt werden<br />
müssen. Dies bezieht sich mit Blick auf unseren Wirkungsbereich<br />
auf folgende Funktionen ländlicher Räume:<br />
90 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
— Erzeugung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen<br />
durch e<strong>in</strong>e möglichst flächendeckende Land- und<br />
Forstwirtschaft;<br />
— Standort für Infrastrukturanlagen und -e<strong>in</strong>richtungen<br />
sowie für Wohnen, Gewerbe, Industrie und Dienstleistungen;<br />
— ökologische Ausgleichs- und Regenerationsfunktionen<br />
für Boden, Wasser und Luft, Retentionsraum für Fauna<br />
und Flora;<br />
— Standort für naturbezogene Freizeit- und Erholungsaktivitäten.<br />
Das heißt aber auch für die Agrarstrukturförderung im<br />
<strong>in</strong>strumentellen und f<strong>in</strong>anziellen S<strong>in</strong>n, Abstand zu nehmen<br />
von e<strong>in</strong>er re<strong>in</strong> sektoralen Betrachtungsweise.<br />
Vielmehr müssen ländliche Räume als Ganzes gesehen<br />
werden.<br />
Demzufolge ist die Land- und Forstwirtschaft so zu<br />
entwickeln, daß zudem<br />
— die Pflege und Bewirtschaftung der Kulturlandschaft<br />
gesichert ist,<br />
— die Landwirtschaft als Flächenreservoir für Infrastruktur-<br />
und Siedlungsvorhaben sowie für ökologische<br />
Ausgleichsmaßnahmen dienen kann und<br />
— die ländlichen Räume als Quelle kultureller und ethischer<br />
Werte erhalten werden.<br />
Ausgehend von dieser Sichtsweise muß sich auch die<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung wandeln. Will Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> diesem<br />
Kontext als Instrument zur ganzheitlichen <strong>Entwicklung</strong><br />
ländlicher Räume verstanden werden, so bedeutet dies für<br />
ihren Ordnungsauftrag heute und künftig:<br />
1. direkte Beseitigung agrarstrukturrelevanter Mißstände<br />
und Mängel — das ist die landwirtschaftlich-betriebliche<br />
Komponente;<br />
2. Umsetzung räumlicher Ziele und Programme mit<br />
agrarischem Bezug — das ist Agrarstrukturförderung<br />
im erweiterten S<strong>in</strong>n;<br />
3. Verwirklichung außerlandwirtschaftlicher Projekte.<br />
Damit s<strong>in</strong>d wir <strong>in</strong>sgesamt bei Ansätzen zur <strong>in</strong>tegralen<br />
Neugestaltung ländlicher Räume . Das heißt: Von e<strong>in</strong>er<br />
auf Anpassung an Vorgaben ausgerichteten, mehr passiven<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung zur aktiven Landentwicklung!<br />
Diese Gedanken s<strong>in</strong>d nicht neu. Der Prozeß vollzieht<br />
sich <strong>in</strong> den Flurbere<strong>in</strong>igungsverwaltungen bereits. Nomen<br />
est omen: Das Referat »Flurbere<strong>in</strong>igung und Dorferneuerung«<br />
im Bundeslandwirtschaftsm<strong>in</strong>isterium heißt seit<br />
neuestem »Landentwicklung«. Aus bayerischen Flurbere<strong>in</strong>igungsdirektionen<br />
s<strong>in</strong>d die Direktionen für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> geworden. In Baden-Württemberg wird die<br />
Verwaltung nunmehr mit »Flurneuordnung und Landentwicklung«.<br />
bezeichnet. Dies ließe sich für andere Bundesländer<br />
fortsetzen.Dennoch: Worte s<strong>in</strong>d so lange Hülsen<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
und Namensänderungen solange Etikettenschw<strong>in</strong>del, wie<br />
sie nicht durch konkretes Handeln h<strong>in</strong>terlegt s<strong>in</strong>d.<br />
Gleichwohl, es ist an der Zeit, den Begriff »Flurbere<strong>in</strong>igung«<br />
zu ersetzen. Denn es ist uns offenbar nicht gelungen,<br />
diese aus der Vergangenheit her mit vielen Vorurteilen<br />
behaftete Bezeichnung durch unser Wirken wieder<br />
mit e<strong>in</strong>em positiven Inhalt zu erfüllen. Das ist mir mehr<br />
als klar geworden, als man neulich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Fernsehreportage<br />
über Vertreibungen <strong>in</strong> Bosnien diese als ethnische<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung (!) bezeichnete.<br />
3. Künftige Schwerpunkte der<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
Aus dem Wandel der Landwirtschaft und damit des<br />
Agrarstrukturbegriffs ergibt sich als Maxime e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegrierten<br />
Landentwicklung:<br />
a) Landentwicklung für Land- und Forstwirtschaft<br />
Landentwicklung wird nach wie vor als wesentliche<br />
agrar strukturelle Komponente die Verbesserung der<br />
Produktions- und Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen <strong>in</strong> der Land- und<br />
Forstwirtschaft umfassen. Dies all erd<strong>in</strong>gs vor dem<br />
H<strong>in</strong>tergrund neuer agrarpolitischer Leitbilder, wie sie im<br />
wesentlichen durch die Reform der geme<strong>in</strong>samen EG-<br />
Agrarpolitik und die GATT-Beschlüsse bee<strong>in</strong>flußt s<strong>in</strong>d.<br />
E<strong>in</strong> verstärkter Ordnungsbedarf wird sich deswegen<br />
konkret im Zusammenhang mit dauerhaften Exten-sivierungsmaßnahmen<br />
aus EG-Programmen ergeben.<br />
Derartige Programme müssen über entsprechende<br />
Ordnungs- und <strong>Entwicklung</strong>s<strong>in</strong>strumente auch <strong>in</strong> der<br />
Fläche umgesetzt werden. Zu diesen sogenannten »flankierenden<br />
Maßnahmen« gehören auf der Grundlage von<br />
EG-Verordnungen Beihilferegelungen für:<br />
— umweltgerechte und den natürlichen Lebensraum<br />
schützende landwirtschaftliche Produktionsverfahren,<br />
— den Vorruhestand und<br />
— Aufforstungsmaßnahmen.<br />
Gerade die bodenordnerische Begleitung von Aufforstungen<br />
wird dabei zu e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>teressanten Aufgabenfeld<br />
der Flurbere<strong>in</strong>igung werden, weil die zur Aufforstung<br />
beantragten Flächen h<strong>in</strong>sichtlich ihrer Lage, Form und<br />
Größe oder von ihren standortlichen Gegebenheiten her<br />
kaum zur Aufforstung geeignet s<strong>in</strong>d. Ich zitiere dazu aus<br />
der Antwort der Bundesregierung auf e<strong>in</strong>e Große Anfrage<br />
zur Lage und <strong>Entwicklung</strong> des Waldes und der Forstwirtschaft<br />
<strong>in</strong> der Bundesrepublik Deutschland. Dort heißt es:<br />
»E<strong>in</strong>e koord<strong>in</strong>ierte Planung, die zur Begründung von<br />
Waldbeständen auf günstigen Standorten mit bewirtschaftbaren<br />
Größen führt, ist aus Sicht der Bundesregierung<br />
wünschenswert. So können Bodenordnungsverfahren<br />
nach Abstimmung mit allen Interessenträgern<br />
im Planungsraum geeignete Flächen für Aufforstungen<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
91
ausweisen und im Zuge des Flächentauschs bewirtschaftbare<br />
Aufforstungsflächen schaffen. Die Verfahren nach<br />
dem Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz — <strong>in</strong>sbesondere der freiwillige<br />
Landtausch oder die beschleunigte Zusammenlegung —<br />
bieten, da sie erfahrungsgemäß Lösungen schnell und<br />
e<strong>in</strong>vernehmlich herbeiführen, dafür gute Möglichkeiten.<br />
Sie s<strong>in</strong>d nach Auffassung der Bundesregierung im besonderen<br />
Maße geeignet, die Interessen der Grundeigentümer<br />
an der Aufforstung mit den Belangen von Landund<br />
Forstwirtschaft, Naturschutz, Erholung und<br />
Wasserschutz auszugleichen«.<br />
Sie sehen: Umsetzung der Aufforstung als Verbundlösung<br />
gegebenenfalls auch mit F<strong>in</strong>anzierungskooperationen.<br />
Das ist zielorientierte Landentwicklung par<br />
excellence!<br />
Betrachten wir e<strong>in</strong>en weiteren Aufgabenschwerpunkt:<br />
b) Landentwicklung für Naturschutz und Erholung<br />
Umwelt- und Ressourcenschutz und die Bewahrung<br />
kulturhistorisch bedeutsamer Landschaften s<strong>in</strong>d generell<br />
e<strong>in</strong> <strong>Entwicklung</strong>sschwerpunkt <strong>in</strong> den ländlichen Regionen<br />
geworden. Dies gilt im übrigen für alle Länder mit landwirtschaftlichen<br />
Überschußproblemen und ökologischer<br />
Orientierung der Gesellschaft. Gerade <strong>in</strong> den vergangenen<br />
Jahren mit guter Konjunkturlage und komfortablen<br />
Wachstumsraten <strong>in</strong> der alten Bundesrepublik bestand<br />
breiter gesellschaftspolitischer Konsens bei der Durchsetzung<br />
von Umweltbelangen. Umweltziele wurden mit<br />
hohem f<strong>in</strong>anziellen Aufwand auch und gerade bei ländlichen<br />
<strong>Entwicklung</strong>svorhaben zu e<strong>in</strong>em bestimmenden<br />
Faktor. Man hat sie beispielsweise <strong>in</strong> der Erfolgsbilanz von<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsverfahren nahezu euphorisch hervorgehoben.<br />
Ich kenne kaum e<strong>in</strong> Faltblatt der Länderflurbere<strong>in</strong>igungsverwaltungen,<br />
<strong>in</strong> dem die ökologische<br />
Komponente nicht dom<strong>in</strong>ant ist.<br />
In Zeiten wirtschaftlicher Rezession wird es jedoch darauf<br />
ankommen, die ökologischen Aspekte verstärkt mit<br />
e<strong>in</strong>er ökonomischen Komponente zu verknüpfen. Dabei ist<br />
durchaus erkannt worden, daß die Umweltqualität schon<br />
heute e<strong>in</strong> wesentliches Kriterium für die Auswahl von<br />
Wohn- und Gewerbestandorten darstellt. E<strong>in</strong> Musterbeispiel<br />
für die Harmonisierung von ökonomischen und<br />
ökologischen Belangen stellt für mich aber der Tr<strong>in</strong>kwasserschutz<br />
dar. Ich sehe dar<strong>in</strong> auch e<strong>in</strong>e der Zukunftsaufgaben<br />
der Flurbere<strong>in</strong>igung. In den agrarisch geprägten<br />
Gebieten geht es dabei <strong>in</strong>sbesondere um die Anlage von<br />
Gewässerrandstreifen und um e<strong>in</strong>e Nutzungsextensivierung<br />
<strong>in</strong> Wasserschutzgebieten. Ich möchte Ihnen dazu<br />
das jüngst erschienene Sonderheft »Landentwicklung<br />
— Schutz der Lebensgrundlage Wasser« ans Herz legen,<br />
das von e<strong>in</strong>er ArgeFlurb-Projektgruppe erarbeitet wurde.<br />
Angesichts der mühsam erworbenen Akzeptanz der<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung im ökologischen Bereich will ich <strong>in</strong> bezug<br />
auf me<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>leitenden kritischen Bemerkungen ke<strong>in</strong>esfalls<br />
so verstanden werden, daß Umweltbelange <strong>in</strong> den<br />
Verfahren künftig zu vernachlässigen s<strong>in</strong>d. Im Gegenteil!<br />
Ich möchte lediglich warnen vor e<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>seitigen ökologischen<br />
Ausrichtung , die die Flurbere<strong>in</strong>igung auch<br />
gegenüber ihrer Klientel, nämlich den Grundeigentümern,<br />
nur <strong>in</strong>s Abseits führen kann.<br />
c) Regionalentwicklung<br />
Der dritte Schwerpunkt künftiger Flurbere<strong>in</strong>igungsaktivitäten<br />
wird me<strong>in</strong>es Erachtens <strong>in</strong> der Regionalentwicklung<br />
liegen.<br />
E<strong>in</strong>e Optimierung der Flächennutzung ist immer dann<br />
erforderlich, wenn aus der landwirtschaftlichen Produktion<br />
genommene Flächen auf Dauer e<strong>in</strong>er neuen Nutzung<br />
zugeführt werden sollen. Dies gilt für kle<strong>in</strong>e wie für große<br />
Infrastrukturvorhaben, von e<strong>in</strong>em Baugebiet bis h<strong>in</strong> zur<br />
Autobahn!<br />
Es kann gar nicht oft genug betont werden, daß sich<br />
der Neuordnungsbedarf dabei nicht nur aus volkswirtschaftlichen<br />
Gründen ergibt. Das wäre pure Fremdnützigkeit,<br />
oder krasser formuliert: Sozialisierung des Eigentums!<br />
E<strong>in</strong>e Neuordnung ist vielmehr zum Schutz der Eigentümerrechte,<br />
<strong>in</strong>sbesondere des dem Eigentum <strong>in</strong>newohnenden<br />
Nutzungsrechts, erforderlich. Nämlich immer<br />
dann, wenn Nutzungsrechte der Eigentümer von Grundstücken<br />
mit Agrar-, Umwelt- und Raumordnungsbelangen<br />
<strong>in</strong> Konflikt geraten. Flurbere<strong>in</strong>igung/Landentwicklung wird<br />
damit zu e<strong>in</strong>em wichtigen Instrument der Konfliktlösung<br />
auf dem Lande.<br />
Als Beispiel für die Regionalentwicklungskomponente<br />
<strong>in</strong> großen Dimensionen mag der Bau von Fernverkehrswegen,<br />
d. h. Autobahnen, Eisenbahntrassen, dienen. Die<br />
Standortwahl von Unternehmen wird heute im wesentlichen<br />
von den <strong>in</strong>frastrukturellen Voraussetzungen, <strong>in</strong>sbesondere<br />
der Anb<strong>in</strong>dung an die Fernverkehrswege,<br />
bestimmt. Daraus resultiert e<strong>in</strong> wachsender Druck der<br />
Wirtschaft auf weiteren Infrastrukturausbau. Dies ist <strong>in</strong><br />
Deutschland gegenwärtig beispielsweise bei den <strong>in</strong> Jahrzehnten<br />
vernachlässigten Ost-West-Verb<strong>in</strong>dungen der<br />
Fall.<br />
Me<strong>in</strong>er Ansicht nach besteht geradezu e<strong>in</strong> »Muß«, derartige<br />
Maßnahmen bodenordnerisch zu begleiten, aus<br />
eigentumsrechtlichen wie aus volkswirtschaftlichen<br />
Gründen. <strong>Ländliche</strong> Räume dürfen es sich künftig gar<br />
nicht gefallen lassen, von Infrastrukturmaßnahmen<br />
— trotz ihrer oft hohen arbeitsmarktpolitischen Wirkung —<br />
ohne Neuordnung überrollt zu werden. Das bedeutet aber<br />
nicht, daß Flurbere<strong>in</strong>igung dann für den Träger der Infrastrukturmaßnahme<br />
nur e<strong>in</strong> notwendigerweise <strong>in</strong> Kauf<br />
genommenes Übel darstellen muß. Im Gegenteil: Wir<br />
müssen unsere Dienstleistungen viel aktiver <strong>in</strong> diesem<br />
Bereich anbieten. Es gilt, die Flurbere<strong>in</strong>igung an die<br />
Diskussion um die Zukunft des Wirtschaftsstandorts<br />
Deutschland anzuhängen.<br />
92 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Soweit aus me<strong>in</strong>er Sicht zu künftigen Aufgabenfeldern,<br />
die ich natürlich nur beispielhaft und ke<strong>in</strong>esfalls umfassend<br />
skizzieren konnte.<br />
Für alle Aufgabenfelder gilt aber — um dieses nochmals<br />
zu unterstreichen: Den obersten rechtlichen Grundsatz<br />
stellt dabei immer die Wahrung des Grundrechts auf<br />
Privateigentum an Grund und Boden dar!<br />
4. Instrumente der Landentwicklung<br />
Zur Umsetzung e<strong>in</strong>er <strong>in</strong>tegralen Landentwicklung<br />
bedarf es geeigneter Planungs-, Ordnungs-, Koord<strong>in</strong>ierungs-<br />
und Gestaltungs<strong>in</strong>strumente. Unser Augenmerk<br />
gilt naturgemäß den Instrumenten mit e<strong>in</strong>em agrarstrukturellen<br />
<strong>Entwicklung</strong>sansatz. Dies s<strong>in</strong>d die agrarstrukturelle<br />
Vorplanung, die Verfahren nach dem Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz<br />
und schließlich die Dorferneuerung. Letztere ist<br />
Schwerpunktthema e<strong>in</strong>es anderen Arbeitskreises und soll<br />
deshalb hier außer acht bleiben.<br />
a) Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
Ist unser gesetzliches Instrumentarium, das Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz,<br />
eigentlich noch <strong>in</strong> der Lage, diesen veränderten<br />
Aufgabenstellungen Rechnung zu tragen? Sie<br />
alle kennen die Vorwürfe an die Flurbere<strong>in</strong>igung — zu<br />
kompliziert, zu teuer, zu lange Dauer der Verfahren. In der<br />
Diskussion, auch um das Flurbere<strong>in</strong>igungsrecht und dessen<br />
verwaltungsmäßige Umsetzung, ist häufig e<strong>in</strong>e merkwürdige<br />
Ambivalenz erkennbar. Zum e<strong>in</strong>en werden pauschal<br />
bürokratische Verhaltensweisen der Verwaltung oder<br />
unüberschaubare Paragraphendickichte beklagt. Auf der<br />
anderen Seite wird im Zusammenhang mit e<strong>in</strong>em konkreten<br />
Sachverhalt oft schnell der Ruf nach e<strong>in</strong>em Ausbau<br />
der Verwaltung oder weiteren rechtlichen Regelungen<br />
erhoben. Der Grund liegt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Diskussion auf zwei<br />
Ebenen: In der pauschalen Kritik spiegelt sich e<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong>es<br />
Unbehagen an der Gesamtheit staatlicher Tätigkeit<br />
wider, die <strong>in</strong> ihrer Komplexität von dem E<strong>in</strong>zelnen oft<br />
nicht mehr durchschaut wird. Wird die Diskussion dagegen<br />
konkret, werden rechtliche Regelungen und die sie<br />
ausführende Verwaltung zumeist akzeptiert. Kritik und<br />
eventuelle Änderungsvorschläge beziehen sich auf<br />
tatsächliche oder verme<strong>in</strong>tliche Mißstände.<br />
Es stimmt wohl: Flurbere<strong>in</strong>igung ist rechtlich wie technisch<br />
höchst anspruchsvoll. Daß das so ist, zeigen beispielhaft<br />
die Besonderheiten des Rechtswegs mit Spruchstellen<br />
und speziellen Flurbere<strong>in</strong>igungssenaten. Aber: Wir<br />
gehen mit dem Grundeigentum anderer Leute um. Und<br />
das tunlichst pfleglich. Das Boxberg-Urteil hat uns sehr<br />
wohl die Leviten gelesen. Was Artikel 14 des Grundgesetzes<br />
bedeutet, ist mir nie so bewußt geworden wie<br />
angesichts der vorgefundenen Verhältnisse <strong>in</strong> der ehemaligen<br />
DDR! Aus Gründen der Privatnützigkeit des<br />
Eigentums als Voraussetzung freier und selbstverantwort-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
licher Lebensgestaltung betreiben wir Wertermittlung und<br />
Vermessung mit e<strong>in</strong>em derartig hohen Aufwand. Nicht<br />
um ihrer selbst willen, sondern von Verfassungs wegen.<br />
Betrachten wir dazu die <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> den neuen<br />
Bundesländern: Investitionshemmnisse und soziale<br />
Konflikte werden beklagt, eben weil die Anpassung des<br />
Eigentums an veränderte Verhältnisse nicht <strong>in</strong> der gebotenen<br />
Eile vollzogen werden kann. Hierzu e<strong>in</strong> ebenso<br />
plastisches wie drastisches Beispiel aus Mecklenburg-<br />
Vorpommern (s. Abb. 6 S. 94). Der Kartenausschnitt zeigt<br />
kle<strong>in</strong>strukturierte Eigentumsverhältnissse. Aufgrund des<br />
kollektiven Bodennutzungsrechts der landwirtschaftlichen<br />
Produktionsgenossenschaft (LPG) erfolgte e<strong>in</strong>e komplexe<br />
Bebauung der privaten Grundstücke ohne Klärung der<br />
Bodeneigentumsverhältnisse. Bodeneigentum und<br />
Gebäudeeigentum s<strong>in</strong>d rechtlich vone<strong>in</strong>ander getrennt<br />
und müssen heute <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er schwierigen Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />
wieder zusammengeführt werden. H<strong>in</strong>zu kommt,<br />
das Teile des Gebäudekomplexes von der Bausubstanz her<br />
abgeschrieben s<strong>in</strong>d. Außerdem benötigt der Nachfolgebetrieb<br />
der LPG aufgrund der betrieblichen Umstrukturierung<br />
nur noch e<strong>in</strong>ige Gebäude; andere Baulichkeiten werden<br />
bereits von Gewerbebetrieben genutzt. Viele von<br />
Ihnen werden ähnliches im Rahmen der Verwaltungshilfe<br />
<strong>in</strong> Sachsen kennengelernt haben. Das Beispiel ist e<strong>in</strong><br />
Plädoyer für Bodenordnung. Diese kostet ohne Zweifel<br />
viel Geld. Es ist aber e<strong>in</strong>e Investition <strong>in</strong> unsere Eigentumsordnung<br />
und damit <strong>in</strong> unsere Gesellschaftsordnung <strong>in</strong>sgesamt.<br />
Soweit zum pauschalen Vorwurf »zu teuer«.<br />
»Flurbere<strong>in</strong>igung dauert zu lange!«. Gerade diese Klage<br />
wird häufig vom Verursacher selbst erhoben. So s<strong>in</strong>d es<br />
oftmals Geme<strong>in</strong>den, die immer mehr Maßnahmen <strong>in</strong> die<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>gepackt haben möchten, weil sie<br />
nach anfänglcher Skepsis dem Charme des Instrumentariums<br />
erlegen s<strong>in</strong>d. Vielleicht müssen wir künftig mehr<br />
Mut zur Beschränkung haben. Die Kunst liegt im Weglassen.<br />
Ne<strong>in</strong>sagen, d. h., kle<strong>in</strong>ere Verfahrensgebiete zu<br />
wählen und den Ordnungsauftrag auf weniger Ziele zu<br />
beschränken, ist e<strong>in</strong> Gebot der Verfahrensbeschleunigung.<br />
b) Bestrebungen zur Novellierung des<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes<br />
Gleichwohl haben derartige Vorwürfe schon ihre<br />
Berechtigung. Ihnen soll mit den gegenwärtigen Bestrebungen<br />
zur Novellierung des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes<br />
begegnet werden. Dies wird aus folgenden Erwägungen<br />
heraus deutlich:<br />
Die Aufgaben <strong>in</strong> Verfahren nach dem Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz<br />
haben sich mit den agrar- und umweltpolitischen<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen erheblich verändert. Im Mittelpunkt<br />
des Interesses der land- und forstwirtschaftlichen<br />
Betriebe und der übrigen Beteiligten stehen neben der<br />
Verbesserung der Produktions- und Arbeitsbed<strong>in</strong>gungen<br />
<strong>in</strong> der Land- und Forstwirtschaft zunehmend die Auflösung<br />
von Landnutzungskonflikten, d. h. die Befreiung<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
93
Abb. 6: Kollektive Bodennutzungsrechte überlagern private Eigentumsrechte —<br />
Komplexe Bebauung ohne Klärung der Bodeneigentumsverhältnisse<br />
94 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
von entwicklungshemmenden Auflagen, und schließlich<br />
die Gestaltung des ländlichen Umfelds durch die Bodenordnung.<br />
E<strong>in</strong>e abnehmende Bedeutung der Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
als direkte Hilfe für die Land- und Forstwirtschaft<br />
wird durch zunehmende Anforderungen an den Vollzug<br />
kommunaler Raumordnungs- und <strong>Entwicklung</strong>svorhaben<br />
mehr als aufgewogen. Wir stellen e<strong>in</strong> wachsendes<br />
Interesse der Geme<strong>in</strong>den, Verbände, Pächter und anderer<br />
Rechts<strong>in</strong>haber, also der Nebenbeteiligten <strong>in</strong> der Term<strong>in</strong>ologie<br />
des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes, fest. E<strong>in</strong>e scharfe<br />
Trennung von privatnützigen und fremdnützigen Maßnahmen<br />
<strong>in</strong> Verfahren nach dem Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz<br />
ist heute schon von daher nicht mehr ohne weiteres<br />
möglich.<br />
Dieser Wandel <strong>in</strong> der Aufgabenstruktur der Bodenordnung<br />
hat die durchschnittliche Dauer der Verfahren <strong>in</strong><br />
den letzten Jahren ansteigen lassen. Das Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz<br />
sieht zwar viele Beschleunigungsmöglichkeiten<br />
bereits vor. Damit konnte aber ke<strong>in</strong>e Kompensation<br />
erreicht werden. Ähnlich verhält es sich bei der<br />
verfahrenstechnischen Beschleunigung. Vieles konnte<br />
und kann durch die Nutzung moderner elektronischer<br />
Informations- und Kommunikationsmittel aufgefangen<br />
werden.<br />
Die Flurbere<strong>in</strong>igungsbehörden bedienen sich derer traditionell<br />
auf e<strong>in</strong>em sehr hohen Niveau. Straffes Projektmanagement,<br />
GPS-Nutzung, moderne Datenverarbeitung,<br />
weniger Abmarkungen — um nur e<strong>in</strong>ige Beispiele zu<br />
nennen — s<strong>in</strong>d vernünftige verfahrenstechnische Ansätze.<br />
Sie alle<strong>in</strong> lösen das Problem aber nicht. Es reicht offensichtlich<br />
nicht aus, dem Aufgabenzuwachs nur alle<br />
bestehenden gesetzlichen Möglichkeiten zur Vere<strong>in</strong>fachung<br />
und Beschleunigung der Verfahren entgegenzusetzen.<br />
Die Bund-Länder-Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
hat deshalb auch auf Initiative Bayerns h<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
Arbeitsgruppe beauftragt, die Notwendigkeit e<strong>in</strong>er<br />
Änderung des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes zu prüfen und<br />
ggf. Vorschläge dazu auszuarbeiten. Ich möchte die<br />
Gründe, die für e<strong>in</strong>e Novellierung sprechen, kurz<br />
skizzieren:<br />
1. Es ist dies eben jene Notwendigkeit der Beschleunigung<br />
und des Ausschöpfens aller Möglichkeiten<br />
— zur Vere<strong>in</strong>fachung der Verfahrensvorschriften,<br />
— zur Abkürzung der Ausführungszeit,<br />
— zur Senkung der Kosten und des<br />
Verwaltungsaufwands.<br />
In die gleiche Richtung zielt beispielsweise das jüngst<br />
<strong>in</strong> Kraft getretene Planungsvere<strong>in</strong>fachungsgesetz für<br />
Verkehrsvorhaben <strong>in</strong> den alten Bundesländern, womit<br />
— ausgelöst durch die Beschleunigungsgesetze für die<br />
neuen Länder — e<strong>in</strong>e Straffung der Planungszeiten erzielt<br />
werden soll. Der <strong>in</strong>vestitionsfördernde Effekt spielt dabei<br />
e<strong>in</strong>e große Rolle. Die Zeit ist <strong>in</strong>sofern auch für die<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung reif und günstig.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
2. Aktive Landentwicklung zu betreiben, ist nach bestehender<br />
Rechtslage ohne weiteres nicht möglich.<br />
§ 1 FlurbG läßt bisher nur e<strong>in</strong>e passive Förderung der<br />
Landentwicklung zu.<br />
3. E<strong>in</strong>e noch weitergehende Beteiligung der Bürger und<br />
der politischen Geme<strong>in</strong>den ist wohl vonnöten.<br />
4. Es ist ist e<strong>in</strong>e Anpassung an die seit 1976 veränderten<br />
Gesichtspunkte fällig. In der Diskussion s<strong>in</strong>d dazu<br />
beispielsweise<br />
— Wahlperioden für Vorstände der TG,<br />
— modifizierte Anforderungen an das<br />
Wertermittlungsverfahren,<br />
— Komb<strong>in</strong>ation der Bodenordnung nach dem<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz und dem Baugesetzbuch,<br />
— verstärkte Berücksichtigung von Pachtverhältnissen,<br />
weil die Pachtquote der Betriebe ständig steigt,<br />
— das Bestehenbleiben der TG nach Beendigung der<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung sowie<br />
— die Übernahme veränderter Rechtsgrundlagen<br />
(z.B. UVPG).<br />
Die Projektgruppe der ArgeFlurb hat sich dafür ausgesprochen,<br />
Vorschläge zu Änderungen zunächst auf die<br />
vere<strong>in</strong>fachte Flurbere<strong>in</strong>igung nach § 86 FlurbG zu konzentrieren.<br />
Die vere<strong>in</strong>fachte Flurbere<strong>in</strong>igung erschien von<br />
allen fünf Verfahrensarten des FlurbG am ehesten geeignet,<br />
Landentwicklung unter dem Vere<strong>in</strong>fachungs- und<br />
Beschleunigungsaspekt zu betreiben. Das Ergebnis der<br />
Projektgruppenarbeit mündet <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Antrag zur<br />
Gesetzesänderung der Länder Baden-Württemberg und<br />
Sachsen-Anhalt, der <strong>in</strong>zwischen <strong>in</strong> den Bundesrat e<strong>in</strong>gebracht<br />
worden ist. Gegenwärtig laufen die Ausschußberatungen.<br />
Es ist beabsichtigt, die Änderungen noch <strong>in</strong><br />
dieser Legislaturperiode zu verabschieden.<br />
Ich beschränke mich darauf, Ihnen die Kernbestimmungen<br />
zur Änderung des § 86 FlurbG vorzustellen: Es soll als<br />
e<strong>in</strong> »vere<strong>in</strong>fachtes Flurbere<strong>in</strong>igungsverfahren zur Landentwicklung«<br />
ausgestaltet werden. E<strong>in</strong> vere<strong>in</strong>fachtes Flurbere<strong>in</strong>igungsverfahren<br />
soll angeordnet werden können, um<br />
vornehmlich Maßnahmen der Landentwicklung, <strong>in</strong>sbesondere<br />
der Agrarstrukturverbesserung, der Siedlung, der<br />
Dorferneuerung und des Städtebaus, des Umweltschutzes,<br />
des Naturschutzes und der Landschaftspflege oder der<br />
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes, zu ermöglichen<br />
oder durchzuführen. E<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>leitung e<strong>in</strong>es solchen<br />
Verfahrens soll zudem möglich se<strong>in</strong>, um Landnutzungskonflikte<br />
aufzulösen. E<strong>in</strong> Verfahren soll nunmehr auch auf<br />
Antrag e<strong>in</strong>es Trägers von Maßnahmen e<strong>in</strong>geleitet werden<br />
können.<br />
Sie sehen: Als wesentlichen Unterschied gegenüber den<br />
bestehenden Regelungen soll Landentwicklung nun nicht<br />
nur <strong>in</strong>direkt gefördert, sondern direkt durchgeführt werden<br />
können. Die Flurbere<strong>in</strong>igungsbehörde bekäme mit<br />
anderen Worten das Mandat für Landentwicklung. Sie<br />
koord<strong>in</strong>iert, konzentriert und entscheidet! Mit anderen<br />
Worten: Von passiver Begleitung zu aktiver Gestaltung!<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
95
Deutlich wird aber auch das Spannungsfeld, <strong>in</strong> dem<br />
sich e<strong>in</strong>e solche Novellierung bef<strong>in</strong>det. Es muß gewährleistet<br />
se<strong>in</strong>, daß durch die Änderung der Vorschriften der<br />
Anspruch der Teilnehmer auf wertgleiche Abf<strong>in</strong>dung <strong>in</strong><br />
Land und das Interesse der Beteiligten als Voraussetzung<br />
für die Anordnung des Verfahrens nicht <strong>in</strong> Frage gestellt<br />
s<strong>in</strong>d. Das ist genau jene Diskussion um Privatnützigkeit<br />
und Fremdnützigkeit der Flurbere<strong>in</strong>igung.<br />
E<strong>in</strong>e derartige Änderung ist verfassungsrechtlich nur<br />
gerechtfertigt, wenn man die Interessen der an der<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung beteiligten Grundeigentümer mit den<br />
fremdnützigen Interessen Dritter so harmonisieren kann,<br />
daß die Grundeigentümer nicht auf der Strecke bleiben.<br />
Ich b<strong>in</strong> aber aufgrund folgender Überlegungen zuversichtlich,<br />
daß der Änderungsvorschläg vor der Verfassung<br />
bestehen kann:<br />
Die Herstellung e<strong>in</strong>er konfliktfreien Ordnung der Landnutzung<br />
muß doch wohl im objektiven, wohlverstandenen<br />
und vorrangigen Interesse der Grundeigentümer liegen.<br />
Und sei es im S<strong>in</strong>ne e<strong>in</strong>er Schutzmaßnahme zugunsten<br />
des Grundrechts auf e<strong>in</strong>e möglichst une<strong>in</strong>geschränkte<br />
Verfügungsgewalt über das Grundeigentum. Auf e<strong>in</strong>en<br />
e<strong>in</strong>fachen Nenner gebracht heißt dies aber nichts anderes<br />
als: Konfliktlösung liegt im Interesse der Grundeigentümer,<br />
weil sie von entwicklungshemmenden Lasten<br />
befreit, und damit orig<strong>in</strong>är privatnützig ist.<br />
c) agrarstrukturelle Vorplanung<br />
Wenn es um Instrumente zur <strong>in</strong>tegralen Landentwicklung<br />
geht, darf die agrarstrukturelle Vorplanung als<br />
e<strong>in</strong> Fördergrundsatz der Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe »Verbesserung<br />
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes« nicht<br />
unerwähnt bleiben. Sie ist <strong>in</strong> der letzten Zeit — vielleicht<br />
zu Recht — etwas <strong>in</strong>s H<strong>in</strong>tertreffen geraten, erlebt aber<br />
mittlerweile geradezu e<strong>in</strong>e Renaissance <strong>in</strong> den neuen<br />
Bundesländern.<br />
Das mangelnde Interesse <strong>in</strong> den alten Bundesländern<br />
liegt wohl dar<strong>in</strong> begründet, daß die agrarstrukturelle<br />
Vorplanung bisher weitgehend auf e<strong>in</strong>e passive Anpassung<br />
an externe <strong>Entwicklung</strong>svorhaben ausgerichtet war.<br />
Sie hatte damit vorwiegend reaktiven Charakter. Vielfach<br />
war sie e<strong>in</strong>zelbetrieblich — landwirtschaftlich ausgerichtet<br />
und damit schon nach kurzer Zeit von e<strong>in</strong>er schnellebigen<br />
<strong>Entwicklung</strong> überholt. Kurzum: Viel Geld für nichts!<br />
E<strong>in</strong>e solche außeragrarischen Vorgaben willfährige<br />
Anpassungsplanung kann aber heute kaum den Ansprüchen<br />
genügen. Man sollte deshalb aber nicht das Instrument<br />
an sich verwerfen, sondern sich Gedanken über e<strong>in</strong>e<br />
Neukonzeption machen. Ich fasse me<strong>in</strong>e Gedanken dazu<br />
kurz zusammen:<br />
— Leitbild künftiger agrarstruktureller Vorplanungen muß<br />
die Formulierung e<strong>in</strong>er aktiven Rolle der Land- und<br />
Forstwirtschaft <strong>in</strong>nerhalb von Landnutzungskonzeptionen<br />
se<strong>in</strong>.<br />
— Sie muß als dynamische <strong>Entwicklung</strong>splanung mit<br />
Alternativen und möglichst zeitnaher Realisierung<br />
ausgestaltet werden.<br />
— Sie muß e<strong>in</strong>en verstärkten regionalen Bezug bekommen.<br />
Damit kann den örtlichen <strong>Entwicklung</strong>spotentialen<br />
weitaus besser Rechnung getragen werden, als<br />
mit e<strong>in</strong>er schematisierten, zu großräumigen und damit<br />
schnell veralterten <strong>Entwicklung</strong>splanung.<br />
— Es geht darum, Aufgaben und Chancen der Landbewirtschaftung<br />
auch als Vorgaben zu übergeordneten<br />
Planungen mit e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen.<br />
— Das bed<strong>in</strong>gt klare Aussagen über Möglichkeiten der<br />
Koord<strong>in</strong>ierung und Bündelung aller — auch außeragrarischer<br />
— Fördermöglichkeiten.<br />
Fazit: Die agrarstrukturelle Vorplanung muß von<br />
der <strong>in</strong>haltlichen Qualität ihrer Aussagen so gut se<strong>in</strong>,<br />
daß sie als das agrarstrukturelle Planwerk anerkannt<br />
wird, ohne das über raumwirksame Wirtschafts-,<br />
Siedlungs-, Infrastruktur- und Umweltvorhaben nicht<br />
mehr entschieden werden kann.<br />
E<strong>in</strong> solches Planwerk kann Maßnahmen der <strong>in</strong>tegralen<br />
Landentwicklung den Weg bereiten. Gesamtheitliche<br />
Landentwicklung wird ohne vorausschauende Grundlagenplanung<br />
kaum realisierbar se<strong>in</strong>. E<strong>in</strong>e projektbezogene<br />
Vorplanung im Rahmen e<strong>in</strong>es Flurbere<strong>in</strong>igungsverfahrens<br />
hat e<strong>in</strong>e ganz andere Zielrichtung und kann sie nicht<br />
ersetzen, sondern soll sie konkretisieren. Ich messe ihr<br />
daher künftig e<strong>in</strong>en sehr hohen Stellenwert bei und<br />
möchte Sie auffordern, dieses Instrument der Landentwicklung<br />
künftig wieder <strong>in</strong> Ihre Überlegungen e<strong>in</strong>zubeziehen.Das<br />
Bundeslandwirtschaftsm<strong>in</strong>isterium hat e<strong>in</strong>en<br />
Forschungsauftrag zur konzeptionellen Neuausrichtung<br />
der agrarstrukturellen Vorplanung vergeben, dessen sehr<br />
bemerkenswerte, praxisbezogene Ergebnisse <strong>in</strong>zwischen<br />
vorliegen.<br />
5. F<strong>in</strong>anzierung der Landentwicklung<br />
Lassen Sie mich zum Schluß noch e<strong>in</strong>ige Worte zur<br />
F<strong>in</strong>anzierung der Flurbere<strong>in</strong>igung sagen. Damit b<strong>in</strong> ich mit<br />
Blick auf den mir gegebenen Vortragstitel »Möglichkeiten<br />
und Grenzen <strong>Ländliche</strong>r <strong>Entwicklung</strong>« bei e<strong>in</strong>er sehr<br />
realen Grenze angelangt: Dazu vorweg e<strong>in</strong>ige nüchterne<br />
und ernüchternde Zahlen:<br />
Der Rahmenplan der Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe »Verbesserung<br />
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes« für<br />
<strong>1994</strong> als wesentliche F<strong>in</strong>anzierungsgrundlage der Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
sieht gegenüber 1993 <strong>in</strong>sgesamt E<strong>in</strong>sparungen<br />
von über 90 Mio. DM für die alten Bundesländer vor. Im<br />
nächsten Jahr drohen für die alten Bundesländer weitere<br />
Kürzungen des Gesamtplafonds i. Höhe von 55 Mio. DM.<br />
Weiterh<strong>in</strong> s<strong>in</strong>d seit dem Rahmenplan <strong>1994</strong> die flankierenden<br />
Maßnahmen <strong>in</strong> die Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe ohne<br />
Erhöhung des Gesamtplafonds e<strong>in</strong>bezogen. Dies bedeutet<br />
<strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>schneidende Reduzierung der<br />
F<strong>in</strong>anzmittel auch und wohl gerade für «klassische«<br />
Fördergrundsätze wie die Flurbere<strong>in</strong>igung. Es bleibt<br />
96 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
abzuwarten, <strong>in</strong>wieweit die Länder Mittel von den überbetrieblichen<br />
Maßnahmen abziehen.<br />
F<strong>in</strong>anzierungsperspektiven müssen deshalb auch außerhalb<br />
der Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe gesucht werden — wo<br />
also? Zur Landentwicklungsdiskussion paßt die Tatsache,<br />
daß der F<strong>in</strong>anzierungsanteil sog. Dritter <strong>in</strong> den Flurbere<strong>in</strong>igungsverfahren<br />
seit langem kont<strong>in</strong>uierlich steigt . Er<br />
liegt ausweislich des letzten Agrarberichts mittlerweile bei<br />
über 20 % des Investitionsvolumens von <strong>in</strong>sgesamt<br />
815 Mio DM im Bundesgebiet. E<strong>in</strong>e wichtige Koord<strong>in</strong>ierungsaufgabe<br />
<strong>in</strong> künftigen Flurbere<strong>in</strong>igungsverfahren<br />
muß folglich dar<strong>in</strong> liegen, alternative F<strong>in</strong>anztöpfe anzuzapfen<br />
und Mittel zu bündeln. F<strong>in</strong>anzkooperationen der<br />
Interessenträger! In Verfahren zur Durchführung von<br />
Landentwicklungsmaßnahmen nach § 86 FlurbG <strong>in</strong> der<br />
Fassung der angestrebten Novellierung ist für Maßnahmen<br />
im Interesse Dritter e<strong>in</strong>e gesetzliche Regelung zur<br />
F<strong>in</strong>anzierung von solchen Ausführungskosten vorgesehen,<br />
die nicht im Interesse der Teilnehmer liegen. Aus dem<br />
Nachteilsausgleich nach geltender Rechtslage, der immer<br />
von e<strong>in</strong>er Belastung durch die Maßnahme ausgeht, wird<br />
e<strong>in</strong> direkter Beitrag des Maßnahmenträgers für die<br />
Realisierung se<strong>in</strong>es Vorhabens.<br />
E<strong>in</strong>e hoffnungsvolle Perspektive liegt für mich <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
künftig verstärkten Nutzung des EU-Förder<strong>in</strong>strumentariums<br />
auch zur F<strong>in</strong>anzierung der Flurbere<strong>in</strong>igung. Hier<br />
hat sich Deutschland <strong>in</strong> der Vergangenheit schwer getan.<br />
Der Aufbruch <strong>in</strong> den neuen Bundesländern mit Blick auf<br />
die dort aufgelegten Operationellen Programme, die zu<br />
50 % und mehr aus EU-Mitteln bestritten werden, hat den<br />
Weg gewiesen. Wir haben es uns von Bundesseite zur<br />
Aufgabe gemacht, nach verstärkten E<strong>in</strong>stiegsmöglichkeiten<br />
für Flurbere<strong>in</strong>igung und Dorferneuerung <strong>in</strong> die<br />
EU-Strukturfonds zu suchen.<br />
»Zeiten leerer Kassen s<strong>in</strong>d immer auch Zeiten größerer<br />
Kreativität.« Dies hielt e<strong>in</strong> Beteiligter an der Podiumsdiskussion<br />
vom Vortage dem E<strong>in</strong>wand begrenzter f<strong>in</strong>anzieller<br />
Ressourcen entgegen. In diesem S<strong>in</strong>ne gilt es, die Zukunft<br />
ländlicher Räume zu gestalten.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
97
Arbeitskreis 2:<br />
Sicherung und Ausbau regionaler Infrastruktur<br />
Robert Bromma<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Ich darf Sie alle recht herzlich zum 2. Tag der <strong>Fachtagung</strong><br />
der Bayerischen Verwaltung für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> zum Arbeitskreis 2, hier <strong>in</strong> der Residenz <strong>in</strong><br />
<strong>Ansbach</strong>, begrüßen. Ich hoffe, Sie haben den ersten Tag<br />
und Abend gut verdaut und s<strong>in</strong>d auch mit Ihrem Quartier<br />
zufrieden.<br />
Wir bef<strong>in</strong>den uns hier an historisch <strong>in</strong>teressanter Stelle,<br />
<strong>in</strong> der herrschaftlichen Bibliothek des markgräflichen<br />
Schlosses. Falls jemand bibliophile Neugier verspürt und<br />
h<strong>in</strong>ter den Vorhängen wertvolle Bücher vermutet, muß ich<br />
ihn leider enttäuschen. Er wird höchstens den Staub von<br />
2 1 / 2 Jahrhunderten vorf<strong>in</strong>den.<br />
1738 gegründet, wurde bereits 1806, als <strong>Ansbach</strong> zu<br />
Bayern kam, e<strong>in</strong> Großteil der Bücher weggebracht. In der<br />
damaligen Fundationsurkunde steht e<strong>in</strong> Satz, der auch für<br />
den heutigen Tag Bedeutung haben dürfte:<br />
Die Bibliothek sollte<br />
E<strong>in</strong>heimischen und Fremden,<br />
Lehrenden und Lernenden,<br />
nützlich se<strong>in</strong>.<br />
Ich hoffe, diesem Anspruch wird auch unsere<br />
Veranstaltung gerecht.<br />
Ziele<br />
Ich denke, wir s<strong>in</strong>d zusammengekommen, um im Rahmen<br />
der diesjährigen <strong>Fachtagung</strong> über den eigenen Wirkungskreis<br />
h<strong>in</strong>aus zu blicken, um <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre, aktuelle<br />
Aspekte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> zu diskutieren und zu<br />
beleuchten. Wir wollen uns mit der Zukunft der <strong>Ländliche</strong>n<br />
Räume ause<strong>in</strong>andersetzen, Probleme aufzeigen und<br />
Erfahrungen bei Ihrer Lösung vorstellen! Ziel des heutigen<br />
Tages ist es, Ihnen über Referate und anschließenden<br />
Diskussionen, Informationen über aktuelle Fragestellungen<br />
und <strong>in</strong>teressante Beispiele zu geben, Sie über Ansprüche<br />
und Aktivitäten unterschiedlicher gesellschaftlicher<br />
Gruppierungen <strong>in</strong> Kenntnis zu setzen, um — und das<br />
halte ich für das Wichtigste — über diese Informationen<br />
Anregungen und Hilfen zum eigenen Wirken und Handeln<br />
im Dienste von <strong>Stadt</strong> und Land zu erhalten.<br />
Schwerpunkte<br />
Die Themenstellung wurde von mir erweitert:<br />
»Ausbau und Sicherung regionaler Infrastruktur mit<br />
Hilfe von Geld, Arbeit und Menschen«.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Damit s<strong>in</strong>d auch schon die 3 Schwerpunkte genannt:<br />
das Geld, die Arbeit und der Mensch.<br />
— Zunächst wird Herr Emil Schneider, vom Bayerischen<br />
Geme<strong>in</strong>detag, zum Thema »Die Geme<strong>in</strong>den auf dem<br />
Weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzkrise« referieren,<br />
— anschließend Herr Bernhard Böckeler, Bgm. <strong>in</strong> Allersberg<br />
die strukturellen Probleme und Lösungswege am<br />
Rande des Ballungsraumes Nürnberg vorstellen.<br />
— Den Vormittag beschließen wird Herr Dr. Walter<br />
Lohmeier, von der IHK Würzburg—Schwe<strong>in</strong>furt, mit<br />
dem Vortrag »<strong>Ländliche</strong> Räume — <strong>in</strong>novative<br />
Wirtschaftsstandorte mit Zukunft«.<br />
— Am Nachmittag spricht Herr Pfr. Dr. Karl-He<strong>in</strong>z Röhl<strong>in</strong><br />
über »Die Lust aufs Land« und damit über die<br />
Erwartungen und Forderungen junger Menschen an<br />
den ländlichen Raum,<br />
— und Herr Gottfried Wieselhuber über e<strong>in</strong>e regionale<br />
Initiative von unten, über die Interessengeme<strong>in</strong>schaft<br />
Maria Bildhausen.<br />
Im Anschluß an jedes Referat besteht die Möglichkeit<br />
zur vertiefenden Diskussion.<br />
Ich nehme an, alle Teilnehmer s<strong>in</strong>d anwesend. Halt, da<br />
kommen ja noch zwei mit dem Zug. Hören wir zu, worüber<br />
Sie sich unterhalten.<br />
Sketch zur E<strong>in</strong>führung über die möglichen Erwartungen<br />
der Arbeitskreisteilnehmer<br />
E<strong>in</strong>führungsreferate <strong>in</strong> den Arbeitskreis 2<br />
99
E<strong>in</strong> herzliches Dankeschön, sicher auch <strong>in</strong> Ihrem<br />
Namen, an me<strong>in</strong>e beiden jungen Kollegen Johannes<br />
Krüger und Jürgen Eisentraut aus Würzburg für ihre<br />
E<strong>in</strong>stimmung <strong>in</strong> das Thema.<br />
Erwartungen zum Thema<br />
Auch für mich war es nicht e<strong>in</strong>fach, sich auf das Thema<br />
e<strong>in</strong>zulassen. Zumal ich bald merkte, daß die Erwartungen<br />
der Teilnehmer sehr unterschiedlich se<strong>in</strong> werden. Wir<br />
könnten heute über Großprojekte und Unternehmensverfahren,<br />
über kostengünstige Wegebaumaßnahmen <strong>in</strong><br />
Dorf und Flur, über Nachbarschaftsläden oder über den<br />
öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum<br />
diskutieren. Wir könnten über die Frage der Unterhaltung<br />
von geme<strong>in</strong>schaftlichen Anlagen <strong>in</strong> schwierigen Zeiten<br />
reden oder, wie es auch <strong>in</strong> dem Sketch angedeutet wurde,<br />
über Möglichkeiten wie man Geld für se<strong>in</strong>e Planungen<br />
und Maßnahmen locker machen kann. Würde ich damit<br />
Ihre Erwartungen treffen?<br />
Ich habe mich dadurch aus dem drohenden Dilemma<br />
gelöst, daß ich wegen dieser unterschiedlichen Erwartungen<br />
e<strong>in</strong>e Mischung an Vorträgen zusammengestellt habe,<br />
die für jeden etwas Neues, Interessantes und Bemerkenswertes<br />
enthalten sollen.<br />
E<strong>in</strong>e umfassende Behandlung des Problembereiches<br />
Infrastruktur ist an e<strong>in</strong>em Tag sowieso nicht möglich. Ich<br />
will mit Ihnen e<strong>in</strong>en Blick über den Zaun werfen, will<br />
heute e<strong>in</strong>en Teil unserer Partner zu Wort kommen lassen.<br />
Wer se<strong>in</strong>e Verbündeten und se<strong>in</strong>e Kunden kennt, kann sie<br />
richtig verstehen und ihnen effektiv Dienst leisten. Der<br />
Weg geht von der Kommunikation zur Kooperation.Nur<br />
dann kann es zur vielbeschworenen PPP »Private Public<br />
Partnership« kommen.<br />
Ausbau und Sicherung regionaler Infrastruktur ist ja<br />
zunächst e<strong>in</strong>e klassische Aufgabe nach dem Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz.<br />
Ich er<strong>in</strong>nere an § 37 FlurbG: »Wege, Straßen,<br />
Gewässer und andere geme<strong>in</strong>schaftliche Anlagen s<strong>in</strong>d zu<br />
schaffen, Maßnahmen der Dorferneuerung können durchgeführt<br />
werden. Die öffentlichen Interessen wie Raumordnung,<br />
Landesplanung, Naturschutz, Landschaftspflege,<br />
Erholung, Ver- und Entsorgung und Verkehr s<strong>in</strong>d zu wahren«.<br />
Mit diesen Begriffen ist die Infrastuktur recht gut<br />
beschrieben. Anderswo wird sie auch als Gesamtheit der<br />
materiellen, <strong>in</strong>stitutionellen und personellen Anlagen,<br />
E<strong>in</strong>richtungen und Gegebenheiten bezeichnet, kurz als<br />
öffentliches, volkswirtschaftliches Kapital.<br />
Hierzu zählt auch die öffentliche Verwaltung und damit<br />
auch die Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>. Wir selbst<br />
s<strong>in</strong>d öffentliches Kapital. Neben dem Sachkapital (wie<br />
Bauten und E<strong>in</strong>richtungen) gehört also auch das Humankapital<br />
zur Infrastruktur, d. h. das technologische Wissen<br />
und Können und die geistigen unternehmerischen Fähigkeiten<br />
der für das öffentliche Wohl tätigen Menschen.<br />
Fazit<br />
Aufgrund der Komplexität der heutigen Lebens- und<br />
Arbeitsverhältnisse und der weiträumiger gewordenen<br />
E<strong>in</strong>zugs- und Auswirkungsbereiche der Infrastruktur kann<br />
und darf sie nicht auf der örtlichen Ebene verharren, sondern<br />
hat auch regionale Bedeutung. Und Regionalisierung<br />
heißt Dezentralisierung. Die eigenständigen Kräfte der<br />
e<strong>in</strong>zelnen Räume s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> wichtiges Infrastrukturpotential.<br />
Ganzheitliches Denken und Handeln über die Siedlungse<strong>in</strong>heit,<br />
über die eigene Geme<strong>in</strong>de h<strong>in</strong>aus ist notwendig.<br />
Die Probleme s<strong>in</strong>d groß, größer denn je, es fehlt an<br />
Geld, es fehlt an Arbeit und an visionären Gedanken und<br />
Menschen.<br />
100 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Emil Schneider<br />
Die Geme<strong>in</strong>den auf dem Weg <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>e F<strong>in</strong>anzkrise?<br />
I. Problemfelder<br />
Vier Probleme belasten die kommunalen Haushalte <strong>in</strong><br />
Bayern <strong>in</strong> außerordentlicher Weise:<br />
1. Beteiligung der Kommunen an den Kosten der<br />
Deutschen E<strong>in</strong>heit<br />
Ohne die Kommunen an den Entscheidungsprozessen<br />
zu beteiligen, werden sie mit 38 % am Länderanteil<br />
Bayerns aus dem Solidarpakt und dem Fonds Deutsche<br />
E<strong>in</strong>heit belastet. <strong>1994</strong> müssen die bayerischen Kommunen<br />
Belastungen <strong>in</strong> Höhe von 655 Mio. DM und 1995 von<br />
1.649 Mio. DM tragen. Der Beitrag der Kommunen zur<br />
Deutschen E<strong>in</strong>heit wird zur Hälfte durch die Anhebung<br />
der Gewerbesteuerumlage (1993: 39 %, <strong>1994</strong>: 56 %,<br />
1995: 79 %) und zur anderen Hälfte über Kürzungen im<br />
kommunalen F<strong>in</strong>anzausgleich f<strong>in</strong>anziert. Auch <strong>in</strong> den<br />
Jahren ab 1996 müssen die bayerischen Kommunen im<br />
Zusammenhang mit der Deutschen E<strong>in</strong>heit mit Belastungen<br />
<strong>in</strong> Höhe von jährlich rd. 1,7 Mrd. DM rechnen.<br />
Wie die geplanten Kürzungen im F<strong>in</strong>anzausgleich 1995<br />
<strong>in</strong> Höhe von 829 Mio. DM zu erbr<strong>in</strong>gen s<strong>in</strong>d, ist noch<br />
nicht entschieden.<br />
— Werden die Schlüsselzuweisungen deutlich gekürzt?<br />
— Wird e<strong>in</strong>e Umlage auf die E<strong>in</strong>kommensteuerbeteiligung<br />
der Gemeiden erhoben?<br />
— Ist mit e<strong>in</strong>er Umlage auf den Kommunalanteil an der<br />
Grunderwebsteuer zu rechnen?<br />
— Muß an e<strong>in</strong>e Kürzung der Projektförderung (Schulen,<br />
K<strong>in</strong>dergärten, Verwaltungsgebäude, Feuerwehrgerätehäuser,<br />
Breitensportanlagen, Investitionen im Bereich<br />
der Wasserversorgung, der Abwasserbeseitigung bzw.<br />
im Straßenbau) gedacht werden?<br />
Der Bayerische Geme<strong>in</strong>detag tritt dafür e<strong>in</strong>, daß die<br />
geplanten Belastungen der Kommunen durch den Solidarpakt<br />
deutlich gesenkt werden. Der Beitrag muß sich am<br />
Anteil der Kommunen am Staatshaushalt orientieren<br />
(<strong>1994</strong>: 16,67 %). Daneben wird gefordert, die Belastungen,<br />
soweit sie im F<strong>in</strong>anzausgleich zu erbr<strong>in</strong>gen s<strong>in</strong>d, ausgewogener<br />
als bei der F<strong>in</strong>anzierung des Fonds Deutsche<br />
E<strong>in</strong>heit auf alle Geme<strong>in</strong>den zu verteilen. Ke<strong>in</strong>esfalls können<br />
die Beiträge ab 1995 <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie durch Kürzungen<br />
im allgeme<strong>in</strong>en Steuerverbund f<strong>in</strong>anziert werden. Es muß<br />
entsprechend der oben angesprochenen Überlegungen<br />
auch an e<strong>in</strong>e Umlage auf die E<strong>in</strong>kommensteuerbeteiligung<br />
und auf den Kommunalanteil an der Grunderwerbsteuer<br />
gedacht werden. E<strong>in</strong>e Kürzung der Projektförderung wird<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
im H<strong>in</strong>blick auf die Auswirkungen für die f<strong>in</strong>anzschwachen<br />
Städte, Märkte und Geme<strong>in</strong>den bzw. auf die<br />
Wirtschaft als nicht sachgerecht erachtet. Wegen bestehender<br />
F<strong>in</strong>anzierungsverpflichtungen bereits bewilligter<br />
Hochbaumaßnahmen, die abf<strong>in</strong>anziert werden müssen,<br />
wären die zur Verfügung stehenden Umschichtungsbeträge<br />
aufgrund ihres ger<strong>in</strong>gen Volumens ohneh<strong>in</strong> ungeeignet<br />
für die Teilf<strong>in</strong>anzierung des Solidarpakts.<br />
2. Anstieg der ungedeckten Solzialhilfebelastungen<br />
der Bezirke<br />
Die ungedeckten Sozialhilfeausgaben der Bezirke als<br />
überörtliche Träger der Sozialhilfe haben sich von 1983<br />
mit 1.116 Mio. DM auf 3.011 Mio. DM <strong>in</strong> 1993 explosionsartig<br />
entwickelt. <strong>1994</strong> bzw. 1995 ist mit e<strong>in</strong>em weiteren<br />
Anstieg auf 3.563 Mio. DM bzw. 3.900 Mio. DM zu rechnen.<br />
Der Kostenanstieg beläuft sich von 1992 bis 1995<br />
auf 1,2 Mrd. DM, das bedeutet pro Jahr e<strong>in</strong>e Steigerung<br />
um 300 Mio. DM. Die Bezirke mußten die Bezirksumlage<br />
von landesdurchschnittlich 16,78 %-Punkte <strong>in</strong> 1983 auf<br />
24,345 %-Punkte <strong>in</strong> <strong>1994</strong> anheben. 1995 ist mit e<strong>in</strong>er<br />
weiteren Anhebung um rd. 2,6 %-Punkte auf landesdurchschnittlich<br />
27 %-Punkte zu rechnen.<br />
Diese <strong>Entwicklung</strong> wurde <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie durch die fehlende<br />
Pflegekostenversicherung, aber auch durch die fehlende<br />
Unterbr<strong>in</strong>gungsverpflichtung mit Kostenübernahme<br />
des Staates für Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtl<strong>in</strong>ge sowie<br />
geduldete Ausländer verursacht.<br />
<strong>Entwicklung</strong> der ungedeckten Sozialhilfeausgaben der<br />
überörtlichen Träger, der Ausgleichsleistungen des Freistaates<br />
Bayern an die Bezirke und der Umlagesätze der<br />
Bezirke seit 1980:<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
101
Jahr<br />
1980<br />
1983<br />
1986<br />
1989<br />
1990<br />
1991<br />
1992<br />
1993<br />
<strong>1994</strong><br />
1995<br />
ungedeckte<br />
Sozialhilfeleistungen<br />
Mio. DM<br />
767<br />
1.116<br />
1.401<br />
1.794<br />
1.904<br />
2.108<br />
2.737<br />
3.011<br />
3.563<br />
3.900<br />
Steigerung<br />
%<br />
45,5<br />
25,5<br />
28,0<br />
6,1<br />
10,7<br />
29,8<br />
10,0<br />
18,3<br />
9,4<br />
Sozialhilfeausgleich<br />
Art. 15 FAG<br />
%<br />
Mio. DM<br />
Der Sozialhilfeausgleich wurde im Nachtragshaushalt<br />
<strong>1994</strong> auf Druck der kommunalen Spitzenverbände um<br />
Haushaltsmittel <strong>in</strong> Höhe von 80 Mio. DM und um Mittel<br />
aus dem Kfz-Steuerverbund <strong>in</strong> Höhe von 78 Mio. DM von<br />
360,8 Mio. DM <strong>in</strong> 1993 auf 518,9 Mio. DM (+ 158,1 Mio.<br />
DM = + 43,8 %) verstärkt. In den 518,9 Mio. DM s<strong>in</strong>d<br />
Mittel aus dem allgeme<strong>in</strong>en Steuerverbund von 140 Mio.<br />
DM und aus dem Kfz-Steuerverbund von 120,0 Mio. DM<br />
enthalten. Soweit die Zahl der Asylbewerber weiter rückläufig<br />
ist und die für die Asylbewerber vorgesehenen<br />
Haushaltsmittel (582,6 Mio. DM) nicht verbraucht werden,<br />
wird der Freistaat Bayern weitere 80 Mio. DM für den<br />
Sozialhilfeausgleich zur Verfügung stellen. Mit e<strong>in</strong>er<br />
Entscheidung <strong>in</strong> dieser Angelegenheit ist bis Ende Mai<br />
<strong>1994</strong> zu rechnen.<br />
Daneben wurde durch e<strong>in</strong>e entsprechende Auslegung<br />
des § 23 KommHV für die Bezirke die Möglichkeit<br />
geschaffen, Haushaltsfehlbeträge aus dem Jahr 1992 <strong>in</strong><br />
Höhe von <strong>in</strong>sgesamt 236 Mio. DM erst 1996 auszugleichen.<br />
Zu diesem Zeitpunkt soll die Pflegekostenversicherung<br />
für die stationäre Unterbr<strong>in</strong>gung von Pflegebedürftigen<br />
wirksam werden und zu e<strong>in</strong>er Entlastung der Bezirke<br />
<strong>in</strong> Höhe von rd. 700 Mio. DM bis 900 Mio. DM beitragen.<br />
Dies gilt allerd<strong>in</strong>gs nur unter der Voraussetzung, daß der<br />
Freistaat über den kommunalen F<strong>in</strong>anzausgleich nicht<br />
wieder erhebliche E<strong>in</strong>sparungsbeträge zugunsten der<br />
Investitionsförderung im Bereich der Alten- und<br />
Pflegeheime abzweigen wird.<br />
Bis entsprechende Leistungen aus der nun beschlossenen<br />
Pflegeversicherung gewährt werden, sollte der Frei-<br />
75<br />
95<br />
170<br />
260<br />
220<br />
240<br />
260<br />
360<br />
519<br />
360 + x<br />
<strong>Entwicklung</strong> der ungedeckten Sozialhilfeleistungen seit 15 Jahren<br />
staat den Solzialhilfeausgleich an die Bezirke gemäß<br />
Art. 15 FAG durch zusätzliche Haushaltsmittel <strong>in</strong> Höhe<br />
von m<strong>in</strong>destens 400 Mio. DM auf rd. 720 Mio. DM verstärkt.<br />
E<strong>in</strong>e weitere Umschichtung von F<strong>in</strong>anzmitteln der<br />
Kommunen aus dem allgeme<strong>in</strong>en Steuerverbund (<strong>1994</strong><br />
140 Mio. DM) und dem Kfz-Steuerverbund (120 Mio. DM)<br />
ist nicht vertretbar. Daneben muß nach Auffassung der<br />
kommunalen Spitzenverbände der Freistaat Bayern entsprechend<br />
der Regelung bei Asylbewerbern für Kriegsund<br />
Bürgerkriegsflüchtl<strong>in</strong>ge sowie geduldete Ausländer<br />
e<strong>in</strong>e staatliche Unterbr<strong>in</strong>gungspflicht mit Kostenübernahme<br />
begründet, da es sich hierbei nicht um e<strong>in</strong>e kommunale<br />
Aufgabe handelt.<br />
3. Konjunkturell bed<strong>in</strong>gte Steuerausfälle<br />
Das Aufkommen aus der Gewerbesteuer lag 1993<br />
wegen der Auswirkung des Steueränderungsgesetzes<br />
1992, aber auch aufgrund e<strong>in</strong>er konjunkturbed<strong>in</strong>gten<br />
Verschlechterung der Unternehmensgew<strong>in</strong>ne um 3,1 %<br />
unter dem Vorjahrswert. Diese <strong>Entwicklung</strong> wird sich<br />
<strong>1994</strong> bzw. 1995 verstärkt fortsetzen. Daneben muß nach<br />
dem Ergebnis der Steuerschätzung vom November 1993<br />
damit gerechnet werden, daß sich die E<strong>in</strong>nahmen der<br />
Geme<strong>in</strong>den aus dem allgeme<strong>in</strong>en Steuerverbund (E<strong>in</strong>nahmen<br />
des Landes aus der E<strong>in</strong>kommen- und Lohnsteuer,<br />
der Körperschaftsteuer, der Umsatzsteuer und der Gewerbesteuerumlage)<br />
und damit die Schlüsselzuweisungen<br />
rückläufig entwickeln. Gleiches gilt für das Kraftfahrzeugsteueraufkommen.<br />
Der Anteil an der E<strong>in</strong>kommensteuer<br />
102 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
9,8<br />
8,5<br />
12,1<br />
14,5<br />
11,6<br />
11,4<br />
10,6<br />
12,6<br />
16,1<br />
?<br />
Bezirksumlage<br />
%<br />
15,65<br />
16,78<br />
16,66<br />
18,24<br />
18,29<br />
18,44<br />
19,80<br />
22,17<br />
ca. 24,345<br />
rd.27<br />
Anhebung<br />
%-Punkte<br />
+ 1,13<br />
- 0,12<br />
+1,58<br />
+ 0,05<br />
+ 0,15<br />
+ 1,36<br />
+ 2,37<br />
+ 2,00<br />
+2,60
wird wegen der wirtschaftlichen Rezession und der steigenden<br />
Arbeitslosenzahlen 1995 allenfalls nur schwach<br />
zunehmen.<br />
4. Belastungen durch neue Leistungsgesetze<br />
Zusätzliche Belastungen, die sich <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen<br />
Geme<strong>in</strong>den unterschiedlich auswirken und nicht konkret<br />
beziffert werden können, ergeben sich unter anderem<br />
durch den Rechtsanspruch auf e<strong>in</strong>en K<strong>in</strong>dergartenplatz,<br />
das Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr,<br />
das Bayerische K<strong>in</strong>der- und Jugendhilfegesetz<br />
(1990 bis 1993 100 %ige Aufgabensteigerung)<br />
und durch verschärfte Anforderungen an Abwasserre<strong>in</strong>igung<br />
und Abfallbeseitigung.<br />
Das Gesundheitsstrukturgesetz wird <strong>1994</strong> bzw. 1995<br />
durch die Anb<strong>in</strong>dung des Krankenhausbudgets an die<br />
Grundlohnsummenentwicklung zu e<strong>in</strong>em deutlichen<br />
Anstieg der Defizite bei den Kreiskrankenhäusern (1992<br />
bereits 200 Mio. DM <strong>in</strong> Bayern) führen. Jede Erhöhung der<br />
Beschäftigungszahl bzw. des Pflegetagevolumens sowie<br />
jede Leistungsausweitung gegenüber dem vere<strong>in</strong>barten<br />
Budget 1992 geht voll zu Lasten der Landkreise. Die<br />
dadurch entstehenden Defizite müssen von den kreisangehörigen<br />
Geme<strong>in</strong>den über die Kreisumlage f<strong>in</strong>anziert<br />
werden, während die Krankenkassen nunmehr ihre<br />
Beiträge senken können<br />
Die Bahnstrukturreform hat e<strong>in</strong>e Reihe von Geme<strong>in</strong>den<br />
zum 01.01.94 »über Nacht« zu Baulastträgern<br />
für Straßenüberführungen und Eisenbahnl<strong>in</strong>ien gemacht<br />
und ihnen damit Belastungen <strong>in</strong> Milliardenhöhe aufgebürdet.<br />
Die Bundesbahn hatte bisher die Kosten für die<br />
Unterhaltung dieser Brücken zu tragen. Die kommunalen<br />
Spitzenverbände auf Landes- und Bundesebene haben im<br />
Rahmen ihrer Möglichkeiten nachdrücklich auf diese<br />
Problematik h<strong>in</strong>gewiesen. Die Belastungen der Geme<strong>in</strong>den,<br />
die am Verhandlungstisch nicht vertreten waren,<br />
wurden vom Bund bzw. von den Länder offensichtlich <strong>in</strong><br />
Kauf genommen.<br />
II. Kommunaler F<strong>in</strong>anzausgleich 1995<br />
Für die bayerischen Kommunen stellt sich immer drängender<br />
die Frage, wie die geplanten Kürzungen im F<strong>in</strong>anzausgleich<br />
1995 im Zusammenhang mit der Mitf<strong>in</strong>anzierung<br />
der Deutschen E<strong>in</strong>heit zu erbr<strong>in</strong>gen s<strong>in</strong>d und <strong>in</strong> welcher<br />
Form der Solzialhilfeausgleich gemäß Art. 15 FAG<br />
gestaltet wird. E<strong>in</strong> Zuwarten bis zu den Haushaltsberatungen<br />
im Herbst <strong>1994</strong> wäre für alle Beteiligten<br />
verhängnisvoll.<br />
Die kommunalen Spitzenverbände <strong>in</strong> Bayern haben daher<br />
den bayerischen M<strong>in</strong>isterpräsidenten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>samen<br />
Schreiben gebeten, den Dialog mit den kommunalen<br />
Spitzenverbänden aufzunehmen, damit ausreichend<br />
Zeit für die erforderliche Diskussion bleibt. Spätestens<br />
Mitte <strong>1994</strong> müssen die Bezirke, Landkreise, Städte,<br />
Märkte und Geme<strong>in</strong>den abschätzen können, welche<br />
Belastungen im e<strong>in</strong>zelnen ab 1995 auf sie zukommen.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Der bayerische M<strong>in</strong>isterpräsident hat mit Schreiben<br />
vom 5. 4. <strong>1994</strong> mitgeteilt, daß er sich für baldige<br />
Gespräche zwischen Staat und Kommunen über die<br />
Gestaltung des F<strong>in</strong>anzausgleichs 1995 e<strong>in</strong>setzt und er um<br />
die f<strong>in</strong>anziellen Nöte der bayerischen Kommunen weiß.<br />
Die notwendigen vorbereitenden Arbeiten für die Erstellung<br />
von diskussionsfähigen Modellen werden derzeit im<br />
F<strong>in</strong>anzm<strong>in</strong>isterium erarbeitet. Es bleibt zu hoffen, daß <strong>in</strong><br />
Kürze erste Kontakte auf Fachebene zwischen der Bayerischen<br />
Staatsregierung und den kommunalen Spitzenverbänden<br />
möglich s<strong>in</strong>d.<br />
III. E<strong>in</strong>schränkungen der kommunalen<br />
Leistungen<br />
Durch die aufgezeigte <strong>Entwicklung</strong> wird die freie<br />
Verfügungsmasse der Kommunen drastisch reduziert. Die<br />
Spielräume für die politischen Gremien werden kle<strong>in</strong>.<br />
Realsteuer- und Gebührenerhöhungen werden zur Diskussion<br />
stehen. E<strong>in</strong>e Umfrage bei e<strong>in</strong>em Teil der Mitgliedsgeme<strong>in</strong>den<br />
ergab, daß 61 % der Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e<br />
Anhebung der Realsteuerhebesätze und 27 % e<strong>in</strong>e deutliche<br />
Kürzung der Investitionen für die Jahre <strong>1994</strong> bis<br />
1995 planen. Die Belastungen der Kommunen können<br />
jedoch nur zu e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>gen Teil durch die Anhebung<br />
der Hebesätze bzw. Gebühren ausgeglichen werden.<br />
Es ist deshalb absehbar, daß die Kommunen <strong>in</strong> Bayern<br />
zu drastischen Sparmaßnahmen gezwungen se<strong>in</strong> werden.<br />
Ohne E<strong>in</strong>schränkungen der kommunalen Leistungen wird<br />
es spätestens ab 1995 nicht mehr gehen. Es wird notwendig,<br />
auch wichtige und wünschenswerte Aufgaben <strong>in</strong><br />
allen kommunalen Bereichen drastisch zurückzuführen.<br />
Der bayerische Staatsm<strong>in</strong>ister der F<strong>in</strong>anzen brachte es <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Presseerklärung Ende 1993 (Nr. 337/93) auf den<br />
Punkt:<br />
»Auch für die Städte und Geme<strong>in</strong>den müsse angesichts<br />
der neuen Herausforderungen <strong>in</strong> Deutschland<br />
Sparen der oberste Grundsatz aller kommunalpolitischer<br />
Entscheidungen se<strong>in</strong>«.<br />
F<strong>in</strong>anzstaatssekretär Alfons Zeller ergänzte am<br />
21. 4. <strong>1994</strong> (Presseerklärung 155/94):<br />
»Wir brauchen jetzt ke<strong>in</strong> Lamentieren über zu wenig<br />
Geld, sondern die Bündelung aller Kräfte und die<br />
Bereitschaft, das Wünschenswerte h<strong>in</strong>ter dem<br />
Notwendigen zurückzustellen«.<br />
Alle Möglichkeiten zur Reduzierung der Ausgaben müssen<br />
ausgelotet und ausgeschöpft werden. Die Bürger<br />
müssen mit e<strong>in</strong>er deutlichen Zurücknahme des Leistungsangebotes<br />
der Städte und Geme<strong>in</strong>den aber auch der<br />
Landkreise und Bezirke rechnen. Der Bayerische Geme<strong>in</strong>detag<br />
hat bereits im April 1993 <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Verbandszeitschrift<br />
e<strong>in</strong>en entsprechenden Katalog möglicher Sparmaßnahmen<br />
des Deutschen Städte- und Geme<strong>in</strong>debundes<br />
veröffentlicht.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
103
Der gesamte kommunale Leistungsapparat muß auf<br />
den Prüfstand. Die Bürgermeister und Geme<strong>in</strong>deräte s<strong>in</strong>d<br />
aufgerufen, <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit der Verwaltung notwendige<br />
Sparkonzepte zu erarbeiten. Bei größeren<br />
Geme<strong>in</strong>den empfiehlt sich auch die E<strong>in</strong>schaltung unabhängiger<br />
Dritter, <strong>in</strong>sbesondere bei der Erstellung von<br />
Organisationsgutachten, um gegebenenfalls vorhandenes<br />
Ämterdenken <strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de abzubauen. Als<br />
Anregung für kommunale Sparmaßnahmen s<strong>in</strong>d vorrangig<br />
zu nennen:<br />
• Allgeme<strong>in</strong>e Verwaltung<br />
— (Zeitweise) Nichtbesetzung freiwerdender Stellen,<br />
— Überprüfung von Stellen, die seit längerer Zeit nicht<br />
besetzt s<strong>in</strong>d,<br />
— pauschale Kürzungen bei Sachausgaben,<br />
— Energiee<strong>in</strong>sparungensmaßnahmen <strong>in</strong>sgesamt bei<br />
geme<strong>in</strong>dlichen E<strong>in</strong>richtungen.<br />
• Öffentliche Sicherheit und Ordnung<br />
— Erhöhung der Leistungsentgelte bei Feuerschutz,<br />
— E<strong>in</strong>sparungen bei der Ausrüstung der Feuerwehr.<br />
• Schulen<br />
— Abbau freiwilliger Zuschüsse im Schulbereich<br />
(Schulfahrten u. a.),<br />
— E<strong>in</strong>sparungen bei Gebäudeunterhaltung und<br />
-renovierung,<br />
— Streichung und/oder Streckung von Investitionen.<br />
• Kulturpflege<br />
— Musikschulen<br />
- Erhöhung der Unterrichtsgebühren.<br />
— Volkshochschulen<br />
- Erhöhung der Gebühren,<br />
- Reduzierung des Angebots,<br />
- Festlegung von M<strong>in</strong>destteilnehmerzahlen für<br />
Kurse.<br />
• K<strong>in</strong>dergärten<br />
— Überprüfung der Elternbeiträge,<br />
— Überprüfung der Zahl der Zweitkräfte,<br />
— Anpassung der Öffnungszeiten an den örtlichen<br />
Bedarf.<br />
• Gesundheit, Sport, Erholung<br />
— Abbau der Hilfen an Sportvere<strong>in</strong>e (z. B. Zuschüsse<br />
für den laufenden Betrieb),<br />
— Streichung und/oder Streckung von Investitionen<br />
bei Sportstätten und Bädern,<br />
— Erhöhung der Nutzungsentgelte eigener Sportstätten<br />
und Bäder, <strong>in</strong>sbesondere bei zur Zeit kostenloser<br />
oder verbilligter Nutzung,<br />
— E<strong>in</strong>sparungen bei der Unterhaltung von Sportstätten,<br />
Bädern, Grünanlagen,<br />
— Kürzung der Öffnungszeiten für Bäder<br />
(Schließung?),<br />
— Absenkung der Wassertemperatur <strong>in</strong> den Bädern.<br />
• Bau- und Wohnungswesen, Verkehr<br />
— Reduzierung der Zahl der Gutachten, Planentwürfe,<br />
Wettbewerbe,<br />
— schnelle Bearbeitung und unverzügliche Erhebung<br />
der Erschließungsbeiträge sowie der Beiträge für die<br />
Erweiterung und Verbesserung von Erschließungsanlagen<br />
und Entwässerungsanlagen nach KAG:<br />
strenge Maßstäbe bei Stundung oder Erlaß,<br />
— E<strong>in</strong>sparung bei der Unterhaltung von Straßen,<br />
Straßenbeleuchtung, Verkehrssignalanlagen,<br />
Wasserläufe, Gebäuden,<br />
— volle Ausschöpfung der gesetzlichen Möglichkeiten<br />
zur Umlage der Kosten der Straßenre<strong>in</strong>igung<br />
e<strong>in</strong>schließlich des W<strong>in</strong>terdienstes; gegebenenfalls<br />
Beschränkung des kommunalen Anteils auf den<br />
gesetzlichen M<strong>in</strong>destanteil.<br />
• Öffentliche E<strong>in</strong>richtungen<br />
— Erhöhung der Gebühren bei Abwasser- und Abfallbeseitigung,<br />
Märkten, Schlacht - und Viehhöfen,<br />
Bestattungswesen,<br />
— vollständige Überwälzung der Abwasserabgaben,<br />
— E<strong>in</strong>sparungen bei der Unterhaltung von Gebäuden,<br />
Kläranlagen, Friedhöfen,<br />
— Zurückstellung von Investitionen, Streckung von<br />
Investitionen bei Kanalbau, Kläranlagen, Fuhrpark.<br />
IV. 10 Forderungen an die Bayerische<br />
Staatsregierung<br />
1. Die geplanten Belastungen der Kommunen durch<br />
den Solidarpakt s<strong>in</strong>d deutlich zu senken; der Beitrag<br />
muß sich am Anteil der Kommunen am Staatshaushalt<br />
orientieren (<strong>1994</strong>: 16,67 %). Der Freistaat muß auf<br />
geplante Kürzungen der F<strong>in</strong>anzausgleichsleistungen<br />
(1995 rund 829 Mio. DM) teilweise verzichten und<br />
umgehend se<strong>in</strong>e Überlegungen im Zusammenhang<br />
mit den geplanten Kürzungen im F<strong>in</strong>anzausgleich<br />
1995 offenlegen, damit ausreichend Zeit für die erforderliche<br />
Diskussion mit den kommunalen Spitzenverbänden<br />
bleibt und die Kommunen sich rechtzeitig auf<br />
die vom Freistaat geplanten Maßnahmen e<strong>in</strong>stellen<br />
können.<br />
2. Bis entsprechende Leistungen aus der nun beschlossenen<br />
Pflegeversicherung gewährt werden, muß der<br />
Freistaat den Sozialhilfeausgleich an die Bezirke <strong>in</strong> den<br />
Jahren 1995 und 1996 gemäß Art. 15 FAG durch<br />
zusätzliche Haushaltsmittel <strong>in</strong> Höhe von m<strong>in</strong>destens<br />
400 Mio. DM auf rund 720 Mio. DM verstärken.<br />
3. Der Freistaat muß entsprechend der Regelung bei<br />
Asylbewerbern auch für die Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtl<strong>in</strong>ge<br />
sowie die geduldeten Ausländer e<strong>in</strong>e staat-<br />
104 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
liche Unterbr<strong>in</strong>gungspflicht mit Kostenübernahme<br />
begründen, da es sich hierbei nicht um e<strong>in</strong>e kommunale<br />
Aufgabe handelt.<br />
4. Es dürfen ke<strong>in</strong>e neuen Leistungsgesetze ohne solide<br />
F<strong>in</strong>anzierungsvorschläge verabschiedet werden. Insbesondere<br />
ist der Rechtsanspruch auf e<strong>in</strong>en K<strong>in</strong>dergartenplatz<br />
bis zum Jahr 2000 zu strecken. Die dritte<br />
Re<strong>in</strong>igungsstufe bei der Abwasserbeseitigung muß<br />
ebenfalls h<strong>in</strong>ausgeschoben werden.<br />
5. Zur Stärkung der Dispositionsbefugnis der Geme<strong>in</strong>den<br />
müssen Richtl<strong>in</strong>ien und Verwaltungsvorschriften über<br />
personelle und sachliche Ausstattungstandards auf<br />
ihre Notwendigkeit überprüft und entwender aufgehoben<br />
oder <strong>in</strong> Empfehlungen umgewandelt werden.<br />
Darüber h<strong>in</strong>aus sollten die allgeme<strong>in</strong>en Förderrichtl<strong>in</strong>ien,<br />
<strong>in</strong>sbesondere im Bereich Antragsverfahren und<br />
Verwendungsnachweise, nachhaltig abgespeckt werden.<br />
6. Kommunalfremde Risiken s<strong>in</strong>d aus der geme<strong>in</strong>d-lichen<br />
Unfallversicherung herauszunehmen und neue nicht<br />
<strong>in</strong> ihr abzusichern, <strong>in</strong>sbesondere die Versicherung der<br />
Pflegepersonen <strong>in</strong> der häuslichen Pflege.<br />
7. Die Beschränkungen bei den sogenannten »kle<strong>in</strong>en<br />
Geme<strong>in</strong>desteuern« müssen aufgegeben werden. Entsprechend<br />
den Regelungen <strong>in</strong> den anderen Bundesländern<br />
(Baden-Württemberg, Hessen, Rhe<strong>in</strong>land-<br />
Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holste<strong>in</strong>)<br />
muß den bayerischen Geme<strong>in</strong>den erlaubt werden, z. B.<br />
e<strong>in</strong>e Zweitwohnungssteuer, e<strong>in</strong>e Getränke- und<br />
Vergnügungssteuer zu erheben.<br />
8. Zur Mobilisierung von Wohnbauland fordern die<br />
Geme<strong>in</strong>den die gesetzliche Zulassung e<strong>in</strong>es erhöhten<br />
Grundsteuerhebesatz für baureife, unbebaute<br />
Grundstücke (sogenanntes zoniertes Satzungsrecht).<br />
9. Die längst überfällige Neubewertung der E<strong>in</strong>heitswerte<br />
von Grund und Boden (gegenwärtiger Stichtag ist der<br />
01.01.1964!) ist -zum<strong>in</strong>dest mit e<strong>in</strong>er Zuschlagsregelung<br />
als Zwischenlösung- <strong>in</strong> Angriff zu nehmen.<br />
10. Der Anteil der Kommunen an der Grunderwerbssteuer<br />
ist entsprechend der Regelung vor 1991<br />
von derzeit 66 2 / 3 % auf 80 % anzuheben. Den<br />
Kommunen gehen alle<strong>in</strong> <strong>1994</strong> durch diese Kürzung<br />
155 Mio. DM verloren.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
105
Bernhard Böckeler<br />
Strukturelle Probleme und<br />
Lösungswege am Rande e<strong>in</strong>es<br />
Ballungsraumes<br />
Markt Allersberg<br />
Planungsraum und Strukturdaten<br />
Der Markt Allersberg gehört zur Industrieregion<br />
Mittelfranken (Region 7). Er liegt <strong>in</strong> der äußeren Verdichtungszone<br />
des Ballungsraumes Nürnberg-Fürth-<br />
Erlangen. Im aktuellen Landesentwicklungsprogramm vom<br />
1. 3. <strong>1994</strong> ist Allersberg als Unterzentrum e<strong>in</strong>gestuft.<br />
Regionalplanerisch s<strong>in</strong>d me<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de die Mittelpunktsfunktion,<br />
Funktionen im Bereich der Erholung und<br />
des Fremdenverkehrs sowie Funktionen zum Schutz und<br />
zur Pflege der Landschaft zugewiesen.<br />
Allersberg liegt an e<strong>in</strong>er Nahtstelle zwischen <strong>Stadt</strong> und<br />
Land und ist somit gut geeignet für das Motto der diesjährigen<br />
<strong>Fachtagung</strong>. Durch unseren Waldreichtum und<br />
unsere abwechslungsreiche Landschaft mit ihrem hohen<br />
Erholungswert s<strong>in</strong>d wir für viele der 500 000 E<strong>in</strong>wohner<br />
von Nürnberg e<strong>in</strong> beliebtes und gut erreichbares Ziel.<br />
Allersberg hat derzeit knapp 8 000 E<strong>in</strong>wohner, im Jahre<br />
1970 waren es weniger als 5 000. Arbeitsplätze s<strong>in</strong>d <strong>in</strong><br />
der Geme<strong>in</strong>de nicht ausreichend vorhanden, was bedeutet,<br />
daß 2 / 3 der Erwerbstätigen pendeln müssen. 22 landwirtschaftliche<br />
Betriebe bewirtschaften je 20 bis 30 ha<br />
Fläche, 11 Betriebe 30 ha und mehr (Stand 1. 1. 1992).<br />
Derzeit laufende überörtliche Planungen<br />
In den 80er Jahren ist der Rothsee mit Haupt- und<br />
Vorsperre gebaut worden. 1993 fand die offizielle E<strong>in</strong>weihung<br />
dieses wasserwirtschaftlichen Großprojektes als Teil<br />
des Neuen Fränkischen Seenlandes statt. Im Geme<strong>in</strong>degebiet<br />
von Allersberg ist hierbei neben der Schaffung von<br />
Freizeite<strong>in</strong>richtungen auch e<strong>in</strong> Naturschutzgebiet ausgewiesen<br />
worden.<br />
Seit 1992 müssen wir uns <strong>in</strong>tensiv mit der geplanten<br />
ICE-Neubaustrecke Nürnberg-Ingolstadt-München ause<strong>in</strong>andersetzen.<br />
Die geplante Trasse soll im wesentlichen<br />
entlang der bestehenden Autobahn A 9 verlaufen.<br />
Neben dem Verkehr auf Wasser und Schiene berührt<br />
uns seit längerer Zeit das Problem des Straßenverkehrs.<br />
Drei Staatsstraßen laufen <strong>in</strong> Allersberg am Marktplatz<br />
zusammen (10 000 Fahrzeuge täglich). Seit 30 Jahren<br />
werden Lösungen zur Ortsumfahrung gesucht und diskutiert.<br />
Die neueste <strong>in</strong> vielen Abstimmungsgesprächen und<br />
Ortsbegehungen mit Straßenbauamt, zuständigen Fachbehörden<br />
und Bund Naturschutz konzipierte Lösung<br />
wurde jüngst im Marktgeme<strong>in</strong>derat behandelt und<br />
beschlossen.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Allersberg hat e<strong>in</strong>e eigene Anschlußstelle an die Autobahn.<br />
Dies ist für die bisherige und vor allem für die künftige<br />
Geme<strong>in</strong>deentwicklung von enormer Bedeutung .<br />
Chancen und Probleme der Geme<strong>in</strong>deentwicklung<br />
Allersberg<br />
Wir <strong>in</strong> Allersberg stehen mitten <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em mehrschichtigen<br />
Umstrukturierungsprozeß. Die Besucher von nah<br />
und fern, angezogen durch unsere attraktive Landschaft<br />
mit ihrem hohen Freizeit- und Erholungswert, können<br />
Allersberg schnell und bequem erreichen. Künftig vielleicht<br />
sogar noch schneller, sollte mit der geplanten ICE-<br />
Neubaustrecke e<strong>in</strong> vom Marktgeme<strong>in</strong>derat gewünschter<br />
Regionalbahnhof <strong>in</strong> Allersberg-Altenfelden Wirklichkeit<br />
werden. Die Fahrzeit nach Nürnberg-Hauptbahnhof würde<br />
13 M<strong>in</strong>uten betragen und hätte den Vorteil e<strong>in</strong>er durchgreifenden<br />
Verbesserung des ÖPNV, vor allem für unsere<br />
Pendler.<br />
Feststellen müssen wir bei dieser Vielzahl der Planungen<br />
von außen, daß unsere Grundstückspreise enorm<br />
gestiegen s<strong>in</strong>d:<br />
Unerschlossenes Wohnbauland kostet ca. 300,— DM/m 2,<br />
landwirtschaftliche Nutzflächen ca. 12,— bis 15,— DM/m 2.<br />
Die Bodenpreise im landwirtschaftlichen Bereich s<strong>in</strong>d<br />
zwischenzeitlich zu 100 % durch die Verkehrsvorhaben<br />
bee<strong>in</strong>flußt, die Baulandpreise durch den Siedlungsdruck<br />
aus dem Verdichtungsraum. E<strong>in</strong>e Preisentwicklung mit<br />
Nachteilen für geme<strong>in</strong>dliche Grundstücksaktivitäten —<br />
wir haben sehr wenig Eigentumsflächen — und für Bauwillige.<br />
Selbst die verkaufsbereiten Grundstückseigentümer<br />
freuen sich nicht nur, sondern haben auch Probleme<br />
mit dem F<strong>in</strong>anzamt.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
107
Geme<strong>in</strong>dliche Vorhaben wie z. B. die Flächennutzungsplanüberarbeitung,<br />
der Standort e<strong>in</strong>es Infozentrums an<br />
der Autobahn sowie die Erstellung e<strong>in</strong>es Rad-, Wanderund<br />
Reitwegenetzes können nicht isoliert von den genannten<br />
überörtlichen Planungen gesehen werden. Auch<br />
bei e<strong>in</strong>er verantwortungsvollen geme<strong>in</strong>dlichen <strong>Entwicklung</strong><br />
gilt der alte geodätische Grundsatz: Vom Großen <strong>in</strong>s<br />
Kle<strong>in</strong>e!<br />
E<strong>in</strong>e echte Chance, sogar e<strong>in</strong>e zw<strong>in</strong>gende Chance ist,<br />
daß sich die Geme<strong>in</strong>deverantwortlichen und die <strong>in</strong>teressierten<br />
Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger bei dieser Planungsvielfalt<br />
von außen mit ihrer Geme<strong>in</strong>de ause<strong>in</strong>andersetzen müssen.<br />
Die immer wieder zu hörenden Fragen lauten:<br />
Woher kommen wir, wo stehen wir, woh<strong>in</strong> wollen<br />
wir?<br />
Als Etappenziel zeitlicher Art pflege ich bei solchen<br />
Diskussionen unsere Heimatgeschichte <strong>in</strong> das Gedächtnis<br />
zu rufen mit dem H<strong>in</strong>weis, daß wir uns Allersberg <strong>in</strong><br />
10 Jahren vorstellen sollten und wir im Jahre 2004 unsere<br />
750-Jahrfeier haben werden.<br />
Die geplante ICE-Strecke läßt das Geme<strong>in</strong>degebiet<br />
näher zusammenrücken. Die Verbesserung des Arbeitsplatzangebotes<br />
muß unser Ziel se<strong>in</strong>, z. B. durch Ausweisung<br />
e<strong>in</strong>es neuen Gewerbegebietes westlich der Autobahn.<br />
Hierzu und für Vorbereitung und Umsetzung der<br />
Umgehungsstraßen brauchen wir ganz gezielt die Bodenordnung<br />
durch die Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>.<br />
Unsere jetzigen Gewerbegebiete liegen alle am östlichen<br />
Ortsrand von Allersberg. Sozusagen e<strong>in</strong>e Drehung um<br />
180° — warum nicht?!<br />
Schlußfolgerungen<br />
In me<strong>in</strong>er kurzen Amtszeit als Bürgermeister habe ich<br />
schon dieselbe Erfahrung gemacht wie <strong>in</strong> me<strong>in</strong>em vorherigen<br />
Beruf. Aufbauend auf e<strong>in</strong>er querschnittsorientierten<br />
Berufsausbildung sollten die für den ländlichen Raum<br />
Verantwortlichen bereit se<strong>in</strong>, mit anderen Menschen<br />
zusammenzuarbeiten. So können beide vone<strong>in</strong>ander profitieren.<br />
Hilfe von außen mit unverstelltem Blick wird<br />
immer bedeutungsvoller bei der Wegsuche und Entscheidungsf<strong>in</strong>dung.<br />
Ich will diese Vorgehensweise, die das<br />
eigene Handeln h<strong>in</strong>terfragt, als Supervision bezeichnen.<br />
Sie kann nur dann gel<strong>in</strong>gen, wenn wir uns vorbehaltlos<br />
und offen begegnen.<br />
Beispiele:<br />
• Erstellung unseres neuen Geme<strong>in</strong>deprospektes<br />
• Konzeption e<strong>in</strong>es Waldmuseums und e<strong>in</strong>es<br />
Infozentrums <strong>in</strong> Allersberg<br />
• Gestaltung der Spielfläche e<strong>in</strong>es K<strong>in</strong>dergartens<br />
• Planungskonferenz auf Geme<strong>in</strong>deebene mit Behörden,<br />
Verbänden und Vere<strong>in</strong>en u. a. mit dem Ziel, Verbündete<br />
zu suchen und geme<strong>in</strong>same Prioritäten zu setzen<br />
• Stellungnahmen von Behörden werden höher gewichtet,<br />
als die e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de; so erlebt am Beispiel<br />
Planfeststellungsverfahren ICE-Trasse.<br />
Prioritäten:<br />
• Ich denke, daß manche Planung und Investition auf<br />
ihre gundsätzliche Notwendigkeit und zeitliche Dr<strong>in</strong>glichkeit<br />
neu h<strong>in</strong>terfragt werden muß. Wir <strong>in</strong> Allersberg<br />
müssen manches Wünschenswerte zurückstellen, z. B.<br />
die Erweiterung der E<strong>in</strong>fachturnhalle zur Dreifachturnhalle.<br />
• Manche geplante Investiton wird derzeit ganz neu<br />
überdacht, so z. B. der geplante Neubau e<strong>in</strong>es Feuerwehrhauses<br />
<strong>in</strong> Allersberg. Die standortbed<strong>in</strong>gten<br />
Mehrkosten s<strong>in</strong>d nicht tragbar und so müssen wir<br />
e<strong>in</strong>en neuen Standort suchen.<br />
• Mehr und mehr Arbeiten werden durch den geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Bauhof ausgeführt, so z. B. die Außengestaltung<br />
der Freifläche e<strong>in</strong>es K<strong>in</strong>dergartens. Ich weiß, daß hierdurch<br />
dem örtlichen Bauhandwerk Aufträge entgehen.<br />
• Insgesamt s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>fachere und kostengünstigere<br />
Lösungen angezeigt. Auf der Suche nach diesen<br />
Lösungen ist unsere Kreativität und Beweglichkeit<br />
gefordert.<br />
• Der Faktor Zeit sollte bei aller Tageshektik nicht vergessen<br />
werden. E<strong>in</strong> gutes Beispiel hierfür ist die <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> der freien Flur. In Allersberg laufen seit<br />
1978 drei Verfahren nach dem FlurbG; für zwei ist<br />
noch ke<strong>in</strong> Ende <strong>in</strong> Sicht. Für die Grundstückseigentümer<br />
sicherlich unbefriedigend, für uns als Geme<strong>in</strong>de<br />
nicht.<br />
Bei dem erwähnten mehrschichtigen Umstrukturierungsprozeß<br />
ist für uns e<strong>in</strong>e Begleitung durch die<br />
Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> unverzichtbar. Wir<br />
brauchen sie auch über die normale Laufzeit e<strong>in</strong>es<br />
Verfahrens h<strong>in</strong>aus, um die großen Planungen, die uns von<br />
außen auferlegt werden, planerisch und bodenordnerisch<br />
zu bewältigen. Dabei könnte für mich der Dienst der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> als der e<strong>in</strong>es Moderators <strong>in</strong> ländlichen<br />
Gebieten verstanden werden.<br />
108 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Walter Lohmeier<br />
<strong>Ländliche</strong> Räume — <strong>in</strong>novative<br />
Wirtschaftsstandorte mit<br />
Zukunft?<br />
Begrüßung<br />
In e<strong>in</strong>em Aufsatz <strong>in</strong> »Dorf International« vom April dieses<br />
Jahres schreibt Dr. Baltasar Huber von der Kommission<br />
der Europäischen Geme<strong>in</strong>schaft <strong>in</strong> Brüssel, daß<br />
»die moderne Industriegesellschaft nicht unbeachtliche<br />
Chancen zur <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume« biete.<br />
In diesem Zusammenhang wird auf fünf Aspekte nachdrücklich<br />
h<strong>in</strong>gewiesen:<br />
• der tertiäre Sektor mit se<strong>in</strong>en hohen Zuwachsraten sei<br />
weniger standortgebunden,<br />
• die weichen Standortfaktoren wie Freizeit und Umwelt<br />
nehmen an Bedeutung zu,<br />
• Unternehmen wie Menschen seien zunehmend mobil,<br />
• die <strong>in</strong>dustrielle Produktion sei durch zunehmend<br />
verr<strong>in</strong>gerte Produktionstiefe geprägt, und<br />
• die Großstädte müßten immer stärker mit ihren<br />
sozialen Folgekosten fertig werden.<br />
Bereits Anfang der 70er Jahre habe ich mich selbst und<br />
dann <strong>in</strong> Folge weiter mit den Zusammenhängen zwischen<br />
landwirtschaftlicher Umstrukturierung und <strong>in</strong>dustriellgewerblicher<br />
<strong>Entwicklung</strong> befaßt. Damals übrigens <strong>in</strong> fast<br />
Wohn- und häufig Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft mit unserem<br />
jetzigen Bundesm<strong>in</strong>ister für Landwirtschaft, Dr. Jochen<br />
Borchert. Heute b<strong>in</strong> ich stärker und <strong>in</strong> verschiedener<br />
Weise <strong>in</strong> Standortprojekte e<strong>in</strong>gebunden, bei denen es<br />
immer wieder um die Um- und Neustrukturierung e<strong>in</strong>es<br />
Raumes geht, aktuell besonders <strong>in</strong> Schwe<strong>in</strong>furt.<br />
Standort ländlicher Raum<br />
Zu den e<strong>in</strong>gangs zitierten Thesen von Herrn Dr. Huber<br />
kann ich dementsprechend aus vielfältiger Erfahrung feststellen:<br />
Ja, das alles trifft zu. Die gesellschaftlichen, ökonomischen<br />
und auch die technologischen <strong>Entwicklung</strong>sl<strong>in</strong>ien<br />
bieten e<strong>in</strong>e Fülle von Chancen für das Land.<br />
Gleichwohl weist jede Statistik heute e<strong>in</strong>dr<strong>in</strong>glich nach,<br />
daß die wirtschaftliche Dynamik ungebrochen <strong>in</strong> den<br />
Ballungsräumen viel ausgeprägter ist als auf dem Land,<br />
<strong>in</strong>sbesondere gegenüber den peripheren Räumen. Wir<br />
f<strong>in</strong>den zwar <strong>in</strong>zwischen auch <strong>in</strong> ausschließlich ländlichen<br />
Regionen high-tech-Produktionen, also solche mit e<strong>in</strong>em<br />
Forschungsanteil von über zehn Prozent, sogar Forschungse<strong>in</strong>richtungen<br />
und auch anspruchsvolle Dienstleistungen.<br />
Das alles aber s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>sgesamt eher die Ausnahmen.<br />
Landwirtschaft und Fremdenverkehr und auch <strong>in</strong><br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
breitem Maße arbeits<strong>in</strong>tensive Industrie kennzeichnen<br />
heute die ländlichen Räume <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>zugsbereichen von<br />
Mittel- und Unterzentren.<br />
Rezession und ländlicher Raum<br />
Die aktuelle wirtschaftliche Rezession, <strong>in</strong>sbesondere<br />
aber der zunehmende Druck auf den Industriestandort<br />
Deutschland überhaupt, ist <strong>in</strong> regional differenzierter<br />
Sicht vor allem e<strong>in</strong> Problem des ländlichen Raumes.<br />
Würde die <strong>in</strong>dustrielle Beschäftigungssituation <strong>in</strong><br />
Bayern weiter <strong>in</strong> dem Maße zurückgenommen, wie wir<br />
das <strong>in</strong> den letzten zwei Jahren erleben, würde dies fraglos<br />
auch <strong>in</strong> München, Nürnberg und Augsburg deutliche<br />
Spuren h<strong>in</strong>terlassen, für den Raum Marktredwitz, für<br />
weite Teile Oberfrankens und Niederbayerns oder auch<br />
hier für Westmittelfranken wäre das e<strong>in</strong>e schlichte<br />
Katastrophe.<br />
Industrie und ländlicher Raum<br />
Der ländliche Raum bildet heute bei uns den dom<strong>in</strong>ierenden<br />
Standort für <strong>in</strong>dustrielle Aktivitäten überhaupt.<br />
München oder Würzburg beschäftigen gerade noch rund<br />
12 Prozent ihrer Erwerbstätigen im <strong>in</strong>dustriellen Sektor,<br />
im Landkreis Ma<strong>in</strong>-Spessart s<strong>in</strong>d es demgegenüber nahezu<br />
60 Prozent.<br />
Innerhalb des <strong>in</strong>dustriellen Sektors wiederum ist der<br />
ländliche Raum dadurch geprägt, daß er vergleichsweise<br />
arbeits<strong>in</strong>tensive Produktionen kennt. So liegen beispielsweise<br />
die durchschnittlichen <strong>in</strong>dustriellen Umsätze je<br />
Beschäftigten <strong>in</strong> den Landkreisen unseres ma<strong>in</strong>fränkischen<br />
Kammerbezirks um nahezu 40 Prozent unter dem<br />
Bundesniveau. Das bedeutet:<br />
• Die <strong>in</strong>ternationale kostenorientierte <strong>in</strong>dustrielle<br />
Standortkonkurrenz betrifft <strong>in</strong>sgesamt die kle<strong>in</strong>en und<br />
ländlichen Standorte viel stärker als die im Schnitt<br />
kapital<strong>in</strong>tensiveren Industrien <strong>in</strong> den Agglomerationen.<br />
Arbeits<strong>in</strong>tensive Produktionen haben <strong>in</strong> den 60er und<br />
70er Jahren erheblich dazu beigetragen, die aus der<br />
Landwirtschaft kommenden Erwerbswilligen <strong>in</strong> großer<br />
Zahl überhaupt aufzunehmen. Jetzt s<strong>in</strong>d gerade diese<br />
Unternehmen e<strong>in</strong>er besonderen Konkurrenz aus<br />
Tschechien oder Ungarn ausgesetzt.<br />
• Der Rationalisierungsdruck muß natürlich umso stärker<br />
ausfallen, je höher die Lohnkostenanteile an der<br />
Produktion s<strong>in</strong>d.<br />
• Seit Jahren wachsen <strong>in</strong> der Beschäftigung <strong>in</strong>nerhalb<br />
des <strong>in</strong>dustriellen Sektors eigentlich nurmehr die vergleichsweise<br />
kapital<strong>in</strong>tensiven Bereiche.<br />
Sie sehen, die Industrie, die den ländlichen Raum überwiegend<br />
charakterisiert, ist hochgradig gefährdet. Und<br />
dann gibt es noch viele verme<strong>in</strong>tlich kluge Köpfe, die auch<br />
bereits hierzulande glauben, absehbar ohneh<strong>in</strong> ganz ohne<br />
Industrie auszukommen. Das s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> aller Regel diejenigen,<br />
die <strong>in</strong> Frankfurter Bürotürmen die post<strong>in</strong>dustrielle<br />
Welt feststellen und, wenn sie zum Schöppeln nach<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
109
Sommerhausen kommen glauben, ganz Unterfranken<br />
müsse doch im wesentlichen von We<strong>in</strong>, Fremdenverkehr<br />
und Urlaub leben.<br />
Umstrukturierung<br />
Von der Industrie- zur Informations- und Dienstleistungsgesellschaft<br />
Wir bef<strong>in</strong>den uns mittendr<strong>in</strong> im Stadium der Umstrukturierung<br />
von der Industrie- zur Informations- und<br />
Dienstleistungsgesellschaft. Der Dienstleistungssektor ist<br />
seit Jahren tatsächlich der e<strong>in</strong>zig auch <strong>in</strong> der Beschäftigung<br />
wachsende. Darüberh<strong>in</strong>aus aber nimmt die<br />
Industrie selbst immer mehr Dienstleistungsmerkmale an.<br />
So s<strong>in</strong>d heute <strong>in</strong> vielen Industrieunternehmen vielleicht<br />
noch 30 oder 40 Prozent der Beschäftigten mit der<br />
eigentlichen Produktion befaßt, die Mehrheit aber mit<br />
Forschung und <strong>Entwicklung</strong>, Market<strong>in</strong>g, After-Sales-<br />
Service, Wartung, Schulungen und Weiterbildung.<br />
Diese <strong>Entwicklung</strong>stendenz wiederum zeigt sich besonders<br />
ausgeprägt <strong>in</strong> den sogenannten high-tech-Industrien,<br />
der Informationsverarbeitung, der Mikroelektronik,<br />
der Mediz<strong>in</strong>technik, der Biotechnologie und bei den neuen<br />
Werkstoffen. In diesen besonders stark wachsenden Industriebranchen<br />
bekommen technologische <strong>Entwicklung</strong>en<br />
erst durch die Software, durch ihre anwendungsorientierte<br />
Adaption e<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n und werden spezifisch.<br />
Beispiel: die digitale Bildverarbeitung, die e<strong>in</strong>e typische<br />
Querschnittstechnologie ist und erst durch spezielle<br />
Anwendungen <strong>in</strong> der Fertigungstechnik oder <strong>in</strong> der mediz<strong>in</strong>ischen<br />
Diagnostik e<strong>in</strong>e Marktrealisierung erfährt.<br />
Selbst technische Innovationen s<strong>in</strong>d heute <strong>in</strong> aller Regel<br />
sehr rasch zu imitieren, sie unterliegen <strong>in</strong> immer kürzeren<br />
Zyklen e<strong>in</strong>em enormen Preisdruck (siehe PC). Marktstärke<br />
gew<strong>in</strong>nen die Unternehmen im Grunde e<strong>in</strong>zig durch die<br />
E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung ihrer technischen <strong>Entwicklung</strong>en <strong>in</strong> hoch<strong>in</strong>telligente<br />
und möglichst komplexe Dienstleistungsverbünde.<br />
E<strong>in</strong> konkretes Fallbeispiel dazu: Ich b<strong>in</strong> derzeit u. a.<br />
auch damit befaßt, mit Vobis <strong>in</strong> Aachen über die regionale<br />
Plazierung e<strong>in</strong>er ggf. neuen Tochtergesellschaft zu sprechen,<br />
deren wesentliches und <strong>in</strong>novatives Softwareprodukt<br />
der »elektronische Hausmeister« ist. Im Grunde geht<br />
es dabei um die <strong>in</strong>formationstechnische Zusammenb<strong>in</strong>dung<br />
verschiedener Überwachungs- und Sensoriklösungen.<br />
Aber die eigentliche wirtschaftliche Dynamik wird<br />
schon jetzt absehbar nur zum kle<strong>in</strong>eren Teil <strong>in</strong> der Softwarelösung<br />
selbst liegen und viel stärker <strong>in</strong> damit verbundenen<br />
Dienstleistungen für kle<strong>in</strong>e Unternehmen, S<strong>in</strong>gle-<br />
Haushalte und was sonst noch als Zielgruppe für e<strong>in</strong> solches<br />
Projekt denkbar ist.<br />
Integration von Dienstleistung und Industrie<br />
Ich möchte mit diesen Beobachtungen deutlich<br />
machen, daß es gar nicht um die Schwarz-Weiß-Entscheidung<br />
Dienstleistungen oder Industrie geht. Richtig<br />
ist vielmehr, daß Dienstleistungen und Industrie immer<br />
stärker <strong>in</strong>tegriert werden, e<strong>in</strong> Phänomen, das übrigens<br />
auch für die Branchen- und Technologiespezialisierungen<br />
gilt. In den beiden Technologiezentren <strong>in</strong> Würzburg und<br />
Schwe<strong>in</strong>furt, die ich verantwortlich führe, ist es mir überwiegend<br />
nicht mehr möglich, die jungen hochtechnologieorientierten<br />
Unternehmen e<strong>in</strong>deutig bestimmten<br />
Branchen zuzuordnen. Flexible Ausrichtungen auf sogenannte<br />
Technik-Schnittstellen s<strong>in</strong>d die Regel.<br />
Für die Förderpolitik <strong>in</strong> Bayern und auch auf Bundesund<br />
europäischer Ebene ist es allerhöchste Zeit, massiv<br />
diese Veränderungsprozesse zu unterstützen. Die klassische<br />
Industrieausrichtung der GA-Förderung, wie sie<br />
beispielsweise jetzt <strong>in</strong> Schwe<strong>in</strong>furt wieder möglich ist, ist<br />
eigentlich e<strong>in</strong> erfolgreiches Instrument von gestern, als<br />
die Förderung arbeits<strong>in</strong>tensiver Produktionen die allererste<br />
Priorität haben mußte.<br />
Innovationsschub und ländlicher Raum<br />
Die Zukunft auf den regionalen ebenso wie auf den<br />
Weltmärkten gehört den Unternehmen, die möglichst<br />
rasch <strong>in</strong>novative Produkte mit <strong>in</strong>novativen Prozessen herstellen<br />
und diese mit e<strong>in</strong>em Kranz von Dienstleistungen<br />
mit starker Kundenb<strong>in</strong>dung auf neuen Märkten plazieren<br />
können.<br />
Auf diesen Innovationsschub hat sich e<strong>in</strong>e Politik für<br />
den ländlichen Raum sofort und mit aller Kraft e<strong>in</strong>zustellen.<br />
Es geht dabei um die Fragen, <strong>in</strong>wieweit technologischer<br />
und wirtschaftlicher Fortschritt <strong>in</strong> welcher Weise<br />
Veränderungen im <strong>Stadt</strong>-Land-Gefüge herbeiführen bzw.<br />
wie dies erreicht werden kann.<br />
Optimistische Hypothesen und skeptische<br />
Erfahrungen<br />
Seit man sich <strong>in</strong> etwa mit Beg<strong>in</strong>n der 70er Jahre<br />
zunächst wissenschaftlich und dann auch praktisch <strong>in</strong>tensiv<br />
mit den Zusammenhängen zwischen der technologischen<br />
und der räumlichen <strong>Entwicklung</strong> befaßt hat, mußten<br />
überwiegend skeptische Erfahrungen mit Blick auf die<br />
<strong>Entwicklung</strong> ländlicher Räume gemacht werden.<br />
Erfahrungen, die leider im Gegensatz zu verschiedenen<br />
Mutmaßungen und Hypothesen stehen, über die sich<br />
gerade der periphere ländliche Raum eigentlich hätte<br />
freuen müssen.<br />
Die Dienstleistungsmotorik der Wirtschaft, die extrem<br />
wachsende Bedeutung der Information und Telekommunikation,<br />
die M<strong>in</strong>iaturisierungstendenzen <strong>in</strong> den Technologien<br />
und auch die Schaffung von Hochgeschw<strong>in</strong>digkeitsnetzen<br />
wie überhaupt die leistungsfähigere Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur<br />
wirkten und wirken weiterh<strong>in</strong> tendenziell<br />
raumüberw<strong>in</strong>dend und tragen sogar grundsätzliche Züge<br />
e<strong>in</strong>er quasi Enträumlichung der Wirtschaft <strong>in</strong> sich. Das<br />
heißt, mit dem hohen Gewicht des Dispositionsfaktors<br />
Information und der Allverfügbarkeit gerade dieses kostbaren<br />
Gutes <strong>in</strong> jeden W<strong>in</strong>kel unseres Landes könnten die<br />
Steuerungszentralen von MBB oder von Höchst doch<br />
genausogut <strong>in</strong> Mellrichstadt oder Regen sitzen wie <strong>in</strong><br />
München oder <strong>in</strong> Frankfurt.<br />
110 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Tatsächlich wissen wir alle, daß die <strong>Entwicklung</strong> sich<br />
so nicht darstellt. Es s<strong>in</strong>d immer noch die eher e<strong>in</strong>fachen<br />
Produktionen, die Werkbänke, die an ländlichen Standorten<br />
anzutreffen s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong> Beispiel aus me<strong>in</strong>er Heimat:<br />
In Grettstadt f<strong>in</strong>det sich die größte Produktionsstätte von<br />
Messmer-Tee, die Unternehmensleitung hat aber weiter<br />
ihren Sitz <strong>in</strong> Frankfurt.<br />
Oder nehmen Sie das Beispiel Behördenverlagerung.<br />
E<strong>in</strong>zig und alle<strong>in</strong> die Bundeswehr wie überhaupt Militärstandorte<br />
haben den ländlichen Raum immer begünstigt,<br />
mit der heute wiederum fatalen Folge, daß die schwierigsten<br />
Konversionsfälle eben <strong>in</strong> der Rhön oder der Oberpfalz<br />
anzutreffen s<strong>in</strong>d, woh<strong>in</strong>gegen der Run auf die neuen<br />
Verfügungsmassen <strong>in</strong> den Oberzentren <strong>in</strong> aller Regel noch<br />
nicht mal annähernd für e<strong>in</strong>e gewerbliche Förderung<br />
genutzt wurde.<br />
Das Sozialgericht kommt ja jetzt auch nur <strong>in</strong> kle<strong>in</strong>eren<br />
Teilen nach Schwe<strong>in</strong>furt. Man kann über alle diese E<strong>in</strong>zelfälle<br />
sehr berechtigt diskutieren. Nur: unterm Strich ist<br />
auch die Behördenverlagerung wohl niemals zu e<strong>in</strong>em<br />
ernsthaften Instrument der Dezentralisierung zugunsten<br />
der peripheren Räume geworden.<br />
E<strong>in</strong> Sogeffekt <strong>in</strong> Richtung <strong>in</strong>novativer und anspruchsvoller<br />
Unternehmen hätte aber ohne weiteres von den<br />
ländlichen Standorten ausgehen müssen: die Wirkung<br />
der sogenannten weichen Standortfaktoren Umwelt,<br />
Wohnungsqualität, vielleicht auch Freizeitwert.<br />
Gewirkt haben diese Merkmale aber wohl nur im unmittelbaren<br />
Umkreis der Ballungen und Oberzentren. Die<br />
Randgeme<strong>in</strong>den Münchens oder Würzburgs s<strong>in</strong>d heute<br />
die typschen regionalen Gew<strong>in</strong>ner der Neuverteilung von<br />
Menschen und unternehmerischen Aktivitäten im Raum.<br />
Von10 neuen Arbeitsplätzen, die <strong>in</strong> den letzten 10 Jahren<br />
<strong>in</strong> <strong>Stadt</strong> und Landkreis Würzburg entstanden, entfielen<br />
beispielsweise 9 auf die sogenannten Kragengeme<strong>in</strong>den.<br />
Die Erwerbsquote im Landkreis Würzburg ist um knapp<br />
10 Prozentpunkte höhere als <strong>in</strong> der <strong>Stadt</strong>. Es gibt also<br />
auch sehr gute <strong>Entwicklung</strong>sl<strong>in</strong>ien im Stand-Land-Vergleich,<br />
aber eben nur im unmittelbaren E<strong>in</strong>zugsbereich der<br />
Städte selbst. Diese me<strong>in</strong>en wir aber eben nicht, wenn wir<br />
der Frage nach gehen, wie wir aus ländlichen Standorten<br />
hochattraktive <strong>in</strong>novative Wirtschaftsstandorte werden<br />
lassen können.<br />
Um Instrumente für e<strong>in</strong>e stärkere Innovationsorientierung<br />
und Beteiligung der ländlichen Standorte an<br />
den positiven Folgen der Technologieveränderung zu<br />
gew<strong>in</strong>nen, ist es zuerst notwendig, die Hemmnisse zu<br />
betrachten und dann nachfolgend abzubauen, die bislang<br />
offensichtlich dafür verantwortlich s<strong>in</strong>d, daß der technische<br />
Fortschritt und die wirtschaftliche Umstrukturierung<br />
praktisch zu ke<strong>in</strong>er nennenswerten Begünstigung<br />
kle<strong>in</strong>erer und peripherer Standorte führt.<br />
Wachstumsressorcen gibt es überall<br />
Die positive Chance lautet: Jede Technologie ist heute<br />
an praktisch jedem Raumpunkt realisierbar. Die Fabrik<br />
der Zukunft, CIM, oder hochmoderne just-<strong>in</strong>time-Kon-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
zepte, lassen sich zwar erfolgreich <strong>in</strong> unmittelbarer<br />
Nachbarschaft von BMW <strong>in</strong> Regensburg darstellen, es gibt<br />
aber auch jede Menge Beispiele für gute logistische<br />
Konzepte, bei denen durchaus große räumliche Entfernungen<br />
überwunden werden. Weder die Technik selbst<br />
noch betriebswirtschaftliche Organistation begünstigt die<br />
räumliche Ballung wirtschaftlicher Aktivitäten.<br />
Die physische Verfügbarkeit von Menschen, Produkten<br />
und Leistungen ist räumlich breit gestreut. Peripherie und<br />
damit Ferne von wirtschaftlichen Attraktivitäten ist nicht<br />
mehr e<strong>in</strong> großräumliches Phänomen des Emslandes oder<br />
Ostbayerns, sondern zunehmend e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>räumliches.<br />
Die Peripherie ist überall bei uns, nämlich rund zwanzig<br />
Kilometer abseits der Bundesautobahnen. Je dichter diese<br />
große Verkehrs<strong>in</strong>frastruktur bei uns gestrickt wird, umso<br />
stärker s<strong>in</strong>d die Räume ausgegrenzt, die nicht mehr unmittelbar<br />
dar<strong>in</strong> verwoben s<strong>in</strong>d.<br />
Die Raumüberw<strong>in</strong>dungstechnologien Information und<br />
(Tele)-Kommunikation s<strong>in</strong>d tatsächlich überall latent<br />
e<strong>in</strong>setzbar. Selbst der Verkabelungsdruck mit der teueren<br />
Infrastruktur hat eher nachgelassen angesichts verbesserter<br />
Satellitentechnik. Und, die Nutzeroberflächen, die<br />
dazugehörige Geräteperipherie ist sehr preiswert geworden.<br />
Ohne Ausnahme s<strong>in</strong>d alle Kommunikations<strong>in</strong>strumente,<br />
die Siemens noch vor 7 Jahren <strong>in</strong> großen Chonta<strong>in</strong>erlastwagen<br />
an verschiedenen Standorten der staunenden<br />
Öffentlichkeit demonstrierte, heute schon so<br />
selbstverständlich und z. T. bereits auf privater Ebene<br />
bezahl- und damit e<strong>in</strong>setzbar, daß beispielsweise e<strong>in</strong><br />
Informationsbroker se<strong>in</strong> weltweites Datenbankgeschäft<br />
genauso von Nordschwaben aus wahrnehmen kann wie<br />
von München oder Düsseldorf.<br />
Ballung als Standortvorteil sui generis<br />
Was führt dann aber dazu, daß <strong>in</strong> den Ballungen nicht<br />
nur mehr neue Unternehmen der Informationsverarbeitung<br />
und der Kommunikationstechnik entstehen als an<br />
ländlichen Standorten, sondern dies sogar weit überproportional<br />
zur Bevölkerungsdichte der Fall ist? E<strong>in</strong> Problem,<br />
übrigens sogar für kle<strong>in</strong>ere Oberzentren wie Würzburg. In<br />
Frankfurt, das rund fünfmal so groß ist wie Würzburg,<br />
gibt es eben nicht nur fünfmal so viele high-tech-Existenzgründer,<br />
sondern rund 20 mal soviele. Das ist natürlich<br />
mehr als bedenkenswert.<br />
Die Erklärung für all diese Phänomene, die ke<strong>in</strong>en<br />
erfreuen können, der sich nachhaltig für die kle<strong>in</strong>eren<br />
Geme<strong>in</strong>den und Städte e<strong>in</strong>setzt, kann mit Synergie umschrieben<br />
werden. Die Dichte selbst ist der wichtigste ökonomische<br />
Vorteil der Ballungszentren überhaupt. Die<br />
Dichte an wirtschaftlich relevanter Infrastruktur, die<br />
Dichte an unternehmerischen Aktivitäten und allen voran<br />
die Dichte an Menschen und damit an potentiellen Mitarbeitern<br />
und Konsumenten.<br />
Auf der Angebotsseite ist die Vergügbarkeit von erwerbsfähigen<br />
Menschen <strong>in</strong> großer Zahl und mit höheren<br />
und verschiedenen Qualifikationen der räumlich wichtigste<br />
Entscheidungsfaktor für Unternehmenswachstum,<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
111
-verlagerung, -ansiedlung oder -neugründung. Auf der<br />
Nachfrageseite gilt dies analog im H<strong>in</strong>blick auf den Konsum,<br />
vor allem aber mit Blick auf notwendige M<strong>in</strong>destschwellen<br />
von Nutzungsgraden bestimmter Dienstleistungen.<br />
Sie können <strong>in</strong> den großen Städten praktisch jede<br />
Infrastruktur rasch auslasten. Angesichts der immer höheren<br />
Vorlauf<strong>in</strong>vestitionen bei neuen wirtschaftlich relevanten<br />
E<strong>in</strong>richtungen ist die absehbare Effizienz des E<strong>in</strong>satzes<br />
von allergrößter Bedeutung.<br />
Diese Erkenntnis läßt leicht nachvollziehen, warum<br />
selbst die Tante-Emma-Läden aus den Dörfern verschwunden<br />
s<strong>in</strong>d und diese Strukturen <strong>in</strong> Ostdeutschland<br />
erst gar nicht mehr entstehen. Sie macht aber vor allem<br />
deutlich, daß e<strong>in</strong>e spezifische Wirtschaftspolitik für den<br />
ländlichen Raum notwendig ist, wenn auch dort <strong>in</strong>novative<br />
Industrien und Dienstleistung morgen stattf<strong>in</strong>den sollen<br />
und der ländliche Raum nicht auf den Status großflächiger<br />
Biospährenreservate zurückfallen soll.<br />
Wie kann man also <strong>in</strong> den Dörfern und kle<strong>in</strong>eren<br />
Städten <strong>in</strong>novative Unternehmen e<strong>in</strong>fangen, wenn die<br />
Landwirtschaft oder der Fremdenverkehr alle<strong>in</strong> nicht ausreichen,<br />
Abwanderungen nachhaltig zu verh<strong>in</strong>dern?<br />
Konkrete Empfehlungen für e<strong>in</strong> <strong>in</strong>novatives<br />
Standortmanagement<br />
1. Die Geme<strong>in</strong>den müssen sich selbst unter die Lupe nehmen,<br />
d. h. im Gespräch mit den E<strong>in</strong>wohnern quasi e<strong>in</strong><br />
check-up wie beim Internisten durchführen. Diese<br />
Prozesse können durch externe Fachleute unterstützt<br />
bzw. moderiert werden.<br />
2. Die Geme<strong>in</strong>den müssen dann über die Eigendiagnose<br />
zu e<strong>in</strong>er mehr normativen Positionierung gelangen, so<br />
ähnlich wie beim Städteleitbild. Es muß e<strong>in</strong> Konsens<br />
darüber gefunden werden, wie man sich künftig entwickeln<br />
will. Der Wille ist dabei durchaus genauso<br />
wichtig, wie das Potential, da letzteres durchaus <strong>in</strong> viel<br />
größerem Maße bee<strong>in</strong>flußbar und veränderbar ist als<br />
viele zunächst glauben.<br />
3. Geme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> ländlichen Räumen müssen Standortgeme<strong>in</strong>schaften<br />
bilden und damit dezentrale, kle<strong>in</strong>räumliche<br />
Konzentrationen ermöglichen. Das ist notwendig,<br />
um Kosten überhaupt bewältigen zu können,<br />
um vor allem aber M<strong>in</strong>destattraktivitätsschwellen zu<br />
überschreiten und auch kle<strong>in</strong>e Sogeffekte zu stärker<br />
bündeln zu können.<br />
Schon im Umfeld der größeren Städte s<strong>in</strong>d die kle<strong>in</strong>räumliche<br />
Konkurrenz und die vielen Abgrenzungen<br />
der Geme<strong>in</strong>den e<strong>in</strong>e unglückliche Geschichte. In häufig<br />
nicht zu eigenständigen Multiplikatoreffekten führen.<br />
Negativbeispiel dafür s<strong>in</strong>d viele Geme<strong>in</strong>den bei unseren<br />
Nachbarn <strong>in</strong> den neuen Bundesländern. Wenn e<strong>in</strong><br />
Unternehmen nicht aus eigener Kraft alle für e<strong>in</strong>e<br />
<strong>Entwicklung</strong> notwendigen Ressourcen selbst darstellen<br />
kann, sucht es Kooperationspartner. Auf geme<strong>in</strong>dlicher<br />
Ebene ist das m<strong>in</strong>destens genauso notwendig.<br />
4. Für e<strong>in</strong>e erfolgreiche übergeme<strong>in</strong>dliche Zusammenarbeit<br />
bei Standortprojekten s<strong>in</strong>d neue Formen des<br />
F<strong>in</strong>anzausgleichs und auch der sonstigen Lastenverteilung<br />
notwendig. Die rechtlichen Spielräume dafür<br />
s<strong>in</strong>d größer als es angesichts der Nichtnutzung sche<strong>in</strong>t.<br />
5. <strong>Ländliche</strong> Geme<strong>in</strong>den brauchen <strong>in</strong> besonderem Maße<br />
e<strong>in</strong> standortspezifisches Projektmanagement. Projektmanagement<br />
bedeutet, daß e<strong>in</strong> gewerblicher<br />
Standort mit ganz spezifischen Zielen, Schwerpunkten<br />
und besonderen Infrastrukturen entwickelt wird, also<br />
weitaus mehr geschieht als nur e<strong>in</strong> Gewerbe- oder<br />
Industriegebiet auszuweisen. Projektmanagement<br />
erfordert <strong>in</strong>tegriertes Handeln der Kommune, der politischen<br />
Mitstreiter, externer Fachberater und möglichst<br />
auch von privaten Unternehmen selbst.<br />
Warum ist Projektmanagement so wichtig?<br />
Weil zunehmend für die Attraktivität e<strong>in</strong>es Mikrostandortes<br />
nicht nur die quasi objektiv am Ort gegebenen<br />
Standortbed<strong>in</strong>gungen wie Lage, Klima, Größe usw.<br />
wesentlich werden, sondern das spezifische Standortkonzept<br />
selbst. So erzielen wir beispielsweise im Schwe<strong>in</strong>furter<br />
GRIBS, e<strong>in</strong>em Gründer- und Innovationszentrum<br />
jetzt bereits teilweise höhere Mieten als im Schwe<strong>in</strong>furter<br />
Durchschnitt über e<strong>in</strong>e besondere Projektattraktivität, und<br />
das, obwohl <strong>in</strong>sgesamt e<strong>in</strong> Überangebot an Büro- und<br />
Gewerbeflächen gegeben ist. Aber: gute Mikrostandorte<br />
mit <strong>in</strong>telligenten <strong>Entwicklung</strong>skonzepten s<strong>in</strong>d nach wie<br />
vor die absolute Ausnahme. So werden bisher nur rund<br />
1 Promille aller Neuansiedlungen der gewerblichen<br />
Wirtschaft <strong>in</strong> sogenannten Gewerbeparks realisiert.<br />
Wie können <strong>in</strong>novative Projekte auf dem Land<br />
aussehen?<br />
Grundsätzlich gilt nur die Forderung, daß sie auch ohne<br />
Dauersubventionen realisierbar se<strong>in</strong> müssen und im E<strong>in</strong>klang<br />
mit dem ländlichen Standort zu stehen haben. Diese<br />
Restriktionen dürften aber <strong>in</strong> vielen Fällen zu erfüllen se<strong>in</strong>.<br />
Projektbeispiele<br />
1. Gewerbeparke und spezialisierte Mikrostandorte.<br />
Der Gewerbepark unterscheidet sich vom normalen<br />
Gewerbe- oder Industriegebiet dadurch, daß er e<strong>in</strong>e<br />
weitergehende geme<strong>in</strong>same Infrastruktur bereithält,<br />
damit verbunden unternehmensübergreifende wirtschaftliche<br />
Nutzungen vorsieht. Das kann Parkplätze<br />
ebenso wie Tagungse<strong>in</strong>richtungen betreffen. Der<br />
Gewerbepark versieht sich <strong>in</strong> aller Regel mit e<strong>in</strong>em<br />
besonderen Image und auch, neuhochdeutsch, mit<br />
e<strong>in</strong>em besonderen geme<strong>in</strong>samen Image. In den USA<br />
gehen <strong>in</strong>zwischen 80 Prozent aller Unternehmensansiedlungen<br />
<strong>in</strong> solche besonders entwickelte Standorte,<br />
<strong>in</strong>sbesondere auch abseits der Ballungskerne. In der<br />
Regel kümmert sich e<strong>in</strong>e Betreibergesellschaft, die von<br />
112 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
den anzusiedelnden Unternehmen f<strong>in</strong>anziert wird, um<br />
geme<strong>in</strong>same Standortbelange. Tatsächlich s<strong>in</strong>d Gewerbeparks<br />
stets auch viel flächenextensiver und<br />
grüner. Das aber paßt ohneh<strong>in</strong> zum ländlichen Raum,<br />
macht aber ganz besonders wieder die <strong>in</strong>terkommunale<br />
Zusammenarbeit notwendig. E<strong>in</strong> Gewerbepark ist zunächst<br />
deutlich teurer als e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>faches Gewerbegebiet.<br />
Besondere Chancen kommen me<strong>in</strong>er Erfahrung nach<br />
spezialisierten Gewerbeparks zu. Das hört sich zunächst<br />
gerade für kle<strong>in</strong>ere Standorte mit Blick auf e<strong>in</strong><br />
eher ger<strong>in</strong>ges Akquisitionspotential nahezu unmöglich<br />
an, ist es aber nicht. Sie können bei Unternehmensansiedlungen<br />
ohne weiteres die Stecknadel im Heuhaufen<br />
suchen, wenn sie den starken Magneten, und<br />
das heißt hier e<strong>in</strong> spezifisch attraktives Standortkonzept<br />
haben.<br />
Beispiel Tauberrettersheim:<br />
Wir werden dort im ländlichen Süden des Raumes<br />
Würzburg versuchen, gezielt e<strong>in</strong>en ökologisch ausgerichteten<br />
Gewerbepark zu schaffen, der sich synergetisch<br />
<strong>in</strong> die Umgebung e<strong>in</strong>fügt und für den erste<br />
Inkubatorunternehmen bereits gesichtet s<strong>in</strong>d.<br />
E<strong>in</strong>e Bemerkung dazu: Für besondere Standortprojekte<br />
müssen so früh wie möglich, Führungsunternehmen<br />
gefunden werden, die dann selbst aktiv <strong>in</strong> das Standortprojekt<br />
e<strong>in</strong>gebunden werden und damit auch die<br />
Rolle als Mitakquisiteur bekommen.<br />
2. Technologie- und Gründerzentren.<br />
Vor kurzem wurden gerade die Technologie- und<br />
Gründerzentren e<strong>in</strong>zig und alle<strong>in</strong> im S<strong>in</strong>n <strong>in</strong> den<br />
großen Ballungsgebieten als berechtigt erachtet.<br />
Inzwischen zeigen Technologiezentren an mittelgroßen<br />
Standorten, daß es auch dort geht.<br />
S<strong>in</strong>n macht es <strong>in</strong> jedem Fall, Gründerzentren ohne allzu<br />
hohe technologische Meßlatte im ländlichen Raum zu<br />
plazieren. Wir s<strong>in</strong>d selbst dabei, e<strong>in</strong>en solchen Versuch<br />
für Gemünden mitzustarten. Im Würzburger TGZ kommen<br />
immerh<strong>in</strong> über e<strong>in</strong> Drittel der durchaus hightech-Gründer<br />
aus kle<strong>in</strong>en unterfränkischen Dörfern.<br />
E<strong>in</strong> Gründer ist auch e<strong>in</strong> Handwerker, kann auch e<strong>in</strong><br />
Landwirt se<strong>in</strong>, der neue Vermarktungsformen schafft<br />
oder e<strong>in</strong>e andere unternehmerische Verb<strong>in</strong>dung e<strong>in</strong>geht.<br />
Diese Prozesse können im Rahmen der Schaffung<br />
von Gründerzentren moderiert und damit vorangetrieben<br />
werden.<br />
3. Handwerkerhöfe.<br />
Sie machen dann e<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n, wenn es um die geme<strong>in</strong>same<br />
Nutzung kostspieliger technischer Ressourcen<br />
geht, um logistische Kapazitäten. Sie können im besten<br />
Fall geme<strong>in</strong>sam mit jungen Handwerkern an den ländlichen<br />
Standorten selbst konzipiert werden.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Interessierte Zuhörer diskutieren mit<br />
Für alle drei Projekttypen bedarf es aber e<strong>in</strong>es M<strong>in</strong>destmaßes<br />
an Konzentration von Aktivitäten, d. h.<br />
e<strong>in</strong>es entwickelten Gewerbestandortes mit besonderen<br />
Infrastrukturen für junge Unternehmen, vor allem<br />
Existenzgründer und für Handwerker.<br />
Derzeit führe ich im Wirtschaftsm<strong>in</strong>isterium auch<br />
Gespräche <strong>in</strong> der Richtung, doch zum<strong>in</strong>dest zwei oder<br />
drei solcher Projekte gezielt im ländlichen Raum als<br />
Versuchs- und damit Modellprojekte darzustellen.<br />
4. Telehäuser und Telezentren.<br />
Offenbar weil das im ländlichen Schweden so gut<br />
funktionierte, lebt bis heute die Idee fort, mit der<br />
E<strong>in</strong>richtung sogenannter Telehäuser den ländlichen<br />
Raum zu entwickeln. Das hat nach wie vor viel bestechendes<br />
und ist gleichzeitig e<strong>in</strong> schwieriges Unterfangen.<br />
Telehäuser verstehen sich als räumliche<br />
Bündelung von E<strong>in</strong>richtungen zur Nutzung modernster<br />
Telekommunikationsentwicklungen.<br />
Durchaus können solche E<strong>in</strong>richtungen dazu geeignet<br />
se<strong>in</strong>, kommunikationsabhängige Arbeitsprozesse und<br />
Dienstleistungen unmittelbar aufs Land zu br<strong>in</strong>gen. Die<br />
Crux ist nur, daß dies <strong>in</strong>zwischen mit jedem preiswerten<br />
PC und e<strong>in</strong>em Modem für den Datentransfer<br />
auch ohne weiteres von zu Hause aus möglich ist. Die<br />
Technik selbst kann angesichts des Innovationstempos<br />
und gleichzeitigen Preisverfalls bei der Hardware nicht<br />
mehr der Engpaß <strong>in</strong> den kle<strong>in</strong>en Geme<strong>in</strong>den se<strong>in</strong>.<br />
Dementsprechend machen E<strong>in</strong>richtungen wie Telehäuser<br />
nur dann e<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n, wenn konkrete Nutzungen<br />
mit genügend großer Intensität von vorhere<strong>in</strong> geplant<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
113
und fest verankert werden. Beispielsweise für besten<br />
zur Auslagerung von auch qualifizierten Arbeiten aus<br />
Unternehmen an dritten Standorten. Wir wollen dies<br />
konkret versuchen und sprechen dazu mit<br />
Unternehmen, ob sie bereit s<strong>in</strong>d, entsprechende Pilotprojekte<br />
auch personell zu unterstützen. Die größte<br />
Aufgabe im Zusammenhang mit Telehäusern liegt im<br />
s<strong>in</strong>nvollen Betrieb, der deutlich über Alib<strong>in</strong>utzungen<br />
h<strong>in</strong>ausgehen muß.<br />
Ich habe eigene (leidvolle) Erfahrung <strong>in</strong> der IHK mit der<br />
äußerst schwierigen Vermarktung von Datenbankrecherchen<br />
an private Unternehmen.<br />
Fazit:<br />
Im ländlichen Raum müssen Projektgeme<strong>in</strong>schaften<br />
entstehen und gefördert werden, die durchaus etwas ähnliches<br />
zu leisten haben wie Flurbere<strong>in</strong>igung, nämlich die<br />
Sortierung und Neuordnung und damit Bündelung der<br />
<strong>in</strong>novativen Ressorcen. Die endogene Potentiale s<strong>in</strong>d<br />
kle<strong>in</strong>räumlich auf dem Land zunächst immer dünner gesät<br />
als <strong>in</strong> der großen <strong>Stadt</strong>. Die typischen Attraktivitätsmerkmale<br />
des ländlichen Raumes s<strong>in</strong>d umgekehrt nicht so<br />
stark, daß sie die wirtschaftlichen Synergienachteile automatisch<br />
aufwiegen können. Der technologische schritt<br />
und die <strong>in</strong>novative Umstruktruierung der Wirtschaft<br />
schließlich hat zwar e<strong>in</strong>e Fülle räumlicher Konsequenzen,<br />
aber ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>deutigen, viel ambivalentes und nicht automatisch<br />
den räumlichen Ausgleich unterstützend.<br />
Zweifelsfrei aber können im ländlichen Raum <strong>in</strong>novative<br />
Wirtschaftsstandorte entwickelt werden. Projektmanagement,<br />
überkommunale Zusammenarbeit und die<br />
unmittelbare Verzahnung der sogenannten weichen<br />
Standortvorteile mit den wirtschaftlich relevanten, spielen<br />
dabei e<strong>in</strong>e herausragende Rolle.<br />
Der ländliche Raum verfügt nicht über e<strong>in</strong>e den Großstädten<br />
vergleichbare wirtschaftliche Dynamik, die zu<br />
eigenständigen gewerblich orientierten Gestaltungen<br />
führt. Die Bürolandschaft Niederrad entsteht <strong>in</strong> Frankfurt<br />
aufgrund des wirtschaftlichen Drucks zwangsläufig, die<br />
Wirtschaftsförderung ist hier eher <strong>in</strong> der assistierenden,<br />
begleitenden Rolle.<br />
Das Dorf muß ungleich mehr das Heft <strong>in</strong> die Hand nehmen,<br />
selbst viel stärker unmittelbar zum unternehmerischen<br />
Akteur werden und dabei viele Verbündete suchen.<br />
Die <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong>novativer Wirtschaftsstandorte im<br />
ländlichen Raum ist e<strong>in</strong>e erstklassige Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe.<br />
114 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Karl-He<strong>in</strong>z Röhl<strong>in</strong><br />
Lust auf’s Land- Erwartungen<br />
und Forderungen junger<br />
Menschen<br />
»Lust auf’s Land« — das Thema spiegelt den Trend.<br />
Jugendliche leben heute (wieder) unter bestimmten<br />
Voraussetzungen gerne auf dem Land. Die Zeitschrift<br />
»land & leute« befragte vor 2 1 / 2 Jahren Jugendliche, ob<br />
sie gerne <strong>in</strong> ihrem Dorf leben und später auch e<strong>in</strong>mal auf<br />
dem Land leben möchten. E<strong>in</strong>e typische Antwort:<br />
»Also mir gfällts auf’n Land super. In der <strong>Stadt</strong><br />
möcht ich net leben; z. B. <strong>in</strong> Nürnberg; da gfällt mers<br />
net, die Hochhäuser, die schlechte Luft, der Verkehr<br />
und ke<strong>in</strong> Garten, ke<strong>in</strong>e Natur.«<br />
Diese Äußerung faßt die wesentlichen Vorzüge des<br />
Lebens auf dem Land zusammen: die günstige Wohn-<br />
Abb. aus »Lust auf Dorf«, Reißig / Röhl<strong>in</strong>;<br />
Zeichnung von Werner Küstenmacher<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
situation, die gesünderen Lebensbed<strong>in</strong>gungen, den<br />
Naherholungswert und die Naturnähe. Trotz fehlender<br />
Arbeitsplätze und unzureichend ausgebautem öffentlichen<br />
Nahverkehr leben Jugendliche gerne auf dem Land. Sie<br />
haben durchaus »Lust auf Dorf« wie e<strong>in</strong> Buchtitel über die<br />
Evangelische Landjugend <strong>in</strong> Bayern heißt.<br />
Aktuelle Situation und Probleme<br />
Lebensbed<strong>in</strong>gungen junger Menschen<br />
Ich gehe vor allem auf die Situation der Jugendlichen<br />
von 14 — 18 Jahren e<strong>in</strong>. Sie besuchen <strong>in</strong> der Regel noch<br />
die Schule oder bef<strong>in</strong>den sich <strong>in</strong> der beruflichen Ausbildung.<br />
Im Vergleich zu ihren Freunden <strong>in</strong> der <strong>Stadt</strong> müssen<br />
die Landjugendlichen Nachteile <strong>in</strong> Kauf nehmen:<br />
— Sie haben längere Fahrtzeiten zur Schule und zum<br />
Arbeitsplatz.<br />
— Sie müssen mehr Pflichten im elterlichen Haushalt, <strong>in</strong><br />
der Landwirtschaft oder im Dorf übernehmen.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
115
— Verschiedene Schullaufbahnen erschweren den Kontakt<br />
zu Freunden und Freund<strong>in</strong>nen.<br />
— Die Freizeitangebote <strong>in</strong> der <strong>Stadt</strong> s<strong>in</strong>d vielfältiger und<br />
zahlreicher.<br />
Fehlende Arbeitsplätze im Dorf erzeugen vor allem <strong>in</strong><br />
strukturschwachen Gebieten e<strong>in</strong>en Abwanderungsdruck.<br />
Die Jugendlichen leben <strong>in</strong> zwei Welten. Auf der e<strong>in</strong>en<br />
Seite die überschaubare, von Traditionen geprägte Welt<br />
des Dorfes. Auf der anderen Seite die Anonymität der<br />
<strong>Stadt</strong> und die Leitbilder der modernen Freizeitwelt.<br />
E<strong>in</strong>engend erleben Jugendliche die soziale Kontrolle im<br />
Dorf. Wer mit wem geht, wer wann nach Hause kommt,<br />
all dies f<strong>in</strong>det <strong>in</strong>teressierte Beobachter.<br />
In der Freizeit besteht für die Jugendlichen das Problem,<br />
da h<strong>in</strong>zukommen, wo sie h<strong>in</strong> wollen. Vor allem<br />
Mädchen, die nicht über e<strong>in</strong> Moped oder e<strong>in</strong> Auto verfügen,<br />
s<strong>in</strong>d benachteiligt und angewiesen auf Fahrer. E<strong>in</strong><br />
junger Mann formuliert das so:<br />
»Am Wochenende geht’s ab <strong>in</strong> die Disco. Manchmal<br />
grasen wir zwei, drei Discos <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Nacht ab. Ich<br />
nehme <strong>in</strong> me<strong>in</strong>em Auto meistens e<strong>in</strong> paar Leute mit.<br />
Ohne Auto bist du auf dem Land aufgeschmissen«.<br />
Die Karriere der jugendlichen Mobilität sieht so aus: Mit<br />
15 Jahren e<strong>in</strong> Mofa, mit 16 Jahren e<strong>in</strong> Moped, mit 18<br />
Jahren e<strong>in</strong> Motorrad oder Auto. Mit Recht schreibt Dieter<br />
Wieland zum Verkehrsproblem auf dem Lande:<br />
»Ohne Auto wäre unser Leben auf den Dorf nicht<br />
möglich. Das ist der Unterschied zur <strong>Stadt</strong>. Und der<br />
größte Nachteil. Das Verkehrsnetz fehlt. Ke<strong>in</strong> Problem<br />
ist so dr<strong>in</strong>gend zu lösen, wie das Verkehrsproblem auf<br />
dem Lande«.<br />
Im Dorf gibt es nur wenig attraktive Freizeitmöglichkeiten.<br />
Nicht von ungefähr bauen sich Jugendliche selbst<br />
Hütten oder richten sich Bauwägen e<strong>in</strong>. Diese Aktivitäten<br />
s<strong>in</strong>d auch als Kritik an Kommune und Kirchengeme<strong>in</strong>de zu<br />
verstehen, die Jugendlichen zu wenig Raum bieten. Für<br />
Jugendliche ist es wichtig, daß sie sich mit Gleichaltrigen<br />
<strong>in</strong> selbstgestalteten Räumen treffen können. Dort verabreden<br />
sie geme<strong>in</strong>same Aktivitäten und sitzen ohne großes<br />
Programm zusammen. In diesen »Hütten« bzw. Bauwägen<br />
haben die älteren Jugendlichen das Sagen. Die Mädchen<br />
mit ihren Anliegen kommen nicht selten zu kurz.<br />
Jugendliche im Alter von 14 — 18 Jahren <strong>in</strong>teressieren<br />
sich wenig für politische oder kirchliche Fragen. Sie engagieren<br />
sich dann, wenn sie persönlich betroffen s<strong>in</strong>d (z. B.<br />
Initiativen für e<strong>in</strong>en Jugendraum, Umweltschutzaktionen,<br />
agrarpolitische Demonstrationen). Als Gründe für diese<br />
Gleichgültigkeit gelten Ohnmachtsgefühle (»Ich kann doch<br />
nichts bewegen«), Informationslücken (»Ich blick da nicht<br />
mehr durch...«) oder persönliche Interessen (»Das br<strong>in</strong>gt<br />
mir nichts; <strong>in</strong> me<strong>in</strong>er Freizeit habe ich Besseres zu tun«.).<br />
Diese Haltung kommt daher, daß für die Jugendlichen<br />
Demokratie vor Ort kaum erlebbar ist. In diesem Defizit an<br />
Erfahrungen mit demokratischen Entscheidungsprozessen<br />
wirkt die kommunale Gebietsreform nach. Sie hat die<br />
Möglichkeiten der Bürger, das Dorfleben mitzugestalten<br />
entscheidend verschlechtert. Die Dorfbewohner nehmen<br />
kommunalpolitische Entscheidungen, die <strong>in</strong> der <strong>Stadt</strong> fallen,<br />
mehr oder weniger zur Kenntnis. Die Verdrossenheit<br />
gegenüber der Verwaltungsbürokratie und zentralen politischen<br />
Strukturen ist nicht nur bei Jugendlichen zu beobachten.<br />
Heute s<strong>in</strong>d nicht die Proteste und Demonstrationen<br />
der Jugendlichen bedeutsam, sondern das wachsende<br />
politische Des<strong>in</strong>teresse.<br />
Wertewandel: von der Pflichtethik zur<br />
Selbstentfaltung<br />
Die E<strong>in</strong>stellung und die Leitbilder der Jugendlichen<br />
haben sich auch auf dem Land geändert. Ich spreche<br />
bewußt von Wertewandel und nicht von Werteverfall.<br />
Zunächst gilt es, den Wertewandel vorurteilsfrei wahrzunehmen.<br />
Dabei ist festzustellen, daß sich <strong>in</strong> den E<strong>in</strong>stellungen<br />
junger Leute gesellschaftliche Leitbilder widerspiegeln.<br />
Insgesamt wenden sich Jugendliche ab von der<br />
»Pflichtethik« der Eltern und Großeltern h<strong>in</strong> zu den Werten<br />
der Selbstentfaltung. Die alten Werte, Diszipl<strong>in</strong>, Leistungsbereitschaft,<br />
Gehorsam, Pflichtbewußtse<strong>in</strong>, Pünktlichkeit,<br />
Unterordnung, Sparsamkeit, Traditionspflege rangieren<br />
h<strong>in</strong>ter den Selbstentfaltungswerten (persönliche Freiheit,<br />
Selbstbestimmung, Unabhängigkeit, Wohlergehen, sich<br />
etwas leisten können).<br />
Die Frage, worauf es im Leben ankommt, beantworten<br />
Jugendliche oft so: »Daß es mir gut geht, daß ich mich<br />
wohlfühle, daß ich glücklich b<strong>in</strong>, daß ich Spaß im<br />
Leben habe«. Als wichtige Lebensziele nennen Jugendliche<br />
gute Freunde, Glück <strong>in</strong> der Partnerbeziehung und<br />
Ehe, Zufriedenheit im Beruf. Die Betonung der Selbstentfaltungswerte<br />
durch junge Menschen <strong>in</strong> den neunziger<br />
Jahren ist gewiß auch e<strong>in</strong>e Reaktion auf e<strong>in</strong>e »verbissene«<br />
Pflichtethik. Junge Menschen, die ihrer Begabung und<br />
Neigung entsprechend wachsen und reifen können, s<strong>in</strong>d<br />
als Erwachsene am ehesten fähig, anderen <strong>in</strong> Freiheit zu<br />
dienen.<br />
Wir Erwachsenen sollten das Streben nach Selbstentfaltung<br />
und Freiräumen nicht voreilig madig machen.<br />
Freilich darf die Selbstentfaltung nicht zu Lasten anderer<br />
gehen. Wer selbstbezogen lebt, ohne sich für das Geme<strong>in</strong>wohl<br />
e<strong>in</strong>zusetzen, der lebt gewissermaßen unter se<strong>in</strong>en<br />
Verhältnissen. Aufgabe der Erziehung ist es, junge<br />
Menschen vor dem Absturz <strong>in</strong> die isolierte Selbstbezogenheit<br />
zu schützen.<br />
Das Streben nach Selbstentfaltung beschreibt die ethische<br />
Haltung von Jugendlichen jedoch nur unzureichend.<br />
In e<strong>in</strong>er repräsentativen Umfrage antworteten auf die<br />
Frage nach »guten Grundsätzen« 93 Prozent: Ehrlich zu<br />
sich selber se<strong>in</strong>. »Verzichten können« und »Opfer br<strong>in</strong>gen«<br />
ist für 75 Prozent e<strong>in</strong> »guter Grundsatz«. Anderen vergeben,<br />
anderen nicht weh tun, f<strong>in</strong>det ähnlich viel Zustimmung.<br />
Junge Menschen achten demnach durchaus Werte,<br />
die anderen Menschen dienen.<br />
116 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Die Klage über den zunehmenden Egoismus der heutigen<br />
Jugend läßt sich durch Umfragen nicht belegen. Im<br />
Gegenteil, junge Menschen urteilen <strong>in</strong> ausgeprägtem<br />
Maße wertorientiert. Sie empf<strong>in</strong>den <strong>in</strong> der Familie, am<br />
Arbeitsplatz, <strong>in</strong> Kirche und Gesellschaft e<strong>in</strong> Defizit an<br />
Werten. Sie sehen sich als moralisch Handelnde <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
unmoralischen Gesellschaft.<br />
Die psycho-soziale Situation von Jugendlichen<br />
Jugendliche im Alter von 14—18 Jahre leben <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
Phase des Überganges. Sie s<strong>in</strong>d nicht mehr K<strong>in</strong>der, sie s<strong>in</strong>d<br />
aber auch noch nicht erwachsen. Die körperlichen Veränderungen<br />
gehen oft e<strong>in</strong>her mit starken Stimmungsschwankungen:<br />
Himmelhoch jauchzend — zu Tode<br />
betrübt.<br />
Die Heranwachsenden lösen sich von den Wertvorstellungen<br />
der Eltern ab. Typisch für das Jugendalter ist<br />
e<strong>in</strong>e gewisse Antihaltung. Sie führt nicht selten zu Konflikten<br />
mit Eltern, Lehrern und Autoritätspersonen. Alternative<br />
Kleidung, grelle Kosmetik und auffällige Haarpracht<br />
s<strong>in</strong>d Ausdruck der Suche nach der eigenen Persönlichkeit.<br />
Wer b<strong>in</strong> ich? Wie komme ich bei anderen an? Wir wirke<br />
ich? Dies s<strong>in</strong>d typische Fragen.<br />
Die Orientierungsprobleme verschärfen sich, wenn<br />
Jugendliche <strong>in</strong> der Schule nicht mitkommen oder von<br />
Arbeitslosigkeit bedroht s<strong>in</strong>d. Gerade der junge Mensch<br />
braucht Erfolgserlebnisse, Bestätigung, damit er Selbstvertrauen<br />
entwickelt und e<strong>in</strong> positives Selbstwertgefühl<br />
aufbaut. Wichtiger Orientierungsrahmen für die Jugendlichen<br />
ist die Clique. Jugendliche übernehmen die Gruppennorm<br />
nur allzu leicht. Sich dem Gruppendruck zu<br />
widersetzen erfordert e<strong>in</strong> starkes Ich. Wenn »man« raucht,<br />
wenn »man« rast, wenn Bier das Gruppengetränk ist, dann<br />
fällt es schwer sich zu entziehen.<br />
Die zunehmende Unübersichtlichkeit unseres Lebens<br />
und ungelöste gesellschaftliche Konflikte (Arbeitslosigkeit,<br />
undurchschaubare Bürokratie) verführen manche Jugendliche<br />
dazu, klare, e<strong>in</strong>deutige, e<strong>in</strong>fache Lösungen zu<br />
suchen. Die Bereitschaft radikalen Parolen zu folgen, ist<br />
<strong>in</strong> den letzten Jahren nicht nur bei jungen Leuten gewachsen.<br />
Jugendliche brauchen <strong>in</strong> ihrer schwierigen Lebensphase<br />
verständnisvolle Berater. Die Erwachsenen, ob Jugendleiter,<br />
Pfarrer oder Bürgermeister s<strong>in</strong>d wichtige Gesprächspartner.<br />
Sie sollten Hilfen anbieten, ermutigen,<br />
korrigieren. Dies alles <strong>in</strong> der Rolle des Begleiters im<br />
H<strong>in</strong>tergrund und nicht des Besserwissers, der mit se<strong>in</strong>em<br />
Wissen und se<strong>in</strong>er Erfahrung neue Ideen und Initiativen<br />
erstickt.<br />
Erwartungen und Forderungen<br />
Arbeits- und Ausbildungsplätze<br />
Um auf dem Land bzw. im Dorf bleiben zu können,<br />
s<strong>in</strong>d für Jugendliche Arbeits -und Ausbildungsplätze <strong>in</strong><br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
erreichbarer Nähe nötig. Die Bereitschaft zu pendeln ist<br />
durchaus vorhanden, trotz der damit verbundenen<br />
Belastungen. Früh aufstehen und jeden Tag 50—60 km<br />
e<strong>in</strong>fach zur Arbeit zu fahren, nehmen manche Jugendliche<br />
durchaus noch h<strong>in</strong>. Bei anderen ist die Grenze der Zumutbarkeit<br />
schon bei 15—20 km erreicht. Sehr schwierig<br />
ist die Situation für arbeitslose Jugendliche auf dem<br />
Land. Die Jugendhilfeprojekte und E<strong>in</strong>richtungen der<br />
Jugendsozialarbeit liegen meist <strong>in</strong> den Städten.<br />
Jugendlichen partnerschaftlich begegnen<br />
Jugendliche klagen oft darüber, daß sie von den Autoritäten<br />
im Dorf nicht ernstgenommen werden. Sie wollen<br />
da, wo es um ihre Belange geht, mitentscheiden und mitgestalten.<br />
Sie erwarten von den Erwachsenen, daß sie<br />
Freiräume gewähren, die Selbständigkeit fördern und<br />
»nicht dauernd re<strong>in</strong>reden«. Die Erwachsenen sollen sich<br />
nicht als »Chefs« aufspielen, sondern die Jugendlichen als<br />
Partner achten. Es ist s<strong>in</strong>nvoll und gut, wenn es im Dorf,<br />
im Geme<strong>in</strong>derat, im Kirchenvorstand e<strong>in</strong>en festen Ansprechpartner<br />
für Jugendfragen gibt. Regelmäßige<br />
Besprechungen mit den Jugendvertretern helfen dabei<br />
Probleme und Bedürfnisse kennenzulernen und Konflikte<br />
zu regeln.<br />
Jugendräume und offene Treffs<br />
Auf der Wunschliste von Jugendlichen im Dorf stehen<br />
eigene Räume ganz oben: Jugendcafe, Spielscheune,<br />
Jugendkeller oder Landjugendraum. Auf dem Land gibt es<br />
immer noch wenig Jugendräume, die von den Jugendlichen<br />
selbst gestaltet und weitgehend selbstverwaltet<br />
werden. Müssen Jugendliche <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Schulhaus oder <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em kirchlichen Geme<strong>in</strong>dehaus den Raum mit anderen<br />
Erwachsenengruppen teilen, dann s<strong>in</strong>d die Konflikte vorprogrammiert.<br />
Die Erwartungen an Farben, Dekoration,<br />
technische Ausstattung und die Ordnungsvorstellungen<br />
von Jugendlichen unterscheiden sich eben grundlegend<br />
von den Interessen und Vorstellungen der Erwachsenen.<br />
Der Jugendraum ist Treffpunkt wo Jugendliche zwanglos<br />
zusammensitzen, Musik hören, ratschen, Karten spielen<br />
oder Aktivitäten planen. Die Zusammenarbeit von politischer<br />
Geme<strong>in</strong>de, Kirchengeme<strong>in</strong>de, Jugendverband und<br />
Jugendlichen hilft bestehende Hürden bei Jugendraum<strong>in</strong>itiativen<br />
zu überw<strong>in</strong>den.<br />
Spezifische Freizeitangebote auch für junge Frauen<br />
Zu Tanzveranstaltungen und <strong>in</strong>s K<strong>in</strong>o müssen Jugendliche<br />
nicht <strong>in</strong> die <strong>Stadt</strong> fahren. Kulturelle Veranstaltungen<br />
können durchaus auf dem Land angeboten werden. In der<br />
Evangelischen Landjugend haben wir gute Erfahrungen<br />
gemacht mit Filmnächten, Kabarettveranstaltungen und<br />
Theaterabenden. Auch themenorientierte Angebote f<strong>in</strong>den<br />
auf Kreisverbandsebene genügend Interesse.<br />
Speziell die jungen Frauen im Dorf melden sich <strong>in</strong>zwischen<br />
selbstbewußt zu Wort. Sie s<strong>in</strong>d nicht mehr zufrieden<br />
mit der ihnen zugewiesenen Rolle. Das Vere<strong>in</strong>sleben<br />
ist im Dorf immer noch e<strong>in</strong>e Domäne der Männer. Mädchen<br />
und jungen Frauen kommen mit ihren Bedürfnissen<br />
und Interessen oft zu kurz.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
117
Lust auf’s Land — ich denke es ist e<strong>in</strong> positives Signal,<br />
daß junge Menschen gerne auf dem Land leben. Politische<br />
Geme<strong>in</strong>de und Kirchengeme<strong>in</strong>de s<strong>in</strong>d verantwortlich für<br />
die Menschen im Dorf, auch für die jungen. Bevor wir<br />
Klagelieder über die heutige Jugend anstimmen, sollten<br />
wir uns an die eigenen »Jugendsünden« er<strong>in</strong>nern.<br />
118 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Gottfried Wieselhuber<br />
Regionale Interessengeme<strong>in</strong>schaft<br />
Maria Bildhausen ( RIM)<br />
— E<strong>in</strong>e Initiative von unten!<br />
Maria Bildhausen<br />
Maria Bildhausen ist e<strong>in</strong> <strong>Stadt</strong>teil von Münnerstadt im<br />
Landkreis Bad Kiss<strong>in</strong>gen.<br />
Maria Bildhausen, e<strong>in</strong>e ehemalige Zisterzienserabtei,<br />
welche im Jahre 1156 von Ebrach aus von Herrmann<br />
Graf Stahleck gegründet wurde, ist heute e<strong>in</strong>e<br />
E<strong>in</strong>richtung zur Pflege für geistig und körperlich beh<strong>in</strong>derte<br />
Menschen. Träger ist die St. Josefskongregation<br />
Ursberg. Die Zisterzienser s<strong>in</strong>d dafür bekannt, daß sie an<br />
unwirtlichen Orten siedelten, um sich zu kasteien. Der<br />
damals unattraktive Ort hat sich, was den Liebreiz anbelangt,<br />
gut entwickelt. Die landwirtschaftlich schlechte<br />
Gegend blieb dagegen schlecht! Über die Jahrhunderte<br />
haben die Zisterzienser die Region besiedelt, gestaltet,<br />
befruchtet, beherrscht, kurzum, geprägt! 1803 <strong>in</strong> der<br />
Säkularisation war das Ende dieser Ära gekommen.<br />
1897 kaufte der Gründer der St. Josefskongregation,<br />
der Pfarrer Dom<strong>in</strong>ikus R<strong>in</strong>geisen, das, was von der<br />
Säkularisation übriggeblieben ist. Fast hundert Jahre s<strong>in</strong>d<br />
die Schwestern der St. Josefskongregation <strong>in</strong> den Gemäuern<br />
der ehemaligen Zisterzienserabtei. Sie betreuen dort<br />
geistig und körperlich Beh<strong>in</strong>derte und geben ihnen e<strong>in</strong><br />
Zuhause. In den Jahren 1980 bis 1993 wurde die E<strong>in</strong>richtung<br />
generalsaniert Die Erfüllung der Aufgabe wird mangels<br />
Schwestern von weltlichen Kräften mit gewährleistet.<br />
200 Angestellte betreuen derzeit über 100 beh<strong>in</strong>derte<br />
Mitmenschen. Die Leitung der E<strong>in</strong>richtung hat bereits <strong>in</strong><br />
den 70er Jahren der Öffnung nach außen Priorität e<strong>in</strong>geräumt!<br />
Unser Motto:<br />
»Nur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Mite<strong>in</strong>ander mit der Region ist e<strong>in</strong>e<br />
Absicherung unserer Aufgabe möglich!«<br />
RIM: Warum <strong>in</strong> Maria Bildhausen?<br />
— Neutraler Ort, ke<strong>in</strong> politisches Gebilde.<br />
— Prägend für die Region aus historischer Sicht<br />
— und der Bekanntheitsgrad (Hauptaufgabe: Acker- und<br />
Gartenbautage, kulturelle Veranstaltungen)<br />
Aufgaben der RIM:<br />
Zweck der RIM ist, die Mitglieder bei der Planung und<br />
Durchführung von Maßnahmen zu unterstützen, die der<br />
<strong>in</strong>tegrierten ländlichen <strong>Entwicklung</strong> der Region Maria<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Bildhausen dienen und deren Wirtschaftskraft nachhaltig<br />
stärken sollen. Der Vere<strong>in</strong>szweck soll auch durch die Tätigkeit<br />
von fachlich spezialisierten Arbeitskreisen verfolgt<br />
werden. Die <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>es regionalen Konzepts für<br />
Freizeit und Erholung, Sport, Direktvermarktung, E<strong>in</strong>satz<br />
von nachwachsenden Rohstoffen und anderer geeigneter<br />
Maßnahmen zur Stärkung der Region s<strong>in</strong>d Ziel.<br />
Die daraus entstehenden Arbeitsplätze auf dem Dienstleistungssektor<br />
werden Arbeitsplätze auf dem Produktionssektor<br />
nach sich ziehen. Voraussetzung dafür ist die<br />
Erhaltung der Kulturlandschaft mit allen Besonderheiten<br />
der Fauna und Flora sowie der Schutz und die Förderung<br />
ihrer historischen und kulturellen Werte und Eigenheiten.<br />
Das ist Grundlage der RIM:<br />
Gründung als e.V. am 22.06.1993 <strong>in</strong> Maria Bildhausen.<br />
Mitglieder derzeit 75, davon 21 Geme<strong>in</strong>den.<br />
Arbeitskreise<br />
— AK Direktvermarktung,<br />
— AK Handwerk, Gewerbe, Industrie,<br />
— AK Fremdenverkehr, Freizeit,<br />
— AK Kultur, Geschichte, Brauchtum,<br />
— AK Landschaft, Natur, nachwachsende Rohstoffe,<br />
— AK Geme<strong>in</strong>den.<br />
Die Arbeitskreise arbeiten selbständig. Die Ergebnisse<br />
s<strong>in</strong>d Grundlage der Gespräche der Arbeitskreisleiter<br />
mit der Vorstandschaft. Das Gebiet der RIM ist klar<br />
def<strong>in</strong>iert, veränderbar, landkreisübergreifend (Landkreise<br />
Bad Kiss<strong>in</strong>gen und Rhön-Grabfeld) und hat derzeit<br />
ca. 500 qkm.<br />
Auslöser für die RIM<br />
Lange vor der Wiedervere<strong>in</strong>igung waren die Zeichen der<br />
Zeit auf Wandlung <strong>in</strong>nerhalb der Landwirtschaft zu erkennen.<br />
Die Erhaltung des »ländlichen Raums« wurde immer<br />
häufiger zitiert. Negative Schlagwörter, wie »Ballungsräume«<br />
und als Pendant »leeres, entvölkertes, flaches Land<br />
mit wenig Attraktivität«, wurden und werden immer häufiger<br />
gebraucht. Die EU legte e<strong>in</strong> Förderprogramm auf:<br />
5b-Mittel.<br />
Die Wiedervere<strong>in</strong>igung mit den neuen Bundesländern<br />
kam schnell und forderte erhebliche, nicht abschätzbare<br />
Mittel, welche vom Steueraufkommen der neuen Länder<br />
nicht gedeckt werden können. Steuermittel aus den alten<br />
Bundesländern müssen <strong>in</strong> die neuen Bundesländer. Die<br />
Grenzlandhilfe fiel und der neue Topf »5b-Mittel« kam zur<br />
Verteilung.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
119
Der neue Fördertopf 5b-Mittel<br />
Die Vergaberichtl<strong>in</strong>ien s<strong>in</strong>d im Operationellen Programm<br />
(OP) <strong>in</strong> der Fassung vom 17. Sept. 1990 festgelegt.<br />
Es ist e<strong>in</strong> weitgefaßter Rahmen mit vielen Spielräumen.<br />
Das ist Chance zum Guten und zugleich Möglichkeit<br />
zum Flop. Zunächst ist die Kreativität <strong>in</strong> Richtung<br />
Visionen gefragt. Die Zusammenarbeit mit bestehenden<br />
Verwaltungse<strong>in</strong>richtungen reichte nicht mehr aus. Damit<br />
war klar, daß Verwaltungsstellen extra dafür geschaffen<br />
werden mußten. Die 5b-Stellen!<br />
»Wer das Ziel nicht kennt, wird den Weg nicht<br />
f<strong>in</strong>den!«,<br />
sagt das Volk. Oder <strong>in</strong> Abwandlung:<br />
»Wer das Ziel kennt, muß den Weg suchen!«<br />
Die Suche hält an!<br />
Manchmal hat man den E<strong>in</strong>druck, daß die Aufgaben<br />
e<strong>in</strong>es Wegweisers, der das OP se<strong>in</strong> soll, s<strong>in</strong>nverkehrt angewandt<br />
werden. Das hat nichts damit zu tun, daß h<strong>in</strong>ter<br />
den ganzen Vorschriften und Paragraphen nicht die<br />
besten Absichten stünden. Die Schwierigkeiten entstehen<br />
nur dadurch, daß die Zuständigkeiten der M<strong>in</strong>isterien<br />
wechseln und damit die Fördervergaben und -höhen.<br />
Die Federführung liegt jedoch bei e<strong>in</strong>em M<strong>in</strong>isterium,<br />
dem Staatsm<strong>in</strong>isterium für Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Forsten.<br />
Die verschiedenen Töpfe der 5b-Mittel werden aber<br />
genau vorher e<strong>in</strong>zelnen M<strong>in</strong>isterien zugeteilt:<br />
• EAGFL (Europ. Ausrichtungs- und Garantiefonds für die<br />
Landwirtschaft) dem StMELF,<br />
• EFRE (Europ. Fond für Regionale <strong>Entwicklung</strong>) dem<br />
StMWV,<br />
• ESF (Europ. Sozialfond) den M<strong>in</strong>isterien für Arbeit und<br />
Soziales (Federführung), Kultur, Landwirtschaft,<br />
Umwelt und F<strong>in</strong>anzen.<br />
Die 5b-Stellen werden jedoch nur von e<strong>in</strong>er Seite, der<br />
landwirtschaftlichen, besetzt. Abgrenzungsverhalten der<br />
e<strong>in</strong>zelnen M<strong>in</strong>isterien untere<strong>in</strong>ander verh<strong>in</strong>dern e<strong>in</strong>e notwendige<br />
Zusammenarbeit mit dem StMELF.<br />
Das Ziel ist genau def<strong>in</strong>iert und lautet:<br />
»<strong>Entwicklung</strong> des ländlichen Raums«, daß da aber<br />
alle Kräfte des Raumes geme<strong>in</strong>t s<strong>in</strong>d, muß erst noch verdeutlicht<br />
werden.<br />
Die 5b-Gebiete s<strong>in</strong>d klar beschrieben und haben alle<br />
bestimmte Merkmale:<br />
— unzureichende Ausstattung mit nicht landwirtschaftlichen<br />
Arbeitsplätzen,<br />
— über dem bay. Durchschnitt liegende Arbeitslosigkeit,<br />
— unterdurchschnittliches E<strong>in</strong>kommensniveau,<br />
— überdurchschnittlicher Anteil der Erwerbsbevölkerung<br />
<strong>in</strong> der Land- und Forstwirtschaft,<br />
— kle<strong>in</strong>bäuerliche Struktur,<br />
— ungünstige Ertragsbed<strong>in</strong>gungen,<br />
— Landbewirtschaftung langfristig nicht mehr gesichert,<br />
— Markt- und Absatzwege s<strong>in</strong>d kle<strong>in</strong>strukturiert,<br />
— Verkehrsanb<strong>in</strong>dung an überregionale Märkte ist unzureichend.<br />
Dies und noch mehr ist allen 5b-Gebieten geme<strong>in</strong>sam.<br />
Die schlechten Preise <strong>in</strong> der Landwirtschaft wirken sich<br />
natürlich zu allererst <strong>in</strong> diesen Gebieten aus.<br />
E<strong>in</strong>e ausreichende Eigenkapitalbildung war aus vorgenannten<br />
Gründen auch nicht möglich. Um aus eigener<br />
Kraft den wegbrechenden landwirtschaftlichen Haupterwerb<br />
zu ersetzen, fehlen die Mittel und die Strukturen,<br />
auf denen sich etwas aufbauen ließe. Das RIM-Gebiet hat<br />
zudem noch die Arbeitslosigkeit der besonders präkären<br />
Situation <strong>in</strong> Schwe<strong>in</strong>furt zu verkraften.<br />
Grundlage für e<strong>in</strong>e Verbesserung der Situation ist die<br />
Erhaltung der Kulturlandschaft<br />
Das alle<strong>in</strong>e der Landwirtschaft aufzutragen, überfordert<br />
sie. Es ist und muß e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe aller<br />
Kräfte se<strong>in</strong>. Mit der Harmonisierung der Förderungen muß<br />
begonnen werden.<br />
Die Iststandsbeschreibung. Unterschiedliche Förderhöhen<br />
s<strong>in</strong>d das größte Problem: Landwirtschaftliche<br />
Förderhöhen s<strong>in</strong>d 50 % bis 60 % und mit der EU abgesprochen<br />
und genehmigt. Wirtschaftsförderung kann nur<br />
max. 15 % <strong>in</strong> 5b-Gebieten betragen.<br />
In der Regionalen Wirtschaftsförderungsvere<strong>in</strong>barung<br />
mit der EU s<strong>in</strong>d diese Förderhöhen mit den alten Bundesländern<br />
festgeschrieben. Im H<strong>in</strong>blick auf die neuen<br />
Bundesländer (Ziel I-Gebiet) s<strong>in</strong>d diese Förderhöhen so<br />
festgelegt, daß e<strong>in</strong> starkes Fördergefälle vom Ziel I-Gebiet<br />
zum 5b-Gebiet entsteht. Das ist so gewollt! Wenn dies so<br />
weiter läuft, ist das Entstehen von Ziel I-Gebieten vorprogrammiert.<br />
Das s<strong>in</strong>d die jetzigen 5b-Gebiete.<br />
Auswirkungen<br />
Die erhöhte Förderung im Ziel I-Gebiet hat <strong>in</strong> dem<br />
angrenzenden 5b-Gebiet zur Folge, daß Firmen <strong>in</strong>s<br />
Ziel-Gebiet wechseln, Firmen gründen, Steuern <strong>in</strong> den<br />
neuen Bundesländern bezahlen und die Konkurrenz<br />
spüren die Kollegen im 5b-Gebiet. Gleich zweimal trifft’s<br />
die 5b-Gebiete Das war sicherlich nicht so gewollt, aber<br />
es ist Fakt!<br />
120 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Initiativen der RIM:<br />
E<strong>in</strong>gedenk der geforderten Geme<strong>in</strong>schaftsaufgabe e<strong>in</strong>er<br />
Region, b<strong>in</strong>det die RIM möglichst alle Kräfte, vernetzt sie<br />
sozusagen und versucht, die Ideen zu bündeln und aufe<strong>in</strong>ander<br />
abzustimmen. Das ist e<strong>in</strong>e schwere Aufgabe,<br />
muß man doch zunächst, um erfolgreich zu se<strong>in</strong>, e<strong>in</strong>e<br />
Reihe von Vorgaben verändern.<br />
Die vorher angesprochenen Förderunterschiede wurden<br />
auf höchster Länderebene, Brief und persönliches<br />
Gespräch mit Wirtschaftsm<strong>in</strong>ister Dr. Otto Wiesheu, Brief<br />
und persönliches Gespräch mit Herrn M<strong>in</strong>isterpräsidenten<br />
Dr. Edmund Stoiber, versucht zu ändern. Die Zusage des<br />
Herrn M<strong>in</strong>isterpräsidenten, nachdem er versichert hatte,<br />
daß er die Zusammenarbeit zwischen dem StMELF und<br />
dem StMWV <strong>in</strong> der Sache für machbar hält, e<strong>in</strong>en dies<br />
untersuchenden Ausschuß e<strong>in</strong>zusetzen, läßt auf e<strong>in</strong>e positive<br />
Änderung hoffen. Kontakte zu diesem Ausschuß<br />
bestehen. An der Regierung von Unterfranken laufen gute<br />
Gespräche vor diesem H<strong>in</strong>tergrund.<br />
Was muß verbessert werden?<br />
5b-Förderung muß zunächst Schwerpunktförderung<br />
se<strong>in</strong>. Der raumbedeutsamen Investition, der Abstimmung<br />
solcher Investitionen untere<strong>in</strong>ander ist der Vorrang e<strong>in</strong>zuräumen.<br />
Die sich daraus ergebenden E<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>vestitionen<br />
s<strong>in</strong>d dann sicherer <strong>in</strong> ihrer <strong>Entwicklung</strong> und E<strong>in</strong>kommensrelevanz.<br />
Das bedeutet für die Förderung<br />
• Ob landwirtschaftlicher oder außerlandwirtschaftlicher<br />
Erwerb, ob Handwerker oder Fremdenverkehrsgewerbe,<br />
alle sollten an der gleichen Förderung gemessen werden.<br />
• Das Additionalitätspr<strong>in</strong>zip, das der Erlangung von EU-<br />
Geldern zu Grunde liegt, besagt, daß jede Mark der EU<br />
von e<strong>in</strong>er weiteren Mark aus dem jeweiligen Land ausgelöst<br />
wird. Diese »Ländermark« darf jedoch nicht aus<br />
e<strong>in</strong>em normalen Fördertopf des Landes verwendet werden!<br />
Nur e<strong>in</strong> zusätzlicher Landeshaushaltsansatz kann<br />
die EU-5b-Mittel vere<strong>in</strong>barungsgemäß auslösen und<br />
ausschließlich <strong>in</strong> 5b-Gebieten verwenden. Diese<br />
Vere<strong>in</strong>barung mit der EU erfüllt das Land Bayern nur<br />
für die EAGFL-Mittel.<br />
• EFRE und ESF haben ke<strong>in</strong>e zusätzlichen Haushaltsansätze.<br />
Im H<strong>in</strong>blick auf den neuen 5b-Zeitraum <strong>1994</strong> bis 1999<br />
sollte versucht werden, unter Beibehaltung der EAGFL-<br />
Förderhöhen die EFRE- und ESF-Mittel <strong>in</strong> gleicher Weise<br />
e<strong>in</strong>zusetzen.<br />
Unser M<strong>in</strong>isterpräsident Dr. Stoiber hat <strong>in</strong> der Richtung<br />
Erfahrung, wenn es gilt, etwas Nichtbewährtes oder<br />
H<strong>in</strong>terliches auf EU-Ebene anzusprechen. Zum<strong>in</strong>dest sollten<br />
die jetzigen Freiräume durch e<strong>in</strong> Mite<strong>in</strong>ander zur<br />
Mittelverdickung genutzt werden.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Die an der 5b-Förderung beteiligten M<strong>in</strong>isterien sollten<br />
mite<strong>in</strong>ander auf Regierungsebene die 5b-Stellen besetzen<br />
Oder als weiteres Modell, unabhängige, auf Zeit angestellte<br />
Projektmanager übernehmen die Steuerung der Projekte.<br />
Sie müssen von der Ausbildung und von der Praxis<br />
e<strong>in</strong>iges an Wissen und Erfahrung mitbr<strong>in</strong>gen. Wirtschaftsjuristen<br />
mit Projektnachweisen s<strong>in</strong>d z.B. geeignet. Die<br />
f<strong>in</strong>anziellen Mittel für e<strong>in</strong>en »Projektmanager« auf Zeit<br />
könnten über die technische Hilfe kommen. Die so besetzten<br />
5b-Stellen oder e<strong>in</strong> Projektmanager müssen dann mit<br />
Regionalen Interessengeme<strong>in</strong>schaften an den Konzepten<br />
arbeiten und sie mite<strong>in</strong>ander umsetzen.<br />
Wer ke<strong>in</strong>e Schwerpunkte schafft,<br />
kann auch nichts bewegen!<br />
Unser M<strong>in</strong>isterpräsident hat diese Möglichkeiten selberangesprochen<br />
und wir sollten das aufgreifen.<br />
Was ist das Besondere an der RIM?<br />
Das eigentlich Experimentelle an der RIM ist die<br />
B<strong>in</strong>dung aller Kräfte e<strong>in</strong>er Region. Der Versuch, e<strong>in</strong>e neue<br />
Möglichkeit der Abstimmung untere<strong>in</strong>ander auszuprobieren.<br />
Wir wissen dann mehr vone<strong>in</strong>ander!<br />
Wir verstehen e<strong>in</strong>ander dann besser!<br />
Damit kann auch der 5b-Gedanke erst greifen. Die<br />
Bereitstellung von Geld für e<strong>in</strong>e Region ist nicht genug.<br />
Umwandlung, Neubeg<strong>in</strong>n auf der Grundlage des bisher<br />
Gewohnten, aber ohne das Gewohnte zu haben, muß mite<strong>in</strong>ander<br />
erarbeitet werden. Das auf breiter Basis erarbeitete<br />
Konzept hat auch viel mehr Chancen, auf Dauer tragfähig<br />
zu se<strong>in</strong>.<br />
Bisher Erreichtes:<br />
Mitglieder der RIM treiben die Realisierung verschiedener<br />
Projekte energisch voran. Der Bau e<strong>in</strong>er 18-Loch-<br />
Golfanlage, die Errichtung von Ferienwohnungen, e<strong>in</strong><br />
Biomasseheizwerk, Selbstvermarkter s<strong>in</strong>d sehr aktiv und<br />
erfolgreich. Mitglieder der RIM nahmen und nehmen an<br />
Fortbildungsmaßnahmen teil. Die 5b-Mittel s<strong>in</strong>d dafür<br />
bewilligt. Das Raumordnungsverfahren und der Bauantrag<br />
für den Golfplatz s<strong>in</strong>d genehmigt, die Ausschreibung<br />
getätigt, die Vergabe erfolgt demnächst. Golfplatz und<br />
Biomasseheizwerk s<strong>in</strong>d für die Region von großer Bedeutung<br />
und haben Arbeitsplätze und E<strong>in</strong>kommen für die<br />
Landwirte der Region zur Folge. Die Errichtung des<br />
Golfplatzes hat außerdem das Dorferneuerungsvorhaben<br />
<strong>in</strong> der <strong>Stadt</strong> Münnerstadt, Ortsteil Großwenkheim, ausgelöst.<br />
Der AK Geme<strong>in</strong>den hat e<strong>in</strong>en umfangreichen Wünschekatalog<br />
für das zweite 5b-Fünfjahresprogramm erstellt,<br />
der als Grundlage für regional bedeutsame Strukturverbesserungen<br />
von der RIM genutzt wird.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
121
Wie geht es weiter?<br />
Die Region Maria Bildhausen wird, so steht es im<br />
Bedarfsplan für Bundesfernstraßen, mit der A 81 an das<br />
BAB-Netz angeschlossen. Dies ist mit Sicherheit e<strong>in</strong>e<br />
bedeutende, richtig zu nutzende Chance. Es ist die Möglichkeit<br />
e<strong>in</strong>en wunderschönen Standort weiterzuentwickeln,<br />
Dienstleistungsarbeitsplätze mit Produktionsarbeitsplätzen<br />
<strong>in</strong> guter Mischung zu haben.<br />
Die Symbiose <strong>Stadt</strong>-Land muß für<br />
uns alle Betätigungsfeld se<strong>in</strong>.<br />
Der Landwirt muß fachlich e<strong>in</strong>e Antwort zur Erhaltung<br />
der Kulturlandschaft geben, die Geme<strong>in</strong>wesen müssen<br />
sich daran beteiligen. Dialog und nicht Monolog muß im<br />
Vordergrund stehen.<br />
Das wollen wir tun!<br />
122 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Arbeitskreis 3:<br />
Land- und Forstwirtschaft<br />
Erich Sperle<strong>in</strong><br />
E<strong>in</strong>führung<br />
»Die Landwirtschaft ist die erste aller Künste. Ohne sie<br />
gäbe es ke<strong>in</strong>e Kaufleute, Dichter und Philosophen. Nur das<br />
ist wahrer Reichtum, was die Erde hervorbr<strong>in</strong>gt«.<br />
So beschreibt und bewertet der Preußenkönig Friedrich<br />
der Große, der durch se<strong>in</strong>e Schwester Sophie enge<br />
Beziehungen nach <strong>Ansbach</strong> hatte, 1769 se<strong>in</strong>e Landwirtschaft.<br />
Bevor ich den Bogen zur heutigen E<strong>in</strong>schätzung der<br />
Land- und Forstwirtschaft spanne, möchte ich Sie ganz<br />
herzlich im Arbeitskreis 3 »Land- und Forstwirtschaft«<br />
begrüßen.<br />
Me<strong>in</strong> besonderer Willkommensgruß gilt den Teilnehmern<br />
aus — nach der Liste — <strong>in</strong>sgesamt fünf verschiedenen<br />
Staaten, nämlich aus Österreich, der Schweiz, der<br />
Tschechischen Republik, aus Polen und aus der Volksrepublik<br />
Ch<strong>in</strong>a. Liebe ausländische Gäste, Ihr Interesse<br />
an unserer <strong>Fachtagung</strong> ehrt uns, denn es zeigt die hohe<br />
Wertschätzung der Arbeit der Bayerischen Verwaltung für<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> Ihren Heimatländern. Vielen<br />
Dank dafür! Weiter begrüße ich die Vertreter<strong>in</strong>nen und<br />
Vertreter der mit der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> gutem<br />
Kontakt stehenden Hochschulen, Banken, Behörden,<br />
Planungsbüros und Verbände. Nicht zuletzt freue ich<br />
mich natürlich über das Interesse der Kollegen aus<br />
unserer Verwaltung. Ich bedanke mich bei Ihnen dafür,<br />
daß Sie den Arbeitskreis 3 ausgewählt haben, um hier<br />
mitzuwirken und heiße Sie ebenfalls sehr herzlich willkommen.<br />
Zur Abwicklung unseres heutigen Tagesprogramms<br />
stehen mir zur Verfügung: Zu me<strong>in</strong>er Rechten Herr Professor<br />
Seibert und zu me<strong>in</strong>er L<strong>in</strong>ken Herr Danner. Ihnen<br />
e<strong>in</strong> herzliches Willkommen und vielen Dank für die spontane<br />
Bereitschaft, den Arbeitskreis mit mir zu gestalten.<br />
Zum Betreuungsteam gehören weiterh<strong>in</strong> die beiden<br />
Kollegen der DLE <strong>Ansbach</strong>, die Herr Langguth bereits vorgestellt<br />
hat, Herr Maucksch und Herr Langguth selbst und<br />
sechs Kollegen aus der Direktion Bamberg, denen ich vorweg<br />
bereits für die Übernahme e<strong>in</strong>er Moderation danken<br />
möchte und die ich hiermit auch begrüße. Ich werde sie<br />
später noch genauer vorstellen.<br />
Herr Langguth hat bereits darauf h<strong>in</strong>gewiesen, daß wir<br />
<strong>in</strong> ansprechenden Räumen tagen können. Die forstliche<br />
Atmosphäre, die von diesen Räumen ausgeht, ist, glaube<br />
ich, Garant dafür, daß der Teilaspekt Forstwirtschaft nicht<br />
übergangen und nicht übersehen werden kann. Es ist<br />
wohl ke<strong>in</strong> Vertreter der Oberforstdirektion anwesend, aber<br />
ich möchte Herrn Präsidenten Seefelder für die Überlassung<br />
dieser Räume sehr herzlich danken.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Nun, als erste aller Künste wird die Landwirtschaft<br />
heute sicher nicht von der Politik e<strong>in</strong>gestuft. Im Gegenteil:<br />
Die Landwirtschaft ist für die Politik e<strong>in</strong> schwieriges<br />
Problemfeld geworden, das von ihr aufwendiges Krisenmanagement<br />
erfordert, um zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>en Teil unerwünschter<br />
<strong>Entwicklung</strong>en abzuwehren. Die derzeitige<br />
Situation der Landwirtschaft läßt sich nicht mehr nur mit<br />
Strukturanpassung beschreiben. Nach Professor Seidl von<br />
der Fachhochschule Weihenstephan hat die derzeitige<br />
Situation im agrargeschichtlichen Vergleich bereits das<br />
Ausmaß e<strong>in</strong>er echten Agrarkrise angenommen. Diese<br />
E<strong>in</strong>schätzung gilt mit unterschiedlichen Ausprägungen<br />
natürlich für die gesamte Landwirtschaft der EU-Staaten.<br />
Sichtbares Zeichen dieser heutigen Krise ist die <strong>in</strong> den<br />
letzten Jahren sehr stark rückläufige Zahl der landwirtschaftlichen<br />
Betriebe, und ich darf ganz kurz am Beispiel<br />
Bayern diese <strong>Entwicklung</strong> demonstrieren.<br />
Auffällig ist die kont<strong>in</strong>uierlich abnehmende Zahl der<br />
Betriebe<br />
Während <strong>in</strong> den letzten 10 Jahren die Abnahmerate bei<br />
2,2 %/Jahr lag, war die Abnahmerate <strong>in</strong> den letzten fünf<br />
Jahren bei 2,7 % gelegen. Man sieht vor allem <strong>in</strong> den<br />
Jahren 1991 und 1993 die stärkere Neigung dieser Kurve.<br />
Nur die Betriebe über 30 ha nehmen absolut und natürlich<br />
relativ noch zu.<br />
E<strong>in</strong>führungsreferate <strong>in</strong> den Arbeitskreis 3<br />
123
Insgesamt ist die Zahl der Betriebe stark rückläufig.<br />
Die Übergänge vom Haupterwerbsbetrieb zum Nebenerwerbsbetrieb<br />
s<strong>in</strong>d hier nicht dargestellt., nur die<br />
tatsächlich aufgegebenen Betriebe. In absoluten Zahlen<br />
bedeutet dies, daß pro Jahr etwa 6 000 Betriebe <strong>in</strong> Bayern<br />
für immer ihre Hoftore schließen, und re<strong>in</strong> statistisch<br />
gesehen werden seit Beg<strong>in</strong>n der <strong>Fachtagung</strong> bis zum Ende<br />
des heutigen Tages wieder 32 Betriebe ihre Produktion<br />
e<strong>in</strong>gestellt haben.<br />
Vier Ereignisse der jüngsten Vergangenheit haben diese<br />
<strong>Entwicklung</strong> von der Tendenz her noch verschärft bzw.<br />
werden sie noch verschärfen.<br />
1. Die Grenzöffnung nach Osteuropa,<br />
2. Die EU-Agrarreform,<br />
3. Die Verwirklichung des EU-B<strong>in</strong>nenmarktes,<br />
4. Die Gatt-Abschlüsse.<br />
Diese Krise ist sicher mehrschichtig. Sie hat <strong>in</strong> jedem<br />
Fall e<strong>in</strong>e ökonomische Komponente, e<strong>in</strong>e ökonomische<br />
Dimension, denn unter den gegebenen verschlechterten<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen läßt sich für viele Betriebe über die<br />
konventionelle Wirtschaftsform ke<strong>in</strong> ausreichendes<br />
E<strong>in</strong>kommen mehr erwirtschaften. Die Ursachen hierfür<br />
s<strong>in</strong>d ausreichend bekannt und brauchen nicht wiederholt<br />
werden. Ähnliches gilt auch im forstwirtschaftlichen<br />
Bereich. Auch hier haben wir e<strong>in</strong>en rapiden Preisverfall bei<br />
den Produkten, und zum Teil können die Produkte gar<br />
nicht mehr auf dem Markt untergebracht werden. Ich<br />
er<strong>in</strong>nere nur an die ganze Schwachholzproblematik.<br />
Das E<strong>in</strong>kommen der Familienarbeitskräfte <strong>in</strong> den alten<br />
Bundesländern war <strong>in</strong> den letzten Jahren tendenziell rückläufig.<br />
(s. Graphik S. 125 oben) Auch für das laufende<br />
Wirtschaftsjahr s<strong>in</strong>d weitere E<strong>in</strong>kommense<strong>in</strong>bußen (um<br />
10 bis 15 %) prognostiziert, so daß der negative Trend<br />
noch nicht gebrochen ist. Der Abstand zum gewerblichen<br />
Vergleichslohn hat sich mittlerweile auf 35 % erhöht.<br />
Wohl liegt der deutsche Landwirt im Vergleich mit se<strong>in</strong>en<br />
Kollegen <strong>in</strong> den EU-Staaten immernoch im unteren<br />
Mittelfeld, aber diese E<strong>in</strong>stufung täuscht e<strong>in</strong>e gewisse<br />
Vorzüglichkeit vor, denn der deutsche Landwirt hat <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em Hochpreisland wie Deutschland beispielsweise hohe<br />
Lebenshaltungskosten und hohe Kosten der sozialen<br />
Sicherheit zu tragen und kann sich deshalb nicht mit<br />
se<strong>in</strong>en Kollegen aus Griechenland oder aus Portugal vergleichen.<br />
(s. Graphik S. 125 unten)<br />
Bei e<strong>in</strong>er Analyse des E<strong>in</strong>kommens bzw. des Gew<strong>in</strong>ns<br />
wird deutlich, daß die staatlichen E<strong>in</strong>kommensübertragungen<br />
e<strong>in</strong>en beachtlichen Anteil daran haben. So kann<br />
davon ausgegangen werden, daß im Durchschnitt bei den<br />
Haupterwerbsbetrieben Bayerns im laufenden Wirtschaftsjahr<br />
1993/94 voraussichtlich 70 bis 75 % des<br />
Gew<strong>in</strong>ns aus direkten staatlichen E<strong>in</strong>kommensübertragungen<br />
stammen werden. Dieser Anteil wird beim letzten<br />
Schritt der Agrarreform im nächsten Jahr evtl. nochmals<br />
ansteigen. Für Oberfranken ist diese Situation besonders<br />
gravierend. Hier soll sich der staatliche Anteil bei den<br />
Haupterwerbsbetrieben im Jahr 1993/94 bei ca. 80 bis<br />
100 % des Gesamtgew<strong>in</strong>ns bewegen, d.h. ohne Ausgleiche<br />
s<strong>in</strong>d die Betriebe mittelfristig nicht mehr existenzfähig.<br />
Und weil ich gerade Herrn Vielhuber dort h<strong>in</strong>ten entdecke:<br />
Am letzten Freitag, Herr Vielhuber, waren vor dem<br />
Amt für Landwirtschaft <strong>in</strong> Bamberg die Landwirte bei der<br />
Abgabe ihres Mehrfachantrags Schlange gestanden. Es<br />
wird wahrsche<strong>in</strong>lich <strong>in</strong> Bayern überall ähnlich gewesen<br />
se<strong>in</strong>. Ich weiß nicht, wie es Ihnen bei e<strong>in</strong>em solchen<br />
Anblick ergeht, mich hat diese Menschenschlange schon<br />
an »Armenspeisung« er<strong>in</strong>nert.<br />
Hier deutet sich bereits die zweite Dimension dieser<br />
Krise an, nämlich die e<strong>in</strong>er S<strong>in</strong>nkrise. Ich möchte dazu e<strong>in</strong><br />
paar Schlaglichter aufblenden.<br />
Welcher freie Unternehmer hängt sich schon freiwillig<br />
an den Tropf des Staates, um se<strong>in</strong>e Existenz zu sichern?<br />
Und wenn <strong>in</strong> der veröffentlichten Me<strong>in</strong>ung — ich betone<br />
ausdrücklich »<strong>in</strong> der veröffentlichten Me<strong>in</strong>ung« — <strong>in</strong> diesem<br />
Zusammenhang der Landwirt immer wieder als lästiger<br />
Subventionsempfänger und als Schmarotzer der<br />
Gesellschaft bezeichnet wurde und zum Teil auch heute<br />
noch so bezeichnet wird, dann kann dies beim Bauern<br />
nicht ohne Wirkung bleiben. Dazu kommt noch, daß die<br />
unter den ökonomischen Zwängen erfolgte Wirtschaftsweise<br />
von den Medien sehr oft pauschal als Angriff auf<br />
die natürlichen Lebensgrundlagen, wie Boden und Wasser<br />
dargestellt wird und <strong>in</strong> der Landwirtschaft der Hauptverantwortliche<br />
für den Rückgang der Artenvielfalt und den<br />
Verlust von Lebensräumen gesehen wird.<br />
Tierhaltungen <strong>in</strong> größerem Umfang wurden und werden<br />
als Massentierhaltung deklariert, mit der viele Bürger<br />
nichtartgerechte Tierhaltung, ja, sogar Tierquälerei verb<strong>in</strong>den<br />
und assoziieren. Durch diese Vorhaltungen erlebt sich<br />
der Landwirt als Täter gegen die natürlichen Lebensgrundlagen.<br />
Gleichzeitig fühlt er sich jedoch als Opfer e<strong>in</strong>er zu<br />
Gunsten des exportorientierten Industriestandortes<br />
Deutschland ausgerichteten Wirtschaftspolitik.<br />
Die Stimmung unter den Bauern ist miserabel und noch<br />
katastrophaler, als sie sich auf Grund der ohneh<strong>in</strong><br />
schlechten Buchführungsergebnisse vermuten ließe. Vor<br />
allem die bäuerliche Jugend steigt nach den genannten<br />
erschwerenden Ereignissen der jüngsten Zeit massenweise<br />
aus. (s. Graphik S. 126)<br />
Wenn wir die Graphik auf Seite 126 betrachten, sehen<br />
Sie auf der oberen Darstellung die E<strong>in</strong>schätzung der<br />
Situation für die Hofnachfolger <strong>in</strong> den Betrieben nach der<br />
EG-Reform. und wenn Sie die Prozentzahlen aufaddieren,<br />
haben Sie e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>schätzung von 92 % der Befragten, die<br />
die Situation als »noch schlechter« oder als »schlechter als<br />
je zuvor« e<strong>in</strong>stufen.<br />
Die Überlegungen für die Zukunft, ob der Betrieb im<br />
Haupterwerb weitergeführt werden soll, beurteilen auch<br />
sehr viele Betriebe als nicht sehr günstig. Wenn wir nur<br />
124 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
125
Pessimismus auf der ganzen L<strong>in</strong>ie<br />
Repräsentative Befragung von 800 Betrieben zeigt<br />
die gedrückte Stimmung auf den Höfen<br />
die Beurteilungen »wahrsche<strong>in</strong>lich nicht« und »ganz sicher<br />
nicht« aufaddieren, dann sehen über 30 %, und wenn wir<br />
noch die Beurteilung »weiß noch nicht« mit re<strong>in</strong>nehmen,<br />
sehen mehr als 60 % der Betriebsleiter <strong>in</strong> der Fortführung<br />
ihres Haupterwerbsbetriebes ke<strong>in</strong>e Chance mehr. Und es<br />
ist ja auch ganz verständlich, wenn die Jugend heute den<br />
Betrieben davonläuft, denn wer will schon gerne <strong>in</strong> e<strong>in</strong>en<br />
Beruf h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>wachsen, <strong>in</strong> dem er möglicherweise e<strong>in</strong> Leben<br />
lang benachteiligt wird, wo ke<strong>in</strong>e leistungsgerechte Entlohnung<br />
zu erwarten ist, sondern Wochenendarbeit und<br />
kaum Freizeit. Wo man auf der Verliererseite steht und<br />
ausgegrenzt wird. Es ist für den Bauern demütigend und<br />
unerträglich, wenn er erfahren muß, daß se<strong>in</strong>e Arbeitsleistung<br />
und er selbst eigentlich gar nicht gebraucht werden<br />
und daß es besser wäre, wenn es nicht so viele<br />
Bauern gäbe. Ebenso ist es für den Bauern deprimierend,<br />
erleben zu müssen, daß se<strong>in</strong> Fleiß und se<strong>in</strong>e Leistungen<br />
sowie gute Ernten und hohe Erträge für die Gesellschaft<br />
zum Problem werden.<br />
Der Leidensdruck <strong>in</strong> der Landwirtschaft ist groß, aber es<br />
g<strong>in</strong>g <strong>in</strong> den letzten Monaten e<strong>in</strong> Ruck durch die Landwirtschaft.<br />
Es war auch nicht anders zu erwarten, denn es<br />
entspricht nicht der bäuerlichen Mentalität, <strong>in</strong> schwierigen<br />
Zeiten zu resignieren, sondern eher die Ärmel aufzukrempeln<br />
und nach neuen Wegen und Lösungen zu<br />
suchen. Ich b<strong>in</strong> überzeugt, daß die negative Selbste<strong>in</strong>schätzung<br />
mittelfristig e<strong>in</strong>er optimistischen Sichtweise<br />
weichen wird. Devisen wie »Jetzt erst recht« oder das<br />
Motto des Bamberger Manifests auf dem Bayerischen<br />
Bauerntag <strong>1994</strong> »Zukunft — trotz Gatt!« dokumentieren,<br />
daß die Bauern <strong>in</strong> die Offensive gehen und daß sie <strong>in</strong> dieser<br />
Krise nicht nur Risiko, sondern auch echte Chancen<br />
sehen. Es s<strong>in</strong>d vere<strong>in</strong>zelt schon gute Ansätze und ökonomische<br />
Erfolge zu erkennen. Neben e<strong>in</strong>er veröffentlichten<br />
Me<strong>in</strong>ung gibt es auch noch die öffentliche Me<strong>in</strong>ung, die<br />
die Landwirtschaft viel positiver sieht.<br />
Nach e<strong>in</strong>er Infas-Umfrage 1993 zeigten sich mehr als<br />
2 /3 der Verbraucher davon überzeugt, daß aus der deutschen<br />
Landwirtschaft die besten Nahrungsmittel kämen.<br />
70 % der Bevölkerung s<strong>in</strong>d der Me<strong>in</strong>ung, daß der Staat<br />
auch künftig die Landwirtschaft unterstützen soll, und<br />
90 % wollen auf e<strong>in</strong>e eigene Landwirtschaft nicht verzichten.<br />
Diese belegten Aussagen zeigen deutlich, daß das<br />
Image der heimischen Landwirtschaft stark zugenommen<br />
hat. Dies muß noch stärker <strong>in</strong> die Landwirtschaft E<strong>in</strong>gang<br />
f<strong>in</strong>den!<br />
Auch die Politik hat die gesellschaftlichen Leistungen<br />
der Landwirtschaft erkannt. So wird anerkennend registriert,<br />
daß die Landwirtschaft zum Nutzen der Verbraucher<br />
seit Jahren als Inflationsbremse wirkt (s. Graphik<br />
S. 127), daß sie die Ernährung sicherstellt und daß trotz<br />
des Rückgangs der Betriebe die ländlichen Räume, das<br />
s<strong>in</strong>d noch 87 % der bayerischen Landschaft, von der<br />
Land- und Forstwirtschaft <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Weise bewirtschaftet<br />
werden, die die breite Zustimmung der Bevölkerung<br />
f<strong>in</strong>det.<br />
Diese Pflege und Erhaltung des ländlichen Raums sieht<br />
die Bayerische Staatsregierung als e<strong>in</strong>e Domäne der<br />
Landwirtschaft und sie hat dafür das KULAP entwickelt<br />
und mit entsprechenden Mitteln ausgestattet.<br />
Selbst wenn Landwirtschaft nicht mehr synonym für<br />
ländlichen Raum stehen kann, weil der ländliche Raum<br />
heute vielfältige Aufgaben zu erfüllen hat, so wird — und<br />
davon b<strong>in</strong> ich überzeugt — die Landwirtschaft weiterh<strong>in</strong><br />
das Rückgrat dieses Raumes bilden, weil neben den ökonomischen<br />
Leistungen der Landwirtschaft ihre Wohl-<br />
126 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
127
fahrtsleistungen gebraucht werden und die bäuerliche<br />
Kultur als stabilisierender Faktor <strong>in</strong> der heutigen<br />
Gesellschaft unverzichtbar ist.<br />
Wenn es der Land- und Forstwirtschaft mit Unterstützung<br />
der Gesellschaft und Politik gel<strong>in</strong>gt, Mittel und<br />
Wege zu f<strong>in</strong>den, weiterh<strong>in</strong> die prägende Kraft des ländlichen<br />
Raums zu bleiben, wird sie die entsprechende gesellschaftliche<br />
und politische Anerkennung und die notwendige<br />
ökonomische Prosperität f<strong>in</strong>den, um die Krise<br />
überw<strong>in</strong>den zu können.<br />
Die Erhaltung und Sicherung des ländlichen Raums ist<br />
seit längerem bereits e<strong>in</strong> hohes Anliegen der Politik auf<br />
allen Ebenen. Bereits im Jahr 1987 hat die damalige EG<br />
e<strong>in</strong>e Kampagne für den ländlichen Raum ausgerufen. Seit<br />
heuer läuft die zweite Periode der 5 b-Förderung »<strong>Entwicklung</strong><br />
des ländlichen Raums« mit e<strong>in</strong>em Milliardenprogramm.<br />
Nicht nur die Politik, sondern auch Wissenschaft,<br />
Wirtschaft und Verwaltung fordern und fördern<br />
e<strong>in</strong>en vielfältigen ländlichen Raum für die Erhaltung der<br />
natürlichen Lebensgrundlagen.<br />
Da die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> für den ländlichen Raum<br />
Mitverantwortung trägt, ist es unsere Aufgabe, Strategien<br />
zu entwickeln, diesen Zukunftsraum zu stärken. E<strong>in</strong><br />
wesentlicher Aspekt dabei wird se<strong>in</strong> müssen, die bäuerliche<br />
Land- und Forstwirtschaft bei ihrer Zukunftsrolle zu<br />
unterstützen.<br />
Das Ziel unseres Arbeitskreises sehe ich deshalb dar<strong>in</strong>,<br />
1. aufzuzeigen, welche Aufgaben zukünftig von der Landund<br />
Forstwirtschaft wahrgenommen werden sollen<br />
und müssen, um e<strong>in</strong>mal aus den ökonomischen<br />
Schwierigkeiten herauszukommen und zum zweiten<br />
e<strong>in</strong>e politisch und gesellschaftlich anerkannte tragende<br />
Rolle für den ländlichen Raum zu übernehmen und<br />
2. zu überlegen, welche Instrumente die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
dazu hat bzw. braucht, um die Land- und<br />
Forstwirtschaft hierbei vorwärts zu br<strong>in</strong>gen.<br />
Me<strong>in</strong>e Damen und Herren, ich habe zur Aufbereitung<br />
dieser Thematik zwei Experten e<strong>in</strong>geladen, die ich Ihnen <strong>in</strong><br />
der Reihenfolge ihres Vortrages vorstellen darf.<br />
Herr Professor Seibert zu me<strong>in</strong>er Rechten betreut an<br />
der Fachhochschule Weihenstephan, Abteilung Triesdorf,<br />
das Fachgebiet Agrarökonomie. Er nimmt zur Zeit auch<br />
die Aufgabe des Dekans an der FH wahr und ist deshalb<br />
e<strong>in</strong> sehr beschäftigter Mann. Professor Seibert befaßt sich<br />
seit Jahren mit Fragen zukunftsträchtiger Formen der<br />
Landwirtschaft und gilt auf diesem Gebiet als Experte.<br />
Herr Professor Seibert, wir erwarten gespannt Ihre<br />
Strategien für e<strong>in</strong>e zukunftsorientierte Landwirtschaft.<br />
Vielen Dank, Herr Professor Seibert, für die umfassende<br />
Darstellung der Zukunftsaufgaben <strong>in</strong> der Landwirtschaft.<br />
Ihr Vortrag enthielt e<strong>in</strong>e Fülle von Anregungen für unsere<br />
spätere Arbeit <strong>in</strong> den Kle<strong>in</strong>gruppen.<br />
Wir dürfen mit dem nächsten e<strong>in</strong>führenden Vortrag,<br />
den Herr Danner halten wird, gleich weiterfahren. Herr<br />
Danner zu me<strong>in</strong>er L<strong>in</strong>ken ist als freiberuflicher Unternehmens-<br />
und Market<strong>in</strong>gberater tätig. Er führt <strong>in</strong> Ruhstorf<br />
(Niederbayern) e<strong>in</strong> Büro unter dem Namen »Team für<br />
angewandte Ökologie«. Die Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
Landau hat an ihn Aufträge mit dem Ziel vergeben,<br />
landwirtschaftliche Betriebs<strong>in</strong>haber <strong>in</strong> Verfahren<br />
der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> zu beraten, wie sie ihre<br />
Betriebe zukunftsträchtig ausrichten können. Auch für die<br />
Direktion München war er me<strong>in</strong>es Wissens bereits tätig.<br />
Herr Danner, ich darf Sie bitten, Ihre Vorschläge und<br />
Erfahrungen mit der Umsetzung von Market<strong>in</strong>gkonzepten<br />
für die Land- und Forstwirtschaft <strong>in</strong> Verfahren der <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> den Arbeitskreis e<strong>in</strong>zubr<strong>in</strong>gen.<br />
Herr Danner, Sie haben e<strong>in</strong> wahres Feuerwerk abgebrannt<br />
und wie Sie an dem Beifall erkennen können,<br />
haben Sie die Zuhörer mitgerissen Die Atmosphäre hat<br />
jetzt e<strong>in</strong>en Höhepunkt erreicht, so daß ich es an sich<br />
bedauere, Sie <strong>in</strong> die Kaffeepause entlassen zu müssen. Ich<br />
hoffe aber, daß Sie diese Stimmung über die Pause h<strong>in</strong>weg<br />
konservieren können, damit wir mit der geweckten<br />
Begeisterung verschiedene Teilaspekte des Arbeitskreisthemas<br />
<strong>in</strong> Kle<strong>in</strong>gruppen mit Moderatorentechnik<br />
bearbeiten können.<br />
Ich darf Ihnen kurz noch aufzeigen, was Sie nach der<br />
Pause erwarten wird:<br />
Es sollen Kle<strong>in</strong>gruppen zu folgenden Bauste<strong>in</strong>en gebildet<br />
werden.<br />
Teilaspekte<br />
1. Bäuerliche Waldwirtschaft<br />
2. Umweltleistungen der Landwirtschaft<br />
3. Erwerbsalternativen und Marktnischen<br />
4. Dienstleistungen durch die Landwirtschaft<br />
5. Konventionelle Landwirtschaft —<br />
zukunftsorientiert<br />
Die Moderatoren der Kle<strong>in</strong>gruppe werden Ihnen zur<br />
Technik e<strong>in</strong>e kurze E<strong>in</strong>weisung geben. Ich darf Sie bitten,<br />
sich den Aspekt auszusuchen und dort mitzuarbeiten, wo<br />
Sie Ihre Erfahrung am besten e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen können. Unsere<br />
ausländischen Gäste bitte ich, sich nach Möglichkeit<br />
gleichmäßig auf die verschiedenen Gruppen zu verteilen.<br />
Zur Kle<strong>in</strong>gruppenbildung f<strong>in</strong>den Sie auf den h<strong>in</strong>teren<br />
Tischen verschiedenfarbige Umdrucke mit Motiven zu den<br />
zu bearbeitenden Teilaspekten. Die Umdrucke s<strong>in</strong>d frei<br />
handelbar, und Sie können <strong>in</strong> der Pause noch tauschen,<br />
wenn Sie me<strong>in</strong>en, daß Sie zu e<strong>in</strong>em anderen Thema mehr<br />
beitragen können. Ausgewogene Gruppenbesetzung wäre<br />
wünschenswert.<br />
128 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Otmar Seibert<br />
Strategien für e<strong>in</strong>e zukunftsorientierte<br />
Landwirtschaft<br />
Bauern auf der roten Liste?<br />
Mit der Überschrift »Bauern bald auf der roten Liste?«<br />
wies am 23. Sept. 1993 die Fränkische Landeszeitung auf<br />
den dramatischen Rückgang von Auszubildenden <strong>in</strong><br />
Agrarberufen h<strong>in</strong>. Laut BML-Statistik halbierte sich deren<br />
Zahl <strong>in</strong> den letzten 12 Jahren. Ende 1992 schlossen nur<br />
noch 32 000 Jungendliche e<strong>in</strong>e Agrarausbildung ab. Und<br />
für e<strong>in</strong>e Lehre direkt auf dem Bauernhof entschieden sich<br />
1993 bundesweit nur noch 8 200 Jungendliche. Lohnt es<br />
sich vor diesem H<strong>in</strong>tergrund überhaupt noch, über<br />
»Strategien für e<strong>in</strong>e zukunftsorientierte Landwirtschaft«<br />
zu reden?<br />
Als Ursache des Abwärtstrends verwies die zitierte<br />
Zeitung auf die drastischen Preisrückgänge bei vielen<br />
Agrarprodukten, die potentielle Berufsanfänger abschreckten.<br />
Doch trifft dieser monokausale Ansatz den<br />
Kern des Problems? Er unterstellt e<strong>in</strong>e Mono-Funktionalität<br />
der Landwirtschaft, die nie existiert hat; er vernachlässigt<br />
aktuelle und für die Landwirtschaft grundlegende<br />
wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen<br />
und nimmt auch ke<strong>in</strong>en Bezug auf die Anpassungsfähigkeiten<br />
der landbewirtschaftenden Bevölkerung an<br />
sich verändernde Rahmenbed<strong>in</strong>gungen.<br />
Landwirtschaft — e<strong>in</strong> traditionell<br />
multifunktionales Gewerbe<br />
Historisch betrachtet hat die landbewirtschaftende<br />
Bevölkerung stets mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllt:<br />
Die Produktion von Nahrungsmitteln für Märkte und zur<br />
Eigenversorgung, aber auch die Gestaltung der Landschaft<br />
und die Sicherung natürlicher Ressourcen. Sie bot Beschäftigung<br />
für ländliches Handwerk, Dienstleistungen<br />
und Handel. Landwirtschaftliche Arbeitskräfte schufen<br />
entscheidende Grundlagen für die gewerbliche Erschließung<br />
unserer Räume.<br />
Der Wert der von den landwirtschaftlichen Haushalten<br />
erbrachten Leistungen hat sich im Zeitverlauf deutlich<br />
gewandelt. Während der ökonomische Beitrag der deutschen<br />
Landwirtschaft, gemessen an Wertschöpfung und<br />
Beschäftigung, immer marg<strong>in</strong>aler wird, rücken mit der Bewirtschaftung<br />
verbundene positive externe Effekte stärker<br />
<strong>in</strong> den Vordergrund. Ihre Bedeutung für die Lebensverhältnisse<br />
der Bevölkerung, die Qualität der Umwelt und<br />
die wirtschaftliche <strong>Entwicklung</strong> der ländlichen Räume<br />
steigt. Andererseits gerät ihr Angebot <strong>in</strong> dem Maße <strong>in</strong><br />
Gefahr, <strong>in</strong> dem die Zahl der Bauern schrumpft und die<br />
wenigen Verbleibenden unter ökonomischem Druck<br />
Entscheidungen treffen, die zu gesellschaftlich unerwünschten<br />
Folgen führen.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Konflikte und aktuelle Lösungsansätze<br />
Die geme<strong>in</strong>same Markt- und Preispolitik hat die<br />
Landwirte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Falle gelockt und den Agrarsektor <strong>in</strong><br />
wachsende Konflikte mit Gesellschaft und Umwelt<br />
geführt. Die künftige Rolle der Landwirtschaft wird auch<br />
davon abhängen, <strong>in</strong>wieweit es gel<strong>in</strong>gt, die folgenden<br />
Konflikte zu entschärfen:<br />
(1) Unbefriedigende Lebensverhältnisse <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er wachsenden<br />
Zahl landbewirtschaftender Haushalte als Folge<br />
beschränkter E<strong>in</strong>kommenskapazitäten, hoher Arbeitsbelastung,<br />
steigender f<strong>in</strong>anzieller Risiken und wachsender<br />
sozialer Isolierung;<br />
(2) Verschwendung knapper Ressourcen für die Produktion<br />
am Markt nicht absetzbarer Überschüsse;<br />
(3) F<strong>in</strong>anzaufwendungen für die Verwertung der Überschüsse<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Ausmaß, das weder ökonomisch<br />
tragbar noch sozialstaatlich zu rechtfertigen ist;<br />
(4) Handelspolitische Konkurrenzen mit den führenden<br />
Agrarexportnationen der Welt ebenso wie mit <strong>Entwicklung</strong>sländern,<br />
denen trotz ihrer wirtschaftlichen<br />
Abhängigkeit vom Agrarsektor durch verzerrte Weltmarktpreise<br />
lebensnotwendige Exporterlöse vorenthalten<br />
werden;<br />
(5) Abweichungen zwischen den Qualitätsanforderungen<br />
der Verbraucher an Nahrungsmittel und den Qualitätseigenschaften<br />
weitgehend standardisierter<br />
Massenware;<br />
(6) Vielgestaltige Umweltkonflikte wie Belastungen von<br />
Boden, Wasser und Luft, Arten-Verarmung und landschaftliche<br />
Monotonie, negative Energiebilanzen usw.<br />
Diese Konfliktfelder lassen sich zu drei Faktorbündeln<br />
verdichten, von denen die künftige Rolle der Landwirtschaft<br />
<strong>in</strong> den ländlichen Räumen geprägt wird:<br />
— Vorgaben der nationalen und <strong>in</strong>ternationalen Agrarpolitik,<br />
die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse<br />
<strong>in</strong> den ländlichen Räumen (<strong>in</strong>sbes. Arbeitsmärkte), der<br />
f<strong>in</strong>anzielle Rahmen für die Landwirtschaft;<br />
— Anforderungen der Gesellschaft an die Landwirtschaft<br />
h<strong>in</strong>sichtlich Produktionsentwicklung, Produktqualität,<br />
Sicherung der natürlichen Umwelt, Erhaltung sozialer<br />
Netzwerke e<strong>in</strong>schließlich »traditioneller« bäuerlicher<br />
Werte;<br />
— Das Anpassungsverhalten der Landwirte, die Wahl ihrer<br />
Wirtschaftsweisen, ihre Innovationskraft und<br />
Professionalität <strong>in</strong> der Ausfüllung ihrer künftigen Rolle.<br />
Diese E<strong>in</strong>flußfaktoren s<strong>in</strong>d Ausdruck dynamischer<br />
<strong>Entwicklung</strong>en und beschreiben den Rahmen für<br />
Strategien für e<strong>in</strong>e zukunftsorientierte Landwirtschaft.<br />
Zwar s<strong>in</strong>d diese Faktoren aus regionaler Sicht <strong>in</strong> hohem<br />
Maße »fremdbestimmt«. Doch liegt e<strong>in</strong> relativ hohes<br />
Gestaltungspotential auch im Verhalten der landwirtschaftlichen<br />
Haushalte selbst. Es ist weit weniger uniform,<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
129
als die offizielle Politik — z. B. bei der Formulierung von<br />
Programmen — unterstellt und bietet e<strong>in</strong>e breite Palette<br />
an dezentral entwicklungsfähigen Alternativen. Insoweit<br />
liegt die Wahl von <strong>Entwicklung</strong>sstrategien und damit<br />
zugleich die künftige Rolle der Landwirtschaft <strong>in</strong> den<br />
ländlichen Räumen zu e<strong>in</strong>em erheblichen Teil <strong>in</strong> den<br />
Händen der ländlichen Bevölkerung selbst.<br />
Zur Entschärfung der angeführten Konflikte wird von<br />
der EU seit 1992/93 der Abbau staatlicher Preis- und<br />
Absatzstützung <strong>in</strong> Richtung auf Weltmarktkonditionen<br />
betrieben, flankiert von großdimensionierten Transferzahlungen<br />
an die Landwirte. Diese für die nächsten Jahre<br />
vorgezeichnete Strategie stellt e<strong>in</strong>seitig auf die Verm<strong>in</strong>derung<br />
wirtschaftlicher und welthandelsbezogener Probleme<br />
ab. Unterbelichtet bleiben die regionalen und ökologischen<br />
Effekte dieser Politik, die Sicherung der nicht<br />
auf Märkten handelbaren Leistungen der Landwirtschaft,<br />
aber auch die Akzeptanz der Transfers durch Bauern und<br />
Gesellschaft. Angesichts der (zum<strong>in</strong>dest relativ) abnehmenden<br />
f<strong>in</strong>anziellen Leistungsbereitschaft des Staates, der<br />
E<strong>in</strong>flüsse des Europäischen B<strong>in</strong>nenmarktes und der unzureichenden<br />
Berücksichtigung regionaler und ökologischer<br />
Effekte der Agrarentwicklung ist deshalb unter status<br />
quo-Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>e stärkere funktionale Trennung<br />
der ländlichen Räume zu erwarten. Davon dürften gerade<br />
jene Betriebe gefährdet werden, die bisher relativ<br />
umweltfreundlich gewirtschaftet haben.<br />
Unter status quo-Bed<strong>in</strong>gungen, d.h. ohne grundlegende<br />
Veränderungen <strong>in</strong> der Agrarpolitik und im Anpassungsverhalten<br />
der Landwirte, wird der Strukturwandel mit<br />
Unterstützung der Agrarreform regionale Spezialisierungstendenzen<br />
verstärken, letztlich <strong>in</strong> Richtung zweier<br />
Extreme:<br />
— Produktion von Nahrungsgütern und Energierohstoffen<br />
<strong>in</strong> immer weniger Regionen <strong>in</strong> natürlicher Gunstlage<br />
und mit großbetrieblichen Strukturen, auf hohem<br />
Intensitätsniveau und <strong>in</strong> der Wahl der Betriebsorgani-<br />
sation relativ unabhängig von den <strong>Entwicklung</strong>s- (und<br />
Lebens-)vorstellungen der betroffenen ländlichen<br />
Bevölkerung.<br />
— Breite Extensivierung bis h<strong>in</strong> zu großräumiger Aufgabe<br />
der Bewirtschaftung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er wachsenden Zahl von<br />
Grenzertrags- und Übergangsstandorten; die Reduzierung<br />
der Betriebszahlen führt hier zu e<strong>in</strong>em sich<br />
selbst verstärkenden Abwärtstrend, der aufgrund<br />
s<strong>in</strong>kender Auslastung auch E<strong>in</strong>schränkungen <strong>in</strong> den<br />
Vermarktungs- und Beschaffungsmöglichkeiten sowie<br />
bei landwirtschaftsbezogenen Dienst- und Beratungsleistungen<br />
verursacht. Während dabei <strong>in</strong> den Produktionsregionen<br />
mit günstigen natürlichen und wirtschaftlichen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen ökonomischer Interessen<br />
das Angebot gesellschaftlich erwünschter Nebenleistungen<br />
unterdrücken dürften, gerät die Schaffung<br />
positiver externer Effekte der Landwirtschaft <strong>in</strong> den<br />
weniger von Natur begünstigten, überwiegend kle<strong>in</strong>strukturierten<br />
Regionen gerade wegen der wirtschaftlichen<br />
Unterauslastung landwirtschaftlicher Produktionsfaktoren<br />
<strong>in</strong> Gefahr. Bei Fortführung der Landbewirtschaftung<br />
korrelieren niedrige landwirtschaftliche<br />
Grenzerträge i.d.R. mit hohen ökologischen Grenznutzen.<br />
Folglich kann die Dualisierung der Landwirtschaft<br />
mit funktionaler Trennung der ländlichen<br />
Räume nicht der Weg der Zukunft se<strong>in</strong>, um möglichst<br />
flächendeckend bäuerliche Strukturen und ökologisch<br />
verträgliche Wirtschaftsweisen zu erhalten.<br />
Änderung der Wirtschaftsweisen,<br />
E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ation<br />
Auch weiterh<strong>in</strong> wird e<strong>in</strong>e wesentliche Aufgabe der<br />
Landwirte dar<strong>in</strong> bestehen, konventionell <strong>in</strong>tensiv hergestellte<br />
Massengüter anzubieten. Der Markt für diese<br />
Produkte wird jedoch immer beschränkter, e<strong>in</strong>mal durch<br />
den härter werdenden Wettbewerb auf den Weltmärkten<br />
und die schrumpfenden Budgetspielräume für die F<strong>in</strong>an-<br />
Arbeitskreisteilnehmer diskutieren<br />
Konflikte und aktuelle<br />
Lösungsansätze<br />
130 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
zierung der Marktordnungen, zum anderen als Folge der<br />
ger<strong>in</strong>gen Wertschöpfung, die mit diesen Grundprodukten<br />
auf der Produktionsstufe erzielt werden kann. In der landwirtschaftlichen<br />
Grundstoffproduktion können künftig<br />
nur die Wenigen überleben, die sehr große Mengen<br />
produzieren.<br />
Bei begrenzter Produktionskapazität muß deshalb die<br />
Erhöhung der Wertschöpfung stärker <strong>in</strong> den Vordergrund<br />
gerückt werden als das Mengenwachstum. Dies verlangt<br />
e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tensivere Berücksichtigung von Qualitätsaspekten<br />
und Umweltanforderungen, neue Qualifikationen der<br />
Bewirtschafter sowie für den Kunden transparentere<br />
Wirtschaftsweisen. Die Märkte entwickeln sich immer<br />
mehr von Verkäufer- zu Käufermärkten. Deshalb muß der<br />
Kunde die Produktionsmethoden kennen und verstehen<br />
können, wenn er dauerhaft Kunde bleiben soll.<br />
Zusammenfassend betrachtet ist somit e<strong>in</strong>e möglichst<br />
flächendeckende Fortführung der Landbewirtschaftung<br />
und die Sicherung der von den Landwirten geschaffenen<br />
öffentlichen Güter an drei Grundvoraussetzungen<br />
gekoppelt:<br />
(1) Anpassung der Produktionsmengen an die Nachfrage,<br />
um natürliche wie f<strong>in</strong>anzielle Ressourcen zu schonen.<br />
(2) Ausrichtung der Wirtschaftsweisen an natürlichen<br />
Kreislaufzusammenhängen und Förderung e<strong>in</strong>zelbetrieblicher<br />
und regionaler Strukturen, die wirtschaftliche,<br />
ökologische und soziale Aufgabenstellungen<br />
möglichst harmonisch verb<strong>in</strong>den.<br />
(3) Veränderungen <strong>in</strong> den Erwerbsstrukturen der bäuerlichen<br />
Haushalte.<br />
Aus ökonomischer Sicht ist es weith<strong>in</strong> unbestritten, daß<br />
die Sicherung positiver externer Effekte <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit<br />
e<strong>in</strong>er sozial, ökologisch und an Marktkräften orientierten<br />
Landbewirtschaftung kostengünstiger und im Gesamteffekt<br />
auch vorteilhafter ist als e<strong>in</strong>e funktionale Trennung<br />
von <strong>in</strong>tensiver Produktion e<strong>in</strong>erseits und re<strong>in</strong>er Flächenpflege<br />
andererseits.<br />
E<strong>in</strong>e Grundvoraussetzung dafür bietet e<strong>in</strong>e komb<strong>in</strong>ierte<br />
E<strong>in</strong>kommenspolitik: Abbau der e<strong>in</strong>kommensorientierten<br />
Preisstützung und Ergänzung der »Markte<strong>in</strong>kommen«<br />
durch produktionsneutrale Leistungse<strong>in</strong>kommen aus der<br />
Bereitstellung öffentlicher Güter.<br />
Während die Gestaltung der Landschaft und die<br />
Sicherung von Umweltgütern <strong>in</strong> der Vergangenheit von<br />
den Bauern aus Eigen<strong>in</strong>teresse und damit quasi als<br />
Nebenprodukt erbracht wurden, geraten die ökologischen<br />
Nebenleistungen der Landwirtschaft <strong>in</strong> dem Maße <strong>in</strong><br />
Gefahr, <strong>in</strong> dem die Anwendung moderner Technik die<br />
Vernachlässigung des Kreislaufdenkens erlaubt und die<br />
Agrarpolitik — bis <strong>in</strong> die jüngste Zeit h<strong>in</strong>e<strong>in</strong> — Spezialisierung<br />
und Intensivierung fördert. Als Konsequenz<br />
müssen bestimmte ökologische Leistungen der Landwirtschaft<br />
künftig bewußt erbracht und <strong>in</strong> der Agrarpolitik als<br />
besondere Aufgabe behandelt werden. Das heißt zugleich,<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
der Landwirtschaft künftig nicht alle<strong>in</strong> ihre wirtschaftliche,<br />
sondern auch ihre ökolologische Wertschöpfung zu<br />
vergüten.<br />
Damit die Transfers von den Landwirten und der<br />
Gesellschaft als »Leistungse<strong>in</strong>kommen« verstanden werden,<br />
s<strong>in</strong>d konkrete Leistungsmerkmale zu def<strong>in</strong>ieren.<br />
PRIEBE spricht <strong>in</strong> diesem Zusammenhang von e<strong>in</strong>em<br />
»agrarkulturellen Ordnungsrahmen für naturgerechte<br />
Wirtschaftsformen«, der den Landwirten Orientierungshilfen<br />
für e<strong>in</strong>e ökonomisch e<strong>in</strong>trägliche und ökologisch<br />
verträgliche Wirtschaftsweise bieten sollte.<br />
E<strong>in</strong> erheblicher Schwachpunkt ist <strong>in</strong> diesem Zusammenhang<br />
das bisherige System der Marktpreisbildung. Je<br />
stärker sich die Landbewirtschaftung von re<strong>in</strong> wirtschaftlichen<br />
Interessen der Produktion möglichst großer und<br />
homogener Mengen löst, um so weniger können verzerrte<br />
Preise auf anonymen Märkten Maßstab für die Faktorentlohnung<br />
se<strong>in</strong>. Wenn aufgrund e<strong>in</strong>er unvollständigen<br />
Kostenrechnung z. B. weder negative Umwelteffekte<br />
weiter Transporte noch soziale Aspekte der Strukturentwicklung<br />
oder die Folgen der Ausbeutung von Land und<br />
Kle<strong>in</strong>bauern <strong>in</strong> <strong>Entwicklung</strong>sländern berücksichtigt<br />
werden, verliert der Preis se<strong>in</strong>en orig<strong>in</strong>ären Charakter als<br />
Knappheits<strong>in</strong>dikator.<br />
E<strong>in</strong>e qualitativ hochwertige Nahrungsversorgung auf<br />
der Basis ökologisch und sozial verträglicher Produktionsund<br />
Marktsyteme verlangt deshalb geradezu nach regional<br />
überschaubaren Marktradien. Die Kenntnis der Produktionsmethoden<br />
gibt dem Kunden zudem Qualitätssicherheit<br />
und der Kontakt zum Kunden dem Bauern<br />
e<strong>in</strong>en sicheren (Teil-) Umsatz.<br />
Mehrfachbeschäftigung als Anpassungs- und<br />
Verhaltensmuster bäuerlicher Familien<br />
Will der Bauer überhaupt externe Leistungen erbr<strong>in</strong>gen?<br />
Wenn Leistungen wie z. B. die Landschaftspflege als<br />
Leistung identifizierbar s<strong>in</strong>d, leistungsbezogen honoriert<br />
werden und den Landwirten zugleich ökonomisches<br />
Verhalten unterstellt wird, erübrigt sich diese Frage. Die<br />
zentrale Frage für immer mehr landwirtschaftliche<br />
Haushalte lautet vielmehr: F<strong>in</strong>den sie Möglichkeiten zur<br />
Mehrfachbeschäftigung, um E<strong>in</strong>kommensdefizite aus<br />
landwirtschaftlicher Tätigkeit aus anderen Erwerbsquellen<br />
zu ergänzen und wie können die Anforderungen von<br />
Betrieb, Haushalt und ergänzender Beschäftigung möglichst<br />
konfliktfrei mite<strong>in</strong>ander <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang gebracht werden?<br />
Welche Anforderungen werden an Bauern gestellt,<br />
die e<strong>in</strong>e Diversifizierung ihrer Erwerbsgrundlagen planen<br />
und welche Hilfen wären für diesen Schritt erforderlich?<br />
Im System bäuerlicher Familienwirtschaft bildet der<br />
Haushalt den Zellkern, von dem aus die <strong>Entwicklung</strong> von<br />
Produktion, Verbrauch und Reproduktion gesteuert wird.<br />
E<strong>in</strong> Haushalt verfügt zu jedem Zeitpunkt über e<strong>in</strong>e<br />
bestimmte Austattung mit Produktionsfaktoren, deren<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
131
Komb<strong>in</strong>ation e<strong>in</strong>en bestimmten Haushaltstyp beschreibt.<br />
Zum<strong>in</strong>dest <strong>in</strong> Europa lassen sich ubiquitär monoaktive,<br />
pluriaktive und sogen. Aussteiger-Haushalte erkennen.<br />
Jeder Haushaltstyp hat unterschiedliche Voraussetzungen<br />
und Ansprüche. Dies ergab e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>ternationale Untersuchung<br />
<strong>in</strong> 24 europäischen Regionen, die im Auftrag der<br />
EG 1993 abgeschlossen wurde.<br />
Die Haushalte agieren <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em räumlichen und sozialen<br />
Kontext, von dem ihre Ausstattung mit Ressourcen,<br />
deren Nutzungsalternativen und die Restriktionen <strong>in</strong> der<br />
Faktornutzung abhängen. Dazu rechnen auch kulturelle<br />
Aspekte, wie sie etwa <strong>in</strong> Gestalt regional verbreiteter<br />
Normen und Verhaltensmuster zum Ausdruck kommen.<br />
Europaweit konnten m<strong>in</strong>destens 5 Regionstypen identifiziert<br />
werden, wiederum mit unterschiedlichen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen und Ansprüchen.<br />
Die drei Haushaltstypen zeigen <strong>in</strong> den jeweiligen<br />
Regionstypen unterschiedliche Anspassungsmuster bei<br />
der Reaktion auf veränderte <strong>in</strong>terne und externe Verhältnisse.<br />
Insoweit ergeben sich klare Verb<strong>in</strong>dungen<br />
zwischen der strukturellen Situation, dem regionalen<br />
Kontext und der Dynamik <strong>in</strong> Haushalt und Betrieb. In der<br />
genannten Untersuchung wurden drei Verhaltens-Grundmuster<br />
festgestellt:<br />
— Professionalisierung,<br />
— Stabiles Verharren,<br />
— Verm<strong>in</strong>derung landwirtschaftlicher Aktivitäten.<br />
In Regionen, die mit den deutschen Verhältnissen (h<strong>in</strong>sichtlich<br />
Zentralität, Arbeitsmarktverhältnissen, Agrarstruktur,<br />
Abhängigkeit von der Landwirtschaft usw.) vergleichbar<br />
s<strong>in</strong>d, waren nur 18 % landwirtschaftlich monoaktiv,<br />
bereits 55 % pluriaktiv und 25 % auf dem Weg des<br />
Ausstiegs. Dieses Bild entspricht der bisherigen Strukturpolitik<br />
sicher nicht, deren Klientel primär Vollerwerbs-<br />
Wachstumsbetriebe waren.<br />
Diese Erkenntnis leitet zu e<strong>in</strong>er generellen Folgerung<br />
über: Soll die Landwirtschaft auch künftig e<strong>in</strong>e Vielfalt an<br />
Funktionen <strong>in</strong> ländlichen Räumen übernehmen, kann der<br />
Erwerbscharakter der landwirtschaftlichen Betriebe nicht<br />
länger zentrales Förderkriterium se<strong>in</strong>. Wichtiger als der<br />
relative Anteil verschiedener E<strong>in</strong>kommen am Erwerbse<strong>in</strong>kommen<br />
des Bewirtschafterpaares s<strong>in</strong>d vielmehr das<br />
Engagement und die Professionalität <strong>in</strong> der Nutzung der<br />
Ressourcen von Haushalt und Betrieb, die fachliche und<br />
persönliche Qualifikation der Haushaltsmitglieder und<br />
deren <strong>Entwicklung</strong>sperspektiven sowie konkrete<br />
Marktchancen.<br />
Daß »Professionalität« dabei nicht nur im traditionellen<br />
Wachstumss<strong>in</strong>ne gefordert werden muß, zeigen zahlreiche<br />
Beispiele aus der genannten EG-Untersuchung. Wird<br />
Professionalisierung als Prozeß verstanden, bei dem es um<br />
e<strong>in</strong>en möglichst effizienten E<strong>in</strong>satz von Ressourcen zur<br />
Erreichung vom Haushalt vorgegebener Ziele geht, eröffnet<br />
dies auch mehrfachbeschäftigten Haushalten vielfältige<br />
Optionen, z. B.:<br />
Innovationen zur Erschließung von Alternativen <strong>in</strong><br />
Produktion, im Angebot von Dienstleistungen und <strong>in</strong> der<br />
Vermarktung;<br />
Ressourcenoptimierung mit dem Ziel, e<strong>in</strong>e möglichst<br />
günstige Verwertung aller verfügbaren Faktoren e<strong>in</strong>es<br />
Haushalts, <strong>in</strong>sbesondere der (oft reichlich vorhandenen)<br />
Arbeitskraft, zu erreichen.<br />
Für beide Fälle lassen sich <strong>in</strong> Europa vielfältige Formen<br />
ergänzender betriebsbezogener Tätigkeiten nachweisen,<br />
sowohl auf traditionellen Gebieten wie z.B. Landschaftspflege<br />
und überbetriebliches Masch<strong>in</strong>enangebot (Ressourcenoptimierung)<br />
als auch auf neuen Märkten bei der<br />
E<strong>in</strong>führung neuer Produkte, der eigenen Verarbeitung,<br />
dem Angebot von Dienstleistungen, touristischen und<br />
naturkundlichen Aktivitäten usw. (Innovationen).<br />
Welcher Bauer hat noch Zukunft und<br />
welches Berufsbild hat der Bauer der<br />
Zukunft?<br />
Das Sprichwort »Jedes Risiko birgt auch e<strong>in</strong>e Chance«<br />
kennzeichnet treffend die derzeitige Situation vieler landwirtschaftlicher<br />
Haushalte. Strukturwandel, Abbau staatlicher<br />
Stützung, verschärfte Umweltnormen, aber auch<br />
wenig aufnahmefähige regionale Arbeitsmärkte bedeuten<br />
für viele Landwirte e<strong>in</strong> wachsendes Existenzrisiko. Daraus<br />
e<strong>in</strong>e Chance zu machen, erfordert den Mut, tradierte<br />
Wege zu verlassen. Wir erkennen vier grundsätzliche<br />
Auswege aus diesem Konflikt:<br />
a) Traditionelles Produktionswachstum kommt aufgrund<br />
der hohen Kapital<strong>in</strong>tensität und der i. d. R.<br />
begrenzten Arbeitskapazität für immer weniger Haushalte<br />
<strong>in</strong> Frage (lange Kapitalb<strong>in</strong>dung, ger<strong>in</strong>ge Organisationsflexibilität,<br />
Schuldenrisiko usw.);<br />
b) Grundlegende Rationalisierung bietet sich grundsätzlich<br />
an, wurde jedoch <strong>in</strong> kaum e<strong>in</strong>em Betrieb bisher<br />
ausgeschöpft. Nur <strong>in</strong> wenigen Branchen ist die<br />
Errichtung e<strong>in</strong>es Arbeitsplatzes so teuer wie <strong>in</strong> der<br />
Landwirtschaft, <strong>in</strong> kaum e<strong>in</strong>em Gewerbe wird zugleich<br />
das <strong>in</strong>vestierte Kapital so langsam umgeschlagen und<br />
das Vermögen so ger<strong>in</strong>g ausgelastet. Die Auslagerung<br />
von Teilarbeiten, neue Ideen <strong>in</strong> der Mechanisierung<br />
(GbR-Masch<strong>in</strong>engeme<strong>in</strong>schaften), die geme<strong>in</strong>same<br />
Nutzung von Stallanlagen (z. B. Melkstand), die Teilung<br />
e<strong>in</strong>es gewerblichen Arbeitsplatzes zwischen zwei<br />
Landwirten, die geme<strong>in</strong>sam wirtschaften, oder auch die<br />
geme<strong>in</strong>same Teilung e<strong>in</strong>er Fremd-AK s<strong>in</strong>d ke<strong>in</strong>eswegs<br />
unrealistische Ideen.<br />
c) Den Weg der Abstockung und Aufgabe werden<br />
längerfristig um so mehr Haushalte beschreiten<br />
(müssen), je weniger sie die Notwendigkeit zur Rationalisierung<br />
begreifen, je eher sie trotz begrenzter<br />
Kapazitäten im konventionellen Mengenwachstum ihre<br />
132 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
<strong>Entwicklung</strong>schancen vermuten und dabei Möglichkeiten<br />
der Mehrfachbeschäftigung und E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ation<br />
nicht aufgreifen.<br />
d) Diversifizierung und E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ation<br />
verlangen von den Betroffenen Marktorientierung,<br />
Flexibilität und hohe fachliche Qualifikation — immer<br />
häufiger auch im nichtlandwirtschaftlichen Bereich.<br />
Diese Eigenschaften waren unter den früheren agrarund<br />
marktpolitischen Verhältnissen wenig gefragt.<br />
Wegen der fehlenden Marktabsicherung außerhalb der<br />
re<strong>in</strong>en Agrarproduktion ist <strong>in</strong>sgesamt mehr »Professionalität«<br />
erforderlich.<br />
Soweit die natürlichen und strukturellen Bed<strong>in</strong>gungen<br />
ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>kommenssicherung durch weltmarktfähige<br />
Produktion ermöglichen, wird der Weg der E<strong>in</strong>kommenskomb<strong>in</strong>ation<br />
— zusammen mit der Ausschöpfung aller<br />
Möglichkeiten der E<strong>in</strong>sparung von Arbeitszeit und Kosten<br />
— die e<strong>in</strong>zige Alternative se<strong>in</strong>, um Bauer bleiben zu können.<br />
Dieser Bauer der Zukunft wird zwar auch noch<br />
Nahrungsmittel produzieren, doch gemessen an se<strong>in</strong>em<br />
Gesamtumsatz relativ immer weniger. Folglich muß sich<br />
se<strong>in</strong> Berufsbild wesentlich erweitern, mit Konsequenzen<br />
für Ausbildung, Beratung, Investitionsförderung, Marktorganisation<br />
usw. Weniger der Landwirt als der »Ressourcenmanager«<br />
wird der »Bauer der Zukunft« se<strong>in</strong>.<br />
Um diesem Anspruch genügen zu können, s<strong>in</strong>d weniger<br />
materielle Förderanreize als vielmehr Angebote zur fachlichen<br />
Qualifizierung jüngerer Arbeitskräfte erforderlich.<br />
Sie müßten sich vor allem an Haushalte im Übergang von<br />
der landwirtschaftlichen Monoaktivität zur Mehrfachbeschäftigung<br />
richten und neben landwirtschaftlichen<br />
auch nichtlandwirtschaftliche Angebote e<strong>in</strong>schließen. Und<br />
weil erwiesenermaßen gerade Landwirte mit kle<strong>in</strong>eren<br />
Betrieben und im Abstockungsprozeß nur ger<strong>in</strong>ge Kontakte<br />
zur Landwirtschaftsberatung unterhalten, wären<br />
dafür neue Ausbildungsangebote zu entwickeln: Wochenendkurse,<br />
Kurzpraktika <strong>in</strong> Fremdbetrieben, Spezialkurse <strong>in</strong><br />
EDV-Anwendung, Management, Market<strong>in</strong>g und Rechnungswesen.<br />
Die Voraussetzungen für komb<strong>in</strong>ierten Erwerb s<strong>in</strong>d<br />
grundsätzlich günstig. Die Ausbildungsqualität der<br />
jungen Landwirte steigt, die »Normalisierung der bäuerlichen<br />
Welt«, gedacht als Abkehr von ständischem Hofesdenken,<br />
breitet sich aus. Die jungen Bäuer<strong>in</strong>nen, häufig<br />
außerhalb der Landwirtschaft beruflich ausgebildet,<br />
nehmen stärkeren Anteil an betrieblichen Entscheidungen<br />
und s<strong>in</strong>d immer häufiger der Teil des Haushalts, der e<strong>in</strong>e<br />
qualifizierte Zusatztätigkeit aufnimmt. Moderne Kommunikationsmittel<br />
und die Tendenz zur Teilzeitarbeit<br />
erlauben gerade ihnen e<strong>in</strong>e flexible Komb<strong>in</strong>ation mit den<br />
Anforderungen <strong>in</strong> Haushalt und Familie.<br />
E<strong>in</strong> zentrales Problem bleibt die unbefriedigende<br />
Situation auf den regionalen Arbeitsmärkten. Ihre Bedeutung<br />
war bisher und wird auch <strong>in</strong> Zukunft weitaus größer<br />
se<strong>in</strong> für die <strong>Entwicklung</strong> der Landwirtschaft als alle agrar-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
strukturpolitischen Programme zusammengerechnet.<br />
War <strong>in</strong> der Vergangenheit häufig e<strong>in</strong> prosperierender<br />
Agrarsektor Motor e<strong>in</strong>er sich entwickelnden regionalen<br />
Wirtschaft, werden heute stabile regionalwirtschaftliche<br />
Arbeitsmarktverhältnisse immer stärker zur zentralen<br />
Voraussetzung für e<strong>in</strong>e zugleich stabile Landbewirtschaftung.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
133
Walter Danner<br />
Umsetzung von Market<strong>in</strong>gkonzepten<br />
für die Land- und<br />
Forstwirtschaft <strong>in</strong> Verfahren der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
Die Arbeit mit Umsetzungsberatern ist e<strong>in</strong> relativ neues<br />
Instrument im Bereich des Naturschutzes und der Regionalentwicklung.<br />
Das Projekt Marchetsreut ist me<strong>in</strong>es<br />
Wissens das erste Verfahren der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
bei dem Umsetzungs- und Market<strong>in</strong>gberater e<strong>in</strong>gesetzt<br />
wurden. Es ist <strong>in</strong> diesem E<strong>in</strong>satzbereich e<strong>in</strong>e große <strong>Entwicklung</strong>sdynamik<br />
vorhanden, weil noch ke<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>gefahrenen<br />
Strukturen vorhanden s<strong>in</strong>d. Das Beispiel<br />
Marchetsreut ist deshalb nur e<strong>in</strong>e Momentaufnahme und<br />
nicht beliebig übertragbar. Entscheidend ist die Vorgehensweise.<br />
Wir bieten ke<strong>in</strong>e Standardlösungen, sondern<br />
entwickeln zusammen mit den Betroffenen »Maßanzüge«,<br />
die auch passen. Jedes Umsetzungsprojekt hat se<strong>in</strong>en<br />
eigenen Charakter, der von der Ausgangssituation, wie<br />
— Zielsetzungen,<br />
— Ausstattung der Landschaft mit Biotopen,<br />
— Situation der Landwirtschaft im Verfahren,<br />
— engagierte Menschen im Projekt,<br />
— Engagement des Bürgermeisters,<br />
— Engagement der Verwaltung ausgeht.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Die Situation<br />
Verfahren der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> beziehen sich<br />
auch heute noch fast ausschließlich auf die Produktionsstruktur.<br />
Das Problem heute ist, daß die Hauptwertschöpfung<br />
<strong>in</strong> den nachgelagerten Bereichen, <strong>in</strong> Verarbeitung<br />
und Vermarktung erzielt wird. Fast jede Investition<br />
<strong>in</strong> Verarbeitung und Vermarktung ist heute rentabler<br />
als die Investition <strong>in</strong> die landwirtschaftliche Produktion.<br />
E<strong>in</strong> anderer Gesichtspunkt ist die <strong>Entwicklung</strong> neuer E<strong>in</strong>kommensmöglichkeiten,<br />
die fast oder gar nichts mehr mit<br />
der landwirtschaftlichen Urproduktion zu tun haben. Für<br />
diesen Bereich gibt es <strong>in</strong> der bisherigen Beratungsstruktur<br />
für die Landwirte ke<strong>in</strong>erlei Angebot. Ökologische Werte,<br />
die die Gesellschaft e<strong>in</strong>fordert, aber den landwirtschaftlichen<br />
E<strong>in</strong>zelbetrieb e<strong>in</strong>schränken, wurden <strong>in</strong> der Vergangenheit<br />
<strong>in</strong> Verfahren der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> oft überhaupt<br />
nicht berücksichtigt.<br />
Neuer Denk- und Handlungskontext<br />
»E<strong>in</strong> Problem kann nie im selben Kontext gelöst werden,<br />
<strong>in</strong> dem es entstanden ist.«<br />
Albert E<strong>in</strong>ste<strong>in</strong><br />
— Haben bisher die Naturschützer Naturschutz gemacht?<br />
— Haben bisher die Landwirte Landwirtschaft gemacht?<br />
— Haben bisher die Händler die Vermarktung gemacht?<br />
Der neue Denkansatz »Neue Landnutzungskonzepte«<br />
<strong>in</strong>tegriert alle Handlungs- und Wirtschaftsbereiche e<strong>in</strong>er<br />
Region oder e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de.<br />
Positionierungsmatrix der verschiedenen Denk- und<br />
Handlungsansätze <strong>in</strong> Landwirtschaft und Naturschutz<br />
Ökologie<br />
Ehrenamtlicher<br />
Naturschutz<br />
● ●<br />
Landschaftspflege<br />
● Biologischer<br />
Landbau<br />
Ökonomie<br />
● NEUE<br />
LANDNUTZUNGS-<br />
KONZEPTE<br />
● Integrierter<br />
Landbau<br />
● Konventionelle<br />
Landwirtschaft<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
135
Was nicht gedacht wird, entsteht nicht. Davon ausgehend<br />
müssen neue Denk- und Handlungsansätze <strong>in</strong> der<br />
Landwirtschaft und im Natursch utz entwickelt werden.<br />
Dazu haben wir die Positionierungsmatrix der verschiedenen<br />
Denk- und Handlungsansätze entwickelt. Auf der<br />
nebenstehenden Graphik ist die Positionierung des neuen<br />
Denkansatzes dargestellt. Mit diesem neuen Denkansatz<br />
der »Neuen Landnutzungskonzepte« soll gleichzeitig die<br />
Ökonomie und die Ökologie zu 100 % entwickelt werden.<br />
(Graphik s. S. 135) Naturschützer haben bisher fast ausschließlich<br />
<strong>in</strong> Ökologie- und <strong>in</strong> Schutzkategorien gedacht.<br />
Wirtschaftliche Interessen der Landnutzer spielten dabei<br />
kaum e<strong>in</strong>e Rolle. Die Landwirtschaft hat ausschließlich <strong>in</strong><br />
ökonomischen Kategorien gedacht. Ökologische Gesichtspunkte<br />
spielten ke<strong>in</strong>e Rolle. Mittlerweile gibt es ganz vorsichtige<br />
Schritte, sich von diesen e<strong>in</strong>seitigen Standpunkten<br />
zu lösen. Zu beachten ist dabei, daß sich der neue<br />
Ansatz auf Landschaftsräume bezieht und nicht auf den<br />
E<strong>in</strong>zelbetrieb beschränkt ist. Die Denk-Beschränkung auf<br />
den E<strong>in</strong>zelbetrieb hat uns viele Probleme gebracht. Diesen<br />
Fehler dürfen wir nicht wieder machen. Trotzdem ist e<strong>in</strong><br />
ausreichendes E<strong>in</strong>kommen des E<strong>in</strong>zelbetriebs sicherzustellen.<br />
Ziel ist es, e<strong>in</strong>e Struktur <strong>in</strong> der Landwirtschaft zu entwickeln,<br />
die neben der rentablen Produktion und Vermarktung<br />
als Koppelprodukt ökologische Werte produziert.<br />
Das bedeutet <strong>in</strong> der Praxis:<br />
— enge Zusammenarbeit und Kommunikation aller<br />
Beteiligten<br />
— Strategiewechsel: von der Schutzstrategie zur <strong>in</strong>telligenten<br />
Nutzstrategie<br />
— Erhöhung der Wertschöpfung unabhängig von der<br />
landwirtschaftlichen Urproduktion<br />
— Neue Denkmodelle über das Übliche h<strong>in</strong>aus<br />
Das Verfahren Marchetsreut<br />
Marchetsreut liegt im Bayerischen Wald <strong>in</strong> der<br />
Geme<strong>in</strong>de Perlesreut, Landkreis Freyung-Grafenau.<br />
Stand des Verfahrens<br />
— Neuverteilung ist abgeschlossen<br />
— Biotopvernetzungskonzept, das mehr als 10 % der<br />
Gesamtfläche ausmacht<br />
— Forschungsprojekt der Uni Stuttgart Hohenheim<br />
Aufgabenstellung für das Team für angewandte<br />
Ökologie<br />
— Integration der Biotopflächen <strong>in</strong> die landwirtschaftliche<br />
Produktion<br />
— Verwertung des Grünlandes mit Schnittzeitpunkt über<br />
die Tierhaltung<br />
— <strong>Entwicklung</strong> neuer E<strong>in</strong>kommensmöglichkeiten<br />
— Optimale Nutzung der staatlichen Programme durch<br />
die Landwirte<br />
Engpässe<br />
— Perspektivlosigkeit <strong>in</strong> vielen landwirtschaftlichen<br />
Betrieben<br />
— Schwieriges Gelände<br />
— Viele Nebenerwerbsbetriebe<br />
— Fehlendes Management und Market<strong>in</strong>g-Know-how<br />
bei den Landwirten<br />
Vorgehensweise<br />
In e<strong>in</strong>er Informationsveranstaltung wurden alle Landwirte<br />
von der Beratungsmöglichkeit <strong>in</strong>formiert. Anschließend<br />
wurden alle Betriebe e<strong>in</strong>zelbetrieblich beraten. Das<br />
Hauptziel der e<strong>in</strong>zelbetrieblichen Beratung war die <strong>Entwicklung</strong><br />
e<strong>in</strong>er Zukunftsperspektive für die Familie und<br />
den Betrieb. Nach dem ersten Beratungsdurchgang wurden<br />
die Ergebnisse <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Arbeitskreis <strong>in</strong> mehreren<br />
Sitzungen besprochen und die Umsetzungsmöglichkeiten<br />
diskutiert. In der gesamten Beratungsphase wurde enger<br />
Kontakt mit dem Amt für Landwirtschaft und Ernährung<br />
<strong>in</strong> Waldkirchen gehalten.<br />
Vernetzung<br />
Von Anfang an wurde darauf geachtet, daß ke<strong>in</strong>e isolierten<br />
E<strong>in</strong>zelmaßnahmen durchgeführt wurden. E<strong>in</strong>e<br />
Vernetzung der Maßnahmen sollte die Tragfähigkeit des<br />
Gesamtkonzeptes erhöhen. In der Abbildung ist die Vernetzungsstruktur<br />
des Verfahrens Marchetsreut dargestellt.<br />
Jede Maßnahme sollte nach dem Pr<strong>in</strong>zip der Mehrfachnutzung<br />
mehrere Nutzenfaktoren <strong>in</strong> verschiedenen Bereichen<br />
haben (Graphik s. S. 137).<br />
E<strong>in</strong> Beispiel für das Pr<strong>in</strong>zip der Mehrfachnutzung ist die<br />
E<strong>in</strong>führung der R<strong>in</strong>derrasse der P<strong>in</strong>zgauer. Folgende<br />
Nutzenfaktoren wurden berücksichtigt:<br />
— hervorragende Eignung für die Mutterkuhhaltung,<br />
— W<strong>in</strong>terhärte,<br />
— leichtgebärend und damit arbeitssparend,<br />
— Schonung der steilen, trittempf<strong>in</strong>dlichen Weiden,<br />
— Werbefaktor <strong>in</strong> der Fleischvermarktung,<br />
— Bei der Wiedere<strong>in</strong>führung gut geeignet für die Öffentlichkeitsarbeit,<br />
— Alte, gefährdetet R<strong>in</strong>derrasse: E<strong>in</strong>führung br<strong>in</strong>gt gutes<br />
Image,<br />
— hohe Fleischqualität,<br />
— Market<strong>in</strong>g: Produktdifferenzierung zu Fleckvieh und<br />
Angus.<br />
Jeder e<strong>in</strong>zelne Faktor br<strong>in</strong>gt Stabilität <strong>in</strong> das Gesamtprojekt.<br />
Das wäre <strong>in</strong> dieser Breite mit Fleckvieh oder<br />
Angus nicht zu erreichen gewesen.<br />
136 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Landschaftspflegemittel<br />
Ergebnisse<br />
F<strong>in</strong>anzierung<br />
Landschaftspflege<br />
Untere<br />
Naturschutzbehörde<br />
Team für angewandte<br />
Ökologie<br />
Zuerwerb<br />
5 b-Stelle<br />
1. <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>es Kooperationsmodells zwischen<br />
zwei Landwirten mit Mutterkuhhaltung und Bau<br />
e<strong>in</strong>es Modellstalles<br />
Zwei Betriebe (10 Kühe/3Kühe) haben als Folge der<br />
Beratung von der Milchviehhaltung auf Mutterkuhhaltung<br />
umgestellt. Beide Betriebe waren arbeitszeitmäßig stark<br />
belastet. Die Umstellung auf die Mutterkuhhaltung brachte<br />
e<strong>in</strong>e entscheidende Entlastung für beide Familien. Die<br />
Stallarbeitszeit des größeren Betriebes sank von ca.<br />
7 Stunden pro Tag auf ca. 30 M<strong>in</strong>uten. Das war <strong>in</strong> diesem<br />
Betrieb besonders wichtig, weil er im Haupterwerb noch<br />
e<strong>in</strong>e Bürstenholzfabrik betreibt.<br />
Als weitere Maßnahme wurde e<strong>in</strong> Mutterkuhstall<br />
gebaut. Der Stall wurde als Laufstall mit E<strong>in</strong>streu konzipiert.<br />
E<strong>in</strong>e Konzeption mit Gülle wurde aus ökologischen<br />
Gründen bewußt vermieden. Die Wiesen und Weiden der<br />
beiden Betriebe hatten noch e<strong>in</strong>e reichhaltige Flora und<br />
Fauna, weil bisher nur mit Stallmist gedüngt wurde. Bei<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Schober<br />
Verfahren der<br />
ländlichen<br />
<strong>Entwicklung</strong><br />
Alte Rassen<br />
Ausbildung<br />
Werbung<br />
Vermarktung<br />
Verfahren Marchetsreut<br />
Forschungsprojek<br />
Mutterkuhhaltung<br />
Modellstall<br />
Amt für Landwirtschaft<br />
Weidegeme<strong>in</strong>schaft<br />
Wirtschaftlichkeit<br />
Arbeitszeit<br />
e<strong>in</strong>er Gülledüngung wären viele Pflanzen- und Tierarten<br />
<strong>in</strong>nerhalb weniger Jahre verschwunden gewesen. Damit<br />
wurde <strong>in</strong> der Struktur e<strong>in</strong>e ökologisch s<strong>in</strong>nvolle Lösung<br />
festgelegt und gleichzeitig wurden die Ansprüche der<br />
Landwirtsfamilien voll berücksichtigt. Mit dieser Lösung<br />
wurden auch die Forderungen des Landschaftspflegekonzeptes<br />
voll erfüllt. E<strong>in</strong> weiterer Vorteil der Festmistlösung<br />
ist, daß hier auch das Grüngut aus der Pflege von<br />
Feuchtflächen als E<strong>in</strong>streu (Pr<strong>in</strong>zip der Mehrfachnutzung)<br />
genutzt werden kann. Bei der Umstellung von Milchviehauf<br />
Mutterkuhhaltung wurde auch die R<strong>in</strong>derrasse<br />
gewechselt. Die Gründe für diesen Wechsel s<strong>in</strong>d bereits<br />
weiter oben dargestellt. E<strong>in</strong> Wermutstropfen ist, daß entgegen<br />
der Me<strong>in</strong>ung der Berater der Stall zu aufwendig<br />
und zu teuer gebaut wurde. Doch die Landwirte wollten<br />
das so: »Wenn wir schon nicht <strong>in</strong> den Urlaub fahren, dann<br />
wollen wir wenigstens e<strong>in</strong>en schönen Stall«. Das ist wieder<br />
e<strong>in</strong> Beispiel dafür, daß <strong>in</strong> der Praxis nicht ausschließlich<br />
die knallharte betriebswirtschaftliche Kalkulation, sondern<br />
andere Faktoren für e<strong>in</strong>e Investitionsentscheidung ausschlaggebend<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
137
2. Fleischvermarktung auf dem Seidlhof<br />
Um auch <strong>in</strong> Zukunft noch e<strong>in</strong>e Perspektive als Haupterwerbsbetrieb<br />
zu haben, hat sich die Familie Seidl entschlossen<br />
e<strong>in</strong>e Fleischvermarktung für ihre Kalb<strong>in</strong>nen und<br />
Rothirsche aufzubauen. Mit Unterstützung des Market<strong>in</strong>gberaters<br />
im Team für angewandte Ökologie wurde e<strong>in</strong><br />
Market<strong>in</strong>gkonzept und entsprechende Werbemittel entwickelt<br />
und umgesetzt. Für die Vermarktung wurden e<strong>in</strong><br />
Kühl-, Zerlege- und Verkaufsraum gebaut. Diese Investition<br />
wurde mit 5b-Mitteln gefördert.<br />
Die Produkte und der Service wurden genau auf die<br />
Zielgruppe abgestimmt. Bisher gab es oft Probleme, wenn<br />
Landwirte R<strong>in</strong>dfleisch <strong>in</strong> 10 kg-E<strong>in</strong>heiten verkauften.<br />
Der Kundenkreis war relativ begrenzt, weil nur wenige<br />
Hausfrauen wissen , wie sie mit 10 kg-»Fleisch-Klumpen«<br />
umgehen sollen. Die Engpässe und Verkaufsh<strong>in</strong>dernisse<br />
wurden geme<strong>in</strong>sam von Familie Seidl und Berater<br />
ermittelt und beschrieben. Daraufh<strong>in</strong> wurde das eigene<br />
Angebot formuliert. Das Resultat ist, daß der Seidlhof<br />
von Anfang an mehr Kunden als Ware hat. Die Anlaufphase,<br />
die bei fast allen Vermarktungsprojekten auftritt,<br />
wurde hier bewußt vermieden und überkompensiert.<br />
E<strong>in</strong> Vorteil der Fleischvermarktung gegenüber e<strong>in</strong>er<br />
herkömmlichen Produktionssteigerung ist, daß die K<strong>in</strong>der<br />
der Familie Seidl, die bereits berufstätig s<strong>in</strong>d, sich jetzt<br />
wieder <strong>in</strong> der Landwirtschaft beteiligen können. In der<br />
Produktion können sie aus Berufsgründen nicht mithelfen.<br />
In der Vermarktung kommt ihnen ihre Berufstätigkeit entgegen.<br />
Sie verkaufen das Fleisch auch an ihre Berufskollegen.<br />
3. Von Schafen zu Auerochsen<br />
E<strong>in</strong> Nebenerwerbsbetrieb hatte ke<strong>in</strong>e Lust mehr, Schafe<br />
zu halten. Sie machen das ganze Jahr Arbeit und dann<br />
wollte ke<strong>in</strong>er das Schaffleisch. An e<strong>in</strong>em Arbeitskreistreffen<br />
wurde die Idee geboren, Auerochsen zu halten.<br />
Mittlerweile halten zwei Betriebe Auerochsen. »Unsere<br />
Auerochsen s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong> Stück Lebensqualität«, sagt dazu die<br />
Nebenerwerbsbäuer<strong>in</strong> Anneliese Fuchs. Lebensqualität ist<br />
hier der entscheidende Begriff. Es geht <strong>in</strong> Nebenerwerbsbetrieben<br />
nicht mehr nur um die Wirtschaftlichkeit. Wer<br />
jeden Nebenerwerbsbetrieb ökonomisch maximieren will,<br />
versteht die heutige Landwirtschaft nicht. Wenn Bankiers<br />
Höfe kaufen und sich als Hobby sündhaftteure Highland-<br />
Cattle halten, dann können auch Nebenerwerbslandwirte<br />
ihren Betrieb ganz oder teilweise als Hobby sehen. Wenn<br />
dann auch noch was ver<strong>dient</strong> ist, so ist das doppelt gut.<br />
4. Biotope <strong>in</strong> die Landwirtschaft<br />
80% der Biotopflächen s<strong>in</strong>d direkt <strong>in</strong> die landwirtschaftliche<br />
Produktion <strong>in</strong>tegriert. Die Landwirte haben<br />
für diese Flächen das Kulturlandschaftsprogramm abgeschlossen<br />
und erhalten für die Bewirtschaftung<br />
650 DM/ha. Nur Feuchtflächen und nicht mähbare<br />
Flächen werden über die Landschaftpflege gepflegt.<br />
5. Landschaftspflege<br />
E<strong>in</strong> Landwirt aus dem Verfahrensgebiet hat die Landschaftspflege<br />
für die nicht bewirtschaftbaren Flächen<br />
übernommen. Für ihn ist es e<strong>in</strong> Zusatze<strong>in</strong>kommen. Da alle<br />
Biotopflächen <strong>in</strong> den Besitz der Geme<strong>in</strong>de Perlesreut<br />
übergegangen s<strong>in</strong>d, ist die Pflege und Bewirtschaftung<br />
dieser Flächen langfristig gesichert.<br />
138 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
6. Akzeptanz<br />
80 % aller Landwirte haben sich <strong>in</strong> irgende<strong>in</strong>er Form an<br />
diesem Projekt beteiligt und e<strong>in</strong>en Beratungsvorschlag<br />
umgesetzt.<br />
Probleme bei der Umsetzung<br />
Fehlende Zeit<br />
Innerhalb von e<strong>in</strong>em oder zwei Jahren ist e<strong>in</strong>e<br />
Geme<strong>in</strong>de, e<strong>in</strong>e Gruppe von Bauern nicht neu auszurichten.<br />
Die Projektdauer sollte sich zwischen fünf und sieben<br />
Jahren erstrecken. Es müssen für die Zukunft noch Wege<br />
gefunden werden, die Arbeit langfristig zu etablieren.<br />
Ke<strong>in</strong>e »sichtbaren« Ergebnisse <strong>in</strong> Beton gegossen<br />
E<strong>in</strong> neue Straße oder e<strong>in</strong>en Gehweg sieht Jeder. Daß die<br />
Landschaft so geblieben ist, daß Bauern weiterexistieren,<br />
sieht man nicht. Daß viele Landwirte wieder e<strong>in</strong>e Perspektive<br />
haben, sieht ke<strong>in</strong>er. Daß die Landwirte durch die optimale<br />
Nutzung der staatliche Förderprogramme mehr Geld<br />
auf dem Konto haben, sieht ke<strong>in</strong>er. Das ist der H<strong>in</strong>tergrund,<br />
wenn es heißt, die Umsetzungsberatung kostet<br />
soviel Geld. Noch wollen viele Landwirte lieber e<strong>in</strong>e neue<br />
Straße als e<strong>in</strong>e neue Perspektive. Auch haben noch viele<br />
Menschen <strong>in</strong> der Verwaltung Hemmungen mit e<strong>in</strong>em<br />
immateriellen Gut, wie Know-how umzugehen. Um e<strong>in</strong>e<br />
Parallele zur Computertechnik zu ziehen: Es wird sich<br />
auch hier die Erkenntnis durchsetzen, daß die Software<br />
(Know-how) m<strong>in</strong>destens so wichtig ist wie die Hardware<br />
(neue Straßen).<br />
Das kann das Market<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Verfahren der<br />
<strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> und <strong>in</strong><br />
Dorferneuerungsverfahren br<strong>in</strong>gen:<br />
— Neuen Beratungsansatz, der völlig anders ist als der<br />
bisher übliche <strong>in</strong> der Landwirtschaftsberatung.<br />
— Neue Denk- und Handlungsansätze aus dem<br />
Market<strong>in</strong>g.<br />
— Professionelle Verarbeitungs- und Vermarktungsstrukturen.<br />
— <strong>Entwicklung</strong> von Produktionsdenken zum Market<strong>in</strong>gdenken<br />
<strong>in</strong> der Landwirtschaft.<br />
— Höhere Wertschöpfung für die Landwirte als Beitrag<br />
zur Existenzsicherung landwirtschaftlicher Betriebe.<br />
— Neue Perspektiven für Landwirte über die Produktion<br />
h<strong>in</strong>aus.<br />
— Besseres Image und höhere Akzeptanz für die<br />
Verfahren der Direktionen für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>,<br />
weil sie damit an der Spitze der Regionalentwicklung<br />
stehen.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
139
Arbeitskreis 4:<br />
Dorfentwicklung<br />
Peter Jahnke<br />
Neue Wege <strong>in</strong> der Dorfentwicklung<br />
– von der Expertenplanung<br />
zur Moderation<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Die Planungskultur hat sich <strong>in</strong> den letzten Jahren<br />
grundlegend geändert. Das ist nicht nur die Erkenntnis<br />
von uns, sondern es ist e<strong>in</strong> Resumee der bekannten<br />
Schweizer Planungszeitschrift DISP, die von der ETH<br />
Zürich herausgegeben wird, und die vergleichende<br />
Untersuchungen über die Planungskultur <strong>in</strong> Europa<br />
angestellt hat.<br />
Vier Schlüsselbegriffe bestimmen unsere heutige<br />
Planungskultur:<br />
— Komplexität,<br />
— Kooperation,<br />
— Konzentration,<br />
— Kompetenz.<br />
Komplexität<br />
Die Komplexität der Aufgabenstellung auch <strong>in</strong> unseren<br />
Dörfern läßt sich deutlich an der Problemlage erkennen,<br />
wie zum Beispiel:<br />
— E<strong>in</strong>bußen lokaler Autonomie,<br />
— Verschüttete Eigenkraft,<br />
— Krise <strong>in</strong> der Landwirtschaft,<br />
— Infrastrukturelle Mängel (<strong>in</strong>sbes. bei der sozialen<br />
Infrastruktur),<br />
— Bauliche Fehlentwicklungen, Gestaltprobleme,<br />
— Kommerzielle Bauleitplanung,<br />
— Fehlende Wirtschaftskraft,<br />
— Verkehrsprobleme,<br />
— Ökologische Mängel.<br />
All diese Probleme können nur im Zusammenhang<br />
gesehen werden, da gerade die Wirkungen der Probleme<br />
untere<strong>in</strong>ander von maßgeblicher Bedeutung für das Dorf<br />
s<strong>in</strong>d. Das Wirkungsgefüge verlangt deshalb die volle Aufmerksamkeit<br />
des Planers. E<strong>in</strong>e sektorale Betrachtungsweise<br />
wird zu e<strong>in</strong>em sektoralen Ergebnis führen, womit<br />
dem Gesamtvorhaben oft nicht ge<strong>dient</strong> ist. Komplex verflochtene<br />
Strukturen verlangen komplexe Handlungsansätze<br />
und e<strong>in</strong> komplexes System von Interaktionen.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Kooperation<br />
Die Verzahnung von Problemfeldern macht e<strong>in</strong>e kooperative<br />
Zusammenarbeit unserer gesamten Gesellschaft<br />
notwendig. Das beg<strong>in</strong>nt damit, daß die Probleme des<br />
ländlichen Raumes nicht alle<strong>in</strong>e im ländlichen Raum zu<br />
lösen s<strong>in</strong>d, sondern nur im Zusammenwirken von <strong>Stadt</strong><br />
und Land. Das Land braucht die <strong>Stadt</strong> z. B. als Markt und<br />
die <strong>Stadt</strong> braucht das Land z. B. für Freizeit und Erholung,<br />
Regeneration des Seelenlebens. Weiter sollten auf der<br />
1. horizontalen Ebene<br />
— Planungen die Grenzen überschreiten, um anzuknüpfen,<br />
— Ressorts und Diszipl<strong>in</strong>en zusammenarbeiten,<br />
— Öffentliche und nichtöffentliche Akteure zusammenarbeiten<br />
und sollte auf der<br />
2. vertikalen Ebene<br />
— Grundlage aller <strong>Entwicklung</strong>splanungen die Partizipation<br />
der Bürger se<strong>in</strong>, mit dem Planungspr<strong>in</strong>zip: »von<br />
unten nach oben«!<br />
Konzentration<br />
Nicht mehr die flächenhafte Planung entspricht den<br />
heutigen Anforderungen, sondern die prozeßhafte<br />
Planung, die aufgaben- und zielorientiert sich auf bestimmte<br />
<strong>in</strong>haltliche oder räumliche Bereiche schrittweise<br />
verdichtet und <strong>in</strong> Rückkoppelungsschritten sich selbst<br />
überprüft. Dazu s<strong>in</strong>d maßgeschneiderte Organisationsformen<br />
notwendig, um die spezifischen Aufgabenstellungen<br />
zu lösen. Anstatt flächendeckender Maßnahmen,<br />
wie Straßenraumgestaltungen, sollten Schlüsselprojekte<br />
angegangen werden, die sich nicht nur auf Bauaufgaben<br />
beschränken, sondern materielle und immaterielle Inhalte<br />
mite<strong>in</strong>ander verb<strong>in</strong>den. Neben den Begriffen der technischen<br />
und der sozialen Infrastruktur taucht hier der<br />
Begriff der »geistigen Infrastruktur«, als neuer wichtiger<br />
Faktor für unsere Gesellschaft auf, der nur durch<br />
Bewußtse<strong>in</strong>sbildung zu erreichen ist.<br />
Kompetenz<br />
Die Rolle des Planers hat sich dabei zwangsweise verändert.<br />
Er ist immer mehr Moderator, der die Informationen<br />
der Betroffenen zusammenträgt und strukturiert.<br />
Dabei darf er aber e<strong>in</strong>e se<strong>in</strong>er wichtigsten Aufgaben nicht<br />
vergessen, nämlich die räumliche Umsetzung von Leitbildern,<br />
Zielvorstellungen, Ideen, Visionen und damit verbundene<br />
kritische Diskussion derselben. Gesamtgesellschaftliche<br />
Werte und Grenzen s<strong>in</strong>d aufzuzeigen z. B. im<br />
ökologischen, ökonomischen, sozialen oder kulturellen<br />
Bereich. In diesem S<strong>in</strong>ne darf ich an das nächste Referat<br />
weitergeben, Herrn Naumann, der aus se<strong>in</strong>er Praxis<br />
berichten wird.<br />
E<strong>in</strong>führungsreferate <strong>in</strong> den Arbeitskreis 4<br />
141
Zusammenfassung<br />
Wir haben <strong>in</strong>tensiv mite<strong>in</strong>ander gearbeitet, und es gab<br />
große Geme<strong>in</strong>samkeiten. Es ist gut, wenn man das Gefühl<br />
hat, daß man nicht alle<strong>in</strong>e draußen arbeitet, häufig <strong>in</strong><br />
Gesetzesnischen re<strong>in</strong>kommt, sich mit den Beteiligten<br />
ärgert, wo man manchmal aufgibt, wo man resigniert hat<br />
und sagt: Hat das eigentlich e<strong>in</strong>en S<strong>in</strong>n, das ist e<strong>in</strong>e<br />
Sisyphusarbeit. Wenn hier heute 50 Leute da waren, den<br />
ganzen Tag gearbeitet haben und zu geme<strong>in</strong>samen<br />
Ergebnissen kamen, glaube ich, können wir geme<strong>in</strong>sam<br />
gestärkt h<strong>in</strong>ausgehen. E<strong>in</strong> wichtiger Begriff am Anfang<br />
des Tages war die Komplexität und ich denke, es war e<strong>in</strong><br />
sehr komplexer Tag. Er war so komplex, daß es schwer<br />
fällt, e<strong>in</strong>e Zusammenfassung zu machen, e<strong>in</strong> Resumee zu<br />
ziehen.<br />
Wir waren froh, daß die Gruppe 5 das Thema »Identität«<br />
auch bearbeitet und das »Wie ist es« <strong>in</strong> e<strong>in</strong> besser passendes<br />
»Was ist das« geändert hat.<br />
Von verschiedenen Gruppen wurde häufig das Problem<br />
»Recht« genannt. Eigentlich e<strong>in</strong> trockener Begriff, der<br />
sicherlich nicht so trocken ist, wenn z. B. das Baurecht<br />
anzuwenden ist auf Handwerksbetriebe, bei denen es um<br />
die Existenz geht, auf Landwirtschaftsbetriebe, wo sie sich<br />
ausdehnen können. Ist dieses Baurecht, das von Städtern<br />
gemacht wurde, tatsächlich noch Baurecht, das auf dem<br />
Land gelten kann? Muß sowas nicht überdacht werden<br />
und selbst das Flurbere<strong>in</strong>igungsrecht, das auf dem Land<br />
aus den Bedürfnissen des Landes heraus entstanden ist,<br />
ist möglicherweise nicht mehr zeitgemäß. Wir sehen es an<br />
dem Wunsch, die fünfzehnjährige Amtszeit des Vorstandes<br />
auf sechs Jahre zu verkürzen, um die Geme<strong>in</strong>samkeiten<br />
zwischen Geme<strong>in</strong>derat und dem Vorstand als<br />
Entscheidungsgremium wieder zusammenzubr<strong>in</strong>gen.<br />
Es ist schön, daß darüber nachgedacht wurde, e<strong>in</strong><br />
Planungsdrehbuch zu schreiben. Wir wollten Möglichkeiten<br />
aufzeigen, daß eben dieses Planungsdrehbuch, so<br />
wie Sie es heute vorgefunden haben für unsere Veranstaltung,<br />
draußen gemacht wird, als Grundlage für e<strong>in</strong>e<br />
geme<strong>in</strong>same Bewußtse<strong>in</strong>sf<strong>in</strong>dung. Die ist notwendig, wie<br />
wir es gesehen haben, bei der Ökologie, wo es um e<strong>in</strong><br />
geme<strong>in</strong>sames Wertebewußtse<strong>in</strong> geht. Ohne dieses Wertebewußtse<strong>in</strong><br />
werden wir auch wenig Akzeptanz haben. Ich<br />
kenne genügend Landwirte, die wir auch <strong>in</strong> unseren<br />
geme<strong>in</strong>samen Sem<strong>in</strong>aren, <strong>in</strong> unseren Schulen hatten, die<br />
engagiert über ökologische Probleme reden und die engagiert<br />
dort mitdenken. Sie haben den Zugang gefunden zu<br />
dem Thema, weil sie erkannt haben, daß Ökologie langfristig<br />
ökonomisch ist.<br />
Von der Mono- zur Multistruktur — daraus Arbeitsplätze<br />
entwickeln. Etwas ganz wichtiges, mite<strong>in</strong>ander verknüpfen,<br />
was bei der Gruppe »Geme<strong>in</strong>schaft« angeklungen<br />
ist. Daß Arbeit mit Aufgaben <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de verbunden<br />
ist oder von Aufgaben <strong>in</strong> der Geme<strong>in</strong>de Arbeit wieder erzeugt<br />
werden kann. Wir haben solche Beispiele, wo nicht<br />
mehr der Bauhof den W<strong>in</strong>terräumdienst übernimmt, son-<br />
dern wo ihn die Landwirte übernehmen, genauso wie Aufgaben<br />
<strong>in</strong> der Infrastrukturbereitstellung, für den Fremdenverkehr<br />
usw. Es g<strong>in</strong>g von den Aufgaben aus, die geme<strong>in</strong>sam<br />
im Dorf wieder gefunden werden müssen, wo das<br />
Bewußtse<strong>in</strong> dafür gefunden werden muß, daß Aufgaben<br />
nur geme<strong>in</strong>sam gelöst werden können. Da ist auch Arbeit<br />
mit Profit verbunden.<br />
Ganz wichtig ist die Eigenverantwortung. Die Eigenverantwortung<br />
mit der Schärfung der S<strong>in</strong>ne für die<br />
Probleme. Wo wir die Tradition nicht undiskutiert übernehmen<br />
müssen. Wir haben nicht mehr das Dorf der<br />
Sozialhierarchie, wir haben e<strong>in</strong> neues Dorf mit neuen<br />
Werten, die aus der Vergangenheit aber heraus transformiert<br />
worden s<strong>in</strong>d. Das heißt eben nicht, daß wir heute<br />
alle Sprossenfenster und Kopfste<strong>in</strong>pflaster haben müssen.<br />
Das Dorf ist e<strong>in</strong>e moderne Lebense<strong>in</strong>heit, wo gerade<br />
die Chancen, die Nischen da s<strong>in</strong>d für multistrukturelle<br />
Arbeitsplätze, wo Chancen da s<strong>in</strong>d für ökologische<br />
Betriebe nicht nur im landwirtschaftlichen Bereich,<br />
sondern z. B. im Forschungsbereich.<br />
Wir hatten heute alle mite<strong>in</strong>ander Geduld, nur mit dieser<br />
Geduld kommt man zu e<strong>in</strong>em Ergebnis und ich b<strong>in</strong><br />
dankbar dafür, daß Sie trotz der schlechten akustischen<br />
Verhältnisse durchgehalten haben. Gerade für die ausländischen<br />
Gäste unter uns war es schwierig deutsch zu verstehen,<br />
dafür me<strong>in</strong>e ich sollten wir extra e<strong>in</strong>mal klopfen.<br />
Und diese Geduld sollten wir verbunden mit dem Zuhören,<br />
was andere zu sagen haben, e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen <strong>in</strong> unsere<br />
Planung vor Ort. Dann werden wir Erfolg haben, dann<br />
können wir alle geme<strong>in</strong>sam <strong>in</strong> unserer Arbeit weiter<br />
machen, die em<strong>in</strong>ent politisch ist. Seien wir froh, daß<br />
wir alle die Chancen haben, <strong>in</strong> der Politik mitwirken zu<br />
können durch unseren Beruf, oder unsere Funktion. Das<br />
haben vor uns Generationen versäumt und bedauert. Es<br />
wäre wichtig gewesen. In diesem S<strong>in</strong>ne wünsche ich<br />
Ihnen noch e<strong>in</strong>en guten Verlauf der Tagung und hoffe,<br />
daß Sie etwas mitgenommen haben.<br />
142 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Fritz Auweck<br />
Dorfentwicklung im Verbund<br />
Ich darf Ihnen e<strong>in</strong>en kurzen Bericht über Erfahrungen<br />
aus e<strong>in</strong>em Projekt geben, bei dem das erste Mal die Dorfentwicklung<br />
über die örtlichen Grenzen e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de<br />
h<strong>in</strong>ausgeht.<br />
Aufgabenstellung<br />
Das Projekt liegt im Dreieck zwischen Füssen, Schongau<br />
und Markt Oberdorf. Im letzten Jahrhundert hat e<strong>in</strong>e<br />
Gebietsreform e<strong>in</strong>en zusammengehörigen Kulturraum, <strong>in</strong><br />
dessen Mitte der Auerberg liegt, der kulturgesschichtlich<br />
von hoher Bedeutung ist, geteilt. Daß die Auerbergler seit<br />
hundert Jahren <strong>in</strong> verschiedene Organisationsstrukturen<br />
aufgeteilt s<strong>in</strong>d, führt dazu, daß die K<strong>in</strong>der und die Verwaltungse<strong>in</strong>heiten<br />
ause<strong>in</strong>andertriften, daß die Teilung wirkt<br />
<strong>in</strong> vielen Bereichen der Infrastruktur, des Sozialen und der<br />
Wirtschaft. Ferner hat e<strong>in</strong>e Untersuchung <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em dieser<br />
Orte gezeigt, daß etwa 72 % des Kaufkraftvolumens <strong>in</strong> die<br />
umliegenden Städte abfließt, daß Waren und Produkte im<br />
wesentlichen von außerhalb e<strong>in</strong>gekauft werden und auch<br />
die Freizeitaktivitäten außen stattf<strong>in</strong>den. Um diesen Tendenzen<br />
zu begegnen, haben sich die neun Geme<strong>in</strong>den<br />
Lechbruck, Roßhaupten, Stötten, Rettenbach auf der<br />
schwäbischen Seite und Bernbeuren, Burggen, Schwabbruck,<br />
Schwabsoien und Ingenried auf der oberbayerischen<br />
Seite entschlossen, e<strong>in</strong>en formlosen Zusammenschluß<br />
<strong>in</strong> Form e<strong>in</strong>er kommunalen Allianz zu bilden. Sie<br />
wollen sich geme<strong>in</strong>sam weiter entwickeln und sich gegenseitig<br />
ergänzen. Das Gebiet besitzt e<strong>in</strong>e Fläche von etwa<br />
22 0000 ha und hat e<strong>in</strong>e Bevölkerung von ca.<br />
13 000 E<strong>in</strong>wohner. Die Bürgermeister dieser Geme<strong>in</strong>den<br />
haben sich Ende 1992 zusammengesetzt und ihre<br />
Erwartungen formuliert:<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
— gegenseitige Ergänzung <strong>in</strong> der Wirtschaft und<br />
Infrastruktur,<br />
— die Geme<strong>in</strong>samkeiten als Stärken weiterentwickeln,<br />
— die Identität durch die Stärkung dieses geme<strong>in</strong>samen<br />
Kulturraumes zu verbessern<br />
— den Fremdenverkehr weiterzuentwickeln,<br />
— den ländlichen Raum allgeme<strong>in</strong> zu stärken.<br />
Struktur<br />
Die Geme<strong>in</strong>den baten die Verwaltung für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> um Unterstützung bei der Organisation und<br />
Durchführung. Im Frühjahr 1993 wurde <strong>in</strong> der Schule <strong>in</strong><br />
Thierhaupten für Dorf- und Landentwicklung e<strong>in</strong> erstes<br />
Sem<strong>in</strong>ar durchgeführt, wo zu weiteren konkreten Aktionen<br />
Aussagen erarbeitet wurden. Als erstes können wir<br />
feststellen: Wenn wir Dorfentwicklung über die Ortsgrenzen<br />
h<strong>in</strong>aus angehen wollen, dann muß der Anstoß zu<br />
diesem Vorhaben aus den Geme<strong>in</strong>den selbst kommen.<br />
Keimzelle für die überörtliche Allianz dieser <strong>Entwicklung</strong><br />
ist natürlich die Dorfentwicklung <strong>in</strong> den e<strong>in</strong>zelnen neun<br />
Geme<strong>in</strong>den. In jeder der neun Geme<strong>in</strong>den läuft e<strong>in</strong>e<br />
Dorfentwicklung die sich jedoch <strong>in</strong> unterschiedlichen<br />
Stadien bef<strong>in</strong>den. Während sie <strong>in</strong> Bernbeuren z. B. sehr<br />
weit fortgeschritten ist, beg<strong>in</strong>nt sie <strong>in</strong> anderen Geme<strong>in</strong>den<br />
erst, wie <strong>in</strong> Schwabsoien oder Schwabbruck. Dabei ist e<strong>in</strong><br />
Nachzieheffekt erkennbar. Die kommunale Allianz wächst<br />
durchaus und hat sich erst im Laufe von e<strong>in</strong>em Jahr <strong>in</strong> der<br />
endgültigen Form gebildet. Die 18 Planer <strong>in</strong> den neun<br />
Orten und 60 Arbeitskreise <strong>in</strong> den Dorfentwicklungen mit<br />
zusammen etwa 600 Teilnehmern bilden e<strong>in</strong>e gigantische<br />
Bürgerbewegung und e<strong>in</strong> unbezahlbares Arbeitspotential<br />
vor Ort.<br />
Raumbezug<br />
Wir sehen, daß die Dorfentwicklung auf das e<strong>in</strong>zelne<br />
Dorf beschränkt, nicht mehr ausreicht, um die zukünftigen<br />
Aufgaben zu lösen. Auch bei e<strong>in</strong>em Blick <strong>in</strong> die<br />
Engagierte Teilnehmer diskutieren<br />
im Arbeitskreis<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
143
europäischen Nachbarländer können wir feststellen, daß<br />
e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>tegrierte <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>e Dorfentwicklung<br />
über das e<strong>in</strong>zelne Dorf h<strong>in</strong>aus erfordert. Das e<strong>in</strong>zelne<br />
Dorf kann also nicht mehr alle<strong>in</strong> Handlungsebene se<strong>in</strong> für<br />
die <strong>Entwicklung</strong> von Regionen im ländlichen Raum. Diese<br />
erweiterten Aufgaben ergeben Konsequenzen für den<br />
räumlichen Umgriff der Verfahren. Es zeigt sich, daß der<br />
Verfahrensumgriff alle<strong>in</strong> auf den Ort beschränkt nicht<br />
mehr ausreicht, weil sich durch die Arbeit der Arbeitskreise<br />
Zielvorstellungen und Wünsche nach Maßnahmen<br />
auch <strong>in</strong> der Flur ergeben. Die klassische Trennung Dorfentwicklung<br />
und Flurgestaltung löst sich immer mehr auf<br />
und greift <strong>in</strong>e<strong>in</strong>ander. Es ergibt Auswirkungen auf die<br />
Verfahrensstrukturen. Es stellt sich die Frage: Wie ordnet<br />
man hier an, flächendeckend oder <strong>in</strong>selförmig? Zum<strong>in</strong>dest<br />
muß es möglich se<strong>in</strong>, auch Maßnahmen <strong>in</strong> der Landschaft,<br />
die sich aus der Dorfentwicklung ergeben, umzusetzen.<br />
Welche Regelung hier s<strong>in</strong>nvoll wird, wird die Zukunft zeigen.<br />
Die Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> München für<br />
den oberbayerischen Bereich und die Direktion für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> Krumbach für den schwäbischen<br />
Bereich werden dabei eng zusammenarbeiten müssen.<br />
Regionales Planungsteam<br />
Kooperation über räumliche und sachliche Grenzen<br />
h<strong>in</strong>weg ist bei kommunalen Allianzen unbed<strong>in</strong>gt erforderlich.<br />
Neben den Verwaltungen s<strong>in</strong>d 18 Planer <strong>in</strong> den neun<br />
Geme<strong>in</strong>den vorhanden, die auch koord<strong>in</strong>iert werden müssen.<br />
Wir sehen, Dorfentwicklung im Verbund bedeutet,<br />
daß auf der überörtlichen Ebene e<strong>in</strong> Planungsteam benötigt<br />
wird, das die Koord<strong>in</strong>ations-, Steuerungs- und Moderationsaufgaben<br />
übernimmt. In diesem Fall haben der<br />
Bereich Zentrale Aufgaben (BZA) und das Büro Flurwerkstatt<br />
die Aufgabe übernommen, zu koord<strong>in</strong>ieren und<br />
geme<strong>in</strong>sam mit den neun Geme<strong>in</strong>den Konzepte für e<strong>in</strong><br />
Leitbild und für die Umsetzung von Geme<strong>in</strong>schaftsprojekten<br />
zu erarbeiten. Bei überörtlichen Dorfentwicklungen<br />
ist e<strong>in</strong> Steuerungs- und Organisations<strong>in</strong>strument auf<br />
überörtliche Ebene zum<strong>in</strong>destens für den Zeitraum von<br />
drei bis fünf Jahren <strong>in</strong> der Startphase erforderlich. In diesem<br />
Fall wird das von der Verwaltung für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> übernommen.<br />
Regionales Planungsmodell<br />
Für die bürgerbezogene Planung wurde e<strong>in</strong> Modell entwickelt,<br />
das auf die Leistungen der e<strong>in</strong>zelnen Dorfentwicklungen<br />
aufbaut. Das ist zunächst die Ebene der örtlichen<br />
Arbeitskreise (ca. 60). Darüber aufbauend wurden<br />
zwei weitere Ebenen geschaffen. Die überörtlichen Fachgruppen,<br />
die sich aus der jeweiligen Problematik ergeben.<br />
Bislang s<strong>in</strong>d es die überörtlichen Fachgruppen Landwirtschaft,<br />
Fremdenverkehr und Planung. In Entstehung s<strong>in</strong>d<br />
gerade die überörtlichen Fachgruppen Siedlungsentwicklung,<br />
Natur und Landschaft. Die Thematik der überörtlichen<br />
Fachgruppe wird nicht vom regionalen Planungsteam<br />
bestimmt, sondern durch Aktivitäten, die sich aus<br />
den beteiligten Geme<strong>in</strong>den heraus entwickelt haben. Die<br />
e<strong>in</strong>zelnen örtlichen Arbeitskreise entsenden <strong>in</strong> die über-<br />
örtliche Fachgruppe Vertreter. Dabei werden Fachleute für<br />
Market<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>geschaltet oder auch Exkursionen zu Beispielobjekten<br />
veranstaltet. Darüber angesiedelt ist der<br />
überörtliche Arbeitskreis, <strong>in</strong> dem die neun Bürgermeister<br />
und Vertreter der e<strong>in</strong>zelnen Orte sich zusammenf<strong>in</strong>den,<br />
um geme<strong>in</strong>same Entscheidungen für diese kommunale<br />
Allianz zu treffen. Wir könnten übertragen sagen, die<br />
obere Ebene ist e<strong>in</strong>e Art Regionsrat und darunter s<strong>in</strong>d die<br />
Ausschüsse, die Entscheidungen vorbereiten.<br />
Umsetzungsprojekte<br />
In der Planungspraxis zeigt sich, daß für diese regionalen<br />
<strong>Entwicklung</strong>en lange Zeiträume erforderlich s<strong>in</strong>d. Deshalb<br />
ist ganz wichtig, daß parallel gearbeitet wird. Nämlich<br />
die <strong>Entwicklung</strong> der Konzeption für die »Region« und<br />
gleichzeitig die Durchführung von Umsetzungsprojekten.<br />
Neben der Konzeptionsentwicklung werden gleichzeitig<br />
Maßnahmenprojekte gestartet, um die Motivation zu fördern<br />
und die Umsetzung und Realisierung zu konkretisieren.<br />
Im Auerbergland erarbeiten wir gerade e<strong>in</strong> Wegekonzept<br />
für Freizeit und Erholung, das sehr weit angelegt<br />
ist und z. B. Fragen der Vermarktung, kulturhistorische<br />
Aspekte und Urlaub auf dem Bauernhof mit <strong>in</strong>tegrieren<br />
soll. Auch bei diesen Umsetzungsprojekten heißt es, die<br />
Planungsphilosophie nicht zu verlassen. Wir bemühen<br />
uns, als Fachplaner das Pr<strong>in</strong>zip der Eigenarbeit der Bürger<br />
vor Ort zu nutzen. Das Wegekonzept wird fach<strong>in</strong>haltlich<br />
im wesentlichen von den Arbeitskreisen vor Ort bearbeitet<br />
und der Fachplaner gibt <strong>in</strong> Form der aktiven Steuerung<br />
die fachlichen Anregungen und bespricht das Konzept mit<br />
den Bürgern. Dabei wird z. B. der Erhebungsbogen zur<br />
Aufnahme der Wege geme<strong>in</strong>sam mit diesen überörtlichen<br />
Fachgruppen erarbeitet. Die örtlichen Arbeitskreis bekommen<br />
Karten, tragen selbst ihre Wegevorschläge e<strong>in</strong>. Der<br />
Fachplaner trägt es zusammen und koppelt es wieder mit<br />
der überörtlichen Fachgruppe zurück.<br />
Neues Planungsverständnis<br />
Für den Fachplaner bedeutet dies Abgeben von fachlicher<br />
Kompetenz an die betreffenden Fachgruppen und<br />
sich im wesentlichen zurückziehen auf die Steuerung und<br />
Moderation. Wir müssen bei mehrstufigen Projekten darauf<br />
achten, daß wir nicht nur <strong>in</strong> der e<strong>in</strong>zelnen Dorferneuerung<br />
demokratisch auf Moderationsebene arbeiten,<br />
sondern daß wir auch bei den überörtlichen Projekten und<br />
bei den konkreten Fachprojekten diese Philosophie durchhalten.<br />
Außerdem muß die Funktion e<strong>in</strong>es regionalen<br />
Planungsteam von außen zeitlich begrenzt se<strong>in</strong>. Auch im<br />
Auerberg-Projekt sollten wir uns nach drei bis fünf Jahren<br />
zurückziehen, wenn die Motoren vor Ort selbst vorhanden<br />
s<strong>in</strong>d und die weitere eigene Organisation <strong>in</strong> die Hand<br />
nehmen. Bei der ländlichen Regionalentwicklung müssen<br />
wir uns vollkommen lösen von den Ideen e<strong>in</strong>er »Bau -<br />
summe« als Maß für e<strong>in</strong>e Leistung. Wir regen geistige und<br />
wirtschaftliche Wertschöpfungen an, die sich nicht adäquat<br />
<strong>in</strong> Baumaßnahmen ausdrücken. Dazu muß sich e<strong>in</strong><br />
neues Planungsverständnis bei Politikern, Auftraggebern<br />
und Planern entwicklen.<br />
144 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Günter Naumann<br />
Der Architekt/Planer als<br />
Moderator<br />
Ich möchte Sie mit me<strong>in</strong>em Beitrag <strong>in</strong> die Praxis entführen<br />
und Ihnen e<strong>in</strong> ganz normales Dorferneuerungsverfahren<br />
vorstellen: das Dorferneuerungsverfahren<br />
Taimer<strong>in</strong>g. Taimer<strong>in</strong>g ist e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>es Dorf südöstlich von<br />
Regensburg <strong>in</strong> der fruchtbaren Donauebene gelegen. Es<br />
setzt sich aus ungefähr 85 Haushalten zusammen, das<br />
Verfahrensgebiet ist ca. 20 ha groß. In der geme<strong>in</strong>dlichen<br />
Wunschliste, die ja der Anordnung 1990 zugrunde gelegen<br />
hat, waren Wünsche wie »Gehsteig an die Staatsstraße«<br />
und e<strong>in</strong> »Dorfplatz« vermerkt, aber auch das leerstehende<br />
Schulhaus, das bestimmmte Gruppen im Ort<br />
gern nutzen wollten. Doch repräsentieren solche Geme<strong>in</strong>dewünsche<br />
auch wirklich die Bürgerwünsche? Leider stellen<br />
die Geme<strong>in</strong>dewünsche oft Wünsche oder Forderungen<br />
an die Dorferneuerung dar, die lediglich geme<strong>in</strong>dliche<br />
Aufgaben unterstützen und zu lösen helfen sollen. Das<br />
kann aber nicht S<strong>in</strong>n der Dorferneuerung se<strong>in</strong>. Also führten<br />
wir e<strong>in</strong>e Bürgerbefragung bei gut 50 % aller Haushalte<br />
durch. In diesem ersten Durchgang nahmen wir<br />
uns für jeden Haushalt mehrere Stunden Zeit und unterhielten<br />
uns mit den Bürgern über die unterschiedlichsten<br />
Themenbereiche rund um das Dorf Taimer<strong>in</strong>g. Dabei konnten<br />
wir ganz andere Probleme erfahren als diejenigen,<br />
welche die Geme<strong>in</strong>de gesehen hatte. So bedauerten z. B.<br />
viele Bürger, daß man im Dorf nichts mehr kaufen kann,<br />
obwohl dort sehr viel erzeugt wird. In Taimer<strong>in</strong>g gibt es<br />
18 Vollerwerbslandwirte und viele Obst- und Bauerngärten,<br />
auch z. B. Hühnerhaltung und e<strong>in</strong>en Imker. Es gibt<br />
eigentlich fast alles, nur kaufen kann man fast nichts.<br />
Zum E<strong>in</strong>kaufen fährt man nach Regensburg <strong>in</strong> den Supermarkt,<br />
kauft dort womöglich noch die Kartoffeln, die <strong>in</strong><br />
Taimer<strong>in</strong>g erzeugt worden s<strong>in</strong>d.<br />
Der spürbare Verlust des dörflichen Sozialgefüges war<br />
e<strong>in</strong> weiterer Punkt, der die Menschen offensichtlich<br />
bedrückte. Man kommt kaum noch mite<strong>in</strong>ander <strong>in</strong>s<br />
Gespräch, weder beim E<strong>in</strong>kaufen noch am Gartenzaun.<br />
Alles das ist weggefallen durch den Wandel der Sozialstruktur.<br />
Taimer<strong>in</strong>g war ursprünglich e<strong>in</strong> bäuerlich<br />
geprägter Ort. Die zunehmende Technisierung <strong>in</strong> der<br />
Landwirtschaft zwang dann viele Bewohner <strong>in</strong> der<br />
Industrie tätig zu se<strong>in</strong>. So fahren Pendler z. B. zu BMW, zu<br />
Siemens oder sonstigen Industriebetrieben im Großraum<br />
Regensburg. Dadurch wurde Taimer<strong>in</strong>g im nichtlandwirtschaftlichen<br />
Bereich zu e<strong>in</strong>em Schlafort mit der entsprechenden<br />
Abschwächung der sozialen Kontakte. In der<br />
Folge also suchten wir nach e<strong>in</strong>er Möglichkeit, um die<br />
Leute wieder mehr zusammenzubr<strong>in</strong>gen, um vielleicht<br />
e<strong>in</strong>e Dynamik zu erzeugen mit dem Ziel der »Hilfe zur<br />
Selbsthilfe«.<br />
E<strong>in</strong> Sem<strong>in</strong>ar <strong>in</strong> der Schule der Dorferneuerung unter<br />
dem Titel »Wie kommen wir wieder mite<strong>in</strong>ander <strong>in</strong>s<br />
Gespräch«, schien uns e<strong>in</strong> geeigneter Anfang zu se<strong>in</strong>.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Überraschenderweise fanden sich ungefähr 25 Teilnehmer<br />
aus Taimer<strong>in</strong>g <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er sehr breit gestreuten Zusammensetzung,<br />
so daß sowohl Junge als auch Ältere, der<br />
Bürgermeister, zwei Geme<strong>in</strong>deräte, der Pfarrer und vor<br />
allem auch viele Frauen <strong>in</strong> der Gruppe vertreten waren.<br />
Dieses Sem<strong>in</strong>ar sollte zwei Tage dauern, doch bereits am<br />
Abend des ersten Sem<strong>in</strong>artages war e<strong>in</strong>e neue Dynamik zu<br />
spüren, die aus diesem Geme<strong>in</strong>schaftsserlebnis wieder<br />
entstanden war. Der zweite Tag war dann umso besser<br />
und die Arbeit wurde von allen mitgetragen. Noch am<br />
zweiten Sem<strong>in</strong>artag beschloss man, zu den als wesentlich<br />
erarbeiteten Themenbereichen Arbeitskreise zu bilden und<br />
selber mitzuwirken an dem, was im Ort passieren soll.<br />
So entstanden zuerst e<strong>in</strong> »Arbeitskreis Ortsgeschichte«,<br />
e<strong>in</strong> »Arbeitskreis Geme<strong>in</strong>schaftshaus«, der sich mit der<br />
Revitalisierung des leerstehenden Schulhauses befassen<br />
wollte und e<strong>in</strong> »Arbeitskreis Direktvermarktung«, mit der<br />
Zielsetzung im Ort erzeugte Produkte auch im Ort anzubieten.<br />
Die Arbeitskreistätigkeit begann mit großem<br />
Engagement, sie läuft jetzt seit April 1993 kont<strong>in</strong>uierlich,<br />
aber mit unterschiedlicher Intensität. Es zeigt sich hier<br />
sehr deutlich, daß <strong>in</strong> bestimmten Zeitabständen greifbare<br />
Ergebnisse gefunden werden müssen, um die Motivation<br />
aufrecht zu erhalten.<br />
Für den Planer als Moderator ist es oft sehr schwierig,<br />
Bürger im Arbeitskreis eigenständig arbeiten zu lassen<br />
und sich nicht e<strong>in</strong>zumischen, denn dies kann leicht Initiativen<br />
abbremsen. Die Gefahr etwas abzukappen, ist hier<br />
sehr groß. Andererseits ist auch die Gefahr des Bemutterns<br />
sehr groß, denn damit läuft man leicht Gefahr, daß<br />
bald niemand mehr ernsthaft mitarbeiten mag, weil das<br />
Gefühl entsteht: »die wissen es ja sowieso besser, die<br />
haben ja sowieso schon alles fertig <strong>in</strong> der Schublade, die<br />
lassen uns da nur spielen«. E<strong>in</strong> fast unlösbares Problem<br />
sehe ich auch dar<strong>in</strong>, daß ich als Planer <strong>in</strong> absehbarer Zeit<br />
e<strong>in</strong>en Dorferneuerungsplan fertigzustellen habe, der Überlegungen<br />
und deren Ergebnisse zu e<strong>in</strong>em Zeitpunkt darstellt,<br />
bei dem die Arbeitskreise e<strong>in</strong>fach mit ihren<br />
Gedankengängen noch nicht abgeschlossen haben.<br />
Ich halte es für absolut erforderlich, daß wesentliche<br />
Ergebnisse, wesentliche Gedanken <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Dorferneuerungsverfahren<br />
aus den Reihen der Bürger kommen und<br />
nicht von der Planung schon vorher postuliert werden.<br />
Denn die Akzeptanz der Bürger für diese Verfahrensschritte,<br />
für diese E<strong>in</strong>zelmaßnahmen ist wesentlich größer<br />
und selbstverständlicher, wenn sie aus eigenen Reihen<br />
kommt. Besonders wichtig bei dieser Arbeit ist auch, daß<br />
hierdurch die Eigenverantwortung für den Ort, für<br />
momentan zwar unwesentliche, aber trotzdem ureigene<br />
Belange wieder von den Bürgern übernommen wird. Der<br />
Bürger wird gezwungen, Aufgaben, die er gerne an die<br />
Geme<strong>in</strong>de abschiebt, wieder selber anzupacken, sich mit<br />
D<strong>in</strong>gen zu befassen die er vorher lieber Fachleuten überlassen<br />
hat. Auch es ist wichtig, daß der Bürger <strong>in</strong> dieser<br />
Arbeitskreisarbeit erkennt, daß es Grenzen gibt von<br />
Leistungsfähigkeit und Leistungswillen und daß diese<br />
Grenzen überwunden werden können.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
145
Die Arbeitskreise s<strong>in</strong>d sehr aktiv und es gibt bereits<br />
»konkrete Ergebnisse«. Der Arbeitskreis »Direktvermarktung«<br />
hat es geschafft e<strong>in</strong>en Dorfmarkt zu organisieren,<br />
stellen, der zur Zeit alle vier Wochen stattf<strong>in</strong>det. Auf diesem<br />
Markt wird das angeboten, was im Ort produziert<br />
werden kann, wie z. B. saisonale Gemüse, Honig, Fruchtsäfte,<br />
Eier, Brot manchmal Käse und Fleischwaren. Das<br />
Angebot wird ständig ausgebaut, man versucht darüberh<strong>in</strong>aus<br />
mit anderen Orten Kontakt aufzunehmen und<br />
e<strong>in</strong>en erweiterten Verbund zu schaffen. Der Nebeneffekt<br />
bei diesem Dorfmarkt ist die eigentliche Hauptsache: Es<br />
ist wieder e<strong>in</strong>e Drehscheibe im Dorf entstanden. Man<br />
freut sich richtig auf den Dorfmarkt, denn es gibt dort<br />
»den Ratsch«, man kann etwas tr<strong>in</strong>ken dabei, man unterhält<br />
sich, man weiß, dort trifft man wieder jemanden. Der<br />
Dorfmarkt ist jetzt fast e<strong>in</strong> vierwöchentlich gastierendes<br />
Kommunikationszentrum geworden. Mittlerweile überlegen<br />
die Initiatoren, dieses Dorfmarktes e<strong>in</strong>e Gesellschaft<br />
zu gründen, um die Probleme und die Risiken solcher<br />
Aktionen auf mehrere Schultern zu verteilen und dem<br />
Ganzen auch e<strong>in</strong>e rechtliche Grundlage zu geben.<br />
Der Arbeitskreis Geme<strong>in</strong>schaftshaus setzte sich <strong>in</strong>tensiv<br />
mit allen örtlichen Vere<strong>in</strong>en ause<strong>in</strong>ander, um den Bedarf<br />
an geme<strong>in</strong>schaftlichen Räumlichkeiten auszuloten. Es<br />
zeigte sich großes Interesse, so daß die veranwortlichen<br />
Leute der e<strong>in</strong>zelnen Vere<strong>in</strong>e zusammen mit dem Arbeitskreis<br />
e<strong>in</strong> Raumprogramm erstellten, versuchten das<br />
Raumprogramm im Gebäude unterzubr<strong>in</strong>gen und sogar<br />
erreichten, daß die Geme<strong>in</strong>de sich bereit erklärte, dieses<br />
Schulhaus als Geme<strong>in</strong>schaftshaus für den Ort Taimer<strong>in</strong>g<br />
zur Verfügung zu stellen.<br />
Da die Maßnahme »Geme<strong>in</strong>schaftshaus« mit sehr viel<br />
Eigenleistung realisiert werden sollte und niemand deren<br />
Machbarkeit richtig e<strong>in</strong>schätzen konnte, wurde e<strong>in</strong> Mehrstufenplan<br />
entwickelt. Zuerst sollten die <strong>in</strong>teressierten<br />
Bürger <strong>in</strong> Taimer<strong>in</strong>g e<strong>in</strong>e kle<strong>in</strong>e Maßnahme durchführen,<br />
nämlich e<strong>in</strong>e Anschlagtafel im Ort errichten, die von ihnen<br />
geplant, gebaut und betreut wird. Das kl<strong>in</strong>gt sehr e<strong>in</strong>fach,<br />
ist jedoch ziemlich schwierig, wenn mehrere verschiedene<br />
Interessensgruppen daran beteiligt s<strong>in</strong>d. Der nächste<br />
Schritt ist die Instandsetzung des leerstehenden Schulhauses<br />
zu e<strong>in</strong>en großen Teil <strong>in</strong> Eigenleistung zu vollziehen.<br />
Dabei müssen die <strong>in</strong>teressierten Gruppen, die das<br />
Gebäude später nutzen wollen, während der Sanierung<br />
mit Hand- und Spanndiensten tätig se<strong>in</strong>. Was vor Jahrhunderten<br />
als geme<strong>in</strong>sames Scharwerk zu erbr<strong>in</strong>gen<br />
war, wird jetzt eben gefordert durch e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>sames<br />
Interesse. Als dritte und vorläufig letzte Stufe könnte man<br />
e<strong>in</strong> weiteres Projekt angehen, das allerd<strong>in</strong>gs schon an der<br />
Grenze zur Illusion liegt. In Taimer<strong>in</strong>g steht nämlich, wie<br />
<strong>in</strong> vielen anderen Orten, die Ortskanalisation an mit<br />
Gesamtkosten von e<strong>in</strong>igen Millionen Mark. Geplant ist e<strong>in</strong><br />
Verbundprojekt mit zwei anderen Geme<strong>in</strong>den,wobei der<br />
Zeitpunkt der Ausführung aufgrund der Mittelknappheit<br />
offen ist. Nun ist die verwegene Frage aufgetaucht,<br />
warum man alles größer machen muß, um es dann als<br />
großes Problem zu lösen. Lösen wir das kle<strong>in</strong>e Problem im<br />
kle<strong>in</strong>en, suchen wir dezentrale Lösungen für Taimer<strong>in</strong>g,<br />
um unabhängig von großer, anfälliger, teurer Technik die<br />
Abwässer zu beseitigen. Denkbar wäre, daß je nach Anfall<br />
der Abwassermenge der E<strong>in</strong>zelne oder sich mehrere<br />
zusammentun im Betrieb von e<strong>in</strong>er Kle<strong>in</strong>kläranlage, die <strong>in</strong><br />
der Summe nicht mehr, sondern sogar wesentlich weniger<br />
kosten würden als die große Kläranlage. Derzeit entsprechen<br />
solche Lösungen allerd<strong>in</strong>gs nicht dem Stand der<br />
Technik, der von den Wasserwirtschaftsämtern gefordert<br />
wird. Insofern ist hier möglicherweise noch e<strong>in</strong>iges an<br />
Aufklärung notwendig, vielleicht auch an technischer<br />
Arbeit, um zu beurteilen, ob dergleichen machbar ist.<br />
Höchst <strong>in</strong>teressant aber wäre folgender Gesichtspunkt:<br />
Wenn jeder für die Re<strong>in</strong>haltung oder für die Re<strong>in</strong>igung<br />
se<strong>in</strong>es Abwassers selber veranwortlich ist, wird er sich<br />
auch überlegen, was er eigentlich an Abwasser verursacht.<br />
Dann könnte man e<strong>in</strong>en neuen Ansatz f<strong>in</strong>den, für e<strong>in</strong>e<br />
erhöhte Eigenverantwortlichkeit des Bürgers <strong>in</strong> der<br />
Geme<strong>in</strong>de für geme<strong>in</strong>dliche Aufgaben. Sicher ist das alles<br />
Illusion, aber ich b<strong>in</strong> zuversichtlich, daß sich auch solche<br />
Vorhaben noch realisieren lassen werden, nicht nur <strong>in</strong><br />
Taimer<strong>in</strong>g, sondern auch <strong>in</strong> anderen Orten.<br />
Letztendlich bietet e<strong>in</strong> Dorferneuerungsverfahren im<br />
herkömmlichen S<strong>in</strong>n solche Gedankenansätze, solche<br />
Lösungsmöglichkeiten gar nicht. Man muß versuchen, das<br />
Verfahren anders zu gestalten. Anzufangen an der Basis,<br />
nicht Planungen zu machen, womöglich überzustülpen.<br />
Man muß sich mit den Ortsbürgern unterhalten und ause<strong>in</strong>andersetzen,<br />
denn sie s<strong>in</strong>d die eigentlichen Experten<br />
für die örtlichen Aufgabenstellungen. Ohne sie geht es<br />
sicher nicht, aber sie nur selber machen zu lassen, das<br />
geht sicherlich auch nicht. Das Mite<strong>in</strong>ander des Bürgers<br />
im Ort, der se<strong>in</strong>e Probleme kennt und des Experten, der<br />
vielleicht auch Lösungsansätze vermitteln und positiv<br />
steuernd e<strong>in</strong>greifen kann, dieses Mite<strong>in</strong>ander führt nach<br />
me<strong>in</strong>er Überzeugung zu Lösungen, die ökologisch s<strong>in</strong>nvoll<br />
und vernünftig s<strong>in</strong>d und die mit wesentlich ger<strong>in</strong>geren<br />
Kosten und mehr langfristigem Erfolg ausgeführt werden<br />
können, als die oft gigantischen Maßnahmen, die wir bisher<br />
gekannt haben.<br />
146 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Leonhard Rill<br />
Neue Anforderungen an die<br />
Flurentwicklung<br />
Viele von Ihnen fragen sich jetzt sicher, warum kommt<br />
im Arbeitskreis Dorfentwicklung nach diesen beiden Vorträgen<br />
nun e<strong>in</strong> Kurzreferat über neue Anforderungen an<br />
die Flurentwicklung. Es ist bei Prof. Aufweck ja schon<br />
angeklungen, warum die Flurentwicklung durchaus e<strong>in</strong>e<br />
Rolle spielt.<br />
Ich behaupte: Dorfentwicklung und Flurentwicklung<br />
müssen sehr eng verknüpft se<strong>in</strong>, um e<strong>in</strong>e wirksame Unterstützung<br />
für den ländlichen Raum bieten zu können. An<br />
zwei Bereichen will ich Ihnen <strong>in</strong> der Kürze der mir gegebenen<br />
Zeit aufzeigen, warum es zu Problemen kommt, wenn<br />
diese Verknüpfung nicht gegeben ist:<br />
1. Der Bereich Grünordnung/Ökologie:<br />
Jeder, der sich mit diesem Thema ause<strong>in</strong>andersetzt,<br />
weiß über die Verknüpfungen von Dorf und Landschaft.<br />
Dorf und Landschaft stellen e<strong>in</strong> Wirkungsgefüge<br />
dar, stellen e<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>heit dar. Wenn wir nur im<br />
bebauten Bereich tätig s<strong>in</strong>d, grenzen wir zu eng ab und<br />
erreichen gerade <strong>in</strong> diesem wichtigen Themenkomplex<br />
nicht die geforderten und gewünschten Ergebnisse.<br />
2. Der Bereich Landwirtschaft:<br />
Wir haben vielerorts die Situation, daß e<strong>in</strong> großer Teil<br />
der Landwirte im Außen- bereich angesiedelt ist <strong>in</strong><br />
Weilern, <strong>in</strong> E<strong>in</strong>zelhöfen. Diese Landwirte nehmen oft<br />
nicht mehr aktiv am Dorfleben teil. Durch Dorferneuerungsverfahren,die<br />
streng auf e<strong>in</strong> Dorf abgegrenzt s<strong>in</strong>d,<br />
erhalten sie wieder ke<strong>in</strong>e Anreize, aktiv mitzuarbeiten.<br />
Oft s<strong>in</strong>d sie sogar von der Förderung ausgegrenzt, was<br />
ebenso demotivierend wirkt. Der Landwirt draußen<br />
sagt: »Ich b<strong>in</strong> wieder nicht gefragt worden, ich b<strong>in</strong><br />
nicht beteiligt an dem Ganzen«. E<strong>in</strong> wesentlicher<br />
Aspekt ist auch, daß die Produktionsfläche, als e<strong>in</strong>er<br />
der wichtigsten wirtschaftliche Faktoren <strong>in</strong> der Landwirtschaft<br />
nicht <strong>in</strong>s Verfahren <strong>in</strong>tegriert ist.<br />
Im übrigen kommen wir immer öfter an den Punkt, wo<br />
die Arbeit der Arbeitskreise zu Ergebnissen führt, die sich<br />
nicht an der Dorfgrenze aufhalten lassen. Die Bürger erarbeiten<br />
Ideen, die <strong>in</strong> die Flur h<strong>in</strong>auswirken. Da s<strong>in</strong>d doch<br />
gerade wir von der Verwaltung für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
gefordert, die D<strong>in</strong>ge auch planerisch und <strong>in</strong> der Umsetzung<br />
zu betreuen.<br />
Wenn <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Dorferneuerung nur e<strong>in</strong> Ortsteil der<br />
Geme<strong>in</strong>de rausgeputzt wird, dann ist es nicht möglich<br />
Konzepte zu entwickeln, die <strong>in</strong> der ganzen Geme<strong>in</strong>de mitgetragen<br />
werden. Es kommt sogar oft soweit, daß dadurch<br />
e<strong>in</strong> weiteres Ungleichgewicht im ländlichen Raum<br />
entsteht. Es gab schon Fälle, <strong>in</strong> denen im Geme<strong>in</strong>derat<br />
Neidgefühle fast zu e<strong>in</strong>er Blockade des ganzen Projekts<br />
führten, weil die Mitglieder des Geme<strong>in</strong>derats aus anderen<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Ortsteilen sagten: »Warum nur <strong>in</strong> diesem e<strong>in</strong>en Ortsteil<br />
Förderung? Warum nur dort Maßnahmen? Wir s<strong>in</strong>d doch<br />
e<strong>in</strong>e Geme<strong>in</strong>de«.<br />
Die neuen Anforderungen, die jetzt (manche davon s<strong>in</strong>d<br />
übrigens auch sehr alt) auf die Flurentwicklung zukommen<br />
s<strong>in</strong>d folgende:<br />
— Wir müssen e<strong>in</strong>e ganzheitliche <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> Dorf<br />
und Flur anstreben. Dazu können wir die nach wie vor<br />
zahlreichen Anträge auf Dorferneuerung nutzen und<br />
geme<strong>in</strong>sam mit den Bürgern und den Geme<strong>in</strong>den<br />
Verfahren e<strong>in</strong>leiten, die sich auf Dorf und Flur erstrecken,<br />
möglichst sogar auf das ganze Geme<strong>in</strong>degebiet.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs müssen wir dabei die Maßnahmen<br />
der Flurentwicklung ganz anders betrachten als <strong>in</strong> den<br />
letzten Jahrzehnten.<br />
— Ich behaupte, wir müssen sie so sehen wie die<br />
Maßnahmen der Dorfentwicklung; d. h. als e<strong>in</strong>en Teil<br />
unseres Gesamtangebots für den ländlichen Raum, den<br />
wir nur dann e<strong>in</strong>setzen, wenn die Wünsche von den<br />
Bürgern kommen und wenn das Ganze auf freiwilliger<br />
Basis abläuft. Ohne Zwang, auf der Grundlage der<br />
Ergebnisse der Arbeitskreise oder e<strong>in</strong>er Flurwerkstatt.<br />
— Das Instrument Bodenordnung muß dabei umweltgerecht<br />
und auf das e<strong>in</strong>zelne Projekt bezogen maßgeschneidert<br />
e<strong>in</strong>gesetzt werden. So etwas wie e<strong>in</strong><br />
»Zusammenlegungsgrad« wird <strong>in</strong> solch e<strong>in</strong>em<br />
Verfahren sicher ke<strong>in</strong>e Rolle mehr spielen.<br />
— Wir müssen den Geme<strong>in</strong>den vielmehr mit Rat und Tat<br />
zur Seite stehen. Es ist beratendes, helfendes Handeln<br />
gefragt, nicht mehr obrigkeitsbestimmtes Handeln —<br />
wirklich das Angebot Hilfe zur Selbsthilfe.<br />
— Was können wir <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em solchen Verfahren, das sich<br />
auf Dorf und Flur, auf das gesamte Geme<strong>in</strong>degebiet<br />
erstreckt, erreichen? Wir sollten mit den Bürgern die<br />
Erstellung e<strong>in</strong>es <strong>Entwicklung</strong>splans für die Geme<strong>in</strong>de<br />
anstreben, also über e<strong>in</strong>en begrenzten Dorferneuerungsplan<br />
h<strong>in</strong>ausgehen. Damit kommen wir auch<br />
leichter weg vom materiellen Gestaltungsbereich. Wir<br />
kommen zu der zukunftsweisenden und notwendigen<br />
Denkarbeit für die ganze Geme<strong>in</strong>de.<br />
— In e<strong>in</strong>em ganzheitlichen <strong>Entwicklung</strong>splan für die<br />
Geme<strong>in</strong>de können Konzepte erarbeitet werden,<br />
• z. B. für die Landwirtschaft.<br />
Die Landwirtschaft muß me<strong>in</strong>er Me<strong>in</strong>ung nach noch<br />
viel mehr e<strong>in</strong>e Zukunftsaufgabe der Geme<strong>in</strong>den<br />
werden. Die Betreuung der Landwirtschaft und der<br />
Landwirte, die Sorge um die Landwirtschaft und um<br />
die Landbewirtschaftung ist weiterh<strong>in</strong> e<strong>in</strong>e der<br />
wichtigsten Aufgabe. Doch wir können die Konzepte<br />
nur umsetzen, wenn wir auch weiterh<strong>in</strong> <strong>in</strong> der Flur<br />
tätig s<strong>in</strong>d. Dann können wir unsere Programme und<br />
auch andere Programme zur Förderung der Landwirtschaft,<br />
zusammenfassen und <strong>in</strong> die Umsetzung<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
147
e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen. Aber noche<strong>in</strong>mal: Die Hilfe wird nur<br />
erfolgreich se<strong>in</strong>, wenn sie sich auch auf die<br />
Produktionsflächen erstreckt.<br />
• Z. B. Konzepte für die Landschaftsund<br />
Dorfökologie<br />
Besonders der Landschaftsplanung besteht die<br />
Möglichkeit, <strong>in</strong> Dorf und Flur zu verknüpfen, die<br />
E<strong>in</strong>heit Dorf und Landschaft herauszuarbeiten. Die<br />
Herbsttagung der Bayer. Akademie <strong>Ländliche</strong>r Raum<br />
1993 stand unter dem Motto: »Nur umweltbewußte<br />
ländliche Geme<strong>in</strong>den haben Zukunft«. Dieses Motto<br />
sollte auch für uns Auftrag se<strong>in</strong>.<br />
— Geme<strong>in</strong>sam mit den Geme<strong>in</strong>den stehen uns die<br />
Planungs<strong>in</strong>strumente kommunale Landschaftsplanung,<br />
dreistufige Landschaftsplanung und Fachplanung<br />
Grünordnung/Dorfökologie zur Verfügung.<br />
— Auch hier können wir gerade durch das Instrument<br />
Bodenordnung <strong>in</strong> die Umsetzung e<strong>in</strong>steigen. Wir können<br />
die Vorgaben des kommunalen Landschaftsplanes<br />
umsetzen, was bisher noch sehr selten geschehen ist.<br />
Jeder weiß, daß die kommunalen Landschaftspläne oft<br />
Alibifunktion haben, um den Flächennutzungsplan mit<br />
se<strong>in</strong>en Baugebietsausweisungen durchzubr<strong>in</strong>gen.<br />
— In der Umsetzungsphase können wir durch unsere<br />
Programme und auch alle anderen Programme der<br />
Naturschutz- und Landwirtschaftsverwaltung (z. B.<br />
Kulturlandschaftsprogramm, Arten- und Biotopschutzprogramm)<br />
Ziele wie Biotopvernetzung, Artenschutz,<br />
Wasserrückhaltung, Gewässerschutz, usw. erreichen.<br />
— Konzepte können natürlich je nach Bedarf auch für<br />
Fremdenverkehr, für Gewerbe, für Kultur im ländlichen<br />
Raum entwickelt werden. Herr Prof. Aufweck hat das<br />
Projekt »Wegenetz <strong>in</strong> der Region Auerberg« angesprochen.<br />
E<strong>in</strong> typisches Beispiel für Augaben der Flurentwicklung.<br />
Man geht raus aus den Dörfern <strong>in</strong> die Flur<br />
und entwirft nicht nur e<strong>in</strong> Wegenetz, sondern b<strong>in</strong>det<br />
Kultur, Natur, Gastronomie und Landwirtschaft mit e<strong>in</strong>.<br />
Sie werden sich jetzt vielleicht fragen, ob sich solche<br />
Verfahren <strong>in</strong> der Praxis e<strong>in</strong>leiten lassen? Ich komme von<br />
der Direktion <strong>in</strong> München. Wir haben <strong>in</strong> unserer Abteilung<br />
<strong>in</strong>nerhalb e<strong>in</strong>es Jahres Verfahren mit e<strong>in</strong>er Fläche von<br />
über 16 000 ha angeordnet. Alle Verfahren s<strong>in</strong>d völlig<br />
ohne Widerspruch von Bürgern, im Gegenteil auf Wunsch<br />
der Bürger e<strong>in</strong>geleitet worden. Die haben das Verfahren<br />
von uns gefordert und wir kommen mit unseren Möglichkeiten,<br />
mit den verschiedenen Förderprogrammen und<br />
mit der Dorferneuerung diesen Wünschen der Bürger<br />
nach.<br />
Ich glaube, daß das e<strong>in</strong> Weg se<strong>in</strong> kann, wie unsere<br />
Arbeit <strong>in</strong> der Zukunft wirklich den Wünschen der Bürger<br />
und der Geme<strong>in</strong>den im ländlichen Raum optimal angepaßt<br />
werden kann.<br />
148 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Gruppenergebnisse<br />
Sechs Gruppen bearbeiteten am Vormittag das Thema<br />
»Wie wünsche ich mir, das Aussehen der Dorferneuerung<br />
im Jahr 2000«.<br />
Die folgenden Ergebnisse werden mit e<strong>in</strong>er Kartenabfrage<br />
ermittelt:<br />
Gruppe 1<br />
1. Geme<strong>in</strong>schaftsbewußtse<strong>in</strong><br />
Geme<strong>in</strong>schaftsbewußtse<strong>in</strong> als Kraftquelle neuen<br />
Dorfgeme<strong>in</strong>schaftslebens.<br />
— Basisdemokratie,<br />
— Bürgernähe,<br />
— Dorferneuerung der Bürger, nicht der Geme<strong>in</strong>den,<br />
— Dorf als Geme<strong>in</strong>schaftszentrum.<br />
Es bedarf vielfältiger Hilfen beim Strukturwandel, der<br />
sich vollzieht und das geht nur, wenn man sich über die<br />
aktuelle Situation im klaren ist.<br />
2. Ökologische Dorfentwicklung<br />
— Ökologische Dorfernerneuerung im allen Bereichen,<br />
— Dorfleben im E<strong>in</strong>klang mit der Natur,<br />
— alternative Energiequellen,<br />
— ganzheitlich orientierte Dorferneuerung, auf breiter<br />
Basis ansetzen,<br />
— E<strong>in</strong>heit von Dorf und Flur und flexible Lösungen<br />
ermöglichen (z. B. Kläranlage! Es muß nicht immer die<br />
großtechnische Anlage se<strong>in</strong>).<br />
3. Das Dorf als Wirtschaftskraft<br />
— Das Dorf nicht losgelöst sehen von der eigentlichen<br />
Entstehungsgeschichte, nämlich von der Landwirtschaft,<br />
sondern immer wieder die Verknüpfung landwirtschaftliche<br />
und außerlandwirtschaftliche<br />
Arbeitsplätze suchen,<br />
— Eigen<strong>in</strong>itiativen fördern,<br />
— Kommunikation als »Lebensmittel« (Thema<br />
Geme<strong>in</strong>schaftsläden).<br />
4. Regionale Kooperation<br />
— zwischenörtliche und geme<strong>in</strong>dliche Vernetzungen<br />
anstreben,<br />
— mehr Regionalmanagement,<br />
— regionale Kooperation,<br />
— sich Partner vor Ort, Verbündende <strong>in</strong> der Nachbarschaft<br />
suchen.<br />
5. Mitwirkung aller Gruppen<br />
— E<strong>in</strong>beziehung vor allem der Jugend <strong>in</strong> die<br />
Dorferneuerung,<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
— aktive Rolle für die Frau (auch der Gäste, Besucher,<br />
Fremde, Neubürger etc.),<br />
— auf breiter Basis alle Gruppierungen e<strong>in</strong>beziehen,<br />
— niemanden »vor der Tür stehen lassen«, der vielleicht<br />
gerne mitarbeiten würde.<br />
6. Weiterentwicklung des baulich-räumlichen Gefüges<br />
— Wie läßt sich alte, leerstehende Bausubstanz im Ort<br />
oder <strong>in</strong> der Ortsmitte speziell nutzen bzw. umnutzen<br />
anstelle von Neubauten?<br />
— Wohnhöfe als Alternativen zum Eigenheim,<br />
— Wie kann der Strukturwandel, der sich <strong>in</strong> den Dörfern<br />
vollzieht, im Rahmen der Bauberatung genutzt werden,<br />
um die regionalen Eigenheiten, die dörfliche Baustruktur<br />
zu pflegen und auch weiterh<strong>in</strong> zu entwickeln.<br />
7. Die Dorfentwicklung als Prozeß sehen<br />
— Im Dorfentwicklungsprozeß dokumentiert sich über die<br />
Wünsche nach Autonomie und Eigen<strong>in</strong>itiative e<strong>in</strong> offener<br />
<strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>ärer Prozeß,<br />
— Das Dorf soll lebensfähig bleiben und sich entwickeln,<br />
— Die geistige Dorferneuerung soll Vorrang vor der<br />
gestaltenden Dorferneuerung haben,<br />
Dorferneuerung ist nie etwas festes oder statisches,<br />
sondern e<strong>in</strong> Prozeß, der sich weiterentwickelt und bei dem<br />
das Endergebenis nie genau vorauszusehen ist.<br />
Gruppe 2<br />
1. Dorf und Flur<br />
— Integrative <strong>Entwicklung</strong> vom Dorf und Flur,<br />
— ke<strong>in</strong>e getrennten <strong>Entwicklung</strong>en, die auf das Dorf beschränkt,<br />
— die <strong>Entwicklung</strong>en <strong>in</strong> der Flur mit e<strong>in</strong>beziehen.<br />
2. Verbesserung der Dorf<strong>in</strong>frastruktur<br />
— Maßnahmen nicht nur im Bereich der technischen<br />
Infrastruktur sondern auch der sozialen Infrastruktur.<br />
3. Bürgermitwirkung<br />
— Verstärkte Mitwirkung und Integration der Bürger bei<br />
der Dorferneuerung , um die Identifikation der Bürger<br />
mit den Maßnahmen zu verstärken.<br />
4. Beschlußgeme<strong>in</strong>schaft<br />
— Zusammenwirken von Geme<strong>in</strong>de und Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaft<br />
(kann durchaus <strong>in</strong> geme<strong>in</strong>samen Beschlüssen<br />
se<strong>in</strong>),<br />
— die Kompetenz e<strong>in</strong>es Geme<strong>in</strong>derates als gewähltes<br />
Beschlußgremium e<strong>in</strong>er Geme<strong>in</strong>de sollte auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e<br />
Dorferneuerungsmaßnahme <strong>in</strong> geeigneter Weise <strong>in</strong>tegriert<br />
werden.<br />
5. Arbeitsplätze<br />
— Schaffung außerlandwirtschaftliche Arbeitsplätze, die<br />
e<strong>in</strong> Abwandern der Bevölkerung (vor allem der<br />
Jugendlichen) verh<strong>in</strong>dern können.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
149
6. Gesetzesänderung<br />
— Zum Beispiel periodische Wahl der Vorsitzenden von<br />
Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaften, um auch hier e<strong>in</strong>e<br />
Demokratisierung zu verwirklichen.<br />
7. Dorfentwicklung als Prozeß<br />
— E<strong>in</strong>e Dorfentwicklung und e<strong>in</strong>e Dorferneuerungsmaßnahme<br />
können nicht e<strong>in</strong>fach enden.<br />
— Schaffung von Grundlagen, damit durch Eigen<strong>in</strong>itiative<br />
aber auch durch Anstöße von außen das Dorf sich<br />
immer weiter entwickeln kann auch über e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelne<br />
DE—Maßnahmen h<strong>in</strong>aus (z. B. »Kommunale Allianz«).<br />
8. Tiefgreifende Dorfentwicklung<br />
— Dorfentwicklung und Dorferneuerung sollen »nicht an<br />
der Oberfläche schwimmen«, nicht nur gestalterische,<br />
ästhetische Maßnahmen sollen durchgeführt werden,<br />
sondern es sollen auch Problemfälle, Problemortschaften<br />
angepackt werden z. B. solche <strong>in</strong> denen große<br />
Umstrukturierungsprozesse stattf<strong>in</strong>den.<br />
9. Alternative Energiekonzepte<br />
— Alternative Energien und <strong>in</strong>telligente Lösungen<br />
der Infrastruktur sollten <strong>in</strong> Zukunft verstärkt überlegt<br />
werden,<br />
— F<strong>in</strong>anzielle Ausstattung darf nicht fehlen; ohne sie wird<br />
sicherlich e<strong>in</strong>e Dorferneuerung auch <strong>in</strong> Zukunft wenig<br />
Anstoß haben.<br />
Gruppe 3<br />
1. Ökologie<br />
— Schonung von Ressourcen,<br />
— Kreislaufwirtschaft,<br />
— Ver- und Entsorgung,<br />
— Vernetzung, Dorfökologie/Landschaftspflege, also der<br />
Bereich Dorf und Flur.<br />
2. Planung flexibel und übergreifend<br />
— flexibel die Instrumentarien gezielt e<strong>in</strong>setzen,<br />
— ke<strong>in</strong>e E<strong>in</strong>heits<strong>in</strong>strumentarien und E<strong>in</strong>heitsplanung,<br />
— flexibel und übergreifend über die Fachbereiche h<strong>in</strong>weg,<br />
e<strong>in</strong>erseits im Bereich der Ämter, z. B. Wasserwirtschaftsamt,<br />
Straßenbauamt, Direktionen usw.<br />
andererseits auf der Planerseite,<br />
— Übergreifend auch über Gemarkungsgrenzen, vielleich<br />
über Geme<strong>in</strong>degrenzen h<strong>in</strong>weg, wo e<strong>in</strong>e übergreifende<br />
Zusammenarbeit notwendig ist — z. B. »Regionale<br />
Allianzen«.<br />
3. Bürgerbeteiligung<br />
— Alle Gruppen im Dorf e<strong>in</strong>b<strong>in</strong>den, wie Frauen,<br />
Jugendliche, K<strong>in</strong>der usw.<br />
4. Dorfkultur/Dorfgeme<strong>in</strong>schaft<br />
— Geme<strong>in</strong>schaft, e<strong>in</strong> Geme<strong>in</strong>schaftsgefühl aufbauen, bzw.<br />
stärken, das auch dann weiterwirkt, wenn sich die<br />
<strong>in</strong>stitutionelle Förderung zurückzieht.<br />
150 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
5. Landwirte im Dorf nicht vergessen<br />
6. F<strong>in</strong>anzierungsklarheit<br />
— F<strong>in</strong>anzierung neuer Planungsaufgaben.<br />
7. E<strong>in</strong>kommensmöglichkeiten ausloten<br />
— Aufbau von Arbeitsplätzen <strong>in</strong> den Dörfern z. B. mit<br />
Hilfe der Telekommunikation, Urlaub auf dem<br />
Bauernhof, Direktvermarktung u. v. m.<br />
Gruppe 4<br />
1. Dorfkonkrete Demokratie<br />
— Landwirtschaft <strong>in</strong> die Dorfdemokratie mite<strong>in</strong>b<strong>in</strong>den ist<br />
sehr wichtig.<br />
2. Dörfliche Kultur fördern und die Dorfgeme<strong>in</strong>schaft<br />
stärken<br />
— Bewußtse<strong>in</strong>sbildung, um die Dorfgeme<strong>in</strong>schaft, die<br />
Dorfkultur <strong>in</strong> den Mittelpunkt zu rücken, um das<br />
Bewußtse<strong>in</strong> dafür zu schärfen und zu stärken.<br />
3. Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit der<br />
Bürger fördern<br />
— Vor dem H<strong>in</strong>tergrund s<strong>in</strong>kender Fördermittel, kann die<br />
Hilfe zur Selbsthilfe maßgebend mitwirken an der weiteren<br />
Dorferneuerung.<br />
— Dörfliche Gestaltung verbessern,<br />
— <strong>in</strong>novative Projekte fördern z. B im Bereich<br />
Wärmerückgew<strong>in</strong>nung, Solaranlagen usw.,<br />
— Versuchen, im Dorf neue Wege zu gehen, um diese<br />
Projekte nicht von vornhere<strong>in</strong> auszuschließen.<br />
4. Arbeitsplätze im Dorf schaffen<br />
— sich bewußt machen, daß junge Leute dann abwandern,<br />
wenn ke<strong>in</strong>e Arbeitsplätze und Ausbildungsmöglichkeiten<br />
vorhanden s<strong>in</strong>d. Die jungen Leute s<strong>in</strong>d<br />
gezwungen auszupendeln und bleiben dann <strong>in</strong> den<br />
Ballungszentren aus verschiedenen Gründen hängen.<br />
5. Wege zur Zusammenarbeit im Dorf, <strong>in</strong> den<br />
Regionen f<strong>in</strong>den<br />
— das Wissen über Nachbarorte verstärken,<br />
— schauen, was passiert <strong>in</strong> den benachbarten Dörfern,<br />
— vernetzte Konzepte erstellen, die auch die Planungen,<br />
die Vorhaben der benachbarten Geme<strong>in</strong>den berücksichtigen,<br />
— die Kommunikation im Dorf verstärken,<br />
— Neuzugezogene, <strong>in</strong>s Dorf <strong>in</strong>tegrieren,<br />
6. Verkehrsprobleme im Ort lösen<br />
— Verkehrsprobleme nicht nur auf den Ort bezogen, sondern<br />
über die Grenzen der Dörfer h<strong>in</strong>aus betrachten.<br />
Gruppe 5<br />
1. Die Bürger im Mittelpunkt<br />
— Die Bürger mit ihren subjektiven Bedürfnissen und der<br />
subjektiven Wahrnehmung ihrer Umwelt stehen im<br />
Mittelpunkt.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
2. Stärkung der lokalen Identität steht für Themen<br />
wie:<br />
— Erhaltung der Dorfkultur,<br />
— E<strong>in</strong>bezug der Planung <strong>in</strong> die Dorfgeschichte,<br />
— die Fragestellung »Wo komme ich her?«.<br />
— Wahrnehmung der Regionalität, also die Wahrnehmung<br />
der Nachbarorte nicht als Konkurrenten, sondern<br />
als Partner.<br />
3. Geme<strong>in</strong>same und ganzheitliche Konzeptentwicklung<br />
— Unterscheiden lernen zwischen kurzfristigen, lokalen<br />
Maßnahmen und langfristigen, regionalen<br />
Maßnahmen, speziell im Zusammenhang mit der<br />
<strong>Entwicklung</strong> ökomomischer Konzepte.<br />
4. Flexibilisierung der Verfahrensabläufe, Vere<strong>in</strong>fachung,<br />
mehr Kooperation<br />
— Zu wenig Kooperation zwischen den verschiedenen, am<br />
Dorferneuerungs- und Dorfentwicklungsverfahren<br />
beteiligten Behörden und auch Institutionen,<br />
— zu wenig Absprache, und dadurch zu unflexible<br />
Verfahren.<br />
Gruppe 6<br />
1. Dorfentwicklung als Bewegung<br />
— Dorfentwicklung braucht am Anfang Anschub, muß<br />
aber nach e<strong>in</strong>iger Zeit selbständig laufen,<br />
— der Geme<strong>in</strong>deverbund muß dann selbst lebensfähig<br />
se<strong>in</strong>.<br />
2. Integrierte <strong>Entwicklung</strong> von Dorf und Flur<br />
— E<strong>in</strong>b<strong>in</strong>dung der Kulturlandschaft <strong>in</strong> die Kultur des<br />
Dorfes.<br />
3. Stärkung des Sozialgefüges<br />
4. Umweltorientierte Dorfentwicklung<br />
5. Planungskultur<br />
— E<strong>in</strong>e endbürokratisierte Planungskultur zwischen den<br />
Arbeitskreisen, zwischen der Geme<strong>in</strong>devertretung, zwischen<br />
den Trägern öffentlicher Belange.<br />
E<strong>in</strong>e Punktebewertung durch alle Arbeitsgruppenmitglieder<br />
führte zu folgenden 6 Themen:<br />
1. Planung<br />
2. Wirtschaftskraft<br />
3. Ökologie<br />
4. Geme<strong>in</strong>schaft<br />
5. Identitätsfaktoren<br />
6. Mitwirkung- Mitveranwortung<br />
Am Nachmittag wurden diese Themen weiterbearbeitet<br />
nach dem Muster:<br />
— Wie ist es?<br />
— Wie wünschen wir es uns?<br />
— Was muß getan werden?<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
151
Zusammenfassung der Ergebnisse:<br />
Gruppe 1: Planung<br />
1. Situation im Planungsbereich:<br />
— starke Orientierung an der baulichen Gestaltung,<br />
— die Planung im Rahmen der Dorferneuerung bezieht<br />
sich sehr stark auf <strong>in</strong>nerörtliche Bereiche, e<strong>in</strong>e Aussage<br />
die unserer Me<strong>in</strong>ung nach sehr stark sich auf die<br />
neuen Bundesländer bezieht.<br />
2. Anordnung der Dorferneuerung<br />
— Anordungsgebiete werden zu zufällig ausgewählt (<strong>in</strong><br />
Komb<strong>in</strong>ation mit gewissen politischen Anordnungszwängen).<br />
3. Beteiligung<br />
— Es gibt noch zu wenig Endscheidungskompetenz <strong>in</strong> den<br />
Dorferneuerungsverfahren vor Ort.<br />
— Die Wahl der aktuellen Enscheidungsträger vor Ort,<br />
<strong>in</strong>sbesonders <strong>in</strong> Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaften birgt<br />
gewisse Probleme; d. h. hier s<strong>in</strong>d nicht alle örtlichen<br />
Gruppierungen vertreten.<br />
4. Planung und Umsetzung<br />
— der Planungsprozeß ist abhängig von örtlichen<br />
E<strong>in</strong>zel<strong>in</strong>itiativen,<br />
— der Planungsprozeß ist nur schwach durchstrukturiert,<br />
der Ablauf ist eher zufällig,<br />
— Schwierigkeit, den richtigen Planungszeitraum zu f<strong>in</strong>den<br />
(nicht zu lang aber auch nicht zu kurz).<br />
5. Bürgerbeteiligung<br />
— abhängig vom Zeitpunkt der Anordnung (je nachdem,<br />
wie alt das Verfahren ist, wurde mehr oder weniger<br />
<strong>in</strong>tensiv beteiligt),<br />
— abhängig vom e<strong>in</strong>zelnen Planer (sieht er Bürgerbeteiligung<br />
als e<strong>in</strong>en Impulsgeber oder als Beh<strong>in</strong>derung?).<br />
Aus dieser Situationsbeschreibung heraus haben wir<br />
dann unsere Wünsche formuliert:<br />
— Die Planung und die Ausführung flexibler gestalten,<br />
— stärker mit den Nachbargeme<strong>in</strong>den bei der<br />
Dorferneuerung zusammenarbeiten,<br />
— <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre Zusammenarbeit zwischen den<br />
Fachdiszipl<strong>in</strong>en,<br />
— neue Wege der Zusammenarbeit müssen geme<strong>in</strong>sam<br />
ausgelotet werden.<br />
— Dorferneuerung soll <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Geme<strong>in</strong>deentwicklungsplan<br />
münden,<br />
— Vor Ort sollte e<strong>in</strong> kompetentes Planungssteuerungsteam<br />
e<strong>in</strong>gesetzt werden, das die verschiedensten<br />
Maßnahmen mite<strong>in</strong>ander koord<strong>in</strong>iert, zusammenführt<br />
und auch untere<strong>in</strong>ander abstimmmt.<br />
— Wo sich die Gelegenheit bietet, länderübergreifende<br />
Projekte <strong>in</strong>stallieren, nicht nur zwischen den Regierungsbezirken,<br />
zwischen den Bundesländern, sondern<br />
<strong>in</strong> das benachbarte Ausland gehen.<br />
Was muß getan werden, damit wir all diesen Wünschen<br />
näher kommen?:<br />
— Änderung des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes, um flexible<br />
Planung zu ermöglichen,<br />
— Neue Methoden der kompetenten Prozeßbegleitung<br />
entwickeln (z. B. Moderationstechnik),<br />
— Geme<strong>in</strong>sam vor Ort e<strong>in</strong> Drehbuch für die Planung und<br />
für die Dorfentwicklung schreiben, damit klar ist, wann<br />
läuft was <strong>in</strong> welchen Phasen ab, mit welchen Inhalten,<br />
damit man sich orientieren kann.<br />
— Stärker noch vor Ort die Verantwortlichkeiten deligieren<br />
und festschreiben<br />
nach dem Muster: Wer macht was, mit wem, bis wann,<br />
und <strong>in</strong> welcher Form (die Aufgaben, die anstehen vor<br />
Ort auf viele Schultern verteilen).<br />
— Sogenannte »Impulsprojekte« angehen, zur besseren<br />
Motivation.<br />
— Die Arbeitskreise müssen <strong>in</strong> der Startphase immer wieder<br />
zusammengeführt werden und untere<strong>in</strong>ander sich<br />
abstimmen.<br />
Gruppe 2: Wirtschaftskraft<br />
1. Wirtschaftssituation im Dorf:<br />
— Der Produktionsfaktor Landwirtschaft geht zurück und<br />
es werden Arbeitsplätze im Bereich der Landwirtschaft<br />
frei.<br />
Wir wünschen uns:<br />
— Außerlandwirtschaftliche Arbeitsplätze <strong>in</strong> den Dörfern<br />
bzw. <strong>in</strong> den nahegelegenen Hauptorten, als Ersatz für<br />
die freiwerdenden Arbeitskräfte und für die nicht mehr<br />
vorhandene Wirtschaftskraft,<br />
— Existenzsicherung der verbleibenden Landwirtschaft<br />
durch e<strong>in</strong>e bauplanungsrechtliche Absicherung der<br />
landwirtschaftlichen Betriebe (Emissionen/Wohnbebauung),<br />
— Existenzsicherung der Landwirtschaft z. B. durch Überlegungen<br />
zu alternativen Bewirtschaftungs- und<br />
Vermarktungsformen sowie im Freizeitsektor,<br />
— Schaffung außerlandwirtschaftlicher Arbeitsplätze<br />
durch Flächenbereitstellungen für gewerbliches<br />
Bauland an geeigneter Stelle (das muß nicht immer <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>em kle<strong>in</strong>en Ortsteil se<strong>in</strong>, das kann durchaus im<br />
benachbarten Hauptort se<strong>in</strong>, wo gewerbliche Flächen<br />
unter Umständen besser an Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen<br />
angebunden s<strong>in</strong>d),<br />
— F<strong>in</strong>anzieller Anreiz für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben<br />
durch staatliche Förderprogramme.<br />
152 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
2. Die Sozialstrukturen im Dorf verändern sich<br />
Wir wünschen uns:<br />
— Übergang von e<strong>in</strong>er landwirtschaftlichen Monostruktur<br />
zu e<strong>in</strong>er pluralistischen Struktur mit Handwerksbetrieben,<br />
kle<strong>in</strong>en Gewerbetrieben, Freizeite<strong>in</strong>richtungen<br />
usw.,<br />
— Verbrauchernahe Grundversorgung durch multifunktionale<br />
Verkaufsstellen (Lebensmittelladen, Post, Bank),<br />
— Verbesserung der Aufenthaltsattraktivität für den<br />
Touristen, für den Erholungssuchenden u. a. durch e<strong>in</strong>e<br />
funktionierende Gastwirtschaft,<br />
— mehr Mut zum unternehmerischen Risiko und mehr<br />
Innovationsbereitschaft auch bei den Landwirten.<br />
Gruppe 3: Ökologie<br />
1. Gegensatz Ökologie - Ökonomie<br />
— Zwischen Ökologie und Ökonomie e<strong>in</strong>schließlich<br />
Landwirtschaft bestehen <strong>in</strong> den Köpfen der Leute<br />
Gegensätze, die schlecht <strong>in</strong> E<strong>in</strong>klang zu br<strong>in</strong>gen s<strong>in</strong>d.<br />
2. Zuviele Planungen<br />
— Es werden viele Planungen gemacht<br />
(Dorferneuerungsplanung, Grünordnungsplan), aber oft<br />
nicht umgesetzt.<br />
3. Fehlendes Wertebewußtse<strong>in</strong> <strong>in</strong> der Bevölkerung zu<br />
Umweltfragen.<br />
— Ökologie wird oft reduziert auf Arten- und<br />
Biotopschutz,<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
— der große Zusammenhang und der Bereich technischer<br />
Umweltschutz fehlen,<br />
— fehlende Innovationsbereitschaft was den technischen<br />
Umweltschutz betrifft, ist vorhanden.<br />
Wir wünschen uns:<br />
— Ökologie muß auch kurzfristig ökonomisch se<strong>in</strong><br />
(Kostendeckung),<br />
— Mehr Planung mit dem Bürger (br<strong>in</strong>gt e<strong>in</strong>e bessere<br />
Umsetzung),<br />
— Mehr Aufklärung und Beratung durch Fachleute,<br />
— Der Ökologiebegriff sollte breiter werden (Integration<br />
des technischen Umweltschutzes),<br />
— mehr dezentralen Lösungen z. B. im Abwasser- und<br />
Energiebereich,<br />
— Förderung neuer Technologien auch <strong>in</strong> der Dorferneuerung,<br />
— Zusammenarbeit mit Sponsoren für Umweltmaßnahmen<br />
z. B. Sparkasse-Umweltpreis usw.<br />
Gruppe 4: Geme<strong>in</strong>schaft<br />
1. Objektive und subjektive Defizite<br />
— Es gibt objektive Defizite und solche, die im subjektiven<br />
Bereich liegen. Die »Orientierung nach Außen« statt<br />
»Kommunikaton nach Innen« hat e<strong>in</strong>deutig objektive,<br />
Ursachen nämlich: z. B. fehlende Arbeitsplätze<br />
und/oder wichtige In- frastrukture<strong>in</strong>richtung im Ort.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
153
2. Fehlendes Geme<strong>in</strong>schaftsbewußtse<strong>in</strong><br />
— E<strong>in</strong>heimische verhalten sich mißtrauisch oder ablehnend<br />
gegenüber Pendlern, weil diese auch andere<br />
Interessen repräsentieren.<br />
3. Fehlende positive Impulsgeber im Dorf<br />
— Sie führen mitunter zu Gleichgültigkeit und e<strong>in</strong><br />
geme<strong>in</strong>sames sich Vorwärtsentwickeln erlahmt und<br />
wird nicht praktiziert.<br />
4. Polarisierung des Sozialgefüges<br />
— Arm und reich werden wieder gängige Begriffe.<br />
5. Mangelnde Kommunikationsorte, wie z. B:<br />
— Geme<strong>in</strong>same Arbeit,<br />
— Infrastrukture<strong>in</strong>richtungen,<br />
— Brauchtumspflege.<br />
Wir wünschen uns im objektiven Bereich:<br />
— Geme<strong>in</strong>schaftse<strong>in</strong>richtungen, wo man mite<strong>in</strong>ander<br />
kommunizieren kann,<br />
— Geme<strong>in</strong>same Ziele zu f<strong>in</strong>den, auch wenn die<br />
Interessenlage ganz unterschiedlich ist und diese durch<br />
geme<strong>in</strong>same Tätigkeit dann auch zu erreichen.<br />
Wir wünschen uns im subjektiven Bereich:<br />
— Mehr Eigen<strong>in</strong>itiative, mehr Integrationsbereitschaft,<br />
mehr Impulsgeber,<br />
— E<strong>in</strong>beziehung anderer statt Ausgrenzung, (Solidarität),<br />
— Neue Formen oder moderne Formen des Zusammenlebens<br />
zwischen den Generationen (Generationszusammenhalt).<br />
Was muß getan werden?:<br />
— Analyse der bestehenden Situation, klar werden über<br />
Defizite und geme<strong>in</strong>same Ziele f<strong>in</strong>den. Dazu ist erforderlich:<br />
— Information anbieten,<br />
— Initiativgruppen bilden und unterstützen.<br />
Wichtige Aktiviäten:<br />
— Funktionen <strong>in</strong>s Dorf zurückholen, die verloren gegangen<br />
s<strong>in</strong>d, die aber rückholbar wären, z. B. Dorfladen,<br />
— das Vere<strong>in</strong>sleben aktivieren, Feste feiern, Brauchtum<br />
fördern und zwischen den Generationen weitergeben,<br />
— Toleranz fördern und Solidarität üben,<br />
— Kommunikationsmöglichkeiten schaffen z. B. Gasthaus,<br />
Dorfplatz, K<strong>in</strong>dertagesstätte,<br />
— die Jugend e<strong>in</strong>b<strong>in</strong>den <strong>in</strong> das Dorf, denn bei ihr liegt die<br />
Zukunft.<br />
Gruppe 5: Identitätsfaktoren<br />
1. Gruppenzusammengehörigkeit und Abhängigkeit<br />
von Gruppenwerten<br />
— Es spielt im Dorf e<strong>in</strong>e außerordentlich große Rolle, ob<br />
man von der jeweiligen schichtenspezifischen, altersspezifischen,<br />
generationsspezifischen Gruppe akzeptiert<br />
und anerkannt wird <strong>in</strong> dem was man tut oder nicht.<br />
2. Raumzugehörigkeit und Raumabhängigkeit<br />
— Es ist e<strong>in</strong> großer Unterschied ob wir im Gebirge oder<br />
am Meer aufwachsen. Das wird sowohl unsere<br />
Identifizierung mit den Raum, als auch die Form unserer<br />
Identität, mit dem was wir als unsere Heimat<br />
bezeichnen, sehr wesentlich prägen und auch unser<br />
Gruppenverhalten bee<strong>in</strong>trächtigen oder fördern.<br />
3. Symbolverständnis<br />
— Identitätsfaktoren s<strong>in</strong>d auch das geme<strong>in</strong>same<br />
Symbolverständnis, das meist über das Unterbewußtse<strong>in</strong><br />
läuft und wir deshalb nur aus dem geme<strong>in</strong>samen,<br />
uns gruppenmäßig verb<strong>in</strong>denden Kulturverständnis<br />
zu e<strong>in</strong>em geme<strong>in</strong>samen Symbolverständnis<br />
kommen werden.<br />
Wir wünschen uns:<br />
— Wir müssen die sozialen und baulichen Identitätsfaktoren<br />
als solche <strong>in</strong> ihrer Wertigkeit erkennen lernen,<br />
verstehen lernen, und entsprechend Werten lernen im<br />
Zusammenhang mit Dorferneuerungsmaßnahmen.<br />
— Die Dorfbevölkerung muß sich stärker über den Wert<br />
ihres sogenannten Heimatraumes bewußt werden,<br />
— Es muß wieder Verantwortung für geme<strong>in</strong>schaftliche<br />
Aufgaben übernommen werden.<br />
Was muß getan werden?:<br />
— Initiiert werden muß mit Sicherheit e<strong>in</strong> Diskurs, <strong>in</strong> dem<br />
unterschiedliche Interessen berücksichtigt werden, weil<br />
die Interessen e<strong>in</strong>e unterschiedliche Lobby haben und<br />
viele Gruppen, die aber nach e<strong>in</strong>em ganzheitlichen<br />
Verständnis die Lebensqualität e<strong>in</strong>es Dorfes ausmachen,<br />
sehr oft eben ke<strong>in</strong>e Lobby haben (K<strong>in</strong>der, Frauen).<br />
— Es muß wieder gelernt werden »Zuhören zu können«.<br />
Die Gruppen im Dorf können sich nicht mehr genügend<br />
zuhören (z. B. mangelndes gegenseitiges Verständnis<br />
von Neubürgern und Altbürgern).<br />
— Eigenverantwortung muß soweit als möglich wieder<br />
zurückgegeben werden (Gebietsreform).<br />
— Die bauliche und soziale Weiterentwicklung unter<br />
Bewußtse<strong>in</strong> der Traditionen muß formiert werden,<br />
denn die Traditionen der Vergangenheit waren nicht<br />
alle schlecht. Wir sollten prüfen, was ist davon für uns<br />
selbst von hohen Wert und muß auch gegen<br />
Modernisierungsnotwendigkeiten verteidigt werden<br />
und <strong>in</strong> unsere Maßnahme e<strong>in</strong>fließen.<br />
Gruppe 6: Mitwirkung-Mitverantwortung<br />
1. Zu lange Amtsperiode<br />
— Der Vorstand e<strong>in</strong>er Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaft, auf<br />
15 Jahre gewählt, ist zu lange im Amt.<br />
Wir wünschen uns:<br />
— Möglichkeit e<strong>in</strong>es kurzfristigen Wechsels,<br />
— e<strong>in</strong>e Amtsperiode von 6 Jahren (als Grundmaß).<br />
Voraussetzung dafür ist:<br />
— e<strong>in</strong>e Gesetzesänderung des Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes,<br />
— Beschlüsse sollten geme<strong>in</strong>sam gefaßt werden.<br />
154 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
2. Die Eigenständigkeit ist groß aber die Eigenverantwortung<br />
muß stärker werden<br />
Wir wünschen uns:<br />
— Mehr Motivation,<br />
— Mehr Bewußtse<strong>in</strong>se<strong>in</strong>stellung,<br />
— Mehr Umsetzung <strong>in</strong> die Praxis.<br />
3. Unterschiedliche Bürgerbeteilung von Geme<strong>in</strong>de zu<br />
Geme<strong>in</strong>de<br />
Wir wünschen uns:<br />
— Aufklärungs,- Fortbildungs- und<br />
Erwachsenenweiterbildungsarbeit,<br />
— Der e<strong>in</strong>zelne Bürger muß viel stärker herangezogen<br />
werden zum Mitreden, Mitfühlen der geme<strong>in</strong>samen<br />
Anliegen und Aufgaben.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
155
Arbeitskreis 5:<br />
Landschaftsgestaltung<br />
Anne Wendl / Michael Sch<strong>in</strong>dler<br />
Neue Aufgabenschwerpunkte <strong>in</strong><br />
der Landschaftsentwicklung<br />
Neue Aufgaben <strong>in</strong> der Landschaftsentwicklung — e<strong>in</strong><br />
provozierender Titel für e<strong>in</strong> Referat — werden Sie sich<br />
vielleicht denken. Anhand des Verfahrens Stefl<strong>in</strong>g will ich<br />
Ihnen aufzeigen, wor<strong>in</strong> diese Aufgabe bestand und wie sie<br />
gelöst wurde.<br />
Das Verfahren Stefl<strong>in</strong>g <strong>in</strong> Zahlen<br />
Die Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Regensburg<br />
ordnete im Jahre 1979 das <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>sverfahren<br />
Stefl<strong>in</strong>g (Landkreis Schwandorf, <strong>Stadt</strong> Nittenau)<br />
mit e<strong>in</strong>er Gesamtfläche von ca. 1 900 ha. an. Das Wegeund<br />
Gewässernetz e<strong>in</strong>schließlich e<strong>in</strong>es landschaftspflegerischen<br />
Begleitplans konnte im Vorausbau <strong>in</strong> den Jahren<br />
1983 — 1986 weitgehend umgesetzt werden. Angesichts<br />
der 1983 <strong>in</strong> Bayern e<strong>in</strong>geführten 3-stufigen Landschaftsplanung<br />
lies der landschaftspflegerische Begleitplan<br />
erhebliche Mängel an Detailschärfe erkennen. Im Jahre<br />
1989 — also zwei Jahre vor der Neuverteilung — beschloß<br />
der Vorstand, die Landschaftsplanung Stufe II mit e<strong>in</strong>er<br />
Kle<strong>in</strong>strukturkartierung für das gesamte Neuverteilungsgebiet<br />
zu vergeben.<br />
Die Analysen bestätigten den vermuteten und für die<br />
Oberpfalz e<strong>in</strong>maligen Bestand an Biotopen. Diese e<strong>in</strong>malige<br />
Dichte an Biotopstrukturen konnte im Rahmen der<br />
Neuverteilung erhalten werden. Es wurde weder e<strong>in</strong><br />
Ranken oder e<strong>in</strong>e Hecke beseitigt noch e<strong>in</strong>e Naßstelle<br />
trockengelegt. Ohne Murren akzeptierten die Landwirte<br />
die teilweise kle<strong>in</strong>parzellige Zuteilung, da sie von dem Reiz<br />
und der E<strong>in</strong>maligkeit ihrer Landschaft überzeugt waren.<br />
Nach diesen grundsätzlichen Überlegungen will ich Sie<br />
nun an Hand von Dias und e<strong>in</strong>igen Folien <strong>in</strong> den Landschaftsraum<br />
und <strong>in</strong> die Problematik des Planungsgebietes<br />
e<strong>in</strong>führen und Ihnen die Ergebnisse der Landschaftsplanung<br />
darlegen.<br />
Überörtliche Planungaussagen<br />
Wir bef<strong>in</strong>den uns im Großraum Regensburg. Für diesen<br />
übernimmt das Gebiet e<strong>in</strong>e entscheidende Funktion als<br />
Naherholungsgebiet. Das Verfahrensgebiet gehört zur<br />
<strong>Stadt</strong> Nittenau, das im Landesentwicklungsprogramm als<br />
Unterzentrum mit <strong>Entwicklung</strong>sschwerpunkt Fremdenverkehr<br />
ausgewiesen ist.<br />
Geologisch betrachtet, bef<strong>in</strong>den wir uns im kristall<strong>in</strong>en<br />
Grundgebirge des Vorderen Bayerischen Waldes mit<br />
Granit und Gneis als Ausgangsgeste<strong>in</strong>. Auf diesen bilden<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
sich Ranker und Braunerden aus. Der Agrarleitplan empfiehlt<br />
wegen der ger<strong>in</strong>ge Ertragsfähigkeit der Böden und<br />
der Hängigkeit des Geländes auf ca. 60 % der Fläche,<br />
Grünlandnutzung zu betreiben. Die landwirtschaftlichen<br />
Betriebe werden v. a. im Nebenerwerb geführt. Neben diesen<br />
ungünstigen Standortbed<strong>in</strong>gungen für die Landwirtschaft<br />
weist das Gebiet aber e<strong>in</strong>en hohen landschaftlicher<br />
Reiz durch se<strong>in</strong>e Höhenlagen von 360 m ü. N. N.(Regen)<br />
bis 612 m ü. N. N. (Jugenberg) auf.<br />
Als besondere Landschafts-und kulturhistorische<br />
Elemente s<strong>in</strong>d zu nennen:<br />
• Die Regenaue<br />
Der Regen (360 m ü. N. N), e<strong>in</strong> Gewässer 1. Ordnung<br />
mit der Güteklasse II, prägt den Norden des Verfahrensgebietes.<br />
Zwei Nebenflüsse (Frankenbach, Doblbach)<br />
führen das Wasser aus den Steilhängen von<br />
Süden her dem Regen zu.<br />
• Die Burgen Stefl<strong>in</strong>g, Hof a. R. und Stockenfels<br />
Die vorhandenen Burgen lassen auf e<strong>in</strong>e bewegte<br />
Geschichte dieser Landschaft im Mittelalter schießen.<br />
Heute noch zeugen sie vom kulturhistorischen Reiz<br />
dieser Landschaft; viele Sagen w<strong>in</strong>den sich um Burgen<br />
und Feldkreuze <strong>in</strong> der Umgebung<br />
• Der Jugenberg<br />
Er gab der Bauerngeme<strong>in</strong>schaft ihren Namen und f<strong>in</strong>det<br />
sich auch im Emblem der Bauern wieder. Sie wollen<br />
damit ihre Regionalität (ihren Identifikationspunkt)<br />
darstellen. Mit 612 m ü. N. N. stellt der Jugenberg die<br />
höchste Erhebung <strong>in</strong> dem Landschaftsraum dar.<br />
Schafweide auf den Hangflächen<br />
E<strong>in</strong>führungsreferate <strong>in</strong> den Arbeitskreis 5<br />
157
• Vielfältige Landschaftsstruktur<br />
Die Hanglagen werden <strong>in</strong> der Regel als Wiesen oder<br />
Weiden mit Schafen bzw. R<strong>in</strong>dern genutzt. Netzartig<br />
durchziehen Hecken und Feldgehölze die Landschaftsstrukturen.<br />
Als typischer Vertreter der Heckenlandschaft<br />
kommt <strong>in</strong> Teilbereichen der Neuntöter und<br />
andere Heckenvögeln vor.<br />
• Bachaue<br />
Mäandrierende Bachläufe mit begleitendem Gehölzufersaum<br />
und Feuchtwiesenbereichen durchziehen die<br />
Täler. Die Überschwemmungsbereiche der Bäche werden<br />
<strong>in</strong> vielen Fällen noch als Wiesen genutzt.<br />
• Obstgärten<br />
E<strong>in</strong>zelhofanlagen werden oft von großflächigen<br />
Obstwiesen e<strong>in</strong>gerahmt. Sie garantieren nicht nur den<br />
unverwechselbaren Charakter dieser Landschaft sondern<br />
s<strong>in</strong>d auch e<strong>in</strong> bedeutender Lebensraum für Tiere<br />
und Pflanzen.<br />
Blick auf reizvolle Hoflage mit Streuobstwiesen<br />
• Trockenbiotope<br />
In Teilbereichen kommen noch bodensaure Halbtrockenrasen<br />
und Flügelg<strong>in</strong>sterheiden vor, die jedoch<br />
von der Aufforstung bedroht s<strong>in</strong>d bzw. sehr kle<strong>in</strong>flächig<br />
ausgeprägt s<strong>in</strong>d.<br />
Zusammenfassung<br />
Als Qualitäten des Gebietes können beschrieben<br />
werden<br />
— hohe Biotopdichte; ca. 20 % der Fläche wurden als<br />
Kle<strong>in</strong>strukturen kartiert<br />
— naturnahe Bachläufe vorhanden<br />
— hohe ästhetische Qualitäten durch Auenlandschaft und<br />
hängige Lagen<br />
— der Regen mit se<strong>in</strong>en Inseln und fragmentarischen<br />
Schwarzerlen-Uferauwald als übergeordnete Vernetzungsachse<br />
Als Defizite können beschrieben werden<br />
— nicht angepaßte Ackernutzung <strong>in</strong> der Regenaue,<br />
— fehlende Vernetzungsstrukturen im Bereich der<br />
Hochebene.<br />
Als Ziel wurde e<strong>in</strong> umfassendes Leitbild für die Landschaftsplanung<br />
entwickelt.<br />
• Sicherung und Erhaltung des naturraumtypischen<br />
Arten- und Lebensraumpotentials<br />
Aufgrund der Vielfalt der Standortbed<strong>in</strong>gungen werden<br />
die sich daraus entwickelnden Biotopstrukturen als<br />
Knotenpunkte <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em aufzubauenden Biotopverbund<br />
verstanden.<br />
• Erhaltung und <strong>Entwicklung</strong> des vorhandenen typischen<br />
Landschaftsbildes<br />
Wesentliche Merkmale für dieses unverwechselbare<br />
Landschaftsbild s<strong>in</strong>d das Vorhandense<strong>in</strong> von halbnatürlichen<br />
Ökosystemen (Hecken usw.) und e<strong>in</strong> kle<strong>in</strong>flächiger<br />
Wechsel von Wiesen- und Ackernutzung <strong>in</strong><br />
großen Teilen des Gebietes. Zur Sicherung dieses landschaftlichen<br />
Potentials ist es notwendig,<br />
— v. a. die Hangflächen und die Talauen offenzuhalten,<br />
— die bäuerlichen Existenzen zu unterstützen,<br />
— die vorhanden Erholungse<strong>in</strong>richtungen qualitativ zu<br />
verbessern.<br />
• Verb<strong>in</strong>dung von umweltgerechter Landnutzung mit<br />
sicherem E<strong>in</strong>kommen für die Bauern<br />
Die Erzeugung gesunder Nahrungsmittel soll nicht losgelöst<br />
von der Erhaltung der Kulturlandschaft gesehen<br />
werden. Es soll e<strong>in</strong>e Integration von Landnutzung und<br />
Naturschutz passieren entgegen e<strong>in</strong>er Segegration.<br />
Ohne die Landwirtschaft s<strong>in</strong>d die Ziele des Naturschutzes<br />
und der Landschaftspflege nicht umsetzbar. Für<br />
e<strong>in</strong>e umsetzungsorientierte Landschaftsplanung s<strong>in</strong>d die<br />
Bauern wichtige Partner. Für den Schutz der Naturgüter<br />
Boden, Wasser, Luft ist e<strong>in</strong>e flächendeckende Extensivierung<br />
<strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit dem Aufbau e<strong>in</strong>es Lebensraumnetzes<br />
notwendig. E<strong>in</strong>e extensive Bewirtschaftung ist<br />
e<strong>in</strong> gleichrangiges Standbe<strong>in</strong> bei der <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong>es<br />
jeden Biotopverbundsystems. Landwirtschaft <strong>in</strong> diesem<br />
S<strong>in</strong>ne bedeutet mehr als die Produktion von Nahrungsund<br />
Futtermitteln. Das Konzept der extensiven Bewirtschaftung<br />
mit Verarbeitung und Vermarktung erfordert<br />
von den Bauern e<strong>in</strong>e Neudef<strong>in</strong>ition ihres Berufsbildes.<br />
Deshalb war e<strong>in</strong> umfassender Bildungs- und Umdenkungsprozeß<br />
bei den Bauern notwendig. Wichtige Mitstreiter<br />
<strong>in</strong> diesem Prozeß waren der Bund Naturschutz<br />
(BN) und die Ökologische Modellregion im Landkreis<br />
Schwandorf e. V. (ÖMS).<br />
158 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Der Umdenkungsprozeß mußte v. a. <strong>in</strong> folgende<br />
Richtungen gefördert werden:<br />
1. Die Erkenntnis muß wachsen, daß angesichts der<br />
natürlichen Voraussetzungen e<strong>in</strong>e Produktionssteigerung<br />
nur bed<strong>in</strong>gt möglich und zudem ökologisch<br />
wenig s<strong>in</strong>nvoll ist.<br />
2. Die Standortnachteile wie hängige Lagen, vom Wasser<br />
bee<strong>in</strong>flußt Böden usw. können mit e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>telligenten<br />
Konzept zu Standortvorteilen werden.<br />
3. Für die regionale Vermarkung der Qualitätsprodukte ist<br />
e<strong>in</strong> Zusammenschluß notwendig, der als Lobby für die<br />
Interessen der Bauern auftritt.<br />
4. Eigen<strong>in</strong>itiative und Geme<strong>in</strong>schaftss<strong>in</strong>n der Bauern s<strong>in</strong>d<br />
wesentliche Voraussetzungen für das Gel<strong>in</strong>gen des<br />
Projektes. Die Fachstellen wie Direktion für <strong>Ländliche</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong>, Amt für Landwirtschaft und Ernährung,<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>sgruppe 5b-Gebiete an der<br />
Regierung der Oberpfalz, ÖMS und BN s<strong>in</strong>d beratend<br />
und unterstützend tätig.<br />
Von besonderer Bedeutung bei dieser Bildungs- und<br />
Motivationsarbeit war das 1. Mostfest, da dies die Aufgabe<br />
hatte, das Produkt Apfelwe<strong>in</strong> auf dem regionalen<br />
Markt zu etablieren, und die Marktchancen zu erproben.<br />
Konzept der Jugenberg-Bauern<br />
Herr Flötgen wird nun im Anschluß das Projekt aus der<br />
Sicht der Bauern darstellen.<br />
Wir nennen uns Jugenberg Bauern, weil im Schatten<br />
dieser höchsten Erhebung seit Jahrhunderten durch die<br />
Hand der Bauern diese Kulturlandschaft entstanden ist.<br />
Die Agrarpolitik nach dem Motto »Wachsen oder Weichen«<br />
führt <strong>in</strong> den Mittelgebirgsregionen immer mehr<br />
dazu, daß Flächen aus der Produktion genommen werden<br />
und brachfallen.<br />
Diese <strong>Entwicklung</strong> gefährdet bäuerliche Betrieb. Die<br />
Jugenberg-Bauern wollen andere Wege gehen. Die<br />
Standbe<strong>in</strong>e unseres landwirtschaftlichen Konzeptes s<strong>in</strong>d:<br />
• Streuobstanbau<br />
• extensive Tierhaltung<br />
• Fremdenverkehr<br />
• Landschaftspflege durch Bauern<br />
(Konzept der Jugenberg-Bauern siehe Seite 164)<br />
Wir s<strong>in</strong>d e<strong>in</strong>e Bauerngeme<strong>in</strong>schaft von 13 Bauern<br />
(2 Haupterwerbs- und 11 Nebenerwerbsbetriebe), zur Verarbeitung<br />
und zur Vermarktung von Qualitätsprodukten.<br />
In der rechtlichen Form e<strong>in</strong>er Gesellschaft bürgerlichen<br />
Rechts mit beschränkter Haftung (GbRmbH) haben wir<br />
uns im November 1991 zusammengeschlossen. Als Vorteile<br />
e<strong>in</strong>er Bauerngeme<strong>in</strong>schaft sehen wir, daß<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
— e<strong>in</strong>e breitere Produktpalette angeboten werden kann,<br />
— vom ersten Produktionsschritt bis zur Veredelung alles<br />
<strong>in</strong> der Hand der Bauern bleiben kann,<br />
— geme<strong>in</strong>sames Market<strong>in</strong>g betrieben werden kann. Dies<br />
ist besonders wichtig, weil wir regional vermarkten<br />
wollen.<br />
— wir die Verarbeitungse<strong>in</strong>richtungen besser ausnutzen<br />
können.<br />
Nun zu den e<strong>in</strong>zelnen Standbe<strong>in</strong>en:<br />
Streuobstanbau<br />
Der Altbestand an Obstbäumen beträgt ca. 600 Stück.<br />
150 Obstbäume wurden <strong>in</strong> der Aktion »Mehr Grün durch<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung« neu gepflanzt. Bei der Neuanlage legten<br />
wir besonderen Wert auf die Sortenauswahl. Es wurden<br />
vorrangig regionale und für die Saftbereitung besonders<br />
geeignete Sorten verwendet. Unsere Produktpalette<br />
umfaßt momentan<br />
• Apfelwe<strong>in</strong><br />
• Apfelsaft<br />
• Beerenwe<strong>in</strong>e<br />
• Obstschnäpse<br />
Wir konnten e<strong>in</strong> Brennrecht erwerben, das 300 l Re<strong>in</strong>alkohol/Jahr<br />
umfaßt. In der Brennerei erzeugten wir 1993<br />
ca. 200l Alkohol, v. a. aus Zwetschge, Birne, Apfel. Von<br />
Fachleuten wird der Schnaps als besonders gut bezeichnet.<br />
In der Saison 1993 verarbeiteten wir ca. 26 000 kg Obst<br />
zu ca.12 000 l Saft.<br />
Hergestellt wird der Saft nach festen Produktionsrichtl<strong>in</strong>ien,<br />
die die Qualität sichern und so das Produkt<br />
von der Masse abheben sollen. Sie lehnen sich an die<br />
Richtl<strong>in</strong>ien der Verbände des anerkannten ökologischen<br />
Anbaus an.<br />
Extensive Tierhaltung<br />
Drei Landwirte s<strong>in</strong>d mit diesem Produktionszweig<br />
befaßt, wobei e<strong>in</strong>er nach den Richtl<strong>in</strong>ien des Demeter-<br />
Bundes wirtschaftet. Im Jahr werden ca. 65 R<strong>in</strong>der<br />
(40 davon s<strong>in</strong>d Angus-R<strong>in</strong>der) und 260 Mutterschafe <strong>in</strong><br />
Form von Frischfleisch bzw. als Wurst über die GbR vermarktet.<br />
Durch die geme<strong>in</strong>same Vermarktung wurden<br />
bereits Zuwachsraten von 30 % erzielt. Die Nachfrage<br />
übersteigt <strong>in</strong>zwischen das Angebot.<br />
Fremdenverkehr<br />
In der Geme<strong>in</strong>schaft bef<strong>in</strong>den sich 6 Ferienwohnungen,<br />
die sehr gut ausgelastet s<strong>in</strong>d (> 200 Belegtage/Jahr). Im<br />
vergangenen Jahr mußte 150 Urlauberfamilien wegen<br />
Überbelegung abgesagt werden.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
159
160 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Landschaftspflege<br />
Die Pflege der wichtigen Biotopflächen soll <strong>in</strong> Kürze <strong>in</strong><br />
Angriff genommen werden, nachdem e<strong>in</strong> detailierter<br />
Pflegeplan vorliegt.<br />
Vermarktung und Vermarktungswege:<br />
Wir vermarkten unsere Produkte über die Gesellschaft<br />
unter dem Namen Jugenberg-Bauern. Entsprechend der<br />
<strong>Entwicklung</strong>sgeschichte des Projektes 1. Mostfest wird e<strong>in</strong><br />
Großteil der Produkte auf Festen (mittelalterliche Feste,<br />
Regensburger Altstadtfest, Bürgerfeste usw.) vertrieben.<br />
Zunehmend f<strong>in</strong>den unsere Produkt aber auch E<strong>in</strong>gang <strong>in</strong><br />
die heimische Gastronomie.<br />
Investitionen<br />
Bisher <strong>in</strong>vestierte die Bauerngeme<strong>in</strong>schaft<br />
ca. 250 000 DM für die Umbau von leer stehenden landwirtschaftlichen<br />
Gebäuden zu e<strong>in</strong>er Mosterei und e<strong>in</strong>er<br />
Brennerei auf den Höfen zweier GbR -Mitglieder. Diese<br />
übernehmen im Auftrag der GbR die Verarbeitung des<br />
Obstes zu Saft bzw. Schnaps.<br />
Weitere Investitionen waren notwendig für Betriebsmittel<br />
wie Flaschen, Kästen, Brennofen, hydraulische<br />
Obstpresse, Zerkle<strong>in</strong>erer usw.<br />
F<strong>in</strong>anzierung:<br />
Durch Kredite von den Gesellschaftern der GbR und<br />
öffentliche Zuschüße von Seiten der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong>sgruppe<br />
5b-Gebiete und von der Direktion für<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Regensburg konnten wir unser<br />
Projekt starten.<br />
Als Erfolg des Projektes sehen wir, daß<br />
• e<strong>in</strong>e Perspektive für den langfristigen Erhalt dieser<br />
wunderbaren Landschaft gegeben ist. E<strong>in</strong>e extensive<br />
Nutzung der Landschaft mit der umweltfreundlichen<br />
Produktion von Nahrungsmitteln verbunden werden<br />
kann. (Bauern und Natur erhalten)<br />
• e<strong>in</strong>e Verarbeitungse<strong>in</strong>richtung für die Region geschaffen<br />
wurde, die auch den Bestand von weiteren Streuobstbeständen<br />
sichert. (Nur wenn der Apfel e<strong>in</strong>en Wert<br />
hat, kann auch der Apfelbaum erhalten bleiben!)<br />
• e<strong>in</strong>e neue Geme<strong>in</strong>schaft entstanden ist wider den<br />
Konkurrenzkampf <strong>in</strong>nnerhalb der Bauern; die Bauern<br />
haben untere<strong>in</strong>ander und <strong>in</strong> der Bevölkerung e<strong>in</strong>e<br />
Lobby gefunden.<br />
An dieser Stelle möchte ich me<strong>in</strong>en Dank aussprechen<br />
an die Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>, das Amt für<br />
Landwirtschaft und Ernährung, die <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>sgruppe<br />
5b-Gebiete, die Firma Landimpuls GmbH,<br />
dem Bund Naturschutz und der Ökologischen Modellregion<br />
im Landkreis Schwandorf e. V.<br />
Um Ihnen das Gesagte näher zu br<strong>in</strong>gen, lade ich Sie <strong>in</strong><br />
der Pause zu e<strong>in</strong>er Kostprobe unserer Erzeugnisse e<strong>in</strong>.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
161
Thomas Gollwitzer / Karl Sp<strong>in</strong>dler<br />
Von der Bürgerbeteiligung zur<br />
Bürgerplanung<br />
Flurwerkstatt Fuhrn —<br />
e<strong>in</strong> Modell<br />
Vorbemerkung:<br />
Bürgerbeteiligung hat <strong>in</strong> der <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong><br />
Bayern schon immer e<strong>in</strong>e große Bedeutung. Seit dem<br />
Bayer. Programm <strong>Ländliche</strong> Neuordnung, aus dem Jahre<br />
1989, ist die Stärkung der Demokratie durch aktive Mitwirkung<br />
der Bürger am Verfahren e<strong>in</strong> eigenständiges Ziel<br />
unseres Verwaltungshandelns.<br />
Jede Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaft erstellt ihre Planungen<br />
der geme<strong>in</strong>schaftlichen Anlagen unter e<strong>in</strong>er möglichst<br />
breiten Mitarbeit der gesamten Bevölkerung. Je nach örtlicher<br />
Notwendigkeit werden somit zum<strong>in</strong>dest Teile der<br />
Flurwerkstatt Fuhrn, mehr oder m<strong>in</strong>der <strong>in</strong>tensiv, ständig<br />
praktiziert.<br />
In Fuhrn wurde <strong>in</strong>soweit das Rad der Bürgerbeteiligung<br />
nicht neu erfunden, sondern nur mit außerordentlichem<br />
Schwung betrieben. Das Bemerkenswerte, wenn man so<br />
will, das Neue am Modell Flurwerkstatt Fuhrn ist das stark<br />
strukturierte Vorgehen sowie die Intensität und Konsequenz<br />
mit der der Auftrag zur aktiven Bürgerbeteiligung<br />
umgesetzt wurde.<br />
Das Modell Flurwerkstatt Fuhrn ist allerd<strong>in</strong>gs nur e<strong>in</strong>e<br />
Möglichkeit, wie die Planung der geme<strong>in</strong>schaftlichen<br />
Anlagen unter aktivster Bürgerbeteiligung erfolgen kann.<br />
In Fuhrn, aufgrund der Ausgangssituation (Verfahrensgröße,<br />
Anzahl der Teilnehmer), wie ich me<strong>in</strong>e, die beste.<br />
Die Durchführung e<strong>in</strong>er Flurwerkstatt entsprechend dem<br />
Modell Fuhrn ist aber nur s<strong>in</strong>nvoll und erfolgreich, wenn<br />
die Bürger bereit s<strong>in</strong>d, selbst Verantwortung zu übernehmen<br />
und dieser Planungsmethode aufgeschlossen<br />
gegenüberstehen.<br />
Darüberh<strong>in</strong>aus müssen die Geme<strong>in</strong>de sowie alle sonstigen<br />
am Planungsgeschehen Beteiligten den Bürger als<br />
gleichberechtigten Partner akzeptieren und sich entsprechend<br />
offen mit se<strong>in</strong>en Problemen und Vorstellungen<br />
ause<strong>in</strong>andersetzen.<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Fuhrn — Lage im<br />
Raum:<br />
Fuhrn liegt ca. 60 km nördlich von Regensburg<br />
im Landkreis Schwandorf. Es ist Bestandteil der <strong>Stadt</strong><br />
Neunburg v. Wald. Das Verfahrensgebiet ist e<strong>in</strong>e<br />
Rodungs<strong>in</strong>sel mit dem zentralen Dorf Fuhrn.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>in</strong> Bayern<br />
Verfahren Fuhrn<br />
<strong>Stadt</strong> Neuburg v. Wald<br />
Lkr. Schwandorf<br />
Kenndaten<br />
● Anordnung nach §§ 1, 4 und 37 FlurbG<br />
mit Beschluß vom<br />
Verfahrensfläche<br />
Teilnehmer<br />
Landwirtschaftliche Betriebe<br />
Gelände<br />
● Vorstandswahl<br />
Mitglieder<br />
● Landschaftsplanung Stufe 1<br />
— <strong>Entwicklung</strong> — SNK<br />
Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiet<br />
Modell Flurwerkstatt Fuhrn<br />
— was heißt das?<br />
14. Dez. 1990<br />
415 ha<br />
ca. 60<br />
15<br />
hügelig,<br />
stark hängig<br />
4. April 1991<br />
5 (1 Frau)<br />
5. Mai 1992<br />
ca. 250 ha<br />
»Von der Bürgerbeteiligung zur Bürgerplanung« ist<br />
das Leitbild der Flurwerkstatt Fuhrn. Die Flurwerkstatt<br />
stellt den — mittlerweile gelungenen — Versuch dar, letztlich<br />
den Plan nach § 41 Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetz von den<br />
Bürgern selbst, im offenen Dialog mit den Experten,<br />
erarbeiten zu lassen.<br />
In Fuhrn hat der Vorstand der Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaft<br />
se<strong>in</strong>e Planungskompetenz (§ 25 FlurbG <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung<br />
mit Art. 2 BayAG FlurbG) <strong>in</strong>soweit e<strong>in</strong>geschränkt,<br />
daß die Planung der geme<strong>in</strong>schaftlichen Anlagen nicht<br />
Aufgabe der Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaft alle<strong>in</strong> ist, sondern<br />
daß alle Bürger, auf freiwilliger Basis, Träger der Planung<br />
s<strong>in</strong>d.<br />
Modell Flurwerkstatt Fuhrn — der Weg:<br />
Das Ziel jedes Verfahrens zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong><br />
ist es, dem Ort, se<strong>in</strong>en Menschen und der umgebenden<br />
Landschaft e<strong>in</strong>en Weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e »erfolgreiche Zukunft«<br />
zu schaffen. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, daß<br />
gerade die Konkretisierung dieses zunächst abstrakten<br />
Begriffes »erfolgreiche Zukunft« vom Bürger selbst vorgenommen<br />
wird. »<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> muß im Kopf<br />
beg<strong>in</strong>nen«. Das geme<strong>in</strong>same Erarbeiten e<strong>in</strong>es Leitbildes<br />
als Grundkonsens für die beabsichtigte <strong>Entwicklung</strong> des<br />
Verfahrensgebietes ist unabd<strong>in</strong>gbare Voraussetzung für<br />
die konkrete Maßnahmenplanung. Dabei kommt dem<br />
Prozeß der Leitbildaufstellung m<strong>in</strong>destens die gleiche<br />
Bedeutung zu, wie der ausformulierten Zieldef<strong>in</strong>ition<br />
selbst.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
163
Ziel:<br />
Dem Ort, se<strong>in</strong>en Menschen und der umgebenden<br />
Landschaft soll e<strong>in</strong> Weg <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e »erfolgreiche Zukunft«<br />
bereitet werden.<br />
Weg:<br />
Flurwerkstatt Fuhrn<br />
1. Durch e<strong>in</strong>e breitangelegte Diskussion aller<br />
Bevölkerungsgruppen sollen die vorhandenen Stärken<br />
und Schwächen bewußt gemacht werden. Unter<br />
Berücksichtigung der Vergangenheit, der Gegenwart und<br />
der vorhandenen Vorstellungen für die Zukunft entsteht<br />
e<strong>in</strong> Leitbild für die beabsichtigte <strong>Entwicklung</strong>.<br />
2. Umsetzung des Leitbildes durch konkrete Maßnahmen<br />
(Plan nach § 41 FlurG)<br />
Leitbild und Plan nach § 41 FlurbG sollen das Ergebnis<br />
e<strong>in</strong>er Diskussion der gesamten Fuhrner Bevölkerung widerspiegeln.<br />
»Von der Bürgerbeteiligung zur Bürgerplanung«<br />
Flurwerkstatt Fuhrn<br />
Schritt 1:<br />
Kennenlernen<br />
gegenseitige Information<br />
Ängste abbauen<br />
Offenheit und Ehrlichkeit<br />
Vertrauensbildung<br />
Schritt 2:<br />
Planungsstrategie geme<strong>in</strong>sam festlegen<br />
Schritt 3:<br />
Problembewußtse<strong>in</strong> und Kompetenz erzeugen<br />
(Bereitschaft zur Verantwortung)<br />
Schritt 4:<br />
Zieldef<strong>in</strong>ition (Leitbild)<br />
geme<strong>in</strong>samer Grundkonsens<br />
Schritt 5:<br />
»Das Geme<strong>in</strong>same geme<strong>in</strong>sam tun«<br />
Maßnahmeplanung<br />
»Von der Bürgerbeteiligung zur Bürgerplanung«<br />
➭<br />
➭<br />
➭<br />
➭<br />
Schritt 1: Vertrauensbildung, Offentheit und<br />
Ehrlichkeit<br />
Grundvoraussetzung für jede gedeihliche Zusammenarbeit<br />
zwischen Menschen ist e<strong>in</strong> hohes Maß an gegenseitigem<br />
Vertrauen. Dazu ist es notwendig, daß dem<br />
Kennenlernen der Vorstandsmitglieder untere<strong>in</strong>ander, der<br />
Planer sowie dem »Betreuungsteam« von der Direktion für<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> e<strong>in</strong> breiter Raum zugebilligt wird.<br />
Es gilt <strong>in</strong> dieser Phase ausführlich Information auszutauschen,<br />
<strong>in</strong>sbesondere darüber, welche Erwartungen an uns<br />
(e<strong>in</strong>schließlich der Planer) gestellt werden, was wir, die<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong>, leisten aber auch was wir nicht<br />
leisten können. Der Erfolg des gesamten Verfahrens hängt<br />
maßgeblich davon ab, <strong>in</strong>wieweit es gel<strong>in</strong>gt, bereits von<br />
anfang an, im vorstand sowie <strong>in</strong> der gesamten Bevölkerung<br />
e<strong>in</strong> Klima der Offenheit und Ehrlichkeit zu erzeugen.<br />
Schritt 2: Planung — aber wie?<br />
Die Planung im Wege e<strong>in</strong>er Flurwerkstatt durchzuführen,<br />
wie im Modell Fuhrn praktiziert, kann ke<strong>in</strong>esfalls<br />
die Entscheidung des Vorsitzenden oder der Planer alle<strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>. Vielmehr muß gerade auch das Festlegen des<br />
Planungsvorgehens e<strong>in</strong> geme<strong>in</strong>samer Beschluß aller<br />
Beteiligten se<strong>in</strong>.<br />
Schritt 3: Der Bürger als gleichwertiger<br />
Planungspartner<br />
Soll der Bürger, obgleich unterstützt durch Experten,<br />
dennoch weitgehend eigenverantwortlich, die <strong>Entwicklung</strong><br />
se<strong>in</strong>er Heimat (Leitbild + Maßnahmenplanung) gestalten,<br />
so muß er dazu <strong>in</strong> die Lage versetzt werden. Insofern s<strong>in</strong>d<br />
e<strong>in</strong> entsprechendes Problembewußtse<strong>in</strong> und die daraus<br />
resultierende Planungskompetenz Grundvoraussetzungen<br />
dafür, daß der Bürger als gleichwertiger Planungspartner<br />
wirken kann und akzeptiert wird. Mit steigendem »Wissen«<br />
wächst auch die Bereitschaft Verantwortung zu übernehmen,<br />
sich zu engagieren.<br />
Schritt 4: Leitbild als geme<strong>in</strong>samer<br />
Grundkonsens<br />
Das Leitbild ist e<strong>in</strong>e Art »Grundgesetz der kommunalen<br />
<strong>Entwicklung</strong>«. Durch e<strong>in</strong> Leitbild, das von den Bürgern<br />
selbst entwickelt wird, können die unterschiedlichen<br />
Interessen auf demokratische Weise ausgeglichen<br />
und koord<strong>in</strong>iert werden. (Materialien zur <strong>Ländliche</strong>n<br />
<strong>Entwicklung</strong> — Heft 26)<br />
Gerade der Prozeß des geme<strong>in</strong>samen Arbeitens an der<br />
eigenen Zukunft, die maßgebliche Beteiligung an der<br />
Weichenstellung für die Gestaltung der Heimat, fördert<br />
den Zusammenhalt <strong>in</strong> der Dorfgeme<strong>in</strong>schaft, den Willen<br />
zu Eigen<strong>in</strong>itiative und die Bereitschaft zur Eigenverantwortung<br />
außerordentlich. Leitbildarbeit ist somit<br />
164 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Beispiel Leitbild für den Themenbereich<br />
»Kulturlandschaft, Naturschutz und Landschaftspflege«<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Geme<strong>in</strong>wesensarbeit. E<strong>in</strong>e »<strong>in</strong>takte« Dorfgeme<strong>in</strong>schaft ist<br />
e<strong>in</strong>e entscheidende Grundvoraussetzung für e<strong>in</strong>e erfolgreiche<br />
Zukunft.<br />
E<strong>in</strong>e wesentliche Rolle fällt selbstverständlich der<br />
Geme<strong>in</strong>de, als Träger der kommunalen Planungshoheit, zu.<br />
Hier s<strong>in</strong>d Vertrauen <strong>in</strong> die Kompetenz der Bürger sowie<br />
e<strong>in</strong>e offene Ause<strong>in</strong>andersetzung mit den Bürgerwünschen<br />
gefragt.<br />
Schritt 5: Geme<strong>in</strong>same Maßnahmenplanung<br />
Das Ausfüllen des Rahmens »Leitbild« durch die konkrete<br />
Maßnahmenplanung erfolgt nun tatsächlich im<br />
Rahmen e<strong>in</strong>er »Werkstatt«. Mehrere Arbeitskreise erstellen<br />
unabhängig vone<strong>in</strong>ander den Wegenetzplan. In den<br />
Arbeitskreisen s<strong>in</strong>d Geme<strong>in</strong>devertreter, Vorstandsmitglieder,<br />
Landschaftsplaner, der Vorsitzende des Vorstands<br />
bzw. se<strong>in</strong>e Stellvertreter und, am wichtigsten, Bürger.<br />
Letztere s<strong>in</strong>d zusammen mit den Vorstandsmitgliedern die<br />
Hauptakteure. Von ihnen müssen alle wesentlichen<br />
Planungsimpulse ausgehen. Die »Experten« stehen beratend<br />
zur Seite. Besonderes Augenmerk ist auf die ständige<br />
H<strong>in</strong>terfragung der Planungen bezüglich Übere<strong>in</strong>stimmung<br />
mit dem Leitbild zu legen.<br />
Nach abgeschlossener Planung und e<strong>in</strong>er Vorstellung<br />
der jeweiligen Wegenetzentwürfe erfolgt sofort die<br />
Alternativendiskussion, bei der die Arbietskreise ihre<br />
unterschiedlichen Vorschläge begründen und gegene<strong>in</strong>ander<br />
abwägen. Die letzte Entscheidung fällt im Rahmen<br />
e<strong>in</strong>er neuerlichen Flurbegehung.<br />
Themenbereiche für die Abende<br />
der Flurwerkstatt Fuhrn<br />
E<strong>in</strong> »Wunschbild«<br />
unserer Landschaft für . . .<br />
➩ Landwirtschaft<br />
➩ Kulturlandschaft, Naturschutz und<br />
Landschaftspflege<br />
➩ Verkehr und landwirtschaftliche<br />
Erschließung<br />
➩ Erholungseignung und lanschaftsgebundene<br />
Erholung<br />
➩ Wasserwirtschaft, Gewässerschutz<br />
und Pflege<br />
➩ Forstwirtschaft und Waldfunktion, Jagd<br />
➩ Bodengesundheit und Erosionsschutz<br />
➩ Geschichte und historische Elemente<br />
der Landschaft<br />
➩ Dorfentwicklung und geme<strong>in</strong>schaftliche<br />
Anlagen<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
165
Obgleich der gewünschte Erfolg der Flurwerkstatt<br />
Fuhrn das strukturierte, schrittweise Vorgehen erfordert,<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Praxis die Grenzen der e<strong>in</strong>zelnen Abschnitte<br />
fließend, <strong>in</strong>sbesondere s<strong>in</strong>d die Schritte 1 und 2<br />
Daueraufgaben.<br />
Modell Flurwerkstatt Fuhrn<br />
Vorgehensweise:<br />
Vorgehensweise allgeme<strong>in</strong><br />
• Schrittweises Vorgehen von der <strong>Entwicklung</strong> von<br />
Leitl<strong>in</strong>ien bis zur Maßnahmenplanung.<br />
• Gemäß dem Beschluß des Vorstandes der Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaft<br />
ergeht die E<strong>in</strong>ladung zu den<br />
Veranstaltungen an alle Bürger<strong>in</strong>nen und Bürger<br />
von Fuhrn.<br />
• Die Veranstaltungen der Flurwerkstatt Fuhrn f<strong>in</strong>den am<br />
Abend oder am Wochenende statt.<br />
• Für die e<strong>in</strong>zelnen Veranstaltungen wird e<strong>in</strong> überschaubarer<br />
Zeitrahmen gewählt, der strikt e<strong>in</strong>gehalten<br />
wird; niemand soll zeitlich überfordert<br />
werden; die Abendveranstaltungen dauern höchstens<br />
2 1 / 2 Stunden.<br />
• Gastgeber der Veranstaltungen ist die Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaft<br />
Fuhrn; das örtlich beauftragte<br />
Vorstandsmitglied eröffnet und beschließt die<br />
Veranstaltungen, bei denen regelmäßig die Geme<strong>in</strong>de<br />
(<strong>Stadt</strong> Neunburg v. Wald) und die örtliche Presse<br />
vertreten ist.<br />
Vorgehensweise Flurwerkstatt<br />
»Leitsätze zur Flurentwicklung«:<br />
• Ziel ist die Bewußtmachung über die verantwortungsvolle<br />
und umfassende Aufgabe der Flurgestaltung und<br />
Flurneuordnung. Daraus sollen grundsätzliche Überlegungen<br />
und Ziele, Leitsätze zur künftigen <strong>Entwicklung</strong><br />
der Flur erarbeitet werden.<br />
• Die Arbeit wird an drei Abenden e<strong>in</strong>er Woche im<br />
Dorfgasthaus durchgeführt. Der Zielkatalog umfaßt 9<br />
vorher beschlossene Themenbereiche, von denen je drei<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Sitzung behandelt werden.<br />
• Die Betreuer, der TG-Vorsitzende und das Planungsbüro,<br />
führen <strong>in</strong> die e<strong>in</strong>zelnen Themenbereiche durch kurze,<br />
problemorientierte Impulsvorträge e<strong>in</strong>.<br />
Für e<strong>in</strong>zelne Themen werden Sonderfachleute h<strong>in</strong>zugezogen<br />
(Amt für Landwirtschaft, Bauabteilung der<br />
<strong>Stadt</strong>verwaltung).<br />
• Es werden anschauliche Hilfsmittel verwendet: Karten,<br />
Dias, Luftbilder, Overheadfolien. Als besonders ansprechend<br />
und <strong>in</strong>formativ empf<strong>in</strong>den die Teilnehmer farbige<br />
Schrägaufnahmen der Flur. Die Karten der SNK werden<br />
zur besseren Lesbarkeit farbig angelegt.<br />
• Die Betreuer wenden verschiedene Moderationstechniken<br />
an. Trotz des straffen Programms wird großer<br />
Wert auf genügend Zeit zur Me<strong>in</strong>ungsäußerung und<br />
Diskussion gelegt. Die erarbeiteten Thesen und Leitsätze<br />
werden durch Punktabfragen bewertet. Weitere<br />
Techniken s<strong>in</strong>d die Abfrage per Zuruf oder die Punktewertung<br />
auf Karten.<br />
• Als Ergebnis zeigt sich, für alle Teilnehmer sichtbar und<br />
nachvollziehbar, der Grad der Identifikation mit den<br />
Leitsätzen zur Flurentwicklung.<br />
Vorgehensweise Flurwerkstatt<br />
»Wegenetz- und Flurplanung«<br />
• Ziel ist der Grobentwurf des landwirtschaftlichen<br />
Wegenetzes und der Flurgestaltung <strong>in</strong> Gruppenarbeit;<br />
die Arbeit f<strong>in</strong>det an drei Abenden statt.<br />
• Es werden drei Arbeitsgruppen gebildet, die gleichzeitig<br />
das gesamte Neuordnungsgebiet bearbeiten.<br />
• Jeder Gruppe stehen als Arbeitsunterlagen e<strong>in</strong>e<br />
Bestandskarte (Realnutzung der SNK) und e<strong>in</strong> Luftbild<br />
1 : 5000 zur Verfügung; des weiteren hängen alle<br />
Bestands- und Analysekarten sowie die vorher erarbeiteten<br />
Leitl<strong>in</strong>ien aus.<br />
• Die Arbeitsgruppen werden durch den TG-Vorsitzenden<br />
und dessen Mitarbeiter sowie die Landschaftsarchitekten<br />
betreut und beraten.<br />
• Die Entwurfsarbeit f<strong>in</strong>det an zwei Abenden statt. Am<br />
dritten Abend präsentieren die Gruppen ihre Entwürfe,<br />
diskutieren sie und tauschen Vor- und Nachteile der<br />
gefundenen Lösungen aus.<br />
• TG-Vorsitzender und Landschaftsarchitekt kommentieren<br />
die Entwurfslösungen. Das Gesamtergebnis wird als<br />
Synthese <strong>in</strong> übere<strong>in</strong>ander liegenden Folien vorgestellt.<br />
• Breiter Konsens und abweichende Lösungsansätze<br />
werden sichtbar. Die Ergebnisse bilden die Ausgangsbasis<br />
für den nächsten Planungsschritt, die 2. Flurbegehungen.<br />
• Bei e<strong>in</strong>er 2tägigen Begehung werden die Entwürfe zur<br />
Wegenetz- und Landschaftsplanung vor Ort ausführlich<br />
und kritisch diskutiert. Die Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaft<br />
e<strong>in</strong>igt sich auf e<strong>in</strong> Maßnahmenkonzept zur Neugestaltung<br />
der Flur.<br />
166 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Modell Flurwerkstatt Fuhrn -<br />
die Praxis (Erfahrungen, Ergebnisse,<br />
Chronologie):<br />
Erfahrungen und Ergebnisse<br />
• Der programmatische Vorstandsbeschluß vom 22. Juni<br />
1993 (Festlegung der Planungsstrategie) wurde voll<br />
erfüllt.<br />
• Die Durchführung e<strong>in</strong>er Flurwerkstatt (Modell Fuhrn)<br />
setzt e<strong>in</strong> neues Rollenverständnis der Planer und<br />
»Spezialisten« voraus, weg vom Vordenker, h<strong>in</strong> zum<br />
Moderator. Bürger und Planer gestalten die beabsichtigte<br />
<strong>Entwicklung</strong> im gleichberechtigten Dialog.<br />
• Die Geme<strong>in</strong>de, als Träger der kommunalen Planungshoheit,<br />
ist <strong>in</strong> besonderer Weise gefordert, sich offen mit<br />
den Vorstellungen der Bürger ause<strong>in</strong>anderzusetzen.<br />
Auf Grund der Aussagen <strong>in</strong> der Leitbilddiskussion, daß<br />
Fuhrn nur maßvoll wachsen soll, hat die <strong>Stadt</strong> Neunburg<br />
v. Wald den Flächennutzungsplan geändert und<br />
e<strong>in</strong>e beabsichtigte Baugebietsausweisung drastisch<br />
reduziert.<br />
• Von herausragender Bedeutung ist der Prozeß der<br />
Leitbildentwicklung, weil hier Problembewußtse<strong>in</strong> und<br />
Verantwortungsbereitschaft <strong>in</strong> besonderer Weise<br />
wachsen.<br />
• Die Teilnehmer haben von sich aus ökologisch wertvolle<br />
Strukturen erhalten und <strong>in</strong> die Planung <strong>in</strong>tegriert.<br />
• Der Identifikationsgrad der Bürger mit ihrem Leitbild ist<br />
durch entsprechende Methoden abzufragen.<br />
• Die getrennte Erstellung von drei Wegenetzentwürfen<br />
führt im Zuge der Alternativendiskussion zu e<strong>in</strong>em ausgereiften,<br />
allseits akzeptierten Konzept.<br />
• Bei der Umsetzung der Planung ist mit »ke<strong>in</strong>en«<br />
Problemen zu rechnen, da Leitbild und Plan nach § 41<br />
FlurbG (Entwurf) geme<strong>in</strong>sam und mit weitgehendem<br />
Konsens erstellt wurden.<br />
• Das geme<strong>in</strong>same Arbeiten an der Weichenstellung für<br />
die »erfolgreiche« Zukunft hat auch die Dorfgeme<strong>in</strong>schaft<br />
gestärkt.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Flurwerkstatt Fuhrn<br />
»Von der Bürgerbeteiligung zur Bürgerplanung«<br />
ca. 30 öffentliche Vorstandssitzungen<br />
Informationsfahrt Landschaftspflege,<br />
Wegebau<br />
1. Dorfabend<br />
1. Teilnehmersprechtag<br />
1. Flurspaziergang<br />
3 Flurwerkstattabende (Leitbild)<br />
Informationsfahrt<br />
»Urlaub auf dem Bauernhof«<br />
3 Flurwerkstattabende<br />
(Plan nach § 41 FlurbG)<br />
3 Tage Flurwerkstatt (2. Ortsbegehung<br />
Wegebau und Landschaftspflege)<br />
Juli 92 — April 94<br />
Juli 92<br />
Juli 93<br />
Juli 93<br />
August 93<br />
November 93<br />
Dezember 93<br />
März 94<br />
April 94<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
167
Arbeitskreis 6:<br />
Informationstechnik<br />
Karl Braumiller<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Unser Arbeitskreis ist heute Gast <strong>in</strong> den Räumen des<br />
Amtsgerichts <strong>Ansbach</strong>. Das Gebäude schließt e<strong>in</strong>e<br />
über zweihundertjährige Baulücke im Bereich der<br />
barocken südlichen <strong>Stadt</strong>erweiterung, der sogenannten<br />
»Neuen Auslage«. Zwei Markgrafen, Johann Friedrich<br />
(1672 — 1686) und Carl Wilhelm Friedrich (1729 — 1757)<br />
versuchten <strong>in</strong> diesem Bereich den planmäßigen Ausbau<br />
e<strong>in</strong>es neuen <strong>Stadt</strong>viertels.<br />
Nach Bebauungsplänen der markgräflichen Baumeister<br />
Zocha und Leopold Retti entstanden im 18. und 19. Jahrhundert<br />
für das <strong>Stadt</strong>bild <strong>Ansbach</strong>s bedeutende bürgerliche<br />
und kirchliche Bauten.<br />
Im Jahr 1981 erwarb der Freistaat Bayern an der<br />
Westseite der »Neuen Auslage« zwischen Karlstraße und<br />
Promenade Gebäude und Grundstücke. Von besonderem<br />
historischen Wert s<strong>in</strong>d dabei das von Johann David<br />
Ste<strong>in</strong>gruber, dem Nachfolger Leopold Rettis, selbst bewohnte<br />
Doppelhaus und das Palais Nostiz. Nach Sanierung<br />
und Erweiterung der bestehenden Gebäude für die<br />
Oberforstdirektion (1985) und das Amtsgericht (1990) zog<br />
neues Leben <strong>in</strong> jahrelang verwaiste Häuser e<strong>in</strong>. Der <strong>in</strong> den<br />
Jahren davor betriebene Abbruch dieses historischen Teils<br />
von <strong>Ansbach</strong> war damit abgewendet.<br />
Me<strong>in</strong>e Damen und Herren, der amerikanische Präsident<br />
Bill Cl<strong>in</strong>ton kündigte kürzlich den forcierten Ausbau e<strong>in</strong>es<br />
mit Milliardenprogrammen geförderten »Information-<br />
Highways«, d. h. e<strong>in</strong>es Datenschnellweges an. Kurz darauf<br />
gab es Zeitungsmeldungen über ähnliche Vorhaben u. a.<br />
aus Kanada, aus Frankreich und von der deutschen<br />
Telekom. Ende 1993 schlug die EU-Kommission e<strong>in</strong>en<br />
europäischen Super-Highway mit e<strong>in</strong>em Investitionsvolumen<br />
von 40 Milliarden Ecu vor.<br />
Illustriert wird die <strong>Entwicklung</strong> durch e<strong>in</strong>e Meldung <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Münchner Tageszeitung, wonach das »Centrum für<br />
Informations- und Sprachverarbeitung (CIS)«. an der<br />
Ludwig-Maximilians-Universität mit zwei Gymnasien e<strong>in</strong><br />
Pilotprojekt durchführt. Die Schüler können über das bislang<br />
wissenschaftlichen Zwecken vorbehaltene Datennetz<br />
»Internet« weltweit mit Partnerschulen kommunizieren<br />
und Datenbanken nach Literaturangaben abfragen.<br />
Aus diesen Szenarien s<strong>in</strong>d die <strong>Entwicklung</strong>strends der<br />
modernen Informations- und Kommunikationstechnik<br />
(IuK) und die ihr <strong>in</strong>zwischen auch auf höchster politischer<br />
Ebene beigemessene Bedeutung zu ersehen.<br />
Die Mikroelektronik hat <strong>in</strong>zwischen <strong>in</strong> vielen Bereichen<br />
des täglichen Lebens E<strong>in</strong>zug gehalten. Nicht nur im beruf-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
lichen Umfeld, auch <strong>in</strong> den Schulen und <strong>in</strong> privaten<br />
Haushalten ist der Computer schon fast e<strong>in</strong>e Selbstverständlichkeit.<br />
Und trotzdem kommt beim Lesen von Nachrichten <strong>in</strong><br />
der oben geschilderten Art das Gefühl auf, wir stünden<br />
erst am Anfang der <strong>Entwicklung</strong>. Weitere Schlagworte wie<br />
RISC- und Client/Server-Technologie, Euro-ISDN, Multimedia,<br />
künstliche Intelligenz und neuronale Netze ließen<br />
sich <strong>in</strong> beliebiger Anzahl aufzählen.<br />
Während <strong>in</strong> den vergangenen drei Jahrzehnten die<br />
Aufgabe der elektronischen Datenverarbeitung vorwiegend<br />
dar<strong>in</strong> bestand, die Kernaufgaben e<strong>in</strong>er Firma oder<br />
Verwaltung durch Individuallösungen abzudecken, werden<br />
durch die heutigen Innovationen alle Unternehmensstrukturen<br />
betroffen. Die gewandelte Ausrichtung der<br />
Mikroelektronik von der Verarbeitung großer Datenmengen<br />
zur Informationsbereitstellung und Verbesserung<br />
der lokalen und überregionalen Kommunikation spiegelt<br />
sich auch <strong>in</strong> der Begriffswandlung von »EDV« auf »IT«<br />
(Informationstechnik) oder »IuK« wider.<br />
Hauptsächliche Ursachen für die jetzigen und auch <strong>in</strong><br />
Zukunft noch zu erwartenden Technologiesprünge auf<br />
dem Hard- und Softwaresektor dürften se<strong>in</strong>:<br />
— Die fortschreitende Standardisierung von Hard- und<br />
Softwareschnittstellen sowie von Netzprotokollen.<br />
Dies bedeutet weniger Mehrfachentwicklungen, breitere<br />
Marktbasis für die Produkte, vermehrte Hersteller-<br />
Unabhängigheit für die Anwender und damit höheren<br />
Wettbewerbs- und Leistungsdruck für die Hersteller.<br />
— Die Computer-, Telekommunikations- und Unterhaltungs<strong>in</strong>dustrie<br />
wachsen auf den Ebenen der Netze,<br />
Netzwerksdienste, Programme und Endgeräte immer<br />
mehr zusammen. Der Kampf um günstige Ausgangspositionen<br />
<strong>in</strong> diesem künftigen gigantischen Markt hat<br />
bereits begonnen und äußert sich <strong>in</strong> strategischen<br />
Allianzen der großen Firmen dieser Branchen mit<br />
e<strong>in</strong>em enormen <strong>Entwicklung</strong>spotential.<br />
Während auf der Hardware- und Netzwerkseite noch<br />
ke<strong>in</strong> Ende bei Rechen- und Übertragungsgeschw<strong>in</strong>digkeiten<br />
und Speicherungskapazitäten abzusehen ist, ist auf<br />
dem Software-Sektor e<strong>in</strong> starker Trend zu modernen<br />
Standard-Softwarelösungen zu verzeichnen. Die Schlüssel<br />
zu den neuen Technologien s<strong>in</strong>d leistungsfähige Datenbanksysteme,<br />
objektorientierte Techniken und sogenannte<br />
»Middleware«. Darunter versteht man Werkzeuge für die<br />
Erstellung von Anwendungssoftware unabhängig von<br />
Betriebssystemen, Hardware- und Netztopologie. Die<br />
Lösungsansätze, mit Hilfe dieser Technologien trotz<br />
heterogener DV-Landschaften die Kommunikation der<br />
E<strong>in</strong>führungreferate <strong>in</strong> den Arbeitskreis 6<br />
169
Systeme und e<strong>in</strong>e für den Anwender transparente<br />
Datenspeicherung sicherzustellen, laufen unter Schlagworten<br />
wie elektronische Vorgangsbearbeitung, Dokumenten-Management-Systeme,<br />
Workgroup Comput<strong>in</strong>g<br />
und virtuelle Teamarbeit.<br />
E<strong>in</strong>e Untersuchung, nach der 58 % der Arbeitnehmer<br />
mit der Bearbeitung, Beschaffung und Weiterleitung von<br />
Informationen beschäftigt s<strong>in</strong>d, läßt das dar<strong>in</strong> steckende<br />
Produktivitätspotential erahnen. Das Marktforschungsunternehmen<br />
Dataquest prognostiziert im Bereich der<br />
»Groupware« e<strong>in</strong>e Steigerung des Gesamtmarktes von derzeit<br />
2,49 Milliarden Dollar auf 5,8 Milliarden im Jahre<br />
1997. Durch ihre Flexibilität dr<strong>in</strong>gen Standardprogramme,<br />
z. B. Geo<strong>in</strong>formationssysteme, auch <strong>in</strong> Bereiche vor, <strong>in</strong><br />
denen bis vor wenigen Jahren e<strong>in</strong>e teure und schwerfällige<br />
Eigenprogrammierung unumgänglich schien.<br />
Allerd<strong>in</strong>gs darf der Aufwand für die Anpassung, <strong>in</strong>sbesondere<br />
an komplexere Abläufe, nicht unterschätzt werden.<br />
Der große Vorteil liegt aber dar<strong>in</strong>, daß nur Standardprogramme<br />
aufgrund ihres breiten E<strong>in</strong>satzes e<strong>in</strong>en hohen<br />
<strong>Entwicklung</strong>sstand aufweisen und ständig an neue Technologien<br />
angepaßt werden können.<br />
Die moderne Informations- und Kommunikationstechnik<br />
kann Geschäftsprozesse besser mitgestalten und<br />
zur Optimierung bestehender Abläufe beitragen. Allerd<strong>in</strong>gs<br />
ist auch e<strong>in</strong>e durchgreifende Änderung des Anwenderverhaltens<br />
erforderlich : Beim E<strong>in</strong>satz von Standardsoftware<br />
müssen Maximalforderungen aufgegeben<br />
werden. Aus Untersuchungen ist bekannt, daß sich viele<br />
Anforderungen der Fachabteilungen an EDV-Projekte<br />
ohneh<strong>in</strong> als Kosmetik erweisen, die für den eigentlichen<br />
Geschäftsablauf nicht nötig s<strong>in</strong>d.<br />
Ausgehend von diesem Gedanken möchte ich aber<br />
noch auf weitere Probleme h<strong>in</strong>weisen, die bei der Fasz<strong>in</strong>ation<br />
über die neuesten Errungenschaften leicht vergessen<br />
werden.<br />
In e<strong>in</strong>igen Branchen wird die zunehmende Digitalisierung<br />
der Informationen e<strong>in</strong>en Wandel oder sogar e<strong>in</strong><br />
Verschw<strong>in</strong>den heute noch gültiger Berufsbilder bewirken.<br />
Beispiele s<strong>in</strong>d heute schon <strong>in</strong> der Druckbranche zu f<strong>in</strong>den.<br />
Neu zu beurteilen s<strong>in</strong>d die Qualität und Authentizität von<br />
Informationen, die Verläßlichkeit des Informationstransfers<br />
und die Rechte der Beteiligten.<br />
Im Zusammenhang mit der E<strong>in</strong>führung neuer Technologien<br />
ist auch die Personalentwicklung (PE) zu sehen.<br />
Sie muß alle großflächigen Veränderungsprozesse begleiten<br />
und von Anfang an <strong>in</strong> alle wichtigen Projekte<br />
e<strong>in</strong>gebunden se<strong>in</strong>. Der ehemalige IBM-Personalleiter<br />
Dr. Ulrich A. Wever äußerte sich folgendermaßen:<br />
». . . Andererseits kann nicht jeder Mensch beliebig zu<br />
jeder Funktion umgeschult werden. Dom<strong>in</strong>ierende mentale<br />
Vorprägungen können bei Erwachsenen nur noch sehr<br />
bed<strong>in</strong>gt verändert werden. Deshalb die alte PE-Weisheit:<br />
E<strong>in</strong> Quentchen Auswahl ist besser als zehn Scheffel<br />
Schulung«.<br />
Da die Forderung nach optimaler Mitarbeiterauswahl<br />
jedoch schwer zu erfüllen ist, kommt der Schulung umso<br />
höhere Priorität zu. Obwohl bereits 37 % der westdeutschen<br />
und 24 % der ostdeutschen Erwerbstätigen am<br />
Computer arbeiten, wurde die Schulung bisher <strong>in</strong> allen<br />
Bereichen sträflich vernachlässigt. E<strong>in</strong> Grund s<strong>in</strong>d die<br />
hohen Kosten bei gleichzeitiger Ineffizienz von Sem<strong>in</strong>aren<br />
mit allgeme<strong>in</strong>er Zielrichtung, weshalb e<strong>in</strong> Trend zu<br />
Inhouse-Schulungen zu beobachten ist. E<strong>in</strong>en Schritt weiter<br />
geht e<strong>in</strong> großer bayerischer Automobilhersteller, der <strong>in</strong><br />
den vergangenen Jahren e<strong>in</strong>e sechsstellige Summe <strong>in</strong> die<br />
<strong>Entwicklung</strong> eigener PC-Tra<strong>in</strong><strong>in</strong>gsmittel <strong>in</strong>vestierte, da die<br />
<strong>in</strong> großer Zahl am Markt verfügbaren Handbücher zu<br />
schlecht waren.<br />
Dr. Wever wiederum me<strong>in</strong>t hierzu: »Der Lernbedarf<br />
steigt zwar ständig, aber die klassische Sem<strong>in</strong>arschulung<br />
ist tot. Sie eignet sich allenfalls für die re<strong>in</strong> kognitive<br />
Vermittlung von Wissen und Fertigkeiten, nicht aber für<br />
die Unterstützung großflächiger Veränderungsprozesse.<br />
Wichtigstes Lernfeld bleibt der Arbeitsplatz (was Coach<strong>in</strong>g<br />
durch den Vorgesetzten voraussetzt). Zunehmend erarbeiten<br />
teilautonome Lern-Projektteams Ansätze zur Lösung<br />
real existierender Probleme im Unternehmen«.<br />
Die Probleme Personalentwicklung und Ausbildung<br />
gelten natürlich nicht nur für die Anwenderseite, sondern<br />
sogar <strong>in</strong> höherer Dr<strong>in</strong>glichkeit für die Betreuer von Anwendern<br />
und der immer komplexer werdenden Systeme<br />
und Netzwerke.<br />
Me<strong>in</strong>e Gedanken zur Aus- und Fortbildung, womit sich<br />
heute <strong>in</strong>tensiver der Arbeitskreis 7 befassen wird, möchte<br />
ich mit e<strong>in</strong>em Zitat von Ex-McK<strong>in</strong>sey-Vorstand Tom Peters<br />
abschließen: »Auf ke<strong>in</strong>er Gehaltsliste e<strong>in</strong>es europäischen,<br />
amerikanischen oder japanischen Unternehmens ist heute<br />
noch Platz für Mitarbeiter, die sich nicht dem lebenslangen<br />
Lernen verpflichten«.<br />
Wie Sie der Tagungsbroschüre entnehmen konnten,<br />
werden die Arbeitskreise 3 — 8 <strong>in</strong> Moderationstechnik<br />
gestaltet. Ich danke Herrn Schellhaas, daß er sich als<br />
Referent für den E<strong>in</strong>führungsvortrag mit dem Thema<br />
»Aktuelle <strong>Entwicklung</strong>en der Informations- und<br />
Kommunikationstechnik — Anwendungsbeispiele <strong>in</strong> der<br />
öffentlichen Verwaltung«. zur Verfügung gestellt hat.<br />
Herr Schellhaas ist Diplom-Mathematiker und bei der<br />
Firma CAP debis als leitender Berater tätig. Das Systemhaus<br />
CAP debis bietet Beratungsdienste im Bereich des<br />
Managements, der Organisation und Technologie. Se<strong>in</strong>e<br />
hardwarenahen Dienste umfassen die Bereitstellung von<br />
Rechenleistung, herstellerneutrale Hardware-Konzeption<br />
e<strong>in</strong>schließlich deren Umsetzung, Migration und Wartungsservice.<br />
Im Software-Bereich bietet CAP debis<br />
Technologie-Knowhow für branchenspezifische Softwareprojekte<br />
und beim E<strong>in</strong>satz von Standardsoftware.<br />
Im Anschluß an den E<strong>in</strong>führungsvortrag werden e<strong>in</strong>zelne<br />
Themenbereiche <strong>in</strong> 4 Workshops <strong>in</strong> Moderationstechnik<br />
vertieft. Die Workshops werden von me<strong>in</strong>en<br />
Kollegen Peter Doneis, Eckhard H<strong>in</strong>te, Horst Küffner und<br />
170 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Axel Schäfer moderiert. Alle vier Kollegen s<strong>in</strong>d an den<br />
Direktionen Würzburg bzw. Bamberg als Vorsitzende des<br />
Vorstands von Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaften tätig. Ich danke<br />
ihnen bereits im voraus für die Unterstützung.<br />
Die hohe Anzahl von Arbeitskreisteilnehmern bestätigt<br />
das Bedürfnis nach neuen Informationen und gegenseitigem<br />
Austausch zu dem Thema Informations- und<br />
Kommunikationstechnik, mit dem wir alle sowohl <strong>in</strong> der<br />
beruflichen Praxis als auch im privaten Alltag immer mehr<br />
konfrontiert werden. Ich darf daher auf Ihre rege Mitarbeit<br />
<strong>in</strong> den Workshops rechnen.<br />
E<strong>in</strong>führung zum Nachmittagsthema:<br />
Durch die umwälzenden politischen <strong>Entwicklung</strong>en der<br />
vergangenen Jahre wie Wiedervere<strong>in</strong>igung, Öffnung der<br />
osteuropäischen Staaten und europischer B<strong>in</strong>nenmarkt<br />
entstehen wirtschaftliche Herausforderungen <strong>in</strong> neuen<br />
Dimensionen. Dem Wettbewerb der europäischen<br />
Regionen können sich ebensowenig wie die Wirtschaft<br />
auch die Kommunen und die übrige öffentliche Verwaltung<br />
entziehen.<br />
Information und Kommunikation wird daher künftig<br />
vermehrt zu e<strong>in</strong>em Produktionsfaktor, der nur mit E<strong>in</strong>satz<br />
neuester Techniken zu gewährleisten ist. E<strong>in</strong>e funktionierende,<br />
hochkomplexe Industriegesellschaft ist ohne die<br />
Möglichkeiten der Telekommunikation nicht mehr vorstellbar.<br />
Diese ist zum Nervensystem e<strong>in</strong>er mobilen<br />
Gesellschaft geworden.<br />
Um die Aktualität dieser Aussagen zu unterstreichen,<br />
möchte ich auf e<strong>in</strong>en Artikel von »Wall Street Journal«<br />
verweisen. Auf dem Informationsnetz Internet, an das<br />
weltweit 20 Millionen Anwender angeschlossen s<strong>in</strong>d, wird<br />
bis September <strong>1994</strong> »Commercenet« e<strong>in</strong>gerichtet. Über<br />
diesen Dienst können Firmen Bestellungen absetzen, sich<br />
an Ausschreibungen beteiligen, an geme<strong>in</strong>samen Produktplanungen<br />
arbeiten etc.<br />
Die <strong>Entwicklung</strong> der Gesellschaft von e<strong>in</strong>er Produktions-<br />
h<strong>in</strong> zu e<strong>in</strong>er Informationsgesellschaft ist gleichzeitig<br />
e<strong>in</strong>e große Chance für den ländlichen Raum. Mit<br />
den Mitteln der Telekommunikation können die Standortnachteile<br />
des Dorfes bezüglich Ausbildungsstätten und<br />
Arbeitsmarkt abgebaut werden. Allerd<strong>in</strong>gs muß nach den<br />
Worten von Dr. Walter Lohmeier, dem Leiter des Technologie-<br />
und Gründerzentrums Würzburg, das Dorf mit se<strong>in</strong>en<br />
Vorteilen — wie z. B. Wohn- und Lebensqualität —<br />
qualifizierte Arbeitskräfte anziehen, um für Standortentscheidungen<br />
attraktiv zu se<strong>in</strong>. Hierfür sei die Dorferneuerung<br />
e<strong>in</strong> wichtiges Instrument.<br />
Nicht zu vergessen ist der ökologische Aspekt, wenn<br />
durch <strong>Entwicklung</strong>en wie Telearbeit, Electronic Bank<strong>in</strong>g<br />
und Videokonferenzen die Mobilität anstatt durch Verkehrssysteme<br />
durch Netzwerke gesichert wird. Informationen<br />
zur Telematik im ländlichen Raum erhalten wir nun<br />
von Herrn Prof. Dr. Jörg Maier <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em E<strong>in</strong>führungs-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
vortrag »Telekommunikation im ländlichen Raum<br />
— Möglichkeiten und Grenzen der Errichtung von<br />
Telestuben«.<br />
Herr Prof. Dr. Maier ist Inhaber des Lehrstuhls Wirtschaftsgeographie<br />
und Regionalplanung an der Universität<br />
Bayreuth und hat sich u. a. anläßlich e<strong>in</strong>es Gutachtens<br />
zur Dorferneuerung Weißenbrunn mit der Thematik<br />
Telestuben befaßt. Die Universität Bayreuth ist ferner<br />
Mitglied im Trägervere<strong>in</strong> »Telehaus Bayreuth«. Ich bitte im<br />
Anschluß an den Vortrag um e<strong>in</strong>e lebhafte Beteiligung an<br />
der Diskussion <strong>in</strong> der Hoffnung, entsprechend dem Motto<br />
der <strong>Fachtagung</strong> »<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> <strong>dient</strong> <strong>Stadt</strong> und<br />
Land« zum<strong>in</strong>dest e<strong>in</strong>en gedanklichen Beitrag zur Telematik<br />
im ländlichen Raum leisten zu können.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
171
Holger Schellhaas<br />
Aktuelle <strong>Entwicklung</strong>en der<br />
Informations- und<br />
Kommunikationstechnik<br />
Anwendungsbeispiele aus der öffentlichen<br />
Verwaltung<br />
Nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen<br />
auf <strong>in</strong>ternationalen Märkten, auch die Effizienz<br />
e<strong>in</strong>er modernen Verwaltung wird schon seit längerem<br />
durch den E<strong>in</strong>satz von Informations- und Kommunikationstechnik<br />
bestimmt. Im Unterschied zu den 80er<br />
Jahren, die mit dem Aufkommen der PCs im Zeichen der<br />
<strong>in</strong>dividuellen Datenverarbeitung am e<strong>in</strong>zelnen Arbeitsplatzes<br />
standen, dom<strong>in</strong>iert heute der Aufbau von Telekommunikations<strong>in</strong>frastrukturen<br />
zur Unterstützung von<br />
Arbeitsabläufen auch über regionale Standorte h<strong>in</strong>weg.<br />
1. Neue TK-Infrastrukturen durch die Deregulierung<br />
Die aktuellen <strong>Entwicklung</strong>en der Informations- und<br />
Kommunikationstechnik wurden vor allem durch die<br />
Deregulierung im Telekommunikationsmarkt ausgelöst,<br />
die das Monopol der DBP Telekom auf drei Bereiche e<strong>in</strong>geschränkt<br />
hat: die Bereitstellung von Monopolleitungen<br />
für die Übertragung von Informationen über öffentlichen<br />
Grund, die Vergabe von Funklizenzen und die (kommerzielle)<br />
Vermittlung von Sprac he (<strong>in</strong> Echtzeit) für Dritte.<br />
Als Folge etablierten sich mehr und mehr (private)<br />
Anbieter aus dem In- und Ausland mit neuen Dienstleistungen<br />
und veränderten das Marktgefüge:<br />
— Durch die Vergabe der Mobilfunklizenzen an Mannesmann<br />
Mobilfunk und an das Eplus-Konsortium hat<br />
die Mobilkommunikation <strong>in</strong> De utschland erheblich<br />
an Attraktivität gewonnen. Bereits im Jahr <strong>1994</strong><br />
beträgt die Zahl »mobiler« Teilnehmer <strong>in</strong> den GSM-<br />
Netzen (D1 und D2) ca. 1 Million. Das Potential für<br />
zellulare Netze (<strong>in</strong>klusive Eplus) wird auf 10 Mio. Teilnehmer<br />
geschätzt. Daneben unterstützt der digitale<br />
INMARSAT-M-Dienst seit 1992 das »mobile« Telefonieren<br />
via Satellit und erschließt über den Zugang <strong>in</strong><br />
lokale Telefonnetze auch <strong>in</strong>frastrukturarme Regionen.<br />
Während jedoch heute noch relativ großvolumige<br />
Endgeräte erforderlich s<strong>in</strong>d, geht der Trend h<strong>in</strong> zu<br />
kle<strong>in</strong>en, den GSM-Endgeräten vergleichbaren<br />
Satellitentelefonen.<br />
— Als neueste Dienstleistung ist der »Datenfunk für jedermann«<br />
verfügbar. Angeboten wird die »mobile«<br />
Datenübertragung von den beiden D-Netz-Betreibern<br />
und (für e<strong>in</strong>e breite wirtschaftliche und private<br />
Nutzung) seit 1993 als öffentlicher Dienst MODACOM.<br />
E<strong>in</strong>satzgebiete s<strong>in</strong>d z.B. die Fernüberwachung oder<br />
Fernsteuerung von Anlagen (»Telemetrie«), Anwendungen<br />
im Außendienst (Stichwort »mobile office« mit<br />
Funkzugriff auf Dokumente und zentrale Datenbanken)<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
und die Steuerung von Fahrzeugflotten bei Feuerwehr<br />
und Rettungsorganisationen.<br />
— Innerhalb von (gesellschaftlich oder privatrechtlich verbundenen)<br />
Kommunikationsgeme<strong>in</strong>schaften ist ebenfalls<br />
seit 1993 die Übertragung von Daten und Sprache<br />
<strong>in</strong> Corporate Networks zulässig. Das damit entstehende<br />
neue Marktsegment »Managen privater Netze« wird als<br />
die Dienstleistung der 90er Jahre bezeichnet.<br />
E<strong>in</strong> Corporate Network ist den Anforderungen e<strong>in</strong>er<br />
def<strong>in</strong>ierten Anwendergruppe optimal angepaßt und stellt<br />
Kommunikationsfunktionen be reit, die über das Angebot<br />
öffentlicher Standardnetze und -dienste h<strong>in</strong>ausgehen.<br />
Eigen betriebene Corporate Networks bieten durch die<br />
Integration von Sprache und Daten auf e<strong>in</strong>er Leitung e<strong>in</strong><br />
erhebliches E<strong>in</strong>sparungspotential. Doch auch für den<br />
re<strong>in</strong>en Telefonverkehr e rgeben sich Chancen zur Kostensenkung,<br />
wenn durch den E<strong>in</strong>satz von Sprachkomprimierern<br />
die Kapazität von vorhandenen Leitungen erhöht<br />
werden kann.<br />
Neben Kostensenkungen ist die Vernetzung von<br />
ISDN-TK-Anlagen <strong>in</strong> Corporate Networks auch unter dem<br />
Schlagwort »Bürgerservice« für <strong>Stadt</strong>- und Landesverwaltungen<br />
<strong>in</strong>teressant. Ziel ist es z. B., e<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>heitlichen<br />
Nummernplan für alle Dienststellen zu schaffen. Die Erleichterung<br />
für die Bürger besteht dar<strong>in</strong>, daß zeitraubende<br />
und nervtötende Versuche, den gewünschten Teilnehmer<br />
zu erreichen, entfallen (z. B. den für die Steuererklärung<br />
zuständigen F<strong>in</strong>anzbeamten). Jeder Anruf unter e<strong>in</strong>er<br />
(dann jedem bekannten) »<strong>Stadt</strong>«-Nummer wird per Vermittlung<br />
durch die Telefonzentrale oder über direkte<br />
Durchwahl und automatische Anrufverteilung im Netz an<br />
die entsprechende Stelle weitergeleitet. E<strong>in</strong>schränkend<br />
gilt allerd<strong>in</strong>gs, daß solche Lösungen derzeit nur s<strong>in</strong>nvoll<br />
funktionieren, wenn TK-Anlagen e<strong>in</strong>er Produktfamilie<br />
e<strong>in</strong>es Herstellers vernetzt werden (aufgrund fehlender<br />
Standardisierung).<br />
E<strong>in</strong> wichtiges E<strong>in</strong>satzbeispiel der Mobilkommunikation<br />
ist die Anb<strong>in</strong>dung »mobiler« Mitarbeiter (z.B. Außendienst)<br />
an zentrale Datenbanken oder Electronic-Mail-Systeme.<br />
E<strong>in</strong>setzbar hierfür s<strong>in</strong>d u. a. alle handelsüblichen Notebooks<br />
— mit e<strong>in</strong>gebautem MODACOM-Modem oder<br />
erweitert um entsprechende PC-Karten »mit Antenne«<br />
(z. B. PCMCIA-GSM-Adapter oder externes Modem; Preis<br />
z. Zt. etwa 3—5000 DM). Da beispielsweise MODACOM<br />
wie e<strong>in</strong>e »Funkbeule« am DATEX-P-Netz funktioniert, ist<br />
problemlos die Datenübertragung <strong>in</strong> beiden Richtungen<br />
möglich (bei der zu erwartenden Flächendeckung der<br />
Datenfunkdienste sogar — falls gewünscht — auch aus<br />
jedem Wirtshaus).<br />
Speziell für Länder und Geme<strong>in</strong>den gew<strong>in</strong>nt die Bereitstellung<br />
von TK-Infrastrukturen »aus e<strong>in</strong>er Hand« an Bedeutung.<br />
E<strong>in</strong>satzfälle reichen von neuen Konzepten des<br />
»<strong>in</strong>telligent build<strong>in</strong>g«, bei denen die TK-Verkabelung als<br />
<strong>in</strong>tegraler Bestandteil des Gebäudekonzepts ange boten<br />
wird, über die <strong>in</strong>formationstechnische Erschließung von<br />
<strong>Stadt</strong>teilen und Gewerbegebieten durch breitbandige<br />
Glasfasernetze bis h<strong>in</strong> zu Telekommunikationszentren, die<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
173
Videoconferenc<strong>in</strong>g, Kommunikation via Satellit oder<br />
Electronic-Mail- und Datenbankdienste als Servicebüros<br />
anbieten. Grundgedanke dieser <strong>in</strong>ternational auch als<br />
»Teleport« bezeichneten Projekte ist e<strong>in</strong>e ganzheitliche<br />
Konzeption, bei der Telekommunikation als gestaltendes<br />
Element im Rahmen kommunaler Infrastrukturmaßnahmen<br />
verstanden wird.<br />
2. Neue Mehrwertdienste durch neue Netze<br />
Von zentraler Bedeutung für die Telekommunikation ist<br />
neben der Deregulierung die rasante Weiterentwicklung<br />
und Standardisierung im Bereich der Übertragungs- und<br />
Vermittlungstechniken. Zur Zeit bef<strong>in</strong>den sich im Weitverkehrsbereich<br />
Glasfasernetze im Aufbau, über die Daten<br />
mit e<strong>in</strong>er Geschw<strong>in</strong>digkeit von bis zu 622 MBit/s übertragen<br />
werden. Aufgrund ihrer Zellstruktur (Stichwort<br />
ATM) können sowohl asynchrone DV-Daten als auch<br />
synchrone Sprach- und Videodaten über e<strong>in</strong>- und dasselbe<br />
Medium transportiert werden.<br />
Was für Weitverkehrsnetze bereits Realität ist, wird für<br />
den Anschlußbereich der Teilnehmervermittlungsstellen<br />
(Ortsbereich) derzeit nachgezogen. Beg<strong>in</strong>nend <strong>in</strong> den<br />
neuen Bundesländern bef<strong>in</strong>den sich optische Anschlußnetze<br />
(OPAL) im Aufbau, die <strong>in</strong> Zukunft Träger von Multimedia-Diensten<br />
se<strong>in</strong> können (<strong>in</strong>dem z.B. Videoverteildienste<br />
— Stichwort »Video On Demand« — kurz vor dem<br />
Sitz des Endabnehmers <strong>in</strong> den Kabelnetz-Anschluß e<strong>in</strong>gespeist<br />
werden).<br />
Multimediale Orientierungs-, Auskunfts- und Informationssysteme<br />
für Grafik, Video und Audio zur Routenbestimmung<br />
und Zimmervermittlung <strong>in</strong> Städten oder als<br />
mehrsprachige Systeme für Touristen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> diesem<br />
Zusammenhang aktuelle Anwendungen. In Ostbayern<br />
werden der zeit als Pilotprojekt an Autobahnraststätten<br />
spezielle Info-Gebäude errichtet; auch die »Infoboys« <strong>in</strong><br />
Bayerisch Zell und Viechtach (mit bis zu 15 000 Anfragen<br />
und 1 000 Ausdrucken pro Monat) zählen hierzu.<br />
Nach e<strong>in</strong>er aktuellen Marktstudie kommt bereits heute<br />
<strong>in</strong>teressanterweise der größte Teil der Auftraggeber von<br />
Multimedia-Produkten neben Banken/Versicherungen aus<br />
M<strong>in</strong>isterien und Behörden sowie aus dem Fremdenverkehr.<br />
Als Ursache wird gerade auch von Städten und<br />
Geme<strong>in</strong>den der hohe Bedarf an entsprechend gestalteten<br />
und <strong>in</strong>teraktiven Diensten genannt.<br />
Nicht zuletzt durch die Mobilkommunikation s<strong>in</strong>d<br />
Sprachmehrwertdienste zu e<strong>in</strong>em echten Wachstumsmarkt<br />
geworden. Darunter fallen alle Anwendungen für<br />
die Bereitstellung von Informationen über das Telefonoperator<br />
geführt (z. B. für die Bearbeitung von Anfragen<br />
und Aufträgen) oder mittels <strong>in</strong>teraktivem Zugriff auf<br />
Datenbanken (z. B. Auskunftssysteme mit Sprach-/Tonerkennung<br />
und automatischer Sprachausgabe).<br />
In Verb<strong>in</strong>dung mit ACD-Lösungen (Automatic Call<br />
Distribution) und standardisierter CSTA-Schnittstelle<br />
(Computer Supported Telephony A pplication) können<br />
solche Lösungen flächendeckend realisiert werden. CSTA<br />
unterstützt dabei die direkte Kommunikation zwischen der<br />
Verb<strong>in</strong>dungssteuerung e<strong>in</strong>er TK-Anlage und angeschlossenen<br />
DV-Systemen. Dies ermöglicht z. B. e<strong>in</strong>em Mitarbeiter<br />
<strong>in</strong> der Telefonzentrale, bei Anruf von außen die unter dieser<br />
Nummer <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Datenbank abgelegten Informationen<br />
via Rufnummernerkennung automatisch an se<strong>in</strong>en Bildschirm<br />
zu holen.<br />
In den Kommunen und Städten gibt es bereits e<strong>in</strong>e<br />
Vielzahl von Beispielen (z. B. <strong>Stadt</strong> Hamburg), wo sprachorientierten<br />
Service-Leistungen der Öffentlichkeit angeboten<br />
werden (auch als »Call Center« bekannt). Dies<br />
umfaßt beispielsweise Verkehrs<strong>in</strong>formationen, die z. T.<br />
auch über Mobilfunk im Auto empfangen werden können,<br />
kommunale Informationen über Öffnungszeiten und aktuelle<br />
Veranstaltungen (wobei der Anrufer über e<strong>in</strong> sprachgeführtes<br />
»Menü« <strong>in</strong>teraktiv zwischen verschiedenen<br />
Auskünften wählen kann) oder Werbe<strong>in</strong>formationen (mit<br />
Bestellservice) ortsansäßiger Unternehmen.<br />
Treibende Kraft für diese Informationsdienste ist auch<br />
der Ausbau der öffentlichen Telefonnetze zu »<strong>in</strong>telligent<br />
networks«, die durch e<strong>in</strong>e konsequente Trennung von<br />
Vermittlungs- und Verarbeitungsfunktionen die schnelle<br />
Konfigurierung neuer Dienste unterstützen. Die neue<br />
Netzarchitektur erlaubt u. a. e<strong>in</strong>e dienstespezifische<br />
Gebührenabrechnung (»itemized bill<strong>in</strong>g«) und bietet damit<br />
privaten Informationsanbietern die Möglichkeit, für<br />
höherwertige Dienste (z. B. Hotelreservierung oder Teleshopp<strong>in</strong>g)<br />
entsprechende Entgelte zu erheben.<br />
3. Neue Lösungen für die Bürokommunikation<br />
»Workgroup Comput<strong>in</strong>g« — die Bereitstellung von<br />
Werkzeugen für die Zusammenarbeit flexibler Arbeitsgruppen<br />
— und »Workflow Management « — die Automatisierung<br />
von standardisierbaren Arbeitsabläufen —<br />
s<strong>in</strong>d die Trends der wiederbelebten Bürokommunikationsdiskussion.<br />
Aber letztlich beschreiben diese neuen Schlagworte<br />
nur das altbekannte Phänomen, daß Büro- bzw.<br />
Verwaltungsarbeit <strong>in</strong> hohem Maße arbeitsteilig ist und<br />
durch die Kooperation zwischen den unterschiedlichen<br />
Arbeitsplätzen gekennzeichnet ist. Neu ist, daß aufgrund<br />
der mittlerweile beachtlichen Durchdr<strong>in</strong>gung mit PC’s und<br />
lokalen Netzen (laut IDC verfügten 1992 rund 15 % aller<br />
Arbeitsstätten <strong>in</strong> der öffentlichen Verwaltung über e<strong>in</strong><br />
LAN) die technische Voraussetzung zur Realisierung e<strong>in</strong>heitlicher<br />
Kommunikationsplattformen für die Unterstützung<br />
vorgegebener Arbeitsabläufe gegeben ist.<br />
Die Basis für e<strong>in</strong>er moderne Bürokommunikation (und<br />
für alle anderen DV-unterstützten Abläufe bis h<strong>in</strong> zur<br />
Produktionssteuerung) bildet zunehmend lokale Intelligenz,<br />
die über entsprechende Netze (z. B. X.25, aber auch<br />
LAN-LAN-Kommunikation über ISDN) verbunden ist.<br />
Generell geht der Trend weg von zentralen Systemkonzepten<br />
zu Client-Server-Architekturen, die der Vor-Ort-<br />
Verarbeitung e<strong>in</strong> größeres G ewicht verleihen. Projektbeispiele<br />
speziell im Behördenumfeld zeigen, daß es allerd<strong>in</strong>gs<br />
verfehlt wäre, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er völligen Dezentralisierung der<br />
DV e<strong>in</strong> Allheilmittel zu sehen. E<strong>in</strong> vernünftiges Inter-<br />
174 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
network<strong>in</strong>g zwischen Zentralrechner und dezentralen<br />
Systemen <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Client-Server-Architektur liefert <strong>in</strong> aller<br />
Regel die besseren Ergebnisse.<br />
Die Anforderungen e<strong>in</strong>er modernen Verwaltung zielen<br />
sowohl auf die klassische Vorgangsbearbeitung mit e<strong>in</strong>em<br />
durchgängigen Dokumentenmanagement als auch auf<br />
neue technische Lösungen für die sich fallweise ergebenden<br />
Entscheidungs-, Projekt- und Teamaufgaben. E<strong>in</strong><br />
Anwendungsbeispiel aus e<strong>in</strong>er Landesbehörde ist die<br />
geme<strong>in</strong>same Erstellung und <strong>in</strong>teraktive Bearbeitung von<br />
umfangreichen Dokumentationen durch Mitarbeiter aus<br />
verschiedenen, räumlich getrennten Dienststellen. In dieses<br />
regelmäßige Berichtswesen s<strong>in</strong>d zudem spezialisierte<br />
E<strong>in</strong>heiten <strong>in</strong>volviert, die Zugriff auf ausgesuchte Datenbestände<br />
haben (z. B. Geo-Informationssysteme) oder<br />
über anspruchsvolle Werkzeuge (z. B. Bildverarbeitung für<br />
die Erstellung von Landkarten) verfügen.<br />
Technisch ist die Lösung realisiert durch den E<strong>in</strong>satz<br />
von »Lotus Notes« als Kommunikationsplattform, das die<br />
Verarbeitung und Verwal tung gemischter Text-/Grafik-<br />
Dokumente <strong>in</strong>nerhalb der Arbeitsgruppe, Freigabeprozeduren<br />
und Zugriffssicherung sowie den Abgleich von<br />
Datenbeständen über die Standorte h<strong>in</strong>weg unterstützt.<br />
Daneben ist »Softswitch Central« als Kommunikationsdrehscheibe<br />
zur e<strong>in</strong>heitlichen Verteilung von Schriftgut<br />
unterschiedlicher Formate (Designer, W<strong>in</strong>Word, Word<br />
Perfect, PCText4 und /370Text). Optimiert wird dadurch<br />
der transparente Dokumentenaustausch zwischen PC-,<br />
UNIX- bzw. hostbasierten Mail-Systemen und das<br />
Zusammenfügen von Teilergebnissen an e<strong>in</strong>er zentralen<br />
Stelle.<br />
E<strong>in</strong> weiteres Beispiel ist die im Rahmen des Landessystemkonzepts<br />
Baden-Württemberg geplante Vere<strong>in</strong>heitlichung<br />
und Zusammenlegung von bis dah<strong>in</strong> separaten<br />
Datennetzen zu e<strong>in</strong>em <strong>in</strong>tegrierten Telekommunikationsnetz.<br />
E<strong>in</strong> Schwerpunkt bildet die Realisierung e<strong>in</strong>es<br />
durchgängigen Dokumenten- und Schriftgutverwaltungssystems<br />
(DSV), das auf allen Bürokommunikationsplattformen<br />
der Landesverwaltung lauffähig ist.<br />
Das System soll dabei im wesentlichen die schrittweise<br />
Realisierung e<strong>in</strong>er elektronischen Vorgangsbearbeitung<br />
ermöglichen, <strong>in</strong> die bew ährte Abläufe und bewährte<br />
Fachanwendungen <strong>in</strong>tegriert werden können. Es werden<br />
Registraturaufgaben unterstützt, d. h. Bearbeiten von<br />
Poste<strong>in</strong>- und -ausgängen, Erfassen und Pflegen der<br />
Verwaltungsdaten, Übernahme und Pflege des landese<strong>in</strong>heitlichen<br />
Aktenplans (Aktennummern, Schlagworte).<br />
Weitere Funktionen s<strong>in</strong>d Mitzeichnung, Akten- und<br />
Statusverfolgung (e<strong>in</strong>schließlich Regelung der Zugriffsberechtigung)<br />
sowie die Wiedervorlageverwaltung.<br />
Die DSV-Lösung ist als portables und konfigurierbares,<br />
auf dem Datenbanksystem Oracle (DBMS unter<br />
SQL*Forms) aufsetzendes System gestaltet und bietet<br />
Dienste, mit deren Hilfe Verwaltungsdaten (Referenz<strong>in</strong>formationen)<br />
von Dokumenten, Vorgängen und Akten im<br />
DBMS abgelegt und bearbeitet werden können. Sie ist als<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Stand-Alone-Version, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Multitask<strong>in</strong>g-Umgebung<br />
auf e<strong>in</strong>em Zentralrechner und <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er verteilten Client-<br />
Server-Umgebung laufähig. Die Dokumente können dabei<br />
<strong>in</strong> Papierform oder als elektronisches Schriftgut vorliegen.<br />
Der Vorteil dieser Lösung ist, daß jede Bürokommunikations-Software<br />
mit jeder anderen auf jeder Hardware-<br />
Plattform zusammenarbeiten kann. Gleichzeitig wird e<strong>in</strong>e<br />
Basis für die später geplante elektronische Vorgangsbearbeitung<br />
geschaffen, ohne die vorhandene Vielzahl von<br />
Bürosystemen auf e<strong>in</strong>en Schlag ersetzen zu müssen.<br />
4. Erfahrungen bei der Umsetzung <strong>in</strong> die konkrete<br />
Projektarbeit<br />
Wie lassen sich aber nun die neuen technischen<br />
Möglichkeiten <strong>in</strong> der praktischen Projektarbeit nutzen?<br />
Wer formuliert den Bedarf, wer trägt die Budget- und<br />
Projektverantwortung, wie s<strong>in</strong>d die Nutzer zu beteiligen,<br />
wie ist der E<strong>in</strong>führungsprozeß zu gestalten? E<strong>in</strong>ige<br />
Gedanken hierzu sollen abschließend anhand der Erfahrungen<br />
aus e<strong>in</strong>em kürzlich abgeschlossenen Projekt <strong>in</strong><br />
e<strong>in</strong>er Behörde formuliert werden. Ziel war der Aufbau<br />
e<strong>in</strong>er langfristig tragfähigen HW- und SW-Infrastruktur<br />
für den dienstweit e<strong>in</strong>heitlichen Dokumentenaustausch.<br />
Konkrete Vorstellungen über Umfang und Laufzeit des<br />
gesamten Vorhabens waren nicht vorhanden, gleichzeitig<br />
lag schon seit Monaten e<strong>in</strong>e Fülle von Anforderungen aus<br />
den Fachreferaten auf dem Tisch. Die Konsequenz war,<br />
daß letztlich doch — obwohl ursprünglich »nur« e<strong>in</strong>e<br />
»quick and dirty« - Lösung zur Vere<strong>in</strong>heitlichung der SW-<br />
Ausstattung an den Büroarbeitsplätzen geplant war — die<br />
»klassischen« Phasen Zieldef<strong>in</strong>ition, Anforderungsanalyse,<br />
Konzeption und Realisierungsplanung z. T. nachträglich<br />
durchlaufen werden mußten, um zu e<strong>in</strong>em tragfähigen<br />
Ergebnis zu kommen:<br />
Zieldef<strong>in</strong>ition:<br />
»Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen«. Dieser Satz gilt<br />
stärker noch als sonst für die Vorbereitung von abteilungs-<br />
oder behördenübergreifenden Vorhaben, z. B. die<br />
Entscheidung, ob e<strong>in</strong> eigenes »Corporate Network« aufgebaut<br />
werden soll oder wie umfassend e<strong>in</strong> Konzept für<br />
Dokumentenmanagement bestehende Abläufe verändern<br />
soll. Da hierfür ke<strong>in</strong>e klaren Vorgaben existierten, prallten<br />
während des laufenden Projekts plötzlich völlig konträre<br />
Vorstellungen der unterschiedlichen Fachabteilungen aufe<strong>in</strong>ander.<br />
Dies reichte von Rationalisierungsforderungen<br />
durch Neugestaltung der Verwaltungsabläufe bis h<strong>in</strong> zu<br />
Forderungen nach Multi-Media-PC’s für Servicestellen.<br />
Die Schlußfolgerung hieraus ist, daß die Auftragserteilung<br />
von e<strong>in</strong>er Stelle erfolgen muß, die auch die<br />
Kompetenz hat, die Realisierung durchzusetzen. Alle<br />
relevanten Organisationse<strong>in</strong>heiten s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> die Projektorganisation<br />
e<strong>in</strong>zubeziehen oder zum<strong>in</strong>destregelmäßig zu<br />
<strong>in</strong>formieren. Zu Beg<strong>in</strong>n des Projekts muß e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same<br />
»Sprache« geschaffen und e<strong>in</strong>e geme<strong>in</strong>same<br />
Zielvorstellung erarbeitet werden.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
175
Anforderungsanalyse:<br />
Die Praxis ist, daß Redesign-Entscheidungen für die<br />
vorhandenen Netze anstehen — oft ausgelöst durch die<br />
aktuelle Kosten-/Nutzendiskussion über Corporate Networks<br />
- ohne daß systematische Analysen zur Identifizierung<br />
von Bedarfspotentialen abgeschlossen s<strong>in</strong>d (oder<br />
überhaupt nicht begonnen wurden). Aber was nützt es,<br />
wenn nach erfolgtem Technike<strong>in</strong>satz <strong>in</strong> vielen Verwaltungsstellen<br />
vielleicht 10% aller Akten und Dokumente<br />
elektronisch erzeugt, bearbeitet und kommuniziert werden,<br />
die restlichen 90 % aber weiterh<strong>in</strong> lange Durchlaufzeiten<br />
über haus<strong>in</strong>terne Verteilsysteme — meist noch mit<br />
Boten — oder mühsames Suchen nach Informationen <strong>in</strong><br />
verstaubten Kellerarchiven verursachen.<br />
Die Konsequenz ist, trotz der verständlichen Neigung,<br />
den Aufwand für die Analyse möglichst ger<strong>in</strong>g zu halten<br />
- mit dem Argument: »Brauchen Sie diese Informationen<br />
wirklich«? oder »Das wissen wir doch schon längst«, bewährte<br />
und wenig aufwendige Verfahren zur »Informationsbeschaffung«<br />
(Kommunikationsanalysen, Verkehrsmessungen<br />
im Netz, etc.) wenigstens an ausgewählten<br />
typischen Arbeitsplätzen b zw. Systemen oder durch Be<br />
fragung von »Experten« e<strong>in</strong>zusetzen und die Auswertung<br />
dieser Informationen auf das »Wesentliche« beschränken.<br />
Konzeption:<br />
Die Diskussion um E<strong>in</strong>satzmöglichkeiten neuer technischer<br />
Lösungen wird verkürzt geführt, wenn bei der<br />
Planung ausschließlich die Vor- oder Nachteile e<strong>in</strong>zelner<br />
Software-Features im Vordergrund stehen. Die e<strong>in</strong>zusetzenden<br />
Systeme stellen primär e<strong>in</strong>e »passive« Infrastruktur<br />
bereit, auf der die Benutzer im Rahmen der entsprechenden<br />
Geschäftsprozesse aktiv alle Aktionen selbst bestimmen<br />
und durchführen.<br />
Als Folge s<strong>in</strong>d technische und organisatorische Aspekte<br />
im Zusammenhang mit der geplanten technischen Lösung<br />
gleichrangig zu betracht en. In unserem Beispiel sollten<br />
Fragen zur Neugestaltung von Arbeitsabläufen zunächst<br />
ausgeklammert bleiben. Nur die Erkenntnis währ end des<br />
Projekts, daß die Realisierung der Nutzenpotentiale neuer<br />
Technik auch aktive gestalterische Leistungen der Mitarbeiter<br />
erfordert und daß anders e<strong>in</strong> Wirtschaftlichkeitsnachweis<br />
nur schwer möglich ist, führte zu e<strong>in</strong>er wenigstens<br />
nachträglichen Erarbeitung e <strong>in</strong>es organisatorischen<br />
Maßnahmenkatalogs.<br />
Realisierungsplanung:<br />
Obwohl <strong>in</strong> der Realisierungsphase natürlich die Implementierung<br />
der Technik im Mittelpunkt steht, darf nicht<br />
vergessen werden, daß der »Erfolg« der Technik von der<br />
richtigen Wahl der E<strong>in</strong>stiegsanwendungen und E<strong>in</strong>stiegsfelder<br />
abhängt. Problematisch <strong>in</strong> dem hier erwähnten<br />
Projekt war, daß e<strong>in</strong>e Auswahl des Herstellers bereits<br />
vorab beschlossen war, also ke<strong>in</strong>e echte Auswahl zwischen<br />
alternativen Produktangeboten erfolgen konnte.<br />
Zudem fehlte e<strong>in</strong>e übergeordnete Planungs- und<br />
Steuerungs<strong>in</strong>stanz für die zur Umsetzung des Konzepts<br />
erforderlichen Teilprojekte. Konsequenterweise stellt<br />
neben der Identifizierung geeigneter Verwaltungsabläufe<br />
für Pilot<strong>in</strong>stallationen und dem damit verbundenen<br />
Nutzennachweis vor allem die Festlegung der dienstweit<br />
gültigen Standards für die Gestaltung der unterlegten<br />
Netz<strong>in</strong>frastruktur (und nicht zuerst die SW-Auswahl)<br />
e<strong>in</strong>en zentralen Planungsschritt dar.<br />
Die Erfahrung zeigt, daß unternehmensspezifische<br />
Rahmenbed<strong>in</strong>gungen, mangelnde Kenntnis der Ist-<br />
Situation, unklare Kompetenzverteilung, Budget- und<br />
Kapazitätsprobleme oder unvorhergesehener Widerstand<br />
von Mitarbeitern ohne die dargestellte Orientierung an<br />
e<strong>in</strong>er grundsätzlichen Vorgehensweise e<strong>in</strong> allgeme<strong>in</strong><br />
akzeptiertes und durchsetzbares Projektergebnis gefährden<br />
können. Die unbestrittenen Kosten- und Nutzeneffekte<br />
neuer technischer Lösungen, die auch <strong>in</strong> der<br />
öffentlichen Verwaltung die Investitionsentscheidungen<br />
bestimmen, s<strong>in</strong>d so kaum optimal zu erzielen.<br />
Interessierte Arbeitskreisteilnehmer<br />
<strong>in</strong> der Diskussion<br />
176 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Jörg Maier<br />
Telekommunikation im ländlichen<br />
Raum — Möglichkeiten und<br />
Grenzen der Errichtung von<br />
Telestuben<br />
1. Begriffsbestimmung und Grundlagen der<br />
technischen <strong>Entwicklung</strong><br />
Gegenstand der Telematik (synonym wird auch der<br />
Begriff der Informations- und Kommunikationstechniken<br />
bzw. -technologien, kurz IuK-Techniken, verwendet) ist die<br />
Technik der Übertragung von Sprache, Text, Bildern<br />
und/oder Daten über größere Distanzen mittels Leitungsoder<br />
Funknetzen. Die Informationstechnik bewerkstelligt<br />
dabei e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>seitige Übertragung, während die Kommunikationstechnik<br />
der zwei- oder mehrseitigen Sprach-, Text-,<br />
Bild, und/oder Datenübertragung <strong>dient</strong>. Obwohl die Grenzen<br />
zwischen Informations- und Kommunikationstechniken<br />
fließend se<strong>in</strong> können, soll an dieser Stelle das Abgrenzungskriterium<br />
der primären Funktion (Information<br />
oder Kommunikation) genügen.<br />
Zum Bereich der <strong>in</strong>formationsorientierten Telematikelemente<br />
zählen demzufolge <strong>in</strong>sbesondere der Rundfunk<br />
und das Fernsehen. In Verb<strong>in</strong>dung mit der Fernsehübertragung<br />
kann auch der Videotext bzw. der Videodat-<br />
Empfang genannt werden, die jeweils mit speziellen<br />
Dekodern empfangen werden können. Durch die genannten<br />
Dienste ist also der Empfang sowohl von Sprache,<br />
bewegten und stillen Bildern sowie Text und Daten<br />
möglich. Kennzeichnend für die Informationsdienste ist,<br />
daß hier e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>seitige Sender-Empfänger-Relation aufgebaut<br />
wird, die nur <strong>in</strong>direkt etwa über E<strong>in</strong>schaltquoten<br />
oder Zuschauer/Zuhörerreaktion <strong>in</strong> ihrem Inhalt bee<strong>in</strong>flußt<br />
werden kann. Entsprechend dieser Def<strong>in</strong>ition zählen<br />
auch die neueren Dienste Cityruf oder Eurosignal zu den<br />
Informationsdiensten, da hier ke<strong>in</strong>e direkte Kommunikation<br />
ermöglicht, sondern mehr oder weniger kurze<br />
Informationen übermittelt werden.<br />
Demgegenüber dienen die kommunikationsorientierten<br />
Elemente der Telematik <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie dem Dialog<br />
zwischen zwei oder auch mehreren Teilnehmern. Der<br />
älteste und auch am weitesten verbreitete Kommunikationsdienst<br />
ist das Telefon zur Übermittlung von Sprache.<br />
Als Folge der Weiterentwicklung der Übertragungstechnologie<br />
s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> den letzten zwanzig Jahren immer mehr<br />
Dienste h<strong>in</strong>zugekommen. Zu nennen s<strong>in</strong>d hier etwa das<br />
ebenfalls bereits ältere Telex (zur Übertragung von<br />
Texten), das Telefax (zur Übertragung von Texten oder<br />
stehenden Bildern), die Daten(fern)übertragung (zur Übertragung<br />
von b<strong>in</strong>ären Daten und zur Computerkommunikation),<br />
Mobilfunk (zum ortsunabhängigen telefonieren)<br />
sowie die Möglichkeit zum Bildfernsprechen und zu<br />
Videokonferenzen.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Wesentlicher Bestimmungsfaktor der technischen<br />
<strong>Entwicklung</strong> der Telematik s<strong>in</strong>d allerd<strong>in</strong>gs die Übertragungsmedien.<br />
Zu unterscheiden ist dabei zunächst<br />
zwischen den leitungsgebundenen und den leitungsungebundenen<br />
(oder Funk-) Netzen.<br />
Bei den leitungsgebundenen Netzen spielt die mögliche<br />
Übertragungsgeschw<strong>in</strong>digkeit e<strong>in</strong>e wichtige Rolle. Zur Zeit<br />
bef<strong>in</strong>den sich zwei Typen von Netzen im Bereich der<br />
Bundesrepublik Deutschland <strong>in</strong> Betrieb: Schmalbandnetze<br />
mit e<strong>in</strong>er möglichen Übertragungsgeschw<strong>in</strong>digkeit von bis<br />
zu 64 kbit/s und Schmalbandnetze mit e<strong>in</strong>er möglichen<br />
Übertragungsgeschw<strong>in</strong>digkeit von 64 bis 144 kbit/s. Zu<br />
dem Typ der langsamen Schmalbandnetze zählen bislang<br />
das herkömmliche Fernsprechnetz, das Telexnetz und die<br />
Datexnetze. Das schnellere Schmalbandnetz <strong>dient</strong> dem<br />
digital <strong>in</strong>tegrierten Netz auf der Basis der o. g. Netze<br />
(ISDN). Das ISDN (Integrated Services Digital Network)<br />
ist e<strong>in</strong> Universalnetz für die digitale Übertragung von<br />
Sprache, Text, Bildern und Daten. In ihm werden alle bisher<br />
zur Verfügung stehenden Dienste <strong>in</strong>tegriert, so daß<br />
e<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>fachere, schnellere und wirtschaftlichere Übertragung<br />
sichergestellt werden kann. Zukünftig sollen alle<br />
Funktionen auf digitaler Basis über das Breitbandnetz<br />
gehen, das über Glasfaserverb<strong>in</strong>dungen e<strong>in</strong>e Vielzahl an<br />
Informationen und Übertragungsgeschw<strong>in</strong>digkeit zuläßt.<br />
So ist erst hier e<strong>in</strong>e s<strong>in</strong>nvolle Nutzung im Austausch von<br />
Massendaten und das Bildfernsprechen möglich.<br />
Zusätzlich zu den leitungsgebundenen Kommunikationstechniken<br />
hat sich <strong>in</strong> den letzten fünfzehn Jahren<br />
auch die Funkübertragung stetig weiter entwickelt. Neben<br />
verschiedenen Mobilfunknetzen der Telekom (C-Netz,<br />
D1-Netz, Chekker und Modacom) haben auch private<br />
Anbieter Funktelefonnetze aufgebaut (D2-Netz und<br />
künftig E-Netz). H<strong>in</strong>zu kommt noch das Satelliten-Funknetz<br />
Inmarsat. Diese Übertragungsmedien dienen etwa<br />
zur Nutzung von Auto- oder mobilen Handtelefonen,<br />
sowie der Übertragung von Daten im Rahmen der mobilen<br />
Datenkommunikation oder der Signalübermittlung für<br />
Cityruf oder Eurosignal. E<strong>in</strong>e weitere Nutzung der Funkund<br />
Satellitentechnologie liegt im Seetelefondienst und<br />
dem Mobilfunk.<br />
E<strong>in</strong> Sonderfall der leitungsgebundenen Netze s<strong>in</strong>d die<br />
Netzwerkdienste der Telekom. Diese Kommunikationsnetze<br />
(Corporate Networks) s<strong>in</strong>d Festverb<strong>in</strong>dungen für geschlossene<br />
Benutzergruppen, die speziell für e<strong>in</strong>zelne Kunden<br />
verlegt oder geschaltet werden. Es kann sich dabei sowohl<br />
um physikalisch unabhängige Netzwerke als auch um die<br />
Schaltung vorhandene Netze und die Nutzung spezieller<br />
Dienstleistungen im Rahmen etwa des Datex-J-(Btx -)<br />
Angebotes handeln.<br />
2. Räumliche Diffusion der Telematik<br />
Das Telefon ist bis heute die wichtigste und am weitesten<br />
verbreitete Telekommunikationstechnologie. Darüber<br />
h<strong>in</strong>aus bildet das Telefonnetz den Ausgangspunkt für die<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
177
E<strong>in</strong>führung e<strong>in</strong>er Reihe an derer Dienste. Die Analyse der<br />
räumlichen Muster der Ausbreitung des Telefons und<br />
dessen siedlungsstrukturelle Folgewirkungen gibt auch<br />
H<strong>in</strong>weise auf die regionale Differenzierung der neuen<br />
Kommunikationsstrukturen. Das Telefon war zunächst auf<br />
den geschäftlichen Bereich konzentriert und wurde erst<br />
nach und nach im privaten Bereich genutzt. Da das Telefon<br />
zu Anfang teuer war, war es lange Zeit e<strong>in</strong>e ausgesprochene<br />
Mittelstandstechnologie. Insofern hat das ökonomische<br />
Interesse der Telefongesellschaften e<strong>in</strong>er räumlichen<br />
Konzentration Vorschub geleistet, weil das Netz<br />
nutzerabhängig aufgebaut wurde. Die Vollversorgung ist<br />
allerd<strong>in</strong>gs im Anschluß an diese <strong>Entwicklung</strong> nur unter<br />
staatlicher E<strong>in</strong>flußnahme möglich gewesen. Großräumig<br />
erfolgte die Ausbreitung demzufolge ausgehend von den<br />
Verdichtungsräumen mit sehr deutlicher Verzögerung des<br />
Ausbaus im ländlichen Raum. Inzwischen kann das Netz<br />
der Telefonanschlüsse, zum<strong>in</strong>dest auf dem Gebiet der<br />
alten Bundesländer als flächendeckend angesehen werden.<br />
Die Erschließung <strong>in</strong> den fünf neuen Bundesländern<br />
benötigt voraussichtlich noch e<strong>in</strong>ige Zeit bis auch hier<br />
e<strong>in</strong>e flächendeckende Anb<strong>in</strong>dung gegeben ist. Dafür<br />
kommen hier von Anfang an die neuesten Techniken der<br />
Leitungstechnologie zum tragen.<br />
Als Beispiel für die großräumige Verteilung neuerer<br />
Telematik-Dienste können exemplarisch die Teletex- (e<strong>in</strong>geführt<br />
1981) und Telefax-Dienste (e<strong>in</strong>geführt 1979) dargestellt<br />
werden. Für die räumliche Analyse dieser Dienste<br />
wurden die amtlichen Teilnehmer- und Anschlußverzeichnisse<br />
der deutschen Bundespost des Jahres 1984 untersucht.<br />
Dabei wurden für den Teletex-Dienst 4 487 Teilnehmer<br />
mit 5 181 Anschlüssen und für den Telefax-Dienst<br />
12 627 Teilnehmer und 15 005 Anschlüsse erfaßt. Von<br />
den 5 589 Geme<strong>in</strong>den bzw. der Verbandsgeme<strong>in</strong>den <strong>in</strong> der<br />
alten Bundesrepublik wiesen zu diesem Zeitpunkt nur<br />
1 117 (20 %) m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>en Teletex-Teilnehmer und<br />
1 696 (30,3 %) m<strong>in</strong>destens e<strong>in</strong>en Telefax-Teilnehmer auf.<br />
Als Ergebnis der Untersuchung kann festgehalten werden,<br />
daß Teletex vor allem die Verdichtungsräume hohe<br />
Teilnehmerquoten auf. Allerd<strong>in</strong>gs zeigt sich <strong>in</strong>nerhalb der<br />
Verdichtungsräume e<strong>in</strong> großer Unterschied zwischen<br />
Gebieten mit guter Struktur und alt<strong>in</strong>dustrialisierten<br />
Gebieten mit deutlich ger<strong>in</strong>gerer Teilnehmerquote. Bei der<br />
Betrachtung auf Landkreisebene zeigt sich auch <strong>in</strong> der<br />
zeitlichen Betrachtung zwischen 1981 und 1986 (Karte 1<br />
bis 3), daß <strong>in</strong>nerhalb der Verdichtungsräume oft nur die<br />
Kernstadt und e<strong>in</strong>ige Landkreise <strong>in</strong> unmittelbarer Nachbarschaft<br />
hohe Quoten aufweisen. Innerhalb der ländlich<br />
geprägten Räume heben sich fast überall die Mittel- und<br />
Oberzentren als Träger hoher Teilnehmer- und Anschlußquoten<br />
heraus.<br />
Bei Telefax bestimmten 1984 noch die Verdichtungsräume<br />
mit Ausnahme der alt<strong>in</strong>dustrialisierten Regionen<br />
das Bild. Die höchsten Quoten wurden bei diesem<br />
Kommunikationsdienst durchwegs <strong>in</strong> den Verdichtungsregionen<br />
erzielt. Bei der Nutzung von Telefax zeichnete<br />
sich somit e<strong>in</strong> viel ausgeprägteres <strong>Stadt</strong>-Land-Gefälle ab.<br />
Wie auch beim Teletex-Dienst zeigte sich auf der Landkreisebene<br />
die hohe Teilnehmerdichte <strong>in</strong> den Zentren der<br />
Verdichtungsräume.<br />
Ausgehend von dieser ersten Analyse der Diffusion<br />
verschiedener Telematikdienste gibt die Betrachtung der<br />
weiteren <strong>Entwicklung</strong> der Nutzung von Telefax- und Btx-<br />
Diensten der Deutschen Telekom <strong>in</strong> den letzten zehn<br />
Jahren e<strong>in</strong>en guten Überblick sowohl über die re<strong>in</strong> quantitative<br />
Nutzung als auch über die räumliche Diffusion.<br />
3. Auswirkungsbereiche der Telematik<br />
3.1. Auswirkungen auf die Standortwahl<br />
Allgeme<strong>in</strong> nimmt die Standortb<strong>in</strong>dung durch den<br />
E<strong>in</strong>satz von Telekommunikationse<strong>in</strong>richtungen ab. Auf<br />
mittlere Sicht ist e<strong>in</strong>e deutliche Erhöhung des Verlagerungspotentials<br />
allerd<strong>in</strong>gs nicht zu erwarten. Bisherige<br />
Studien zeigen, daß nur bei ohneh<strong>in</strong> geplanten Verlagerungen<br />
und Neuansiedlungen die Anzahl der Freiheitsgrade<br />
<strong>in</strong> der Standortwahl zunimmt. E<strong>in</strong>e Untersuchung<br />
der E<strong>in</strong>wirkungen neuer Telekommunikationsdienste auf<br />
Standortentscheidungen ergibt <strong>in</strong>sbesonders für peripher<br />
gelegene Regionen ke<strong>in</strong> günstiges Bild. So wird festgestellt,<br />
daß <strong>in</strong>sbesonders der Informationsstand über das<br />
Angebot der Telekom sehr ger<strong>in</strong>g ist. Für Ostbayern kam<br />
e<strong>in</strong>e Studie des OTTI-Instituts Regensburg 1986 zu dem<br />
Ergebnis, daß Teletex und Telefax nur bei wenig mehr als<br />
zehn Prozent der befragten Produktionsunternehmen<br />
bekannt war. Obwohl sich dies <strong>in</strong>folge der verbesserten<br />
Informationspolitik und der Ausbreitung der neuen Techniken<br />
geändert haben dürfte, stellt sich immer noch die<br />
Frage, ob und <strong>in</strong>wieweit auch heute noch <strong>in</strong> den verschiedenen<br />
siedlungsstrukturellen Gebietstypen Informationsdefizite<br />
vorliegen. Nach unseren neuesten Untersuchungen<br />
für die Telekom hängt dies mitentscheidend von Entscheidungsträgern<br />
und Vertretern der Telekom vor Ort ab.<br />
3.2. Auswirkungen im Verkehrsbereich<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der Auswirkungen der Telematik-Dienste<br />
auf den Verkehr werden unterschiedliche Thesen vertreten.<br />
Die Substitutionsthese unterstellt, daß die physischen<br />
Bewegungen im Raum mit Hilfe verschiedener Verkehrsmittel<br />
durch Telekommunikationsdienste und Informationsübertragungen<br />
ersetzt werden können. In Anspielung<br />
auf den Energieverbrauch ist hier von e<strong>in</strong>er Substitution<br />
des »heißen« durch e<strong>in</strong>en »kalten« Verkehr die Rede. Als<br />
Ursache für solche Vorgänge werden allgeme<strong>in</strong> Energieund<br />
allgeme<strong>in</strong>e Kostenersparnisse vermutet. Inzwischen<br />
hat sich bei der Mehrzahl der Fachautoren allerd<strong>in</strong>gs die<br />
Erkenntnis durchgesetzt, daß der Substitution von Verkehr<br />
durch Telekommunikation enge Grenzen gesetzt s<strong>in</strong>d und<br />
zusätzliche neue Verkehrsbewegungen <strong>in</strong> Verb<strong>in</strong>dung mit<br />
der <strong>Entwicklung</strong> der Telematik entstehen werden.<br />
178 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
3.3. Auswirkungen auf die <strong>Stadt</strong>entwicklung und die<br />
Siedlungsstruktur<br />
In bezug auf die Siedlungsstruktur werden ke<strong>in</strong>e sensationellen<br />
Trendveränderungen erwartet. Eventuell könnte<br />
durch den E<strong>in</strong>satz und die Verbreitung der Telematik der<br />
Trend zur Dezentralisierung (Suburbanisierung) verstärkt<br />
werden, was zu e<strong>in</strong>er Entschärfung der Innenstadtprobleme<br />
— durch Rückgang des Zentral itätsdrucks aufgrund<br />
höherer Standortflexibilität — führen kann. Rationalisierungseffekte<br />
können zudem zu e<strong>in</strong>er Freisetzung<br />
von Büroarbeitsflächen mehrheitlich <strong>in</strong> Großstadtzentren<br />
und zu e<strong>in</strong>er Freisetzung von Industriearbeitsflächen<br />
mehrheitlich <strong>in</strong> agrar<strong>in</strong>dustriellen Gebieten führen. Durch<br />
die E<strong>in</strong>führung der Teleheimarbeit werden die Anforderungen<br />
an die Standortqualitäten von Büroarbeitsplätzen<br />
unspezifischer. Für F<strong>in</strong>anzzentralen sowie technologisch<br />
neu organisierte Fertigungsbetriebe h<strong>in</strong>gegen steigen die<br />
Anforderungen an die Ausstattungs- sowie die Umweltqualitäten.<br />
Innerhalb der Verdichtungsräume können Nutzungsverlagerungen<br />
stattf<strong>in</strong>den durch den Bedeutungsverlust<br />
der City als Standort für Büronutzung und entsprechende<br />
Bedeutungsgew<strong>in</strong>ne von Agglomerationsrandgebieten.<br />
Der ländliche Raum dürfte demgegenüber nur teilweise<br />
von solchen Verlagerungen profitieren.<br />
H<strong>in</strong>sichtlich der räumlichen Wirkungen lassen sich u. a.<br />
zwei verschiedene Thesen unterscheiden:<br />
— die Dekonzentrations- bzw.- Konzentrationsthese und<br />
— die Hierarchisierungs- und Polarisierungs- bzw.<br />
Nivellierungsthese.<br />
Die Vertreter der Dekonzentrationsthese gehen davon<br />
aus, daß die Telematik flächendeckend verfügbar s<strong>in</strong>d und<br />
damit die traditionellen Standortvorteile der Verdichtungsräume<br />
tendenziell abgebaut werden. Die Aufwertung<br />
der Standortvorteile des ländlichen Raumes sowie die<br />
Möglichkeit für die Menschen, ihre Standortpräferenzen<br />
zu realisieren, da enge B<strong>in</strong>dungen an den Arbeitsplatz<br />
entfallen, können dann zu e<strong>in</strong>er gleichmäßigeren Verteilung<br />
von Arbeitsstätten und Wohnungen im Raum und<br />
damit zu e<strong>in</strong>er räumlichen Dekonzentration führen.<br />
Die Vertreter der Konzentrationsthese gehen demgegenüber<br />
von der gegebenen räumlichen Struktur aus, die<br />
durch e<strong>in</strong> wirtschaftliches Gefälle von den Zentren zur<br />
Peripherie gekennzeichnet ist. Sie sehen zwar größtenteils<br />
die genannten potentiellen Wirkungen der Telematik auf<br />
die Standortfaktoren, nehmen aber an, daß die Zentren<br />
der Verdichtungsräume zuerst von den Vorteilen der<br />
neuen Technologie profitieren.<br />
Andere Studien weisen darauf h<strong>in</strong>, daß die <strong>Entwicklung</strong><br />
der Telematik unter Status-Quo-Bed<strong>in</strong>gungen eher zu<br />
e<strong>in</strong>er großräumigen Zentralisierung und Konzentration bei<br />
gleichzeitiger kle<strong>in</strong>räumiger Dekonzentration führen<br />
könnte. Dieser Prozeß geht e<strong>in</strong>her mit der Herausbildung<br />
e<strong>in</strong>er Hierarchie der bestehenden Zentren, wobei es zu<br />
e<strong>in</strong>er Polarisierung zwischen den sich relativ günstig ent-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
wickelnden <strong>Stadt</strong>regionen auf der e<strong>in</strong>en und Regionen mit<br />
relativ ungünstiger <strong>Entwicklung</strong> auf der anderen Seite<br />
kommen könnte. Demgegenüber geht die Nivellierungsthese<br />
davon aus, daß sich die entsprechenden Standortund<br />
<strong>Entwicklung</strong>svorteile der erstgenannten Zentren<br />
durch den E<strong>in</strong>satz von Telematik-Diensten abbauen lassen.<br />
Dazu ist zunächst festzuhalten, daß der E<strong>in</strong>satz neuer<br />
Informations- und Kommunikationstechniken nicht nur<br />
E<strong>in</strong>fluß auf Kommunikationsprozesse, Organisationsstrukturen<br />
und Arbeitsabläufe hat, sondern auch auf die<br />
Attraktivität von Standorten e<strong>in</strong>wirken kann. Wenn etwa<br />
die betriebsexterne, aber auch -<strong>in</strong>terne Kommunikation<br />
sich der neuen Technik be<strong>dient</strong>, so könnte die Bedeutung<br />
von Standortfaktoren und Wettbewerbsvorteilen, die bislang<br />
typisch für die Zentren waren (Agglomerations- und<br />
Fühlungsvorteile) wie<br />
— Möglichkeiten zu persönlichen Kontakten (face-toface-contacts)<br />
mit Gesprächspartnern aus verschiedensten<br />
Bereichen,<br />
— Kundennähe,<br />
— Nähe zu Behörden, Agenturen, Unternehmen,<br />
Datenbanken, wissenschaftliche Institutionen,<br />
Servicefirmen usw.<br />
relativiert werden. Da Kommunikation aufgrund der<br />
neuen Netze und Dienste zum<strong>in</strong>dest technisch bald von<br />
jedem Standort aus möglich ist (Dienste wie Btx, Teletex,<br />
Telefax und Datex, also schmalbandige Dienste, werden<br />
heute schon flächendeckend angeboten), könnten<br />
Unternehmen auch <strong>in</strong> die peripheren Räume verlagern<br />
oder zum<strong>in</strong>dest die Errichtung geeigneter Arbeitsplätze<br />
aus den Unternehmen an die Wohnstandorte von<br />
Mitarbeitern (»Tele-Heimarbeit«).<br />
Allerd<strong>in</strong>gs stellte Mens<strong>in</strong>g 1988 fest, daß e<strong>in</strong>erseits<br />
immer noch deutliche Präferenzen für Zentrumsstandorte<br />
bestehen, etwa aufgrund von Imagefaktoren (»gute<br />
Adresse«, Prestigestandort), der Kundennähe, dem City-<br />
Umfeld (Atmosphäre) und der Möglichkeit zu vielfältigen<br />
Kontakten, also e<strong>in</strong>e wesentliche E<strong>in</strong>schränkung des<br />
Dezentralisierungspotentials der Telekommunikation<br />
besteht. Andererseits, und dies wissen wir <strong>in</strong> Oberfranken<br />
besonders seit der Grenzöffnung, ist ke<strong>in</strong>e Verlagerung<br />
geplant, so wird die Telekommunikat ion wohl alle<strong>in</strong> auch<br />
ke<strong>in</strong>e auslösen. S<strong>in</strong>d aber aus wirtschaftlichen und/oder<br />
organisatorischen Gründen schon Gedanken an e<strong>in</strong>e event<br />
uelle Aus- oder Verlagerung gegeben, so könnte die neue<br />
Technik e<strong>in</strong>e entsprechende Entscheidung erleichtern und<br />
vorantreiben.<br />
4. Das Konzept der Telehäuser und<br />
Telestuben<br />
Überträgt man nun diese Fragestellung auf die konkrete<br />
Ausrichtung der Telehäuser und Telestuben, so kann<br />
bereits im Landesentwicklungsprogramm Bayern (LEP)<br />
von 1984 nachgelesen werden, daß es das Ziel ist<br />
»im Interesse e<strong>in</strong>er besseren Befriedigung des Infor-<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
179
mations- und Kommunikationsbedarfs auf den E<strong>in</strong>satz<br />
geeigneter neuer Kommunikationstechnologien, <strong>in</strong>sbesondere<br />
für die peripheren Gebiete Bayerns, h<strong>in</strong>gewirkt<br />
werden (soll)«. Als mögliches Instrument hierzu kann<br />
das Konzept der Telehäuser bzw. Telestuben zum E<strong>in</strong>satz<br />
kommen.<br />
E<strong>in</strong>e Vorreiterrolle bei der E<strong>in</strong>richtung von Telestuben,<br />
Telehäusern bzw. e<strong>in</strong>es »<strong>in</strong>formationstechnologischen<br />
Lokalzentrums« — so der hier verwendete Oberbegriff —<br />
spielen die skand<strong>in</strong>avischen Länder, wo bis 1988 bereits<br />
über 30 solcher Projekte gegründet worden s<strong>in</strong>d. Zwar ist<br />
die Größe und Ausstattung dieser Zentren unterschiedlich<br />
und stark von den örtlichen Gegebenheiten abhängig,<br />
e<strong>in</strong>ige Geme<strong>in</strong>samkeiten lassen sich je doch bei allen<br />
feststellen:<br />
— Sie s<strong>in</strong>d konzipiert als Maßnahme für kle<strong>in</strong>e, periphere<br />
Kommunen bzw. Dörfer,<br />
— sie beruhen auf der Anwendung moderner Kommunikations-<br />
und Informationstechniken,<br />
— sie wollen die Benutzung entsprechender Anlagen und<br />
Geräte e<strong>in</strong>er breiten Bevölkerung zugänglich machen,<br />
— sie erstreben e<strong>in</strong>e allgeme<strong>in</strong>e Hebung des Qualifikationsniveaus<br />
der Bevölkerung und des lokalen<br />
Wirtschaftslebens (die Anwendung von EDV und<br />
Kommunikationstechnik soll vermittelt werden),<br />
— sie sollen neue Arbeitsplätze schaffen, die entweder<br />
e<strong>in</strong>en ungedeckten lokalen Bedarf befriedigen oder<br />
aber auf Telearbeit beruhen;<br />
— sie werden gegründet und betrieben als »jo<strong>in</strong>t-venture«<br />
durch Zusammenarbeit von Geme<strong>in</strong>den und Privaten.<br />
Das Angebot <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Telestube richtet sich also zunächst<br />
an die Bevölkerung im Ort und an lokale Unternehmen.<br />
H<strong>in</strong>zu kommen aber <strong>in</strong> verstärktem Maße auch<br />
die Ausführung von Dienstleistungen für Auftraggeber <strong>in</strong><br />
entfernten Regionen und Zentren sowie die Kooperation<br />
und Hilfestellung der Telestuben untere<strong>in</strong>ander.<br />
Zum Aufbau und zur Funktionsweise e<strong>in</strong>es Tele-<br />
Servicecenters können gehören:<br />
1) Kommunalfunktionen, wie die Beratung und<br />
Vermittlung, die Information über Beratungsdienste<br />
und Planungen, die Vermittlung kommunaler<br />
Dienstleistungen, oder auch e<strong>in</strong>e Bibliothek, z. B. mit<br />
Videos oder Lernprogrammen auf Diskette.<br />
2) E<strong>in</strong>e Telekommunikationswerkstatt, zur Orientierung<br />
über IuK-Technik, zur Unterrichtung <strong>in</strong> der PC-Nutzung<br />
(»PC-Führersche<strong>in</strong>«), zur Vermittlung von PC-Anwendungsmöglichkeiten,<br />
mit Kursen für spezielle Zielgruppen<br />
und entsprechenden Aufbaukursen und evtl.<br />
e<strong>in</strong>er Videowerkstatt.<br />
3) Die Vermittlung von Dienstleistungstätigkeiten, wie<br />
z. B. Programmier-, Schreib- und Zeichenarbeiten,<br />
Buchhaltungsaufgaben für Unternehmen, Vere<strong>in</strong>e u. a.<br />
4) E<strong>in</strong> Kommunikationstreff (Foyer) mit Cafe/Kiosk,<br />
Informationstafeln und Filmvorführungen.<br />
5) Automatisierte private und öffentliche Dienstleistungen,<br />
mit öffentlichem Telefax und (Bild-) Telefon,<br />
mit SB-Bank mit Btx-Term<strong>in</strong>al, Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker<br />
u.a. .<br />
Der »Kommunikations-Treff« sollte hier e<strong>in</strong>e zentrale<br />
Lage haben und e<strong>in</strong>ladend wirken, da er als <strong>in</strong>tegrierendes<br />
Moment das Image des Tele-Servicecenters bestimmt und<br />
helfen soll, Schwellenängste abzubauen.<br />
5. Umsetzung des Telestubenkonzepts am<br />
Beispiel Weißenbrunn<br />
Ausgehend von der Idee der kommunalen Wirtschaftspolitik,<br />
durch Innovationen im technologischen Bereich<br />
e<strong>in</strong>e Stabilisierung des Arbeitsmarktes bzw. neue Impulse<br />
für die örtliche Wirtschaft zu schaffen, wurden <strong>in</strong> dieser<br />
H<strong>in</strong>sicht Überlegungen zur Errichtung e<strong>in</strong>er Telestube <strong>in</strong><br />
Weißenbrunn (Lkr. Kronach) geprüft.<br />
Ausgangspunkt hierfür war die Überlegung, daß der<br />
E<strong>in</strong>satz neuer IuK-Techniken nicht nur die Leistungsfähigkeit<br />
der regionalen Wirtschaft verbessern kann,<br />
sondern auch positive Auswirkungen auf die Attraktivität<br />
bzw. das Image e<strong>in</strong>es Standortes nehmen kann.<br />
Bevor konkrete Entscheidungen über die E<strong>in</strong>richtung<br />
und Ausstattung e<strong>in</strong>er Telestube getroffen werden können,<br />
muß zunächst der Bedarf möglichst genau ermittelt<br />
werden, um unnötige Investitionen zu vermeiden. Bei entsprechender<br />
Akzeptanz und steigender Nachfrage kann<br />
dann die Ausstattung mit Computern, Btx- oder Telefaxgeräten<br />
und weiteren Gegenständen erweitert werden.<br />
Da die VHS <strong>in</strong> den Räumen der Volksschule bereits Computer-Kurse<br />
anbietet, sollte das Angebot der Telestube<br />
auch <strong>in</strong> Zusammenarbeit mit der VHS aufgestellt werden.<br />
Bei der Nachfrage sollte unterschieden werden zwischen<br />
dem privaten und öffentlichen Interesse von seiten der<br />
Bevölkerung, der Geme<strong>in</strong>de aber auch möglicherweise<br />
Vere<strong>in</strong>en und dem ökonomischen Bedarf, also den Nutzungsmöglichkeiten,<br />
die sich für die Unternehmen<br />
ergeben.<br />
In Weißenbrunn bestehen im Bereich des Gewerbes,<br />
v. a. bei Kle<strong>in</strong>betrieben durchaus s<strong>in</strong>nvolle Anwendungsmöglichkeiten<br />
für den EDV-E<strong>in</strong>satz. Allerd<strong>in</strong>gs kommt<br />
i. d. R. bei diesen Betrieben der E<strong>in</strong>satz großer und dementsprechend<br />
kostenaufwendiger EDV-Anlagen, beispielsweise<br />
für Kosten- und Kalkulationsberechnungen, kaum <strong>in</strong><br />
Frage. Deshalb ist gerade diese Gruppe e<strong>in</strong> Potential für<br />
die Idee der Telestuben gegeben. Auch im Bereich der<br />
Mitarbeiterschulung zeigt sich e<strong>in</strong> nennenswertes Interesse.<br />
Da dieses E<strong>in</strong>satzfeld bisher von der VHS bzw. der<br />
IHK betreut wird, bietet sich e<strong>in</strong>e Kooperation, etwa <strong>in</strong><br />
Form der Durchführung entsprechender Kurse und Sem<strong>in</strong>are,<br />
an. Die Schaffung e<strong>in</strong>es Angebots vor Ort hätte für<br />
die kle<strong>in</strong>eren Betriebe da neben den Vorteil, direkt an den<br />
Geräten bzw. der Software ausgebildet zu werden, die<br />
ihnen danach im Arbeitsalltag auch tatsächlich zur<br />
Verfügung stehen.<br />
180 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Neben berufstätigen Weiterbildungswilligen ist auch<br />
bei den Jugendlichen e<strong>in</strong> hoher Anteil an Fortbildungswilligen<br />
vorhanden. Dieser Bedarf kann ebenfalls durch<br />
die Telestube <strong>in</strong> Kooperation mit bereits vorhandenen<br />
lokalen Jugend- bzw. Bildungse<strong>in</strong>richtungen abgedeckt<br />
werden.<br />
Die Möglichkeiten des EDV-E<strong>in</strong>satzes im Bereich der<br />
Landwirtschaft wird bislang kaum genutzt. Hier könnte<br />
e<strong>in</strong>e zentrale E<strong>in</strong>richtung mit Unterstützung des Landwirtschaftsamtes<br />
e<strong>in</strong>e weitere Nutzergruppe erschließen.<br />
Auch die privaten Haushalte stellen e<strong>in</strong>e potentielle<br />
Nachfragergruppe dar. Für Weißenbrunn denkbare<br />
Anwendungen wären dabei etwa Informationen über Busund<br />
Bahnverb<strong>in</strong>dungen, örtliche und regionale Veranstaltungsh<strong>in</strong>weise<br />
bis h<strong>in</strong> zu Dienstleistungen im Verwaltungsbereich<br />
(z. B. Ausdruck von Formularen für<br />
Steuererklärungen). Da zur Erledigung derartiger Dienstleistungen<br />
meist die Kreisstadt Kronach aufgesucht<br />
werden muß, würde die Telestube für viele Bürger sicherlich<br />
e<strong>in</strong>e Erleichterung darstellen, da nicht nur die Entfernung<br />
ger<strong>in</strong>ger wäre, sondern sie auch nicht an die<br />
Sprech- bzw. Öffnungszeiten der jeweiligen Ämter und<br />
Behörden gebunden wären.<br />
Daneben bestehen <strong>in</strong> Weißenbrunn zahlreiche Vere<strong>in</strong>e,<br />
die aufgrund der spezifisch anfallenden Arbeiten wie<br />
Erstellung von Ausschreibungen, von E<strong>in</strong>ladungen, Programmen,<br />
Satzungen, Wettkampfauswertungen sowie<br />
Mitgliederverwaltung u.ä. ebenfalls potentielle Nachfrager<br />
darstellen.<br />
Potentieller Bedarf besteht hiermit sowohl h<strong>in</strong>sichtlich des<br />
Dienstleistungsanbieters Geme<strong>in</strong>de als auch an e<strong>in</strong>em<br />
Ausbildungs-und Kommunikationszentrum. Was die<br />
Kommunikationsfunktion angeht, so ist hierbei <strong>in</strong>sbesondere<br />
auf die Möglichkeit der An- bzw. E<strong>in</strong>gliederung e<strong>in</strong>es<br />
Cafés o. ä. h<strong>in</strong>zuweisen, für das aufgrund des Fehlens<br />
e<strong>in</strong>er entsprechenden E<strong>in</strong>richtung im Ort e<strong>in</strong>e weitere<br />
<strong>Entwicklung</strong>schance zu sehen ist.<br />
6. Fazit — Telestuben als Instrument zur<br />
<strong>Entwicklung</strong> ländlicher Räume<br />
Abschließend kann gesagt werden, daß die Grenzen der<br />
E<strong>in</strong>satzfähigkeit von Telestuben im ländlichen Raum<br />
wesentlich von der tatsächlichen Nutzung durch die<br />
Nutzergruppen gesetzt werden. Wenn durch flankierende<br />
Maßnahmen im Werbungs- und Informationsbereich e<strong>in</strong>e<br />
ausreichende Nachfragemenge <strong>in</strong>duziert wird, e<strong>in</strong>e kompetente<br />
Betreuung der Hard- und Software sichergestellt<br />
und die Ausstattung der Telestube auf die tatsächlichen<br />
Bedürfnisse der Nutzergruppen abgestimmt s<strong>in</strong>d, ersche<strong>in</strong>t<br />
das Konzept im Rahmen weiterer Maßnahmen der<br />
Dorferneuerung tragfähig und s<strong>in</strong>nvoll. Da sowohl die<br />
Bedarfsanalyse als auch deren Umsetzung gerade im<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
ländlichen Raum mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden<br />
s<strong>in</strong>d, muß allerd<strong>in</strong>gs auch vor e<strong>in</strong>er allzu großen<br />
Euphorie gewarnt werden. Auch die Telestuben können<br />
alle<strong>in</strong>e ke<strong>in</strong> Allheilmittel für wirtschaftliche Probleme des<br />
ländlichen Raumes bilden.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
181
Arbeitskreis 7:<br />
Aus- und Fortbildung<br />
Helene Stegmann<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
Unser Arbeitskreis trägt die Überschrift »Aus- und<br />
Fortbildung«. Im konkreten Thema, mit dem wir uns heute<br />
befassen, bildet die Aus- und Fortbildung lediglich e<strong>in</strong>en<br />
Teilaspekt, e<strong>in</strong>en Bauste<strong>in</strong>. Unser Thema lautet »Personalentwicklung«.<br />
Warum steht »Personalentwicklung« heute<br />
zur Diskussion? In der Arbeit mit unseren Beteiligten<br />
haben wir längst erkannt, wie wichtig es ist, bei allem<br />
Geschehen <strong>in</strong> den Ortschaften und Fluren die Bürger aktiv<br />
zu beteiligen. Denn nur so kann die Identifikation mit dem<br />
Neuen, mit den Veränderungen die wir <strong>in</strong>itiieren, entstehen.<br />
Wie sieht es <strong>in</strong>tern <strong>in</strong> unserer Verwaltung aus?<br />
Wie stark können sich unsere Mitarbeiter mit ihrer<br />
Arbeit, mit ihrem Unternehmen identifizieren?<br />
Wieviel Aufmerksamkeit schenken wir unseren<br />
Mitarbeitern im Alltag?<br />
S<strong>in</strong>d sie entsprechend ihren Neigungen und<br />
Fähigkeiten e<strong>in</strong>gesetzt?<br />
Wie zufrieden s<strong>in</strong>d sie mit ihrer Arbeit?<br />
Was tun wir als Vorgesetzte, um die Ängste, die sich<br />
durch die Kienbaum-Untersuchung allerorts breitgemacht<br />
haben, zu bearbeiten?<br />
Diese Untersuchung wird Veränderungen <strong>in</strong> unserer<br />
Verwaltung auslösen. Herr Staatsm<strong>in</strong>ister Bocklet hat<br />
gestern von »lean adm<strong>in</strong>istration«, »schlanker Verwaltung«<br />
gesprochen. Das Personal steht somit besonders stark im<br />
Kreuzfeuer, da es <strong>in</strong> unserem Dienstleistungsunternehmen<br />
den höchsten Kostenfaktor darstellt. Aber die Menschen<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Unternehmen bergen auch das größte Potential<br />
<strong>in</strong> sich. Peter Zürn hat se<strong>in</strong>em Buch über Unternehmenskultur<br />
<strong>in</strong> Deutschland mit dem Titel »Vom Geist und Stil<br />
des Hauses« den Leitsatz vorangestellt: Das Wertvolle an<br />
e<strong>in</strong>em Unternehmen s<strong>in</strong>d nur die Menschen, die dafür<br />
arbeiten und der Geist, <strong>in</strong> dem sie dieses tun.<br />
Sie arbeiten fast alle für unsere Verwaltung oder s<strong>in</strong>d<br />
ihr zum<strong>in</strong>dest eng verbunden. Ich b<strong>in</strong> dankbar, daß <strong>in</strong><br />
diesem Kreis heute Gelegenheit zur Innenschau besteht,<br />
daß wir uns mit den Menschen im Unternehmen, — also<br />
uns selbst, — befassen. Dabei s<strong>in</strong>d uns Ihre Erfahrungen<br />
wichtig, Ihr subjektives Erleben am Arbeitsplatz. Uns <strong>in</strong>teressieren<br />
auch Ihre Wünsche, Ziele und Idealvorstellungen.<br />
Dr. Eykmann forderte gestern von den Führungskräften,<br />
sich aktiv und konstruktiv <strong>in</strong> Veränderungsnotwendigkeiten<br />
e<strong>in</strong>zuf<strong>in</strong>den. Ich fände es schön, wenn wir nicht<br />
Notwendigkeiten, sondern Chancen dar<strong>in</strong> sähen und kon-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
E<strong>in</strong>stiegsreferat<br />
Dipl.-Soz. Rudolf Bögel<br />
Gruppenarbeit<br />
zu 5 Themenbereichen<br />
Präsentation der Gruppenarbeiten<br />
im Plenum<br />
Zusammenfassung<br />
Aktionsplan<br />
krete Aktivitäten festlegen, um noch vorhandene Gestaltungsspielräume<br />
zu nutzen. Da wir unter uns s<strong>in</strong>d, haben<br />
wir auch die Chance, den D<strong>in</strong>gen offen und ehrlich zu<br />
begegnen. Die wenigen externen Teilnehmer bitte ich um<br />
Diskretion bezüglich der Internas, die hier zur Sprache<br />
kommen.<br />
In e<strong>in</strong>em kurzen E<strong>in</strong>führungsreferat wird Sie Herr Bögel<br />
mit der Thematik vertraut machen und Ihnen Arbeitsfelder<br />
der Personalentwicklung vorstellen. Fünf Bereiche, fünf<br />
Bauste<strong>in</strong>e der Personalentwicklung davon werden Sie <strong>in</strong><br />
Kle<strong>in</strong>gruppen, jeweils unter Leitung e<strong>in</strong>es Moderators,<br />
genauer betrachten und bearbeiten.<br />
1. Auswahl und die E<strong>in</strong>arbeitung neuer Mitarbeiter<br />
2. die fachliche und außerfachliche Weiterbildung<br />
3. die Mitarbeiterführung<br />
4. die Arbeitsgestaltung<br />
5. die Persönlichkeitsentwicklung.<br />
Während die Themen 1 bis 3 für sich sprechen, darf ich<br />
zu den Themen 4 und 5 noch kurz erläutern, was sich<br />
dah<strong>in</strong>ter verbirgt.<br />
E<strong>in</strong>führungsreferate <strong>in</strong> den Arbeitskreis 7<br />
183
Die Gruppe 4, — Arbeitsgestaltung — betrachtet die<br />
Arbeit u. a. unter den Gesichtspunkten Verantwortung,<br />
Kreativität, Selbstorganisation, Lernmöglichkeit, Vielfalt,<br />
Arbeitsplatzumfeld und Rückmeldung.<br />
Thema 5 —Persönlichkeitsentwicklung — steht neben<br />
der fachlichen Aus- und Weiterbildung. Die Person des<br />
Mitarbeiters ist Mittelpunkt. Die Anlagen, die er mitbr<strong>in</strong>gt<br />
werden gefördert und entwickelt. Sie befassen sich <strong>in</strong> dieser<br />
Gruppe mit persönlichen Eigenschaften die im beruflichen<br />
Umfeld für erfolgreiches Handeln wichtig ersche<strong>in</strong>en<br />
wie z. B.<br />
— Welche Werte s<strong>in</strong>d mir wichtig?<br />
— Welche Überzeugungen trage ich <strong>in</strong> mir?<br />
— Mit welcher Tatkraft/Energie arbeite ich?<br />
— Liebe ich me<strong>in</strong>e Arbeit?<br />
— Kann ich strategisch Denken und Handeln?<br />
— B<strong>in</strong> ich teamfähig oder E<strong>in</strong>zelgänger?<br />
— Wie ist es um me<strong>in</strong>e Kommunikation bestellt?<br />
Moderation<br />
Gruppe 1 Herr Rudolf Langmantl von der Direktion für<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Regensburg<br />
Gruppe 2 Herr Egon Ankenbrand von der Staatlichen<br />
Führungsakademie<br />
Gruppe 3 Frau Cornelia Reiff von der Direktion für<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Landau<br />
Gruppe 4 Herr Re<strong>in</strong>hard Reif von der Direktion für<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Landau<br />
Gruppe 5 Herr Willi Perzl von der Direktion für<br />
<strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> Regensburg.<br />
Für die Bereitschaft, diese Aufgabe zu übernehmen<br />
bedanke ich mich vorweg bei der Kolleg<strong>in</strong> und den<br />
Kollegen. Die Vorgehensweise <strong>in</strong> den Kle<strong>in</strong>gruppen werden<br />
Ihnen die Moderatoren selbst erläutern.<br />
Die Ergebnisse der Kle<strong>in</strong>gruppen werden im Plenum<br />
präsentiert und stellen zusammengefaßt das Ergebnis des<br />
Arbeitskreises dar. Als Grundlage für die Arbeit <strong>in</strong> den<br />
Gruppen wird Sie nun Herr Rudolf Bögel von der Ludwig-<br />
Maximilians-Universität München mit dem Thema vertraut<br />
machen. Herr Bögel ist Diplom-Soziologe. Er arbeitet<br />
am Lehrstuhl für Organisations- und Wirtschaftspsychologie<br />
und befaßt sic h seit längerer Zeit <strong>in</strong>tensiv mit diesem<br />
Thema, nicht nur bezogen auf die freie Wirtschaft,<br />
sondern gerade auch auf die Verwaltung.<br />
Herr Bögel, ich freue mich, daß Sie me<strong>in</strong>er Bitte nachgekommen<br />
s<strong>in</strong>d und nun uns <strong>Ländliche</strong>n Entwicklern den<br />
Blick <strong>in</strong> Richtung Personalentwicklung lenken.<br />
Vorstellung und Diskuslsion<br />
der Ergebnisse<br />
der Arbeitsgruppe<br />
184 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Rudolf Bögel<br />
Systematische<br />
Personalentwicklung<br />
Selektion und <strong>Entwicklung</strong> von Mitarbeitern als<br />
Führungsaufgabe<br />
Wenn Sie an Ihre Behörde und Ihre Mitarbeiter<br />
denken, dann wünschen Sie sich vielleicht manchmal<br />
andere und kompetentere Mitarbeiter für e<strong>in</strong>e optimalere<br />
Erfüllung der Ihnen gesetzten Aufgaben und Ziele.<br />
Manche Vorgesetzte lamentieren ja viele Jahre über die<br />
schlechten Mitarbeiter, aber diese Vorgesetzten müssen<br />
sich auch fragen lassen, was sie <strong>in</strong> der ganzen Zeit zur<br />
Qualifizierung ihrer Mitarbeiter beigetragen haben?<br />
Die Qualifizierung von Mitarbeitern ist aus dieser<br />
Perspektive ke<strong>in</strong>e private Angelegenheit der Mitarbeiter,<br />
sondern e<strong>in</strong>e Führungsaufgabe und e<strong>in</strong>e der wichtigsten<br />
und vornehmsten, wenn vielleicht auch e<strong>in</strong>e nicht<br />
leichte.<br />
Manch e<strong>in</strong>er me<strong>in</strong>t vielleicht, er täte sich leichter, wenn<br />
er die Mitarbeiter e<strong>in</strong>fach austauschen könnte und beruft<br />
sich dabei auf die sog. »freie Wirtschaft«; aber dort weiß<br />
man längst, daß das Pr<strong>in</strong>zip »hire and fire« viel zu teuer ist<br />
und personalqualifizierende Maßnahmen letztlich nicht<br />
ersetzen kann.<br />
Im Zentrum der Überlegungen steht hier zuerst der<br />
Vorgesetzte als »Coach«, der se<strong>in</strong>e Mitarbeiter e<strong>in</strong>arbeitet,<br />
deren Zusammenarbeit fördert, sie <strong>in</strong>formiert, ihre<br />
Qualifizierung vorantreibt und mit ihnen zusammen<br />
lernt. Dieses Bild vom Vorgesetzten steht im Gegensatz<br />
zum traditionellen Bild des Vorgesetzten, der als erster<br />
Sachbearbeiter <strong>in</strong> der Abteilung alles besser weiß und<br />
kann als se<strong>in</strong>e Mitarbeiter. Dieses traditionelle Bild ist<br />
vom autokratischen und autoritären Führungsstil geprägt.<br />
Im folgenden soll die Bedeutung des Vorgesetzten für<br />
die Qualifizierung der Mitarbeiter deutlich werden. Selbst<br />
wenn wir das denkbar beste Weiterbildungs- und Personalentwicklungskonzept<br />
im H<strong>in</strong>tergrund hätten — was<br />
wir nicht haben — so bliebe doch die Bedeutung des<br />
unmittelbaren Vorgesetzten für die Qualifikation se<strong>in</strong>er<br />
Mitarbeiter zentral. Bei allen Bemühungen um die<br />
Qualifizierung se<strong>in</strong>er Mitarbeiter, die wir dem Vorgesetzten<br />
unterstellen, bleibt er relativ hilflos, wenn er<br />
nicht auf e<strong>in</strong>e systematische Unterstützung zurückgreifen<br />
kann; se<strong>in</strong>e Bemühungen bleiben beliebig und<br />
»Flickschusterei«.<br />
Aus- und Fortbildung als systematische<br />
Personalentwicklung<br />
Def<strong>in</strong>itionsversuche von Personalentwicklung, daß<br />
diese nur die Diskrepanz von Anforderungen und Fertigkeiten,<br />
die nicht durch Selektion ausgeglichen werden<br />
könne, zu entwickeln habe, greifen zu kurz. Sie berücksichtigen<br />
zu wenig die Zukunft der Organisation und<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong> der Menschen. Fortbildungsmaßnahmen<br />
s<strong>in</strong>d aber nur dann s<strong>in</strong>nvoll, wenn mit ihnen nicht nur<br />
die gröbsten Löcher zugestopft werden, sondern wenn<br />
mit ihrer Hilfe längerfristiger Erfolg gesichert<br />
werden kann. Dies ist nur im Rahmen e<strong>in</strong>es Konzepts<br />
möglich, das auf zukünftige Anforderungen h<strong>in</strong> ausgerichtet<br />
ist.<br />
Weiterbildungsmaßnahmen greifen zu kurz, wenn nur<br />
die unterschiedlichen Interessen e<strong>in</strong>zelner Mitarbeiter zum<br />
Zuge kommen oder die willkürlich von Vorgesetzten diagnostizierten<br />
Schwachstellen berücksichtigt werden oder<br />
auf den e<strong>in</strong>gefahrenen Geleisen von Fortbildungen weitergefahren<br />
wird, weil e<strong>in</strong>e »Personalverwaltung« auch<br />
e<strong>in</strong>en Etat für Fortbildung aufwirft.<br />
Bei e<strong>in</strong>em systematischen Ansatz muß deshalb gefragt<br />
werden:<br />
1. Was fordert die Zukunft von uns?<br />
2. Welche Konsequenzen hat das?<br />
3. Wo haben wir unsere Schwachstellen bzw.<br />
Nachholbedarf?<br />
4. Wie können wir diese erfolgreich beseitigen bzw.<br />
e<strong>in</strong>holen?<br />
Zu 1. Was fordert die Zukunft von uns?<br />
Bei aller Vorsicht bei der Prognose dessen, was der<br />
»Markt« von uns fordert, sehen wir folgende Forderungen<br />
auf uns zukommen:<br />
• Hohe Erwartungen an den öffentlichen Dienst bezüglich<br />
se<strong>in</strong>er Flexibilität und Kundenorientierung.<br />
• Neue wissenschaftliche und technologische<br />
Erkenntnisse, die schnell umgesetzt werden sollen.<br />
• Gewandelte Interessen der Mitarbeiter: Postmaterielle<br />
Werte; ganzheitliche Aufgaben und <strong>Entwicklung</strong>smöglichkeiten;<br />
mehr Frauen; mehr Teilzeitarbeit,<br />
job-shar<strong>in</strong>g etc.<br />
• Konkurrenz durch sog. »freie Anbieter«, die staatsentlastend<br />
tätig werden wollen und teilweise auch<br />
können.<br />
• Knappere Mittel, die effizienter als bisher e<strong>in</strong>gesetzt<br />
werden sollen; Qualitätsmanagement, verstärktes<br />
Controll<strong>in</strong>g und »Zertifizierung«.<br />
Zu 2. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus:<br />
• Ständige Optimierungsprozesse, die auch vor traditionellen<br />
Strukturen nicht halt machen.<br />
• E<strong>in</strong>e »Lernende Organisation« im Unterschied zu<br />
Mitarbeitern, die etwas lernen sollen.<br />
• Mehr <strong>in</strong>terdiszipl<strong>in</strong>äre Zusammenarbeit als bisher und<br />
Teamarbeit.<br />
• Mitarbeiter mit mehr und teils auch anderen Schlüsselqualifikationen<br />
als bisher: kognitive und soziale<br />
Fähigkeiten, z. B. Lern-, Konflikt- und Teamfähigkeit.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
185
E<strong>in</strong>e systematische Personalentwicklung ist vor dem<br />
H<strong>in</strong>tergrund dieses Scenarios e<strong>in</strong>e Notwendigkeit, die sich<br />
jedoch nicht automatisch ergibt, aber mit Ihrer Hilfe entwickelt<br />
werden kann. E<strong>in</strong>e Personalentwicklung kann auch<br />
von »oben« angeordnet werden, sie ist dann meistens<br />
nicht so erfolgreich, als wenn sie von und mit den<br />
Betroffenen selbst erarbeitet wird.<br />
Überblick über e<strong>in</strong>e umfassende Personalentwicklung<br />
Um Sie bei den Überlegungen, »wo haben wir unsere<br />
Schwachstellen bei der Personalentwicklung« und »wie<br />
können wir diese zukünftig meistern«, zu unterstützen,<br />
erlaube ich mir <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Abriß über die Spanne des<br />
Berufslebens h<strong>in</strong>weg zu zeigen, was alles unter Personalentwicklung<br />
im weiteren S<strong>in</strong>ne zu verstehen ist:<br />
(1) Beg<strong>in</strong>nen wir bei der Auswahl des »Personals« (besser<br />
ist wohl der Ausdruck: »Mitarbeiter«), dann kommen<br />
wir schon zu spät, wird häufig behauptet, d.h.<br />
wir müssen im öffentlichen Dienst nehmen, was der<br />
Markt übrig läßt. E<strong>in</strong> offensives Personalmarket<strong>in</strong>g,<br />
das auf die optimale Fächerkomb<strong>in</strong>ation <strong>in</strong> Ausbildung<br />
und Studium E<strong>in</strong>fluß nimmt und diese auch<br />
zum Gegenstand ihres Market<strong>in</strong>gs und des Auswahlverfahrens<br />
macht, wäre hier zu fordern. Ich<br />
glaube, daß der öffentliche Dienst hierbei gar nicht so<br />
hilflos se<strong>in</strong> muß, wie es den Ansche<strong>in</strong> hat.<br />
(2) Die üblichen Prospekte und Ausschreibungen im<br />
öffentlichen Dienst stellen häufig Negativbeispiele<br />
der Personalwerbung dar. Der potentielle Bewerber<br />
liest mehr die traditionelle »Anpassung« als die herausfordernden<br />
Tätigkeiten und <strong>Entwicklung</strong>smöglichkeiten<br />
aus dem Ausschreibungstext heraus, weil<br />
diese Tätigkeiten selbst nicht realitätsgerecht und<br />
glaubwürdig beschrieben werden.<br />
(3) Für die Auswahl selbst s<strong>in</strong>d Anforderungsprofile<br />
zu erstellen, die vom zukünftigen Arbeitsplatz ausgehen.<br />
Schlüsselqualifikationen, wie z. B. Team- und<br />
Konfliktfähigkeit, kommunikative Fertigkeiten oder<br />
Alternativen für Entscheidungen entwickeln zu können,<br />
bekommen <strong>in</strong> Zukunft größere Bedeutung.<br />
Schaut man bei der Auswahl — wie das traditionell<br />
üblich ist — nur auf bestimmte Noten, dann wird die<br />
Basis für die Auswahl oft recht schmal, zu schmal für<br />
e<strong>in</strong> differenziertes Auswahlverfahren wie z. B. für e<strong>in</strong><br />
»Assessment Center«.<br />
(4) Der E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> die Organisation und die erste Zeit<br />
der Sozialisation oder die E<strong>in</strong>gewöhnung, stellen<br />
e<strong>in</strong>en der wichtigsten Abschnitte im Berufsleben<br />
des e<strong>in</strong>zelnen und der Personalentwicklung dar:<br />
An se<strong>in</strong>en ersten Arbeitstag er<strong>in</strong>nert man sich noch<br />
nach vielen Jahren. Wird man den Mitarbeitern überhaupt<br />
vorgestellt; wird man e<strong>in</strong>fach alle<strong>in</strong> gelassen,<br />
»<strong>in</strong>s kalte Wasser geworfen«? Bekommt man e<strong>in</strong>en<br />
erfahrenen Mentor oder Tutor zur Seite gestellt, oder<br />
wird e<strong>in</strong>fach e<strong>in</strong> »Loch« <strong>in</strong> der schlechtesten Abteilung<br />
zugemacht bei Mitarbeitern, mit denen sonst<br />
ke<strong>in</strong>er mehr arbeiten will?<br />
(5) Hier ungefähr setzen traditionell Weiterbildungsmaßnahmen<br />
e<strong>in</strong>, aber s<strong>in</strong>d diese auch systematisch<br />
geplant und mit der Eignung und Neigung des Mitarbeiters<br />
abgestimmt? Für welche Karriere s<strong>in</strong>d welche<br />
Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen obligatorisch,<br />
wurden diese dem Mitarbeiter beim E<strong>in</strong>stellungsoder<br />
Förderungsgespräch auch mitgeteilt? S<strong>in</strong>d den<br />
Mitarbeitern, die immer über ihre begrenzten Aufstiegsmöglichkeiten<br />
klagen, die Kriterien dafür und<br />
ihre Chancen auch klar gemacht worden?<br />
(6) E<strong>in</strong> Beispiel im S<strong>in</strong>ne des »learn<strong>in</strong>g on the job«<br />
stellt Jobrotation dar: Job rotation <strong>in</strong> verschiedenen<br />
Aufgabengebieten z. B. als Voraussetzung für<br />
Beförderungen. Jobrotation hält erstarrte Organisationen<br />
und ansonsten e<strong>in</strong>seitige Spezialisten<br />
flexibel! Jobrotation steht im Gegensatz zu<br />
»Kam<strong>in</strong>aufstieg«. Job rotation sollte geplant und im<br />
Rahmen e<strong>in</strong>er systematischen Personalentwicklung<br />
stattf<strong>in</strong>den.<br />
(7) Führungstra<strong>in</strong><strong>in</strong>gs: Wie soll e<strong>in</strong> Vorgesetzter das<br />
Mitarbeitergespräch führen, wenn er das nicht<br />
gelernt hat? Wie soll er Gruppen- und Teamarbeit<br />
fördern und anleiten, wenn dies nicht Teil e<strong>in</strong>er<br />
systematischen Personalentwickung ist? Führungssem<strong>in</strong>are,<br />
z. B. s<strong>in</strong>d s<strong>in</strong>nvoll, wenn sie systematisch<br />
aufbauen, alle Vorgesetzten nach Plan diese durchlaufen,<br />
Nachfolge-Veranstaltungen stattf<strong>in</strong>den, <strong>in</strong> die<br />
die Führungskräfte ihre praktischen Erfahrungen mit<br />
dem Gelernten e<strong>in</strong>br<strong>in</strong>gen und schließlich organisationszentriert<br />
Vorgesetzte und Mitarbeiter geme<strong>in</strong>sam<br />
teilnehmen. Nur so kann e<strong>in</strong> Transfer <strong>in</strong> die Praxis<br />
sichergestellt werden und die Bedürfnisse der Betroffenen<br />
berücksichtigt werden.<br />
(8) Die Weiterbildung im Rahmen e<strong>in</strong>es s<strong>in</strong>nvollen<br />
Personalentwicklungs-Konzeptes bedeutet auch<br />
Weiterbildung für alle Mitarbeiter und nicht nur<br />
für e<strong>in</strong>ige auserwählte. Weiterbildungsmaßnahmen<br />
kommen auch häufig zu spät. Führungstra<strong>in</strong><strong>in</strong>gs gibt<br />
es manchmal erst, wenn man zur letzten Beförderung<br />
ansteht.<br />
(9) Der oft beschworene ältere Mitarbeiter, der ke<strong>in</strong>e<br />
Motivation (dt.: Anstrengungsbereitschaft) für se<strong>in</strong>e<br />
Arbeit mehr aufbr<strong>in</strong>gt und statt dessen <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er<br />
Freizeit recht aktiv ist, ist auch das Produkt organisationaler<br />
Sozialisation! Es s<strong>in</strong>d nicht die mangelnden<br />
äußeren Anreize <strong>in</strong> erster L<strong>in</strong>ie, die dieses Verhalten<br />
bed<strong>in</strong>gen, wie z. B. »Das Ende der Fahnenstange«,<br />
sondern mangelnde Herausforderungen und <strong>in</strong>teressante<br />
Aufgaben und e<strong>in</strong>e Organisationskultur, die e<strong>in</strong><br />
bestimmtes Verhalten fördert. (Die empirische<br />
Motivationsforschung kann dies belegen.) Es ist ausgesprochen<br />
traurig, wenn Menschen im Berufsleben<br />
verkommen, daß der Beruf sozusagen amtlich zur<br />
Nebensache wird.<br />
Die Persönlichkeitsförderlichkeit durch die Arbeit ist<br />
e<strong>in</strong>e Aufgabe der Personalentwicklung. Die Organisation<br />
hat nicht nur e<strong>in</strong> Ziel, nämlich die Leistung,<br />
186 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
sondern auch das Ziel zufriedene, gesunde und entwickelte<br />
Persönlichkeiten hervorzubr<strong>in</strong>gen, so steht es<br />
ja auch <strong>in</strong> den Lehrbüchern der Betriebswirtschaftslehre.<br />
(10) Zu guter Letzt geht es noch um e<strong>in</strong>e gel<strong>in</strong>gende<br />
Ablösung aus dem Berufsleben und e<strong>in</strong>en bruchlosen<br />
Übergang <strong>in</strong> die Pensionierung, damit dieses<br />
lebensverändernde Ereignis nicht zum Schockerlebnis<br />
wird oder gar zum »Pensionstod« führt.<br />
Referent Bögel<br />
Personalentwicklung als lebendiger und partizipativer<br />
Prozeß<br />
Die »bestgewollten« Maßnahmen der Weiterbildung<br />
bleiben nutzlos, wenn ke<strong>in</strong> Transfer zur Praxis möglich ist.<br />
Das Transferproblem ist jedoch nur zum ger<strong>in</strong>gsten Teil<br />
e<strong>in</strong> <strong>in</strong>dividuelles. Der e<strong>in</strong>zelne kann die Bed<strong>in</strong>gungen<br />
se<strong>in</strong>er Praxis nur sehr begrenzt bee<strong>in</strong>flussen. Sie wissen ja,<br />
wie man manchmal nach dem »erfolgreichen« Besuch<br />
e<strong>in</strong>er Weiterbildungsmaßnahme von se<strong>in</strong>en Kollegen<br />
begrüßt wird: »Du hast e<strong>in</strong>e schöne Zeit gehabt, wir dagegen<br />
haben De<strong>in</strong>e Arbeit machen müssen.«<br />
Die Frage ist, ob die Organisation bereit ist, Impulse aus<br />
der Weiterbildung aufzunehmen? Diese Bereitschaft ist<br />
strukturell verankert <strong>in</strong> der Organisations- und Führungskultur.<br />
Wer von e<strong>in</strong>er qualifizierenden Weiterbildung<br />
nichts hält, der kann ke<strong>in</strong> Vorgesetzter se<strong>in</strong>!<br />
E<strong>in</strong> elaboriertes Konzept der Personalentwicklung ist<br />
natürlich e<strong>in</strong> strukturbildendes Element e<strong>in</strong>er Unternehmenskultur.<br />
Letztlich zeichnet sich e<strong>in</strong>e Organisationskultur<br />
aber dadurch aus, wie sie gelebt wird. Konzepte<br />
bleiben oft »totes Papier« und verstauben <strong>in</strong> Regalen, <strong>in</strong>sbesondere<br />
wenn sie fremdbestimmt wurden. Konzepte, die<br />
mittels partizipativer Strategien entwickelt wurden, wo<br />
Betroffene zu Beteiligten gemacht wurden, haben die<br />
Chance auch gelebt zu werden; denn durch die Beteiligung<br />
wird Akzeptanz für Inhalte und Ziele erreicht und<br />
die notwendige Motivation (Anstrengungsbereitschaft) für<br />
die Umsetzung.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
187
Arbeitskreis 8<br />
Unternehmenskultur<br />
Günter Bschor<br />
E<strong>in</strong>führung<br />
»Von ihrem Auftrag her eigentlich auf Dienstleistungen<br />
ausgerichtet, s<strong>in</strong>d solche Unternehmen tatsächlich häufig<br />
nach <strong>in</strong>nen orientiert und mit sich selbst beschäftigt. Die<br />
Mitarbeiter s<strong>in</strong>d gründlich und ordentlich, aber auch vorsichtig,<br />
kle<strong>in</strong>lich, perfektionistisch, detailbesessen, fügsam<br />
und angepaßt. Entscheidungen werden exakt vorbereitet,<br />
sie dauern entsprechend lange und man sichert sich nach<br />
allen Seiten ab.<br />
Die Kommunikation ist umständlich und hierarchiebetont.<br />
Kooperation f<strong>in</strong>det nur bed<strong>in</strong>gt statt. Das Hauptaugenmerk<br />
wird darauf gerichtet, wie etwas getan wird,<br />
weniger darauf, was getan wird. Die Form steht im Vordergrund,<br />
das Ergebnis eher im H<strong>in</strong>tergrund. Anordnungen<br />
werden ausgeführt, ob sie s<strong>in</strong>nvoll s<strong>in</strong>d oder nicht.<br />
Über alle Vorgänge werden Aktennotizen verfaßt, es<br />
besteht e<strong>in</strong> hervorragendes Ablagesystem. Man ist nach<br />
außen h<strong>in</strong> weitgehend abgeschottet, und der Realitätsverlust<br />
ist mitunter erschreckend. Zwischen Leistung und<br />
Belohnung besteht kaum e<strong>in</strong>e Beziehung. Titel spielen für<br />
die Selbste<strong>in</strong>schätzung e<strong>in</strong>e größere Rolle als Geld.« Der<br />
Autor des Bandes »Unternehmenskultur«, Herr Ulrich<br />
Wever, nennt diese Kategorie von Unternehmenskultur die<br />
Verwaltungskultur. Der öffentliche Dienst also mal wieder<br />
als Negativbeispiel?<br />
Zum Vorlauf<br />
Bei der <strong>Fachtagung</strong> 1992 beschäftigte sich ebenfalls e<strong>in</strong><br />
Arbeitskreis 8 mit der Thematik »Unternehmenskultur«.<br />
Kollege Egon Ankenbrand von der FÜAK stellte damals<br />
e<strong>in</strong>en Vergleich an zwischen unserer Tätigkeit <strong>in</strong> der<br />
Dorferneuerung und unserer Unternehmenskultur:<br />
Demnach s<strong>in</strong>d die drei Grundfragen <strong>in</strong> der Dorferneuerung<br />
— wo kommen wir her?<br />
— wer s<strong>in</strong>d wir?<br />
— wo wollen wir h<strong>in</strong>?<br />
auch für uns als Unternehmen anwendbar.<br />
Ziel des Arbeitskreises 8 sollte 1992 und soll auch<br />
heuer se<strong>in</strong>, zu den Fragen<br />
— wer s<strong>in</strong>d wir?<br />
— wo wollen wir h<strong>in</strong>?<br />
ansatzweise Perspektiven und Visionen aufzuzeigen.<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Wir bauen heute nicht auf den sachlichen<br />
Erkenntnissen des Arbeitskreises 8 von 1992 auf, sondern<br />
bearbeiten neue Themen. Diese Ergebnisse wollen wir<br />
gewissermaßen als weitere Glieder e<strong>in</strong>er Stoffsammlung<br />
zum Thema »Unternehmenskultur« weitergeben. Dabei<br />
hoffen wir natürlich auf e<strong>in</strong>e Umsetzung der enthaltenen<br />
Visionen und Anregungen.<br />
So wurde Ende 1993 e<strong>in</strong>er der Vorschläge des Arbeitskreises<br />
8 von 1992 erfüllt mit der Bekanntgabe unseres<br />
Corporate Design.<br />
Herr Strößner schreibt dazu <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Vorwort:<br />
»Die Aufgaben und Schwerpunkte unserer<br />
Verwaltung haben sich <strong>in</strong> den vergangenen Jahren<br />
stark verändert und verlagert. Aus dem Fachgebiet der<br />
klassischen Flurbere<strong>in</strong>igung ist das umfassende<br />
Dienstleistungsangebot <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong> entstanden.<br />
Gleichzeitig haben sich nicht nur unsere Arbeitsplätze<br />
und -methoden, sondern auch unsere<br />
Beziehungen nach außen — <strong>in</strong>sbesondere zu unseren<br />
wichtigsten Partnern, den Bürgern und Geme<strong>in</strong>den —<br />
nachhaltig gewandelt. Die geänderte Unternehmenskultur<br />
unserer Verwaltung soll künftig mehr als bisher<br />
Themenauswahl<br />
Artefakte: 1 Identifikation-Market<strong>in</strong>g-<br />
Außenwirkung:<br />
Unsere Arbeit am Beispiel der<br />
gestalteten Landschaft<br />
Normen: 2 Konflikt-, Informations- und<br />
Kooperationsverhalten <strong>in</strong><br />
unserer Verwaltung<br />
Wertvor- 3a E<strong>in</strong>stellung zu Innovationen<br />
vorstellung: und ihre Auswirkungen auf<br />
die Arbeit<br />
Alternativ: 3b E<strong>in</strong>stellung des Personals zur<br />
Verwaltung<br />
Grundwerte: 4a Verhältnis zu Natur und<br />
Technik<br />
Alternativ: 4b Soziale Beziehungen <strong>in</strong> der<br />
Organisation<br />
E<strong>in</strong>führungsreferate <strong>in</strong> den Arbeitskreis 8<br />
189
durch e<strong>in</strong> zeitgemäßes Ersche<strong>in</strong>ungsbild <strong>in</strong>haltlich<br />
erfaßt werden und visuell zur Darstellung kommen.<br />
Es gibt zahlreiche Elemente, die dazu beitragen, die<br />
Identität der Gesamtheit unserer Verwaltung zu formen.<br />
Dies transparent zu machen und e<strong>in</strong>prägsam zu<br />
gestalten, ist Aufgabe e<strong>in</strong>es Corporate Design.«<br />
— Soweit Herr Strößner.<br />
Aus me<strong>in</strong>em Schreiben an die Teilnehmer dieses<br />
Arbeitskreises konnten Sie entnehmen, daß wir für Sie aus<br />
den Kulturelementen e<strong>in</strong>e Vorauswahl von sechs Themen<br />
getroffen haben. Sie können anschließend daraus drei<br />
Themen auswählen und <strong>in</strong> moderierten Kle<strong>in</strong>gruppen<br />
bearbeiten.<br />
Zur aktuellen Situation<br />
Wir und vor allem Kollegen des M<strong>in</strong>isteriums, aus<br />
Krumbach, Landau und Würzburg mußten uns für e<strong>in</strong>e<br />
e<strong>in</strong>gehende Untersuchung unseres Unternehmens <strong>in</strong> den<br />
letzten Wochen sehr <strong>in</strong>tensiv mit allen Vorgängen <strong>in</strong><br />
unserer Verwaltung befassen.<br />
An sich ist dies nichts Neues für uns, da sich an jeder<br />
Direktion Arbeitskreise für e<strong>in</strong>en möglichst effektiven<br />
Arbeitsablauf auch früher schon Gedanken machten und<br />
machen, — und auch <strong>in</strong> dem weit angelegten Spektrum<br />
der Untersuchung sollte es nicht nur e<strong>in</strong>e Gefahr, sondern<br />
auch e<strong>in</strong>e Chance für unser Unternehmen se<strong>in</strong>.<br />
Die allgeme<strong>in</strong>e Rezession, der Druck auf die öffentlichen<br />
Haushalte und damit auf den öffentlichen Dienst<br />
und auch <strong>in</strong>terne Probleme <strong>in</strong> der Landwirtschaftspolitik<br />
— e<strong>in</strong>e Politik für den ländlichen Raum gibt es leider noch<br />
nicht — kommen für unser Unternehmen <strong>in</strong> diesem<br />
Zusammenhang zu e<strong>in</strong>em denkbar ungünstigen Zeitpunkt.<br />
Aus e<strong>in</strong>er fast re<strong>in</strong>en Verteidigungsposition heraus<br />
(Stichwort Badura-Kommission) tun wir uns sehr hart,<br />
solche Chancen wahrzunehmen:<br />
— Die Stärken unserer eigenen Unternehmenskultur nach<br />
<strong>in</strong>nen und außen entsprechend darzustellen,<br />
— e<strong>in</strong> schlüssiges Gesamtleitbild weiter zu entwickeln<br />
und umzusetzen,<br />
— aufgezeigten Schwächen s<strong>in</strong>nvoll zum Wohl der<br />
<strong>Entwicklung</strong> des ländlichen Raumes zu begegnen.<br />
Jede Unternehmenskultur benötigt für e<strong>in</strong>e positive<br />
<strong>Entwicklung</strong> Freiräume und klar def<strong>in</strong>ierte Vorgaben.<br />
Unter dem äußeren Druck stecken wir derzeit sicher <strong>in</strong><br />
<strong>Entwicklung</strong>sproblemen. Lassen Sie sich davon <strong>in</strong> unserer<br />
heutigen Tätigkeit bitte nicht zu sehr bee<strong>in</strong>flussen. Die<br />
wesentlichen Merkmale unserer Unternehmenskultur<br />
behalten auch <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em personell reduzierten Unternehmen<br />
ihre Gültigkeit!<br />
Zu den Personen, die Sie heute begleiten<br />
Ich freue mich, daß wir zur fachlichen E<strong>in</strong>führung und<br />
Begleitung Herrn Dr. Norbert Hagemann gew<strong>in</strong>nen konnten.<br />
Nach e<strong>in</strong>em Studium der Politikwissenschaften pro-<br />
movierte er <strong>in</strong> Berl<strong>in</strong> zu gesellschaftlichen, wirtschaftlichen<br />
und organisatorischen Konsequenzen technischer<br />
Innovationen. Se<strong>in</strong>e beruflichen Erfahrungen sammelte<br />
er <strong>in</strong> öffentlichen Verwaltungen sowie Unternehmen der<br />
Privatwirtschaft. Seit 1993 ist Dr. Hagemann als Berater<br />
im Bereich Management Consult<strong>in</strong>g der Firma Sietec<br />
Consult<strong>in</strong>g tätig.<br />
Näheres zur Moderation und zum Ablauf erläutern<br />
Ihnen im Anschluß an das Fachreferat des Herrn<br />
Dr. Hagemann die Kollegen Alois Krausenböck und<br />
Harald Mohr. Bei der Moderation der Gruppen werden Sie<br />
weiterh<strong>in</strong> von den Kolleg<strong>in</strong>nen Gerl<strong>in</strong>de August<strong>in</strong> und<br />
Monika Hirl und den Kollegen Wolfgang Ewald, Ferd<strong>in</strong>and<br />
Bisle und Karl Schur — alle Direktion für <strong>Ländliche</strong> Entwickung<br />
Krumbach — unterstützt. Von der <strong>Ansbach</strong>er<br />
Direktion s<strong>in</strong>d für die heutige Organisation die Kollegen<br />
Klaus Zupfer und Wolfgang Gartzke zuständig. Zu me<strong>in</strong>er<br />
Person: Ich b<strong>in</strong> an der Direktion für <strong>Ländliche</strong> <strong>Entwicklung</strong><br />
Krumbach Abteilungsleiter IT und Geschäftsführer<br />
der Schule für Dorf- und Landentwicklung Thierhaupten.<br />
Beim Schnuppern <strong>in</strong> der Literatur b<strong>in</strong> ich auf e<strong>in</strong>e<br />
amüsante Parallele gestoßen: Im Mittelalter pflegte sich<br />
jeder König e<strong>in</strong>en Hofnarren zu halten. Der Hofnarr hatte<br />
nicht nur die Aufgabe, den König mit Scherzen zu unterhalten.<br />
Er hatte außerdem die sprichwörtliche »Narrenfreiheit«,<br />
die ihn verpflichtete, die Politik des Königs scharf<br />
zu beobachten und — wenn auch mit dem berufseigenen<br />
Schalk im Nacken — massive Kritik zu äußern.<br />
In Zukunft wird wohl kaum e<strong>in</strong> Unternehmen ohne<br />
e<strong>in</strong>en Hofnarren auskommen. Vorbei s<strong>in</strong>d die Zeiten der<br />
Firmenideologien, die e<strong>in</strong>en Bann gegen jeden aussprachen,<br />
der gut geme<strong>in</strong>te E<strong>in</strong>wände hatte. Lassen sie uns<br />
also heute unsere eigenen Hofnarren se<strong>in</strong>, die kritisch<br />
ihren »Hofstaat« beäugen.<br />
Herr Dr. Hagemann wird Sie nun mit se<strong>in</strong>em Referat<br />
»Unternehmensstrategie und Unternehmenskultur<br />
— der Schlüssel zum Unternehmenserfolg« <strong>in</strong>s Thema<br />
e<strong>in</strong>führen<br />
190 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Norbert Hagemann<br />
Unternehmensstrategie und<br />
Unternehmenskultur<br />
— der Schlüssel zum Unternehmenserfolg<br />
»Die Unternehmensberater erhalten e<strong>in</strong> neues und<br />
attraktives Beratungsprodukt, der akademisch-wissenschaftliche<br />
Bereich f<strong>in</strong>det <strong>in</strong> legitimatorischer und beruflicher<br />
H<strong>in</strong>sicht e<strong>in</strong> thematisch neues Arbeitsfeld«. Auf<br />
dieses lakonische Kürzel br<strong>in</strong>gt Karl Sandner von der Wirtschaftsuniversität<br />
Wien das Interesse, die Hoffnungen<br />
und die Erwartungen, die sich an das <strong>in</strong> Fachkreisen seit<br />
geraumer Zeit stark diskutierte Thema der Unternehmenskultur<br />
knüpfen. Die Entdeckung der Unternehmenskultur<br />
und deren Zusammenhang mit dem Erfolg e<strong>in</strong>es Unternehmens<br />
hat <strong>in</strong> den letzten Jahren aber auch bei vielen<br />
Managern <strong>in</strong> der Privatwirtschaft den E<strong>in</strong>druck entstehen<br />
lassen, der Universalschlüssel für den Erfolg <strong>in</strong> schnellebigen<br />
Zeiten sei gefunden worden. Akute Probleme und<br />
Rückschläge bei der Umsetzung neuer Strategien, die<br />
Suche nach neuen, effizienteren Führungskonzepten und<br />
-<strong>in</strong>strumenten sowie der Erfolgsnimbus, der der kulturellen<br />
Andersartigkeit japanischer Unternehmen anhaftet,<br />
bildeten den fruchtbaren Boden für die anhaltend hohe<br />
Akzeptanz unternehmenskultureller Fragestellungen <strong>in</strong><br />
Managementkreisen.<br />
Inhalt dieses Vortrages wird die kritische Betrachtung<br />
dieses »Universalschlüssels« sowie das Aufzeigen<br />
von Möglichkeiten und Grenzen se<strong>in</strong>er Nutzung se<strong>in</strong>.<br />
E<strong>in</strong>geleitet werden die Ausführungen durch e<strong>in</strong>en<br />
kurzen Aufriß der Herausforderungen, mit denen sich<br />
öffentliche Verwaltungen gegenwärtig und zukünftig konfrontiert<br />
sehen. Der sich hieran anschließende Überblick<br />
über die Entstehungsgeschichte des Interesses an unternehmenskulturellen<br />
Themen und ihrer E<strong>in</strong>ordnung <strong>in</strong> den<br />
Unternehmenszusammenhang soll die Bedeutung der<br />
Unternehmenskultur für die heutige Betriebswirtschaft<br />
aufzeigen. Hierauf aufbauend werden unter E<strong>in</strong>bezug von<br />
Beispielen die e<strong>in</strong>zelnen Ebenen und Elemente der Unternehmenskultur<br />
e<strong>in</strong>er näheren Betrachtung unterzogen.<br />
Ansatzpunkte für die Gestaltung der Kultur e<strong>in</strong>es Unternehmens<br />
schließen den Vortrag ab und bilden zugleich die<br />
Überleitung zur weiteren Vertiefung des Themas <strong>in</strong> den<br />
Arbeitsgruppen.<br />
Als e<strong>in</strong> zentraler Leistungsträger unseres Geme<strong>in</strong>wesens<br />
rückt der Bereich öffentliche Verwaltungen zusehends <strong>in</strong><br />
das Zentrum der Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Von<br />
ihm werden Leistungen erwartet, die bei deutlich ger<strong>in</strong>gerem<br />
Ressourcene<strong>in</strong>satz e<strong>in</strong>e höhere Qualität des Geme<strong>in</strong>wohls<br />
sichern sollen. Effektivität und Effizienz s<strong>in</strong>d damit<br />
die aktuellen Schlagworte auch für das »Unternehmen«<br />
Verwaltung. Verwaltungserfolg wird an wirtschaftlichen<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Kennziffern gemessen werden. Aber nicht nur. Bereits<br />
heute, und zukünftig noch mit steigender Intensität, sieht<br />
sich die öffentliche Verwaltung mit e<strong>in</strong>er Vielfalt zum Teil<br />
neuartiger Herausforderungen konfrontiert. In der Folie,<br />
die wir »Dreieck der Herausforderungen« genannt haben<br />
(s. Abb. S. 192) s<strong>in</strong>d diese schematisch angerissen. Zu<br />
ihnen zählen vor allem die hochdynamischen <strong>Entwicklung</strong>en<br />
<strong>in</strong> technischer, organisatorischer, aber auch gesellschaftlicher<br />
H<strong>in</strong>sicht.<br />
Neue und steigende Anforderungen erwachsen z. B.<br />
aus dem Wertewandel <strong>in</strong> der Gesellschaft, denken wir<br />
nur an die veränderte gesellschaftliche Rezeption der<br />
Bedeutung des Dorfes, erwachsen aus den Veränderungen<br />
im Arbeitsprozeß sowie <strong>in</strong> der gesellschaftlichen Organisation,<br />
die der rasanten Verbreitung der neuen Informations-<br />
und Kommunikationstechologien geschuldet s<strong>in</strong>d,<br />
erwachsen aus dem veränderten Demokratiebewußtse<strong>in</strong><br />
der Bürger und ihrem Wunsch, im eigenen Lebensbereich<br />
unmittelbarer mitwirken und mitbestimmen zu können.<br />
Nennenswerte Beispiele aus dem schier unerschöpflichen<br />
Fundus unserer sich stetig verändernden Umwelt s<strong>in</strong>d<br />
ebenso die deutsche E<strong>in</strong>heit, die Zunahme multikultureller<br />
Aspekte unserer Gesellschaft sowie der Europäische<br />
E<strong>in</strong>igungsprozeß mit se<strong>in</strong>en Rückwirkungen auf die<br />
nationale, Landes- und ländliche Politik.<br />
Aber nicht nur die Nutzer der öffentlichen Dienstleistungen<br />
wollen sich <strong>in</strong> ihren Ansprüchen befriedigt<br />
wissen. Die Mitarbeiter der Verwaltungen selbst s<strong>in</strong>d Teil<br />
dieser Umwelt und entwickeln ähnliche Bedürfnisse wie<br />
ihre Kollegen, z. B. privatwirtschaftlicher Unternehmen.<br />
Denken wir nur an die Fragen der flexiblen Arbeitszeitgestaltung<br />
oder der größeren Attraktivität der eigenen<br />
Verwaltungsarbeit. Schließlich will der Mitarbeiter stolz<br />
se<strong>in</strong> auf se<strong>in</strong> erbrachtes Produkt, sich auch offen identifizieren<br />
können mit se<strong>in</strong>em »Unternehmen«.<br />
Und letztlich muß diesen Herausforderungen unter<br />
den Bed<strong>in</strong>gungen von tiefgreifenden Umbrüchen <strong>in</strong><br />
den Verwaltungen selbst Rechnung getragen werden<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
191
192 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
(s. Abb. S 196). Wie bereits erwähnt, müssen wir davon<br />
ausgehen, daß gegenläufig zu den steigenden<br />
Anforderungen die Budgets der Verwaltungen real s<strong>in</strong>ken<br />
werden, und zudem <strong>in</strong> vielen Bereichen die Verschlankung<br />
der Verwaltung zu e<strong>in</strong>em nicht unerheblichen<br />
Stellenabbau führen wird. In Baden-Württemberg s<strong>in</strong>d es<br />
mittelfristig ca. 4 000 Stellen, <strong>in</strong> den anderen<br />
Bundesländern nicht weniger.<br />
Sie als aktive Gestalter s<strong>in</strong>d gefordert, nicht nur jede<br />
Ecke dieses Dreiecks <strong>in</strong> sich zu verbessern, sondern die<br />
Relationen <strong>in</strong> ihrer Ganzheitlichkeit zu erkennen und zu<br />
optimieren. Selbstverständlich kann man nicht davon ausgehen,<br />
daß dies von jedem e<strong>in</strong>zelnen Mitarbeiter geleistet<br />
wird, aber an jedem Arbeitsplatz wird sich diese Situation<br />
widerspiegeln, und jeder Mitarbeiter wird sich mit ihr konfrontiert<br />
sehen.<br />
Die Bewältigung der aufgezeigten Herausforderungen<br />
erfordert, um das Wort von Herrn Glück zu<br />
gebrauchen, »Realutopien«. Sie erfordert e<strong>in</strong>e Kultur, die<br />
es ermöglicht, Herausforderungen auch als Chance zu<br />
begreifen. Jürgen Weber, Controll<strong>in</strong>g- und Logistik-<br />
Professor an der Wissenschaftlichen Hochschule für<br />
Unternehmensführung <strong>in</strong> Koblenz, schätzte jüngst im<br />
Manager-Magaz<strong>in</strong> e<strong>in</strong>, daß die Realisierung der Vision<br />
von Verwaltungen nur gel<strong>in</strong>gen werde, wenn der öffentliche<br />
Dienst die Herausforderung der permanenten Veränderung<br />
akzeptiere. Dieses aber greife so tief <strong>in</strong> das<br />
Verhalten aller Bediensteten e<strong>in</strong>, daß es hierzu e<strong>in</strong>er<br />
grundlegenden Kulturveränderung bedarf. Um so begrü-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
ßenswerter s<strong>in</strong>d solche Arbeitskreise wie der heutige, <strong>in</strong><br />
denen es im geme<strong>in</strong>samen Austausch und Überlegen<br />
konkret zur Sache geht (s. Abb. unten).<br />
Durch die Globalisierung der Märkte sahen sich die<br />
Unternehmen der Privatwirtschaft schon seit Beg<strong>in</strong>n der<br />
80er Jahre mit dem angedeuteten Optimierungsproblem<br />
konfrontiert. Inzwischen s<strong>in</strong>d <strong>in</strong> der Privatwirtschaft<br />
Erkenntnisse gereift, die <strong>in</strong> neu entwickelten Methoden<br />
und Instrumenten für die Bewältigung dieser Herausforderungen<br />
ihren Niederschlag gefunden haben.<br />
Beispiele hierfür s<strong>in</strong>d:<br />
• das Qualitätsmanagement<br />
• Organisations- und Strukturanpassungen z. B. unter<br />
den Stichworten Lean Production, Lean Management<br />
oder Workflow-Management<br />
• Controll<strong>in</strong>gsysteme oder auch<br />
• die Optimierung von Geschäftsprozessen.<br />
Diese Methoden und Instrumente stellen das eigentliche<br />
Betätigungsfeld des Bereiches Management Consult<strong>in</strong>g<br />
der Sietec Consult<strong>in</strong>g dar. In unserer täglichen Arbeit<br />
<strong>in</strong> den Unternehmen und Verwaltungen mußten wir aber<br />
beobachten, daß es e<strong>in</strong>en Faktor gibt, der den Erfolg unserer<br />
Arbeit maßgeblich bee<strong>in</strong>flußt und somit beständig mit<br />
<strong>in</strong> Betracht zu ziehen war: Dieser Faktor ist das, was wir<br />
mit dem Begriff Unternehmenskultur fassen.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
193
Immer wieder haben wir festgestellt, daß der Erfolg der<br />
E<strong>in</strong>führung und Umsetzung neu konzipierter Strategien<br />
und Strukturen wesentlich davon abhängt, ob die Mitarbeiter<br />
diese mittragen, ob das Neue mit der kulturellen<br />
Tradition und dem kulturellen Horizont vere<strong>in</strong>bar ist, d. h.,<br />
dem kulturellen Selbstverständnis der Organisation entspricht.<br />
Plastisches Beispiel hierfür ist unser Mutterunternehmen,<br />
die Siemens Nixdorf Informationssysteme AG<br />
selbst. Es war ke<strong>in</strong> Geheimnis, daß der Informatik-Bereich<br />
von Siemens und die Nixdorf AG zum Zeitpunkt der<br />
Fusion beider Unternehmen zwei völlig unterschiedliche<br />
Kulturen verkörperten. Weit mehr als zwei Jahre hat es<br />
nach ihrer Zusammenführung gedauert, bis aus den<br />
beiden Kulturen e<strong>in</strong>e von allen Mitarbeitern geme<strong>in</strong>sam<br />
getragene SNI-Kultur wurde. Zweifellos gab es auf diesem<br />
Weg diverse Reibungsverluste, das schlagartige Durchsetzen,<br />
quasi per Vorstandsrundschreiben, e<strong>in</strong>er der<br />
beiden Kulturen hätte aber mit Sicherheit zu e<strong>in</strong>em Fiasko<br />
der Fusion geführt.<br />
Gehen wir davon aus, daß die im Bereich der Wirtschaft<br />
und <strong>in</strong> den öffentlichen Verwaltungen zu lösenden<br />
Probleme strukturell ähnlich s<strong>in</strong>d, so ist die Frage der<br />
Nutzung der <strong>in</strong> der Privatwirtschaft gewonnenen Erfahrungen<br />
naheliegend.<br />
Zweifelsfrei können e<strong>in</strong>e Vielzahl der entwickelten<br />
Methoden und Instrumente auch im Verwaltungsbereich<br />
e<strong>in</strong>gesetzt werden. Bezogen auf unser Thema um so mehr,<br />
als wir von e<strong>in</strong>em Organisationsbegriff ausgehen, wonach<br />
die Unternehmung, das Krankenhaus, der Sportvere<strong>in</strong> und<br />
eben auch die Verwaltung Organisation ist. Es bleibt aber<br />
weiterh<strong>in</strong> offen, ob sich bei e<strong>in</strong>em bloßen Übertragen der<br />
Erfahrungen, die <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em anderen Kulturumfeld erzielt<br />
wurden, auch dieselben Wirkungen e<strong>in</strong>stellen werden.<br />
In unserem Unternehmen hat sich diesbezüglich die<br />
Erkenntnis durchgesetzt, daß jede Organisation ihren<br />
»eigenständigen« Weg der Problemlösung f<strong>in</strong>den muß.<br />
Diese Eigenständigkeit bezieht sich auch auf die Zusammenarbeit<br />
mit dem externen Know-how, sprich mit den<br />
Beratern. In ihrem jüngst herausgegebenen Buch<br />
»Organisationsentwicklung — Verwaltungen helfen sich<br />
selbst« stellen die Autoren der Bayerischen Verwaltungsschule<br />
<strong>in</strong> diesem Zusammenhang heraus, daß sich der<br />
Lösungsbedarf der öffentlichen Verwaltungen nicht auf<br />
die gegenwärtigen Probleme beschränkt. Die Aufgaben<br />
und Rahmenbed<strong>in</strong>gungen ihres Handelns würden sich<br />
ständig ändern, was die Fähigkeit der Verwaltung erfordere,<br />
heute gefundene Lösungen weiterzuentwickeln und<br />
zukünftige Probleme sachgerecht anzupacken. Erschließen<br />
und Entwickeln des eigenen Sachverstandes und knowhow-Transfer<br />
heißen die diesbezüglichen Stichworte.<br />
Nach unserem Verständnis sollte sich der E<strong>in</strong>satz externen<br />
Know hows bei der Lösung so komplexer Aufgabenstellungen<br />
wie der <strong>Entwicklung</strong> von Organisationskultur<br />
im wesentlichen auf die Moderation des angestrebten<br />
Veränderungsprozesses beziehen. Wie aus der abgebildeten<br />
Folie ersichtlich, steht dabei die Gestaltung e<strong>in</strong>es<br />
wünschenswerten Unternehmenskulturmodells, nennen<br />
wir es e<strong>in</strong>mal SOLL-Kultur, im Vordergrund der <strong>in</strong>haltlichen<br />
Arbeit. Voraussetzung hierfür ist e<strong>in</strong> zum<strong>in</strong>dest<br />
grobes Verständnis des IST-Zustandes der Kultur im<br />
194 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Unternehmen. Die hierfür erforderliche Analysearbeit, vor<br />
allem aber die <strong>Entwicklung</strong> der SOLL-Kultur, sollte — unter<br />
Anleitung externer Moderatoren — von den Mitarbeitern<br />
selbst durchgeführt werden. Dieses wäre zugleich e<strong>in</strong>e<br />
entscheidende Voraussetzung dafür, daß die »Früchte dieser<br />
Anstrengungen« von möglichst vielen getragen und<br />
damit auch umgesetzt werden.<br />
Wie kam es zur Entdeckung der Organisationskultur<br />
als Faktor des Erfolgs von Unternehmungen?<br />
Seit Beg<strong>in</strong>n der Industrialisierung bis heute wurde der<br />
Mensch im Unternehmen stets <strong>in</strong> se<strong>in</strong>er Funktion für den<br />
Unternehmenserfolg betrachtet. Anfang des 20. Jahrhunderts<br />
wurde dabei vor allem arbeitsorganisatorischen<br />
Aspekten Aufmerksamkeit geschenkt. Die organisatorische<br />
Struktur von Unternehmungen, ihre hierarchischen Gliederungen<br />
und die damit e<strong>in</strong>hergehende Arbeitsteilung<br />
standen im Zentrum aller Bestrebungen.<br />
Vor dem H<strong>in</strong>tergrund e<strong>in</strong>er gesellschaftlichen Ause<strong>in</strong>andersetzung<br />
um mehr <strong>in</strong>dividuelle Freiräume verlagerte<br />
sich die Aufmerksamkeit <strong>in</strong> den siebziger Jahren von der<br />
strukturellen auf die soziale Dimension der Arbeit. Die<br />
Organisationswissenschaft »entdeckte« parallel, daß<br />
Organisationen e<strong>in</strong>er permanenten dynamischen <strong>Entwicklung</strong><br />
unterworfen s<strong>in</strong>d, daß erst die Menschen <strong>in</strong> der<br />
Organisation diese mit Leben erfüllen und dieses oft<br />
anders, als man sich es bei der Planung der Strukturen<br />
und der Arbeitsorganisation gedacht hatte. »Glückliche<br />
Mitarbeiter leisten mehr« wurde zum zentralen Motto der<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
Unternehmensführung. Das Schlagwort von der<br />
»Humanisierung der Arbeit« machte die Runde und damit<br />
Pro-gramme zur Erweiterung des Arbeits<strong>in</strong>haltes, zur<br />
Rotation an den Arbeitsplätzen und zur Verbesserung der<br />
sozialen Beziehungen der Mitarbeiter untere<strong>in</strong>ander.<br />
In der ersten Hälfte der achtziger Jahre hatten sich die<br />
wirtschaftlichen Rahmenbed<strong>in</strong>gungen durch gestiegene<br />
Komplexität und Dynamik stark verändert. Um den<br />
Unternehmenserfolg auch unter diesen Bed<strong>in</strong>gungen zu<br />
gewährleisten, mußte e<strong>in</strong> Weg gefunden werden, die<br />
Mitarbeiter <strong>in</strong> die Lage zu versetzen, auch <strong>in</strong> komplexen,<br />
sich schnell verändernden Situationen im S<strong>in</strong>ne des<br />
Unternehmens richtig zu entscheiden. Bisher genutzte<br />
Verfahrensvorschriften und Verhaltensmaßregeln erwiesen<br />
sich als nur noch bed<strong>in</strong>gt nutzbar, der Übergang zur<br />
Delegation von Entscheidungskompetenz als notwendig.<br />
Man erkannte, daß es neben dem »Glücklichse<strong>in</strong>« der<br />
Mitarbeiter noch etwas gibt, von dessen Ausprägung es<br />
wesentlich abhängt, ob die Mitarbeiter die an sie geknüpften<br />
Erwartungen erfüllen.<br />
Dieses Etwas ist die Organisationskultur. »So wie man<br />
e<strong>in</strong>es Tages begonnen hatte, Kommunikationsprozesse<br />
oder Konflikte oder Führungsverhalten bewußt wahrzunehmen,<br />
um diese dann auch bewußt zu gestalten, auch<br />
wenn man dies immer schon <strong>in</strong>tuitiv getan hat, so . . .<br />
(begann) man nun, die kulturelle Dimension (der Unternehmung)<br />
bewußt wahrzunehmen«, also all das, was den<br />
Charakter, den Geist und damit die E<strong>in</strong>maligkeit und<br />
Unverwechselbarkeit e<strong>in</strong>es Unternehmens ausmacht. So<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
195
Dr. Wagner <strong>in</strong> se<strong>in</strong>em Referat vor 2 Jahren <strong>in</strong> Bamberg.<br />
Mit den Themen der E<strong>in</strong>stellungen und Werthaltungen<br />
war zugleich e<strong>in</strong> neuer Ansatz der Unternehmensführung<br />
gefunden, der dem Wunsch des Managements nach<br />
<strong>in</strong>direkten, impliziten und damit weicheren Führungs<strong>in</strong>strumenten<br />
im Rahmen e<strong>in</strong>er gelenkten und gestalteten<br />
Evolution des Unternehmens entsprach.<br />
Wie ordnet sich die Organisationskultur <strong>in</strong> das<br />
Management e<strong>in</strong>es Unternehmens e<strong>in</strong>?<br />
Ausgehend von den Zielen e<strong>in</strong>es Unternehmens oder<br />
e<strong>in</strong>er Organisation werden Strategien zu deren Erreichung<br />
aufgestellt. Die Umsetzung dieser Strategien manifestiert<br />
sich <strong>in</strong> der konkreten Ausgestaltung der e<strong>in</strong>zelnen Organisationselemente,<br />
zu denen die Mitarbeiter, die Organisationsstrukturen,<br />
die Systeme (EDV), die Geschäftsprozesse,<br />
der Führungsstil, aber auch die Organisationskultur<br />
zu zählen s<strong>in</strong>d. E<strong>in</strong>e erfolgreiche Realisierung unternehmenspolitischer<br />
Zielsetzungen ist nur möglich, wenn die<br />
Ziele, die verfolgte Strategie sowie die e<strong>in</strong>zelnen Organisationselemente<br />
konsistent s<strong>in</strong>d. Damit ist auch die<br />
wechselseitige Bed<strong>in</strong>gtheit von Unternehmensstrategie,<br />
Unternehmenskultur und Unternehmenserfolg umrissen.<br />
Besteht zwischen den Werten und Normen der Unternehmenskultur<br />
e<strong>in</strong>er Organisation und der Strategie<br />
dieser Organisation ke<strong>in</strong> Gleichklang, so bedarf es zur<br />
Sicherung des angestrebten Unternehmenserfolges entweder<br />
e<strong>in</strong>er Anpassung der Strategie an das kulturell<br />
Machbare oder e<strong>in</strong>er <strong>Entwicklung</strong> der Organisationskultur<br />
(s. Abb. S. 197).<br />
Diesen Zusammenhang reflektieren auch die gegenwärtig<br />
<strong>in</strong> der Siemens AG unternehmensweit laufenden<br />
Aktivitäten zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit.<br />
Dabei wird davon ausgegangen, daß das Ziel, im <strong>in</strong>ternationalen<br />
Wettbewerb durch e<strong>in</strong> schnelleres Reagieren<br />
auf Marktveränderungen zu bestehen, mit der herkömmlichen<br />
Siemens-Kultur nicht zu bewerkstelligen ist. E<strong>in</strong>e<br />
unter dem Namen TOP (Siemens soll top werden) laufende<br />
»Kampagne« zielt <strong>in</strong> diesem Zusammenhang vor allem auf<br />
Veränderungen <strong>in</strong> der E<strong>in</strong>stellung, der Motivation der<br />
Mitarbeiter und dem Führungsverhalten der Vorgesetzten.<br />
Die zielgerichtete <strong>Entwicklung</strong> der Unternehmenskultur<br />
soll ihren Niederschlag f<strong>in</strong>den <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er größeren<br />
Verantwortung jedes e<strong>in</strong>zelnen. Die Vorgesetzten sollen<br />
im Ergebnis nicht mehr »Anweiser« sondern »Coach«, die<br />
Mitarbeiter nicht mehr »Mit-Arbeiter« sondern »Mit-<br />
Denker« se<strong>in</strong>. Bei der Konzipierung der »Kampagne« ließen<br />
sich die Verantwortlichen zugleich von der Erkenntnis leiten,<br />
daß es nicht möglich se<strong>in</strong> wird, das noch weit verbreitete<br />
Warten auf Vorgaben abzubauen, wenn die kulturellen<br />
nicht durch die entsprechenden z. B. organisatorischen<br />
Veränderungen begleitet werden. TOP thematisiert<br />
<strong>in</strong> diesem Zusammenhang die Verlagerung operativer<br />
Tätigkeiten und Befugnisse von oben nach unten, ebenso<br />
wie Fragen e<strong>in</strong>er Weiterentwicklung der bestehenden<br />
Entgeltsysteme sowie maßgeschneiderter Arbeitszeitmodelle.<br />
Der auch an diesem Beispiel sichtbare Zusammenhang<br />
zwischen Unternehmensstrategie, Unternehmenskultur<br />
und Unternehmenserfolg verdeutlicht e<strong>in</strong> wesentliches<br />
Axiom für die Kulturentwicklung selbst: die Stärke der<br />
Kultur e<strong>in</strong>es Unternehmens liegt nicht so sehr <strong>in</strong> der spezifischen<br />
Ausprägung se<strong>in</strong>er e<strong>in</strong>zelnen Bestandteile sondern<br />
vor allem im Grad der Harmonie mit den unternehmenspolitischen<br />
Notwendigkeiten.<br />
Kommen wir nun zur Begriffsbestimmung.<br />
Zahlreich s<strong>in</strong>d <strong>in</strong>zwischen auch <strong>in</strong> Deutschland die<br />
Bücher und Publikationen der Fachpresse zum Thema der<br />
Organisationskultur. In allen e<strong>in</strong>schlägigen Nachschlagewerken<br />
der Betriebswirtschaft f<strong>in</strong>den Sie Abhandlungen<br />
von profilierter Hand. Ungeachtet dessen werden Sie<br />
Schwierigkeiten haben, e<strong>in</strong>e übere<strong>in</strong>stimmende und zudem<br />
unserem Kulturkreis adäquate, weil klare und präzise<br />
Def<strong>in</strong>ition dieses Phänomens zu f<strong>in</strong>den. E<strong>in</strong> Teil der Autorenschaft<br />
versucht sich gar ganz darum herumzumogeln<br />
oder def<strong>in</strong>iert sie z. B. nur als<br />
» . . . grundsätzliche Idee oder Vorstellung davon . . . ,<br />
wie mit organisatorischer Komplexität besser<br />
zurechtzukommen« ist.<br />
Die Ursachen hierfür liegen unter anderem dar<strong>in</strong>, daß<br />
die Betriebswirtschaft über ke<strong>in</strong>e diesbezügliche Begrifflichkeit<br />
verfügt, diese somit der anthropologischen Kulturforschung<br />
zu entleihen war, welche aber aufgrund<br />
konzeptioneller Unterschiede auch ke<strong>in</strong>en e<strong>in</strong>heitlichen<br />
Kulturbegriff bietet. H<strong>in</strong>zu kommt, daß sich die Organisationskultur<br />
als e<strong>in</strong> sehr komplexes und zudem schwer<br />
faßbares Phänomen darstellt. Se<strong>in</strong>e bis zum gegenwärtigen<br />
Zeitpunkt nur mangelnde empirische Durchleuchtung<br />
hat zur Folge, daß wir um se<strong>in</strong>e e<strong>in</strong>zelnen Bestandteile<br />
wissen, weit weniger jedoch darum, wie und durch<br />
welche Prozesse aus den e<strong>in</strong>zelnen Elementen Organisationskultur<br />
entsteht. Sehr treffend ist der <strong>in</strong> diesem<br />
Zusammenhang oft angeführte Vergleich zwischen der<br />
Organisationskultur und dem, was August<strong>in</strong>us von der<br />
Zeit sagte: »Beim Aussprechen des Wortes verstehen wir<br />
. . . , was es me<strong>in</strong>t, und verstehen es gleichso, wenn wir es<br />
e<strong>in</strong>en anderen aussprechen hören. (. . .) Wenn mich<br />
niemand danach fragt, weiß ich es; will ich e<strong>in</strong>em<br />
Fragenden es erklären, weiß ich es nicht«.<br />
Dieses Defizit wird sicherlich von der Organisationsund<br />
auch der Kulturwissenschaft <strong>in</strong> den nächsten Jahren<br />
zu tilgen se<strong>in</strong>. Dabei bleibt aber offen, ob wir angesichts<br />
divergierender Ansätze, auf die wir später noch e<strong>in</strong>mal<br />
zurückkommen, dann die Def<strong>in</strong>ition erhalten werden.<br />
E<strong>in</strong>e treffende Charakteristik des Wesens von<br />
Organisationskultur liefert der St. Gallener Betriebswirtschafts-Professor<br />
Bleicher. Er versteht unter Unternehmenskultur<br />
»das kognitiv entwickelte Wissen und die Fähigkeiten<br />
e<strong>in</strong>er Unternehmung sowie die affektiv<br />
geprägten E<strong>in</strong>stellungen ihrer Mitarbeiter . . . <strong>in</strong><br />
196 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
ihrer Formung von Perzeption (Wahrnehmungen)<br />
und Präferenzen (Vor-lieben) gegenüber Ereignissen<br />
und <strong>Entwicklung</strong>en . . .«.<br />
Organisationskultur ist demnach die Gesamtheit der <strong>in</strong><br />
der Unternehmung gewachsenen Denk- und Verhaltensmuster<br />
sowie der <strong>in</strong> ihr geltenden Werte und Normen.<br />
Gehen wir mit Hegel davon aus, daß das Wesen sche<strong>in</strong>t<br />
und die Ersche<strong>in</strong>ung west, so kann sich Organisationskultur<br />
jedoch begrifflich nicht auf die handlungsbestimmenden<br />
Orientierungsmuster beschränken, sondern muß<br />
ihre symbolischen und d<strong>in</strong>glichen Manifestationen, ihre<br />
Vermittlungsmechanismen und Ausdrucksformen ebenso<br />
berücksichtigen.<br />
Die Komplexität der Organisationskultur läßt sich am<br />
besten über das von Sche<strong>in</strong>, dem Vordenker unternehmenskultureller<br />
Theoriebildung, entwickelte Schichtenmodell<br />
erschließen. Dieses Schichtenmodell bildet die<br />
e<strong>in</strong>zelnen Kulturebenen <strong>in</strong> ihrem <strong>in</strong>neren Zusammenhang<br />
ab. Vorweggeschickt sei an dieser Stelle bereits, daß sich<br />
die eigene, unverwechselbare kulturelle Identität e<strong>in</strong>er<br />
Organisation nach <strong>in</strong>nen und außen nur aus der Gesamtheit<br />
und dem Zusammenspiel ihrer e<strong>in</strong>zelnen Kulturebenen<br />
und -elemente ergibt.<br />
Die eigentliche Basis der Organisationskultur bildet das<br />
sogenannte Weltbild der Mitarbeiter. Dabei handelt es sich<br />
um meist unbewußte, als selbstverständlich gelebte<br />
Orientierungs- und Vorstellungsmuster, so z. B. über<br />
dieNatur des menschlichen Handelns, über das Verhältnis<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
zur Wahrheit oder über die sozialen Beziehungen <strong>in</strong><br />
Organisationen. Zusammen mit den darüberliegenden<br />
Wertvorstellungen bilden sie Prädispositionen der<br />
Wahrnehmung und damit auch Interpretationsmaßstäbe<br />
für fremdes und eigenes Handeln. »Weltbild« und<br />
Wertvorstellungen erfahren ihre handlungsorientierende<br />
Konkretisierung <strong>in</strong> Verhaltensweisen. Über sie (z. B. <strong>in</strong><br />
Gestalt von Maximen, ungeschriebenen<br />
Verhaltensrichtl<strong>in</strong>ien, Verboten u. ä.) erfolgt die eigentliche,<br />
implizite Verhaltenssteuerung der Mitarbeiter. Allen<br />
drei Ebenen ist geme<strong>in</strong>sam, daß sie gar nicht oder nur<br />
begrenzt wahrnehmbar s<strong>in</strong>d. Explizit def<strong>in</strong>iert f<strong>in</strong>den wir<br />
die Ausprägungen der Organisationskultur auf diesen drei<br />
Ebenen nur <strong>in</strong> Unternehmensphilosophien oder <strong>in</strong> sogenannten<br />
Führungsgrundsätzen, wie wir sie<br />
z. B. von BMW kennen. Unmittelbar überprüfbar im S<strong>in</strong>ne<br />
e<strong>in</strong>es Corporate Design s<strong>in</strong>d die <strong>in</strong> Führungsgrundsätzen<br />
festgeschriebenen Orientierungsmuster nur auf der Ebene<br />
der Artefakte. Hierbei handelt es sich um durch Menschenhand<br />
erzeugte materielle, greif- und beobachtbare<br />
Objekte, so z .B. Technik, die Aufmachung von Dokumenten,<br />
Architektur, die Gestaltung von Werk- und Büroräumen<br />
oder, wie <strong>in</strong> Ihrem Falle, die gestaltete Landschaft<br />
als Ergebnis Ihrer Arbeit. Artefakte s<strong>in</strong>d der eigentliche<br />
d<strong>in</strong>gliche Ausdruck der ver<strong>in</strong>nerlichten Weltbilder, Wertvorstellungen<br />
und Verhaltensweisen.<br />
Betrachten Sie die e<strong>in</strong>zelnen Ebenen <strong>in</strong> ihrem Zusammenhang,<br />
so wird deutlich, daß mit zunehmender Transparenz<br />
die Komplexität der Phänomene abnimmt,<br />
während gleichzeitig die Gestaltungsmöglichkeiten von<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
197
der Ebene des Weltbildes über die der Wertvorstellungen<br />
und der Verhaltensweisen bis zur Ebene der Artefakte<br />
zunehmen.<br />
Die Substanz der Kultur e<strong>in</strong>es Unternehmens läßt sich<br />
jedoch nur über den umgekehrten Weg erschließen, durch<br />
die Interpretation dessen, was an der für Externe sichtbaren<br />
Oberfläche bewußt oder unbewußt vermittelt wird.<br />
Auch <strong>in</strong> diesem Zusammenhang sei e<strong>in</strong> Beispiel aus<br />
dem Siemens-Konzern gestattet. Im Rahmen e<strong>in</strong>er Neuausrichtung<br />
der Kommunikationspolitik wurde das<br />
Bereichsmarket<strong>in</strong>g der Siemens-Unternehmen mit zwei<br />
gleichberechtigten Zielstellungen konfrontiert: Externe<br />
Image-Untersuchungen hatten ergeben, daß die Kunden<br />
Siemens zwar als marktstark und technisch kompetent<br />
e<strong>in</strong>schätzen, der Konzern aber gleichzeitig als unübersichtlicher<br />
Industriegigant wahrgenommen wird. Daraus<br />
wurde das Ziel e<strong>in</strong>er stärkeren Profilierung der e<strong>in</strong>zelnen<br />
Bereiche am Markt abgeleitet. Der technische Nutzen für<br />
den e<strong>in</strong>zelnen und nicht die Technik für sich soll nunmehr<br />
im Vordergrund stehen, erstmals will man nicht nur wirtschaftliche<br />
und politische Entscheider, sondern auch<br />
generell die <strong>in</strong>teressierte Öffentlichkeit ansprechen und<br />
hierbei e<strong>in</strong>e emotionale, unkonventionelle und modernwitzige<br />
Sprache nutzen. Neben der Verb<strong>in</strong>dung von<br />
Kompetenz und Sympathie im Rahmen e<strong>in</strong>er stärker artikulierten<br />
Kunden- und Bürgernähe sollte als zweites Ziel<br />
die Zugehörigkeit der e<strong>in</strong>zelnen Bereiche zum Siemens-<br />
Konzern-Verbund prägnanter dokumentiert werden.<br />
Synergie-Effekte werden dabei ebenso anvisiert wie e<strong>in</strong>e<br />
größere Identitätsstiftung nach <strong>in</strong>nen.<br />
Die Komb<strong>in</strong>ation von Logo und Symbol der Sietec<br />
Consult<strong>in</strong>g verdeutlicht anschaulich die simultane Zielerreichung.<br />
So wird die Zugehörigkeit zum Siemens-<br />
Konzern-Verbund, die u. a. Macht, Stärke, Tradition und<br />
<strong>in</strong>ternationale Erfahrung aber auch Kompetenz und Innovation<br />
manifestieren soll, vor allem über zwei Momente<br />
transportiert. Zum e<strong>in</strong>en über die, den Firmennamen<br />
Sietec e<strong>in</strong>führende Silbe »Sie« und zum anderen über die,<br />
seit der jüngsten Veränderung, petrolfarbene Darstellung<br />
der Silbe »tec«. Diese Petrolfarbe f<strong>in</strong>den Sie im Firmennamen<br />
von Siemens oder im Logo der SNI als Balken zwischen<br />
Siemens und Nixdorf wieder. Die geforderte eigenständige<br />
Profilierung am Markt wird unterstützt durch<br />
das Symbol der sechs Kugeln <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em sich überlappenden<br />
Kreis. Die Form der Kugel, die Überschneidungen, die an<br />
e<strong>in</strong> stilisiertes Kugellager er<strong>in</strong>nern, sowie die Verwendung<br />
von Spektralfarben stehen zum e<strong>in</strong>en für Globalisierung,<br />
Ganzheitlichkeit und Integration und zum<br />
anderen für Kundenorientierung und Kundennutzen.<br />
Wie an diesem Beispiel zu erkennen, werden Artefakte<br />
nicht nur durch die ver<strong>in</strong>nerlichten Weltbilder, Wertvorstellungen<br />
und Verhaltensweisen geprägt, sondern spiegeln<br />
diese auch wider. Durch ihre primär nach außen<br />
gerichtete Orientierung und Wirkung gestatten sie somit<br />
Rückschlüsse auf die Kultur e<strong>in</strong>er Organisation. Die hierbei<br />
vorhandenen Interpretationsspielräume schließen allerd<strong>in</strong>gs<br />
die Gefahr e<strong>in</strong>er gewissen Fehl<strong>in</strong>terpretation mit<br />
e<strong>in</strong>.<br />
E<strong>in</strong>en weiteren Zugang zur Kultur e<strong>in</strong>er Organisation<br />
ergibt sich aus der Analyse der Verhaltensweisen ihrer<br />
Mitglieder. Über Sagas, Geschichten und Mythen oder<br />
auch über Formen sozialer Interaktion, z. B. <strong>in</strong> Gestalt von<br />
Zeremonien und Riten, werden die spezifischen Verhaltensweisen<br />
von den Mitgliedern der Organisation gelernt.<br />
Wer kennt <strong>in</strong> diesem Zusammenhang nicht die Anekdote<br />
über die immer offene Tür zum Materiallager e<strong>in</strong>es führenden<br />
<strong>in</strong>ternationalen Elektronikunternehmens und über<br />
den Chef Bill H., der sie e<strong>in</strong>es Samstags verschlossen fand,<br />
sie persönlich aufsperrte und damit Kultur stiftete, <strong>in</strong>dem<br />
er signalisierte, bei uns kann jeder frei von formalen<br />
Grenzen und zeitlichen Beschränkungen — so wie es kreatives<br />
Arbeiten erfordert — für das geme<strong>in</strong>same Wohl des<br />
Unternehmens tätig se<strong>in</strong>. An diesem Beispiel wird die<br />
eigentliche Zielsetzung von Geschichten oder auch Riten<br />
sichtbar. Über das <strong>in</strong>direkte aber e<strong>in</strong>prägsame Vermitteln<br />
oder Weitervermitteln von dem, worauf es <strong>in</strong> der Unternehmung<br />
besonders ankommt, soll primär geme<strong>in</strong>sames<br />
Praktizieren e<strong>in</strong>heitlicher Normen erreicht werden. Integration<br />
durch Vorleben seitens des Managements ist hier<strong>in</strong><br />
<strong>in</strong>begriffen. Nicht der Pförtner, sondern der Chef fand<br />
die Tür zum Materiallager versperrt, und er entdeckte<br />
dies nicht irgendwann <strong>in</strong> der Arbeitswoche sondern am<br />
Samstag. Sche<strong>in</strong>bar die Geschichte e<strong>in</strong>er Kle<strong>in</strong>igkeit, mit<br />
ihrem enormen symbolischen Gehalt gibt sie jedoch prägnante<br />
Verhaltensorientierungen aus. Wer die so vermittelten<br />
Orientierungen kennt, sie akzeptiert und praktiziert,<br />
der signalisiert, daß er dazu gehört. Verhaltensweisen<br />
kommen somit <strong>in</strong> der Unternehmensführung Indikatorfunktion<br />
über die Integration und die potentielle Rolle<br />
des Mitarbeiters <strong>in</strong> der Organisation zu.<br />
Die Verhaltensweisen, die ihren Niederschlag <strong>in</strong> den<br />
Artefakten f<strong>in</strong>den, stellen die konkrete Ausprägung der<br />
ihnen zugrunde liegenden Wertvorstellungen dar. Diese<br />
charakterisieren mentale Dispositionen der Mitarbeiter<br />
gegenüber konkreten Objekten, Personen bzw. Leistungsanforderungen.<br />
Die aus der Privatwirtschaft sicherlich<br />
bekanntesten Kategorien erfolgreicher Wertvorstellungen<br />
s<strong>in</strong>d die Kundenorientierung, die Mitarbeiterorientierung,<br />
die Innovationsorientierung sowie die Produktivitätsorientierung.<br />
E<strong>in</strong>stellungen selbst basieren immer auf<br />
der Existenz und Konsistenz ihrer drei Komponenten,<br />
der kognitiven (Gedanken, Wissen, bewußte Wahrnehmungen),<br />
der affektiven (Gefühle, Haß, Zuneigung, Ärger)<br />
und der Handlungs-Komponente (ausgelöste Anreizwirkung<br />
auf das Handeln). Die jeweils konkrete Ausprägung<br />
der mentalen Disposition, die sich z. B. <strong>in</strong> Wertschätzung,<br />
E<strong>in</strong>satzbereitschaft, Kompromißfähigkeit, Partizipation,<br />
Kooperation und Vertrauen äußern kann, steht <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er<br />
sehr engen Abhängigkeit von der persönlichen Wahrnehmung<br />
der zu erfüllenden Aufgabe sowie des selbst erzeugten<br />
Produktes. Das betrifft, bezogen auf das Produkt,<br />
u. a. Fragen nach se<strong>in</strong>em gesellschaftlichen Nutzen, nach<br />
198 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
dem Ansehen und der Akzeptanz <strong>in</strong> der Öffentlichkeit,<br />
nach se<strong>in</strong>er Leistungsfähigkeit und Qualität sowie nach<br />
den Zukunftschancen. H<strong>in</strong>sichtlich der Aufgabe kann die<br />
konkrete E<strong>in</strong>stellung durch die Fragen nach dem eigenen<br />
Entscheidungs- und Verantwortungsspielraum, nach dem<br />
Grad der Zielerreichung und der Entlohnung oder auch<br />
danach bee<strong>in</strong>flußt werden, <strong>in</strong>wieweit mit ihr e<strong>in</strong>e <strong>in</strong>dividuelle<br />
Bedürfnisbefriedigung zu erreichen ist. Entsprechend<br />
der unterschiedlichen Beantwortung dieser Fragen<br />
ergeben sich unterschiedliche Ausrichtungen der Wertvorstellungen,<br />
die die Grundlage der eigentlichen organisationsspezifischen<br />
Kulturprofile bilden. Diese Besonderheiten<br />
der Kultur e<strong>in</strong>er Organisation liegen <strong>in</strong> der Regel im Verborgenen<br />
und können, wie das Beispiel e<strong>in</strong>er von uns<br />
durchgeführten Untersuchung der Dienstleistereignung<br />
im Fremdenverkehr <strong>in</strong> Mecklenburg-Vorpommern zeigt,<br />
durch den Vergleich mit andersartigen Kulturen oder wie<br />
<strong>in</strong> diesem Falle mit andersartigen Wahrnehmungen verdeutlicht<br />
werden.<br />
Basis aller bisher genannten Kulturebenen ist das<br />
»Weltbild«. Es besteht aus e<strong>in</strong>zelnen Grundwerten, die<br />
zusammengenommen e<strong>in</strong> ganzheitliches S<strong>in</strong>nbild der<br />
Organisation formen. Die Grundwerte selbst tragen<br />
abstrakten Charakter, verfügen jedoch über e<strong>in</strong>e faktische<br />
Wirkung. Sie s<strong>in</strong>d gesellschaftlich vorgeprägt, z. B. durch<br />
landesspezifische Traditionen (Schuhplatteln, Fensterln),<br />
durch Geschichte, Geographie und Religion. Aber auch<br />
und gerade das Bildungssystem bee<strong>in</strong>flußt die Verhaltensweisen,<br />
Wahrnehmungsmuster, Werte und Normen schon<br />
vor dem E<strong>in</strong>tritt <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Organisation. Basierend auf oft<br />
langjährige, u. U. Jahrhunderte umfassende Erfahrungs-<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
prozesse werden Grundwerte wesentlich durch die Grundthemen<br />
menschlicher Existenzbewältigung bestimmt.<br />
Dazu zählt, um nur e<strong>in</strong> Beispiel zu nennen, u. a. die Sicht<br />
auf die Organisationsumwelt. Wird die Umwelt als<br />
bezw<strong>in</strong>gbar, herausfordernd, bedrohlich oder als übermächtig<br />
empfunden? Von der Beantwortung dieser<br />
Frage hängt wesentlich ab, welche kulturell machbare<br />
Strategie e<strong>in</strong>e Unternehmung wählt oder welche Schritte<br />
der Kulturentwicklung im Interesse der Realisierung<br />
der strategischen Zielsetzungen unternommen werden<br />
müssen.<br />
S<strong>in</strong>d alle die Kultur e<strong>in</strong>er Organisation kennzeichnenden<br />
Merkmale auf dem aufgezeigten Wege offengelegt, so<br />
offenbaren sich deren spezifischen, unverwechselbaren,<br />
<strong>in</strong>dividuellen Züge. Individuelle Charakteristika lassen sich<br />
nach verschiedenen Rastern wieder verdichten, wodurch<br />
sich Typen von anzutreffenden Kulturen ergeben. Die<br />
wohl bekanntesten s<strong>in</strong>d die von Kets de Vries und Miller,<br />
bei denen die Charakteristika der Kultur, ihr Leitmotiv und<br />
die <strong>in</strong> ihr angelegten Gefahren zur Typologisierung herangezogen<br />
wurden. E<strong>in</strong>e der von ihnen aufgezeigten<br />
Typen ist die depressive Kultur. Sie ist z. B. geprägt von<br />
pessimistischen Prognosen, von e<strong>in</strong>er Haltung des Ausgeliefertse<strong>in</strong>s<br />
an das Schicksal sowie des Wartens auf<br />
Hilfe von außen. Ihr Leitmotiv lautet: Ich kann am Lauf<br />
der D<strong>in</strong>ge ohneh<strong>in</strong> nichts ändern, dazu wäre ich auch<br />
nicht kompetent genug. Die Gefahren dieser Kultur s<strong>in</strong>d<br />
offensichtlich: Apathie, ger<strong>in</strong>ge Motivation, hohe Absentismusraten,<br />
wenig Entschlußkraft und e<strong>in</strong>e freudlose<br />
Stimmung, die sich bis <strong>in</strong> das Privatleben der Mitarbeiter<br />
h<strong>in</strong>e<strong>in</strong>ziehen kann.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
199
Der Vorteil derartiger Typenbildungen liegt zweifellos <strong>in</strong><br />
se<strong>in</strong>er für die Unternehmensführung hilfreichen Schematisierung,<br />
die Wesentliches von Unwesentlichem zu trennen<br />
ermöglicht. Um sich nicht falschen Rückschlüssen<br />
auszuliefern muß jedoch gleichzeitig kritisch angemerkt<br />
werden, daß Typologien ihrem Charakter nach immer<br />
Hilfsmittel der Interpretation s<strong>in</strong>d und somit oft mit<br />
erheblichen Reduzierungen und Vere<strong>in</strong>fachungen verbunden<br />
s<strong>in</strong>d. Ziel der Organisationskulturentwicklung ist aber<br />
gerade die erforderliche Unverwechselbarkeit der Kultur<br />
(s. Abb. S. 199).<br />
Welche Funktionen hat Organisationskultur?<br />
Wie schon zu Beg<strong>in</strong>n erwähnt, ist die Aufmerksamkeit,<br />
die die Organisationskultur neuerd<strong>in</strong>gs <strong>in</strong> der Unternehmensführung<br />
erfährt vor allem darauf zurückzuführen,<br />
daß sie als Instrument für die Lösung komplexer Probleme<br />
geeignet sche<strong>in</strong>t. In diesem Zusammenhang ist es notwendig,<br />
zum<strong>in</strong>dest schematisch auf die von ihr zu erfüllenden<br />
Funktionen e<strong>in</strong>zugehen.<br />
Kultur kann vor allem <strong>in</strong> H<strong>in</strong>blick auf die Stabilität, die<br />
Identität und die Anpassung des Unternehmens an sich<br />
verändernde Bed<strong>in</strong>gungen e<strong>in</strong>en wesentlichen Beitrag<br />
leisten. Über den sie kennzeichnenden Basiskonsens der<br />
Mitglieder der Organisation h<strong>in</strong>sichtlich von Grundauffassungen<br />
sichert die Organisationskultur auch <strong>in</strong> Konfliktsituationen<br />
das Herstellen von E<strong>in</strong>vernehmen und<br />
bildet damit e<strong>in</strong>e wesentliche Voraussetzung für die<br />
Stabilität der Organisation selbst. Die Koord<strong>in</strong>ationsfunktion<br />
der Kultur kommt vor allem durch ihre entlastende<br />
Wirkung von fallweisen Handlungsanleitungen<br />
durch Verhaltensstandards zum tragen. Organisationskultur<br />
ist <strong>in</strong> diesem S<strong>in</strong>ne auch Substitut für strukturelle<br />
und personelle Führung. Mit der Motivationsfunktion<br />
verb<strong>in</strong>det sich der s<strong>in</strong>nstiftende Charakter der Organisationskultur,<br />
der für die Mitarbeiter motivationsfördernd<br />
nach <strong>in</strong>nen und handlungslegitimierend im Außenverhältnis<br />
wirkt. Schreyögg weist <strong>in</strong> diesem Kontext auf den<br />
oft vernachlässigten Zusammenhang von Handlungssicherheit<br />
und Komplexitätsreduktion h<strong>in</strong>. So brauche der<br />
Mitarbeiter <strong>in</strong> e<strong>in</strong>er Welt voller Unsicherheit und<br />
Komplexität Orientierungshilfen und Reaktionsmuster, die<br />
ihm die Möglichkeit e<strong>in</strong>er überschaubaren und zu bewältigenden<br />
Interaktion mit se<strong>in</strong>er Umwelt geben. Ihre<br />
Identifikationsfunktion erfüllt die Organisationskultur<br />
durch das Vermitteln e<strong>in</strong>es Zugehörigkeits- und damit<br />
Geme<strong>in</strong>schaftsgefühls. Ist dieses positiv ausgeprägt, so ist<br />
e<strong>in</strong>e Stärkung des Selbstbewußtse<strong>in</strong>s ihr Ergebnis. Durch<br />
die Veränderung der Organisationskultur <strong>in</strong> Reaktion auf<br />
die permanenten Austauschprozesse im externen und<br />
<strong>in</strong>ternen Umfeld leistet sie nicht zuletzt e<strong>in</strong>en Beitrag zur<br />
Flexibilität der Organisation.<br />
Fassen wir die wesentlichen Aussagen (<strong>in</strong> Anlehnung<br />
an Schreyögg) zusammen.<br />
Organisationskultur ist e<strong>in</strong> im wesentlichen implizites<br />
Phänomen.<br />
• Organisationskulturen s<strong>in</strong>d geme<strong>in</strong>sam geteilte Überzeugungen,<br />
die die konstituierende Grundlage des<br />
Selbstverständnisses und der Eigendef<strong>in</strong>ition der<br />
Organisation bilden.<br />
• Als »Me<strong>in</strong>ungs-, Norm- und Wertgefüge« wird Organisationskultur<br />
von ihren Trägern, den Mitarbeiter der<br />
jeweiligen Organisation, <strong>in</strong> der Regel als selbstverständlich<br />
gelebt und nicht h<strong>in</strong>terfragt.<br />
• Organisationskultur bezieht sich auf geme<strong>in</strong>same<br />
Orientierungen, Werte usw. Als kollektiv angenommene<br />
Verhaltens- und Wertorientierung prägt sie das<br />
Handeln des e<strong>in</strong>zelnen Mitarbeiters.<br />
• Die Organisationskultur bildet durch ihren »verb<strong>in</strong>dlichen«<br />
Charakter die Basis für die E<strong>in</strong>heitlichkeit und<br />
Kohärenz des Verhaltens der Mitarbeiter der<br />
Organisation.<br />
• Die Organisationskultur ist das Ergebnis e<strong>in</strong>es permanenten<br />
Austauschprozesses mit der Umwelt <strong>in</strong>nerhalb<br />
und außerhalb der Organisation. In se<strong>in</strong>em Verlauf<br />
enstehen über e<strong>in</strong> sukzessives Profilieren bevorzugter<br />
Wege des Denkens und des Problemlösens Orientierungsmuster,<br />
die letztlich handlungsweisenden<br />
Charakter erhalten.<br />
• Als Abbild der »konzeptionellen Welt« der Mitglieder<br />
der Organisation vermittelt Organisationskultur S<strong>in</strong>n<br />
und Orientierung, <strong>in</strong>dem sie Muster der Selektion und<br />
der Interpretation liefert.<br />
• Organisationskultur wird nicht bewußt gelernt, sondern<br />
<strong>in</strong> e<strong>in</strong>em Sozialisationsprozeß vermittelt.<br />
Wie Sie spätestens aus der Erfahrung e<strong>in</strong>es größeren<br />
bayerischen Automobilproduzenten wissen, s<strong>in</strong>d Unternehmenskulturen<br />
trotz ihrer <strong>in</strong> der Regel stark beharrenden<br />
Züge deutlichen Wandlungsprozessen unterworfen.<br />
Hiervon ausgehend stellt sich die Frage, ob und <strong>in</strong>wieweit<br />
die Organisationskultur auch Gegenstand e<strong>in</strong>es geplanten<br />
Wandels se<strong>in</strong> kann. Im Folgenden gilt es, sich an diese vor<br />
allem <strong>in</strong> Extremen diskutierte Frage heranzuarbeiten. Das<br />
hierbei angewendete Muster lautet:<br />
Darf ich? — Kann ich? — Soll ich?<br />
Ähnlich wie wir es bereits aus anderen Bereichen der<br />
Organisationswissenschaften kennen, zeigen sich auch bei<br />
der Konzeptualisierung der Organisationskultur zwei diametral<br />
gegenüberstehende Ansätze. Lassen wir alle<br />
gegenseitigen Unterstellungen beiseite, so besteht der<br />
Extrakt beider Positionen <strong>in</strong> folgendem:<br />
• Die »<strong>in</strong>strumentalistische« Sichtweise stellt (nach<br />
Sandner) die Organisationskultur <strong>in</strong> e<strong>in</strong>e Reihe mit vielen<br />
anderen Elementen, die e<strong>in</strong>e Organisation auszeichnen.<br />
Als Teil e<strong>in</strong>es übergeordneten Ganzen versteht<br />
sie Kultur als etwas, was e<strong>in</strong>e Organisation hat.<br />
Unternehmen produzieren demnach nicht nur Güter<br />
und Leistungen sondern ebenso Kultur. In der Überzeugung<br />
der Bedeutung der Kultur und ihrer verhaltenssteuernden<br />
Wirkung als erfolgsentscheidendem<br />
Faktor fordern sie ihren gezielten E<strong>in</strong>satz und ihre<br />
200 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
planmäßige Ausrichtung an den unternehmensrelevanten<br />
Zielstellungen. Analog der Konzipierung e<strong>in</strong>es verfahrenstechnischen<br />
Ablaufes sollen bei der <strong>Entwicklung</strong><br />
von Kultur jene kulturellen Faktoren identifiziert<br />
bzw. bestimmt und e<strong>in</strong>gesetzt werden, die e<strong>in</strong>e<br />
Anpassung der IST-Kultur an die anvisierte SOLL-Kultur<br />
ermöglichen.<br />
• In Abgrenzung davon betrachtet die »analytischdeskriptive«<br />
Sichtweise, deren Vertreter <strong>in</strong> der Literatur<br />
mit Charakterisierungen wie Kulturalisten, Abst<strong>in</strong>enzler,<br />
Chronisten oder Zweifler belegt werden, Kultur als<br />
etwas, was vor und über den konkreten Aufgaben liegt,<br />
die e<strong>in</strong>e Organisation zu erfüllen hat. Organisation sei<br />
selbst Kultur, die Organisationskultur bezeichne e<strong>in</strong>e<br />
Art S<strong>in</strong>ngeme<strong>in</strong>schaft. Da Kultur die ureigensten Bedürfnisse<br />
des Menschen zum Ausdruck br<strong>in</strong>gen würde,<br />
müsse sie sich jeglichem Zugriff <strong>in</strong>genieurmäßiger<br />
Gestaltungsrationalität oder gar e<strong>in</strong>er Unterordnung<br />
unter wirtschaftliche Zielstellungen entziehen.<br />
Wie immer liegt der Ste<strong>in</strong> des Weisen offensichtlich <strong>in</strong><br />
der Mitte. Dem von den Kulturalisten geforderten »Hände<br />
weg« ist entgegenzuhalten, daß Organisationskultur stets<br />
das Ergebnis menschlicher Aktion ist. Man kann sich als<br />
Betrachter der Tatsache kultureller <strong>Entwicklung</strong> von<br />
Organisationen entziehen, ungeachtet dessen wird derartige<br />
<strong>Entwicklung</strong> aber weiterh<strong>in</strong> stattf<strong>in</strong>den. Problematisch<br />
ist die Position der »Zweifler« auch, wenn unsere<br />
E<strong>in</strong>gangsprämisse vom Wertewandel <strong>in</strong> der Gesellschaft<br />
stimmt. E<strong>in</strong> Reagieren der Organisation, die ja mit der im<br />
Umbruch bef<strong>in</strong>dlichen Umwelt im Austauschverhältnis<br />
steht, würde durch e<strong>in</strong> Festschreiben des kulturellen<br />
status quo unterbunden werden. Auch der Ansatz e<strong>in</strong>er<br />
planerischen Neugestaltung von Organisationskultur<br />
bedarf e<strong>in</strong>er kritischen H<strong>in</strong>terfragung. Alle bisherigen<br />
Erfahrungen haben gezeigt, daß e<strong>in</strong> diesbezüglicher <strong>Entwicklung</strong>sprozeß<br />
nur bed<strong>in</strong>gt steuerbar ist. Gezielte Anstöße<br />
zeitigen häufig völlig ungewollte Wirkungen und<br />
Ergebnisse, ignorieren sie doch <strong>in</strong> der Regel, daß Tiefenerkenntnisse<br />
nicht beliebig auflösbar s<strong>in</strong>d, e<strong>in</strong> Zerstören<br />
des sicherheitsspendenden Orientierungs- und Handlungsrahmens<br />
Gegenwehr erzeugt und letztlich Kulturwandel<br />
immer <strong>in</strong> die Verteilungsverhältnisse immaterieller<br />
und materieller Ressourcen e<strong>in</strong>greift und damit zwangsläufig<br />
Machtkämpfe verursacht. Selbst wenn man dies<br />
alles berücksichtigt, bleibt zu fragen, ob es nicht besser<br />
ist, den Mitarbeiter weniger als Objekt denn als Subjekt<br />
kultureller Veränderungen zu nehmen und auf den willentlichen<br />
Wandel zu setzen. In e<strong>in</strong>em solchen kulturellen<br />
Veränderungsprozeß könnte das Management e<strong>in</strong>e kulturgestaltende<br />
Funktion vor allem <strong>in</strong> Bezug auf das visionäre<br />
Konzipieren der angestrebten Kultur sowie h<strong>in</strong>sichtlich<br />
e<strong>in</strong>er korrigierenden Moderation des zu vollziehenden<br />
Übergangs erfüllen.<br />
Mit dem Begriff Kulturentwicklung wird <strong>in</strong> der Regel<br />
der Aufbau oder die Förderung von »starken« Kulturen<br />
verbunden. Als stark gelten dabei Kulturen, die klare<br />
Orientierungsmuster und Werthaltungen vermitteln, sich<br />
durch e<strong>in</strong>en hohen Verbreitungsgrad <strong>in</strong> der Organisation<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
auszeichnen und durch die Mitarbeiter <strong>in</strong>ternalisiert wurden.<br />
Nach dem Motto »Je stärker, desto besser« knüpft<br />
sich an e<strong>in</strong>en hohen Grad der Erfüllung dieser Kriterien<br />
immer die Hoffnung bedeutsamer Wirkungen z. B. gegenüber<br />
der Konkurrenz, mit der man im Wettbewerb steht.<br />
Der dabei unterstellte unmittelbare Zusammenhang<br />
zwischen Stärke von Organisationskultur und Leistungsfähigkeit<br />
e<strong>in</strong>er Organisation ist so nicht gegeben. Positiven<br />
Effekten, z. B. <strong>in</strong> Gestalt e<strong>in</strong>er wirkungsvolleren Kommunikation,<br />
e<strong>in</strong>er schnelleren Entscheidungsf<strong>in</strong>dung und<br />
e<strong>in</strong>em ger<strong>in</strong>geren Kontrollaufwand, steht e<strong>in</strong>e Reihe<br />
negativer Effekte gegenüber. Bereits bei der Betrachtung<br />
des Zusammenhangs von Strategie, Kultur und Erfolg<br />
wurde auf den potentiell blockierenden Charakter von<br />
Organisationskulturen verwiesen. Daneben könnten aber<br />
auch Tendenzen zur Abschottung gegen kritische Umwelte<strong>in</strong>flüsse<br />
und die Fixierung auf traditionelle Erfolgsmuster<br />
genannt werden. Ist die Kategorie der »Stärke«<br />
e<strong>in</strong>er Kultur unter organisationstheoretischen Gesichtspunkten<br />
noch von Interesse, so relativiert sich ihre Bedeutung<br />
als Richtwert <strong>in</strong> der Praxis merklich. Beispiele aus<br />
unserer Beratertätigkeit belegen dieses. So sahen wir uns<br />
im Rahmen e<strong>in</strong>es Projektes <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em öffentlichen, zur<br />
Privatisierung anstehenden Unternehmen mit e<strong>in</strong>er ausgesprochen<br />
starken Organisationskultur konfrontiert. Die<br />
mit den Jahren der Existenz des Unternehmens allgeme<strong>in</strong><br />
akzeptierten und tief verwurzelten Orientierungsmuster,<br />
Wertvorstellungen und Verhaltensweise ließen die E<strong>in</strong>leitung<br />
e<strong>in</strong>es reflexiven Prozesses, d. h. der Lösung des<br />
Unternehmens aus se<strong>in</strong>er Verklammerung <strong>in</strong> diese starke<br />
Kultur, zur Voraussetzung für das Anpassen an die neuen<br />
Bed<strong>in</strong>gungen der Privatwirtschaft werden. In e<strong>in</strong>er Anstalt<br />
des öffentlichen Rechts <strong>in</strong> den neuen Bundesländern<br />
führten unsere Untersuchungen dagegen zu der Erkenntnis,<br />
daß es im Interesse des Aufbaus perspektivisch relevanter<br />
Stärken notwendig sei, e<strong>in</strong>er »Profilierung« der als<br />
schwach bewerteten Organisationskultur verstärkte Aufmerksamkeit<br />
zu widmen. Wieder ganz anders sieht die<br />
Situation bei der SNI aus, wo sich die Überlegungen um<br />
das Kulturprofil des Unternehmens im Spannungsverhältnis<br />
von Harmonisierung und Offenheit für Veränderungen<br />
bewegen. Diente die altbekannte Losung »Synergie at<br />
work« lange Zeit als Symbol e<strong>in</strong>es produktiven Zusammenwachsens<br />
von Siemens und Nixdorf, so hat sie heute<br />
e<strong>in</strong>e neue Bedeutung erlangt. Überwiegend nur noch im<br />
Ausland gebraucht, soll sie dort signalisieren, Siemens<br />
Nixdorf schöpft <strong>in</strong> Zeiten der Globalisierung der Märkte<br />
aus dem Zusammengehen verschiedener Kulturen.<br />
H<strong>in</strong>tergrund dieser Entscheidung: die Überlegung, ist es<br />
für e<strong>in</strong> <strong>in</strong> 45 Ländern agierendes Unternehmen, dessen<br />
Personal zu e<strong>in</strong>em Viertel aus den unterschiedlichsten<br />
Kulturkreisen kommt, s<strong>in</strong>nvoll und zweckmäßig, sich e<strong>in</strong>e<br />
starke, e<strong>in</strong>heitliche Kultur zu geben. Die Antwort lautete:<br />
nicht s<strong>in</strong>nvoll, nicht zweckmäßig. Alle drei Beispiele unterstreichen<br />
die bereits getroffene Aussage: Entscheidend<br />
für die Bewertung der Kultur ist der Grad der Harmonie<br />
mit den unternehmenspolitischen Notwendigkeiten.<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
201
Veränderungen von Organisationskulturen können<br />
nicht per Anordnung durchgesetzt werden. Alle bisherigen<br />
»gestalterischen« Erfahrungen besagen, daß es hierzu<br />
systematischer und konsequenter, aber zugleich vorsichtiger<br />
Veränderungen von Rahmenbed<strong>in</strong>gungen im betreffende<br />
Unternehmen bedarf. Idealtypischer Weise könnte<br />
e<strong>in</strong> solcher Prozeß (nach Schreyögg) folgende Phasen<br />
umfassen:<br />
1. Diagnosephase: <strong>in</strong> ihr erfolgt das Erfassen der kulturellen<br />
Ausdrucksformen sowie das Erschließen der<br />
zugrundeliegenden Basis-Orientierungen;<br />
2. Beurteilungsphase: <strong>in</strong> ihr werden die Wirkungen der<br />
IST-Kultur abgeschätzt und deren Veränderungsbedürftigkeit<br />
ermittelt;<br />
3. Veränderungsphase: <strong>in</strong> ihr wird im Dialog mit den<br />
Betroffenen e<strong>in</strong>e anzuvisierende Kultur entworfen,<br />
werden die eigentlichen Interventionen e<strong>in</strong>geleitet und<br />
die Neuorientierung verifiziert und bestärkt<br />
In e<strong>in</strong>em von uns moderierend begleiteten großen ostdeutschen<br />
Studentenwerk erwies sich im Gefolge e<strong>in</strong>es<br />
umfangreichen Studiums der dort angetroffenen konkreten<br />
Bed<strong>in</strong>gungen sowie zahlreicher Absprachen mit dessen<br />
Leitung folgendes Vorgehen als das geeignetste, den<br />
anvisierten Veränderungsprozeß zu gestalten. In e<strong>in</strong>em<br />
ersten Schritt wurde <strong>in</strong> Beratungen mit dem engsten<br />
Führungskreis des Studentenwerkes die Unternehmensstrategie<br />
und -politik h<strong>in</strong>terfragt und aus ihr e<strong>in</strong>e kulturelle<br />
Vision abgeleitet. Diese wurde <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em erweiterten<br />
Leitungskreis präsentiert und darüber e<strong>in</strong>e Sensibilisierung<br />
der SOLL-Kultur-Multiplikatoren e<strong>in</strong>geleitet. In diesem<br />
Kreis wurde auf der Basis e<strong>in</strong>er kritischen Bestandsaufnahme<br />
zugleich e<strong>in</strong> e<strong>in</strong>heitlicher Aktionsfokus def<strong>in</strong>iert.<br />
Dieser umfaßte sowohl die Schwerpunkte als auch die<br />
weitere Vorgehensweise. Auf der Grundlage e<strong>in</strong>er kulturkritischen<br />
Analyse des Personalbestandes erfolgte e<strong>in</strong>e<br />
Bestimmung der »positiv« e<strong>in</strong>gestellten »Inseln« sowie der<br />
eigentlichen kulturellen Schwachstellen. Sie <strong>dient</strong>en als<br />
Ausgangspunkt für im weiteren durchgeführte strukturelle<br />
Veränderungen (z. B. Abschaffung von Posten, die von<br />
»Verweigerern« besetzt waren) sowie von Neubesetzungen<br />
neuralgischer Stellen mit Persönlichkeiten, die geeignet<br />
waren, Multiplikatorenfunktionen (kulturelle Taktschläger)<br />
zu übernehmen. Parallel hierzu wurden Aktivitäten e<strong>in</strong>geleitet,<br />
die auf e<strong>in</strong>e Sensibilisierung der Mitarbeiter für die<br />
erforderlichen kulturellen Veränderungen abzielten. Die <strong>in</strong><br />
diesem Zusammenhang vorgenommene Kritik der im<br />
Studentenwerk bestehenden Kultur wurde durch die<br />
E<strong>in</strong>beziehung von Öffentlichkeit über umfangreichen<br />
Befragungen der Dienstleistungsnehmer (Studenten,<br />
Personal von Universitäten sowie Professoren) abgesichert.<br />
Ausgehend von der Erkenntnis, daß neue Werte<br />
nicht durchgesetzt werden können, wenn sie dem Verständnis<br />
der Mitarbeiter nicht zugeführt werden, wurden<br />
die »Ziel«-Werte <strong>in</strong> Führungsleitsätzen, <strong>in</strong> e<strong>in</strong>em gesonderten<br />
Papier zur Kundenorientierung, wie wir es von AVIS<br />
oder auch von Siemens Nixdorf kennen, sowie <strong>in</strong> jeder<br />
e<strong>in</strong>zelnen Stellenbeschreibung schriftlich fixiert und damit<br />
verb<strong>in</strong>dlich festgeschrieben. Ungeachtet der Tatsache, daß<br />
der Veränderungsprozeß der Organisationskultur des<br />
betreffenden Studentenwerkes noch lange nicht abgeschlossen<br />
ist, brachten jüngste, der Verifizierung des<br />
Fortschritts dienende begrenzte Testumfragen e<strong>in</strong>ige<br />
erfreuliche Ergebnisse. Man gestand den Mitarbeitern des<br />
Studentenwerkes e<strong>in</strong>en deutlich gestiegenen Willen zu<br />
mehr Kundenfreundlichkeit zu.<br />
202 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
Bisher erschienene Berichte<br />
1/1966 *<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung 1965, Flurbere<strong>in</strong>igung Schönberg II<br />
2/1967 *<br />
Landwirtschaftsberatung und Flurbere<strong>in</strong>igung, Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
1966, Luftbildmessung, We<strong>in</strong>bergbere<strong>in</strong>igung,<br />
Kontenverbund, Zusammenwirken der Planungsträger<br />
3/1968 *<br />
Arbeitsprogramm 1968 – 1975, Grundsatzterm<strong>in</strong>, Schutzpflanzungen,<br />
Naturschutz, Wirtschaftswegebau, Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
1967, EDV<br />
4/1969 *<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung 1968, Flurbere<strong>in</strong>igung Nördl<strong>in</strong>gen<br />
5/1969 *<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung und Landschaftspflege<br />
6/1970 *<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> der Hallertau, Flurbere<strong>in</strong>igung 1969<br />
7/1970 *<br />
Ausarbeitung e<strong>in</strong>es Flächennutzungsplanes<br />
8/1970 *<br />
FlD Würzburg im neuen Gewande, Sem<strong>in</strong>ar <strong>Stadt</strong>- und<br />
Dorferneuerung, selbstregistrierende Theodolite<br />
9/1971 *<br />
Landschaftspflege und Flurbere<strong>in</strong>igung an den Beispielen<br />
Gottsdorf, Großengsee, Gritschen, Hirschlach, Wiesenfelden,<br />
Ammerbach und Munn<strong>in</strong>gen<br />
10/1971 *<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung 1970, Flurbere<strong>in</strong>igung Mail<strong>in</strong>g,<br />
Menschen- und Betriebsführung, Neuorganisation des<br />
Staatsm<strong>in</strong>isteriums für Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Forsten<br />
11/1971 *<br />
Die moderne Flurbere<strong>in</strong>igung, 10 Beispiele (Faltblätter)<br />
12/1972 *<br />
Prämierung von Flurbere<strong>in</strong>igungen 1971: Strullendorf,<br />
Krombach, Hirschlach, Michelsneukirchen<br />
13/1972 *<br />
Städtebauliche Maßnahmen im Dorf, Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
1971, Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> Verdichtungsgebieten,<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung im Vorfeld Nationalpark,<br />
Grundstücksdatenbank, Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> Nordrhe<strong>in</strong>-<br />
Westfalen, FlG-Kongress, Flurbere<strong>in</strong>igung Olang<br />
* vergriffen<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
14/1973 *<br />
<strong>Fachtagung</strong> 1972: Flurbere<strong>in</strong>igung, e<strong>in</strong>e gesellschaftspolitische<br />
Aufgabe<br />
15/1973 *<br />
Baulandumlegung durch die Flurbere<strong>in</strong>igungsbehörde<br />
16/1973 *<br />
Prämierung von Flurbere<strong>in</strong>igungen 1972: Schwe<strong>in</strong>furt-<br />
Süd, Gegenbach, Tagmersheim<br />
17/1974 *<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung im Vorfeld des Nationalparks Bayer. Wald,<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung, e<strong>in</strong>e gesellschaftspolitische Aufgabe<br />
unserer Zeit, Flurbere<strong>in</strong>igung 1972, Denkmalpflege,<br />
Almsanierung<br />
18/1974 *<br />
Wertermittlung, Landwirtschaftliche Beratung,<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung 1973, Nutzen-Kosten-Untersuchungen,<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsrecht, AVA-Jahrestagung, Er<strong>in</strong>nerungen<br />
an e<strong>in</strong> Arbeitsleben (Präs. a.D. Hermann)<br />
19/1974 *<br />
<strong>Fachtagung</strong> 1974: Flurbere<strong>in</strong>igung, Hilfe für ländliche<br />
Problemgebiete<br />
20/1975 *<br />
We<strong>in</strong>bergbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> Bayern<br />
21/1975 *<br />
Automation <strong>in</strong> der bayerischen Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
22/1975 *<br />
Prämierung von Flurbere<strong>in</strong>igungen 1973/74: Obere<br />
Altmühl, Postmünster-Rottspeicher, Pfreimd,<br />
Wildenranna/Thurnreuth, Handzell<br />
23/1975 *<br />
Wegebau im Hochgebirge, Dorferneuerung, Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
1974, Flurbere<strong>in</strong>igungsverfahren nach<br />
§ 87 FlurbG, Verbände der Teilnehmergeme<strong>in</strong>schaften,<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> Spargel- und Hopfenanbaugebieten<br />
24/1976 *<br />
Bayer. Agrarpolitik und Naturschutz, Geschichte der<br />
bayer. Flurbere<strong>in</strong>igung, Kemptener Vere<strong>in</strong>ödungen,<br />
Landentwicklung <strong>in</strong> der Krise, Flurbere<strong>in</strong>igung 1975,<br />
Großmasch<strong>in</strong>en und Grundstücksgröße, Taschenrechner<br />
HP-65<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
205
25/1976 *<br />
Forschungsvorhaben Hesselberg – Kurzfassung 1975<br />
26/1977 *<br />
Prämierung von Flurbere<strong>in</strong>igungen 1975/76:<br />
Fraunberg-Thalheim, Hausen, Pent<strong>in</strong>g, Velburg<br />
27/1977 *<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsrecht 1976/77 für Bayern<br />
28/1977 *<br />
Naturschutz und Landschaftspflege, Flurbere<strong>in</strong>igungsrecht,<br />
Bundesnaturschutzgesetz, Bundesbaugesetz,<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung 1976, Verfahren nach § 87 FlurbG,<br />
Landesentwicklungsprogramm, Besiedlung und Neuordnung<br />
im Bayer. Wald, Dorferneuerung, Waldflurbere<strong>in</strong>igung,<br />
Agrarstrukturelle Vorplanung<br />
29/1977 *<br />
Kontaktstudium Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
30/1978 *<br />
Arbeitsgeme<strong>in</strong>schaft Flurbere<strong>in</strong>igung, Flurbere<strong>in</strong>igung im<br />
Wandel, Flurbere<strong>in</strong>igung 1977, Agrarpolitik, Dorferneuerung<br />
»Unser Dorf soll schöner werden«, Denkmalpflege,<br />
Untersuchung zur Erhaltung der Kulturlandschaft<br />
31/1979 *<br />
<strong>Fachtagung</strong> 1978: Landentwicklung durch Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
32/1979 *<br />
Prämierung von Flurbere<strong>in</strong>igungen 1977/78:<br />
Hesselberg, Schwanberg, Bärnau<br />
33/1980<br />
Kontaktstudium Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
34/1980 *<br />
Dr.-Ing. E.h. für M<strong>in</strong>isterialdirektor<br />
Dr.-Ing. Wilhelm Abb<br />
35/1980 *<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung 1978, Landesflurbere<strong>in</strong>igungsverband<br />
Bayern, Flurbere<strong>in</strong>igungsverfahren aus Anlaß von Unternehmen,<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> Südtirol, Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong><br />
Mittelgebirgslagen, Nachbarrecht <strong>in</strong> der Dorferneuerung<br />
36/1980 *<br />
Unser Land erhalten und gestalten –<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> Bayern<br />
37/1981 *<br />
<strong>Fachtagung</strong> 1980: Flurbere<strong>in</strong>igung und Umweltgestaltung<br />
38/1981 *<br />
Prämierung von Flurbere<strong>in</strong>igungen 1979/80:<br />
Albertshofen, Heiligenstadt, Illertissen, S<strong>in</strong>delsdorf<br />
* vergriffen<br />
39/1981 *<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung und Geme<strong>in</strong>de, Flurbere<strong>in</strong>igung 1979,<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsstatistik, Landesverschönerung <strong>in</strong> Bayern,<br />
Denkmalpflege und Dorferneuerung, Flurnamenforschung<br />
40/1981<br />
Neue <strong>Entwicklung</strong>en <strong>in</strong> der Flurbere<strong>in</strong>igungstechnik<br />
41/1982<br />
Bayerischer Flurbere<strong>in</strong>igungsbericht 1979/80<br />
42/1982 *<br />
Gutachten Grundlagen zur Dorferneuerung – Kurzfassung<br />
43/1982 *<br />
Niederalteich – e<strong>in</strong> Beispiel verdeutlicht die Anliegen der<br />
umfassenden Dorferneuerung<br />
44/1982 *<br />
Leitfaden Dorferneuerung (LeitFDorfErn)<br />
45/1983 *<br />
Groborientierung und Landtechnische Daten –<br />
Entscheidungshilfen für die Dorferneuerungsplanung<br />
46/1983 *<br />
<strong>Fachtagung</strong> 1982: Flurbere<strong>in</strong>igung und Geme<strong>in</strong>de<br />
47/1983 *<br />
Prämierung von Flurbere<strong>in</strong>igungen 1981/82:<br />
Freystadt-Europakanal, Niederalteich-Hengersberg,<br />
Seßlach, Hahnbach-Süß<br />
48/1983 *<br />
Bayerischer Flurbere<strong>in</strong>igungsbericht 1981/82<br />
49/1983<br />
Abzug nach § 47 FlurbG<br />
50/1984 *<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> erosionsanfälligen Gebieten, Sozialgeographische<br />
Auswirkungen der Dorferneuerung, dörfliche<br />
Straßenraumplanung, Me<strong>in</strong>ung der Landbevölkerung<br />
über Flurbere<strong>in</strong>igung, Naturschutz <strong>in</strong> der Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
51/1984<br />
1550 – 1880 <strong>Ländliche</strong> Neuordnung durch Vere<strong>in</strong>ödung<br />
52/1984<br />
<strong>Fachtagung</strong> 1984: Flurbere<strong>in</strong>igung und Landwirtschaft<br />
53/1985<br />
Prämierung von Flurbere<strong>in</strong>igungen 1983/84:<br />
Hechl<strong>in</strong>gen, Ratzenhofen, Sommerhausen-Erlach,<br />
Hemmersheim<br />
54/1985<br />
Bayerischer Flurbere<strong>in</strong>igungsbericht 1983/84<br />
206 Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong>
55/1985<br />
Landesentwicklungsprogramm Bayern, Flurbere<strong>in</strong>igung,<br />
Naturschutz, Dorferneuerung, Geme<strong>in</strong>schaftliche Anlagen,<br />
Wegeunterhaltung, Wasserrückhaltung, Unternehmensflurbere<strong>in</strong>igung,<br />
Darlehenskonditionen, Flurbere<strong>in</strong>igungs<strong>in</strong>formationssystem,<br />
Geschichtliches zur Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
56/1986<br />
»Wie sie E<strong>in</strong>öd<strong>in</strong>en gemachet«<br />
Vere<strong>in</strong>ödung im Kemptener Raum – e<strong>in</strong> Beitrag zur<br />
Geschichte der ländlichen Neuordnung durch Flurbere<strong>in</strong>igung<br />
57/1986<br />
<strong>Fachtagung</strong> 1986 München<br />
»100 Jahre Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> Bayern«<br />
58/1987<br />
Prämierung von Flurbere<strong>in</strong>igungen 1985/86:<br />
Vorfeld Nationalpark-West, Bad W<strong>in</strong>dsheim,<br />
Unterschleißheim III, Wurz<br />
59/1987<br />
Bayerischer Flurbere<strong>in</strong>igungsbericht 1985/86<br />
60/1988 *<br />
Flurbere<strong>in</strong>igung <strong>in</strong> den ausgehenden 80er Jahren;<br />
Möglichkeiten und Grenzen der Flurbere<strong>in</strong>igung zum<br />
Aufbau e<strong>in</strong>es Biotopverbundsystems; Waldflurbere<strong>in</strong>igung;<br />
Dorfökologie; E<strong>in</strong>fluß der Hangneigung auf den<br />
Wert landwirtschaftlicher Grundstücke; Umweltschutz<br />
und Landschaftsgestaltung; Die Verfahrensarten des<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsgesetzes; Bürgerbeteiligung <strong>in</strong> der Dorferneuerung;<br />
Auswirkungen der Dorferneuerung auf die<br />
Ortsverbundenheit der Bewohner; Konzept für die Weiterentwicklung<br />
der Datenverarbeitung der Bayerischen<br />
Flurbere<strong>in</strong>igungsverwaltung<br />
61/1989<br />
Prämierung von Flurbere<strong>in</strong>igungen 1987/88:<br />
Obernzenn, Unternzenn–Oberaltenbernheim, Unteraltenbernheim,<br />
Schottenste<strong>in</strong>–Welsberg, Fre<strong>in</strong>hausen, Forstern<br />
62/1989<br />
<strong>Fachtagung</strong> 1988 Würzburg<br />
»Flurbere<strong>in</strong>igung – Landwirtschaft – Umwelt«<br />
63/1990<br />
Bayerischer Flurbere<strong>in</strong>igungsbericht 1987/88<br />
64/1990<br />
Ausstellung »Dorf und Landschaft«<br />
65/1990<br />
<strong>Fachtagung</strong> 1990 Passau<br />
»<strong>Ländliche</strong> Neuordnung – Dienst an Bürger und Heimat«<br />
* vergriffen<br />
Berichte zur <strong>Ländliche</strong>n <strong>Entwicklung</strong> 70/<strong>1994</strong><br />
66/1991<br />
Prämierung 1989/90:<br />
Absberg, Kammeltal-Süd, Illschwang, Nammer<strong>in</strong>g<br />
67/1991<br />
Leitl<strong>in</strong>ien und Perspektiven der Dorferneuerung <strong>in</strong> Bayern<br />
und Europa; Bilanz 10 Jahre Bayerisches Dorferneuerungsprogramm;<br />
Erster Europäischer Dorferneuerungspreis<br />
1990; Agrarpolitik und Perspektiven für den ländlichen<br />
Raum <strong>in</strong> den 90er Jahren; Bayerisches Programm<br />
<strong>Ländliche</strong> Neuordnung; Betriebswirtschaftliche Vorteile<br />
durch <strong>Ländliche</strong> Neuordnung; Kultur- und Erholungslandschaft<br />
nach der Flurbere<strong>in</strong>igung; Dissertationen:<br />
Modell zur Auswahl von Gestaltungsmaßnahmen <strong>in</strong> der<br />
Dorferneuerung; Computerunterstützte Neuverteilung;<br />
Landschaftsästhetik, Ökologie und Ökonomie <strong>in</strong> der<br />
<strong>Ländliche</strong>n Neuordnung<br />
68/1992<br />
<strong>Ländliche</strong> Neuordnung <strong>in</strong> Bayern 1989/90<br />
69/1993<br />
<strong>Fachtagung</strong> 1992 Bamberg<br />
»<strong>Ländliche</strong> Neuordnung im Zeichen der Nachbarschaft«<br />
Referate Arbeitskreis 2<br />
207