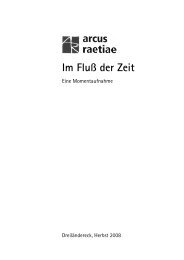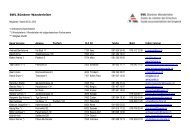Download (Deutsch) PDF 4,9 MB - Licht.de
Download (Deutsch) PDF 4,9 MB - Licht.de
Download (Deutsch) PDF 4,9 MB - Licht.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
För<strong>de</strong>rgemeinschaft Gutes <strong>Licht</strong>Gutes <strong>Licht</strong>Ausstellungen18für Museen,Galerien,Freier <strong>Download</strong> aufwww.licht.<strong>de</strong>
InhaltVisuelle Erlebnisse 1<strong>Licht</strong>wirkungen 2Exponate im <strong>Licht</strong> 6Vitrinenbeleuchtung 8WECHSELAUSSTELLUNGWechselausstellung 10Foyer, Flure, Treppen 12Audiovisuelle Medien 14Vortragsraum 15Bibliothek 16Studienraum 17Cafeteria, Museumsshop 18<strong>Licht</strong> zum Arbeiten:Büro, Werkstatt, Lagerräume 19EXPONATE IN VITRINENObjekte im Freien 20Nachtbil<strong>de</strong>r 21Tageslicht 22<strong>Licht</strong>management 24Sehen, erkennen, wahrnehmen 26<strong>Licht</strong>schutz 30Wartung 33Lampen 34EXPONATE IM RAUMLeuchten 38Normen und Literatur 42Bildnachweis 43Impressum 44Informationen von <strong>de</strong>rFör<strong>de</strong>rgemeinschaft Gutes <strong>Licht</strong> 45EXPONATE AN WÄNDENZum Titelbild: <strong>Licht</strong> schafft in je<strong>de</strong>r Ausstellungvisuelle Erlebnisse. Es wirkt alsmodulieren<strong>de</strong>r und akzentuieren<strong>de</strong>r Erlebnisfaktor,es stützt die publikumswirksamePräsentation. Ohne <strong>Licht</strong> sind Raumeindruckund Kunstgenuss nicht möglich.EINGANGSBEREICH
<strong>Licht</strong>wirkungen<strong>Licht</strong> für WegeEs gibt Ausstellungsräume,in <strong>de</strong>nen sich je<strong>de</strong>rBesucher frei in alle Richtungenbewegen kann.Häufig sollen die Besucheraus inhaltlichen o<strong>de</strong>rorganisatorischen Grün<strong>de</strong>njedoch „geleitet” wer<strong>de</strong>n.Dafür sind Leuchtensinnvoll, <strong>de</strong>ren <strong>Licht</strong> dieWegeführung ver<strong>de</strong>utlicht,ohne die angrenzen<strong>de</strong>nAusstellungsbereiche zustören. Ebenso schön wiepraktisch ist eine (zusätzliche)Orientierungsbeleuchtungam Bo<strong>de</strong>n, zum Beispielmit LED-<strong>Licht</strong>leisten.Bild 1: <strong>Licht</strong> und Schatten sowieihre Mischung formen Ambienteund Raumerlebnis.Bild 2: Diffuses <strong>Licht</strong> dient vorwiegend<strong>de</strong>r Raumbeleuchtung.1Bild 3: Objektbeleuchtung –gerichtetes <strong>Licht</strong> inszeniert dieExponate.Konzeption und Konfiguration<strong>de</strong>r Beleuchtung inAusstellungsräumen hängenvon vielen Planungsparameternab. Dazu gehörtbeson<strong>de</strong>rs die Gebäu<strong>de</strong>architektur,mit <strong>de</strong>r dieBeleuchtung harmonierensollte. Dazu gehören weiterhindie Raumproportionen,die Raumgestaltung, dieFarbgebung, das zur Verfügungstehen<strong>de</strong> Tageslichtund nicht zuletzt die Art <strong>de</strong>rAusstellung. Von grundsätzlicherBe<strong>de</strong>utung ist es,<strong>Licht</strong>schutzTageslicht und künstliches<strong>Licht</strong> enthalten Strahlungsanteile,die Ausstellungsobjektebei Dauerbeleuchtungausbleichen,austrocknen, verfärbeno<strong>de</strong>r verformen können.Davor schützen konservatorischeMaßnahmen, jedochnur, wenn sie striktangewen<strong>de</strong>t und eingehaltenwer<strong>de</strong>n. Mehr zum<strong>Licht</strong>schutz auf Seite 30.wie <strong>Licht</strong> und Schatten dasAmbiente formen.<strong>Licht</strong> für <strong>de</strong>n RaumAusstellungsräume in Museenwer<strong>de</strong>n mit diffusemund mit gerichtetem <strong>Licht</strong>beleuchtet. Die jeweiligenAnteile und die darausresultieren<strong>de</strong> Mischungbestimmen die Härte <strong>de</strong>rSchatten von Bil<strong>de</strong>rrahmen,die Plastizität von Skulpturenund räumlicher Objekte. DieMischung bei<strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>anteileist außer<strong>de</strong>m verantwortlichfür das gesamte Erscheinungsbild<strong>de</strong>s Raumes.Eng damit zusammen hängtdie Unterscheidung zwischenRaumbeleuchtungund Objektbeleuchtung.Die diffusen <strong>Licht</strong>anteile wer<strong>de</strong>nfast ausschließlich von<strong>de</strong>r Raumbeleuchtungerzeugt. Sie übernimmt dieHelligkeitsverteilung undsetzt <strong>Licht</strong>schwerpunkte in<strong>de</strong>r Fläche.Nur in seltenen Fällen kommteine Ausstellung alleine mit<strong>de</strong>r Raumbeleuchtung aus.Umgekehrt kann das auf dieBil<strong>de</strong>r gerichtete <strong>Licht</strong> einerobjektbezogenen Beleuchtungnur in wenigen – vorzugsweiserelativ kleinenund hellen Räumen – füreine ausreichend helleRaumbeleuchtung sorgen.<strong>Licht</strong> für ObjekteMit hartem, gerichteten <strong>Licht</strong>akzentuiert die Objektbeleuchtungeinzelne Exponate.Sie muss in <strong>de</strong>r Regeldurch die weichere Raumbeleuchtungergänzt wer<strong>de</strong>n;eine Objektbeleuchtungausschließlich mit Strahlernist nur unter beson<strong>de</strong>renInszenierungsaspekten sinnvoll.Außer<strong>de</strong>m gilt: Ein spannungsreichesRaumerlebnisergibt sich aus <strong>de</strong>r Mischungvon diffusem (Raumbeleuchtung)und gerichtetem (Objektbeleuchtung)<strong>Licht</strong>.Diffuses <strong>Licht</strong>Diffus streut das <strong>Licht</strong>, wennes von einer in alle Richtungenabstrahlen<strong>de</strong>n FlächeRaumteile o<strong>de</strong>r Gegenstän<strong>de</strong>beleuchtet. Am Ort <strong>de</strong>rBeleuchtung selbst, also in<strong>de</strong>m Teil <strong>de</strong>s Raumes o<strong>de</strong>ram Gegenstand, ist dieRichtung, aus <strong>de</strong>r das <strong>Licht</strong>kommt, nicht exakt auszumachen:Das <strong>Licht</strong> fließt ungerichtetin <strong>de</strong>n Raum undüber die Objekte. Kommt esaus sehr vielen Richtungen,ist die diffus abstrahlen<strong>de</strong>Fläche also groß, erzeugtdie Beleuchtung wenig biskeine Schatten.Gerichtetes <strong>Licht</strong>Gerichtetes <strong>Licht</strong> wird vornehmlichvon punktförmigen,im Verhältnis zum Beleuchtungsabstandalso kleinenLampen o<strong>de</strong>r von entsprechen<strong>de</strong>nStrahlern erzeugt.Das <strong>Licht</strong> fällt direkt auf <strong>de</strong>nzu beleuchten<strong>de</strong>n Gegenstand:Es trifft mit einemdurch die Geometrie <strong>de</strong>r Beleuchtungsanordnung<strong>de</strong>finiertenWinkel auf das Objekto<strong>de</strong>r Teile davon. Wenndie Oberfläche <strong>de</strong>s Objektsnicht eben ist, entstehen2
Abb. 2: Gerichtetes <strong>Licht</strong> für dieWand, diffuses <strong>Licht</strong> für <strong>de</strong>n Raum2Abb. 3: Zusätzliches, gerichtetes<strong>Licht</strong> für Objekte im RaumAbb. 4: Indirektes wirkt als diffuses,das direkte als gerichtetes <strong>Licht</strong>.3Abb. 5: Ausschließlich gerichtetes<strong>Licht</strong>markante Schatten. Sie unterstützendie plastische Wirkungdreidimensional ausgeführterOberflächen, könnenjedoch stören, wenn siezu dominant o<strong>de</strong>r zu großflächigsind.Diffuses/gerichtetes <strong>Licht</strong>Bei vielen Anwendungenkann die <strong>Licht</strong>wirkung nichtein<strong>de</strong>utig als ausschließlichdiffus o<strong>de</strong>r als ausschließlichgerichtet <strong>de</strong>finiertwer<strong>de</strong>n. Das ist <strong>de</strong>r Fall,wenn die <strong>Licht</strong> abstrahlen<strong>de</strong>Oberfläche we<strong>de</strong>r alsgroßflächig noch als punktförmigzu bezeichnen ist –zum Beispiel bei einemStrahler mit Streuscheibe(Diffusor). Abhängig vomDurchmesser <strong>de</strong>r Scheibeund vom Beleuchtungsabstandverläuft <strong>de</strong>r Schattenenger o<strong>de</strong>r breiter, härtero<strong>de</strong>r weicher.Diffuses/gerichtetes <strong>Licht</strong>entsteht auch, wenn eineFläche zur Erzeugung diffusen<strong>Licht</strong>s angestrahlt o<strong>de</strong>rhinterleuchtet wird, wobeiein Teil <strong>de</strong>s <strong>Licht</strong>s in eineVorzugsrichtung strahlt unddamit teilweise gerichtet ist.Auf <strong>de</strong>n beleuchteten Gegenstän<strong>de</strong>nist erkennbar,woher das <strong>Licht</strong> kommt.Das entsprechen<strong>de</strong> Schattenbildam Ausstellungsobjektist jedoch weniger markantals bei ausschließlichgerichtetem <strong>Licht</strong>. Dass <strong>de</strong>rSchatten durch <strong>de</strong>n diffusen<strong>Licht</strong>anteil zusätzlichaufgehellt wird, mil<strong>de</strong>rt seineWirkung nochmals.Ein weiteres Beispiel für diffuses/gerichtetes<strong>Licht</strong> sindlinienförmige Lampen inentsprechen<strong>de</strong>n Leuchten.Hier hängt die Schattenwirkungvon <strong>de</strong>r Position <strong>de</strong>rLeuchte zum Bild ab:Wandfluter mit stabförmigenLeuchtstofflampen, diehorizontal und parallel zuroberen Wandkante angebrachtsind, erzeugen anhorizontalen Bil<strong>de</strong>rrahmenharte Schatten, während dieSchatten <strong>de</strong>r vertikalenRahmenteile kaum erkennbarsind.Schlagschattenvermei<strong>de</strong>nGerichtetes <strong>Licht</strong> erzeugtKörperschatten. Wenndieser als Schlagschattenauf benachbarte Objektefällt, stören seine harteKontur und die nicht unmittelbarnachzuvollziehen<strong>de</strong>Herkunft diesesSchattens. Schlagschattenwer<strong>de</strong>n vermie<strong>de</strong>n durcheine entsprechen<strong>de</strong> Mischungaus diffusem undgerichtetem <strong>Licht</strong>, die richtigeräumliche Anordnung<strong>de</strong>r Beleuchtungsquelle,die gerichtetes <strong>Licht</strong> erzeugt,o<strong>de</strong>r die entsprechen<strong>de</strong>Anordnung <strong>de</strong>r angestrahltenObjekte zueinan<strong>de</strong>r.3
<strong>Licht</strong>wirkungen5Bild 4: <strong>Licht</strong><strong>de</strong>cken eignen sichinsbeson<strong>de</strong>re für Gemäl<strong>de</strong>galerien.Die Voutenbeleuchtunghellt die Deckenkanten zusätzlichauf.Bild 5: Indirektes <strong>Licht</strong> wirktähnlich wie eine <strong>Licht</strong><strong>de</strong>cke.4Die wichtigsten Beleuchtungssysteme,die in Ausstellungsräumeneingesetztwer<strong>de</strong>n, sind: <strong>Licht</strong><strong>de</strong>cken mit opalerVerglasung (diffuses <strong>Licht</strong>)o<strong>de</strong>r satiniertem Glas undStrukturglas (diffus/gerichtet), Indirektleuchten (diffus), Voutenleuchten (diffus), Wandfluter (gerichtet o<strong>de</strong>rdiffus/gerichtet), Punkt-Strahler (gerichtet).<strong>Licht</strong><strong>de</strong>ckenDie Ausgangsüberlegungfür <strong>Licht</strong><strong>de</strong>cken war <strong>de</strong>rWunsch, das Tageslichtnachzuahmen. <strong>Licht</strong><strong>de</strong>ckenerzeugen insbeson<strong>de</strong>re fürGemäl<strong>de</strong>galerien geeignetes<strong>Licht</strong> – überwiegenddiffus bei opaler Ab<strong>de</strong>ckung,mit geringen gerichtetenAnteilen bei <strong>de</strong>n Ab<strong>de</strong>ckungensatiniertes Glas o<strong>de</strong>rStrukturglas. Die in je<strong>de</strong>r<strong>Licht</strong><strong>de</strong>cke entstehen<strong>de</strong>Wärme muss abgeleiteto<strong>de</strong>r abgesaugt wer<strong>de</strong>n.Vorzugsweise wer<strong>de</strong>n stabförmigeLeuchtstofflampeneingesetzt, angeordnet entsprechend<strong>de</strong>m Profilraster<strong>de</strong>r <strong>Licht</strong><strong>de</strong>cke. Für einegute Gleichmäßigkeit sollteihr Abstand untereinan<strong>de</strong>rnicht größer sein als <strong>de</strong>r Abstandzum Abschluss <strong>de</strong>r<strong>Licht</strong><strong>de</strong>cke. Die Größe einer<strong>Licht</strong><strong>de</strong>cke, ihre Teilung sowiedie Übergänge zwischenDecke und Wän<strong>de</strong>nmüssen auf die Raumproportionenund die Art <strong>de</strong>rausgestellten Objekte abgestimmtwer<strong>de</strong>n.<strong>Licht</strong><strong>de</strong>cken, die Tageslichtnachahmen, brauchen eineentsprechend hohe Leuchtdichtevon 500 bis1.000 cd/m 2 ,für ganz hohe Räume bis2.000 cd/m 2 . <strong>Licht</strong><strong>de</strong>ckeneignen sich vor allem fürRäume mit min<strong>de</strong>stens 6 MeterHöhe. Bei geringerenRaumhöhen kann das <strong>Licht</strong>blen<strong>de</strong>n, weil die <strong>Licht</strong><strong>de</strong>ckeeinen großen Teil <strong>de</strong>s Gesichtsfel<strong>de</strong>seinnimmt. Wirddas <strong>Licht</strong> aus konservatorischenGrün<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r, um dieBlendung zu reduzieren, ge-4
dimmt, verliert die <strong>Licht</strong><strong>de</strong>ckeihre Tageslichtqualität,sie wirkt grau und erdrückend.<strong>Licht</strong><strong>de</strong>cken – auchsolche mit Tageslicht – muss<strong>de</strong>r Fachmann planen.IndirektleuchtenÄhnlich wie eine <strong>Licht</strong><strong>de</strong>ckewirkt indirektes <strong>Licht</strong>, dasvon <strong>de</strong>r Decke und <strong>de</strong>moberen Teil <strong>de</strong>r Wandflächenin <strong>de</strong>n Raum reflektiert. Diesesdiffuse und gleichmäßige<strong>Licht</strong> wird vorwiegend inRäumen ohne Tageslichteinfalleingesetzt. Es stammtmeist von abgepen<strong>de</strong>ltenLeuchten, die nach oben abstrahlen.In Ausstellungsräumenbieten sich zum BeispielLeuchten für abgepen<strong>de</strong>lteStromschienensysteme an:Sie wer<strong>de</strong>n von oben in dieSchiene eingesetzt, währendStrahler für gerichtetes <strong>Licht</strong>ihren Platz in <strong>de</strong>r unterenFührung fin<strong>de</strong>n.VoutenleuchtenEbenfalls als Indirektbeleuchtungwirkt das diffuse<strong>Licht</strong> von Leuchten, die imgewölbten Übergang zwischenWand und Decke –<strong>de</strong>r Voute – installiert sind.In mo<strong>de</strong>rnen Museumsbautenwer<strong>de</strong>n meist Voutenleuchteneingesetzt, <strong>de</strong>renLeuchtenkörper selbst dieVoute bil<strong>de</strong>t.Die vorwiegen<strong>de</strong> <strong>Licht</strong>richtung<strong>de</strong>r Voutenbeleuchtungist etwas flacher als bei einer<strong>Licht</strong><strong>de</strong>cke und entspricht inetwa <strong>de</strong>r umlaufen<strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>bän<strong>de</strong>r.Das <strong>Licht</strong> ist weitgehendschattenfrei. Eingesetztwer<strong>de</strong>n linienförmige Lampen,meist stabförmigeLeuchtstofflampen.Zu hohe Leuchtdichten imDecken- und <strong>de</strong>ckennahenWandbereich erzeugenBlendung und stören dasRaumerlebnis. Dies kannpassieren, wenn in Voutenauf lichtlenken<strong>de</strong> Maßnahmenverzichtet wird – zumBeispiel, weil in vorhan<strong>de</strong>nenVouten kein Platz fürPrismen o<strong>de</strong>r Reflektoren ist.Bei einfachen, nicht überlappen<strong>de</strong>n<strong>Licht</strong>leisten kommtes im Fassungsbereich <strong>de</strong>rLampen außer<strong>de</strong>m zu sichtbarenHell-Dunkel-Übergängen,die stören.WandfluterWandfluter wer<strong>de</strong>n als Einzelleuchteno<strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>bän<strong>de</strong>reingesetzt. Deckenbündig(auch mit aus <strong>de</strong>r Decke ragen<strong>de</strong>mKickreflektor) o<strong>de</strong>r<strong>de</strong>ckennah installiert, sollensie Wän<strong>de</strong> möglichst gleichmäßigausleuchten. Reflektorenmit asymmetrischer<strong>Licht</strong>verteilung übernehmendiese Aufgabe. Wichtig isteine gute Entblendung inRichtung <strong>de</strong>s Betrachters.Vorrichtungen an <strong>de</strong>r Leuchtezur Aufnahme von Leuchtenzubehör– wie Filter o<strong>de</strong>rEntblendungsklappen – sindsinnvoll.Linienförmige Lampen zählenzu <strong>de</strong>n Favoriten fürWandfluter: Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampenin gestreckter Bauform,linienförmige Hochvolt-Halogenlampen.Das diffuse/gerichtete <strong>Licht</strong> <strong>de</strong>r damitmöglichen Bandanordnungerzeugt relativ starke Schatten,bei Bil<strong>de</strong>rrahmen vornehmlichan <strong>de</strong>r horizontalenKante.Das gerichtete <strong>Licht</strong> von Einzelleuchtenmit nicht linienförmigenLampen dagegenformt zusätzlich Schatten an<strong>de</strong>n waagerechten Kanteneines Bil<strong>de</strong>rrahmens.Punkt-StrahlerIn Reflektorlampen (eingesetztin Leuchten ohneReflektor) o<strong>de</strong>r Strahlernlenken Reflektoren das <strong>Licht</strong><strong>de</strong>r punktförmigen Lampenzum überwiegen<strong>de</strong>n Teil ineine <strong>de</strong>finierte Ausstrahlrichtung.Strahler und Downlightsmit Strahlercharakteristikkönnen als Deckeneinbau-Strahlervöllig o<strong>de</strong>rzum überwiegen<strong>de</strong>n Teil indie Decke (o<strong>de</strong>r Wand) integriertwer<strong>de</strong>n. Deckenanbau-Strahlerund -Downlightssowie Strahler fürStromschienen haben sichtbareLeuchtenkörper. Vorrichtungenan Strahlern undDownlights zur Aufnahmevon Leuchtenzubehör – wieFilter o<strong>de</strong>r Entblendungsklappen– sind sinnvoll.Zu <strong>de</strong>n punktförmigen Lampenzählen Hochvolt-Halogenlampenund Nie<strong>de</strong>rvolt-Halogenlampen mit undohne Reflektor, Glühlampenmit o<strong>de</strong>r ohne Kopfspiegelsowie Halogen-Metalldampflampen.Bild 6: Wandfluter haben eineasymmetrische <strong>Licht</strong>verteilung.Bild 7: Das gerichtete <strong>Licht</strong> vonPunkt-Strahlern erhellt vor allemdie Exponate – mit entsprechen<strong>de</strong>mAusstrahlungswinkelwie hier auch Gemäl<strong>de</strong>.6 75
Exponate im <strong>Licht</strong>Mittelgroße, große bis sehrgroße Ausstellungsobjekteund das auf sie fallen<strong>de</strong><strong>Licht</strong> entfalten ihre Wirkungnur aus <strong>de</strong>r Sichtentfernung.Darauf muss bei <strong>de</strong>r Anordnung<strong>de</strong>r Objekte geachtetwer<strong>de</strong>n.Sehen ohne StörungenDamit alle Ausstellungsobjektegut zur Geltungkommen, dürfen we<strong>de</strong>r dieRaum- noch die ObjektbeleuchtungStörungen <strong>de</strong>rSehaufgabe erzeugen: Es sollten keine expressivenSchatten o<strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>musterauf Wän<strong>de</strong>n o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>r Decke entstehen. FürAusstellungswän<strong>de</strong> müssen<strong>de</strong>rartige Störungen unbedingtausgeschlossen wer<strong>de</strong>n. Reflexe und ungewollteSchatten auf Bil<strong>de</strong>rn undObjekten sollten vermie<strong>de</strong>nwer<strong>de</strong>n. Davor schützt beidirekter Anstrahlung eineLeuchtenposition, die zumAusstellungsobjekt einenAbstand von zirka einemDrittel <strong>de</strong>r Wandhöhe hält. Auf benachbarte Objektesollten keine Schlagschattenfallen. Ein größerer Abstand vonWandflutern zur Wand be<strong>de</strong>utetbessere Gleichmäßigkeit,birgt aber die Gefahrvon Direktblendung. DerKompromiss zwischen gleichmäßigerAusleuchtung undSehkomfort: Der Winkel zwischenWand und Leuchte,bezogen auf die untereKante <strong>de</strong>r Präsentationsfläche,sollte 25 bis 30 Gradbetragen (siehe Abb. 6 + 7).Reflexionsgra<strong>de</strong> im RaumFarbe, Muster und Reflexionsgra<strong>de</strong><strong>de</strong>r Raumbegrenzungsflächenbeeinflussendie Wirkung <strong>de</strong>r Ausstellungsstückeund die Raumstimmung.Wie hell o<strong>de</strong>rdunkel Wän<strong>de</strong> und Deckegehalten wer<strong>de</strong>n können,wie hoch also ihr Reflexionsgradsein soll, hängt wesentlichab von <strong>de</strong>r gestalterischenAbsicht. Eine allgemeingültigeEmpfehlung istnicht möglich.Wie wirkt welches <strong>Licht</strong>?„Exponate im <strong>Licht</strong>“ heißt(fast) immer „Exponate ingerichtetem <strong>Licht</strong>“. Was dieÄn<strong>de</strong>rung von <strong>Licht</strong>richtungund Ausstrahlungswinkelbewirkt, wie Objekte mito<strong>de</strong>r ohne Umfeldhelligkeitaussehen, was Leuchtenzubehörkann, zeigen dieBildbeispiele auf Seite 7:das Portrait und die nichtgegenständliche Darstellungfür Bil<strong>de</strong>r, <strong>de</strong>r Kopf einerantiken Statue und dierote Vase für dreidimensionaleplastische Objekte.BildkantenBlicklinieCyB1,65 mAx30°70°kleinsterBeobachtungsabstand1 m1,6 m30° optische Achse60° Flutlichtwinkel30° Spot-ÖffnungswinkelgrößterBeobachtungsabstandWas für diese relativ kleinenAusstellungsstücke gilt,ist vom Prinzip her übertragbarauf große Bil<strong>de</strong>rund Objekte. Allerdingswird für diese mehr <strong>Licht</strong>benötigt: Für die Objektbeleuchtungmüssen Lampenhöherer Leistung o<strong>de</strong>rmehrere Strahler eingesetztwer<strong>de</strong>n. Ganz große Objekte,etwa ein Auto o<strong>de</strong>r einFlugzeug, können auch vonmehreren Positionen ausangestrahlt wer<strong>de</strong>n. So wirkensie aus mehrerenSichtrichtungen akzentuiert.100° kritischeBeobachtungszonefür vertikaleBeleuchtungBesucherbereichyxBlicklinieBild 8: Für Großobjekte wer<strong>de</strong>nLampen höherer Leistung o<strong>de</strong>rmehrere Strahler eingesetzt.Schwarz auf weißText-Informationen zumExponat machen nur Sinn,wenn sie lesbar sind. Dasist bei ausreichend großer,schwarzer Schrift aufweißem Grund immer <strong>de</strong>rFall. Wer<strong>de</strong>n an<strong>de</strong>re Beschriftungengewünscht,sollten diese vorher auf Lesbarkeitgetestet wer<strong>de</strong>n.Wichtig: Auch Spiegelungenerschweren die Lesbarkeit.30°1,65 m4,00(y = 2,35)3,30(y = 1,65)2,70(y = 1,05)x = y · tan 30°Raumhöhex = AbstandSpot/Wand2,7 m 0,60 m3,3 m 0,95 m4,0 m 1,35 mAbb. 6 + 7: Berechnung <strong>de</strong>r optimalen Leuchtenposition für Bil<strong>de</strong>r an <strong>de</strong>r Wand – Raumhöhe, Beobachtungszone,Bildgröße und optimaler Blickwinkel (linke Abb.) sind maßgeblich für die optimaleLeuchtenposition <strong>de</strong>r Wandbeleuchtung. Die obere Kante <strong>de</strong>s Bil<strong>de</strong>s entschei<strong>de</strong>t über <strong>de</strong>n Öffnungswinkel<strong>de</strong>s Strahlers (B: 30°, C: 60°) bei gleichem Neigungswinkel von 30°. Flachere Einstellungen als30° können zu Reflexen am oberen Bildrand führen (kritische Betrachtungszone).Die mathematische Formel zur Berechnung <strong>de</strong>s Abstan<strong>de</strong>s „x“ zwischen Spot und Wand für dieBeleuchtung eines Bil<strong>de</strong>s mit Höhe „y“ lautet: x = y • tan 30° (rechte Abb.).86
Spot mit 15° Ausstrahlungswinkelund Umfeldhelligkeit9 10 11 12Spot mit 15° Ausstrahlungswinkelund diffuser UmfeldhelligkeitKonturenstrahler ohne UmfeldbeleuchtungDiffuse UmfeldhelligkeitSpot mit 15° Ausstrahlungswinkelund Weichzeichner13 14 15 16Spot mit 45° Ausstrahlungswinkelund OvalzeichnerWandfluter mit symmetrischer<strong>Licht</strong>verteilung bestückt mitR7s-Halogenlampen (230 V)Wandfluter mit asymmetrischer<strong>Licht</strong>verteilung bestückt mitR7s-Halogenlampen (230 V)17181920Spot mit 15° Ausstrahlungswinkel,<strong>Licht</strong> von vorne oben mittigSpot mit 15° Ausstrahlungswinkel,<strong>Licht</strong> von vorne oben linksSpot mit 15° Ausstrahlungswinkel,<strong>Licht</strong> von vorne unten linksSeitenlicht von rechts21 22 23 24<strong>Licht</strong> von vorne <strong>Licht</strong> von hinten <strong>Licht</strong> von rechts <strong>Licht</strong> von oben7
VitrinenbeleuchtungAbb. 8 + 9:Gerichtetes<strong>Licht</strong> (links)inszeniert dieExponate,flächiges <strong>Licht</strong>(rechts) sorgtfür gleichmäßigeAusleuchtung.Vitrinen sind Ausstellungsräumeim Kleinen. Entsprechendwer<strong>de</strong>n die Exponatebeleuchtet: mit diffusemo<strong>de</strong>r gerichtetem <strong>Licht</strong>.Ausleuchtung und Akzentuierungkönnen in <strong>de</strong>n verglastenSchaukästen in einigenFällen auch miteinan<strong>de</strong>rgemischt wer<strong>de</strong>n.Welches <strong>Licht</strong> wofür?Die Art <strong>de</strong>r Beleuchtunghängt wesentlich ab von<strong>de</strong>n Eigenschaften <strong>de</strong>r Ausstellungsstücke:von plastischerForm, Struktur, Glanzund Transparenz <strong>de</strong>r Oberflächeno<strong>de</strong>r <strong>de</strong>r Farbigkeit.Die meisten Objekte ausMetall, zum Beispiel gol<strong>de</strong>neo<strong>de</strong>r silberne Gefäße,gewinnen durch Glanz Reizund ästhetische Wirkung.Dieser Glanz entsteht bei<strong>de</strong>r Anstrahlung mit punktförmigen<strong>Licht</strong>quellen. Beidiffusem <strong>Licht</strong> erscheinendie Gefäße matt und leblos.25 26Durchsichtige o<strong>de</strong>r durchscheinen<strong>de</strong>Objekte, zumBeispiel aus Glas, wirkenakzentuierter mit Schattenund weniger durch Glanz.Bei ihnen spielt außer<strong>de</strong>mdie Oberflächenstruktur –geschliffen, geätzt o<strong>de</strong>r bemalt– eine wichtige Rolle.Je nach Objekt kann diffuseo<strong>de</strong>r gerichtete Beleuchtung(Durchleuchtung) o<strong>de</strong>reine Kombination darausrichtig sein. Bei gerichtetem<strong>Licht</strong> entschei<strong>de</strong>t die <strong>Licht</strong>einfallsrichtungüber dieWirkung. Diffuses <strong>Licht</strong> eignetsich für farbige o<strong>de</strong>rdurchscheinen<strong>de</strong> Materialienwie Glasfenster.Integriertes <strong>Licht</strong>Kleine flache (verglaste Tische)o<strong>de</strong>r kastenförmigeund hohe Vitrinen habenüberwiegend eine integrierteBeleuchtung. Diese hatVorteile: Auf <strong>de</strong>m Vitrinenglas entstehenweniger bis gar keineReflexe. Direktblendung <strong>de</strong>s Betrachtersdurch helle unabgeschirmte<strong>Licht</strong>quellen istleichter vermeidbar. <strong>Licht</strong>effekte zur wirkungsvollenInszenierung sin<strong>de</strong>infacher möglich.Bei kleinen Vitrinen überwiegtdie Beleuchtung <strong>de</strong>rExponate von <strong>de</strong>r Seite. Inhohen Vitrinen ist die Beleuchtungvon <strong>de</strong>r Vitrinen<strong>de</strong>ckemöglich. Außer<strong>de</strong>mkönnen Objekte vom Vitrinensockelaus von unten in<strong>Licht</strong> getaucht wer<strong>de</strong>n.Eine eigenständige Umgebungsbeleuchtungzusätzlichzum in die Vitrine integrierten<strong>Licht</strong> ist meist unverzichtbar.Je nach gewünschterAtmosphäre undkonservatorisch erlaubterBeleuchtungsstärke hat dieBild 25: Das Vitrinenlicht vonoben taucht die Rüstungen ineinen facettenreichen Glanz.Bild 26: <strong>Licht</strong>schutz mit LEDs –die Leuchtdio<strong>de</strong>n strahlenwe<strong>de</strong>r ultraviolettes <strong>Licht</strong> nochWärme ab.Raumbeleuchtung ein Niveauknapp unterhalb <strong>de</strong>rVitrinenbeleuchtung o<strong>de</strong>rnoch darunter. Eine ausschließlichdurch das Streulichtaus <strong>de</strong>n Vitrinen erzeugteund damit nicht eigenständigeOrientierungsbeleuchtungsollte nicht zudunkel sein.<strong>Licht</strong>schutzAuch für die Vitrinenbeleuchtungist <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>schutz(siehe Seite 30) wichtig –nicht zuletzt <strong>de</strong>shalb, weildie Lampen <strong>de</strong>n Objektenin Vitrinen häufig näher sindals in Ausstellungsräumen.Außer<strong>de</strong>m muss beachtetwer<strong>de</strong>n, dass in <strong>de</strong>m abgeschlossenenRaum „Vitrine“ein Mikroklima entsteht.Bei <strong>de</strong>r Beleuchtung gibt esAlternativen zu <strong>de</strong>n frühereingesetzten Lampen: LEDs,in <strong>de</strong>ren <strong>Licht</strong>bün<strong>de</strong>l we<strong>de</strong>rUV-Strahlung noch Wärme(IR-Strahlung) vorkommt,o<strong>de</strong>r faseroptische Beleuch-8
tungssysteme mit sehr geringerUV-Strahlung undwenig Wärme. Bei<strong>de</strong> eignensich aufgrund ihrerGröße übrigens auch fürdie Beleuchtung ganz kleinerVitrinen.Bei Leuchtstofflampen,Kompaktleuchtstofflampeno<strong>de</strong>r Hochvolt- und Nie<strong>de</strong>rvolt-HalogenlampeninVitrinen greifen dieselbenSchutzmaßnahmen wie imgroßen Ausstellungsraum.Vitrinen mit horizontalenund vertikalen Glasflächeneine wichtige Rolle. Ein wirksamerSchutz vor Reflexenist entspiegeltes Glas.Reflexe auf horizontalenGlasflächen treten seltenerauf, wenn das Glas zumBetrachter hin geneigt ist.Sie sind umso sichtbarer, jestärker <strong>de</strong>r Kontrast zwischenReflex und Umfeld,je dunkler also die Vitrine27 28ist. Heller gestaltete undinnen beleuchtete Vitrinensind <strong>de</strong>shalb wenigergefähr<strong>de</strong>t.Außer<strong>de</strong>m können vonFenstern (Tageslicht) erzeugteReflexe auftreten.Die entsprechen<strong>de</strong> Anordnung<strong>de</strong>r Vitrinen o<strong>de</strong>r dieAbschirmung <strong>de</strong>s Tageslichtszum Beispiel mit Vertikallamellenbeugt dieserReflexblendung vor.Bild 27: Die Texte in <strong>de</strong>n Vitrinenwän<strong>de</strong>nsind von oben bis untengleichmäßig ausgeleuchtet.Bild 28: Reflexfreies <strong>Licht</strong> vonaußen beleuchtet und inszeniertdie Bücher in <strong>de</strong>n Vitrinen.Bild 29: <strong>Licht</strong> von <strong>de</strong>r Decke istweitgehend reflexfrei, wenndie Leuchten vitrinenbezogenangeordnet wer<strong>de</strong>n.<strong>Licht</strong> von außenBei <strong>de</strong>r Vitrinenbeleuchtungvon außen wird für dieRaum- und Objektbeleuchtungüberwiegend <strong>Licht</strong> von<strong>de</strong>r Decke eingesetzt. DieseArt <strong>de</strong>r Beleuchtung eignetsich vor allem für Ganzglasvitrinenund flache, vonoben betrachtete verglasteTische. Tageslicht und objektorientierteRaumbeleuchtungmüssen in <strong>de</strong>rRegel mit akzentuieren<strong>de</strong>rObjektbeleuchtung ergänztwer<strong>de</strong>n. Wenn sich dieLeuchtenanordnung auf dieVitrinen bezieht, kommt eskaum zu Reflexblendung.Reflexe begrenzenDie Begrenzung <strong>de</strong>r Reflexblendungspielt bei allenArten <strong>de</strong>r Beleuchtung von299
WechselausstellungAusstellungsobjekte, dienicht ständig zugänglichsind o<strong>de</strong>r die auf Reisengehen, präsentieren sich in<strong>de</strong>n Räumen für Wechselausstellungen.Je<strong>de</strong>r Wechselerhöht die Attraktivität,lockt neue Besucher auchin die Dauerausstellung.Für die Beleuchtungsanlagebe<strong>de</strong>utet <strong>de</strong>r regelmäßigeAustausch <strong>de</strong>r Exponate:Sie muss sich anpassen lassen.Gefragt ist also in hohemMaße flexibles <strong>Licht</strong>. Dabeiist jedoch zu be<strong>de</strong>nken:Absolute Flexibilität, mit <strong>de</strong>rdie Beleuchtung wie bei einerDauerausstellung <strong>de</strong>tailliertauf je<strong>de</strong> Konzeption <strong>de</strong>rPräsentation ausgerichtetwer<strong>de</strong>n kann, gibt es nicht.Flexibles <strong>Licht</strong>Weitgehend unabhängigvom Standort <strong>de</strong>r Ausstellungsobjekteist die Allgemeinbeleuchtung,das diffuse<strong>Licht</strong>. Wie flexibel Beleuchtungsanlagenseinkönnen, muss das gerichtete<strong>Licht</strong> beweisen. Hierzu eignensich vor allem Stromschienensysteme,in die anje<strong>de</strong>r Stelle schwenk- unddrehbare Strahler eingeklicktwer<strong>de</strong>n können. Ein Teil <strong>de</strong>reingesetzten Stromschienensollte entlang <strong>de</strong>r Wän<strong>de</strong>installiert wer<strong>de</strong>n, um einegalerieartige Wandbeleuchtungzu ermöglichen. Imweiteren Raum schaffen inRechtecken o<strong>de</strong>r Quadratenangeordnete Stromschienenmehr Flexibilität als die Anordnungin nur einer Richtung.Als Alternative zu Stromschienenbieten sich fest installierteStrahler in kardanischerAufhängung an. Sielassen sich ebenfalls freiausrichten, für Bewegungund Fokussierung könnenStellmotoren eingesetztwer<strong>de</strong>n. Kardanisch verstellbareStrahler sind zwarnicht ganz so flexibel wieStrahler an Stromschienen,doch ermöglichen sie einDeckenbild, das wesentlichruhiger wirkt als mit Stromschienen.Leuchten neu ausrichtenZur Flexibilität <strong>de</strong>r Beleuchtunggehört, dass dieLeuchten für je<strong>de</strong> neueWechselausstellung neuausgerichtet wer<strong>de</strong>n müssen,gegebenenfalls durchExperimentieren und dasUmstellen von Ausstellungsstücken.Die Hilfsmittel Leitero<strong>de</strong>r Steiger sind unverzichtbar.Für schwer zugänglicheStellen sind fernsteuerbareinzustellen<strong>de</strong>Strahler die richtige Lösung.Tageslicht beachtenFin<strong>de</strong>n Wechselausstellungenin Tageslichträumenstatt, müssen außer<strong>de</strong>m <strong>de</strong>rTageslichteinfall und diePosition zum Beispiel vonVitrinen zu Fenstern (sieheSeite 9) berücksichtigt wer<strong>de</strong>n.Damit entsprechendkonzipierte Ausstellungengezeigt wer<strong>de</strong>n können,sollten sich Tageslichträumeam besten komplett verdunkelnlassen. Über Tageslichtinformieren die Seiten22/23. Die Verdunklungkann auch eine Maßnahme<strong>de</strong>s <strong>Licht</strong>schutzes sein;über die Anfor<strong>de</strong>rungen,die natürlich auch Exponatevon Wechselausstellungenan <strong>de</strong>n <strong>Licht</strong>schutz stellen,informieren die Seiten 30bis 33.Mobile StrahlerWer<strong>de</strong>n zur Präsentationmobile Stellwän<strong>de</strong> eingesetzt,sind für diese mitKlemmen o<strong>de</strong>r Schraubvorrichtungenan <strong>de</strong>r Stellwandzu befestigen<strong>de</strong> mobileStrahler eine Alternativezu Strahlern an Stromschienen.Damit die Kabel zurStromversorgung <strong>de</strong>r mobilenStrahler keine Stolperfallenbil<strong>de</strong>n, sollten in Räumenfür WechselausstellungenFußbo<strong>de</strong>nsteckdoseninstalliert sein.Bild 30: Das <strong>Licht</strong> <strong>de</strong>r kardanischverstellbaren Strahler istfokussierbar.3010
Bild 32: In die Decke integrierteStromschienen ermöglichen<strong>de</strong>n flexiblen Einsatz von Strahlern.Bild 33: Bei Bedarf hoheBeleuchtungsstärken – je<strong>de</strong><strong>de</strong>r Leuchten hat vier kardanischverstellbare Strahler.Bild 31: In die Tragschienen-Konstruktion <strong>de</strong>r Decke sindStromschienen integriert zurAufnahme <strong>de</strong>r Strahler für dieObjektbeleuchtung.31Bild 34: Für je<strong>de</strong> neue Wechselausstellungmüssen die Strahlerneu ausgerichtet wer<strong>de</strong>n.3233 3411
Foyer, Flure, TreppenDer Eingangsbereich ist dieVisitenkarte <strong>de</strong>s Hauses. Erprägt <strong>de</strong>n ersten Eindruck,seine Gestaltung kannSchwellenangst abbauen.Eine harmonische <strong>Licht</strong>atmosphärebil<strong>de</strong>t <strong>de</strong>n Rahmenfür <strong>de</strong>n freundlichenEmpfang. Je<strong>de</strong>s Foyer hataußer<strong>de</strong>m die funktionaleAufgabe, ins Innere <strong>de</strong>sGebäu<strong>de</strong>s zu führen.Harmonisches <strong>Licht</strong>Die Beleuchtung erfüllt dieseAnfor<strong>de</strong>rungen im Zusammenspielvon direktemund indirektem <strong>Licht</strong> – mitkombinierten Beleuchtungssystemen,die ganzheitlichwirken sollten: Diegleichmäßige Allgemeinbeleuchtungvermittelt Sicherheitund erleichtert die Orientierung,<strong>Licht</strong>akzente anDecke und Wän<strong>de</strong>n lockerndas Bild auf. Direkt o<strong>de</strong>rdirekt/indirekt strahlen<strong>de</strong>Leuchten mit wirtschaftlichenLeuchtstoff- o<strong>de</strong>rKompaktleuchtstofflampendominieren die Allgemeinbeleuchtung,Wandleuchtenmit indirektem <strong>Licht</strong> sindTeil <strong>de</strong>r Akzentbeleuchtung.Im Bereich <strong>de</strong>r Eingangstürwechseln Passanten vomhellen Tageslicht in dasdunklere Gebäu<strong>de</strong> o<strong>de</strong>raus nächtlicher Dunkelheitin das hell beleuchteteHaus. Damit sich die Augenauf die jeweils an<strong>de</strong>re Helligkeiteinstellen können,sind Adaptationsstreckenempfehlenswert: Tagsübermuss <strong>de</strong>r unmittelbare Eingangsbereichbeson<strong>de</strong>rshell beleuchtet sein, nachtssollte die Beleuchtungsstärkeim Gebäu<strong>de</strong> in RichtungAusgang abnehmen.Ihre Visitenkarten-Wirkungmacht Foyers interessantfür architektonische Beson<strong>de</strong>rheiten.Beleuchtung und<strong>Licht</strong>wirkung sollten dieseunterstreichen. Bei hohenDecken beispielsweise sindlichtstarke Strahler mitHochdruck-Entladungslampenempfehlenswert; alsPen<strong>de</strong>lleuchten mit direkt/indirekter <strong>Licht</strong>verteilungbetonen sie die Höhe <strong>de</strong>sRaumes. Stuck<strong>de</strong>cken,Säulen o<strong>de</strong>r Emporen könnensehr gut mit akzentuieren<strong>de</strong>m<strong>Licht</strong> betont wer<strong>de</strong>n.Wegweisen<strong>de</strong>s <strong>Licht</strong>Gänge, Treppen, Aufzügeverbin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n Eingangsbereichmit <strong>de</strong>m Inneren<strong>de</strong>s Hauses. Diese Wegeund Bereiche wirken abschreckend,wenn sie wesentlichdunkler als dasFoyer erscheinen. Um diesenTunneleffekt zu vermei<strong>de</strong>n,sollten entwe<strong>de</strong>rdieselben Beleuchtungsstärkenrealisiert o<strong>de</strong>r dieHelligkeit nur ganz <strong>de</strong>zentabgestuft wer<strong>de</strong>n. DIN EN12464-1 sieht für die VerkehrsflächeFlur min<strong>de</strong>stens100 Lux Beleuchtungsstärkevor.Ein Wegeleitsystem gibt<strong>de</strong>n Besuchern zusätzlicheund leicht nachvollziehbareOrientierungshilfe. Zu einerklaren Linienführung gehörenhelle Informationsflächeno<strong>de</strong>r hinterleuchteteSchil<strong>de</strong>r, die ein<strong>de</strong>utig Auskunftgeben.Sicheres <strong>Licht</strong>Die Stolpergefahr bei einzelnenStufen und auf Treppenverringert sich, wennsie gut beleuchtet sind. DieBeleuchtungsstärke solltemin<strong>de</strong>stens 150 Lux betragen(DIN EN 12464-1). Daes gewöhnlich gefährlicherist, die Treppe hinunter zufallen als sie hinauf zu stolpern,muss die Beleuchtungdie Stufen beson<strong>de</strong>rsvon oben her erkennbarmachen. Außer<strong>de</strong>m sorgt<strong>Licht</strong>, das vom oberenTreppenabsatz nach untenfällt, für kurze weicheSchatten. So setzen sichdie Trittstufen <strong>de</strong>utlich voneinan<strong>de</strong>rab, je<strong>de</strong> einzelneist gut zu erkennen.Bo<strong>de</strong>nnahes Orientierungslichtschafft zusätzliche Trittsicherheit.Hierfür eignensich Wandleuchten, dietreppenbegleitend installiertdirektes <strong>Licht</strong> auf die Trittstufenlenken. Eine neueAlternative sind LED-Beleuchtungssysteme,zumBeispiel in die Trittkanteeingelassene LEDs. DieLeuchtdio<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n auchzur Beleuchtung von Handläufeneingesetzt.35Bild 35: Verteilerfunktion –Foyer und Flure verbin<strong>de</strong>n auchoptisch in das Innere <strong>de</strong>sHauses.12
Bil<strong>de</strong>r 36 und 37: Der Eingangsbereichprägt <strong>de</strong>n ersten Eindruck.Harmonisches <strong>Licht</strong> sorgtfür einen freundlichen Empfang.36Bil<strong>de</strong>r 39 und 40: <strong>Licht</strong> in Flurenbegleitet die Besucher undmacht ihren Weg sicher. DieBeleuchtungsstärke: min<strong>de</strong>stens100 Lux.3739Bild 38: <strong>Licht</strong> in <strong>de</strong>n Handläufen– LEDs machen es möglich.384013
Audiovisuelle MedienVi<strong>de</strong>oinstallationen o<strong>de</strong>rPräsentationen an Bildschirmen,auf Großbildschirmo<strong>de</strong>r auf Großleinwandkönnen Teil einerAusstellung sein. Auch „nurTon“, also das Abspielenvon Stimmen, Tönen o<strong>de</strong>rMusik, gehört zu <strong>de</strong>m Thema„audiovisuelle Medien“.Reflexblendung störtDie Beleuchtung muss auf<strong>de</strong>n Medieneinsatz abgestimmtwer<strong>de</strong>n. Weil Reflexblendungauf Bildschirmenerheblich stört, solltein <strong>de</strong>ren Umgebung aufstark gerichtetes <strong>Licht</strong> verzichtetwer<strong>de</strong>n. DenselbenBlen<strong>de</strong>ffekt haben hoheLeuchtdichten aus benachbartenAusstellungsbereichen;auch dieses Streulichtsollte begrenzt wer<strong>de</strong>n.Für die Präsentation mit audiovisuellenMedien darf esin <strong>de</strong>r Regel nicht zu hellsein: we<strong>de</strong>r für das Sehen,noch für das Wahrnehmenvon Geräuschen, wenn sichdie Besucher darauf konzentrierensollen. Bei interaktivenVorführungen ist es<strong>de</strong>nnoch wichtig, dass sieBedienelemente wie zumBeispiel Tasten und <strong>de</strong>renBeschriftung gut erkennen.Die Beleuchtungsstärke <strong>de</strong>szusätzlich dafür eingesetzten<strong>Licht</strong>s und seine Abstrahlungin Richtung Bildschirm(Reflexblendung)und Bediener (Direktblendung)müssen jedoch insoweitbegrenzt sein, dass siedie Wahrnehmung <strong>de</strong>r Präsentationnicht stören.Computer-RaumSind die Computer undBildschirme nicht integriert,son<strong>de</strong>rn <strong>de</strong>r Ausstellung ineinem separaten Raum mitmehreren Computer-Plätzenangeglie<strong>de</strong>rt, ist essinnvoll, diese Räume wieBüros zu beleuchten (sieheSeite 19). Bei eng begrenzterVerweildauer – zum Beispielbei vorgegebener maximalerNutzungsdauer –darf hier auch das Beleuchtungskonzept<strong>de</strong>rAusstellung fortgeführt wer<strong>de</strong>n,zum Beispiel mit einemdunkleren Beleuchtungsniveau.In je<strong>de</strong>m Fallaber müssen Direkt- undReflexblendung ausgeschlossensein.Bild 41: Audiovisuelle Medienkönnen Bestandteil einer Ausstellungsein. Die Beleuchtungmuss darauf abgestimmtwer<strong>de</strong>n: Verzicht auf starkgerichtetes <strong>Licht</strong>, Anpassung<strong>de</strong>r Helligkeit an die Präsentation,ausreichend <strong>Licht</strong> für dieBedienelemente.Bild 43: Spüren, hören, sehen –Besucher erleben die Ausstellungmit allen Sinnen.Bild 42: In einem separatenComputer-Raum gelten dieRegeln für Bürobeleuchtung.41424314
VortragsraumIm Vortragsraum fin<strong>de</strong>n nahezualle Veranstaltungenstatt, einige Führungen startenund en<strong>de</strong>n hier. Entsprechendmultifunktionalsollte <strong>de</strong>r Raum eingerichtetund ausgerüstet sein. DieBeleuchtung dafür schafft situationsgerechte<strong>Licht</strong>verhältnisse,erhöht damit dieKonzentrationsfähigkeit, steigertdas Aufnahmevermögenund erleichtert dieKommunikation.Situationsgerechtes <strong>Licht</strong>Wie flexibel das <strong>Licht</strong> seinmuss, ergibt sich aus <strong>de</strong>nunterschiedlichen Veranstaltungssituationen.Voraussetzungist die Zusammenfassung<strong>de</strong>r Leuchten in voneinan<strong>de</strong>rgetrennten Schaltkreis-Gruppen.Denn dieeinzelnen Beleuchtungssituationenwie „Empfang“,„Vortrag“ o<strong>de</strong>r „Präsentation“erfor<strong>de</strong>rn verschie<strong>de</strong>ne Einstellungen:Eine Leuchten-Gruppe bleibt ausgeschaltet,eine an<strong>de</strong>re wird extra eingeschaltet,das <strong>Licht</strong> einerweiteren Gruppe gedimmt.Die <strong>Licht</strong>steuerung wird voneiner einfachen Steuerungseinheito<strong>de</strong>r – in größerenRäumen – von einem <strong>Licht</strong>management-Systemübernommen.Beim <strong>Licht</strong>managementlassen sich gespeicherte<strong>Licht</strong>szenen individuellenBedingungen anpassen,ohne die Programmierungzu verän<strong>de</strong>rn.Überblendzeiten sind zwischeneiner Sekun<strong>de</strong> undmehreren Minuten frei wählbar.Die meisten <strong>Licht</strong>management-Systemebietenals Option die Einbeziehungvon Fensterverdunklungund Sonnenschutz in dieProgrammierung.In je<strong>de</strong>m Fall ist es sinnvoll,wenn das <strong>Licht</strong> – gegebenenfallsauch vom Vortragen<strong>de</strong>n– via Fernbedienunggesteuert wer<strong>de</strong>nkann.Akzente unverzichtbarAußer funktional wirkt <strong>Licht</strong>auch gestaltend. So istAkzentbeleuchtung im repräsentativenVortragsraumunverzichtbar. Zahlreiche<strong>Licht</strong>punkte, indirekte Anteile<strong>de</strong>r Beleuchtung, auchzur Betonung <strong>de</strong>r Raumarchitektur,sowie die großflächigeo<strong>de</strong>r gerichteteAnstrahlung von Bil<strong>de</strong>rnund Wandbereichen wirkenansprechend. Für die Beleuchtungssituation„Empfang“sollten AllgemeinundAkzentbeleuchtungaufeinan<strong>de</strong>r abgestimmtprogrammiert wer<strong>de</strong>n undzusammen eingeschaltetsein.Bild 44: „Filmpräsentation“o<strong>de</strong>r „Vortrag“ sind die bei<strong>de</strong>nhäufigsten Beleuchtungssituationen.Bild 45: <strong>Licht</strong> im Vortragsraumbe<strong>de</strong>utet multifunktionaleBeleuchtung für situationsgerechte<strong>Licht</strong>verhältnisse.44Gut geeignet für die <strong>Licht</strong>steuerungim Vortragsraumist das DALI ® -System (DigitalAddressable Lighting Interface)mit seiner standardisiertendigitalen Schnittstelle.Die wichtigsten Vorteile: wenigKomponenten, geringerVerdrahtungsaufwand, einfachesBedienkonzept. Informationen:www.dali-ag.org.4515
BibliothekDie Beleuchtung <strong>de</strong>r Bibliothekhat mehrere Aufgaben:Sie schafft Übersicht, hilftbeim Auffin<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r gewünschtenLiteratur, erleichtertdas Lesen und prägteine ruhige bis leicht anregen<strong>de</strong>Atmosphäre. Planungsgrundlageist DIN EN12464-1. Generell gilt: Jeanspruchsvoller die Sehaufgabe,<strong>de</strong>sto höher die Beleuchtungsanfor<strong>de</strong>rung.Sosollten Verkehrsflächen mit100 Lux Beleuchtungsstärkeund Regale mit 200 Lux beleuchtetsein. Lesebereichebenötigen dagegen 500 Lux.Schnelle OrientierungDas <strong>Licht</strong> <strong>de</strong>r Allgemeinbeleuchtung– mit zusätzlicherKennzeichnung von Hauptwegenund <strong>de</strong>r Ausgänge –muss schnelle Orientierungermöglichen und leitet sicherdurch die Regalreihen.Direkt/indirektes <strong>Licht</strong> erzeugteine angenehm helleRaum<strong>de</strong>cke und verhin<strong>de</strong>rt<strong>de</strong>n sogenannten „Höhleneffekt“,<strong>de</strong>r leicht auch inTeilbereichen einer Bibliothekentstehen kann. Beigeringen Anteilen von direktem<strong>Licht</strong> verringern sichaußer<strong>de</strong>m stören<strong>de</strong> Spiegelungen(Reflexblendung) aufglänzen<strong>de</strong>m Papier.Buchrückens – bei<strong>de</strong> sindhäufig Suchkriterien – guterkannt wer<strong>de</strong>n.An Leseplätzen muss esheller sein. Wer<strong>de</strong>n zusätzlichzur Allgemeinbeleuch-tung Schreibtischleuchtenaufgestellt, kann je<strong>de</strong>r Besucherdas Beleuchtungsniveaunach Bedarf erhöhen.Bild 46: Übersicht schaffen,Lesen erleichtern, eine ruhigebis leicht anregen<strong>de</strong> Atmosphäreerzeugen – diese Aufgabenhat die Beleuchtungeiner Bibliothek.46Überwiegend wer<strong>de</strong>n abgepen<strong>de</strong>lteLeuchten für stabförmigeLeuchtstofflampeneingesetzt, in hohen Räumenauch Leuchten für Halogen-Metalldampflampen.Vertikale <strong>Licht</strong>anteileBücherregale und Schränkesollten in ihrer ganzenFläche gut ausgeleuchtetsein, vertikale Anteile <strong>de</strong>rBeleuchtungsstärke müssenbis hin zu <strong>de</strong>n unterenFächern reichen. Nur so lassensich die Titel auf <strong>de</strong>nBücherrücken auf angemesseneDistanz müheloslesen. Für diese Beleuchtungsaufgabesind beson<strong>de</strong>rsWandfluter mit asymmetrischer<strong>Licht</strong>verteilunggeeignet. Lampen mit guterFarbwie<strong>de</strong>rgabe (In<strong>de</strong>x R a 80) stellen sicher, dassFarbe und Gestaltung <strong>de</strong>s16Bil<strong>de</strong>r 47 und 48: Wandfluter mit asymmetrischer<strong>Licht</strong>verteilung leuchten Regale aus – von<strong>de</strong>r Decke (47) o<strong>de</strong>r als ins Regal integrierteLeuchten (48).4748
StudienraumEinige Museen bieten einenStudienraum an, <strong>de</strong>r an<strong>de</strong>rsals ein Leseplatz in <strong>de</strong>rBibliothek mehr Ruhe bietet.Außer Büchern können Stu<strong>de</strong>ntenund an<strong>de</strong>re Interessiertehier die zugänglichenDokumente aus Ausstellungund Archiv einsehen.AnspruchsvolleSehaufgabenAuch wenn <strong>de</strong>r Studienraumnicht mit Computern ausgestattetist, sollte die Beleuchtungbildschirmgerecht sein.Denn heute hat fast je<strong>de</strong>rRecherchieren<strong>de</strong> seinenLaptop dabei. Arbeiten amComputer, Lesen undSchreiben sind anspruchsvolleSehaufgaben, für dieDIN EN 12464-1 eine Beleuchtungsstärkevon min<strong>de</strong>stens500 Lux vorsieht.49Da Blendung die Sehleistungherabsetzt und <strong>de</strong>nSehkomfort min<strong>de</strong>rt, ist – wieim Büro und an je<strong>de</strong>m an<strong>de</strong>renBildschirmarbeitsplatz– darauf zu achten, dass we<strong>de</strong>rDirekt- noch Reflexblendungentstehen.Für die direkte Beleuchtungeignen sich zum Beispiel abgepen<strong>de</strong>lteLeuchten – einzelno<strong>de</strong>r als <strong>Licht</strong>bän<strong>de</strong>rverbun<strong>de</strong>n – mit hochwertigenReflektoren und Rasterno<strong>de</strong>r <strong>de</strong>rart ausgerüsteteDownlights. Alternative ist direkt/indirektes<strong>Licht</strong> aus abgepen<strong>de</strong>ltenLeuchten o<strong>de</strong>rvon speziellen Büro-Stehleuchten.Beleuchtungsniveau nacheigenem BedarfBeson<strong>de</strong>rs hohen Komfortbietet die Beleuchtungsanlage,wenn die Stehleuchtengedimmt o<strong>de</strong>r zusätzlicheLeseleuchten auf <strong>de</strong>nTischen zugeschaltet wer<strong>de</strong>nkönnen, um das Beleuchtungsniveauam Platz individuelleinzustellen. DieBestückung mit Leuchtstoffo<strong>de</strong>rKompaktleuchtstofflampenan (dimmbaren) elektronischenVorschaltgeräten(EVG) ermöglicht auch imStudienraum eine beson<strong>de</strong>rswirtschaftliche Beleuchtung.Bild 49: Als indirektes <strong>Licht</strong>gelangt Tages- o<strong>de</strong>r künstliches<strong>Licht</strong> durch die <strong>Licht</strong>schächte in<strong>de</strong>n Studienraum. Downlightsan <strong>de</strong>n Längsseiten ergänzendie Beleuchtung.Bild 50: Die Leuchten fürLeuchtstofflampen sind inStromschienen eingesetzt, nachoben o<strong>de</strong>r nach unten abstrahlend.Sie spen<strong>de</strong>n indirektesund direktes <strong>Licht</strong>.Bild 51: An diesen Tischen nehmenvor allem Schüler Platz. Fürdie Lese- und Schreibaufgabenstehen 500 Lux Beleuchtungsstärkezur Verfügung.505117
Cafeteria, Museumsshop53Bild 52: Das diffuse <strong>Licht</strong> <strong>de</strong>rAllgemeinbeleuchtung wirktunaufdringlich.Bild 53: Die vielen kleinen<strong>Licht</strong>punkte dominieren dasBild.Bild 54: Akzentuieren<strong>de</strong>s <strong>Licht</strong>mit abgestuften Helligkeitenschafft eine anregen<strong>de</strong>Verkaufs(raum)atmosphäre.52Cafeteria o<strong>de</strong>r Museumsshopsind – meist zum Abschluss<strong>de</strong>s Museumsbesuchs– beliebte Anlaufstellen.Je<strong>de</strong>r Besucher freutsich über die gastronomischePause, viele erwerbenSouvenirs als Erinnerungsstückeo<strong>de</strong>r Mitbringsel.<strong>Licht</strong> für die CafeteriaFür die Cafeteria ist einedifferenzierte Beleuchtungmit verschie<strong>de</strong>nen <strong>Licht</strong>systemenzur Strukturierung<strong>de</strong>s Raumes sinnvoll: zumBeispiel Pen<strong>de</strong>lleuchten fürTische, Wandleuchten undDownlights zur maßvollenErhöhung <strong>de</strong>s Beleuchtungsniveaus,Downlightsund Strahler für die Akzentbeleuchtung.Je nachGröße und Gestaltungsabsichtkann auch ein Beleuchtungssystemgenügen.Gastronomie-Beleuchtunghat weitgehen<strong>de</strong> Gestaltungsfreiheit,die erst aufGrenzen stößt, wenn Sehleistungund Sehkomforterheblich gestört wer<strong>de</strong>n.Das be<strong>de</strong>utet, Blendung istin je<strong>de</strong>m Fall unerwünscht.Auch starke Schatten sindschlecht, weil sie dasErkennen von Gesichternstören.Servicebereiche in <strong>de</strong>rCafeteria dürfen sich inpunkto Helligkeit im Hintergrundhalten – mit einerAusnahme: Die Essensausgabeund alle an<strong>de</strong>ren Verkaufs-und Präsentationsbereichefür Speisen und Getränkesollten nach DIN EN12464-1 mit 200 bis 300Lux Beleuchtungsstärke hellerbeleuchtet sein als <strong>de</strong>rübrige Raum. Das erleichtert<strong>de</strong>n Gästen die Orientierungund unterstützt dieSehaufgabe bei <strong>de</strong>r Speisenwahl.<strong>Licht</strong> zum VerkaufenWer <strong>de</strong>n visuell verwöhntenMenschen von heute ansprechenwill, muss <strong>de</strong>nVerkaufsraum geschickt inszenieren.So vielfältig wiedas Angebot an mo<strong>de</strong>rnenLampen, Leuchten undStrahlern ist, sind die individuellenLösungen. Das Planungszielfür Museumsshops:Bauart und Einrichtung<strong>de</strong>s Raumes mit <strong>de</strong>rzum Warenangebot passen<strong>de</strong>nBeleuchtung optimalaufeinan<strong>de</strong>r abstimmen.Zu unterschei<strong>de</strong>n sindAllgemeinbeleuchtung – das„<strong>Licht</strong> zum Sehen“ – undAkzentbeleuchtung – das„<strong>Licht</strong> zum Hinsehen“ fürRegale, Wän<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r beson<strong>de</strong>reAngebote auf <strong>de</strong>r Verkaufsfläche.Als Faustregelfür das richtige Mischungsverhältnisgilt: Je exklusiverdas Angebot, umso höherwertigersollte die Beleuchtungsein, wobei umsomehr Wert auf differenzierteAkzentbeleuchtung zu legenist.54Der Gesamteindruck abgestufterHelligkeiten entschei<strong>de</strong>tdarüber, wie anregend<strong>de</strong>r Kun<strong>de</strong> die Verkaufs-(raum)atmosphäre fin<strong>de</strong>t.Doch Vorsicht: Zu krasseHelligkeitsunterschie<strong>de</strong>überfor<strong>de</strong>rn die Augen vonKun<strong>de</strong>n und Mitarbeitern.Ausführlicher informiertFGL-Heft 6 (siehe Seite 45)über Verkaufsraum- undSchaufensterbeleuchtung.Es gilt DIN EN 12464-1.18
<strong>Licht</strong> zum Arbeiten„<strong>Licht</strong> zum Arbeiten“ ist notwendigfür Räume, dieBesuchern nicht zugänglichsind und in <strong>de</strong>nen die Beleuchtungausschließlichauf die Sehaufgaben <strong>de</strong>rArbeiten<strong>de</strong>n zugeschnittenist. Dazu gehören im wesentlichenBüros, zum Beispiel<strong>de</strong>r Verwaltung, Werkstättensowie Lagerräumewie Magazin, Depot undArchiv.<strong>Licht</strong> im BüroGrundvoraussetzung fürSehleistung und Sehkomfortist ein ausreichen<strong>de</strong>s Beleuchtungsniveau.NachDIN EN 12464-1 darf dieBeleuchtungsstärke <strong>de</strong>s Arbeitsbereichesnicht unter500 Lux liegen, die <strong>de</strong>s Umgebungsbereichesnichtunter 300 Lux. Die Norm unterschei<strong>de</strong>traum-, arbeitsbereich-und teilflächenbezogeneBeleuchtung (weitergehen<strong>de</strong>Informationen:FGL-Heft 4, siehe Seite 45).werkstatt sollte unabhängigvon <strong>de</strong>r Art <strong>de</strong>r Handwerksarbeitenbei 500 Lux liegen(analog Lehrwerkstätten).Je kritischer und feiner dieSehaufgabe ist, umso mehr<strong>Licht</strong> wird benötigt; hierfürkönnen zusätzliche Arbeitsplatzleuchtenzur Erhöhung<strong>de</strong>r Beleuchtungsstärkeam Werkstück eingesetztwer<strong>de</strong>n. Für die Allgemeinbeleuchtungeignet sichdie arbeitsplatzbezogeneLösung mit Leuchten fürLeuchtstofflampen in fensterparallelerAnordnung, ambesten mit seitlichem <strong>Licht</strong>einfallauf die Werkbank.Grundsätzlich ist es sinnvoll,in <strong>de</strong>r Werkstatt Leuchtenhöherer Schutzart einzusetzen.Eine Leuchte <strong>de</strong>rSchutzart IP 43 beispielsweiseist geschützt gegenfeste Fremdkörper 1 mmund gegen Sprühwasser,eine IP 54-Leuchte gegenStaub und Spritzwasser.Bild 55: Im Büro darf das<strong>Licht</strong> we<strong>de</strong>r Direktblendungnoch Reflexblendung auf<strong>de</strong>m Bildschirm erzeugen.Bild 56: Je kritischer und feinerdie Sehaufgabe, umso mehr<strong>Licht</strong> wird benötigt.Bil<strong>de</strong>r 57 und 58: Lagerräumesind mit min<strong>de</strong>stens 100 Luxnormgerecht beleuchtet, bessersind höhere Beleuchtungsstärken.55Favorit <strong>de</strong>r Bürobeleuchtungsind abgepen<strong>de</strong>lte Leuchteno<strong>de</strong>r Stehleuchten mit direkt/indirekter<strong>Licht</strong>verteilung,die von <strong>de</strong>n meistenMenschen als angenehmempfun<strong>de</strong>n wird. Die alternative,direkte Allgemeinbeleuchtungmit Deckeneinbau-,Deckenanbau- o<strong>de</strong>rabgepen<strong>de</strong>lten Leuchten mitSpiegelraster überzeugtvor allem durch ihre Gleichmäßigkeit.Wichtigstes Gütekriteriuminsbeson<strong>de</strong>re auch für Bildschirmarbeitsplätzeim Büroist die Begrenzung <strong>de</strong>rDirekt- und <strong>de</strong>r Reflexblendung– durch entsprechen<strong>de</strong>Anordnung <strong>de</strong>r Leuchten,<strong>de</strong>r Tische und <strong>de</strong>rMonitore. Auch die Akzentbeleuchtungmit Wand-,Vitrinen- o<strong>de</strong>r Bil<strong>de</strong>rleuchtendarf keine stören<strong>de</strong> Reflexblendungerzeugen.<strong>Licht</strong> in <strong>de</strong>r WerkstattWas für Büros – siehe oben– gilt, sieht DIN EN 12464-1im Prinzip auch für Werkstättenvor. Die Beleuchtungsstärkein <strong>de</strong>r Museums-<strong>Licht</strong> in LagerräumenFür die Arbeit in Magazin,Depot o<strong>de</strong>r Archiv wird weniger<strong>Licht</strong> benötigt als fürhandwerkliche Tätigkeiten.Relativ hohe Beleuchtungsstärkensind <strong>de</strong>nnoch wichtigbeim Umgang mit kleinteiligemLagergut und füralle Arbeiten mit Leseaufgaben(Beschriftung amLagergut, Formularerfassung).Wenn sich die LeseundSuchaufgabe auf Regale– also eine vertikaleEbene – konzentriert, könnenvertikale Beleuchtungsstärkenvon bis zu 300 Luxnotwendig sein.Etwas höhere Beleuchtungsstärkenals die vonDIN EN 12464-1 vorgesehenen100 Lux erleichterndie sichere visuelle Wahrnehmung,erhöhen die Konzentration,helfen, Fehler zuvermei<strong>de</strong>n und schützenvor Unfällen. Für Räumenormaler Höhe eignen sicham besten Leuchten fürLeuchtstofflampen, für höhereHallen Leuchten mitHochdruck-Entladungslampen.57565819
Objekte im FreienBild 59: Skulpturen inszeniertim Spiel von <strong>Licht</strong> und SchattenAlternative zu Strahlern.Überwiegend eingesetztwird enggebün<strong>de</strong>ltes <strong>Licht</strong>,unter an<strong>de</strong>rem bei <strong>de</strong>r Anstrahlungvon unten kann<strong>de</strong>r Ausstrahlungswinkelauch größer sein.FreilichtmuseumHäuser und Anlagen vergangenerZeiten, imOriginal o<strong>de</strong>r nachempfun<strong>de</strong>n,sind die zentralenAusstellungsobjektevon Freilichtmuseen. Sieschließen, wenn es dunkelist, so dass künstliches<strong>Licht</strong> meist nur in<strong>de</strong>n Häusern eingesetztwird, möglichst ohne dasBild <strong>de</strong>r nicht elektrifiziertenVergangenheit zustören. Wenn ein Freilichtmuseumin <strong>de</strong>n Dunkelstun<strong>de</strong>ngeöffnet hat,müssen zu<strong>de</strong>m die Wegebeleuchtet wer<strong>de</strong>n.Ob Skulpturen o<strong>de</strong>r Installationen,einige Kunstwerkesind fürs Freie vorgesehen,an<strong>de</strong>re Ausstellungsstückekommen zum Beispiel aufgrundihrer Ausmaße fürdie Ausstellung unter freiemHimmel infrage. Für dieüberwiegen<strong>de</strong> Zahl <strong>de</strong>r Objektegenügen meist <strong>de</strong>r Innenhofo<strong>de</strong>r ein kleinesStückchen Garten.Im Spiel von <strong>Licht</strong> undSchattenIm Freien wirken Anstrahlungenin <strong>de</strong>r Dämmerungo<strong>de</strong>r bei Dunkelheit – imPrinzip mit <strong>de</strong>nselben Ergebnissenwie bei Anstrahlungenmit gerichtetem <strong>Licht</strong> in59Ausstellungsräumen (sieheSeiten 2, 6). Hinzu kommt<strong>de</strong>r Vergleich zum Erscheinungsbildbei Tageslicht:Das künstliche <strong>Licht</strong> formtneue Strukturen, inszeniertdas Objekt neu im Spielvon <strong>Licht</strong> und Schatten.Der i<strong>de</strong>ale Standort für ortsverän<strong>de</strong>rlicheStrahler o<strong>de</strong>rScheinwerfer lässt sich ambesten durch Tests ermitteln:<strong>Licht</strong> von unten, vonseitlich unten, von <strong>de</strong>r Seite,von oben, von seitlich obeno<strong>de</strong>r sogar indirekt strahlen<strong>de</strong>s<strong>Licht</strong> – je<strong>de</strong> Lösung hatihren eigenen Reiz. Für„<strong>Licht</strong> von unten“ sind Er<strong>de</strong>inbauscheinwerferdieBlendung vermei<strong>de</strong>nSoll das ganze Objekt zurGeltung kommen, muss <strong>de</strong>rAbstand <strong>de</strong>r Scheinwerfergrößer sein als für die Anstrahlungvon Details. Wichtig:Beim Einrichten <strong>de</strong>rStrahler und Scheinwerferist darauf zu achten, dassBetrachter zumin<strong>de</strong>st in <strong>de</strong>renHauptblickrichtung nichtgeblen<strong>de</strong>t wer<strong>de</strong>n.Um bei verschie<strong>de</strong>nen Objektendieselbe <strong>Licht</strong>wirkungzu erzielen, gilt generell:Je dunkler das Objekt undje heller die Umgebung,umso mehr <strong>Licht</strong> wirdbenötigt. Letztlich ist aberauch die Beleuchtungsstärkeeine Frage von Geschmackund Gestaltungsabsicht.Bild 60: „<strong>Licht</strong> von unten“ – dieEr<strong>de</strong>inbauscheinwerfer sind inGruppen fest installiert.Bild 61: Fassa<strong>de</strong>nbild – Strahlerlichterhellt die farbenfroheMalerei.606120
Nachtbil<strong>de</strong>rBeleuchtete Bauwerke wirkenbei Dunkelheit insbeson<strong>de</strong>redurch ihre Architektur.Wenn Fassa<strong>de</strong>nbeleuchtungdiese sichtbarmacht, entstehen <strong>de</strong>korativeNachtbil<strong>de</strong>r. Auch <strong>Licht</strong>werbungund Anstrahlungenvor <strong>de</strong>m Museumsbau tragenzum nächtlichen Erscheinungsbildbei.Fassa<strong>de</strong>nbeleuchtungMit <strong>Licht</strong> kann je<strong>de</strong>s Gebäu<strong>de</strong>zum effektvollen Blickfangwer<strong>de</strong>n. Im Verbundmit reizvoller Architekturmacht eine gut geplanteFassa<strong>de</strong>nbeleuchtung einGebäu<strong>de</strong> unverwechselbar.Zugleich wird die Umgebungaufgewertet.Die Anstrahlung <strong>de</strong>s Gesamtobjektswirkt beson<strong>de</strong>rsaus <strong>de</strong>r Ferne. Betont das<strong>Licht</strong> nur architektonischeDetails, hat die Anstrahlungvor allem Nahwirkung.Kontrastreiche <strong>Licht</strong>-Schatten-Verhältnisseund damitPlastizität entstehen, wennHauptblick- und Anstrahlrichtungnicht i<strong>de</strong>ntischsind: Ein Winkel von zirka60 Grad zur Blickrichtungist richtig für ungeglie<strong>de</strong>rteo<strong>de</strong>r schwach geglie<strong>de</strong>rteFassa<strong>de</strong>n, für stark geglie<strong>de</strong>rteGebäu<strong>de</strong>ansichtenkann <strong>de</strong>r Winkel kleinersein.Die Installation <strong>de</strong>r Scheinwerferin relativ großem Abstandvermei<strong>de</strong>t zu starkeSchatten. <strong>Licht</strong>bün<strong>de</strong>l solltensich nicht kreuzen, weil danndie Schatten verwischen.Die aus <strong>de</strong>r Entfernung wirken<strong>de</strong>nScheinwerfer solltenhoch und möglichst unauffälligangebracht wer<strong>de</strong>n.Natriumdampf-Hochdrucklampenunterstreichen <strong>de</strong>nCharakter warmer Farbenund Materialien, für kälteranmuten<strong>de</strong> Oberflächeneignen sich Halogen-Metalldampflampen.Anstrahlungensind auch mit in dieFassa<strong>de</strong> integrierten Wandleuchtenund mit direkt davorpositionierten Er<strong>de</strong>inbauscheinwerfernmöglich.Bil<strong>de</strong>r 62 und 63: Mit <strong>Licht</strong> wer<strong>de</strong>nFassa<strong>de</strong>n zum effektvollenBlickfang, es wertet auf undmacht unverwechselbar.Eigenfarbe und damit dieReflexionseigenschaften <strong>de</strong>sangestrahlten Objekts (Objekt-Leuchtdichte)sowie dieUmgebungshelligkeit bestimmendie jeweils erfor<strong>de</strong>rlicheBeleuchtungsstärke: Jedunkler das Objekt und jeheller die Umgebung, um somehr <strong>Licht</strong> wird benötigt. ExaktePlanung vermei<strong>de</strong>t <strong>Licht</strong>emissionin die Umgebung.Alternativen zur klassischenAnstrahlung sind faseroptischeBeleuchtungssystemeo<strong>de</strong>r LEDs, mit <strong>de</strong>nen dieFassa<strong>de</strong> o<strong>de</strong>r Teile davonauch mit einem dynamischenFarbwechsel inszeniertwer<strong>de</strong>n können. Einean<strong>de</strong>re Möglichkeit ist dieGestaltung <strong>de</strong>r Fassa<strong>de</strong> mittels<strong>de</strong>r eingeschalteten (undgesteuerten) Innenraumbeleuchtung.An<strong>de</strong>re AnstrahlungenDie Fassa<strong>de</strong>nbeleuchtung istin <strong>de</strong>r Regel eigenständig.<strong>Licht</strong>werbung – zum Beispiel<strong>de</strong>r Namenszug <strong>de</strong>sMuseums in Leuchtschrift –sollte jedoch eingeplant wer<strong>de</strong>n.Um die gewünschtenEffekte zu erzielen, mussauch <strong>Licht</strong> für zusätzlicheSignalwirkung, zum Beispieldie Anstrahlung von Fahneno<strong>de</strong>r eines Spannplakates,mit <strong>de</strong>r Fassa<strong>de</strong>nbeleuchtungabgestimmt wer<strong>de</strong>n.Im weiteren Außenbereichentstehen mit angestrahltenBäumen o<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>renPflanzen ebenfalls schöneBil<strong>de</strong>r. Diese Anstrahlungenfolgen <strong>de</strong>n Regeln <strong>de</strong>r Objektbeleuchtung(siehe Seite20). Ist zu<strong>de</strong>m die Fassa<strong>de</strong>beleuchtet, sollten nur Pflanzenin weiterem Abstandvom Gebäu<strong>de</strong> angestrahltwer<strong>de</strong>n.Bild 64: Der LED-Halbkreis an<strong>de</strong>r Fassa<strong>de</strong> <strong>de</strong>r BuhlschenMühle in Ettlingen symbolisiertdas Mühlrad.62636421
TageslichtRaumbeleuchtung mit Tageslichtist eine architektonischeAufgabe, die unbedingtin <strong>de</strong>r frühen Entwurfsphaseeines Neubaus angegangenund entschie<strong>de</strong>nwer<strong>de</strong>n muss. Die Gegebenheitenzur Tageslichtnutzungkönnen nachträglichselten und schwer geän<strong>de</strong>rtwer<strong>de</strong>n. Die Tageslichtplanunggehört in die Hän<strong>de</strong>erfahrener Fachleute.TageslichtmuseumDie öffentlichen Museumsbautenaus <strong>de</strong>r ersten Hälfte<strong>de</strong>s 19. Jahrhun<strong>de</strong>rts warenauf Tageslicht angewiesen.Schon früh setzten die Baumeisterbei <strong>de</strong>r Tageslichtnutzungauf Oberlichter: ImSalon Caree <strong>de</strong>s PariserLouvre wur<strong>de</strong>n die Seitenfenster1789 zugemauert,um alle Wän<strong>de</strong> als Ausstellungsflächenutzen zu können.Lange Zeit war je<strong>de</strong>r Neubautrotz vorhan<strong>de</strong>nemkünstlichen <strong>Licht</strong> ein Tageslichtmuseum.Das än<strong>de</strong>rtesich in <strong>de</strong>n 1950-er und1960-er Jahren, als bekanntund bewusst wur<strong>de</strong>, welchenScha<strong>de</strong>n das Tageslichtanrichten kann, vor allemdurch <strong>de</strong>n Verfall <strong>de</strong>rFarben und an<strong>de</strong>rer organischerMaterialien. Deshalbkonzentrierte sich <strong>de</strong>r Museumsbauvorübergehendausschließlich auf fensterloseRäume.Heute ermöglichen es dieErkenntnisse <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>techniksowie mo<strong>de</strong>rne SteuerundRegeltechnik, dasTageslicht genau zu lenkenund zu dosieren. So spieltTageslicht im Museumsbauwie<strong>de</strong>r eine wichtige Rolle.OberlichterOberlicht gilt als klassischeTageslichtbeleuchtung vonGemäl<strong>de</strong>galerien. Es lieferteine gleichmäßig diffuse Beleuchtung.Durch <strong>de</strong>n großflächigen<strong>Licht</strong>eintritt entstehenweiche Schatten. Dasdurch ein Oberlicht einfallen<strong>de</strong>Tageslicht erreicht nahezualle Bereiche einesRaumes, also auch freistehen<strong>de</strong>Vitrinen, Skulptureno<strong>de</strong>r Stellwän<strong>de</strong>. Da Fenstereingespart wer<strong>de</strong>n, ist an<strong>de</strong>n Wän<strong>de</strong>n mehr Platz fürGemäl<strong>de</strong>. Das Problem,dass durch Fenster seitlicheinfallen<strong>de</strong>s Tageslicht Reflexeauf <strong>de</strong>n Ausstellungswän<strong>de</strong>nerzeugen kann, entfällt.Bei großflächigen Oberlichternkönnen ungewollteStörungen entstehen, <strong>de</strong>nenmit entsprechen<strong>de</strong>r Anordnung<strong>de</strong>r Oberlichter un<strong>de</strong>xakter <strong>Licht</strong>lenkung begegnetwer<strong>de</strong>n muss. So bestehtdie Gefahr ungleichmäßiger<strong>Licht</strong>verteilung an<strong>de</strong>n Wän<strong>de</strong>n. Beson<strong>de</strong>rs indunkel ausgestatteten Räumenist die vertikale Beleuchtungsstärkein Augenhöheoft zu gering. Der Kontrastzwischen Wand- undDeckenhelligkeit kann Blendungerzeugen. Außer<strong>de</strong>mkommt es auch beim <strong>Licht</strong>einfallvon oben manchmalzu Reflexen auf Gemäl<strong>de</strong>nan <strong>de</strong>r Wand.Tageslicht hat großes SchädigungspotenzialTageslicht und künstliches <strong>Licht</strong> enthalten Strahlungsanteile,die Ausstellungsobjekte bei Dauerbeleuchtungausbleichen, austrocknen, verfärben o<strong>de</strong>r verformenkönnen. Nach wie vor gilt: Am gefährlichsten ist dasTageslicht. Das lässt sich unter an<strong>de</strong>rem belegen mit<strong>de</strong>r kunsthistorischen Schrift „Über das <strong>Licht</strong> in <strong>de</strong>rMalerei“ (Wolfgang Schöne, Berlin 1993): Sie befasstsich bei <strong>de</strong>r Behandlung <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>quellen fast ausschließlichmit <strong>de</strong>m Tageslicht. Der künstlichen Beleuchtungsind dagegen nur wenige Seiten gewidmet.Dieses Heft informiert ab Seite 30 über <strong>Licht</strong>schutz.Direktes Sonnenlicht mussimmer „ausgesperrt“ wer<strong>de</strong>n.Doch nicht nur <strong>de</strong>r<strong>Licht</strong>schutz stellt hohe Anfor<strong>de</strong>rungen:Allen mo<strong>de</strong>rnenOberlicht-Lösungen gemeinsamist ein hoher Konstruktionsaufwandfür Lenkung,Steuerung und Filterung<strong>de</strong>s Tageslichts. Tageslichtnutzungmit Oberlichternist auf die oberenGeschosse eines Gebäu<strong>de</strong>sbeschränkt o<strong>de</strong>r setzt eingeschossigeBauweise voraus.Oberlichter sind keinErsatz für <strong>de</strong>n durch Fenstererlebten visuellen Kontaktzur Außenwelt.65Bild 65: Die Aufnahme gibt <strong>de</strong>nBlick frei auf das Innere <strong>de</strong>r<strong>Licht</strong><strong>de</strong>cke dieses Ausstellungsraumes,wo Tages- und künstliches<strong>Licht</strong> im Bedarfsfallgemischt wer<strong>de</strong>n.FensterÜberdimensionierte Fenstersind nicht unbedingt die geeigneteAlternative zu Oberlichternund eigentlich nichtdas richtige Mittel, um dasTageslicht maximal zu nutzen.An<strong>de</strong>rerseits gibt esheute vielfältige Möglichkeiten,auch bei Seitenfensterndas Tageslicht zu lenkenund direktes Sonnenlicht„auszusperren“. Allerdingserfüllen diese undurchsichtigenSysteme nicht die Anfor<strong>de</strong>rungan Fenster einesTageslichtmuseums, die tages-und jahreszeitlichenVerän<strong>de</strong>rungen sowie daswitterungsbedingte Geschehenvisuell erlebbar zu machen.Fenster verkleinern die AusstellungsflächeWand. Ungelenktund ungefiltert einfallen<strong>de</strong>sTageslicht kann zuReflexen auf <strong>de</strong>n Ausstellungswän<strong>de</strong>nführen.Tages- und KunstlichtWenn Tageslicht und künstliches<strong>Licht</strong> gemischt wer<strong>de</strong>n,sollten sie vollständig vermischtsein, bevor sie auf22
ein Objekt treffen; dazuzählt, dass auch die räumlicheVerteilung bei<strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>artenaneinan<strong>de</strong>r angepasstsein muss. Die Grün<strong>de</strong>: DieLampen <strong>de</strong>r künstlichen Beleuchtunghaben unterschiedliche<strong>Licht</strong>farben, diespektrale Zusammensetzung<strong>de</strong>s Tageslichts än<strong>de</strong>rt sichständig. Bei<strong>de</strong> haben zu<strong>de</strong>mverschie<strong>de</strong>ne Einfallsrichtungenund unterschiedlicheAusstrahlungswinkel.Das passt nicht zusammen,das Bild <strong>de</strong>r Ausstellungsobjektewird ohne vollständigeVermischung verfälscht.Die einzige Alternative zumMischen heißt „Abstand halten“.Dafür muss zwischen<strong>de</strong>m durch Tageslicht beleuchtetenBereich und <strong>de</strong>mKunstlicht-Bereich soviel Abstandliegen, dass sich bei<strong>de</strong><strong>Licht</strong>arten nicht beeinflussen.Es sei <strong>de</strong>nn, das Zwielichtwird bewusst eingesetzt,um eine bestimmteRaumstimmung zu erzeugen.Bild 68: Das durch die Oberlichtereinfallen<strong>de</strong> Tageslichtkommt vor allem auf <strong>de</strong>n Ausstellungsflächenim 1. Stock an;<strong>de</strong>r Gang muss zusätzlichbeleuchtet wer<strong>de</strong>n.66 67Bil<strong>de</strong>r 66 und 67: Die <strong>Licht</strong><strong>de</strong>cke im 800 Quadratmeter großen„Salle <strong>de</strong>s Etats“ im Pariser Louvre ist 300 Quadratmeter groß. Sielenkt das durch ein verglastes Dach einfallen<strong>de</strong> Tageslicht in <strong>de</strong>nAusstellungsraum. Künstliches <strong>Licht</strong> wird zugeschaltet, wenn dieMessgeräte mel<strong>de</strong>n, dass das Tageslicht nicht mehr ausreicht.Installiert sind 360 Leuchten mit je zwei Leuchtstofflampen à 80Watt, zum Teil mit breitstrahlen<strong>de</strong>n und teilweise mit tiefstrahlen<strong>de</strong>nReflektoren. Die Beleuchtungsstärke auf <strong>de</strong>m Museumsbo<strong>de</strong>nbeträgt 250 Lux, an <strong>de</strong>n Wän<strong>de</strong>n wer<strong>de</strong>n 100 Lux erzielt. Bild 67zeigt das Innenleben <strong>de</strong>r Deckenkonstruktion.Tageslichteinfall von oben durcheine <strong>Licht</strong><strong>de</strong>cke (Prinzip im Raumquerschnitt)Tageslichteinfall von <strong>de</strong>r Seitedurch Fenster (Prinzip im Raumquerschnitt)Von oben fällt auf waagerechteFlächen in <strong>de</strong>r Raummitte mehr<strong>Licht</strong> als auf Flächen am Rand undstets (Winkel) mehr als...Bei Seitenlicht nimmt die Beleuchtungsstärkemit wachsen<strong>de</strong>r Entfernungvom Fenster auf waagerechtenFlächen genauso ab...68...auf senkrechte Flächen an gleicherStelle, auf die Raumwän<strong>de</strong>mehr als auf frei stehen<strong>de</strong>Stellflächen....wie auf senkrechten Flächen, diejedoch wegen <strong>de</strong>s günstigerenAuftreffwinkels besser beleuchtetwer<strong>de</strong>n.Abb. 10-1523
<strong>Licht</strong>managementIn höchster Ausbaustufebe<strong>de</strong>utet <strong>Licht</strong>managementdie Automatisierung <strong>de</strong>rBeleuchtung. Zum <strong>Licht</strong>managementzählen alleSysteme, die das starreMuster „ein o<strong>de</strong>r aus“ durchbrechen.Dafür gibt esKomponenten zum Steuernund Regeln. Beim Regelnwer<strong>de</strong>n Soll- und Ist-Werteabgeglichen.Ausbaustufen<strong>Licht</strong>management-Bausteine,die in unterschiedlichenAusbaustufen auch kombinierteingesetzt wer<strong>de</strong>n,sind: Abrufbare, vorher programmierte<strong>Licht</strong>szenen. Schaltung <strong>de</strong>r Beleuchtungmit Bewegungsmel<strong>de</strong>rnin Abhängigkeit von<strong>de</strong>r Anwesenheit (Präsenzkontrolle). Regelung <strong>de</strong>s Beleuchtungsniveausin Abhängigkeitvom Tageslicht durchDimmen und/o<strong>de</strong>r Teilabschaltungen– über <strong>Licht</strong>sensoren imRaum o<strong>de</strong>r– über Außenlichtsensoren(Tageslichtmessköpfe).Die Komponenten zumSteuern und Regeln mit<strong>Licht</strong>management-Systemensind in Leuchten undBedienelementen integriert.Sie wer<strong>de</strong>n programmiertfür Einzelleuchten, für einenRaum, für eine Gruppe vonRäumen o<strong>de</strong>r eingebun<strong>de</strong>nin die Systemtechnik einesGebäu<strong>de</strong>s (BMS – BuildingManagement System).<strong>Licht</strong>management-Systemekönnen realisiert wer<strong>de</strong>nmit <strong>de</strong>r standardisiertendigitalen Schnittstelle DALI ®(Digital AddressableLighting Interface). Dieseerlaubt auch die Einbindungin Gebäu<strong>de</strong>management-Systemewie zumBeispiel ein BUS-System.Informationen:www.dali-ag.org.<strong>Licht</strong>management imMuseumIm Museum gibt es zahlreicheEinsatzmöglichkeitenfür <strong>Licht</strong>management: <strong>Licht</strong>management-Systemekönnen die künstlicheBeleuchtung in Abhängigkeitvom verfügbaren Tageslichtzu- und abschalteno<strong>de</strong>r dimmen. Sie können <strong>de</strong>n SonnenundBlendschutz an Oberlichterno<strong>de</strong>r Fenstern tageslichtabhängigsteuern. <strong>Licht</strong>management-Systemeerleichtern die Inszenierung<strong>de</strong>r Beleuchtung: Szenisches<strong>Licht</strong> o<strong>de</strong>r dynamischeEffekte lassen sicheinfach programmieren. <strong>Licht</strong>management erleichtertdie bereichsweise Einstellungverschie<strong>de</strong>ner Beleuchtungsstärken:EinzelneLeuchten wer<strong>de</strong>n einfachgedimmt. Das dient <strong>de</strong>rInszenierung einer Ausstellungo<strong>de</strong>r wird als <strong>Licht</strong>schutzmaßnahmefür einzelneExponate genutzt. <strong>Licht</strong>management erlaubtdie einfache multifunktionaleNutzung einzelner Räume. Die Zuordnung installierterLeuchten zu ausstellungsbezogenenLeuchtenist mit <strong>Licht</strong>managementohne Deinstallation <strong>de</strong>r vorhan<strong>de</strong>nenLeuchten undohne Umverdrahtung möglich. Ein <strong>Licht</strong>management-System kann Leuchtenüberwachen und ihrenFunktionszustand mel<strong>de</strong>n,auch <strong>de</strong>n Ausfall. <strong>Licht</strong>management-Systemekönnen <strong>de</strong>n Betriebszustand<strong>de</strong>r Anlage unddamit die Bestrahlung <strong>de</strong>rExponate für <strong>de</strong>n <strong>Licht</strong>schutz-Pass(siehe Seite32) protokollieren. Notbeleuchtung lässt sicheinfach ins <strong>Licht</strong>managementintegrieren. Eine mit <strong>Licht</strong>managementüberwachte Beleuchtungsanlagespart im Vergleichzu einer ungesteuertenAnlage Energie.24
7169Bil<strong>de</strong>r 69 und 70: Diegetrennt voneinan<strong>de</strong>r schaltbarenLeuchten und Leuchtengruppenkönnen mit<strong>Licht</strong>management einfachgesteuert wer<strong>de</strong>n. Die 3D-Darstellung in Bild 69 zeigtdie Beleuchtungssituation„komplett eingeschaltet“, diein Bild 70 zeigt die Situation„Spotbeleuchtung“.Bil<strong>de</strong>r 71 und 72: Die Beleuchtung dieser Ausstellungs- und Veranstaltungshalleerlaubt unterschiedliche Nutzungen. Abgebil<strong>de</strong>t sinddie mit <strong>Licht</strong>management gesteuerten Beleuchtungssituationen„helles tageslichtweißes <strong>Licht</strong>“ (71), die meist tagsüber eingeschaltetwird, und „weniger helles warmweißes <strong>Licht</strong>“ (72), gedacht vorallem für abends.7270Bild 73: Digital gesteuerteTageslicht<strong>de</strong>cke – bei Bedarfwird das künstliche <strong>Licht</strong> stufenloszugemischt.7325
Sehen, erkennen, wahrnehmenÜber 80 Prozent aller Informationennimmt <strong>de</strong>r Menschmit <strong>de</strong>n Augen wahr. Wersich mit <strong>de</strong>n Voraussetzungenfür gutes Sehen beschäftigt,also die visuellenAnfor<strong>de</strong>rungen in ihrenGrundzügen kennt, verstehteinfacher, wie <strong>Licht</strong> Sehleistungermöglicht und wasdiese stört. Ausführlicher informiertHeft 1 „Die Beleuchtungmit künstlichem <strong>Licht</strong>“(siehe Seite 45) über dieGrundlagen.BeleuchtungsstärkeDie Beleuchtungsstärke(Kurzzeichen: E) hat großenEinfluss darauf, wie schnell,wie sicher und wie leicht dieSehaufgabe erfasst und ausgeführtwird. In <strong>de</strong>r MaßeinheitLux (lx) gibt sie <strong>de</strong>n<strong>Licht</strong>strom an, <strong>de</strong>r von einer<strong>Licht</strong>quelle auf eine bestimmteFläche trifft: Die Beleuchtungsstärkebeträgt1 Lux, wenn <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>stromvon 1 Lumen 1 QuadratmeterFläche gleichmäßig ausleuchtet.Beispiel: Eine normaleKerzenflamme erzeugtim Abstand von 1 Meterzirka 1 Lux.Gemessen wird die Beleuchtungsstärkeauf horizontalenund vertikalenFlächen. Die gleichmäßigeVerteilung <strong>de</strong>r Helligkeit erleichtertdie Sehaufgabe.In Ausstellungsräumen wirddie Höhe <strong>de</strong>r Beleuchtungsstärkein vielen Fällen vorrangigvon <strong>de</strong>r Empfindlichkeit<strong>de</strong>r Exponate bestimmt:Denn die Beleuchtungsstärkefür gefähr<strong>de</strong>te Ausstellungsstückesollte möglichstgering sein. (<strong>Licht</strong>schutz, sieheSeite 30).Zweites Entscheidungskriteriumist die Gestaltungsabsicht.Erst an dritter Stellefolgt – ausnahmsweise – dieFrage, wieviel <strong>Licht</strong> notwendigist, um die Sehaufgabeerfüllen zu können. Aus allendrei Kriterien wird die Höhe<strong>de</strong>r Beleuchtungsstärke alsKonsens abgeleitet: Dabeimuss klar sein, das Niveaudarf nicht zu gering ausfallen.Das gängige Beleuchtungsstärkeniveauin Ausstellungsräumenreicht im Mittelvon 150 bis 250 Lux – jenach<strong>de</strong>m, ob wandbezogenbeleuchtet wird, o<strong>de</strong>r ob dieExponate im Raum stehen,mit höheren vertikalen o<strong>de</strong>rmehr horizontalen Anteilen.Manchmal muss es auskonservatorischen Grün<strong>de</strong>ndunkler sein, heller ist eshäufig höchstens bei Tageslichteinfall.Wird viel diffuses und wenigergerichtetes <strong>Licht</strong> eingesetzt,ist <strong>de</strong>r Ausstellungsraumgleichmäßiger ausgeleuchtet.Ausschließlich aufExponate gerichtetes <strong>Licht</strong>führt zu weitgehen<strong>de</strong>r Ungleichmäßigkeit<strong>de</strong>r Beleuchtungsstärkenim Raum.Abb. 16 74LeuchtdichteverteilungDie Leuchtdichte (Kurzzeichen:L) als Maß für <strong>de</strong>nHelligkeitseindruck, <strong>de</strong>n dasAuge von einer leuchten<strong>de</strong>no<strong>de</strong>r beleuchteten Flächehat, wird gemessen in Can<strong>de</strong>lapro Flächeneinheit(cd/m 2 ).Die Sehleistung hängt wesentlichvon <strong>de</strong>r Leuchtdichteverteilungim Gesichtsfeldab, weil diese <strong>de</strong>n Adaptationszustand<strong>de</strong>r Augen bestimmt.Mit steigen<strong>de</strong>r Adaptationsleuchtdichteerhöhensich Sehschärfe, Kontrastempfindlichkeitund Leistungsfähigkeit<strong>de</strong>r Augenfunktionen.Für Sehaufgaben amSchreibtisch gilt, dass hellerePartien in <strong>de</strong>r Gesichtsfeldmittedie Konzentration för<strong>de</strong>rn.Übertragen auf dieSituation in Ausstellungenbe<strong>de</strong>utet das: Die Exponatesollten prinzipiell eine höhereLeuchtdichte haben als ihrUmfeld. Erreicht wird diesunter an<strong>de</strong>rem mit abgestuftenBeleuchtungsstärken.Der Sehkomfort lei<strong>de</strong>t unterzu niedrigen Leuchtdichteno<strong>de</strong>r bei fehlen<strong>de</strong>n Leuchtdichteunterschie<strong>de</strong>n(unattraktive<strong>Licht</strong>atmosphäre), zuhohen Leuchtdichteunterschie<strong>de</strong>n(Augen ermü<strong>de</strong>n,weil sie ständig neu adaptierenmüssen) und zu hohenpunktuellen Leuchtdichten(Blendung).Bild 74: Das diffuse <strong>Licht</strong> <strong>de</strong>r<strong>Licht</strong><strong>de</strong>cke wird hier kombiniertmit gerichtetem Strahlerlicht.26
75AdaptationDie Anpassung <strong>de</strong>r Augenan unterschiedlicheHelligkeiten übernehmenSinnesrezeptoren auf <strong>de</strong>rNetzhaut bei gleichzeitigerVerän<strong>de</strong>rung <strong>de</strong>rPupillenöffnung. Die Anpassungvon Dunkelnach Hell beträgt nurSekun<strong>de</strong>n, die vollständigeDunkeladaptationdauert Minuten.Der jeweilige Adaptationszustandbestimmt dieSehleistung: Je mehr<strong>Licht</strong> zur Verfügung steht,umso schneller kannfehlerlose Sehleistungerbracht wer<strong>de</strong>n. Sehstörungentreten auf,wenn zu große Helligkeitsunterschie<strong>de</strong>in zukurzer Zeit verarbeitetwer<strong>de</strong>n müssen.LampeOhne Lampe kein <strong>Licht</strong>:„Lampe“ bezeichnet dietechnische Ausführungeiner künstlichen <strong>Licht</strong>quellewie Glühlampe,Leuchtstofflampe usw.LeuchteDer gesamte Beleuchtungskörperinklusivealler für Befestigung undBetrieb <strong>de</strong>r Lampe notwendigenKomponentenist die „Leuchte“. Sieschützt die Lampe, verteiltund lenkt <strong>de</strong>ren<strong>Licht</strong>, verhin<strong>de</strong>rt, dasses blen<strong>de</strong>t.LEXIKONBild 75: Im Raum ist es relativdunkel, die höhere Beleuchtungsstärkeam Objekt ermöglichtdie Sehaufgabe. Generellsind geringe Beleuchtungsstärkenmanchmal notwendig,um die Exponate vor <strong>Licht</strong> zuschützen.76Bild 76: Das diffuse <strong>Licht</strong> von<strong>Licht</strong><strong>de</strong>cken wirkt nur, wenn eshell ist. Hier beträgt die Beleuchtungsstärkeknapp 250 Lux.27
Sehen, erkennen, wahrnehmenDirektblendung,ReflexblendungLeuchten, freistrahlen<strong>de</strong> Lampeno<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Flächenmit zu hoher Leuchtdichte –auch Fenster – erzeugenDirektblendung. Reflexblendungwird von Reflexenverursacht, die durch Spiegelungenauf glänzen<strong>de</strong>nOberflächen entstehen.Blendung kann die Sehleistung<strong>de</strong>rart stören, dasssicheres Wahrnehmen undErkennen unmöglich wer<strong>de</strong>n.Die physiologischeBlendung ist eine messbareAbnahme <strong>de</strong>r Sehfunktion,beispielsweise <strong>de</strong>rSehschärfe. PsychologischeBlendung löst Unbehagenund Konzentrationsschwächeaus. Blendungkann generell nicht ausgeschlossen,aber <strong>de</strong>utlichbegrenzt wer<strong>de</strong>n. AnerkannteVerfahren zur Blendungsbewertunggibt es fürbei<strong>de</strong> Arten <strong>de</strong>r Blendung.wird von <strong>de</strong>r Verteilung <strong>de</strong>rLeuchten und ihrer Anordnungim Raum. Die Gestaltungvon „<strong>Licht</strong> und Schatten“in Ausstellungsräumenist in diesem Heft ab Seite2 beschrieben.Sehleistung und Sehkomfortwer<strong>de</strong>n außer<strong>de</strong>m beeinflusstvon <strong>Licht</strong>farbe undFarbwie<strong>de</strong>rgabeeigenschaft<strong>de</strong>r eingesetzten Lampen.Bei<strong>de</strong> Eigenschaften wer<strong>de</strong>nauf Seite 35 erläutert.In Ausstellungsräumenkann Reflexblendung in begrenztemMaße als Gestaltungsmitteleingesetzt wer<strong>de</strong>n:zum Beispiel bei glänzen<strong>de</strong>nExponaten mit brillanterreflektieren<strong>de</strong>r Oberfläche,die mit gerichtetem<strong>Licht</strong> inszeniert wer<strong>de</strong>n, damitsie zur Geltung kommen.77<strong>Licht</strong>richtung undSchattigkeitForm und Oberflächen imRaum sollen <strong>de</strong>utlich (Sehleistung)und auf angenehmeWeise (Sehkomfort) erkennbarsein. Das erfor<strong>de</strong>rtausgewogene Schatten mitweichen Rän<strong>de</strong>rn. Beeinflusstwird die Schattenbildungvon <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>richtung,die wie<strong>de</strong>rum bestimmtBil<strong>de</strong>r 77 bis 79: Für dieMuseumsbeleuchtung geltenbeson<strong>de</strong>re Maßstäbe. Das <strong>Licht</strong>muss mit 150 bis 250 Lux nichtsehr hell sein. Doch es solltemöglichst nicht blen<strong>de</strong>n, weilDirekt- wie Reflexblendung dieSehaufgabe zu sehr stören.7828
<strong>Licht</strong>stärkeDie <strong>Licht</strong>stärke (Kurzzeichen:I) charakterisiertdie <strong>Licht</strong>ausstrahlung vonReflektorlampen undLeuchten. Sie wird inCan<strong>de</strong>la (cd) gemessen.Wer<strong>de</strong>n die Eckpunkte<strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>stärken in <strong>de</strong>nverschie<strong>de</strong>nen Ausstrahlungswinkelnin einemDiagramm verbun<strong>de</strong>n,entsteht die <strong>Licht</strong>stärke-Verteilungskurve (LVK).ReflexionsgradDer Reflexionsgrad besagt,wieviel Prozent <strong>de</strong>sauf eine Fläche fallen<strong>de</strong>n<strong>Licht</strong>stroms reflektiert wer<strong>de</strong>n.Helle Flächen habeneinen hohen, dunkleFlächen einen niedrigenReflexionsgrad. Das be<strong>de</strong>utetauch: Je dunklerein Raum ausgestattet ist,umso mehr <strong>Licht</strong> wird für<strong>de</strong>n gleichen Helligkeitseindruckbenötigt.SehaufgabeDie Sehaufgabe wird bestimmtvon <strong>de</strong>n Hell-/Dunkel- und Farbkontrastensowie <strong>de</strong>r Größe vonDetails. Je schwierigerdie Sehaufgabe ist, <strong>de</strong>stohöher muss das Beleuchtungsniveausein,um die erfor<strong>de</strong>rlicheSehleistung zu erbringen.SehleistungDie Sehleistung wird von<strong>de</strong>r Sehschärfe <strong>de</strong>r Augen,ihrer Unterschiedsempfindlichkeitfür HellundDunkelsehen sowie<strong>de</strong>r Wahrnehmungsgeschwindigkeitbestimmt.L E X I K O N7929
<strong>Licht</strong>schutzAusbleichen, vergilben,nachdunkeln, verfärben,versprö<strong>de</strong>n, verformen, verwölben,splittern, reißen,aufquellen, austrocknen,schrumpfen, sich auflösen– diese Aufzählung klingtnach äußerst <strong>de</strong>struktivenEinflüssen. Tatsächlichdroht <strong>de</strong>n Exponaten, dieunter Tageslicht o<strong>de</strong>r künstlichem<strong>Licht</strong> ausgestelltwer<strong>de</strong>n, meist nicht mehrals eine dieser Gefahren.Optische StrahlungDennoch ist das Gefahrenpotenzialnicht zu unterschätzen.Es entsteht, weileinige Materialien die optischeStrahlung – das sinddie kurzwellige ultraviolette(UV) Strahlung (100 bis380 nm = Nanometer),<strong>Licht</strong> (sichtbare Strahlung)mit 380 bis 780 nm Wellenlängeund langwellige infrarote(IR) Strahlung (780 nmbis 1 Millimeter) – nichtvertragen. Sie löst photochemischeo<strong>de</strong>r thermodynamische(physikalische)Prozesse aus. Tageslichtmit seinem hohen UV-Anteilund <strong>de</strong>r Wärmestrahlung<strong>de</strong>r Sonne ist immer kritisch.<strong>Licht</strong>techniker und an<strong>de</strong>reWissenschaftler haben diesePhänomene untersucht.Das Resultat ist neben Erfahrungswertenund auchdaraus abgeleiteten Tippsfür konservatorische Maßnahmen<strong>de</strong>s <strong>Licht</strong>schutzesein umfangreiches Formelwerk,das die Scha<strong>de</strong>nswirkungzwar berechenbar, für<strong>de</strong>n Nicht-<strong>Licht</strong>technikeraber nicht verständlichermacht. Auf Formeln, mathematischeZusammenhängeund Berechnungen soll<strong>de</strong>shalb an dieser Stelleverzichtet wer<strong>de</strong>n.Wichtig zu wissen: Nicht dieauf das Objekt auftreffen<strong>de</strong>,son<strong>de</strong>rn die absorbierteStrahlung ist maßgeblichfür eine Schädigung. UV-Strahlung und kurzwelliges<strong>Licht</strong> wirken in <strong>de</strong>r Regelschädigen<strong>de</strong>r als langwelliges<strong>Licht</strong> und IR-Strahlung.Das heißt: Auch Strahlungim sichtbaren Bereich –also <strong>Licht</strong> – kann Scha<strong>de</strong>nanrichten.PhotochemischeVerän<strong>de</strong>rungenVor allem organische Materialiensind anfällig für photochemischeVerän<strong>de</strong>rungen.Anorganisches Materialist viel seltener betroffen.Im Museum wer<strong>de</strong>n vorallem Farbverän<strong>de</strong>rungengefürchtet, also das Ausbleichen,Vergilben, Nachdunkelnvon Farbpigmenten,Bin<strong>de</strong>mitteln, Schlussüberzügenin <strong>de</strong>r AquarellundÖlmalerei, bei Papier,Textilien und Holz.Photochemische Verän<strong>de</strong>rungenverlaufen langsam.Dabei sind <strong>Licht</strong>schä<strong>de</strong>nkumulativ, das heißt, keinMaterial vergisst eine Bestrahlung,ihre Stärke undDauer.Die wichtigsten Parameter,die zu photochemischenProzessen beitragen, sind: Bestrahlungsstärkeam Objekt. Die Bestrahlungsstärkehat das KurzzeichenE e und wird gemessenin W/m 2 . Bestrahlungsdauerist die Zeit, in <strong>de</strong>r ein Objekt<strong>de</strong>r Bestrahlung ausgesetztist. Bestrahlung (H e )wird als Produkt aus <strong>de</strong>rBestrahlungsstärke und <strong>de</strong>r80 81Dauer dieser Einwirkunggebil<strong>de</strong>t. Je höher die Bestrahlungsstärkeist und jelänger die Bestrahlung andauert,umso höher ist dasGefahrenpotenzial. Spektrale Strahlungsverteilung<strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>quelle(Tageslicht o<strong>de</strong>r Lampen)Zu je<strong>de</strong>r Wellenlänge <strong>de</strong>s<strong>Licht</strong>s gehört eine bestimmteSpektralfarbe. Weißes<strong>Licht</strong> setzt sich zusammenaus einer Vielzahl vonSpektralfarben unterschiedlicherIntensität. Diese spektraleStrahlungsverteilungist charakteristisch für <strong>de</strong>njeweiligen Lampentyp o<strong>de</strong>rdas Tageslicht. So dominierenbei Glühlampen dielangwelligen roten Spektralfarbenund beim Tageslichtdie kurzwelligen blauen. Relative spektrale Objektempfindlichkeitkennzeichnet die Abhängigkeit<strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>empfindlichkeiteines Objekts von<strong>de</strong>n Wellenlängen <strong>de</strong>rBezugsstrahlung. Wirksame Schwellenbestrahlungist das Maß für die absoluteObjektempfindlichkeit. Bei<strong>de</strong>r ersten Bestrahlungbeginnt die Verän<strong>de</strong>runglichtempfindlichen Materials– zunächst unsichtbar, spätersichtbar. Die zahlenmäßigeBestimmung dieserSchwelle <strong>de</strong>r beginnen<strong>de</strong>nSichtbarkeit ist <strong>de</strong>r Maßstabzur Bewertung <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>empfindlichkeit.Die Schwellenbestrahlungsdauer(also die Zeit biszum Erreichen <strong>de</strong>r Schwelle)wird für einzelne Materialartenunter Tageslichto<strong>de</strong>r <strong>de</strong>m <strong>Licht</strong> verschie<strong>de</strong>nerLampen ausgewiesen.Die wirksame Bestrahlungwird mathematisch ermitteltaus <strong>de</strong>n Werten für die optischeStrahlung (spektraleVerteilung), für die Bestrahlungund für die relativeObjektempfindlichkeit.Außer<strong>de</strong>m spielen folgen<strong>de</strong>Eigenschaften und Bedingungenbei photochemischenProzessen eine Rolle: Spektrale Absorptionseigenschaften<strong>de</strong>s Materialsund seine spezifische Dispositionfür Sekundärreaktionen, Umgebungs- und Objekttemperatur, Feuchtigkeit im Objektund in seiner Umgebung, Schadstoffe o<strong>de</strong>r Staub,die sich auf <strong>de</strong>m Objektabgelagert haben, Eigenschaften <strong>de</strong>r verwen<strong>de</strong>tenFarbstoffe undPigmente.SchädigungspotenzialDie schädigen<strong>de</strong> Bestrahlungsstärkeund die Beleuchtungsstärkeam Exponatstehen in einem festenVerhältnis zueinan<strong>de</strong>r.Dieses Verhältnis ergibtdas Schädigungspotenzial.Es ist die entschei<strong>de</strong>n<strong>de</strong>30
Bil<strong>de</strong>r 80 und 81: Die bei<strong>de</strong>nStoffproben wur<strong>de</strong>n einer Stoffbahnentnommen. Das StückStoff von Bild 80 wur<strong>de</strong>überwiegend ohne <strong>Licht</strong>- undUV-Bestrahlung aufbewahrt,während die Stoffprobe vonBild 81 tagsüber überwiegend<strong>de</strong>m Sonnenlicht und damitUV-Strahlung ausgesetzt war.Bild 82: Farbechtheit im Test –Versuchsaufbau <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>technikeran <strong>de</strong>r TechnischenUniversität Berlin: Die bestrahltenProben 1 und 3 sind Textilien,die an<strong>de</strong>ren Aquarellfarben.82<strong>Licht</strong>schutz im Jahr 1905Gegen die <strong>Licht</strong>einwirkungen hat ein zoologischesMuseum „… radikale Abhilfe getroffen, in<strong>de</strong>m mandas Schau-Museum an zwei Tagen je<strong>de</strong>r Woche für2 Stun<strong>de</strong>n öffne; dann allerdings sei die Belichtungeine möglichst reichliche. Im übrigen ver<strong>de</strong>cke mandie Fenster mit vollkommen lichtabschließen<strong>de</strong>nVorhängen, so daß die Dunkelheit einer photographischenDunkelkammer herbeigeführt wer<strong>de</strong>.“Noch weiter ging eine völkerkundliche Ausstellung:„… beson<strong>de</strong>rs lichtempfindliche Objekte wie die außergewöhnlichkostbaren Fe<strong>de</strong>rmäntel … schützt man,in<strong>de</strong>m man sie in Behältnissen aufbewahrt, die mit Vorhängenversehen sind, welche je<strong>de</strong>r Besucher zumBesichtigen … <strong>de</strong>r Gegenstän<strong>de</strong> aufheben kann.“Größe zur Beschreibung<strong>de</strong>s Schädigungsvermögens,das von einer Beleuchtungssituationmit bestimmten<strong>Licht</strong>quellen undFiltern auf bestimmte Ausstellungsobjekteund Materialienausgeht.VorbelichtungUntersuchungen belegen,dass für die Auswahl <strong>de</strong>rBeleuchtung eines Exponatesauch <strong>de</strong>ssen Vorbelichtungeine Rolle spielenkann: So scha<strong>de</strong>n bereitskleine Dosen einer wirksamenBestrahlung noch niemalsausgestellten, nichtvorbelichteten Objektenwährend älteres, vorbelichtetesund schon verän<strong>de</strong>rtesMaterial für <strong>de</strong>nselbenScha<strong>de</strong>n mit viel höherenDosen bestrahlt wer<strong>de</strong>nmüsste.Viele molekulare Abbauprozesseverlangsamensich stetig, kommenschließlich gar zum Stillstand.In diesen Fällen istes möglich, die <strong>Licht</strong>schutzmaßnahmenauf die Zeit<strong>de</strong>r Vorbelichtung abzustimmenund zu verringern.Die Vorbelichtung lässt sicham besten ermitteln, wennalle Zeiten (und Arten) <strong>de</strong>rBestrahlung dokumentiertsind. Um die Vorbelichtungmit Vergleichsmessungenfeststellen zu können, müssenam Objekt unbelichtetePartien vorhan<strong>de</strong>n sein.Schutzmaßnahmengegen photochemischeVerän<strong>de</strong>rungenWenn photochemische Prozesseerst gar nicht o<strong>de</strong>rzumin<strong>de</strong>st vermin<strong>de</strong>rt inGang gesetzt wer<strong>de</strong>n sollen,be<strong>de</strong>utet <strong>Licht</strong>schutz dieVerringerung <strong>de</strong>r wirksamenBestrahlung. Vor allemsollte die beson<strong>de</strong>rs schädlichekurzwellige, insbeson<strong>de</strong>redie UV-Strahlung verringerto<strong>de</strong>r gänzlich ausgeschlossenwer<strong>de</strong>n.Dafür gibt es mehrere wirksameMaßnahmen: Wahl <strong>de</strong>r geeigneten<strong>Licht</strong>quelle: Sehr empfindlichesMaterial sollte mit<strong>Licht</strong> beleuchtet wer<strong>de</strong>n,das wenig Schädigungspotenzialhat. Ausfiltern <strong>de</strong>r schädigen<strong>de</strong>nStrahlung: Sollen an<strong>de</strong>reLampen eingesetzto<strong>de</strong>r Strahlung völlig ausgeschlossenwer<strong>de</strong>n, kanndie kurzwellige Strahlungherausgefiltert wer<strong>de</strong>n.Halogenlampen für Netzspannungund Nie<strong>de</strong>rvoltgibt es zwar mit integriertemUV-Stopp, doch genügtdieser nicht <strong>de</strong>n konservatorischenAnfor<strong>de</strong>rungen.Einziges Mittel <strong>de</strong>r Wahlsind spezielle Filter. Begrenzung <strong>de</strong>r Belichtung:Bei Dunkelheit sinktdie Gefährdung durch photochemischeVerän<strong>de</strong>rungauf Null.Ausfiltern bis 420 nmGlasfilter, Absorptionsfilter,dichriotische Filter, Kunststoffgläsero<strong>de</strong>r -folien –die Auswahl ist groß, fürje<strong>de</strong> Anwendung stehengeeignete Filter zur Verfügung.Mit ihnen kann diekurzwellige Strahlung bis380 nm ausgefiltert wer<strong>de</strong>n.Eliminiert <strong>de</strong>r Filter außer<strong>de</strong>mdas kurzwellige <strong>Licht</strong>,beträgt die Grenzwellenlänge420 nm. Wer<strong>de</strong>n weitereWellenlängen ausgefiltert,verschiebt sich <strong>de</strong>rspektrale Transmissionsgradso weit, dass sich <strong>de</strong>rFarbwie<strong>de</strong>rgabe-In<strong>de</strong>x starkverschlechtert.Alternative zu Filtern am<strong>Licht</strong>austritt sind Vitrinenglaso<strong>de</strong>r Bildverglasungen,die das UV-<strong>Licht</strong> herausfiltern.Wenn sie zusätzlich zuan<strong>de</strong>ren Maßnahmen <strong>de</strong>s<strong>Licht</strong>schutzes eingesetztwer<strong>de</strong>n, verbessern sie diekonservatorischen Bedingungenjedoch nicht.Begrenzte BestrahlungsdauerExponate und Ausstellungsräumesollten möglichst nurfür kurze Zeit beleuchtetwer<strong>de</strong>n. Außerhalb <strong>de</strong>r Öffnungszeitenist Dunkelheitdas Beste; für die Reinigung(Putzlicht) o<strong>de</strong>r fürAufbau-/Abbau- und Reparaturarbeitenist eine separate,nicht schädigen<strong>de</strong>Beleuchtung empfehlenswert,zumin<strong>de</strong>st sollte diereine Präsentationsbeleuchtungdafür ausgeschaltetbleiben und die Allgemeinbeleuchtunggegebenenfallsgedimmt wer<strong>de</strong>n.In vielen Fällen sind Anwesenheitssensorenein geeignetesMittel, um die Bestrahlungwährend <strong>de</strong>r Öffnungszeitenzu begrenzen. RechtzeitigesDimmen gestaltet<strong>de</strong>n Übergang Dunkel/Hellvisuell angenehm. Das Ausschaltensollte mit reichlicherZeitverzögerung programmiertwer<strong>de</strong>n.TageslichtZum <strong>Licht</strong>schutz gehört,dass auch das Tageslicht inseiner Beleuchtungsstärkebegrenzt wird. Für entsprechen<strong>de</strong>mpfindliche Exponatemüssen auch dieUV-Strahlung und das kurzwellige<strong>Licht</strong> ausgefiltertwer<strong>de</strong>n. Für die Bewertung<strong>de</strong>r konservatorischen Eigenschaften<strong>de</strong>s Tageslichtskommt in <strong>de</strong>r Regel <strong>de</strong>rmittlere Himmelszustand mit6.500 K Farbtemperatur undseiner spezifischen spektralenStrahlungsverteilunginfrage; mit dieser NormlichtartD65 kann auch dasSchädigungspotenzial ermitteltwer<strong>de</strong>n.ThermodynamischeProzesseVon thermodynamischenProzessen sind nahezu aus-31
<strong>Licht</strong>schutzschließlich organische Materialienbetroffen: Holz,Textilfasern, Pergament, Le<strong>de</strong>rund an<strong>de</strong>re. Die Wärmebelastung<strong>de</strong>s Ausstellungsobjektesentstehtdurch Absorption von <strong>Licht</strong>und IR-Strahlung. Die Erwärmungführt überwiegendzu Trocknungsprozessen.Beim Austrocknen verringernsich Zugfestigkeit,Elastizität und Volumen, unter<strong>de</strong>r entstan<strong>de</strong>nen mechanischenSpannung verformtsich zunächst dieOberfläche, häufig danachauch das gesamte Objekt.Die physikalischen Verän<strong>de</strong>rungendurch Wärmestrahlungsind gravieren<strong>de</strong>rbei gleichzeitig ablaufen<strong>de</strong>nphotochemischen Prozessen,die von <strong>de</strong>r Wärmebeschleunigt wer<strong>de</strong>n und inWechselwirkung zu <strong>de</strong>nthermodynamischen Prozessentreten. Auch wennTemperatur und Feuchtigkeitwechseln, zum Beispieldurch das Ein- und Ausschaltenvon <strong>Licht</strong>quellen,beschleunigt sich die physikalischeVerän<strong>de</strong>rung.An<strong>de</strong>rs als die molekulareVerän<strong>de</strong>rung bei photochemischenProzessen, diezum Stillstand kommenkann, wirkt die thermischeBelastung durch Bestrahlungimmer schädigend.Die thermodynamische Wirkung<strong>de</strong>r Strahlung am Objektwird durch seine thermischeEmpfindlichkeit und<strong>Licht</strong>-PassExakte Aussagen über<strong>de</strong>n Vorbelichtungszustan<strong>de</strong>ines Objekts sindnur möglich, wenn dieVorbelichtung in einem<strong>Licht</strong>-Pass dokumentiertist. Zur Buchführunggehören Angaben überdie Ausstellungsperio<strong>de</strong>nsowie jeweils dieArt <strong>de</strong>r eingesetzten<strong>Licht</strong>quelle, die Beleuchtungsstärkeund die Bestrahlungsdauer.die spektrale Bestrahlungsstärkeam Objekt bestimmt.Dabei ist vor allem die absorbierteStrahlung maßgebend.Für die thermischeBelastung <strong>de</strong>s Ausstellungsraumsdurch künstlicheBeleuchtung ist dasProdukt aus <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>ausbeute<strong>de</strong>r Lampen und<strong>de</strong>m Beleuchtungswirkungsgrad<strong>de</strong>r Beleuchtungsanlageentschei<strong>de</strong>nd.Schutzmaßnahmengegen thermodynamischeProzesseDie Schutzmaßnahmen gegenWärmebelastung korrespondierenmit <strong>de</strong>nengegen photochemischeProzesse. Die wirksamenMaßnahmen sind: Wahl <strong>de</strong>r geeigneten<strong>Licht</strong>quelle: Für wärmeempfindlicheMaterialien eignensich nur Lampen, <strong>de</strong>ren<strong>Licht</strong> wenig IR-Strahlungenthält. Bei Verwendungvon Nie<strong>de</strong>rvolt-Halogenlampensind Kaltlichtspiegel-Lampendie richtigeWahl. Keine IR-Strahlung istim <strong>Licht</strong>bün<strong>de</strong>l von faseroptischenBeleuchtungssystemenund LEDs enthalten. Ausfiltern <strong>de</strong>r schädigen<strong>de</strong>nStrahlung mit IR-Filtern Begrenzung <strong>de</strong>r Belichtung Ableitung <strong>de</strong>r Wärme:Auch bei Lampen, <strong>de</strong>ren<strong>Licht</strong>strom wenig Wärmeenthält, kann sich dieLeuchte und ihre unmittelbareUmgebung erwärmen.Das ist zum Beispiel in Vitrinenmöglich. Damit diesesekundäre IR-Strahlungkeine Schä<strong>de</strong>n anrichtet,muss sie abgeleitet wer<strong>de</strong>n.Die Luftzirkulation kann gegebenenfallsmit Ventilatorenerhöht wer<strong>de</strong>n. Die IR-Strahlung <strong>de</strong>sTageslichts ist genausoschädlich wie die von Lampen.Direktes Sonnenlichtmuss daher immer „ausgesperrt“wer<strong>de</strong>n.Relative spektrale EmpfindlichkeitGruppe Materialproben in %empfindlich Ölfarben auf Leinwand 100sehrempfindlichTextilproben 300Aquarellfarben aufBüttenpapier 485Die relative spektrale Empfindlichkeit <strong>de</strong>r hier aufgeführtenMaterialien bezieht sich auf die Schädigungswirkung beiÖlgemäl<strong>de</strong>n (Bezugswert: 100 Prozent). Aquarelle sind<strong>de</strong>mnach mit 485 Prozent fast fünfmal stärker gefähr<strong>de</strong>t alsÖlgemäl<strong>de</strong>. Die Beleuchtungsstärke auf <strong>de</strong>m Objekt beträgt200 Lux – ein Kompromiss zwischen <strong>de</strong>r für die Sehaufgabenotwendigen Helligkeit und <strong>de</strong>n konservatorischen Anfor<strong>de</strong>rungen;sehr empfindliche Objekte sollten mit maximal50 Lux beleuchtet wer<strong>de</strong>n.Relatives Schädigungspotenzial von <strong>Licht</strong>quellen<strong>Licht</strong>quelleohneKantenfilterFensterglasFilterkante bei (nm)380 400 420 einfach doppeltin ProzentTageslicht 235 155 130 110 205 190Allgebrauchs- 85 75 70 65 80 75GlühlampeNV-Halogen- 100 80 75 70 90 90lampeHalogen- 220 175 145 110 210 210Metalldampf-HochdrucklampeLeuchtstoff- 100 85 80 70 95 90lampeneutralweißLeuchtstoff- 90 75 70 60 85 85lampewarmweißLED kaltweiß 80 80 80 75 80 80Das relative Schädigungspotenzial <strong>de</strong>s Tageslichts und <strong>de</strong>r hieraufgeführten Lampen bezieht sich auf die Schädigungswirkung,die das ungefilterte <strong>Licht</strong> von Nie<strong>de</strong>rvolt-Halogenlampen hat(Bezugswert: 100 Prozent). Ein Objekt, das zum Beispiel 1.000Stun<strong>de</strong>n lang bei 200 Lux Beleuchtungsstärke <strong>de</strong>m <strong>Licht</strong> einerHalogen-Metalldampflampe mit einem Kantenfilter bei 380 nm(einfacher UV-Schutz) ausgesetzt ist, erfährt mit 180 Prozenteine fast doppelt so starke Schädigung wie durch eine ungefilterteNie<strong>de</strong>rvolt-Halogenlampe.Das be<strong>de</strong>utet vice versa: Für <strong>de</strong>nselben Grad <strong>de</strong>r Schädigungkann das Objekt mit <strong>de</strong>m ungefilterten <strong>Licht</strong> einer Nie<strong>de</strong>rvolt-Halogenlampe fast doppelt so lange o<strong>de</strong>r fast doppelt so starkbeleuchtet wer<strong>de</strong>n wie mit <strong>de</strong>m gefilterten <strong>Licht</strong> <strong>de</strong>r Halogen-Metalldampflampe.32
WartungDurch Alterung und Verschmutzungvon Lampen,Leuchten und Raumoberflächensinkt die Beleuchtungsstärke.Aus diesemGrund muss je<strong>de</strong> Beleuchtungsanlageregelmäßig gewartetwer<strong>de</strong>n. Die in <strong>de</strong>neuropäischen Beleuchtungsnormenwie DIN EN12464-1 angegebenenWerte wie zum Beispiel dieHöhe <strong>de</strong>r Beleuchtungsstärkesind Wartungswerte. Dasheißt, sie dürfen zu keinerZeit unterschritten wer<strong>de</strong>n.Höhere NeuwerteinstallierenUm das angestrebte Beleuchtungsniveauüber einengeeigneten Zeitraumsicherzustellen und die Beleuchtungsanlagelängerohne zusätzliche Wartungsarbeitenbetreiben zu können,muss ein entsprechendhöherer Neuwert installiertwer<strong>de</strong>n. Dieser wird mithilfe<strong>de</strong>s Wartungsfaktors festgelegt.Der Wartungsfaktor hängtab von <strong>de</strong>n Betriebsbedingungensowie <strong>de</strong>r Art <strong>de</strong>reingesetzten Lampen, Betriebsgeräteund Leuchten.Planer (und Betreiber) müssen<strong>de</strong>n Wartungsfaktor dokumentierenund festlegen.Er ist Grundlage <strong>de</strong>s Wartungsplans.Der Neuwerterrechnet sich wie folgt:Neuwert = Wartungswert /Wartungsfaktor.Mehr Wartung für AusstellungsräumeFür Ausstellungsräume gebendie Normen keinen <strong>de</strong>finitivenWartungsfaktor an.Dieser muss individuell ermitteltwer<strong>de</strong>n. Danach sollte<strong>de</strong>r Wartungsplan erstelltwer<strong>de</strong>n. Insgesamt ist <strong>de</strong>rWartungsaufwand in Ausstellungsräumenetwashöher als in an<strong>de</strong>ren Bereichen,weil er über die regelmäßigeReinigung hinausgeht: Die Anzahl verschie<strong>de</strong>nerLeuchtentypen mit unterschiedlicherBestückung,ihre Verstellbarkeit sowie dieBild 83: Alle Beleuchtungsanlagenmüssen regelmäßiggewartet wer<strong>de</strong>n, weil dieBeleuchtungsstärke durchAlterung und Verschmutzungmit <strong>de</strong>r Zeit sinkt.Handhabung <strong>de</strong>s Zubehörswie Filter, Linsen usw. erhöhen<strong>de</strong>n Wartungsaufwandper se. BedienerfreundlicheLeuchten, die unter an<strong>de</strong>remeinfach fixierbar sind,und eine begrenzte Oberflächentemperaturhaben,erleichtern die Wartung wie<strong>de</strong>rum. Nach <strong>de</strong>r Reinigung o<strong>de</strong>rbeim Wechsel einzelner Exponateist darauf zu achten,die Leuchten wie<strong>de</strong>r richtigauszurichten. Leuchten sollten möglichstnicht verbaut wer<strong>de</strong>n, auchnicht durch Aufbauten auf<strong>de</strong>m Bo<strong>de</strong>n. Denn schwereErreichbarkeit erhöht <strong>de</strong>nWartungsaufwand erheblich. Muss eine Leuchte ersetztwer<strong>de</strong>n, sollte die neuemöglichst aus <strong>de</strong>rselbenLeuchtenfamilie stammen. Wenn einzelne Lampenausgefallen sind, müssendiese sofort ersetzt wer<strong>de</strong>n.Dabei ist darauf zu achten,dass die neue Lampe dieselbe<strong>Licht</strong>farbe hat wie diean<strong>de</strong>ren Lampen einerLeuchtengruppe. Von Zeitzu Zeit kann ein Gruppenwechsel<strong>de</strong>r Lampen sinnvollsein. Betriebsgeräte, die dieLebensdauer von Lampenerhöhen, wirken sich positivauf <strong>de</strong>n Wartungsaufwandaus. Für <strong>de</strong>n Betrieb vonLeuchtstoff- und Kompaktleuchtstofflampensollten<strong>de</strong>shalb elektronische Vorschaltgeräte(EVG) eingesetztwer<strong>de</strong>n.Wirtschaftliches <strong>Licht</strong>Die Beleuchtung selbst hat einen relativ geringen Anteilam gesamten Energieverbrauch. Trotz<strong>de</strong>m zählt je<strong>de</strong>Einsparung. Wer energie- und kostenbewusst beleuchtenwill, setzt auf langlebige Lampen mit hoher <strong>Licht</strong>ausbeute(Lumen/Watt-Wert), auf wirtschaftliche Betriebsgeräte wie elektronischeVorschaltgeräte (EVG) für Leuchtstofflampen, wirtschaftliche Leuchten mit guten optischen Eigenschaftenund anwendungsgerechte <strong>Licht</strong>stärkeverteilungen.Außer<strong>de</strong>m sollte das <strong>Licht</strong> bedarfsgerecht sein. So wärees zum Beispiel nicht richtig, auf gerichtetes <strong>Licht</strong> zuverzichten, nur weil die meisten dafür geeigneten Lampeneine geringere <strong>Licht</strong>ausbeute haben als Leuchtstofflampen.Über Einsparpotenziale informiert FGL-Heft12 „Beleuchtungsqualität mit Elektronik“ (siehe Seite 45).NotbeleuchtungFür die meisten Räume im Museum ist eine netzunabhängigeNotbeleuchtung vorgeschrieben. Beim Ausfall<strong>de</strong>r Stromversorgung soll sie Besuchern und Personaldas gefahrlose Verlassen <strong>de</strong>s Gebäu<strong>de</strong>s ermöglichen.Voraussetzung dafür ist die Sicherheitsbeleuchtung<strong>de</strong>r Rettungswege und <strong>de</strong>ren Kennzeichnung.Errichtung, Betrieb und Wartung <strong>de</strong>r Notbeleuchtungsind unter an<strong>de</strong>rem geregelt in DIN EN 1838 und DIN4844 für die lichttechnischen Anfor<strong>de</strong>rungen sowie inDIN VDE 0108 für die elektrotechnischen Vorgaben.Ausführlich informiert FGL-Heft 10 „Notbeleuchtung,Sicherheitsbeleuchtung“ (siehe Seite 45).8333
Lampen1, 23, 4, 566 67141416161311 12131517ww = WarmweißFarbtemperaturunter 3.300 Knw = NeutralweißFarbtemperatur3.300 bis 5.300 Ktw = TageslichtweißFarbtemperaturüber 5.300 KMerkmaleLampenleistung(Watt)Lampentypvonbis<strong>Licht</strong>strom (Lumen) bzw. von<strong>Licht</strong>stärke (Can<strong>de</strong>la) bisLampen-<strong>Licht</strong>ausbeute von(Lumen/Watt)bis<strong>Licht</strong>farbeFarbwie<strong>de</strong>rgabe-In<strong>de</strong>x R a(zum Teil als Bereich)SockelDreiban<strong>de</strong>n Ø 26 mm„De Luxe“ Ø 26 mm1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Stabförmige LeuchtstofflampenDreiban<strong>de</strong>n Ø 16 mm 4)hohe <strong>Licht</strong>ausbeuteDreiban<strong>de</strong>n Ø 16 mm 4)hoher <strong>Licht</strong>strom„De Luxe“ Ø 16 mm1-, 2- o<strong>de</strong>r 3-Rohrlampe4-Rohrlampe undquadratische BauformGestreckte BauformKompaktleuchtstofflampen„De Luxe“ gestreckteBauform3- o<strong>de</strong>r 4-Rohrlampe 4)RingformInduktionslampen18 18 14 24 24 5 16 18 18 60 70 55 6)58 58 35 80 54 70 38 80 5) 55 120 150 165 6)1.350 870 1.100 1.650 1.300 250 1.050 1.200 750 4.000 6.500 3.6505.200 4.600 3.300 6.150 3.550 5.200 2.800 6.000 3.650 9.000 12.000 12.00075 1) 61 2) 79 (93 3) ) 69 (84 3) ) 58 (67 3) ) 50 61 67 42 67 75 6) 66 6)89 1) 79 2) 93 (104 3) ) 88 (99 3) ) 76 (79 3) ) 82 78 87 66 75 79 6) 73 6)ww,nw, tw ww,nw, tw ww,nw, tw ww,nw, tw ww,nw, tw ww,nw, tw ww,nw, tw ww,nw, tw ww,nw, tw ww, nw ww, nw ww, nw85 90 85 85 90 80–85 80–85 80–85 90 80–85 80–85 80–85G23, G24 2G10G13 G13 G5 G5 G5 2G7 GR8 2G11 2G11 2G8-1 Spezial SpezialGX24 GR10q34
7 108, 910Die Tabelle gibt eine Übersicht über die wichtigstenLampentypen. Die Leistungsdaten sind alsvon/bis-Bereiche zusammengefasst. GenauereWerte für einzelne Lampen und weitere Daten,zum Beispiel zur Lampenlebensdauer, enthaltendie Kataloge <strong>de</strong>r Hersteller.Die elektrische Leistung gibt an, wieviel Watt (W)von <strong>de</strong>r Lampe aufgenommen wird. Für <strong>de</strong>n Betriebvon Entladungslampen (Lampen 1 bis 15)sind Vorschaltgeräte erfor<strong>de</strong>rlich, die zusätzlichelektrische Energie verbrauchen. Diese Vorschaltgeräteverlustesind in <strong>de</strong>r Tabelle nicht berücksichtigt(Ausnahmen: Lampen 11 und 12).Der <strong>Licht</strong>strom in Lumen (lm) ist die in alle Richtungenabgestrahlte <strong>Licht</strong>menge einer Lampe. FürReflektorlampen wird statt <strong>de</strong>s <strong>Licht</strong>stroms die<strong>Licht</strong>stärke (siehe Seite 29) in Can<strong>de</strong>la (cd) ausgewiesen.Wie wirtschaftlich eine Lampe (ohneReflektor) <strong>Licht</strong> erzeugt, beschreibt ihre <strong>Licht</strong>ausbeutein Lumen/Watt. Je höher das Verhältnislm/W, <strong>de</strong>sto besser setzt eine Lampe die eingebrachteEnergie in <strong>Licht</strong> um.18 1819 192021 21 21 22212323, 2425Lampen haben unterschiedliche <strong>Licht</strong>farben, entsprechendihrer Farbtemperatur (in Kelvin, K):Warmweiß (ww), Neutralweiß (nw) o<strong>de</strong>r Tageslichtweiß(tw). Zur Bewertung <strong>de</strong>r Farbwie<strong>de</strong>rgabe-Eigenschaften von Lampen dient <strong>de</strong>r allgemeineFarbwie<strong>de</strong>rgabe-In<strong>de</strong>x R a . Der Maximalwertbeträgt R a = 100. Je niedriger <strong>de</strong>r In<strong>de</strong>x, <strong>de</strong>stoschlechter ist die Farbwie<strong>de</strong>rgabe <strong>de</strong>r Lampe.Der Sockel stellt die mechanische Verbindung zurLeuchte her und dient <strong>de</strong>r Stromversorgung <strong>de</strong>rLampe. Grundsätzlich zu unterschei<strong>de</strong>n sind Lampensockelzum Schrauben (alle E-Sockel) undzum Stecken.KolbenformEinseitig gesockelt(Keramiktechnik)Zweiseitig gesockelt(Keramiktechnik)Stecksockel,stark farbverbessertMit HüllkolbenMit Alu-ReflektorMit Alu- o<strong>de</strong>rKaltlichtreflektorOhne HüllkolbenZweiseitig gesockelt13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25Halogen-MetalldampflampenNa-HochdruckHalogenlampen (230 V)Nie<strong>de</strong>rvolt-Halogenlampen (12 V)20 70 35 25 40 20 25 60 5 10 10 20 35250 250 100 230 100 75 75 2.000 100 50 50 50 1001.600 5.100 1.300 260 850 160 260 840 60 250 300 450 1.40025.000 25.000 5.000 4.350 8.500 3.000 1.100 44.000 2.200 1.400 13.000 16.000 48.00080 73 39 10 _ _ 10 14 12 _ _ _ _100 100 52 19 15 22 27ww, nw ww, nw ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww ww80–85 75–95 80–85 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100G12, G22G4Fc2 E14 E14 GU10GU6,5/G8,5PG12-1G9 R7s GY6,35RX7sE27 E27 GZ10PGJ5 G8,5Stiftsockel ohne/mitIR-BeschichtungG4GY6,35G4GU5,3GU5,3Stiftsockel,mit ReflektorMit Alu- o<strong>de</strong>rKaltlichtreflektorMit Alu- o<strong>de</strong>r Kaltlichtreflektor,IR-BeschichtungMit Alureflektor, Ø 111 mm,ohne/mit IR-BeschichtungG531) Bei Betrieb mit EVGsteigt die <strong>Licht</strong>ausbeuteauf 81 bis 100 Im/W.2) Bei Betrieb mit EVGsteigt die <strong>Licht</strong>ausbeuteauf 66 bis 88 Im/W.zu 1 + 2)Die Leistungsaufnahmesinkt jeweils von 18 Wauf 16 W, von 36 W auf32 W und von 58 W auf50 W.3) Hoher Wert nur bei35° C Umgebungstemperaturrealisierbar4) Betrieb nur mit EVG5) 40 W, 55 W und 80 Wnur mit EVG6) System (Lampe + EVG)35
Lampen1, 23, 4, 566 67 1071014148, 91316 1618 1819 1921 21 21 22212311 1213152023, 2417 2584Stabförmige Dreiban<strong>de</strong>n-Leuchtstofflampen mit26 mm (1) o<strong>de</strong>r 16 mm (3,4) Durchmesser sind sehrlanglebig und haben generelleine hohe <strong>Licht</strong>ausbeute.Sie arbeiten noch energieeffizienter,wenn sie anelektronischen Vorschaltgeräten(EVG) betriebenwer<strong>de</strong>n; Ø 16 mm-Lampensetzen <strong>de</strong>n EVG-Betriebvoraus. Warmstart-EVGerhöhen die Lebensdauerdieser Lampen.Dreiban<strong>de</strong>n-Leuchtstofflampengibt es in allen <strong>Licht</strong>farben.Die Farbwie<strong>de</strong>rgabeist gut (R a -In<strong>de</strong>x 85): Lampenmit <strong>de</strong>m Namenszusatz„<strong>de</strong> Luxe“ (2, 5)haben sehr gute Farbwie<strong>de</strong>rgabe-Eigenschaften(R a -In<strong>de</strong>x 90), spezielletageslichtweiße Ausführungenerreichen <strong>de</strong>n R a -In<strong>de</strong>x98. Die <strong>Licht</strong>ausbeute <strong>de</strong>r„<strong>de</strong> Luxe“-Lampen ist jedochetwas geringer. Wennsie an entsprechen<strong>de</strong> EVGangeschlossen sind, könnenLeuchtstofflampen gedimmtwer<strong>de</strong>n.Stabförmige Leuchtstofflampenbestimmen die langgestreckteBauform <strong>de</strong>rLeuchte, Kompaktleuchtstofflampeneignen sichauch für kleinere rechteckigeund run<strong>de</strong> Leuchten. Zu<strong>de</strong>n kleineren Bauformen(6) gesellen sich 4-Rohr-Lampen und quadratischeAusführungen (7), Lampengestreckter Bauform (8, 9)und als NeuentwicklungLampen mit hohem <strong>Licht</strong>strom(10).Kompaktleuchtstofflampenhaben dieselben positivenEigenschaften wie die stabförmigeDreiban<strong>de</strong>n-Leuchtstofflampe: (sehr)lange Lebensdauer, hohe<strong>Licht</strong>ausbeute, gute bis –bei „<strong>de</strong> Luxe“-Ausführungen– sehr gute Farbwie<strong>de</strong>rgabeeigenschaften,Auswahlunter allen <strong>Licht</strong>farben.Lampen für <strong>de</strong>n energieeffizientenBetrieb an EVG haben4-Stift-Sockel, fast allekönnen an dimmbarenEVG betrieben wer<strong>de</strong>n.Bild 84: Dies sind die wichtigstenLampentypen für die Beleuchtungvon Museen, Galerienund Austellungen. Ihre Leistungsdatenfasst die Tabelle auf<strong>de</strong>n Seiten 34/35 direkt vordieser Doppelseite zusammen.Weil sie keine verschleißen<strong>de</strong>nKomponenten wieGlühwen<strong>de</strong>ln o<strong>de</strong>r Elektro<strong>de</strong>nhaben, sind Induktionslampen(11, 12) mitbis zu 60.000 Betriebsstun<strong>de</strong>näußerst langlebig. Siemüssen <strong>de</strong>shalb selten gewechseltwer<strong>de</strong>n, eignensich daher beson<strong>de</strong>rs gutfür hohe Räume undschwer zugängliche Decken,zum Beispiel überRolltreppen. Ihr <strong>Licht</strong> erzeugendiese Lampen durchdie elektromagnetische Induktioneiner Gasentladung.Halogen-Metalldampflampen(13, 14) sind lichtstarkeund wirtschaftliche<strong>Licht</strong>quellen. Sie vereineneine sehr kompakte Bauform,die optimale <strong>Licht</strong>lenkungermöglicht, mit hoher<strong>Licht</strong>ausbeute, (sehr)guter Farbwie<strong>de</strong>rgabe undlanger Lebensdauer. Dieein- o<strong>de</strong>r zweiseitig gesockeltenLampen gibt esmit <strong>de</strong>n <strong>Licht</strong>farben Warmweißund Neutralweiß, fastalle haben UV-absorbieren<strong>de</strong>Kolben.Natriumdampf-Hochdrucklampen(15) zeichnensich generell durch beson<strong>de</strong>rswarmweißes <strong>Licht</strong>ohne UV-Anteil und einesehr hohe <strong>Licht</strong>ausbeuteaus. Für die Innenraumbeleuchtungeignet sich ausschließlichdie Ausführung„stark farbverbessert“ mit<strong>de</strong>m Farbwie<strong>de</strong>rgabe-In<strong>de</strong>x36
Bild 85: Bei <strong>de</strong>n Leuchtdio<strong>de</strong>n(LEDs) fin<strong>de</strong>t die <strong>Licht</strong>erzeugungin einem Halbleiter statt, <strong>de</strong>relektrisch zum Leuchten angeregtwird (Elektrolumineszenz).Zum Schutz vor Umwelteinflüssenwird <strong>de</strong>r Halbleiter in einGehäuse eingebracht.Es gibt Einzel-LEDs und – wiehier im Bild – LED-Module. Basis<strong>de</strong>r Module ist eine Leiterplatte,die außer <strong>de</strong>n Halbleiterkristalleno<strong>de</strong>r Einzel-LEDs auchalle an<strong>de</strong>ren Komponenten –unter an<strong>de</strong>rem zur Ansteuerung<strong>de</strong>r LEDs – trägt.85R a 80–85, die jedoch einegeringere <strong>Licht</strong>ausbeute hatals an<strong>de</strong>re Natriumdampf-Hochdrucklampen.Angenehm frisches, warmweißesund außergewöhnlichbrillantes <strong>Licht</strong> kennzeichnetHalogenlampen(16–25). Sie haben einehöhere <strong>Licht</strong>ausbeute alsAllgebrauchsglühlampenund eine längere Lebensdauer.Dabei bleibt über diegesamte Zeit <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>stromkonstant – ein Ergebnis<strong>de</strong>s Halogen-Kreisprozesses:Die Halogene im Füllgas<strong>de</strong>r Lampe transportierenvon <strong>de</strong>r Glühwen<strong>de</strong>lverdampfte Wolframteilchenwie<strong>de</strong>r zurück an die heißeWen<strong>de</strong>l, Wolfram und Halogenestehen erneut für <strong>de</strong>nKreisprozess zu Verfügung.So bleibt <strong>de</strong>r Glaskolbenfrei von Schwärzungendurch Nie<strong>de</strong>rschlag vonWolfram, <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>stromwird nicht reduziert.Es gibt die ein- o<strong>de</strong>r zweiseitiggesockelten Halogenlampenin zahlreichen Bauformenund Leistungsstufen.Grundsätzlich zu unterschei<strong>de</strong>nsind Lampen fürNetzspannung 230 Volt(16–20) – sie wer<strong>de</strong>n auchals Hochvolt-Halogenlampenbezeichnet – und Nie<strong>de</strong>rvolt-Halogenlampen(21–25) – überwiegend12 Volt, auch 6 o<strong>de</strong>r 24 Volt–, die mit vorgeschaltetemkonventionellen o<strong>de</strong>r elektronischenTransformatorbetrieben wer<strong>de</strong>n müssen.230 Volt-Lampen sind uneingeschränktdimmbar.Das Dimmen von Nie<strong>de</strong>rvolt-Lampenerfor<strong>de</strong>rt entsprechen<strong>de</strong>Dimmer/Trafo-Kombinationen.Eine spezielle IR-Beschichtung<strong>de</strong>s Lampenkolbenskann <strong>de</strong>n Energieverbrauch<strong>de</strong>r Halogenlampen beigleichem <strong>Licht</strong>strom um biszu 45 Prozent senken.Die Beschichtung – siewird eingesetzt in zweiseitiggesockelten 230-Volt-Lampen (20) und in Nie<strong>de</strong>rvolt-Lampen(21, 24,25) – reflektiert die von <strong>de</strong>rGlühwen<strong>de</strong>l abgegebeneWärmestrahlung zumgroßen Teil wie<strong>de</strong>r auf dieWen<strong>de</strong>l.Bei 230-Volt- und bei Nie<strong>de</strong>rvolt-Lampengibt esAusführungen mit Kaltlichtreflektor.Sie haben einenfacettierten Reflektor, <strong>de</strong>rals Kaltlichtspiegel ausgeführtist: Dieser verringertdie Wärmeabstrahlung im<strong>Licht</strong>bün<strong>de</strong>l um zwei Drittel.Die „ausgefilterte“ Wärmewird durch <strong>de</strong>n Reflektornach hinten abgeleitet.<strong>Licht</strong> emittieren<strong>de</strong> Dio<strong>de</strong>n(LEDs), wie sie Bild 85zeigt, sind als <strong>Licht</strong>quellenfür Beleuchtungszweckenoch nicht lange im Einsatz.Als sehr kleine <strong>Licht</strong>quellenerzeugen sie das<strong>Licht</strong> sehr effizient. Außer<strong>de</strong>mhaben sie eineäußerst lange Lebensdauer(bis zu 50.000 Betriebsstun<strong>de</strong>n).Bei <strong>de</strong>n Leuchtdio<strong>de</strong>nfin<strong>de</strong>t die <strong>Licht</strong>erzeugungin einem Halbleiterstatt, <strong>de</strong>r elektrisch zumLeuchten angeregt wird(Elektrolumineszenz). ZumSchutz vor Umwelteinflüssenwird <strong>de</strong>r Halbleiter inein Gehäuse eingebracht.Es gibt Einzel-LEDs undLED-Module.LEDs erzeugen im Gegensatzzu herkömmlichenLeuchtmitteln monochromeFarben. Weißes <strong>Licht</strong> wirdmittels Lumineszenskonversionerzeugt: Das <strong>Licht</strong> einermonochrom blauenLED wird durch einen Konverterstoffwie zum BeispielPhosphor geleitet.Das <strong>Licht</strong> von LEDs enthältkeine ultraviolette (UV) undinfrarote (IR) Strahlung. Siekönnen <strong>de</strong>shalb gut für dieBeleuchtung licht- und wärmeempfindlicherAusstellungsstückeeingesetzt wer<strong>de</strong>n.Die <strong>Licht</strong>quelle LED begannihre Karriere als StatusundSignalanzeige in elektrischenGeräten und imAuto. Mit <strong>de</strong>r Entwicklungneuer farbiger LEDs erobertendie Leuchtdio<strong>de</strong>nschnell Effekt- und Displaybeleuchtung,hatten baldauch einen festen Platz in<strong>de</strong>r Orientierungsbeleuchtung.In ersten SchreibtischundStehleuchten stellenweiße LEDs bereits „<strong>Licht</strong>zum Sehen“ zur Verfügung.Die Helligkeit von LED-<strong>Licht</strong>kann verän<strong>de</strong>rt wer<strong>de</strong>n:Wenn <strong>de</strong>r Betriebsstromvariiert, verän<strong>de</strong>rt sich <strong>de</strong>rabgegebene <strong>Licht</strong>stromproportional. Diese Funktionentspricht im Ergebnis <strong>de</strong>mDimmen; sie wird vor allemfür Effekte genutzt.Weitergehen<strong>de</strong> Informationengibt FGL-Heft 17 „LED– <strong>Licht</strong> aus <strong>de</strong>r Leuchtdio<strong>de</strong>“,siehe Seite 45.37
LeuchtenDer gesamte Beleuchtungskörper inklusive aller für Befestigung,Betrieb und Schutz <strong>de</strong>r Lampe notwendigenKomponenten ist die „Leuchte“. Sie schützt die Lampe,verteilt und lenkt <strong>de</strong>ren <strong>Licht</strong>, verhin<strong>de</strong>rt, dass es blen<strong>de</strong>t.Die schematisierten, nicht maßstabsgerechten Darstellungendieser Doppelseite zeigen eine Auswahl typischerInnen- (Abb. 17 bis 40) und Außenleuchten (Abb.41 und 44). Auf <strong>de</strong>r folgen<strong>de</strong>n Doppelseite wird eineStrahler-Typologie gezeigt und Zubehör vorgestellt.Auswahlkriterien<strong>Licht</strong>technische Qualität, Wirtschaftlichkeit, Sicherheit sowieMontage- und Bedienerfreundlichkeit sind wichtigeAspekte <strong>de</strong>r Leuchtenkonstruktion. Das Design technischerQualitätsleuchten – also Gehäuseform, Oberflächengestaltund Farbgebung – steht ihrer Funktionalitätin nichts nach.Abb. 21 + 22Einbau-Wandfluter mit asymmetrischer <strong>Licht</strong>verteilung, <strong>de</strong>r rechtemit einem „Kickspiegel“ zur <strong>Licht</strong>lenkung auch auf die DeckenkanteBetriebssicherheit und Normenkonformität von Leuchtendokumentieren das VDE-Zeichen und das gleichwertigeeuropäische Prüfzeichen ENEC. Bei<strong>de</strong> vergibt das OffenbacherInstitut <strong>de</strong>s Verban<strong>de</strong>s <strong>de</strong>r Elektrotechnik ElektronikInformationstechnik (früher: Verband <strong>Deutsch</strong>er Elektrotechniker),das ENEC-Zeichen mit <strong>de</strong>m I<strong>de</strong>ntifikationszusatz„10“.Die Leuchtenauswahl ist auch abhängig von <strong>de</strong>r Wahl<strong>de</strong>r Lampen. Die Entscheidung wird außer<strong>de</strong>m wesentlichbestimmt von <strong>de</strong>r Architektur <strong>de</strong>s Raumes, seinerEinrichtung und <strong>de</strong>r gestalterischen Konzeption.<strong>Licht</strong><strong>de</strong>ckeAbb. 23 + 24Abb. 17 + 18Strahler für Stromschienen (links) und schwenkbares Einbau-Downlightmit Strahlercharakteristik (rechts); Stromschienen eignen sichauch für <strong>de</strong>n Deckeneinbau.Abb. 25 + 26Voutenleuchte, <strong>de</strong>ren Leuchtenkörper die Voute bil<strong>de</strong>t (links), und<strong>Licht</strong> aus bauseitiger Voute (rechts)Abb. 19 + 20Downlights mit symmetrischer <strong>Licht</strong>verteilung (links) und mit asymmetrischer<strong>Licht</strong>verteilung (rechts)<strong>Licht</strong>kanäle mit klarer (links) und opaler (rechts) Ab<strong>de</strong>ckungAbb. 27 + 2838
Abb. 29 + 30Indirektleuchte mit Leuchtstofflampen für Stromschienen, betriebenin <strong>de</strong>r <strong>de</strong>ckenseitigen Führung an einer StromschienenphaseAbb. 37 + 38<strong>Licht</strong> zum Arbeiten: Pen<strong>de</strong>lleuchte für stabförmige Leuchtstofflampenmit direkt/indirekter <strong>Licht</strong>verteilungAbb. 31 + 32Kardanisch verstellbare Strahler als Einbau-Downlight mit Strahlercharakteristik(links) und als Stromschienenstrahler (rechts); Stromschieneneignen sich auch für <strong>de</strong>n DeckeneinbauRettungszeichenleuchteAbb. 39 + 40Abb. 33 + 34Faseroptisches Beleuchtungssystem für Vitrinen: Die <strong>Licht</strong>leitersind durch gebogene Rohre geführt. Ein optisches Anschlussstückam Faser- bzw. Rohren<strong>de</strong> verteilt das <strong>Licht</strong>.Abb. 41 + 42Er<strong>de</strong>inbauscheinwerfer (links) für Anstrahlungen und akzentuiertes<strong>Licht</strong> sowie Orientierungsleuchten zum Wan<strong>de</strong>inbau (rechts)Abb. 35 + 36LED-Miniaturleuchte, hier eingesetzt zur Vitrinenbeleuchtung unddafür installiert im oberen VitrinenabschlussAbb. 43 + 44Scheinwerfer für Anstrahlungen mit Reflektoren für die <strong>Licht</strong>verteilungenSpot (links) und Flood (rechts)39
LeuchtenFür die Objektbeleuchtungin Museen, Galerien undAusstellungen sind Strahlerund Leuchten mit Strahlercharakteristikvon zentralerBe<strong>de</strong>utung. Die technischeinfachste Form einesStrahlers kommt ohne Reflektoraus, weil dieser in<strong>de</strong>r Lampe integriert ist. Inallen an<strong>de</strong>ren Fällen steuertein Reflektor im Strahlergehäuse<strong>de</strong>n Hauptstrahl.Die lichttechnische Qualitäteines Strahlers o<strong>de</strong>r einerLeuchte mit Strahlercharakteristikhängt unmittelbarzusammen mit <strong>de</strong>r Minimierung<strong>de</strong>s Streulichtanteils,da dieser in größerenEntfernungen unerwünschteAufhellungen o<strong>de</strong>r sogarBlendung verursachenkann.Typografie <strong>de</strong>r StrahlerDie Abbildungen 45, 47,49 und 51 zeigen die fünfwichtigsten Strahlertypenund ihre Ausstrahlungscharakteristik,die Abbildungen46, 48, 50 und 52 dieentsprechen<strong>de</strong>n <strong>Licht</strong>stärkeverteilungskurven.DieGrenzen zwischen diesengenerischen Gruppen sindjedoch fließend, weil sichin Abhängigkeit von <strong>de</strong>nunterschiedlichen Reflektorenund <strong>de</strong>n eingesetztenLampen Überschneidungenergeben.Abb. 45 + 46Punktstrahler 8° mit Glühfa<strong>de</strong>nblen<strong>de</strong>, die verhin<strong>de</strong>rt, dass <strong>de</strong>rGlühfa<strong>de</strong>n außerhalb <strong>de</strong>s Öffnungswinkels sichtbar ist: symmetrischer,extrem engstrahlen<strong>de</strong>r Spot bis maximal 8° mit sehr hoher<strong>Licht</strong>stärke; Bestückung: Nie<strong>de</strong>rvolt-Halogenlampe Ø 111 mmAbb. 47 + 48Punktstrahler 12° bis 24° mit Lampenblen<strong>de</strong>, die Streulicht undBlendung außerhalb <strong>de</strong>s Öffnungswinkels verhin<strong>de</strong>rt: symmetrischer,engstrahlen<strong>de</strong>r Spot, in Relation zu <strong>de</strong>m 8°-Punktstrahler mit halbierter<strong>Licht</strong>stärke; Bestückung: Nie<strong>de</strong>rvolt-Halogenlampe Ø 111 mmo<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re Nie<strong>de</strong>rvoltlampen, auch mit KaltlichtreflektorAbb. 49 + 50Akzentstrahler 24° bis 38°: symmetrischer Strahler, im Vergleichzu <strong>de</strong>n Spot-Strahlern mit weniger klar <strong>de</strong>finierter <strong>Licht</strong>wirkung, mitzunehmend weichen Konturen aufgrund <strong>de</strong>s Nebenlichtanteils, <strong>Licht</strong>strahlselbst mit <strong>de</strong>nnoch ten<strong>de</strong>nziell hartem Zentrum; Bestückung:diverse Nie<strong>de</strong>rvolt-HalogenlampenZubehör für StrahlerFür Strahler gibt es zahlreichesZubehör. Vorsätze,Linsen und Filter sind vielfachaus <strong>de</strong>r Welt <strong>de</strong>sTheaters entlehnt, ihrewichtigsten Einsatzgebietesind außer AusstellungsräumenSchaufenster undVerkaufsräume. Das Zubehörwird mithilfe entsprechen<strong>de</strong>rInstallationsvorrichtungendirekt amStrahler vor <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>austrittsöffnungangebracht.VorsätzeDie wichtigsten Vorsätzesind solche für <strong>de</strong>n Blendschutz.Sie verhin<strong>de</strong>rnStreulicht und blen<strong>de</strong>n <strong>de</strong>n<strong>Licht</strong>austritt ab: Abblendzylin<strong>de</strong>ro<strong>de</strong>r Barn Doors.Auch Wabenraster dienen<strong>de</strong>m Blendschutz. WeitereVorsätze sind Kreuzraster,Konturenschieber, Globohalterund an<strong>de</strong>re Projektionsvorsätze.Auch Vorsatzringe– zum Beispiel mitFiltern –, die aufgeschraubto<strong>de</strong>r -gesteckt wer<strong>de</strong>n –gehören in diese Gruppe.LinsenZu <strong>de</strong>n gebräuchlichstenLinsen zählen Streuscheibensowie Flood- undSkulpturenlinsen. Sie verän<strong>de</strong>rndie Ausstrahlungscharakteristik<strong>de</strong>s<strong>Licht</strong>s. Fresnelllinsen (Stufenlinsen)gestatten verstellbareAusstrahlungswinkel;für die Ausrichtung zurLampe gibt es Fokussiereinrichtungen.Fluter mit breiter, rechteckigerAusstrahlung: rechteckigesGehäuse mit schaufelförmigenReflektoren für stabförmige Lampen,sehr breit strahlend fürgleichmäßige vertikale Ausleuchtungen;Bestückung: stabförmigeLeuchtstofflampenAbb. 51 + 52Breitstrahler 60°: symmetrischer, sehr breiter <strong>Licht</strong>strahl mit sehrweichen Konturen und einem weichen Zentrum, schon fastfluten<strong>de</strong>s <strong>Licht</strong>; Bestückung: diverse Nie<strong>de</strong>rvolt-HalogenlampenAbb. 53 + 54FilterDie wichtigsten Filter fürAusstellungen sind <strong>Licht</strong>schutz-Filter(„<strong>Licht</strong>schutz“,siehe Seite 30) wie UV-Sperrfilter, IR-Absorbero<strong>de</strong>r Kombinationen daraus.Außer<strong>de</strong>m gibt esFarbfilter; in Ausstellungenwer<strong>de</strong>n – wenn überhaupt– Filter zur <strong>de</strong>zentenFarbverän<strong>de</strong>rung eingesetzt.Filtermagazine o<strong>de</strong>r-kassetten stellen mehrereFilter bereit.40
Abblendzylin<strong>de</strong>r86 90 94GobohalterUV-IR-FilterBarn Doors (Entblendungsklappen)87 91 95ProjektionsvorsatzDaylight-KonversionsfilterWabenraster88 92 96FloodlinseSkintone-FilterKreuzraster89 93SkulpturenlinseFilterkassette9741
Normen und LiteraturDIN EN 12464-1 <strong>Licht</strong> und Beleuchtung – Beleuchtungvon Arbeitsstätten, Teil 1: Arbeitsstätten in InnenräumenDIN EN 1838 Angewandte <strong>Licht</strong>technik – NotbeleuchtungDIN 4844 Graphische Symbole – Sicherheitsfarben undSicherheitszeichen, Teile 1–3DIN VDE 0108-100 SicherheitsbeleuchtungsanlagenHandbuch <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>planung, Rüdiger Ganslandt undHarald Hofmann, Lü<strong>de</strong>nscheid und Braunschweig/Wiesba<strong>de</strong>n1992 (<strong>Download</strong> auf www.erco.<strong>de</strong>)Museumsbeleuchtung: Strahlung und ihr Schädigungspotenzial– Konservatorische Maßnahmen, Grundlagenzur Berechnung, Son<strong>de</strong>rveröffentlichung <strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rgemeinschaftGutes <strong>Licht</strong> (FGL), Frankfurt am Main 2006(<strong>Download</strong> auf www.licht.<strong>de</strong>)Control of damage to museum objects by optical radiation,CIE-Publikation 157, Wien 2004 (www.cie.co.at/cie)98Sammlungsgut in Sicherheit, Günter S. Hilbert (Hrsg.),Berlin 2002 (3. Auflage)Zur Beleuchtung musealer Exponate, Günter S. Hilbert,Sirri Aydinli und Jürgen Krochmann, Fachzeitschrift fürKunsttechniken, Restaurierung und Museumsfragen„Restauro“, München 1991 (5), Seiten 313–32199Bil<strong>de</strong>r 98 bis 100: In <strong>Deutsch</strong>land gibt es über 6.000 Museen. MitAusstellungen aus <strong>de</strong>n Bereichen Kunst, Wissenschaft, Technik,Geschichte, Kulturgeschichte und Persönlichkeiten <strong>de</strong>r Geschichteerreichen sie je<strong>de</strong>s Jahr über 100 Millionen Menschen.Sie alle zeigen unterschiedliche Ausstellungsstücke, unterschei<strong>de</strong>nsich entsprechend in <strong>de</strong>r Art <strong>de</strong>r Ausstellung. Allen gemeinsamjedoch ist <strong>de</strong>r Wunsch nach publikumswirksamer Präsentation.Dabei spielt das <strong>Licht</strong> eine wichtige Rolle: Es schafft visuelle Erlebnisse,es wirkt als modulieren<strong>de</strong>r und akzentuieren<strong>de</strong>r Erlebnisfaktor,es trägt wesentlich zum Erfolg je<strong>de</strong>r Ausstellung bei.10042
BildnachweisBil<strong>de</strong>rTitel, 1 bis 79, 83, 86 bis 109 – alle zur Verfügunggestellt von Mitgliedsunternehmen <strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rgemeinschaftGutes <strong>Licht</strong> (FGL)Zusatzinformationen zu <strong>de</strong>n Bil<strong>de</strong>rn26 Chris Korner, Marbach38 Jürgen Tauchert, Wuppertal44 JARO Medien, Mönchengladbach80, 81 Andreas Kelm, Darmstadt82 Fachgebiet <strong>Licht</strong>technik an <strong>de</strong>r TU Berlin84, 85 Blitzwerk, MühltalAbbildungenAbb. 1 Designergruppe Schloss+Hof, UteMarquardt, Wiesba<strong>de</strong>nAbb. 2 bis 5, 8 bis 15, 45 bis 54 KugelstadtMedienDesign, DarmstadtAbb. 6, 7 FGL-MitgliedsunternehmenAbb. 16 bis 44 JARO Medien, MönchengladbachBestellungBitte liefern Sie ohne weitere Nebenkosten die bezeichneten Hefte (E = available in English as pdf-file, download free of charge at www.all-about-light.org):Heft-Nr./Titel StückBittefreimachenPostkarteFör<strong>de</strong>rgemeinschaftGutes <strong>Licht</strong>Postfach 70 12 6160591 Frankfurt am Main0 1 Die Beleuchtung mit künstlichem <strong>Licht</strong> (7/04) E R 9,–02 Gutes <strong>Licht</strong> für Schulen und Bildungsstätten (7/03) E R 9,–03 Gutes <strong>Licht</strong> für Sicherheit auf Straßen, Wegen, Plätzen (Neuauflage 4/07) E R 9,–04 Gutes <strong>Licht</strong> für Büros und Verwaltungsgebäu<strong>de</strong> (1/03) E R 9,–05 Gutes <strong>Licht</strong> für Handwerk und Industrie (4/99) R 9,–Absen<strong>de</strong>rName, Firma, AmtAbteilungz. Hd.Straße, PostfachPLZ Ort12/06/20/18Bildnummern Rücktitel:101 102 103104 105 106107 108 10906 Gutes <strong>Licht</strong> für Verkauf und Präsentation (2/02) E R 9,–07 Gutes <strong>Licht</strong> im Gesundheitswesen (4/04) E R 9,–08 Gutes <strong>Licht</strong> für Sport und Freizeit (9/01) E R 9,–09 Repräsentative <strong>Licht</strong>gestaltung (8/97) R 9,–10 Notbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung (4/00) R 9,–11 Gutes <strong>Licht</strong> für Hotellerie und Gastronomie (1/05) E R 9,–12 Beleuchtungsqualität mit Elektronik (5/03) E R 9,–14 I<strong>de</strong>en für Gutes <strong>Licht</strong> zum Wohnen (4/00) R 9,–16 Stadtmarketing mit <strong>Licht</strong> (4/02) E R 9,–17 LED – <strong>Licht</strong> aus <strong>de</strong>r Leuchtdio<strong>de</strong> (10/05) E R 9,–18 Gutes <strong>Licht</strong> für Museen, Galerien, Ausstellungen (12/06) E R 9,–<strong>Licht</strong>forum kostenlosHefte 13 und 15 sind vergriffenOrt Datum Stempel/UnterschriftBitte <strong>de</strong>n Absen<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>r Rückseite <strong>de</strong>r Postkarte nicht vergessen.
Bitte <strong>de</strong>n Absen<strong>de</strong>r auf <strong>de</strong>r Rückseite <strong>de</strong>r Postkarte nicht vergessen.Ort Datum Stempel/UnterschriftHefte 13 und 15 sind vergriffen<strong>Licht</strong>forum kostenlos18 Gutes <strong>Licht</strong> für Museen, Galerien, Ausstellungen (12/06) E R 9,–17 LED – <strong>Licht</strong> aus <strong>de</strong>r Leuchtdio<strong>de</strong> (10/05) E R 9,–16 Stadtmarketing mit <strong>Licht</strong> (4/02) E R 9,–14 I<strong>de</strong>en für Gutes <strong>Licht</strong> zum Wohnen (4/00) R 9,–12 Beleuchtungsqualität mit Elektronik (5/03) E R 9,–11 Gutes <strong>Licht</strong> für Hotellerie und Gastronomie (1/05) E R 9,–10 Notbeleuchtung, Sicherheitsbeleuchtung (4/00) R 9,–09 Repräsentative <strong>Licht</strong>gestaltung (8/97) R 9,–08 Gutes <strong>Licht</strong> für Sport und Freizeit (9/01) E R 9,–07 Gutes <strong>Licht</strong> im Gesundheitswesen (4/04) E R 9,–06 Gutes <strong>Licht</strong> für Verkauf und Präsentation (2/02) E R 9,–05 Gutes <strong>Licht</strong> für Handwerk und Industrie (4/99) R 9,–04 Gutes <strong>Licht</strong> für Büros und Verwaltungsgebäu<strong>de</strong> (1/03) E R 9,–03 Gutes <strong>Licht</strong> für Sicherheit auf Straßen, Wegen, Plätzen (Neuauflage 4/07) E R 9,–02 Gutes <strong>Licht</strong> für Schulen und Bildungsstätten (7/03) E R 9,–0 1 Die Beleuchtung mit künstlichem <strong>Licht</strong> (7/04) E R 9,–Heft-Nr./Titel StückBitte liefern Sie ohne weitere Nebenkosten die bezeichneten Hefte (E = available in English as pdf-file, download free of charge at www.all-about-light.org):BestellungImpressum18Herausgeber:<strong>Licht</strong>technischeBeratung:Dieses Heft ist die Nummer18 <strong>de</strong>r SchriftenreiheInformationen zur<strong>Licht</strong>anwendung,mit <strong>de</strong>r die För<strong>de</strong>rgemeinschaftGutes <strong>Licht</strong> (FGL) übergute Beleuchtung mit künstlichem<strong>Licht</strong> informiert.Sie können die Hefte mit <strong>de</strong>n abtrennbarenPostkarten dieser Seite,per E-Mail (fgl@zvei.org) o<strong>de</strong>r imInternet (www.licht.<strong>de</strong>) bestellen.Sie wer<strong>de</strong>n Ihnen mit Rechnunggeliefert. Kostenlos sind die<strong>PDF</strong>-Dateien <strong>de</strong>r Hefte, die zum<strong>Download</strong> auf www.licht.<strong>de</strong> zurVerfügung stehen.För<strong>de</strong>rgemeinschaftGutes <strong>Licht</strong> (FGL)Stresemannallee 1960596 Frankfurt am MainTelefon 0 69 6302-0Telefax 0 69 63 02-317E-Mail fgl@zvei.org<strong>Deutsch</strong>e <strong>Licht</strong>technischeGesellschaft (LiTG) e.V. undFör<strong>de</strong>rgemeinschaft Gutes <strong>Licht</strong>12/06/20/18PLZ OrtStraße, Postfachz. Hd.AbteilungName, Firma, AmtAbsen<strong>de</strong>rRedaktion undRealisation:Gestaltung:Lithobearbeitung:rfw. redaktion fürwirtschaftskommunikationDarmstadtKugelstadt MedienDesignDarmstadtLayout Service DarmstadtDruck:Druckhaus HaberbeckLage/Lippe60591 Frankfurt am MainFör<strong>de</strong>rgemeinschaftGutes <strong>Licht</strong>Postfach 70 12 61PostkarteBittefreimachenQuellennachweis:ISBN: 3-926 193-35-2Nachdruck:In <strong>de</strong>n Heften dieser Schriftenreihewur<strong>de</strong>n die jeweilsgültigen DIN-Normen undVDE-Vorschriften berücksichtigt.DIN-Normen:Beuth-Verlag GmbH10787 BerlinDIN-VDE-Normen:VDE-Verlag10625 BerlinMit Genehmigung <strong>de</strong>s Herausgebersgestattet.12/06/20/18Gedruckt auf chlorfreigebleichtem Papier.
Informationen von <strong>de</strong>r För<strong>de</strong>rgemeinschaft Gutes <strong>Licht</strong>Die För<strong>de</strong>rgemeinschaftGutes <strong>Licht</strong> (FGL) informiertüber die Vorteile guter Beleuchtung.Sie hält zu allenFragen <strong>de</strong>s künstlichen<strong>Licht</strong>s und seiner richtigenAnwendung umfangreichesInformationsmaterial bereit.Die Informationen <strong>de</strong>r FGLsind herstellerneutral undbasieren auf <strong>de</strong>n einschlägigentechnischen Regelwerkennach DIN und VDE.Die Beleuchtungmit künstlichem <strong>Licht</strong> 1Gutes <strong>Licht</strong> für Schulenund Bildungsstätten2Gutes <strong>Licht</strong> für Sicherheitauf Straßen, Wegen, Plätzen3Gutes <strong>Licht</strong> für Bürosund Verwaltungsgebäu<strong>de</strong> 4Informationen zur<strong>Licht</strong>anwendungDie Hefte 1 bis 18 dieserSchriftenreihe helfen allen,die auf <strong>de</strong>m Gebiet <strong>de</strong>rBeleuchtung planen, Entscheidungentreffen und investieren,Grundkenntnissezu erwerben. Damit wirddie Zusammenarbeit mitFachleuten <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>- undElektrotechnik erleichtert.Alle lichttechnischen Aussagensind grundsätzlicherArt.Gutes <strong>Licht</strong> fürHandwerk und Industrie 5Repräsentative<strong>Licht</strong>gestaltung 9Gutes <strong>Licht</strong> für Verkaufund Präsentation 6NotbeleuchtungSicherheitsbeleuchtung10Gutes <strong>Licht</strong> imGesundheitswesen 7Gutes <strong>Licht</strong> für Hotellerieund Gastronomie11Gutes <strong>Licht</strong> fürSport und Freizeit 8Beleuchtungsqualitätmit Elektronik12<strong>Licht</strong>forum<strong>Licht</strong>forum behan<strong>de</strong>lt aktuelleFragen <strong>de</strong>r <strong>Licht</strong>anwendungund stellt Beleuchtungstrendsvor. Diese„Fachinformationen fürBeleuchtung“ erscheinenin loser Folge.www.licht.<strong>de</strong>Im Internet ist die FGL unter<strong>de</strong>r Adresse www.licht.<strong>de</strong>präsent. Tipps zur richtigenBeleuchtung geben„<strong>Licht</strong>anwendungen“ inPrivatPortal und ProfiPortalmit zahlreichen Beispielenfür Privatanwendungenund gewerbliche Beleuchtung.Erläuterungen lichttechnischerBegriffe bietendie Menüpunkte „Über<strong>Licht</strong>“ und „Beleuchtungstechnik“.Datenbanken mitumfangreichen Produktübersichten,Liefermatrixsowie Adressdaten <strong>de</strong>rFGL-Mitgliedsunternehmenweisen <strong>de</strong>n direkten Wegzum Hersteller und seinenProdukten. Das Angebot<strong>de</strong>r gedruckten „Publikationen“im Online-Shopund „Linktipps“ ergänzendas vielseitige <strong>Licht</strong>portal<strong>de</strong>r FGL.Gutes <strong>Licht</strong> für kommunaleBauten und Anlagen13LED – <strong>Licht</strong>aus <strong>de</strong>r Leuchtdio<strong>de</strong>17I<strong>de</strong>en für Gutes <strong>Licht</strong>zum Wohnen14Gutes <strong>Licht</strong> für Museen,Galerien, Ausstellungen 18Hefte 13 und 15 sind vergriffen.Gutes <strong>Licht</strong>am Haus und im Garten 15Stadtmarketing mit <strong>Licht</strong>16
Informationenzur <strong>Licht</strong>anwendungHeft 18Gutes <strong>Licht</strong> für Museen, Galerien, AusstellungenFör<strong>de</strong>rgemeinschaft Gutes <strong>Licht</strong>