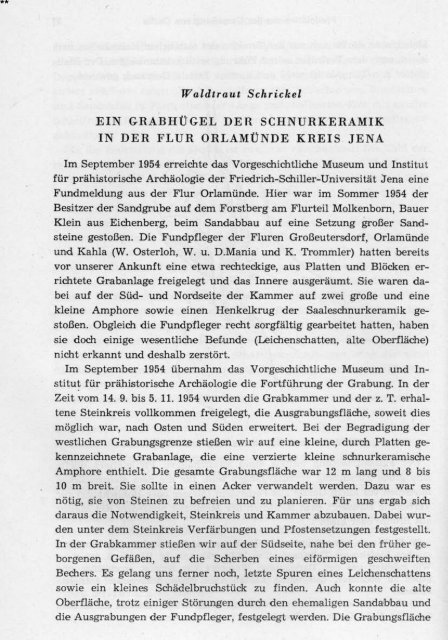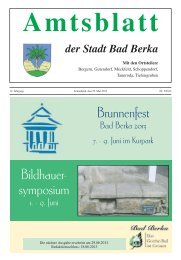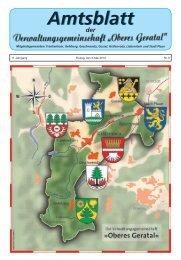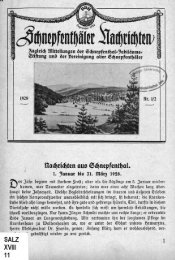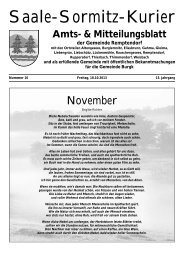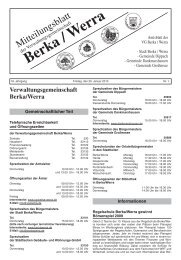Waldtraut Schrickel EIN GRABHÜGEL DER SCHNURKERAMIK IN ...
Waldtraut Schrickel EIN GRABHÜGEL DER SCHNURKERAMIK IN ...
Waldtraut Schrickel EIN GRABHÜGEL DER SCHNURKERAMIK IN ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
wurde mit ihren einzelnen Objekten vermessen und gezeichnet, dieHöhenlage der Kammersteine sowie der Steine des Kreises nach einerNullinie, die der obersten Steinlage der Kammer sowie des Kreises imWesten entspricht, eingemessen.Außer der Keramik konnten keine weiteren Grabbeigaben festgestelltwerden. Doch enthielten die umliegenden Erd-. und Sandschichten wieauch die Grabfüllung vereinzelte Scherben, darunter sogar RandundÖsenstücke, die z. T. mit Schnureindrücken verziert waren. Außerdemwurde eine Anzahl Feuersteinklingen, die z. T. mit Retusche versehenwaren und Feuersteinabschläge gefunden. Feisgeräte bzw. Bruchstückevon solchen waren selten. Sie sind auch auf den benachbarten Feldernnicht häufig. Es fällt bei dem wenigen Vorhandenen immer wieder dieeinfache Gestaltung und rohe Bearbeitung auf. Von dieser Art war auchein angeschliffenes Kieselschieferstück, das im Bereich der Grabanlageselbst gefunden wurde. Sonst enthielt die Füllerde im Grab und zwischenGrab und Ring Holzkohlepartikel, die an einigen Stellen gehäuft auftraten.Bleiben auch infolge der teilweisen Zerstörung der Anlage mancheFragen ungeklärt, so bietet doch das große Orlamünder Grab in Bau undBeigaben noch bemerkenswerte Einzelheiten genug.Lage der FundstelleDie Fundstelle befindet sich westlich der Saale, und zwar auf der Hochflächenordöstlich von Orlamünde und westlich von Großeutersdorf (Meßtischblatt3062). Sie liegt direkt an der Grenze beider Fluren im Gebietedes mittleren Buntsandsteins. Wenngleich die Fundstelle nicht den höchstgelegenenPlatz im Gelände einnimmt, so hat man von ihr doch nachSüden und Südwesten einen weiten Überblick über die umliegende Gegendsowie über das Saaletal hinweg bis zur jenseitigen Hochfläche. Nach Nordwestenwird der Blick durch den BuchundKugelberg begrenzt, währendnach Nordosten eine schmale Geländeerhebung sowie der hohe Nadelwaldim Osten nahe des Grabes die Sicht verdecken.Die Fundstelle selbst liegt inmitten eines von Ackerbau genutztenGebietes, bemerkenswerterweise aber auf einem Ödlandstreifen, der sichentlang eines Feldweges erstreckt und eine Breite von ungefähr 15 m hat.Diese auffällig breite Fläche blieb bisher unbebaut, weil sie zu "steinig"war. Eine Reihe Anzeichen lassen erkennen, daß weitere Gräber mitallerdings kaum sichtbaren Hügeln hier vorhanden sein werden.Das untersuchte große Grab ist das östlichste auf diesem Ödlandstreifen.Das Baumaterial, Blöcke und Platten von Sandsteinen und Quarzit, stammt
aller Wahrscheinlichkeit nach aus dem Anstehenden des Gebietes selbst.Streufunde und Holzkohlereste lassen vermuten, daß ehemals an Stelleder Grabanlagen eine Siedlung bestand oder daß Siedlungserde aus derNähe zur Aufschüttung des Hügels benutzt worden ist.Die große GrabanlageDie große Grabanlage bestand aus Grabkammer und teilweise erhaltenemSteinkreis. Während die Grabkammer im wesentlichen unversehrtwar und nur auf der Außenseite der Ostwand einige Störungen aufwies,war der Steinkreis an dieser sowie an der Nordseite völlig dem Sand-.abbau zum Opfer gefallen und eine leichte Störung auch auf der Südseitedurch ein modernes "Hundegrab" zu verzeichnen. Den vor der östlichenKammerwand liegenden stelenartigen "Säulen" möchten wir keine Funktionim Grabzusammenhang zusprechen, weil sie mit anderen Blöcken inder Störungszone lagen und hierher evtl. erst durch den Sandabbau gelangtsind.Ein Hügelaufwurf konnte nicht beobachtet werden. Ein Teil der oberstenSteine lag, wie ihre Moosbewachsung zeigte, an der Oberfläche.DerKammeraufbauDie Grabkammer war von NO nach SW orientiert. Ihre Länge betrug,von Außenseite zu Außenseite gemessen, 5,50 m, ihre Breite 4 m. DieKammerwände waren durchschnittlich 1,10 m hoch, 1 bis 1,70 m breit.Die Ungleichheit in der Breite ist z. T. dadurch hervorgerufen worden,daß ein Teil der Steine nach innen, in den oberen Lagen aber auch nachaußen abgerutscht war. Es konnte anfänglich, da die Erdundum die Grabkammer bereits abgetragen waren, nicht festgestelltSandschichwerden, ob die Kammer eingetieft oder auf dem gewachsenen Bodenerrichtet worden war. Erst die Befunde, die nach dem Abbau des Steinkreisezutage traten, gestatten eine eindeutige Aussage. Danach war dasgroße Grab von Orlamünde über 80 cm in den gewachsenen Boden versenkt.Wie die Befunde erkennen lassen, wurde zuerst eine 60 bis 70 cmtiefe Grube, die wahrscheinlich der Größe des Grabes entsprach, ausgehobDanach setzten die Schnurkeramiker das 0,80 bis 1 m breiteFundament. Der Fundamentrahmen bestand aus Steinplatten, die z. T. mitder breiten Seite, z. T. nur mit einer Spitze in den Boden getrieben waren.Zwischen diesen Rahmen wurden Blöcke und Platten in waagerechter oderschräger Lage, teilweise durch weitere senkrecht stehende Platten gestützthineingeklemmt. Es entstand so ein dichtes Gefüge untereinanderverkeilter Steine. Es ist fraglich, ob für dieses Fundament noch ein besondeFundamentgraben ausgehoben worden ist. Auffällig war nur,
Abb. 1: Orlamünde, Kreis Jena, Sandgrube Klein.Schnurkeramischer Grabhügel.Plan 1
Abb. 1: Orlamünde, Kreis Jena, Sandgrube Klein.Schnurkeramischer Grabhügel.Plan 1
Plan 2: Grundriß.
Abb. 2: Orlamünde, Kreis Jena, Sandgrube Klein.Schnurkeramischer Grabhügel, Schnitt A-B.daß die Steine des Fundamentrahmens noch etwa 20 cm unter die Grabsohlehinabreichten. Das Fundament läßt erkennen, daß die Grabanlage alsRechteck mit abgerundeten Ecken beabsichtigt war. Der Innenraum warannähernd rechteckig (3,10X1,50 bis 2,20 m), wobei die Seiten im scharfenWinkel aufeinander trafen. Teile des Fundamentes waren infolge des starkenDruckes der daraufgesetzten Mauer nach innen bzw. nach außenabgedrückt worden. Auch die oberen Steinlagen zeigten, daß hier versuchtworden war, die Steine möglichst genau ineinander zu fügen, um so demAufbau einen hohen Grad von Festigkeit zu geben. Wir glauben nicht, daßallein der Druck des Baumaterials es vermocht hat, die einzelnen Blöckeund Platten derart ineinander zu verkeilen, weil bei diesem Ineinanderauch die besondere Formgebung der Steine ausgenutzt worden war. DieseKammerwände haben ungefähr 30 cm über die alte Oberfläche hinausgeragtOb auf ihr die ehemalige Pflanzendecke vor Errichtung der Anlageabgebrannt worden ist oder ob wir in den Holzkohleanreicherungen unddem Anflug von Holzkohlepartikeln Spuren der Besiedlung oder Restevon Totenfeuern zu sehen haben, ist fraglich.DerSteinkreisIn unterschiedlichem Abstande (1,30 bis 2,20 m) folgte der Grabkammerauf der WestundSüdseite ein Steinkreis. Er ruhte auf der alten Oberflächewar 1 bis 1,60 m breit und bestand im wesentlichen aus einer SteinschichIm Westen lagen die Steine des Kreises in gleicher Höhe mit denender obersten Schicht der Grabkammer. Eine besondere Anordnung derSteine konnte nicht festgestellt werden. Unter dem Steinkreis hoben sichim gelblichen Sande deutlich dunkle Verfärbungen und Holzkohleteilchenab. 6 cm tiefer wurden die Pfostenlöcher sichtbar. Fünf Standspuren (28 bis
40 cm Durchmesser) ehemaliger Pfosten verteilten sich in nicht ganz regelmäßigenAbständen (0,90 bis 1,60 m) über die erhaltene Fläche des Steinkreises.Zwischen Pfosten 4 und 6 lag eine breite schwellenartige Verfärbung(5). Die Tiefe der Pfostengruben variierte von 12 bis 24 cm. DieQuerschnitte zeigen, daß die Pfosten eingegraben und festgeschlagen wordensind. Das untere Ende der Pfostengruben war gerade, rund oder spitzgestaltet. Aus der Lage der Steine zu den Pfostengruben kann nicht entnommenwerden, daß die Steine etwa als Stütze der Pfosten gedient haben.Rekonstruktion des großen GrabesDie Grabkammer, die ungefähr 30 cm aus dem Boden hervorsah, wirdehemals abgedeckt gewesen sein. Es ist dabei an eine flache Holzdecke zudenken, die mit einigen größeren und kleineren Steinen beschwert war.Einige dieser Beschwersteine sind später mit der Decke in das Innereder Grabkammer gesunken. So z. B. auch die große, im Grabinneren liegendeSteinplatte (0,70x0,36 bis 0,54 m), unter der nur Sand angetroffenwurde. Über dem Grabe befand sich jedenfalls ein Hügel, der wenigstensaus dem Aushub der Grabkammer bestanden hat. Begrenzt und gestütztwurde dieser Hügel durch eine Holzwand, die aus senkrechten Pfosten,die untereinander durch waagerechte Hölzer verbunden waren, bestand.Die große Entfernung der Pfosten voneinander, aber auch die breiteschwellenförmige Verfärbung, sprechen eher für eine Bretterbzw.als für eine Faschine. Zwischen der Bohlenwand und demBohlenverschalungHügelfuß oder auf dem Hügelfuß selbst waren Steine eingefügt oder aufeinandergepacAls die Holzwand vermorschte und in sich zusammenfiel,rutschten die Steine auseinander und kamen dabei nebeneinander zu liegen.Es entstand derSteinkreis.BestattungenDas große Grab scheint für mehrere Tote errichtet worden zu sein. Dieletzte Spur von einem Toten konnte in einer Tiefe von 1,01 m auf dernördlichen Grabseite festgestellt werden. Zu dieser Bestattung gehört diekleine Amphore. Die vier Gefäße der südlichen Grabseite sind entwederdieser oder anderen Bestattungen zuzuweisen. Auf Grund der Erfahrungenvon H. Kretzsch, Seifartsdorf, und H. Höckner, Altenburg, fallen gewöhnlichzwei Gefäße auf einen Toten. Nach den Untersuchungen von G. Loewe1943 verändert sich dieses Verhältnis in der Spätzeit der Schnurkeramik inder Weise, daß dann gewöhnlich drei Gefäße beigegeben werden1. Das1) G. Lo e w e: Die Kultur mit Schnurkeramik im Lande Thüringen, Diss.Jena 1943 (unveröffentlicht).
große Grab von Orlamünde könnte demnach zwei bis drei Tote geborgenhaben. Auch die starke Randlage des einen sicher festgestellten Toten ander nördlichen Kammerwand würde für eine Mehrzahl von Bestattetensprechen. Ob die Beerdigungen in diesem Falle aber gleichzeitig erfolgtenoder ob Nachbestattung geübt wurde, ist aus den Befunden der Grabkammernicht zu entscheiden. Die einzige Stelle der Grabkammer, an der einEingang zu vermuten wäre, befindet sich auf der Ostseite. Doch kann dieVeränderung der Grabwand hier durch Störungen infolge des Sandabbahervorgerufen sein.Die kleine Grabanlage westlich des großen GrabesAußerhalb des Steinkreises und bautechnisch nicht zum großen Grabgehörig, lag eine kleine Grabstätte, die aus senkrecht stehenden undwaagerecht liegenden Platten gebildet war. Die ganze Anlage, die ungefährals rechteckig bezeichnet werden kann, maß 1,30X0,80 m in Länge undBreite und war von NO nach SW orientiert wie die große Kammer. Auchdieses Grab war in den gewachsenen Boden versenkt. Die Sohle lag 80 cmunter der Nullinie. Im hinteren Drittel dieser Steinsetzung, mit einerSteinplatte abgedeckt, stand leicht geneigt auf zwei kleinen Kieseln einewohlerhaltene verzierte, kleine becherförmige Amphore. Um das Gefäß,besonders aber südwestlich davon, befand sich eine dunkle Verfärbung, dieüber die Steinsetzung an dieser Seite hinausreichte und 40 bis 50 cm imDurchmesser maß. Auffällig war die plastische Eigenschaft, die der Sandhier hatte. Sichere Schlüsse lassen sich, etwa aus der Form der Verfärbung,nicht ziehen. Vielleicht stand hier eine besonders fetthaltige Totenbeigavielleicht rührt die Verfärbung vom Toten selbst her. Wir neigenauf Grund der geringen Ausmaße des Grabes und seiner einfachen Bauweisezu der Annahme, daß hier kein Erwachsener, sondern ein Kindbestattet gewesen ist.InventarAus dem großen Grabe stammen fünf Gefäße. Die beiden großenAmphoren und der Henkelkrug standen zusammen auf der südlichenKammerseite. Nur wenig westlich davon lagen die Scherben des eiförmigengeschweiften Bechers. An der nördlichen Kammerwand stand diekleine unverzierte Amphore. Das kleine Grab enthielt die verzierte becherförmAmphore.1. Große Amphore, unverziert.Große Amphore mit eiförmigem, schiefem Körper, kleiner Standfläche und mittelholeicht nach außen geschwungenem Halse. Farbe: graubraun. Ton: grob
gemagert und nur schwach gebrannt. Oberfläche z. T. überglättet. Aus Scherbenzusammengesetztund ungefähr zu 1Ä ergänzt.Maße: H.: 38,5; gr. Dm.: 35; Mdm.: 13; Bdm.: 7; Wdst.: 0,8-1,2 cm; L. d. Halses:4,5; B. d. Ösenhenkels: 5,2-6,3 cm.Abb. 3: Orlamünde, Kreis Jena, Sandgrube Klein.Gefäße aus dem schnurkeramischen Grab. 1/62. Große Amphore mit Kerbleiste.Große Amphore mit kugeligem aber schiefem Körper. In Höhe der oberenösenansätze läuft rings um das Gefäß eine ungefähr 1 cm breite Leiste, die mitsenkrechten bzw. leicht schräg verlaufenden Einkerbungen versehen ist. Der
Abb. 4: Orlamünde, Kreis Jena, Sandgrube Klein.Gefäße aus dem schnurkeramischen Grab. 1/4Hals von mittlerer Höhe ist leicht nach außen geschwungen. Farbe rötlichbraun,stellenweise ins Graue spielend. Grob gemagerter Ton, Brand nicht allzu hart.Oberfläche teilweise überglättet. Die Amphore konnte aus den Scherben fastvollständig zusammengesetzt werden.Maße H.: 32; gr. Dm.: 29,5; Mdm.: 14; Bdm.: 8; Wdst.: 0,8-1,4 cm; L. d. Halses:4,5; B. d. Ösenhenkel: 3,5-4,5 cm.3. Kleine Amphore, unverziert.Amphore von verwaschener, leicht schiefer Form. Der Hals geht ohne sichtbareMarkierung in die Schulter und diese in den Bauch über. Farbe grau, nach demUnterteil zu mehr gelblichbraun. Brand und Oberflächenbehandlung, obwohl dieWandstärke geringer als bei Nr. 1 und 2 ist, gleich diesen Gefäßen. Aus Scherbenvollständig zusammengesetzt.Maße: H.: 14; gr. Dm.: 16,4; Mdm.: 9,5; Bdm.: 5,6; Wdst.: 0,35-0,8 cm; B. d. Ösenhenke1,9-2,3 cm.4. Henkeikrug mit hohem Hals, unverziert.Auf einem leicht schief gearbeiteten Bauchteil sitzt ein langer, schwach konischerHals. Der Henkel ist unterständig 1,2 cm unter dem Mündungsrand angebracht
und reicht bis zum Übergang von Hals zu Schulter. Farbe rötlichbraun, amUnterteil ins Grauschwarze übergehend. Brand und Oberflächenbehandlung wieNr. 1-3. Aus Scherben bis auf ein Bauchstück und den Henkel zusammengesetzt.Maße: H.: 19; gr. Dm.: 15; Mdm.: 10,6; Bdm.: 6,5; Wdst.: 0,3-0,5 cm; L. d. Halses:9; B. d. Henkels am unteren Ansatz: 2,4 cm.5. Eiförmiger Becher mit geschweifter Wandung, unverziert.Das Gefäß ist leicht schief gearbeitet. Ohne besondere Markierung gehen Bauch,Schulter und Hals ineinander über. Der Hals ist nach außen geneigt. Farbebraun, nur in Höhe der Schulter grau. Ton, Brand und Oberflächengestaltungwie oben. Aus Scherben zusammengesetzt.Maße: H.: 19; gr. Dm.: 14,2; Mdm.: 13; Bdm.: 8; Wdst.: 0,5-1 cm; L. d. Halses:3,7 cm.6. Becherförmige Amphore mit Schnurverzierung.Die kleine Amphore, die formal eine Mischung zwischen Amphore und Becherdarstellt, besitzt eine breite Standfläche, die am Rande nach dem Körper zueinen deutlichen Absatz zeigt. Die Profilierung ist weich, ohne scharfe Markierungzwischen Bauch, Schulter und Hals. Auf dem Bauch sitzen an der Stelledes größten Durchmessers gegenständig zwei Ösenhenkel. Das Gefäß ist amRande von graubrauner Farbe, die nach dem Boden zu ins Rötliche hinüberspielt.Ton grob gemagert; Oberfläche überglättet.V e r z je r u n g: Die Verzierung bedeckt Hals und Schulter und schließt inHöhe des unteren Henkelansatzes ab. Sie ist in Schnurtechnik ausgeführt. DieSchnur war zweiteilig. Auf dem Halsteil sechs Horizontallinien. Die 1. und 2.sowie die 5. und 6. Linie sind in sich geschlossenund einzeln hergestellt. Die3. und 4. Linie hängen spiralig miteinander zusammen. Man kann sehen, daßhier die Schnur von links nach rechts um das Gefäß geführt worden ist. Derdurchschnittliche Abstand zwischen den Horizontallinien beträgt 0,4 cm. Andiese Horizontalverzierung schließen hängende Dreiecke (bzw. Zickzackmuster)an. Die Zacken sind in der Regel dreilinig gearbeitet. Die Breite dieser Bänderbeträgt 0,9 cm. Zwischen den Henkeln sind immer zwei herabhängende Zackendeutlich sichtbar, während eine dritte jeweils rechts dicht neben den Henkelnerscheint. Diese beiden Zacken sind sehr schlecht ausgeführt. Alle Zacken trageneine Füllung von fünf bis sieben horizontalen oder leicht schräggeneigtenSchnurlinien. In den Zacken rechts der Henkel verlaufen die Füllstiche parallelzur einen Zackenseite. Während die Zacken nach oben hin gewöhnlich in einerSpitze enden, die gelegentlich auch einmal über die Halsverzierung hinausgezogensein kann, fehlen die unteren Zackenspitzen ganz. Hier treten - wiedermit Ausnahme rechts der Henkel - immer zwei kurze, annähernd waagerechtverlaufende Abschlußstriche in Schnurtechnik auf. Links der Henkel ist einvierliniges Winkelmuster zu sehen. Ein mehrliniges Winkelornament in Schnurtechnik,mit der Spitze nach oben, erscheint auf den Henkeln.Maße: H.: 12,2; gr. Dm.: 10,4; Mdm.: 8,5-9,2; Bdm.: 7,5; Wdst.: 0,4-1,0 cm; B. d.Henkelöse: 1,5-1,7 cm.
Auswertung und ZusammenfassungDas große Grab von Orlamünde liegt am Südrande des Verbreitungsgebieteder Saaleschnurkeramik und weist in der Anlage und auch imkeramischen Inventar ganz eigene Züge auf. Die nächst gelegenen undgut untersuchten schnurkeramischen Grabhügel in der Flur Seifartsdorf,Kreis Eisenberg2, sind zwar auch durch einen Steinkreis gekennzeichnetund weisen Innenbauten aus aufeinandergeschichteten Steinen in denverschiedensten Formen auf, doch sind hier bisher nie tief versenkte'Grabkammemit so hoch aufgeführten dicken Wänden wie in Orlamündegefunden worden. Die Konstruktion einer hölzernen Stützwand um einenschnurkeramischen Grabhügel ist bisher in Thüringen überhaupt nochnicht beobachtet worden. Handelt es sich hierbei um einen Niederschlagjener von den Kreisgrabengräbern bekannten Sitte3? Es wäre aber durchausmöglich, daß Pfostensetzungen um Grabhügel auch in anderen Gebietenauftreten und nur infolge der Bodenverhältnisse nicht erkannt wordensind. Selten wurden auch Grabkammer und Steinkreis bis auf dieStandspuren abgebaut.So eigen wie der Grabbefund ist auch ein Teil der Keramik. Auch hiermüssen wir immer vor Augen haben, daß das Orlamünder Grab nicht imZentrum der Saaleschnurkeramik gelegen ist. Versuchen wir die OrlamünderGefäße in das 1943 von G. Loewe aufgestellte Schema einzuordnen,so ergibt sich, daß die Keramik nicht einem frühen, sondern einem spätenStadium der Entwicklung angehört. Die von G. Loewe aufgestellten Stufen3 und 4 werden gekennzeichnet u. a. durch die Abwandlung derAmphoren zu gedrungenen, breiten oder hohen, langgestreckten Formen.Die Verzierung nimmt ab, sie wird auf einzelne Gefäßteile reduziert underscheint nicht mehr auf Hals, Schulter und Bauch. Dagegen setzt die Verwenduvon Kerbleisten als Schmuck ein. Außerdem fällt in diese Abschnitdie Herausbildung von Mischformen, z. B. zwischen Amphore undBecher. Auf Grund dieser Merkmale können die eiförmige große Amphore,die große Amphore mit Kerbleiste, die kleine verzierte becherförmigeAmphore, aber auch die unverzierte kleine Amphore, der Henkelkrug undder eiförmige geschweifte Becher hier eingeordnet werden. Doch liegenaus Mitteldeutschland selbst nicht zu allen Orlamünder Gefäßen wirkliche2) G. L o e w e: Zwei schnurkeramische Grabhügel an der "Alten Straße" beiSeifartsdorf, Ldkr. Stadtroda (Spatenforscher 8) Jena 1943,S. 1 if.H. K r e t z s c h: Drei schnurkeramische Grabanlagen auf dem "GroßenSteine" bei Seifartsdorf, Landkr. Eisenberg/Thür. (Alt- Thüringen 1 1953/54),Weimar 1955,S. 182 if.3) E. A. y. G j f f e n: Die Bauart der Einzelgräber I, 1T, Leipzig 1930.
Parallelen vor. Parallelen finden sich eher in anderen Randgebieten desschnurkeramischen Bereiches, sowohl im Westen als auch im Osten. Be. sondersin Böhmen treten Formen auf, die den Orlamündern ähnlich sind4.Es finden sich große Amphoren mit eiförmigem Körper, die unverziertoder mit plastischen Leisten versehen sind5. Ferner kommen kleine verwascheneAmphoren vor und Gefäße, die einen Übergang zwischenAmphore und Becher darstellen6. Besonders auffällig sind im böhmischenMaterial die vielen Henkelbecher bzw. Henkelkrüge7. Diese Henkeikrüge,die sich durch wirkliche große Henkel im Gegensatz zu den sonst typischenÖsenhenkeln auszeichnen, sind in Mitteldeutschland selbst nicht häufig.Sie erscheinen dort, wo die Schnurkeramik in Kontakt mit anderen Gruppen,denen große Henkel eigen sind, gekommen ist. Es ist anzunehmen,daß diese Henkelform durch die Glockenbechergruppe ihren Eingang indie Schnurkeramik von Orlamünde gefunden hat, da Funde der Glockenbecherleuteaus diesem Gebiet ebenfalls vorliegen8.Das Vorgeschichtliche Museum der Universität Jena besitzt aus der FlurGroßeutersdorf, Kreis Jena, also aus nächster Nähe der ausgegrabenenAnlagen, einen dieser seltenen Henkelkrüge°. Er soll, da er noch nichtveröffentlicht ist, hier kurz beschrieben werden. Das Gefäß stammt auseinem der Gräber, die sich an der Stelle der Gemeindekiesgrube, nördlichdes "Mordgrabens" befanden und seit 1870 durch den Sandabbau allmählichzerstört worden sind10.4) J. F iii p: Praha Praveka, Prag 1949, Fig. 23, 24.J. S c h ra n II: Die Vorgeschichte Böhmens und Mährens, Berlin, Leipzig1928, T. XIX.5) A. S t o c k 35: La Boheme préhistorique I, Prag 1929, T. LXV, LXX.6) A. Stocký: a. a. O. (FN 5), T. LXX, LXXIII, LXXVII.7) A. Stockt: a. a. O. (FN 5), T. LXVII f.8) G. N e u ma n n: Die Gliederung der Glockenbecher in Mitteldeutschland(PZ 10), Berlin 1929, Abb. 5. - Derartige Henkel kommen auch im gleichzeitigenHorizont des Marschwitzer Types vor. Vgl. H. S e g e r (Eberts Reallexikon 8),Berlin 1927, T. 6. Eine Ableitung der Henkelform von der Salzmünder Keramikist für Orlamünde nicht wahrscheinlich, da die Salzmünder Gruppe nicht bis inden Süden Mitteldeutschlands vorgedrungen ist.9) Geborgen 1916. 1937 mit einigen schnittlinienverzierten Amphorenhalsstücken,die 1911 zutage gekommen sind, in den Besitz des Vorgesch. Mus, derUniversität gelangt (Kat. Nr. 29 907).10) E. A me n d e: Vorgeschichte des Altenburger Landes, Altenburg 1919,S. 18.A. Au e r b a c h: Die vorundfrühgeschichtlichen Altertümer Ostthüringens,Jena 1930,S. 159.A. Au e r b a c h: Übersicht über die VorundFrühgeschichte Ostthüringens,Zeulenroda 1932,S. 229.
Henkelkrug,Abb. 5: Großeutersdorf, Kreis Jena.Henkelkrug aus einem zerstörten schnurkeramischen Grab. 14verziert.Henkelkrug mit bauchigem Unterteil und leicht ausladendem Halse. Der Henkelist randständig und reicht bis zur Schulter. Farbe gelblichbraun, nach dem Oberteilzu ins Graue übergehend. Ton grob gemagert, Oberfläche überglättet. Heuteist die Oberfläche teilweise sehr stark ausgelaugt, so daß die Schnurverzierungvielfach nur verwaschen sichtbar ist. Gefäß bis auf den größten Teil derHalspartie gut erhalten.V e r z j e r u n g: Die Verzierung ist auf Hals und Schulter angebracht. Siebesteht aus Schnureindrücken. Auf dem Hals vier parallel laufende Schnurlinienvon insgesamt 1,2 cm Breite. Rechts des Henkels und wahrscheinlich auchlinks befindet sich ein Sanduhrmotiv, das aus zwei mit der Spitze gegeneinandergekehrten Dreiecken mit Schnurlinienfüllung besteht. Zwischen Hals und Schulterbefinden sich wiederum vier waagerechte Schnurlinien in einer Breite von1,4 cm. An der letzten Linie hängen insgesamt neun mit schrägen Schnurliniengefüllte Winkel. Die Fläche unter dem Henkel ist freigelassen.Maße: H.: 16,4; gr. Dm.: 14,9; Mdm.: 11,4; Bdm.: 8; Wdst.: durchschnittlich0,6 cm; L. d. Halses: 6; B. d. Henkels: 2,3-3,4 cm.Auf Grund seiner Proportion ist der Krug zwar mehr an klassischeFormen der Schnurkeramik anzuschließen als der größte Teil der OrlamündeGefäße, allein infolge der reduzierten Verzierung wäre er in diegleiche Phase wie die verzierte becherförmige Amphore einzureihen.Treten auch einige Merkmale an den Orlamünder Gefäßen auf, dieG. Loewe als charakteristisch für die 3. und 4. Stufe, besser Stilphase,aufgezeigt hat, so gehören sie doch wohl nur z. T. hierher und sind imwesentlichen noch jünger anzusetzen. Der Henkelkrug mit hohem Halsund die kleine unverzierte Amphore mit verwaschenem Profil kehren inähnlicher Form in der Hügelgräberbronzezeit wieder". Wir glauben daher,11) K. W iii vo n s e d e r: Die mittlere Bronzezeit in Österreich, Wien 1937,T. 3 f, 9 f.
daß diese beiden Gefäße im Orlamünder Grab sehr jung anzusetzen sind.Dazu gehört auch der eiförmige geschweifte Becher. Er erinnert an späteSchnurbecher des Rheingebietes und auch an die Jütländer Formen diesesRaumes12. Er muß aber, da die gleiche Proportionierung bei diesen Bechernnicht auftritt und auch anderswo zu fehlen scheint, als späte selbständigeBildung der Saaleschnurkeramik angesehen werden.Sondern wir aber diese drei Gefäße als sehr jung aus, so ergibt sich, daßeventuell die übrigen Gefäße (die beiden großen Amphoren und die verziertebecherförmige Amphore sowie der Henkelkrug von Großeutersdorf)ein älteres Stadium verkörpern. Allerdings fällt auch dieses nicht in dieBlütezeit der Schnurkeramik, sondern in den Beginn der Spätstufe oderin diese selbst. Die Grabbefunde geben zu einer derartigen Zweiteilungder Keramik keinen Hinweis. Eher könnte man aus der Verteilung derKeramik im Grab das Gegenteil vermuten, denn die zwei großen Amphorenstanden mit dem Henkelkrug zusammen und nicht weit davon lagendie Scherben des eiförmigen Bechers. Lediglich die kleine verwascheneAmphore stand isoliert auf der anderen Grabseite. Vielleicht gehörenalle Gefäße doch einem chronologischen Horizont an, und die älter anmutendenFormen hätten sich dann auf der abseits gelegenen OrlamünderHochfläche lange gehalten, während andererseits schon eigene Bildungenauftraten. Solange wir keinen eindeutigen Hinweis dafür haben, daß aufder Orlamünder Hochfläche zwei Besiedlungsschichten bzw. chronologischeHorizonte vertreten sind, möchten wir die Grabanlage mit dem Inventarals eine Einheit ansehen und beides ins Spätneolithikum oder in die frühePhase der Bronzezeit datieren.Das große und das kleine Grab von Orlamünde haben in ihrem Material,die große Grabanlage auch durch ihre Bauweise, eine Bereicherung unsererKenntnis über die Saaleschnurkeramik erbracht. Es ist zu hoffen,daß bei weiteren Grabungen auf der Orlamünder Flur die hier erzieltenErgebnisse unterbaut und erweitert werden können.12) R. S t a m p f u ß: Die jungneolithischen Kulturen in Westdeutschland,Bonn 1929,T. I, V.