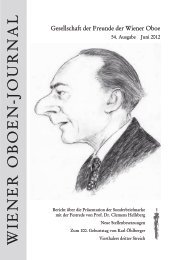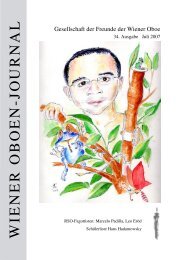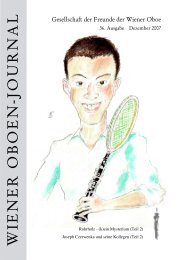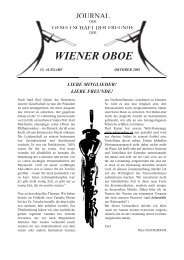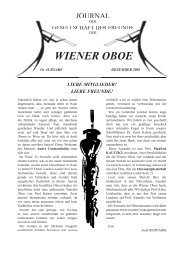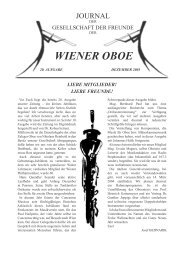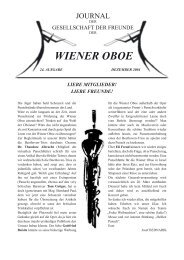DieOboisten am Theater an der Wien während ... - Wiener Oboe
DieOboisten am Theater an der Wien während ... - Wiener Oboe
DieOboisten am Theater an der Wien während ... - Wiener Oboe
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Lichte können wir <strong>an</strong>nehmen, dass Beethoven (durch Haydn) das <strong>Oboe</strong>nkonzert deswegen nach Bonn<br />
schickte, da Libisch im November 1793 noch dort war und erst Anf<strong>an</strong>g 1794 nach <strong>Wien</strong> k<strong>am</strong>.<br />
Sollte Libisch tatsächlich bei seiner Ankunft o<strong>der</strong> kurz d<strong>an</strong>ach das Engagement im Freihaustheater<br />
<strong>an</strong>getreten haben, so wäre <strong>der</strong> M<strong>an</strong>gel <strong>an</strong> Kontakt zwischen Oboist und Komponist leicht erklärbar. Zu<br />
diesem Zeitpunkt schrieb Beethoven für die Gebrü<strong>der</strong> Teimer, die im Dienste des Fürsten Schwarzenberg<br />
und des Hoftheaters st<strong>an</strong>den, das Trio op.87 und die Variationen über „La ci darem la m<strong>an</strong>o“ (WoO). 47<br />
Überhaupt versuchte Beethoven sich in Hofkreisen beliebt zu machen: Er spielte bei gleich zwei<br />
Benefizkonzerten <strong>der</strong> Tonkünstler-Societät (<strong>am</strong> Klavier) im März 1795 – diese Konzerte waren das eifrig<br />
und eifersüchtig geschützte Revier des Hofkapellmeisters Salieri – und gab sein erstes eigenes Konzert, bei<br />
dem seine neue erste Symphonie aufgeführt wurde, im Hofburgtheater <strong>am</strong> 2. April 1800. Die d<strong>am</strong>aligen<br />
Oboisten des Burgtheaters waren Georg Triebensee (1746-1813) und Joh<strong>an</strong>n Went (1745-1801).<br />
Offensichtlich hoffte Beethoven mit dem Ballett „Die Geschöpfe des Prometheus“, das <strong>am</strong> 28. März 1801<br />
<strong>am</strong> Burgtheater uraufgeführt wurde, die Gunst Kaiserin Maria Theresias, <strong>der</strong> Gattin des Kaisers Fr<strong>an</strong>z, für<br />
sich zu gewinnen. Aber bis zum Frühjahr 1802 war ihm klar geworden, dass seine Bemühungen in diese<br />
Richtung keine weiteren Vorteile bei Hofe bringen würden. Zu diesem Zeitpunkt war die zweite Symphonie<br />
bereits größtenteils fertig skizziert. Wieweit die Instrumentation schon vollendet war, bleibt im Dunkeln, da<br />
das Partiturautograph, das <strong>an</strong>geblich seinem Schüler Ferdin<strong>an</strong>d Ries übergeben wurde, verloren geg<strong>an</strong>gen ist.<br />
Erst jetzt, wahrscheinlich <strong>während</strong> des berühmten Sommeraufenthalts in Heiligenstadt o<strong>der</strong> erst im<br />
Frühherbst, hat Beethoven einen Vertrag mit E. Schik<strong>an</strong>e<strong>der</strong> abgeschlossen. In diesem wurde festgehalten,<br />
dass Beethoven eine Oper für das <strong>Theater</strong> schreiben sollte und dafür das Haus zur Ver<strong>an</strong>staltung eigener<br />
Konzerte benutzen dürfe. Zu diesem Zeitpunkt war Georg Libisch schon in Ungarn im Dienste <strong>der</strong><br />
Esterházy.<br />
Wer beerbte wen... und w<strong>an</strong>n?<br />
Zwischen 1801 und 1805 erlebte das Orchester des <strong>Theater</strong> a. d. <strong>Wien</strong> stärkere Personalschw<strong>an</strong>kungen.<br />
Ältere Mitglie<strong>der</strong> starben, traten in den Ruhest<strong>an</strong>d o<strong>der</strong> verließen die Stadt. Sie wurden oft durch gut<br />
beleumundete Musiker aus Prag (als Beispiel <strong>der</strong> Kontrabassist Anton Gr<strong>am</strong>s) o<strong>der</strong> einige <strong>der</strong><br />
herausragenden Talente <strong>der</strong> böhmischen Hauptstadt (z. B. <strong>der</strong> Klarinettist Joseph Friedlowsky) ersetzt. Diese<br />
Engagements st<strong>an</strong>den möglicherweise unter dem Einfluss des Fürsten Lobkowitz – einer <strong>der</strong><br />
leidenschaftlichsten Unterstützer Beethovens – brachten aber auf alle Fälle einige Orchestermusiker nach<br />
<strong>Wien</strong>, die Beethoven schon k<strong>an</strong>nte und mit denen er schon <strong>während</strong> seiner zwei Prager Besuche (1796 und<br />
1798) zus<strong>am</strong>mengearbeitet hatte.<br />
Den nächsten Bericht über einen Personalwechsel in <strong>der</strong> <strong>Oboe</strong>ngruppe gibt es über die Ankunft Fr<strong>an</strong>z<br />
Stadlers aus Prag im Jahre 1804. Die Frage, ob zwischen Libischs Abg<strong>an</strong>g und <strong>der</strong> Ankunft Stadlers<br />
tatsächlich g<strong>an</strong>ze zwei Jahre vergingen, k<strong>an</strong>n im Augenblick nicht mit voller Sicherheit be<strong>an</strong>twortet werden.<br />
Ich vermute, dass Gebauer nicht wie<strong>der</strong> auf die erste Stelle geg<strong>an</strong>gen ist, son<strong>der</strong>n Steph<strong>an</strong> Fichtner sie<br />
vorübergehend bis zu Stadlers Ankunft (die möglicherweise schon einige Zeit im Voraus avisiert wurde)<br />
besetzte und d<strong>an</strong>n auf die zweite Stelle zurückging. Gleichzeitig war Gebauer zunehmend mit <strong>der</strong><br />
Org<strong>an</strong>isation <strong>der</strong> Kopierarbeiten des <strong>Theater</strong>s beschäftigt, <strong>während</strong> <strong>der</strong> Basssänger Philipp Teimer weiterhin<br />
nach Bedarf Englischhorn spielte. Wir wollen nun die Lebensläufe von Stadler und Fichtner näher unter die<br />
Lupe nehmen.<br />
FRANZ STADLER (1760 – 22. Mai 1825)<br />
Keineswegs darf m<strong>an</strong> den Oboisten Fr<strong>an</strong>z Stadler mit dem berühmten Klarinettisten Anton Paul (1753-1812)<br />
und Joh<strong>an</strong>n Nepomuk Fr<strong>an</strong>z (1755-1804) Stadler, Freunde Mozarts, verwechseln, aber auch nicht mit dem<br />
Komponisten und Pi<strong>an</strong>isten Abbé Maximili<strong>an</strong> Stadler (1748-1833) o<strong>der</strong> dem Kontrabassisten Felix Stadler<br />
(1754-1824), ursprünglich auch Mitglied des Freihaustheaterorchesters. Im gleichen Zeitraum in <strong>Wien</strong> aktiv<br />
waren <strong>der</strong> Chorsänger Fr<strong>an</strong>z Stadler (ca. 1755-1811) im Steph<strong>an</strong>sdom 48 sowie <strong>der</strong> gleichn<strong>am</strong>ige Sekretär im<br />
Kriegsministerium (1760-ca. 1837), <strong>der</strong> nebenbei als Amateursänger und Pi<strong>an</strong>ist tätig war. Noch mehr ist<br />
47 Inzwischen gibt es bedeutendes neues biographisches Wissen über die F<strong>am</strong>ilie Teimer, dass aber auf seine Auswertung warten<br />
muss.<br />
48 <strong>Wien</strong>, Magistrat, Totenbeschauprotokoll, 1811, S, Dezember, fol. 134v (gestorben <strong>am</strong> 19. Dezember).Daraus erfahren wir, dass<br />
dieser Fr<strong>an</strong>z Stadler verheiratet war, im Ad<strong>am</strong>berger Haus Nr.30 (innerhalb <strong>der</strong> Stadtmauern) wohnte und <strong>an</strong> Lungenbr<strong>an</strong>d<br />
(Tuberkulose) starb. Einzelheiten des Nachlasses unter <strong>Wien</strong>, Magistrat, Verlassenschaftsabh<strong>an</strong>dlungen 728/1811 (Gustav Gugitz<br />
“Persönlichkeiten” unter “S”)<br />
8