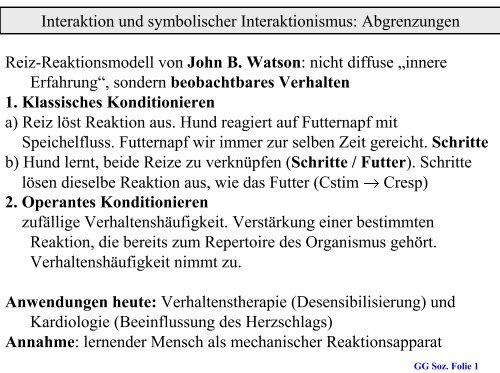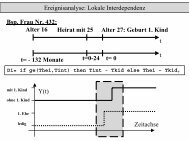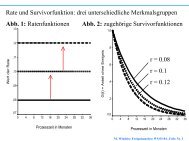Interaktion und symbolischer Interaktionismus: Abgrenzungen Reiz ...
Interaktion und symbolischer Interaktionismus: Abgrenzungen Reiz ...
Interaktion und symbolischer Interaktionismus: Abgrenzungen Reiz ...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Interaktion</strong> <strong>und</strong> <strong>symbolischer</strong> <strong>Interaktion</strong>ismus: <strong>Abgrenzungen</strong><br />
<strong>Reiz</strong>-Reaktionsmodell von John B. Watson: nicht diffuse „innere<br />
Erfahrung“, sondern beobachtbares Verhalten<br />
1. Klassisches Konditionieren<br />
a) <strong>Reiz</strong> löst Reaktion aus. H<strong>und</strong> reagiert auf Futternapf mit<br />
Speichelfluss. Futternapf wir immer zur selben Zeit gereicht. Schritte<br />
b) H<strong>und</strong> lernt, beide <strong>Reiz</strong>e zu verknüpfen (Schritte / Futter). Schritte<br />
lösen dieselbe Reaktion aus, wie das Futter (Cstim → Cresp)<br />
2. Operantes Konditionieren<br />
zufällige Verhaltenshäufigkeit. Verstärkung einer bestimmten<br />
Reaktion, die bereits zum Repertoire des Organismus gehört.<br />
Verhaltenshäufigkeit nimmt zu.<br />
Anwendungen heute: Verhaltenstherapie (Desensibilisierung) <strong>und</strong><br />
Kardiologie (Beeinflussung des Herzschlags)<br />
Annahme: lernender Mensch als mechanischer Reaktionsapparat<br />
GG Soz. Folie 1
George Herbert Mead (angelehnt an Dewey <strong>und</strong> Cooley):<br />
Hauptwerk: Geist, Identität <strong>und</strong> Gesellschaft (1934): innere Erfahrung!<br />
• auf <strong>Reiz</strong> folgt nicht direkt Reaktion. Hemmung der Reaktion<br />
• menschliche Natur ist Produkt der <strong>Interaktion</strong>/Kommunikation<br />
<strong>Reiz</strong>: löst bei einem selbst implizit dieselbe Reaktion aus. Wird jedoch<br />
gehemmt. Ermöglicht so Antizipation der Reaktion Anderer.<br />
Geste: Symbol für Idee einer Handlung Egos, die erfolgen könnte.<br />
Signifikante Geste: Ego weiß: Geste wird auch von Alter so verstanden.<br />
Geist: Reflexivität ermöglicht Rollenübernahme <strong>und</strong> Erkennen des Sinns<br />
von Gesten.<br />
Rollenübernahme: weil Geste auch bei Ego selbst zu gehemmter<br />
Reaktion führt, weiß Ego, das Alter auch so reagieren wird. Erlernen v.<br />
Rollen. Kind im „play“, indem des Handeln beliebiger Personen imitiert.<br />
Führt zum „generalisierten Anderen“ im „game“: z.B. Fußball<br />
Kann nicht durch Konditionierung erklärt werden!<br />
GG Soz. Folie 2
Identität: Selbstbewusstsein im gesellschaftlichen Prozess entwickelt.<br />
Ego lernt, bei sich selbst dieselben Reaktionen auszulösen, wie bei<br />
anderen. Intersubjektivität, d.h. „gemeinsam geteiltes Wissen“ ist<br />
Voraussetzung. Wird wiederum in <strong>Interaktion</strong> erworben.<br />
Selbst (=Identität) besteht aus „I“ <strong>und</strong> „Me“.<br />
Aufgr<strong>und</strong> eigner Biografie reagiert „I“ in spezifischer Weise auf<br />
unmittelbare Erfahrung. Spontan <strong>und</strong> kreativ.<br />
Im „Me“ schlägt sich der „generalisierte Andere“ nieder. Man<br />
betrachtet sich aus der Perspektive der Gesellschaft <strong>und</strong> deren<br />
Verhaltenserwartungen.<br />
„I“ reagiert auf die Betrachtung durch das „Me“.<br />
⇒ Haben alle <strong>Interaktion</strong>steilnehmer „Me“ herausgebildet, stehen<br />
Chancen für eine gelingende <strong>Interaktion</strong> nicht schlecht.<br />
⇒ Problem: situationsspezifische Verhaltenserwartungen, der<br />
„Fremde“ bei Alfred Schütz<br />
GG Soz. Folie 3
Erving Goffman: <strong>Interaktion</strong> als Theater<br />
• In der <strong>Interaktion</strong> erzeugt man besonders durch Gesten Eindrücke bei<br />
Anderen. Realer Eindruck vs. intendierter Eindruck. (Fassade)<br />
• Akteur bewegt sich auf Bühne <strong>und</strong> versucht, den Erwartungen aus<br />
Sicht des „Me“ gerecht zu werden.<br />
• Anspruch auf seine Identität soll in der <strong>Interaktion</strong> durchgesetzt<br />
werden.<br />
• Damit kann man auch Scheitern! Anwendung von Techniken, um<br />
Situation zu retten.<br />
• Identität nichts Feststehendes, sondern wird in der <strong>Interaktion</strong><br />
ausgehandelt.<br />
Bsp.: wissenschaftlicher Fachvortrag. „Das gerupfte Huhn“<br />
GG Soz. Folie 4
Harold Garfikel: Krisenexperimente<br />
1. Analyse der alltäglichen <strong>Interaktion</strong>en:<br />
a) Alltagshandeln basiert auf sicherem „common sense knowledge“<br />
b) Typisierungen von Alltagssituationen: Schemata für konkrete<br />
<strong>Interaktion</strong>ssituationen. Bedürfnis nach Sinn von Situationen.<br />
• Andernfalls: Konstruktion von Sinn. Soziale Nähe <strong>und</strong> Vertrautheit<br />
durch indexikalische Äußerungen<br />
• Unsicherheit bei Nichtverstehen relativiert durch Erwartung der<br />
Klärung. Vorteil unpräziser Äußerungen.<br />
c) Idealisierung von Kontinuität <strong>und</strong> Wiederholbarkeit:<br />
d) Wechselseitige Perspektiven:<br />
• Vertauschbarkeit der Standpunkte: Anderer hätte gleiche<br />
Perspektive<br />
• Kongruenz der Relevanzsysteme: Anderer würde Situation nach<br />
denselben Kriterien beurteilen<br />
2. Krisenexperiment:<br />
a) bis d) werden außer Kraft gesetzt => Akteure geraten unter Druck!<br />
GG Soz. Folie 5
Jürgen Habermas: <strong>Interaktion</strong> als kommunikatives Handeln<br />
• interagierende Akteure wollen sich verständigen<br />
• Verständigung mit dem Ziel der Handlungskoordination<br />
1. Instrumentelles Handeln: 2. Strategisches H. 3. kommunikatives H.<br />
Arbeit, erfolgsorientierte <strong>Interaktion</strong>, verständigungsorientiert<br />
Zweckrationalität<br />
• Analyse des Scheiterns der <strong>Interaktion</strong> in einer<br />
• Idealen Sprechsituation: herrschaftsfrei, Orientierung am<br />
Konsens, Diskurs, „zwangloser Zwang des besseren Argumentes“<br />
vs.<br />
• Realität: Macht <strong>und</strong> „nicht verstehen wollen“.<br />
• Ursache: Sphäre der Zweckrationalität expandiert in Lebenswelt<br />
hinein. „Berechenbarkeit“ dringt auch in „privates Leben“<br />
⇒ „Kolonialisierung der Lebenswelt“ durch Zweckrationalität<br />
⇒ Erkenntnis als kritische Theorie der Gesellschaft<br />
GG Soz. Folie 6