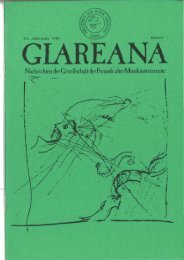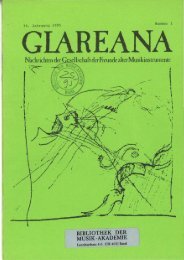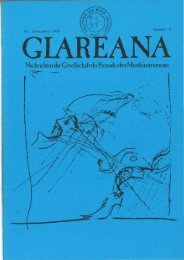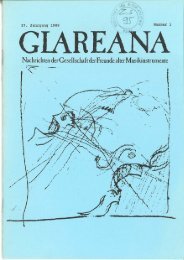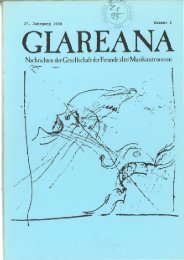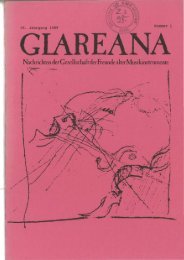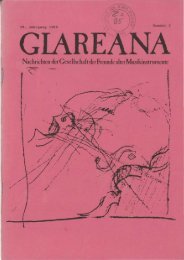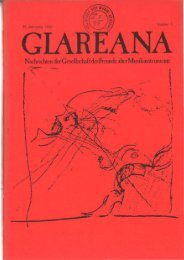Glareana_45_1996_#1
Heinrich Kawinski und Martin Kirnbauer Querflöten aus dem aussergewöhnlichen Werkstoff Glas [Zweitveröffentlichung aus: Restauro - Zeitschrift für Kunsttechniken, Restaurierung und Museumsfragen, 102 / H. 1 (1996), 22-27.]
Heinrich Kawinski und Martin Kirnbauer Querflöten aus dem aussergewöhnlichen Werkstoff Glas
[Zweitveröffentlichung aus: Restauro - Zeitschrift für Kunsttechniken, Restaurierung und Museumsfragen, 102 / H. 1 (1996), 22-27.]
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>1996</strong> <strong>45</strong>.Jahrgang Heft 1<br />
GLAREANA<br />
Nachrichten<br />
der Gesellschaft<br />
der Freunde<br />
alter Musikinstrumente
GLAREANA<br />
Nachrichten der Gesellschaft der Freunde alter Musikinstrumente<br />
<strong>1996</strong><br />
<strong>45</strong>. Jahrgang<br />
Heft 1<br />
Inhalt<br />
Editorial I<br />
Editorial II. Adressen des Vorstands<br />
2<br />
3<br />
Beiträge<br />
Heinrich Kawinski und Martin Kirnbauer<br />
Querflöten aus dem aussergewöhnlichen Werkstoff Glas<br />
4<br />
Drehleier und Musette - ein altes und wohlklingendes Paar<br />
GEFAM-Jahresversammlung vom 5. Mai 16<br />
Petition gegen die Schliessung der Geigenbauschule in Brienz 19<br />
Diebstähle in den Musikinstrumenten-Sammlungen von Basel und Bad Säekingen 21<br />
Mitteilungen und Termine 22<br />
Mutationen (Adressänderungen, Ein- und Austritte) 24<br />
Redaktionsschluss: für Heft 1: 31 .Januar; für Heft 2: 31.Juli
2<br />
Editorlall<br />
Liebe Mitglieder der Gesellschaft der Freunde alter Musikinstrumente!<br />
Aufgrund meiner beruflichen Aufgaben sehe ich mich gezwungen, die arbeitsintensiven,<br />
sogenannten "Nebenbeschäftigungen" abzugeben. Dazu gehört zweifelsohne auch die<br />
Redaktion der GLAREANA. Meine Prioritäten müssen sich für die nächsten drei bis vier<br />
Jahre auf die Neueinrichtung eines Musikmuseums in Basel konzentrieren, und dass<br />
daneben wenig freie Kapazitäten bleiben, bedarf wohl kaum weiterer Erklärungen. Auch<br />
würden sich weitere unnötige Fehler einschleichen, wie z.B. im letzten Heft (2/1995), wo in<br />
der Vorstandsliste leider wiederum Harry Joelson-Strohbach als Adressverwalter<br />
vergessen wurde, eine Funktion, die für einen Verein besonders wichtig ist!! Ich möchte<br />
mich hier für diesen Lapsus entschuldigen.<br />
Auf der Suche nach einer Nachfolge sind wir dann bald fündig geworden: Glücklicherweise<br />
stellt sich Frau Rebekka Reichlin zur Verfügung, ein Mitglied unserer Gesellschaft aus<br />
der jungen Generation, was mir zusätzlich Freude bereitet. Sie bringt sowohl musikalische<br />
als auch journalistische Erfahrung mit und ist damit für die Aufgabe zweifelsohne sehr<br />
qualifiziert. Ich möchte hiermit alle Mitglieder herzlich bitten, die Unterlagen für die<br />
GLAREANA in Zukunft Frau Reichlin zukommen zu lassen und damit die aktive Mitarbeit<br />
in der Gesellschaft wie bisher weiterzuführen. Die Adresse von Frau Reichlin finden Sie in<br />
der Liste der Vorstandsmitglieder.<br />
Ich selbst möchte mich hier von Ihnen als Redaktorin der GLAREANA nach fünfeinhalb<br />
Jahren verabschieden und Ihnen allen für Ihre Mitarbeit danken.<br />
Veronika Gutmann
3<br />
Editorial II<br />
Liebe Leserinnen und Leser<br />
Nun übernehme ich also das Szepter - heutzutage heisst das: die Diskette - von Frau<br />
Gutmann und ich freue mich darauf, die GLAREANA zu machen. Mir persönlich gibt diese<br />
Tätigkeit die Möglichkeit, etwas näher an die alte Musik heranzurücken. Bedingt durch<br />
mein Slavistik-Studium an der Universität Bern und meine passive Mitgliedschaft in der<br />
GEFAM, hatten in den letzten Jahren andere Gebiete mehr Gewicht bekommen. Die<br />
Freude und das Interesse an alter Musik und Instrumenten habe ich aber überhaupt nicht<br />
verloren. Die Redaktion der GLAREANA gibt mir die Möglichkeit, lustvoll und neugierig<br />
Journalismus und alte Musik zu verbinden.<br />
Dabei hoffe ich natürlich, dass das Produkt - die GLAREANA - Ihnen gefällt und Sie<br />
anregt. Ich bin aber auch angewiesen auf Ihre Unterstützung. Falls Sie etwas geschrieben<br />
haben oder schreiben möchten, falls Sie Ideen haben für Berichte, falls ein Thema Sie<br />
brennend interessieren würde, falls Sie Kritik äussern möchten, nehmen Sie doch bitte mit<br />
mir Kontakt auf! Ich bin sehr neugierig auf Ihre Meinung, Ihr Anliegen, Ihre Idee I<br />
Die Verspätung, mit der diese Ausgabe der GLAREANA erscheint, bitte ich Sie zu<br />
entschuldigen, die nächsten Nummern sollten wieder termingerecht bei Ihnen sein. Ganz<br />
herzlich möchte ich mich bei Frau Gutmann für ihre Unterstützung und Arbeit bedanken.<br />
Nun wünsche ich allen viel GLAREANA-Lesegenussl<br />
Rebekka Reichlin<br />
Der Vorstand der Gesellschaft der Freunde alter Musikinstrumente<br />
Präsident: Georg F. Senn, Bündtenweg 62,4102 Binningen<br />
Vizepräsident Paul J. Reichlin-Moser, Im Seeli, 8833 Samstagern<br />
Kassier: Hannes Paul Scherrer, Suntenwiesenweg 4, 8803 Rüschlikon<br />
Aktuar: Uc. phil. Thomas Drescher, Lenzgasse 25, 4056 Basel<br />
Beisitzer: Dr. phil. Veronika Gutmann, Bachlettenstr. 82, 4054 Basel<br />
Markus Hünninger, Stöberstr. 15, 4055 Basel<br />
Adressverwaltung: Harry Joelson-Strohbach, Albanistr. 16, 8400 Winterthur<br />
GLAREANA·Redaktion: Rebekka Reichlin, Zinggstr. 24, 3007 Bern
4<br />
Querflöten aus dem aussergewöhnlichen Werkstoff Glas<br />
von<br />
Heinrich Kawinski und Martin Kirnbauer<br />
I<br />
Abb. 1 Glasflöte mit zwei alternativen Fussstücken und originalem Etui von C.Laurent,<br />
Paris 1815, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg lnv.Nr. Ml410 (GNM) [J.Musolf]<br />
Über 50 Querflöten, deren Korpus aus Glas gefertigt ist, haben sich in verschiedenen<br />
Musikinstrumentensammlungen erhalten. Sie datieren alle in die erste Hälfte des 19.<br />
Jahrhunderts und wurden zumeist von Claude Laurent gefertigt 1 .<br />
Weitere solche<br />
Glasquerflöten sind nur noch von seinem Werkstattnachfolger J. D. Breton 2 und einem<br />
Brüsseler Hersteller mit Namen Louis Joseph Constantin Savreux 3 bekannt. Sie weisen<br />
Besonderheiten auf, die auch von konservatorischer Bedeutung sind. So traten an der im<br />
Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg verwahrten Querflöte von Claude Laurent,<br />
Paris 1815 (Abb. 1 ), aufgrund der spezifischen Werkstoffeigenschaften Probleme auf, die<br />
sich allerdings später als Scheinprobleme herausstellten. Sie waren aber der Ausgangspunkt<br />
für Fragen nach der<br />
Herstellungstechnik. Als zusätzliches<br />
Vergleichsinstrument<br />
diente eine etwas spätere,<br />
sonst aber weitgehend<br />
gleichartige Flöte von Laurent<br />
im Historischen Museum<br />
Basel Abb. 2 4 •<br />
Abb. 2 Glasflöte von C.Laurent, Paris 1826, Historisches<br />
Museum Basellnv.Nr. 1957.12. (HMB) [M.Kirnbauer]<br />
' Vgl. hierzu die allerdings bei weitem nicht vollständige Auflistung bei L.G. Langwill, Musical Wind-Instrument<br />
~. Edinburgh 6/1980, $.101<br />
2 Tätig zwischen 1848 und 1874; W. Waterhouse, Tbe New Langwm Index A Dictionary of Musjcal Wind<br />
Instrument Makers and Inventars, London 1993, S.44<br />
3 Tätig um 1825- Waterhouse, siehe Anm. 2, S.347. Eine vierteilige Glasflöte mit 4 Klappen, angeblich das<br />
Instrument eines Darmstädter Herzogs, hat sich in einer deutschen Privatsammlung erhalten.<br />
4 Historisches Museum Basel, lnv.-Nr. 1957.12., signiert ·c. LAURENT A PARIS 1826./ Brevete•.
5<br />
Die Querflöte von Claude Laurent in Nürnberg<br />
Die vierteilige Nürnberger Flöte (lnventarnummer MI 41 O) ist durch die Gravur "Laurent ä<br />
Paris 1815 I Brevete• signiert und vollständig in einem originalen mahagonifurnierten<br />
Kasten erhalten. Zu dem üblichen D-Fussstück gibt es ein alternativ zu verwendendes C<br />
Fussstück. Die Flöte trägt 6 Klappen für c2, b 1, gis 1, doppeltes f1 und dis 1 bzw. mit C<br />
Fussstück 8 Klappen (zusätzlich cis 1 und c 1) in Säulchen Iagerung. Die gläsernen Korpusteile<br />
sind an den Enden mit Silbertüllen verbunden, der Pfropfen besteht offenbar<br />
ebenfalls aus Glas 5 .<br />
Werkstoff Glas in den Quellenschriften<br />
Die Verwendung von Glas als Werkstoff im "Holz"-Biasinstrumentenbau hat eine lange<br />
Tradition. Bereits in mittelalterlichen Texten ist von "businen• aus Glas die Rede 6 , 1511<br />
erwähnt A. Schlick "glass" als scheinbar selbstverständliches Material für Orgelpfeifen 7 ,<br />
und 1547 werden im Inventar Henry's VIII. von England auch ausdrücklich "iii fflutes of<br />
glasse and one of woode painted like glasse" genannt 8 . Ein knappes Jahrhundert später<br />
berichtet M. Mersenne über Flöten: "ons les fait ordinairement de buis; elles sont aussi fort<br />
bonnes de chrystal, ou de verre & d'ebene." 9 (Üblicherweise fertigt man die Flöten aus<br />
Buchsbaumholz; sie sind auch sehr gut aus "chrystal" oder Glas und aus Ebenholz.)<br />
Der Glasflötenbauer Claude Laurent<br />
Durch erhaltene Instrumente belegbare Verwendung im Instrumentenbau findet dieses<br />
Material aber erst zu Beginn des 19. Jahrhunderts. 1806 erwirbt Claude Laurent, ein aus<br />
Langres stammender Pariser Uhrmacher und Mechaniker, ein Patent "pour une flute en<br />
cristal" 10 . Neben einer Reihe von "Verbesserungen" - im Sinne von Veränderungen - in<br />
der Lochanordnung, der Verwendung von bestimmten weniger bruchanfälligen Klappenfedern<br />
und der Anbringung von metallenen Zapfenverbindungen mit<br />
Bajonettverschlüssen 11 stellt die grosse Besonderheit seiner neuen Flöte das Material<br />
Glas und seine speziellen Eigenschaften dar. Dazu heisst es in der Patentschrift:<br />
5<br />
Eine Beschreibung des Instrumentes findet sich bei J.H. van der Meer, Neuerwerbungen des<br />
Germanischen Nationalmyseyms, in: Anzeiger des GNM 1972, Nümberg 1973, S.186<br />
• Vgl. F. Brücker, Die BlasinstrumenJe ja der altfranzösischen Literatur. Gießen 1926, S.18<br />
7 Spiegel der Orgelmacher, Speyer 1511, Das Acht Capitel, 1.3: •orgelt oder positiff I was pfeiffen die haben<br />
von metalt holtz I bapir I duch oder glaß [ ... ]" (Was auch immer von einer derartigen Überlieferung zu halten<br />
sein mag: die Autoren.)<br />
8<br />
"inventory of the Guarderobes• Britlsh Llbrary London, Ms. Harley 1419: hier zitiert nach C. Sachs,<br />
Beallexjkon der Musikinstrumente, Berlin 1913, S.159a<br />
9 M. Mersenne, Harmonie universelle, Paris 1636, f.13v. ·Könnte aus dieser Stelle vielleicht geschlossen<br />
werden, daß die Begriffe chrystal und verre synonym verwendet sind, zeigt die 1648 erschienene lateinische<br />
Ausgabe eine klare Reihung an: "ebeno, vitro, atque chrystallo, quibus adde cerram. &c.".<br />
' 0 Patent Nr.236 vom 21 . November 1806; freundlicherweise zur Verlügung gestellt vom Staatlichen Institut<br />
für Musikforschung, PK, Berlin. Bereits aus dem Jahre 1805 hat sich eine gläserne Quertlöte Laucents<br />
erhalten (Sotheby·Auktion London 14.Juni 1990, Losnummer 148).<br />
11<br />
Für eine aus1Uhr1ichere Darstellung dieser Aspekte siehe N. Toff, The Development of the Modern flute,<br />
New York 1979, S.31 ff.
6<br />
"On sait que tous les instrumans en bois ou en ivoire se<br />
gonflent par l'humidite atmospherique, ou par celle que<br />
produit le soufle du musicien, et qu'ils se dessechent,<br />
quelquefois se fendent, lorsque, dans un temps sec, on est<br />
long-temps sans en faire usage. Le cristal, au contraire,<br />
impassible aux effets de l'humidite, conserve toujours ses<br />
m~mes dimensions, et joint ä son inalterabilite une compacite<br />
elastique qui rend l'instrument plus sonore et plus facile."<br />
(Man weiss, dass alle Instrumente aus Holz oder Elfenbein durch<br />
Luft- oder Atemfeuchtigkeit quellen, und dass sie austrocknen<br />
und manchmal auch reissen, wenn sie in trockener Luft lange<br />
unbenutzt bleiben. Im Gegensatz dazu bewahrt "cristal",<br />
unbeeinflusst von den Auswirkungen der Feuchtigkeit, immer<br />
seine Masse und verfügt neben der Unveränderlichkeit über<br />
Elastizität, die das Instrument klangvoller und müheloser<br />
spielbar macht.)<br />
Diese Vorzüge bestätigt auch eine "Commission aus den Mitgliedern des Kaiserlichen<br />
Conservatoriums der Musik" in Paris mit folgendem Untersuchungsbericht<br />
"Die Proben wurden bei verschiedenen Graden der Temperatur <br />
von 5 bis 6 Grad über dem Nullpunkte des Reaumursehen Thermometers<br />
bis zu der stärksten Hitze eines Kaminfeuers - angestellt,<br />
und es ergab sich, dass das gläserne Instrument keine<br />
Veränderung des Tons, selbst bei dem schnellsten Wechsel der<br />
Temperatur von der Wärme zur Kälte, und eben so wenig bei dem<br />
allmähligen Uebergange von dem einen zu dem anderen Extrem<br />
erlitt." 12<br />
Im Patenttext bezeichnet Laurent das Material als "cristal". Diese Bezeichnung ist doppeldeutig<br />
und kann sich - vom Hersteller vielleicht nicht ganz unbeabsichtigt - einerseits auf<br />
Quarz oder "Bergkristall", andererseits aber auf Glas mit einem hohen Bleigehalt<br />
beziehen, das gemeinhin Kristallglas genannt wird. Diese Materialzusammensetzung<br />
zeichnet sich gegenüber herkömmlichen Glassorten durch eine stärkere Lichtbrechung<br />
und einen damit zusammenhängenden schönen, kräftigen Glanz aus. Zudem ist dieses<br />
Glas etwas weicher und lässt sich deshalb leichter schleifen und bearbeiten. Durch die<br />
12 Nach einem Bericht des Weimarer Journal des Luxus und der Moden, Ausgabe Juni 1806, $ .385 f.; zitiert<br />
hier nach K. Ventzke, Krjstallglas!föten im 19 Jahrhundert, in: Tibia 3/4 (197Bn9), $.397-399. Diese etwas<br />
gewaltsam erscheinende Versuchsanordnung entsprach seinerzeit durchaus realen Anforderungen, die die<br />
Zellgenossen sehr beschäftigte, vgl. den Beitrag von J.H. Liebeskind, Bruchstücke aus ejnem noch<br />
uogedruck1en phjlosophjsch·prak1jscheo Versuche Ober dje Natur und das Taospiel der deutscheo Flöteo, ln:<br />
Allgemeine Musikalische Zeitung (1aon. besonders in Nr.a Sp. 11 3-120.
7<br />
Zugabe geringer Mengen färbender Stoffe 13 lässt sich auch eine Tönung des Glases<br />
erreichen. Beides - ausgefeilten Schliff mit zahlreichen spiegelnden Flächen sowie<br />
gelegentlich auch Einfärbung - hat Laurent für seine Instrumente zur Anwendung<br />
gebracht.<br />
Warum Glas?<br />
Neben den bereits oben erwähnten akustischen Vorteilen war diese äusserliche<br />
Prächtigkelt sicher nur ein weiterer Anlass, gerade Glas für die Flötenherstellung zu verwenden.<br />
Daneben bot die Außergewöhnlichkeit des Materiales wie auch die Beherrschung<br />
eines hohen, spezifisch technologischen Standards Laurent eine gute Möglichkeit,<br />
sich als "flötenbauender Uhrmacher• gegen eine starke Konkurrenz von Instrumentenbauern<br />
im damaligen Paris durchzusetzen 14 • Stolz heisst es auch in der Patentschritt,<br />
dass die Bearbeitung dieses Materiales schwierig sei: "Le travail de cette matiere<br />
presentait des difficultes qu'il a fallu surmonter, on a meme trouve le moyen de rendre<br />
encore l'instrument plus partalt dans son execution."<br />
Schliesslich darf nicht vergessen werden, dass die Möglichkeiten der traditionellen<br />
Bauweise von Flöten zu jener Zeit weitestgehend erschöpft schienen, das zeigen nicht<br />
zuletzt die Auseinandersetzungen führender Flötisten und Flötenbauer in den damaligen<br />
Fachzeitschritten 15 . Ausserdem läßt sich in der Verwendung von Glas vielleicht ein<br />
gewisses manieristisches Moment entdecken, zumal diese Instrumente auch<br />
entsprechend teuer waren 16 •<br />
Zustand der Nürnberger Flöte<br />
Folgendes konnte an der Glasflöte im GNM anläßlich der Übernahme 1979 sowie später<br />
1987 beobachtet werden:<br />
Neben einigen Korrosionsschäden an den Metallteilen wurde vor allen Dingen eine rauhe<br />
Oberfläche der Innenbohrung registriert, die das Glas trübe erscheinen lässt. ln den<br />
Kehlen der rundum eingeschliffenen Rippen fanden sich an einigen Stellen geringe<br />
Mengen einer hellen, körnigen Substanz, die sich leicht entfernen liess.<br />
Rund um das Anblasloch fiel eine aufgerauhte Partie auf, die besonders auf der dem<br />
Spieler zugewandten Seite weit hinunterreicht. Die Anblaskante ist in Blasrichtung<br />
geringfügig ausgebrochen, die gesamte Kante leicht gerundet.<br />
13<br />
Z.B. Se, Co203, Mn203, CuO, U02 oder Cr203. Schöne Beispiele gefärbter Flöten Laucents finden sich<br />
in der Sammlung Dayton C. Miller, heute in der Library of Congress, Washington D.C.<br />
14<br />
Vielleichtaufgrund dieses Vorsprunges war er 1806 auch der erste Hersteller von 'Holzblasinstrumenten'<br />
auf einer industriellen Handelsmesse (siehe Waterhouse, siehe Anm.2, 8.225). der dabei sogleich eine<br />
Silbermedaille erringen konnte, die für einen Flötenbauer für Jahrzehnte singulär blieb (siehe T. Giannini,<br />
Great Flute Makers of France • The Lot & Godroy Families 1650·1900, London 1993, S.216).<br />
15<br />
Siehe hierzu z.B. D.H. Förster, Die Flöte im frühen 19 Jahrhundert, in: Tibia 3/4 (1978n9), S.222-230<br />
18<br />
Laureets Nachfolger Breton verkaufte 1855 eine fünfklappige Glasflöte für die enorme Summe von 1.500<br />
Francs (nach Waterhouse, siehe Anm.2., S.44). ln dem oben erwähnten Beitrag Krjstallglasflöten (siehe<br />
Anm.12) vergleicht Ventzke wohl nicht zu Unrecht die Glasflöten mit den heute hin und wieder<br />
anzutreffenden Platinflöten.
8<br />
"Giaskrankheit"?<br />
in der Summe führten diese Beobachtungen im Jahre 1979 zu der Annahme, die sogenannte<br />
Glaskrankheit sei die Ursache. 17 Darunter lässt sich einerseits eine oberflächliche<br />
Korrosion vor allem an Punkten grösserer Materialspannung verstehen, andererseits aber<br />
eine "Entglasung", bei welcher es zur Ausscheidung fester, meist kristalliner Partikel in der<br />
Glasmasse kommt. Gestützt wurde diese Annahme durch Informationen wie der<br />
folgenden:<br />
"Bei Museumsgegenständen aus G.[las] führt hohe<br />
Luftfeuchtigkeit [oder eben Blasfeuchtigkeit, die Autoren) zur<br />
Auslaugung der alkalischen Bestandteile, weshalb eine<br />
Konservierung erfolgen muß. Von der Herstellung her befinden<br />
sich auf der G.-Oberfläche viele offene Bindungen. Durch<br />
Reaktionen mit der Luftfeuchtigkeit bilden sich dort<br />
Gruppierungen wie -SiOH aus, die für die Oberflächenchemie<br />
des G. verantwortlich sind." 18<br />
Als konservatorische Massnahme wurde eine Entwässerung des Glases mit Aceton und<br />
anschliessender Alkoholtrocknung durchgeführt. Diese Massnahme ist allerdings kaum als<br />
wirksam gegen allfällig wasserbeteiligte Glaskrankheit zu betrachten. Glas enthält lediglich<br />
in kleinsten Mengen an der Oberfläche adsorbiertes Wasser, das sich nach Verdampfen<br />
der Lösemittel, soweit diese überhaupt wasserfrei sind, aus der Luftfeuchtigkeit sofort<br />
wieder zurückbildet. Jedes künftiges Anspielen des Instrumentes wurde aber strikt ausgeschlossen.<br />
Korrosion<br />
An den Metallteilen des Instrumentes gab es neben einer leichten Silberschwärzung ein<br />
besonderes Problem: Die Säulchen für die Befestigung der Klappenapplikatur stecken in<br />
Korpuslöchern, die bis zur Innenbohrung hineinreichen. Dort sind sie von innen mit einer<br />
Art von runden Schraubenmuttern aus Messing befestigt, die zusätzlich mit Schellack (?)<br />
gehalten werden, was zugleich Dichtungsfunktion hat. Diese Messingteile waren stark<br />
korrodiert (Grünspan) und mit dem Schellack in den schwer zugänglichen Korpuslöchern<br />
richtiggehend verbacken.<br />
Bei einer erneuten restauratorischen Bearbeitung kamen Zweifel an dieser für das Objekt<br />
vernichtenden Diagnose Glaskrankheit auf. Diese führten zur Frage nach der vermutlichen<br />
Herstellungstechnik der Glasflöte.<br />
[<br />
17<br />
Restaurierungsprotokoll des Germanischen Nationalmuseums 1979, Friedemann Helfwig<br />
18<br />
Zitiert nach H. Römpp, Chemie-Lexikon, Stuttgart 8/1981 , Bd.2, 5.1486
9<br />
Mutmassungen zur Herstellung des Instrumentes<br />
Glasrohr als Rohling<br />
Der Rohling für die Herstellung der Flötenteile dürfte ein dickwandiges gezogenes<br />
Glasrohr gewesen sein. Für einen vorangegangenen Ziehvorgang sprechen eindeutig<br />
einige wenige im Glaskörper eingeschlossene langgezogene Gasblasen. Solche könnten<br />
zwar in gezogenen massiven Glasstäben ebenfalls vorkommen, doch wird vernünftigerweise<br />
niemand einen Glasstab längs aufbahren, wenn er stattdessen von einem Rohr<br />
ausgehen kann.<br />
Schleifen der Rippen<br />
Die zahlreichen an allen Teilen des Instrumentes u.a. zur Verzierung ("Kristall"!), aber<br />
auch zur Gewichtsverminderung angebrachten Rippen sind sicher eingeschliffen worden.<br />
Einschlägige Schleiftechniken mit rotierenden schleifmittelbelegten Metall- oder Holzscheiben<br />
waren seinerzeit schon lange bekannt.<br />
Polieren<br />
Weniger sicher liess sich aber zunächst die Art des Poliervorganges angeben. Neben<br />
mechanischer Politur mit Polierrot oder Poliertonerde wäre an Feuerpolitur zu denken, bei<br />
welcher der fertig geschliffene Glaskörper sehr vorsichtig eben so hoch erhitzt wird, daß<br />
die Rauhigkeiten verschmelzen, es aber noch nicht zu einer Verformung kommt. Danach<br />
muss sehr sorgfältig durch langsames Absenken der Temperatur "gekühlt" werden, um<br />
die Spannungen im Glas auszugleichen. Schliesslich wäre noch die heute meist übliche<br />
Politur im Flussäurebad denkbar 19 - Flussäure ist schon seit 1771 bekannt 20 •<br />
Zur Entscheidung zwischen den Werkstoffen Glas und Quarz wurde eine Prüfung mit<br />
gekreuzten Polarisationsfiltern vorgenommen, die neben dem Befund Glas außerdem<br />
zeigte, daß alle Glasteile völlig spannungsfrei sind. Dies machte angesichts der damals<br />
doch schwierigen Regelung eines Kühlprozesses eine Feuerpolitur so dickwandiger<br />
Glaskörper nicht eben wahrscheinlich. Eine genauere Untersuchung der Flöte führte<br />
schließlich auf die Spur des Poliervorganges: ln der Tiefe von einigen der spitzwinkligen<br />
Zwickel zwischen den Rippen konnten rauhe Stellen beobachtet werden, wie sie<br />
zustandekommen, wenn die rotierende Polierscheibe die tiefste Stelle des<br />
eingeschliffenen Glaskörpers nicht erreicht. Dieser Befund belegt zweifelsfrei eine schon<br />
vorher als besonders wahrscheinlich vermutete mechanische Politur und erklärt zugleich<br />
ein Sympton, das zur Diagnose Glaskrankheit geführt hatte.<br />
Anzumerken wäre noch, dass die bis hierher beschriebenen Herstellungsschritte vielleicht<br />
nicht vom Instrumentenmacher ausgeführt worden sind, sondern in einer spezialisierten<br />
Glashütte, wo man mit solchen Arbeiten wohl vertraut war.<br />
•• H. Ost, Lehrbuch der Chemischen Technologie, Leipzig 9/1918, S.287<br />
20 C.W. Scheele, Kongl. Yetenskaps-Akademiens haodlioger, Stockholm 1771, 8.120
10<br />
Bohrung<br />
Für den genauen Herstellungsgang der Bohrung sind keine Quellen<br />
bekannt,<br />
insbesondere schweigt sich auch der Patentbericht darüber aus. Dieser beschränkt sich<br />
auf traditionelle flötenbauliche Aspekte, die "Betriebsgeheimnisse· wohlweislich hütend. ln<br />
Anlehnung an die heutige Praxis der Herstellung von konischen Schliffverbindungen für<br />
chemisch-technische Zwecke, die ja ebenfalls auf eine längere Tradition zurückgeht 21 , ist<br />
aber mit<br />
Bestimmtheit anzunehmen, daß die Bohrung des Instrumentes durch<br />
Ausschleifen hergestellt worden ist.<br />
Dies könnte so zugegangen sein, dass der Hersteller für jedes der Teilstücke einen der<br />
Mensur entsprechend abgedrehten Dorn aus Metall, z.B. Eisen, aussen mit einem Brei<br />
aus Schleifmittel und Schmierflüssigkeit bedeckt, in Drehung versetzt und das Glasrohr<br />
wiederholt darübergeschoben hat, so lange, bis sich der leicht konische Dorn bis zum<br />
angestrebten Endmass der Innenbohrung einführen ließ. Die Bohrung des Instrumentes<br />
zeigt an verschiedenen Stellen peripher umlaufende Riefen, die kaum anders als durch<br />
gröbere Körner im Schleifmaterial erzeugt worden sein können und damit einen derartigen<br />
Schleifvorgang belegen.<br />
I<br />
Hülsenschliff<br />
Zur Veranschaulichung seien hier die heute üblichen Schritte zur Herstellung eines<br />
Hülsenschliffes vorgestellt: Abbildung 3 zeigt den am Ende durch Erweichenlassen vor<br />
der Gebläselampe und drehendes Einführen eines konischen Holz· oder Graphitdornes<br />
aufgeweiteten Rohling zusammen mit dem Schleifwerkzeug, das hier aus einem eisernen<br />
Trägerkonus und einer aufgesteckten und nach Abnutzung auswechselbaren kegeligen<br />
Hülse mit der genauen Steigung besteht. Nach Einsetzen des Schleifwerkzeuges in die<br />
Drehmaschine wird mit Wasser angeschlämmtes Schleifmittel, heute meist Siliciumcarbid,<br />
auf die Hülse aufgetragen (Abb. 4) und das Schleifwerkzeug in Rotation versetzt. Der<br />
Schleifvorgang besteht in öfter wiederholtarn Aufschieben des Rohlings und Nachsetzen<br />
von Schleifmittel (siehe Abb. 5). Das Endergebnis (Abb. 6) ist eine rauhe kegelmantel·<br />
förmige Innenzone (Hülsenschliff) mit der gewünschten Steigung, in welche ein entsprechendes<br />
Gegenstück mit geschliffener Aussenzone von gleicher Steigung (Kernschliff) zur<br />
Herstellung einer lösbaren Ganzglasverbindung eingeführt werden kann. Die Steigung<br />
des Innenkonus der Flöte ist allerdings viel geringer als bei dieser modernen Norm·<br />
schliffverbindung.<br />
.I<br />
21<br />
So sollen eingeschliffene Glasstopfen schon in den Apotheken und alchimistischen Laboratorien des<br />
Mittelalters vorgekommen sein, während es lösbare konische Schliffverbindungen im heutigen Sinne<br />
allerdings erst seit etwa 1906 gibt; siehe F. Friedrichs, Das Glas im chemjschen Laboratorium, Berlin 3/1960,<br />
S.23
11
12<br />
j<br />
Schleifmaterial<br />
Welches Schleifmaterial seinerzeit wirklich verwendet wurde, ist nicht bekannt. Das relativ<br />
weiche Glas lässt sich aber bereits mit Quarzsand schleifen. Jedenfalls wurde hierzu eine<br />
einheitliche Kornfraktion des Schleifmittels benötigt, die man damals wohl - genau wie<br />
noch vor wenigen Jahrzehnten - nach dem Absieben von groben Partikeln durch<br />
Aufschlämmen mit Wasser und Absetzenlassen nach Zeit selbst erzeugen konnte.<br />
Ungenügende Aufmerksamkeit bei diesem Vorgang oder unsaubere Arbeitsweise hatte<br />
dann zur Folge, dass sich gröbere Körner in der feineren Fraktion befanden. Dies führte<br />
zur Bildung von Kratzern und Riefen beim Schleifen. Als Schmiermittel sind neben Wasser<br />
verschiedene dünnflüssige Öle verwendet worden.<br />
Polierte oder nichtpolierte lnnenbohrung?<br />
Die Bohrung der Flöte war mit Sicherheit nie poliert. Dafür spricht einmal die Tatsache,<br />
dass beim Polieren eine wenn auch geringe Aufweitung der Mensur eintritt, deren klangliche<br />
Auswirkung sich nur schwer im voraus abschätzen lässt. Der Abstimmvorgang nach<br />
dem Bohren der Grifflöcher wird zudem sicher noch nachträgliche Eingriffe an der Mensur<br />
erfordert haben, und solche sind vermutlich durch reines Nachpolieren nicht zu verwirklichen,<br />
weil dieser Vorgang dafür wiederum zu wenig Material abträgt. Zum anderen wird<br />
aber eine rauhe innere Oberfläche aus klanglichen Gründen durchaus erwünscht gewesen<br />
sein, was auch historisch belegt ist. So schreibt Justus Johannes Heinrich Ribock zu<br />
einer Flöte von Friedrich Gabrial August Kirst, tätig in Potsdam zwischen 1772 und 1804:<br />
"Ich habe eine Flöte aus Ebenholz von ihm gesehen, die inwendig<br />
eine vollkommene Spiegelpolitur hatte. ln seiner Art ist das<br />
ein Meisterstück, dennoch aber, meiner Meinung nach, nicht zu<br />
billigen. Denn 1) können bei solchen Ausschleifungen die<br />
richtigen Dimensionen schwerlich allenthalben beibehalten<br />
werden, wie man ohne weitere sorgfältige Prüfung, in den<br />
Gegenden der Einzapfungen schon merken kann, wenn man ein<br />
solches Instrument ganz der Länge nach durchsiahet 2) So<br />
werden alle pori des Holzes so voll der Unelastischen Materie<br />
des Schleifens, aus Bimsstein oder Schmirgel mit Oele,<br />
gepfropfet, daß die Abprallung und Resonanz gewiss variieret.<br />
Überdem so weiss ich aus Erfahrung, dass man auf diesem Wege<br />
eine besondere Verbesserung des Tones vergeblich suchet. Ich<br />
habe selbst eine Flöte, die, was die Nettigkeit des Tones<br />
betritt, uniadelich ist, und dennoch so wenig mühsame Politur<br />
hat, dass man vielmehr noch jeden Schnitt des Bohrers siehet." 22<br />
22<br />
J.J.H. Ribock, Bemerkungen über die flöte und Versuch zy ejner kurzen Anleitung zur bessern<br />
Einrichtung und Behandlung derselben, Sieodal 1782, S.33. - Herrn Rainer Weber sei für die Vermittlung des<br />
Zitats gedankt.
13<br />
Es darf aber hier nicht unerwähnt bleiben, dass es auch mindestens vier Glasflöten mit<br />
polierter Innenbohrung gibt, darunter drei von Laurent selbst 23 • Diese und ein unsigniertes<br />
Instrument unterscheiden sich auch äusserlich von den "normalen" Laurentschen Flöten<br />
durch ein geschliffenes und poliertes Rautenmuster an Stelle der Längsrippen auf der gesamten<br />
Aussenseite, wobei nur der Bereich des Anblasloches meistens aufgerauht ist, an<br />
einer Flöte aber auch nicht. Hinsichtlich ihrer vermutlichen Intentionen bezüglich der lnnenbohrung<br />
sei aber auf Kirst und die entsprechende Stellungnahme von Ribock<br />
hingewiesen.<br />
Bohren der Griff-, Klappen- und Korpuslöcher<br />
Die Griff- und Klappenlöcher sind gebohrt worden. Hierfür stand damals mindestens die<br />
schon in der Steinzeit geübte Technik mit Bogenbohrer und Schleifmittel zur Verfügung.<br />
Das Hinterschleifen zum Zweck des genauen Einstimmens der Flöte sowie das ovale<br />
Ausformen des Anblasloches dürften ähnlich wie die Mensurbohrung vorgenommen<br />
worden sein. Gleiches gilt für die Korpuslöcher, in denen die Gewindestifte der die<br />
Klappenlager tragenden Säulchen stehen. Diese Gewindestifte reichen in den Innenraum<br />
der Flöte hinein und sind dort mit konischen Muttern befestigt, die in genau passenden<br />
Bohrungen versenkt sind.<br />
Die Herstellung dieser Bohrungen vom Innenraum der Flöte aus erschien zunächst<br />
rätselhaft, bezeichnet sie Laurent im Patent auch als "artistement et solidement<br />
adaptees". ln der Diskussion mit dem Restaurator Rainer Weber konnte aber hierfür eine<br />
plausible Hypothese entwickelt werden (Abb. 7):<br />
1 Einbohren des Lochs 2 Einführ8t! der Achse<br />
und Fassen des SChleif·<br />
schelbchens<br />
3 SChleifen 4 18f11Qe Bohrung<br />
23 Leipzig, Musikinstrumentenmuseum der Universität, lnv.-Nr. 3999, signiert ''laurent a Paris 1811 ';<br />
Edinburgh, Reid Collection of Musical Instruments, lnv.-Nr. 55, unsigniert; sowie wenigstens zwei weitere<br />
Instrumente von laurent in der Dayton C. Miller Collection, wo sich insgesamt 17 Glasflöten befinden, nach<br />
einer Abbildung in A. Girard, H!stolre et richesses de Ia flüte, Paris 1953, PI.X
14<br />
Die Skizze zeigt das<br />
• Herstellen der Bohrung für die Gewindestange des Säulchens (1), das<br />
• Herstellen eines konischen Schleifscheibchens mit den Massen des Loches für die<br />
Mutter, mit axialer Gewinde-bohrung und einseitig mit Schleifmittel belegt, das<br />
• Einführen des Plättchens an den richtigen Ort in der Mensurbohrung durch Schieben<br />
und Schütteln, das<br />
• Fangen des Schleifplättchens mit einer durch die Bohrung für die Gewindestange<br />
gesteckten Achse mit Gewinde am Ende (2) und das<br />
• geduldige Ausschleifen des kurzen Kegelstumpfs durch Drehen der Achse und<br />
gleichzeitiges Ziehen derselben nach aussen (3).<br />
ln dieser aufwendigen und im Detail auch sorgfältig ausgeführten Fertigung liegt auch<br />
eine Besonderheit der Instrumente Laurents. Deutlich wird dies im Vergleich zu einer Flöte<br />
seines Konkurrenten Savreux, deren Säulchen für die Klappenlager z.B. auf Leistehen<br />
stehen, die wiederum im Glas direkt eingesetzt sind, und die überhaupt eine weniger<br />
"gediegene" Ausführung aufweist. Hier zeigt sich auch der Unterschied von Original und<br />
imitierender Kopie.<br />
Folgerungen für Konservierung und Pflege<br />
Herstellungsbedingte Rauhigkeit<br />
Da das Glasmaterial der Querflöte in allen Teilen völlig klar ist und die befürchtete<br />
Entglasung unter Ausscheidung irgendwelcher fester Substanzen nicht stattgefunden hat,<br />
liegt keine Glaskrankheit vor. Die Rauhigkeit der Mensurbohrung sowie der inneren<br />
Bereiche von Anblasloch und Grifflöchern ist herstellungsbedingt und damit völlig normal.<br />
Die Kante des Anblasloches ist gerundet, aber in so geringem Ausmaß, daß eine<br />
Unterscheidung zwischen allenfalls äusserst geringer Korrosion an dieser höchst<br />
exponierten Stelle und einer vom Hersteller beabsichtigten Abrundung kaum möglich ist.<br />
Das Basler Instrument zeigt an dieser Kante sogar deutlich eine angeschliffene Facette,<br />
so daß eine korrosionsbedingte Rundung ausgeschlossen werden kann. Leider ist die<br />
Anblaskante am Nürnberger Instrument geringfügig mechanisch ausgebrochen, was aber<br />
ihre Funktion kaum beeinträchtigt. Die geringen in den Rinnen der äußeren Rippen<br />
beobachteten Ablagerungen möchten wir als Schmutz deuten, zumal die Rinnen keinerlei<br />
Hinweise auf Korrosion zeigen.<br />
Ein einzig unklarer Punkt betrifft eine aufgerauhte Partie um das Anblasloch herum, die<br />
auf der dem Spieler zugewandten Seite wesentlich tiefer hinabreicht als auf der anderen.<br />
Das vergleichbare Basler Instrument und andere zeigen eine ganz gleichartige<br />
aufgerauhte Zone, die der Erbauer - zu welchem Zweck auch immer - absichtlich<br />
angebracht hat. Zu denken wäre an einen sicheren Halt beim Ansatz oder ein<br />
angenehmeres Gefühl bei längerem Spielen oder vielleicht auch nur an ein aasthetisch<br />
befriedigenderes Aussehen. Alles dies wiese auf die Imitation einer Embouchure hin, wie<br />
sie später bei Querflöten üblich wurde.
15<br />
KonseNierende Behandlung<br />
Es kann insgesamt ein hervorragender Erhaltungszustand des Instrumentes festgestellt<br />
werden. Einige der vom Erbauer erhofften Vorteile des verwendeten Materiales sind auch<br />
ober lange Zelträume hinweg voll bestätigt worden. Die Metallteile wurden mit einem<br />
Komplexbildner von Korrosionsprodukten befreit und ihre Oberfläche durch Auftragen von<br />
Polaroid B 72 konserviert.<br />
Da das Instrument im Museum nicht gespielt wird, konnten sich die erhaltenden<br />
Maßnahmen auf sorgfältiges Ausspülen mit Leitungs- und vollentsalztem Wasser mit<br />
anschließender Trocknung an der Luft beschränken. Wenn auch ein Anblasen<br />
grundsätzlich zu vermeiden ist, müßte dieser Vorgang (bei demontierten Klappendeckeln<br />
etc.) nach jedem auch noch so kurzen Benutzen wiederholt werden, um Chlorid und<br />
andere korrosionsfördernde Bestandteile des unvermeidlich eindringenden Speichels<br />
wieder zu entfernen. Die Anwendung von Lösungsmitteln sollte mit Rücksicht auf den<br />
vermutlich harzhaltigen Kitt an Pfropfen und metallenen Beschlägen unterbleiben.<br />
Wir danken Glasbläsermeister Karl Steinebrunner, 79576 Weil am Rhein/Haltingen, der<br />
uns in seiner Werkstatt freundliehst Gelegenheit zur Anfertigung von Bildern gegeben hat,<br />
Restaurator Klaus Martius, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg sowie Dr. Veronika<br />
Gutmann, Historisches Museum Basel, für ihr Entgegenkommen.<br />
(Erstveröffentlichung in: Restauro- Zeitschrift für Kunsttechniken, Restaurierung und<br />
Museumsfragen, Jg. 102 H. 1 (<strong>1996</strong>, 22-7)
16<br />
Drehleier und Musette - ein altes und wohlklingendes Paar<br />
Die diesjährige GEFAM-Jahresversammlung<br />
am 5. Mai fand ihren stimmigen Auftakt in der<br />
kommentierten Sonntagsmatinee "Le printemps<br />
champ~tre" im Kreuzgang des Schweizerischen<br />
Landesmuseums. "Les Anachoretes",<br />
Franziska Heiniger (Musette, Blockflöte) und<br />
Carmen Ehinger (Drehleier, Gesang), legten<br />
mit den (nur) zwei Instrumenten einen Klangteppich,<br />
in dem Musette und Drehleier ganz in<br />
einander verwoben waren, und dabei aber<br />
trotzdem immer wieder unerwartete Klangkombinationen<br />
und Töne herauszuhören waren. Die<br />
Musikerinnen schlugen mit ihrer differenzierten<br />
"Les Anachoretes"- Franziska Heiniger<br />
und Carmen Ehinger anlässtich der<br />
und vielfältigen Musik die Zuhörerinnen und Matinee im Landesmuseum.<br />
Zuhörer in ihren Bann.<br />
Vom Dorf an den französischen Hof...<br />
Besonders die Musette erweckte zu Beginn auch die Neugierde und Heiterkeit der<br />
Anwesenden. Franziska Heiniger erklärte, dass die Musette im 16. Jahrhundert im Zuge<br />
des Naturalismus den Weg vom Hirten- und Volksinstrument<br />
an den französischen<br />
Königshof gefunden und grossen Erfolg hatte. Die Musette, die dort gespielt wurden,<br />
waren prächtig verziert und fein gedrechselt.<br />
Im Unterschied zum Dudelsack oder zur Sackpfeife, wo mit dicken Backen der Sack<br />
aufgeblasen werden muss, wird bei der Musette mit eleganter Armbewegung mittels eines<br />
Blasbalgs unter dem rechten Arm Luft in den Sack gepumpt und der Druck stabil<br />
gehalten. Dabei bleibe der Mund frei, erklärte Franziska Heiniger, und das Gesicht werde<br />
nicht unschön verzerrt, was wohl auch im Sinne der Ästhetik am Königshof gewesen sei.<br />
Merkmal der Drehleier sei der schnarrende Klang, sagte Carmen Ehinger, der nicht allen<br />
gefalle. Durch das Rad biete die Drehleier auch viele rhythmischen Möglichkeiten. Die<br />
Drehleier war zu Beginn ein Instrument der Bettler, bevor sie für die "edlere Musik"<br />
entdeckt wurde.<br />
Wissenswertes über Drehleier und Musette<br />
Nach dem feinen Mittagessen hielt Beat Wolf, Instrumentenbauer in Schaffhausen, den<br />
GEFAM-Mitgliedern einen Vortrag über "die bauliche Entwicklung und den Gebrauch der<br />
Drehleier und der Musette". Das Rad der Drehleier zeige symbolisch das ewig<br />
Wiederkehrende und der Bordun versinnbildliche die Mutter Erde. Die Melodie darüber<br />
widerspiegle die Spannungskraft der verschiedenen Verhältnisse. Das Rad diene nicht<br />
etwa der Erleichterung des Spiels, sondern werde aus klanglichen Gründen eingesetzt.
17<br />
Die Intervalle der Drehleier können rein gestimmt oder "schräg" sein. "Die Feinregulierung<br />
ermöglicht immer den Bezug zum Bordun", sagte Beat Wolf, "das ist eine zentrale<br />
Möglichkeit der Drehleier", und spielte als Beispiel eine reine Septime.<br />
Etwas Drehleier-Geschichte<br />
Erste Darstellungen einer Drehleier tauchen im 12. Jahrhundert in Spanien auf. Man<br />
nimmt an, dass sie bereits vor 1000 Jahren im Orient existiert hat und über Byzanz oder<br />
Gibraltar-Spanien zu uns gelangt ist. Dieser Weg konnte allerdings nie bewiesen werden.<br />
Früher diente die Drehleier als Bettelinstrument Hinweise darauf geben seltsame<br />
Schallöffnungen, die geeignet zum Geldeinwurf waren und ein Kasten, wo das Geld auch<br />
wieder herausgenommen werden konnte. Ungefähr 1720 baute Charles Baton als erster<br />
Lyren in Lautenform. Beat Wolf erklärte, eventuell seien auch Lauten und Gitarren zu<br />
Lyren umgebaut worden, da die Nachfrage innert kurzer Zeit sehr stark zugenommen<br />
habe.<br />
Was ist ein "chlen"?<br />
Besonders charakteristisch für den Klang der Drehleier ist der schnarrende Ton. Er rührt<br />
vom "chien" her. Der "chien" ist ein loser Steg unter der Schnarrseite. Wird ruckartig<br />
gespielt, kann man mit diesen Betonungen auch den geraden oder ungeraden Takt<br />
markieren. Die Drehleier ist mit Darmsaiten bespannt. Die Bordunsaiten sind noch mit<br />
Metall umsponnen, da sie so tiefer werden. Um überhaupt einen Ton erzeugen zu<br />
können, muss das Rad mit Kolophonium bestrichen werden. Wattebäuschchen um die<br />
Saiten machen den Ton feiner und verändern die Ansprache. "Gerade für Anfängerinnen<br />
und Anfänger ist es eine grosse Kunst, diese Bäuschchen richtig zu befestigen," sagte<br />
Beat Wolf. Die Decke ist aus Hartholz, in Frankreich aus Mahagoni und Ahorn, bei den<br />
Volksinstrumenten auch aus Fichte, je nach Verwendung und finanziellen Möglichkeiten.<br />
Und noch einiges zur Sackpfeife ...<br />
Wie Beat Wolf erklärte, hat die Sackpfeife eine konische Spielpfeife wie eine Schalmei<br />
und ist daher lauter als die Musette. Sie besitzt ein doppeltes Rohrblatt und ein oder zwei<br />
Bordune im Quint-Abstand. Die Spielpfeife ist meist diatonisch. Der Tonumfang beträgt<br />
eine None, dazu zusätzlich drei bis vier zusätzliche Tonklappen für den kleinen Finger.<br />
Bekannte Abbildungen von Sackpfeifen liefert der vom Beginn des 16. Jahrhunderts<br />
stammende Pfeiferbrunnen in Bern, den Hans Garnper gebaut hat. Sackpfeife und Lyra<br />
seien eine beliebte Kombination gewesen, sagte Beat Wolf, in der sich auch die Symbolik<br />
männlich/weiblich widerspiegelte. So gebe es nur wenig Abbildungen von<br />
Pfeifenspielerinnen, aber viele von Leierspielerinnen.<br />
Rebekka Reichlin
18<br />
Petition gegen die Schliessung der Geigenbauschule in Brienz<br />
Mitte April wurden bekannt, dass die Geigenbauschule Brienz geschlossen werden sollte.<br />
Deshalb wurde anlässlich der Generalversammlung der GEFAM eine Petition gegen die<br />
Schliessung der Geigenbauschule gestartet. Präsident Georg Friedrich Senn schickte die<br />
qnterschriften zusammen mit einem Begleitbrief an die Erziehungsdirektion des Kantons<br />
Bern. Sie finden sowohl diesen Brief wie auch die Antwort von Regierungsrat Schmid<br />
nachstehend abgedruckt.<br />
GESELLSCHAFT DER FREUNDE ALTER MUSIKINSTRUMENTE<br />
OL.O MUSlCAL INSTRUMENTS SOCIETY<br />
ZÜRICH<br />
SOCIETE OES AMIS O'INSTRUMENTS ANCIENS OE MUSIOUE<br />
Georg F. Senn, Präsident<br />
Bündtenweg 62<br />
CH-4102 BinDingen<br />
Tel. 061 421 83 63<br />
Fax 061 421 83 38<br />
Binningen , den 8. Mai <strong>1996</strong><br />
Erziehungsdirektion des<br />
Kantons Bern<br />
Herrn Peter Sclunid<br />
Sulgeneckstrasse 70<br />
3005 BERN<br />
Sehr geehrter Herr Schmid ,<br />
Am vergangeneo Sonntag, 5. Mai fand unsere Jahrestagung im Schweizerischen Landesmuseum<br />
in Zürich statt. Anlässtich der Generalversammlung waren u.a. die Pläne<br />
um die Geigenbauschule in Brienz ein Gesprächsthema.<br />
Mit Bestürzung nehmen wir Kenntnis von einer möglichen Schliessung dieser Institution<br />
aufgrund von gewissen formu lierten Sparanstrengungen. Wir können zwar verstehen,<br />
dass der Kanton Bern nicht länger bereit ist, e.ine Schule mit Gesamtschweizerischem<br />
Anspruch zu finanzieren. Da es sich aber um eine weitherum bekannte Fachschule<br />
mit gutem Ruf und langer Tradition handelt -zudem die einzige ihrer Art in<br />
der Schweiz-. ist für uns der geplante Kahlschlag unverständlich und nicht zu akzeptieren.<br />
Wir meinen, es müsste doch möglich sein, mit Eidgenössischen Institutionen oder<br />
Stiftungen Gespräche zu führen über eine allenfalls breitere Trägerschaft. Wir sind<br />
überzeugt davon, dass eine solche, vielleicht nicht einmal sehr aufwendige Kommunikation<br />
auf fruchtbaren Boden fallen und das notwendige Oberleben der Geigenbauschule<br />
ermöglichen würde.<br />
Ich bitte Sie, diesen Aufruf unserer Gesellschaft, die letztlich auch auf qualifizierte<br />
Fachleute im Instrumentenbau angewiesen ist, mit Respekt entgegenzunehmen und den<br />
für eine langfristig gesunde Kulturpolitik richtigen Entscheid zu fällen.<br />
Im Namen der Gesellschaft der Freunde alter Musikinstrumente und der beiliegend<br />
unterzeichnenden Mitglieder bleibe ich mit freundlichen Grüssen<br />
~.~,eS;:'~<br />
Georg Friedrich Senn<br />
Beilage: Unterschriftenbogen GEFAM
19<br />
Erziehungsdirektfon<br />
des Kantons Bern<br />
Dlrec11on do<br />
l'lnstruction publique<br />
du canton de Berne<br />
3005 Bern<br />
Sulgeneckstrasse 70<br />
Telefon 031 633 85 11<br />
Telefax 031 6338355<br />
Gesellschaft der Freunde<br />
·alter Musikinstrumente<br />
Herrn<br />
Georg F. Senn, Präsident<br />
BOndienweg 62<br />
4102 Binnlngen<br />
Bern, 29. Mai <strong>1996</strong><br />
GBSGofam.Moykr<br />
Sehr geehrter Herr Senn,<br />
sehr geehrte Damen und Herren<br />
-<br />
Ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 8. Mai <strong>1996</strong>, worin Sie sich für die Erhaltung der Geigenbauschule<br />
Brienz einsetzen.<br />
Der Kanton Bem finanziert die einzige Geigenbauschule der Schweiz ohne Mithilfe anderer<br />
Kantont;!. Versuche, die Trägerschaft auf eine breitere Basis zu stellen, waren bis anhin erfolg·<br />
los. An der Galgenbauschule Brienz werden vorwiegend bereits gelernte Berufsleute zum<br />
Zweitberuf der Geigenbauerin/des Geigenbauers ausgebildet. Aus unserer Sicht wäre vor<br />
allem eine Zweitausbildung auch in einem Lehrbetrieb erlernbar. Wir sind Oberzeugt, dass der<br />
Schliessungsentscheid auch eine Verbesserung des dualen Ausbildungssystems bewirken<br />
kann.<br />
Wir haben die Schulkommission der Geigenbauschule Brienz gebeten, die Frage der Trägerschaft<br />
nochmals aufzunehmen. Sollte es gelingen, eine breitere Trägerschaft zu finden, so ist<br />
der Kanton Bem unter der Voraussetzung der finanziellen Entlastung bereit, z. B. die vor·<br />
handene Infrastruktur zu günstigen Bedingungen zur Verfügung zu stellen.<br />
Der Kanton Bern ist heute leider gezwungen, auch im Bildungsbereich Prioritäten zu setzen.<br />
Deshalb war aus unserer Sicht die Fortführung der Subventionierung der kantonalen<br />
Geigenbauschule im bisherigen Ausmass nicht mehr möglich.<br />
Mit freundlichen Grüssen<br />
Der Erziehungsdirektor<br />
~~~<br />
Pater Schmid<br />
Regierungsrat<br />
z.K. KAB
20<br />
Diebstähle in den Musikinstrumenten-Sammlungen von<br />
Basel und Bad Säekingen<br />
Am 26. Januar <strong>1996</strong> ist in der Basler Musikinstrumenten-Sammlung während der<br />
Öffnungszeit (nachmittags) eine Pochette in Violinform (mit F-Löchern) von Franz Straub,<br />
Friedenweiler 1696, und ein entsprechend kleiner Bogen (L. 402 mm) entwendet worden.<br />
Sie gehörte zu den bedeutenden Stücken der Sammlung und dürfte "auf Bestellung"<br />
gestohlen worden sein. Die Grundmasse betragen L. gesamt 470 mm, B. Corpus oben<br />
100 mm, Mitte 70 mm, unten 135 mm, Zargenhöhe 18 mm.<br />
Eine genaue Beschreibung mit Abbildungen findet sich in der Publikation von Olga Adelmann,<br />
Die Alemannische Schule, Berlin 1990, S. 85 (Beschreibung) und S. 128<br />
(Abbildungen). Sachdienliche Hinweise bitte an Frau Dr. Veronika Gutmann, Historisches<br />
Museum Basel, Steinenberg 4, CH-4051 Basel (Tel. 061 1271.05.05), wo auch weitere<br />
Auskunft erhältlich ist.<br />
Zwischen dem 9. und 11. März <strong>1996</strong> ist im Trompetenmuseum in Bad Säekingen ein<br />
gewundenes Jagdhorn von Johann Wilhelm Haas, Nürnberg 1688, gestohlen worden.<br />
Auch hier handelt es sich um ein besonders wertvolles Stück, um das drittälteste datierte<br />
Horn von Haas. Das Horn ist aus Messing, die Masse betragen H. 32,8 cm, gesamte<br />
Rohrlänge 214 cm, Durchmesser Schallstück 13,2113,3 cm. Zugleich wurden zwei jüngere<br />
Mundstücke für Horn und Trompete entwendet.<br />
Das Schallstück bzw. der Kranz ist dekoriert mit getriebenen, aufgelöteten Figuren: Löwenkopf<br />
mit Ring im Maul; Jäger mit Flinte, nach rechts gerichtet; springender Hirsch;<br />
springender Eber; springender Hirsch; Jäger mit Flinte, nach links gerichtet. Die Signatur<br />
lautet IOHANN I WILHELM I HAAS I NVRNBERG I 1688 I bzw. IWH und Meisterzeichen<br />
springender Hase, rückwärts schauend und die Vorderpfoten in der Luft.<br />
Sachdienliche Mitteilungen an das Bürgermeisteramt Bad Säckingen, Postfach 1143, D-<br />
79702 Bad Säekingen (Deutschland).
21<br />
Abbildung des aus dem Trompetenmuseums gestohlenen Jagdhorns mit Dekorationen:
22<br />
Mitteilungen und Termine<br />
Bitte teilen Sie der Redaktion nur jene Termine mit, die so weit im voraus bekannt sind,<br />
dass sie mit den Erscheinungsdaten der GLAREANA korrespondieren und Ihre<br />
Informationen somit zeitgerecht zu unseren Mitgliedern gelangen können.<br />
Die Bibliothek der Gesellschaft<br />
wird in der Zentralbibliothek Luzern, Sempacherstr.1 0, CH-6002 Luzern, aufbewahrt und<br />
kann zu den bibliotheksüblichen Bedingungen benützt werden. Kontaktperson: Herr Paul<br />
Hess.<br />
Das Nachbestellen von GLAREANA-Jahrgängen und -Einzelheften<br />
ist über Herrn Paul Hess, c/o Zentralbibliothek Luzern, Sempacherstr. 10, CH-6002 Luzern,<br />
möglich.<br />
Der Vorstand hat am 18.Februar 1984 dafür folgende Preise festgelegt:<br />
1. Jahrgänge bis und mit 1971 : Zu den in der Zentralbibliothek<br />
Luzern üblichen Bedingungen und Kopiergebühren.<br />
2. Jahrgänge 1972 bis und mit 1981: Pro Jahrgang SFr. 20.- für<br />
Mitglieder und SFr. 30.- für Nichtmitglieder.<br />
3. Einzelhefte ab 1983: SFr. 10. • für Mitglieder und SFr. 15.- für<br />
Nichtmitglieder. (1982 ist keine GLAREANA erschienen.)<br />
Zu allen Preisen kommen Porto- und Verpackungsspesen hinzu.<br />
Achtung: Neumitglieder: Sie können bei Herrn Hess den Katalog unserer Gesellschaftsbibliothek<br />
gratis anfordern. Er ist 1989 als Heft 1 der GLAREANA (38. Jahrgang) erschienen.<br />
Termine<br />
CONCERTI A LUME Dl CANDELA • Im Rahmen des Festival Musica Antica a Magnano,<br />
Estate <strong>1996</strong>, Konzertbeginn jeweils um 21 Uhr, Eintritt frei<br />
• 16. August, Chiesa Parrocchiale: Lorenzo Ghielmi (Italien), Organe, L'Organo nel<br />
Seicento e Settecento.<br />
• 23. August, Chiesa Romanica di San Secondo: Andrew Lawrence-King (England),<br />
Arpa Rinascentista e Arpa Doppia, Opere die Marini, Frescobaldi, Gesualdo, Gibbons,<br />
Dowland, Caccini, ecc.<br />
• 30. August, Chiesa Romanica di San Secondo: La Dada (Niederlanden), Flauto dolce,<br />
fagotto barocco e Clavicembalo, I Virtuosi Barocchi del Flauto Dolce.<br />
• 6. und 7. September, Chiesa Romanica di San Secondo: Bernard Brauchli (Schweiz),<br />
Clavicordo, Tre Secoli di Clavicordo.
23<br />
corsi di Musica Antica a Magnano. 15. bis 25. August <strong>1996</strong>: Musica tastieristica dal<br />
Cinquecento al Settecento, Organologia, Canto e coro, Kursleitung: Bernard Brauchli,<br />
Lorenzo Ghielmi, Georges Kiss, Alberto Galazzo, Jörg Gobeli und Thomas Wälti, Eva<br />
Kiss. Anmeldung bei Corsi die Musica Antica a Magnano, Via Roma 48, 1-13050 Magnano<br />
(BI), ltalia, Tel. (Italien) 015/2 33 06 oder 015/67 92 60; Tel. (Schweiz) 021/728 59 76, Fax<br />
(Schweiz) 021/728 70 56.<br />
Ia cithare, Instrument ä r~decouvri r. Ausstellung vom 13. Oktober <strong>1996</strong> bis 26. Januar<br />
1997 im Musee gruerien, 1630 Bulle. Oeffnungszeiten Di bis Sa 10-12 Uhr, 14-17 Uhr, So<br />
14-17 Uhr. Oeffentliche Führungen und Konzerte am 20. Oktober, 23. November, 19.<br />
Januar, 16.30 -18 Uhr.
24<br />
Mutationen (neue Adressen, Ein- und Austritte)<br />
(Stand 30. September 1995)<br />
Adressänderungen<br />
Altred Hedinger, Am Zinggen 120 8217 Wilchingen<br />
Christopher Schmidt, Weinbergweg 11, 5400 Ennetbaden<br />
Rudolf Schlatter, Zum Harfenacker 8 0 -04179 Leipzig<br />
Urs Vollmer, Montalinstr 12 7203 Trjmmjs<br />
Neue Mitglieder (seit der letzten GLAREANA)<br />
Ermanno Chiavi, Gitarrenbau, Hardstrasse 219, 8005 Zürich<br />
I. Gitarren, Zupfinstrumente<br />
Frieder Neunhoeffer, Obere Plessurstrasse 25, 7000 Chur<br />
I. Histor. Tasteninstrumente<br />
Kai Köpp, Lambertusstrasse 9, 0 -79104 Freiburg i.Brsg.<br />
I. Streichinstrumente, spez. Viola d'amore<br />
Martin Vogelsanger, Talekarstrasse 18, 8404 Wintertbur<br />
I. Histor. Tasteninstrumente, Instrumentenrestaurierung<br />
Hansruedi Gredinger, Bodmerstrasse 4, 7002 Chur<br />
I. Klarinetten, Klaviere<br />
Christoph Henking, Bürglistrasse 57, 8400 Wintertbur<br />
I. Streich- und Tasteninstrumente<br />
Bernhard von Hünerbein, Lintgasse 22-26, 0 - 50667 Köln<br />
I. Alte Musikinstrumente aller Art, Sammlungen etc.<br />
Urs A. Marcandella, Säntisstrasse 12, 8200 Schaffhausen<br />
I. Streich- und Blasinstrumente<br />
Austritte<br />
Adrian Bodmer, Schlatt<br />
Sabine Matzenauer, 0-München<br />
Sonja Wipf, Rupperswil<br />
Guy Tostivint, Zürich<br />
Bach-Haus, Eisenach