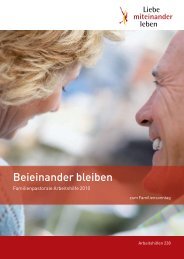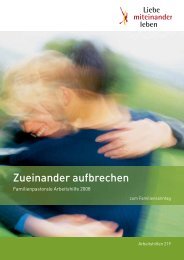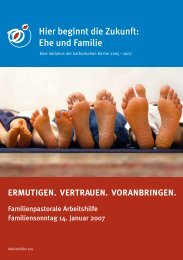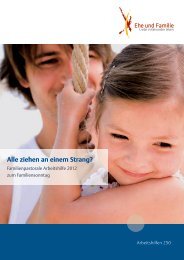Ehe und Familie - Ehe-Familie-Kirche
Ehe und Familie - Ehe-Familie-Kirche
Ehe und Familie - Ehe-Familie-Kirche
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
keine Kinder wünschen, ist dagegen das Alleinleben die am häufigsten genannte Wunsch-<br />
Lebensform.<br />
In einer anderen Studie, in der b<strong>und</strong>esweit Personen befragt wurden, die zwischen 1999 <strong>und</strong><br />
2005 geheiratet hatten, haben Schneider <strong>und</strong> Rüger (2007) nach Sinnzuschreibungen <strong>und</strong> Hei-<br />
ratsmotiven geforscht. Sie fanden hoch heterogene Motivlagen ("nutzenorientiert", "wertori-<br />
entiert", "spontan-emotional") für eine Heirat. Etwa ein Viertel ihrer verheirateten Befragten<br />
sah die <strong>Ehe</strong> noch als bedeutsame traditionelle, kirchliche Institution an. Gut die Hälfte aller<br />
Befragten hatte auch kirchlich geheiratet, allerdings wiederum nur zur guten Hälfte auch tat-<br />
sächlich aus religiösen Motiven. Konfessionelle Unterschiede wurden dabei nicht festgestellt.<br />
Zusammenfassende Thesen:<br />
Die <strong>Ehe</strong> wird aus sehr unterschiedlichen Motiven vom überwiegenden Teil der Bevölkerung<br />
immer noch als probater <strong>und</strong> erstrebenswerter Rahmen für eine Paargemeinschaft (vor allem)<br />
mit Kindern angesehen. Ihre Unbedingtheit als einzige legitime oder religiös begründete<br />
Gr<strong>und</strong>lage von partnerschaftlicher Lebensgemeinschaft <strong>und</strong> <strong>Familie</strong> gilt aber nicht mehr. Sie<br />
hat als institutionelle <strong>und</strong> ideelle Basis partnerschaftlichen Zusammenlebens an Bedeutung<br />
verloren.<br />
Die damit einhergehende De-Institutionalisierung, die postulierte Emotionalisierung von<br />
Paarbeziehungen sowie eine zunehmende wirtschaftliche Unabhängigkeit der Partner vonein-<br />
ander haben zu einer erheblichen De-Stabilisierung von <strong>Ehe</strong> (<strong>und</strong> <strong>Familie</strong>), also einem deut-<br />
lich erhöhten Scheidungsrisiko von <strong>Ehe</strong>n beigetragen.<br />
3. Zur Situation der <strong>Familie</strong>nentwicklung<br />
Empirische Bef<strong>und</strong>e<br />
Neue Schätzungen zu Kinderzahlen von Frauen <strong>und</strong> Männern sind jüngst vom Statistischen<br />
B<strong>und</strong>esamt veröffentlicht worden (Statistisches B<strong>und</strong>esamt 2007). Die westdeutschen Frauen<br />
der Geburtsjahrgänge 1957 bis 1961 haben danach im Mittel etwa 1,6 Kinder geboren (Ost-<br />
deutschland: 1,8 Kinder), 23 Prozent von ihnen blieben kinderlos (Ostdeutschland bei 10 Pro-<br />
zent). Besonders bei Frauen <strong>und</strong> Männern mit einem hohen Bildungsniveau ist die Kinderlo-<br />
sigkeit weit verbreitet. 38 Prozent der westdeutschen Akademikerinnen <strong>und</strong> 42 Männer im<br />
Alter 40 bis 44 Jahren (Geburtsjahrgänge 1960 bis 1964) hatten keine Kinder geboren. Bei<br />
den Männern ist auch die Kinderlosigkeit unter den Geringausgebildeten hoch.<br />
16