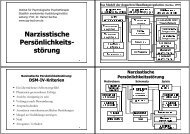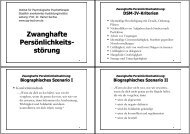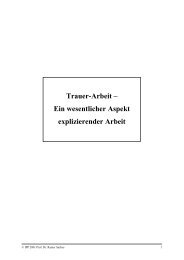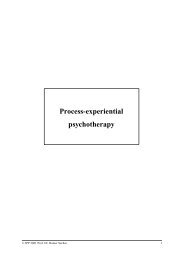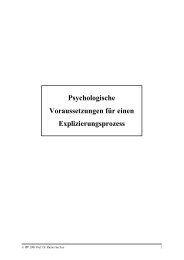Signalkongruenz - Institut für Psychologische Psychotherapie
Signalkongruenz - Institut für Psychologische Psychotherapie
Signalkongruenz - Institut für Psychologische Psychotherapie
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
„Klassische“<br />
Klientenzentrierte<br />
<strong>Psychotherapie</strong><br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 1
Rogers-Theorie<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 2
Rogers: Therapietheorie<br />
• Rogers (1957) hat 6 Bedingungen beschrieben, die<br />
als therapeutic conditions <strong>für</strong> eine konstruktive Psy-<br />
chotherapie gegeben sein müssen:<br />
1. Zwei Personen nehmen Kontakt auf, sie gehen eine<br />
psychotherapeutische Beziehung miteinander ein.<br />
2. Eine dieser Personen, der Klient, ist inkongruent: Er<br />
ist mit sich selbst uneins, empfindlich, ängstlich.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 3
Rogers: Therapietheorie<br />
3. Die andere Person, der Therapeut, ist in der Bezie-<br />
hung zum Klienten kongruent: Er ist „mit sich<br />
eins“, hat Zugang zu seinem Erleben, seinen Gefüh-<br />
len dem Klienten gegenüber.<br />
4. Der Therapeut empfindet unbedingte positive Wert-<br />
schätzung <strong>für</strong> den Klienten: Er ist in der Lage, die<br />
Person des Klienten und die vom Klienten geäußer-<br />
ten Inhalte anzunehmen, eigene Wertungen zurück-<br />
zustellen und sich auf den Klienten einzulassen.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 4
Rogers: Therapietheorie<br />
5. Der Therapeut realisiert ein empathisches Verstehen<br />
des Klienten und erfasst so den inneren Bezugsrah-<br />
men des Klienten.<br />
Das, was er vom inneren Bezugsrahmen des Klien-<br />
ten, von dessen Gefühlen, Wahrnehmungen usw.<br />
verstanden hat, teilt er dem Klienten mit.<br />
6. Der Klient nimmt zumindest ansatzweise wahr, dass<br />
der Therapeut ihn empathisch versteht und unbe-<br />
dingt wertschätzt.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 5
Therapeutic conditions<br />
• Diese „therapeutic conditions“ implizieren drei<br />
„therapeutische Basisbedingungen“ auf Therapeu-<br />
tenseite:<br />
– Kongruenz<br />
– Akzeptierung<br />
– Empathie<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 6
Therapeutic conditions<br />
• Sie implizieren auch drei Voraussetzungen auf<br />
Klienten-Seite:<br />
– Der Klient nimmt zum Therapeuten Kontakt<br />
auf, ist also in minimaler Weise beziehungsfä-<br />
hig.<br />
– Der Klient weist Inkongruenz auf und spürt<br />
dies, er weist damit zumindest minimalen Lei-<br />
densdruck auf.<br />
– Der Klient nimmt das Handeln des Therapeu-<br />
ten zumindest ansatzweise wahr.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 7
Inkongruenz<br />
• Der zentrale Begriff der Störungstheorie bei Rogers<br />
ist der Begriff „Inkongruenz“.<br />
• Rogers nimmt ein zentrales menschliches Motiv an,<br />
das er als „Aktualisierungstendenz“ bezeichnet: all-<br />
gemeine Tendenz des Organismus, alle seine Fä-<br />
higkeiten zur Aufrechterhaltung, Förderung und<br />
Weiterentwicklung einzusetzen.<br />
• Aktualisierungstendenz ist damit das höchste Motiv<br />
in der Motivhierarchie.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 8
Erfahrung<br />
• Der Organismus kann Erfahrungen machen.<br />
– Erfahrung ist dabei ein subjektiver Verarbei-<br />
tungs- und Konstruktionsprozess.<br />
• Die Person lebt nach Rogers in einer eigenen, indi-<br />
viduell erzeugten Welt, in einem „phänomenalen<br />
Feld“.<br />
• Dieses Feld wird vom „inneren Bezugssystem“ der<br />
Person bestimmt, von Wissen, Zielen, Bewertungen<br />
usw.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 9
Erfahrung<br />
• Der Organismus reagiert nicht auf „die Realität“,<br />
sondern auf die Wahrnehmung der Realität.<br />
• Diese wird durch das innere Bezugssystem mitbe-<br />
stimmt.<br />
• Der Organismus kann nun Erfahrungen daraufhin<br />
bewerten, ob sie zur Erhaltung und Förderung des<br />
Organismus dienlich sind oder nicht.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 10
Erfahrung<br />
• Ein Teil der Erfahrung kann symbolisiert werden<br />
und erreicht so den Status des Bewusstseins.<br />
• Symbolisierung kann akkurat geschehen oder „ver-<br />
zerrt“ werden.<br />
• Gefühle sind besonders relevante Aspekte von Er-<br />
fahrung: Gefühle weisen immer auf subjektive Re-<br />
levanzen von Erfahrungen hin.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 11
Erfahrung<br />
• Erfahrungen sind z.T. Selbsterfahrungen: Die Per-<br />
son macht Erfahrungen mit sich selbst.<br />
• Diese Erfahrungen bilden das Selbstkonzept oder<br />
„Selbst“.<br />
• Rogers nimmt an, dass der Organismus ein „need<br />
for positive regard“ aufweist.<br />
• Dieses Bedürfnis ist <strong>für</strong> die Entwicklung des<br />
Selbstwertes wesentlich.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 12
Erfahrung<br />
• Erhält die Person positive Rückmeldung, insbeson-<br />
dere in Form von „unconditional positive regard“,<br />
dann entwickelt sich ein positiver Selbstwert.<br />
• Erhält sie jedoch negative Bewertungen oder be-<br />
dingte Anerkennungen, dann entwickelt sich ein<br />
negativer Selbstwert, der weitgehend von äußeren<br />
Anerkennungen abhängig ist.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 13
Erfahrung<br />
• Selbstaktualisierungstendenz ist nach Rogers die<br />
Tendenz, den eigenen Selbstwert zu erhöhen.<br />
• Die Selbstaktualisierungstendenz kann nun mit der<br />
Aktualisierungstendenz in Konflikt geraten.<br />
• Dies ist z.B. der Fall, wenn eine Person versucht,<br />
ihren Selbstwert mit Hilfe von Strategien zu erhö-<br />
hen, die dem Organismus als Ganzem nicht gut tun,<br />
z.B. durch permanente Leistungsbemühungen.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 14
Erfahrung<br />
• Stehen Selbstakzeptierungstendenz und Aktualisie-<br />
rungstendenz in Widerspruch, dann weist die Per-<br />
son eine Inkongruenz auf.<br />
• Eine Person kann dabei die Inkongruenz deutlich<br />
wahrnehmen: sie hat dann ein starkes Inkongruenz-<br />
Erleben.<br />
• Es gibt aber auch Personen, die Inkongruenzen gar<br />
nicht mehr wahrnehmen.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 15
Rogers-Theorie<br />
• Deutlich wird, dass Rogers versucht, eine universel-<br />
le Störungstheorie zu entwerfen, die <strong>für</strong> alle psychi-<br />
schen Störungen gelten soll.<br />
• Es gibt keine differentielle Störungstheorie.<br />
• Damit in Einklang entwickelt Rogers auch eine uni-<br />
verselle Therapie und keine störungsspezifischen<br />
Ansätze.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 16
Basisvariablen<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 17
Basisvariablen<br />
• Empathisches Verstehen<br />
Verstehen des „inneren Bezugssystems“ des Klien-<br />
ten<br />
• Akzeptieren<br />
Akzeptieren der Person<br />
Rückstellen eigener Bewertungen bezüglich der In-<br />
halte<br />
• Kongruenz<br />
Zugang des Therapeuten zu sich selbst<br />
• Echtheit<br />
Therapeut wird vom Klienten als „echt“ wahrge-<br />
nommen<br />
• Signal-Kongruenz<br />
Stimmigkeit des Therapeuten auf verschiedenen<br />
Kommunikationskanälen<br />
• Transparenz<br />
Durchschaubarkeit therapeutischer Maßnahmen<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 18
• Rogers (1973):<br />
Empathisches Verstehen<br />
„Nach dieser Formulierung wäre es die Funktion des<br />
Beraters, soweit er dazu imstande ist, das innere Be-<br />
zugssystem des Klienten zu übernehmen, die Welt so zu<br />
sehen, wie der Klient sie sieht, den Klienten zu sehen,<br />
wie er sich selbst sieht, dabei alle Vorstellungen vom<br />
äußeren Bezugssystem abzulegen und dem Klienten et-<br />
was von diesem einfühlenden Verstehen mitzuteilen.“<br />
(S. 42)<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 19
Empathisches Verstehen<br />
• Empathisches Verstehen bedeutet somit, dass ein<br />
Therapeut „den inneren Bezugsrahmen“ des Klien-<br />
ten versteht, d.h., die Wünsche, Ziele, Motive, Ü-<br />
berzeugungen, die ein Klient hat.<br />
• Empathisches Verstehen bedeutet, „den Klienten<br />
aus dessen Voraussetzungen heraus zu verstehen“:<br />
zu verstehen, wie ein Klient die Welt sieht, warum<br />
er so fühlt, wie er fühlt und warum er so handelt,<br />
wie er handelt.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 20
Empathisches Verstehen<br />
• Truax & Mitchell (1977) definieren empathisches<br />
Verstehen:<br />
„Ein genaues empathisches Verstehen beinhaltet die Fä-<br />
higkeit, sowohl die Gefühle als auch die Erfahrungen<br />
einer anderen Person, und auch deren Bedeutung und<br />
Relevanz, akkurat und sensibel erkennen und mitteilen<br />
zu können.“<br />
„Durch einen Prozess der probeweisen Identifikation<br />
versetzen wir uns in die Lage einer anderen Person und<br />
betrachten die Welt aus ihrem emotionalen und wahr-<br />
nehmendem Blickwinkel.“<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 21
Empathisches Verstehen<br />
„Weil wir nun aber nicht wirklich eine andere Person<br />
sein können, ist es uns möglich, sowohl „in“ einer ande-<br />
ren Person zu sein und trotzdem „außen vor“ zu blei-<br />
ben.“<br />
„Dadurch können wir die Bedeutung von Zorn, Furcht<br />
oder Freude der anderen Person fühlen, ihre Gedanken<br />
und Konsequenzen aufspüren, ohne dass wir von dem<br />
Erleben überwältigt werden.“<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 22
Empathisches Verstehen<br />
„Auf diese Weise können wir einen Beitrag leisten zur<br />
Erweiterung und Klärung des Bewusstseins der anderen<br />
Person hinsichtlich ihrer eigenen Erfahrungen und Ge-<br />
fühle.“<br />
„Dies ist das Resultat der Feinabstimmung zwischen ei-<br />
ner Identifikation mit einer anderen Person und der Ob-<br />
jektivität, die eine wahrhaft empathische Person aus-<br />
zeichnet.“<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 23
Empathisches Verstehen<br />
„Wenn wir Empathie zeigen, übernehmen wir die Rolle<br />
der anderen Person und leisten in dieser Rolle den Pro-<br />
zess der Selbstbearbeitung ein, als ob wir selbst die an-<br />
dere Person seien.“<br />
Und:<br />
„Um empathisch zu sein, müssen wir also die sinnvollen<br />
Mitteilungen einer anderen Person von denen trennen,<br />
die als Schutzschild oder gesellschaftliche Fassade auf-<br />
rechterhalten werden.“<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 24
Und:<br />
Empathisches Verstehen<br />
„Die wirklich empathische therapeutische Person zeigt<br />
nicht nur ein sensibles Verständnis <strong>für</strong> die manifesten<br />
Gefühle des Klienten, sondern bemüht sich auch um<br />
Klärung der durch Stimme, Gesten und inhaltliche Hin-<br />
weise gegebenen Andeutungen.“<br />
„Sowohl die akkurate Voraussage als auch die effektive<br />
Mitteilung des vom Klienten aktuell Erlebten und Ge-<br />
fühlten und somit dessen, was der Klient gesagt hätte,<br />
wäre er offener und weniger defensiv, charakterisiert die<br />
Qualität des empathischen Verstehens.“<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 25
Empathisches Verstehen<br />
• Empathisches Verstehen ist ein komplexer Vorgang<br />
und erfordert komplexe Fähigkeiten.<br />
• Davon später mehr.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 26
VEE-Skala<br />
Basisvariablen: VEE<br />
Stufe 2: Keine Verbalisierung der vom Klienten ausge-<br />
drückten persönlich-emotionalen Inhalte des<br />
Erlebens durch den Psychotherapeuten. Auch<br />
keine Äußerungen über irgendwelche vom<br />
Klienten vorgebrachten äußeren Sachverhalte.<br />
Die Äußerung besteht etwa aus einer Belehrung<br />
oder Ermahnung.<br />
Stufe 6: Verbalisierung eines oder einiger nebensächlicher<br />
vom Klienten ausgedrückten Erlebensinhalte.<br />
Es werden nicht diejenigen Erlebnisinhalte<br />
vom Psychotherapeuten verbalisiert, auf<br />
die der Klient in seiner Äußerung das Hauptgewicht<br />
legte; z.B. bezieht sich der Psychotherapeut<br />
ausschließlich auf einen Inhalt, den der<br />
Klient nur als Beispiel <strong>für</strong> den Hauptinhalt des<br />
Erlebens brachte.<br />
Stufe 8: Verbalisierung eines Teiles der wesentlichen,<br />
vom Klienten ausgedrückten persönlichemotionalen<br />
Inhalte des Erlebens durch Psychotherapeuten.<br />
– Es fehlen aber andere wesentliche<br />
Erlebnisinhalte.<br />
Stufe 12: Verbalisierung in genauer Form aller wesentlichen<br />
vom Klienten beäußerten persönlichemotionalen<br />
Inhalte des Erlebens durch den<br />
Psychotherapeuten.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 27
Basisvariablen: VEE<br />
• Beispiel <strong>für</strong> VEE-Stufe 10 aus TAUSCH (1973),<br />
Seite 83:<br />
Klient:<br />
„Ich hab` nicht einmal Lust, irgendwelche Sachen<br />
zu versuchen. Ich meine, wenn ich zu einer Arbeit<br />
gehe oder so, - ich – also – habe ich das Gefühl,<br />
dass ich versagen werde. Es ist schrecklich, aber...“<br />
Therapeut:<br />
„Es kommt Ihnen so vor, als wären Sie schon geschlagen,<br />
bevor Sie anfangen und dieses Gefühl<br />
lähmt Sie.“<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 28
Kongruenz<br />
Kongruenz<br />
Auf Seiten des Therapeuten bedeutet Kongruenz, dass<br />
der Therapeut Zugang hat zu seinen eigenen Gefühlen<br />
und Gedanken, die er dem Klienten und der therapeuti-<br />
schen Situation gegenüber hat. Er wehrt diese Gefühle<br />
usw. nicht ab, sondern kann sie wahrnehmen und verar-<br />
beiten, ja sogar <strong>für</strong> ein Verständnis des Klienten sowie<br />
ein Verständnis seiner eigenen Probleme nutzen<br />
(BIERMANN-RATJEN et al., 1989; LINSTER, 1980;<br />
ROGERS, 1982). Wesentlich ist, dass der Therapeut<br />
keine „Abwehrhaltung“ einnimmt (TRUAX & MIT-<br />
CHELL, 1971).<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 29
Echtheit<br />
Echtheit<br />
Echtheit des Therapeuten bedeutet etwas, das über Kon-<br />
gruenz hinausgeht: Der Therapeut hat hier die Intention,<br />
nicht nur Gefühle usw. zuzulassen und wahrzunehmen,<br />
sondern auch, den Klienten gegebenenfalls daran teil-<br />
nehmen zu lassen.<br />
Echtheit bedeutet somit, dass der Therapeut bereit ist,<br />
dem Klienten mitzuteilen, was in ihm vorgeht, falls der<br />
Klient dies möchte.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 30
Echtheit<br />
Echtheit bedeutet auch, dass der Therapeut dem Klien-<br />
ten nichts vormacht, also nicht versucht, Gefühle zu<br />
verheimlichen oder vorzutäuschen.<br />
Der Therapeut soll, wie PFEIFFER (1982) sagt, nicht<br />
„hinter einer Fassade verschwinden“, er soll „als<br />
Mensch in Erscheinung treten“.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 31
Echtheit<br />
TRUAX und MITCHELL (1971) vermuten, dass Echt-<br />
heit eine Art von „Hygiene-Variable“ ist: Sie muss in<br />
einem gewissen Ausmaß vorhanden sein, um (insbeson-<br />
dere <strong>für</strong> den Aufbau einer Arbeitsbeziehung) therapeu-<br />
tisch wirksam zu sein. Eine „Steigerung von Echtheit“<br />
über diesen wirksamen Punkt hinaus erhöht aber die<br />
therapeutische Effektivität nicht. Daher ist es auch sinn-<br />
voller zu sagen, ein Therapeut solle „nicht unecht“ sein,<br />
als zu sagen, ein Therapeut solle „echt“ sein.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 32
<strong>Signalkongruenz</strong><br />
<strong>Signalkongruenz</strong><br />
Von der Perspektive des Klienten aus ist insbesondere<br />
die <strong>Signalkongruenz</strong> (vergl. ARGYLE, 1972; SCHE-<br />
RER, 1972) des Therapeuten wesentlich (GRAESSNER<br />
& HEINERTH, 1975). Das heißt, es ist wesentlich, ob<br />
der Klient den Therapeuten in dem, was er tut, als ein-<br />
heitlich und stimmig oder als unstimmig und wider-<br />
sprüchlich wahrnehmen kann. Signalinkongruent wird<br />
ein Therapeut dann, wenn er sog. Kanaldiskrepanzen<br />
aufweist, also z.B., wenn er dem Klienten mit zitternder<br />
Stimme und verkrampfter Haltung versichert, dass die<br />
Vorwürfe des Klienten ihn persönlich gar nicht berüh-<br />
ren.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 33
Transparenz<br />
Transparenz<br />
Transparenz bedeutet, dass die Therapie dem Klienten<br />
zugänglich ist, der Klient in alle therapeutischen Strate-<br />
gien und Prinzipien Einblick erhalten kann, wenn er das<br />
will, dass er die Therapie verstehen darf und soll (vergl.<br />
MAIWALD & FIEDLER, 1981). Transparenz bedeutet,<br />
dass der Therapeut im Umgang mit dem Klienten keine<br />
geheimen Pläne verfolgt, nicht versucht, ihn zu manipu-<br />
lieren (PFEIFFER, 1982).<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 34
Akzeptierung<br />
• Die Basisvariable „Akzeptanz“ ist kein einheitliches<br />
Konzept. Sie besteht aus mehreren Teilaspekten.<br />
• Akzeptierung bedeutet,<br />
– die Person des Klienten ernstzunehmen.<br />
– sich <strong>für</strong> sie zu interessieren.<br />
– sich auf sie einzulassen.<br />
– sie nicht wegen bestimmter Inhalte oder Ver-<br />
haltensweisen abzulehnen.<br />
• Akzeptierung bedeutet auch,<br />
– die vom Klienten geäußerten Inhalte anzuneh-<br />
men.<br />
– sie weder positiv noch negativ zu bewerten.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 35
Akzeptierung<br />
• Akzeptierung bedeutet im Wesentlichen, dass der<br />
Therapeut seine eigenen Bewertungen zurückstellen<br />
kann.<br />
• Akzeptierung bedeutet, die Person des Klienten und<br />
die vom Klienten geäußerten Inhalte nicht nach dem<br />
eigenen Motiv- und Wertesystem zu bewerten.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 36
Akzeptierung<br />
• Akzeptierung bedeutet nicht, dass der Therapeut das<br />
Verhalten des Klienten gut finden muss;<br />
• Akzeptieren bedeutet vielmehr, dass er das Verhal-<br />
ten des Klienten gar nicht bewertet, sondern nur<br />
versucht, es aus den Voraussetzungen des Klienten<br />
heraus zu verstehen.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 37
Akzeptierung<br />
• Akzeptieren bedeutet auch nicht, dass der Therapeut<br />
das Verhalten des Klienten nicht analysieren darf.<br />
• Der Therapeut darf z.B. erkennen, dass ein Klient<br />
nichts tut, andere Personen verprellt, sich ungünstig<br />
verhält usw.<br />
• Der Therapeut kann auch den Klienten mit all die-<br />
sen Aspekten konfrontieren.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 38
Akzeptierung<br />
• Damit dem Therapeuten ein Klienten-Verhalten ü-<br />
berhaupt als „dysfunktional“ auffallen kann,<br />
braucht der Therapeut einen Vergleichsmaßstab, ei-<br />
nen Maßstab darüber, was „funktional“ ist.<br />
• Ein Maßstab ist dabei das Bezugssystem des Klien-<br />
ten selbst: Der Klient will X, handelt aber so, dass<br />
er X nicht erreichen kann; damit ist dieses Handeln<br />
dysfunktional.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 39
Akzeptierung<br />
• Ein anderer möglicher Maßstab sind soziale Regeln:<br />
Der Klient weicht von sozialen Regeln ab und be-<br />
kommt dadurch Schwierigkeiten. Der Therapeut<br />
kann den Klienten darauf aufmerksam machen.<br />
• Der Therapeut kann aber auch seine eigenen Maß-<br />
stäbe als Standards benutzen: Er kann den Klienten<br />
darauf aufmerksam machen, dass der Klient, nach<br />
Ansicht des Therapeuten, so und so handeln könnte,<br />
aber nicht so handelt.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 40
Akzeptierung<br />
• Solche Maßstäbe und Standards dienen dem Thera-<br />
peuten aber nur dazu, auf mögliche Probleme des<br />
Klienten aufmerksam zu werden und den Klienten<br />
darauf aufmerksam zu machen.<br />
• Ob der Klient sich ändern will, ob er etwas als dys-<br />
funktional auffassen will, ob er einen Maßstab ak-<br />
zeptiert oder nicht, liegt aber allein in der Entschei-<br />
dung des Klienten.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 41
Akzeptierung<br />
• Der Therapeut hat kein Recht, den Klienten zu be-<br />
werten; er muss die Entscheidungen des Klienten<br />
akzeptieren.<br />
• Das heißt aber nicht, dass der Therapeut den Klien-<br />
ten nicht auf Aspekte aufmerksam machen darf; er<br />
darf ihn mit Konsequenzen seines Handelns, mit<br />
sozialen Normen und auch mit seiner eigenen<br />
Sichtweise konfrontieren.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 42
Akzeptierung<br />
• Entscheidet sich der Klient jedoch da<strong>für</strong>, eine ande-<br />
re Sichtweise zu haben, sollte der Therapeut dies<br />
akzeptieren.<br />
• Dies ist <strong>für</strong> Therapeuten aber wegen eigener Motive<br />
und Überzeugungssysteme nicht immer leicht.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 43
Konfrontation<br />
Als „Konfrontation“ werden solche Therapeuten-<br />
Äußerungen bezeichnet, in denen der Therapeut Diskre-<br />
panzen aufgreift oder thematisiert.<br />
Dabei kann es sich handeln um:<br />
1. Diskrepanzen innerhalb der verbalen Aussagen des<br />
Klienten: Zum Beispiel kann eine Diskrepanz deutlich<br />
werden zwischen der augenblicklichen Selbsteinschät-<br />
zung des Klienten und seinem Idealbild.<br />
2. Diskrepanzen zwischen dem verbalen und nonverbalen<br />
bzw. paraverbalen Ausdruck des Klienten, z.B.: Der<br />
Klient sagt mit zitternder, belegter Stimme, dass ihn<br />
ein Ereignis gar nicht berührt.<br />
3. Diskrepanzen zwischen der Selbsteinschätzung des<br />
Klienten und der Sichtweise des Therapeuten<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 44
Effekte der conditions<br />
• Die drei therapeutic conditions sollen bestimmte<br />
Arten von Effekten beim Klienten haben.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 45
Empathisches Verstehen<br />
• Empathisches Verstehen vermittelt dem Klienten<br />
die Erfahrung, verstanden zu sein: Dass es eine Per-<br />
son gibt, die den Klienten und dessen Bezugssystem<br />
versteht.<br />
• Dies kann bereits eine korrigierende Beziehungser-<br />
fahrung sein.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 46
Empathisches Verstehen<br />
• Empathisches Verstehen hilft dem Klienten, sein<br />
inneres Bezugssystem zu klären.<br />
Er setzt sich systematisch mit eigenen Gefühlen,<br />
Gedanken, Motiven, Zielen usw. auseinander.<br />
• Empathisches Verstehen erhöht die Selbstexplorati-<br />
on des Klienten.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 47
Empathisches Verstehen<br />
• WEXLER (1974) weist auf drei Funktionen des<br />
empathischen Verstehens hin:<br />
1. Aufmerksamkeitssteuernde Funktion:<br />
Der Therapeut lenkt die Aufmerksamkeit des Klien-<br />
ten auf bestimmte Informationen und ermöglicht<br />
dem Klienten so eine angemessene Informations-<br />
verarbeitung: Der Klient kann bestimmte Informati-<br />
onen beachten, in bestehende Schemata integrieren<br />
oder ist u.U. gezwungen, neue Schemata aufzubau-<br />
en.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 48
Empathisches Verstehen<br />
2. Hilfe bei der Strukturierung von Information:<br />
Der Therapeut nimmt durch seine empathische Re-<br />
aktion auch eine (vorläufige) Strukturierung von In-<br />
formation vor (Betonung bestimmter Aspekte,<br />
Weglassen anderer, Stiften von Zusammenhängen,<br />
usw.). Dies erleichtert dem Klienten eine Differen-<br />
zierung und Integration von Information. Der Klient<br />
wird auf Zusammenhänge, Widersprüche, eigene<br />
Schlussfolgerungen usw. aufmerksam, die ihm ohne<br />
die Aussage des Therapeuten entgangen wären.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 49
Empathisches Verstehen<br />
3. Aktivierung von Gedächtnisbeständen:<br />
Durch die Aussagen des Therapeuten werden be-<br />
stimmte, (problemrelevante) Informationen im<br />
Langzeitspeicher aktiviert und dem Klienten so<br />
wieder verfügbar: Er kann sie zur Verarbeitung ak-<br />
tueller Information, zum Aufbau und zur Verände-<br />
rung von Schemata nutzen.<br />
Damit nimmt WEXLER bereits eine starke Steue-<br />
rung des Klientenprozesses durch therapeutische In-<br />
terventionen an.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 50
Akzeptierung<br />
• Akzeptierung fördert den Aufbau einer vertrauens-<br />
vollen Therapeut-Klient-Beziehung: Der Klient<br />
fühlt sich angenommen in der Beziehung und hat<br />
den Eindruck, dass er dem Therapeuten alles sagen<br />
kann.<br />
• Dadurch, dass der Klient dem Therapeuten alles sa-<br />
gen kann, ohne bewertet zu werden, nimmt seine<br />
Tendenz zu, sich problematischen Inhalten zuzu-<br />
wenden und diese dem Therapeuten mitzuteilen.<br />
• Die Selbstexploration des Klienten steigt.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 51
Akzeptierung<br />
• Durch Akzeptierung werden Wünsche des Klienten<br />
nach Anerkennung „gesättigt“: Sie nehmen damit in<br />
der therapeutischen Beziehung an Bedeutung ab.<br />
Dadurch kann sich der Klient verstärkt problemati-<br />
schen Inhalten zuwenden.<br />
• Der Klient lernt durch die Akzeptierung des Thera-<br />
peuten, dass Inhalte „ok“ sind, normal sind, dass<br />
man sie betrachten und bearbeiten kann. Damit<br />
nimmt die Vermeidungstendenz des Klienten ab.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 52
Akzeptierung<br />
• Durch die Realisation von Akzeptierung und Empa-<br />
thischem Verstehen lernt der Klient die Unterschei-<br />
dung von „psychologischen Fakten“ und Bewertun-<br />
gen.<br />
• Klienten mischen oft psychologische Fakten und<br />
Bewertungen sehr stark:<br />
„Ich kann X nicht und deshalb bin ich ein Versa-<br />
ger“; „ich tue Y und deshalb bin ich unmoralisch.“<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 53
Akzeptierung<br />
• In der Therapie lernt der Klient, dass bestimmte<br />
„psychologische Fakten“ und deren Bewertung<br />
zwei Aspekte sind und auseinander gehalten werden<br />
können.<br />
• Der Klient kann sehen, dass er „X nicht kann“, dass<br />
dies aber keineswegs bedeutet, dass er ein Versager<br />
ist, sondern dass er auch selbst akzeptieren kann,<br />
dass er X nicht kann.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 54
Kongruenz<br />
• Die Kongruenz / Echtheit des Therapeuten gibt dem<br />
Klienten das Gefühl, dass der Therapeut authentisch<br />
ist.<br />
Der Klient entwickelt damit den Eindruck, dass<br />
man dem Therapeuten vertrauen kann.<br />
Dies ist sehr wesentlich zum Aufbau einer therapeu-<br />
tischen Allianz.<br />
Entwickelt der Klient kein Vertrauen zum Thera-<br />
peuten, ist es unwahrscheinlich, dass eine konstruk-<br />
tive inhaltliche Arbeit zustande kommt.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 55
Effekte <strong>für</strong> den Therapeuten<br />
• Die therapeutic conditions haben aber auch Effekte<br />
auf den Therapeuten.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 56
Akzeptierung<br />
• Akzeptiert der Therapeut den Klienten, d.h., stellt er<br />
seine eigenen Bewertungen zurück, wird er offen<br />
<strong>für</strong> die vom Klienten kommende Information.<br />
• Würde der Therapeut die Information bewerten,<br />
würde er anfangen, sie selektiv zu verarbeiten.<br />
• Damit könnte er den Klienten aber nicht mehr ver-<br />
stehen.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 57
Empathisches Verstehen<br />
• Empathisches Verstehen ist die Grundlage da<strong>für</strong>,<br />
dass ein Therapeut ein „Modell über den Klienten<br />
aufbauen kann“.<br />
• Dadurch verbessert der Therapeut im Laufe der Zeit<br />
auch sein Verstehen des Klienten immer mehr.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 58
Empathisches Verstehen<br />
• Empathisches Verstehen erleichtert in der Regel<br />
auch Akzeptierung: Wenn ich verstehe, warum eine<br />
Person so handelt wie sie handelt, wenn ich ihre<br />
Motive verstehe, dann fällt es mir auch leichter, das<br />
Handeln der Person zu akzeptieren.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 59
Kongruenz<br />
• Hat ein Therapeut Zugang zu eigenen Gefühlen,<br />
dann kann er auch spüren, was ein Klient in ihm<br />
auslöst.<br />
• Damit kann er etwas über seine eigenen Schemata<br />
lernen, die vom Klienten ausgelöst werden.<br />
• Damit kann er aber auch etwas über den Klienten<br />
lernen: Darüber, was der Klient mit ihm macht, wie<br />
der Klient handelt usw.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 60
Therapeutische Effekte<br />
• Es sollten im Therapieprozess bestimmte Verände-<br />
rungen beim Klienten auftreten:<br />
– Der Klient beschäftigt sich zunehmend mit sich<br />
selbst, mit seinen Zielen, Motiven usw. Er ori-<br />
entiert sich zunehmend stärker internal.<br />
– Er setzt sich zunehmend mit bisher vermiede-<br />
nen Selbst-Aspekten auseinander.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 61
Therapeutische Effekte<br />
– Der Klient nimmt Aspekte wahr, die er bisher<br />
vermieden hatte; diese können <strong>für</strong> ihn unange-<br />
nehm und schmerzlich sein. Dies bedeutet, dass<br />
sich der emotionale Zustand des Klienten in<br />
der Therapie vorübergehend verschlechtern<br />
kann.<br />
– Inkongruenzen, Konflikte, Unzufriedenheiten<br />
usw. werden Klienten zunehmend deutlich. Der<br />
Klient erarbeitet ein zunehmend klares Prob-<br />
lembewusstsein.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 62
Therapeutische Effekte<br />
– Der Klient klärt <strong>für</strong> sich immer stärker eigene<br />
Gefühle und eigenes Erleben. Er kann Gefühle<br />
immer mehr zulassen, kann ihren Kontext ana-<br />
lysieren und ihre Bedeutung <strong>für</strong> sich verstehen.<br />
– Der Selbstwert steigt; er kann sich und auch<br />
problematische Aspekte immer besser „anneh-<br />
men“.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 63
Therapeutische Effekte<br />
– Der Klient wehrt Erfahrungen zunehmend we-<br />
niger ab. Er repräsentiert eigene Schemata und<br />
die Realität zunehmend genauer.<br />
– Der Klient klärt seine Ziele und entwickelt eine<br />
Repräsentationen davon, was ihm zentral wich-<br />
tig ist.<br />
© IPP 2001 Prof. Dr. Rainer Sachse 64