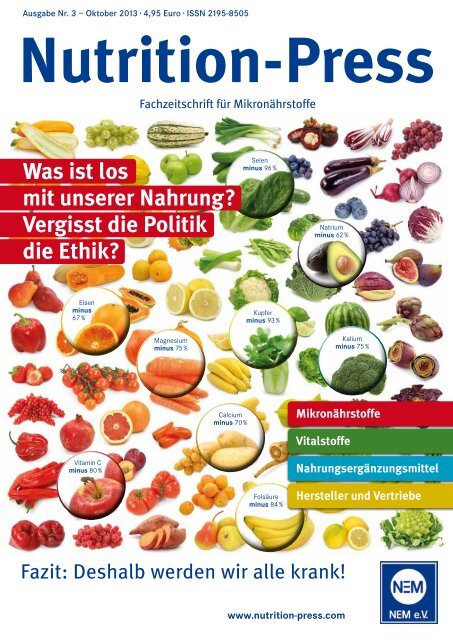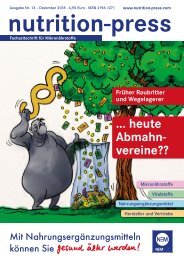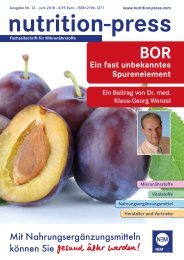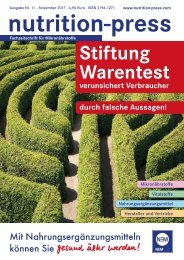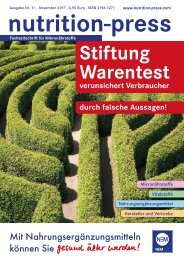Nutrition Press_03_Online_05
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Ausgabe Nr. 3 – Oktober 2013 · 4,95 Euro · ISSN 2195-85<strong>05</strong><br />
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Fachzeitschrift für Mikronährstoffe<br />
Was ist los<br />
mit unserer Nahrung?<br />
Vergisst die Politik<br />
die Ethik?<br />
Selen<br />
minus 96 %<br />
Natrium<br />
minus 62 %<br />
Eisen<br />
minus<br />
67 %<br />
Magnesium<br />
minus 75 %<br />
Kupfer<br />
minus 93 %<br />
Kalium<br />
minus 75 %<br />
Calcium<br />
minus 70 %<br />
Mikronährstoffe<br />
Vitalstoffe<br />
Vitamin C<br />
minus 80 %<br />
Nahrungsergänzungsmittel<br />
Folsäure<br />
minus 84 %<br />
Hersteller und Vertriebe<br />
Fazit: Deshalb werden wir alle krank!<br />
<br />
www.nutrition-press.com<br />
www.nutrition-press.com
Editorial<br />
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,<br />
Immer wieder gibt es über die Medien Hinweise wie:<br />
„Nahrungsergänzungsmittel braucht man nicht“ oder „Vorsicht kann gefährlich für<br />
die Gesundheit sein“. Einer schreibt vom anderen ab, weil es eine Negativnachricht<br />
gibt, die Leserstimmen einbringt. Wir glauben dennoch an das gute der Journalisten.<br />
Die meisten sind eben beeinflussbar durch die Verlage, die wiederum ihr Hauptinteresse<br />
auf Anzeigen legen. Wir glauben an die Zukunft der ehrlichen, gut recherchierenden<br />
Journalisten mit ethischem Anspruch. Die Tendenz dazu ist schon zu sehen.<br />
1. Überdosieren kann man nicht, da klare gesetzliche Regeln getroffen sind,<br />
was die Verzehrempfehlung anbetrifft. Das hat sogar das BFR – das Bundesamt<br />
für Risikobewertung – übersehen: die Behörde, die neulich in der BILD am<br />
Sonntag ihre Falschmeldung veröffentlichen lies. Sogar einzelne Produkte wurden<br />
diskriminiert, die alle gesetzeskonform sind.<br />
2. Nahrungsergänzungsmittel braucht man nicht – ist eine totale Desinformation.<br />
Das Gegenteil ist der Fall. Wer was anderes behauptet lügt und schadet<br />
der Volksgesundheit – und dies ist milde ausgedrückt. Es ist menschenverachtend<br />
und verstößt meiner Meinung gegen die Menschenrechte.<br />
111,23 Millionen Krankheiten und Risikogruppen gibt es in Deutschland. Dies ist<br />
eindeutig statistisch nachgewiesen – also dokumentiert. Die Quellen sind dem<br />
Ver band bekannt. In der nächsten Ausgabe werden wir detailliert darüber berichten.<br />
Das Krankheitsbild hat zum großen Teil etwas mit unserer Nahrung zu tun. Für un sere<br />
Lebensmittel ergibt sich eine erschreckende Bilanz: Vitamine, Min eral stoffe,<br />
Spu ren elemente usw. sind erheblich geschrumpft. Warum nehmen die Behörden<br />
und Ministerien dies nicht endlich zur Kenntnis. Unabhängig von den Giften,<br />
die wir über unsere Nahrung aufnehmen.<br />
Manfred Scheffler<br />
Präsident NEM e.V.<br />
Abnahme der Nährstoffgehalte in den letzten 50 Jahren:<br />
Möhren: Magnesium* minus 75 % Kartoffel: Calcium* minus 70 %<br />
Bananen: Folsäure* minus 84 % Apfel: Vitamin C* minus 80 %<br />
Spinat: Selen** minus 96 % Kresse: Kupfer* minus 93 %<br />
Brokkoli: Kalium* minus 75 % Orangen: Eisen* minus 67 %<br />
Avocados: Natrium* minus 62 %<br />
* Quelle EFN ** Quelle souci-Tabelle<br />
Klar, gibt es auch zusätzliche Gründe unserer mangelhaften Ernährungssituation:<br />
• Genusshafte Ernährung bis hin zur Sucht, Umweltgifte, Intensivierung der<br />
Landwirtschaft (Dünger, Pestizide), exzessiver und einseitiger Anbau, zu frühe<br />
Ernten, lange Transportwege.<br />
Die DGE (vom Staat gestützt) sagt 5 mal am Tag je eine Hand voll Obst und Gemüse<br />
und man hat alle Mikronährstoffe erhalten, die man pro Tag benötigt. Nur wer isst<br />
soviel Obst und Gemüse – die Wenigsten.<br />
Gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Fachbeirat werden wir ehrliche<br />
Öffen t lichkeitsarbeit betreiben. Die Wissenschaft muss sprechen – über Fakten<br />
und was für unsere Gesundheit zu tun ist.<br />
Mit herzlichen Grüßen<br />
Manfred Scheffler<br />
Präsident NEM e.V.<br />
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong> ist die offi zielle<br />
Zeitschrift des NEM e.V.<br />
Verband mittelständischer<br />
europäischer Hersteller und<br />
Distributoren von Nah rungsergänzungsmitteln<br />
& Gesundheitsprodukten<br />
e.V.
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Inhalt<br />
5 Lebensmittelindustrie am Pranger•Dr. jur. Thomas Büttner<br />
9 Kontrollpflicht, Kennzeichnung, Import von Lebensmitteln•Dr. H.-Joachim Kopp<br />
13 Risiko = Mehrwertsteuer•Dr. Bettina Elles<br />
17 Umsatzsteuer: Gelangensbestätigung ab dem 01. Oktober 2013•Günter Heenen, Carsten Stritzel<br />
21 Das Burn-out-Syndrom – Energiewende auf Zellebene gefordert•Dr. med. Rainer Mutschler, M. A.<br />
24 Firmicuten – die Dickmacher unter den Darmbakterien: Störungen der Darmflora<br />
in Verbindung mit krankhaftem Übergewicht•Kyra Hoffmann, Sascha Kauffmann<br />
28 Kamillentee alleine ist noch keine Naturheilkunde<br />
und gesunde Ernährung kein Garant für genügend Vitamine und Spurenelemente•Peter Abels<br />
32 Biotin (Vitamin B7, Vitamin H) – Die wichtigsten Funktionen von Biotin<br />
36 Zunahme an Brusttumoren – Prävention und nicht nur Identifikation<br />
ist das Gebot der Stunde! •Prof. Dr. med. Enno Freye<br />
42 Brainfood DHA jetzt auch für Vegetarier und für alle, die Fischöl nicht vertragen•Robert Schneider<br />
44 Nahrungsergänzung braucht man nicht – oder doch?•Andreas Binninger<br />
48 Gesundheitsprävention in Unternehmen•Prof. Dr. med. Jörg Spitz<br />
50 Die eigene Website•ARAG<br />
Impressum<br />
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Fachzeitschrift für Mikronährstoffe,<br />
Vitalstoffe, Nahrungsergänzungsmittel,<br />
Hersteller und Vertriebe<br />
<strong>Online</strong>-Ausgabe: ISSN 2195-85<strong>05</strong><br />
Herausgeber: Elite Magazinverlags GmbH<br />
Boslerstraße 29 · 71088 Holzgerlingen<br />
Telefon:+49(0)7<strong>03</strong>1/744-0 · Fax:+49(0)7<strong>03</strong>1/744-195<br />
E-Mail: info@nutrition-press.com<br />
Chefredaktion: Bernd Seitz (V.i.S.d.P.)<br />
Leitender Redakteur: Manfred Scheffler<br />
Redaktion: Gabriele Thum M.A.<br />
Wissenschaftlicher Beirat:<br />
Dr. Gottfried Lange<br />
Prof. Dr. Kurt S. Zänker<br />
Juristischer Beirat: Dr. jur. Thomas Büttner<br />
Gastautoren:<br />
Peter Abels<br />
Andreas Binninger<br />
Dr. jur. Thomas Büttner<br />
Dr. Bettina Elles<br />
Prof. Dr. med. Enno Freye<br />
Günter Heenen<br />
Kyra Hoffmann<br />
Sascha Kauffmann<br />
Dr. H.-Joachim Kopp<br />
Dr. med. Rainer Mutschler, M. A.<br />
Manfred Scheffler<br />
Robert Schneider<br />
Prof. Dr. med. Jörg Spitz<br />
Carsten Stritzel<br />
Grafik/Layout: Melanie Wanner<br />
Technische Abwicklung: Sanela Cutura<br />
Anzeigenabteilung:<br />
Andrea Hiddemann<br />
Telefon: +49 (0)7<strong>03</strong>1/744-110<br />
E-Mail: hiddemann@elite-magazinverlag.de<br />
Bildnachweis: thinkstockphotos.de, fotolia.com<br />
Erscheinungsweise: 3 mal pro Jahr:<br />
Januar, April, Oktober<br />
Einzelpreis: 4,95 Euro, zzgl. Versandkosten<br />
Bestellung der Print-Ausgabe: info@nem-ev.de<br />
Print-Ausgabe: ISSN 2196-1271<br />
<strong>Online</strong>-Magazin und Media-Daten:<br />
kostenlos unter www.nutrition-press.com<br />
Copyright-Hinweis: Die gesamten Inhalte des Magazins<br />
sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte auf Konzept<br />
und Gestaltung: Elite Magazinverlags GmbH und NEM e.V..<br />
Vervielfältigungen jeglicher Art nur mit ausdrücklicher<br />
Genehmigung der Elite Magazinverlags GmbH<br />
und des NEM e.V.. (alle Anschriften siehe Verlag)<br />
Offizielles Magazin des NEM e.V.:<br />
NEM Verband mittelständischer europäischer<br />
Hersteller und Distributoren von Nahrungs ergänzungsmitteln<br />
& Gesundheitsprodukten e.V.<br />
Horst-Uhlig-Str. 3, 56291 Laudert<br />
Telefon: +49 (0)6746/80 29 82 0<br />
Fax: +49 (0)6746/80 29 82 1<br />
E-Mail: info@nem-ev.de<br />
Internet: www.nem-ev.de<br />
4<br />
www.nutrition-press.com
Recht<br />
Lebensmittelindustrie<br />
am Pranger<br />
Rechtswidrige Internetveröffentlichungen<br />
durch staatliche Behörden – neueste Rechtsprechung<br />
zu § 40 Abs. 1 a) LFGB<br />
Nach einer Reihe von der Öffentlichkeit<br />
verunsichernden Lebensmittelskandalen<br />
wie EHEC, Dioxin, Salmonellen etc., reagierte<br />
der Gesetzgeber reflexartig mit einer erheblichen Verschärfung<br />
der Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten<br />
der zuständigen Überwachungsbehörden gegenüber<br />
der Lebensmittelindustrie. Unter anderem wurde<br />
§ 40 Abs. 1 a) Nr. 2 LFGB eingeführt. Danach informiert<br />
die zuständige Behörde die Öffentlichkeit unter Nennung<br />
der Bezeichnung des Lebensmittels oder Futtermittels<br />
sowie unter Nennung des Lebensmittel- oder<br />
Futtermittelunternehmens, unter dessen Namen oder<br />
Firma das Lebensmittel oder Futtermittel hergestellt<br />
oder behandelt oder in den Verkehr gelangt ist, wenn<br />
der durch Tatsachen hinreichend begründete Verdacht<br />
besteht, dass<br />
1. in Vorschrift im Anwendungsbereich dieses Gesetzes<br />
festgelegte zulässige Grenzwerte, Höchstgehalte oder<br />
Höchstmengen überschritten wurden oder<br />
2. gegen sonstige Vorschriften im Anwendungsbereich<br />
dieses Gesetzes, die dem Schutz der Verbraucherinnen<br />
und Verbraucher vor Gesundheitsgefährdung<br />
oder vor Täuschung oder der Einhaltung hygienischer<br />
Anforderungen dienen, in nicht nur unerheblichem<br />
Ausmaß oder wiederholt verstoßen worden ist<br />
und die Verhängung eines Bußgeldes von mindestens<br />
350,00 Euro zu erwarten ist.<br />
Diese Regelung wurde von zahlreichen staatlichen Behörden<br />
zum Anlass genommen, bei festgestellten Verstößen<br />
gegen das Lebensmittelrecht sogenannte „Internetpranger“<br />
einzurichten. In den Internetprangern wur den<br />
die Namen von Lebensmittelunternehmern und Produktbezeichnungen<br />
veröffentlicht, ohne Rücksicht da -<br />
rauf, ob die festgestellten angeblichen Verstöße gegen<br />
das Lebensmittelrecht rechtskräftig festgestellt waren,<br />
noch fortbestehen oder tatsächlich gewichtig waren.<br />
In der Zwischenzeit hat es zu dieser Fragestellung eine<br />
Vielzahl von Gerichtsentscheidungen gegeben, woraus<br />
sich die Rechtswidrigkeit entsprechender staatlicher<br />
Maßnahmen ergibt.<br />
5
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Insbesondere stellte sich zunächst die Frage, ob die nationale<br />
Regelung des § 40 Abs. 1 a) Nr. 2 LFGB gegen<br />
das vorrangige Europäische Recht gemäß Artikel 10 der<br />
Basisverordnung 178/2002/ EG verstößt. Mit dieser<br />
Vorschrift ist ermöglicht, dass, wenn ein hinreichender<br />
Verdacht besteht, dass ein Lebensmittel oder Futtermittel<br />
ein Risiko für die Gesundheit von Mensch oder<br />
Tier mit sich bringen kann, die Behörden unbeschadet<br />
der nationalen oder Gemeinschaftsbestimmungen über<br />
den Zugang von Dokumenten je nach Art, Schwere und<br />
Ausmaß des Risikos geeignete Schritte, die Öffentlichkeit,<br />
über die Art des Gesundheitsrisikos aufzuklären.<br />
Dabei sind möglichst umfassend das Lebensmittel oder<br />
Futtermittel oder die Art des Lebensmittels oder Futtermittels,<br />
das möglicherweise damit verbundene Risiko<br />
und die Maßnahmen anzugeben, die getroffen wurden<br />
oder getroffen werden, um dem Risiko vorzubeugen, es<br />
zu begrenzen oder auszuschalten.<br />
In der Rechtsliteratur wurde deshalb die Auffassung<br />
vertreten, dass Artikel 10 der Verordnung 178/2002/<br />
EG eine abschließende Regelung für die den Behörden<br />
erlaubten Maßnahmen enthält, über die nationales Recht<br />
nicht hinausgehen darf. Dies ist vor allem vor dem Hintergrund<br />
von Relevanz, da Artikel 10 ausdrücklich von<br />
einem Risiko für die Gesundheit ausgeht, während dieser<br />
Maßstab in § 40 Abs. 1a) Nr. 2 LFGB nicht zwingendes<br />
Tatbestandsmerkmal ist.<br />
Das Landgericht München hat in einem Vorab-Entscheidungsersuchen<br />
diese Rechtsfrage dem Europäischen<br />
Gerichtshof vorgelegt. Der EuGH hat mit Urteil<br />
vom 11. 04. 2010 – „Berger“ in der Rechtssache Rs.<br />
§<br />
C-636/11, entschieden, dass Artikel 10 der Verordnung<br />
178/2002/EG nicht einer nationalen Regelung entgegensteht,<br />
nach deren Information der Öffentlichkeit unter<br />
Nennung der Bezeichnung des Lebensmittels und<br />
des Unternehmens, und dessen Namen oder Firma des<br />
Lebensmittels hergestellt, behalten oder in Verkehr gebracht<br />
wurde, unzulässig ist, wenn ein Lebensmittel<br />
zwar nicht gesundheitsschädlich, aber für den Verzehr<br />
durch den Menschen ungeeignet ist. Artikel 10 der Verordnung<br />
beschränke sich nur darauf, den Behörden<br />
eine Informationspflicht aufzuerlegen, wenn ein hinreichender<br />
Verdacht auf Gesundheitsrisiken besteht. Die-<br />
§<br />
se Bestimmung untersagt es jedoch den Behörden<br />
nicht, die Öffentlichkeit zu informieren, wenn ein Lebensmittel<br />
für den Verzehr durch den Menschen ungeeignet,<br />
aber nicht gesundheitsschädlich, ist. Im Ergebnis<br />
hat der EuGH damit klargestellt, dass das europäische<br />
Lebensmittelrecht keine abschließende Regelung<br />
für staatliche Informationen enthält.<br />
6
Recht<br />
Nicht geklärt ist damit jedoch die weitere Frage, ob im<br />
Einzelfall eine entsprechende Veröffentlichung des Lebensmittelunternehmers<br />
auf einer Internetseite den notwendigen<br />
Maßstäben des Verhältnismäßigkeitsprinzips<br />
gerecht wird.<br />
§<br />
Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hat<br />
mit Beschluss vom 28. 01. 2013 – Informationen über<br />
Hygienemängel – entschieden, dass eine von der Überwachungsbehörde<br />
vorgenommene Veröffentlichung<br />
auf der Homepage zu festgestellten Hygienemängeln<br />
unverhältnismäßig in die grundrechtlich geschützten<br />
Rechte des Lebensmittelunternehmers<br />
eingreift. Unter anderem stellt der Verwaltungsgerichtshof<br />
Baden-Württemberg darauf ab, dass eine Verbraucherinformation<br />
zu angeblichen Rechtsverstößen<br />
eines Unternehmens für dieses existenzgefährdend<br />
oder sogar existenzvernichtend wirken kann. Das Bundesverfassungsgericht<br />
habe den Ge richten aufgegeben,<br />
wegen der Besonderheiten der Ver breitung von Informationen<br />
über das Internet – insbesondere die schnelle<br />
und praktisch permanente Ver fügbarkeit der Informationen<br />
für jeden, der an ihr interessiert ist, einschließlich<br />
der über Suchdienste erleichterten Kombinierbarkeit<br />
mit anderen relevanten In for mationen, die mit einer Anprangerung<br />
in diesem Me dium verbundenen nachteiligen<br />
Wirkungen für grundrechtlich geschützte Belange<br />
ein gesteigertes Augenmerk zu widmen (BVerfG, Beschluss<br />
des 1. Senats vom 09. 10. 2001, 1 BvR 622/01).<br />
Mit einer Veröffentlichung im Internet werde ohne Zwei fel<br />
in Grundrechte des Antragstellers eingegriffen, die auch<br />
vor Beeinträchtigungen durch schlichtes Verwaltungshandeln<br />
schützen. Betroffen seien die Schutzbereiche<br />
des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung und<br />
der Berufsausbildungsfreiheit sowie des Rechts auf Bewahrung<br />
von Betriebsgeheimnissen sowie das Recht am<br />
eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb. Zudem<br />
würden erhebliche verfassungsrecht liche Bedenken gegen<br />
die Regelung des § 40 Abs. 1 a) LFGB bestehen.<br />
Durch die Anknüpfung an ein Bußgeld von mindestens<br />
350,00 Euro fehlt es an der ausreichend präzisen Bestimmtheit<br />
der Erkennbarkeit für den Betroffenen, ob er<br />
unter den Tatbestand falle. Darüber hinaus bestünden<br />
erhebliche Zweifel, ob § 40 Abs. 1 a) LFGB dem Gebot der<br />
Verhältnismäßigkeit genügt. Dies insbesondere vor dem<br />
Hintergrund, dass § 40 Abs. 1 LFGB keine Regelungen bezüglich<br />
der Dauer der Veröffentlichung vorsehe. Zudem<br />
verlange das Gebot der Ver hältnismäßigkeit, dass die<br />
Schwere der gesetzgeberischen Grundrechtsbe schränkung<br />
bei einer Gesamterwägung nicht außer Verhältnis<br />
zu dem Gewicht der sie rechtfertigenden Gründe bestehe.<br />
Bei Bußgeldtatbeständen in Höhe von 350,00 Euro sei<br />
von Bagatellen auszugehen, die eine mit der Pran gerwirkung<br />
im Internet einhergehenden Intensität der<br />
Grundrechtsbeeinträchtigungen nicht entsprechen.<br />
Ebenfalls nicht hinnehmbar sei, dass<br />
§ 40 Abs. 1 a) LFGB eine zwingende<br />
Pflicht zur Veröffentlichung enthalte.<br />
Damit sei ein angemessener Ausgleich<br />
zwischen dem öffentlichen Interesse an<br />
der Information und dem grundrechtlichen Geheimhaltungsinteresse<br />
nicht mehr gewährleistet. Die genannte<br />
Vorschrift lasse nicht einmal Raum, um besonderen<br />
Fallgestaltungen oder Folgen Rechnung zu tragen und<br />
ein bei der Preisgabe von personen- und unternehmensbezogenen<br />
Informationen im konkreten Einzelfall<br />
drohendes Übermaß abzuwehren. Im Eilverfahren sei<br />
deshalb zugunsten des Lebensmittelunternehmers zu<br />
entscheiden.<br />
Vergleichbar urteilte auch der Bayerische VGH in einem<br />
Beschluss vom 18. März 2013, Az. 9 CE 12.2755. Hierbei<br />
wurde es der zuständigen Behörde untersagt, die<br />
bei einer amtlichen Kontrolle im Betrieb der Antragstellerin<br />
festgestellten Mängel im Internet auf der hierfür<br />
eingerichteten Plattform zu veröffentlichen. Auch dieser<br />
Senat äußerte erhebliche Zweifel an der Verfassungsmäßigkeit<br />
des § 40 Abs. 1 a) Nr. 2 LFGB. Mit der<br />
geplanten Veröffentlichung werde nachhaltig in Grundrechte<br />
der Antragstellerin eingegriffen. Eingriffe dieser<br />
Art unterliegen dem Gebot der Verhältnismäßigkeit,<br />
welches verlange, dass ein Grundrechtseingriff einem<br />
legitimen Zweck diene und als Mittel zu diesem Zweck<br />
geeignet, erforderlich und angemessen sei. Hierfür<br />
spreche schon das Missverhältnis zwischen § 40 Abs. 1<br />
LFGB und § 40 Abs. 1 a) Nr. 2 LFGB. Während der Behörde<br />
bei der Veröffentlichung von Gesundheitsgefahren<br />
oder der Warnung vor ekelerregenden Lebensmitteln<br />
ein Ermessensspielraum eingeräumt werden<br />
(... soll ... informieren), sei die Behörde im Fall des § 40<br />
Abs. 1 a) Nr. 2 LFGB bereits bei in aller Regel weniger<br />
schwierigen Sachverhalten zu einer Information der<br />
Öffentlichkeit mit namentlicher Nennung des Betriebs<br />
verpflichtet.<br />
7
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Dr. jur. Thomas Büttner<br />
Rechtsanwalt, LL.M, Frankfurt a. Main.<br />
Lebensmittelrechtlicher Beirat des NEM e.V.<br />
und Mitglied des Rechtsausschusses des BLL.<br />
Er hat das „OPC“-Urteil des Bundesver wal tungs -<br />
gerichts vom 25. 07. 2007 erstritten und<br />
ist spe zialisiert auf die rechtliche Beratung<br />
von Vertreibern von Nahrungsergänzungsmitteln,<br />
diätetischen Lebensmitteln, angereicherten<br />
Lebensmitteln sowie Kosmetika, Medizinprodukten<br />
und Arzneimitteln.<br />
Angesichts der Schwere des Eingriffs und der zu erwartenden<br />
wirtschaftlichen Folgen für die Betroffenen erscheine<br />
ein Schwellenwert von nur 350,00 Euro für das<br />
prognostizierte Bußgeld völlig unverhältnismäßig. Eine<br />
solche Publikation in den Medien sei auch nicht erforderlich.<br />
Der Tatbestand enthalte keine zeitlichen Vorgaben<br />
für die Neuheit der Veröffentlichung bzw. keine<br />
Löschungsfristen. Eine zeitlich unbegrenzte Information<br />
der Öffentlichkeit über die in einem Betrieb zu einem<br />
bestimmten Zeitpunkt festgestellten Mängel sei jedoch<br />
unverhältnismäßig. Hinzu tritt, dass einmal ins Internet<br />
gestellte Daten in der Folge kaum effektiv gelöscht werden<br />
können, weil die Behörden mit deren Veröffen t-<br />
lichung insoweit die Verfügungsgewalt weitestgehend<br />
verlieren.<br />
Diese Rechtsprechung wurde ferner durch<br />
einen Beschluss des OVG Lüneburg<br />
vom 14. 06. 2013 bestätigt. Das<br />
Oberverwaltungsgericht<br />
führte aus, dass die beabsichtigte<br />
Veröffentlichung<br />
von Grenzwertüberschrei tungen durch ein<br />
Lebensmittel bereits nicht auf eine wirksame Ermächtigungsgrundlage<br />
gestützt werden kön ne. Der Tatbestand<br />
des § 40 Abs. 1 a) LFGB genüge jedenfalls bei der<br />
im Eilverfahren gebotenen summarischen Überprüfung<br />
nicht den verfassungsrechtlichen Vorgaben. Dies ergebe<br />
sich schon daraus, dass er die vorgesehene Information<br />
der Öffentlichkeit nicht zeitlich begrenze. Angesichts<br />
der weitreichenden Verbreitung der vorgesehenen<br />
Informationen durch die jederzeit gegebene Abrufbarkeit<br />
des Internets und ihre erheblichen wirtschaftlichen<br />
Konsequenzen für die betroffenen Lebensmittelunternehmen,<br />
liegen eine besonders drastische Form<br />
des Eingriffs in die grundrechtlich geschützten Positionen<br />
des Lebensmittelunternehmers vor.<br />
Bestätigt wird diese Rechtsprechung ebenfalls durch<br />
ein aktuelles Urteil des VG Düsseldorf vom 16. 04. 2013,<br />
Az. 16 L 494/13. Das VG Düsseldorf führt aus, dass<br />
zwar durch das Urteil des EuGH vom 11. April 2013 geklärt<br />
sei, dass Artikel 10 der Verordnung 178/2002/EG<br />
keine generelle Sperrwirkung für nationale Regelungen<br />
enthalte. Es bleibe jedoch dabei, dass § 40 Abs. 1a)<br />
LFGB erheblichen verfassungsrechtlichen Bedenken<br />
unterliege. Der EuGH habe nicht die Frage geklärt, ob<br />
§ 40a Abs. 1 a) LFGB mit dem deutschen Verfassungsrecht<br />
bzw. mit der Basisverordnung vereinbar ist.<br />
Abschließend ist festzustellen, dass die zitierten Gerichtsentscheidungen<br />
dazu geführt haben, dass in fünf<br />
Bundesländern (Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz,<br />
Nordrhein-Westfalen und Hessen) formelle<br />
Vollzugstops entsprechender Veröffentlichungen im Internet<br />
erfolgt sind.<br />
Erfreulicherweise haben somit die Gerichte einer unverhältnismäßigen<br />
Vollzugspraxis der Überwachungsbehörde<br />
zunächst einmal Einhalt geboten. Darüber hinaus<br />
ist davon auszugehen, dass die Rechtmäßigkeit und<br />
Verfassungsmäßigkeit der nationalen Regelungen des<br />
§ 40 Abs. 1a) LFGB zukünftig vor dem Bundesverfassungsgericht<br />
einer Überprüfung unterliegen wird.<br />
Bis dahin sind die Überwachungsbehörden verpflichtet,<br />
in jedem Einzelfall zu überprüfen, ob eine Veröffen t-<br />
lichung von angeblichen lebensmittelrechtlichen Verstößen<br />
im Internet verhältnismäßig ist. Auf der Grundlage<br />
der zitierten Rechtsprechung haben betroffene<br />
Lebensmittelunternehmen aktuell gute Erfolgsaussichten,<br />
sich mit Rechtsmitteln gegen eine solche Veröffentlichung<br />
zu wehren.<br />
8
Recht<br />
Kontrollpflicht, Kennzeichnung<br />
und Import von Öko-Lebensmitteln<br />
Öko-Lebensmittel haben einen festen Platz im Markt erobert<br />
und sind beim Verbraucher weiterhin geschätzt. Zur Regelung<br />
der Öko-Produkte gelten die Öko-Basis-Verordnung Nr. 834/2007<br />
und die Durchführungsverordnungen Nr. 882/2008<br />
und Nr. 1235/2008 zum Import.<br />
Da der Unterschied zwischen Bio- und konventionellen<br />
Erzeugnissen analytisch am<br />
Produkt kaum festzumachen ist wurde ein ausgeklügeltes<br />
Kontrollregime entwickelt, das auf Systemkontrollen<br />
vor Ort beruht und den gesamten Werdegang eines Bio-<br />
Produktes umfasst.<br />
1. Kontrollpflicht<br />
Die Öko-Verordnung regelt sämtliche Lebensmittel mit<br />
Öko-Hinweisen, aber auch z. B. Heimtiernahrung und<br />
Bio-Hefen. Seit 2012 gibt es auch „Bio-Wein“. Weitere<br />
Regelungen durch die Kommission sollen folgen, ggf.<br />
auch noch für Kosmetika. Arzneimittel werden nicht<br />
von der Öko-Verordnung erfasst.<br />
Das Auslösen der Öko-Verordnung und die Kontrollpflicht<br />
ergeben sich durch Kennzeichnung und Werbung.<br />
Grundsätzlich lösen alle Begriffe wie „ökologisch“<br />
oder „biologisch“ oder „Bio“ und „Öko“ die Anwendung<br />
der Verordnung aus.<br />
Erfasst werden bei der Betrachtung nicht nur Hinweise,<br />
die im Etikett der Produkte erscheinen, sondern auch<br />
Angaben in Etikettierung, Werbung und Geschäftspapieren.<br />
Selbst die Führung der Silbe „Bio“ in einer<br />
Marke oder Firmierung, auch wenn diese historisch<br />
belegt ist, führt nach Artikel 23 der Öko-Verordnung<br />
dazu, dass der Verbraucher nach Auffassung des<br />
Ge setzgebers ein Bio-Produkt vermutet. Die Kontrollpflicht<br />
gilt für Erzeugerbetriebe und Hersteller genauso<br />
wie für Einführer, Lagerhalter und grundsätzlich<br />
alle Inverkehrbringer, aber auch für Restaurants und<br />
Kan tinen.<br />
Einzelhandel<br />
Für den Einzelhandel bestehen Ausnahmen von der<br />
Kontrollpflicht. Trotzdem befinden sich viele Einzelhandelsketten<br />
im Öko-Kontrollverfahren, entweder weil sie<br />
Vertriebslager betreiben oder auch, weil an Bedientheken<br />
(Aufbacken, Fleischtheken, Fischtheken) Bio-Produkte<br />
bearbeitet, abgepackt oder gekennzeichnet werden.<br />
Internet-Shops<br />
Die Arbeitsgemeinschaft der Bundesländer (LÖK) hat<br />
festgestellt, dass Internet-Händler im Distanz-/Versandhandel<br />
tätig seien und eine direkte Verkaufshandlung<br />
unter Anwesenheit des Endverbrauchers hier nicht<br />
vorliege und beschlossen: „Der Versandhandel einschließlich<br />
des <strong>Online</strong> Handels über das Internet ist<br />
unabhängig von individuellen Vereinbarungen und der<br />
Zusammensetzung der Käuferschaft kontrollpflichtig.“<br />
Unteraufträge<br />
Unterauftragnehmer, die kontrollpflichtige Tätigkeiten<br />
ausüben, müssen ebenfalls in das Kontrollregime einbezogen<br />
werden. Allerdings gibt es neben der direkten<br />
Anmeldung bei der zuständigen Behörde auch die Möglichkeit<br />
einer indirekten Teilnahme über die Anmeldung<br />
des den Lohnauftrag erteilenden Unternehmens.<br />
9
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
2. Bio-Kennzeichnung<br />
Obwohl die Öko-Verordnung verschiedene Produktkategorien<br />
und Kennzeichnungsmöglichkeiten beschreibt,<br />
wird fast ausschließlich die 100 %-Bio Variante<br />
genutzt, die eine prominente Bio-Auslobung ermöglicht.<br />
Öko-Hinweise in der Verkehrsbezeichnung<br />
Unter folgenden Voraussetzungen dürfen bei 95 % -100 %<br />
Bio-Produkten Öko-/Bio-Hinweise in der Verkehrsbezeichnung<br />
ohne Festlegung auf einen bestimmten<br />
Wort laut verwendet werden, wie z. B. Bio-<br />
Müsli oder Bio-Apfelsaft. Auch weitere zutreffende<br />
Hinweise auf die ökologische<br />
Erzeugung sind in der Kennzeichnung<br />
möglich.<br />
• Das Lebensmittel besteht überwiegend<br />
aus Zutaten landwirtschaftlichen<br />
Ursprungs; hinzugefügtes<br />
Wasser und Kochsalz werden<br />
nicht berücksichtigt<br />
• Mindestens 95 % der Zutaten landwirtschaftlichen<br />
Ursprungs stammen<br />
aus der ökologischen Produktion;<br />
nicht ökologische Zutaten<br />
müssen zugelassen sein.<br />
• Es dürfen nur Zusatzstoffe, Verarbeitungshilfsstoffe,<br />
Aromastoffe, Wasser, Salz, Zubereitungen<br />
aus Mikroorganismen, Enzyme, Mineralstoffe,<br />
Spurenelemente, Vitamine sowie Aminosäuren und<br />
andere Mikronährstoffe verwendet werden, die zugelassen<br />
sind<br />
• „Zwillingsverbot“: Eine ökologische Zutat darf nicht<br />
zusammen mit der gleichen nicht ökologischen oder<br />
einer Zutat verwendet werden<br />
• Das Lebensmittel ist ohne Verwendung von gentechnisch<br />
veränderten Organismen und auch nicht auf<br />
der Grundlage von gentechnisch veränderten Organismen<br />
hergestellt und auch nicht mit ionisierenden<br />
Strahlen behandelt worden<br />
• Zutaten aus ökologischer Erzeugung sind in der Zutatenliste<br />
immer als solche kenntlich zu machen.<br />
z. B. Tomatensaft*, Meersalz aus ökologischer Erzeugung*<br />
• Kontrollgebot: Erzeugung und Verarbeitung sowie<br />
gegebenenfalls auch Einfuhr und Vermarktung sind<br />
gemäß gültiger Kontrollbestimmungen kontrolliert<br />
und bescheinigt worden<br />
Zutatenkennzeichnung ohne Bio-Mindestanteil<br />
Unter bestimmten Voraussetzungen kann ein jeglicher<br />
Öko-Anteil und sei er noch so gering, ausschließlich in<br />
der Zutatenliste als „öko“ gekennzeichnet werden. Das<br />
EU-Logo ist dann nicht zulässig. Die meisten Voraussetzungen<br />
der 100 %-Kennzeichnung müssen aber erfüllt<br />
sein, nämlich<br />
• Überwiegend landwirtschaftlich<br />
• Nur zugelassene Stoffe<br />
• Zwillingsverbot<br />
• Verbot von GVO und ionisierenden Strahlen<br />
• Kontrollgebot<br />
Einschränkungen in Bezug auf die Hinweise<br />
• Der Hinweis darf nur im Verzeichnis der Zutaten erscheinen<br />
• Der Gesamtanteil der ökologischen Zutaten muss<br />
angegeben werden<br />
• Die Angaben im Zutatenverzeichnis dürfen nicht<br />
hervorgehoben werden<br />
Wild-Produkte mit Bio-Anteil<br />
Diese seltene Kategorie trifft z. B. auf<br />
Fischkonserven zu wie z. B. Sardinen in<br />
Bio-Olivenöl. Der Bio-Hinweis erscheint in<br />
demselben Sichtfeld wie die Verkehrsbezeichnung,<br />
sofern<br />
• die Hauptzutat ein Erzeugnis der Jagd<br />
oder der Fischerei ist<br />
• andere Zutaten landwirtschaftlichen<br />
Ur sprungs ausschließlich ökologisch<br />
sind.<br />
Umstellware<br />
Gelegentlich trifft man auch auf die sogenannte „Umstellware“.<br />
Für Lebensmittel gilt für diesen Fall in der<br />
Kennzeichnung der einzig mögliche Pflichttext „Erzeugnis<br />
aus der Umstellung auf den ökologischen Landbau“<br />
oder „Erzeugnis aus der Umstellung auf die biologische<br />
Landwirtschaft“ ohne jegliche Hervorhebung und ohne<br />
weitere Bio-Hinweise. Voraussetzung ist aber auch<br />
noch, dass das Erzeugnis nur eine pflanzliche Zutat<br />
landwirtschaftlichen Ursprungs enthält und ein Umstellungszeitraum<br />
von mindestens zwölf Monaten eingehalten<br />
wurde.<br />
Produkte mit Anteil Hefe<br />
oder Hefeerzeugnissen<br />
Ab dem 31. Dezember 2013<br />
sind Hefe und Hefeprodukte<br />
zu den Zutaten landwirtschaftlichen<br />
Ursprungs zu rechnen. Das<br />
heißt insbesondere für Hersteller<br />
von Bio-Brot auf strichen,<br />
dass Hefe anteile und Hefeextrakte<br />
nicht mehr als „Mikroorganismenzubereitungen“<br />
unberücksichtigt<br />
bleiben, sondern aus Öko-Hefe gewonnen<br />
worden sein müssen. Es bleibt jedoch die Möglichkeit<br />
bestehen, konventionelle Hefe z. B. bei der<br />
Herstellung von Backwaren einzusetzen, sofern der<br />
Hefeanteil 5 % nicht übersteigt.<br />
10
Recht<br />
Gemeinschaftslogo und Herkunftsangabe<br />
Das EU-Logo muss und darf nur bei Bio-Produkten eingesetzt werden, die unter die<br />
95 % - 100 % Kategorie fallen. Sofern das Logo eingesetzt wird, ist auch die Herkunft<br />
der Zutaten des Lebensmittels anzugeben. Mit der Herkunft ist dabei der Ort gemeint,<br />
an dem der pflanzliche Rohstoff gewachsen ist oder das Tier auf gewachsen<br />
ist, nicht der Verarbeitungsort.<br />
Die Herkunftsangabe muss in folgender Form erfolgen:<br />
• „EU-Landwirtschaft“<br />
• „Nicht-EU-Landwirtschaft“<br />
• „EU-/Nicht-EU-Landwirtschaft“<br />
• Alleinige oder zusätzliche Angabe des Ländernamens bei Erzeugung aller landwirtschaftlichen<br />
Ausgangsstoffe in demselben Land, z. B. „Deutsche Landwirtschaft“.<br />
Zutaten, die weniger als zwei Gewichtsprozent der Gesamtmenge der Zutaten landwirtschaftlichen<br />
Ursprungs ausmachen, können außer Acht gelassen werden. Als<br />
weitere zwingende Kennzeichnungsvorgaben sind festgelegt worden:<br />
• Herkunftskennzeichnung muss unter der Codenummer der Kontrollstelle erscheinen<br />
• die Herkunftskennzeichnung muss in demselben Sichtfeld wie das Gemeinschaftslogo<br />
erscheinen<br />
Das Gemeinschaftslogo darf auch außerhalb der verpflichtenden Kennzeichnung von<br />
vorverpackten Lebensmitteln verwendet werden, wie z. B. in Katalogen, Verkaufsräumen,<br />
auf Internetseiten oder in Geschäftspapieren. Die Angabe der Codenummer mit<br />
Herkunftsangabe ist hier nicht erforderlich. Wohl aber ist die Angabe der Codenummer<br />
des Rechnungsstellers auf Rechnungen über Bio-Waren sowie die Code nummer<br />
des Lieferanten auf den Lieferscheinen erforderlich. Ebenso ist die Kennzeichnung<br />
von blickdichten Umkartons vorverpackter Lebensmittel mit der Codenummer der<br />
Kontrollstelle erforderlich, wie das Verwaltungsgericht Regensburg kürzlich feststellte.<br />
Bei Heimtiernahrung schließen die Mitgliedstaaten die Verwendung des Gemeinschaftslogos<br />
noch aus, da für diese Produktgruppe bisher keine EU-Regeln auf gestellt<br />
wurden, sondern nur private oder nationale Richtlinien bestehen.<br />
Codenummer der Kontrollstelle<br />
Jede Kontrollstelle hat eine eindeutige Kontrollcodierung erhalten; in Deutschland<br />
hat sie die Form „DE-ÖKO-000“, wobei in den letzten drei Ziffern die Nummer<br />
der zugelassenen Stelle steht, die die Kontrolle der letzten Erzeugungs- oder Aufbereitungshandlung<br />
vorgenommen hat“.<br />
3. Einfuhr von Bio-Produkten<br />
Die Einfuhr von Bio-Produkten erfolgt nach verschiedenen Regelungen, die alle<br />
in Verordnung (EG) Nr. 1235/2008 aufgezeigt werden. Wer Bio-Produkte in die EU<br />
einführen möchte, muss sich für diese Tätigkeit allerdings zuerst als Einführer registrieren<br />
und kontrollieren lassen.<br />
Warenbegleitend ist dann jeweils eine Kontrollbescheinigung bei der Verzollung zu<br />
präsentieren, in der der Zoll die Richtigkeit per Sichtvermerk bescheinigt und der<br />
Erste Empfänger in der EU anschließend auf demselben Dokument die Nämlichkeit<br />
der Bio-Lieferung bestätigt.<br />
11
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Das Einfuhrgeschäft selbst erfolgt derzeit nach drei<br />
Verfahren.<br />
1) „Drittlandliste“<br />
Das Ausfuhrland ist mit den Produkten die eingeführt<br />
werden sollen auf der sogenannten „Drittlandliste“.<br />
Dies sind derzeit die Länder Argentinien, Australien,<br />
Kanada, Costa Rica, Indien, Israel, Japan, Schweiz,<br />
Tunesien, USA, Neuseeland. Im Anhang sind auch die<br />
für diese Länder autorisierten Kontrollstellen gelistet<br />
und die Produkte, für die die Länder in der Liste stehen.<br />
Eine sorgfältige Überprüfung durch den Einführer ist<br />
erforderlich, sonst übersieht er z. B. Besonderheiten<br />
wie derzeit eine noch aktuelle Aussetzung der Drittlandlistung<br />
für „verarbeitete Lebensmittel“ aus Indien.<br />
2) „Liste anerkannter Kontrollstellen“<br />
Das Ausfuhrland und die betroffenen Produkte sind<br />
in der „Liste anerkannter Kontrollstellen“ erfasst. Diese<br />
Liste wurde zuletzt durch Verordnung (EU) Nr. 586/2013<br />
aktualisiert. Der Geltungsbereich dieses Verfahrens<br />
be trifft nur Länder, die nicht auf der Drittlandliste<br />
stehen.<br />
3) Vermarktungsgenehmigungen<br />
Es handelt sich um ein Antragsverfahren (BLE), in dem<br />
der Importeur darlegt, welche Waren er in welchem<br />
Umfang und woher einführen möchte. Nach Über prüfung<br />
wird eine befristete Genehmigung erteilt, diese<br />
Produkte einzuführen und zu vermarkten.<br />
Dieses Verfahren wird jedoch auslaufen; es sollen<br />
– ab 01. 07. 2013 für in Anhang IV gelistete Kontrollstellen/Erzeugnisse<br />
keine Vermarktungsgenehmigungen<br />
mehr erteilt werden<br />
– ab 01. 07. 2014 keine neuen Vermarktungsgenehmigungen<br />
mehr erteilt werden<br />
– ab 01. 07. 2015 bestehende Vermarktungsgenehmigungen<br />
ihre Gültigkeit verlieren<br />
Wichtig für den Einführer ist es, dass sämtliche sogenannte<br />
„Erste Empfänger“ in der EU für das Öko-<br />
Kontrollverfahren anzuzeigen ist. Sofern der Einführer<br />
einen Dienstleister mit dieser Aufgabe betraut, ist auch<br />
dieser ins Verfahren zu melden; ansonsten kann die<br />
Folge sein, dass ein Bio-Produkt seinen Bio-Status aus<br />
formalen Gründen verliert.<br />
Die Regelung der Produktion, des Inverkehrbringens<br />
und der Einfuhr von Öko-Lebensmitteln und auch der<br />
Vollzug dieser Regelungen sind inzwischen äußerst<br />
komplex geworden, so dass die Europäische Kommission<br />
auch schon laut darüber nachgedacht hat,<br />
ob nicht die Kontrollen verstaatlicht werden sollen oder<br />
ob gar die gesamte Öko-Regelung zugunsten privater<br />
Standards wieder abgeschafft werden sollte.<br />
Dr. H.-Joachim Kopp,<br />
LACON-Institut, Offenburg<br />
12
Steuern<br />
Risiko = Mehrwertsteuer<br />
Nahrungsergänzungsmittel wie auch diätetische Lebensmittel<br />
befinden sich sozusagen an der Schnittstelle zwischen Lebensund<br />
Arzneimitteln, und damit auch zwischen dem regulären<br />
und dem ermäßigten Umsatzsteuersatz von 7 % . 1<br />
Ihre Einordnung ist abhängig von der Zugehörigkeit zu bestimmten<br />
Zolltarif-Nummern. Sie kann im Auftrag des Herstellers, bei spielsweise<br />
durch einen Sachverständigen vorgenommen werden, rechtlich<br />
belastbar ist jedoch in diesem Zusammenhang nur eine Zolltarifauskunft<br />
. 2<br />
Was aber ist zu tun, wenn die Einordnung<br />
durch den Zoll nicht zufriedenstellend<br />
ausfällt oder nachträglich, womöglich mit Rückwirkung,<br />
geändert wird?<br />
Aktuelle Praxis der Finanzbehörden<br />
In der Beratungspraxis taucht immer häufiger das Problem<br />
auf, dass im letztgenannten Fall, Produkte vom<br />
Finanzamt aus dem ermäßigten Umsatzsteuersatz<br />
ausgenommen werden, obwohl an dem Produkt und<br />
sei ner Präsentation keinerlei Änderungen vorgenommen<br />
wurden.<br />
eine erneute Einholung, d. h. die Überprüfung einer bereits<br />
erteilten ZTA 3 . Möglich ist ein solches Vorgehen<br />
des Finanzamtes selbst dann, wenn eine verbindliche<br />
ZTA erteilt wurde, denn selbst diese bietet keine endgültige<br />
Sicherheit. 4<br />
In der Regel wird das Finanzamt dabei so vorgehen,<br />
dass es zunächst eine unverbindliche Zolltarifauskunft<br />
(ZTA) einholt und dann auf deren Basis entscheidet.<br />
Dies kann erstmalig geschehen, möglich ist aber auch<br />
1 Vgl. dazu: „Welches ist der richtige Steuersatz“ – Die unverbindliche Zolltarifauskunft als Antwort, <strong>Nutrition</strong> <strong>Press</strong> 1 –<br />
Januar 2013, S. 44 ff.<br />
2 Zu Einzelheiten und zum Verfahren der verbindlichen Zolltarifauskunft siehe BMF <strong>05</strong>. 08. 2004, - IV B 7 - S 7220 - 46/04 -,<br />
BStBl 2004 I, 638.<br />
3 Eine bereits erteilte uvZTA wird schlicht ungültig, wenn sich die zugrunde liegende zolltarifliche Einreihung oder der in<br />
der Auskunft ausgewiesene Umsatzsteuersatz ändert.<br />
4 Im Allgemeinen gilt eine vZTA sechs Jahre. In bestimmten Fällen (z. B. Veröffentlichung einer Einreihungsverordnung,<br />
Änderung in der Auslegung der Nomenklatur auf internationaler Ebene oder andere Möglichkeiten, die in den Durchführungsvorschriften<br />
für den Zollkodex vorgesehen sind) kann die Gültigkeit einer VZTA aber vorher erlöschen. In solchen<br />
Fällen hat der Wirtschaftsbeteiligte die Möglichkeit, bei den Zollbehörden beantragen, die VZTA für eine Übergangszeit<br />
weiter verwenden zu dürfen (so genannte „Vertrauensschutzfrist“). Einem solchen Antrag wird nur<br />
stattgegeben, sofern die gesetzlich vorgeschriebenen Bedingungen hierfür erfüllt sind.<br />
13
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Als nachteilige Konsequenz ergibt sich auf steuerlich<br />
er Ebene ein Änderungsaufwand, der regelmäßig,<br />
namentlich bei rückwirkender Änderung der Einreihung,<br />
zu einer aufwändigen Umsatzsteuerberichtigung führt.<br />
Daraus entstehende Nachzahlungen können nicht immer<br />
durch Zuzahlungen der beteiligten Geschäftspartner<br />
abgefangen werden. Wurde bereits direkt an den<br />
Endverbraucher verkauft, bleibt diese Möglichkeit verschlossen.<br />
In jedem Fall sind in der Regel erhebliche<br />
Beträge aufzubringen und zudem entsteht ein oft erheblicher<br />
Verwaltungsaufwand.<br />
Auch ohne eine Rückwirkung können sich nachteilige,<br />
wirtschaftliche Konsequenzen aus dem geringeren Nettoerlös<br />
oder einer Verteuerung des Produktes ergeben.<br />
An die veränderte, zolltarifliche Einordnung knüpfen<br />
sich unter Umständen weitere Konsequenzen für Einund<br />
Ausfuhr von Produkten. Zudem kann auch für die<br />
Verkehrsfähigkeit im Innland eine Arzneimittelzulassung<br />
erforderlich werden, die bekanntermaßen nur mit<br />
großem Aufwand zu erreichen ist.<br />
Beispielfälle<br />
Wichtig und wohl auch im Hinblick auf die Gesamtrechtsordnung<br />
fragwürdig, ist in diesem Zusammenhang<br />
der Umstand, dass die Einstufung als Arzneiware<br />
keinesfalls von einer tatsächlichen, nachweisbaren<br />
therapeutischen Wirkung des betreffenden Produktes,<br />
sei es Nahrungsergänzungsmittel oder diätetisches<br />
Lebensmittel, abhängt. Unter Umständen kann eine<br />
solche Einreihung auch dann festgesetzt werden, wenn<br />
der Hersteller von einer Auslobung entsprechender<br />
Eigenschaften völlig abgesehen hat. 5<br />
Ausreichend ist vielmehr, dass die verantwortliche Zollbehörde<br />
zu der Auffassung gelangt, die Voraussetzungen<br />
für die Einreihung in die Position 3004 der kombinierten<br />
Nomenklatur („KN“) seien erfüllt. 6<br />
Solche Ergebnisse sind, insbesondere im Hinblick auf<br />
die unermüdlichen Bemühungen des europäischen Gesetzgebers<br />
um die Eliminierung aller Produkte, deren<br />
gesundheitsbezogene Auslobung nicht außerhalb jeden<br />
Zweifels, wissenschaftlich nachweisbar ist, schwer nachvollziehbar.<br />
Nährstoffkonzentration<br />
Im Rahmen der behördlichen Prüfungspraxis wird besonders<br />
häufig an das Kriterium der „Konzentration der<br />
enthaltenen Wirkstoffe“ angeknüpft. Liegt diese „deutlich<br />
höher als die empfohlene Tagesdosis“ reicht dies<br />
vom Standpunkt der Zollbehörde und damit auch für<br />
das Finanzamt oft bereits aus, da Angaben über die zu<br />
verabreichende Menge und die Art der Anwendung<br />
für Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel<br />
ohnehin zwingend vorgeschrieben sind und somit<br />
auch die weiteren Voraussetzungen vorliegen.<br />
Entgegen der ausdrücklichen Formulierung in der KN:<br />
„Ein aktiver Wirkstoff ist eine chemisch definierte Substanz,<br />
eine chemisch definierte Gruppe von Substanzen<br />
oder ein Pflanzenextrakt. Diese aktiven Substanzen<br />
müssen medizinische Eigenschaften zur Verhütung oder<br />
Behandlung von spezifischen Krankheiten, Leiden oder<br />
deren Symptomen haben (ErlKN zu Kapitel 30 (KN)<br />
Anm. 1. 1)“. Die Zollbehörden tendieren eindeutig dazu,<br />
jeden in einem Produkt enthaltenen Inhaltstoff als<br />
Wirkstoff zu bewerten, ganz unabhängig davon, ob er<br />
tatsächlich als „Wirkstoff“ in diesem Sinn anzusehen<br />
5 Vgl. BFH-Urteil vom 04. 11. 20<strong>03</strong> - VII R 58/02; BFH-Urteil in BFHE 190, 501, 5<strong>05</strong> sowie EuGH-Urteil in EuGHE 1998,<br />
I-8357.<br />
6 Die Position 3004 erfasst Arzneiwaren. Nicht in diese Position einzureihen sind nach Ziff. 1 a. der Anmerkungen zu<br />
Kapitel 30, Nahrungsmittel wozu insbesondere auch diätetische Lebensmittel zählen. Aus den Zusätzlichen Anmerkungen<br />
zu Kapitel 30 ergibt sich, dass die Einreihung unter die Position 3004 zwingend an das Vorliegen der folgenden,<br />
Voraussetzungen geknüpft ist:<br />
Die Zubereitungen sind in Pos. 3004 einzureihen, wenn auf dem Etikett, der Verpackung oder dem Beipackzettel<br />
folgende Angaben gemacht werden:<br />
a) die spezifischen Krankheiten, Leiden oder deren Symptome, bei denen die Erzeugnisse verwendet werden sollen;<br />
b) die Konzentration des enthaltenen Wirkstoffs oder der enthaltenen Wirkstoffe;<br />
c) die zu verabreichende Menge und<br />
d) die Art der Anwendung. (...)<br />
Bei Zubereitungen auf der Grundlage von Vitaminen, Mineralstoffen, essentiellen Aminosäuren oder Fettsäuren muss<br />
die Menge dieser Stoffe pro auf dem Etikett angegebener Tagesdosis deutlich höher sein, als die für den Erhalt der<br />
allgemeinen Gesundheit oder des allgemeinen Wohlbefindens empfohlene Tagesdosis.<br />
7 RDA werden nicht international einheitlich festgelegt. So unterscheiden sich beispielsweise die in den USA geltenden<br />
RDA signifikant von den innerhalb der EU geltenden Werte. Sowohl die Gültigkeit, als auch die Genauigkeit der Vorgaben<br />
steht zudem wissenschaftlich in Frage, da grundsätzlich wie bei allen Bewertungsmethoden, verschiedenste<br />
Ansätze und Kriterien gewählt werden können.<br />
8 § 21 Abs. 2 Ziffer 1 DiätVO.<br />
14
Anzeige /<br />
ist, also ob ihm tatsächlich eine „heilende oder prophylaktische Wirkung“ im Zusammenhang<br />
mit der Wirkung des Produktes zukommen kann. Hierdurch erhöht sich das<br />
allgemeine Risiko für die Hersteller erheblich, da letztlich jeder Inhaltsstoff auf dem<br />
Prüfstand steht.<br />
Als „deutliche Überschreitung“ gelten dabei, entsprechend den Erläuterungen zur KN<br />
Werte, die „mindestens dreimal höher“ als die normalerweise empfohlene Tagesdosis<br />
(Recommended Daily Allowance – RDA) sind.<br />
Hierzu ein kleiner Exkurs: Die RDA geben die Mengen von essentiellen Nährstoffen<br />
an, die nach dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnisstand für ausreichend angesehen<br />
werden, den täglichen Bedarf nahezu jedes gesunden Menschen zu decken.<br />
Sie enthalten keine Aussagen über die täglich zulässige Höchstmenge des betreffenden<br />
Stoffes, hier liegen die RDA häufig sogar weit unter der Menge, die durch natürliche<br />
Nahrungsaufnahme möglich wäre. 7<br />
Dies könnte insgesamt zu dem Schluss verleiten, hieraus ergäbe sich für den Hersteller<br />
zumindest bei der Entwicklung eines Produktes im Falle der Einhaltung dieser<br />
Werte eine gewisse Rechtssicherheit. Diese Annnahme ist jedoch unzutreffend.<br />
Tatsächlich unterliegt der Bestand an RDA Festlegungen sowohl in Bezug auf die Zahl<br />
der erfassten Nährstoffe, als auch in Bezug auf die festgelegten Werte, ständiger<br />
Überarbeitung und stellt damit eine unberechenbare Variable dar. Aus diesem Grund<br />
ist es also durchaus möglich, dass ein Produkt, dessen Gehalt an Inhaltsstoffen ursprünglich<br />
innerhalb der empfohlenen Grenzwerte lag, infolge der Erweiterung und/<br />
oder Änderung der RDA Festlegungen für einen beliebigen Inhaltsstoff, ohne weiteres<br />
als Arzneiware eingestuft wird.<br />
Therapeutische oder Prophylaktische Zweckbestimmung<br />
Weiter wird von den Zollbehörden an das 1. Kriterium der KN, der Verwendung im<br />
Zusammenhang mit „die spezifischen Krankheiten, Leiden oder deren Symptomen“<br />
angeknüpft. Auch hier ist es möglich, dass einem Produkt, dessen Bestimmung vom<br />
Hersteller z. B. nur mit „Nahrungsergänzungsmittel“ bezeichnet wird, nach einer Gesamtbewertung<br />
der Präsentation durch die Behörden eine entsprechende heilende<br />
oder vorbeugende Zweckbestimmung beigelegt wird. Ist ein diätetisches Lebensmittel<br />
einzureihen, so wird dieser Schluss beinahe durchgängig aus der gesetzlich vorgesehenen<br />
Zweckbeschreibung 8 gezogen.<br />
Änderungen der Einreihung können sich schließlich auch noch aus anderen Gründen<br />
ergeben, dies geschieht etwa, wenn sie aufgrund des Erlasses einer EU-Verordnung<br />
dem damit gesetzten Recht nicht mehr entspricht,<br />
wenn sie mit der Auslegung einer Nomenklatur<br />
nicht mehr vereinbar ist, weil beispielsweise<br />
die Erläuterungen zum harmonisierten<br />
System oder zur kombinierten Nomenklatur geändert<br />
worden sind oder aufgrund neuer Erkenntnisse<br />
bzw. modernerer Herstellungsverfahren<br />
und Materialien die Auffassung zum Einreihungsergebnis<br />
neu überdacht werden musste.
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Lösungsansätze: Die richtige Strategie<br />
Es ist vorauszuschicken, dass es bedingt durch die Verschiedenheit der Ursachen,<br />
die für die oben dargestellte Rechtsänderung eine Rolle spielen können, nicht generell<br />
möglich sein wird, sich vor den durch eine Einreihung unter Position 3004 entstehenden<br />
Risiken zu schützen.<br />
Dr. Bettina Elles, LL.M.,<br />
Schadbach Rechtsanwälte,<br />
Frankfurt a. Main, Fach -<br />
li cher Beirat des NEM e. V.<br />
(Präventive) Lösungsansätze<br />
Eine präventive Berücksichtigung der Veränderung bzw. des Hinzutretens von RDA<br />
würde hellseherische Fähigkeiten voraussetzen. Möglich und sinnvoll ist es allerdings,<br />
die Präsentation des Produktes präventiv zu optimieren. Das bedeutet, dass –<br />
unter Einhaltung aller zwingenden gesetzlichen Vorgaben – alle Angaben auf Verpackung<br />
und Beipackzettel auf kritische Formulierungen untersucht und gegebenenfalls<br />
abgeändert werden. Diese Möglichkeit bietet sich in allen geschilderten Fällen<br />
an und hat sich in unserer Praxis bereits im außergerichtlichen Bereich als überwiegend<br />
erfolgreich erwiesen.<br />
Auf die Problematik einer „Überdosierung“ kann nur nach einer Einreihung als Arzneiware<br />
reagiert werden. Insbesondere wegen der damit drohenden verschärften<br />
Zu lassungsvoraussetzungen wird es dabei in der Regel nicht ratsam sein, die veränderte<br />
Einreihung einfach hinzunehmen. Für manche Hersteller bietet sich hier die Veränderung<br />
der Rezeptur als Lösung an.<br />
Kommt dieser Ansatz nicht in Betracht kann es sich durchaus wiederum als sinnvoll<br />
erweisen, die Präsentation des Produktes entscheidend zu bearbeiten 9 . Dies gilt<br />
selbst dann, wenn einer der Inhaltsstoffe in einer die RDA mehr als das dreifache<br />
überschreitenden Dosis enthalten ist. Veränderungen müssen dabei umfassend an<br />
den Angaben auf Verpackung und Beipackzettel vorgenommen werden. Diese Vorgehensweise<br />
kann sich trotz der zwingenden Vorgaben der DiätVO auch für diätetische<br />
Lebensmittel anbieten. Werden Veränderungen vorgenommen, ist grundsätzlich<br />
nach Abschluss eine neue ZTA zu beantragen.<br />
Rechtsmittel<br />
Neben den aufgezeigten präventiven und/oder außergerichtlichen Reaktionsmöglichkeiten<br />
bleibt natürlich immer die Möglichkeit, im Rahmen von Einspruchsverfahren<br />
und darauf folgenden Klageverfahren gegen die auf der geänderten Einreihung<br />
basierenden Steuerbescheide vorzugehen.<br />
Die Finanzbehörden sind dabei in den seltensten Fällen tragfähigen, rechtlichen Argumenten<br />
zugänglich, sodass eine Abhilfe im Einspruchsverfahren kaum zu erwarten<br />
sein wird. Ähnliches gilt für die Finanzgerichte, die in der 1. Instanz sehr häufig geneigt<br />
sind, die Argumentation der Finanzbehörden zu übernehmen. Deutlich besser<br />
werden die Aussichten für die Kläger allerdings vor den Obergerichten. Das bedeutet<br />
allerdings selbstverständlich ein langwieriges, aufreibendes und kostenintensives<br />
Verfahren, das teilweise durchgeführt werden muss, obwohl die unerwünschten<br />
Steuerbescheide ihre Gültigkeit behalten.<br />
Fazit<br />
Für Nahrungsergänzungsmittel und diätetische Lebensmittel besteht grundsätzlich<br />
ein akutes Risiko der (Neu-) Einreihung in die Position 3004 KN als Arzneiware.<br />
Neben der weiterhin gültigen Empfehlung sich durch die Beantragung einer ZTA<br />
zunächst Klarheit zu verschaffen, ist dazu zu raten, auch der Rezeptur und besonders<br />
der Präsentation der Produkte große Aufmerksamkeit zu widmen und diese gerade<br />
unter Berücksichtigung dieses Risikos zu prüfen und ggf. auch anzupassen. Insgesamt<br />
sollten diese Maßnahmen unbedingt von fachlich kompetenten Beratern begleitet<br />
werden.<br />
16<br />
9 Nach einer aktuellen Entscheidung des FG Niedersachsen vom 10. <strong>05</strong>. 2012, Az.: 16 K<br />
281/11, kommt es sogar allein auf die Aufmachung des Produktes an. Das Verfahren<br />
ist zur Zeit beim BFH abhängig.
Steuern<br />
Umsatzsteuer:<br />
Gelangens be stätigung<br />
ab 01. 10. 2013 –<br />
jetzt aktiv werden!<br />
Speziell im Hinblick auf die Belegnachweise, die in der sogenannten<br />
Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung (UStDV)<br />
ge regelt sind, gab es zum 01. Januar 2012 eine praktisch bedeutsame<br />
Neuerung, die sogenannte „Gelangensbestätigung“<br />
Mit dem grenzüberschreitenden Wa renverkehr<br />
sind viele steuerliche Fragen<br />
eng verbunden. Ein zentraler Themenkomplex dabei ist<br />
die Umsatzsteuer. Der innergemeinschaftliche Warenverkehr<br />
sowie die Ausfuhrlieferungen sind regelmäßig<br />
von der Idee geprägt, dass eine Umsatzbesteuerung<br />
im Bestimmungsland der Ware erfolgen soll. Dies hat<br />
konsequenter Weise zur Folge, dass die Ware im Land<br />
des Lieferanten von der Umsatzbesteuerung zu befreien<br />
ist (z. B. als steuerbefreite innergemeinschaftliche<br />
Lieferung oder als Ausfuhrlieferung) und im Bestimmungsland<br />
der dortigen Umsatzsteuer zu unterwerfen<br />
ist (z. B. als steuerpflichtiger innergemeinschaftlicher<br />
Erwerb oder als steuerpflichtige Einfuhr).<br />
Voraussetzung für das komplexe Zusammenspiel von<br />
Steuerbefreiung im Ursprungsland und Steuerpflicht im<br />
Be stimmungsland ist unter anderem, dass die Ware tatsächlich<br />
über die Grenze gelangt und entsprechende<br />
Buch- und Belegnachweise hierüber geführt werden können.<br />
War es bislang ausreichend, dass der Abnehmer<br />
der Ware versichert, die Ware in ein anderes EU-Land<br />
zu befördern und dort zu verwerten, müssen deutsche<br />
Lieferanten zukünftig nachweisen, dass bei innergemeinschaftlichen<br />
Lieferungen die gelieferten<br />
Gegenstände auch tatsächlich im EU-Ausland an gekommen<br />
sind – anderenfalls können diese Lieferungen<br />
nicht steuerfrei erfolgen. Für den Nachweis sieht § 17 a<br />
UStDV die Gelangensbestätigung vor. Diese Regelung<br />
i st zwar bereits seit dem 01. Januar 2012 in Kraft,<br />
wur de jedoch aufgrund massiver Gegenwehr bis lang<br />
im Rahmen einer Übergangsregelung nicht ange wendet.<br />
Zum 01. Oktober 2013 endete diese Übergangsregelung<br />
– Unternehmer die regelmäßig Waren an Unternehmer<br />
mit Ansässigkeit im EU-Ausland verkaufen sollten<br />
daher aktiv werden und sich über die praktischen<br />
Auswirkungen dieser Regelung informieren und sich<br />
entsprechend vorbereiten.<br />
Die Gelangensbestätigung kann dabei grundsätzlich in<br />
jeder die erforderlichen Angaben enthaltenden Form<br />
erbracht werden; sie kann auch aus mehreren Dokumenten<br />
bestehen, aus denen sich die geforderten Angaben<br />
insgesamt ergeben. Folgende Angaben sind ab<br />
dem 01. Oktober jedoch zwingend erforderlich:<br />
• Namen und Anschrift des Abnehmers (= Unternehmen<br />
im EU-Ausland)<br />
• Wie bei jeder normalen Rechnung auch die handelsübliche<br />
Bezeichnung und die Menge der gelieferten<br />
Ware. Bei Fahrzeugen im Sinn des § 1b Abs. 2 UStG<br />
erwartet das Finanzamt zusätzlich die Angabe der<br />
Fahrzeug-Identifikationsnummer.<br />
17
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
• Es muss der Ort und der Monat des Erhalts der Ware<br />
schriftlich festgehalten werden.<br />
• Bei Abholung der Ware durch den Abnehmer, muss dieser<br />
nachträglich bestätigen, dass die Ware tatsächlich<br />
ins EU-Ausland gelangt ist.<br />
• Das Datum der Ausstellung der Gelangensbestätigung<br />
oder der anderen Nachweispapiere.<br />
• Die Unterschrift des Abnehmers. Bei elektronischer<br />
Übermittlung ist keine Unterschrift erforderlich, wenn<br />
der Abnehmer aus den anderen Papieren zu entnehmen<br />
ist. Die Unterschrift des Abnehmers kann auch<br />
von einem von dem Abnehmer Beauftragten oder von<br />
einem zur Vertretung des Abnehmers Berechtigten<br />
geleistet werden. Dies kann z. B. ein Arbeitnehmer<br />
des Abnehmers sein, ein selbständiger Lagerhalter,<br />
der für den Abnehmer die Ware entgegen nimmt, ein<br />
anderer Unternehmer, der mit der Warenannahme<br />
beauftragt wurde, oder in einem Reihengeschäft der<br />
tatsächliche (letzte) Abnehmer am Ende der Lieferkette.<br />
Sofern an der Vertretungsberechtigung für das<br />
Leisten der Unterschrift des Abnehmers im konkreten<br />
Einzelfall Zweifel bestehen, ist der Nachweis der<br />
Vertretungsberechtigung zu führen (dies gilt nicht,<br />
wenn die Gelangensbestätigung neben der Unterschrift<br />
auch einen Firmenstempel des Abnehmers<br />
enthält). Dieser kann sich aus anderen Unterlagen,<br />
die dem liefernden Unternehmer vorliegen, ergeben<br />
(z. B. aus dem Lieferauftrag bzw. Bestellvorgang).<br />
In der am 22. März 2013 verabschiedeten „Elften Verordnung<br />
zur Änderung der Umsatzsteuer-Durchführungsverordnung“<br />
(BR-Drs. 66/13 vom 04. 02. 2013)<br />
finden sich drei grundlegende Aussagen zur Gelangensbestätigung,<br />
die Unternehmer bei ihren Vorbereitungen<br />
unbedingt beachten sollten:<br />
Wahlrecht: Der Nachweis, dass die Ware bei der innergemeinschaftlichen<br />
Lieferung tatsächlich ins EU-Ausland<br />
gelangt ist, „kann“ durch die Gelangensbestätigung<br />
nachgewiesen werden. Es dürfen jedoch auch alternative<br />
Nachweismöglichkeiten gewählt werden. Der<br />
Nachweis muss also nicht zwingend durch die Gelangensbestätigung<br />
erbracht werden, sondern kann auch<br />
anhand anderer Unterlagen erfolgen. Es empfiehlt sich<br />
jedoch die Verwendung der Gelangesbestätigung nach<br />
Muster der Finanzverwaltung (abrufbar z. B. im Internet<br />
bei IHK Rhein-Neckar, Ihr Steuerberater ist sicher<br />
gerne behilflich), da sämtliche erforderlichen Vorgaben<br />
dort berücksichtigt werden. Welche Alternativen möglich<br />
sind hängt davon ab, ob die Ware bei einer innergemeinschaftlichen<br />
Lieferung befördert oder versendet<br />
wird (siehe unten).<br />
Starttermin: Die neuen Nachweisregelungen zur Gelangensbestätigung<br />
sind grundsätzlich ab 1. Oktober<br />
2013 anzuwenden. Bis zum 31. Dezember 2013 wird es<br />
jedoch nicht beanstandet, wenn die Buch- und Belegnachweise<br />
nach der bis Ende 2011 gültigen Rechtslage<br />
erbracht werden. (vgl. BMF vom 16. 09. 2013, IVD3-<br />
S7141/13/10001).<br />
Liefervariante: Ob die Gelangensbestätigung zum Einsatz<br />
kommt oder andere Nachweismöglichkeiten hängt<br />
davon ab, ob die Ware ins Ausland befördert oder versendet<br />
wird. Denkbar sind bei der Beförderung die Eigenbeförderung<br />
und die Abholfahrt sowie bei der Versendung<br />
die Warenbewegung durch einen Kurier, durch<br />
eine Spedition oder durch die Post.<br />
Bei der Eigenbeförderung (z. B. mit firmeneigenen Lkw)<br />
empfiehlt sich die Verwendung des Musters der Gelangensbestätigung<br />
der Finanzverwaltung. Die Unterzeichnung<br />
der Gelangensbestätigung durch den Abnehmer<br />
sollte dann vor Herausgabe der Ware zur Bedingung gemacht<br />
werden.<br />
Auch im Fall der Selbstabholung der Ware durch den<br />
Abnehmer sollte die Gelangensbestätigung nach amtlichem<br />
Muster verwendet werden – natürlich darf die<br />
Gelangensbestätigung auch erst am Ende der Abholfahrt<br />
ausgestellt werden. An dieser Stelle sei darauf<br />
hingewiesen, dass in solchen Abholfällen seit jeher besondere<br />
Sorgfaltspflichten gelten, welche durch die Gelangensbestätigung<br />
nicht außer Kraft gesetzt sind (hierzu<br />
jüngst BFH Urteil vom 14. 12. 2012 – XI R 17/12,<br />
Vertrauensschutz bei fehlerhaftem Identitätsnachweis).<br />
Bei der Versendung der Ware als innergemeinschaftliche<br />
Lieferung durch eine Spedition – egal ob vom Lieferanten<br />
oder vom Abnehmer beauftragt – kommen als<br />
Alternative zur Gelangensbestätigung auch folgende<br />
Nachweise in Betracht:<br />
• Frachtbrief: Es genügt als Nachweis für die Umsatzsteuerfreiheit<br />
der innergemeinschaftlichen Lieferung<br />
der handelsrechtliche Frachtbrief (§ 17a Abs. 3 Satz 1<br />
Nr. 1a UStDV i.d.F. ab 01. 10. 2013).<br />
• Konnossement: Der Nachweis kann auch durch ein<br />
Konnossement oder durch Doppelstücke des Frachtbriefs<br />
oder den Konnossements erbracht werden.<br />
Hinweis: Der Frachtbrief oder das Konnossement müssen<br />
die Unterschriften des deutschen Unternehmers und<br />
die Empfangsbestätigung des Abnehmers enthalten.<br />
18
Steuern<br />
Die Unterschrift des Spediteurs ist nicht nötig. Ist der Versendungsbeleg ein Frachtbrief<br />
(z. B. CMR-Frachtbrief), muss dieser vom Absender als Auftraggeber des Frachtführers,<br />
also dem Versender des Liefergegenstands, unterzeichnet sein (beim CMR-<br />
Frachtbrief in Feld 22).<br />
• Der Nachweis, dass die Ware ins EU-Ausland gelangt ist, kann auch durch eine<br />
Bescheinigung des Spediteurs erfolgen (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1b UStDV i.d.F. ab<br />
01. 10. 2013).<br />
Bei Einschaltung eines Kurierdienstleisters kommen anstatt der Gelangensbestätigung<br />
als Nachweis folgende Unterlagen in Betracht (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr. 1c UStDV<br />
i.d.F. ab 01. 10. 2013):<br />
• Vorlage der schriftlichen oder elektronischen Auftragserteilung des Kuriers und<br />
• Protokoll des Kurierdienstleisters, das den Transport bis zur Ablieferung beim Kunden<br />
im EU-Ausland lückenlos dokumentiert (sog. Tracking-and-Tracing-Protokoll).<br />
/ Anzeige /<br />
ARAG Aktiv-Rechtsschutz –<br />
Premium für Selbstständige<br />
Schützen Sie Ihr Recht als Unternehmer!<br />
Mit dem ARAG Aktiv-Rechtsschutz für Selbstständige „Premium“ erhalten Sie<br />
umfangreiche Leistungen und profitieren vom ausgezeichneten Service der ARAG.<br />
Unser Versicherungsschutz greift im Wettbewerbsrecht auch bei Abmahnungen –<br />
sowohl zur Abwehr als auch für die Geltendmachung von Schadenersatzund<br />
Unter lassungs an sprüchen (§ 28p (4) ARB2013).<br />
Wir beraten Sie gerne persönlich.<br />
19<br />
Sonderkonditionen für NEM-Mitglieder<br />
Ansprechpartner: Generalagent Wolfgang Dey | Telefon: 0172 - 3 11 61 02 | E-Mail: Wolfgang.Dey@ARAG-partner.de
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Nachweisführung zur innergemeinschaftlichen Lieferung bei Versendung durch<br />
Postdienstleister<br />
• Bei Postsendungen an Kunden im EU-Ausland würde die Gelangensbestätigung<br />
nicht zum gewünschten Ziel führen. Bei der Versendung der Ware über einen Postdienstleister<br />
kommt folgende Nachweisführung in Betracht (§ 17a Abs. 3 Satz 1 Nr.<br />
1d UStDV i.d.F. ab 01. 10. 2013):<br />
• Empfangsbescheinigung des Postdienstleisters über die Entgegennahme der an<br />
den Abnehmer adressierten Postsendung und<br />
• Nachweis über die Bezahlung der Lieferung.<br />
Es genügt bei Versendung als innergemeinschaftliche Lieferung durch einen Postdienstleister<br />
jedoch auch, wenn wie bei Versendung durch einen Kurier die Auftragserteilung<br />
und das Tracking-and-Tracing-Protokoll als Nachweis aufbewahrt werden.<br />
Praxishinweis: Die Gelangensbestätigung kann auch als sogenannte Sammelbestätigung<br />
ausgestellt werden. In der Sammelbestätigung können Umsätze aus bis zu<br />
einem Quartal zusammengefasst werden. Die Sammelbestätigung nach einem Quartal<br />
ist auch bei der Pflicht zur monatlichen Abgabe von Umsatzsteuer-Voranmeldungen<br />
zulässig.<br />
Beispiel:<br />
Der liefernde Unternehmer hat mit einem Kunden eine ständige Geschäftsbeziehung<br />
und liefert in den Monaten Juli bis September Waren, über die in insgesamt 150 Rechnungen<br />
abgerechnet wird. Der Kunde kann in einer einzigen Gelangensbestätigung<br />
den Erhalt der Waren unter Bezugnahme auf die jeweiligen Rechnungsnummern hinweisen.<br />
Als Zeitpunkt des Warenerhalts kann der jeweilige Monat angegeben werden.<br />
Die Unternehmensführung sollte in den nächsten Wochen klären, für welche<br />
Kunden die Gelangensbestätigung oder eine andere Nachweisführung ab dem<br />
1. Oktober 2013 am meisten geeignet ist.<br />
Günter Heenen<br />
Dipl.-Kfm., Dipl.-Hdl.<br />
Günter Heenen,<br />
Steuer berater<br />
und Fachberater<br />
für internationa les<br />
Steuerrecht,<br />
NeD Tax Kanzlei<br />
Günter Heenen<br />
Carsten Stritzel<br />
Dipl.-Oec., Steuerberater<br />
Grenzüberschreitende<br />
Steuerberatung<br />
Ganz ohne Komplikationen dürfte die Umstellung des Nachweisverfahrens nicht vonstattengehen.<br />
Denn die Regelung zur Gelangensbestätigung ist – kaum verwunderlich<br />
– eine rein deutsche Maßnahme und viele unternehmerische Kunden im EU-<br />
Ausland dürften wenig Verständnis dafür aufbringen, Zusatzarbeiten aufgebürdet zu<br />
bekommen. Um bei diesen Kunden ein Einsehen zu bewirken, empfiehlt es sich daher,<br />
die entsprechenden Konsequenzen bei fehlender Gelangesbestätigung darzulegen,<br />
nämlich, dass ansonsten deutsche Umsatzsteuer für die Warenlieferung in Rechnung<br />
gestellt werden muss. Die Vorsteuer würde der EU-Unternehmer dann nur im<br />
Wege des sogenannten Vorsteuervergütungsverfahren wieder erstattet bekommen -<br />
und dieser Erstattungsweg ist für den Kunden in der Regel (zeit-) aufwändig und führt<br />
bis zur Erstattung unter Umständen zu Liquiditätsengpässen.<br />
Tipp: Weigert sich ein EU-Kunde also, das Gelangen der Ware ins EU-Ausland zu bestätigen,<br />
könnte das Darlegen des geschilderten Szenarios – Ausweis Umsatzsteuer<br />
in Rechnung und Vorsteuervergütungsverfahren – zu einer Akzeptanz der Gelangensbestätigung<br />
beim EU-Kunden führen. Um diese Schwierigkeiten nicht erst ab dem<br />
1. Januar 2014 zu bekommen, empfiehlt es sich dringend, bereits heute aktiv zu<br />
werden und die Vorkehrungen für die Gelangensbestätigung oder die alternativen<br />
Nachweisführungen anzugehen. Dies kann zum Beispiel auch die rechtzeitige Information<br />
von Geschäftspartnern im Ausland in Form eines kurzen Formschreibens<br />
einschließen um etwaige Fragen im Vorfeld erörtern zu können. Auch sollte eine<br />
Rücksprache mit Ihrem steuerlichen Berater erfolgen, um die getroffenen bzw. beschlossenen<br />
Maßnahmen rechtssicher beurteilen zu lassen.<br />
20
Ernährung / Prävention Ernährung<br />
Das Burn-out-<br />
Syndrom –<br />
wenn die Lichter<br />
ausgehen –<br />
Energiewende<br />
auf Zellebene<br />
gefordert!<br />
Die Energiewende ist deutschlandweit in aller Munde. Jede Firma,<br />
jede Behörde, jede Fabrik muss sich darum kümmern, dass jederzeit<br />
genug Energie zur Verfügung steht – und zwar genau dort,<br />
wo sie gebraucht wird! Dabei sollte das teure Gut Energie so nachhaltig<br />
und sparsam wie möglich gewonnen und verteilt werden.<br />
Wird die Energiewende hin zu mehr regenerativen Energien nicht<br />
gut geplant und durchgeführt, dann wird es zu Stromausfällen kommen,<br />
viel gefürchtet und von Kritikern oft vorhergesagt: Die Lichter<br />
werden ausgehen, die Fabriken stillstehen, nichts geht dann mehr.<br />
Wer derzeit in Fragen der Energieversorgung mitentscheidet, kommt schnell<br />
auf die Idee, sich Systeme genauer anzusehen, die schon lange eine optimierte<br />
und nachhaltige Energieversorgung praktizieren. Auf diese Weise kann man lernen,<br />
wie solch funktionierende Netze und erfolgreiche Transportmöglichkeiten funktionieren.<br />
Und diese gut erprobten Abläufe können – nach einer geeigneten Anpassung – auf<br />
die eigene Energieversorgung übertragen werden. Ebenso kann man aus Pannen und<br />
Fehlfunktionen solcher Systeme seine Schlüsse ziehen und gegebenen falls deren Notfallund<br />
Reparaturmaßnahmen übernehmen.<br />
21
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Körperzellen sind energieoptimiert<br />
Körperzellen und -organe sind solche Systeme, die ihre<br />
Energieversorgung schon seit Jahrtausenden optimiert haben.<br />
Die Evolution hat dafür gesorgt, dass fast jede Zelle<br />
ihre eigenen „Energiekraftwerke“ hat: die Mitochondrien.<br />
Sie bilden stetig energiereiche Moleküle, das sogenannte<br />
Adenosintriphosphat, kurz ATP, das universell überall in<br />
der Zelle als Energielieferant verwertbar ist. Bei seiner Nutzung<br />
wird ATP gespalten und seine Spaltprodukte können<br />
später in den Mitochondrien wiederum zu energiereichem<br />
ATP zusammengefügt werden. Die Menge ATP, die jeder<br />
Mensch auf diese Weise täglich ab- und wieder aufbaut,<br />
beträgt in etwa der seines Körpergewichtes! Weil ATP direkt<br />
in der Zelle produziert wird, sind die Wege zum Ort der<br />
Energienutzung immer sehr kurz, daher stellt die Kurzlebigkeit<br />
des Zellenergie-Trägers in der Praxis keine Schwierigkeit<br />
dar.<br />
Wenn jedoch etwas in den Mitochondrien schiefläuft,<br />
dann hat das natürlich Auswirkungen auf die Energiebereitstellung.<br />
Die optimale Versorgung mit Energie wird<br />
dann nicht mehr erreicht. Die Zelle sucht und findet<br />
Alternativ-Lösungen, die jedoch den Bedarf an ATP in der<br />
Zelle nur unzureichend decken können. Die Folgen sind<br />
klar: Der Stoffwechsel verlangsamt sich. Die Zelle konzentriert<br />
sich auf ihre lebenserhaltenden Vorgänge, andere<br />
müssen „warten“. Es entstehen Stoffe, die sich in den<br />
Zellen sonst nicht in dem Ausmaß bilden. Die Zellen<br />
können diese nicht rechtzeitig entsorgen, daher sammeln<br />
sie sich an. Die Langzeitfolgen sind vorhersehbar, wie auch<br />
bei der Energie wende in der realen politisch-wirtschaftlichen<br />
Welt: Nichts geht mehr – Burn-out!<br />
Burn-out ist mehr als der psychische Knock-out<br />
Alle wissen: Burn-out ist ein sehr aktuelles Problem in unserer<br />
Gesellschaft. Es gibt kaum eine Firma oder Behörde,<br />
die nicht Ausfälle von Mitarbeitern wegen Burn-out kennt.<br />
Früher waren es vor allem die Manager, die „ausgebrannt“<br />
waren. Man stellte sich damals den typischen Börsenmakler<br />
vor, der ständig unter Strom stand, mit mehreren Telefonen<br />
und Computern gleichzeitig hantierte und wichtige,<br />
folgenschwere Entscheidungen zu treffen hatte. Das Bild<br />
hat sich gründlich gewandelt. Heute weiß man, dass jeder,<br />
vom Chef bis zum kleinen Angestellten, vom Burn-out betroffen<br />
sein kann. Jeder zweite Arbeitnehmer fühlt sich<br />
gestresst, jeder fünfte überfordert. Burn-out, Depression<br />
und Angstzustände waren 2011 für 73.200 Menschen der<br />
Grund vorzeitig in Rente zu gehen. Insgesamt 53 Millionen<br />
Krankheitstage waren 2012 psychischen Störungen geschuldet<br />
1 . Damit steht psychosozialer Stress als Auslöser<br />
für Burn-out fest. Doch ist das alles? Sind die Ursachen für<br />
Burn-out wirklich ausschließlich in der Psyche, dem Gehirn<br />
und in den Lebenseinstellungen des Betroffenen zu finden?<br />
Definitiv nicht! Burn-out ist auch eine körperliche Erkrankung.<br />
Burn-out ist sogar im Labor messbar. Werden die<br />
körperlichen Ursachen beseitigt, dann können sich Burnout-Patienten<br />
meist sehr schnell wieder in ihren (Berufs-)<br />
Alltag integrieren und gleichzeitig erfolgreich an der psychischen<br />
Seite der Erkrankung arbeiten. Oder noch besser:<br />
Wer um die körperliche Seite der Erkrankung weiß,<br />
kann gezielt vorbeugen und den Burn-out verhindern.<br />
Gerade für Firmen ist dieses Wissen bares Geld wert, denn<br />
mit den richtigen Maßnahmen ist es möglich, lange Krankheitsausfälle<br />
von Mitarbeitern frühzeitig abzuwenden.<br />
Die Lösung ist in den Mitochondrien zu finden<br />
Der Weg zu Prävention und Behandlung von Burn-out läuft<br />
demnach natürlich über die Mitochondrien der Betroffenen.<br />
Ein Neuer Zweig der Medizin hat sich diesem Weg<br />
verschrieben: die Regenerative Mitochondrien-Medizin<br />
(RMM). Sie sucht an erster Stelle durch gezielte Laboranalysen,<br />
wo bei einem – aktuell oder präventiv – von Burnout<br />
Betroffenen die Schwachstelle des Energiesystems<br />
steckt. Häufig spielen dabei (vergangene) Infektionen<br />
( z. B. Borreliose) oder/und unterschwellige Entzündungen<br />
1 Lohmann-Haislah: Stressreport Deutschland 2012. Psychische Anforderungen, Ressourcen und Befinden. 1. Auflage.<br />
Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, 2012.<br />
2 Kuklinski, B.: „Das HWS-Trauma“, Aurum-Verlag, Bielefeld, 2006.<br />
3 Gröber, U.: „Arzneimittel und Mikronährstoffe“, Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft Stuttgart, 2. Auflage 2012,<br />
S. 53 bis 90.<br />
4 Seminar „Klinische Mitochondrien- und Umweltmedizin“ Fortbildungsveranstaltung für Ärzte<br />
und Therapeuten sowie Studierende an der Viadrina 2012 und 2013; siehe auch www.mito-medizin.de.<br />
22
Ernährung / Prävention<br />
(z. B. im Darm) eine Rolle, die in der Schulmedizin bis dato<br />
keine Beachtung finden. Auch psychische und körperliche<br />
Traumata (insb. HWS 2 ) können eine wichtige Rolle spielen.<br />
Alle diese Störeinflüsse wirken sich langfristig über oxidativen<br />
und nitrosativen Stress schädigend auf die Mitochondrien<br />
der Betroffenen aus.<br />
Ebenso ohne Behandlung durch die herkömmliche Medizin<br />
bleiben Belastungen mit Umweltgiften (Schwermetalle,<br />
organische Stoffe, etc.), die leicht in die Mitochondrien<br />
eindringen und dort zu Fehlfunktionen führen können.<br />
Gesunde können diese schädlichen Stoffe meist gut entgiften.<br />
Menschen mit Mitochondrien-Schäden (sogenannte<br />
sekundäre Mitochondriopathien) hingegen zeigen häufig<br />
ungünstige Variationen (Polymorphismen) in ihren Entgiftungsenzymen,<br />
sodass dieselben Umweltgifte bei ihnen<br />
mehr Schäden anrichten können. Hinzu kommen bestimmte<br />
alltägliche Gewohnheiten: Rauchen, Alkohol, Ernährung<br />
sowie Bewegung und Entspannung haben alle<br />
großen Einfluss auf die Gesundheit der Mitochondrien.<br />
Nicht vergessen werden dürfen auch die in vielen Fällen<br />
negativen Auswirkungen von Medikamenten auf die Mitochondrien<br />
(insb. Antibiotika, Chemotherapeutika u. a.) 3 .<br />
Weiterhin ist das Verdauungssystem ein zentraler Punkt<br />
für die Mitochondrien: Die durch die westliche Ernährungsweise<br />
leider sehr häufigen Fehlbesiedelungen in<br />
Dünn- und Dickdarm führen nicht selten zu Nährstoff-<br />
Defiziten, die langfristig auch die Mitochondrien treffen.<br />
Die RMM begegnet all diesen schädlichen Einflüssen<br />
durch eine spezielle Therapien-Kombination, die individuell<br />
auf die Patienten ausgerichtet wird.<br />
Wie therapiert die Regenerative Mitochondrien-<br />
Medizin?<br />
Die richtigen Mikronährstoffe spielen eine zentrale Rolle in<br />
der RMM. Durch oben genannte Störungen kommt es bei<br />
den Betroffenen zu einer mangelhaften Versorgung mit<br />
Nährstoffen und gleichzeitig zu einem erhöhten Bedarf<br />
daran. Um diese Situation zu entschärfen, empfiehlt es<br />
sich – insbesondere bei akuten Fällen des Burn-outs – zuerst<br />
über Mikronährstoff-Infusionen die Situation unter<br />
Umgehung des Darmes zu verbessern. Eine Darmsanierung<br />
sollte parallel dazu gestartet werden, damit sich so<br />
ein mög licher Entzündungsherd im Darm beruhigen kann,<br />
eine normale Nährstoffversorgung in absehbarer Zeit wieder<br />
möglich wird und dann auch ggf. auf eine orale Einnahme<br />
der benötigten Mikronährstoffe gewechselt werden kann.<br />
Entgiftungskuren mit Komplexbildnern und/oder Algen<br />
(Chlo rella) zur Entgiftungsunterstützung und stoffliche Hilfen<br />
mit Antioxidantien und Co. gehören ebenso zur RMM,<br />
wenn entsprechende Belastungen nachweisbar sind. Weiterhin<br />
ist die Versorgung mit gesunden Ölen (viel Omega-<br />
3-Fettsäuren) sehr zu empfehlen und eine individuelle Ernährungsumstellung<br />
auf ballaststoffreiche Kost mit viel<br />
Gemüse. Ein besonderer Blick sollte bei der Ernährung unbedingt<br />
in Richtung der Unverträglichkeiten von Nahrungsmitteln<br />
gehen. Diese sind viel häufiger als gemeinhin angenommen.<br />
Dass der spezielle Zucker aus Milch und Milchprodukten<br />
(Laktose) oft ein Problem ist, das ist in Deutschland<br />
inzwischen weitgehend anerkannt. Auch die Zöliakie<br />
als Reaktion gegen das Klebeeiweiß (Gluten) der gängigen<br />
Getreidearten ist als Krankheit etabliert. Doch die Unverträglichkeiten<br />
gegen Fruchtzucker (Fruktose), den Zuckeraustauschstoff<br />
Sorbit, und/oder andere Unverträglichkeiten<br />
gegen Getreide oder weitere Nahrungsmittel sind nicht<br />
so leicht zu ermitteln und auch die Akzeptanz dafür ist bei<br />
Ärzten und Patienten bisher eher schlecht. Dabei sind diese<br />
Unverträglichkeiten und das Meiden der entsprechenden<br />
Lebensmittel ein wichtiger Schlüssel zur Gesundung<br />
eines kranken Darmes. Weitere energieliefernde oder entlastende<br />
Therapien (Laser, Infrarot-Sauna, IHHT, spezielle<br />
Phytotherapie, ganzheitliche Zahnmedizin, antientzündliche<br />
Therapien u. a.) komplettieren das Portfolio der RMM 4 .<br />
So gelingt es die Mitochondrien der Betroffenen zur Regeneration<br />
anzuregen und eine Energiewende zurück zum<br />
optimalen System in den Zellen einzuleiten. Der ganze<br />
Mensch wird wieder besser mit Energie versorgt und<br />
kommt zu Kräften. Vielen Patienten geht es sogar nach der<br />
Behandlung besser als jemals zuvor.<br />
Erst der Körper dann die Psyche<br />
Bei all den Erfolgen auf körperlicher Ebene sollte man<br />
die psychische Seite des Burn-outs keinesfalls vergessen!<br />
Wer sich ständig selbst überfordert, den unbarmherzigen<br />
Perfektionismus auf seine Fahnen geschrieben<br />
hat, es immer allen recht machen will und nicht mal<br />
schaut, ob er denn seine eigenen Bedürfnisse wirklich erfüllt<br />
bekommt, der wird auch nach einer Mitochondrien-<br />
Therapie Gefahr laufen, erneut in die Burn-out-Falle zu geraten.<br />
So kann der Schritt danach nur heißen, mit neugewonnener<br />
Kraft seine bisherige Lebensweise (selbst-)<br />
kritisch unter die Lupe zu nehmen und geeignete Maßnahmen<br />
einzuleiten, um falsche Verhaltensweisen zu verändern<br />
– am besten geschieht dies natürlich unter fachkundiger<br />
Anleitung. Daher gehört zu einer guten RMM-Therapie<br />
des Burn-out immer auch das Angebot der Psychotherapie.<br />
Denn die RMM gehört im besten Sinne des Begriffes<br />
zu den ganzheitlichen Therapien! Sie macht es damit möglich,<br />
dass Burn-out bald ein Problem von gestern sein wird.<br />
Dr. med. Rainer Mutschler,<br />
M.A.<br />
Centrum für integrative<br />
Me dizin (CFI), Speyer, und<br />
Leiter des Ausbildungsganges<br />
„Klinische Mito chondrienund<br />
Umweltmedizin“<br />
an der Viadrina, Fachlicher<br />
Beirat des NEM e. V.<br />
• www.cfi-speyer.de<br />
• www.mito-medizin.de<br />
23
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Firmicuten: Die Dickmacher<br />
unter den Darmbakterien –<br />
Störungen der Darmflora<br />
in Verbindung mit krankhaftem<br />
Übergewicht<br />
Übergewicht und Fettleibigkeit können eine mikrobielle Ursache<br />
haben. So kann eine falsch zusammengesetzte Darmflora zusätz liche<br />
Kalorien aus Ballaststoffen produzieren.<br />
Sicher hat der ein oder andere von Ihnen<br />
diese Gedanken mit ein wenig Neid auch<br />
schon mal im Kopf gehabt: „Der kann ja essen was er<br />
will – und nimmt einfach kein Gramm zu!“ Gleichzeitig<br />
fragt man sich dann, warum es so vielen Menschen<br />
genau anders ergeht. Sie quälen sich mit Zurückhaltung<br />
und das Gewicht will trotzdem nicht weichen. Jede kleine<br />
Sünde findet ihren Weg und landet schließlich als<br />
hartnäckige Fettpolster auf den Hüften. Dort machen<br />
sie sich es gemütlich und bleiben. Naja, sagt man sich<br />
dann, der eine kann es eben besser verwerten und der<br />
andere schlechter. „Ach und die Gene sind sowieso<br />
schuld daran, da kann man einfach nichts machen“ –<br />
es klingt nach einem naivem Spruch, an dem – nach<br />
neuesten Forschungen – aber mehr dran sein könnte,<br />
als bisher vermutet wurde.<br />
Der Amerikaner Jeffrey Gordon und sein Team von der<br />
Washington University School of Medicine aus St. Louis,<br />
haben im Wissenschaftsmagazin Nature im Jahre 2004<br />
Ergebnisse vorgelegt, die allen bisherigen Konzepten<br />
über die Entstehung der Fettleibigkeit einen Umschwung<br />
geben könnten. Sie konnten im Tierversuch an Mäusen<br />
und später auch an der menschlichen Darmflora einen<br />
eindeutigen Zusammenhang von Fettleibigkeit und bestimmten<br />
Darmflorastörungen feststellen.<br />
Während wir mit unseren „schuldigen Genen“ selbstverständlich<br />
unsere Erbanlagen meinen, zeigte Gordon<br />
mit seiner Studie, dass unsere vielfältigen bakteriellen<br />
Mitbewohner eine entscheidende Rolle spielen. Jener<br />
buchstäblich Milliarden von Mikroben nämlich, die unser<br />
Verdauungssystem besiedeln.<br />
Die menschliche Mikrobiota<br />
Forscher gehen davon aus, dass im Darm ca. 100 Billionen<br />
Bakterien leben, die sich auf 500 bis 1000 Bakterienarten<br />
verteilen. Die Darmflora ist nur in sehr<br />
geringem Ausmaß erforscht. Bekannt ist, dass die<br />
Darmbakterien eine wichtige Funktion in der Immunabwehr,<br />
Produktion von Vitaminen und auch in der<br />
Krebsprävention einnehmen. In der modernen Naturheilkunde<br />
wird daher in Therapie und Prävention großen<br />
Wert auf eine gesunde Darmflora gelegt. Laboruntersuchungen<br />
geben Aufschluß über den jeweiligen<br />
Bakterienstatus. Abweichungen können gut mit Probiotika<br />
(= Gabe von lebenswichtigen Darmbakterien,<br />
z. B. Laktobazillen) behandelt werden.<br />
Neu ist die Untersuchung des Verhältnisses von Firmicuten<br />
zu Bakteriodetes bei der Therapie von Adipositas<br />
(krankhaftes Übergewicht). Die Firmicuten sind<br />
eine Gruppe von ca. 270 Bakterienarten, die in der<br />
Lage sind, aus Ballaststoffen Kalorien herzustellen.<br />
Die Bakteriodetes sind sogenannte „physiologische“,<br />
also „gute“ Darmbakterien, die die schädlichen Auswirkungen<br />
der Firmicuten verhindern können.<br />
24
Ernährung / Prävention<br />
Was bedeutet das für die Patienten im Alltag? Es bedeutet,<br />
dass Patienten mit einem hohen Firmicutenanteil<br />
auch aus Lebensmitteln, die im allgemeinen als gesund<br />
bezeichnet werden, wie z. B. Obst und Gemüse sowie<br />
Vollkornprodukte, überdurchschnittlich viel Kalorien herstellen<br />
können. Eine Ernährungstherapie, wie sie<br />
übli ch e r weise bei Fettleibigkeit verordnet wird, kann<br />
daher häufig an den unsichtbaren Mitbewohnern im<br />
Darm scheitern. Diese Begebenheit läßt die Betroffenen<br />
oft verzweifeln. So wurden Therapien häufig mit<br />
dem Ergebnis beendet, da sie ja eh (scheinbar) nichts<br />
brachten.<br />
Seit der Entdeckung der Firmicuten, ist es deshalb<br />
auch ratsam, grundsätzlich in der Therapie von Übergewicht<br />
und seiner Folgeerkrankungen, z. B. auch Diabetes<br />
Typ II (Altersdiabetes), die Diagnose und ggf. Therapie<br />
der Darmflora, mit zu berücksichtigen.<br />
Die Diagnose von Darmflorastörungen beinhaltet – neben<br />
einem Anamnesegespräch – in jedem Fall auch<br />
ei nen ausführlichen Kyberstatus (Darstellung der wich -<br />
t i gsten Leitkeime), sowie Entzündungsmarker, ggf. noch<br />
Funktionsmarker für die Bauchspeicheldrüse und Leber/Galle.<br />
Zudem sollte auch das Verhältnis der Fir -<br />
micuten zu den Bakteriodetesbakterien ermittelt werden.<br />
Ein erhöhtes Verhältnis, wie bei der o. g. Patientin, zeigt,<br />
dass eine Milieustörung vorliegt. Ein „Ausmerzen“<br />
der schlechten Firmicuten wäre – naturheilkundlich betrachtet<br />
– nur ein bloßes „Herumdoktern“ an den Symptomen.<br />
Wichtig ist hier eine ganzheitliche Therapie, die<br />
fallweise eine gründliche Darmreinigung (z. B. mit Colon-Hydro-Therapie),<br />
die Gabe hochwertiger Pro biotika,<br />
eine individuelle Ernährungstherapie sowie ggf. darmschleimhautaufbauende<br />
Maßnahmen beinhalten sollte.<br />
Seit den Veröffentlichungen von Gordon konnte mehrfach<br />
gezeigt werden, dass eine bestimmte Gruppe<br />
von Darmbakterien, die Firmicuten, bei einem Teil von<br />
fettleibigen Menschen zu hoch ist. Diese Gruppe von<br />
Mikroben sind in der Lage, sogar aus Ballaststoffen<br />
Kalorien herzustellen.<br />
25
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
26
Anzeige /<br />
Um den therapeutischen Effekt so effektiv wie möglich zu gestalten,<br />
sollten die Probiotika möglichst hochdosiert sein. Bewährt haben<br />
sich in unseren Praxen, die Gabe von Breitbandprobiotika, die mindestens<br />
1 Milliarde lebensfähige Keime pro Milliliter sowie eine hohe<br />
Anzahl verschiedener Bakterienstämme enthalten.<br />
Die Therapie eines gestörten Darmmilieus nimmt Zeit in Anspruch.<br />
Wir sprechen hier gerne sinnbildlich von einem Marathon und keinem<br />
Sprint. Berücksichtigt man den Bereich den man therapieren<br />
will: Denn die gesamte Fläche des Verdauungstraktes beträgt<br />
ca. 400 qm, dies entspricht in etwa der Größe eines Fußballfeldes.<br />
Schon ein Kleinkind benötigt 2 Jahre, um seine Darmflora aufzubauen<br />
und zu trainieren, ein kranker Erwachsener benötigt mindestens<br />
1 Jahr, um eine gestörte Darmflora wieder herzustellen. Das<br />
sollte der Patient wissen und auch verstehen. Darum sollte es in der<br />
Therapieplanung immer berücksichtigt werden.<br />
Wichtig finden wir, sich in der Therapie des Darmes von einem erfahrenen<br />
Therapeuten begleiten zu lassen. Alleingänge, insbesondere<br />
ohne vorherige ausreichende Diagnostik, führen in der Regel<br />
nicht zum gewünschten Erfolg.<br />
Darum sagen wir:<br />
Erst richtig diagnostizieren, dann erfolgreich therapieren!<br />
Kyra Hoffmann<br />
Heilpraktikerin und zertifizierte<br />
Cellsymbiosis-Therapeutin.<br />
Tätig in der Ausbildung von<br />
Heilpraktikern und Ärzten so wie<br />
in der Erwachsenen bildung.<br />
Fachautorin und Co-Autorin<br />
des Buches „Der Burnout Irrtum“.<br />
• www.naturheilkund l iche -<br />
medizin.de<br />
Sascha Kauffmann<br />
Heilpraktiker mit Schwerpunkt<br />
Diagnose und Therapie<br />
von Stoffwechselerkran kungen,<br />
Nahrungsmittelunverträg -<br />
lich keiten sowie Autoimmun -<br />
er krankungen. Er ist zudem<br />
auch als Referent undvFachautor<br />
tätig.<br />
• www.saschakauffmann.de<br />
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Kamillentee alleine ist noch<br />
keine Naturheilkunde<br />
und ge sunde Ernährung kein<br />
Garant für genügend Vita mine<br />
und Spuren elemente<br />
Was macht eigentlich Naturheilkunde aus?<br />
Sind Naturheilkunde und Schulmedizin<br />
überhaupt kompatibel? Um es<br />
mit den Worten der NRW<br />
Gesundheitsministerin Frau<br />
Barbara Steffens auszudrücken:<br />
„… beide Medizin richtungen<br />
sollten für den Bürger<br />
ein SOWOHL ALS<br />
AUCH sein.“<br />
Naturmedizin ist in ihrer<br />
Gesamtheit so facettenreich<br />
wie die Natur selbst. Der Mensch ist<br />
aus der Natur entstanden und benötigt daher<br />
für seine Gesunderhaltung die Natur. Bei<br />
genauerer Betrachtung eines Erkrankten,<br />
können in der Natur sehr häufig die Bestandteile<br />
gefunden werden, die zu einer Heilung notwendig<br />
sind. Das bedeutet für Therapeutinnen und Therapeuten:<br />
Ursachenfindung. Nicht das Symptom, sondern die<br />
Ursache bildet die Basis für einen Behandlungserfolg. Die gilt insbesondere für<br />
chronische Erkrankungen. Dabei kann und darf es keine Rolle spielen, ob Arzneimittel<br />
oder Nahrungsergänzungsmittel zum Einsatz kommen. Entscheidend ist,<br />
dass die notwendige Substanz zur Anwendung kommt.<br />
28
Ernährung / Prävention<br />
Daher Vorsicht bei Kombinationsmitteln! Ein Hinweis<br />
auf die Tagesmenge ist ein wichtiger Hinweis im Rahmen<br />
der Eigenverantwortung.<br />
Die Eigenverantwortung ist besonders wichtig, da die<br />
Hersteller naturheilkundlicher Mittel genau hinsehen,<br />
was auf den Beipackzetteln der Hersteller von Nahrungsergänzungsmitteln<br />
steht.<br />
Das Wissen über viele helfende Mittel aus der Natur<br />
war früher in den Familien bekannt. In der modernen<br />
Zeit ist es verloren gegangen. Nur wenige Teesorten<br />
sind in Erinnerung geblieben. Nicht selten wird Kamillentee<br />
als ein besonderer Heilsbringer angesehen.<br />
Nicht selten habe ich aber auch in meiner Praxis Patienten<br />
mit unklaren Oberbauchbeschwerden behandelt.<br />
Nach eingehender Anamnese stellte sich heraus,<br />
dass sie über Monate manche sogar über Jahre Kamillentee<br />
tranken. Nach Absetzen des Kamillenfrühstückstees<br />
und der Verordnung eines homöopathischen Mittels<br />
konnten die Beschwerden beseitigt werden.<br />
Kamillentee ist eine gute Heilpflanze und unter<br />
gegebenen Umständen anzuwenden aber nicht<br />
für den täglichen Gebrauch geeignet.<br />
Das Wissen über den Einsatz naturheilkundlicher Mittel,<br />
insbesondere über den Einsatz von Tees, ist in der<br />
Bevölkerung verloren gegangen. Eine vor einigen Jahren<br />
durchgeführte Befragung ergab, dass mehr als 80<br />
Prozent der Befragten Naturheilkunde lediglich mit<br />
Homöopathie in Verbindung brachten. Die Vielzahl von<br />
Behandlungsverfahren wie Phytotherapie, Akupunktur,<br />
Ayurveda, Bachblütentherapie, um nur einige zu nennen,<br />
sind ebenso wie eine Viel zahl manueller Verfahren, nur<br />
einer gewissen Bevölkerungsschicht<br />
bekannt.<br />
So dürfen Hersteller homöopathischer Mittel keine<br />
Indikationsangaben auf ihren Präparaten machen, was<br />
zu starken Einschränkungen im Vertrieb führt. Auf Zeit<br />
gesehen führt dies auch zu einer Reduzierung von naturheilkundlichen<br />
Therapien in der Bevölkerung. Betrachtet<br />
man den gesamten Markt naturheilkundlicher<br />
Mittel, in den auch Nahrungsergänzungsmittel mit einzubeziehen<br />
sind, ist dies eine gewollte Kampagne. Der Bevölkerung<br />
soll vermittelt werden, dass die Chemie und<br />
die angebotenen Nahrungsmittel alles zu unserer Gesunderhaltung<br />
liefern können.<br />
Weit gefehlt! Wir leben in der Medizin nicht im rein wissenschaftlichen<br />
Bereich, sondern leben aus einer Jahrhunderte<br />
bzw. Jahrtausend alten Erfahrung.<br />
Die Medizin ist ein Hybrid, die aus allen Wissenschaften<br />
und der Erfahrung profitiert. Versucht man die<br />
Wissenschaftsanteile in der Medizin in Prozent zu analysieren,<br />
dann wird man nicht weit über 5 Prozent kommen.<br />
Nun könnte man geneigt sein, dies als eine Katastrophe<br />
oder als lächerliche Behauptung abzutun,<br />
ohne sich über den Schatz der Erfahrung klar zu werden.<br />
Zu den modernen Therapieverfahren<br />
gehören auch die Nahrungsergänzungsmittel<br />
(Lebensmittelkonzentrate). Aber auch hier<br />
ist bei der Selbstverabreichung Vorsicht geboten.<br />
Nicht selten werden aufgrund von Empfehlungen<br />
Mittel doppelt und dreifach eingenommen, die durch<br />
die Addition einzelner Substanzen ungewollte Nebenwirkungen<br />
auslösen können.<br />
Es ist dringend darauf zu achten, dass die Verzehrempfehlungen,<br />
die gesetzlich geregelt sind, eingehalten<br />
werden. Bei allem, was wir verabreichen,<br />
durch Verordnung oder durch Selbstversorgung,bleibt<br />
der bekannte Satz: „Auf die Dosis kommt es an“. Ein<br />
Zuviel an Zink oder Selen, um nur zwei Beispiele zu<br />
nennen, kann bei Überdosis eine toxische Wirkung<br />
auslösen. Dies gilt es zu vermeiden.<br />
29
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Denken wir an den wertvollen Schatz der Sammlung<br />
naturheilkundlicher Mittel der Hildegard von Bingen<br />
oder an die großartigen Behandlungsmöglichkeiten<br />
mit der Akupunktur, um nur auch hier 2 Beispiele zu<br />
nennen.<br />
Durch Erfahrung konnten Wirkstoffe aus pflanzlichen<br />
Mitteln entwickelt werden, die in der Schulmedizin<br />
zum Einsatz gelangten. Auch hier 2 Beispiele: Convallaria<br />
majalis (das Maiglöckchen) oder Digitalis (der<br />
Fingerhut). Beide Mittel sind wertvolle Herzglykoside.<br />
Das Wichtigste in der Medizin sollte sein, den Schatz<br />
der Erfahrung zu nutzen und zum Wohl der Menschen<br />
zu verwenden.<br />
Gleiches gilt für unsere Lebensmittel. Hier hat die<br />
Menschheit scheinbar das Maß der Dinge überschritten.<br />
Überschritten bedeutet, durch Profitgier Veränderungen<br />
an Getreide, Gemüse und Früchten vorgenommen,<br />
mit der Folge, dass hieraus eine Versorgung mit<br />
wichtigen Vitaminen und Spurenelemente nicht mehr<br />
gewährleistet ist. Der anerkannte Vitaminforscher<br />
Dr. Dr. Karlheinz Schmidt, Professor für Experimentelle<br />
Medizin, sieht eine Kostenlawine ernährungsbedingter<br />
Krankheiten auf uns zukommen. Volkswirtschaftlich<br />
eine Katastrophe, menschlich eine Tragödie.<br />
Starben früher die Menschen meistens an Altersschwäche,<br />
so sterben sie heute an schweren chronischen<br />
Erkrankungen. Diabetes, Rheuma, Krebs, Arteriosklerose,<br />
um nur einige schwere Erkrankungen zu<br />
nennen, sind durch falsche Ernährung vorprogrammiert.<br />
Aus der Welt am Sonntag vom 18. <strong>03</strong>. 2013:<br />
Die Qualität von Obst und Gemüse hat seit 50 Jahren<br />
erheblich abgenommen. In der dort aufgeführten Tabelle<br />
wird deutlich, welches Defizit in der Aufnahme<br />
unserer täglichen Nahrung liegt:<br />
Verlust an Kupfer<br />
93 %<br />
in Kresse<br />
Magnesium<br />
75 %<br />
in Möhren<br />
Kalium in Brokkoli 75 %<br />
Eisen in Steckrüben 71 %<br />
Eisen in Spinat 60 %<br />
Phosphor<br />
47 %<br />
in Kartoffeln<br />
Verlust an Eisen<br />
67 %<br />
in Orangen<br />
Natrium in Avocados 62 %<br />
Kalzium in Erdbeeren 55 %<br />
Kalium in Passionsfrüchten<br />
43 %<br />
Kalium in Himbeeren 39 %<br />
Kalium in Rhabarber 32 %<br />
Wenn wir auch Glauben uns vollwertig zu ernähren,<br />
verhungern wir bei vollen Töpfen!<br />
30
Ernährung / Prävention<br />
Betrachtet man die Angaben über Verluste an Vitaminen<br />
in der Veröffentlichung der vorletzten Ausgabe<br />
dieser Zeitschrift, rundet sich das Bild der Verluste von<br />
wichtigen Wirkstoffen in unserer Ernährung ab.<br />
Diese Angaben tragen zum Verständnis der Entstehung<br />
zivilisationsbedingter Erkrankungen bei.<br />
Hieraus wird einmal mehr erkennbar, wie wichtig Nahrungsergänzungsmittel<br />
für den Erhalt der Gesundheit<br />
und für die Genesung erkrankter Menschen sind.<br />
Nicht nur bei der Prävention sondern auch in der Therapie<br />
haben diese Mittel einen unverzichtbaren Wert.<br />
Wenn diese Mittel erkrankten Menschen nicht erstattet<br />
werden, ist das ein nicht mehr zu vertretendes Verhalten<br />
der Krankenversicherungen.<br />
Hier gilt es über die Politik Einfluss auszuüben, eine<br />
dringend notwendige Veränderung anzumahnen.<br />
Eine Erstattung hilft den Betroffenen, aber auch der<br />
Versicherung im Rahmen der Kostensenkung.<br />
Dann muss man nicht mehr so dümmliche Erstattungsablehnungen<br />
lesen wie:<br />
Wir verstehen, dass Sie selbst für Ihre Gesundheit sorgen<br />
möchten, indem Sie Ihren Körper mit Vitaminen,<br />
Mineralien und Spurenelementen in Form von Kapseln<br />
oder Tabletten versorgen. In den meisten Fällen ist das<br />
nicht notwendig. Der Bedarf an Vitaminen, Mineralstoffen<br />
Peter Abels<br />
Heilpraktiker,<br />
Vorsitzender des EFN –<br />
European Fe der ation<br />
for Naturo pathy e.V.<br />
und Kooperationspartner<br />
des NEM e.V.<br />
und Spurenelementen kann weitgehend durch gesunde<br />
Ernährung gedeckt werden.<br />
Die Versicherung hatte vergessen aufzulisten, was der<br />
Patient denn nach ihrer Auffassung essen und trinken<br />
sollte, um den notwendigen Ausgleich zu erlangen.<br />
Es lohnt sich klare Position für unsere Gesundheit zu<br />
beziehen. Wir benötigen keine patentierten Samen.<br />
Wir benötigen Natur pur ohne das Bastelwerk von Profithaien!<br />
/ Anzeige /<br />
31
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Biotin (Vitamin B7, Vitamin H):<br />
Die wichtigsten Funktionen<br />
von Biotin<br />
Biotin unterstützt den Aufbau von Eiweiß und die Energiegewinnung<br />
aus Fett. Der Körper braucht Biotin, um die Energiefreisetzung<br />
aus Kohlenhydraten zu steuern. Biotin hilft, Haut und Schleimhäute<br />
gesund zu erhalten. Es ist für eine normale Nervenfunktion erforderlich.<br />
Biotin ist wichtig für den Fett- und<br />
Zucker stoffwechsel und ermöglicht ein<br />
optimales Zellwachstum. Biotin, das auch als Vitamin H<br />
bezeichnet wird, zählt zu den wasserlöslichen B-Vitaminen.<br />
Es wurde 1936 aus Eigelb isoliert und 1942 erzeugte<br />
man bei einer Gruppe von freiwilligen Biotinmangel,<br />
der zu Hautveränderungen, Muskelschmerzen<br />
und Depressionen führte. Nach Gabe von 150 Mikrogramm<br />
Biotin verschwanden die Symptome. Bis heute<br />
kennt man neun Enzyme, die von Biotin abhängen, und<br />
die am Eiweiß-, Fett- und Kohlenhydratstoffwechsel<br />
beteiligt sind. Rohe Eier enthalten Avidin, das die Aufnahme<br />
des Biotins verhindert. Biotin ist wichtig für das<br />
Wachstum, für die Erhaltung von Blutzellen und Nervengewebe.<br />
Wegen seiner Bedeutung für die Talgdrüsen<br />
und somit für Haut und Haare, findet man es häufig<br />
in Kosmetika. Biotin ist wirksamer, wenn es zusammen<br />
mit Vitamin B2, B6 Niacin und A aufgenommen wird.<br />
32
Ernährung / Prävention<br />
Biotin ist wichtig für die Synthese der<br />
DNS, die das Zellwachstum ermöglicht.<br />
Für Abbau und Synthese der Fettsäuren<br />
sind biotin haltige Enzyme notwendig. Beim<br />
Stoffwechsel der essenziellen Fettsäuren,<br />
z. B. der Umwandlung von Linolensäure in verschiedene<br />
Omega-3-Fettsäuren, wird Biotin gebraucht.<br />
Ein biotinhaltiges Enzym verursacht den ersten Schritt<br />
bei der Synthese von Glucose. Glucose ist nötig, um<br />
den Blutzuckerspiegel konstant zu halten und Unterzuckerung<br />
zu vermeiden.<br />
Biotin gehört zu den lebensnotwendigen<br />
(essentiellen) Vitaminen<br />
Biotin, auch als Vitamin B7 oder Vitamin H bezeichnet,<br />
ist ein wasserlösliches Vitamin aus dem B-Komplex. Es<br />
spielt als prosthetische Gruppe von Enzymen im Stoffwechsel<br />
eine bedeutende Rolle, ist aber auch im<br />
Zellkern wichtig für die epigenetische Regulation der<br />
Genfunktion.<br />
Die französische Nomenklatur benennt Biotin häufig<br />
als Vitamin B8, während sich in der angelsächsischen<br />
und auch in der deutschen Literatur die „Adenylsäure“<br />
(Adenosinmonophosphat) als Vitamin B8 findet; zuweilen<br />
werden auch das Inositol, welches kein Vitamin<br />
ist, bzw. die Folsäure, die ebenfalls dem Vitamin-B-<br />
Komplex angehört, als Vitamin B8 bezeichnet. Der von<br />
der IUPAC empfohlene Name ist jedoch einzig Biotin.<br />
Biotin gehört zu den lebensnotwendigen (essenziellen)<br />
Vita minen, die dem Körper mit der Nahrung zugeführt<br />
werden müssen. Ein Biotinmangel tritt bei gesunden<br />
Menschen mit ausgewogener Ernährung nur sehr selten<br />
auf. Der Körper braucht Biotin für eine Reihe wichtiger<br />
Stoffwechselprozesse. So ist das Vitamin Bestandteil<br />
des Fett-, Kohlenhydrat- und Eiweißstoffwechsels.<br />
Funktion im Körper<br />
Der Name Vitamin H als veraltete Bezeichnung für<br />
Bio tin leitet sich aus seiner Wirkung ab: Biotin trägt zu<br />
einem gesunden Wachstum von Haut und Haaren bei.<br />
Deswegen wird bei verschiedenen Hauterkrankungen<br />
wie zum Beispiel Akne empfohlen, zusätzlich Biotin einzunehmen.<br />
Eine zentrale Bedeutung nimmt Biotin beim Stoffwechsel<br />
der Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße als soge nan n-<br />
tes Koenzym ein. Koenzyme sind Bestandteile der Enzyme.<br />
Enzyme wiederum wirken wie Katalysatoren.<br />
Ohne sie würden bestimmte biochemische Reaktionen<br />
im Körper nicht oder nur sehr verlangsamt stattfinden.<br />
Ein Beispiel für eine solche biochemische Reaktion, an<br />
der Biotin als Koenzym mitwirkt,<br />
ist die so genannte Gluconeogenese.<br />
Bei der Gluconeogenese<br />
wird aus körpereigenen Eiweißen<br />
und Fetten Zucker (Glukose) gewonnen.<br />
Dieser Mechanismus trägt dazu<br />
bei, dass der Blutzuckerspiegel steigt. In<br />
Zeiten des Hungers verfügt der Körper<br />
über zu wenig Zucker (Kohlenhydrate).<br />
Die Gluconeogenese sorgt dafür, das<br />
Blut mit ausreichend Zucker zu versorgen.<br />
Biotin wirkt auch positiv auf die Qualität der<br />
Fingernägel. Bei Menschen mit „schlechten Fingernägeln“<br />
kann das Vitamin dazu beitragen,<br />
die Dicke und Oberflächenstruktur der Nägel<br />
und die Nagelfestigkeit zu verbessern. Weiterhin<br />
ist Biotin wichtig für das Wachstum<br />
und die Lebensdauer der Blutzellen, des<br />
Nervengewebes und der Talgdrüsen.<br />
33
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
schaft und Stillzeit gilt die gleiche Empfehlung. Für<br />
Säuglinge wird die benötigte Biotinmenge mit 5-10 μg/<br />
Tag angenommen. Die europäische RDA nennt als<br />
wünschenswerte Biotinzufuhr für gesunde Erwachsene<br />
50 μg/Tag, vor einigen Jahren wurden noch 150 μg/<br />
Tag angegeben.<br />
Der genaue Bedarf ist nicht bekannt, da es an aussagekräftigen<br />
experimentellen Studien fehlt. Das macht es<br />
notwendig, die Angaben zum Biotinbedarf auf Plau sibilitätsüberlegungen<br />
zu stützen. Bei Säuglingen wird<br />
beispielsweise der durchschnittliche Biotingehalt der<br />
Muttermilch und die tägliche Trinkmenge der Abschätzung<br />
zugrunde gelegt.<br />
Vorkommen in der Nahrung<br />
Biotin ist in sehr vielen Nahrungsmitteln enthalten, jedoch<br />
meistens nur im einstelligen Mikrogramm-Bereich.<br />
Die folgenden Beispiele geben einen Überblick<br />
und beziehen sich jeweils auf 100 g des Lebensmittels:<br />
• Trockenhefe (200μg),<br />
• Rinderleber (1<strong>03</strong> μg),<br />
• Eigelb (50 μg),<br />
• Sojabohnen (30 μg),<br />
• Haferflocken (20 μg),<br />
• Walnüsse (19 μg),<br />
• Champignons (12 μg),<br />
• ungeschälter Reis (12 μg),<br />
• Weizen-Vollkornmehl (8 μg),<br />
• Fisch (7 μg),<br />
• Spinat (6 μg),<br />
• Rind- und Schweinefleisch (5 μg),<br />
• Bananen (5 μg),<br />
• Kuhmilch (3 μg),<br />
• Äpfel (1 μg)<br />
Bakterien der Darmflora produzieren Biotin<br />
Seit den 1940er Jahren ist bekannt, dass Bakterien, die<br />
in der normalen Darmflora enthalten sind, neben anderen<br />
B-Vitaminen auch Biotin produzieren und in Abhängigkeit<br />
von der Bakterienart und der zur Verfügung<br />
stehenden Zeit ihre Umgebung in unterschiedlichem<br />
Maße damit anreichern. Eine Folge ist, dass die Ausscheidungen<br />
mehr Biotin enthalten als die zuvor konsumierte<br />
Nahrung. Es gilt als sehr wahrscheinlich, dass<br />
aus dieser Quelle stammendes Biotin in gewisser Menge<br />
vom Organismus verwertet wird, bezüglich der Höhe<br />
dieses Beitrags herrscht aber Unsicherheit.<br />
Weitere Aussagen zum Tagesbedarf<br />
Bei ausgewogener und abwechslungsreicher Ernährung,<br />
wird der tägliche Biotinbedarf in der Regel ausreichend<br />
gedeckt. Da der genaue Tagesbedarf allerdings<br />
nicht exakt bekannt ist, kann der Bedarf in Einzelfällen<br />
deutlich höher sein. Der Tagesbedarf liegt Schätzungen<br />
zufolge für Erwachsene zwischen 30 bis 60 Mikrogramm<br />
(µg) Biotin (Vitamin H) pro Tag. Grundschulkinder<br />
zwischen sieben und zehn Jahren haben einen täglichen<br />
Biotinbedarf von etwa 30 Mikrogramm. Bei<br />
Säug lingen und Kleinkindern steigt die wünschenswerte<br />
Zufuhr von anfangs 5 Mikrogramm bis auf 15 Mikrogramm<br />
Biotin pro Tag.<br />
Schwangere und stillende Mütter können einen erhöhten<br />
Biotinbedarf haben. Das gleiche gilt für Menschen,<br />
die übermäßig viel Alkohol und Nikotin konsumieren.<br />
Auf eine ausreichende Biotinzufuhr sollten außerdem<br />
Menschen achten, die sich besonders einseitig mit rohen<br />
Eiern ernähren. Wir empfehlen, auf die nachfolgend beschriebenen<br />
Mangelsymptome zu achten und bei Bedarf<br />
Biotin als Nahrungsergänzung einzunehmen.<br />
Biotinmangel<br />
Ein Biotinmangel wirkt sich auf den Kohlenhydrat-, den<br />
Eiweiß- und den Fettstoffwechsel aus. Diese Folgen resultieren<br />
vor allem aus einer Funktionseinschränkung<br />
der biotinabhängigen Carboxylasen. Das Krankheitsbild<br />
wird deshalb allgemein als multipler Carboxylasemangel<br />
bezeichnet. Neben einem eigentlichen Biotinmangel<br />
kommen aber auch Gendefekte im Bereich des<br />
Biotinstoffwechsels als Auslöser dafür infrage.<br />
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung nennt<br />
30 - 60 μg/Tag als Schätzwert für die angemessene Zufuhr<br />
bei gesunden Erwachsenen. In der Schwanger-<br />
34
Anzeige /<br />
Als Folge eines Biotinmangels wurden beim Menschen<br />
folgende Symptome beobachtet:<br />
• Hautstörungen,<br />
• Depressionen,<br />
• extreme Mattigkeit,<br />
• Schläfrigkeit,<br />
• Muskelschmerzen,<br />
• Überempfindlichkeit,<br />
• lokale Fehlempfindungen,<br />
• Halluzinationen,<br />
• Appetitlosigkeit,<br />
• Übelkeit,<br />
• Haarausfall,<br />
• Farbveränderungen der Haare,<br />
• brüchige Nägel,<br />
• erhöhte Cholesterinwerte,<br />
• abnorm hohe Spiegel an ungeradzahligen<br />
Fettsäuren,<br />
• Störungen der Herzfunktion,<br />
• Blutarmut, grau-blasse Hautfarbe,<br />
• Bewegungsstörungen (Ataxie, Hypotonie)<br />
• erhöhte Anfälligkeit für Infektionen<br />
(Kandidose, Keratokonjunktivitis, Glossitis)<br />
Bei Tieren wurden außerdem noch weitere Effekte festgestellt,<br />
wie metabolische Veränderungen und Verfettung<br />
des Herzmuskels, Fettleber, plötzlicher Tod durch<br />
Unterzuckerung bei körperlicher Belastung, Beeinträchtigung<br />
des Immunsystems und eine schlechtere<br />
Wundheilung. Bei Hühnern senkte Biotinmangel den<br />
Biotingehalt der Eier wesentlich, was zu einer verringerten<br />
Schlupfrate und häufigen Missbildungen der<br />
Küken führte, obwohl die Anzahl der gelegten Eier noch<br />
unverändert blieb. Auch bei einigen Säugetierarten<br />
wurden fruchtschädigende Wirkungen des Biotinmangels<br />
beschrieben.<br />
Mit freundlicher Genehmigung<br />
der Redaktion des www.vitalstoff-journal.de
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Zunahme an Brusttumoren –<br />
Prä vention und nicht nur<br />
Identi fikation ist das Gebot<br />
der Stunde!<br />
Weil in den westlichen Ländern eine fast schon endemische<br />
Zunahme an Brustdrüsenerkrankungen bei der Frau in<br />
den letzten 20 Jahren zu verzeichnen ist und die senologischen<br />
Ambulanzen (Senologie = Spezialgebiet für Brusterkrankungen<br />
der Frau) voller Rat suchender und verzweifelter Frauen sind,<br />
soll mit dem Artikel ein Problem angesprochen werden,<br />
dass nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ein Umdenken<br />
er fordert resp. zum Nachdenken auffordert. Denn nur der aufgeklärte<br />
und informierte Patient kann als Partner, zusammen<br />
mit dem Arzt, ein Therapi eregime abstecken; er ist jedoch<br />
n iemals verpflichtet, alles kritiklos über sich ergehen zu lassen!<br />
36
Ernährung / Prävention<br />
Der Brustkrebs ist die häufigste maligne (= bösartige) Erkrankung bei<br />
der Frau und die zweithäufigste Ursache für eine krebsbedingte Todesfolge.<br />
Auch ist der Brustkrebs 3mal häufiger, als alle anderen gynäkologischen Krebserkrankungen<br />
zusammen. Wobei eine stetige Zunahme zu verzeichnen ist. Lag die<br />
Erkrankungsrate im Jahre 1960 noch bei 1:20, so ist sie heute bis auf 1 : 7 angestiegen,<br />
d. h. von 7 Frauen wird, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, eine<br />
an Brustkrebs erkranken.<br />
Wie kann man sich solch eine steile Zunahme der Erkrankung erklären? Auch muss<br />
es erlaubt sein, einmal den heutigen Stand der hierbei angebotenen therapeutischen<br />
Optionen kritisch zu hinterfragen. Und last but not least dürfen, ja sollten auch alternative<br />
Therapieansätze nicht von vornherein als völlig wirkungslos abgetan und dem<br />
Gebiet der Quacksalberei zugeordnet werden.<br />
Im Rahmen der Regeneration, Prävention und der Rehabilitation nach durchgemachten<br />
Operationen, Chemo- und/oder Radiotherapien, ist eine natürlich belassene<br />
Er nährung von besonderer Bedeutung. Dies zumal der sog. Fortschritt in der Lebensmittelindustrie<br />
noch nicht in alle Nischen der täglichen Nahrungsmittelversorgung<br />
Eingang gefunden hat und der Anbau von genmodifiziertem Mais und Soja noch nicht<br />
den großen Durchbruch in Deutschland geschafft hat. Denn die heutige, zivili satorische<br />
Lebensweise ist mit bis zu 80 Prozent maßgeblich an der Entwicklung einer<br />
malignen Erkrankung beteiligt, zumal die zunehmende Konservierung, Behandlung<br />
mit Pestiziden und Herbiziden seit den 50er Jahren ebenfalls mit einer Zunahme<br />
an Krebs einhergeht. In der Tat konnten anhand von paleoanthropologischen (Lehre<br />
bzw. Wissenschaft von der Entwicklung des Menschen) Untersuchungen nachgewiesen<br />
werden, dass früher die Erkrankung Krebs nicht existent war und erst mit<br />
Verzehr einer wertstoffarmen und durch die Agrochemie veränderten Nahrung aufgetreten<br />
ist. Krebs ist somit eine durch den Menschen verursachte Erkrankung.<br />
Zwar gibt es spezielle Kliniken, die sich der Patienten mit Krebs annehmen und wo<br />
die bei einer solchen Erkrankung notwendige Entgiftung des Organismus und die<br />
Aufnahme von echten Lebensmitteln (denn konservierte Nahrungsmittel zeigen keine<br />
Vitalität mehr) als Grundpfeiler jeglicher therapeutischer Ansätze, begleitet von Sonnenbestrahlung,<br />
einer vergleichsweise reinen Luft und einem nicht mit hormonellen<br />
Resten belasteten Quellwassers in der Therapie, angestrebt wird.<br />
Was jedoch beinhaltet eine beginnende Entgiftung? Hierzu soll etwas ausgeholt<br />
werden, indem unsere tägliche Nahrung kritisch ins Visier genommen, aber auch<br />
gleich mit einigen der so lieb gewonnenen Produkte der Kosmetikindustrie abgerechnet<br />
wird. So ist die in fast allen Hautcremes, Waschlotionen, ja selbst in Sonnenschutzcremes<br />
nachweisliche Parabenbelastung als potentes Karzinogen (Stoff der<br />
einen Krebs auslöst) offensichtlich und selbst Haarfärbemittel, Haarshampoos,<br />
Kon ditioner (Haarspüler) sowie Make-ups sind in der Liste potentieller Karzinogene<br />
zu finden. Ein Blick auf die Inhaltsstoffe wird bestätigt dies und der neutrale Be obachter<br />
muss sich dann nicht wundern, dass eine Zunahme an Brustkrebser krankungen im<br />
letzten Jahrzehnt zu verzeichnen ist. So war es besonders auffallend, dass sich bis<br />
zu sechs verschiedene Parabene in Brusttumoren nachweisen liessen, die als potentiell<br />
brustkrebsauslösend eingestuft werden konnten.<br />
Weitere Beispiele potentieller Brandbeschleuniger für Brustkrebs sind:<br />
1. Natrium-Laurylsulfat und Natrium-Laurethsulfat (sowie ihre zahlreichen Abkömmlinge)<br />
die sich regelmäßig in Zahnpasta, Haarshampoos, Konditioner und Seifen als<br />
Fettlöser resp. Schaumbildner finden und die nicht nur die schützende Fettschicht<br />
der Haut radikal entfernen und die Haut sowie Haarfollikel brüchig machen. Sie<br />
bilden mit den häufig verwendeten Zusatzprodukten wie Dioxan krebserzeugende<br />
Nitrosamine.<br />
37
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
2. Dioxan und Ethylenoxid finden sich als Abfallprodukte<br />
in sulfathaltigen Detergentien wie flüssigen Duschseifen<br />
und Kosmetikprodukten, wobei das Erste als<br />
Karzinogen (löst beim Tier Brusttumore aus, eine Tatsache<br />
die schon seit 1965 bekannt ist!) eingestuft<br />
wird und das Zweite als Nervengift zu klassifizieren<br />
ist.<br />
3. Diethylaminoethanol oder DEAE, ebenfalls in Shampoos<br />
und Kosmetikartikeln, reagiert mit Nitraten unter<br />
Bildung krebserzeugender Nitrosamine.<br />
4. Propylenglycol (E 1520), verwandt mit dem Frostschutzmittel<br />
Ethylenglycol, wird als Wärmeträgermedium<br />
in Kühlanlagen eingesetzt und findet sich als<br />
Zusatz in Zahnpasta, Shampoos, Hautcremes, Bräunungslotionen<br />
und Deos. Als Lösungsmittel, Feuchthaltemittel,<br />
Penetrationsverstärker und Weichmacher,<br />
kann es bis zu 50 % darin enthalten sein. Es<br />
führt zu Hautirritationen und wird in den Sicherheitsbestimmungen<br />
als potentiell Leber- und Nierenschädlich<br />
eingestuft.<br />
Noch brandheißer wird es aber, wenn wir die Östrogenmimetika<br />
(= Substanzen, die eine hormonähnliche,<br />
östro genartige Wirkung offenbaren) betrachten. Denn<br />
der Brustkrebs ist eng an eine Exposition mit Östrogenen<br />
gebunden. Solche, das Hormon Östrogen nachahmende<br />
Stoffe, finden wir in:<br />
1. Der Innenauskleidung jeglicher Konservendosen, in<br />
Form des BPA (Bisphenol A).<br />
2. BPA findet sich auch in allen Arten von Deos (nebst<br />
den darin zusätzlich enthaltenen Duftstoffen), wobei<br />
auf Grund ihrer hohen Aluminiumanteile die Östrogenbindestellen<br />
in der Brustdrüse zusätzlich und unnötigerweise<br />
aktiviert werden.<br />
3. Haarshampoos und Haarfärbemittel enthalten karzinogen<br />
wirkende Zusätze aus der Petrochemie (ein<br />
Blick auf die Inhaltsstoffe und man erblickt einen<br />
kleinen Chemiebaukasten).<br />
4. Detergentien, d. h. synthetische, organische, grenzflächenaktive<br />
Substanzen, wie sie im Haushalt und in<br />
Waschmitteln regelmäßig Verwendung finden.<br />
5. Der so appetitliche Chicken-Burger am Stand, wo<br />
das Huhn zur Wachstumsbeschleunigung mit Hormonen<br />
„behandelt“ wurde, die der Konsument dann<br />
(neben den im Huhn enthaltenen Antibiotika) ebenfalls<br />
aufnimmt. Fazit: Nur das frei umherlaufende<br />
Huhn ist hormon- und antibiotikafrei<br />
6. Seifen, denen Duftstoffe zugesetzt wurden. Mindestens<br />
900 der chemischen Duftstoffe in Parfum & Eau<br />
de Toilette können als toxisch eingestuft werden.<br />
7. PET-Plastikflaschen die neben Bisphenol A auch<br />
noch sog. Phthalate (= Weichmacher) enthalten, Substanzen<br />
die ebenfalls als Östrogenmimetika einzustufen<br />
sind und den Brustdrüsenkörper unnötigerweise<br />
aktivieren.<br />
8. Die im Lippenstift, aber auch in fast allen Hautcremes<br />
in die Östrogensynthese eingreifenden sowie<br />
zerstörenden Zusatzstoffe wie Aluminiumoxid, Polyethylen,<br />
Polybuten und Titandioxid. Als besonders<br />
karzinogen ist jedoch die gesamte Gruppe der Parabene<br />
(z. B. Methyl- und Propylparaben um nur einige<br />
zu nennen) aufzuführen, die als Östrogenmimetika in<br />
Verbindung mit den oben aufgeführten Penetrationsverstärkern<br />
rasch die Haut durchwandern und dann<br />
vom Blutstrom aufgenommen, zu den Brustdrüsen<br />
gelangen, wo sie ihr zerstörendes Werk beginnen.<br />
Die Alternative zu diesen belasteten Produkten? Einsatz<br />
von Hygieneprodukten, die frei von solchen potentiell,<br />
karzinogenen Zusatzstoffen sind (kritischer Blick auf<br />
die Inhaltsbezeichnungen genügt) und nur reine, natürliche<br />
Substanzen verwenden. Und weil solche Belastungen<br />
selten alleine in Erscheinung treten, werden<br />
dem ahnungslosen Konsumenten auch gleich noch<br />
1. Pestizid-behandelte Früchte in besonders schöner<br />
Farbe angeboten (Bio-Obst wäre die Alternative)<br />
2. Sog. Acrylamide, die in stark geröstetem Knabbergebäck<br />
und gebratenem Fleisch, Pommes Frites<br />
oder Kartoffelchips entstehen.<br />
3. Fleischprodukte wie Wurst, Pizza, Schinken, Peppero ni<br />
usw., die mit dem Konservierungsmittel Natriumnitrit<br />
(einem Karzinogen, oft auch mit einem weiteren Karzinogen<br />
dem MSG, im Gepäck) angeboten werden.<br />
4. Mononatriumglutamat (MSG), das in allen Fertigsaucen,<br />
Ketchup und Tütensuppen als Geschmacksverstärker<br />
zu finden ist, eine Substanz die im Tier zu<br />
Hirntumoren führt.<br />
5. Nicht zu vergessen, eine schon im Jahre 2002 nachgewiesene<br />
Verbindung zwischen einer Hormonersatztherapie<br />
in der Menopause und ein damit einhergehender<br />
steiler Anstieg an Brusttumoren (Studie<br />
der Frauengesundheitsinitiative).<br />
38
Ernährung / Prävention<br />
6. Daneben sind genmodifizierter Mais und Soja (befinden<br />
sich in den importierten US Cerealien und<br />
Cornflakes) auch als potentielle Krebsverursacher in<br />
Verruf gekommen. Denn erst kürzlich konnte eine<br />
franz. Forschergruppe nachweisen, dass bei Fütterungsversuchen<br />
mit genmodifizierten (GMO) Mais bis<br />
zu 70 % (!) der weibliche Ratten nach 2 Jahren, neben<br />
Nieren- und Leberschäden, massive Brusttumore<br />
aufwiesen. Interessant ist hierbei, dass GMO-Produzenten<br />
wie die Fa. Monsanto 23 % der weltweiten<br />
Produktion kontrollieren, während eine Fa. wie Bayer<br />
einen Anteil von 20 % der Pestizidproduktion auf dem<br />
Weltmarkt einnimmt.<br />
Was aber kann zur Prävention (Vorbeugung) unternommen<br />
werden? Denn ist die Diagnose eines Brusttumors<br />
erst einmal gestellt, so kann zwar Operation und<br />
Chemotherapie mit einer daran sich anschließenden<br />
Bestrahlung die Überlebensrate verlängern – aber zu<br />
welchem Preis: Haarausfall, chronische Nervenschmerzen,<br />
chron. Müdigkeit, Übelkeit/Erbrechen, sowie Abgeschlagenheit<br />
und Konzentrationsschwäche, Symptome<br />
die im amerikanischen Sprachgebrauch unter der<br />
schönen Bezeichnung „Chemo brain“ schon eine eigene<br />
Krankheitsbezeichnung erlangt haben. (Tenor eines bekannten<br />
Krebspezialisten: „Oftmals ist es doch so, dass<br />
eine achtwöchige Chemotherapie zu einer Verlängerung<br />
der Überlebenszeit von nur wenigen Wochen führt.<br />
In dieser Zeit leben aber viele Patienten nur für die Statistik,<br />
denn es geht ihnen sehr schlecht“. Oder, wie die<br />
engl. Zusammenfassung eine Reviews zur Chemotherapie<br />
bei allen Krebsformen aufzeigt: chemotherapy<br />
contributes just over 2 % to improved survival rates for<br />
cancer patients(!) In fact, 2 % should be regarded as<br />
chemo’s “upper limit of effectiveness.”). Fazit: Chemotherapie<br />
hat im günstigsten Fall nur bei 2 % aller Betroffenen<br />
Erfolg!<br />
Zielsetzung eines zusätzlichen alternativen Ansatzes ist<br />
es deshalb immer, das Immunsystem zu stärken (und es<br />
mit Zellgiften nicht zusätzlich zu schwächen), damit die<br />
dort entstehenden natürlichen Killerzellen in ausreichender<br />
Zahl gebildet werden, die dann die Tumorzellen<br />
vernichten und/oder verhindern, dass sich Tochtergeschwülste<br />
festsetzen können. Obgleich die fol genden<br />
Optionen einer alternativen Therapie keinen Anspruch<br />
auf Vollständigkeit erheben, soll hiermit doch<br />
ver deutlicht werden, dass auch die Ernährung als Medizin<br />
wirken kann (Zitat: „Eure Nahrungsmittel sollen<br />
Eure Heilmittel und Eure Heil -<br />
mittel Eure Nah rungsmittel<br />
sein“ – Hippokra<br />
tes 460 - 370 v.<br />
Chr.) Zumal bei bis<br />
zu 98 % der Brustkrebs<br />
pa tientinnen<br />
die Er krankung durch eine entsprechende Diät verhindert<br />
werden kann:<br />
1. Als erstes sollte jeglicher Zucker und insbesondere<br />
die in Diätgetränken enthaltene Fruktose verbannt<br />
werden, weil Zuckermoleküle selektiv von Krebszellen<br />
zum Wachstum genutzt werden und eine Tumorausbreitung<br />
insofern noch fördern indem nach Zuckerkonsum<br />
ein hoher Insulinspiegel in Verbindung<br />
mit dem Insulin-ähnlichen Wachstumsfaktoren (IGF)<br />
die Tumorzunahme erst recht ankurbeln. Die sog. Zuckerersatzstoffe<br />
wie z. B. Cyclamat und Aspartam<br />
stellen auch keine Lösung dar, weil es bei regelmäßigem<br />
Konsum nachweislich zu einer höheren Rate an<br />
Leukämie, multiplem Myelom und Non-Hodgkin Lymphom<br />
kommt und insbesondere Aspartam die Tumorrate<br />
nch fördert.<br />
2. Ein ausreichend hoher Vit. D3-Spiegel, wobei ein<br />
Wert über der üblichen Norm von 50 ng/ml anzustreben<br />
ist. Denn Metaanalysen (Studien mit > 7000<br />
Patienten) haben eindeutig eine enge Beziehung<br />
zwischen hoher Krebsrate und einem niedrigen Vit.<br />
D3 -Spiegel belegt.<br />
3. Ausreichende Mengen an natürlichem Vit. A, wie es<br />
in Eigelb, Biobutter, Rohmilch sowie in der Rinderund<br />
Hühnerleber (aber nur bei natürlich aufgezogenen<br />
Tieren) enthalten ist.<br />
4. Nur fermentierte Sojaprodukte, weil rohes Soja, aus<br />
den USA oder Brasilien importiert, genmodifiziert<br />
ist und der rohe Soja sog. Phytoöstrogene (= pflanzl.<br />
Östro gne) enthält, die im Konzert mit anderen Östrogenen<br />
das Brustzellenwachstum ankurbeln, mit zunehmender<br />
Wahrscheinlichkeit einer krebsigen Entartung.<br />
5. Eines der besten gehüteten Geheimnisse im Rahmen<br />
der Therapie von Krebs ist die Einnahme von qualitativ<br />
hochwertigem Curcumin (Wirkstoff im Curcuma<br />
Longa, dem gelben Ingwer in Verbindung mit schwarzem<br />
Pfeffer). Dies besonders, weil erste Studien (bis<br />
zu 3 g 4 x täglich) auf seine tumortötende, entzündungshemmende<br />
Wirkung hinweisen (Curcumin-Lösungen<br />
führen die Apotheken).<br />
39
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Prof. Dr. med.<br />
Enno Freye<br />
Arzt; Spezialgebiete<br />
Spezielle Schmerz -<br />
t hera pie, Anästhe si o lo gie,<br />
Intensivmedizin<br />
und Suchttherapie,<br />
Nutra zeutika, Mikronährstoffe,<br />
Zivilisationskrank<br />
heiten, Renaturierung<br />
Die folgenden Empfehlungen sind unter der Rubrik „Zusatztherapien“ einzustufen,<br />
weil sie alleine nicht ausreichen, das Tumorzellwachstum hemmen zu können.<br />
1. Der Granatapfel oder Präparate mit Granatapfelextrakt weisen einen tumo r-<br />
tötenden Effekt sowohl im Labor als auch in der Phase 2 bei Patientinnen auf.<br />
2. Sportliche Betätigung soweit möglich, weil laut Studien, hierdurch die Todesratebei<br />
Brusttumorerkrankung um 50 % (!) reduziert werden konnte.<br />
3. Ausreichende Mengen an Antioxidantien, wie das natürliche (!) Vit. C in Früchten<br />
(z. B. Acerola) in Verbindung mit Vitamin E und Selen sowie alpha-Liponsäure<br />
(in Brokkoli oder als Reinsubstanz in der Apotheke).<br />
4. Das Karotinoid Lykopin in der Tomate, insbesondere bei Prostatakrebs und nach<br />
neusten Untersuchungen verhindert es bis zu 50% einen Schlaganfall.<br />
5. Ginsengextrakt, insbesondere der Sibirische Ginseng (erhältlich in einer speziellen,<br />
gut-resorbierbaren Formulierung in der Apotheke)<br />
6. Fisch-Öle oder mittelkettige Fettsäuren (z. B. in Kokosnussöl) mit ihren hohen<br />
Anteilen an Omega-3 Fetten, um die bei einem Krebsgeschehen auch immer ursächlich<br />
beteiligte Entzündung zu unterbinden. In diesem Zusammenhang haben<br />
selbst Kirschen einen entzündungshemmenden Effekt unter Beweis gestellt (bitte<br />
nur die nicht mit Pestiziden behandelten Früchte!).<br />
7. Die vielen in der Natur vorkommenden Polyphenole, wie z. B. Quercetin und Re s-<br />
veratrol, die sich in allen Beerensorten und Traubenschalen finden sowie die<br />
Phytofarbstoffe, die sich u.a. in allen grünen Blattgemüsen (nicht pestizidbehandlt!)<br />
nachweisen lassen.<br />
8. Das im Extrakt von Weintraubenkernen und den Schalen der Weintraube enthaltene<br />
Antioxidans OPC (Oligomere Proanthocyanidine) oder das Astaxanthin, ein<br />
Beta-Carotinoid aus der Mikroalge Haematococcus pluvialis, ebenfalls ein wirkstarkes<br />
Antioxidanz (OPC und Astaxanthin aus der Apotheke).<br />
9. Coenzym Q10 (oder Ubiquinon) ist ein weiteres nützliches Ergänzungsmittel, dass<br />
für die Zellatmung von ganz entscheidender Bedeutung ist. Und weil das reduzierte<br />
Q10 (oder Ubiquinol) vom Körper besser verwertet werden kann, sollte auch<br />
hier, den neusten Forschungsergebnissen entsprechend, eine in der Apotheke<br />
angebotene Ubiquinol-Fomulierung zum Einsatz kommen.<br />
10. Methylsulfonylmethan (MSM) als diätetisches Ergänzungsmittel, liefert die für<br />
eine Zellreparatur notwendigen Schwefelwasserstoffe.<br />
11. Und weil 80 % aller Brustkarzinome bei Patientinnen nach der Menopause festgestellt<br />
werden, besteht auch ein Bedarf, vorbeugend sog. natürliche Aromatasehemmer<br />
(= hemmen die Produktion der Östrogene) aus Vital-Pilzen mit fast unaussprechlichem<br />
Namen wie Coriolus versicolor (Trametes versicolor, Polyporus<br />
versicolor, Polystictus versicolor, Yun Zhi, Kawaratake) einzusetzen.<br />
12. Broccoli, welcher in hohen Dosen das Phytopharmakon Indol-<br />
3-carbinol (I3C) enthält, um die hohen Östrogenmengen in<br />
ein nicht-aktives Produkt zu überführen (Studie am Nationalen<br />
Krebsinstitut in den USA).<br />
13. Genistein aus fermentierter Soja leitet den Zelltod der<br />
Krebszelle ein und ist antioxidativ. Beide, sowohl<br />
IC3 als auch Genistein, hemmen dosisabhängig<br />
die durch Östrogene aktivierten Bindestellen<br />
in der Brustdrüse.<br />
40
Anzeige /<br />
14. Daneben soll nicht verschwiegen werden, dass tief<br />
sitzende psychische Probleme, die als Dauerstress<br />
über Jahre anhalten, die Bereitschaft an einem Karzinom<br />
zu er kran ken, deutlich erhöhen. Hier wäre ein<br />
weiterer Angriffspunkt der Prävention anzusetzen<br />
indem einige Kliniken mit der Einrichtung sog. Psychoonkologischer<br />
Abteilungen den Trend der Zeit<br />
erkennen.<br />
Zusammengefast wird der (die) Normalverbraucher (in)<br />
mit Recht nun feststellen, dass die so angeblich gesunde<br />
Nahrung voller Gifte und Toxine ist, deren Konsum<br />
nicht sofort aber bei jahrelanger Zufuhr letztendlich<br />
nicht nur zu Brusttumoren führen kann, sondern fast<br />
zwangsläufig führen muss. Daraus abzuleiten ist deshalb<br />
die Prävention (Vorbeugung) durch rigorose Elimination<br />
(Weglassen) belasteter Produkte angezeigt, wobei natürliche<br />
Antioxidantien, wie oben aufgeführt, wertvolle<br />
Hilfe leisten.<br />
Zum Abschluss noch einige Bemerkungen zu der propagierten<br />
regelmäßigen Mammographie, um den Tumor<br />
rechtzeitig zu entdecken. Nach einer groß angelegten<br />
Untersuchung, konnte die Mammographie die Todesrate<br />
nur bei einer von insgesamt 1000 Brustkrebspatientinnen<br />
verhindern (Studie im renommierten New<br />
England Journal of Medicine, 2010). Oder in anderen<br />
Worten: 2500 Frauen müssten sich über 10 Jahre lang<br />
regelmäßig einer Mammographie unterziehen, um nur<br />
einen krebsbedingten Todesfall zu verhindern. Dies ist<br />
mehr als ernüchternd und bestätigt nur, dass die heutige<br />
Medizin weit von einer Prävention entfernt ist. Somit<br />
rettet die propagierte Mammographie, trotz landläufiger<br />
Meinung, kaum Leben und noch weniger verhindert<br />
sie, diese bedrohliche Erkrankung überhaupt zu<br />
bekommen. Zwar wird konstant weiter behauptet, dass<br />
die Mammographie eine „lebensrettende“ Untersuchungsform<br />
darstellt und sich hierdurch die Todesrate<br />
um 15 % bis 25 % reduzieren lässt, nur leider basieren diese<br />
Ergebnisse auf Studien, die vor Jahrzehnten gemacht wurden<br />
und heutzutage keine Aktualität mehr haben!<br />
Als Alternative zu einer Mammographie, bei der die<br />
Brust einem Druck ausgesetzt wird, um anschließend<br />
mit Hilfe ionisierender Strahlen Dichteunterschiede (die<br />
in den meisten Fällen nicht krebsbedingt sind) zu identifizieren,<br />
empfiehlt sich die Thermographie. Denn bei<br />
jeder Krebserkrankung liegt am Randbezirk immer ein<br />
Entzündungsprozess mit einer gesteigerten Durchblutung<br />
und einer damit einhergehenden lokalen Erwärmung<br />
vor. Es ist somit eine Methode, neben der Sonographie<br />
(fragen Sie als mündige Patientin dazu ihren<br />
Frauenarzt – er hat die Antwort), die mit einer höheren<br />
Identifikationsrate, keiner zusätzlichen Strahlenbelastung<br />
und geringeren Kosten im Rahmen des regulären<br />
Screenings einhergeht.<br />
41
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Brainfood DHA<br />
jetzt auch für Vege tarier<br />
und für alle, die Fischöl<br />
nicht vertragen<br />
Die essentielle Omega-3-Fettsäure DHA (Docosahexaensäure)<br />
ist für Hirn, Herz und Augen unverzichtbar. Da große Teile<br />
der Bevölkerung daran Mangel leiden, empfehlen Ärzte,<br />
vor allem Schwangeren und stillenden Müttern sowie allen<br />
infarktgefährdeten älteren Patienten, täglich mindestens<br />
200 Milligramm DHA einzunehmen. Nur wer zweimal pro Woche<br />
ausreichend Lachs, Hering, Makrele, Sardinen oder Thunfisch<br />
isst, kann auf Omega-3 aus Nahrungsergänzungen verzichten.<br />
Einerseits wird der regelmäßige Verzehr dieser Fische empfohlen und<br />
andererseits wird wegen der hohen Schadstoffbelastung und der Überfischung<br />
der Meere auch davon abgeraten. Das aus Fischen und Fischabfällen gewonnene<br />
Öl kann große Mengen an Schadstoffen enthalten. Wenn aus diesem Fischöl<br />
so genanntes „pharma zeutisches Qualitätsfischöl“ hergestellt wird, muss es etliche<br />
denaturierende Ver arbeitungsschritte durchlaufen. Außerdem vertragen viele<br />
Menschen Fischöl nicht gut und nehmen diese dann doch nicht regelmäßig. Mit DHA<br />
aus Algen ist jetzt eine echte Alternative verfügbar.<br />
Nach 15 Jahren Forschung, ursprünglich aus einem Projekt für die NASA, kann jetzt<br />
DHA aus gezüchteten Algen in speziell dafür entwickelten Pflanzenkapseln an geboten<br />
werden. Dieser Schritt lag nahe, denn letztlich produzieren auch die Fische<br />
das DHA nicht selbst, sondern akkumulieren es aus DHA-reichen Algen.<br />
42
Ernährung / Prävention<br />
Die Patienten vertragen es, auch jene, die bisher Fischöl abgelehnt haben, weil<br />
sie unter anderem unangenehmes Aufstoßen davon bekamen. DHA ist für Vegetarier,<br />
und alle, die aus anderen Gründen keinen Fisch essen, unerlässlich, aber letzt lich<br />
profitiert jeder von einer ausreichenden DHA-Zufuhr. Viele wissen heute, das Omega-<br />
3-Fettsäuren wichtig sind, und dass ein Zuviel an Omega-6 entzündliche Prozesse<br />
fördert. Unsere übliche Nahrung hat jedoch einen zu hohen Anteil an Omega-6 und<br />
kaum jemand ernährt sich so bewusst, dass er das ideale Verhältnis von einem Anteil<br />
Omega-3 zu drei Anteilen Omega-6 erreicht. Aber selbst, wenn man den Omega-3-<br />
Anteil über Leinöl oder Hanföl steigert, diese Öle versorgen uns mit ALA (Alpha-Linolensäure),<br />
die auch wichtig ist aber nicht mit der für unser Hirn, Herz und unsere<br />
Augen wichtigsten Fettsäure DHA. Die Leber kann zwar in geringen Mengen DHA aus<br />
ALA synthetisieren, aber das reicht in vielen Fällen nicht aus. Ich rate daher jedem,<br />
vorbeugend täglich eine Kapsel Algen-DHA einzunehmen.“<br />
Robert Schneider<br />
Heilpraktiker<br />
DHA ist ein integraler Bestandteil von Zellmembranen, vor allem der Nervenzellen,<br />
und befindet sich hauptsächlich im Gehirn und in der Netzhaut. Fast alle Omega-3-<br />
Fettsäuren des Gehirns und bis zu 93 Prozent der Omega-3-Fettsäuren der Netzhaut<br />
bestehen aus DHA. Außerdem ist DHA eine Schlüsselkomponente des Herzgewebes<br />
und ein natürlicher Bestandteil der Muttermilch.<br />
Zahlreiche wissenschaftliche Studien bestätigen, dass jeder Mensch von einer aus -<br />
reich enden Versorgung mit DHA profitieren kann. Bei werdenden Müttern unterstützt<br />
DHA eine gesunde Schwangerschaft. Bei Embryos und Säuglingen ist DHA<br />
wichtig für die Entwicklung des Gehirns und der Augen. Bei Kindern verbessert<br />
DHA die Entwicklung der Konzentrationsfähigkeit und fördert einen gesunden<br />
Schlaf und bei Erwachsenen und auch im Alter unterstützt DHA die Gesunderhaltung<br />
des Gehirns, der Augen und des Herz-Kreislauf-Systems.<br />
/ Anzeige /<br />
43
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Nahrungsergänzung<br />
braucht man nicht –<br />
oder doch?<br />
Sie hören und lesen es immer wieder. Fast schon gebetsmühlenartig<br />
wird vor der Einnahme von Nahrungsergänzungsmitteln<br />
gewarnt. Nutzlos bis gefährlich sollen sie sein. Von gesundheitlichem<br />
Nutzen keine Spur.<br />
Nun frage ich Sie, kochen Sie jeden Tag<br />
Ihre Mahlzeiten selber? Verwenden<br />
Sie dabei nur oder überwiegend frische, hochwertige<br />
Zutaten? Würzen Sie Ihre Speisen mit Kräutern und guten<br />
Gewürzen? Essen Sie jeden Tag mehrmals Obst und<br />
Gemüse? Verzehren Sie insbesondere viel grüne Blattsalate<br />
und grünes Gemüse? Gehören Pilze regelmäßig<br />
zu Ihrem Speiseplan? Halten Sie sich regelmäßig in der<br />
Sonne auf?<br />
Wenn Sie nur eine dieser Fragen mit Nein beantwor -<br />
ten, dann profitieren Sie wahrscheinlich von einem<br />
Nah rungs ergänzungsmittel.<br />
Schauen wir ein wenig zurück in die menschliche<br />
Entwicklungsgeschichte<br />
Als unsere Vorfahren noch Jäger und Sammler waren,<br />
nutzten sie ein vielfältiges und abwechslungsreiches<br />
Nahrungsangebot. Der Wechsel hin zu einer sesshaften<br />
Lebensweise und die Entwicklung des Ackerbaus<br />
führten jedoch zu einer deutlichen Reduzierung unserer<br />
Lebensmittelauswahl. Die Ernährung veränderte sich<br />
zudem hin zu einer kohlenhydratreicheren Zusammensetzung.<br />
Anhand von Zahn- und Knochenfunden konnten<br />
Wissenschaftler feststellen, dass zu dieser Zeit der<br />
Menschheitsgeschichte Zahnerkrankungen und Infektionen<br />
sprunghaft anstiegen. Betrachtet man unsere<br />
44
Ernährung / Prävention<br />
heutige Ernährung, so ist diese mehr denn je geprägt<br />
von einseitigem, extrem kohlenhydratreichen Essverhalten.<br />
Der ewige Hype um das Cholesterin und die<br />
angeblich ungesunden Fette hat diese Entwicklung<br />
entscheidend vorangetrieben. Eine Vielzahl von sogenannten<br />
Light-Produkten mit geringerem Fettanteil ziert<br />
mittlerweile die Verkaufsregale. Ein Widerspruch wird<br />
dabei gerne übersehen. Nämlich, dass die ebenfalls<br />
weit läufige Gesundheitsempfehlung zu mediterraner Kost<br />
ja gerade eine Empfehlung für eine ölreiche (also fettreiche),<br />
dafür aber eben kohlenhydratärmere Ernährung<br />
ist. Mediterrane Kost enthält reichlich gesundes Öl,<br />
einen hohen Anteil an Gemüse und Salat, Fisch, Fleisch,<br />
aber weniger kohlenhydrathaltige Beigaben wie Kartoffeln,<br />
Reis und Brot, als das in unseren Breitengraden<br />
der Fall ist. Mediterranes Essen ist das Paradebeispiel<br />
für eine Lowcarbernährung, der Ernährung unserer<br />
Vorfahren, auf die wir noch immer genetisch programmiert<br />
sind. Immer mehr Wissenschaftler sind mittlerweile<br />
davon überzeugt, dass nicht fettreiche Lebensmittel,<br />
sondern die allgegenwärtigen Kohlenhydrate die<br />
Ursache für die Zunahme an Fettleibigkeit und Diabetes<br />
II sind. Es zeigt sich übrigens immer deutlicher, dass es<br />
übergewichtigen Menschen in der Regel nicht gelingt,<br />
durch den Einsatz von fettreduzierten Light-Produkten<br />
abzunehmen.<br />
Statt auf Lowcarb zu setzen, verwenden wir vielfach<br />
fertige Nahrungsmittel oder Zutaten, die kohlenhydratlastig<br />
sind. Dabei kommen gerne auch geschmacks neutrale<br />
Kohlenhydrate, wie Maltodextrin, als Füllstoffe in<br />
den Rezepturen zum Einsatz. Verallgemeinernd kann<br />
man über diese Art kohlenhydratreicher Kost sagen,<br />
dass es sich um „leere“ Lebensmittel handelt. Sie<br />
haben eine hohe Energiedichte, machen satt, aber enthalten<br />
nur verhältnismäßig geringe Mengen an Mikronährstoffen.<br />
Mit dem Begriff „Versteckter Hunger“, wird<br />
dieses Problem in der modernen Ernährungswissenschaft<br />
sehr treffend beschrieben. Vormals nur als Problem<br />
der dritten Welt betrachtet, wo einseitige Ernährung<br />
mit „Sattmachern“ an der Tagesordnung ist, müssen<br />
wir uns mittlerweile auch bei uns mit dem Thema<br />
ernsthaft auseinandersetzen. Energiereiche Lebensmittel<br />
sind in der Regel die billigeren Lebensmittel, weshalb<br />
nicht zuletzt auch der Geldbeutel eine entscheidende<br />
Rolle spielt. Zudem ersetzen immer häufiger<br />
Aromastoffe oder Kunstprodukte, auch aus Preisgründen,<br />
natürliche Bestandteile in unserem Essen mit der<br />
Folge, dass wichtige Stoffe aus pflanzlicher Nahrung<br />
zunehmend weniger enthalten sind:<br />
Die sekundären Pflanzeninhaltsstoffe<br />
Ihre Zahl ist so riesig, dass viele noch gar nicht untersucht<br />
werden konnten. Von einigen wissen wir aber bereits<br />
jetzt, dass sie gegen Viren und Bakterien schützen,<br />
den Körper im Kampf gegen Krebs unterstützen<br />
können oder die Wirkung der Vitamine in unserem Körper<br />
positiv beeinflussen. Nach jüngsten Erkenntnissen<br />
sind sie auch an epigenetischen Vorgängen beteiligt<br />
und können über die Regulation von Genen in den<br />
Stoffwechsel eingreifen.<br />
Wir müssen sie deshalb heute genau so wie Vitamine,<br />
Mineralstoffe und Spurenelemente zu den unverzichtbaren<br />
Mikronährstoffen zählen, die für ein gesundes<br />
Leben wichtig sind. Seit Jahren gibt es daher die Forderung<br />
nach mindestens fünf Portionen Obst und Gemüse<br />
in der täglichen Ernährung.<br />
Aber ein Großteil unserer Bevölkerung unterschreitet<br />
noch immer die von der Deutschen Gesellschaft für<br />
Ernährung empfohlene tägliche Menge für den Verzehr<br />
von Obst und Gemüse sowie die Aufnahme von Folsäure<br />
und Vitamin D. (statistisch belegt durch die vom<br />
Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und<br />
Verbraucherschutz im Jahre 2008 veröffentlichte Nationale<br />
Verzehrsstudie II, Herausgeber Max-Rubner-<br />
In stitut, Bundesforschungsinstitut für Ernährung und<br />
Lebensmittel, Haid-und-Neu-Str. 9, 76131 Karlsruhe).<br />
Allein diese unbestrittene Tatsache führte bisher leider<br />
nicht dazu, dass allgemeine Empfehlungen zur re gelmäßigen<br />
Supplementierung von Folsäure und Vitamin D<br />
ausgesprochen wurden. Noch schlimmer, es wird sogar<br />
ausdrücklich davon abgeraten.<br />
Wenn Sie jetzt an dieser Stelle meinen, dass Sie das<br />
alles nicht betrifft, weil Sie jeden Tag ausreichend Obst<br />
und Gemüse verzehren, dann haben Sie vielleicht damit<br />
Recht. Bedenken Sie aber, dass viele Obstsorten unreif<br />
geerntet werden und unter künstlichen Bedingungen<br />
nachreifen. Und Gemüse und Obst müssen häufig lange<br />
Transport- und Lagerzeiten über sich ergehen lassen.<br />
45
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Ein sehr gutes Beispiel hierzu präsentierte die Re da k tion<br />
W wie Wissen in ihrer Sendung vom 3. Fe bruar 2013<br />
(nachzulesen im Internet unter http://www.daserste.de/<br />
information/wissen-kultur/w-wie-wissen/sendung/<br />
aepfel-110.html). Das interessanteste Fazit die ser Sendung<br />
für mich war, dass ein Apfel während der monatelangen<br />
Lagerung in hochtechnisierten Kühlhäusern<br />
nur wenig Verluste erleidet, jedoch innerhalb von sieben<br />
Tagen bei Raumtemperatur den Großteil an Vitamin C<br />
und sekundären Pflanzenstoffen verliert. Alldieweil, die<br />
abschließende Empfehlung des Autors, Äpfel nach dem<br />
Kauf im Kühlschrank auf zubewahren, stellte mich nicht<br />
wirklich zufrieden. Denn die meisten Äpfel haben bis<br />
zum Kauf bereits Tage bei Raumtemperatur im örtlichen<br />
Handel verbracht. Zwangsläufig müsste man für Äpfel<br />
eine Kühlkette fordern, wollte man die Qualität bis zum<br />
Verbraucher bewahren. Der Apfel würde zum Luxusgut<br />
werden.<br />
Doch bereits schon vorher, in der Produktion von Obst<br />
und Gemüse, gibt es Probleme. Oftmals wird auf ausgelaugten<br />
Böden angebaut und vielfach werden Neuzüchtungen<br />
eingesetzt, die aus Haltbarkeitsgründen,<br />
wegen des Aussehens oder des Geschmacks, ganz anders<br />
zusammengesetzt sind als die Obst- und Gemüsesorten,<br />
die wir noch im frühen 20. Jahrhundert kannten.<br />
Statistische Erhebungen zum Gehalt von Lebensmitteln<br />
belegen über die letzten Jahrzehnte eine deutliche<br />
Re duzierung an Calcium, Magnesium, Kalium, Zink,<br />
Vita min C, Folsäure und Vitamin E in Obst und Gemüse.<br />
So dass selbst abwechslungsreiche Ernährung zu unzureichender<br />
Versorgung mit lebenswichtigen Substanzen<br />
führen kann. Man sieht es den Nahrungsmitteln<br />
leider nicht an, was in ihnen steckt.<br />
Mittlerweile gibt es zahlreiche wissenschaftliche Studien<br />
zur Wirkung von Mikronährstoffen. Viele zeigen<br />
die positive Wirkung einer ausreichenden Versorgung<br />
für unsere Gesundheit sowie die körperliche und geistige<br />
Leistungsfähigkeit.<br />
Besonders deutlich wird ihr ganzes Potential im Bereich<br />
des Leistungssports. Gerade bei extrem hoher körperlicher<br />
Beanspruchung entscheidet eine ausreichende<br />
Versorgung mit Mikronährstoffen oft über Erfolg oder<br />
Mißerfolg.<br />
Wenn Sie intensiv Freizeit- oder Profisport<br />
betreiben, bildet Ihr Körper in höherem Maße<br />
freie Radikale, als im Alltag.<br />
Diese sind für uns zwar unerlässlich, denn sie unterstützen<br />
unser Immunsystem u. a. bei der Zerstörung von<br />
Krankheitserregern (auch deshalb hat Sport einen positiven<br />
Einfluss auf unsere Gesundheit).<br />
46
Ernährung / Prävention<br />
Ein Übermaß jedoch hat nachteilige Wirkungen. So wirken sich überhöhte Konzentrationen<br />
an freien Radikalen negativ auf das Immunsystem aus. Darüber hinaus<br />
zerstören sie körpereigene Strukturen und werden beispielsweise mit Gefäßerkrankungen<br />
wie Atheriosklerose in Verbindung gebracht. Für Sportler besonders interessant<br />
ist, dass mittlerweile für freie Radikale auch eine ursächliche Bedeutung für die<br />
Mikrofrakturen unserer Muskulatur diskutiert wird. Gemeinhin bezeichnen wir diese<br />
Muskelfrakturen als Muskelkater. Im schlimmsten Fall kommt es sogar zum Muskelfaserriss.<br />
Jeder Muskelkater bedeutet einen Trainingsrückschritt. Im Wettkampf,<br />
können Mikrofrakturen zu Leistungsminderungen bis hin zum vorzeitigen Ausscheiden<br />
führen. Eine ausreichende Zufuhr von Antioxidantien versetzt unseren Körper<br />
in die Lage, nachteilige Wirkungen freier Radikale zu verhindern. Um dem erhöhten<br />
oxidativen Stress beim leistungsorientierten Sport zu begegnen, müssten die täglich<br />
verzehrten Mengen an Obst und Gemüse wesentlich erhöht werden. Große Mengen<br />
pflanzlicher Lebensmittel belasten jedoch erheblich den Darm. Verantwortlich hierfür<br />
sind vor allem die Ballaststoffe und die Fructose in vielen Obstsorten. Von dem<br />
so beliebten Apfel weiß man beispielsweise, dass er ein besonders ungünstiges Fruc to se-<br />
Glucose-Verhältnis hat und deshalb bei vielen Menschen in größerer Menge zu<br />
Bauchgrummeln und Durchfall führt. Und Hülsenfrüchte, die zu den wertvollsten<br />
pflanzlichen Eiweißlieferanten zählen, führen bekanntermaßen ebenfalls zu unerwünschten<br />
Darmbeschwerden.<br />
Allerdings, für eine normale und gesunde Darmtätigkeit, sind Ballaststoffe wichtig.<br />
Niemand sollte deshalb auf den regelmäßigen Verzehr von Obst und Gemüse verzichten.<br />
Aber ein Mehrbedarf, wie er zum Beispiel beim Sport entsteht, lässt sich vorteilhaft<br />
mit Nahrungsergänzungsmitteln decken.<br />
In der Realität sieht es leider eher so aus, dass sogar im Leistungssport Fastfood an<br />
der Tagesordnung ist und viele Sportler sich genau so unausgewogen ernähren, wie der<br />
Rest der Bevölkerung. Mit dem Ergebnis, dass sie weit unter ihren Möglichkeiten<br />
bleiben.<br />
Zum Ende meiner Betrachtung kann ich nur zu einem Schluss kommen:<br />
Nahrungsergänzungsmittel haben eine Daseinsberechtigung. Sie sind aufgrund<br />
unserer modernen Lebens- und Ernährungsumstände unverzichtbar und schließen<br />
die Lücken in unserer täglichen Mikronährstoffversorgung. Darüber hinaus haben sie<br />
das Potential, die körperliche Leistungsfähigkeit zu verbessern und stellen eine Alternative<br />
zu verbreiteten Dopingpraktiken dar. Wer sie pauschal ablehnt, vergibt eine<br />
Chance auf mehr Gesundheit, Vitalität und Leistungsfähigkeit. Forderungen nach<br />
einer sinnvollen Regulierung des Marktes sind aber berechtigt. Maßnahmen zum<br />
Verbraucherschutz sollten jedoch sachlich und mit Sinn und Verstand umge setzt<br />
werden. Niemand würde bestreiten, dass die Aussage, grünen Tee zu trinken sei<br />
gesund, richtig ist. Warum soll es dann für Grünteeextrakt bewiesen werden?<br />
Andreas Binninger<br />
Apotheker und Vorsitzender<br />
der Europäischen Gesellschaft<br />
für Gesunde Ernä hrung<br />
und Gesundheit im Allgemeinen<br />
Gemeinnütziger<br />
Verbraucherverein e. V. (EGE)<br />
47
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Gesundheitsprävention<br />
in Unternehmen<br />
Jahrzehntelang war es in deutschen Unternehmen<br />
üblich, in ihrer Leistung nachlassende,<br />
ältere Mitarbeiter durch jüngere Bewerber zu<br />
ersetzen<br />
Dies galt insbesondere für solche Fälle, in denen sich chronische<br />
Krankheiten einstellten. Auch wenn die Einarbeitung der neuen Mitarbeiter<br />
ebenso wie das vorzeitige Ausscheiden der alten Mitarbeiter Kosten verursachte,<br />
rechnete sich dieses Vorgehen für die Unternehmen. Seit wenigen Jahren<br />
zeichnet sich nun jedoch ein Paradigmenwechsel ab und es wird zunehmend von der<br />
betrieblichen Gesundheitsvorsorge gesprochen.<br />
Prof. Dr. med. Jörg Spitz<br />
Spezialgebiet Präventionsmedizin,<br />
u. a. Gründer<br />
der „Gesellschaft für<br />
Me di zinische Information<br />
und Prävention“, Referent<br />
und Buchautor, Fachlicher<br />
Beirat des NEM e. V.<br />
Treiberfaktoren für die Entwicklung der Gesundheitsprävention<br />
in Unternehmen<br />
1. Demographische Entwicklung in den Industriestaaten<br />
2. Versagen der individuellen Verhaltensprävention im Rahmen der Gesundheitsvorsorge<br />
3. Positive Erfahrungen mit Maßnahmen zur Arbeitsplatzsicherheit in den Unternehmen<br />
4. Maßnahmen zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge sind Investitionen mit hohem<br />
ROI<br />
Aus dem Zusammenspiel der unterschiedlichen Treiberfaktoren ergibt sich ein<br />
ganzes Dutzend guter Argumente für die Etablierung gezielter Maßnahmen zur Gesundheitsvorsorge<br />
in Unternehmen. Dabei wird im Rahmen dieses Übersichtsartikels<br />
nicht zwischen betrieblicher Gesundheitsvorsorge und betrieblichem Gesundheitsmanagement<br />
unterschieden. Es soll vielmehr dargelegt werden, dass es für jeden<br />
Unternehmer sinnvoll ist, sich mit diesem Thema näher zu befassen, und eine<br />
ge zielte Strategie zur Implementation von Maßnahmen zur Gesundheitsprävention<br />
in seinem Unternehmen zu entwickeln. Die Punkte erheben keinen Anspruch auf<br />
Vollständigkeit, bieten jedoch hilfreiche Denkansätze für ein individuelles Konzept,<br />
das idealerweise mit einem auf dem Gebiet der betrieblichen Gesundheitsvorsorge<br />
kompetenten Partner eingeleitet und umgesetzt werden sollte.<br />
1. Der Arbeitsplatz ist der Bereich, in dem der einzelne Mensch den größten Teil<br />
seiner ihm zur Verfügung stehenden Zeit verbringt. Dieser Umstand erhöht die<br />
Wirksamkeit jeglicher Maßnahme.<br />
2. In den Betrieben existiert in der Regel bereits eine gut wickelte Organisationstruktur,<br />
die zur effektiven und ökonomischen Umsetzung von Maßnahmen genutzt<br />
werden kann.<br />
48
Prävention<br />
3. Damit entfällt der kostspielige Aufbau neuer Organisationsstrukturen<br />
für die Gesundheitsvorsorge.<br />
4. Die meisten Betriebe verfügen über umfangreiche<br />
Erfahrungen auf dem Gebiet der Verhältnisprävention<br />
(Arbeitsplatzsicherheit), deren Maßnahmen in der<br />
Regel wesentlich erfolgreicher sind als die reine Verhaltensprävention<br />
mit ihren Compliance Problemen.<br />
Das betriebliche „Setting“ bietet somit eine einzigartige<br />
Chance zur effektiven Kombination beider Präventionsprinzipien.<br />
5. Die unveränderte Fortführung der bisherigen Arbeitsplatzmaßnahmen<br />
wird mit relativ hohem Kostenaufwand<br />
nur noch zu einer geringen Optimierung der<br />
bereits erreichten Ziele bei der Gesunderhaltung der<br />
Mitarbeiter führen (Berufskrankheiten sind gegenüber<br />
den „Zivilisationskrankheiten“ absolut in den<br />
Hintergrund getreten).<br />
6. Dem gegenüber lassen sich mit relativ geringem<br />
finanziellem Aufwand im beruflichen Setting Maßnahmen<br />
zur Verbesserung des Lebensstils der Mi t-<br />
arbeiter initiieren und nachhaltig organisieren.<br />
7. Die demographische Entwicklung führt zu einem steigenden<br />
ökonomischen Interesse an der Gesunderhaltung<br />
der Mitarbeiter und damit an der konsequenten<br />
Umsetzung von Maßnahmen zur Änderung<br />
des Lebensstils. Dies unterstützt wiederum die individuellen<br />
Bemühungen des Mitarbeiters. Der „return on<br />
invest“ für solche Maßnahmen liegt bei 1:3 bis 1:5.<br />
Damit wird die betriebliche Gesundheitsvorsorge zu<br />
einer sinnvollen betrieblichen Investition, auch aus<br />
ökonomischen Gründen.<br />
8. Kollektive Maßnahmen innerhalb des Betriebes haben<br />
durch die zugrunde liegende Gruppendynamik<br />
eine weitaus höhere Erfolgsquote als individuelle<br />
Einzelmaßnahmen.<br />
9. Wissenschaftliche Studien zeigen ferner, dass der<br />
erforderliche Maßnahmenkatalog standardisierbar<br />
und somit für kollektive Maßnahmen sehr geeignet<br />
ist, ohne dabei den Anspruch auf individuelle Ausprägung<br />
für den einzelnen Mitarbeiter aufzugeben.<br />
10. Der Benefit der Präventionsmaßnahmen stellt sich<br />
für den Mitarbeiter und das Unternehmen nicht erst<br />
nach ungewissen Jahrzehnten ein, sondern bei zahlreichen<br />
Maßnahmen bereits kurzfristig innerhalb<br />
weniger Monate nach ihrem Beginn.<br />
11. Das betriebliche Setting ist wie kein anderes geeignet<br />
als Multiplikator zu dienen, da über die Familien<br />
der Mitarbeiter praktisch die gesamte Bevölkerung<br />
erreicht wird. Die Maßnahmen müssen nur entsprechend<br />
angelegt werden.<br />
12. Die betriebliche Gesundheitsvorsorge ist somit in<br />
der Lage, mittel- bis langfristig eine Sanierung des<br />
kaum noch finanzierbaren Gesundheitswesens zu<br />
bewirken.<br />
Professionelle Lösungsansätze stehen bereits auf dem<br />
Markt zur Verfügung. Aufgabe der Politik ist es, die Rahmenbedingungen<br />
für die Betriebe und die Krankenkassen<br />
so zu verändern, dass der für eine effektive Umsetzung<br />
zwingend erforderliche finanzielle Anreiz nicht nur<br />
bei den Unternehmen, sondern auch bei den Mitarbeitern<br />
spürbar wird.<br />
49
<strong>Nutrition</strong>-<strong>Press</strong><br />
Die eigene Website<br />
Sie träumen vom eigenen Kochbuch-Blog, einer coolen<br />
eigenen Website, einer spannenden Facebook-Profilseite?<br />
Alles ist schnell gebaut. Und wer generell nur vom Urheber<br />
genehmigte Bilder, Texte und Musikstücke verwendet,<br />
die Impressumspflicht beachtet und weiß, dass er für die Inhalte<br />
haftet, macht schon das Allermeiste richtig.<br />
Als Websitebetreiber wie auch als Inhaber<br />
von Twitter- und Facebook-Accounts<br />
haften Sie für Inhalte wie Postings, Kommentare und<br />
RSS-Feeds, denn laut § 7 Abs. 1 Telemediengesetz ist<br />
der Diensteanbieter grundsätzlich für eigene Inhalte auf<br />
seinen Seiten verantwortlich.<br />
Haftung für eigene Inhalte<br />
Gut, wenn Sie fremde Texte auf Ihrer Seite prüfen und<br />
reagieren, wenn Ihnen eine Rechtsverletzung gemeldet<br />
wird. Denn: Sie haften möglicherweise als so genannter<br />
„Störer“ auch dafür. So urteilte das Landgericht Berlin<br />
in einem Fall um einen auf einer Website eingebundenen<br />
RSS-Feed, der ehrverletzende Äußerungen enthielt<br />
(LG Berlin Az.: 27 O 190/10).<br />
Haftung für Links<br />
Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass derjenige,<br />
der den Hyperlink setzt, wie für eigene Informationen<br />
haftet, wenn er sich die Inhalte der fremden Website<br />
zu Eigen macht (BGH AZ I ZR 10/<strong>05</strong>). Diese Haftung<br />
kann teilweise durch die Er stellung eines „Disclaimers“<br />
vermieden werden. Das ist die ausdrückliche Erklärung,<br />
dass man sich vom Inhalt der verlinkten Website distanziert.<br />
Ratsam ist es, nur ein fache Links zum Beispiel auf<br />
das Logo oder die Adresse der fremden Seite anzugeben<br />
mit dem Beisatz „Weiterführende Informationen“.<br />
Die fremde Seite sollte in einem neuen Fenster<br />
erscheinen.<br />
Überprüfen Sie generell und regelmäßig verlinkte<br />
Seiten auf deren Rechtmäßigkeit und löschen die Verlinkung<br />
sofort, wenn Sie Umstände erfahren, aus denen<br />
sich eine offensichtliche Rechtswidrigkeit ergibt.<br />
Haftung für Fotos<br />
Jede Veröffentlichung von Bildern im Internet kann<br />
haftungsrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen,<br />
wenn das Urheberrecht oder Persönlichkeitsrecht<br />
verletzt werden. Dies kann zu Unterlassungs- oder<br />
Schadensersatzansprüchen führen.<br />
Unser Tipp für Facebooknutzer<br />
Wenn Sie einen Medien-Artikel verlinken, zieht Facebook<br />
automatisch ein Miniaturbild, wenn vorhanden,<br />
mit. Setzen Sie in jedem Fall ein Häkchen beim Button<br />
„Kein Miniaturbild“, damit Sie nicht die Urheberrechte<br />
des Fotografen verletzen.<br />
Quelle: www.arag.de<br />
(Rund ums Recht<br />
> Mein Recht<br />
> Internetrecht)<br />
50
Der Fachbeirat<br />
des NEM e.V.<br />
stellt sich vor:<br />
Peter Abels<br />
Therapeut, Vorsitzender des European Federation<br />
for Naturopathy e.V. – EFN,<br />
Medizinischer Leiter des Steinbeis-Transfer-Instituts<br />
Gesundheitsprävention, Therapie und Komplementärmedizin<br />
der Steinbeis-Hochschule Berlin – SHB<br />
Fachbereich: Ernährungswissenschaft<br />
Dr. jur. Thomas Büttner<br />
Rechtsanwalt, LL.M.<br />
Fachbereich: Lebensmittelrecht,<br />
Cosmeticrecht, Medizinprodukterecht,<br />
Wettbewerbsrecht,<br />
Verwaltungsrecht, Strafrecht<br />
und Markenrecht<br />
Dr. Bettina C. Elles<br />
Rechtsanwältin, LL.M.<br />
Fachbereich:<br />
Gesellschaftsrecht, Internetrecht,<br />
Markenrecht, Wettbewerbsrecht<br />
und Steuerrecht<br />
Prof. Dr. med. Enno Freye<br />
Arzt; Spezialgebiete Spezielle Schmerztherapie,<br />
Anästhesiologie, Intensivmedizin<br />
und Suchttherapie, Nutrazeutika,<br />
Mikronährstoffe, Zivilisations krankheiten,<br />
Renaturierung<br />
Fachbereich: Ernährungswissenschaft<br />
Dr. Uwe Greulach<br />
Chemiker<br />
Fachbereich:<br />
Lebensmittelchemie,<br />
Qualitäts-Management<br />
Günter Heenen<br />
Steuerberater, Fachberater<br />
für Internationales Steuerrecht<br />
Fachrichtung: Allgemeines Steuerrecht<br />
inkl. Lohn- und Umsatzsteuer,<br />
Internationales Steuerrecht, Bilanzierung,<br />
Betriebswirtschaftliche Beratung<br />
Dr. med. Gottfried Lange<br />
Spezialgebiet Orthomolekulare Medizin<br />
Fachbereich:<br />
Ernährungswissenschaft<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Jan I. Lelley<br />
Spezialgebiet angewandte Mykologie<br />
Fachbereich:<br />
Ernährungswissenschaft<br />
Dr. Peter Mewes<br />
Apotheker; Spezialgebiet<br />
Nahrungsergänzungsmittel<br />
Fachbereich:<br />
Ernährungswissenschaft<br />
Prof. Dr. Dr. Claus Muss<br />
Spezialgebiet Studien<br />
für NEM-Industrie<br />
Fachbereich:<br />
Ernährungswissenschaft<br />
Dr. med. Rainer Mutschler M.A.<br />
Spezialgebiet angewandte Mykologie<br />
Fachbereich:<br />
Ernährungswissenschaft<br />
Prof. Dr. Dr. h.c. Otto Pulz<br />
Spezialgebiet Mikroalgen<br />
Fachbereich:<br />
Ernährungswissenschaft<br />
Prof. Dr. med. Jörg Spitz<br />
Spezialgebiet Präventionsmedizin<br />
Fachbereich:<br />
Ernährungswissenschaft<br />
Prof. Dr. med Wolfgang Wuttke<br />
Spezialgebiet Endokrinologie<br />
Fachbereich:<br />
Ernährungswissenschaft
NEM e.V.<br />
Der NEM-Verband setzt neue Qualitätsmaßstäbe für<br />
Hersteller und Unternehmen durch Selbstkontrolle.<br />
Ziel ist es, ein (Nahrungsergänzungsmittel-) Produkt auf den Markt zu<br />
bringen, dessen Zusammensetzung und Aufmachung inhaltlich geprüft<br />
und somit über der gesetzlichen Forderung liegt, als Selbstkontrolle.<br />
www.nem-ev.de<br />
NEM e.V. Qualitätsmaßstab für Europa<br />
Qualitätsmarke NEM Control ®<br />
Mit Einreichung vorbereiteter und vollständiger Produkt-<br />
Dokumentationen findet eine Abschlussprüfung durch das<br />
NEM-Fachgremium statt. Anträge können nur Mitglieder<br />
des NEM-Verbandes stellen.<br />
Informationen unter www.nem-ev.de<br />
cos<br />
NEM e.V.<br />
Abteilung Cosmetic<br />
NEM e.V. – Abteilung Cosmetic<br />
Das Hauptaugenmerk der Abteilung Cosmetic des NEM e.V. liegt<br />
auf dem Bereich der Naturkosmetik, die eine gesunde Pflege<br />
ermöglicht. Ziel sind wissenschaftlich fundierte Informationen für<br />
Hersteller und Unternehmen sowie Verbraucheraufklärung.<br />
Informationen unter www.cos-ev.de<br />
NEM Verband mittelständischer europäischer Hersteller und Distributoren<br />
von Nahrungsergänzungsmitteln & Gesundheitsprodukten e. V.<br />
Horst-Uhlig-Straße 3 · D-56291 Laudert · Telefon +49 (0)6746/80298-20<br />
Telefax +49 (0)6746/80298-21 · E-Mail: info@nem-ev.de<br />
www.nem-ev.de