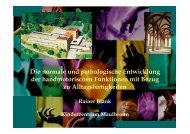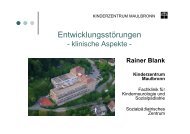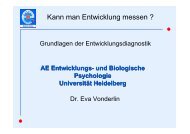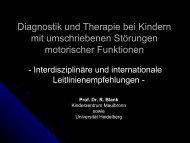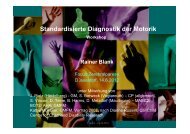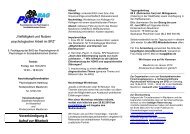pdf.1,3MB - Kinderzentrum Maulbronn
pdf.1,3MB - Kinderzentrum Maulbronn
pdf.1,3MB - Kinderzentrum Maulbronn
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
KRANKENGYMNASTIK AUF NEUROPHYSIOLOGISCHER GRUNDLAGE NACH<br />
BOBATH UND VOJTA BEI DER FRÜHBEHANDLUNG VON ZEREBRALEN<br />
BEWEGUNGSSTÖRUNGEN -DISSENS UND KONSENS-<br />
D. Karch*, P.Schulz**, H. Haberfellner***, W. Berger****<br />
Einleitung<br />
Seit Jahrzehnten werden unterschiedliche Techniken zur Behandlung von Kindern<br />
mit zerebraler Bewegungsstörung angewendet (Scrutton 1984). Fast alle<br />
Behandlungstechniken ergaben sich aus dem praktischen Umgang mit Patienten.<br />
Theoretische Modellvorstellungen wurden erst nachträglich entwickelt, welche aus<br />
neurophysiologischer oder entwicklungsneurologischer Sicht die Methode<br />
begründen sollten. Dies gilt auch für die Krankengymnastik auf<br />
neurophysiologischer Grundlage sowohl nach Bobath als auch nach Vojta.<br />
Obwohl es für beide Methoden keine Studien gibt, die Erfolge zweifelsfrei belegen<br />
können, geschweige denn eine vergleichende Studie zwischen beiden Methoden,<br />
bestehen z.T. rational nicht einsehbare Meinungsunterschiede. In der<br />
Vergangenheit kam es bisweilen zu einer Polarisierung, die dazu führte, daß eine<br />
Ausschließlichkeit der Methode von jeder Seite reklamiert und z.B. eine ergänzende<br />
Anwendung beider Methoden bei ein und dem selben Kind strikt abgelehnt wurde<br />
(Karch et al. 1993).<br />
In dem folgenden Beitrag soll der Versuch unternommen werden, die Theorie und<br />
Praxis beider Methoden, ihre Gemeinsamkeiten und ihre Unterschiede zu<br />
verdeutlichen, insbesondere bei der Früherkennung und Frühbehandlung von<br />
infantilen Zerebralparesen oder zerebralen Bewegungsstörungen. Dabei wird jeder<br />
Seite die Möglichkeit gegeben, das eigene Begriffssystem und die eigene Diktion<br />
anzuwenden und zu erklären. Die Terminologie gibt die jeweils benutzten Begriffe<br />
und Deutungen unter historischen Aspekten wieder. Eine kritische Bewertung ist,<br />
auch in der Darstellung von Konsens und Dissens, nicht durchgeführt und nicht<br />
beabsichtigt.<br />
Die zerebralen Bewegungsstörungen werden als Überbegriff für alle Störungen von<br />
Körperhaltung und Bewegung verstanden, die auf einer Erkrankung, Schädigung<br />
oder Aufbaustörung (Anomalie) des Gehirns beruhen. Dazu gehören die infantilen<br />
Zerebralparesen (cerebral palsy), eine Gruppe von Syndromen mit nicht<br />
progredienten, aber sich ändernden sensomotorischen Störungen, die sich in der<br />
frühen Kindheit manifestieren; eine allgemein anerkannte Definition gibt es nicht<br />
(Tabelle 1).<br />
______________________________________________________________<br />
Die Autoren sind Teil der ”Arbeitsgemeinschaft Bobath/Vojta -Konsens/Dissens”<br />
(Mitglieder: H. Bauer**, W. Berger****, W. Ernst**, A. Glauche-Hiegler*, H.<br />
Haberfellner***, U. Haberfellner***,<br />
D. Karch*, G. Naß*, P. Schulz**, H. von Voß**).<br />
* Klinik für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie, <strong>Maulbronn</strong>,<br />
** <strong>Kinderzentrum</strong> München,<br />
*** Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde, Abteilung Bewegungs-<br />
und Entwicklungsstörungen, Innsbruck<br />
**** Neurologische Universitätsklinik und Poliklinik-Neurozentrum, Freiburg.<br />
1
Der Beitrag ist in 3 Kapitel gegliedert:<br />
A) Darstellung der Begriffssysteme,<br />
B) Konzepte und Durchführung der Krankengymnastik,<br />
C) Indikation zur Behandlung im ersten Lebensjahr.<br />
A) BEGRIFFSSYSTEME<br />
In diesem Abschnitt sollen die Bezeichnungen und Begriffssysteme, welche nach<br />
dem Vojta- oder Bobath Konzept verwendet werden, definiert und die<br />
Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede analysiert werden (Bobath et al. 1983, Bobath<br />
1986, Vojta 1988, Vojta et al. 1997). Dabei werden in den Abschnitten a) und b) die<br />
Semantik nach Vojta bzw. Bobath und in den Abschnitten c) Konsens und d)<br />
Dissens behandelt (Tabelle 2)<br />
Posturale Ontogenese / motorische Entwicklung<br />
a) Die posturale Ontogenese ist nur ein Aspekt der menschlichen Ontogenese und<br />
wird beschrieben durch folgende Entwicklungsparameter (Tabelle 3):<br />
− die 7 Lagereaktionen (posturale Reaktionen),<br />
− die wichtigsten Aspekte der Spontanmotorik wie Aufrichtung, phasische<br />
zielgerichtete Motorik und Lokomotion (posturale Aktionen) sowie<br />
− die Entwicklungsdynamik der primitiven Reflexe und Automatismen. Sie folgt<br />
einem artspezifischen Programm, das daher nicht trainiert werden muß.<br />
Die automatische Steuerung der Körperhaltung ist Ausdruck einer zentralnervösen<br />
posturalen Funktion, die mit den Lagereaktionen erfaßbar ist. Sie begleitet jede<br />
normale motorischen Äußerung des Säuglings. Es lassen sich bestimmte<br />
Meilensteine der idealen posturalen Aktionen (= Spontanmotorik) auf bestimmte<br />
Stufen der idealen posturalen Reaktionen (= Lagereaktionen) beziehen und<br />
umgekehrt.<br />
Auch die physiologische Präsenz, Abschwächung oder Abwesenheit der primitiven<br />
Reflexe und Automatismen (= Dynamik der primitiven Reflexe) läßt sich anhand der<br />
Lagereaktionen oder der Spontanmotorik vorhersagen, wenn diese ideal gestaltet<br />
sind. -Zum Beispiel ist ein Kind mit einem posturalen Niveau am Beginn des 7.<br />
Monats in der Lage, sich auf die geöffneten Hände zu stützen und sich rückwärts<br />
auf die Knie zu schieben. Die Primitivreflexe sind mit Ausnahme des<br />
Fußgreifreflexes zu diesem Zeitpunkt erloschen (Vojta 1989a).- Die Beschreibung<br />
der Lagereaktionsentwicklung beginnt mit der Geburt (40. SSW). Nach dem<br />
Abschluß des 10. posturalen Entwicklungsmonats können die Lagereaktionen nicht<br />
mehr zur Feststellung des posturalen Alters gewertet werden.<br />
Bei Frühgeborenen wurden sie noch nicht standardisiert. Gesunde Säuglinge gehen<br />
zeitweilig über die Grenzen ihrer sicheren posturalen Fertigkeiten hinaus. Die<br />
Frühgeborenen benutzen passagere Ersatzmuster (vgl. Kapitel Spontanmotorik),<br />
wenn sie durch ihre früher reifende visuelle und akustische Perzeption zum Handeln<br />
motiviert werden.<br />
b) Die motorische Entwicklung -ein Aspekt der psychomotorischen Entwicklung<br />
insgesamt- wird von unterschiedlichen Faktoren beeinflußt und zeigt innerhalb<br />
2
estimmter Grenzen eine große Variabilität. Dies erschwert die Früherkennung der<br />
zerebralen Bewegungsstörungen bzw. auch der verzögerten oder gestörten<br />
motorischen Entwicklung eines Kindes. In diesem Zusammenhang müssen vor<br />
allem der Entwicklungsstand der Rumpfaufrichtung und Kopf(haltungs)kontrolle, der<br />
Stütz- und Greiffunktion in Verbindung mit der Absicherung der Körperlage (Hand-<br />
Mund-Fuß-Koordination, Übergreifen der Mittellinie etc.) beachtet werden. Skripten<br />
und Kursaufzeichnungen zur Beurteilung sind nicht allgemein zugänglich, daher<br />
orientiert man sich an Studien über die motorische und psychomotorische<br />
Entwicklung wie z.B. Bobath et al. 1983, 1984, Gesell et al. 1964, Illingworth 1975,<br />
Mc Graw 1989, Sheridan 1975).<br />
Die motorische Entwicklung ist genetisch determiniert. Wie einzelne Entwicklungsschritte<br />
erreicht werden, kann individuell unterschiedlich sein und wird von<br />
epigenetischen Faktoren beeinflußt, wie z.B. kulturelle, familiäre oder psychosoziale<br />
Einflüsse (Michaelis 1985, Michaelis et al. 1989). In prospektiven Studien ist diese<br />
Variabilität von Largo et al. (Largo et al. 1985, Largo et al. 1993) demonstriert<br />
worden. Ca. 13% der Kinder wählten andere Bewegungsmuster bzw. ließen<br />
bestimmte Meilensteine der Aufrichtung und Lokomotion bis zum freien Laufen aus.<br />
Unklar ist allerdings, ob es sich dabei, zumindest bei einigen Kindern, um den<br />
Versuch handelt, eine bestehende Störung der motorischen Koordination zu<br />
kompensieren.<br />
c) Der Säugling nutzt angeborene Bewegungsmuster und sensomotorische<br />
Regulationskreise, so daß er bei einer zielgerichteten Bewegung oder Aufrichtung<br />
nicht jeden einzelnen Bewegungsablauf völlig neu und individuell erlernen muß.<br />
Teile dieser angeborenen Bewegungsabläufe werden spinal oder im Hirnstamm<br />
generiert. Aufgrund von Tierversuchen sprechen Grillner et al. (1985) von "central<br />
pattern generator" (CPG). Solche "Teilprogramme" werden auch für den Menschen<br />
als angeboren diskutiert, die unter zunehmender supraspinaler Kontrolle modifiziert<br />
werden (Berger et al. 1984, Schotland 1992). Um sich auf die Erfordernisse der<br />
Umwelt einzustellen, werden neurale Mechanismen benötigt, die in einem<br />
komplexen Netzwerk eng miteinander in Verbindung stehen müssen (Touwen<br />
1993). Der Einfluß von angeborenen Bewegungsmustern wird mit der Reifung des<br />
ZNS geringer.<br />
d) Vojta betont, es komme auf den systematischen Zusammenhang zwischen den<br />
posturalen Reaktionen (Lagereaktionen), posturalen Aktionen (Spontanmotorik)<br />
sowie der Entwicklungsdynamik der primitiven Reflexe und Automatismen beim<br />
Säugling an.<br />
Bei Bobath wird ein lockerer Zusammenhang von Primärreaktionen und spontaner<br />
Motorik angenommen (z.B. Handgreifreflex und Greifen) (Touwen 1984 und1993).<br />
Spontanmotorik<br />
a) Spontanmotorik bedeutet, daß bestimmte Aspekte der Motorik (Aufrichtung,<br />
Greifen, Fortbewegung), die bei der Interaktion mit dem Säugling unwillkürlich oder<br />
willkürlich auftreten, vom Untersucher beobachtet werden. Auch hier werden<br />
reifeabhängige, ideale Muster zugrunde gelegt (Tabelle 4). Abweichungen davon<br />
werden als Ersatzmuster beurteilt.<br />
3
Die Spontanmotorik gehört zu den essentiellen Bewertungsmerkmalen bei jeder<br />
Untersuchung und erlaubt im Normalfall eine weitgehende Vorhersage des<br />
posturalen Entwicklungsstandes. Beim Auftreten von Ersatzmustern wiederum<br />
wird eine Zentrale Koordinationsstörung, definiert mit den Lagereaktionen, erwartet.<br />
b) Die Beobachtung der spontanen Motorik (Haltung, Aufrichtungs- und<br />
Willkürmotorik) des Neugeborenen und Säuglings stellt die wichtigste<br />
Informationsquelle zur Beurteilung der Entwicklung sowie zur Erkennung von<br />
zerebralen Bewegungsstörungen dar. Beachtet werden alle spontanen Haltungen<br />
und Aktivitäten<br />
− des Kindes, die seine Körperlage stabilisieren und es befähigen,<br />
den Körperschwerpunkt zu verlagern,<br />
− die zur Entwicklung der Fein- und Zielmotorik beitragen und<br />
− die der Fortbewegung dienen,<br />
− insbesondere bei Kommunikation mit Bezugspersonen (Tabelle 5).<br />
Sie wird vor allem qualitativ beurteilt (bis Ende des 1. Lebensjahres entsprechend<br />
dem korrigierten Lebensalter = neurologisches Alter) und unter Berücksichtigung<br />
der unten aufgeführten Kriterien zur Beurteilung der automatischen Reaktionen.<br />
Verzögerte motorische Entwicklung, eingeschränkte Variabilität der spontanen<br />
Motorik oder gar stereotypes (= ”pathologisches”) Auftreten von Haltungs- und<br />
Bewegungsmustern sind Kriterien, die eine mentale Entwicklungsstörung oder<br />
eine zerebrale Bewegungssstörung vermuten lassen.<br />
c) Die Spontanmotorik stellt eine äußerst wichtige, aber nicht die einzige<br />
Informationsquelle zur Beurteilung der Entwicklung und zur Erkennung spezieller<br />
Abweichungen dar. Die ”Ersatzmuster” des Vojta-Konzepts entsprechen weitgehend<br />
den ”pathologischen” Haltungs- und Bewegungsmustern des Bobath-Konzepts.<br />
Posturale Reagibilität / automatische Reaktionen zur Haltungskontrolle<br />
a) Die posturale Reagibilität bezeichnet die grundsätzliche Fähigkeit des<br />
Menschen, auf provozierte Lageveränderungen zu reagieren. Posturale Reaktionen<br />
laufen unbewußt ab und dienen der Sicherung der Körperhaltung bei jeder<br />
Lokomotion und Zielbewegung (Magnus 1924).<br />
b) Automatische Reaktionen sind Stell- und Gleichgewichtsreaktionen sowie<br />
Kettenreaktionen (Peiper 1963), die für die automatische Kontrolle der<br />
Körperhaltung sorgen und als Haltungshintergrund für jede willkürliche Bewegung<br />
unerläßlich sind. In der klinischen Untersuchung sind die Wirkbereiche der<br />
einzelnen Reaktionen nicht klar voneinander zu trennen.<br />
c) Beide Begriffe beschreiben die unbewußt ablaufenden, angeborenen<br />
Fähigkeiten, die Körperhaltung zu kontrollieren. Selbst beim Neugeborenen sind die<br />
automatischen Reaktionen nie in der vom Tierversuch bekannten Form sichtbar.<br />
Gleichgültig, ob es gesund oder zerebral geschädigt ist, sind die Einflüsse<br />
verschiedener zentralnervöser Bereiche im Gegensatz zum Tierversuch nie auf<br />
definierten Ebenen vollständig unterbrochen. Die Stell- und<br />
Gleichgewichtsreaktionen sind zunehmend weniger variabel oder gar nicht mehr<br />
auslösbar, je nachdem wie stark das ZNS geschädigt ist. Beide Konzepte nehmen<br />
4
eine eigenständige Funktion kortikaler und subkortikaler Areale an, die alle für die<br />
Haltung bedeutsamen Teilfunktionen des ZNS sowie Informationen aus Rumpf,<br />
Extremitäten und Sinnesorganen integriert.<br />
d) Vojta schätzt die Stell- und die Kettenreaktionen als weniger bedeutend für die<br />
Frühdiagnostik von zerebralen Bewegungsstörungen ein als die Vertreter des<br />
Bobath- Konzeptes.<br />
Prüfung der posturalen Reagibilität / automatischen Reaktionen zur<br />
Haltungskontrolle<br />
a) Die posturale Reagibilität wird mittels 7 Lagereaktionen geprüft:<br />
Traktionsreaktion (modifiziert von Vojta), Landau-Reaktion (modifiziert von<br />
Vojta),Axillare Hängereaktion, Seitkippreaktion nach Vojta, Horizontale<br />
Seithängereaktion nach Collis (modifiziert von Vojta), vertikale Hängereaktion nach<br />
Peiper und Isbert (modifiziert von Vojta) sowie Vertikale Hängereaktion nach Collis<br />
(modifiziert von Vojta). Die Lagerereaktionen prüfen die posturale Reagibilität. Die<br />
Reaktionsmuster entwickeln sich während des Säuglingsalters als maßgeblicher Teil<br />
der posturalen Ontogenese.<br />
Die Bewertung erfolgt nach zwei Gesichtspunkten: das Lagereaktionsalter<br />
(posturales Alter) und Zahl der abnormalen Reaktionen (Abbildung 1). Die idealen<br />
Antworten auf die 7 Lageveränderungen ergaben sich für alle Lebensalter zwischen<br />
Geburt (40.SSW) und dem 10. Lebensmonat aus zahlreichen Einzelbeobachtungen<br />
und wurden von Vojta als Idealitätsmaßstab nach rein kinesiologischen<br />
Gesichtspunkten definiert. Im Alter von 4-6 Wochen erfüllen z.B. 70% der Säuglinge<br />
diese idealen Kriterien (Costi et al. 1983). Die interindividuelle Variabilität der<br />
Reifung wurde dadurch berücksichtigt, daß Abweichungen des posturalen Alters<br />
vom Lebensalter bis zu höchstens 3 Monaten noch als normal beurteilt werden.<br />
Bei der kinesiologischen Bewertung der Reaktionen unterscheidet man globale<br />
Muster (z.B. Beugesynergie des 2. Trimenons) und Teilmuster (z.B. lockere<br />
Streckung des Armes, Pronation der Hand). Jede Abweichung von den idealen<br />
Reaktionsmustern führt zur Bewertung der jeweiligen Reaktion als abnormal. Eine<br />
Retardierung des Lagereaktionsalters (=posturales Alter) von mehr als 3 Monaten<br />
führt ebenfalls zur Bewertung der Lagereaktion als abnormal, selbst wenn die<br />
Teilmuster nicht von der idealen Form abweichen. Der idealen Reaktionsweise<br />
(= keine abnormalen Lagereaktionen, LR) wird die abnormale mit folgender<br />
Quantifizierung gegenübergestellt:<br />
− 1-3 abnormale LR = leichteste Zentrale Koordinationsstörung (ZKS)<br />
− 4-5 abnormale LR = leichte ZKS<br />
− 6-7 abnormale LR = mittelschwere ZKS<br />
− 7 abnormale LR + schwere Muskeltonusstörung = schwere ZKS<br />
Die Beziehung der posturalen Reaktionen zum Entwicklungsstand der Aufrichtung,<br />
Fortbewegung und Greifmotorik wird als so eng angesehen, daß Vojta von<br />
provozierten, posturalen Reaktionen (Lagereaktionen) und spontanen, posturalen<br />
Aktionen (Spontanmotorik) spricht. Insofern sind bei abnormalen Lagereaktionen<br />
immer auch Abweichungen von idealen spontanen Aufrichtungs- und<br />
Fortbewegungsmustern zu erwarten. Je abnormaler die Teilmuster und globalen<br />
5
Muster der Lagereaktionen ausfallen, desto weniger ist das posturale Alter des<br />
Säuglings bestimmbar. Besteht eine schwere zerebrale Bewegungsstörung, ist das<br />
posturale Alter weder ablesbar noch entwickelt es sich weiter (Blockade der<br />
posturalen Ontogenese). Auch die Waltezeit der Primitivreflexe und die<br />
Abschwächung ihrer Intensität sind entscheidend vom Stand der posturalen<br />
Entwicklung (nicht alleine vom Lebensalter) abhängig.<br />
Die begriffliche Unterscheidung zwischen "idealer” und "abnormaler”<br />
Reaktionsweise ist semantisch nicht einwandfrei; es müßte eigentlich "ideal” und<br />
"nicht ideal” heißen. Die Idealität wurde nach rein kinesiologischen Gesichtspunkten<br />
festgelegt und beruht nicht auf statistischen Erhebungen. Die idealen<br />
kinesiologischen Muster der Lagereaktionen wurden nach klinischer Erfahrung<br />
einem idealen posturalen Alter zugeordnet. Ihre Beziehung zur normalen<br />
motorischen Ontogenese stützt sich wesentlich auf die von Gesell (1964,1988)<br />
angegebenen motorischen Meilensteine. Dadurch gelang es auch, eine Beziehung<br />
zum Lebensalter herzustellen, die relativ locker ist, da Unterschiede in der normalen<br />
individuellen Entwicklungsgeschwindigkeit bis zu drei Monate toleriert werden.<br />
Der Begriff "pathologisch" wird im Zusammenhang mit den posturalen Reaktionen<br />
und der ZKS nicht benutzt, denn der zunehmende Abweichungsgrad der<br />
Haltungsmuster von der Idealität zeigt nur ein steigendes symptomatisches Risiko<br />
für eine evtl. erst später definierbare Entwicklungsstörung an.<br />
b) Die Prüfung der automatischen Reaktionen hat das Ziel, die zunehmenden<br />
Einflüsse der obersten Kontrollebenen des ZNS auf die Ausprägung der<br />
Stellreaktionen, der Kettenreaktionen und der Gleichgewichtsreaktionen während<br />
des 1. Lebensjahres zu erfassen. Ihre altersabhängige Entwicklung gilt als Indikator<br />
für die Entwicklung und Reifung der Haltungskontrolle und der motorischen<br />
Entwicklung. Die Prüfung erfolgt mittels Beobachtung spontaner motorischer<br />
Aktivität und interaktiver Motorik in einem dem Kind verständlichen und adäquaten<br />
Kontext.<br />
Die Stellreaktionen steuern die Einstellung des Kopfes im Raum sowie die<br />
Ausrichtung der Rumpfsegmente zueinander und in Beziehung zum Kopf. Sie<br />
dienen der Orientierung des Körpers im Raum im Bezug auf die Schwerkraft, auf die<br />
Unterstützungsfläche sowie auf andere sensorische Reize. Im einzelnen wurden<br />
folgende Reaktionsmuster beschrieben: die Labyrinthstellreaktion auf den Kopf, die<br />
Kopfstellreaktion auf den Körper, die Körperstellreaktion auf den Körper, die<br />
Körperstellreaktion auf den Kopf, sowie die optische Stellreaktion (R. Magnus 1924).<br />
Die Kettenreaktionen (Peiper 1963) wirken - z.B. ausgehend von der<br />
Labyrinthstellreaktion - von einem Körpersegment auf das nächste (wie von einem<br />
Kettenglied zum anderen) entlang des Rumpfes und der Extremitäten mit fortlaufend<br />
koordinierten Muskelkontraktionen (z.B. im Sinne der Extension und Abduktion). Sie<br />
können sich sowohl in kraniokaudaler wie auch in umgekehrter Richtung auswirken.<br />
Es können symmetrische und asymmetrische Kettenreaktionen beobachtet werden.<br />
Unter Gleichgewichtsreaktionen versteht man Veränderungen der Haltung des<br />
Rumpfes und der Extremitäten, sowie automatische Bewegungsantworten als<br />
Reaktion auf Einwirkungen, die zu einer Verlagerung des Körperschwerpunktes<br />
führen oder führen können. Sie bestehen nicht nur in Tonusänderungen oder<br />
Bewegungen des Rumpfes sondern auch der Extremitäten.<br />
6
c) Es werden angeborene und reifende Bewegungs- und Reaktionsmuster<br />
beschrieben, die sowohl den Reifegrad der Körperhaltungskontrolle als auch der<br />
motorischen Entwicklung erkennen lassen, da sie sich entsprechend der Reifung<br />
und Entwicklung des ZNS in charakteristischer Weise ändern. Die Haltungskontrolle<br />
stellt die Basis für die Willkürmotorik dar. Verläßliche Normwerte für die Entwicklung<br />
der automatischen Reaktionen existieren nicht.<br />
d) Die Vertreter des Bobath-Konzepts sehen die Grenzen bei der Beurteilung der<br />
posturalen Reagibilität von Vojta zu eng gesetzt. Für die Vertreter des Vojta<br />
Konzeptes sind die sehr variablen Angaben über das normale Auftreten der<br />
automatischen Reaktionen nicht vereinbar mit dem Ziel einer frühen Erkennung von<br />
zerebralen Bewegungsstörungen (siehe auch Kapitel C).<br />
Zentrale Koordinationsstörungen / sensomotorische Koordinationsstörung<br />
a) Die Zentrale Koordinationsstörung (ZKS) ist eine zusammenfassende<br />
Bewertung abnormaler Lagereaktionen. Sie bedeutet eine aktuelle<br />
entwicklungsneurologische Funktionsbeschreibung des Nervensystems,<br />
insbesondere der motorischen Regulationskreise, und spiegelt die Funktionen der<br />
Afferenzen, zentralen Verarbeitung und Efferenzen, einschließlich des Muskel-<br />
Skelettsystems wider. Die Wahrscheinlichkeit einer pathologischen Entwicklung<br />
erhöht sich mit steigender Zahl abnormaler Lagereaktionen bzw. mit<br />
unterschiedlichem Ausprägungsgrad der ZKS insbesondere wenn die Ergebnisse<br />
bei Kontrolluntersuchungen gleich bleiben oder sich gar verschlechtern. Hinter der<br />
ZKS verbergen sich nicht nur rein motorische, sondern auch intellektuelle<br />
Entwicklungsstörungen und andere Beeinträchtigungen, die zu Störungen der<br />
motorischen oder mentalen Entwicklung führen können (Imamura et al.1983, Costi<br />
et al. 1983). Spontane Verbesserungen der ZKS nach dem 6. Lebensmonat sind<br />
häufig (Lajosi 1985).<br />
b) Unter dem Begriff der sensomotorischen Koordinationsstörung sollen<br />
Abweichungen vom normalen Verhalten zusammengefaßt werden, die sich bei der<br />
Beobachtung des Spontanverhaltens, der Prüfung der automatischen Reaktionen,<br />
der Beurteilung des motorischen Entwicklungsstandes und der klinischneurologischen<br />
Untersuchung als sensomotorische oder mentale<br />
Entwicklungsstörungen bzw. Defizite zeigen. Die Ursache dafür kann im ZNS, aber<br />
auch im peripheren Nervensystem oder dem Muskel- und Bindegewebesystem<br />
liegen.<br />
Solche Abweichungen sind z.B. die folgenden Störungsbilder:<br />
Hyperexzitabilitätssyndrom, Hemisyndrom mit einseitiger Bewegungssstörung,<br />
Hypotoniesyndrom oder Apathiesyndrom und Hypertoniesyndrom. Die verwendeten<br />
Bezeichnungen sind nicht Bobath-spezifisch, sie werden z.B. bei den<br />
Früherkennungsuntersuchungen U4 -U6 verwendet). Eine weitere Bezeichnung ist<br />
die ”Dystonie”: dem Alter und der Beobachtungssituation nicht adäquater posturaler<br />
Tonus, vom Wortsinn her. Die häufigste Form: hypotoner Hals und Rumpf,<br />
hypertone Extremitäten, entspricht der Beschreibung von Drillien (1972).<br />
Weitere Symptome können sein: Asymmetrie, Muskelypertonie oder -hypotonie in<br />
7
anderen Körperregionen. Bei günstigem Verlauf (Normalisierung) wird retrospektiv<br />
von einer transienten Dystonie gesprochen.<br />
c) Es handelt sich bei allen Begriffen um eine vorläufige Beschreibung einer<br />
Auffälligkeit der Bewegungsentwicklung, deren Ursache nicht nur in einer Störung<br />
des ZNS liegen muß.<br />
d) Sowohl die transiente Dystonie als auch die Definition verschiedener Syndrome,<br />
die bei den Früherkennungsuntersuchungen benutzt werden, sind im Vojta Konzept<br />
deshalb entbehrlich, da das Begriffssystem der ZKS die Quantifizierung einer<br />
neurologischen Störung, eine Verlaufskontrolle und eine frühe Einschätzung der<br />
Prognose erlauben soll. Die beim Bobath Konzept genannten Begriffe und<br />
Beschreibungen der Störungsbilder sollen eine adäquatere Beurteilung und<br />
Verlaufseinschätzung ermöglichen, sie auf einer Prüfung im einem funktionellen<br />
Zusammenhang und in der entwicklungsgemäßen Auseinandersetzung mit der<br />
Umwelt beruhen. Siehe auch Kapitel C.<br />
Primitiv-Reflexe/ primäre Reaktionen<br />
a) Unter Primitivreflexen werden Automatismen und Reaktionen der<br />
Neugeborenen und Säuglinge bis zum Ende des ersten Trimenons verstanden, die<br />
unmittelbar, unwillkürlich und regelmäßig im Wachzustand reproduzierbar sind.<br />
Diese sind vornehmlich das Puppenaugenphänomen, der optiko-faziale Reflex, die<br />
oralen Suchreflexe (Rootingreflexe), der Babkin-Reflex, die Greifreflexe der Hand<br />
und des Fußes, die Galant-Reaktion, der suprapubische und der gekreuzte<br />
Streckreflex, der Fersen- und Handwurzelreflex, das positive Supporting der Beine<br />
und der Gehautomatismus (Anhang Tabelle I).<br />
Die "Waltezeit" der Primitivreflexe wurde von Vojta (1988) beschrieben. Die<br />
entsprechenden Altersangaben beziehen sich immer auf das posturale Alter. Bei<br />
reifen, normalen Säuglingen ist spätestens nach 3 Monaten - bei den meisten<br />
Reflexen schon früher - eine Auslösung nicht mehr möglich. Vojta nennt diese<br />
Entwicklung die "Dynamik der Primitivreflexe".<br />
Die Greifreflexe der Hand und des Fußes sind bis zur Entwicklung der Stütz- und<br />
Greiffunktion der Hand, bzw. bis zur Entwicklung der Stützfunktion des Fußes<br />
nachweisbar. Bestehen Primitiv-Reflexe bei retardiertem posturalem Alter und<br />
idealen oder nahezu idealen Lagereaktionen 3 Monate über die angegebenen<br />
"Waltezeiten" hinaus, so ist aus klinischer Erfahrung mit einer gestörten mentalen<br />
Entwicklung zu rechnen. Persistieren sie bei abnormalen Lagereaktionen, so muß<br />
man von einer "motorischen Pathologie" ausgehen, die bereits im 2. Trimenon<br />
näher bezeichnet werden kann (Abbildung 2). Auch konstante Seitendifferenzen oder<br />
ein vorzeitiges Nichtvorhandensein sind unspezifische Zeichen einer pathologischen<br />
Entwicklung (Futagi et al. 1995).<br />
Futagi et al. (1992) beobachteten, daß die meisten Primitiv-Reflexe normalerweise<br />
mit etwa 3-4 Monaten nicht mehr zu finden waren, außer bei Kindern mit einer<br />
zerebralen Bewegungsstörung, bei der sie auch über das erste Lebensjahr hinaus<br />
persistieren können (Abbildung 3)und (Abbildung 4). Diese Ergebnisse wurden bestätigt<br />
bei Berechnung der Mittelwerte und Streubreite von Futagi (persönliche Mitteilung),<br />
8
sowie in den Studien von Ferro (1991) und Zafeiriou et al. (1995). Dies gilt auch für<br />
die vorzeitige Abschwächung der Galant-Reaktion und des plantaren Greifreflexes<br />
bei sich entwickelnder Spastik und ihre Persistenz bei sich entwickelnden Athetosen<br />
(Futagi et al. 1995).<br />
b) Die primären Reaktionen des Neugeborenen und Säuglings sind regelhaft<br />
auslösbare motorische Antworten auf definierte kutane und/oder propriozeptive<br />
Reize, z.B. durch Änderungen der Körperlage. Bei normaler Entwicklung erscheinen<br />
die meisten dieser Reaktionen im Verlauf der ersten Lebensmonate. Sie<br />
verschwinden schließlich in ihrer ursprünglichen Ausprägung und werden<br />
wahrscheinlich als motorische Teilprogramme in die sich entwickelnden<br />
differenzierteren Bewegungsabläufen eingeordnet. Es handelt sich dabei um<br />
unterschiedliche, von verschiedenen Autoren beschriebene Reaktionen wie z.B.<br />
Puppenaugenphänomen, orale Suchreaktion, Mororeaktion, Galant-Reaktion, Hand-<br />
und Fußgreifreflexe und primäres Schreiten etc.. Neben einer erheblich verlängerten<br />
Nachweisbarkeit dieser Reaktionen, (normalerweise sind die primären Reaktionen<br />
etwa nach dem 3. Lebensmonat abgeklungen), sind ihr völliges Fehlen und eine<br />
konstant asymmetrische Antwort als auffällige Befunde zu bewerten und können die<br />
aus anderen Untersuchungstechniken resultierenden Hinweise auf eine Störung der<br />
motorischen Entwicklung oder des ZNS unterstützen (André-Thomas et al. 1966,<br />
Bobath 1986).<br />
c) Bei einer Wertung der bisherigen Studien über die klinische, insbesondere auch<br />
diagnostische Bedeutung der Primitivreflexe oder primären Reaktionen muß<br />
berücksichtigt werden, daß selbst namensgleiche Reaktionen oder Reflexe<br />
uneinheitlich ausgelöst und beurteilt werden.<br />
d) Im Bobath-Konzept ist das Verschwinden bzw. Auftreten von primären<br />
Reaktionen mit der motorischen Entwicklung nicht so eng verknüpft wie im Vojta-<br />
Konzept. Nach dem Vojta-Konzept korreliert die Persistenz bestimmter<br />
Primitivreflexe im 2. Trimenon eng mit dem Schweregrad der ZKS. Daraus wird eine<br />
hohe prognostische Aussagekraft für die Entwicklung einer zerebralen<br />
Bewegungsstörung abgeleitet.<br />
B) WIRKWEISE UND DURCHFÜHRUNG DER KRANKENGYMNASTISCHEN<br />
BEHANDLUNG BEI KINDERN MIT ZEREBRALEN BEWEGUNGSSTÖRUNGEN<br />
In diesem Kapitel soll dargestellt werden, wie man sich den Einfluß der<br />
Krankengymnastik allgemein und speziell bei der Behandlung nach den Konzepten<br />
von Vojta und Bobath vorstellt und welche neurophysiologischen Grundlagen<br />
bestehen (Übersicht bei Karch et al. 1993).<br />
KRANKENGYMNASTIK ALLGEMEIN<br />
9
Muskel und Bindegewebe<br />
Jede aktive und passive krankengymnastische Übung beeinflußt das Muskel-<br />
Bindegewebs-Skelettsystem. Wenn Bewegungsausmaß und -intensität<br />
eingeschränkt sind, kommt es zu strukturellen Veränderungen, die zu einer<br />
Kontraktur führen können (O'Dwyer et al. 1989). Es gibt auch Hinweise aus<br />
Tierexperimenten, daß die Muskulatur der spastischen Maus langsamer wächst als<br />
die der gesunden, wodurch die Entstehung von Gelenkkontrakturen unterstützt wird<br />
(Ziv et al. 1984).<br />
Veränderungen des Muskelaufbaus bei Kindern und Erwachsenen mit einer<br />
spastischen Bewegungssstörung wurden von mehreren Arbeitsgruppen beschrieben<br />
( Castle et al. 1979, Tardieu et al. 1977 und 1979, Dietz et al. 1981 und 1986,<br />
Bourbonnais et al. 1989, Dietz et al. 1995). Tardieu et al. 1982a und b) leiten aus<br />
unterschiedlichen strukturellen und biomechanischen Eigenschaften der Muskulatur<br />
auch unterschiedliche therapeutische Maßnahmen bei der ICP ab. Allerdings lassen<br />
sich nur relativ geringe histologische Veränderungen nachweisen (Übersichten bei<br />
Bax et al. 1985 und Bleck 1987).<br />
Spinale Ebene<br />
Über afferente Rückmeldungen wirken sich biomechanische Veränderungen und<br />
krankengymnastische Übungen auf das spinale System aus.<br />
In einer Übersichtsarbeit haben Umphread et al. (1985) die neurophysiologischen<br />
Grundlagen analysiert. Beugen und Strecken der Gelenke, aktives und passives<br />
Dehnen, Tapping, Druck auf die Muskeln, isometrische Anspannung und<br />
Aufrichtung gegen die Schwerkraft aktivieren das Muskelspindel-System durch<br />
Längenänderung, das Golgi-System durch Spannungsänderung und die<br />
Gelenkrezeptoren durch statische oder dynamische Belastung des Gelenks.<br />
Zusätzliche Stimulationen durch Wärme- Kälte oder Vibrationsreize werden<br />
allgemein bei der Krankengymnastik eingesetzt.<br />
Jede motorische Übung wirkt sich auf die Entladungsbereitschaft der Alpha-<br />
Motoneurone aus; nicht nur wegen der beschriebenen biomechanischen Effekte,<br />
sondern auch über neurale Regelkreise. Eine tonische Dauerdehnung hemmt, eine<br />
phasische Muskeldehnung bahnt die Entladungsbereitschaft. So konnten Nash et al.<br />
(1989) nachweisen, daß bei repetitiver Dorsalflexion des Fußes die Empfindlichkeit<br />
des tonischen Streckreflexes bei Kindern mit spastischer Bewegungssstörung<br />
gesenkt werden kann, wodurch sich die Muskelspannung verringert. Alle afferenten<br />
Impulse werden von den supraspinalen Zentren moduliert. Es kann vermutet<br />
werden, daß diese Modulation (auf supra- und spinaler Ebene) aufgabenspezifisch<br />
ist, und daß z.B. eine Hemmung (im Sitzen) in eine Bahnung (beim Stehen)<br />
umgewandelt werden kann (Faist et al. 1995).<br />
Das supraspinale System und Plastizität des ZNS<br />
In tierexperimentellen Studien wurde eine Reihe von schablonenartigen<br />
Bewegungs- und Haltungsmustern beschrieben (sog. Labyrinth- und Halsreflexe),<br />
sobald der Einfluß von supraspinalen Zentren ausgeschaltet worden war.<br />
Muskeltonus, Körperhaltung, automatische Bewegungsabläufe, Stellreaktionen und<br />
Laufreaktionen werden auf der spinalen und Hirnstamm-Ebene generiert (Schmidt<br />
10
und Wiesendanger 1993). Zur sinnvollen, kontrollierten und angepaßten Bewegung<br />
ist die Mitwirkung höherer Zentren jedoch unerläßlich. Bei Kindern mit frühkindlichen<br />
Hirnschäden und einer daraus resultierenden zerebralen Bewegungssstörung<br />
beeinflussen diese schablonenhaften Muster Körperhaltung und Bewegungsablauf<br />
besonders eindrucksvoll, da der gestörte supraspinale Einfluß die normale Reifung<br />
behindert (Berger et al. 1982 und 1984).<br />
Bei der Behandlung wird das Wechselspiel zwischen Peripherie und ZNS auf allen<br />
Ebenen angesprochen. Rückmeldevorgänge und Programmierung von<br />
Bewegungsabläufen geschehen nicht ohne Beteiligung der supraspinalen Ebene.<br />
Gerade die höheren Ebenen der sensomotorischen Kontrollsysteme sind allerdings<br />
am meisten geschädigt, wodurch Perzeption, Verarbeitung und Programmierung in<br />
unterschiedlicher Weise beeinträchtigt sind.<br />
Die Konzepte<br />
Das Konzept der krankengymnastischen Behandlung auf neurophysiologischer<br />
Grundlage setzt auf die Plastizität des ZNS und auf Reorganisations- und<br />
Kompensationsvorgänge, die im Tierexperiment und beim Menschen beobachtet<br />
worden sind (Tabelle 6).<br />
Viele Publikationen zur Plastizität des ZNS beschäftigen sich allerdings mit<br />
erworbenen, meist selektiven Hirnschädigungen oder mit ungewöhnlichen<br />
Beispielen wie Hemisphärektomien oder Callosotomien im frühen Kindesalter, wobei<br />
die übrigen Hirnareale wahrscheinlich unversehrt oder zumindest klinisch ungestört<br />
funktionstüchtig erscheinen (Hallet et al. 1993, Kaas et al. 1991, Hallet 1995). Bei<br />
Kindern mit kongenitaler Hemiparese konnte nachgewiesen werden (Farmer et al.<br />
1991, Carr et al. 1993), daß die ipsilateralen kortikospinalen Bahnen und<br />
Verbindungen zur Steuerung der plegischen Seite eingesetzt werden können. Wie<br />
groß die Chance für solche Reparaturvorgänge bei Kindern mit frühkindlichen<br />
Hirnschädigungen oder Hirnaufbaustörungen ist, kann im Prinzip nicht beurteilt<br />
werden. Die Behandlungs-effekte lassen sich z.B. von denen der gleichzeitig<br />
stattfindenden Reifung und Entwicklung nicht sicher abgrenzen.<br />
Ein weiterer Aspekt ist die Wirkung neurotropher Faktoren, welche in den letzten<br />
Jahren, vor allem an Tiermodellen und in vitro, untersucht worden sind. Sie sind<br />
wichtig als Basis aller neurologischer Regenerationsvorgänge und beeinflussen<br />
auch die normale Reifung und Entwicklung des ZNS. Ob ihnen eine klinische<br />
Relevanz im Zusammenhang mit der Behandlung der zerebralen Bewegungstörung<br />
zukommt, ist eine offene Frage ( Snider et al. 1989).<br />
Historisch gesehen, war man am Anfang des Jahrhunderts u.a. aufgrund von<br />
neuroanatomischen Untersuchungen Cajals (1928) der Meinung, daß es<br />
regeneratorische Prozesse im ZNS praktisch nicht geben würde. Bereits Foerster<br />
(1936) hat dagegen die Reorganisationsfähigkeiten des ZNS hervorgehoben im<br />
Sinne einer "Betriebsumstellung" bzw. Arbeitsgemeinschaft mit und von erhaltenen<br />
ZNS-Arealen. Man blieb aber skeptisch gegenüber den eigentlichen Regenerationsfähigkeiten.<br />
Aus diesem Grunde konzentrierte sich die krankengymnastische<br />
Behandlung von zerebralen Bewegungsstörungen auf biomechanisch wirksame<br />
Maßnahmen: passives Durchbewegen, Schienen, Weichteiloperationen u.a. Später<br />
rückte die aktive Bewegungstherapie in den Mittelpunkt (Köng 1991). Auch<br />
zweifelhafte Methoden wie das systematische passive Einüben von primitiven<br />
Bewegungsschablonen in der angenommenen Reihenfolge der phylogenetischen<br />
11
oder ontogenetischen Entwicklung (z.B. speziell im Konzept von Doman und<br />
Delacato) wurde versucht (Karch et al. 1997).<br />
In dieser Zeit entwickelte man auch die Vorstellung, daß man Einfluß nehmen könne<br />
nicht nur auf das motorische System selbst, sondern auf die zugrunde liegenden<br />
Störungen und Läsionen des ZNS, indem man Kompensations-, Reorganisations-<br />
und auch Regenerationsvorgänge stimulieren und ausnutzen könne. Die<br />
Krankengymnastik auf neurophysiologischer Grundlage formulierte erstmals unter<br />
dem Einfluß des Ehepaars Bobath, daß es darauf ankommt, normale<br />
sensomotorische Erfahrungen anzuregen bzw. zu sammeln, die dann bei der<br />
Planung der aktiven Bewegungen und Handlungen eingebunden werden können.<br />
Hinweise zur Früherkennung einer gestörten psychomotorischen Entwicklung<br />
einschließlich einer zerebralen Bewegungsstörung, d.h. zu einem Zeitpunkt, an dem<br />
das Vollbild der Erkrankung noch nicht ausgeprägt ist, gab erstmals Eirene Collis<br />
(1953 und 1954). Sie leitete auch die Eltern im Umgang mit ihrem Kind an, so daß<br />
funktionseinschränkende Fehlentwicklungen reduziert wurden, und legte einen<br />
Grundstein für die Frühbehandlung.<br />
Nach wie vor bleiben zur Wirkungsweise der Krankengymnastik bei Patienten bzw.<br />
Kindern mit zerebralen Bewegungsstörungen Antworten auf viele wichtige Fragen im<br />
Bereich von weithin akzeptierten Annahmen und persönlichen Erfahrungen offen:<br />
− Können verbleibende Verbindungswege erhalten oder gefestigt werden, und<br />
wenn ja, wie geschieht dies?<br />
− Kann eine frühzeitig beginnende Behandlung zu einer besseren oder<br />
rascheren Reorganisation führen?<br />
− Inwieweit können Ersatzwege angeregt werden, insbesondere bei Kindern,<br />
deren Neuroplastizität, nach allem was wir wissen, größer ist?<br />
− Wieviel aktive Bewegung ist erforderlich, um einen motorischen Ablauf zu<br />
− trainieren? Wieviel darf passiv sein?<br />
− Kann man, ohne bestimmte Entwicklungsschritte zu berücksichtigen, ein<br />
− aufgabenspezifisches Training (Laufen für Laufen, Greifen für Greifen,<br />
Handbewegung für Handbewegung) durchführen?<br />
− Wie groß ist der Effekt eines allgemeinen Arousals, unter Berücksichtigung<br />
von Untersuchungsergebnissen zu evozierten Potentialen bei<br />
Lernvorgängen?<br />
− Welchen Anteil haben positive und negative emotionale Beteiligung und<br />
− Motivation des Patienten an motorischen Lernvorgängen?<br />
− Wie erkennt man, in wieweit ein gestörter Bewegungsablauf beeinflußt wird<br />
von falschen Ersatzstrategien, die nicht nur von der Läsion selbst, sondern<br />
z.B. durch eine forcierte bewußte Kontrolle bei zielgerichteten Bewegungen,<br />
im Sinne einer Ko-Kontraktion, bedingt sind? Wie kann es gelingen neue<br />
Ersatzstrategien zu finden, die automatisiert werden können?<br />
Diese Fragen sind bei infantilen Zerebralparesen noch schwieriger zu beantworten<br />
als bei später erworbenen Bewegungsstörungen. Fehlende und gestörte<br />
Weiterreifung können sich potentiell überlappen mit diesen Ersatzstrategien.<br />
Mögliche Auswirkungen der krankengymnastischen Behandlung interferieren mit<br />
dem Verlauf der Reifung und Entwicklung des zentralen Nervensystems.<br />
12
a) KRANKENGYMNASTIK NACH DEM VOJTA KONZEPT<br />
Vojta bezeichnet seine krankengymnastische Therapie als Aktivationsprinzip der<br />
Reflexlokomotion. Spezifische Zonen werden durch den Druck in definierter<br />
Richtung gereizt. Dadurch werden lageabhängig verschiedene Lokomotionsmuster<br />
ausgelöst, aus der Bauchlage das Reflexkriechen, aus der Rückenlage die erste<br />
Phase des Reflexumdrehens und aus der Seitlage die zweite Phase des<br />
Reflexumdrehens.<br />
Historie<br />
Seit 1954 entwickelte Vojta seine Therapie bei normalbegabten, gehfähigen<br />
Schulkindern mit infantilen Zerebralparesen (CP). Er versuchte zunächst, die<br />
typischen pathologischen Haltungsstereotypien der CP bei Spastikern passiv zu<br />
verändern. Anfangs nutzte er dazu auch Aufforderungen, die zur Haltungsänderung<br />
von Rumpf und rumpfnahen Extremitätengelenken führen sollten. Dabei<br />
beobachtete er, daß definierte Veränderungen der Rumpfhaltung regelmäßig<br />
bestimmte Bewegungen distal an den Extremitäten provozierten und daß mit<br />
bestimmten Ausgangsstellungen der Zugang zu den provozierten<br />
Haltungsänderungen und phasischen Bewegungen erleichtert wurde. Diese<br />
Ausgangsstellungen wurden zunächst als "Attitüden", später als aktivierte oder labile<br />
Körperlagen bezeichnet.<br />
Nach den Übungen berichteten die Patienten regelmäßig von einem Gefühl der<br />
Lockerung, welches bis zu einigen Stunden anhielt. Eine erste Langzeitauswirkung,<br />
schon wenige Wochen nach Behandlungsbeginn, war die Verbesserung des<br />
Sprechens bei verschiedenen CP-Bildern. Während der Krankengymnastik und<br />
auch einige Zeit danach konnten gerade dort vermehrte Muskelaktivitäten<br />
beobachtet werden, wo sie typischerweise bei CP-Kindern mangelhaft vorhanden<br />
waren, wie die Aktivität der Schulterblattadduktoren und die der Außenrotatoren der<br />
proximalen Extremitäten-gelenke (Hüft- und Schultergelenke: Schlüsselgelenke).<br />
Dagegen reduzierten die Antagonisten dieser aktivierten Muskeln fühlbar ihre<br />
Anspannung. Diese Beobachtungen waren bei der leichten CP die Regel und<br />
führten zu der hypothetischen Vorstellung, daß die CP therapeutisch beeinflußbar<br />
sein müßte.<br />
Die Behandlungen mußten wiederholt werden, da die günstige Nachwirkung<br />
zunächst nur wenige Minuten anhielt. Diese Zeitspanne verlängerte sich mit der<br />
Gesamtdauer der Behandlung. Zudem erschienen allmählich neue, bisher für den<br />
CP-Patienten nicht oder nicht ausreichend verfügbare Funktionen, die im<br />
Übungsprogramm nicht konkret angestrebt wurden. Nämlich: eine verbesserte<br />
Rumpfhaltung, eine Steigerung der aktiven Beweglichkeit in den Schulter- und<br />
Hüftgelenken, effektivere Mundmotorik bei der Nahrungsaufnahme. Aber auch eine<br />
Verbesserung der vegetativen Funktionen, wie die Steigerung der costalen Atmung,<br />
Zunahme der Darmentleerungen und Minderung des Strabismus convergens<br />
alternans bei Kindern mit spastischer Diparese wurde beobachtet. Bei gehfähigen<br />
Jugendlichen war schon nach wenigen Behandlungen eine positive Veränderung<br />
des Schrittzyklus zu sehen. Die während der Therapie regelmäßig aktivierten<br />
Bewegungsmuster hatten zudem einen reziproken Charakter: so wurden bei der<br />
Reizung auf einer Seite des Rumpfes ein Bein gestreckt, Rumpf und Arm gebeugt,<br />
bei der Reizung auf der Gegenseite wurden das eben gestreckte Bein gebeugt,<br />
sowie Rumpf und Arm gestreckt. Außerdem löste der Reiz auf nur einer Körperseite<br />
13
ein reproduzierbares motorisches Muster auf beiden Körperseiten aus. Diese<br />
Beobachtungen führten zur Ansicht, daß den provozierten Reaktionen komplexe<br />
Reaktionsmuster zugrunde liegen, die als Koordinationskomplexe" bezeichnet<br />
wurden.<br />
Nicht nur Extremitätenbewegungen konnten systematisch ausgelöst werden,<br />
sondern auch eine aktive Streckhaltung der gesamten Wirbelsäule mit Reduzierung<br />
der Kopfreklination und der ventralen Beckenbeugung, die von Vojta als<br />
”Aufrichtung des Axisorgans” bezeichnet wurde. Die Auswirkung auf das<br />
autochthone Muskelsystem der Wirbelsäule wurde als die eigentliche Ursache für<br />
die verbesserte Haltung und Bewegung der Extremitäten in den Schlüsselgelenken<br />
angesehen. Auch sakkadische Augenbewegungen gehörten regelmäßig dazu, die in<br />
Richtung der stimulierten Kopfdrehung abliefen. Die genauere Beobachtung der<br />
Koordinationskomplexe nahm viele Jahre in Anspruch. Durch die bessere Kenntnis<br />
der Reizantworten konnte auf die anfangs genutzten Kommandos verzichtet und<br />
statt dessen der bewegungsführende Widerstand an den Extremitäten mit dem<br />
gleichen Ergebnis eingesetzt werden. Die Reizungen wurden zunehmend<br />
punktueller, und bestimmte Reizzonen wurden definiert (Tabelle 7). Die regelmäßig<br />
provozierbaren Koordinationskomplexe erweckten den Eindruck, als ob sie Teile<br />
einer Lokomotion wären. So lag der Begriff der Reflexlokomotion nahe, und zwei<br />
definierte Koordinationskomplexe wurden publiziert: der aus der Bauchlage<br />
(Reflexkriechen, Vojta 1965 und 1968) und der aus der Rückenlage<br />
(Reflexumdrehen, Vojta 1970). Während das Reflexumdrehen der spontanen<br />
menschlichen Körperdrehung analog war, fand sich für den Koordinationskomplex<br />
Reflexkriechen keine eindeutige Analogie in der Spontanmotorik des Menschen.<br />
Entscheidend für das Verständnis der Therapie, als auch ihrer Resultate bei<br />
Patienten mit CP, war für Vojta die Annahme einer "Blockierung" der posturalen<br />
Ontogenese durch die Hirnschädigung. Auch die lokomotorische Ontogenese<br />
entwickelt sich bei dem schwer zerebral geschädigten Säugling nicht über den<br />
Zustand der ersten sechs Lebenswochen hinaus ("ist blockiert"). Normalerweise ist<br />
dieser Säugling aber dennoch bemüht, zu greifen, sich aufzurichten und sich<br />
fortzubewegen. Die dafür notwendigen Haltungs- oder Bewegungsmuster stehen<br />
ihm dafür aber nicht oder nur begrenzt zur Verfügung. So weicht er während der<br />
Entwicklung seiner motorischen Kommunikation mit der Umwelt auf sog.<br />
"Ersatzmuster" aus. Diese werden auch als abnormale Muster in den<br />
Lagereaktionen beobachtet. Während der krankengymnastischen Behandlung soll<br />
die Möglichkeit eröffnet werden, zunehmend die von Vojta beschriebenen idealen<br />
Muster der Reflexlokomotion einzusetzen und somit weniger auf Ersatzmuster<br />
angewiesen zu sein.<br />
Ist die Behandlung erfolgreich, können in den Lagereaktionen zunächst die ”idealen<br />
Muster” der Neugeborenenzeit beobachtet werden. Nach dem Erreichen der idealen<br />
Neugeborenenmuster (”Startstufe der posturalen Ontogenese”) durchläuft der<br />
Säugling die weiteren Entwicklungsschritte der posturalen Ontogenese. Parallel<br />
dazu normalisiert sich auch die Spontanmotorik ( Vojta et al. 1989b).<br />
14
Heute<br />
Kurz zusammengefaßt, wurden in den mehr als 40 Jahren seit der Entwicklung der<br />
Reflexlokomotion regelmäßig folgende Beobachtungen während der<br />
krankengymnastischen Behandlung gemacht:<br />
− Abhängigkeit des Ablaufes der Reflexlokomotion von bestimmten<br />
Körperhaltungen ("aktivierte oder labile Lage");<br />
− Provokation reziproker Extremitäten-Bewegungs-Muster;<br />
− aktiv gehaltene Streckung des gesamten Rumpfes infolge Aktivierung der<br />
autochthonen Wirbelsäulenmuskulatur ("Rumpfaufrichtung");<br />
− Annäherung der Muskelaktivierung an ideale Bewegungsabläufe;<br />
− Funktionsdifferenzierung des einzelnen Muskels: erst eine größere Variabilität<br />
von exzentrischer und konzentrischer isometrischer wie auch phasischer<br />
Kontraktionsfähigkeit ermöglicht eine Umkehr der Kontraktionsrichtung. Diese<br />
ist notwendig für den Austausch von Punctum fixum und mobile in<br />
unterschiedlichen Funktionszusammenhängen (z.B. Beugung des<br />
Unterarmes vs. Heranziehen des Rumpfes an den gestützten Ellenbogen im<br />
Reflexkriechen);<br />
− Wirkung auf vegetative Funktionen wie Hautrötung und lokale<br />
Schweißbildung in der aktivierten Körperregion, sowie auf Respiration,<br />
Darmperistaltik und Urinentleerung.<br />
Langfristig lassen sich klinisch eine funktionelle Besserung des klinischen<br />
Zustandes ohne Training von Einzelfunktionen beobachten und die Veränderung<br />
der Trophik oder Vermeidung oder Verbesserung der Hypoplasie an der betroffenen<br />
Extremität.<br />
b) Krankengymnastische Behandlung nach dem Bobath Konzept<br />
Die Bobaths haben ihr therapeutisches Vorgehen weitgehend an der<br />
sensomotorischen Entwicklung orientiert und deshalb als entwicklungsneurologische<br />
Behandlung (neurodevelopmental treatment) bezeichnet.<br />
Historie<br />
In den 40er Jahren hatte die Krankengymnastin Berta Bobath bei der Behandlung<br />
eines erwachsenen Patienten mit einer spastischen Hemiparese die stereotypen,<br />
kaum variierten Beugemuster eines spastischen Armes beobachtet. Diese waren<br />
bei allen willkürlichen Bewegungsversuchen und vor allem auch bei psychischen<br />
und physischen Belastungssituationen aufgetreten (B.Bobath, persönliche<br />
Mittteilung 1973, Köng 1991).<br />
Die verschiedenen stereotypen Haltungen der Gelenke des betroffenen Armes<br />
(assoziierte Reaktionen) konnten durch die Therapeutin von den proximalen<br />
Gelenken, am effektivsten von der Schulter aus, beeinflußt werden. Neben einer<br />
Reduktion des erhöhten Muskeltonus veränderte sich auch die Haltung der Hand.<br />
Noch in der gleichen Therapiesitzung waren minimale Willkürbewegungen der<br />
Finger zu beobachten, und der Patient berichtete über eine verbesserte Empfindung<br />
in dieser Hand. Damit hatte B. Bobath nicht nur wahrgenommen, daß eine zentral<br />
verursachte Bewegungsstörung von der Peripherie her beeinflußt werden kann. B.<br />
und K. Bobath erkannten darüber hinaus, daß es sich bei spastischen<br />
Bewegungsstörungen nicht um ausschließlich motorische, sondern um<br />
“sensomotorische Störungen” handelte.<br />
15
Eine neurophysiologische Erklärung für diese Beobachtungen fand Karel Bobath in<br />
den Arbeiten von Magnus (1924), Sherrington (1947) und Schaltenbrand (1925).<br />
Diese hatten bei Tieren durch experimentell gesetzte Hirnläsionen regelhafte Reflex-<br />
und Bewegungsantworten sowie Haltungsmuster beschrieben, die den bei Patienten<br />
beobachteten spastischen Mustern ähnlich schienen.<br />
Berta Bobath stellte im Verlauf ihrer Arbeit fest, daß die Bewegungen der Patienten<br />
in bestimmten Körperhaltungen deutlich weniger von pathologischer Reflexaktivität<br />
bestimmt wurden und bezeichnete diese als reflexhemmende Ausgangsstellungen<br />
(”reflex inhibiting postures, RIP”). Ziel der Therapie wurde es, unter<br />
Berücksichtigung der RIP von bestimmten "Schlüsselpunkten" aus diejenigen<br />
Bewegungsmuster zu hemmen - inhibieren -, die wegen ihrer Invariabilität als<br />
pathologisch angesehen wurden. Gleichzeitig sollten variablere Bewegungen<br />
angebahnt - fazilitiert - werden. Die erwartete Normalisierung von Haltung,<br />
Bewegung und Wahrnehmung außerhalb der Therapiesituation gelang allerdings<br />
häufig nur unvollständig.<br />
Bei der Therapie von sehr jungen Kindern mit zerebralen Bewegungsstörungen<br />
schienen häufig Vorerfahrungen zu fehlen, die für die Sicherung der Körperhaltung<br />
und Einleitung von Bewegungen notwendig sind. Diese Erkenntnis führte -neben<br />
den Anregungen durch E. Collis (1954)- zum Studium der normalen Entwicklung von<br />
Säuglingen und Kleinkindern und deren Berücksichtigung in der Therapie. In der<br />
Behandlung sollte in festgelegter Entwicklungsfolge eine Fertigkeit nach der<br />
anderen verfügbar gemacht werden. Erst sollte die Kontrolle der Kopfhaltung, dann<br />
Drehen, Sitzen, Vierfüßlerstand, Kniestand, Stehen und Gehen geübt werden -<br />
“neurodevelopmental treatment” - (Bobath, 1984).<br />
Allerdings führten der "normalere" Muskeltonus und die effektiveren Stell- und<br />
Gleichgewichtsreaktionen in den oft noch recht statischen Therapiesituationen<br />
häufig nicht zu einer funktionellen Verbesserung der Spontan- und Zielmotorik.<br />
Berta Bobath und ihre Mitarbeiter beobachteten, daß eine dynamischere, in<br />
funktionellen Bewegungsabfolgen durchgeführte und in alltagsnahen Situationen<br />
gestaltete Behandlung wesentlich besser zum Ziel führte. Die in der Therapie<br />
erarbeiteten Mechanismen der Haltungskontrolle konnten dadurch besser in die<br />
Alltagssituation übernommen werden. Auch wurde bald erkannt, daß eine direkte<br />
und stark kontrollierende therapeutische Einflußnahme im Verlauf der Behandlung<br />
reduziert werden mußte. Die zunehmende Betonung der Motivation und der<br />
Anregung der Eigenaktivität des Kindes bei der Regulierung von Gleichgewicht und<br />
Bewegung wies der Interaktion zwischen Therapeutin und Kind einen immer<br />
größeren Stellenwert zu.<br />
(Die Änderung der Begriffe -aus reflex-inhibiting postures wurde reflex-inhibiting<br />
patterns- führte nicht zur Änderung der Abkürzung -"RIP"- woraus lange Zeit<br />
Mißverständnisse resultierten.)<br />
Unabhängig von der beschriebenen Entwicklung blieben die Grundgedanken des<br />
Konzeptes erhalten. Die Therapie soll dem Kind ermöglichen, die assoziierten<br />
Reaktionen und Bewegungen zu verringern und seinen Bewegungs- und<br />
Handlungsspielraum zu erweitern. So sollen neue sensomotorische Erfahrungen<br />
möglich und positiv veränderte Rückmeldungen über das jeweils erreichte Ergebnis<br />
erzielt werden (Bobath 1990).<br />
16
Für die Entstehung der Symptomatik bei der infantilen Zerebralparese werden nach<br />
wie vor für wesentlich gehalten und sollen positiv verändert werden (Tabelle 8)<br />
Dabei gilt die Verminderung „assoziierter Reaktionen“ als Indikator für eine<br />
Reduktion der pathologischen Einschränkung mit dem Risiko fixierter<br />
Fehlstellungen, jene der „assoziierten Bewegungen“ als Hinweis auf Ausreifung<br />
und zunehmende Ökonomisierung.<br />
Heute wird das therapeutische Vorgehen durch Erkenntnisse über motorische<br />
Lernvorgänge modifiziert. Variable Bewegungsabläufe und die entsprechende<br />
Haltungskontrolle sollen eigenständig in funktionell sinnvollen Zusammenhängen<br />
erlernt und gefestigt werden. Es wird erwartet, daß so zumindest teilweise eine<br />
antizipatorische Programmierung der Motorik für differenzierte Aufgabenstellungen<br />
erreicht werden kann.<br />
Die Anwendung der Behandlungstechniken Inhibition, Fazilitation und Stimulation<br />
setzt eine sorgfältige Bewegungsanalyse und die Kenntnis der Faktoren, welche die<br />
Tonusregulation beeinflussen (z.B. Körperhaltung, Intention, Emotion), voraus. Die<br />
Bedeutung der "klassischen Behandlungstechniken" für die Therapie wird aufgrund<br />
der Einbeziehung neuer Erkenntnisse über die Entwicklung der Haltungs- und<br />
Bewegungskontrolle (Matiello und Woolacott 1997) von vielen Bobath-<br />
Therapeutinn/-en in den Hintergrund gerückt.<br />
Als Ausgangsbasis für die Behandlung dient der sensomotorische und der mentale<br />
Entwicklungsstand des Kindes. Im Vordergrund steht die Frage: Was kann das Kind<br />
und was sind kurz- oder mittelfristige Behandlungs- oder Lernziele? Als Leitlinie für<br />
die Therapie und Begleitung dient einerseits der normale Verlauf der<br />
psychomotorischen Entwicklung und anderseits die Absicht, Entwicklungsschritte<br />
adäquat anzuregen und zu unterstützen, wenn diese noch nicht oder nur mit<br />
pathologischen Haltungs- und Bewegungsmustern erreicht werden können.<br />
Spätestens im Vorschulalter wird das therapeutische Vorgehen immer mehr von<br />
dem mentalen Entwicklungsstand, den Interessen und der Motivation des Kindes<br />
bestimmt als von dem Ziel, motorische Entwicklungsschritte in einer bestimmten<br />
Abfolge erreichen zu wollen oder die Qualität der Bewegungen zu verbessern. So<br />
werden im Laufe der Zeit auch als pathologisch zu bewertende Bewegungsabläufe<br />
zum eigenständigen Lösen einer Aufgabe oder zum Erreichen eines Ziels in Kauf<br />
genommen.<br />
Das therapeutische Vorgehen muß immer im Gesamtzusammenhang der<br />
Lebenssituation des Kindes gesehen und zwischen den Fähigkeiten und<br />
Bedürfnissen des Kindes, den Wünschen der Eltern und den Zielen des<br />
Therapeuten abgestimmt werden. Das gilt auch für die Auswahl geeigneter<br />
Hilfsmittel. Sie sollen dazu beitragen, durch neue Haltungs- und<br />
Bewegungsmöglichkeiten die Selbständigkeit zu verbessern und die Fixierung von<br />
abnormen Haltungen und Bewegungen zu vermeiden, um die Entstehung<br />
sekundärer orthopädischer Probleme zu vermindern.<br />
'Handling' ist ein integraler Bestandteil der Therapie. Man versteht darunter das<br />
Einbeziehen therapeutischer Prinzipien in den Alltag und alle Maßnahmen, die zur<br />
Erleichterung im Umgang der Eltern und Therapeuten mit dem Patienten dienen.<br />
Bei der Pflege (wie z.B. Lagern, Wickeln, Anziehen oder Baden), beim Essen, bei<br />
17
der Selbstversorgung sowie im Spiel, sollen pathologische Bewegungsabläufe<br />
möglichst vermieden oder in ihrer Ausprägung gemildert werden. Variablere<br />
Bewegungen sollen angeregt und die Eigenaktiviät des Kindes zur Bewältigung der<br />
alltäglichen Aufgaben gefördert werden.<br />
Ein wesentlicher Bestandteil des Bobath Konzeptes ist auch die Einbeziehung<br />
spezieller Formen der Ergotherapie und Logopädie, die vorwiegend über andere<br />
Sinnesmodalitäten als die Krankengymnastik wirken und sensorische Störungen<br />
verändern wollen. Sie tragen durch Verbesserung der visuellen, räumlichen und<br />
taktilen Wahrnehmung sowie durch Unterstützung beim Kleiden, bei der<br />
Nahrungsaufnahme, bei der Laut- und Sprachanbahnung und bei der<br />
Kommunikation zu einer Ausweitung der Patienten-Selbständigkeit bei.<br />
c) Konsens<br />
Die neurophysiologischen theoretischen Vorstellungen zur motorischen Kontrolle<br />
unterscheiden sich zwischen beiden Methoden nach den ursprünglichen Konzepten<br />
weit weniger, als dies allgemein angenommen wird. Das zugrunde liegende<br />
hierarchisch-reflektorische Modell der motorischen Kontrolle wirkte sich konkret<br />
auch auf das therapeutische Vorgehen bei der zerebralen Bewegungssstörung aus<br />
(Horak 1992).<br />
Dabei wird von den folgenden Annahmen ausgegangen:<br />
− Die abnormale motorische Kontrolle ist direkte Folge der Hirnläsion und führt zu<br />
einer Enthemmung von Reflexen bzw. Reaktionsmustern der unteren Ebenen<br />
des Zentralnervensystems. Die motorischen Äußerungen des CP-Kindes<br />
werden mehr oder weniger durch die Aktivität primitiver, primärer und tonischer<br />
Reflexe bzw. Reaktionen bestimmt ("Ersatzmuster", ”assoziierte Reaktionen und<br />
Bewegungen").<br />
− Die Motorik kann durch Therapie nur verbessert werden, wenn auch höhere<br />
Zentren ihre ”Kontrollfunktionen" erlangen und keine weiterreichenden<br />
Veränderungen auf spinaler Ebene oder sekundäre Veränderungen des<br />
Bewegungsapparates eingetreten sind.<br />
− Nach konsequenter Therapie ist es von einem bestimmten Alter an nicht mehr<br />
möglich ist, die typischen Symptome einer zerebralen Bewegungsstörung<br />
wesentlich zu verbessern.<br />
d) Dissens<br />
So ähnlich die "ursprünglichen" Vorstellungen zur Entwicklungsneurologie sind,<br />
welche die Konzepte beeinflußt haben, so unterschiedlich ist aber das praktische<br />
Vorgehen in der Therapiesituation. Der gestörte Muskeltonus wird von Vojta als<br />
Folge der posturalen Störung angesehen, die sich in der Haltlosigkeit des Rumpfes<br />
bei allen Formen der CP ausdrückt. Die Therapie richtet sich dementsprechend in<br />
erster Linie auf die Verbesserung der Wirbelsäulenhaltung (”Aufrichtung” der<br />
Wirbelsäule), die wiederum die Basis für eine Verbesserung der<br />
Extremitätenfunktion bildet. Die passive Aufrichtung eines Kindes, das postural dazu<br />
noch nicht selbständig in der Lage ist, wird strikt abgelehnt, da in einer vom Kind<br />
nicht kontrollierbaren Haltung vermehrt Ersatzmuster auftreten und so z.B. auch die<br />
Hüftluxation gefördert wird.<br />
Im Vojta Konzept wird davon ausgegangen, daß Eltern normalerweise zur Erziehung<br />
und Förderung ihres Kindes fähig sind. Sie werden nicht ausdrücklich zu<br />
18
zusätzlichen Maßnahmen im täglichen Leben oder beim Spielen angehalten,<br />
sondern die notwendige krankengymnastische Behandlung wird täglich mehrmals<br />
gefordert. Es wird erwartet, daß es dem ZNS selbständig gelingt, die angebotenen<br />
idealen Bewegungsmuster in der freien Spielsituation in die willkürliche<br />
Alltagsmotorik zu übernehmen, bzw. auf ihnen aufzubauen. Nur falls das Kind sehr<br />
passiv ist oder die Eltern wenig zur Bewegungsmotivation beitragen können, wird<br />
die Krankengymnastik mit Ergo- bzw. Montessori-Therapie oder psychologischer<br />
Therapie kombiniert.<br />
Stagniert die motorische Entwicklung mehr als ein Jahr, wird die Krankengymnastik<br />
reduziert. Sie dient dann vor allem der Prophylaxe von schweren Sekundärveränderungen<br />
am Muskel-Skelettsystem. Dann werden auch orthopädische<br />
Operationen oder Hilfsmittel zur Erhaltung des Erreichten eingesetzt. Hilfsmittel zur<br />
Fortbewegung werden bei Kindern angewendet, deren Vertikalisierung vor allem<br />
wegen einer mentalen Entwicklungsstörung verzögert ist.<br />
Nach dem Bobath Konzept benötigen die Eltern wegen der gestörten Interaktion<br />
Unterstützung im Alltag für einen adäquaten Umgang mit dem<br />
entwicklungsgestörten oder behinderten Kind, sowie für die optimale Anregung<br />
kindlicher Aktivitäten. Die Behandlung beschränkt sich daher nicht nur auf<br />
spezifische Therapieeinheiten, sondern begleitet Kind und Bezugspersonen<br />
während des gesamten Tages.<br />
Je älter das Kind wird und je motivierter es ist, um so eher werden auch<br />
Bewegungsabläufe geduldet, die das Risiko in sich tragen, daß abnorme "Muster"<br />
gespeichert oder automatisiert werden. Bei Kindern, bei denen die Erfolge der<br />
Behandlung nur relativ gering sind, soll nach dem Bobath Konzept die Behandlung<br />
und Förderung auch und gerade im Bereich der Schule fortgeführt werden, selbst<br />
wenn dadurch lediglich Verschlechterungen vermieden oder Erreichtes erhalten<br />
werden kann.<br />
In den letzten Jahren haben sich im Bobath Konzept die Schwerpunkte der<br />
Behandlung mehr auf die Anregung von eigenständigen und selbstbestimmten<br />
(motorischen) Lernprozessen verlagert. Die Unterschiede zwischen den beiden<br />
Konzepten sind dadurch auch in ihren theoretischen Grundlagen größer geworden.<br />
C) INDIKATION ZUR KRANKENGYMNASTISCHEN BEHANDLUNG IM ERSTEN<br />
LEBENSJAHR<br />
a) Nach dem Vojta Konzept<br />
wird die Indikation zur Frühbehandlung eines Säuglings fast ausschließlich aufgrund<br />
des klinischen Befundes gestellt. Anamnese (Risikofaktoren) und technische<br />
Befunde werden weniger stark berücksichtigt. Ausnahmen bilden hierbei z.B. eine<br />
ausgeprägte periventrikuläre Leukomalazie oder porenzephale Cysten, die mit<br />
hoher Wahrscheinlichkeit auf die Entwicklung einer zerebralen Bewegungsstörung<br />
hinweisen.<br />
Bei der klinischen Befundherhebung spielt die Zentrale Koordinationsstörung (ZKS)<br />
(Vojta 1988) die Hauptrolle, die sich aus der Summe der abnormalen<br />
Lagereaktionen und den Störungen der interaktiven Spontanmotorik (in Rücken-<br />
19
und Bauchlage) sowie in Auffälligkeiten der Primitivreflexe ergibt. Da das Risiko<br />
einer zerebralen Bewegungsstörung bei einer schweren und mittelschweren ZKS<br />
deutlich ansteigt, stellen diese die Hauptindikation bei Frühgeborenen und<br />
Säuglingen dar (Costi 1983, Imamura 1983); die Behandlung soll unmittelbar nach<br />
der Diagnostik beginnen. Bei leichteren Formen der ZKS wird eine langfristige<br />
Behandlung eingeleitet, wenn durch Kontrolluntersuchungen spontane<br />
Normalisierungen unwahrscheinlich, abnormale Entwicklungen dagegen sicher<br />
scheinen (Tabelle 9).<br />
b) Nach dem Bobath Konzept<br />
ist die Behandlung dann angezeigt, wenn eine deutliche motorische oder<br />
sensomotorische Entwicklungsstörung erkannt oder die Diagnose einer zerebralen<br />
Bewegungsstörung als wahrscheinlich angesehen wird. Vielfach ergibt sich die<br />
Indikation nicht nur aus der klinisch-neurologischen Untersuchung und Beobachtung<br />
des Kindes, sondern auch aus detaillierten Informationen über das Verhalten des<br />
Kindes.<br />
Bei sehr unreif geborenen Kindern stellen Auffälligkeiten der Körperhaltung und der<br />
Bewegungsabläufe, welche die Pflegemaßnahmen und Nahrungsaufnahme<br />
beeinträchtigen, schon in den ersten Lebenswochen und -monaten eine Indikation<br />
zur krankengymnastischen Behandlung dar. Bei der entwicklungsneurologischen<br />
Untersuchung sind nicht nur Muskeltonus, Muskelkraft, Muskeleigenreflexe,<br />
Körperhaltung, Funktion der Hirnnerven -von Paine et al. (1970) angegeben- und<br />
Stand der motorischen Entwicklung zu beachten, sondern weitere Symptome<br />
wichtig (Tabelle 10): z.B. Auffälligkeiten des Verhaltens wie Bewegungsarmut, Apathie,<br />
vermehrte Erregbarkeit, Störungen des Schlaf-Wach-Rhythmus, sowie Ess- und<br />
Trinkstörungen oder abnorme Ausprägung der automatischen und auch der<br />
primären Reaktionen (siehe Kapitel A) im Bezug auf "neurologisches Alter" sowie<br />
geringe Variabilität oder gar Stereotypie der Bewegungsabläufe. Dazu konstante<br />
Asymmetrien, symmetrische Fehlhaltungen, besonders eine immer wiederkehrende<br />
Überstreckung des Rumpfes und des Halses. Auch ein auffälliges Kommunikations-<br />
und Interaktionsverhalten, insbesondere mit den nahestehenden Bezugspersonen,<br />
sowie Hinweise auf eine gestörte akustische, optische oder taktile Wahrnehmung<br />
kann auf Störungen der zentralnervösen Funktionen hinweisen und wird für die<br />
Indikation beachtet.<br />
Zusätzlich können Informationen über ernsthafte Erkrankungen der Mutter in der<br />
Schwangerschaft, Risiken oder Komplikationen in der Prä- und Perinatalzeit<br />
(Übersicht bei Karch 1994) und Befunde von bildgebenden Verfahren zur<br />
Untersuchung des Gehirns die Indikation unterstützen. Insbesondere abnorme<br />
Befunde der Neurosonographie im Neugeborenenalter bei untergewichtig und unreif<br />
geborenen Kindern besitzen eine große prognostische Aussagekraft.<br />
c) Konsens<br />
Beide Konzepte nehmen an, daß eine klinisch noch nicht fixierte CP im Sinne einer<br />
Kompensation beeinflußbar ist. Zumindest aber mit einer behandlungsbedingten<br />
funktionellen Verbesserung wird fest gerechnet. Kontrollierte Nachweise darüber<br />
müssen jedoch noch erbracht werden.<br />
20
Die Kriterien zur Indikation einer Frühbehandlung der zerebralen Bewegungsstörung<br />
bzw. ihre Früherkennung nach dem Vojta oder Bobath Konzept sind bisher nicht<br />
ausreichend in prospektiven, kontrollierten Diagnostikstudien evaluiert worden.<br />
Die Methode zur Früherkennung nach Vojta (Spontanmotorik, Lagereaktionen,<br />
Primitivreflexe) wurde im Rahmen von prospektiven Therapiestudien überprüft.<br />
Dabei wurden die Kinder auf erhebliche Entwicklungsstörungen einschließlich der<br />
zerebralen Bewegungsstörung nachuntersucht. Es ergab sich bei 4 - 6 Wochen<br />
alten Säuglingen eine Sensitivität von 87,5 und eine positive Prädiktion von nur 8,1<br />
(Costi et al. 1983) und bei Säuglingen bis zum Alter von 5 Monaten eine Sensitivität<br />
von 100 bei einer positiven Prädiktion von 34,4 (Tomi 1984) (Anhang Tabelle II a).<br />
Auch wenn die Voraussagen bei älteren Säuglingen deutlich besser waren, wurde<br />
doch auch hier eine große Zahl von Kindern "fälschlich" behandelt. Da während des<br />
Studienzeitraums ein Teil der Kinder, bei dem eine Indikation angenommen wurde,<br />
behandelt wurde, könnte auch argumentiert werden, daß die positive Prädiktion so<br />
gering war, weil sich die Zahl der CP-Kinder therapiebedingt verringert hätte.<br />
Ähnliche Studien gibt es für die unter b) dargestellten Kriterien zur Früherkennung<br />
unter ausdrücklicher Berufung auf das Bobath Konzept bis heute nicht. Allerdings<br />
wurden einige neurologische Untersuchungsverfahren von ähnlichem Charakter, im<br />
Bobathbereich auch nur teilweise akzeptiert, in prospektiven Studien überprüft. Die<br />
Ergebnisse sind in Tabelle II b - c im Anhang aufgeführt. Die Patientenkollektive<br />
sind meistens klein, nur in wenigen Untersuchungen repräsentativ für eine<br />
Normalpopulation und die Nachuntersuchungsverfahren sind nur selten miteinander<br />
vergleichbar. Bei Untersuchungen mit Hochrisiko-Populationen treten CP und<br />
sonstige Entwicklungstörungen ohnehin häufiger auf, so daß die<br />
Untersuchungsmethoden aussagekräftiger aussehen können, als sie es wirklich<br />
sind. Zudem wurde in allen Studien die Vorhersage einer CP oder<br />
Entwicklungsstörung nur nach einer einzigen Untersuchung getroffen. Es ist aber<br />
damit zu rechnen, daß die diagnostische Treffsicherheit durch mehrere<br />
Nachuntersuchungen erheblich vergrößert wird (Allen et al. 1997).<br />
Die Beurteilung der General Movements als interaktionsfreie Spontanmotorik nach<br />
Prechtl et al. (1997) hat in den letzten Jahren eine weitere Verbreitung gefunden.<br />
Bei dieser Methode werden grundsätzlich -anders als bei den bisher erwähnten-<br />
mehrere follow-up-Untersuchungen durchgeführt. Prospektive Studien, bei relativ<br />
wenigen Hochrisiko-Neugeborenen, zeigten eine überraschend gut Sensitivität und<br />
und positive Prädiktion im Alter von 2-3 Monaten durch die Beurteilung der<br />
sogenannten fidgety movements (Anhang Tabelle II d). In den ersten 6 Lebenswochen<br />
bei der Beurteilung der sogenannten writhing movements war die diagnostische<br />
Sicherheit allerdings deutlich geringer. Ob sich diese Methode in der täglichenPraxis<br />
bewährt, ist noch nicht entschieden.<br />
Neurosonographische Befunde alleine besitzen keine bessere Voraussagefähigkeit<br />
als andere neurologische Methoden bei Frühgeborenen von 501 - 2000 g. Pinto-<br />
Martin et al. (1995) weisen für verschiedene Ultraschallbefunde eine Sensitivität von<br />
61% bis 15% und eine positive Prädiktion von 52% bis 9% nach. Die höheren<br />
Werte werden bei den schweren Zerebralparesen erreicht. Whitaker et al. (1996)<br />
untersuchten bei Frühgeborenen (
Der Wunsch, mit einer einzigen Untersuchung das Bestehen einer infantilen<br />
Zerebralparese bei einem Säugling nicht zu übersehen und zudem keinen<br />
Gesunden fälschlich für zerebralparetisch zu halten, ist bisher nicht erfüllbar. Noch<br />
problematischer scheint es zu sein, bei sehr jungen Säuglingen (
Angesichts der Tatsache, daß für beide Methoden bis heute kontrollierte Studien,<br />
welche die zu erwartenden Erfolge belegen, noch nicht vorliegen, sollte es Anliegen<br />
der Anhänger beider Konzepte sein, eine unnötige Polarisierung ihrer Meinungen zu<br />
vermeiden. Die jahrzehntelange Debatte über Wert und Unwert der verschiedenen<br />
Methoden war möglicherweise mitverantwortlich dafür, daß wichtige Fragen zur<br />
Indikation, Intensität, Dauer und Effektivität bis heute nicht ausreichend in Studien<br />
untersucht worden sind. Der Wert der diagnostisch-prognostischen und dann auch<br />
therapeutischen Bemühungen der beiden Konzepte wird sich in Zukunft an<br />
fortschreitenden neurophysiologischen / bildgebenden Meßmethoden überprüfen<br />
lassen, ebenso an objektivierenden Verfahren in der Neurorehabilitation (Berger<br />
1998).<br />
Folgende Fragen sollten in Evaluations-Studien sobald wie möglich geprüft werden:<br />
1. Ausmaß und Art der Behandlungseffekte der krankengymnastischen<br />
Behandlung auf neurophysiologischer Grundlage unter besonderer<br />
Berücksichtigung von<br />
− Indikationen,<br />
− Intensität,<br />
− Dauer und<br />
− möglicher Nachteile der Behandlung;<br />
2. Unterschiedliche Effekte bei der Behandlung nach Bobath bzw. Vojta;<br />
3. Behandlungseffekte bei Kombination mit anderen Massnahmen (z.B.<br />
Manuelle Medizin, Botulinum Toxin, Laufbandtraining, orthopädischen<br />
Hilfsmitteln);<br />
4. Vergleiche zwischen der Behandlung auf neurophysiologischer Grundlage<br />
und anderen Konzepten wie z.B. der konduktiven Förderung nach Petö.<br />
ANHANG<br />
Literaturverzeichnis<br />
4 Abbildungen und 13 Tabellen<br />
23
Literatur<br />
Allen MC, Alexander DR (1997) Using motor milestones as a multistep process to screen preterm infants for<br />
cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 39:12-16.<br />
Allen MC, Capute AJ (1989) Neonatal neurodevelopmental examination as a predictor of neuromotor outcome<br />
in premature infants. Pediatrics 83:498-506.<br />
Amiel-Tison C, Grenier A (1986) Neurological Assessment Within the First Year of Life. Oxford Univ. Press,<br />
New York.<br />
André-Thomas and S. Autgaerden (1966) Locomotion from Pre- to Post-natal Life. Clinics in Developmental<br />
Medicine no 24, S.7, Heinemann, London.<br />
Bax MCO (1964) Terminology and classification of cerebrasl palsy. Dev Med Child Neurol 6:295-297.<br />
Bax MCO, Brown JK (1985) Contractures and their therapy. Dev Med Child Neurol 27:423-424.<br />
Bayley N (1969) Manual for the Bayley Scales of Infant Development. The Psychological Corporation, New<br />
York.<br />
Berger W, Quintern J, Dietz V (1982) Pathophysiology of gait in children with cerebral palsy. Electroenc Clin<br />
Neurophysiol 63:538-548.<br />
Berger W, Altenmüller E, Dietz V (1984) Normal and impaired development of children's gait. Hum Neurobiol<br />
3:163-170.<br />
Bierman-van Eendenburg ME, Jurgens-van-der Zee AD, Olinga AA, Huisje HH, Touwen BCL (1981)<br />
Predictive value of neonatal neurological examination: follow-up Study at 18 months. Dev Med Child Neurol<br />
23:296-305.<br />
Bleck EE (1987) Prognosis and structural changes. In: Bleck EE Orthopaedic Management in Cerebral Palsy.<br />
Clin Dev Med No 99/100 Blackwell Oxford.<br />
Bobath B (1973) Persönliche Mitteilung.<br />
Bobath B, Bobath K (1983) Die motorische Entwicklung bei Cerebralparesen. Thieme Stuttgart.<br />
Bobath K, Bobath B (1984) Management of the motor disorders of children with cerebral palsy. Mc Keith Press<br />
London.<br />
Bobath B (1986) Abnorme Haltungsreflexe bei Gehirnschäden. 4. Auflage, Thieme Stuttgart.<br />
Bobath K (1990) Das Bobath Konzept. Grundsätzliches zum theoretischen Hintergrund in der Behandlung von<br />
Kindern mit cerebralen Bewegungsstörungen und sonstigen zentral-neurologischen Erkrankungen. der<br />
kinderarzt 21:863-870.<br />
Bourbonnais D, Noven SV (1989) Weakness in patients with hemiparesis. Am J Occupational Therapy 43:313-<br />
319.<br />
Brett EM (1991) Pediatric Neurology, 2nd ed Churchill Livingstone, Edinburgh London.<br />
Cajal, RS, y (1928) Degeneration and regeneration of the nervous system. Oxford Univ Press.<br />
Carr LJ, Harrison LM, Evans AL, Stephens JA (1993) Patterns of central motor reorganization in hemiplegic<br />
cerebral palsy. Brain 116:1223-1247.<br />
Castle ME, Reyman TA, Schneider M (1979) Pathology of spastic muscle in cerebral plasy. Clin Orthopedics<br />
142:223-233.<br />
24
Chandler LS, Andrews MS, Swanson MW (1980) Movement Assessment of Infants: A Manual. Rolling Bay,<br />
Wa (veröffentlicht durch die Autoren).<br />
Collis E (1953) Clinical tests relating to mental activity in infancy. Lancet Feb 28:416-420.<br />
Collis E (1954) Some differential characteristics of cerebral palsy in infancy. Arch Dis Childh 29:113-122.<br />
Costi GC, Radice C, Raggi A, Kron AM, Angisano A, Busato E, Montrasio G, Perfetti C, Pissacroia C (1983)<br />
Le sette reazioni posturali di Vojta come depistage delle alterazioni neuromotorie del lattante. Esperienza su<br />
2382 sogetti. Ped Med Chir 5:59-66.<br />
Dietz V, Quintern J, Berger W (1981) Electrophysiological studies of gait in spasticity and rigidity. Evidence<br />
that altered mechanical properties of muscle contribute to hypertonia. Brain 104:431-449.<br />
Dietz V, Berger W (1995) Cerebral palsy and muscle transformation. Dev Med Child Neurol 7:180-184.<br />
Drillien CM (1972) Abnormal neurological signs in the first year of life in low birth weight infants: possible<br />
prognostic significance. Dev Med Child Neurol 14:575-584.<br />
Ellenberg JH, Nelson KB (1981) Early recognition of infants at high risk for cerebral palsy: examination at age<br />
four months. Dev Med Child Neurol 23:705-716.<br />
Faist M, Hoefer C, Duyens J, Berger W, Dietz V (1995) Decrease in Ib inhibition during human standing and<br />
walking. Electroenceph Clin Neurophys 97:178-????.<br />
Farmer SF, Harrison LM, Ingram DA, Stephens JA (1991) Plasticity of central motor pathway in children with<br />
hemiplegic cerebral palsy. Neurology 41:1505-1510.<br />
Ferro CJA (1991) Die klinische Bedeutung der Neugeborenenreflexe bei der infantilen spastischen Diparese.<br />
Dissertation Ludwig-Maximilians-Universität München.<br />
Foerster O (1936) Übungstherapie. In: Bumke O, Foerster O (Hrsg) Handbuch der Neurologie, 316-414.<br />
Springer Berlin.<br />
Futagi Y, Tagawa T, Otani K (1992) Primitive reflex profiles in infants: differences based on categories of<br />
neurological abnormality. Brain Dev 14:294-298.<br />
Futagi Y, Otani K, Imai K (1995) Asymmetry in plantar grasp response during infancy. Pediatr Neurol 12:54-57.<br />
Gesell A, Amatruda CS (1964) Developmental Diagnosis. Normal and Abnormal Child Development. Harper<br />
and Row New York.<br />
Gesell A (1988) The Embryology of Behaviour. Classics in Developmental Medicine 3. Cambridge Univ. Press,<br />
Cambridge. Reprint: Gesell A, Amatruda CS, 1945.<br />
Griffiths R (1970) The abilities of young children. Chard, Bristol.<br />
Grillner S, Wallen P (1985) Central pattern generation for locomotion, with special reference to vertebrates. Ann<br />
Rev Neurosci 8:233-262.<br />
Hadders-Algra M, Touwen BCL, Huisjes HJ (1986) Neurologically deviant newborns: neurological and<br />
behavioural development at the age of six years. Dev Med Child Neurol 28:569-578.<br />
Hallet M, Cohen LG, Pascual-Leone A, Brasil-Neto J, Wassermann EM, Cammarota AN, (1993) Plasticity of<br />
the human cortes. In: Thilmann et al. (Eds) Spasticity: Mechanisms and Management. Springer Berlin-<br />
Heidelberg-New York.<br />
Hallett M (1995) The plastic brain. Ann Neurol 38: 4-5.<br />
25
Horak FB (1992) Motor control models underlying neurologic rehabilition of posture in children. In Forssberg<br />
H, Hirschfeld H (eds) Movement Disorders in Children. Med Sport Sci. Karger, Basel Freiburg Paris.<br />
Illingworth RS (1975) The Normal Child. Churchill Livingstone, Edinburgh.<br />
Imamura S, Sakuma K, Takahashi T (1983) Follow-up study of children with cerebral coordination disturbance<br />
(ccd, Vojta). Brain & Development 5:311- 314.<br />
Kaas JH (1991) Plasticity of sensory and motor maps in adult mammals. Ann Rev Neurosci 14:137-167.<br />
Karch D, Glauche-Hiegeler A (1993) Neurophysiologische Grundlagen krankengymnastischer Behandlung bei<br />
infantilen Zerebralparesen-Ist ein Methodenstreit noch zeitgemäß? Krankengymnastik 45:1211-1223.<br />
Karch D (1994) Prae- und perinatale Risikofaktoren -ein komplexes System-. In: Karch D (Hrsg) Risikofaktoren<br />
der kindlichen Entwicklung. Steinkopff, Darmstadt.<br />
Karch D, Groß-Selbeck G, Hanefeld F, Ritz A, Schlack H-G (1997) Behandlung von zerebralen<br />
Bewegungsstörungen nach Doman und Delacato. Aktuelle Neuropädiatrie 1996, s.485-497. Novartis Pharma<br />
Verlag, Nürnberg.<br />
Knobloch H, Stevens F, Malone AE (1980) Manual of Developmental Dignosis. Harper & Row, Hagerstown,<br />
MD.<br />
Köng E (1991) Geschichte und Entwicklung des Bobath-Konzeptes. der kinderarzt 22:705-710.<br />
Lajosi F (1985) Aktuelle Probleme der Früherkennungsuntersuchungen für Kinder in der Bundesrepublik<br />
Deutschland. In: Hellbrügge Th (Hrsg) Fortschritte der Sozialpädiatrie 8, Screening- und<br />
Vorsorgeuntersuchungen im Kindesalter. Hanseat. Verlagskontor, Lübeck.<br />
Largo RH, Molinari L, Weber M, Comenale Pinto L, Duc G (1985) Early development of locomotion:<br />
significance of prematurity, cerebral palsy and sex. Dev Med Child Neurol 27:183-191.<br />
Largo RH, Kundu S, Thun-Hohenstein L (1993) Early motor development in term and preterm children. In:<br />
Kalverboer F, Hopkins B, Geuze R (eds) Motor Development in Early and Later Childhood: Longitudinal<br />
Approaches. Cambridge Univ Press.<br />
Little Club (1959) Memorandum on terminology and classification on "cerebral palsy". Cerebral Palsy Bull.<br />
1:27-35.<br />
Magnus R (1924) Körperstellung. Springer Berlin.<br />
Matiello D, Woolacott M (1997) Posture control in children: Development in typical populations and in children<br />
with cerebral palsy and Down syndrome. In: Conolly KJ, Forssberg H (eds) Neurophysiology &<br />
Neuropsychology of Motor Development. Clinics in Developmental Medicine No. 143/144. Cambridge<br />
University Press, Cambridge, p 54-77.<br />
Mc Graw MB (1989) The neuromuscular maturation of the human infant. Classics in Developmental Medicine<br />
4. Cambridge Univ. Press, Cambridge (Reprint 1966).<br />
Michaelis R (1985) Überlegungen zur motorischen und neurologischen Entwicklung des Kindes. Mschr<br />
Kinderheilk 133:417-421.<br />
Michaelis R, Krägeloh-Mann I, Haas G (1989) Beurteilung der motorischen Entwicklung im frühen Kindesalter.<br />
In Karch D, Michaelis R, Rennen-Allhoff B, Schlack HG (Hrsg) Normale und gestörte Entwicklung-Kritische<br />
Aspekte zu Diagnostik und Therapie. Springer, Berlin Heidelberg New York.<br />
Michaelis R, Niemann G (1999) Entwicklungsneurologie und Neuropädiatrie 2. Auflage, Georg Thieme,<br />
Stuttgart New York.<br />
26
Morgan AM, Aldag JC (1996) Early identification of cerebral palsy using a profile of abnormal motor patterns.<br />
Pediatr 98:692-697<br />
Mutch L, Alberman E, Hagberg B, Kadoma K, Perat MV (1992) Cerebral palsy epidemiology: Where are we<br />
noe and where are we going ? Dev Med Child Neurol 31:143-153<br />
Nash J, Neilson PD, O'Dwyer NJ (1989) Reducing spasticity to control muscle contraction of children with<br />
cerebral palsy. Dev Med Child Neurol 31:471-480.<br />
Nickel RE, Gallenstein J (1983) A motor screen for the early identification of infants at high riskfor cerebral<br />
palsy. Clinical Research 31, 100A.<br />
Nickel RE, Renken C, Gallenstein JS (1989) The infant motor screen. Dev Med Child Neurol 31:35-42.<br />
O'Dwyer NJ, Neilson PD, Nash J (1989) Mechanisms of muscle growth related to muscle contracture in cerebral<br />
palsy. Dev Med Child Neurol 31:543-552.<br />
Paine RS, Brazelton TB, Donovan DE, Drorbaugh JE, Hubbell JP, Sears EM (1964) Evolution of postural<br />
reflexes in normal infants and the presence of chronic brain syndromes. Neurology 14:1037-1048.<br />
Paine RS (1966) Neurological Examinations in Children. Spastics Society Medical Education and Information<br />
with William Heinemann Medical Books, London.<br />
Paine RS, Oppé TE (1970) Die neurologische Untersuchung von Kindern. Thieme, Stuttgart.<br />
Peiper A (1963) Die Eigenart der kindlichen Hirntätigkeit. 3.Aufl. Edition Leipzig.<br />
Einspieler C, Prechtl HFR, Ferrari F, Cioni G, Bos AF (1997) The qualitative assessment of general movements<br />
in preterm, term and young infants - review of the methodology. Early Hum Dev 50:47-60.<br />
Prechtl HFR, Beintema DJ (1968) Die neurologische Untersuchung des reifen Neugeborenen. Thieme, Stuttgart.<br />
Prechtl HFR, Einspieler C, Cioni G, Bos AF, Ferrari F, Sontheimer D (1997) An early marker for neurological<br />
deficits after perinatal brain lesions. Lancet 349:1361-1365<br />
Schaltenbrand G (1925) Normale Bewegungs- und Lagereaktionen bei Kindern. Dtsch Zschr Nervenheilk<br />
87:23-59.<br />
Schmidt RF,Wiesendanger M (1993) Motorische Systeme. In: Schmidt RF, Thews G: Physiologie des<br />
Menschen. 25. Aufl. Springer, Berlin-Heidelberg-New York.<br />
Schotland J (1992) Neural control of innate behaviour. In: Forssberg H, Hirschfeld H (Eds) Movement<br />
Disorders in Children. Medicine and Sport-Science Vol 36. Karger, Basel.<br />
Scrutton D (1984) Management of Motor Disorders of Children with Cerebral Palsy. Clin Dev Med No. 90<br />
SIMP, Blackwell, Oxford<br />
Sheridan M (1975) Children's Developmental Progress from Birth to five Years. The Stycar Sequences. NFER<br />
Publishing, Windsor.<br />
Sherrington Ch (1947) The Integrative Action of the Nervous System. 2.Aufl. Yale Univ Press, New Haven.<br />
Snider WD, Johnson EM (1989) Neurotrophic molecules. Ann Neurol 26:489-506.<br />
Stewart A, Hope PL, Hamilton P, de-L Costello AM, Baudin J, Bradford J, Amile Tison C, Reynolds EOR<br />
(1988) Prediction in very preterm infants of satisfactory neurodevelopmental progress at 12 months. Dev Med<br />
Child Neurol 30:53-63.<br />
Swanson MW, Bennet F, Shy KK, Whitfield MF (1992) Identification of neurodevelopmental abnormality at<br />
four and eight months by the movement assessment of infants. Dev Med Child Neurol 34:321-337.<br />
27
Tardieu C, Tabary JC, Huet de la Tour E, Tabary C, Tardieu g (1977) The relationship between sarcomere<br />
length in thge soleus and tibialis anterior and the articular angle of the tibia-calcaneum in cats during growth. J<br />
Anatomy 124:561-588.<br />
Tardieu C, Tardieu G, Colbeau-Justin P, Huet de la Tour E, Lespargot A (1979) Trophic muscle regulation in<br />
children with congenital cerebral lesion. J Neurol Sci 42:357-364<br />
Tardieu C, Huet de la Tour E, Bret MD, Tardieu G (1982a) Muscle hypoextensibility in children wirh cerebral<br />
palsy: I. Clinical an experimental observations. Arch Phys Med Rehabil 63:97-102.<br />
Tardieu G, Tardieu C, Colbeau-Justin, Lespargot A (1982b) Muscle Hypoexten-sibility in children with cerebral<br />
palsy. II. Therapeutic implications. Arch Phys Rehabil 63:103-107.<br />
Tomi M (1985) Zur Früherkennung und Frühbehandlung bei Kindern mit cerebraler Bewegungsstörung in<br />
Japan. In: Hellbrügge T (Hrsg) Fortschritte der Sozialpädiatrie 9. Schmidt-Römhild, Lübeck, S 35-48.<br />
Touwen BCL (1976) Neurological development in infancy. Clinics in Developmental Medicine Vol 58,<br />
Heinemann, London.<br />
Touwen BCL (1984) Normale neurologische Entwicklung: Die nicht bestehenden Inter- und Intra-Item-Beziehungen.<br />
In: Michaelis R, Nolte R, Buchwald-Saal M, Haas G Entwicklungsneurologie.<br />
Kohlhammer, Stuttgart.<br />
Touwen BCL (1993) Pränatale und frühe postnatale motorische Entwicklung und ihre Bedeutung für die<br />
Früherkennung von Entwicklungsstörungen. Monatsschr Kinderhkd 141:638-642.<br />
Umphread DA, McCormack C (1985) Classification of common facilitory and inhibitory treatment techniques.<br />
In: Umphread DA (Ed) Neurological Rehabilitation. Mosby St. Louis-Toronto-Princeton.<br />
Umphread DA, Mc Cormack GL (1985) Classification of common facilitatory and inhibitory treatment<br />
techniques. In: Umphread DA (ed) Neurological Rehabilitation. Mosby, St Louis/Toronto<br />
Vojta V (1965) Rehabilitation des spastischen infantilen Syndroms. Eigene Methodik. Beitr Orthop Traumatol<br />
12:557-562.<br />
Vojta V (1968) Das Reflexkriechen und seine Bedeutung für die krankengymnastische Frühbehandlung. Z<br />
Kinderheilkd 104:319-330.<br />
Vojta V (1970) Reflex-Umdrehen als Bahnungssystem der menschlichen Fortbewegung. Z Orthop 108:446-452.<br />
Vojta V (1988) Die cerebralen Bewegungsstörungen im Säuglingsalter. Frühdiagnose und Frühtherapie. 5. Aufl.,<br />
Enke, Stuttgart.<br />
Vojta V (1989a) Die posturale Ontogenese. der kinderarzt 20:669-674.<br />
Vojta V, Schulz P (1989b) Die Wirkung des Aktivationsystems der Reflexfortbewegung auf die gestörte<br />
posturale Ontogenese. Sozialpädiatrie 11:758-765.<br />
Vojta V., Peters A (1997) Das Vojta-Prinzip, Springer, Berlin, Heidelberg.<br />
Whitaker AH, Feldman J vRossem R, Schonfeld IS, Pinto-Martin J, Torre C, Blumenthal S, Paneth N (1996)<br />
Neonatal cranial ultrasound abnormalities in low birth weight infants: relation to cognitive outcome at six years.<br />
Pediatr 98:719-729.<br />
Zafeirirou DI, Tsikoulas IG, Kremenopoulos GM (1995) Prospective follow-up of primitive reflex profiles in<br />
high-risk infants: Clues on early diagnosis of cerebral palsy. Pediatr Neurol 13:148-152.<br />
Ziv J, Blackburn N, Rang M, Korska J (1984) Muscle growth in normal and spastic mice. Dev Med Child<br />
Neurol 26:94-99<br />
28
Tabelle 1<br />
Definitionen der zerebralen Bewegungsstörungen und Zerebralparesen in der Literatur<br />
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Little Club (1959)<br />
Unter “cerebral palsy” versteht man eine persistierende Erkrankung der Bewegung und der Haltung, die in der<br />
frühen Kindheit auftritt und auf einer entwicklungsbedingten nichtprogressiven Schädigung des Gehirns beruht.<br />
Bax (1964)<br />
Eine Zerebralparese wird definiert durch eine Störung von Bewegung und Haltung infolge eines Defektes oder<br />
einer Läsion des unreifen Gehirns.<br />
Brett (1991)<br />
Eine Zerebralparese ist eine bleibende sich in ihrem Verlauf symptomatisch verändernde, aber nicht<br />
progrediente Erkrankung des unreifen Gehirns.<br />
Mutch et al. (1992)<br />
Als infantile Zerebralparese wird eine Gruppe von nichtprogressiven Syndromen motorischer Störungen<br />
bezeichnet infolge von Läsionen oder Anomalien des Gehirns aus der frühen Entwicklungsphase.<br />
Michaelis et al. (1999)<br />
Der Begriff Zerebralparesen sollte vorbehalten sein, wenn die folgenden ätiologischen Faktoren bestehen:<br />
Perinatale Komplikationen mit schwerer zentraler Hypoxie, Prä- oder perinatale Verschlüsse von größeren<br />
zentralen Arterien oder Venen, Prä- oder perinatale Infektionen, Placentar bedingte Hypoxien bei mütterlichen<br />
Erkrankungen, eventuell auch Hirnfehlbildungen.<br />
Tabelle 2<br />
Konsens und Dissens bei der Begriffsbildung: Vergleichbare Begriffspaare<br />
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Nach Vojta Nach Bobath<br />
Posturale Ontogenese Motorische Entwicklung<br />
Spontanmotorik Spontanmotorik<br />
Posturale Reagibilität Automatische Reaktionen zur<br />
Haltungskontrolle<br />
Zentrale Koordinationsstörung Sensomotorische Koordinationsstörung<br />
Primitiv-Reflexe Primäre Reaktionen<br />
29
Tabelle 3<br />
POSTURALE ONTOGENESE: Untersuchung zur Entwicklung der Motorik.<br />
UNTERSUCHUNG<br />
Posturale Aktionen (interaktive Prüfung der<br />
Spontanmotorik)<br />
Posturale Reaktionen (Provokation der<br />
Lagereaktionen)<br />
Prüfung der Primitivreflexe und automatischen<br />
Reaktionen<br />
ERGEBNIS<br />
Erreichte Meilensteine der Aufrichtung,<br />
Lokomotion und Handmotorik mit Altersangabe<br />
Posturales Alter (Lagereaktionsalter)<br />
Primitivreflexalter<br />
Die Entwicklung ist normal, wenn die motorischen Meilensteine, die Lagereaktionen und die<br />
Primitivreflexe sich entsprechend dem Lebensalter entwickelt haben (homogenes Profil).<br />
Die Entwicklung ist nicht normal, wenn die Ergebnisse der drei Untersuchungen inhomogen sind<br />
und die Entwicklung auf früheren Stufen persistiert.<br />
Die posturale Ontogenese ist nur ein Teilaspekt der menschlichen Ontogenese im ersten<br />
Lebensjahr. Weitere Teilaspekte sind: z.B. Ontogenese der mentalen Fähigkeiten, der Sprache,<br />
des Verhaltens.<br />
Tabelle 4<br />
Aspekte der Spontanmotorik<br />
Aufrichtung in<br />
Bauchlage<br />
Greifen<br />
Fortbewegung<br />
ideale Muster, ”normal”<br />
(im Alter von)<br />
z.B. physiologische Streckung der<br />
Brust- und Halswirbelsäule, Stütz auf<br />
beiden Ellenbogen, Hände frei zum<br />
Greifen.<br />
(5 Monate)<br />
z.B. radiale Duktion der entfalteten<br />
Hand beim Pinzettengriff.<br />
(7 Monate)<br />
z.B. schnelles Robben mit<br />
physiologisch gestreckter Wirbelsäule,<br />
alternierendem Voranschreiten der<br />
Ellenbogen und locker gestreckten<br />
Beinen, Füße in Neutralstellung.<br />
(9 Monate)<br />
Ersatzmuster, abnormal<br />
z.B. Reklination des Kopfes im atlantooccipitalen<br />
Gelenk bei Hyperkyphose<br />
der Brustwirbelsäule, Stütz im<br />
Handwurzelbereich auf steif<br />
extendierten Armen, Greifen nicht<br />
möglich.<br />
z.B. ulnare Duktion der unentfalteten<br />
Hand im Handgelenk, Adduktion des<br />
Daumens bei mangelhaftem oder<br />
fehlendem Pinzettengriff.<br />
z.B. beginnendes Robben oder<br />
Kriechen mit gleichzeitigem Einsatz<br />
(homolog) der Unterarme bei<br />
rekliniertem Kopf, steif gestreckten<br />
Beinen und Spitzfuß.<br />
30
Tabelle 5<br />
Stato-motorische Leitlinien nach dem Bobath-Konzept<br />
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Beachtet werden Haltung und Aktivitäten bei:<br />
− der Stabilisierung der Körperlage,<br />
− der Fortbewegung,<br />
− der Kommunikation,<br />
− der Feinmotorik.<br />
Beurteilt werden (qualitativ):<br />
− der Einfluß der automatischen Reaktionen (Stell-, Gleichgewichts- und Kettenreaktionen)<br />
auf die Kontrolle der Körperhaltung,<br />
− die Variabilität der spontanen Motorik und Bewegungsabläufe,<br />
− die Symmetrie,<br />
− das Auftreten von assoziierten Reaktionen und Bewegungen.<br />
Tabelle 6<br />
"Plastizität" des zentralen Nervensystems<br />
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
− Bildung neuer Synapsen<br />
− Aussprossen von Axonen ("sprouting")<br />
− Reorganisation motorischer Kontrollsysteme und sensorischer Areale<br />
− Übernahme von Aufgaben durch Hirnbereiche, die dafür nicht vorgesehen sind<br />
− Konditionierung automatisierter Bewegungsabläufe (auf Hirnstamm- und spinaler Ebene)<br />
− Kompensation von Funktionsverlusten durch Ausnutzen völlig anderer Möglichkeiten<br />
(z.B. bessere auditive und taktile Wahrnehmung bei Blinden)<br />
Tabelle 7<br />
10 Haupt- und Hilfszonen für das Reflexkriechen und das Reflexumdrehen<br />
Hauptzonen<br />
Reflexkriechen<br />
dem Hinterhaupt<br />
zugehörige Körperseite<br />
dem Gesicht<br />
zugehörige Körperseite<br />
distaler radialer Rand<br />
Unterarm<br />
Epicondylus medialis humeri<br />
Ferse condylus medialis femoris<br />
Hilfszonen Acromion innerer Scapularand unteres Drittel<br />
glutäale Oberschenkelfaszie<br />
Rumpf unterhalb Schulterblatt<br />
spina iliaca anterior superior<br />
Reflexumdrehen<br />
Zone Brustzone zwischen 7. und 8. Rippe<br />
Von jeder Haupt- oder Hilfszone alleine kann in der Neugeborenenperiode der gesamte<br />
Lokomotionskomplex aktiviert werden. Der Kopf wird dabei stets vor Beginn der Stimulation<br />
in eine asymmetrische Haltung gebracht .<br />
31
Tabelle 8<br />
Behandlungsziele bei der infantilen Zerebralparese nach dem Bobath-Konzept<br />
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------<br />
− Bessere Regulation des Haltungstonus und der Haltungskontrolle<br />
− Abstimmung der Kontraktion von synergistisch und antagonistisch wirkenden Muskelgruppen<br />
− Verbesserung der abnormen, meist stereotypen grob- und feinmotorischen Bewegungsabläufe<br />
(einschließlich der Mundmotorik)<br />
− Verminderung der assoziierte Reaktionen und assoziierte Bewegungen<br />
Tabelle 9<br />
Indikationen zur Behandlung nach Vojta im frühen Kindesalter<br />
Sofortiger Behandlungsbeginn bei<br />
− schweren und mittelschweren Zentralen Koordinationsstörungen (ZKS),<br />
− leichter ZKS mit konstanten Haltungsasymmetrien,<br />
Behandlungsbeginn nach Kontrolluntersuchungen<br />
− bei gravierender Verschlechterung von leichtesten und leichten ZKS. Kontrollen<br />
bei leichtester ZKS nach 6 - 8 Wochen, bei leichter ZKS nach 4 - 6 Wochen.<br />
Tabelle 10<br />
Kriterien bei der Indikation zur Behandlung im frühen Kindesalter nach dem Bobath-Konzept<br />
Bei reifgeborenen Säuglingen<br />
− deutliche motorische oder sensomotorische Entwicklungsstörung<br />
− Symptome, die eine zerebrale Bewegungsstörung wahrscheinlich machen<br />
Bei sehr unreifgeborenen Säuglingen<br />
− Auffälligkeiten von Körperhaltung und Bewegungsabläufen, die die Nahrungsaufnahme beeinträchtigen<br />
− Erhebliche Verhaltensauffälligkeiten wie z.B. Ess- und Trinkstörungen, Störung des Schlaf-Wachrhythmus<br />
− Abnorme Ausprägung der automatischen und der primären Reaktionen (im Bezug auf das Lebensalter oder<br />
"neurologische" Alter)<br />
− Stereotype Bewegungsabläufe, konstante Haltungs- und Bewegungsasymmetrien<br />
− Gestörte Kommunikations- und Interaktionsfähigkeit.<br />
Ergänzende Kriterien<br />
− Erhebliche Komplikationen in der Perinatalzeit<br />
− Abnorme Befunde bei der Bildgebung, die auf eine schlechte Prognose hinweisen<br />
32
Tabelle 11<br />
Vergleich der Behandlungskonzepte nach Bobath und Vojta<br />
1) Konzepte zur<br />
Motorischen Entwicklung<br />
und Kontrolle:<br />
Bobath-Konzept Vojta-Konzept<br />
Ursprünglich hierarchisch-reflektorisch<br />
orientiert, später Betonung der Umwelt-<br />
einflüsse und der simultanen Entwicklung der<br />
sensomotorischen Bereiche, die miteinander<br />
in Verbindung stehen, aber<br />
nicht zwingend aufeinander aufbauen.<br />
2) Behandlung: Individuelles, aufgaben- und<br />
funktionsorientiertes Vorgehen, mit dem Ziel<br />
die Körperhaltung zu stabilisieren und<br />
eigenständige Handlungen anzuregen. Die<br />
Behandlung soll in den Alltag eingebunden<br />
werden und ist daher sehr variabel zu<br />
gestalten. Nur in den ersten Lebensjahren<br />
wird die Verbesserung der Qualität der<br />
Bewegungsabläufe in den Vordergrund<br />
gestellt.<br />
Hierarchisch-reflektorisch orientiert.<br />
Repetitives Auslösen angeborener<br />
Bewegungsmuster (Reflexkriechen und<br />
Reflexumdrehen) mit dem Ziel, diese so<br />
fazilitieren zu können, daß sie als<br />
normaleTeilmuster auch der<br />
Willkürmotorik zur Verfügung stehen.<br />
Die Behandlung erfolgt 2 bis 4mal<br />
täglich nach festgelegtem Plan. Bei<br />
Stagnation der Fortschritte orientiert<br />
sich die Therapie an der Erhaltung des<br />
Erreichten.<br />
33
Anhang Tabelle I<br />
Auswahl bestimmter Neugeborenen-Primitiv-Reflexe und Automatismen für die Diagnostik<br />
nach Vojta<br />
Bezeichnung Waltezeit<br />
Intensität)<br />
(höchste Pathologisches Symptom<br />
Orofaziale Reflexe<br />
Babkin-Reflex<br />
bis 4 Wochen<br />
nach 6 Wochen<br />
Rooting-Reflexe<br />
bis 3 Monate<br />
nach 6 Monaten<br />
Saug-Reflex<br />
bis 3 Monate<br />
nach 6 Monaten<br />
Puppenaugenphänomen<br />
Positive Supporting Reaction<br />
der Arme<br />
der Beine<br />
Phasische Streckreflexe<br />
Handwurzelreflex<br />
Fersenreflex<br />
Tonische Streckreflexe<br />
suprapubischer Streckreflex<br />
gekreuzter Streckreflex<br />
Neonataler Gehautomatismus<br />
Galant-Reflex<br />
Lift-Reaktion<br />
Greifreflexe<br />
der Hand<br />
des Fußes<br />
Telerezeptorische Reaktionen<br />
bis 4 Wochen<br />
keine<br />
bis 4 Wochen<br />
keine<br />
bis 4 Wochen<br />
bis 4 Wochen<br />
bis 6 Wochen<br />
nach 6 Wochen<br />
von Geburt an<br />
nach 3 Monaten<br />
von Geburt an<br />
nach 3 Monaten<br />
nach 3 Monaten<br />
nach 3 Monaten<br />
bis 4 Wochen<br />
nach 3 Monaten<br />
bis 4 Monate nach 3 Monaten<br />
bis 4 Monate +++ im 2. Trimenon<br />
bis zur Entwicklung der<br />
Stütz- und Greiffunktion<br />
der Hand<br />
bis zur Entwicklung der<br />
Stützfunktion des Fußes<br />
vermindert bis fehlend im 2. Trimenon bei<br />
dyskinetischer Bedrohung<br />
+++ im 2. Trimenon und später bei spastischer<br />
Bedrohung<br />
vermindert bis fehlend im 2.-3. Trimenon und<br />
später bei spastischer Bedrohung<br />
+++ im 2. und 3. Trimenon und später bei<br />
dyskinetischer Bedrohung<br />
RAF (Reflex acustico-facialis) ca. 10. Lebenstag bis bei Fehlen nach 4. Lebenswoche<br />
Lebensende<br />
ROF (Reflex optico-facialis) nach 3. Monat bis bei Fehlen nach 4. Lebensmonat<br />
Lebensende<br />
Für alle Reflexe gültig: jede Abschwächung oder Fehlen in der Waltezeit ist pathologisch.<br />
34
Anhang Tabelle II<br />
35
Abbildung 1<br />
37
Abbildung 2<br />
38
Abbildung 3<br />
gemittelte<br />
Reflexstärke<br />
2.0<br />
1.5<br />
1.0<br />
0.5<br />
Kontrolle (n = 458) Spastische CP (n = 65)<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
Alter (Monate)<br />
Anhang Abbildung 3 : Altersabhängigkeit der Intensität des suprapubischen<br />
Streckreflexes bei normalen Säuglingen und bei solchen mit infantiler<br />
spastischer Zerebralparese (Futagi et al. 1992)<br />
39
Abbildung 4<br />
gemittelter<br />
Reflexscore<br />
2,5<br />
2<br />
1,5<br />
1<br />
0,5<br />
0<br />
Kontrolle (n=458) Spastische CP (n=65)<br />
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11<br />
Alter (Monate)<br />
Anhang Abbildung 4: Altersabhängigkeit der Intensität des gekreuzten Streckreflexes<br />
bei normalen Säuglingen und solchen mit infantiler spastischer Zerebralparese<br />
(Futagi et al. 1992)<br />
40