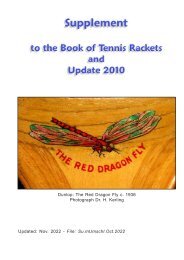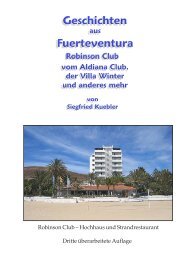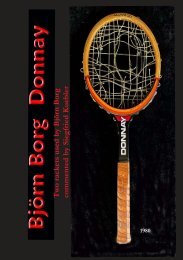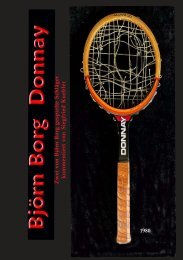Unter dem Jerusalemer Kreuz
Württemberger In Palästina
Württemberger In Palästina
- Keine Tags gefunden...
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
2
Vorderseite: Bild von Jerusalem
Mit etwas Fantasie erkennt man links den Felsendom, wohl das
bekannteste Wahrzeichen Jerusalems. Daneben die Al-Aqsa-
Moschee, das drittwichtigste Heiligtum der Moslems.
Rechts erkennt man die Grabeskirche, die als die heiligste Stätte
der Christen gilt. Sie wird von den griechisch-orthodoxen Gläubigen
Auferstehungskirche genannt.
Darunter ist die Klagemauer gezeichnet. Eine heilige Stätte der
Juden. Sie stellt für sie ein Symbol für den ewigen Bund Gottes mit
seinem jüdischen Volk dar.
Sinnbildlich vom Verfasser dargestellt.
Band 1
1931-1942
Vierte Auflage
Nach drei Auflagen mit insgesamt 130 Exemplaren
folgt jetzt die vierte Auflage, die einige wenige
zusätzliche Ergänzungen beinhaltet.
Sie ist auf 20 Bücher beschränkt.
Siegfried Kuebler
Autobiografie
In dieser Reihe sind bisher folgende Bändchen erschienen:
Band 1: Unter dem Jerusalemer Kreuz (1931-1942)
Band 2: In Überlingen (1942-1953)
Band 3: Immer nur ein Fremder (1953-1956)
Band 4: Ein Immigrant in Kanada (1957-1960)
Band 5: Ein Kirschbaum blüht im Garten (1960-1984)
© Copyright
by Siegfried Kuebler
Mai 2013
Zur Grundel 18
D 88662 Überlingen
Württemberger in Palästina ...
Unter dem Jerusalemer Kreuz
(1931-1942)
von
Siegfried Kuebler
Vierte Auflage
Inhaltsverzeichnis
Prolog: Wer ist denn der Neue im Club? 7
Vorwort zur dritten Auflage 9
In Jerusalem geboren 13
Die Templer 22
Die Familie Dyck in der Ukraine 34
Johannes am Kaukasus und auf der Krim 37
Johannes heiratet eine Edelmannstochter 42
Johannes zieht in die Templersiedlung Haifa 44
Johannes verliert seine Familie 47
Johannes in Jerusalem 50
Ein Amerikaner – mein Großvater Friedrich Kuebler 58
Mein Vater musste die Metzgerei übernehmen 63
Jona Kuebler – der Bruder meines Vaters 66
Der Erste Weltkrieg bricht über Palästina herein 68
Mein Vater wird Deutscher 71
Kuebler's Tourist- and Travel Office 73
Mein Vater heiratete Paula Dyck 79
Meine frühe Kindheit 83
Ein Erdbeben 89
Der Täuberich 91
Der grüne, ungenießbare Frosch 94
Mein Vater wird ungarischer Honorarkonsul 96
Eine Gartenparty für die Diplomaten 99
Yachia, der stärkste Träger Jerusalems 101
Ein Einbrecher 103
Ich lernte eine Lektion 105
Die blauen Nonnen 109
Unruhen in Jerusalem 113
Tante Kea 116
Ein neues Büro am Jaffator 122
6
Onkel Egmont 124
The German Colony 127
Alt Jerusalem 138
Der arabisch-israelische Konflikt 144
Lawrence of Arabia 146
Der Zweite Weltkrieg bricht aus 152
Die Templersiedlung Sarona 156
Ein späterer Besuch in Sarona 159
Bei Familie Weller 165
Jugendstreiche 178
Gefährliche Jugendstreiche 184
Die Ungarnbuben 191
Bombenangriffe auf Tel-Aviv 201
Trachom bricht im Lager aus 206
Mein Vater wird nach Australien verlegt 209
Das Internierungslager Athlit 214
Der Gefangenenaustausch nach Deutschland 219
Die überraschende, neue Geschichte des Hauses Kuebler 222
Zeitungsausschnitte, die meinen Vater betreffen 227
Shay Farkash 230
Anmerkungen zu Walter Mittelholzer 232
Literaturverzeichnis 235
Weitere Bücher 237
Die Untertitel in kursiver Schrift sind geläufige arabische Sprichwörter.
7
8
Hochmittelalterlicher „Stadtplan“ von Jerusalem
Prolog: Wer ist denn der Neue im Club?
Zwischen Lachen und Spielen werden die Seelen gesund.
„Heute ist es mir ganz gut gelaufen“, sagte Emmi zu ihrem
Mann. „Am Loch 18 war der Ball allerdings im Wasser
gelegen, und ich musste einen Strafschlag in Kauf nehmen,
aber ich habe immer noch ein Doppelbogey gespielt.“
„Ich habe heute Pech gehabt“, meinte Paul. „Meinen Ball
habe ich immer wieder ins hohe Rough geschlagen und ihn
nicht wiedergefunden. In unserer Runde war übrigens der
Neue dabei, von dem wir neulich gesprochen hatten. Obwohl
er schon 70 Jahre alt ist, stellte er sich gar nicht so ungeschickt
an. Er soll langjähriges Mitglied des Überlinger Tennis
Clubs sein und im letzten Jahr sogar Turniere der Medenrunde
gespielt haben. Tennisspieler haben es einfacher,
wenn sie mit Golf anfangen. Sie bringen das Ballgefühl mit.“
„Anfangs machen sie schnelle Fortschritte“, erwiderte
Emmi. „Wenn sie aber einmal die Eins vor ihrem Handicap
stehen haben, geht es ihnen wie allen anderen. Es geht nur
noch sehr langsam mit dem Handicap abwärts oder gar nicht
mehr. Übrigens hat mir Käthe erzählt, die den Neuen schon
länger kennt, ich glaube er heißt Kuebler, dass er einige Erfindungen
gemacht haben soll und eine große amerikanische
Sportgerätefirma, man sagt es sei Wilson, die Lizenz für den
Nachbau seiner entwickelten Tennisschläger erworben hat.“
„Er soll auch in Deutschland, und zwar in Singen, eigene
Tennisschläger gebaut und mit gutem Erfolg vertrieben haben“,
meinte Paul. „Karl hatte einen Schläger von ihm in den
Achtzigerjahren gespielt und war damit sehr zufrieden. Er
erzählte, dass Kuebler von Beruf Kälte- und Klimafachmann
sei und mechanische Kühltürme entwickelt hatte, die die
Firma Gohl in Singen seit 1960 bis heute bauen würde. Sie
9
sei zum größten Hersteller für solche Geräte in Europa geworden.“
„Er soll in Jerusalem geboren sein“, krähte Emmi mit heiserer
Stimme. „Käthe meinte, dass er aber weder Moslem
noch Israeli sei, sondern einer evangelischen Sekte angehören
würde, deren Mitglieder aus Württemberg gegen Ende
des 19ten Jahrhunderts nach Palästina ausgewandert seien.
Templer hätten sie sich genannt.“
„Wir haben in letzter Zeit schon wirkliche Exoten als neue
Mitglieder in unseren Club aufgenommen. Von jedem erzählt
man sich eine noch wildere Geschichte. Aber das alles
kann uns gleichgültig sein, solange sie sich beim Spiel und
beim Umgang mit anderen korrekt verhalten und nicht ihre
unerzogenen Enkel auf den Platz mitbringen. Vielleicht gelingt
einigen der neuen Mitglieder sogar, dem manchmal
langweiligen Clubleben neue Impulse zu geben. So gesehen
kann auch der Kuebler uns willkommen sein“, entgegnete
Paul und schob auf dem Putting-Green, wo er nach dem Spiel
seinen Schlag wiederfinden wollte, den nur 15 cm vom Loch
entfernten Ball daneben, was ihm einen nicht gesellschaftsfähigen
Fluch entlockte.
Emmi schaute sich um, ob irgendjemand den Ausruf ihres
Mannes gehört haben könnte, und warf ihm dann einen vorwurfsvollen
Blick zu.
„Echt geil, die Grufties müssen noch viel lernen“, murmelte
der Jugendliche, der den Ausspruch gehört hatte. Sein fünf
Meter entfernter Ball auf dem benachbarten Grün rollte während
seines Kommentars direkt ins Loch.
Die beiden schon schlecht hörenden Alten, sie hatten den
Ausspruch des Jungen nicht gehört, trotteten vom Grün zum
Restaurant, wo ein kühles Bier nach der anstrengenden Runde
auf sie wartete.
10
Vorwort zur dritten Auflage
Das Leben besteht aus zwei Teilen: die Vergangenheit – ein
Traum; die Zukunft – ein Wunsch.
Wie schon seit vielen Jahren verbringen Regine und ich
den deutschen Winter im sonnigen Südafrika. Wir haben uns
in der Nähe von Kapstadt ein kleines Häuschen gekauft, das
in einer bewachten Anlage liegt und den hübschen Namen
Zevenwacht Village trägt, genannt nach dem Weingut, das
weiter oben auf einem Hügel liegt, von wo man einen weiten
Blick in die Kapstadtebene hat mit dem Tafelberg im
Hintergrund als Silhouette. Auch wir können von unserem
Garten aus den Tafelberg sehen und sogar den unverwechselbaren
Lions Head, der etwas weiter nach Westen liegt.
Das Häuschen und auch den Garten hat Regine in ein kleines
Kleinod verwandelt. Auf der Terrasse entlang dem Häuschen
unter dem Schatten der dichten orange, violett, dunkelrot
und pink blühenden Bougainvillea-Sträuchern habe
ich mich niedergelassen, um meinem Hobby nachzugehen:
zu schreiben. Regine hat mir ihren Garten erklärt, den sie
zusammen mit ihrer Freundin Sue, einer gebürtigen Südafrikanerin,
angelegt hat. Sie ist von Beruf Landschaftsgärtnerin
und kennt die einheimischen Pflanzen von Südafrika aus
dem Effeff (die werden hier indigenous plants genannt). Der
Garten hat schon die Bewunderung von vielen der etwa 200
Bewohner dieses Villages auf sich gezogen. Im Besonderen
wird der Berea Grasrasen bestaunt, der nicht gelb wird, wie
viele andere trotz Beregnung im Sommer, sondern sein saftig-grünes
Leuchten beibehält. Im Hochsommer beginnt das
Gras sogar zu blühen. Dieser Rasen muss gepflanzt werden,
wie die Setzlinge von Reis. Jede kleine Pflanze bildet Ausleger,
die sich wieder eine Stelle suchen, wo sie Wurzeln schla-
11
gen können. So wird der Rasen immer dichter und man geht
schließlich darauf wie auf einer weichen Matratze. Diese
Grassorte ist in Südafrika heimisch und deshalb an die stark
wechselnden Klimabedingungen angepasst. Der große Garten
ist durch eine drei Meter hohe Bleiwurz-Hecke, deren Doldenblüten
hellblau sind, vor neugierigen Blicken geschützt.
Davor sind Baumfarne gepflanzt, Geranien – auch in Südafrika
heimisch –, und weiße, blaue und violette Agapanthen.
Ein lustiger rot und pink blühender Bottlebrush steht für sich
allein, ich glaube, dass der nicht allzu groß wachsende Baum
auf Deutsch Lampenputzer heißt. Die sichelförmige gemauerte
Einfassung, die sich auch zum Sitzen bei Partys im Freien
anbietet, ist mit Lavendel und Eisbergrosen eingefasst.
Sie werden mit Vorliebe in dieser Weingegend am Rand von
Weinbergen gepflanzt, weil sie irgendwelche Krankheiten
vor den Reben bekommen, sodass der Weinbauer rechtzeitig
darauf reagieren kann. Regine ist besonders stolz auf die
vielen Bäume im Garten, darunter sind zwei haushohe Steinpinien,
einige kleinere Olivenbäume, ein rot blühender Rooiblom
Blue-Gum Eukalyptusbaum, ein Frangipanibaum mit den
rosahellgelben Blüten, die einen äußerst starken, in manchen
Parfüms wiederzufindenden Duft abgeben, ein Zitronenbaum,
ein Feigenbaum und zwei Granatapfelbäume. Die
beiden Damen haben auch einen englischen Rosengarten
angelegt, umgeben von Hortensien, die, man sieht es ihrer
Blütenfülle an, das Klima lieben. Ergänzt werden alle Pflanzen
von Proteas und Fynbos-Arten, die nirgends auf der Welt
in dieser Vielfalt vorkommen wie in der Kap-Region.
Wir spielen dreimal in der Woche Golf. Das nimmt Zeit in
Anspruch. Trotzdem bleibt noch Muße zum Lesen übrig.
Allerdings befriedigt mich das Lesen nicht immer, und dann
suche ich nach einem neuen Projekt, nach einem neuen The-
12
ma, über das ich schreiben könnte. Wie wäre es, die Geschichten
aufzuschreiben, die ich bei meinen vielen Urlauben auf
der Insel Fuerteventura erlebt habe? Ich könnte das Erlebte
etwas abändern, Neues hinzuerfinden, sodass es für den
Leser interessanter wird. Dann fällt mir das Büchlein „Unter
dem Jerusalemer Kreuz“ in die Hand. Ich überlege mir, ob
ich es nochmals überarbeiten sollte, einige Korrekturen anbringen,
einige Ergänzungen einfügen. Shay Farkash, der
Israeli aus Tel Aviv, der mich vor drei Jahren in Überlingen
aufgesucht hatte, nachdem ihm mein Büchlein in die Finger
gekommen war, und der alle Schwarz-Weiß-Fotos meiner
Mutter mit der Beschreibung eines jeden Fotos haben wollte,
um sie digital in sein Archiv über die Templer aufzunehmen,
hatte mir einen an ihn gerichteten Brief von Felix Haar
zugeschickt, der wichtige Anregungen zu dem Büchlein
machte und einige Korrekturen vorschlug. Felix Haar, heute
in Australien lebend, war mit uns zusammen in Sarona interniert.
Er ist drei Jahre älter als ich und kann sich daher an
manche damalige Ereignisse – er war damals 13 und ich erst
10 – besser als ich erinnern.
Außerdem ist der Prozess, den der israelische Generalstaatsanwalt
gegen den ehemaligen israelischen Ministerpräsidenten
Ehud Olmert angestrengt hatte, mit einem Freispruch
für Olmert zu Ende gegangen. Ihm war vorgeworfen
worden, das Haus in der Cremieuxstraße No. 8 (zur Erinnerung:
es ist mein Vaterhaus in der ehemaligen deutschen
Kolonie) viel zu billig erworben zu haben. Diesen Preisvorteil
habe er sich nur als damaliger Oberbürgermeister von
Jerusalem verschaffen können, und er habe somit sein Amt
missbraucht. Mit dem Freispruch ist nun die Geschichte um
das Haus zu einem Ende gekommen.
13
Shay Farkash war besonders interessiert an einem kleinen
Fotoalbum meiner Tante Kea, der Schwester meiner Mutter.
Es enthielt viele Aufnahmen von ihrem Bauernhof in der kleinen
Templersiedlung „Neuhardthof“, den sie mit ihrem
Mann zusammen, südlich von Haifa direkt am Meer gelegen,
bewirtschaftete. Er meinte, dass dies das bisher einzige
Bildmaterial von „Neuhardthof“ sei. Die Universität von
Haifa würde sich auch für diese Bilddokumente interessieren.
Warum sollte ich nicht die Geschichte meiner Tante in
das Büchlein aufnehmen? Einige Fotos dazu?
Auf der Terrasse mit den Singvögeln in den Büschen rings
um mich herum und den beiden Frankolins – eine südafrikanische
Fasanenart –, die mit ihren Jungen über Regines
Garten hüpfen, werde ich vielleicht die Ruhe finden, um dieses
Projekt durchzuziehen.
Und die vierte Auflage?
Die Ergebnisse der Recherchen über den Verbleib der Luftaufnahmen
von Palästina Anfang der 1930er Jahre von dem
Schweizer Flieger Mittelholzer wurden dargelegt und einige
kleinere Ergänzungen vom Internierungslager in Sarona hinzugefügt.
14
In Jerusalem geboren
Seltener Besuch vermehrt die Freundschaft. Wenn er aber oft kam,
schnitten sie ihm die Flügel.
„Wo sind Sie geboren? Wie bitte? In Jerusalem? Dann sind
Sie wohl ein Araber?“
Diese Frage wird mir heute manchmal gestellt, wenn ich im
Sommer braun gebrannt einem Beamten bei der Einreise in
ein nicht zur EU gehörendes Land gegenüberstehe und meinen
Pass, in dem natürlich mein Geburtsort vermerkt ist,
vorlege. Sofort werde ich insgeheim verdächtigt, ein möglicher
Terrorist zu sein, doch der Beamte fährt dann mit seiner
Hand über sein Kinn und denkt für sich: Dafür ist dieser
Mann eigentlich zu alt. Im Winter aber, wenn meine Gesichtsfarbe
weiß ist, lautet die Frage: „Dann sind Sie wohl ein Jude
oder ein Israeli?“
Keiner dieser Beamten würde auf die Idee kommen, mich
als Deutschen und schon gar nicht als Baden-Württemberger
einzustufen. Wo liegt schon Baden-Württemberg? Nie davon
gehört. Doch bei der Nationalität steht „deutsch“ im Pass,
und er lässt mich passieren.
Mein Aussehen ähnelt allerdings auch nicht unbedingt dem
eines nordischen Germanen. Es würde eher mit dem eines
Römers übereinstimmen. Das ist nichts Außergewöhnliches,
denn die Mehrzahl der Baden-Württemberger besitzen braune
Augen, dunkle Haare und einen etwas dunkleren Teint
als ein typischer Norddeutscher. Die Römer hatten seinerzeit
südlich des Limes ihre Spuren hinterlassen und das germanische
Element mit ihren Genen aufgemischt, manche behaupten
sogar veredelt.
Für Passkontrolleure ist jedoch alles ganz einfach: Wenn ei-
15
Die Grabeskirche gilt als die heiligste Stätte der Christenheit.
Sie wurde auf dem Platz erbaut, wo sich nach christlicher
Überlieferung das Grab Jesu befunden haben soll. Die
ältesten Teile sind Überreste einer Basilika, die unter Kaiser
Konstantin dem Großen im 4ten Jahrhundert errichtet worden
war.
ner in Jerusalem geboren wurde, müsste er eigentlich arabischer
oder jüdischer Herkunft sein.
In Jerusalem geboren zu sein, ist schon ein Privileg. Jerusalem
ist eine ganz besondere Stadt mit einer bewegten Geschichte,
die ihresgleichen sucht.
„Deiner Herkunft und deiner Geburt nach stammst du aus dem
Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter, deine Mutter
eine Hethiterin“, das sagte Gott zu Jerusalem (Jesaja 16.3).
Jerusalem birgt viele heilige Stätten der drei großen Religionen
wie zum Beispiel die Grabeskirche der Christen, die Klagemauer
der Juden und die al-Aqsa-Moschee der Moslems,
dahinter den Felsendom – die Omar Moschee –, das herausragende
Wahrzeichen Jerusalems.
16
Die Klagemauer ist die heiligste Stätte des Judentums. Sie ist
der Überrest einer Stützmauer um den Jerusalemer Tempel,
die 20 v. Chr. von Herodes gebaut worden war. Der Name
entstand, weil die Israeliten hier die Zerstörung ihres Tempels
durch die Römer 70 n. Chr. bis heute beklagen.
Jerusalem ist die Tempelstadt Davids und Salomons, die Stätte
der Auferstehung Jesu. Mohammed war auf dem geflügelten
Pferd Burak von Mekka nach Jerusalem gekommen.
Vom Tempelberg reiste er weiter durch sieben Himmel bis
zum Thron Gottes. An der Stelle seines Aufbruchs über dem
Felsen Moria wurde der Felsendom errichtet.
Die frühesten Siedlungsspuren fand man südlich der heutigen
Altstadt, die aus dem 4. Jahrtausend v. Chr. von einer
semitischen Bevölkerung stammen sollen. Auf einer in Nordsyrien
gefundenen Tontafel von 2400 bis 2150 v. Chr. las man
zum ersten Mal in sumerischer Keilschrift den Namen
Urusalim. Uru war der Name für Stadt und Salim hieß Heil.
An dem Namen und seiner Bedeutung hat sich im Laufe der
17
Jahrtausende nichts geändert. Selbst die Moslems nennen die
Stadt el Quds, übersetzt Stadt des Heils und die Israelis
Yerushalayim.
Dieser Stadt sind aber viele weitere Namen im Laufe der
Zeit gegeben worden. Über 70 sind bekannt. So wurde sie
auch Adonai Jireh – der Ewige sieht, Betulah – Jungfrau,
Druschah – Gesuchte, nie verlassene Stadt, Ir HaEmet – Stadt
der Wahrheit, Shalem – Friede, Kiriah Aliza – Stadt der Fröhlichkeit,
Klilat Joffi – der Schönheit Krone, Tzur HaMishor –
Fels in der Ebene genannt. Sion ist der biblische Name für
die Stadt: Maria, Tochter Sion. Am besten passt zu ihr
zweifelsohne: die Heilige Stadt, wie sie heute auch allgemein
genannt wird.
Die Geschichte der Stadt Jerusalem war von Kriegen bestimmt.
Sie wurde unzählige Male blutig erobert und zerstört,
dann prächtiger denn je wieder aufgebaut, nur um erneut
zerstört zu werden. Bei jeder Eroberung wurden viele
Einwohner umgebracht, und die mit dem Leben davonkamen,
vertrieben. Sie stand unter ägyptischer, amoritischer
(Kanaaniter aus dem Zweistromland), hethitischer, semitischer,
hellenistischer, römischer, christlicher, persischer und
türkischer Herrschaft. Und es gab eine Periode, in der die
Kreuzritter das Sagen hatten. Sie war zwischendurch immer
wieder die Hauptstadt der Juden. In Jerusalem ließ sich
David, der 998 v. Chr. die Philister überwinden konnte, zum
König salben. König Salomon folgte ihm, der auf dem Berg
Moria seinen Palast und den Tempel errichtete. Die Stadt
wird auch als die Stadt Davids bezeichnet.
Man muss sich allerdings fragen: Ist sie wirklich die Stadt
des Heils? Keine andere Stadt der Welt hat so viele Kriege,
so viele Zerstörungen und wahrscheinlich auch so viel Leid
über sich ergehen lassen müssen. Und das alles, obwohl sie
18
Der Felsendom ist nach der Kaaba in Mekka und der
Grabmoschee Mohammeds in Medina das drittwichtigste
Heiligtum des Islam. Er umschließt den Heiligen Fels, auf
dem die Gläubigen den Huf Abdruck von Mohammeds
Pferd Burak erkennen. Mohammed soll von hier auf dem
Pferd in den Himmel geritten sein. Nach jüdischer
Überlieferung handelt es sich um den Felsen, auf dem
Abraham seinen Sohn opfern wollte.
weder über eine besondere strategische Lage, wie z. B. Troja,
verfügte noch über genügend Wasser und fruchtbares Land
in ihrer Umgebung. Wie hieß es schon in der Bibel? Viel Steine
gabs und wenig Brot! – Und das kann man wörtlich nehmen.
Alle Menschen, die Jerusalem aus ihrer Sicht oft in guter
Absicht das Heil bringen wollten, haben in ihrem Fanatismus
das Gegenteil bewirkt. Die christliche Lehre, die sagt:
Du sollst deine Feinde lieben, ist gerade hier in der Geburtsstadt
Jesu am allerwenigsten befolgt worden.
Die englische Krone hatte von 1920 bis 1947 einen Hoch-
19
kommissar eingesetzt, der Palästina verwaltete. Er hatte seinen
Sitz in Jerusalem. Die Stadt wurde, nachdem die britische
Herrschaft beendet war, zwischen den Palästina-Arabern
und den Israelis aufgeteilt. Schließlich wurde sie 1980
zur Hauptstadt Israels erklärt. Heute hat Jerusalem etwa
600 000 Einwohner, darunter 130 000 Moslems und 25 000
Christen. Um die Jahrhundertwende waren es nur 58 000
Einwohner, davon 28 000 Juden, 16 000 Christen und 14 000
Moslems, die Juden waren in Jerusalem schon damals in der
Überzahl.
In der Heiligen Stadt wurde ich am 31. Oktober 1931 morgens
früh im Deutschen Krankenhaus in Jerusalem als gesunder sieben
Pfund schwerer Junge geboren. Am Reformationstag.
Kann man sich ein einprägsameres und schöneres Datum
wünschen? Bereits 1851 war von der Kaiserswerther Diakonie
ein Krankenhaus, das sogenannte Deutsche Krankenhaus,
und eine Apotheke in der Altstadt von Jerusalem eröffnet
worden. Meine Mutter hob mich mit ihren Händen hoch und
zeigte mir durch das Fenster die Klagemauer und den Felsendom.
„Jerusalem ist die Stadt, in der du geboren bist“, flüsterte sie
mir ins Ohr, „so wie dein Vater und ich auch in diesem Krankenhaus.“
Natürlich sah und hörte ich nichts von ihrem
Ausruf, doch später, als ich erwachsen war, erzählte sie mir
davon, dass das Erste, was ich von der Außenwelt sah, der
Tempelplatz war.
Meine Mutter hatte etwa ein Jahr zuvor eine Totgeburt gehabt.
Es war ein Junge gewesen. Die Nabelschnur hatte sich
um den Hals des Babys gewickelt und es im Mutterleib erstickt.
Sie war die Zeit danach in tiefe Depressionen gefallen, hatte
dunkle Bilder in Öl gemalt und noch düstere Wandteppiche
20
in den wenigen Zimmern der kleinen Wohnung in dem elterlichen
Haus meines Vaters aufgehängt. Während ihrer
erneuten Schwangerschaft war sie oft melancholisch gestimmt
und glaubte nicht, dass ich gesund zur Welt kommen
würde. Als ich dann den ersten Schrei von mir gab, löste
sich alles in Tränen des Glücks auf und ihre Melancholie
war wie weggeblasen.
Manchmal hege ich den Verdacht, dass die Traurigkeit, die
mich in jungen Jahren nach der Pubertät hin und wieder befiel,
mit der Zeit der Schwangerschaft zu tun hatte. Gehen
nicht manche Forschungen davon aus, dass die Verfassung
der Mutter während dieser Zeit entscheidenden Einfluss auf
die spätere Entwicklung des Menschen hat?
Während ihrer Schwangerschaft war auch ihr geliebter Vater
Johannes Dyck gestorben, der immer ein offenes Ohr für
sie hatte und ihr Trost zusprach. Dagegen war die Mauer,
die zwischen ihr und ihrer durch die vielen Schicksalsschläge
hart und unnahbar gewordenen Schwiegermutter
Katharina Kuebler sowie deren unverheiratete schon 48 Jahre
alte Tochter Sofie bestand, noch höher und undurchdringlicher
geworden. Aber auch Katharina starb noch vor meiner
Geburt.
Wir lebten in der Deutschen Kolonie, einer Siedlung, die 1873
von eingewanderten Württembergern gegründet worden
war, die einer der evangelischen Kirche nahe stehenden Sekte
der Templer angehörten. Meine Eltern gehörten natürlich,
genauso wie meine Großeltern, die alle bei meiner Geburt
schon gestorben waren, dieser Sekte an. Ich war also auch
ein Templer.
Die Kolonie war im Süden der Stadt im Rephaim-Tal entstanden.
In etwa hundert schmucken Häusern, möglichst
erdbebensicher aus großen geschlagenen Kalksteinquadern
21
gebaut, wohnten etwa 400 Deutsche. Anfangs nannten sie
die Siedlung Rephaim in Anlehnung an den Namen des Tals.
Die Templer hatten eigene Schulen eingerichtet, sogar ein
Gymnasium, eine eigene Bank gegründet und eine Kirche
gebaut, die sie wegen ihrer Schlichtheit und ohne Turm auch
nur Saal nannten. Das religiöse Oberhaupt der Templer wohnte
in der Deutschen Kolonie und nicht in einer der anderen
Siedlungen der Templer, die über ganz Palästina verstreut
waren.
Die folgende Geschichte meines Großvaters Johannes Dyck,
die sich sicher als Drehbuch für einen spannenden abendfüllenden
Film anbieten dürfte, wirft etwas Licht auf die Herkunft
meiner Mutter und erklärt, weshalb sie mit ihrem Vater
so verbunden war. Zuvor aber folgt ein Kapitel über die
Templer, die natürlich absolut nichts mit den Templern des
Mittelalters zu tun haben. Zur Erinnerung: Im Jahr 1312 löste
Papst Clemens V. auf dem Konzil von Vienne (Frankreich)
den Orden auf.
22
Deutsche Kolonie in Jerusalem (eingekreist).
Von den etwa 100 Häusern sind nur einige gezeigt.
23
Die Templer
Bist du in jemandes Haus, so komm mit ihm aus.
Die Sekte der Templer wurde 1854 von dem evangelischen
Theologen Christoph Hoffmann zunächst unter dem Namen
Gesellschaft für die Sammlung des Volkes Gottes in Jerusalem gegründet,
deshalb auch Jerusalemfreunde genannt. Er wurde
1815 in Leonberg bei Stuttgart als Sohn des Gründers der
pietistischen freien Bürgergemeinde geboren und wuchs in Korntal
bei Stuttgart auf. Er studierte Theologie an der Universität
in Tübingen und wirkte anschließend als Lehrer in Ludwigsburg.
Er war Mitbegründer der Süddeutschen Warte, einem
religiösen und politischen Wochenblatt für das Deutsche
Volk.
Beispielhafte Frömmigkeit, Bescheidenheit und Demut
sollten seine Anhänger als neues Gottesvolk auszeichnen, als
dessen eigentliche Heimat er Jerusalem sah. In dieser Gemeinschaft
brüderlicher Gesinnung und tätiger Nächstenliebe
soll sich der Einzelne als lebendiger Baustein am geistigen
Tempel Gottes verstehen – daher der Name Templer. Georg
Hardegg, Mitbegründer der Sekte, schlug als Erster vor, diesen
Namen für die Gesellschaft zu verwenden.
Das besondere Anliegen der Templer ist die Besinnung auf
den Kern der Botschaft Jesu, auf seine Verheißung vom Reich
Gottes und auf seinen Auftrag, durch das eigene Trachten
und Handeln zum Werden einer besseren Welt, eben zu diesem
Reich der Liebe und Güte, beizutragen.
Revolutionär für die damalige Zeit war die Aussage der
Templer, dass Jesus ein Mensch war, der uns vorgelebt hat,
wie wir unser Leben ausrichten sollen und dürfen: Vertrauen
zu Gott und Liebe zum Nächsten im Streben nach dem
Reich Gottes.
24
Die Bibel wurde als eine reiche Quelle menschlicher Erfahrungen
mit Gott angesehen. Sie sollte unvoreingenommen
gelesen und dabei ein kritischer Maßstab angelegt werden.
Der Maßstab sollte der Grundgedanke der Lehre Jesu
sein.
Hinweisen biblischer Prophezeiungen folgend, glaubte
Hoffmann damals in Palästina dem Babylon der europäischen
Verhältnisse zu entkommen und durch die Errichtung von
religiös und sozial vorbildlichen Gemeinschaften beispielhaft
wirken zu können.
Er trieb die Auswanderung seiner Anhänger voran, die
zum größten Teil aus Württemberg stammten. Manche wanderten
nach Russland aus, und andere zog es in die Vereinigten
Staaten von Amerika. Doch die meisten fanden eine
neue Heimat in Palästina, so, wie es sich Hoffmann vorgestellt
hatte. Von 1868 bis 1873 wurden dann Siedlungen in
Haifa, Jaffa, Sarona und Rephaim bei Jerusalem gegründet.
Haifa war die größte und die erste der Siedlungen. Kaufleute,
Handwerker, Gastwirte, Lehrer und Beamte standen einer
kleineren Zahl von Landwirten gegenüber.
Später schaffte Hoffmann auch die Sakramente ab und
wandte sich in seinem Alterswerk der von Hegel beeinflussten
Vorstellung eines rein geistigen und ortsunabhängigen
Charakters eines zu errichtenden Gottesreiches zu.
Die Süddeutsche Warte war das Bindeglied zwischen den
Templern, die später in die Warte des Tempels überging.
Eine Zusammenfassung über die Geschichte der Templer
ist in der Wiener Zeitung am 14. Mai 1999 erschienen.
(Sie ist hier auszugsweise für diejenigen der Leser wiedergegeben,
die noch mehr über die Templer und deren Schicksal
erfahren möchten.)
25
Auf den Spuren der Templer im Heiligen Land:
Wuchtige alte Grabsteine
von Dieter Mühl
Den Begriff Templer verbinden die meisten Menschen mit
einem mittelalterlichen Ritterorden. In diesem Fall handelt
es sich jedoch um eine aus der protestantischen Pietistenbewegung
kommende, religiöse Gruppe, die um die Mitte des
19ten Jahrhunderts im Stuttgarter Raum vom Theologen
Christoph Hoffmann (1815 bis 1885) als die Tempelgesellschaft
gegründet wurde. Ihr Ziel war die Rückkehr zum einfachen
Leben der Urchristen sowie die Sammlung und Rückführung
des Volkes Gottes nach Jerusalem. Bis zur Umsetzung
ihres Zieles mussten die Gründerväter der Tempelgesellschaft
aber einige Hürden überwinden. Heftige Auseinandersetzungen
mit der evangelischen Kirche, welche im Jahr
1858 zum Ausschluss der Templer aus derselben führten, und
eine stark schwankende Mitgliederzahl verhinderten eine
dynamische Entwicklung.
Daran änderte auch der Umstand nichts, dass die Templer
bereits im Jahr 1856 eine Mustersiedlung in der Nähe von
Stuttgart gründeten, um ihre Mitglieder auf das Leben in
Palästina vorzubereiten. Zu Beginn der Sechzigerjahre des
19ten Jahrhunderts hatte die Tempelgesellschaft mit rund 10
000 Mitgliedern den Gipfel ihres Bestandes erreicht. Ein weiterer
Fortbestand schien den führenden Mitgliedern aber
dennoch nicht gesichert, sodass sie sich entschlossen, mit dem
geplanten Siedlungsprojekt im Heiligen Land zu beginnen.
Zunächst wurden vier Mitglieder auf eine Expedition zur
Erkundung der Lebensbedingungen ins Heilige Land geschickt.
Nach ihrer Rückkehr begann die langwierige Auswahl
der Kandidaten. Ende der Sechzigerjahre war es dann
so weit, und die ersten Templerfamilien erreichten Palästi-
26
Wuchtige alte Grabsteine
Grab des Johannes Dyck
„Erkennet, dass der Herr Gott ist.
Denn der Herr ist freundlich
und seine Gnade währet ewig
und seine Wahrheit für und für.
PS - 100“ – (Psalm 100)
na, unter ihnen Christoph Hoffmann und sein Mitarbeiter
Georg Hardegg (1812 bis 1879), ein Kaufmann aus Ludwigsburg.
Die erste Siedlung wurde 1868/69 in Haifa am Fuße des
Karmelgebirges gegründet. Sie sollte später auch die größte
und bedeutendste Siedlung werden. Die Berufsstruktur der
Templer war in Haifa durch die Stadt geprägt: Kaufleute,
Handwerker, Gastwirte, Beamte und Lehrer standen einer
kleinen Zahl von Landwirten gegenüber. Bereits kurze Zeit
nach der Gründung kam es zu internen schweren Meinungsverschiedenheiten
zwischen Christoph Hoffmann und Georg
Hardegg und in deren Folge zur Abspaltung von rund
einem Drittel der Mitglieder, Anhänger von Hardegg, die
zur evangelischen Kirche zurückkehrten. Die Verwaltung der
Siedlung, aber auch die Schule und der Kindergarten, blie-
27
ben jedoch weiterhin als Einheit erhalten. Der Zwist mit
Hardegg veranlasste Hoffmann, noch vor der Spaltung der
Bewegung nach Jaffa zu gehen und dort im Jahr 1869 eine
neue Siedlung zu gründen, wo die Templer auch ein eigenes
Krankenhaus betrieben.
Jerusalem als Zentrum
Entscheidend für die weitere Entwicklung der Tempelgesellschaft
war die Gründung einer Siedlung in Jerusalem, die
das religiöse Zentrum der Templer wurde. Dies konnte im
Jahre 1873 mit der Errichtung einer Siedlung im Rephaim-
Tal, im Süden der Stadt, verwirklicht werden. Jerusalem
wurde der Wohnsitz des Tempelvorstehers, dem religiösen
Oberhaupt der Templer, sowie der Sitz der Zentralleitung.
Die Siedlung in Jerusalem besaß im Gegensatz zu den anderen
Siedlungen mit nur Volks- oder Hauptschulen auch ein
Gymnasium, in welchem nach deutschen Lehrplänen unterrichtet
wurde. Ähnlich wie in Haifa war die Berufsstruktur
der Jerusalemer Siedlung eine städtische. In den folgenden
Jahren gründeten die Templer weitere vier, vorwiegend landwirtschaftlich
orientierte Siedlungen: 1892 Neuhardthof, rund
8 km südlich von Haifa, 1902 Wilhelma (heute: Bnei Atarot)
in der Nähe des heutigen Flughafens Ben Gurion bei Tel Aviv,
1906 Bethlehem (Beit Lehem Hagalilit) und 1908 Waldheim
(Alonei-Abba), die beiden zuletzt Genannten in der Nähe
von Nazareth. Waldheim wurde in erster Linie von ausgetretenen
Templern (Gruppe um Hardegg) gegründet.
Darüber hinaus gab es auch in Nazareth und Tiberias Templerfamilien.
(Anmerk: Sarona, heute im Herzen von Tel Aviv
und Hakirya genannt, war schon im Jahr 1871 gegründet
worden).
In den ersten zehn Jahren kamen rund 750 Templer ins
28
Heilige Land. Der Alltag der Siedler machte es erforderlich,
dass sie sich teilweise von ihrem religiösen Ziel entfernten
und stattdessen die Verbesserung der Lebensbedingungen
im Heiligen Land und ihre (angestrebte) Vorbildfunktion für
die Einwohner in den Vordergrund stellten. So waren sie
beispielsweise maßgeblich am Ausbau der Verkehrswege
zwischen Haifa und Nazareth sowie zwischen Jaffa und Jerusalem
beteiligt.
Nach den ersten schweren Jahren begann sich das Siedlungswerk
der Templer gegen Ende des 19. Jahrhunderts zu
konsolidieren. Die Beziehungen zur ansässigen arabischen
und jüdischen Bevölkerung blieben jedoch ambivalent. Zu
Beginn des Ersten Weltkrieges lebten rund 2 000 Templer im
Heiligen Land. Ihre Siedlungen entwickelten sich trotz einiger
Rückschläge während des Krieges gut, und die Templer
wurden in den Zwanziger- und Dreißigerjahren wohlhabend.
Die politischen Veränderungen in Deutschland durch den
politischen Aufstieg der Nationalsozialisten und deren
Machtübernahme wirkten sich auch auf die Templer aus.
Rund ein Drittel ihrer Mitglieder waren in der NSDAP oder
anderen nationalsozialistischen Vereinen organisiert. In allen
Siedlungen gab es Lokalorganisationen der NSDAP, welche
darüber hinaus in einem Landesverband zusammengefasst
waren. Bei Kriegsausbruch wurden die Templer von
den Engländern interniert. In den folgenden Jahren wurde
ein Teil nach Deutschland repatriiert, und der andere Teil
nach Australien gebracht. Die letzten Templer verließen das
Land im Jahre 1948, als der Staat Israel gegründet wurde.
Heute leben rund 800 Mitglieder in Deutschland und etwa
1 200 in Australien.
In Israel blieben nur die steinernen Zeugen zurück, Häuser
und Friedhöfe – auf Hebräisch Häuser der Ewigkeit ge-
29
nannt. Wer heute durch Jerusalems belebte Einkaufsstraße
Emek Rephaim schlendert, kann unschwer die gut erhaltenen
Templerhäuser ausmachen, die in ihrer stillen Gravität etwas
fremd wirken. Nach einiger Zeit steht er vor einer hohen
Umzäunungsmauer mit einem großen, grünen Eisentor.
Dahinter verbirgt sich der Templerfriedhof. In den ersten
Jahren hatten die Templer in Jerusalem ihre Toten auf
dem deutsch-englischen, evangelischen Friedhof auf dem
Zionsberg beerdigt.
Nach Meinungsverschiedenheiten mit dem evangelischen
Bischof kaufte die Templerin Anna Berner im Jahre 1878 ein
Grundstück in der Nähe der Templersiedlung, um ihren
Mann begraben zu können. Bis heute befindet sich dort der
Templerfriedhof in der Emek-Rephaim-Straße 39. Den Schlüssel
für die Besichtigung des Friedhofes bekommt man im
deutschen Hospiz in der Loyd-George-Straße 12 in Jerusalem.
Wie in Mitteleuropa
Beim Betreten des Friedhofes ist man als Besucher überrascht,
denn man befindet sich auf einem Friedhof, der einen
eher an Mitteleuropa als an die schlichten und schmucklosen
israelischen Friedhöfe erinnert. Man geht an wuchtigen
alten Grabsteinen vorbei, die gruppenweise angeordnet sind.
Auf halbem Weg öffnet sich der dicht von Bäumen bewachsene
Platz und gibt zur Linken ein Denkmal für die gefallenen
Templer des Ersten Weltkrieges frei. 24 Inschriften geben
Auskunft über die Schlachtfelder des Krieges, von Flandern
bis Galizien, von Serbien bis Nazareth. In der Mitte steht
ein Denkmal für 450 Tote und Gefallene in beiden Weltkriegen.
Eine Zusatztafel soll an die Gemeinden Sarona (1871 bis
1939), Jaffa (1869 bis 1942) und Wilhelma (1902 bis 1948) er-
30
innern. Der Templerfriedhof von Sarona wurde im Jahr 1952
aufgelassen und seine Gräber nach Jerusalem überführt. Im
Jahr 1970 wurden die Friedhöfe in Wilhelma, Bethlehem und
Waldheim aufgelöst und nach Jerusalem bzw. Haifa überführt.
In diesen beiden Städten bestehen die Friedhöfe bis
heute. Auf ihnen liegen rund 1 300 Tote begraben, deren
Gräber weiterhin Kunde von den einstigen Templergemeinden
geben.
Nach diesem Bericht aus der Wiener Zeitung wollen wir
uns vergegenwärtigen, wie es wohl war, als die ersten
Württemberger das Heilige Land betraten. Kontrolliert wurde
Palästina damals von den Türken. Es war ein Teil des osmanischen
Reichs. Die Türken eroberten das Land bereits 1517.
Die Templersiedlung Haifa
31
Sie besiegten die Mameluken ein Jahr zuvor. Sie beherrschten
Palästina mit kurzen Unterbrechungen 400 Jahre lang.
Die Verwaltung des Landes war, wenn überhaupt vorhanden,
ineffektiv und ungenügend. Eine Infrastruktur gab es
nicht. Keine Straßen, keine nennenswerte Landwirtschaft. Es
waren arme Menschen, vielleicht 350 000 an der Zahl, davon
vielleicht 30 000 Christen, die vorwiegend der griechisch orthodoxen
Kirche angehörten, vielleicht etwas über 12 000
Juden und alle anderen waren muslimische Araber.
Diese lebten meistens, wenn sie keine Nomaden waren, in
armseligen Lehmziegelhütten in kleinen Ansiedlungen an
Orten, wo es Wasser gab. Die Landschaft war in einem desolaten
Zustand. Die Ziegen hatten das Land kahl gefressen.
Nur Dornenbüsche, einige wenige Palmen und verstreute
Olivenbäume waren übrig geblieben. Bewaldete Gebiete
suchte man vergebens.
Wie konnten die Einwanderer in diesem abgewirtschafteten
Land eine Existenz aufbauen?
Sie schöpften ihre Kraft und ihre Zuversicht aus ihrem festen
Glauben. Sie waren fleißig und verfügten über Erfindungsgabe.
Sie missionierten nicht, dies war gegen ihre religiöse
Überzeugung, sondern suchten menschliche Beziehungen
zu den Einheimischen und übervorteilten sie nicht, wenn
sie mit ihnen Handel trieben. Es gelang ihnen, nördlich der
kleinen Stadt Haifa, damals mit wenigen Tausend Einwohnern,
ihre erste Siedlung zu gründen.
Aus Wikipedia 2009: „1869, im Jahr der Eröffnung des Suezkanals,
gründeten die Templer – christliche Siedler aus
Süddeutschland – ein Dorf, damals ein Stück außerhalb der
Stadt Haifa, unterhalb des heutigen Schreins des Bab. Sie lösten
Modernisierungsimpulse durch modernes Handwerk,
Landwirtschaft, Industrie, Gesundheits- und Transportwe-
32
sen aus, und veranlassten den Bau der ersten Mole, damit
Schiffe anlegen konnten. [Haifa besitzt keinen natürlichen
Hafen.]
Durch den gleichzeitigen Ausbau der Landstraßen nach
Akko, nach Nazareth und auf den Karmel und die Eröffnung
des ersten Hotels wurde die wirtschaftliche Entwicklung von
Haifa maßgeblich geprägt. Haifa wurde zu einem wichtigen
Knotenpunkt für Pilgerreisende. Die politische Bedeutung
von Haifa wurde dadurch gesteigert, dass einige Templer
verschiedene europäische Regierungen konsularisch vertraten,
sozusagen den Posten eines Vizekonsuls inne hatten.“
Die Templer gründeten dann im Jahr 1871 die erste landwirtschaftliche
Siedlung Sarona nördlich von Tel Aviv. Doch
dieses Unternehmen kostete vielen dieser Siedler das Leben.
Allein im Jahr 1872 starben 28 der 125, die an diesem Projekt
beteiligt waren. Bis 1874 sollte die Zahl auf 57 ansteigen. Der
Grund war die Malaria, deren Erreger noch nicht erkannt
war. Man wusste nicht, dass die Krankheit durch Moskitos
übertragen wurde. Ebenso wenig war Chinin als Gegenmittel
bekannt. Man glaubte, dass die Krankheit durch schlechte
Luft – mala aria = ital. schlechte Luft – übertragen wurde.
Die Templer hatten gelesen, dass in Gegenden, wo Eukalyptusbäume
standen, die Krankheit weniger stark auftrat. Sie
pflanzten deshalb Eukalyptusbäume. Es sollen um die tausend
gewesen sein. Das Sumpfgebiet um Sarona herum trocknete
aus. Die Malaria ging zurück. Brunnen wurden gebohrt.
In etwa 20 Meter Tiefe fanden sie sauberes Grundwasser,
die Grundlage für die landwirtschaftliche Nutzung des Gebiets
um Sarona herum und auch die Grundlage für die Orangenpflanzungen,
die rings um Sarona entstehen und deren
Früchte als Jaffa Orangen weltweit bekannt werden sollten
(empfohlen wird das Buch hierzu: From Desert Sands to Gol-
33
den Oranges, von Helmut Glenk, Horst Blaich und Manfred
Häring, 2005).
Die Erfolge der Templer in ihren Siedlungen blieben nicht
unbemerkt. Ihre Tätigkeiten in den vielen über das Land
verstreuten Siedlungen wirkten wie eine Initialzündung für
die Wirtschaft des Landes. Araber strömten ins Land. Die
im Ausland lebenden Juden, die in manchen europäischen
Staaten, vor allen Dingen aber in Russland, Repressalien
ausgesetzt waren, blickten nach Palästina. Das war das Land
ihrer Väter. Im religiösen und historischen Bewusstsein der
Juden war Palästina immer das „Heilige Land“ geblieben,
das mit der Bibel und der Geschichte des jüdischen Volkes
verbunden ist.
Der französische Baron Edmond Rothschild begann 1882
Grundstücke in Palästina zu erwerben, förderte die Gründung
von Zichron Jaakow und Rischon leTzion und wurde somit
ein aktiver Unterstützer des Zionismus. 1889 übergab er
25 000 Hektar palästinensischen Agrarlandes samt den sich
darauf befindenden Ansiedlungen an die Jewish Colonization
Association. Weiterhin ermöglichte er russischen Juden in den
1880er-Jahren, sich wegen dort stattfindender Pogrome in
Palästina anzusiedeln. Kein Zweifel besteht, dass die Templersiedlungen
sein Engagement beflügelt, wenn nicht sogar
ausgelöst hatten. Mein Vater hatte mir erzählt, dass damals
das Gerücht umgegangen sei, der Baron habe sogar versucht,
den Templern die Siedlung Haifa abzukaufen, was natürlich
bei der religiösen Einstellung der Templer außer jeder
Möglichkeit stand.
Die Templer waren so gesehen vielleicht ein wesentlicher
Anstoß gewesen, dass jüdische Siedlungen im größeren
Umfang nach 1880 in Palästina gegründet wurden. Damit
setzte auch die erste größere Einwanderungswelle von Ju-
34
den nach Palästina ein, die schließlich zur Gründung des Staates
Israel führte. Die Bevölkerung in dem heutigen geteilten
Palästina dürfte vielleicht zwölf Millionen Menschen betragen
(acht Millionen Israelis und vier Millionen Araber). Sie
betrug 350 000, als meine Vorfahren eingewandert waren.
Wie sollte dieses arme Land – kleiner als die Schweiz – so
vielen Menschen eine Existenz bieten und sie auf Dauer ernähren?
35
Die Familie Dyck in der Ukraine
Die Morgendämmerung kommt nicht zweimal, um einen Mann
zu wecken.
Johannes Dyck wurde als Jüngster von weiteren fünf Geschwistern
am 20. Februar 1858 in der Mennoniten-Siedlung
Rudnerweide, Molotschna, damals Südrussland, heute südliche
Ukraine, geboren. Seine Eltern Dietrich und Cornelia
Dyck waren beide aus Ostpreußen, damals Deutschland, aus
Heuboden und Rosenhof / Marienwerder, im Jahre 1819 nach
Rudnerweide mit ihren Eltern übergesiedelt. Der Vater war
zehn Jahre und die Mutter ein Jahr alt. Sie heirateten 1836 in
Pordenau, Molotschna. Die Vorfahren waren als Mennoniten
aus Holland gekommen. Sie glaubten, dass sie von der
Familie des van Dyck, des berühmten holländischen Malers,
abstammten.
Johannes Dycks Vater besaß und bewirtschaftete in Rudnerweide
einen Bauernhof mit etwa 200 Morgen Land und
ernährte damit die achtköpfige Familie. Aus gesundheitlichen
Gründen konnte er bald nicht mehr den Hof umtreiben.
Der älteste Sohn Abraham war zu jung, um die Arbeit
zu übernehmen. Da kam für seinen Vater der Ruf der Jerusalemfreunde,
die sich später Templer nannten (sie haben – wie
oben bereits erwähnt – absolut nichts mit dem Templerorden
aus der Zeit der Kreuzzüge zu tun, der schon 1312 aufgelöst
worden war), als Hausvater an die höhere Schule mit
angegliedertem Pensionat nach Gnadenfeld gerade recht, das
nur 20 km von Rudnerweide entfernt lag. Das war im Jahr
1862. Aber schon ein Jahr später starb der Vater, als der kleine
Johannes gerade fünf Jahre alt war.
Die Eltern von Johannes waren Mennoniten, eine protestantische
Sekte, die ihren Ursprung in der Schweiz mit den
36
Schweizer Brüdern im 16. Jahrhundert hatte und später von
dem Holländer Menno Simon, einem Priester, ihren Namen
bekamen.
Herausragende Merkmale dieser Mennoniten waren die
Ablehnung der Taufe, was ungeheuerlich für die damalige
Zeit war, die Kriegsdienstverweigerung und die Ablehnung
des Schwurs. Ihre Auffassung war: Ein Mennonit sagt immer
die Wahrheit, deshalb braucht er auch nicht zu schwören.
Die Mennoniten fanden zuerst politischen Freiraum in
Holland. Andere aber fanden ihre Heimat in Westpreußen,
dem heutigen Nordpolen am Vistula Fluss, früher Weichsel
genannt, und dessen Flussdeltas. Die weitere Verfolgung im
18. Jahrhundert in der Schweiz ließ die Mennoniten auch nach
Süddeutschland kommen. Viele aber wanderten in die USA
aus. Vom Vistula Delta zog ein Großteil der Mennoniten in
die Ukraine.
Das Ziel ihrer Religion fassten sie in den folgenden Thesen
zusammen, die für sich sprechen:
„Unsere größte Aufgabe besteht darin, den Hungrigen Nahrung
zu geben und die Durstigen zu stillen. Wir haben uns die Aufgabe
gestellt, das Leben aller Menschen zu erhalten und zu schützen.
Wir werden niemals in irgendeiner Weise dazu beitragen, menschliches
Leben zu zerstören oder zu verletzen.“
Die Sprache der Mehrzahl der Mennoniten in vielen Ländern
der Erde, wo sie siedelten, war das Plautdietsch, eine
besondere Art Plattdeutsch, das heute so gut wie ausgestorben
ist. Neben ihrer Religion war diese Mundart ihr wichtigstes
Zugehörigkeitsmerkmal.
Johannes sprach also Plautdietsch in seiner Jugend.
Die Familie kam mit der Anstellung des Vaters zum ersten
Mal mit den Templern in Berührung, die von Württemberg
nach Russland – viel früher als die Einwanderung nach
37
Palästina erfolgte – eingewandert waren, und schloss sich
der neuen Religionsbewegung an, die viel Gemeinsames mit
dem Glauben der Mennoniten hatte.
38
Johannes am Kaukasus und auf der Krim
Die Armut ist eine Erziehung und der Reichtum eine Versuchung.
So entstand auch in Gnadenfeld (Molotschna) eine Templergemeinde,
wo der Vater von Johannes wie berichtet eine
Anstellung fand.
Die Mennoniten in Gnadenfeld wollten aber die Templer
nicht als selbstständige Gemeinde in ihrer Mitte dulden. Die
Schule der Templer wurde durch die Regierung geschlossen
und die Lehrer zunächst eingesperrt, weil sie keine Berechtigung
besaßen, eine Privatschule neben einer bestehenden
mennonitischen Schule zu betreiben.
So sahen sich die Templer gezwungen, wenn sie nach ihrer
eigenen Überzeugung leben wollten, die mennonitischen
Siedlungen zu verlassen und an den Kameelsberg am Fluss
Kuma im Nordkaukasus überzusiedeln, zwischen dem
Schwarzen und dem Kaspischen Meer gelegen. Welch eine
Entfernung von Gnadenfeld! Eintausend Kilometer?
Sie konnten fruchtbares Land, 20 km lang und etwa 4 km
breit, von Fürst Orbeljani mit einer Laufzeit von 30 Jahren
pachten. Frisches Wasser stand in ausreichender Menge vom
Kameelsberg kommend zur Verfügung. Der Fluss Kuma
hatte genügend Gefälle, um Getreidemühlen anzutreiben. Die
Voraussetzungen für die Neugründung einer Siedlung waren
gut.
Die Templer zogen dann im Jahre 1866 auf schlechten, holprigen
Wegen mit Pferde- und Ochsenwagen in die Ebene vor
dem Kaukasus Gebirge, wo sie die Siedlungen Tempelhof und
Orbeljanowka gründeten, die sich gegenüberliegend links und
rechts des Kuma-Flusses entlang erstreckten. Später wurde
die ganze Siedlung mit Tempelhof bezeichnet.
39
Barbara Hagenlocher, geb. am 22. Mai 1880, schreibt in ihren
Aufzeichnungen Mein Leben (1951), im Folgenden
auszugsweise wiedergegeben:
„Meine Großeltern Rohrer wanderten 1866 mit ihren beiden
Kindern von Neuffen (eine kleine Stadt in Württemberg
nicht weit von Esslingen) nach Russland in den Kaukasus
mit Pferdewagen aus, um dort mit anderen deutschen Auswanderern
die Siedlung Orbeljanowka aufzubauen. – Das
Leben war hart. Meine Mutter fand schließlich eine Anstellung
als Haushilfe in einer deutschen Mennonitenfamilie. Die
Kinder sprachen ihre Eltern damals noch mit Ihr an und
mussten rückwärtsgehend den Raum verlassen. Der Bruder
meiner Mutter Christian Rohrer, ein Nachzögling, wurde –
erst zehn Jahre alt – von meinen Großeltern in die neue höhere
Templerschule nach Jaffa/Palästina geschickt, die vom
Gründer der Tempelgesellschaft Christoph Hoffmann geleitet
wurde, und wo er auch selbst unterrichtete.“
Aus diesen Aufzeichnungen erkennen wir, dass eine Verbindung
unter den Templern in Russland und in Palästina
dauernd bestanden und auch ein Erfahrungsaustausch stattgefunden
hat. Viele der Templer in Russland sind in den folgenden
Jahren in die Siedlungen der Templer nach Palästina
gezogen, besonders aber in die Haifa-Siedlung.
Johannes war zehn Jahre alt, als die Familie schließlich das
Siedlungsgebiet erreichte. Zunächst wurde ein einfaches
Haus gebaut. Im Sommer gab es auf dem Feld und beim
Hüten der Schafe genügend Arbeit. Für die Schule war kaum
Zeit. Wenn Unterricht stattfand, geschah dies durch ein Mitglied
der Sekte in einem Zimmer in einem Wohnhaus, das
durchaus nachts auch als Schlafzimmer dienen konnte.
Dann wurde eine Schule in Tempelhof eingerichtet, die
Johannes bis zum Frühjahr 1874 besuchen konnte. In diesem
40
41
Jahr wurde er getauft, als er 16 Jahre alt war, was man bei
den Templern mit Darstellung oder mit einem Gelöbnis bezeichnet,
nach Gottes Wort zu leben, weil es die Taufe bei
den Templern im herkömmlichen Sinne nicht gibt.
Eine seiner Schwestern hatte in der Zwischenzeit einen
gewissen Benjamin Lange geheiratet und war mit ihm zusammen
nach Schönbrunn in die Krim gezogen.
Johannes hatte eines Tages die Gelegenheit, seine Mutter
in die Krim zu begleiten, um die Schwester zu besuchen.
Johannes hatte nämlich ein Angebot erhalten, den Beruf des
Schreiners oder Maurers bei den Gebr. Imberger in Haifa,
Palästina, zu erlernen. Von Schönbrunn hätte er die Reise
nach Palästina über das Schwarze Meer und Konstantinopel
nach Haifa antreten sollen. Doch diese Pläne realisierten sich
nicht. Johannes hatte keinen gültigen Pass. Er blieb in Schönbrunn
hängen. In Schönbrunn konnte Johannes aber eine
Schreinerlehre bei dem Deutschen Dettner beginnen. Eines
Tages packte jedoch Dettner seine Sachen und verließ Schönbrunn
mit dem Ziel Palästina, das für viele Templer Verheißung
in ihrem Glauben bedeutete, und ließ Johannes zurück,
ohne dass dieser seine begonnene Lehre beenden konnte.
Johannes Schwager Benjamin Lange war Lehrer. Da Johannes
ein kluger Junge war, wissbegierig und strebsam, wurde
er von Lange als Unterlehrer angestellt, mit der Maßgabe,
auch dessen Kühe zu versorgen.
Schon ein Jahr später, 1875, wurde Benjamin Lange als
Lehrer nach Haifa an die deutsche Schule berufen. Johannes
durfte ihn begleiten. In Jaffa konnte er dann das Institut besuchen,
eine von den Templern gegründete und verwaltete
höhere deutsche Schule. Zwei Jahre lang. Das erforderliche
Geld dazu hatte er aus einem Erbe von seinem Großvater
Wiebe, der seinerzeit in Rudnerweide verstorben war.
42
Nach Beendigung der Schule hieß es für Johannes, mit den
gewonnenen Kenntnissen seinen Lebensunterhalt selbst zu
bestreiten. Er dachte, dass ihm dies in Russland leichter fallen
würde als in Palästina.
Doch die Reise nach Russland gestaltete sich viel komplizierter
als zunächst angenommen, denn der russisch-türkische
Krieg tobte und die Reise über Konstantinopel war nicht
möglich. Er musste einen langen Umweg in Kauf nehmen.
Die Stationen waren: Port Said, Alexandria, Neapel, Rom,
Ancona, Triest, Wien, Krakau, Lemberg, Padwolatschisk und
schließlich Russland.
Johannes kam endlich in Schönbrunn an mit einem zerrissenen
Koffer, abgetragenen Kleidern und mittellos. Er hatte
Glück. Die Gemeinde Schönbrunn stellte ihn für den Deutschunterricht
als zweiten Lehrer an.
In seiner Freizeit büffelte Johannes Russisch, wobei ihm
ein russischer Student Unterricht erteilte. Im selben Jahr bestand
er sein Lehrerexamen in Russisch am Gymnasium in
Simferopol. Sein Bruder Dietrich hatte in der Zwischenzeit
das Abitur bestanden und besuchte die Universität in Charkow.
Er schrieb ihm, ob er sich ihm nicht anschließen wolle.
Mit seiner Hilfe könnte er auch das Abitur in zwei Jahren
schaffen und dann an der Universität studieren. Johannes
war es klar, dass er das Geld dazu nicht hatte. Vielleicht konnte
er es aber beschaffen, wenn er Nachhilfestunden geben
würde? Vielleicht würde ihn auch sein Bruder unterstützen?
Johannes wagte es. Er fuhr nach Charkow. Er büffelte russische
Grammatik, Literatur, Arithmetik, Geschichte, Geografie,
Latein und Griechisch von morgens früh bis abends
spät. Doch es half alles nichts. Das nebenbei verdiente Geld
reichte nicht. Er musste nach anderthalb Jahren das Studium
aufgeben und eine Stelle als Buchhalter annehmen.
43
Johannes heiratet eine Edelmannstochter.
Die Liebe währt sieben Sekunden, die Fantasie sieben Minuten
und das Unglücklichsein das ganze Leben.
Während seiner Vorbereitung auf das Abitur hatte er bei
seiner Zimmervermieterin eine junge Dame kennengelernt.
Johannes war gut aussehend, mittelgroß, blond und hatte
helle wasserblaue Augen. Die junge Dame mit Namen Maria
Wassiljewna Kirejewskaya war eine russische Edelmannstochter.
Sie hatte in jungen Jahren ihr Elternhaus verlassen,
um als eine der ersten Rotkreuz-Krankenschwestern im russisch-türkischen
Krieg an der Front zu arbeiten. Das wurde
ihr als Adlige von ihrem Vater nie verziehen, und sie wurde
aus der Familie ausgestoßen.
Trotz der für die damalige Zeit fast unüberwindlichen
Schwierigkeiten – sie Adelige und der orthodoxen Kirche
angehörend und er Bürgerlicher und Templer – sie und er
mittellos, beschlossen beide, im Jahr 1881 zu heiraten.
Bis 1884 arbeitete Johannes als Buchhalter bei der Firma
Hamm & Charkov in Halbstadt. Danach war er wieder Lehrer
in Arnanir, Tempelhof und Wohldemfürst, alles Templersiedlungen
im nördlichen Kaukasus.
Johannes und Maria fühlten eine tiefe Zuneigung
zueinander. Es war eben die wirkliche Liebe, von der man in
Romanen liest. Der Ehe entsprossen vier Kinder:
Wolja(russisch: Wille) ein Junge und die drei Mädchen Werra
(russisch: Glaube), Ljuba (russisch: Liebe) und Maria, später
nur Mascha genannt. Bei der Geburt von Mascha, als die
Familie bereits nach Wohldemfürst im nördlichen Kaukasus
gezogen war, starb die Mutter 1888. Sie war durch Schwindsucht
geschwächt, die sie sich im russisch-türkischen Krieg
zugezogen hatte. Ljuba war bereits in Charkow gestorben,
44
als sie gerade ein halbes Jahr alt war, Werra starb im Jahre
1890, also zwei Jahre nach dem Tod der Mutter.
Johannes wurde von diesen Schicksalsschlägen hart getroffen.
Er konnte seiner bisherigen Tätigkeit nicht mehr nachgehen.
So versorgte er Tiere für einige Zeit bei bekannten Familien
und hütete Schafe, um sein Leid zu vergessen. Das verdiente
Geld reichte natürlich nicht aus, seine Familie zu ernähren,
und auch nicht für die Bezahlung der Amme für die
kleine Mascha und für die bevorstehende Ausbildung von
Wolja.
45
Johannes zieht in die Templersiedlung Haifa.
Lieber tausend Freunde, auch wenn sie anstrengend sind, als
einen Feind.
Sein ältester Bruder Abraham war schon vor einigen Jahren
nach Palästina in die aufblühende Templersiedlung Haifa
gezogen und hatte sich dort eine Existenz aufgebaut. Johannes
bekam einen Brief, er solle doch mit seiner Familie herkommen.
Die Einladung kam zur rechten Zeit. Die klein gewordene
Familie packte ihre Habseligkeiten zusammen und trat die
beschwerliche Reise im Jahr 1889 nach Palästina an.
Angekommen kaufte sich Johannes etwas Land bei Haifa
und fing mit einem Fuhrunternehmen an. Er hatte zwei in
Amerika gebaute Pferdewagen erworben, die ganz überdacht
waren und drei Sitzbänke hintereinander besaßen. Schutzklappen
konnten seitlich gegen Wind, Staub und Regen heruntergelassen
werden. Die Fahrten führten von Haifa nach
Jaffa und Jerusalem. Tel-Aviv existierte damals noch nicht.
Von der Eisenbahn bestand keine Konkurrenz, denn sie wurde
erst Jahre später nämlich 1898 zwischen Jaffa und Jerusalem
in Betrieb genommen. Johannes hatte trotzdem ein unregelmäßiges
und nicht ausreichendes Einkommen.
Er hatte in Haifa eine junge Dame kennengelernt, die mit
ihrer Familie in der Templersiedlung wohnte. Marie Kraiß.
Sie war mit ihren aus Württemberg stammenden Eltern, ebenfalls
Templer, von Tioga, Pennsylvania, USA, wo sie auch
geboren war, nach Palästina eingewandert. Er brauchte eine
Mutter für die Kinder und heiratete Marie. Die kleine Mascha
wurde von seinem Bruder Abraham und dessen Frau,
die selbst keine Kinder besaßen, adoptiert.
46
Johannes mit seiner zweiten Frau Marie Kraiß
47
Bald wurden Johannes und Marie zwei Mädchen geschenkt.
Minna und Else.
Überraschend erhielt Johannes von der Zentralkasse der
Templer das Angebot, die kaufmännische Leitung der Weinkellerei
der Templersiedlung Sarona bei Jaffa zu übernehmen.
Er zögerte nicht lange, gab sein Haus in der Templersiedlung
im Stadtgebiet von Haifa auf und siedelte mit seiner
Familie nach Jaffa über.
In dem sumpfigen Gebiet um Sarona war die Malaria weit
verbreitet und viele der württembergischen Einwanderer fielen
dem Fieber zum Opfer. Manche behaupten, dass jeder
Dritte daran starb. Auch Marie mit ihren Kindern wurde von
heftigem Fieber erfasst und auch das angestellte Kindermädchen
aus Deutschland. Johannes beschloss, alle zur Erholung
und Genesung zu den Eltern seiner Frau nach Haifa zu schikken.
Bald konnten alle die Krise überstehen, und so beschloss
er, nach Haifa zu fahren, um sie abzuholen. Das war im
Herbst 1892.
Die Reise zurück nach Jaffa sollte sich dramatisch gestalten.
Johannes buchte eine Schiffsreise von Haifa nach Jaffa,
weil er seiner noch geschwächten Familie die anstrengende
Fahrt auf dem Landweg ersparen wollte. Sie gingen an Bord
des Postschiffs Selene, das dann die Anker zur Fahrt nach
Jaffa und weiterem Ziel Alexandrien lichtete.
Nach dem Schirokko der vergangenen Tage war die See
ruhig. Dann aber kam ein Gewitter auf mit heftigem Wetterleuchten
und Blitzen. Das Schiff begann zu schlingern und
zu stampfen. Der Wind sprang von Südost nach Westen über.
Endlich kamen sie in der Bucht vor Jaffa an. Da Jaffa über
keinen Hafen für große Schiffe verfügte, musste das Schiff in
der stürmischen See vor Anker gehen.
48
Johannes verliert seine Familie.
Zwei Dinge werden erst geschätzt, wenn man sie nicht mehr
hat, die Gesundheit und die Jugend.
Es war mittags 12:00 Uhr. Ein Boot wurde, an der schwankenden
Schiffswand scheuernd, heruntergelassen. Die Besatzung
folgte und dann die Reisenden, die ausschiffen wollten.
Johannes war mit seiner Familie noch nicht an der Reihe.
Die Ruderer legten sich ins Zeug und steuerten das Boot
so gut es ging durch die hohen Wellen. Als sie die Brandung
erreichten, schlugen einige Wellen über das Boot herein. Aber
es landete trotzdem glücklich an Land. Es kehrte wieder zum
Postschiff zurück.
Marie hatte Angst. Fragend schaute sie Johannes an.
„Sollen wir dieses Boot nehmen? Wir mit den kleinen Mädchen?
Was geschieht, wenn es in der Brandung kentert?“
Johannes wusste, dass sie nach Alexandrien weiterfahren
mussten, wenn sie das Boot jetzt nicht besteigen würden.
Dort würden sie für einige Wochen in Quarantäne gestellt
und könnten frühestens zurück, wenn wieder ein Schiff nach
Jaffa in See stechen würde.
Eine Entscheidung, die gut überlegt sein musste. Als dann
die Bootsführer die Familie aufforderten einzusteigen, willigte
Johannes schließlich ein. Als mitreisende Einheimische
sahen, dass der Europäer das Boot bestieg, entschieden sie
sich in letzter Minute, dasselbe zu tun. Das Boot war, obwohl
Johannes lautstark protestierte, hoffnungslos überladen.
Es stieß ab und in der Brandung geschah das unvermeidliche
Unglück.
Marie hatte das kleine einjährige Mädchen Else fest an die
Brust gedrückt. Johannes hatte die kleine zweijährige Minna
49
im Arm. Das 18-jährige Kindermädchen hielt den neunjährigen
Wolja fest umschlungen.
Doch die Wellen waren stärker. Sie brachen über das Boot
herein. Es kenterte. Alle wurden von Bord gespült. Johannes
fand sich tief unter Wasser wieder und versuchte, die Oberfläche
zu erreichen.
Wo ist meine kleine Minna, durchzuckte es ihn, ich hatte
sie doch fest im Arm gehabt!
Jetzt war er über Wasser. Er holte tief Luft und tauchte
sofort wieder in die kochende See, um seine Tochter zu suchen.
Wieder und wieder tauchte er hinab in das aufgewühlte
trübe Wasser. Vergebens. Er konnte unter Wasser nichts erkennen.
Völlig außer Atem und erschöpft sah er das Boot
kieloben nicht weit vor sich treiben. Da war niemand. Wo
sind sie alle, dröhnte es durch seinen Kopf, wo sind sie, Marie,
Minna, Else und Wolja? Das Kindermädchen? Oh mein
Gott, oh mein Gott im Himmel!
Als guter Schwimmer, für die damalige Zeit ungewöhnlich,
hatte er das Boot bald erreicht. Er hielt angestrengt Ausschau
nach allen Seiten, nachdem er das Boot bestiegen hatte.
Er rief sich die Lunge wund. Marie, Minna, Else, Wolja.
Wo seid ihr alle? Antwortet doch!
War da nicht ein Hilferuf? War das nicht die Stimme seines
Sohnes? Er glaubte, die Stimme durch das Tosen der
Wellen deutlich zu hören. Ja, dort klammerte sich Wolja verzweifelt
an eine der losgerissenen Planken.
„Papa, Papa, hilf mir“, rief er. Johannes war schon bei ihm
und zog ihn aufs Boot. Dann begann er, vom Boot aus erneut
zu tauchen, um seine geliebte Frau, seine Kinder und das
Dienstmädchen zu suchen.
In der stürmischen See und in der Brandung war das ein
hoffnungsloses Unterfangen. Erschöpft, kaum mehr fähig zu
50
atmen, brach er zusammen und begann bitterlich zu weinen.
Die Wellen spülten das Boot schließlich an Land. Johannes
und Wolja lagen wie tot, körperlich am Ende, am Strand und
wurden neugierig von den herbeigeeilten Einheimischen betrachtet.
Else und Minna wurden am nächsten Tag tot vom Strand
geborgen, wo sie in der Nacht angeschwemmt worden waren.
Das Dienstmädchen fand man zwei Tage später. Marie
aber wurde von der See nicht wieder hergegeben.
Von Johannes Familie war Wolja übrig geblieben. Wenigstens
sein Sohn war ihm geblieben, und er dankte Gott dafür.
Aber es war anders bestimmt.
Drei Wochen später erkrankte Wolja an Diphtherie. Sein
Körper war von dem Unglück noch geschwächt. Er überstand
die Krankheit nicht und starb nach wenigen Tagen.
Johannes war diesmal unfähig zu weinen. Er war fast schon
apathisch, unfähig noch Gefühle zu haben. Er war zerstört.
In einem Brief an einen Freund aber schrieb er: „Ich beklage
mich nicht, denn ich weiß, sie sind in denselben Vaterhänden,
die ihnen auch das irdische Leben geschenkt haben.“
Johannes war jetzt mit 34 Jahren ganz allein.
51
Johannes in Jerusalem
Die schönste Blume des Sieges ist das Verzeihen.
Die Templer hatten in Jerusalem eine Bank für ihre Mitglieder
gegründet. Sie nannten sie Zentralkasse. Johannes
bekam das Angebot, die Leitung der Kasse zu übernehmen,
was er dann auch tat.
Er lernte in Jerusalem Fräulein Sofie Magdalene Bubeck kennen.
Sie stammte aus Rotenberg bei Stuttgart und war bislang
als Sekretärin in Ägypten für den berühmten Arzt und Forscher
Robert Koch tätig, der dort seine Untersuchungen über
Tuberkulose betrieb.
52
Etwa 1893: Sofie Magdalene Bubeck,
meine Großmutter
Familie Dyck 1906 - von links nach rechts:
Paula (meine Mutter sitzend), Ida, Großvater Johannes,Abram,
Dietrich, Großmutter Sofie, Cornelia (sitzend) und Hans
Johannes fand Gefallen an Fräulein Bubeck und machte
ihr einen Heiratsantrag. Die Ehe wurde 1893 geschlossen.
Sie zogen in der Alten Mühle ein, ein Haus, das der Templergemeinde
gehörte und das ihm für wenig Geld vermietet
worden war.
Es begann eine glückliche Zeit für das Ehepaar. Er verdiente
so viel, dass er seiner Frau ein schönes Zuhause und
einen angemessenen Lebensstandard bieten konnte.
Sofie gebar in den folgenden zehn Jahren sechs gesunde
53
Kinder: Hans, Cornelia, Ida, Paula, Abram und Dietrich. Sie
wurden alle in Jerusalem zur Welt gebracht.
Paula, meine Mutter, erblickte zur Jahrhundertwende am
28. Dezember 1899 das Licht der Welt.
Johannes war ein strenger, aber auch gerechter Vater. Die
Kinder sollten etwas lernen und dabei lebenstüchtig werden.
Als die Buben eines Tages einigen Fliegen die Flügel ausrissen
und ohne Flügel laufen ließen, holte er die Peitsche. Die
Jungs hatten nichts zu lachen und machten sich diesen Spaß
nie mehr.
Da es der Familie gut ging, entschloss er sich, vier arabische
Waisen in sein Haus aufzunehmen. Sie konnten ihren
islamischen Glauben beibehalten. Vonseiten der Familie
wurden auch keine Anstalten unternommen, die jungen Araber
zum christlichen Glauben zu bekehren. Drei von den
Familie Dyck ca. 1908 - von links nach rechts:
Cornelia, Dietrich, Großvater Johannes, Hans, Abram,
Ida, Großmutter Sofie und Paula (meine Mutter)
54
aufgenommenen Waisen schafften es, zu studieren, als sie
älter waren. Einer wurde Arzt und ein anderer Zahnarzt.
Seine wirtschaftlichen Verhältnisse erlaubten es Johannes,
im Jahre 1912 seine alte Heimat Russland noch einmal zu
besuchen. Die Reise dauerte fast ein halbes Jahr.
Doch das Schicksal schlug wieder zu. Seine Frau Sofie war
gerade 42 Jahre alt, als sie erkrankte. Sie starb 1913 an einer
heimtückischen Grippe. Cornelia, die älteste Tochter, gerade
14 Jahre alt und Kea gerufen, musste die Stelle der Mutter
einnehmen.
Eine Zeit lang ging es gut. Aber der große Haushalt mit elf
Personen brauchte eine feste Hand.
Johannes entschloss sich, schon wegen der Kinder nochmals
eine Ehe einzugehen. Er heiratete 1916 Katharina Hess. Sie
war verwitwet und durch ihre vorherige Heirat entfernt mit
der Familie des Rudolf Hess verwandt, der in Kairo geboren
war und der später Hitlers Stellvertreter wurde. Katharina
war eine von Güte geprägte Frau, selbst kinderlos, die seine
Kinder wie ihre eigenen behandelte.
Der Erste Weltkrieg war auch über Palästina hereingebrochen,
das bis dahin unter türkischer Herrschaft gestanden
hatte. Die Türken wurden von den von Ägypten anrückenden
Engländern unter Führung von General Allenby angegriffen
und aus Palästina vertrieben. Seine Truppen rückten
1917 in Jerusalem ein.
Am Ende des Kriegs wurden alle Deutschen aus den im
Süden Palästinas liegenden Templersiedlungen von den Engländern
interniert und in ein Wellblechlager nach Helouan
gebracht, einem kleinen Städtchen bei Kairo in Ägypten. Die
Internierung dauerte drei Jahre.
In Deutschland wurde schon wieder Charleston getanzt,
als die Templer in unmöglichen Unterkünften im wahrsten
55
Johannes Dyck im Alter
Sinne des Wortes schmoren mussten, denn Helouan lag in
der Wüste, und die Lufttemperatur in den die Hitze durchlassenden
Wellblechbaracken stieg bis auf +48 °C an. Johannes,
in Russland aufgewachsen und solche Temperaturen
nicht gewohnt, brach immer wieder zusammen und litt dann
in der Enge der Gefangenschaft an Verfolgungswahn.
Die Engländer entließen die Deutschen Ende 1920. Sie kehrten
nach Palästina zurück und erhielten ihr Eigentum zurück.
Die Häuser jedoch waren geplündert, die Ländereien
verwahrlost. Sie mussten gepflügt und eingesät und die drei
Jahre lang stillgelegten Geschäfte neu aufgebaut werden.
Meine Mutter Paula hatte zuvor Palästina nach Deutschland
verlassen können und war so der Internierung entgangen.
Sie arbeitete zuerst als Au-pair-Mädchen in Berlin und
machte anschließend eine Ausbildung zur Kindergärtnerin
56
und Lehrerin für die ersten Volksschulklassen am Fröbelinstitut
in Stuttgart.
Sie kam mit ihrem Examen in der Tasche nach Jerusalem
zurück, wo sie wieder in ihrem Elternhaus unterkam. Sie lernte,
als sie eine Weile den Haushalt ihres Vaters führte, einige
russische Gerichte zuzubereiten. Mein Großvater liebte die
russische Küche, aber auch die arabische und natürlich die
schwäbische. Welch eine Mischung!
Danach war sie als Buchhalterin bei verschiedenen Firmen
in Jerusalem tätig und kam schließlich als Kindergärtnerin
in ihrem Beruf unter, bis sie 1929 heiratete.
Aus Ägypten zurückgekommen, sanierte Johannes zuerst
die Zentralkasse, der eine entscheidende Rolle beim schwierigen
Wiederaufbau der Siedlungen zufiel.
Sein ältester Sohn Hans bereitete ihm Sorgen. Als er jung
war, wollte er schon nicht richtig lernen und schwänzte
immer wieder die Schule. Gleich nach der Rückkehr von
Ägypten nach Palästina machte er sich auf den Weg nach
Beirut, wo er im Rotlichtmilieu verkehrte und seinen Lebensunterhalt
suchte.
Das konnte Johannes mit seinem tiefen Glauben nicht gutheißen.
Immer wieder kamen Briefe an, in denen ihn sein
Sohn um Geld bat. Er tat zunächst sein Möglichstes. Als aber
die Briefe und Bitten kein Ende nahmen, schloss er seinen
ältesten Sohn aus seinem Herzen aus und wollte den Namen
seines Sohnes nicht mehr hören.
Johannes wurde nicht müde, an sich zu arbeiten. Er lernte
die Stenografie. Er kaufte sich eines der ersten Radios in Jerusalem
und eine der ersten Schreibmaschinen. Er lernte
Arabisch und Englisch und nahm aktiv am Gemeindeleben
teil.
Als seine anderen Kinder erwachsen waren, einen Beruf
57
erlernt hatten und einige schon verheiratet waren, starb er
73 Jahre alt an einem Prostataleiden. Damit war ein reiches,
aber auch dramatisches Leben zu Ende gegangen.
Nie hatte er in seinem Leben die Hoffnung aufgegeben,
auch wenn es ihm schlecht ging. Immer hatte er an Gott und
an das Gute im Menschen geglaubt und keine Anstrengung
war ihm zu groß, wenn es um seine Familie ging oder wenn
er etwas Neues lernen konnte.
Er wurde von vielen Menschen, die ihn kannten, verehrt
und von allen seinen Kindern tief geliebt.
Nach seinem Tod wurde er in der Warte der Templer mit
folgenden Worten gewürdigt:
Weit mehr als der Tempelvorsteher und die anderen Mitglieder
der Zentralleitung sorgte und bemühte Johannes Dyck
sich um das Gedeihen der Gesellschaft und auf die Regelung
ihrer Probleme. Viel mehr als der Tempelvorsteher war
er der rector spiritus, das für die ganze Gesellschaft schlagende
Herz und der für alle denkende Kopf.
Er wurde z. B. nicht müde, junge Leute zum Beitritt in die
Zentralkasse oder den Verein der Tempelgesellschaft aufzufordern.
Er erteilte seinen geschätzten Rat vielen Siedlern
beim Aufbau ihrer Existenzen, besonders bei den Neugründungen
von Wilhelma und Bethlehem. Auf sein Betreiben
organisierten sich die Jerusalemer Manschettenbauern und
unterstützten mit einer Schweinezucht im Großen die Siedlung
Wilhelma.
Auf sein Drängen beteiligte sich die Tempelgesellschaft bei der
Anlage von Orangengärten. Ihm ist hauptsächlich die Gründung
einer Pensionskasse für die Lehrer und Beamten der Tempelgesellschaft
zu danken. Auch war er es meist, der diesen oder jenen Bürgersohn
aufforderte, den Lehrerberuf zu ergreifen, wobei er auf die
Hilfe durch die Hoffmannstiftung aufmerksam machte.
58
Meine Mutter war also auch schon in Jerusalem geboren
und ihr Leben war eng mit dem ihres Elternhauses verbunden,
bis auf die wenigen in Deutschland verbrachten Jahre.
Sie war durch die starke Persönlichkeit ihres Vaters für ihr
ganzes Leben geprägt worden. Ihre Intelligenz und Güte hatte
sie sicher ihm zu verdanken und von ihm geerbt. Und, wenn
sie später in meiner Kindheit russische Gerichte auf den Tisch
brachte, wie Borschtsch oder Schneeflöckchen mit Vanillesoße,
blieb mir das bis heute in Erinnerung.
Wo aber kam mein Vater her?
59
Ein Amerikaner – mein Großvater Friedrich Kuebler
Ein Trunk Wasser in meiner Heimat ist mir lieber als Honig in
der Fremde.
Mein Vater wurde am 14. Juni 1884 in Jerusalem geboren.
Er war 47 Jahre alt, als ich das Licht der Welt erblickte.
Mein Großvater mit gleichem Vornamen, Fritz gerufen,
stammte aus Murrhardt. Murrhardt ist eine kleine Stadt im
Herzen des Schwäbischen Waldes, ca. 30 km nordöstlich von
Stuttgart am Oberlauf der Murr. Der Limes zieht sich direkt
durch das Stadtgebiet.
In jungen Jahren war mein Großvater von Gaildorf aus,
wahrscheinlich zusammen mit seinen Eltern, nach Amerika
ausgewandert. Wo sie lebten, was sie arbeiteten, ist leider
unbekannt geblieben. Vielleicht war ihre Geschichte genauso
interessant wie die von Johannes Dyck gewesen.
Wahrscheinlich war die Süddeutsche Warte, mittlerweile
religiöses Mitteilungsblatt der Templer, das bindende Glied
zwischen den ausgewanderten Kueblers und ihrer Heimat
und sie konnten darin im fernen Amerika über die entstandenen,
schnell wachsenden Templersiedlungen in Palästina
lesen.
Mein Großvater hatte während seines zehnjährigen Aufenthalts
in den Vereinigten Staaten die amerikanische Staatsbürgerschaft
erworben.
Er entschloss sich, nachdem er mit Verwandten in Palästina
korrespondiert hatte, nach Palästina zu ziehen. Er blieb
aber Amerikaner bis an sein Lebensende im Jahr 1898. In
Palästina, ein halbes Jahrtausend schon unter türkischer
Herrschaft stehend (Osmanisches Reich), konnte man seine
Staatsbürgerschaft nicht verlieren und so lange man wollte
beibehalten. Das war hauptsächlich auf die korrupte, türki-
60
Mein Vaterhaus in Jerusalem, Seestraße 8, 1948 umbenannt
in 8 Cremieux Street nach dem Vorsitzenden der
"Alliance Israelite Universelle". Aufgenommen ca. 1980.
sche Verwaltung und den großen Einfluss der akkreditierten
Konsuls der europäischen Länder zurückzuführen.
Als er dann die USA verlassen hatte und in Jerusalem angekommen
war, lernte er nach kurzer Zeit Katharina Adelheid
Wieland kennen, die mit ihren Eltern aus Fornsbach /
Württemberg, nicht weit von seinem eigenen Geburtsort
Murrhardt entfernt, nach Jerusalem ausgewandert war. Sie
heirateten 1873.
Die sieben Kinder, die der Ehe beschieden waren, waren
amerikanische Staatsbürger, so auch mein Vater Friedrich.
Der Älteste unter ihnen, Jonathan, Jona gerufen, wurde 1875
geboren. Die fünf Mädchen hießen Johanna, Frieda, Sofie,
Katharina und Ida. Mein Vater war das sechste Kind in der
Reihe und wurde wie alle anderen in einem Haus in der In-
61
62
nenstadt von Jerusalem nicht weit vom Russenbau am 14. Juni
1884 geboren. Bald danach zog die Familie um in das von
meinem Großvater gebaute Haus in der Deutschen Kolonie,
die südwestlich von Jerusalem gelegen war.
Die etwa 70 cm breiten Kalksteine für die Außenmauern
des dreistöckigen Hauses waren mit wenig Mörtel so
ineinandergefügt, dass geringe Verschiebungen möglich
waren, um Erdbeben besser widerstehen zu können, die in
Jerusalem seit alters her häufig vorkommen und gefürchtet
sind. Das Haus hat alle Erdbeben und Kriegswirren bis zum
heutigen Tag überstanden und ist von israelischen Familien
bewohnt.
Rings um das Haus waren Stallungen angelegt. Mein Großvater
war von Beruf Metzger. Ein Metzger in Jerusalem musste
damals alle Tiere selbst schlachten. Schlachthäuser waren
unbekannt. In den Stallungen waren Kälber, Schweine, Schafe
und Ziegen untergebracht. Jeden Morgen um vier, sonntags
ausgenommen, wurde man durch das einsetzende Brüllen
der Tiere, die zur Schlachtbank geführt wurden, und von
denen in den Ställen, die ihren Tod im Voraus ahnten, aus
dem Schlaf gerissen. Angestellte Araber halfen meinem Großvater
bei dieser schweren, traurigen Arbeit.
Immerhin kauften die Templer das Fleisch und die Wurst
bei Fritz Kuebler, und viele Besitzer der neu entstandenen
Hotels in der Stadt waren ebenfalls Kunden. Das Auskommen
der Familie war gesichert, sodass mein Großvater seinen
ältesten Sohn Jona, der die Schule der Templer in Jerusalem
besucht hatte, mit einem zusätzlichen Jahr im französischen
Institut der Christlichen Brüder in Jerusalem nun in die
Schweiz zur Ausbildung schicken konnte.
Jona absolvierte in Zürich eine kaufmännische Lehre und
bewarb sich in Folge um die schweizerische Staatsbürger-
63
schaft, die ihm von der Gemeinde Kloten gegen eine einmalige
Gebühr von fünfhundert Schweizer Franken – damals
ein Vermögen – gewährt wurde. Er arbeitete ein Jahr als kaufmännischer
Angestellter in London und kehrte 1899, ein Jahr
nach dem Tod seines Vaters, nach Palästina zurück.
Mein Vater besuchte die Templerschule in Jerusalem und
anschließend war er ebenfalls ein Jahr bei den Christlichen
Brüdern zur Ausbildung, wie Jona vor Jahren. Von der Zeit
bei den französischen Patres hat er im Alter immer wieder
gesprochen. Die Brüder waren herzlich, aber auch streng.
Trotzdem hat er durch das im Kloster verbrachte Jahr ein besonderes
enges Verhältnis zu Frankreich entwickelt, vor allen
Dingen aber zur französischen Kultur und Sprache.
64
Mein Vater musste die Metzgerei übernehmen.
Das Kamel trägt Zuckerrohr und bekommt doch nur die Dornen
zu fressen.
Der frühe Tod meines Großvaters hatte die Familie aus der
Bahn geworfen. Mein Vater war noch nicht einmal 15 Jahre
alt. Jona war in London und hatte einen kaufmännischen
Beruf. Alle anderen Geschwister waren Mädchen. Für die
strenge und energische Mutter meines Vaters – wie konnte
man sich auch anders durchsetzen, wenn man sieben Kinder
und drei weitere verwandte, verwaiste, aufgenommene Jugendliche
betreuen und ernähren musste – war es eine Selbstverständlichkeit,
dass mein Vater trotz seines jugendlichen
Alters die Metzgerei weiterführte.
Jeden Morgen um vier ging mein Vater in den Hof hinunter
und musste mit seinen arabischen Gehilfen junge Tiere
aus ihren Stallungen ziehen. Oft stand er da, seine blutverschmierte
Kutte übergestülpt, einen Vorschlaghammer in der
Hand, um ein vor ihm stehendes, zitterndes, ihn anstarrendes
Kälbchen zu töten. Jetzt zuschlagen, hoffentlich ist es
gleich betäubt, und jetzt abstechen. Dies hat den 15-jährigen
Jungen für sein ganzes Leben geprägt. Ganz war er nie über
das Töten der Tiere hinweggekommen. Unter der scheinbar
harten Schale des späteren Mannes war die Feinfühligkeit
nie verloren gegangen und schlummerte im Verborgenen.
Erschwerend für diese Tätigkeit war, dass Wasser nur im
begrenzten Umfang zur Verfügung stand. Es wurde in der
spärlichen Regenzeit vom Dach des Gebäudes in eine im
Haus untergebrachte Zisterne geleitet und war eigentlich nur
zum Trinken bestimmt, natürlich nach vorherigem Abkochen,
Jeweils eine Handpumpe war in den drei Küchen des Hau-
65
ses installiert. Nach heftigem Betätigen eines Hebels kam das
Wasser schließlich aus der Zisterne und floss in den darunter
gestellten Eimer.
Mein Vater erzählte in seinem Alter, dass er solche Pumpen
von der Firma Allweiler, in Radolfzell am Bodensee ansässig,
bezogen und in Jerusalem in seinem späteren Geschäft
verkauft hatte.
Einmal im Jahr musste die Zisterne gereinigt werden. Bei
dieser Gelegenheit wurde nachgesehen, ob die beiden eingesetzten
Aale noch am Leben waren, die das Wasser rein
hielten und die sich immer wieder bildenden roten Würmchen
auffraßen. Als ich einmal als Junge beim Reinigen zusah
und die Aale entdeckte, glaubte ich, Schlangen vor mir
zu haben und war entsetzt. Ich wollte kein Wasser mehr aus
der Zisterne trinken. Meine Mutter aber beruhigte mich: Bevor
wir das Wasser trinken, wird es abgekocht. Aber auch
die auf einer Anhöhe in Richtung Katamon angelegten Wasserreservoirs
der Stadt, in denen das Regenwasser gesammelt
wurde, wimmelten von Schlangen und niemand konnte
mir einreden, dass es keine waren.
Heute wäre es undenkbar, einen Schlachthof, und um einen
solchen handelte es sich bei der sogenannten Metzgerei,
fast ohne Wasser zu betreiben. Erst viel später im Jahre 1939
wurde unser Haus als eines der ersten an die städtische öffentliche
Wasserversorgung angeschlossen, und es schien wie
ein Wunder, als beim Aufdrehen eines Hahns Wasser herausschoss.
Auch gab es, als mein Vater den Schlachthof betreiben
musste, nur spärliches Licht von mit Petroleum gespeisten
Lampen und Kerzen. Die ersten elektrischen Glühbirnen
tauchten in Jerusalem erst etwa 1910 auf. Eisstangen kannte
man ebenso wenig wie Kälteanlagen und Kühlschränke.
66
So mussten die geschlachteten Tiere bei dem vorherrschenden
warmen Klima in Jerusalem am selben Tag verarbeitet
und das Fleisch eingepökelt, geräuchert oder verkauft werden.
Man konnte frisches Fleisch nicht lange lagern.
Mein Vater war in jungen Jahren zwar mager, aber mit 1,79
m für die damalige Zeit groß gewachsen. Die Familie, die er
nach dem Tod seines Vaters zu ernähren hatte, war durch
die Aufnahme von zwei arabischen Waisen, welche die Familie
als strenggläubige und überzeugte Templer aufgenommen
hatte, nochmals angewachsen, jetzt auf zwölf Personen.
Sechs Tage in der Woche, von morgens früh bis spät in die
Nacht, musste er arbeiten. Nur der Sonntag war frei.
Diese Tätigkeit als Metzger dauerte viele Jahre, bis etwa
1917, als der Erste Weltkrieg in Europa tobte. Er war 33 Jahre
alt geworden und längst im heiratsfähigen Alter.
Er erinnerte sich:
„Welches Mädchen in der Kolonie wollte schon einen Mann
heiraten, der blutbeschmiert und wenig gepflegt im Hof steht
und Tiere schlachtet, danach ihnen das Fell abzieht und mit
dem Beil zerlegt?“
So war der freie Sonntag gewöhnlich von Langeweile geprägt.
Zwar besuchte er den Gottesdienst im Saal, der
durchaus auch zum Unterricht der Kinder dienen konnte,
wenn es mal an Räumlichkeiten fehlte. Nachmittags machte
er gewöhnlich einen Spaziergang zum Katamon, einer Bergerhebung
bei Jerusalem und kam abends allein und unzufrieden
zurück.
Aber er fand etwas, was ihn erfüllte. Die Musik!
Er lernte das Waldhorn zu blasen und die Trompete. Er
spielte in der von der Templergemeinde gegründeten Blaskapelle
mit. Dann entdeckte er seine Liebe zum Cello, zum
Klavier und zum Harmonium. Und er hatte eine gute Stimme
– einen Bariton.
67
Jona Kuebler – der Bruder meines Vaters
Jeder Ehrgeizige ist ein Gefangener und jeder Geizige ein Armer.
Jona hatte nach seiner Rückkehr aus London eine Stelle als
Bankkaufmann in Jerusalem angetreten. Aber schon nach
zwei Jahren gründete er seine eigene Firma in Jaffa, das am
Mittelmeer etwa 47 km westlich von Jerusalem liegt. Unter
anderen kaufmännischen Tätigkeiten exportierte er Orangen
in alle Welt, welche die Templer in der Ebene um Jaffa herum
anpflanzten (man behauptet, dass sie den Orangenbaum
aus Afrika eingeführt und die ersten Zitrusplantagen in Palästina
angelegt haben), und sein Name war bald in allen
einschlägigen Handelskreisen bis nach Amerika hin bekannt
geworden. Damals entstand der bis heute geläufige Begriff
der Jaffa-Orange, die ihrer Qualität wegen Weltruf erlangte.
Sein Bekanntheitsgrad führte dazu, dass ihn Schweden zum
Honorarkonsul ernannte und Spanien zum Vizekonsul für
Palästina. Diese Länder sahen in ihm den geeigneten Mann,
ihre Interessen in Palästina vertreten zu lassen. Im Ersten
Weltkrieg vertrat er sogar zusätzlich – sprachgewandt, wie
er war – alle alliierten Staaten auf der einen Seite und Deutschland
andererseits. Ihm gelang es – dies sei als Beispiel seines
Einflusses schon im Ersten Weltkrieg angeführt – die Türken
davon abzubringen, die Franziskanerkirche in Jerusalem
zu zerstören. Sie wollten das Baumaterial der Kirche für
Befestigungszwecke verwenden. Seine persönliche Freundschaft
zu Kemal Pascha, nach 1934 Atatürk genannt, dem Begründer
der neueren Türkei, hatte dabei die ausschlaggebende
Rolle gespielt.
Jona hatte in der Schweiz eine Schweizerin geheiratet. Das
Ehepaar konnte selbst keine Kinder bekommen. So beschlos-
68
sen sie, eine schweizerische Waise zu adoptieren, die sie Liselotte
nannten.
Mein Vater war in dieser Zeit ganz im Schatten seines Bruders
gestanden. Er beneidete Jona um seinen Erfolg und auch
um seine Ausbildung, die er durch die familiären Umstände
selbst nicht hatte wahrnehmen können. Er war nur ein einfacher
– wenn auch tüchtiger – Metzger geblieben und fühlte
sich doch zu Besserem berufen.
Jona Kuebler
69
Der Erste Weltkrieg bricht über Palästina herein.
Der ist der beste Redner, der der Menschen Ohren in Augen
verwandeln kann.
Doch der Erste Weltkrieg erreichte auch Palästina. Die
Engländer rückten von Ägypten kommend nach Palästina
vor, um die Türken und die deutsch-österreichischen Militäreinheiten
zu bezwingen. Die hatten sich in Gaza festgesetzt.
Sie standen unter dem Kommando des osmanischen
Generals Tala Bey und des deutschen Generals Kreß von Kressenstein,
der später das Buch schrieb: Mit den Türken zum Suezkanal.
Erst in der dritten Schlacht um Gaza waren die britischen
Truppen unter der Führung von General Allenby mit ihrem
dritten Angriff – die dritte Schlacht um Gaza – erfolgreich
und durchbrachen 1917 die Verteidigungslinie Gaza-Beersheba.
Die Templer selbst waren in die Auseinandersetzungen
nicht aktiv verwickelt, bis auf einige Farmer, die Artillerie-
Munition von Jaffa nach Gaza transportierten, dabei gefangen
genommen und in Sidi-Bischer in Ägypten interniert
wurden (Quelle: Brief von Felix Haar vom 25. Juli 2009). Die
Briten brauchten ein weiteres Jahr, um das Land von Jaffa
bis Haifa zu erobern und zu besetzen.
In der Folge machten die Engländer Palästina zum englischen
Mandatsgebiet. Die Franzosen übernahmen Syrien und
den Libanon.
Viele wehrtüchtige deutsche Templer hatten zuvor vom
Deutschen Reich einen Stellungsbefehl erhalten und waren vor
dem Einmarsch der Engländer, oft auf abenteuerliche Weise,
nach Deutschland gereist, wo sie dann eingezogen wurden.
70
Mein Vater hatte einen solchen Stellungsbefehl als Amerikaner
natürlich nicht erhalten. Doch sein Herz hatte immer
nur für Deutschland geschlagen und als die Engländer dann
im Land waren, entschloss er sich, über Aleppo mit anderen
Kameraden nach Deutschland zu fliehen, um als freiwilliger
Amerikaner auf deutscher Seite mitzukämpfen.
Auf seiner Flucht wäre er beinahe von den Engländern erschossen
worden. Er erzählte, wie er nachts in einem unbewohnten
Haus auf einem Hügel übernachtet hatte, als eine
englische Einheit morgens früh damit begann, das Haus zu
beschießen. Halb angezogen stürzte mein Vater zum rückwärtigen
Ausgang und lief um sein Leben den Hügel hinunter,
bis er in Sicherheit war. Diese Geschichte hat er im Alter
wieder und wieder erzählt. Dieses Erlebnis musste bei ihm
einen regelrechten Schock bewirkt haben.
So, wie es meinem Vater erging, erging es auch anderen
Palästinadeutschen, die versuchten, über die Türkei nach
Deutschland zu kommen, um einer Internierung durch die
Engländer zu entgehen und um dem Vaterland als Soldat zu
dienen. Welche Gefahren eine solche Flucht barg und welche
Entbehrungen zu ertragen waren, kann man in dem Buch
Der Orangenpflanzer von Sarona von Rudolf de Haas nachlesen.
Darin wird auch beschrieben, wie die Flüchtenden, auch
versprengte reguläre deutsche Soldaten, von den Engländern
und Franzosen mit Flugzeugen auf freiem Feld einzeln gejagt
und bombardiert worden waren. Auch die aufständischen
Araber waren den Flüchtenden nicht wohlgesinnt,
denn diese kämpften an der Seite der verhassten Türken.
Als mein Vater schließlich in Deutschland angekommen
war, war der Krieg zu Ende. Er wurde nicht mehr gebraucht,
konnte aber in den Nachkriegswirren auch nicht mehr zurück
nach Palästina. Die Engländer hatten die Templer aus
71
den Kolonien in Jerusalem, Sarona und Wilhelma, etwa 850
an der Zahl, 1918 interniert und dazu in ein altes Hotel,
damals genannt Al Hayat, mit angebauten Wellblechbaracken
nach Helouan nicht weit von Kairo nach Ägypten verfrachtet,
wo, wie bereits berichtet, auch mein Großvater Johannes
Dyck interniert gewesen war. Sie wurden 1920 freigelassen
und durften dann nach Palästina in ihre alten Siedlungen
zurückkehren.
Die deutschen Siedler im nördlichen Palästina blieben von
der Internierung verschont. Sie konnten eine Regelung mit
dem für dieses Gebiet zuständigen englischen Kommandanten
treffen. Nach der Aussage von Felix Haar lebten damals
allein in der Templersiedlung Haifa über ein Duzend Templer
mit der amerikanischen Staatsbürgerschaft. Die meisten
Deutschen aber mussten ihre Häuser für die Briten und ihre
Verbündeten räumen. Die Angehörigen meines Vaters in
Jerusalem waren nicht interniert worden, da sie
glücklicherweise auch einen amerikanischen Pass besaßen.
72
Mein Vater wird Deutscher.
Das Schwerste für den Menschen ist die Selbsterkenntnis.
Mein Vater hatte in Deutschland wieder die deutsche
Staatsbürgerschaft beantragt und bewilligt bekommen, was
sich später im Zweiten Weltkrieg in einer fast neunjährigen
Kriegsgefangenschaft auswirken sollte.
Leider hat mein Vater von der Zeit in Deutschland wenig
erzählt. Wo war er beschäftigt? Wo hatte er gewohnt? Wovon
hatte er gelebt? Hatte ihn seine älteste Schwester Johanna,
die in Augsburg verheiratet war, aufgenommen oder gar
unterstützt? Hatte er eine kaufmännische Schule in Stuttgart
besucht und absolviert?
Unvergesslich blieb für ihn die Aufführung des Nibelungen-Rings,
der er in Bayreuth beiwohnen konnte. Wenn er
einmal einen Sohn bekommen würde, würde er ihn nach Siegfried
Wagner, den Sohn von Richard Wagner, nennen. So habe
ich meinen Vornamen Siegfried bekommen.
Nachdem die Templer aus Helouan wieder nach Palästina
durften und ihre Existenzen neu aufbauten, war es für ihn
an der Zeit, ebenfalls zurückzukehren. Das war 1922.
Diesmal würde er nicht wieder als Metzger arbeiten. Das
schwor er sich. Seine Schwestern waren in der Zwischenzeit
verheiratet, bis auf Sofie, die bis zu ihrem Tod unverheiratet
geblieben war, und fielen der Mutter nicht mehr zur Last.
Die Waisen waren groß geworden und ausgezogen. Er kam
also zu seiner Mutter und seiner Schwester Sofie in sein Elternhaus
zurück. Dieses Trio lebte zusammen.
Er machte sich mit einem Reisebüro selbstständig. Er kannte
Palästina so gut wie seine Westentasche, und er war auch
schon einige Male in Transjordanien gewesen, dem heutigen
Jordanien, das damals noch ein weißer Fleck auf der
73
Landkarte und dem Tourismus gänzlich verschlossen war.
Die heute berühmte Sehenswürdigkeit und in der Römerzeit
etwa 30 000 Einwohner zählende Stadt Petra (griech.:
Fels), eine der schönsten und rätselhaftesten Stätten der Antike
zum Beispiel, war erst 1812 von dem Schweizer Abenteurer
Burckhardt wiederentdeckt worden. Dieses Kleinod lag
jahrhundertelang verborgen am Ende eines schmalen Hohlweges
in der Wüste von Süd-Jordanien, obwohl durch Petra
die legendäre, gepflasterte, von Aleppo nach Akaba gehende
Römerstraße führt.
Amman, die heutige Millionenstadt und Hauptstadt von
Jordanien, war um die Jahrhundertwende von der einstigen
Blüte in der Antike zu einer Beduinensiedlung verkommen.
Die Wende kam, als Amman von der Hedschasbahn 1903 erreicht
wurde, die von Damaskus nach Medina führt, aber
nach dem Ersten Weltkrieg nur noch in Teilstrecken in Betrieb
war.
74
Kueblers Tourist and Travel Office
Ausdauer ist der Schlüssel zur Freude.
Die Zeichen für sein Unternehmen, das Kueblers Tourist and
Travel Office, standen gut, denn der Touristenstrom aus Europa
ins Heilige Land, vor allen Dingen aber aus Deutschland,
wuchs von Jahr zu Jahr. Mein Vater mietete einige Räume
an, die nicht weit vom Jaffator an der südwestlichen Grenze
der Altstadt Jerusalems lagen.
Aber auch die Nachfrage nach europäischen Gebrauchsgütern
war groß, sodass er sich entschloss, Waren aus
Deutschland und England einzuführen, wie Postkarten mit
Motiven von Palästina – damals kamen die ersten farbigen
Postkarten auf – sowie Schmuck und Andenken, z. B. das
Jerusalemer Kreuz; weiterhin Modeschuhe und Spielzeug bis
hin zum Automobil. Für die Lagerung waren die Räumlichkeiten
der aufgegebenen Metzgerei rund um sein Elternhaus
Jerusalem
75
gut geeignet. Er berichtete, dass er die Vertretungen für etwa
500 ausländische Firmen in Palästina hatte.
Er erzählte, wie er eine neue Mercedes Benz Limousine
nach Jericho lieferte, um sie über den damals etwa 20 m breiten
Jordan mit einem Floß übersetzen zu lassen. Auf der transjordanischen
Seite wurde sie von den Beauftragten des Königs
Saud in Empfang genommen. Sie war von König Saud
von Transjordanien bei ihm bestellt worden.
Die Jerusalemer Kreuze, ein Renner im Verkauf an viele Touristen,
hatte er von dem damals führenden Schmuckwarenhersteller
Rotewinneberger (R&W) aus Pforzheim bezogen. Der
Verkauf der Kreuze brach jedoch ein, als die englische Mandatsregierung
verlangte, dass auf der Rückseite der Kreuze
Made in Germany eingeprägt werden musste. Wer wollte aber
in Jerusalem ein Kreuz als Erinnerungsstück kaufen, das in
Deutschland hergestellt worden war?
Aber mein Vater hatte eine glänzende Idee. Die offiziellen
Sprachen in Palästina waren englisch, hebräisch und arabisch.
Wer konnte schon Arabisch? Made in Germany erschien bei
der nächsten Lieferung in arabischer Schrift auf der Rückseite
des Anhängers. Niemand konnte das verbieten. Die Käufer
aber dachten, wegen der arabischen Schriftzeichen auf
der Rückseite, dass das Kreuz in Jerusalem oder aber
zumindest in Palästina angefertigt worden war. So verkaufte
er mehr Kreuze als je zuvor.
Das Kueblers Tourist and Travel Office hatte er, wie bereits
erwähnt, nicht weit vom Jaffator, an der südwestlichen Seite
der Stadtmauer von Alt-Jerusalem, eröffnet. Er stellte einen
Araber für die arabische Kundschaft und einen Deutschjuden
namens Falscheer, der aus der Schweiz stammte, für die
jüdische und deutsche Kundschaft ein. Nach kurzer Zeit
wurde ihm die äußerst begehrte Alleinvertretung für den
76
Norddeutschen Lloyd übertragen. Die Gesellschaft besaß die
berühmten Ozeanriesen Bremen und Europa. Die Europa war
das Schiff, welches das blaue Band für die schnellste Überquerung
des Atlantiks nach Deutschland zurückholte.
Wenn ein Templer nach Amerika zu seinen Verwandten
reisen wollte – viele hatten noch Verwandte dort –, war dies
eine günstige Verbindung über Haifa, Triest, Bremerhaven
und weiter nach New York. So konnte man die Schiffsreise
mit einem gleichzeitigen Besuch in Deutschland verbinden.
Die Colombo war ein weiteres großes Schiff der Gesellschaft,
das mindestens einmal im Jahr Touristen von Bremerhaven
nach Beirut brachte und sie nach ihrer Studienreise durch
den Libanon, Palästina, Sinai und Ägypten wieder in Alexandrien
abholte. Bis zu 800 Reisende gingen in Beirut an
Land. Meinem Vater oblag es, die Touristen in Beirut abzuholen,
sie zu betreuen und die lange Reise zu organisieren,
damit sie alle zum richtigen Zeitpunkt wieder in Alexandrien
abreisebereit waren.
Eine gigantische Aufgabe, wenn man die Möglichkeiten
der damaligen Zeit berücksichtigt. Das Telefon stand erst am
Anfang seiner Entwicklung, und nicht jeder Ort in Palästina
war zu erreichen. Es gab nur wenige Busse im Land und die
mit wenig Komfort. Man konnte sie den Reisenden nicht
zumuten. So musste er alle Taxis in Palästina und viele vom
Libanon anmieten, die die Touristen nach der Besichtigung
Palästinas und vor allem der Heiligen Stätten bis nach Ägypten
fuhren, also durch das Sinai mit seinen schlechten Straßen,
die meistens noch Schotterpisten waren.
Wenn er von diesen Fahrten redete, leuchteten seine Augen.
Er war in seinem Element und sicherlich war die Ankunft
der Colombo immer ein Höhepunkt in seinem Leben
gewesen.
77
Bei der Betreuung der Reisenden auch in kleineren Gruppen
oder von Einzelnen lernte er bedeutende Persönlichkeiten
dieser Zeit kennen, so z. B. den schwedischen Streichholzkönig
Krüger, mit dem er eine Nacht mit Arrak, einem starken
Anisschnaps, durchgezecht hatte, obwohl er nie viel vertragen
konnte. Auch hatte er die Bekanntschaft von Albert Einstein,
der Jerusalem besuchte, gemacht, und er kannte Ben
Gurion (erster Ministerpräsident von Israel 1948-1953) und
Golda Meir (Ministerpräsidentin von Israel 1969-1974).
Er hatte auch von einem Flug mit einer dreimotorigen, blau
lackierten Fokker von Gaza nach Petra in Transjordanien
berichtet, zu dem er von dem berühmten Schweizer Flieger
und Forscher Walter Mittelholzer eingeladen worden war.
Mittelholzer soll einige Loopings gedreht haben, wobei es
meinem Vater den Angstschweiß auf die Stirn trieb und er
sich fast übergeben musste. Er schwor sich, nie wieder in ein
solches Flugzeug zu steigen. Von diesem Flug wurde damals
in der Palestine Post vom 14. Febr. 1934 (im letzten Kapitel ist
der Original-Wortlaut aus der Palestine Post wiedergegeben) geschrieben:
„Mittelholzer startete mit seiner dreimotorigen Fokker am
13. Febr. 1934 von Gaza nach Petra. Er flog dabei auch einige
Runden über Jaffa, Tel-Aviv und Jerusalem. Dreitausend
Fotoaufnahmen und auch Filme sollen dabei aus der Luft
gemacht worden sein. An Bord waren Dr. Gogler, Professor
Morf und F. Kuebler. Das große blaue Flugzeug war von Kaiser
Haile Selassie [auch Negus Negesti „König der Könige“ genannt
oder auch „Löwe von Juda“] gekauft worden und Mittelholzer
oblag die Aufgabe, das Flugzeug nach Addis Abeba
zu überführen.“ Darüber hat er später ein Buch mit dem
Titel Abessinienflug geschrieben, das im gleichen Jahr in Zürich
veröffentlicht wurde.
78
Kueblers Tourist & Travel Office am Jaffator
79
In der Templergemeinde war mein Vater in der Blaskapelle
engagiert. Als Tennis populär wurde, gründete er einen
Tennisverein. Westlich der Templerkolonie auf einem Feld,
wo im Frühjahr Tausende roter Anemonen blühten, ließ er,
zwischenzeitlich zum Präsidenten des Vereins gewählt, zwei
Tennisplätze anlegen. Dazu waren Sprengungen der herausragenden
Kalksteinfelsen notwendig. Es entstand auch ein
Clubhaus, in dem sogar eine Kegelbahn Platz fand. Ich schätze,
dass die Tennisplätze zwischen 1925 und 1928 gebaut
wurden. Meine Mutter, damals Fräulein Paula Dyck, war
gut in diesem Sport, sie war mehrmals Clubmeisterin. Mein
Vater dagegen war im Bälleschlagen weniger begabt. Er soll
sich beim Spurt nach einem Ball so verletzt haben, dass er
kaum noch zu überreden war, den Schläger nochmals in die
Hand zu nehmen. Dafür hat er aber die Meisterschaft im
Kegeln gewonnen.
Die Begeisterung meiner Mutter für diesen Sport hat sich
wahrscheinlich auf mich übertragen. Ich war aber schon 28
Jahre alt, als ich den ersten Schläger – einen Slazenger, natürlich
aus Holz und gebraucht gekauft – in der Hand hatte
und die ersten Bälle über das Netz beförderte.
80
Mein Vater heiratete Paula Dyck.
Wer nie jagte, nie liebte, nie den Duft einer Blume suchte und nie
beim Klang der Musik erbebte, der ist kein Mensch, sondern ein
Esel.
Meine Mutter, damals Fräulein Paula Dyck und sechzehn
Jahre jünger als mein Vater, war eine der ersten jungen Damen
in der Kolonie, die dem Weißen Sport huldigte. Als mein
nicht so sportlicher Vater einige Mal beim Spiel mit meiner
Mutter den Kürzeren zog und dabei sogar stürzte, gab er das
Tennisspielen schnell wieder auf. Dafür wurde er Experte im
Kegeln. Immerhin hatte er auf diese Weise Fräulein Dyck näher
kennengelernt. Aber seine große Liebe war eine andere.
Liselotte, die angenommene Tochter von seinem Bruder
Jona, war zu einer bildschönen, blonden jungen Frau herangewachsen.
Wenn sie auf der Straße mit ihren Eltern spazieren
ging, schauten sich alle jungen Männer um, um einen
zweiten Blick zu wagen. Meinem Vater blieb die Schönheit
Liselottes natürlich nicht verborgen. Er machte ihr den Hof.
Sie war gerade 18 und er 38. Er verliebte sich in das Mädchen,
das seine Liebe bald erwiderte. Es entwickelte sich eine Romanze
zwischen den beiden, die Jona und dessen Frau nicht
gerne sahen. Er stellte meinen Vater zur Rede – ohne Erfolg –
und entschloss sich kurzerhand, mit seiner Familie von Jerusalem
nach Jaffa umzuziehen. Die Gelegenheit dazu war günstig,
denn die Schweiz hatte ihn zum schweizerischen Honorarkonsul
für Palästina ernannt. Das Konsulat wurde 1927 in
Jaffa eröffnet. Die konsularischen Vertretungen für Schweden
und Spanien legte er nieder, weil das die Voraussetzung für
seine Ernennung war.
Die Zeit und die Entfernung brachten, wie so oft im Leben,
81
die beiden Liebenden auseinander. Meines Vaters erste große
Liebe war vorbei.
Manchmal dachte er an Fräulein Dyck und traf sie zu einem
Drink im Tennisclub. Er hielt sich aber zurück und machte
keine Avancen. Fräulein Dyck, die sich Hoffnungen gemacht
hatte, war eine resolute junge Frau und zog bald die Konsequenzen.
Sie war für klare Fronten. Sie nahm kurzerhand das
Angebot einer reichen Familie in Mexiko City an, deren Kindern
als Hausdame Unterricht zu erteilen und sie zu erziehen.
Sie besorgte sich die erforderlichen Visa und kaufte die
Fahrkarten bei Kueblers Tourist and Travel Office, um mit dem
Schiff zuerst von Haifa nach Triest zu reisen und anschließend
mit einem anderen Schiff den Atlantik von Hamburg
nach Vera Cruz zu überqueren. Sie wollte den Umweg über
Deutschland nehmen, da sie in Deutschland einige Besuche
vorhatte.
Doch lassen wir meine Mutter zu Wort kommen:
„Am letzten Abend war ich mit meinen Eltern zusammen
zu einem Abschiedstrunk in unseren Tennisclub gegangen.
Viele gute Wünsche wurden mir von meinen Freunden und
Bekannten mit auf die Reise gegeben. Beim Verlassen des Clubs
trafen wir Herrn Kuebler. Es war eine Wette offen, die er verloren
hatte.
Ich sagte:
‚Heute haben Sie noch die Gelegenheit, Ihre Wette einzulösen.
Der Zeppelin ist doch nach Jerusalem gekommen. Ich habe
die mit Ihnen abgeschlossene Wette also gewonnen. Sie waren
ja anderer Ansicht. Morgen reise ich ab.‘ Er aber lachte
und erwiderte:
‚Das hat sicher noch Zeit.‘
Ich dachte: welch dummes Junggesellengerede. Mein Ge-
82
päck war schon abgeholt worden, und ich musste nur noch
den Handkoffer schließen.
Am nächsten Morgen fuhr ein Taxi vor, aber nicht das von
mir bestellte. Der Taxifahrer überreichte mir einen Brief von
Herrn Kuebler:
‚Liebes Fräulein Dyck!
Ich habe heute geschäftlich in Haifa zu tun. Sie können mich
mit Ihrem Bruder Abram begleiten, wenn Sie wollen.‘
Ich verabschiedete mich von meinen Eltern und meinen
Geschwistern und sagte:
‚Die drei Jahre werden wohl bald vorbei sein‘ und stieg mit
meinem Bruder in das vorgefahrene Taxi ein. Die Blaskapelle
spielte, und einige Tränen liefen mir über die Wangen. Wir
holten Herrn Kuebler in einem Kaffeehaus ab, wo er auf uns
wartete. Er setzte sich neben mich.
Wir fuhren an der Amerikanischen Kolonie vorbei in Richtung
Norden. Auf der Anhöhe angekommen, versuchte ich,
einen letzten Blick von der Stadt Jerusalem mit der Omar
Moschee zu erhaschen.
Kaum hatten wir die Hauptstraße erreicht, wandte sich Herr
Kuebler unvermittelt an mich und fragte:
‚Fräulein Dyck wollen Sie meine Frau werden?‘
Ich war wie vom Blitz getroffen und wusste nicht, was ich
antworten sollte.
‚Wollen Sie nicht?‘
Seine Augen schimmerten, und schon lag ich in seinen Armen.
Das Ja kam wie von selbst über meine Lippen.“
So weit die Schilderung meiner Mutter.
Die Taxifahrt wurde nicht unterbrochen. Es wurde ein Ausflug,
der über Nablus, Haifa und Nazareth zurück nach Jerusalem
führte. In Nazareth löste mein Vater seine verlorene
Wette ein und bestellte die gewetteten zwei Flaschen Bier und
83
ein dazugehöriges Masa, auf Arabisch eine Art Vorspeise.
Damit war die Wette eingelöst.
Die Nachricht von der Verlobung der beiden verbreitete sich
in der deutschen Kolonie wie ein Lauffeuer. Wie ist das möglich,
fragten sich die Leute, alle Fahrkarten waren doch schon
gekauft und jetzt bleibt sie doch da? Konnte er sich zu diesem
Schritt nicht früher entschließen? Musste er den letzten Moment
abwarten?
Als die beiden in Jerusalem ankamen, wurden sie von vielen
der neugierig zusammengelaufenen Menschen der Siedlung
empfangen. Sie waren auch gekommen, um den Jungverlobten
zu gratulieren.
Mein Vater hatte bisher bei seiner Mutter und Schwester
Sofie in seinem Vaterhaus gewohnt. Die Mutter war von der
Nachricht der Verlobung völlig überrascht worden und konnte
sich nicht richtig freuen. Ihr Fritz war der einzige Mann im
Haus und schon 45 Jahre alt. Musste er in diesem Alter noch
heiraten? Sollte sie ihn, ihre rechte Hand und Stütze, an eine
junge Frau verlieren? Auch Sofie zeigte sich verschlossen. Ihr
Bruder gehörte ihr jetzt nicht mehr allein.
Paula und Fritz heirateten dessen ungeachtet, und das jungvermählte
Paar zog in die obere Wohnung des Vaterhauses
ein, während die Mutter und Sofie die größere untere Wohnung
behielten.
84
Meine frühe Kindheit
Schütte das schmutzige Wasser nicht weg, bevor du sauberes
gefunden hast.
Im Jahre 1930 brachte meine Mutter, wie schon erwähnt,
einen Sohn zur Welt. Es war eine Totgeburt. Ein Jahr später
wurde ich geboren und zwei Jahre später meine Schwester
Gisela.
Meine ersten Erinnerungen beziehen sich auf ein Wohnzimmer,
wo ich krank auf einem zu einem Bett umfunktionierten
Sofa lag. Ich hatte eine schwere Nierenentzündung. Meine
Mutter pflegte mich aufopfernd. Sie legte mir nasse Kopftücher
gegen das hohe Fieber auf die Stirn und flößte mir heißen
Tee mit Zitrone ein, den ich überhaupt nicht mochte. Ich habe
einen solchen Widerwillen dagegen entwickelt, dass ich Tee
in dieser Kombination bis heute nicht trinken mag.
Meine kleine Schwester lag in einem Bettchen einige Schritte
entfernt. Ich kann mich an einen Wandteppich erinnern,
den meine Mutter aufgehängt hatte und der mir Angst machte.
Er zeigte einen Engel mit großen Federflügeln in einer mit
Zypressen bewachsenen Landschaft. Es waren die Bäume des
Todes. Ich glaubte, dass ich sterben müsste und war auch tatsächlich
dem Tode sehr nah, wie mir meine Mutter später bestätigte,
als ich erwachsen war.
Wir zogen nach der überwundenen Krankheit ein Stockwerk
tiefer, denn Sofie brauchte die größere Wohnung nicht mehr,
nachdem die Mutter meines Vaters Anfang 1930 verstorben
war.
Meine Eltern konnten sich jetzt ein Esszimmer leisten, ein
Wohnzimmer und allem voran ein Musikzimmer. Viele Musikinstrumente
standen darin: ein Klavier, ein Harmonium,
viele Blasinstrumente vom Bass bis zum Waldhorn, ein Cello,
85
Geigen und ein Kontrabass. Das hatten sich beide gewünscht:
ein Musikzimmer, in dem sie nach Herzenslust musizieren
konnten.
So spielten sie vierhändig auf dem Klavier, wie z. B. den Freischütz
von Weber. Meine Mutter spielte Die Ungarische Rhapsodie
allein, und mein Vater begleitete sie dazu mit dem Cello.
Als wir etwas älter waren, war es uns Kindern fast nicht möglich,
ohne die bis ins Schlafzimmer dringende Musik einzuschlafen,
wenn unsere Eltern vielleicht einmal zu einem Diner
ausgegangen waren.
Meine Eltern waren mit ihrer Musik wahrscheinlich das
glücklichste Paar der Welt.
Sofie hatte mich und meine Schwester in ihr Herz geschlossen.
Das Verhältnis zu meinem Vater hatte sich in dem Moment
geändert, als wir geboren waren. Immer wieder hatte
sie in ihren Händen ein kleines Geschenk für mich. Oft war es
ein Taschenmesser. Ich glaube, dass ich, bis ich elf Jahre alt
war, mindestens zehn Taschenmesser von ihr bekommen habe.
Über jedes neue freute ich mich, denn ich schnitzte bei jeder
Gelegenheit an Stöcken und Holzstücken herum. Und die Klingen
waren immer von unterschiedlicher Schärfe und wurden
auch schnell stumpf. Je schöner und teurer das Taschenmesser
war, umso schlechter waren seine Schnitzeigenschaften.
Mit dem Schnitzen hatte ich bestimmt schon mit fünf oder
sechs Jahren angefangen und brachte es später zu einer erstaunlichen
Fertigkeit.
Im Erdgeschoss lebte die Familie Hans Hesselschwerdt. Die
Schwester Katharina meines Vaters hatte den Kraftfahrzeugmeister,
der von Deutschland eingewandert war, geheiratet.
Er hatte mit seinem Bruder nicht weit von unserem Haus entfernt
eine Werkstätte eingerichtet, in der er mit einigen Angestellten
PKWs, aber auch Lastwagen wartete und reparierte.
86
Vom Fenster aus konnte man die Lastwagen im Hinterhof der
Werkstätte erkennen. Onkel Hans nahm mich hin und wieder
mit, damit ich mich umsehen konnte und bei der Reparatur
dabei sein konnte.
Katharina und Hans hatten zwei Töchter, die ältere Olga –
damals, als ich sechs war, war sie etwa vierzehn – und Nellie
zwölf. Beide waren natürlich besonders begehrte Spielgefährten
für uns. Sie hatten sich, als wir noch klein waren, auch als
Babysitter betätigt.
Nellie schob mich in meinem Spielzeugauto im Garten herum
und Olga hatte mir einen Pullover gestrickt.
Keiner konnte wissen, welch fürchterliches Schicksal dieser
Familie und Sofie bevorstand. Als der Zweite Weltkrieg losbrach,
wurden sie alle wie wir auch in Sarona interniert. Die
Engländer versuchten, ihre Internierungslager in Palästina
nach und nach aufzulösen. Zu ihrer Entscheidung hatte
sicherlich der Vormarsch Rommels mit dem Ziel, den Suezkanal
zu erreichen, beigetragen. Ein Teil der Deutschen wurden
gegen Juden und einige Engländer über die in diesem Krieg
neutrale Türkei nach Deutschland ausgetauscht. Die meisten
aber wurden 1942 nach Australien verschifft. 1941 war der
erste Austausch, der zweite folgte Ende 1942 und der dritte
1944. Die Familie Hesselschwerdt und Sofie kamen im Sommer
1944 im Rückwandererheim in Stuttgart an – das war das
ehemalige alte Hotel Central –, um dort die Nacht zu verbringen,
bevor sie zu ihrem endgültigen Standort irgendwo in einer
kleineren Stadt in Württemberg weiterreisen sollten.
Doch in dieser Nacht bombardierten die Alliierten Stuttgart.
Stuttgart brannte.
Das Rückwandererheim wurde von Splitterbomben getroffen
und sank wie ein Kartenhaus in sich zusammen.
Sie wurden in einem teilweise zusammengestürzten Keller
87
des Hauses erst nach Tagen gefunden. Die beiden Mädchen
lagen am Boden vor der Tür, um durch den unteren Schlitz
den letzten Lufthauch einzuatmen, der von draußen hereinsickerte.
Vergeblich. Alle waren sie erbärmlich erstickt. –
Dunkel kann ich mich auch an einen Ausflug erinnern, der
meinen Vater mit meiner Mutter, Gisela und mir zum nördlichen
Teil des Jordans führte, wo der Fluss vielleicht zehn Meter
breit und an den Ufern mit hohen Büschen besäumt war.
Er mietete ein Boot, wir nahmen Platz, und er ruderte zur
Flussmitte. Hier taufte er mich und meine kleine Schwester
mit echtem Jordanwasser. Das war natürlich keine echte Taufe,
aber immerhin blieb mir dieses Ereignis in Erinnerung. Heute
soll der Jordan in diesem Abschnitt nur ein Rinnsal sein, in
dem kaum noch Wasser fließt.
Als ich etwa sieben war, es war in den Ferien, und ich musste
nicht in die Schule, spielte ich an einem Morgen auf dem
Fußboden der überdachten Glasveranda, die vor dem Musikzimmer
lag.
Sie war auch der Durchgang zur Toilette, die separat vom
Haus über einen Steg zu erreichen war. Sie war als Plumpsklo
überhöht angelegt. Die Fäkaliengrube wurde, wenn sie voll
war, abgepumpt und von dem Tankfahrzeug an den Stadtrand
südlich des Jaffators gebracht und dort in ein Tal abgelassen.
Ein von meinem Vater angestellter, arabischer Träger
mit dem Namen Yachia, der mich manchmal abholen musste,
um mich ins Büro meines Vaters zu bringen, drohte mir, wenn
ich nicht mehr gehen wollte, mich in den stinkenden Schlick
zu werfen, der weit ins Tal hineinreichte. Er hatte keine Lust,
mich bis ins Büro zu tragen. Ente wuachet hatcher, du bist so
schwer wie ein Stein, sagte er dann bedeutungsvoll mit tiefer
Stimme. Mir graute vor der Vorstellung, darin zu versinken,
obwohl ich wusste, dass er es nicht ernst meinte. Nichts
88
Schrecklicheres könnte mir passieren! Ich sah sofort ein, dass
ich ihn nicht mehr auffordern würde, mich zu tragen, bis wir
die Stelle weit hinter uns gelassen hatten.
Mein Spielen wurde durch den einsetzenden Regen unterbrochen.
Die Regenzeit hatte begonnen. Die großen Tropfen
klatschten gegen die Scheiben der Glasveranda und liefen
unregelmäßig herunter. Die Fenster waren leicht von innen
beschlagen. Ich drückte meine Nase an den Scheiben platt, um
besser nach draußen sehen zu können.
Die Spatzen badeten in den Pfützen im Hof und säuberten
mit den Schnäbeln ihr Gefieder. Ein lustiges Schauspiel. Trübe
Tage sind in Jerusalem selbst in dieser Jahreszeit so selten
wie der Regen. Doch er wird dringend benötigt, um die spärliche
Vegetation zum Leben zu erwecken und die Zisternen und
Stauseen der Menschen zu füllen. Einen Dauer- oder Landregen
wie in Deutschland kennt man nicht. Manchmal gibt es
aber Schneeflocken, die in dem Augenblick schmelzen, wenn
sie den Boden berühren. Die tief hängenden Wolken verschwinden
nach wenigen Stunden und machen der Sonne
wieder Platz. Ich glaubte immer, die weichen Wolken einfangen
zu können. Ich müsste nur auf den gegenüberliegenden
Telegrafenmast steigen und die Wolke mit beiden Händen
greifen und nach unten ziehen. Das würde ein weiches Daunenbett
geben! Man könnte sich darin kuscheln. Und wenn
man es nicht mehr brauchte, würde es sich in Nichts auflösen.
Wenn dann die Halbwüste um Jerusalem erblüht und der
braungelben Landschaft mit den weißen, herumliegenden
Kalksteinen Farbe gibt, wird man erst die sparsame Schönheit
des Landes erkennen können. Die schönsten und auffallendsten
Blumen zugleich sind die roten Anemonen. Wenn ich
für Jerusalem eine Blume aussuchen könnte, wäre es eben diese
89
Anemone und nicht die weiße Lilie, die schon auf einer in Jerusalem
gefundenen und wahrscheinlich um 350 v. Chr. nur
8,5 mm großen geprägten Silbermünze abgebildet ist.
Die weiße Lilie
90
Ein Erdbeben
Keiner ist von Sorgen frei, nicht einmal der Stein in der Mauer.
Auf dem Verandaboden hatte ich die Teile meines Märklin-
Baukastens ausgebreitet und an dem Kran weitergearbeitet,
dem Bild auf der Schachtel folgend. Heute gibt es diese Art
von Baukästen bedauerlicherweise nicht mehr. Gestanzte,
schmale Stahlblechteile mit vielen Löchern und in verschiedenen
Längen ließen sich mit kleinen Schräubchen zu unglaublichen
Konstruktionen zusammenfügen. Brücken, Krane, Baumaschinen,
Lastwagen, Hochhäuser, alles konnte man bauen,
der Fantasie waren keine Grenzen gesetzt. Und die geschaffenen
Bauwerke waren stabil, man konnte sie nicht ohne Weiteres
zerstören oder zerschlagen. Bauen, auseinanderschrauben
und wieder etwas Neues bauen, das war meine Lieblingsbeschäftigung.
Plötzlich hörte ich ein tiefes, lautes, furchterregendes Grollen,
das sich wie das Brüllen eines Riesentiers anhörte. Meine
Mutter kam schreiend angerannt, packte meine gerade mit
Puppen spielende Schwester und rief gleichzeitig mir zu:
„Schnell, schnell, aus dem Haus, ein Erdbeben!“
Und schon fing das Haus zu schwanken an. Vasen fielen
von den Simsen und Fenster klirrten, als wir die Treppe ins
Freie hinabstürzten.
Und dann bebte die Erde fürchterlich. Ich meinte, dass sie
sich vor uns in einem breiten Riss öffnen müsste. Erdbebenspalten
hatte mir mein Vater auf einem Feld bei einem unserer
Spaziergänge gezeigt. Ich schaute das schwankende Haus an
und erwartete, dass es jeden Moment einstürzen würde. Aber
es hielt, und die anderen Häuser in der Nachbarschaft auch.
Nachdem die Erde aufgehört hatte zu beben, trauten wir uns
zunächst nicht, in das Haus zurückzukehren.
91
Sofie, die natürlich auch ins Freie geflüchtet war, Katharina,
Olga und Nellie waren die Ersten, die nach einer halben
Stunde bangen Wartens den Mut fanden, ins Haus zurückzugehen.
Wir folgten. An der Rückwand des Hauses hatten sich
einige der gehauenen, dicken Kalksteine um bis zu fünf Zentimeter
verschoben, und ein breiter Riss klaffte in einer Außenwand,
durch den man ins Freie sehen konnte.
Mein Vater kam mit einem Taxi vorgefahren. Er war im Büro
gewesen und legte die drei Kilometer lange Strecke jeden Tag
zu Fuß zurück. Er war erleichtert, uns unversehrt vorzufinden.
Allerdings bereiteten ihm die verschobenen Kalksteine
einiges Kopfzerbrechen, denn an eine Reparatur war nicht zu
denken, ohne dabei die ganze Wand abzutragen, was einem
Teilabriss des Hauses gleichkam.
Aber etwas anderes fiel meiner Mutter sofort auf. Sein kleiner
Finger stand im rechten Winkel nach oben.
„Was ist geschehen?“, fragte sie. „Hast du dich verletzt?“
„Als das Grollen losging“, antwortete er, „saß ich einem
arabischen Kunden gegenüber. Wir tranken Achue [starker
türkischer Kaffee], rauchten Wasserpfeife und sprachen über
belanglose Dinge, bevor wir zum eigentlichen Geschäft kamen.
Der behäbige Araber und ich sprangen gleichzeitig auf
und drängten uns durch die Tür zur Treppe. Jeder von uns
wollte natürlich, alle Höflichkeiten jetzt vergessend, zuerst
hindurch und alle stürzten dabei zusammen die Treppe hinunter.
Er kugelte mit seiner Fülle auf die Straße hinaus, während
ich versuchte, mich abzustützen und mir dabei den kleinen
Finger brach.“ Ich bemerkte, wie meine Mutter – die groteske
Situation vor Augen, wie die beiden sich gegenseitig die
Tür versperrten – kaum ein Lachen unterdrücken konnte. Und
plötzlich mussten wir alle lachen. Mein Vater hingegen fand
das gar nicht so komisch.
92
Der Täuberich
Gott segne den, der Besuche macht, und kurze Besuche.
Manchmal, wenn mir langweilig war, turnte ich auf der
hohen Mauer herum, die das Anwesen einzäunte, stieg auf
die angrenzenden Akazienbäume, saugte den Nektar aus deren
weißen Blüten und beobachtete die vielen Tauben, die auf
den Dächern turtelten und in den Schuppen um das Haus nisteten.
Das war eine großartige Sache, denn der größte und
schönste Täuberich Charlie, der sein Gefieder immer aufgeplustert
hatte, um seinem Harem zu gefallen, gehörte mir. Mir
allein. Mein Vater hatte ihn mir vor einer Woche geschenkt.
Er war gerade wieder in den Verschlag im Schuppen gekrochen.
Und dann kam Onkel Abram, der jüngere Bruder meiner
Mutter, die Straße herauf mit einem Käfig in der Hand.
„Ist dein Vater zu Hause?“
Ich rannte ins Haus, um meinem Vater Bescheid zu sagen.
Er kam herunter und begrüßte meinen Onkel. „Achlan u Sachlan.
Wie geht es dir?“ Sie begrüßten sich wie üblich auf Arabisch.
„Ich bin gekommen, den Täuberich zu holen“, sagte er. Sie
gingen zum Verschlag, schlossen die Klappe, mein Vater packte
Charlie mit beiden Händen und holte ihn heraus.
„Den kannst du für deine Zucht mitnehmen“, sagte er und
sie sperrten ihn in den mitgebrachten Käfig. Ich rannte weg
und schrie: „Das ist aber mein Täuberich. Du hast ihn mir geschenkt.
Es ist der Charlie, den kannst du nicht einfach weggeben
und weiterverschenken.“
Mein Vater sah mich verwundert an.
„Wie kann er denn dir gehören, wenn er immer nur auf dem
Dach sitzt. Du kannst doch gar nichts mit ihm anfangen. Doch
93
wenn du unbedingt einen haben willst, kannst du ja den bläulichen
Täuberich nehmen, der dort drüben auf dem Baum
sitzt.“
Ich wollte den bläulichen Täuberich natürlich nicht haben.
Den würde er sicher bei nächster Gelegenheit ebenso verschenken.
Ich war tief enttäuscht und würde die Lehre nie vergessen.
Sagt nicht ein Sprichwort: Lieber den Spatz in der Hand als
die Taube auf dem Dach?
Spurlos ging die Geschichte allerdings auch an meinem
Vater nicht vorbei. Er wollte den Vertrauensbruch mit einem
besonders schönen Geschenk zu meinem Geburtstag, der vor
der Tür stand, wieder wettmachen. Er kam mit einem kleinen
Fahrrad an, das er seiner Schwester Ida abgekauft hatte, die
verheiratet in Jaffa lebte und deren Sohn Hugo-Kunz dem
Fahrrad entwachsen war.
Mein Vater selbst konnte nicht Fahrrad fahren, wollte es mir
aber trotzdem beibringen.
Das Fahrrad war so hoch, dass meine Beine nicht zu den
Pedalen hinunterreichten. Also musste ich quer einsteigen und
das eine Bein unter der oberen Querstange zum Pedal auf der
anderen Seite hindurchschieben. Es gelang, und auf einmal
hatte ich die ersten zehn Meter geschafft.
Nach wenigen Tagen fuhr ich schon die Straße auf und ab.
Ich fuhr meinem Vater entgegen, als er nach Hause kam. Die
Straße war frisch geteert und mit scharfem Schotter übersät,
der bei dem geringen Verkehr über ein Jahr brauchte, um sich
in den Asphalt einzuarbeiten. Ich wollte ihm zeigen, wie
schnell ich fahren konnte, verlor dabei aber die Herrschaft über
das Rad. Ich schlitterte in voller Länge über den Schotter, riss
mir die Knie, Hände und Arme auf und blutete stark. Meine
Mutter war außer sich und nahm mir das Rad vorläufig mit
94
der Maßgabe weg, es erst wieder fahren zu dürfen, wenn meine
Beine zu den Pedalen reichten. Das konnte dauern!
Das war nicht der erste Unfall mit dem Rad gewesen. An
den Tennisplätzen war eine Weitsprunggrube angelegt. Sie
war mit Sand gefüllt. Ich fuhr den Hügel hinunter, um Anlauf
zu nehmen die Grube zu überqueren, lief dabei Gefahr,
die Kontrolle über das Rad zu verlieren und bremste deshalb
mit der stärkeren, rechten Hand, so stark ich konnte, bevor
ich die Grube erreichte. Es kam, wie es kommen musste. Das
Vorderrad blockierte, das Rad überschlug sich mit mir in der
Luft, ich flog in die Grube und schlug mir die Hälfte eines
Vorderzahns an einem Stein aus. Dieser Unfall hatte meine
Mutter aufgebracht, nicht nur dass ich jetzt eine unschöne
Zahnscharte hatte, sondern es stand auch ein Besuch bei Zahnarzt
Dr. Katzenellenbogen an, der in der Innenstadt wohnte und
im unteren Teil seines Hauses seine Praxis hatte. Er war ein
zuvorkommender Mann mit jiddischem Akzent.
„Er wird nachwachsen. An diesem Zahn möchte ich nichts
machen. Eine Füllung würde in deinem Alter ohnehin nicht
halten“, meinte er und strich mir mit der Hand über die Haare,
wie um mich zu trösten.
95
Der grüne, ungenießbare Frosch
Freundliche Rede lockt selbst eine Schlange aus ihrem Loch.
Entgegen landläufiger Meinung ist der Zahn im Laufe der
Jahre tatsächlich etwas nachgewachsen. Heute kann man
nichts mehr von einer Scharte erkennen. Trotzdem habe ich
eine unangenehme Erinnerung an den ungewöhnlichen Namen
Katzenellenbogen.
Meine Mutter war mit Frau Katzenellenbogen befreundet.
Sie war zum Kaffe eingeladen und nahm mich mit. In dem
mit viel Plüsch eingerichteten Wohnzimmer war der Tisch
gedeckt. In der Mitte des Tisches türmte sich eine Platte mit
Kuchen- und Tortenstücken. Die jüdische Gemeinde in Jerusalem
hatte einen anderen Geschmack als wir Templer. Die
Tortenstücke waren reichhaltig mit farbigen Cremes gefüllt,
sehr süß und meistens mit einem Zuckerguss überzogen. Sie
hatte aber auch einzelne Tortenexemplare, die Tiere darstellten.
Da war ein weißer Schwan, hier eine Katze, und als Krönung
in der Mitte ein giftig aussehender, grüner Frosch.
„Was willst du denn nehmen, mein Lieber“, fragte sie mich
freundlich. „Der grüne Frosch ist etwas ganz Besonderes. Er
gefällt dir sicher. Darf ich ihn dir geben?“
Ich nickte etwas verlegen, denn lieber hätte ich die braune
Schokoladenkatze genommen, und sie schob mir den grässlich-grünen
Frosch auf einem goldumrandeten Teller zu.
Die beiden Frauen unterhielten sich angeregt, als ich den
ersten Bissen machte. Der Frosch schmeckte fürchterlich. So
giftig, wie er aussah, so schmeckte er auch. Ich hatte gelernt,
das zu essen, was auf den Teller kam. Bis er leer war. Ich schob
den zweiten Bissen hinein. Ich würgte die grüne Masse mit
der grünen Glasur hinunter. Die zähe Masse wollte und woll-
96
te nicht rutschen. Frau Katzenellenbogen sah mein grünlich
werdendes Gesicht und fragte besorgt:
„Schmeckt der Frosch denn nicht?“
So war es, er blieb mir förmlich im Hals stecken. Ich schaute
verzweifelt zu meiner Mutter hinüber, Hilfe suchend, aber sie
lächelte nur.
„Doch, doch“, hörte ich mich zu meiner eigenen Verwunderung
sagen und machte einen verhängnisvollen Fehler, indem
ich fortfuhr:
„Ich esse nur so langsam, weil der Frosch so gut schmeckt!“
Damit hatte ich mich selbst gefangen. Ich musste das Stück
Torte bis zum letzten Bissen essen. Hatte ich nicht hinausposaunt,
dass er so vorzüglich schmecke? Mir wurde so schlecht,
dass die giftgrüne Farbe des Frosches jetzt mein ganzes Gesicht
überzog. Frau Katzenellenbogen und meine Mutter waren
indes so in ein Gespräch vertieft, dass sie nichts davon
bemerkten.
Ich hatte bei Frau Katzenellenbogen etwas gelernt. Man muss
es immer laut und ehrlich sagen, wenn einem etwas nicht
passt, auch in anderen Lebenssituationen. Man hat es dann
einfacher und muss den Frosch nicht hinunterwürgen.
97
Mein Vater wird ungarischer Honorarkonsul.
Hast du ein Geheimnis, so ist es dein Gefangener. Lässt du es
frei, so bist du sein Gefangener.
Einmal nahm mich mein Vater ins King David Hotel mit, dem
vornehmsten Hotel in Jerusalem, wo er sich mit seinem Bruder
Jona treffen wollte. Dieses in der Nähe zur Altstadt massive,
1931 von einer reichen, jüdischen Familie aus Ägypten
im gelblichen Jerusalemstein gebaute Haus beherbergte vom
ersten Tag seiner Eröffnung an prominente Gäste, wie z. B.
den abessinischen Kaiser Haile Selassie und viele andere, die
alle zu erwähnen unmöglich ist. Der griechische König George
hatte hier im Zweiten Weltkrieg seine Exilregierung eingerichtet.
Das Hotel wurde im Juli 1946, kurz vor der Gründung des
Staates Israel, Ziel eines von der jüdischen Befreiungsorganisation
Stern inszenierten Bombenanschlags, der den Engländern
galt, die ihr Hauptquartier auch in dieses Hotel verlegt
hatten. Und bis heute ist das King David Treffpunkt für Politiker
aus aller Herren Länder geblieben, die um die Befriedung
des Nahen Ostens ringen.
Das war der Ort, den Jona für das Treffen mit meinem Vater
ausgewählt hatte. Jona hatte eben seine Eigenheiten. Er
besuchte uns kaum einmal zu Hause. Vielleicht verhielt er sich
immer noch meinem Vater gegenüber reserviert wegen der
vorhergegangenen Liebschaft meines Vaters mit seiner Tochter
Liselotte.
Der Name Kuebler hatte durch Jona in Palästina einen internationalen
Ruf gewonnen. Jona war der dienstälteste Konsul
im Land. Die ungarische Regierung bot meinem Vater vielleicht
aus diesem Grund die konsularische Vertretung für die
nicht allzu vielen in Palästina lebenden Ungarn an. Das war
98
mit dem Titel eines Honorarkonsuls verbunden. Das Angebot
kam völlig überraschend für ihn, da er nicht Ungar, sondern
Deutscher war.
Für die ungarische Regierung waren aber auch seine vielen
Verbindungen, die er in Palästina hatte, und die Kenntnis des
Landes und die Beherrschung der arabischen Sprache entscheidend.
Er hatte das Angebot angenommen und wollte die
Neuigkeit seinen Bruder wissen lassen. Seine Gründe für die
Annahme waren einleuchtend. Der Touristenstrom von
Deutschland ins Heilige Land war durch die Unruhen zwischen
Juden und Arabern fast zum Erliegen gekommen und
die großen Schiffe blieben aus. Das Kueblers Tourist and Travel
Office machte nicht mehr die gewohnten Umsätze. Die Konsulatsführung
war mit einer gewissen zusätzlichen Dotierung
verbunden und würde auch sicher einen neuen Kundenkreis
erschließen.
Gesellschaftlich war der Aufstieg verlockend. Er war jetzt
in gleicher Augenhöhe mit seinem Bruder. Er war so weit gekommen,
ohne den Vorteil eines vorherigen Studiums wie Jona
gehabt zu haben.
Aus der Gestik meines Onkels bei dem Treffen glaubte ich
schließen zu können, dass ihm diese Neuigkeit nicht sonderlich
behagte. Doch er rang sich offenbar dazu durch, mit Blick
auf mich als dem einzigen Kuebler Stammhalter, meinem Vater
zu gratulieren und ihm einige Ratschläge auf den Weg zu
geben.
Mit Fleiß, Eifer und Ausdauer hatte sich mein Vater aus eigenen
Kräften, sozusagen als Selfmademan, an die gesellschaftliche
Spitze Jerusalems geschoben. Mein Vater war jetzt
Königlicher Ungarischer Honorarkonsul und seine Akkreditierungs-Urkunde,
die er in seinem Alter eingerahmt über seinem
Schreibtisch aufgehängt hatte, war vom englischen Kö-
99
nig George IV. und dem seinerzeit amtierenden englischen
Außenminister Eden unterschrieben. Ich glaube, dass dies im
Jahr 1937 geschehen war.
Garten Gethsemane mit den alten Olivenbäumen. Mein Vater meinte,
dass einige davon über 2000 Jahre alt sein könnten.
100
Eine Gartenparty für die Diplomaten
Neid zertrümmert die Dachbalken.
Meine Mutter war jetzt ganz in ihrem Element. Mit einem
ihr eigenen Charme überzeugte sie meinen Vater, zur Inauguration
die Diplomaten Jerusalems zu einer Gartenparty einzuladen.
Wie fast in jedem Land in der ersten Hälfte des 20sten Jahrhunderts
gab der französische Konsul den gesellschaftlichen
Ton unter den akkreditierten Diplomaten an, dicht gefolgt vom
englischen und amerikanischen Konsul. Der englische Konsul
fiel natürlich für Palästina aus, weil Palästina englisches
Mandatsgebiet war und vom High Commissioner im Auftrag
der englischen Krone regiert bzw. verwaltet wurde.
Lampionketten zogen sich in unserem Garten von Pinienbaum
zu Pinienbaum. Eingedeckte Tische mit blütenweißen
Decken standen unter den hohen Bäumen. Ein am Rande aufgebautes
Buffet war mit einheimischen Köstlichkeiten gespickt,
aber auch die deutsche Küche kam nicht zu kurz.
Fast alle geladenen Gäste waren mit ihren Frauen gekommen.
Sogar der High Commissioner. Die Straße vor dem Haus
war von englischen Soldaten bewacht und im Hinterhof hatten
sich ebenfalls einige postiert. Eine Musikkapelle war engagiert,
die zum Tanz aufspielte. Münchner Bier vom Fass
wurde ausgeschenkt und dazu Weißwürste gereicht. Viele der
Diplomaten stürzten sich auf diese deutschen Spezialitäten, die
in Palästina nicht überall zu haben waren.
Ich glaube, mich erinnern zu können, dass mich der amerikanische
Konsul in gebrochenem Deutsch nach den Waschräumen
fragte. Der Weg führte die Treppe hoch durch die
verglaste Veranda über den Steg zur Toilette.
Mein Vater hatte auf dem stillen Örtchen eine große Welt-
101
karte aufgehängt, die zwei Meter breit und so angeordnet war,
dass sie einem beim Sitzen direkt in die Augen stach. So hatte
ich manchen Namen mit meinen noch unvollkommenen Lesefähigkeiten
mühsam entziffert und einige Namen hatte mir
meine Mutter auch vorgesagt.
Der Konsul kam aus dem Örtchen heraus und fragte mich:
„Kannst du mir Amerika auf der Karte zeigen?“ Ich deutete
darauf. „Und Palästina?“ – „Hier ist Jerusalem und das hier
das Tote Meer“, sagte ich nicht ohne einen gewissen Stolz. Er
erwiderte: „Very well, my boy. Du wirst einmal ein großer Diplomat
werden. Schade, dass du kein Amerikaner bist.“ Wenn
er gewusst hätte, dass mein Vater einmal einer war, und ich
beinahe einer geworden wäre!
Diese Angewohnheit meines Vaters habe ich in meinem späteren
Leben fortgeführt. Wenn ich etwas intensiv lernen wollte,
heftete ich den entsprechenden Text, die Grafik, Karte oder
Tabelle an die Wand in der Toilette. So lernte ich spielend das
Periodensystem der chemischen Elemente auswendig, die
Hauptregeln im Bridge, doch den größten Effekt konnte man
doch mit Landes- oder Weltkarten erzielen. Man wurde einfach
nicht müde, in Gedanken dahin zu fahren, wohin man
wollte.
102
Yachia, der stärkste Träger Jerusalems
Meine Familie bleibt meine Familie, auch wenn sie meinen Rücken
bricht.
Yachia war die ganze Zeit über auch mit von der Partie. Er
hatte seine besten Hosen an, natürlich Pumphosen in Schwarz,
und ein weites, weißes Hemd. Er sah richtig gut aus. Überall,
wo man ihn auf der Party brauchte, sprang er ein.
Mein Vater hatte mir erzählt, dass er der stärkste Träger
Jerusalems sei. Was gibt es denn so Schweres zu tragen?, wagte
ich zu fragen. Doch ich sollte bald Gelegenheit bekommen,
selbst zu sehen, was er zu leisten imstande war.
Die Party war vorbei und schon fast vergessen. Ein Lastwagen
fuhr vor. Er hatte ein neues Klavier geladen, das mein Vater
von Deutschland hatte kommen lassen. Drei Träger waren
dabei. Sie sollten das Klavier ins Musikzimmer bringen. Doch
Yachia schob sie weg. „Ich mache das allein.“
Meine Mutter protestierte vergeblich. Sie hatte Angst, dass
er sich das Rückgrat brechen könnte.
Er schlang den breiten Gurt um das Klavier. Die Helfer hievten
das Instrument auf seinen Rücken. Ganz langsam stieg er
die Steintreppe hoch, Schritt für Schritt, zur Veranda. Das
ganze Gewicht des Klaviers musste beim Hochgehen von Stufe
zu Stufe auf einem seiner Beine lasten. Sie kamen mir so dünn
vor und ich fürchtete, dass sie einfach einknicken könnten.
Weiter führte sein Weg ins Musikzimmer. Langsam ließ er es
vom Rücken hinunter in die Hände der Helfer gleiten. Als es
auf seinen Rollen stand, wischte er mit seinem Handrücken
die Schweißperlen von seiner Stirn ab und schaute mich triumphierend
an. „Bin ich nicht der stärkste aller Träger in Jerusalem?“
„Ja, du bist der Stärkste“, rief ich begeistert und stolz zu
103
gleich, weil der stärkste Mann von Jerusalem, ja vielleicht von
ganz Palästina, mein Freund war und für meinen Vater arbeitete.
Dann sagte er etwas, dessen Bedeutung ich damals nicht
ganz verstand: „Das Kamel trägt Zuckerrohr und bekommt
doch nur die Dornen zu fressen.“
Ansicht von Alt-Jerusalem
104
Ein Einbrecher
Es ist besser, ein freilaufender Hund zu sein als ein angebundener
Löwe.
Es war kurz vor dem Mittagessen. Meine Mutter war in der
Küche damit beschäftigt, ein Kusagemüse zu kochen. Das ist
ein arabisches Gericht mit Zucchini, Auberginen und Tomaten.
Dieses Gemüse wird zu gleichen Teilen in Scheiben geschnitten,
zugegeben wird dann angebratenes Hackfleisch,
Zwiebelscheiben, ein Schuss Essig, etwas Olivenöl, Pfeffer,
Salz, eine halbe, fein geschnittene Knoblauchzehe und etwas
Sojasoße. Alles zusammen wird etwa eine Stunde lang gekocht.
Das heiße Kusagemüse wird zu dampfendem, weißem Reis
gereicht. Damals wie heute ist das eines meiner Lieblingsgerichte.
Als Nachspeise sollte es Wassermelonen geben. Meine Mutter
erklärte mir, dass man beim Kauf auf den Stiel der Melone
achten müsse. Ist er abgetrocknet, ist die Melone reif und süß.
Die Melonenschnitze standen am offenen Fenster. So kühlten
sie durch Verdunstung im Luftzug ab, wie auch der mit Wasser
gefüllte Tonkrug, der danebenstand.
Sie ging ins Esszimmer, um den Tisch zu decken. Ich war in
der Küche, als ich hörte, wie Porzellan auf dem Steinboden
zerschellte, und danach gellte ein fürchterlicher Schrei, der
von meiner Mutter kam. Als ich auf den Gang stürzte, überrannte
mich ein junger Araber mit einem blitzenden Messer
in der Hand und stürmte über die Veranda ins Freie.
Er wird doch nicht meiner Mutter etwas angetan haben! Im
Esszimmer stand meine Mutter wie versteinert da, alles Blut
war aus ihrem Gesicht gewichen, unfähig irgendetwas zu sagen.
Aber sie war unverletzt.
Der junge Einbrecher war an der Dachrinne hochgeklettert,
105
hatte einen Fensterladen gepackt und war durch das geöffnete
Fenster eingestiegen. Er stand plötzlich drohend meiner
Mutter gegenüber.
Sie hatte sich nie von diesem Schock erholt, hatte viele Jahre
danach Angstträume, immer die dunkle Gestalt mit dem
scharfen Messer in der Hand vor Augen. Welch psychologische
Langzeitschäden Einbrecher anrichten können!
106
Ich lernte eine Lektion.
Das beste Erbe, das du einem Sohn hinterlässt, ist, wenn du ihm
jeden Tag ein paar Minuten widmest.
In späteren Jahren erinnert man sich zwar daran, dass man
von seinem Vater (oder auch seiner Mutter) eine Strafe erhalten
hatte, aber meistens nicht mehr für deren Anlass.
Jedenfalls meine ich, und so geht es vielen anderen auch,
dass sie zu Unrecht gegeben wurde. Man hatte sie nicht verdient
gehabt! Irgendetwas musste ich wohl angestellt haben.
Mein Vater kam vom Geschäft nach Hause.
„Siegfried“, rief er, „komm sofort her!“
Ich ahnte Böses und rannte ins Esszimmer. Er hinterher. Als
er die Türklinke niederdrückte, drehte ich den Schlüssel um.
Er rüttelte an der Klinke.
„Mach sofort auf. Dir werde ich schon zeigen, was Sache
ist!“, schrie er und seine Wut steigerte sich zusehends. Meine
Angst vor ihm nahm im gleichen Maß zu wie seine Wut. Ich
dachte nicht daran aufzuschließen. Er rannte wie ein verwundetes
Tier vor der Tür hin und her und stieß dabei furchterregende
Drohungen aus.
Plötzlich war es ganz still. Ich hörte, wie er auf leisen Sohlen,
was ihm in seiner Erregung nicht ganz glückte, ins Musikzimmer
schlich, um durch die zweite nicht abgeschlossene
Tür ins Esszimmer zu gelangen. Als er die Klinke drückte,
schloss ich ab.
Plötzlich änderte sich sein Ton. Er versuchte mit verstellter,
ruhiger Stimme auf mich einzureden.
„Wenn Du jetzt die Tür aufschließt, verspreche ich dir, dass
dir nichts geschehen wird. Wir werden die Sache ganz ruhig
besprechen, wie es sich unter Männern gehört.“
107
Mein Vater mit Mandoline ca. 1925
Meine Eltern mit mir 1932
Aufnahme von ca. 1937
Aufnahme von ca. 1937
Teppenaufgang,
heute Cremieux St. No. 8,
damals Seestraße 8
108
Auf einem Ausflug
zum
Katamon mit der
arab. Haushilfe
und Yachia,
ca. 1935
Weihnachten im
Vaterhaus
ca. 1936
Besuch in
Ägypten
ca. 1937
109
Ich war nicht sicher, was ich machen sollte, und sagte einfach:
„Ehrenwort?“
„Ja“, sagte er, „du kannst dich auf mich verlassen“, wobei
er das Ehrenwort tunlichst vermied, was ich damals natürlich
nicht registrierte.
Schließlich, ihm vertrauend, schloss ich auf.
Er packte mich und verabreichte mir eine Tracht Prügel, die
erste und die letzte, die ich jemals von ihm bekommen habe,
so lange, bis meine Mutter einschritt und rief:
„Willst du den Jungen umbringen?“
Ich hatte eine Lektion gelernt, die ich für mein ganzes Leben
brauchen konnte. Sie war aber eine andere als die, die mit
der Strafe bezweckt war. Traue keinem Versprechen. Niemals.
Auch nicht dem deines Vaters.
Wie war es doch mit der Erziehungsmethode eines Armeniers
gewesen?
Er hatte zu seinem Sohn gesagt: „Bist du so mutig, um von
dem Schrank zu springen? Ich fange dich in der Luft auf!“
Der Junge stieg auf den Schrank und sprang, natürlich seinem
Vater vertrauend. Der Vater wich aber zur Seite aus und
ließ den Jungen platt auf den Boden fallen, der sich dabei die
Nase wund schlug. Der Junge sah seinen Vater verwundert
an und rief:
„Warum hast du mich nicht aufgefangen, wie du versprochen
hattest?“
Der Armenier schaute ihn ruhig an und erwiderte:
„Du solltest lernen, niemandem zu trauen, auch deinem eigenen
Vater nicht.“
110
Die blauen Nonnen
Ich weinte, weil ich keine Schuhe hatte, da sah ich einen Mann,
der hatte keine Füße!
Meine Mutter sagte eines Morgens zu uns Kindern:
„Heute werden wir euren Vater im Büro besuchen und anschließend
in die Altstadt gehen. Wir werden für dich, mein
Sohn, ein Hemd und eine Hose kaufen und für dich, Gisela,
ein Kleidchen.“
Der blaue Himmel spannte sich über Jerusalem, die Temperatur
war angenehm, die Luft war kristallklar. Wir nahmen
den Bus. Im Büro hatte mein Vater nur wenig Zeit für uns. Er
hatte Kunden zu betreuen.
Doch er ließ uns, auf unsere drängenden Bitten hin, die Leiter
zum Dachgeschoss über den Büroräumen hinaufsteigen.
Es war vollgestopft mit Warenmustern von den vielen Firmen,
die mein Vater vertrat. Da waren Puppen mit eingestanzten
Löchern, sodass sie nicht als neu weiterverkauft werden konnten.
Unzählige Schuhe mit ausgestanzten Löchern in den Sohlen.
Immer nur rechte oder linke. Ein passendes Paar konnte
man nicht finden. Farbige Postkarten en mass. Spazierstöcke
mit Perlmutt eingelegten Griffen, bei denen die Spitzen abgeschraubt
waren. Auch die unterschiedlichsten Spiele in Kartons,
kurzum so viele schöne Sachen, dass man als Kind auf
diesem Speicher Stunden hätte zubringen können. Manche
Dinge, die uns besonders gefielen, wollten wir nach Hause
nehmen, doch er ließ dies nicht zu.
In meiner Fantasie wuchs dieses geheimnisvolle, nicht erforschte
Warenlager in den kommenden Jahren weiter an. Es
wurde zu einer Art Schatzkammer, in der man alles finden
konnte, was man wollte, wenn man nur lange genug suchte.
So stellte ich mir die Schatzkammer in der Geschichte von Ali
111
Baba und die vierzig Räuber aus Tausend und einer Nacht vor.
Meine Mutter hatte uns das Märchen vor wenigen Tagen vor
dem Einschlafen vorgelesen.
Meine Mutter nahm uns an die Hand und führte uns nach
dem erfolglosen Durchstöbern des Dachbodens durchs Jaffator
in die Innenstadt. Es wimmelte geradezu vor Menschen. Es
war bunt und laut. Fellachen mit rot-weißen Kopftüchern,
Juden mit einer runden Kippa, Araber mit einem
quadratischen, weiß-schwarzen Tuch auf dem Kopf – Kefije
genannt –, griechisch orthodoxe Geistliche, Blinde in Lumpen,
die um Almosen bettelten und Araber in europäischen
Anzügen mit einem roten Fes als Kopfbedeckung.
Wir kamen an einer Mauer vorbei, über die man in ein umzäuntes
Tal blicken konnte. Dort unten sah man Menschen,
die humpelten, denen Gliedmaßen fehlten und die alle in Lumpen
gekleidet waren.
„Dies sind die Ärmsten der Armen“, sagte meine Mutter.
„Es sind Aussätzige, die das Tal nicht verlassen dürfen. Sie
haben eine Krankheit, die sehr ansteckend ist: Lepra. Ihre Gesichter
sind oft entstellt. Ihre Arme und Beine faulen ab, bis
sie daran sterben. Sie leben von Almosen, von Essen, das von
Vorbeigehenden hinuntergeworfen wird. Manchmal sind
auch Münzen dabei.“
Beim Anblick dieser armen verstümmelten Menschen wurde
mir schwindlig. Ich hielt meine Augen zu, um dieses Elend
nicht anschauen zu müssen. Nur schnell weg von dieser Mauer,
von diesem Anblick, von diesem Geruch der Fäulnis, der
heraufdrang!
Wir gingen weiter, bis wir an das Geschäft des Juden kamen,
der Kinderkleidung verkaufte. Ich bekam eine schicke
Kakihose und ein rotes Hemd. Das hatte ich mir schon immer
gewünscht, da Rot schon damals wie heute noch meine Lieb-
112
lingsfarbe ist. Ich durfte beides auch sogleich überstülpen. Mit
meinem eigentlich viel zu großen Korkhelm, original englischer
Machart, musste ich lustig ausgesehen haben. Nun ging
es wieder zurück zum Jaffator. Überall waren Kirchen. Manche
davon versteckt in den vielen Gassen, von außen oft nicht
als Kirche oder Kloster auszumachen.
Meine Mutter zeigte auf eine Steintreppe, deren ausgetretene
Stufen zu einem offen stehenden Portal nach unten führten.
„Das ist der Orden der blauen Nonnen“, erklärte sie uns
bedeutungsvoll und sagte uns auch den richtigen Namen, den
ich allerdings nach so langer Zeit vergessen habe. Wir standen
im rückwärtigen Teil des Gewölbekellers. Um den in der
Mitte stehenden Altar, der mit vielen Kerzen beleuchtet war,
gruppierten sich kniende, betende Nonnen in leuchtenden
blauen Gewändern, die Hände gefaltet, den Kopf gesenkt.
Unbeweglich. Starr. Es roch nach verbranntem Wachs und
Weihrauch.
„Wie lange müssen sie beten?“, fragte ich flüsternd meine
Mutter.
„Den ganzen Tag mit wenigen Pausen zum Essen“, erwiderte
sie genau so leise, wie ich gesprochen hatte. Ich fror. Den
ganzen Tag beten? Mein kurzes Gebet am Abend erschien mir
schon zu lange. Wie lange war dann ein ganzer Tag? Unendlich
lange! Auf den Knien. Kein draußen, keine frische Luft,
keine Sonne, kein Gespräch, kein Gegenüber.
„Das ist ein strenger Orden“, fuhr meine Mutter fort, als sie
mein Gesicht sah. „Nicht alle Orden sind so.“
„Wie viele Tage müssen sie beten?“, wollte ich wissen.
„Solange sie leben, für immer“, war ihre Antwort.
Seither haben die Worte für immer eine schreckliche Bedeu-
113
tung für mich erlangt. Ich sehe die blauen Nonnen vor mir auf
den Knien, unbeweglich, wie gehauene kalte Steine.
Nein, eine Nonne oder ein Mönch in einem solchen Orden
wollte ich nie werden. Und ein Gedanke durchzuckte mein
Gehirn, den ich allerdings nie aussprechen dürfte: Lieber würde
ich bei den Aussätzigen leben, einer von ihnen sein, als in
diesem kalten Keller den ganzen lieben Tag über als Nonne
oder Mönch beten! Für immer!
Noch in trüben Gedanken verloren schlenderte ich neben
meiner Mutter her. Ich ging auf der Straße, sie und meine kleine
Schwester auf dem schmalen Gehweg. Das Jaffator war in
Sichtweite.
Plötzlich kam Bewegung in die Menschen. Schreiend stoben
sie auseinander. Ein Stier mit gesenkten Hörnern hatte
sich losgerissen und galoppierte die Straße hinauf in unsere
Richtung. Er erblickte mich. Das rote Hemd! Er stürmte auf
mich zu. In Panik wollte ich wegrennen. Nonnen und Aussätzige
waren vergessen. War es schon zu spät? Ich sah mich
schon aufgespießt auf seinen Hörnern.
Ein Araber packte mich im letzten Augenblick und zerrte
mich in einen schützenden Hauseingang. Der Stier raste mit
glasigen, wilden Augen vorbei. Meine Mutter schrie. Meine
Schwester weinte. Der Araber lachte mich aber an. Ich fiel ihm
um den Hals. „Allah Akbar“, sagte er, drehte sich um und ging
seines Weges, ohne dass meine Mutter sich bei ihm bedanken
konnte.
Alle diese Eindrücke und Erlebnisse an einem Tag! Zu viele
für einen Bub. Der Stier war weg und das Leben in der Straße
verlief wieder in seinen gewohnten Bahnen. Wir erreichten
den Bus, der uns zurückbrachte.
114
Unruhen in Jerusalem
Das Brot des Satten kommt für den Hungrigen zu spät.
Die Unruhen in Jerusalem nahmen von Tag zu Tag zu. Menschen
wurden auf den Straßen erschossen und erstochen. Die
Engländer reagierten darauf mit harten Strafen. Gefasste Terroristen
wurden gehängt, meistens öffentlich. Dann führten
sie eine Ausgangssperre, auf Englisch Curfew genannt, für die
Nacht nach 18:00 Uhr ein. Sirenen heulten auf, und die Straßen
waren leer gefegt, bis auf patrouillierende Soldaten in
Militärfahrzeugen.
In der Kolonie merkten wir weniger von den Unruhen, doch
ich entdeckte immer wieder flachköpfige Nägel auf der Hauptstraße,
die beim Hinwerfen auf dem Kopf zu stehen kamen
und die Reifen der Fahrzeuge zum Platzen brachten. Puncture
nannten die Engländer das. So hatte auch ich mit meinem
Fahrrad einen Platten bekommen.
Wir beobachteten auch, wie Draisinen einige Hundert Meter
vor den Zügen herfuhren, auf denen arabische Freischärler
angekettet waren. Dadurch sollten Sprengstoffanschläge
auf die Züge und Beschädigungen an den Schienen verhindert
werden, die zum Entgleisen der Züge führen konnten. Die
Draisine würde zuerst in die Luft fliegen und der angekettete
Araber, ein zumeist wegen Terroranschlägen zu einer langen
Freiheitsstrafe oder schon zum Tod Verurteilter, verletzt oder
getötet werden. Die Anschläge auf die Züge blieben in Folge
aus.
Als Jugendliche waren wir ganz versessen darauf, uns die
Nummern der eingesetzten Lokomotiven zu merken. Die
Nummer 1 war häufig eingesetzt. Aber die Nummer 13 hatte
erst einer gesehen. Keine der Lokomotiven hatte eine höhere
Nummer als 18. Wir saßen dazu stundenlang auf der Schul-
115
hofmauer gegenüber dem Bahnhof, von wo wir eine gute Übersicht
über die Zugbewegungen hatten, aber auch der Bahnübergang
am Ende der Kolonie, nicht weit vom Friedhof der
Templer, der bis heute unversehrt besteht, war ein guter Beobachtungspunkt.
Nicht weit davon war Onkel Abram Dycks Haus an der Kreuzung
der Straßen Masaryk und Smats. Hans Werner, mein etwa
gleichaltriger Vetter, Sohn von Abram, war fast immer mit
von der Partie. Als wir nach einer erfolglosen Beobachtung
zu ihm nach Hause gegangen waren und von seiner Mutter
Friedel eine Limonade bekamen, fand ich im Garten im Sand
eine schwarze, kleine Scheibe, die sich bei näherem Hinsehen
als eine alte Münze herausstellte. Hannelore und Peter, die
jüngeren Geschwister von Hans Werner, rannten gleich zu
ihrem Vater und riefen: „Papa, Papa, Siegfried hat eine wertvolle
Münze in unserem Garten gefunden!“ Onkel Abram war
sofort da und betrachtete sie aufmerksam.
„Die ist uralt“, meinte er. „Die ist bestimmt viel wert. Sie
war auf unserem Grundstück und deshalb gehört sie auch
uns!“
Ich war den Tränen nahe. Ich hatte sie doch gefunden. Sie
gehörte mir ganz allein. Er hatte mir schon den Charlie gestohlen.
Und jetzt auch noch die Münze? Das war zu viel!
„Darf ich sie noch einmal sehen?“, fragte ich ihn so unauffällig
wie möglich. Er gab sie mir. Ich steckte sie schnell in die
Hosentasche und rannte weg, so schnell ich konnte, bis ich zu
Hause war und die unglaubliche Geschichte meiner Mutter
erzählen konnte.
„Du kannst die Münze behalten. Ich werde mit meinem Bruder
sprechen“, sagte sie mit festem Ton, der keine weiteren
Zweifel aufkommen ließ.
Wo sie geblieben ist? In den Wirren der nachfolgenden
116
Kriegsjahre ist sie verloren gegangen. Vielleicht war sie sogar
eine der uralten Münzen mit einer eingeprägten Lilie und einem
Falken, die 350 Jahre v. Chr. in Jerusalem im Umlauf
waren und von der ich schon berichtet hatte?
Die linke Seite zeigt einen Falken mit ausgestreckten Flügeln mit
dem Kopf nach rechts gewandt. Die weiße Lilie, auf der rechten
Abbildung zu sehen, ist bis heute das Symbol der Reinheit geblieben.
„Ich werde für Israel sein wie der Tau. Blühen soll es wie die
Lilie, und Wurzel schlagen wie der Libanon ...“ (Hosea 14,6).
Sie kommt heute noch selten als Wildpflanze in Galiläa und an
den Berghängen des Carmels vor, doch sie soll im Altertum in Israel
weit verbreitet gewesen sein. Ihre Duftstoffe waren als Parfüm
begehrt. Die Inschrift auf der Münze ist in Alt-Hebräisch abgefasst.
Die Lilie gilt als Wahrzeichen Israels, insbesondere aber Jerusalems.
Sie hat sechs zarte Blütenblätter und sieht von oben betrachtet
wie ein Stern aus. Hieraus leitet sich das sechseckige Symbol
der Juden ab: zwei sich überschneidende Dreiecke. Eines der bekanntesten
Symbole der Welt, das schon über drei Jahrtausende
besteht.
117
Tante Kea
Ein Haus ohne Nachbarn ist 1.000 Denare wert.
Meine Mutter kam aufgeregt auf die überdachte und verglaste
Terrasse, wo Gisela und ich gerade spielten, und rief:
„Kinder, morgen fahren wir ans Meer auf den Bauernhof
Neuhardthof von Tante Kea und Onkel Hans [Nachname
Hermann]. Onkel Abram hat ein größeres Auto gemietet. Hans
Werner und Hannelore kommen mit.“ Abram war der zwei
Jahre jüngere Bruder meiner Mutter und Tante Kea ihre fünf
Jahre ältere Schwester. Mein Vetter Hans Werner war einige
Monate jünger als ich und meine Cousine Hannelore etwas
jünger als Gisela. Wir waren in unserem Leben erst einmal
am Meer gewesen, und zwar am Strand bei Tel-Aviv. Das
Meer hatte eine ungeheure Faszination auf mich ausgeübt,
nicht nur wegen des Badens, sondern war wegen seiner Weite
mit meiner Vorstellung verbunden, dass es unendlich ist, nie
aufhörte, auch nicht, wenn man es mit einem Schiff befahren
würde. Meine Mutter hatte uns natürlich auch von dem Hof
erzählt, dass es dort Pferde gäbe, Maultiere, Esel, Kühe, Schweine,
Schafe, Ziegen, Hühner und auch Hasen. Das würde ein
Erlebnis geben. Vielleicht durfte ich sogar auf einem Pferd reiten!
Aufgeregt und voller Erwartungen stiegen wir am nächsten
Morgen in das vorgefahrene Auto ein. Zuerst waren die
Straßen noch asphaltiert, doch die gingen dann in staubige
Schotterstraßen über, bis wir dann nach mehreren Stunden
Fahrt in einen schmalen Feldweg einbogen, an dessen Ende
der Hof lag. Wie ich bei meinen späteren Recherchen für dieses
Büchlein herausfand, musste das die Siedlung „Neuhardthof“
sein, die von den Templern 1892 gegründet worden war.
Doch von einer „Siedlung“ konnte keine Rede. Ich kann mich
118
nur an das Wohngebäude mit den darum herum angeordneten
Stallungen erinnern.
Tante Kea, die mit vollem Namen Cornelia hieß, stürmte
auf das Auto zu, als es in den Hof einfuhr. Die Geschwister
hatten sich schon längere Zeit nicht gesehen und umarmten
sich innig. Keas blaue Augen strahlten vor Freude an diesem
heißen Augusttag, der keine Wolke am Himmel zuließ. Obwohl
sie erst etwa 43 Jahre alt war, konnte sie sich schlecht
bewegen, ihre körperliche Fülle gestattete das nicht. Sie war
nicht besonders groß und ihr Bubikopfschnitt machte sie optisch
noch kleiner als sie schon war. Onkel Hans sei im Kuhstall,
meinte sie. Eine Kuh kalbe gerade. Sie reichte uns Kindern
kalte Zitronenlimonade. Doch wir waren nicht mehr zu
halten, ließen die Limonade stehen. Wir rannten zu den Stallungen
und sahen das zarte Kalb, noch nass von der Geburt,
auf dem strohbedeckten Boden liegen. Aus der Kuh sei es herausgekommen,
erklärte meine Mutter, die auch herbeigeeilt
war. Aus dem Bauch der Kuh? Ich konnte das nicht glauben.
Es versuchte immer wieder, aufzustehen. Die Kuh leckte es,
wie um es zu ermuntern, die Versuche nicht einzustellen.
„Lasst dem Kalb noch etwas Zeit“, sagte Onkel Hans mit
einer tiefen Bassstimme, die uns erschrocken hätte, wenn er
dabei nicht so breit gelacht hätte.
„In einer halben Stunde steht es auf seinen Beinen.“ Er hatte
ein rotes Gesicht, als ob sein Blutdruck bei 180 stehen geblieben
wäre. Seine Körperfülle stand in nichts der von Tante
Kea nach. Groß war er auch. Ein ungepflegter Schnauzer hing
ihm unter den Lippen, tiefblaue Augen darüber. Seine schwarzen
Reitstiefel waren mit Kuhmist verschmiert.
„Kommt erst einmal ins Haus“, bestimmte er.
„Eure Tante hat für euch eine Zitronenlimonade vorberei-
119
tet und Wassermelonenschnitze kalt gestellt. Das ist das Beste
gegen den Durst bei dieser Hitze.“
Er schob uns mit diesen Worten die weinigen Steinstufen
hinauf, die in der Bauernstube endeten. Wir bekamen auch
einige Butterbrote zu essen, die Tante Kea aus selbst gebackenem
Brot vorbereitet hatte.
Ein Pferdewagen von einem der angestellten Araber geführt,
fuhr in den Hof ein. Er war voll beladen mit Wassermelonen.
Riesige runde Melonen! Größer als Fußbälle. Tante Kea sah
meinen Blick und erläuterte:
„So große Melonen wie dieses Jahr hatten wir noch nie gehabt.
Wir hatten eine Melone mit sage und schreibe einem
halben Meter Durchmesser.“ Und sie zeigte mit ausgestreckten
Armen an, wie groß sie war, weil sie nicht wusste, ob ich
ermessen konnte, wie groß ein halber Meter war.
Dann zog es uns zum Strand, der nur etwa 600 Meter entfernt
war. Ein breiter Sandstrand. Wir stürzten uns ins Wasser,
obwohl wir nicht schwimmen konnten. Meine Mutter rief
aufgeregt:
„Nur am Rand bleiben, um Gottes willen nicht hinausgehen!“
Zum ersten Mal in meinem Leben sah ich meine Mutter
im Badeanzug. Wie komisch sie aussah! Gar nicht wie meine
Mutter.
Schreiend stürzte Hans Werner aus dem Wasser. Auf seinem
Rücken hatte sich eine Qualle festgesaugt. Sie ließ sich
nicht entfernen. Wir rannten alle zum Bauernhof. Ein Araber
wollte schon ein Eisen glühend machen. Das würde helfen,
die Qualle könne die Hitze nicht ertragen und lasse sofort los.
Hans Werner hatte aber Glück. Sie ließ von selbst los und fiel
zu Boden in den Sand. Zurück blieb auf seinem Rücken ein
großer roter Fleck, der höllisch brennen musste.
In späteren Recherchen habe ich herausgefunden, dass die
120
bewirtschaftete Fläche um den Hof etwa 128 Hektar betragen
hat (Bundesministerium für Justiz BGBl. I 1965, 201 – 205).
Kea und Hans hatten 1921 geheiratet. Sie hatten dann den
Hof gekauft und bewirtschaftet. Durch harte gemeinsame
Arbeit, einer war auf den anderen angewiesen, stellte sich
schließlich ein bescheidener Erfolg ein, der ihnen ein Auskommen
sicherte. Sie konnten zu dem Leidwesen beider keine Kinder
bekommen.
Das besinnliche Leben, das die beiden auf dem Neuhardthof
führten, sollte ein jähes Ende nehmen. Hans deutete die
Zeichen der Zeit auf seine Weise. Kurz vor Ausbruch des Krieges
brach er nach Deutschland auf. Er wollte dabei sein, um
sein deutsches Vaterland zu verteidigen. Wenn ich mich richtig
erinnere, war er in jungen Jahren bei der Kavallerie gewesen.
Der Krieg brach los, Hans war weg und Tante Kea kam in
ein Internierungslager, ich glaube in die Templersiedlung nach
Wilhelma, das von den Engländern in ein Internierungslager
umfunktioniert worden war. Sie kam bei dem ersten Gefangenenaustausch
im Dezember 1941, den die Engländer organisiert
hatten, in Stuttgart an. Ihr Herz schlug bis zum Hals,
denn sie hatte ihren heiß geliebten Mann und Kamerad, ihren
Hans, über zwei Jahre lang nicht gesehen. Sie hatte in diesen
zwei nicht zu Ende gehen wollenden Jahren Briefe von ihm
erhalten. Er nannte sie darin mit ihrem Kosenamen. Er vermisse
sie. Er habe eine Wohnung. Zur Front war er wegen seines
Alters noch nicht eingezogen worden. Er redete von Liebe.
Jetzt nur noch einige Minuten, der Zug fuhr gerade in den
Hauptbahnhof in Stuttgart ein, und sie würde ihren geliebten
Hans in ihren Armen halten. Sie kämmte vor dem Handspiegel
nochmals ihre kurzen Haare, sprühte noch etwas 4711,
121
122
Hans und Kea Hermann, Neuhardthof
das sie für diesen Moment die ganze Zeit über in der Gefangenschaft
bewahrt hatte, in ihr Gesicht.
Sie sah ihn am Bahnhofsteg stehen, als der Zug aus Wien
holpernd in den Bahnhof einfuhr. Sie sprang aus dem Zug, so
gut es ihre Körperfülle zuließ mit dem kleinen Köfferchen in
der Hand, das ihre ganze Habe enthielt, die sie mitnehmen
durfte. Er hatte eine Wehrmachtsuniform an. Er war schlanker
geworden, sah mit seinem jetzt gepflegten Schnauzer blendend
aus. Sie wollte auf ihn zuspringen, doch er wich einen
Schritt zurück. Erstaunt schaute sie ihn an.
„Ich habe eine andere Frau gefunden“, stand in seinem Blick
und dann sagte er auch diesen fürchterlichen Satz.
„Ich liebe eine andere. Ich habe das nicht gewollt, dass eine
andere Frau in mein Leben tritt. Es ist einfach passiert. Wir
leben zusammen. Du kannst bei mir nicht wohnen. Doch im
Ausländerheim haben sie einen Platz für dich reserviert, bis
du entschieden hast, wo du hingehen willst.“ Sie hörte seine
weiteren Entschuldigungen und Beteuerungen nicht mehr und
sagte nur: „Bitte geh! Ich will Dich nie mehr wiedersehen.“
Die Welt brach in diesen wenigen Augenblicken für Kea
zusammen und ihr Herz zerbrach. – Nie sollte sie sich von
diesem Schlag erholen. Nie sollte sie ihren Neuhardthof wiedersehen.
Nie sollte sie wieder einen anderen Mann besitzen.
Ihr Herz war zersprungen und hatte keinen Platz mehr, wollte
keinen Platz mehr finden für irgendjemand anderen.
Sie lebte noch lange und starb 92 Jahre alt 1987 in Stuttgart.
Sie hatte ein kleines Fotoalbum hinterlassen, in dem viele
Aufnahmen des Hofes enthalten waren. Shay Farkash, wie
bereits erwähnt Member of the Society for Preservation of Historic
Sites in Israel, war von den Aufnahmen fasziniert. Es seien
die Einzigen, die je aufgetaucht seien, das einzige Zeugnis, was
von Neuhardthof übrig geblieben sei.
123
Ein neues Büro am Jaffator
Am Baum des Schweigens hängt seine Frucht, der Frieden.
Mein Vater brauchte zusätzliche Räume für das Konsulat.
Er fand entsprechende Räumlichkeiten in der Nähe des Jaffators.
Sein Geschäft hatte er auf Ausgleich aufgebaut. Ich kann
mich gut an den bereits erwähnten Herrn Falscheer erinnern,
den er angestellt hatte und der morgens im Büro die Jerusalem
Post las, die damals wie heute die maßgebliche Zeitung des
Landes war. Ich wunderte mich schon als Junge darüber und
fragte mich, ob er nichts anderes, Wichtigeres, zu tun hatte.
Auch ein ungarischer Jude, namens Horowitz, war beschäftigt,
der sich um die konsularischen Belange kümmerte und
mit den ins Konsulat kommenden Ungarn in ihrer Sprache
reden konnte. Fast alle Juden in Jerusalem sprachen deutsch,
meistens in jiddischem Dialekt, auch untereinander, nur wenige
studierte, orthodoxe Juden hebräisch, das damals keine
Umgangssprache war.
Für die arabische Klientel hatte mein Vater einen arabischen
Angestellten, namens Yussaf, im Büro sitzen. Alle Bürowände
waren mit Weltkarten und den Bildern von den Schiffen des
Norddeutschen Lloyd behangen. Er war von seinem Geschäft
voll in Anspruch genommen, Konsulat, Reisebüro und Großhandel.
Die Gespräche mit Kunden und anderen Besuchern
waren immer mit dem Anbieten eines türkischen Kaffees verbunden,
den er schon aus Höflichkeit mittrank. Der Boy, der
die Tassen ausspülte, hatte von dem aggressiven Kaffeesatz
hässliche, aufgerissene Finger mit tiefen, braunen Spalten bekommen.
Wie für die Hände des Boys war der starke Kaffee
natürlich auch Gift für den Magen meines Vaters.
Nach Büroschluss und an curfew-freien Tagen schaute er in
Lendtholds Pub auf einen Arrak vorbei, dem starken, bereits
124
erwähnten Anisschnaps. Unter den Templern war das Pub
unter dem Namen Mätchle bekannt. Dort erfuhr man das Neueste
aus der Kolonie. Wer war gestorben, wer geboren, wann
war die nächste Hochzeit, wer fuhr nach Deutschland, wer
war zugezogen, wer hatte in der Lotterie gewonnen? Wird
Hitler mit einem Krieg beginnen?
Wenn er vom Mätchle nach Hause kam, war sein erster
Gang zur Toilette, wo er sich übergeben musste. Die Aufregungen
im Geschäft, die vielen Tassen türkischen Kaffees, die
Arraks in der Wirtschaft bei unregelmäßigen Essgewohnheiten
und die allerdings in Maßen gerauchten Zigaretten hatten
diese Reaktion des Körpers ausgelöst. Und das Abendessen
schmeckte ihm nicht. Diese Lebensweise war seiner Gesundheit
nicht zuträglich und meine Mutter machte sich Sorgen.
Irgendetwas musste sich ändern. Die Veränderung kam aber
ganz anders als erwartet, denn der Zweite Weltkrieg stand
bevor.
125
Onkel Egmont
Prüfe deinen Freund, ehe du ihn nötig hast.
Meine Großmutter Katharina hatte einen Bruder in Jerusalem.
Er hieß Hugo Wieland. Er war verheiratet und hatte mit
seiner Frau fünf Kinder. Er hatte mit seinem Bruder (Carl?)
eine Fabrik zur Herstellung von Fliesen und Steinplatten gegründet,
die gute Geschäfte machte. Egmont, der Jüngste seiner
Söhne, etwa zehn Jahre jünger als mein Vater, war im Krieg
bei der Kavallerie gewesen und sein Hobby waren Pferde. Er
soll einmal, vielleicht hatte er zuvor etwas getrunken gehabt,
auf seinem Pferd ins Mätchle hineingeritten sein und mit seinem
Säbel herumgefuchtelt haben. Einige englische Offiziere,
die das Mätchle als besonders gemütliche Kneipe für sich entdeckt
hatten, wo vorzügliches deutsches Bier ausgeschenkt
wurde und wo sie auch, ohne dass sich jemand störte, ihre
Beine auf die niedrigen Tische legen konnten, zogen ihre Revolver.
Das brachte Egmont zur Vernunft. Er stieg ab und führte,
den Säbel wieder in der Scheide, das Pferd aus dem Lokal.
Egmont hatte sich in ein Au-pair-Mädchen namens Gertrud
Waldbauer verliebt, das im Haushalt der Familie arbeitete. Sie
war eine Pfarrerstochter aus Schweigern bei Heilbronn. Die
beiden hatten vor Jahren geheiratet und in der Zwischenzeit
drei Kinder: Margret, Marianne und Werner, der in meinem
Alter war.
Egmont hatte in der Innenstadt von Jerusalem einige Lose
der Süddeutschen Klassenlotterie gekauft und den Höchstgewinn
gezogen. Sie hatten sich eines der schönsten Häuser am
Rande der Kolonie auf einer kleinen Anhöhe gebaut, aber auch
ein herrlich gelegenes Anwesen in Deutschland mit weitem
Blick über den Bodensee in Aufkirch nördlich von Überlingen
erworben. Gertrud hatte ein besonderes Gespür für politische
126
Entwicklungen. Sie traute dem Frieden und vor allen Dingen
Hitler nicht. Sie überzeugte Egmont, dass die Familie möglichst
bald in dieses Haus nach Überlingen übersiedeln sollte.
Und sie taten das auch, kurz bevor der Krieg ausbrach, und
konnten so der Internierung durch die Engländer entgehen.
Egmont hatte seine besondere Liebe für das Jordantal nördlich
von Jericho, die als älteste Stadt der Welt gilt, entdeckt.
Er kaufte sich ein fruchtbares Stück Land, das er mit dem
Wasser des Flusses bewässern konnte, und legte sich eine Obstplantage
an mit all den exotischen Früchten, die in dem subtropischen
Klima mit Temperaturen um die +40 °C – Jericho
liegt fast 400 m unter dem Meeresspiegel – wuchsen. Trauben,
Avocados, Maracuja, Ananas, Melonen jeder Art, Papayas,
Mangos und natürlich alle Arten von Zitrusfrüchten. Ein
kleines Paradies. Er nannte es liebevoll „Hatschle“. Er ritt häufig
mit seinem Pferd den beschwerlichen Weg zu seiner Bijare,
wie eine solche Pflanzung auf Arabisch heißt, verbrachte
dort einige Tage, bis er wieder den Aufstieg nach Jerusalem
antrat. Auf der etwa 30 km Strecke musste ein Höhenunterschied
von 1.200 m überwunden werden, da Jerusalem etwa
800 m über dem Meeresspiegel liegt.
Er hatte sich in seinem kleinen Paradies mit Bilharziose angesteckt,
einer weitverbreiteten Krankheit und Geißel der
Menschheit in den Tropen und subtropischen Ländern, wofür
es damals, besonders im fortgeschrittenen Stadium, keine
effektive Therapie gab. Das Verhängnis für ihn war, dass die
Krankheit viel zu spät, als die Familie schon längst in Deutschland
war, als Bilharziose diagnostiziert wurde und eine wirksame
Behandlung nicht mehr möglich war.
Das Auftreten der Krankheit ist vom Vorkommen der als
Zwischenwirte fungierenden, in warmen Binnengewässern
lebenden Schnecken abhängig. Die eigentlichen Krankheits-
127
erreger sind 1-2 cm lange Saugwürmer. Die Wurmlarven dringen
bei Kontakt mit kontaminiertem Süßwasser durch die
Haut des Menschen ein und wandern über Lymph- und Blutgefäße
in die Leber, wo sie sich zu reifen Pärchenegeln entwickeln.
Anschließend verbreiten sie sich im Körper und befallen
Harnblase und Darm. Ihre Eier werden mit dem Stuhl oder
Urin wieder ausgeschieden. Theodor Bilharz (1825-1862), ein
in Württemberg geborener und in Kairo arbeitender Tropenarzt,
entdeckte 1852 den Erreger dieser Erkrankung.
128
The German Colony
Dem Ersten gebührt der Ruhm, wenn auch die Nachfolger es
besser gemacht haben.
Mit sechseinhalb Jahren kam ich in die Schule, die auf dem
abgedruckten Plan der Kolonie weiter vorne in diesem Buch
eingezeichnet ist.
Viele Jahre später, bei meinem Besuch in den 80er-Jahren in
Israel, bemerkte ich, dass das ganze Areal, auf dem sich die
alte Schule, die neue Schule und der Saal befanden, mit einer
von Soldaten bewachten Absperrung versehen war. Auf einem
großen Schild war zu lesen: Institut für Agrikultur.
Ich sprach den Soldaten an und fragte, ob ich wohl das Schulhaus
besuchen könne. Er sah mich skeptisch an, musterte mich
von oben bis unten und dachte sich: Terroristen sehen anders
aus!
„Nie von einer Schule gehört“, fauchte er missmutig.
Ich fragte ihn, ob er mich zu seinem Vorgesetzten führen
könne, was er dann auch widerwillig tat.
Der Direktor des Instituts empfing mich sehr freundlich. Er
hörte sich ungläubig meine Geschichte an und als ich ihm erklärte,
dass ich im unteren, linken Zimmer des Hauses auf der
Schulbank gesessen hatte, gab er sich einen Ruck und führte
mich in den Raum, in dem etwa zehn Personen an Schreibtischen
arbeiteten. Ich erklärte den erstaunten Büroangestellten,
dass ich hier die Schulbank gedrückt hatte. Keiner von
allen hatte die blasseste Ahnung, dass dieses Gebäude einmal
eine deutsche Schule gewesen war. Und keiner hatte jemals
etwas von den Templern gehört.
Der Begriff German Colony, dieser Stadtteil wird in gültigen
Stadtplänen auch so bezeichnet, war ihnen allerdings geläufig.
Sie konnten damit jedoch nichts anfangen. Mir wurde ein
129
Kaffee angeboten. Danach verließ ich das Gebäude, nicht ohne
mich herzlich zu bedanken.
In einem jungen Staat wie Israel ist alles im Fluss. Die Menschen
werden von der Gegenwart mit all ihren Problemen so
in Beschlag genommen, dass Vergangenes kaum interessiert.
Doch das sollte sich in späteren Jahren ändern, als Alex Carmel
sein Buch Die Siedlungen der württembergischen Templer in
Palästina 1868-1918 im Kohlhammer Verlag veröffentlichte. Er
war 1931 als Alexander Buchmann in Berlin geboren und verließ
Deutschland als Kind mit seiner Familie nach dem Pogrom
von 1938. Er lehrte später Neue Geschichte an der Hebräischen
Universität von Jerusalem. Die israelische Öffentlichkeit
wurde auf die württembergischen Siedler aufmerksam.
Es ist hauptsächlich der Initiative Einzelner wie Shay Farkash
und Ariel Atzil zuzuschreiben, dass Häuser der Siedler erhalten
blieben und sogar restauriert worden sind, unterstützt von
der Stadt Tel-Aviv. Shay Farkash hat es sogar zu seiner Aufgabe
gemacht, die Geschichte der Familien, die in den Häusern
gewohnt hatten, zu erforschen und ein Archiv mit allen
erhältlichen Fotos anzulegen. Die beiden haben sich besonders
auf Sarona spezialisiert.
Der bekannte israelische Architekt David Kroyanker hat ein
Buch über die Architektur der württembergischen Häuser der
Deutschen Kolonie Jerusalem verfasst, das in hebräischer Sprache
im Jahr 2008 veröffentlicht worden ist (Jerusalem – The
German Colony and Emek Refaim Street, by David Kroyanker,
399 Seiten). Das Buch setzt sich mit der Architektur der
Templerhäuser im Detail auseinander und ist eingerahmt von
faszinierenden persönlichen Erzählungen ehemaliger Bewohner.
Hunderte von Fotografien, Grafiken und Zeichnungen,
von denen die meisten bisher unveröffentlicht waren, schmü-
130
cken das Buch weiter aus. Darunter sind auch einige Fotos von
der Kuebler-Familie.
Das Leben der Templer in ihren Siedlungen war weniger von
religiösen Dogmen geprägt, als man bei einer relativ jungen
Sekte vermuten würde. Am Sonntag war Gottesdienst, der
entweder vom Tempelvorsteher oder einem ganz gewöhnlichen
Mitglied gehalten wurde. Einen Pfarrer gab es nicht. Der
Saal – so nannten die Templer ihre Kirche – war im Innern
schlicht gehalten, und es gab auch keine Kanzel, sondern
lediglich ein etwas erhöhtes Pult. Die Templer hatten ein eigenes
Gesangbuch verlegt, das auf dem Württembergisch-
Evangelischen beruhte, doch bei vielen Liedern war der Text
umgeschrieben worden, wenn er zu viele sakrale Elemente
enthielt. Auch der Bezug auf Gottes Sohn – Jesu war, wie zuvor
erwähnt, bei den Templern ein Mensch mit göttlichen Eigenschaften
– oder auf die Dreifaltigkeit – die Templer glaubten
konsequenterweise auch nicht an den Heiligen Geist – war
aus den Liedertexten entfernt worden. Aber musizieren konnten
die Templer! Fast jeder von ihnen spielte ein Instrument
und viele sangen im Gemeindechor mit. Ihre Lieblingslieder
waren, soweit ich mich erinnern kann: Eine feste Burg ist unser
Gott und So nimm denn meine Hände. Viele Lieder im Gesangbuch
waren von Mitgliedern komponiert worden und andere
schrieben einen passenden Text dazu.
Es war keineswegs Pflicht, den Gottesdienst zu besuchen,
und wir Kinder wurden dazu auch nicht gezwungen. Die
Templer lebten frei und versuchten, nach Gottes Wort zu leben.
Wenn einer mehr oder weniger unverschuldet in finanzielle
Not geriet, sein Haus abbrannte oder einen Unfall hatte,
half ihm die Gemeinde. Wenn die Eltern von Kindern frühzeitig
starben, fand sich immer eine Familie, die die Waisen
aufnahm. Für einen Templer war irgendeine Versicherung im
131
Grunde überflüssig. Es war – wenn man das so sagen kann –
ein praktizierter und funktionierender Kommunismus ohne
jeglichen Beigeschmack, der die individuelle Freiheit einschloss.
Er entsprang der religiösen Einstellung, beruhte dennoch
auf Freiwilligkeit und kam aus dem Herzen.
Das Bibelwort Liebe deinen Nächsten wie dich selbst stand im
Vordergrund. Danach wollten die Templer leben.
Deshalb war es für eine Templerfamilie ein besonderes Anliegen,
eine oder mehrere heimatlose Waisen auch anderer
Religionen und Rassen als Familienmitglieder aufzunehmen,
mit Brot und Bett, und ihnen eine Berufsausbildung zu ermöglichen,
bis sie auf eigenen Beinen stehen konnten. Dabei wurde
ihre Religion respektiert und keine Anstalten unternommen,
sie zu missionieren. Schon in der zweiten Generation der
Templer, also in den 30er-Jahren, ließ dieser Idealismus mit
wachsendem Wohlstand merklich nach. Viele Templer waren
durch ihren Fleiß und auch durch den wachsenden Bedarf
vermögend geworden, der durch die jüdischen Einwanderer
aus Europa, hauptsächlich aber aus Deutschland, für
Güter entfacht worden war, die die Templer herstellten oder
vertrieben. Leider muss man auch berichten, dass manche
sogar der National Sozialistischen Deutschen Arbeiter Partei –
der NSDAP von Hitler –, in Verkennung der wahren Absichten
dieser Partei, beigetreten waren.
Ja, das Heilige Land mit Jerusalem im Zentrum ist die Wiege
der drei großen Weltreligionen, die nur einen Gott kennen.
Es ist das Ziel von unendlich vielen Pilgern von alters her für
Juden, Christen und Moslems auf der Suche nach den Ursprüngen
ihrer Kultur. Viele ihrer allerheiligsten Stätten sind
hier. Alle gehen auf dieselben Urväter zurück. Abraham, Isaak
und Jakob. Die Bibel gibt Hinweise auf den König von Salem,
der Abraham die Kunde Gottes überbracht hat. Die Israeliten
132
nach der Prophezeiung von David unter Salomo errichteten
ihren ersten Tempel auf dem Tempelberg, auf dessen Grundmauern
jetzt vermutlich die Al Aqsa Moschee der Mohammedaner
steht. Die Klagemauer ein Teil der alten Stadtmauer von
Jerusalem und unmittelbar am Tempelberg gelegen (manche
sind fälschlicherweise der Ansicht, dass die Klagemauer ein
Teil des alten Tempelfundaments sei) ist über 2000 Jahre alt
und für Juden das bedeutendste Heiligtum. Immer wieder fanden
hier Kämpfe statt, ob mit den Römern, Arabern, Kreuzfahrern,
Mamelucken, Türken oder Briten – immer wieder
wurde die Klagemauer von den Juden zurückerobert. So pilgern
täglich viele Menschen zu einem Gebet an die Klagemauer.
Frauen und Männer beten getrennt, für Frauen gibt es ein
extra reserviertes Stück Mauer.
Das Alte Testament gilt interessanterweise für alle drei
Weltreligionen gleichermaßen, im Koran etwas abgewandelt.
Als mich Ariel Atzil, ehemaliger Pilot der israelischen Luftwaffe,
der gerade an der Universität Haifa seine Doktorarbeit
über die Templer schreibt und nebenher als Fremdenführer
tätig ist, in Überlingen im Frühjahr 2009 besuchte, zeigte er
mir ein Reiseprospekt meines Vaters, ein Reiseprospekt des
Kueblers Tourist & Travel Office, das er mitgebracht hatte. Er
erklärte, dass es heute mehrere Tausend Fremdenführer in Israel
gäbe und mein Vater, soweit seine Ermittlungen ergaben,
der Erste in Palästina gewesen sei, der diesen Beruf hauptberuflich
ausübte. Es freute mich sehr, dass ein Israeli diese anerkennenden
Worte nach so vielen Jahren über meinen Vater
fand. Mein Vater hatte seinen Beruf sehr ernst genommen. Er
kannte Palästina und auch Transjordanien, das heutige Jordanien,
wie seine Westentasche.
Mein Vater pflegte Kontakte zu hohen Vertretern der verschiedenen
Religionen unter anderem auch zu einem jüdischen
133
Rabbi, der aus Berlin stammte mit Deutsch als Muttersprache.
In den Gesprächen, die er mit dem Rabbi führte, hatte er
viel über den jüdischen Glauben erfahren. Einen muslimischen
Geistlichen kannte er auch, der hatte in Kairo studiert und
anschließend in Berlin, und er sprach deutsch. Die Moslems,
vornehmlich die Sunniten, zu denen die meisten Moslems in
Palästina gehören, kennen den Beruf eines Priesters in unserem
Sinne nicht, da es für den Muslim keiner vermittelnden
Instanz zwischen den Gläubigen und Gott bedarf. Es gibt aber
in der Moschee einen sogenannten Iman, der die Gebete
spricht, und er war ein solcher. Mein Vater erfuhr von ihm
einiges über den Inhalt des uns zunächst fremd anmutenden
Korans. Und mein Vater hat mir einen Teil von seinem Wissen
in seinem Alter weitergegeben.
Wie unterscheidet sich die jüdische Religion von der Christlichen?
Wie der Islam? Abenteuerliche Vorstellungen, wenn
nicht sogar Vorurteile, herrschten da zuweilen unter den
württembergischen Einwanderern mit meinem Vater eingeschlossen.
Nach den Gesprächen wurde ihm bewusst: In den
Grundwerten sind alle drei Glaubensrichtungen ebenbürtig.
Sie halfen meinem Vater, die Menschen um ihn herum, Christen
jeder Glaubensrichtung, Araber und Juden, besser zu verstehen.
Und das vermittelte ihm der Rabbi:
Die drei monotheistischen Religionen gehen auf gleiche Wurzeln
zurück. Abraham ist eine zentrale Figur des Alten Testaments.
Abrahams Geschichte wird im biblischen Buch Genesis
erzählt. Danach gehört er zusammen mit seinem Sohn Isaak
und seinem Enkel Jakob zu den Erzvätern, aus denen laut biblischer
Überlieferung die Zwölf Stämme des Volkes Israel hervorgingen.
Neben dem Judentum berufen sich auch das Christentum
134
und der Islam auf Abraham als Stammvater. Darum bezeichnet
man alle drei auch als abrahamitische Religionen. Sie ähneln
sich auch in ihren ethischen Grundsätzen. Erinnern wir
uns an die Zehn Gebote der Christen:
Du sollst keine anderen Götter haben neben mir.
Du sollst dir kein Bildnis machen.
Du sollst den Namen des Herrn nicht missbrauchen.
Du sollst den Feiertag heiligen.
Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren.
Du sollst nicht töten.
Du sollst nicht ehebrechen.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst kein falsches Zeugnis geben.
Du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib oder Haus.
Sie unterscheiden sich im Inhalt nicht von den Geboten der
Juden, die in den Fünf Bücher Mose offenbart sind. Moses ist
der höchste Prophet in unserem Glauben, der Gott so nah sein
kann, wie sonst kein Mensch vorher oder seitdem. Er gilt als
Verfasser der Fünf Bücher Mose, umgangssprachlich Thora genannt,
die die Basis des jüdischen Glaubens bilden.
Die Thora wird nicht mit „Gesetz“ oder „Gebot“ übersetzt,
sondern mit „Weisung“, die das Leben erleichtern soll. In der
Thora sind diese Weisungen etwas ausführlicher als die 10
Gebote der Christen niedergeschrieben, die man auf das heutige
Leben übertragen hat. Dadurch entstanden 613 Bestimmungen,
die alle im Alten Testament stehen. Die Schriftgelehrten
nannten diese Bestimmungen den „Zaun der Weisung“,
der sie vor der Außenwelt schützen soll. Im Talmud,
das ist neben der Bibel unser wichtigstes Buch, wird der Sinn
der Thora von zwei Lehrern ausführlich erläutert. Ich möch-
135
te als Beispiele herausgreifen: die Weisung der Elternehrung,
die Weisung zu opfern, die Weisung, Arme zu beschenken,
die Weisung, den Nachbarn wie sich selbst zu lieben, die Weisung,
keine Rache zu üben, die Weisung, keine „Schatnes“,
also Kleidung aus Wolle mit Leinen vermischt, zu tragen, die
Weisung, zwei verschiedene Samen nicht einzupflanzen und
die Weisung vom koscheren Essen. Das zeigt, wie die Thora in
das tägliche Leben eines gläubigen Juden eingreift und es zu
regeln versucht.
Die Gebote, also die Weisungen, die Mose von Gott erhalten
hat, lauten in unserem Glauben wie folgt:
Ich bin Jahwe, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus
dem Sklavenhaus.
Du sollst neben mir keine anderen Götter haben.
Du sollst dir kein Gottesbild machen und keine Darstellung von
irgendetwas am Himmel droben, auf der Erde unten oder im
Wasser unter der Erde.
Du sollst dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich
nicht verpflichten, ihnen zu dienen. Denn ich, der Herr, dein Gott,
bin ein eifersüchtiger Gott: Bei denen, die mir feind sind, verfolge
ich die Schuld der Väter an den Söhnen, an der dritten und
vierten Generation; bei denen, die mich lieben und auf meine
Gebote achten, erweise ich tausendfach meine Huld.
Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen;
denn der Herr lässt den nicht ungestraft, der seinen Namen
missbraucht.
Gedenke des Sabbats: Halte ihn heilig!
Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun.
Der siebte Tag ist ein Ruhetag, dem Herrn, deinem Gott, geweiht.
An ihm darfst du keine Arbeit tun: du, dein Sohn und deine Toch-
136
ter, dein Sklave und deine Sklavin, dein Vieh und der Fremde,
der in deinen Stadtbereichen Wohnrecht hat.
Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel, Erde und Meergemacht
und alles, was dazugehört; am siebten Tag ruhte er. Darum
hat der Herr den Sabbattag gesegnet und ihn für heilig erklärt.
Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in
dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt.
Du sollst nicht morden.
Du sollst nicht die Ehe brechen.
Du sollst nicht stehlen.
Du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen.
Du sollst nicht nach dem Haus deines Nächsten verlangen. Du
sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen, nach seinem
Sklaven oder seiner Sklavin, seinem Rind oder seinem Esel
oder nach irgendetwas, das deinem Nächsten gehört.
Die „Parascha“, ein Leseabschnitt in der Thora, enthält noch
weitere Gebote.
Du sollst die Früchte eines Baumes innerhalb der ersten drei Jahre
nach dem Pflanzen nicht essen.
Du sollst die Schläfenlocken und den Bart nicht mit einem Rasiermesser
zuschneiden.
Du sollst die Dienste eines Magiers nicht beanspruchen.
Du sollst vor älteren Menschen aufstehen und ihnen so Ehre erteilen.
Du sollst keine Konvertiten verhöhnen.
Du sollst im Geschäftsleben nicht betrügen.
Du sollst keine unerlaubte sexuelle Beziehungen eingehen.
Du sollst keine unerlaubte Tierarten konsumieren.
137
Und das wusste der Iman:
Der Koran ist die Grundlage des islamischen Glaubens. Koran
heißt übersetzt: Das oft zu lesende Buch, Islam heißt Frieden
und Sure Weisheit. Von den 114 Suren – Abschnitten –
des Korans ist die erste „eröffnende“ Sure sehr kurz und gleichzeitig
das Kurzgebet der Moslems, das immer allen anderen
Gebeten voransteht. Sie lautet:
Im Namen Gottes, des Gnädigen und Barmherzigen. Lob sei Gott,
dem Herrn der Menschen in aller Welt, dem Barmherzigen und
Gnädigen, der am Tag des Gerichts herrscht. Dir dienen wir und
Dich bitten wir um Hilfe. Führe uns den geraden Weg, den Weg
derer, denen Du gnädig bist, die nicht dem Zorn anheimfallen
und nicht irregehen.
Der Koran enthält alle verbindlichen Religionsvorschriften,
aber auch bürgerliche, soziale und strafrechtliche Richtlinien.
Allem voran steht der Glaubenssatz:
Allah ist der einzige Gott und Mohammed ist sein Prophet. Einige
weitere herausgegriffene Gebote sind:
Achtung vor dem Leben der Mitmenschen, damit verbunden ist
die Einschränkung der Blutrache und das Verbot der Tötung von
weiblicher Nachkommenschaft.
Treue und Anständigkeit im Einhalten von Verträgen z. B. in
Maß und Gewicht. Die Ächtung des Zinses im Besonderen des
Zinses Zins.
Beschränkung in der Polygamie auf vier Frauen.
Güte gegenüber Eltern, Kindern und Verwandten.
Hilfe gegenüber Mitmenschen besonders aber Waisen.
Güte gegenüber Untergebenen.
Geben von Almosen an Bedürftige.
138
Verbot des Selbstmords. Der Selbstmord ist laut Koran haram,
also verboten.
[Da es im Islam gegenwärtig weder eine dem Papst vergleichbare
Autorität gibt noch eine sonstige zentrale Auslegung
der religiösen Schriften vorhanden ist, herrscht Uneinigkeit
innerhalb der islamischen Jurisprudenz darüber, ob
die Selbsttötung unter bestimmten Bedingungen erlaubt ist
oder nicht].
Prozessuale Vorschriften kommen hinzu wie z. B.:
Anrufung des Propheten bei Streitigkeiten. Verfahrenweise bei
einer Scheidung, bei der Verteilung des Erbes und der Aufteilung
der Beute nach erfolgreichen Kriegen.
[In der Bibel ist Vergleichbares nicht zu finden. Der Koran
ist so nicht nur die Bibel der Moslems. Für manche moslemische
Länder ist der Koran auch das Gesetzbuch.]
Vieles im Koran bezieht sich auf das Alte Testament. So gilt
Abraham als Stammvater der Araber. Es wird immer wieder
Bezug auf Moses mit seinen Zehn Geboten genommen. Jesus
wird als Prophet genannt und Maria wird verehrt. Immer
wieder findet man Legenden aus dem Alten Testament in abgewandelter
Form.
Der Koran wurde in den Jahren 610 bis 625 nach Chr. von
Mohammed verfasst und verkündet, nicht als sein Wort, sondern
als die ihm zuteilgewordenen Offenbarungen Allahs, des
alleinigen einzigen Gottes seit Ewigkeit, Weltenerschaffers und
Herren aller Weltenbewohner, der keinen Sohn und Helfer
besitzt und benötigt. [Wahrscheinlich eine Anspielung auf
Jesus, den die Christen als den Sohn Gottes betrachten. Goethe,
der den Koran studiert hatte, sah übrigens in der zweiten
Sure den maßgeblichen Teil des Koran.]
139
Alt Jerusalem
Eile ist vom Teufel.
Auf alten Karten ist Jerusalem als Zentrum der Welt gezeigt
– nicht ganz zu Unrecht. Man kann die Geschichte bis 1917
grob in vier große Perioden in die Biblische Periode von 1004 v.
Chr. bis 70 n. Chr., die Römische Periode von 63 v. Chr. bis 324
n. Chr., die Byzantinische Periode von 324 bis 638 n. Chr. und
die Muslimische Periode von 638 n. Chr. bis 1917 einteilen.
Für Christen ist Jerusalem die Stadt, wo Jesus lebte, predigte,
gestorben und auferstanden ist. Die Orte, an denen er gewirkt
hat, ziehen seit Jahrhunderten Pilger und Gläubige an.
Die Verwaltungsrechte der verschiedenen christlichen Kirchen
an den Heiligen Stätten – auch Status-quo-Regelung genannt
– wurden im Laufe des neunzehnten Jahrhunderts mit
dem Osmanischen Reich geregelt. Sie blieben während des
englischen Mandats in Kraft und gelten bis heute in Israel fort.
Aber warum lassen wir nicht meinen Vater zu Wort kommen,
der in seinem Alter in Überlingen Lichtbildervorträge hielt,
die den Besuch eines Touristen in Palästina und im Besonderen
in Jerusalem nachzeichnen?
„Durch eines der sieben Tore Jerusalems gelangen wir auf
den Tempelplatz. Vor uns liegt der imposante Felsendom mit
seiner schwarz-blauen mit einem Halbmond gekrönten Kuppel.
Nachdem wir den Vorplatz überschritten haben, steigen
wir auf breiten, steinernen Stufen zur höher gelegenen Plattform
des Felsendoms hinauf. Diese Moschee dürfte wohl die
schönste aller sein, die Hagia Sophia in Konstantinopel
vielleicht ausgenommen. Sie wirkt auf uns Abendländer wie
ein verwirklichter Traum aus Tausend und einer Nacht. Die
mit Blei belegte 30 m hohe Kuppel [heute ist der Dom mit Blatt-
140
gold, einer Spende Saudi Arabiens, überzogen] prägt die Silhouette
der alten Stadt.
In der Mitte des Doms erkennen wir einen unbehauenen
Felsrücken, der uns wie eine erstarrte Woge des Chaos anmutet.
Hier sollen Abraham, David, Salomon und Elias gebetet
haben. Von hier soll, nach mohammedanischem Glauben,
Mohammed in der Nacht der Geheimnisse auf dem Pferd El
Barak in den Himmel geritten sein, um dort einen Besuch abzustatten.
Hier war einst der alte Tempel der Juden gestanden und
genau an dieser Stelle das Allerheiligste. Hier, im ehemaligen
Tempel, wo Jesus aus- und einging und predigte, glauben wir,
seine Worte zu hören: Zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen,
denn der Ort, worauf du stehst, ist Heiliges Land.
An dieser Stelle stand einst auch der alte Zweite Tempel der
Juden, der 70 n. Chr. von den Römern zerstört wurde. Sie raubten
die Menora, den siebenarmigen Leuchter aus reinem Gold,
für dessen Anfertigung Moses auf dem Berg Sinai von Gott
den Auftrag erhalten hatte und der einer der heiligsten Ritualgegenstände
des jüdischen Volkes war. Im Triumphzug
wurde sie später durch Rom getragen und auf dem Titusbogen
abgebildet. 1948 dann übernahm der junge Staat Israel
die Menora als offizielles Emblem.
Mohammed hatte einen Bart getragen. Die mohammedanischen
Geistlichen und Strenggläubigen sowie alle Stammesoberhäupter,
Scheichs und Derwische tragen Bärte. Es gilt bis
heute der Schwur: Beim Barte des Propheten. Die heiligen Haare
des abgeschnittenen Barts von Mohammed wurden nach
seinem Tod auf 40 Fläschchen verteilt. Sie werden in verschiedenen
Moscheen aufbewahrt. Auch im Felsendom ist ein solches
Fläschchen vorhanden und wird den Gläubigen jedes Jahr
an Mohammeds Geburtstag gezeigt.
141
Außerhalb des Tempelplatzes erstreckt sich die Klagemauer,
wo die Juden den Untergang und die Zerstörung ihres Großen
Tempels beklagen, ein Herzstück jüdischer Kultur. Sie gilt
als Relikt des von Herodes gebauten Großen Tempels, tatsächlich
aber ist sie ein Teil der alten Stadtmauer. An der Klagemauer
sehen wir Orthodoxe Juden in ihren schwarzen Anzügen,
schwarzen Hüten und Schläfenlocken, den so genannten
Peijes. Sie schlagen ihre Köpfe gegen die Mauer und stecken
Nägel zwischen die großen Steine der Mauer.
Man nimmt an, dass das Haus, in dem Jesus mit seinen Jüngern
das Abendmahl einnahm, auf dem Zionsberg lag. In der
Nacht des Verrats durch Judas Ischariot wanderte Jesus mit
seinen Jüngern durch das Kidrontal, an den Mauern des Tempelhofs
vorbei, in nordöstlicher Richtung zum Garten Gethsemane.
Diesen Weg soll seinerzeit auch König David gegangen
sein, als er vor seinem eigenen Sohn Absolon fliehen musste.
Gethsemane ist ein ruhiger Ort, etwa 70 Schritte lang und breit,
bepflanzt mit Olivenbäumen und Zypressen. Einige der Olivenbäume
sollen zu Jesu Zeiten schon hier gestanden haben.
Auf einem Fels mitten im Garten soll Jesus mit seinen Jüngern
geruht haben, als die Häscher der Pharisäer erschienen
und ihn festnahmen. Man glaubt, seine Worte im Rascheln
der Olivenblätter zu hören: Mein Vater ists möglich, so gehe
dieser Kelch an mir vorüber, doch nicht wie ich will, sondern wie
du willst!
Wir folgen dem gleichen Weg nach Jerusalem, den die Häscher
mit Jesus genommen haben. Bevor wir über das Josephatal
in die Stadt kommen, entdecken wir auf beiden Seiten des
Wegs bis zum Abhang des Ölbergs hinauf mohammedanische
und jüdische Friedhöfe. Hier soll, den Weissagungen zufolge,
am Jüngsten Tag die Auferstehung aller Toten stattfinden. Beim
Eintritt durch das Stephanstor in die Altstadt taucht das Haus
142
des Pilatus vor uns auf und nicht weit davon das Gefängnis
Christi, die Antonia Festung. Von hier beginnt der Leidensweg
Jesu mit dem Kreuz auf dem Rücken. Es ist die berühmteste
Straße Jerusalems, die Via Dolorosa, eine enge Gasse, auch
Kreuzweg genannt, mit ihren 14 Stationen, die hinauf nach
Golgatha zur Grabeskirche, den Ort der Kreuzigung, führt. Im
vierten Jahrhundert erklärte Kaiser Konstantin das Christentum
zur Staatsreligion und befahl, über dem Grab Christi eine
prachtvolle Kirche zu bauen. Sie wurde später von den Arabern
und Persern bis auf die Grundmauern zerstört. Die Grabeskirche
wurde von den Kreuzrittern wieder neu errichtet.
Der Kreuzfahrer Gottfried von Bouillon stiftete damals die Glocke.
Die große Kirchenpforte wird täglich von einem mohammedanischen
Geistlichen auf- und zugeschlossen. Das Schlüsselrecht
für eine der ältesten christlichen Kirchen war von den
Türken einer mohammedanischen Familie zugesprochen worden
und wurde später auch von der englischen Mandatsregierung
respektiert.
Die Grabeskirche ist eines der ehrwürdigsten und gleichzeitig
eigenartigsten Gebäude in Jerusalem. Auf dem freien
Platz davor feiern die griechisch-katholischen Christen Gründonnerstag,
14 Tage später als wir. Auf einem hier unter freiem
Himmel errichteten Podium nimmt der griechisch-katholische
Patriarch bei zwölf Archimanliten – das sind hohe Geistliche
– in sinnbildlicher Weise eine Fußwaschung vor.
Am Samstag vor Ostern Punkt 13:00 Uhr schlägt eine Flamme
aus der ovalen Öffnung der Grabeskapelle im Innern der
Kirche heraus. Es ist das Heilige Feuer. Kopf an Kopf drängen
sich die Gläubigen. Jeder will als Erster seine Kerze anzünden
und als Erster in der Geburtskirche in Bethlehem ankommen,
143
um dort die hängenden Öllampen mit dem Heiligen Feuer für
das kommende Jahr zu entzünden.
Das Anrecht für die Benutzung, wie z. B. die Abhaltung von
Gottesdiensten in der Grabeskirche, ist zwischen den verschiedenen
Konfessionen wie der römisch-katholischen, griechischorthodoxen,
armenischen, koptischen und abessinischen Kirche
nach alten Statuten festgelegt.
In Jerusalem sind vier Patriarchen ansässig. Es gibt auch
ungezählte Klöster und Kirchen aller christlichen Konfessionen.
Nur wenige Schritte von der Grabeskapelle entfernt ist die
Franziskaner Kapelle, in der deren Mönche das von dem Kreuzfahrer
und Eroberer Gottfried von Bouillon getragene Schwert,
Kettenpanzerhemd, Kreuz sowie seinen Ring aufbewahren.
Ihm wurde seinerzeit die Königskrone angetragen, die er aber
mit der Begründung ablehnte: Vor mir war ein größerer König!
Das erste Heiligtum, auf das wir beim Eintritt in die Kirche
stoßen, ist der Salbungsstein, eine gelbrötliche Marmorplatte.
Auf ihr soll Niedemus den Leichnam von Jesus einbalsamiert
haben. Wir gelangen in den Kuppelbau, der sich über dem
Heiligen Grab erhebt, ein Marmortempelchen, das erst im Jahr
1810 errichtet worden ist. Steinbänke und riesige Leuchter
umgeben den Vorplatz, über den wir in die von weiteren 15
kostbaren Lampen beleuchtete Engelskapelle eintreten.
Durch eine niedrige Pforte gelangen wir in die eigentliche
Grabeskapelle. Viele Lampen hängen von der Decke herab und
erhellen die eigentliche Grabbank. Mit Inbrunst hat manch
einer hier schon niedergekniet und gebetet und um die Vergebung
seiner Sünden gefleht. Abertausende gingen hier schon
ein und aus. Freund und Feind begegneten sich hier und beugten
ihre Knie vor diesem Heiligtum. Das ist vielleicht das ein-
144
zige Gotteshaus, in dem sich Christen aller Kirchen und Sekten
einfinden und zusammen beten, so, wie Jesus es sagte:
Eine Herde und ein Hirte.
Beim Hinausgehen klingen die Worte in unseren Ohren:
Was suchet ihr die Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier.
Er ist auferstanden!
Oben auf Golgatha wird uns der Platz gezeigt, wo das Kreuz
Jesu gestanden haben soll. Auch die gespaltene Felsplatte ist
zu sehen, von der schon Matthäus berichtete. Beim Tode Jesu
hätte die Erde gebebt und sich der Felsen geteilt. Hier rief Jesus
in seiner Qual am Kreuz:
Mein Gott, mein Gott, warum hast Du mich verlassen!
Hier flehte er: Mich durstet.
Dort schied er von der Erde mit dem Ruf:
Es ist vollbracht, Vater in Deine Hände befehle ich meinen Geist.
Jeden Freitagnachmittag findet eine von den Franziskanermönchen
angeführte Prozession von Gethsemane den Leidensweg
entlang hinauf nach Golgatha statt. An allen 14 Stationen
wird eine Pause für ein kurzes Gebet eingelegt.“
Diese Schilderung ist auszugsweise einem Lichtbildervortrag
meines Vaters entnommen, den er Anfang der 50er-Jahre
in verschiedenen Städten und Dörfern rings um den Bodensee
hielt. Sie verdeutlicht, wie sehr Jerusalem mit dem
christlichen Glauben verbunden ist. Überall in der Altstadt
wirkt das Leben Jesu nach und für die Juden und Araber ist es
mit ihrer Religion nicht viel anders. Jerusalem ist unumstritten
die Heilige Stadt.
145
Der arabisch-israelische Konflikt
Wer ein Kamel liebt, muss sich mit seinen Höckern abfinden.
Wie kam es eigentlich zu der Feindschaft zwischen Juden
und Arabern?
Vor dem Ersten Weltkrieg lebten sie mit den Christen zusammen
friedlich nebeneinander in Palästina. Damals waren
es etwa 780 000 Menschen, etwa 90 000 Juden, 30 000 Christen,
der Rest Araber. Sie verteilten sich auf ein Land, die Negev-Wüste
nicht eingerechnet, das etwa halb so groß wie die
Schweiz ist.
Die Engländer waren an dieser Entwicklung nicht schuldlos.
Als der Erste Weltkrieg begann, erkannten die Engländer,
die Ägypten als Mandatsgebiet verwalteten, gleich die Gefahr,
die dem Suezkanal drohte, der nur wenige Hundert Kilometer
von der südlichen Grenze Palästinas entfernt liegt. Palästina
war von den Türken besetzt, die sich auf die deutsche
Seite geschlagen hatten. Der Suezkanal in türkischer oder gar
in deutscher Hand? Undenkbar! Für das Weltreich Großbritannien
strategisch unzulässig. Das musste unbedingt verhindert
werden.
Man brauchte die Hilfe und Unterstützung der arabischen
Bevölkerung, und zwar nicht nur der Araber in Palästina, sondern
auch die der umliegenden Länder wie Transjordanien,
Syrien und Saudi-Arabien. Die Araber sprachen jedoch nicht
mit einer Stimme. Es gab viele unterschiedliche Stämme, und
die Stammesfürsten waren obendrein untereinander zerstritten.
Wie konnte man hier eine schlagkräftige Truppe aufbauen?
Welcher Mann wäre in der Lage, diese schwierige Aufgabe
zu übernehmen? Wer kannte ihre Sitten, wer ihre Sprache?
Wem würden sie vertrauen? Ohne eine handfeste Belohnung
146
für die Araber würde selbst der beste Mann nichts ausrichten
können. Geld stand nicht in genügender Menge zur Verfügung,
aber vielleicht ein Versprechen?
Eines kam ihnen entgegen: der Hass aller Araber auf die
Türken!
147
Lawrence of Arabia
Wenn du redest, dann muss deine Rede besser sein, als dein
Schweigen gewesen wäre.
Wie so oft in der Vergangenheit hatte die damals unumstrittene
Weltmacht England die Gabe, den richtigen Mann für
diese schwer zu lösende Aufgabe zu finden. Es war Lawrence
of Arabia. Als junger Mann war er von den Burgen und Altertümern
des Mittleren Ostens fasziniert und als Student der
Oxford-Universität befasste er sich mit dem Einfluss der
Kreuzfahrer auf den Bau von Befestigungsanlagen in Europa.
Noch als Student unternahm er eine Trekking-Tour zu Fuß
durch Syrien und Palästina, die damals als Staatsgebiete nicht
existierten und zum Osmanischen Reich gehörten. Er lernte
Arabisch und konnte bei seinen gefährlichen Touren viele
Kreuzritterburgen vermessen und deren Architektur studieren.
Er wurde angeschossen, beraubt und geschlagen. Er erkrankte
sogar an Malaria. Doch seine Liebe zu diesem Land
blieb trotz all dieser Rückschläge bestehen!
Anschließend graduierte er mit dem Thema in Oxford.
Im Jahre 1911 wurde ihm eine Stelle als Aufseher für die
arabischen Arbeiter angeboten, die im heutigen Syrien bei archäologischen
Ausgrabungen bei der alten Hethiterstadt Carchemish
eingesetzt waren. Er nahm die ihm angebotene Stelle
an. Durch seine freundschaftliche Art und Kenntnis der Sprache
gewann er dabei viele arabische Freunde. 1914 wurde er,
wie viele andere, vom Ersten Weltkrieg überrascht.
Die Türken hatten die ganze Region unter ihrer Kontrolle.
Das Osmanische Reich, schon fünfhundert Jahre regierend,
hatte sich auf die Seite der Deutschen geschlagen. Lawrence
musste als Engländer schleunigst das Land verlassen und traf
in Kairo ein, wo er dem militärischen Geheimdienst zugeteilt
148
wurde. 1916 wurde er mit der Mission betraut, die arabischen
Beduinenstämme zu unterstützen, die mit einer Revolte gegen
die Türken unter der Führung des haschemitischen Scherifen
von Mekka Emir Husain begonnen hatten.
Er wurde bald Freund und Berater von dessen Sohn Prince
Feisal, der die Rebellen befehligte. Er konnte sich in kürzester
Zeit so einfügen – er trug ihre Kleidung, ritt auf einem Pferd
und kämpfte an deren Seite –, dass ihm die Führung der Rebellen
übertragen wurde.
Es gelang ihm mit seinen arabischen Beduinen, Akaba den
Türken zu entreißen und einzunehmen. Seine Kämpfer kannten
die Wüste wie ihre Westentasche, und es gelang ihnen
durch gezielte Anschläge, die wichtige Hedschas Eisenbahnlinie
von Damaskus nach Amman (sie sollte bis nach Mekka
weiterführen und eine Teilstrecke dorthin war auch schon
gebaut worden) zu unterbrechen und damit auch den Nachschub
für die weiter südlich gegen die Engländer kämpfenden
türkischen Truppen zu unterbrechen. Schließlich waren
die arabischen Kämpfer auch dabei, als Damaskus von den
Engländern erobert wurde. Die Neuigkeit über den nicht für
möglich gehaltenen Sieg über die Türken verbreitete sich in
Windeseile in alle Welt, und die Legende von Lawrence of Arabia
– gerechtfertigt oder nicht – war geboren. Man fragte sich,
wie Lawrence das nur geschafft hatte, mit diesen unzivilisierten
Barbaren gegen die gut ausgerüsteten Türken anzutreten
und militärische Erfolge zu erzielen.
Lawrence gab die Zusage seiner Regierung an die Araber
weiter, dass die von den Türken befreiten Länder, also auch
Palästina und Syrien, unabhängige arabische Staaten werden
würden. Die Araber kämpften also für ihre eigene Freiheit!
Hierüber gab es einen Schriftverkehr 1915/16 zwischen dem
englischen Chief Officer of the British Government in Egypt Sir
149
Henry McMahon, natürlich im Auftrag der englischen Krone,
und Emir Husain mit entsprechenden Zusicherungen an die
arabische Seite. Dieses Versprechen wurde aber nach Kriegsende
von der englischen Regierung anders ausgelegt und
schließlich, was Palästina und Syrien betraf, nicht eingehalten.
Lawrence musste erfahren, dass Lloyd George, englischer
Munitionsminister, und Clemenceau, französischer Kriegsminister,
zuvor schon einen geheimen Vertrag abgeschlossen hatten,
den sogenannten Sykes-Picot Vertrag, der vorsah, das befreite
Land zwischen Frankreich und England aufzuteilen.
England sollte das Mandat für Palästina und Frankreich das
von Syrien erhalten.
Lawrence sah sich von seiner eigenen Regierung betrogen.
Zurück in England verweigerte er deshalb alle Ehrenorden,
die ihm für seine Verdienste im Kampf gegen die Türken vom
englischen König verliehen werden sollten. Er wollte weiter
für sein Versprechen kämpfen, das er im Auftrag seiner Regierung
den Arabern gegeben hatte. Er konnte sogar erreichen,
dass Feisal, Sohn des Haschemitenkönigs Husain, zu den Friedensverhandlungen
nach Frankreich eingeladen wurde. Doch
der wurde in Frankreich, wie auch später in England, mehr
als diplomatischer Tourist denn als Verhandlungspartner behandelt.
Thomas Edward Lawrence hatte die Vision gehabt, ein arabisches
Königreich unter der Einbeziehung von Palästina und
Syrien zu schaffen. Er setzte nun alle seine Hoffnungen auf
die USA, die es vielleicht als einzige Macht der Welt in der
Hand hatten, gegen alle vor dem und in dem Krieg getroffenen
geheimen Verträge vorzugehen und sie neu zu verhandeln.
Diese Hoffnungen erfüllten sich aber nicht.
Er zog sich verbittert zurück und nahm sogar einen ande-
150
ren Namen an. Er kam 1935 bei einem mysteriösen Motorradunfall
ums Leben. Bis zu seinem Tod war er über den Verrat
an seinen arabischen Freunden nicht hinweggekommen.
Die Engländer hatten eine andere Zusage an die Juden gemacht,
die die Züge eines Vertrags aufwiesen und als Balfour
Deklaration in die Geschichte einging.
Der Führer der zionistischen Bewegung Haim Weizmann ließ
sich 1904 in England nieder, um seiner Karriere als Chemiker
nachzugehen. 1906 wurde er Lord Balfour vorgestellt, der den
jungen Zionisten davon überzeugen wollte, dass sich Uganda
viel besser als Palästina als neue Heimat für die Juden eignen
würde. Doch Weizmann gelang es seinerseits, die eigenen Pläne
ihm und damit auch der englischen Regierung näherzubringen.
Als dann der Erste Weltkrieg begann und jede Unterstützung
anderer Länder für den Krieg gewonnen werden
musste, erwärmte sich auch die englische Regierung für die
Ideen des Zionisten. Die jüdische Lobby in den USA war groß.
Man musste auch den Deutschen zuvorkommen, denn Gerüchte
gingen um, dass sie ein Papier in Vorbereitung hätten,
das zum Inhalt hatte, den Juden bei der Schaffung einer Heimat
in Palästina jede Unterstützung zuteilwerden zu lassen.
Der mit Emir Husain abgeschlossene Vertrag wurde indessen
so ausgelegt, dass weder Jerusalem noch die Küstenregionen
Palästinas eingeschlossen waren und deshalb auch nicht
zur Deklaration im Widerspruch standen.
So konnte die Balfour-Deklaration entstehen, die Lord Balfour
dem einflussreichen Lord Rothschild, Jude und reichster
Mann der Welt, übergab. Sie lautete ins Deutsche übersetzt:
151
„Die Balfour-Deklaration
Foreign Office of Great Britain, 2. November 1917.
Sehr geehrter Lord Rothschild!
Ich habe die angenehme Aufgabe, Ihnen im Auftrag der
Regierung seiner Majestät mitzuteilen, dass folgende Deklaration
im Sinne der dem Kabinett unterbreiteten jüdisch-zionistischen
Anregungen beschlossen wurde:
His Majestys Regierung befürwortet die Schaffung einer nationalen
Heimat für das jüdische Volk in Palästina und wird alle
Anstrengungen unternehmen, die Durchführung dieses Projekts
zu erleichtern. Es versteht sich, dass nichts unternommen wird,
die zivilen und religiösen Rechte der nicht jüdischen Volksgruppen
in Palästina zu beschneiden oder die Rechte und den politischen
Status, die Juden in irgendeinem anderen Land genießen.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Zionistische Vereinigung
über diese Deklaration in Kenntnis setzen würden.
Ihr ergebener Arthur James Balfour“
Nachdem der Krieg für die Alliierten gewonnen war, kamen
die verschiedenen Verträge nach und nach ans Tageslicht
und auch deren Bedeutung. Vereinfacht gesagt hatten
die Engländer Palästina sowohl den Arabern als auch den Juden
für deren Hilfe im Krieg gleichzeitig versprochen. Doch
die Engländer entzogen sich zunächst der Affäre, indem sie –
entsprechend dem mit Frankreich geschlossenen Vertrag – ein
Mandat für Palästina einrichteten mit einem englischen Hochkommissar
an der Spitze. Sie hielten sich wieder einmal an
ihr bewährtes Prinzip teile und herrsche, mit dem sie in anderen
Ländern gut gefahren waren, wie z. B. in Indien – Moslems
und Hindus – sowie in Zypern – Türken und Griechen –
und hielten sich so aus dem sich anbahnenden Konflikt her-
152
aus. Sie erhielten auch ein Mandat für Transjordanien, dem
heutigen Jordanien, und für Mesopotamien, dem heutigen Irak.
In keiner Weise wurde auf die geografische Ausdehnung
und die kulturellen Strukturen der heimischen arabischen
Volksstämme Rücksicht genommen, ein Mitbestimmungsrecht
unberücksichtigt gelassen und willkürlich Grenzen gezogen,
die heute noch Konflikte nähren, wie das Beispiel Irak zeigt.
Die Araber hatten es nicht für möglich gehalten, dass ihr
Land Palästina, in dem wie schon erwähnt etwa 570.000 von
ihnen und nur 90.000 Juden lebten, ihnen entrissen werden
könnte.
Die einsetzende Judenverfolgung durch die Nazis in
Deutschland verschärfte die Situation, denn immer mehr jüdische
Einwanderer kamen oft auf abenteuerliche Weise aus
Europa in das kleine unfruchtbare Land, teils legal, teils illegal,
wie es so dramatisch in dem Buch Exodus beschrieben
worden ist. Tel-Aviv, eine von den Juden gegründete junge
Stadt in der Nähe Jaffas, platzte aus allen Nähten. Und viele
neue jüdische Siedlungen sprießen im ganzen Land wie Pilze
aus dem Boden.
Die Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Die Araber
reagierten mit Terroranschlägen. Und die Juden schlugen zurück.
Die Engländer verhängten hohe Strafen für gefasste Terroristen,
manch einer wurde öffentlich gehängt. Sie führten
nächtliche Ausgangssperren ein, ließen Militärfahrzeuge patrouillieren,
wie jeder weiß mit wenig Erfolg.
So hatten die ersten Auseinandersetzungen zwischen Juden
und Arabern, die friedlich zuvor in Palästina zusammengelebt
hatten, Anfang der 1920er-Jahre begonnen. Die Spannungen
und Terroranschläge von beiden Seiten eskalierten und
erreichten zwischen 1936 und 1939 ihren vorläufigen Höhepunkt.
153
Der Zweite Weltkrieg bricht aus
Man fragte: Was ist süßer als Honig?
Es wurde geantwortet: Essig, den man umsonst haben kann.
Doch dann geschah etwas, was niemand glauben wollte.
Sollte es tatsächlich zu einem neuen Weltkrieg kommen? War
der letzte nicht schon barbarisch genug gewesen? Hatte er
nicht schon viel zu viel Leid über die Völker gebracht?
Man schrieb den 1. September 1939, einen Sonntag. Mein
Vater hielt seinen Kopf ganz dicht an den Lautsprecher des
Radiogeräts. Den Langwellensender konnte man nur schlecht
empfangen.
Er murmelte vor sich hin: „Hitler wird doch nicht von allen
Geistern verlassen sein und einen Krieg anzetteln?“
Mein Vater hielt nicht viel von den Nationalsozialisten.
Warum auch? Hatten sie nicht sein Geschäft fast in den Ruin
getrieben? Seit zwei Jahren hatte die Colombo nicht mehr in
Beirut angelegt. Die Spannungen zwischen Juden und Arabern
wurden mit jedem neu zugewanderten aus Europa geflohenen
Juden größer. Und Hitler trug die ganze Schuld. So
war mein Vater, im Gegensatz zu manchen anderen in Jerusalem
lebenden Templern, nicht der Partei beigetreten.
Gegen 14:00 Uhr, immer noch das Ohr am Radiogerät, läutete
es Sturm an der Haustür. Die Nachricht war im Radio
noch nicht gekommen, dass England Deutschland, nach
Deutschlands Überfall auf Polen, den Krieg erklärt hatte. Das
geschah erst eine Stunde später um 15:00 Uhr Palästinazeit.
Ein gepanzertes englisches Militärfahrzeug war vor unserem
Haus vorgefahren, und Soldaten mit angeschlagenen Gewehren
standen vor der Tür.
„We came to arrest you, Mr. Kuebler“, hatte einer von ih-
154
nen gesagt. „Sie haben fünf Minuten Zeit, das Notwendigste
zusammenzupacken.“
Als er abgeführt wurde, drückte meine Mutter meinem Vater
noch eine Wolldecke in die Hand. Wir wussten nicht, wo
er hingebracht werden sollte. Wir ahnten auch nicht, dass dies
ein Abschied für viele Jahre werden sollte.
Er wurde in das Gefängnis in Jerusalem für Schwerverbrecher
geworfen. In eine dunkle, feuchte Zelle, wo man die eigene
Hand vor dem Gesicht kaum erkennen konnte, mit finsteren
Gesellen und Ratten. Es stank fürchterlich, denn eine Ecke
des Raums diente als Toilette. Die feindseligen Blicke der eingesperrten
Araber beängstigten ihn. Es kam ihm jetzt zugute,
dass er fließend arabisch sprechen konnte.
Nach drei Tagen wurde er endlich dem Haftrichter vorgeführt.
Der diplomatische Protest seines einflussreichen Bruders
Jona, der natürlich als Schweizer frei war, half vielleicht,
und er wurde, wie alle anderen deutschen Männer im wehrpflichtigen
Alter, in das schon seit Monaten vorbereitete, die
Engländer hatten den Krieg erwartet gehabt, Gefangenenlager
bei Akko nördlich von Haifa verlegt, wo die Bedingungen
menschlicher waren.
Warum mein Vater als einziger Deutscher der Kolonie, der
als ungarischer Konsul eigentlich diplomatische Immunität
besaß, von den Engländern wie ein Schwerverbrecher behandelt
wurde, ist bis heute rätselhaft geblieben.
Hatte der englische Geheimdienst CID (Crime Investigation
Department) falsche Hinweise erhalten, dass mein Vater
mit den Nazis kollaboriert hatte? Warum war er als Deutscher
ungarischer Konsul geworden? Was steckte dahinter? Warum
war er nicht wie andere Templer Parteigenosse geworden?
Um vielleicht als Kollaborateur nicht aufzufallen?
Mein Vater musste jetzt dafür bezahlen, dass er damals in
155
Deutschland wieder Deutscher geworden und nicht Amerikaner
geblieben war. Als Amerikaner wäre er dem Schutz der
USA unterstellt gewesen und niemand, zuallerletzt die Engländer,
hätten je gewagt, ihm nur ein einziges Haar zu krümmen.
Nicht nur mit den drei Tagen im Gefängnis sollte er dafür
bezahlen, nein, er musste fast neun lange Jahre in der Internierung
bleiben, getrennt von seiner Familie, und er sollte auch
sein ganzes Hab und Gut verlieren.
Aber wer weiß, wie es ohne die Internierung gelaufen wäre,
denn mein Vater hatte, jetzt 55 Jahre alt, wie bereits erwähnt
gesundheitliche Probleme, die er selbst zu verantworten hatte.
In der Internierung waren die Beschwerden bald wie weggeblasen,
da alle die Auslöser entfielen. Kein türkischer Kaffee
mehr, kein Arrak, keine Zigaretten, keine Aufregungen und
viel, viel Zeit für sich selbst. Er war gezwungen, ein enthaltsames
Mönchsleben zu führen.
So gesehen war es für ihn ein Segen, dass er aus dem Trott
mit Kriegsbeginn herausgerissen wurde. Er wäre sicher nicht
87 Jahre alt geworden.
Meine Mutter, Schwester und ich wurden ein halbes Jahr
später mit allen anderen Deutschen aus Jerusalem auch interniert.
Die Engländer hatten die Templersiedlung Sarona, eine
Gemeinde mit etwa 500 Einwohnern, bei Tel-Aviv gelegen, in
ein Internierungslager für Frauen, Kinder und alte Männer
umfunktioniert. Unter den Internierten befanden sich nicht
nur Templer, sondern auch evangelische und katholische
Deutsche, die in Jerusalem in christlichen Missionen, Krankenhäusern
und sozialen Einrichtungen, wie z. B. das im ganzen
Vorderen Orient bekannte, von der Familie Schneller im
vorigen Jahrhundert gegründete Syrische Waisenhaus, wo ara-
156
bische, meistens blinde Waisen betreut wurden tätig waren.
Auch waren interessanterweise viele Juden dabei, die noch
die deutsche Staatsbürgerschaft besaßen. Alle wurden bei den
sesshaften Familien in Sarona einquartiert, sodass das Lager
schätzungsweise 800 Internierte aufwies.
Zweimal in der Zeit von September 1939 bis Ende 1942
durften die Frauen ihre Männer und Kinder ihre Väter im
Barackenlager in Akko für einige Stunden besuchen. Das
zweite Mal konnten wir die Männer nur von der Ferne, am
Stacheldrahtzaun stehend, sehen. Der Lagerkommandant
hatte angeordnet, dass sich alle Frauen einer von Soldaten
durchgeführten Leibesvisitation unterziehen müssten. Da sie
sich dazu ganz ausziehen sollten, war das für die Frauen so
erniedrigend, dass sie auf den Besuch ganz verzichteten, und
die Busse unverrichteter Dinge wieder zurückfuhren.
157
Die Templersiedlung Sarona
Was das Auge nicht sieht, tut dem Herzen nicht weh.
„Ich bin nur eine Blume in der Ebene Saron, eine Lilie aus
den Tälern. Aber wie eine Lilie unter den Dornen ist meine
Freundin unter den Mädchen!“ Hohelied 2/1-2.
Schon zu biblischer Zeit war Saron, hebräischer Begriff für
Ebene, Flachland, eine relativ fruchtbare Landschaft in Israel,
wo gelegentlich Rosen unter Dornen zu bewundern waren,
die sich einer hohen Wertschätzung erfreuten. Auch Lilien
waren zu finden, wie aus dem Text des Hoheliedes hervorgeht.
Hier erwarb der Gründer und Vorsteher der Tempelgesellschaft
Christoph Hoffmann im Jahr 1868 für die Gesellschaft
etwa drei Kilometer nordöstlich von Jaffa 60 Hektar Land, also
in der Saron Ebene, die sich entlang der Küste des Mittelmeers
von Jaffa, durchschnittlich 15 Kilometer breit, bis hin zum
Karmel Gebirge bei Haifa erstreckt. Es ist eine fruchtbare Ebene,
aber sandig an der Küste und sumpfig im Süden bei Jaffa.
Das gekaufte Land war für Mitglieder bestimmt, die Ackerbau
betreiben wollten.
Die entstandene Siedlung wurde, dem Namen der Ebene
folgend, Sarona getauft, als sie 1871 eingeweiht wurde.
Die Siedlung hatte eine Kreuz- und eine Querstraße, die sie
in vier etwa gleich große Sektoren teilte. Die Bauparzellen an
der Kreuzung wurden für gemeinnützige Bauten wie das Gemeindehaus
mit einer Schule, die Gemeindekirche (Saal) und
einen Wasserturm reserviert.
Die Anfänge gestalteten sich schwierig, denn der nahe gelegene
Wadi el Musrara mit seinen Sümpfen war ein idealer Lebensraum
für Moskitos, die, mit Malaria infiziert, die Krankheit
auf die Siedler übertrugen. Viele starben, nicht nur an
158
159
Malaria, sondern auch an Ruhr und Typhus. Das Fortbestehen
der Kolonie war bedroht. Erst nachdem es mit importierten
Eukalyptusbäumen gelungen war, die Sümpfe trocken zu
legen, verbesserten sich die Lebensverhältnisse. In den folgenden
Jahren entwickelte sich Sarona zu einer der blühendsten
Siedlungen aller Volksgruppen in ganz Palästina. Die Siedler
bauten Gerste und Weizen an, sie legten Plantagen mit Bananen
und Zitrusfrüchten an und kultivierten Wein, der sogar
nach Deutschland exportiert werden konnte. Die Jaffa Orange
war durch ihre Qualität weltbekannt geworden.
Um 1882 hatte die Siedlung etwa 200 Einwohner.
Heute ist Sarona ein Teil von der heute größten Stadt Israels,
Tel-Aviv – in Hebräisch heißt Tel-Aviv Hügel des Frühlings
–, geworden, die erst viel später im Jahr 1907 gegründet
wurde. Sarona wurde nach der Gründung des Staates Israel
in Hakirya umbenannt. Die Geschichte von Sarona ist in dem
umfassenden, in Englisch geschriebenen Werk von Helmut
Glenk, Horst Blaich und Manfred Haering aufgezeichnet: From
Desert Sands to Golden Oranges, 2005 erschienen, ISBN 1-4120-
3506-6.
160
Ein späterer Besuch in Sarona
Es trifft dich nur das, was für dich bestimmt ist.
Im Jahr 1985 hatte ich bei einer Studienreise durch Israel
Gelegenheit, Sarona zu besuchen. Die ehemalige Siedlung hatte
am Anfang des Zweiten Weltkriegs als Internierungslager
gedient für viele Templerdeutsche, aber auch andere Deutsche,
die in Palästina lebten. Ich hatte als Elfjähriger im Lager
Modellflugzeuge geschnitzt und an der Außenwand neben
einem Luftschacht unseres Hauses, in dem wir wohnten, vergraben.
„Die Flugzeuge bleiben hier!“, hatte meine Mutter unmissverständlich
gesagt und damit jeden Einwand im Keim erstickt.
Wir mussten unsere Habseligkeiten packen, um nach
Deutschland gegen andere Gefangene ausgetauscht zu werden.
Jeder durfte nur 20 kg mitnehmen. Die Flugzeuge waren
zu sperrig und wogen auch etwas. Ich aber gab einen feierlichen
Schwur ab:
„Ich werde euch eines Tages wieder holen und wenn ich ein
Leben dazu brauche.“
Das war natürlich nicht der einzige Grund, weshalb ich Sarona
wiedersehen wollte, doch ein gewichtiger. In Tel-Aviv
fragte ich einen älteren Passanten, ob er sich vielleicht an eine
deutsche Siedlung in unmittelbarer Nähe Tel-Avivs erinnern
könnte oder ob er jemals etwas von Sarona gehört hätte.
„Nein, da müssen Sie sich täuschen. In der Nähe von Tel-
Aviv hat es nie eine deutsche Siedlung gegeben. Ich würde es
wissen, denn ich lebe schon 50 Jahre in diesem Land und schon
sehr lange in dieser Stadt.“
Vielleicht wusste ein alter Taxifahrer mehr. Am Taxistand
konnte sich ein etwa 65-Jähriger tatsächlich an die Siedlung
erinnern.
161
Ja, Sarona hätte es gegeben. Da hätten vor dem Krieg etwa
500 Deutsche gelebt. Er glaube, sie hätten sich Templer genannt.
Sie hätten Landwirtschaft betrieben, hätten über große
Orangenplantagen verfügt und auch Wein angepflanzt. Sie
seien sehr fleißig gewesen und hätten sich schmucke Steinhäuser
gebaut. Sie hätten viel zur wirtschaftlichen Entwicklung
des damaligen Palästinas beigetragen.
„Ich kann Sie dorthin fahren, wenn Sie wollen. Sie werden
staunen, wie sich alles verändert hat.“
Ich schaute mir den Stadtplan von Tel-Aviv an, den ich mir
zuvor besorgt hatte. Hier konnte ich sehen, dass sich im Norden
entlang der Siedlung die breite Boulevardstraße Sederot
Shaul Ha-Melekh hinzog, an der sich auch das Museum und
der IBM Hochhauskomplex befanden, im Osten befand sich
die Durchgangsstraße Derekh Petah Tiqua, im Süden die Straße
Ha-Hashmondin und im Westen Leonardo da Vinci. Mitten
durch Sarona aber. von Westen nach Osten, lag die Kaplanstraße,
die die Fortsetzung der bekanntesten Einkaufsstraße
Tel-Avivs darstellte, mit Namen Digengoff, benannt nach dem
ersten Bürgermeister von Tel-Aviv. Sarona war auf dem Stadtplan
nicht erwähnt, dafür aber stand an der Stelle in fetten
Lettern: Verteidigungsministerium.
Ich war überrascht und gespannt, ob ich überhaupt noch
etwas von Sarona erkennen würde.
Sarona lag auf einem flachen Hügel und hatte eine Ausdehnung
von etwa einem Quadratkilometer. Ich schätze, dass auf
dem Gebiet etwa 150 Häuser standen. Auf dem Scheitelpunkt
des Hügels kreuzten sich rechtwinklig zwei Straßen. Natürlich
waren sie damals nicht geteert und wenn es regnete, klebte
der Lehm an den Schuhen. Eine davon war jetzt die bereits
genannte Kaplanstraße, die breit und geteert vor mir lag. Ich
162
dankte dem Taxifahrer, bezahlte und stieg aus. War das Sarona?
Die linke Seite der Kaplanstraße, also der nördliche Teil von
Sarona, war nicht wiederzuerkennen. Betonbauten und mittlere
Hochhäuser erhoben sich, wo einst die schmucken Siedlungshäuser
standen. Ein neues Hochhaus war gerade im Bau.
Es war schon etwa 70 m hoch und viele Radarschirme waren
bereits angebracht.
Einige der damaligen Häuser glaubte ich jedoch, einordnen
zu können. Der Zugang zu dieser Seite war untersagt. Hier
waren die vielen Behörden des Verteidigungsministeriums
untergebracht, ein hoch sensibles militärisches Sperrgebiet. Ich
glaubte, jetzt vor dem ehemaligen Haus der Wellers zu stehen,
in das wir einquartiert worden waren. War dies das
Schlafzimmerfenster, das jetzt direkt an der Straße lag? War
hier nicht ein schattiger Vorgarten mit hohen Bäumen gewesen?
Er hatte wohl zur Verbreiterung der Straße weichen
müssen.
Als ich mich streckte und in das Zimmer schielen wollte,
stand ein bis an die Zähne bewaffneter Soldat vor mir.
„Was suchen Sie hier. Zeigen Sie mir mal Ihre Papiere!“
Wenn ich ihm erklärt hätte, dass ich an der Hauswand graben
wollte, um Spielzeugflugzeuge herauszuholen, die ich vor
vielen Jahren als Jugendlicher versteckt und mir geschworen
hatte, sie eines Tages wiederzuholen, hätte er mich mitgenommen
und ich hätte endlose Verhöre über mich ergehen lassen
müssen. Wie lange das gedauert hätte! Ich hätte sicher den
Anschluss an die Reisegruppe verloren.
Ich gab mich kooperativ und nach eingehendem Studium
meines Reisepasses ließ er mich weiterziehen. Schließlich konnte
man sich auf der Kaplanstraße frei bewegen, allerdings war
fotografieren überall streng verboten.
163
Meinen jugendlichen Schwur, die zwanzig in mühevoller
Schnitzarbeit hergestellten Modellflugzeuge, mit einem Rumpf
aus poliertem, hartem, herrlich gemasertem Olivenholz mit
eingesetzten Aluminiumflügeln – alle sorgfältig in wasserdichte
Dachpappe verpackt und zu einem Paket verschnürt –
wie einen Schatz zu heben und aus ihrem Versteck zu befreien,
musste ich wohl oder übel brechen.
Ich war auf der kleinen Anhöhe an der Kreuzung angelangt.
Gegenüber auf der rechten Seite konnte ich unverändert den
Saal erkennen, das ehemalige Gottes- und Gemeinschaftshaus
der Templer. Dahinter hob sich der Wasserturm, ein großer
Betonbehälter auf Betonstützen, gegen den blauen Himmel ab.
War er noch in Betrieb? Neben dem Saal war früher die Schule
angesiedelt. Sie war verschwunden und hatte anderen Bauwerken
im Barackenstil Platz gemacht. Von dem Pinienwäldchen,
das unser Schulhof war, war nichts mehr zu sehen.
Insgesamt machte die Siedlung, die auf der rechten Seite deutliche
Merkmale von Sarona aufwies, einen traurigen Eindruck,
da die Stilelemente der grauen, glatten Betonbauten den
württembergisch geprägten Steinhäuschen übergestülpt worden
waren. Es scheint jedoch, dass eine durchgreifende, großzügigere
Planung bald diesem architektonischen Durcheinander
ein Ende setzen und danach nichts mehr an Sarona erinnern
wird. Am Ende der Kaplanstraße im Osten entdeckte
ich zu meiner Freude das von mir so geliebte Eukalyptuswäldchen.
Das war der Anfang von Sarona gewesen. Die Templer
hatten in der Gründerzeit eine Delegation nach Afrika geschickt,
um von dort Bäume nach Palästina zu bringen, die
hier gedeihen könnten. Es war der Orangenbaum dabei und
der Eukalyptusbaum.
Die Sümpfe bei Sarona mussten trockengelegt werden. Der
Eukalyptusbaum spielte dabei die entscheidende Rolle. Er ent-
164
zog dem Boden sehr viel Wasser und wuchs bis zu sieben Meter
im Jahr. Das Trockenlegen der Sümpfe war eine vordringliche
Aufgabe, sonst hätte man die Siedlung in diesem Gebiet
wegen der vielen Todesfälle aufgeben müssen, die die Malaria
seinerzeit forderte.
Die stattlichen Bäume standen vor mir. Sie waren 44 Jahre
älter geworden. Würde ich den Baum noch finden, in dessen
dicke Rinde ich mit meinem Taschenmesser tief die Buchstaben
SK und HB eingeschnitzt hatte? Die Buchstaben standen
für meinen Namen und den von Helga Baldenhofer, einem
gleichaltrigen Mädchen, in das ich mich mit elf unsterblich
verliebt hatte.
Ich fand einen Baum, dessen Rinde Vernarbungen zeigte,
und ich bildete mir einfach ein, dass das die gesuchten Buchstaben
waren. Von diesem Baum nahm ich einige am Boden
herumliegende Samen mit, weil meine Erinnerung wach bleiben
sollte.
Ich hatte etwas gefunden, das den Besuch in Sarona lohnenswert
gemacht hatte, auch wenn ich meinen Schwur gebrochen
hatte.
Wo sollte ich aber die Samen pflanzen? In Deutschland
würde ein Eukalyptusbaum bei dem ersten Frost eingehen.
165
Das ältere Wohnhaus „Jonathan Weller“ in Sarona
Fenster
In diesem Haus wohnten wir während der Gefangenschaft in Sarona.
Unterhalb des Fensters, direkt an der Wand in etwa 50 cm Tiefe, habe
ich die gebastelten Spielflugzeuge, in Dachpappe eingepackt, im
Sommer 1942 vergraben. Sie hatten einen Rumpf aus Olivenholz,
Flügel aus Aluminiumblech und eine Spannweite von vielleicht 10 cm.
Bilder im Jahr 2006 zur Verfügung gestellt von:
Ariel Atzil und Shay Farkash, member of the Society for Preservation
of Historic Sites in Israel.
Das dahinter liegende neue Wohnhaus „Jonathan Weller“
166
Bei Familie Weller
Ein Buch ist wie ein Garten, den man in der Tasche trägt.
Meine Mutter, meine Schwester und ich wurden in das Haus
der Familie Jon Weller eingewiesen. Frau Weller hatte für uns
ein großes Zimmer freigemacht mit einem Ausgang in einen
kleinen Vorgarten entlang der staubigen Hauptstraße der
Siedlung.
Die Wellers besaßen einen relativ großen Bauernhof mit Pferde-,
Kuh- und Schweineställen. Etwa fünf Araber waren als
landwirtschaftliche Arbeiter angestellt. Sie bestellten die Felder
und bewässerten die Orangenhaine außerhalb des Gefangenenlagers,
kamen frühmorgens an und verließen den Hof
vor Dunkelheit, um in ihre Dörfer zurückzukehren. Allerdings
wohnte eine Familie mit ihren Kindern auf dem Hof in einer
Baracke. Die Mutter pflegte im Freien zu kochen. Sie entfachte
ein kleines Holzfeuer und stülpte eine große mit etwas Olivenöl
eingeriebene Blechschüssel umgekehrt über die Flammen.
Sie goss einen dünnen, stark gesalzenen Weizenmehlbrei
geschickt darüber. Nach wenigen Minuten war der dünne
Fladen, dünner als ein Pfannkuchen, gebacken und sie zog
ihn von der Schüssel ab. Zum Essen saß die Familie am Boden,
umgeben von diversen Tonschalen, die Oliven, Tomaten,
Zwiebeln und gemahlene Sesampaste, sogenannte Tine, enthielten.
Vom Fladen wurden Stücke abgerissen, zusammengerollt,
in die Paste getunkt und zusammen mit Oliven, Tomaten
und Zwiebeln gegessen. Nur bei besonderen Anlässen
gab es dazu etwas Hammelfleisch mit Couscous oder Reis.
Ganz besonders gut mundete das von ihr hergestellte Kebab,
Spießchen aus gemahlenem Lammfleisch mit untergerührten
geschnittenen Zwiebeln, Salz, Pfeffer und reichlich Petersilie,
die dem Kebab seinen unverwechselbaren Geschmack verlieh.
167
Sie hatte mir eines zum Probieren
gegeben, das über glühender Holzkohle
gegrillt worden war. In meinem
ganzen Leben habe ich nie wieder ein
vergleichbar köstliches Kebab gefunden.
Die Bestellung der Felder ließ zu
wünschen übrig, da es Jon (Jonathan)
Weller, der schon etwas älter war und
nicht in das Männerinternierungslager
Akko gekommen war, aus welchen
Gründen auch immer, natürlich
nicht gestattet wurde, das Lager zu
verlassen, um nach dem Rechten zu Ruth und Patrick McCorry
sehen.
Er hatte das Aussehen eines richtigen Bauern mit wettergegerbtem
Gesicht, worin blaue Augen strahlten. Tante Karoline
hatte ebensolche Augen. Er war schlank im Gegensatz zu
Tante Karoline, die sich in ihrer Fülle kaum bewegen konnte.
Sie hatten eine Tochter Ruth, die etwa 18 Jahre alt war. Sie
trug meistens ein Dirndl mit einem tief sitzenden, freizügigen
Ausschnitt, der ihre melonengroßen Brüste, aufrecht getragen,
zum Blickfang jeden Besuchers machten. So sehr man sich auch
bei einer Unterhaltung mit ihr bemühte, ihr dabei in die Augen
zu sehen, blieben die Blicke schließlich an ihrem übergroßen
Busen hängen. Ihrer pietistischen Mutter war das gar nicht
recht und wenn sie ihrer Tochter empfahl, den Ausschnitt
nicht so tief zu tragen, war er am nächsten Tag noch einige
Millimeter tiefer gerutscht.
Die Schönheit des rothaarigen Mädchens war auch dem
etwa 35-jährigen englischen Lagerkommandanten nicht entgangen,
der der Familie immer wieder einen Besuch abstatte-
168
te. Er hatte sich unsterblich in Ruth verliebt und verbrachte
manche Stunde mit ihr auf der Terrasse des Hauses und ließ
sich Tee servieren. Und wo die Liebe hinfällt, gibt es keine
Schranken. Die beiden heirateten.
Tante Karoline, wie wir Kinder Frau Weller nennen durften,
weil eine weitläufige Verwandtschaft ausgemacht werden
konnte, war eine hervorragende Köchin. Das Essen nahmen
wir im ersten Jahr gemeinsam auf der offenen, aber überdachten
Terrasse ein. Schwäbische Spätzle vom Brettchen ins
kochende Wasser von Hand geschabt und abgeschöpft mit
Butter angelassen konnte sie wie keine andere machen. Dazu
gab es Schweinekrustenbraten mit reichlich Soße, die durch
Zwiebeln und Tomaten eine unvergleichliche Würze erhielt
und in der auf dem Teller die Spätzle schwammen.
Mir gegenüber saß am Tisch Graf Lüttichau. Er war Deutschjude,
war aus Deutschland geflohen und in Palästina als Deutscher
von den Engländern interniert worden. Das Abendessen
wurde eingenommen, wenn die Sonne schon untergegangen
war, was in Palästina im Sommer auch nicht später als
19:00 Uhr geschah. Nach Osten konnte man den oft sehr klaren
Sternenhimmel von der Terrasse aus bewundern. Die Sterne
waren manchmal so nah, dass man meinte, sie fassen zu
können. Ich hing an den Lippen des Grafen, wenn er über die
Sterne erzählte.
„Alle Sterne, die du am Himmel siehst, gehören zum Milchstraßensystem“,
erklärte er mir.
„Der milchige Streifen, der quer über den Himmel läuft, wird
durch Sterne gebildet, die hier besonders nahe beieinanderliegen.
Daher der Name des Systems. Nur einen Stern am Himmel,
den wir mit bloßem Auge sehen können, gehört nicht
dazu. Vielleicht kannst du ihn dort erkennen“, und er zeigte
mit dem Finger in eine Richtung.
169
„Das ist der Andromeda-Nebel und damit auch kein einzelner
Stern, sondern ein Spiralnebel. Man nennt diese Spiralnebel
auch Galaxien, die aus Milliarden von Sternen bestehen.
Der Andromeda-Nebel hat etwa die Größe der Milchstraße,
die natürlich auch ein Spiralnebel ist. Im Milchstraßensystem
hat es etwa 400 Milliarden Sterne. Eine Milliarde ist eine
Zahl mit neun Nullen! All diese Sterne sind Sonnen wie unsere
Sonne, teils viel größer, teils kleiner, und viele könnten wie
unsere Sonne Planeten besitzen. Weißt du, dass unsere Sonne
von Planeten umkreist wird, die selbst nicht leuchten und
trotzdem am Himmel sichtbar sind, weil sie das Licht unserer
Sonne reflektieren? Du hast sicher von den Planeten schon
gehört. Merkur, Venus, Erde, Mars, Jupiter, Saturn, Neptun
und Pluto. Ja, unsere Erde ist nur einer der kleineren Planeten,
der die Sonne umkreist.
Und stell dir vor, es gibt Milliarden von Galaxien im Weltall,
von denen man viele mit einem guten Teleskop erkennen
Das neue Jon Weller Haus
170
Eigentümer der Häuser in Sarona (unvollständig)
Der nebenstehend abgebildete Plan wurde freundlicherweise von Ariel
Atzil und Shay Farkash (s. auch S. 111) zur Verfügung gestellt.
01 Weiss, Christian
02a Weinkeller
U2b Co-opershop, Weinkeller
03 Weinkeller, Wohnungen
04 Weber, Heiner
05 Knoll, Karl
07 Lämmle, Fritz, Otto und Lina
08 Kübler, Karl 1.
09a Saal
09b Verkaufsladen
09c Kindergarten
10 Jung, Heinrich
11 Weiss, Jakob
12 Groll, Phillip
13 Kübler, Carl
14 Kübler, Fritz
15 Weinmann, George
16 Ehnis, Ludwig (Hoefer)
17 Baldenhofer, Friedrich
18 Weinkeller, Druckerei u. Wohnung
19 Lämmle, Wilhelmine
20a Pflugfelder, Christian
20b Ölmühle (Pflugfelder)
21 Günther, Wille (Café)
22a Weller, Georg
22b Mamlock & Jakob, (Drogerie)
23 Fröschle, Karl
24 Graze, Gottlob
25 Altes Gemeindehaus
26 Häring (Geschwister)
27 Weller, Jakob
28 Groll, Samuel
29 Aberle, Wilhelm
30 Wennagel, Josef
31 Weiss, Johann
32 Jung, Jakob
33 Sickinger, Jakob
34 Weller, Jon
35 Orth, Johannes
36 Jung, Otto
37 Wasserturm
38a Grözinger, Willi
38b Grötzinger, (Metzgerei)
39 Weller, Samuel
40 Steller, Karl
41 Weller, Rudolf
171
Stacheldraht im
Zweiten Weltkrieg
Sarona
172
kann. Aber das ist natürlich nicht alles. Das Weltall dehnt sich
mit unvorstellbarer Geschwindigkeit aus. Wohin? In die Unendlichkeit?
Gibt es so etwas überhaupt?“
Die für mich unvorstellbare Größe des Weltalls erschreckte
mich, aber machte mich auch gleichzeitig neugierig. Alles, was
die Menschen darüber wissen, wollte ich erfahren, wollte ich
lernen, und dieser Wissensdrang hat bis spät in mein Mannesalter
angehalten.
„Hört das Weltall denn gar nie auf, kann es denn gar nie
aufhören?“, kam es über meine Lippen. Die Vorstellung von
etwas Unendlichem bereitete mir Kopf- und Magenschmerzen.
„Ja“, entgegnete er nachdenklich. „Vielleicht ist es unendlich.
Wir können das mit unserem begrenzten Verstand nicht
nachvollziehen. Und wenn wir länger darüber nachdenken
würden, würden wir meschugge werden. Aber ein jüdischer
Wissenschaftler, namens Einstein, hat eine neue Theorie entwickelt.
Er hat die Zeit als weitere Dimension eingeführt. Die
drei Dimensionen kennst du sicher, Länge, Breite, Höhe. Er
sagt, dass der Raum gekrümmt sei. Das würde bedeuten, dass
man auf einer Reise durch den Raum irgendwann an die ursprüngliche
Stelle zurückkehren würde. Das würde bedeuten,
dass das Weltall nicht unendlich ist.“
Was er erzählte, war so geheimnisvoll und spannend für
mich, dass ich ihn ein Loch in den Bauch fragte. Er erklärte
mir, wie man am Himmel den nicht so stark leuchtenden Polarstern
finden kann, der immer im Norden stünde, ganz
gleich, auf welcher Stelle ich mich der Erde befände.
„Du musst dir das so vorstellen: Der Polarstern liegt auf der
Verlängerungslinie der Erdachse. Von der Südhalbkugel
kannst du ihn natürlich nicht sehen, da dir dann die Erde selbst
im Weg ist. Du musst zuerst lernen, den Großen Wagen am
173
Himmel zu entdecken. Das ist nicht schwierig, denn der Wagen
besteht aus vier hellen Sternen und die Deichsel davor
aus drei. Der mittlere Stern mit dem Namen Mizar hat einen
kleinen Reiter Alkor dabei, den du mit deinen scharfen Augen
sehen müsstest. Die beiden Sterne haben aber tatsächlich nichts
miteinander zu tun, sondern stehen nur zufällig in derselben
Richtung. Ich kann den Reiter nicht mehr mit dem bloßen Auge
sehen, dazu brauche ich eine Brille. Verlängere die Hinterachse
des Wagens fünfmal im Geiste und du landest direkt auf dem
Polarstern, der übrigens das Ende der Deichsel des Kleinen
Wagens darstellt.“
Manchmal konnte ich es nicht erwarten, bis er den letzten
Bissen geschluckt hatte, denn meine Mutter hatte mir eingebläut:
„Lass ihn zuerst essen, bevor du ihn mit deinen Fragen
bombardierst.“
Graf Lüttichau war ein großer hagerer Mann, der hin und
wieder eine Brille trug. Er war bestimmt schon 60 Jahre alt, er
war braun gebrannt und glatt rasiert, immer höflich und den
Damen gegenüber zuvorkommend, wie man es von einem
Grafen erwartete, und seine Geschichten, die er erzählte, handelten
nicht nur von den Sternen, sondern auch von vielen
anderen Wissensgebieten.
Sein Zimmer lag zur Hauptstraße hin, und er pflegte nach
dem Mittagessen einen Mittagsschlaf zu halten. Da durfte man
keinen Lärm machen. Wir unterhielten uns um die Mittagszeit
nur leise, denn einmal hatte er losgewettert in seinem dann
durchkommenden Jiddisch und gebrüllt: „Wer hat gemacht
Radau?“
Einmal jedoch schrie er so laut, dass wir in sein Zimmer
stürzten und fragten, was denn passiert sei. Entsetzt starrte
er uns mit offenen Augen an und brüllte: „Herr, nundiekass!
174
Eine Schlange, eine Schlange ist zwischen meinen Beinen!“
Der erste Ausdruck war ein jiddischer Fluch.
Und tatsächlich! Sie war wahrscheinlich durch die offene
Tür ins Bett gekrochen. Sie hatte ihn nicht gebissen, sondern
schnell das Weite gesucht. Ich konnte mir nichts Entsetzlicheres
vorstellen, als im Bett zu spüren, wie eine Schlange die
Beine entlang zu den Lenden kriecht.
Neben mir saß Madame Silberstein. Sie war auch Deutschjüdin
und in dem Lager völlig fehl am Platz. Sie war aus Beirut
gekommen und hatte ebenfalls viel zu erzählen.
„Gehabt hab ich Massel, dass die Franzosen nicht mich ins
Gefängnis in Beirut einlocht haben. Ich hab Zores gehabt großen
wegzukommen. Hatte zuvor ich in meinem Geschäft einen
guten Reibach gemacht! Hatte in der oberen Etage wunderschöne
Zimmer, die mit rotem Plüsch ausgeschlagen waren
und eingerichtet. Schicksen hatte ich von der ganzen Welt,
rissen sich bei mir um Anstellung. Unsere Kunden waren nur
Prominente, auch von Palästina, Diplomaten und Geschäftsleute.
Gingen ein und aus. Ich könnte einige Namen nennen
von der ganzen Mischpoke, die Ihnen alle geläufig wären, sogar
die Namen von einigen Templern. Die waren alle gut betucht.
Manche hatten aber eine Macke ab, andere miese Typen waren,
aber alle waren sie jeck. Wenn sie nach ihrem gemachten
Geschäft wieder gingen, waren sie meistens ganz schön schicker.
Das war dann ein gut gemachter Reibach für mich. Ich
als seriöse Geschäftsfrau nenne selbstverständlich keine Namen,
das gehört sich nicht.“
Graf Lüttichau, dem ihre freimütige Erzählung peinlich war,
warf ein:
„Jetzt ist aber genug mit diesem Stuss“, worauf sie still wurde
und nur noch ihre dick rot lackierten, langen Fingernägel
betrachtete, dann die über ihre übergroßen Brüste spannen-
175
de, gelbe Bluse zurechtrückte und an ihren aufgeklebten Augenwimpern
zupfte.
Anmerkung zu den jiddischen Ausdrücken:
meschugge – hebr. meschugä
= verrückt
Herr, nundiekass! – hebr. käass
= Zorn
Massel – hebr. Masäl = Gestirn, das Glück bringt
Zores – hebr. zarä
= Sorgen
Reibach – hebr. rewach
= Zins, Gewinn
Schikse – hebr. Schekez = Mädchen, Reptil
Mischpoke
= Gesindel, Verwandtschaft
betucht – hebr. batüuach
= zuverlässig
Macke – hebr. ma-kä
= Hieb, Schlag
mies – hebr. miüss
= ekelhaft
jeck- hebr. agur ben Jake = zu dumm für Menschen
schiker – hebr. schikör
= betrunken
Stuss – hebr. schtüh = Unsinn, albernes Gerede
Tante Karoline fügte in astreinem Schwäbisch hinzu:
„Frau Silberstein, sie könnet morgen in der Küche hälfe, dann
habetse was Vernünftiges zu tua und kommet auf keine dumme
Gedanka.“ Sie hatte schon bemerkt, wie ihr Mann Madame
Silberstein verstohlen mit seinen Augen abtastete.
Ich hatte damals als Junge noch nicht verstanden, was die
Mädchen bei ihr in den plüschbeschlagenen Zimmern zu tun
hatten, und auf meine Frage an meine Mutter schüttelte sie
nur mit dem Kopf, ohne eine Erklärung abzugeben.
Doch Ruth hatte dem Gespräch aufmerksam zugehört. Sie
wusste offensichtlich, welche Arbeit die Mädchen verrichtet
hatten.
Schräg gegenüber saß mein Onkel Jonathan.
Er schimpfte oft über die unzureichende Bestellung seiner
176
Felder. „Heute hat mir Achmed berichtet, dass die Traubenernte
ausfallen wird. Alle Trauben sind von den Reben gestohlen
worden. Diese Drecksäcke!“
Indem er das sagte, spuckte er auf den Boden, eine hässliche
Angewohnheit, die selbst Araber verabscheuten. Ich konnte
mich an die Schilder in jedem Bus von Jerusalem erinnern,
auf denen in großen Buchstaben stand: No Spitting! Das waren
die ersten englischen Worte, die ich zu lesen vermochte.
Und er wischte sich anschließend mit seinem rauen Handrücken
über die Lippen, als ob er etwas wegschieben wollte.
Er hatte eine kleine, stecknadelgroße Wunde an der Oberlippe.
Wenn sich eine Blutkruste gebildet hatte, ließ er sie nicht
heilen, sondern kratzte sie immer wieder mit den Fingernägeln
ab. Die Wunde wurde von Woche zu Woche größer und
schließlich suchte er den im Lager praktizierenden Arzt Dr.
Hoffmann auf. Überzeugter Templer und in direkter Linie vom
Gründer Christoph Hoffmann abstammend, war er ein erfahrener
Arzt. Er erklärte Jonathan, dass die Wunde gar nicht
gut aussehe und er sie keinesfalls mehr berühren dürfte. Der
Handrücken wäre schon schlimm genug und das Abkratzen
der Kruste das Verkehrteste, was er machen konnte. So könne
sie nie heilen.
Die Wunde war bald pfenniggroß, dann so groß wie eine
Dollarmünze und sie war auch schon tief geworden, bis sie
dann die Lippe durchgefressen hatte und man den Kiefer sehen
konnte.
Das Unheil nahm seinen Lauf. Der arme Mann wurde in
eine Klinik nach Tel-Aviv geschickt, um dort den Fortgang
durch Auflegen von Radium zu stoppen. Das Radium erzeugte
die erforderliche Strahlung, mit der man glaubte, den Krebs
stoppen zu können. Jonathan kam mit fürchterlichen Verbrennungen
zurück.
177
Ich hatte noch nicht erzählt, dass wir in dem alten Haus der
Wellers zusammen mit Graf Lüttichau und Madame Silberstein,
die je ein eigenes Zimmer uns gegenüber besaßen, lebten
und die Familie Weller in dem vierstöckigen Neubau nebenan.
In jener Nacht hörten wir zum ersten Mal Jonathan vor
Schmerzen schreien. Es war herzzerbrechend und durchdringend.
Die Schmerztabletten zeigten keine Wirkung mehr. Die
Bestrahlungen wurden fortgesetzt, doch die Wunde war jetzt
schon so groß wie eine Orange, die Haut über dem Oberkiefer
weggefressen und im Hals klaffte ein Loch, in dem ein Tennisball
Platz gefunden hätte. Der starke wortkarge Mann
wurde buchstäblich vom Krebs zerfressen, die Wunde faulte,
verbreitete einen schrecklichen Geruch nach verwesendem
Fleisch und jede Nacht hörten wir sein Schreien. Dem Ende
zu erhielt er schließlich gegen die Schmerzen Morphiumspritzen,
die ihm viel früher hätten verabreicht werden müssen.
Sein Tod war eine Erlösung für ihn, auch für seine Frau und
Ruth, die das Mitleiden kaum mehr verkraften konnten.
Nach seinem Tod ließ Tante Karoline wissen, dass sie nicht
mehr in der Lage sei, für alle zu kochen. Meine Mutter bekam
einen Petroleumherd, die bekannte Marke Primus, und das
Zimmer von Graf Lüttichau wurde zur Küche umfunktioniert.
Die Engländer hatten eingesehen, dass es Unsinn und völkerrechtlich
fragwürdig war, Deutsch-Juden, die unter dem
Dritten Reich gelitten hatten oder sich gar nicht als Deutsche
fühlten, in der Internierung zu halten. Fragebogen wurden
verteilt, in denen die Betroffenen eidesstattlich versichern
mussten, dass sie Juden seien und die deutsche Staatsangehörigkeit
aufgeben wollten.
So kamen aus dem Lager etwa 50 Personen nach etwa einem
halben Jahr frei, darunter natürlich auch Graf Lüttichau
und Madame Silberstein. Ich weinte, als sich der Graf verab-
178
schiedete. Die Unterhaltungen, die mich bis in mein späteres
Leben hinein nachhaltig prägten, waren zu Ende und ich vermisste
seine Geschichten.
Bestimmt waren sie in Tel-Aviv untergekommen. Was wohl
aus ihnen geworden ist?
179
Jugendstreiche
Das Kamel bleibt ein Kamel und wenn man es mit Edelsteinen
beladen würde.
Ich kam in die Schule, die nicht weit vom Wasserturm entfernt
war. Neben mir auf der Schulbank saß Peter Lange, ein
großer, intelligenter Junge, der in seinem späteren Leben Tempelvorsteher
in Stuttgart werden sollte. Hinter mir saß Heinz
Hesselschwerdt, der es auf mich abgesehen hatte. Wir prügelten
uns regelmäßig auf dem Schulhof. Wenn er mich schon
von Weitem sah, fiel er über mich her und ich zog den Kürzeren,
bis sich das Blatt wendete und er anstatt ich im Schwitzkasten
am Boden lag. Ich drückte und drückte seinen Hals zu,
bis er nach Luft rang, ließ meiner aufgestauten Wut freien
Lauf, bis ein alter Mann hinzukam und mich anschrie und
aufforderte, ihn sofort loszulassen. Von diesem Tag an ließ
Heinz Hesselschwerdt mich in Ruhe.
In diesem Alter muss man sich immer wieder vor anderen
Jungs beweisen. Ein besonders zäher und sportlicher Junge,
Walter Fröschle, konnte 50 Klimmzüge hintereinander absolvieren
und war dann immer noch nicht müde.
Am Rand des Schulhofs standen sieben Pinien dicht nebeneinander.
Als ich morgens auf dem Schulhof erschien, wurde
ich mit einem lauten Hallo empfangen. Walter hätte es geschafft,
vom ersten Baum über die Zweige bis zum Letzten zu
klettern, und triumphierend blökte Heinz, dass er es auch geschafft
hätte. Es war klar. Meine Position konnte ich nur verteidigen,
wenn ich dieser Mutprobe folgte. Ich stieg auf den
ersten Baum. Ich hielt mich wie ein Affe an den Zweigen fest.
Der Übergang zum zweiten Baum gelang mir und auch zum
dritten. Die Lehrerin kam von der Straße und die Jungs riefen
180
mir zu: „Sie kommt, sie kommt“ und rannten weg zum Schulzimmer.
Die Irritation, eine kleine Unachtsamkeit und ich fiel von
sechs Meter Höhe in die Tiefe. Ich konnte mich in der Luft
nicht mehr drehen, ich war von dem unerwarteten Fall viel
zu überrascht, als dass ich dazu die Geistesgegenwart gehabt
hätte, und landete auf dem harten, trockenen Boden voll auf
dem Rücken.
Die Lehrerin kam angelaufen und rief: „Hast du dich verletzt?“
und beugte sich über mich. Ich japste: „Ich bekomme
keine Luft“, und sie klopfte mir leicht auf den Rücken. Nach
einigen Minuten konnte ich ungeschickt aufstehen.
„Am besten du gehst jetzt gleich zu deiner Mutter“, sagte
sie. Ich schleppte mich nach Hause. Sie fragte noch, ob jemand
mich begleiten solle, doch ich schüttelte vehement den Kopf.
Meine Mutter sah mich überrascht an: „Was ist denn los
mit dir?“, fragte sie aufgeregt. „Ich will nur schlafen“, brachte
ich mühsam hervor und legte mich auf die blanke Matratze,
die meine Mutter gerade beziehen wollte.
„Was ist mit deinem rechten Arm geschehen?“ und deutete
auf meinen Arm. Die Hand stand im rechten Winkel ab. „Oh
Gott!“, jammerte sie, „der Arm ist gebrochen. Wir müssen
sofort zu Dr. Hoffmann in die Krankenstation. Ich wimmerte:
„Nicht jetzt, bitte nicht jetzt, ich bin soo müde.“
Sie zerrte mich zu Dr. Hoffmann. Er schaute mich mit seinen
schwarzen, bauschigen Augenbrauen finster an und
schimpfte:
„Das geschieht dir recht. Man steigt nicht von einem Baum
zum anderen. Jetzt wird es wehtun. Das hast du so verdient!“
Er nahm meine Hand und meinen Arm, riss sie mit einem
Ruck auseinander und renkte beide Teile wieder in eine gerade
Position ein. Ich schrie auf vor Schmerzen. „Es ist ein glat-
181
ter Bruch direkt über deinem Handgelenk“, fuhr er fort. „Wir
können nur hoffen, dass das Gelenk nicht steif wird. Ich habe
auch nur noch einen Gipsverband im Schrank. Glaube ja nicht,
dass du den in den nächsten vier Wochen wegmachen kannst.
Einen Neuen bekommst du nicht.“
Die nächsten vier Wochen war ich von der Schule befreit,
da ich mit dem gebrochenen Arm nicht schreiben konnte. Im
Vorgarten hatte mir meine Mutter eine Liege aufgestellt, ich
schaute Bücher an, spielte mit den jungen Katzen und hörte
dem Gezwitscher der Vögel zu, die sich in dem dichten Baum
über mir tummelten. Der Käfig meines Distelfinken, einem
Prachtexemplar und dazu noch ein Männchen, der jeden
Morgen lustig die schönsten Melodien pfiff und so die anderen
Vögel anlockte, hing mitten im Baum.
Den Käfig hatte ich selbst gebaut. Ein Araber hatte mir ein
Muster geliehen und mir einige Tipps verraten. Ich hatte getrocknete
Bambusstangen aus der Gärtnerei Orth von nebenan
gestibitzt und aus einem langen Stück zwischen den Knoten
Stäbchen gespalten. Sie bildeten das Gitter des Käfigs mit einem
Abstand von etwa 10 mm voneinander. Die Rahmen
wurden aus weichen Rechteckhölzern gespalten, Löcher eingebohrt
und die Stäbchen eingesetzt.
Der Käfig hatte auf einer Seite eine Klappe, die man mit einem
Gummi spannen und offenhalten konnte. Ein kleines
Holzstäbchen lief quer über die Öffnung. Dadurch war der
Käfig zu einer Vogelfalle geworden. Legte man Sonnenblumenkerne
hinein, am besten gleich eine ganze Sonnenblume,
dauerte es nicht lange, bis ein Distelfink aufgeregt um den
Käfig herumflog, von Ast zu Ast hüpfend, bis er sich ein Herz
fasste und auf das Holzstäbchen sprang, das nach unten
rutschte, den Gummizug freigab und die Klappe zum Zu-
182
schnappen brachte. Der Vogel war flatternd im Käfig gefangen.
Ein lustig singender Distelfink ist gar nicht so einfach zu
finden. Man muss ihn von vielen auswählen. Um mehrere
Vögel auf einmal zu fangen, hatten wir Buben eine Schabeke
gebaut, die die Araber zum Fangen von Vögeln verwenden.
Dem pfeifenden und trillernden Distelfink meines Freundes
banden wir vorsichtig ein Schnürchen an eines seiner Beinchen
und das andere Ende an einen dünnen Holzstab, der
seinerseits am Ende mit einem Lederstreifen auf einem Brett
festgenagelt war. Diese Konstruktion legten wir auf einen freien
Platz in einem Orangenhain. Hinter der Hecke saßen wir.
Mit einer Schnur konnten wir das Stäbchen bewegen. Der
Vogel flog hoch und nieder und beschwerte sich dabei mit
heftigem Gezwitscher.
Wir hatten rings um den Vogel Sonnenblumen mit reifen
Kernen gelegt. Ganz neugierig saßen schon um die zwanzig
Distelfinken auf den Orangenbäumen rings herum und beäugten
die Sonnenblumen argwöhnisch. Jetzt flog unser Vogel
wieder hoch und pfiff in den hellsten Tönen, als ob er sagen
wollte:
„Kommt herunter und fresst euch satt!“
Die vorsichtigen Distelfinken dachten: „Hat er wirklich etwas
zum Fressen gefunden?“
Alle Achtsamkeit vergessend, flog ein Weibchen daher, ließ
sich nieder und begann, die Kerne herauszupicken. Ein anderer
Distelfink folgte und auf einmal waren fast alle da.
Jetzt kam es darauf an: Links und rechts hatten wir Netzflügel
am Boden montiert. Ich zog schnell am dicken Seil. Die
Netze fielen über die fressenden Vögel, die sich darin verfingen.
Wir hatten auf einen Schlag 15 gefangen!
Alle kamen in einen großen Käfig, den wir mit einem Tuch
183
abdeckten. Denn die Vögelchen waren so aufgeregt, dass sie
im Käfig wie wild umherflogen und sich dabei verletzen konnten.
Am nächsten Morgen, als wir das Tuch entfernten, waren
alle ruhig. Aber zwei fingen an zu pfeifen. Wie im Duett. Ein
größeres, wunderschönes buntes Männchen und, welch Wunder,
auch ein nicht minder schönes Weibchen. Nicht jeder Distelfink
pfeift. Von 15 Finken pfeifen und singen in der Regel
nur zwei und Weibchen sind selten darunter. Nur die beiden
Sänger behielten wir, die anderen ließen wir wieder fliegen.
Ich bekam das Männchen. Jeden Morgen bei aufgehender Sonne
weckte es mich jetzt mit seinem Gezwitscher.
Manchmal war ich darüber traurig. Ein Vogel, der frei in
den Lüften fliegen konnte, war bei mir gefangen. Sollte ich
ihn nicht freilassen, dass er sich mit einem Weibchen ein Nest
bauen konnte? Ich nahm mir fest vor, ihm die Freiheit dann
zu schenken, wenn der Gipsverband weg war und ich nicht
mehr die langweiligen Vormittage im Garten verbringen
musste.
An einem der nächsten Morgen, die ersten Sonnenstrahlen
fielen schon auf mein Bett, vermisste ich die Stimme des Vogels.
Ich stürzte im Pyjama in den Garten und entdeckte den
Käfig auf der Erde. Er war zwar ganz, doch der Vogel war
verschwunden und dann bemerkte ich die vielen kleinen, bunten
Federn, die rings um den Käfig herum verstreut lagen.
Dafür gab es nur eine Erklärung. Der schwarze Kater war
auf den Baum gestiegen und auf den Käfig gesprungen, der
mit dem Aufprall und Gewicht des Tieres zu Boden fiel. Dann
gelang es der Katze, mit ihren Krallen, sogar durch die engen
Stäbe, den panikartig flatternden Vogel zu fassen, herauszuziehen
und der Tod des wunderbaren Sängers war besiegelt.
Der verdammte Kater hatte meinen Liebling aufgefressen.
184
Mein Entsetzen und meine Traurigkeit hielten sich die Waage
und verwandelten sich schließlich in eine unbeschreibliche
Wut. Ich würde die Katze ersäufen, wenn ich sie erwischte.
Meine Mutter beruhigte mich: „Das ist die natürliche Veranlagung
einer Katze. Sie fängt Mäuse und Vögel, um sie zu
fressen. Sie ist unschuldig. Wenn jemand Schuld trifft, bist du
es! Du hättest den Käfig am Baum mit einem dickeren Draht
befestigen müssen. Dann wäre er nicht zu Boden gegangen
und die Katze hätte keine Chance gehabt. Du hättest den Vogel
gar nicht fangen sollen, dann würde er jetzt noch leben.“
Zwei Wochen nach dem Armbruch waren unter den Gipsverband
Hühnerflöhe eingedrungen und hatten sich in der
Gaze eingenistet. Die Flöhe hatten den ganzen Arm verstochen,
ich hielt es vor Jucken kaum mehr aus.
„Du hast Dr. Hoffmann gehört“, sagte meine Mutter. „Es
gibt keinen neuen Verband.“
Ich stocherte mit langen Stricknadeln zwischen Gips und
Arm herum, um mir etwas Linderung zu schaffen. Schließlich
schwoll der Arm so stark an, dass meine Hand sich leicht blau
verfärbte. Nicht ganz drei Wochen waren verstrichen, als ich
es nicht mehr aushielt und, ohne meiner Mutter etwas zu sagen,
den Verband mit einer Säge, die linke Hand benutzend,
aufschnitt und abnahm.
Der Arm erholte sich in wenigen Tagen. Einen neuen Gipsverband
erhielt ich nicht. Aber zur Schule ging ich wieder.
Dort war es viel interessanter als in meinem Vorgarten, nachdem
mein geliebter Distelfink gestorben war.
185
Gefährliche Jugendstreiche
Herzen sind die Verwahrer von Geheimnissen, Lippen die Schlösser
und Zungen ihre Schlüssel.
Walter Fröschle wartete mit einer neuen Idee auf. Nichts
war ihm zu gefährlich, nichts zu riskant.
Der im Dorf stehende Wasserturm hatte es ihm neuerdings
angetan. Er hatte ihn bestiegen und forderte uns auf, dasselbe
zu tun. Der etwa 10 m im Durchmesser messende, aus Beton
gegossene, zylindrische Behälter war auf vier Betonstelzen
gesetzt. Eine Treppe führte zu der Plattform unter dem Behälter
hoch. Hier begann über dem Geländer eine schmale
Eisenleiter zur Spitze. Um ein ungewolltes Besteigen des
Turms zu verhindern, waren die ersten zwei Sprossen der
Leiter abgesägt worden. Man musste also zuerst auf das Geländer
steigen und von dort in die Höhe springen, um die erste
Sprosse mit den Händen fassen zu können. Beim Absteigen
ließ man sich zuerst hängen, schwang dann an der schon locker
gewordenen Leiter hin und her und sprang schließlich
im richtigen Moment über das Geländer, um auf dem Boden
der Plattform mit einer Rolle sicher zu landen. Ich starb fast
vor Angst, als ich auf dem Geländer stand und unter mir ein
etwa 15 m tiefer Abgrund gähnte.
Oben waren vier Jungs angelangt. Das Dach war leicht abgeschrägt,
und in der Mitte war ein etwa 5 m weites offenes
Loch. Wenn man hineinfallen würde, wäre kein Entkommen
möglich, denn es führte keine Leiter heraus. Wie ein armes
Schwein würde man darin ersaufen. Walter Fröschle forderte
mich hier oben zu einem Ringkampf auf. Das war eines meiner
schrecklichsten Erlebnisse, das ich in meinem bisherigen
Leben hatte. Ein falscher Tritt, dann würde ich jämmerlich
ins Loch fallen und ertrinken. Eine falsche Bewegung und ich
186
würde 30 Meter tief in die gähnende Tiefe fallen. Er war schon
über mir und nach einem kurzen Gerangel ließ er plötzlich
ab. Wahrscheinlich war ihm die Gefährlichkeit des Spiels, auch
für ihn selbst, bewusst geworden. Nachdem ich unten wieder
unversehrt angekommen war, schwor ich mir, diese Art von
Mutproben einfach nicht mehr mitzumachen. Ein klares Nein
ist mutiger, als vor Angst zu sterben!
Walter hatte mit seinem nicht weniger forschen Bruder Otto
in ihrem Garten hinter dem Haus lange Gräben ausgehoben
und mit Wellblech und Erde abgedeckt. Die Gänge führten
sternförmig nach allen Seiten
mit etlichen geheimen Ausgängen.
Ein echtes Labyrinth.
Es war klar, dass man alles
tun musste, was die Brüder
verlangten, wenn man bei diesen
Kriegs- und Abenteuerspielen
mitmachen wollte. Bei
den Grabarbeiten waren sie
auf ungebrauchte, aber stark
korrodierte Gewehrhülsen
aus dem Ersten Weltkrieg gestoßen,
die sie stolz vorzeigten.
Die Gewehrspitzen waren
besonders begehrt. Um sie
von den Hülsen zu trennen,
steckten sie das Teil in einen
Schraubstock und wuchteten
die Spitze mit einer Zange
nach der Seite heraus. Die gelben
Pulverstäbchen kamen
Der Wasserturm
zum Vorschein, die angezün-
187
det wurden und schnell verpufften. Ich war darüber überrascht,
denn ich hatte geglaubt, dass Pulver explodieren würde.
Das ist aber nur der Fall, wenn es in einer festen Hülle
steckt, wie z. B. in einer Gewehrhülse.
Da müsste es auch anderswo in Sarona Gewehrhülsen geben,
folgerte ich. Onkel Carl hatte erzählt, dass die deutschtürkischen
Truppen Sarona im Ersten Weltkrieg gegen die
Engländer verteidigt hätten. Die Stellungen seien östlich des
Wasserturms gewesen. Ich ließ es auf einen Versuch ankommen
und suchte die Felder ab, die auf dem Plan von Sarona
eingezeichnet waren. Gisela half mir dabei. Mit ihren scharfen
Augen hatte sie bald eine Kugelspitze auf dem Acker entdeckt.
Sie war vorne nicht spitz, sondern rund. Welch ein Fund!
Wir beide wurden vom Schatzfieber erfasst, ließen nicht locker,
wieder und wieder liefen wir suchend mit Argusaugen
über das Feld und hatten zum Schluss nicht ganz ein Dutzend,
wobei auch einige mit einer normalen Spitze dabei waren.
Die runden stammten von sogenannten Dum-Dum-Geschossen.
Sie sollen aus italienischen Gewehren abgeschossen worden
sein. Ein Dum-Dum-Geschoss verursacht beim Getroffenen
beim Austritt der Kugel aus dem Körper eine riesige Wunde.
Einen glatten Durchschuss gibt es offenbar nicht. Auf Menschen
schießen ist schon schlimm genug, dachte ich damals,
aber solche Geschosse anzuwenden ist ein richtiges Verbrechen.
Nach dem Ersten Weltkrieg wurde die Dum-Dum-Munition
mit der Genfer Konvention vom Jahr 1929, wie auch
die Anwendung von Giftgas, international geächtet. Damit
wird der Grundsatz unterstrichen, dass die meuchlerische Tötung
oder Verwundung des Feindes untersagt bleiben sollte.
Ich war jetzt der Größte, denn Gisela überließ mir alle Kugeln,
die sie gefunden hatte.
In diesem Alter konnte man ein Geheimnis nicht lange für
188
sich allein behalten. Plötzlich waren alle Jungs unterwegs,
suchten das freie Gelände überall in Sarona ab und wurden
fündig. Hunderte von intakten Gewehrhülsen mit Spitzen
wurden in einer Grube nicht weit hinter dem Wasserturm (auf
dem Gelände des Otto Jung?) gefunden. Der Handel mit den
Spitzen blühte.
Natürlich musste die Oxidation von den aus Messing oder
gar reinem Kupfer hergestellten Kugeln mit Sand- oder Glaspapier
entfernt werden. Das Polieren war eine zeitaufwendige
Arbeit, denn die Oxidation hatte sich teilweise tief in das
Metall hineingefressen, und bald war das knappe Sandpapier
aufgebraucht.
Ich beschloss, selbst Sandpapier herzustellen. Ich zertrümmerte
dazu eine Flasche und schlug mit einem Hammer so
lange auf die Scherben, wobei ich einen großen Stein als Unterlage
benutzte, bis sich feiner Glasstaub bildete. Jetzt fehlte
ein geeigneter Klebstoff.
Ich hatte einen kleinen Baum entdeckt, eine Akazienart mit
gelben Blüten und feinblättrigen grünen Blättern, der an einer
der vielen staubigen Wege in der Nachbarschaft stand und
an dessen Stamm relativ große Mengen Harz austraten, die
den Geruch des Klebstoffs hatten, mit dem die Rückseite von
Briefmarken beschichtet ist. Das würde vielleicht den richtigen
Klebstoff geben. Ich legte das abgekratzte Harz über Nacht
in Wasser. Am nächsten Morgen war nach Umrühren ein zäher
Klebstoff entstanden, der allerdings schrecklich stank. Einer
der älteren Mitschüler meinte, dass es sich bei dem Klebstoff
um Gummi arabicum handeln würde, den die Araber seit
alters her verwenden würden. Die fertigen Glaspapierbogen,
die in der heißen Sonne schnell getrocknet waren, bot ich meinen
Freunden im Tausch gegen Kugelspitzen an.
Doch dann verriet mir ein Mitschüler, wie er seine Spitzen
189
bearbeitete. Am Rand der Tennisplätze hatte er zwei fassgroße
Glasgefäße ausfindig gemacht, die verdünnte Salzsäure
enthielten. Legte man die Spitzen über Nacht in ein mit dieser
Säure gefülltes Glas, waren sie am Morgen blitzblank. Ich
rannte mit einer Flasche hin und füllte sie ab. Beim Kippen
des Containers spritzte die Salzsäure über meine Hose und
lief über meine Hände, die ich mit Wasser abspülte, um das
beginnende unangenehme Jucken zu stoppen. In wenigen
Stunden hatten sich in der Hose große Löcher gebildet und
meine Hände waren gelb geworden. Beides blieb meiner Mutter
leider nicht verborgen, und ich musste die ganze Geschichte
von Anfang an erzählen, mit der Munition, mit den Kugelspitzen
und mit der Salzsäure. Das schöne Hobby fand ein
jähes Ende. Meine Mutter meldete das Vorkommnis der Kommandantur,
da sie Angst hatte, dass mir beim Hantieren mit
der gefährlichen Munition und der Salzsäure etwas passieren
könnte. Die Hauptfundstelle wurde ausgehoben und die Container
abtransportiert. Meinen Freunden erzählte ich
wohlweislich nicht, dass meine Mutter – durch meine leichtfertige
Beichte – hinter dem Verrat steckte.
Auf dem Bauernhof der Wellers gab es immer viel zu beobachten
und zu tun. Der hinter den Stallungen aufgetürmte
Strohhaufen, ein richtiger Strohberg, vielleicht zehn Meter
hoch, war ein richtiges Spielparadies. Wir hatten Gänge durch
das Stroh mit verschiedenen Ausgängen gebohrt, sodass intime
Verstecke entstanden. Von dem Scheitel des Haufens konnten
wir auf dem Hosenboden nach unten schlittern, was viel
Freude bereitete, bis eines Tages eine Heugabel dazwischenlag
und eine ihrer Spitzen tief in meinen Fuß zwischen zwei
Zehen eindrang. Wieder war der Gang zu Dr. Hoffmann fällig,
der mir, wie üblich, eine Moralpredigt hielt.
Ein anderes Mal konnte ich meiner Mutter beim Kochen von
190
Orangenmarmelade helfen. Ich glaube, dass sie mit ihrer Marmelade
das ganze Lager versorgte, denn die Zinkbadewanne,
die wir zum Waschen und Baden benutzten, war voll. Sie sagte,
dass das Geheimnis einer guten Orangenmarmelade darin
läge, dass ein Drittel Grapefruit zu den Orangen hinzugegeben
werden müsste. Das würde den etwas bitteren Geschmack
verstärken und den säuerlichen Geschmack verfeinern.
Dann half ich Ali, einem jungen Araber, beim Häckseln von
grünen Maisstängeln, die an die Kühe verfüttert werden sollten.
Ein anderer Araber, Achmed, hatte einen Ausdruck mir
gegenüber verwendet, den ich mir gemerkt hatte. Inaldinak war
das Wort, dessen Bedeutung mir unbekannt war und das ich
nie vergessen sollte. Ich sagte leichthin zu Ali Inaldinak. Er
schaute mich entsetzt mit großen Augen an. Sein Gesicht verfinsterte
sich, und er packte mich mit beiden Händen an den
Schultern, schüttelte mich und schrie: „Was hast du gesagt?“
Die Häckselmaschine hatte einen Durchlass, durch den man
auch einen Jungen, wie mich, zu dem herabschlagenden Messer
hindurchschieben konnte. Sie funktionierte wir eine Guillotine.
Er zerrte mich auf das laufende Band der Maschine.
„Woher hast du dieses Wort. Meine Religion soll verflucht
sein?“, schrie er weiter, ohne sich beruhigen zu können. In
meiner panischen Angst rief ich: „Achmed hat es mir gestern
beigebracht.“ „Ist das wirklich wahr?“, wetterte er. „Achmed
hast du das zu dem Jungen gesagt?“ Achmed war plötzlich,
durch das Geschrei angelockt, erschienen und sah, wie er mich
auf dem Band festhielt. Er nickte verlegen und die beiden gerieten
in einen heftigen Streit. Die Worte flogen nur so hin und
her. Doch Ali ließ mich los. Ich nutzte sofort die Gelegenheit,
sprang von dem Band und rannte weg, so schnell ich konnte.
Ich fragte danach Tante Karoline nach der Bedeutung: Sie
sagte: „Das ist das Schlimmste, was man einem Araber sagen
191
kann. Verflucht sei deine Religion. Verwende dieses Wort nie
mehr in deinem Leben. Am besten du streichst es ganz aus
deinem Gedächtnis.“
Der gehäckselte Mais wurde den Kühen zum Fressen gegeben.
Sie dankten das mit viel Milch. Ich glaube, dass Mais das
nahrhafteste Futter für diese Tiere ist, wie die Kleie für die
Schweine, die sich auf dem Misthaufen der Kühe wohlfühlten
und sich sogar in deren Jauche suhlten, wenn es sehr heiß
war. Manchmal wurde es nämlich in der Sarona-Ebene sehr,
sehr heiß. Ich kann mich erinnern, dass ein Thermometer im
Schatten einmal +45 °C anzeigte. An diesem Tag war der Himmel
mit feinem Staub verdeckt, der von der Sahara herangezogen
sein soll. Ein Sandsturm, ein Schirokko, in der Höhe.
Der Sand war beim Aufsteigen in der Wüste so aufgeheizt
worden, dass er jetzt seine Wärme nach unten abgab. Unter
dieser Sandglocke war ein Atmen kaum mehr möglich. Niemand
wagte sich um die Mittagszeit auf die Straße. Alle suchten
etwas Linderung in den kühleren Wohnungen.
192
Die Ungarnbuben
Wenn der Gast ankommt, ist er ein Fürst, wenn er sich setzt, ein
Gefangener, wenn er geht, ein Dichter.
Angrenzend an den Bauernhof der Wellers befand sich die
Gärtnerei Orth. Der etwas skurrile Gärtnermeister Johannes
Orth war in Akko interniert, und zwei Araber sollten die Gärtnerei
in Schuss halten. Sie waren unbeaufsichtigt und sahen
deshalb nicht ein, mehr zu tun als absolut nötig. So verkam
der Garten zusehends.
Als Gärtnerei hatte sich Orth einen Namen gemacht. Templer
und Juden aus Tel-Aviv waren gute Kunden für seine Pflanzen,
die er nicht nur im Freien sondern auch in sieben Glasgewächshäusern
züchtete.
Orth hatte in seinem Garten, der Tradition vieler Templer
folgend, auch viele Bäume, Sträucher und Gräser angepflanzt,
die in Palästina nicht heimisch waren.
Vielleicht war ja irgendeine Pflanze darunter, die eine Lücke
in Palästina füllen könnte und die hier besonders gut gedeihen
würde. Jedenfalls war das weit auslaufende Areal zu
einem kleinen Dschungel geworden, der auf uns Buben einen
unbeschreiblichen Reiz ausübte.
Ein groß gewachsener afrikanischer Baum stand in der Mitte
mit dicht übereinanderliegenden Ästen, die es uns Buben
erlaubten, mühelos, wie auf einer Leiter, bis zur Spitze des
Baums hochzuklettern. Ich hatte eine klasse Hohner Mundharmonika
von meiner auch im Lager lebenden Tante Sofie
zum Geburtstag geschenkt bekommen und konnte schon ganz
gut darauf spielen. Der Alte Kameraden Marsch und Lustig ist
das Zigeunerleben waren meine Lieblingsstücke. Wenn ich
abends ganz oben in den Ästen saß und beobachtete, wie die
Sonne im Mittelmeer unterging, das in weiter Ferne wie ein
193
silberner Streifen am Horizont lag, und das Abendrot den
Himmel überzog, spielte ich die Lieder voller Inbrunst wieder
und wieder und wurde dabei sehr traurig, weil ich das Meer
nie von der Nähe sehen, nie am Strand rennen und mich nie
in die Wellen stürzen konnte. Dann war mir so richtig bewusst,
dass wir alle in einem Lager gefangen waren, aus dem es kein
Entrinnen gab.
Von hier oben konnte ich auch in der Ferne die Häuser von
Tel-Aviv erkennen, die wie rechteckige, mehr graue als weiße
Würfel in der Landschaft standen.
Mehr interessierten mich allerdings die dicht mit Laub bewachsenen
Bäume, die sich vor mir leicht im Wind wiegten.
Hunderte von Vögeln, hauptsächlich Distelfinke, schwirrten
aufgeregt um die Bäume herum, um schließlich darin einen
Schlafplatz für die bevorstehende Nacht zu finden.
Ich konnte der Versuchung nicht widerstehen, einen schlafenden
Vogel zu fangen. Das wäre das Einfachste der Welt.
Ich schlich zu einem der Bäume und versuchte, den ersten Ast
zu erhaschen, um mich hochzuziehen. Doch schon beim geringsten
Geräusch fing das Gezwitscher an, und die Vögel
schwirrten alle zusammen wie auf Kommando aus dem Baum
heraus und flogen aufgeregt mit den Flügeln flatternd weg.
Was mir mit einigen Schwalben gelungen war, gelang mit diesen
cleveren Vögelchen nicht.
Die Schwalben verbrachten die Nacht gewöhnlich im Pferdestall
von Wellers. An der Decke des Stalls waren Doppel T-
Träger aus Eisen eingezogen. Auf den unteren Flanschen saßen
sie in Reih und Glied ganz nah aneinandergedrückt, um
sich vielleicht gegenseitig zu wärmen.
Ich war von der Außenwand zum offenen Oberlicht hochgestiegen.
Die Schwalben saßen auf dem Flansch nicht einmal
einen halben Meter von meinem Kopf entfernt. Vorsichtig
194
streckte ich meine Hand aus und hatte die erste gefangen, die
ich in meinen Hosensack steckte. Es folgte die zweite und die
dritte. Die anderen Schwalben, es waren mehr als zweihundert,
merkten nichts davon, dass drei ihrer Kameraden verschwunden
waren. Unten wieder angelangt nahm ich eine und
schleuderte sie, meinen Arm im Kreis schwingend, in die Luft.
Sie flog leicht orientierungslos davon, wie beschwipst von der
Drehung. Die beiden anderen folgten.
Am nächsten Abend wollte ich den Spaß wiederholen. Als
ich durch das Oberlicht griff, entdeckte ich, dass sich keine
einzige Schwalbe auf den Trägern niedergelassen hatte. Im
ganzen Stall war keine einzige Schwalbe. Eigenartig dachte
ich, wie hatten die Betroffenen ihre Artgenossen warnen können?
„Wie kannst du nur so grausam sein! So geht man mit Tieren
nicht um“, schalt mich meine Mutter, als ich die Geschichte
erzählte. „Am Sonntag wirst du zum Gottesdienst gehen!“
Die beiden im Orth‘schen Haus mit ihrer Mutter untergebrachten
Ungarnbuben, die etwas älter als ich waren, hatten
sich Dei-Dies gebastelt, der arabische Name für Steinschleudern
mit Gummibändern, die von alten Autoschläuchen als
etwa 15 mm breite Streifen herausgeschnitten waren. Die
Holzgabeln stammten von Haselnusssträuchern. Ich hatte in
wenigen Stunden auch eine Schleuder angefertigt.
Wir gingen auf Spatzenjagd, aber auch Tauben waren ein
begehrtes Ziel, denn gebraten ist eine Taube eine Delikatesse.
Es erfordert viel Geschicklichkeit, einen Vogel zu treffen, und
wir verbrachten Stunden, uns im Schießen zu üben. Die jungen
Araber hatten eine unglaubliche Geschicklichkeit darin
entwickelt und jeder dritte Schuss war ein Treffer. Mir gelang
es einfach nicht, einen Spatzen zu treffen, und heute bin ich
darüber gar nicht so unglücklich, denn Spatzen sind an-
195
spruchslose Charaktervögel, die über alle Länder der Erde
verbreitet sind. Sperrt man einen in einen Käfig, verweigert
er die Futteraufnahme und trinkt auch nicht. Nach drei Tagen
Gefangenschaft ist er tot. Lieber den Tod, als ein Leben in
Gefangenschaft!
Die beiden Ungarn erzählten, dass sie eine große, schwarze
Schlange im Garten der Wellers gesehen hätten. Sie sei sehr
dick gewesen und drei Meter lang. Sie sei schnell über den
Boden gekrochen mit weit ausholenden Schlangenbewegungen
und sei in einem Loch verschwunden. Im Garten nicht
weit vom Feigenbaum, der reife Früchte trug, die besonders
morgens, wenn sie vom Tau noch kühl waren und aufgeplatzt
ein Hochgenuss waren, entdeckten wir viele große Löcher in
der Erde und dort am Rande lagen zwei große Schlangen in
der Sonne. Wir ergriffen die Flucht. Die beiden bei Orth angestellten
Araber waren auf einmal hellwach, als wir unsere
Geschichte erzählten. Das war etwas, was sie interessierte.
Giftig seien die Schlangen nicht, meinten sie. Nur Schlangen,
die einen stumpfen Schwanz hätten, seien giftig. Ob das wohl
stimmte?
Jedenfalls bewaffneten sie sich mit Spaten und Hacken, und
wir folgten ihnen im gebührenden Abstand. Sie versperrten
einer Schlange den Fluchtweg in ihr Loch und schlugen auf
sie ein, bis sie tot war. Sie schulterten die schwere Schlange
und trugen sie zum Gewächshaus. Sie rollten sie auf und legten
sie vor das Gewächshaus, in dem gerade eine junge Frau
beschäftigt war. Das Gezeter der Frau war entsetzlich, als sie
die Tür öffnete und die schwarze Schlange vor sich sah. Sie
konnte sich kaum mehr beruhigen, trotz unserer Versicherung,
dass das Tier tot wäre und sie sich nicht zu fürchten brauchte.
Wieder hatten wir auf Kosten eines anderen unseren Spaß
gehabt und auch die beiden Araber.
196
Jon Weller Bauernhof/Gärtnerei Orth
197
Der Orth‘sche Garten wurde immer mehr zu einer unheimlichen
Stätte. Als ich einmal, meinen Mut mir selbst beweisen
wollend, auf einem schmalen Pfad hindurchrannte, in den
Sträucher, Zweige und Gräser hineinragten, sah ich zu meinem
Entsetzen eine giftgrüne, dünne Schlange von einem Baum
herunterbaumeln, die einen stumpfen Schwanz hatte. Eine
grüne Baumschlange! Von ihr gebissen, wäre jedes von Dr.
Hoffmann gespritzte Gegengift zu spät gekommen, und man
wäre dem Tod geweiht gewesen. Innerhalb von nur zehn Minuten
hätte das Gegengift gespritzt werden müssen.
Trotzdem hatte der Garten ungeheure Reize. Ich begann,
Samen zu sammeln. Die meisten Samen der Pflanzen waren
in Schoten wie bei Bohnen gehüllt. Millimetergroße Samen bis
zu einem Zentimeter groß. Die Vielfalt der Farben und Formen
war erstaunlich. Rubinrote, blaue, bunt gesprenkelte,
weiße, einfach alle Farben, die man sich vorstellen konnte, und
manche glänzend mit einer faszinierenden Leuchtkraft. Hundert
Streichholzschächtelchen hatte ich mit unterschiedlichen
Samen gefüllt. Ich hatte sie zu einer größeren Einheit zusammengeklebt
und vor mein Bett gestellt, damit ich sie auch
nachts ganz nah bei mir hatte. Ich konnte es fast nicht glauben,
dass von jedem Samen ein Baum oder Strauch entstehen
konnte, dass so viel Information in einem so kleinen Teil enthalten
sein sollte. Wenn man einen Samen mit einem Stein
zerrieb oder zerschlug, war darin einfach nichts Besonderes
zu entdecken. Kein Hinweis auf einen Baum, kein Hinweis auf
die Fähigkeit zu keimen und zu wachsen.
Hat das Sammeln von Samen zu meiner späteren Sammlerleidenschaft
für Tennisschläger geführt, obwohl die Samen
mit Tennisschlägern wirklich nichts Gemeinsames hatten?
Eines Tages kamen die Ungarnbuben mit Murmeln an, die
in allen Farben schillerten und mich an manche Samen erin-
198
nerten. Es würde sicher welche in dem kleinen Laden geben,
der im Gemeindehaus untergebracht war. Ich bekam einige
Piaster von meiner Mutter und rannte los. Ein ganzes Päckchen
war noch da, voll mit herrlichen Glasmurmeln, innen
im durchsichtigen Glas mit einem farbigen Blumenkelch. Eine
war dabei, die einen grasgrünen Kelch zeigte und von grünlich
durchsichtigem Glas umschlossen war.
Welch ein Grün! Ich verliebte mich in diese Murmel. Wenn
ich in sie hineinblickte, glaubte ich eine Wahrsagekugel vor
mir zu haben, die mir die Weisheiten der Erde offenbaren
konnte. Dieses Grün versetzte mich in eine ähnliche Stimmung,
die ich später beim Hören von Musikstücken, wie Romeo
und Julia von Tschaikowsky, wiederfinden sollte.
Auf dem ausgetrockneten sandigen Wege durch Sarona gab
es viele geeignete Stellen, unser Spiel auszutragen. Im Boden
wurden drei hintereinanderliegende, kleine Mulden angelegt,
in die man eine ausgelegte Murmel durch Treffen mit der
Hauptmurmel, dem sogenannten Ras, was auf Arabisch Kopf
heißt, befördern musste. Der Gewinner des Spiels erhielt eine
Murmel vom Verlierer. Es dauerte nicht lange, bis ich meine
Murmeln verloren hatte. Ich hatte das letzte Päckchen bekommen,
und es gab keine Chance, neue zu kaufen. Die Ungarnbuben
waren natürlich die Gewinner.
Ich stand vor der Entscheidung, meinen Ras zu setzen. Das
war natürlich meine Murmel mit dem unverwechselbaren,
leuchtenden Grün. Das würde ich niemals tun! Das käme
niemals infrage! Diese Murmel würde ich bis an mein Lebensende
behalten!
Am nächsten Tag brach bei mir die Spielleidenschaft wieder
durch. Wie heute beim Schach, beim Skat, beim Bridge oder
an der Börse.
Ich setzte sie und verlor!
199
Schwimmbassin bei Lippmann
(Pumpenhaus rechts zu sehen)
Die Murmel ist in meiner Erinnerung immer schöner geworden.
Wenn ich heute das junge Gras der Fairways beim Golf
im Frühjahr vor mir sehe, gehen meine Gedanken zu dieser
Murmel zurück, und ich weiß, dass das Grün der Murmel weit
leuchtender war als das des jungen Grases. Das wunderbare
Gefühl der Murmel steigt unvermittelt tief aus meinem Herzen
in mir auf, versetzt mich in die Jugendzeit und macht mich
glücklich. –
Die Buben hatten wieder ein neues Hobby gefunden. Innerhalb
des Lagers lag ein Orangenhain, eine richtige Orangen-,
Mandarinen- und Grapefruit-Plantage. Ein etwa 30 m tiefer
Brunnen war früher gebohrt worden, aus dem eine Pumpe
Süßwasser in ein Bassin von etwa 15 m Seitenlänge förderte.
Dort wurde es für etwa acht Tage zurückgehalten, damit es
sich erwärmen konnte. Für die wöchentliche Bewässerung der
jungen Orangenbäume eignete sich das warme, abgestande-
200
ne Wasser besser als das kalte, direkt vom Brunnen geförderte
Wasser. Es war das „Lippmann‘sche“ Anwesen.
Die Ungarnbuben nahmen mich mit. Hier konnte man baden.
Das Bassin war ein ideales Spiel- und Schwimmbecken
für uns. Ich konnte noch nicht schwimmen und versuchte mich
damit am Rand des Beckens.
Ich glaubte, die ersten, freien Züge gemacht zu haben, und
schrie:
„Ich bin die ersten Meter geschwommen. Ich kann jetzt
schwimmen!“
Ein größerer Junge hörte das. „Wirklich?“, sagte er, „das
wollen wir sehen!“ und schleppte mich zur Mitte des Bassins,
ließ mich los und schwamm weg.
Ich schlug wie wild mit meinen Armen um mich, versank
im Wasser, kam wieder hoch, schluckte Wasser, sodass ich
kaum mehr atmen konnte. Panik überfiel mich. Ich möchte
nicht ertrinken, schrie es in mir. Ich ruderte wie verrückt mit
Armen und Beinen wie wild um mich schlagend weiter und
erreichte endlich, blau angelaufen, den rettenden Rand. Keiner
der Jungs, auch nicht die Ungarnbuben, war mir zur Hilfe
gekommen, auch der nicht, der mich zur Mitte gezerrt hatte.
Sie lachten nur. „Jetzt weißt du, was schwimmen heißt“, rief
der größere Junge und spuckte verächtlich in die Ecke.
Dies war mir eine Lehre für mein ganzes Leben, nie mit etwas,
was man nicht beherrscht, zu prahlen. Am besten ist es
sogar, überhaupt nie mit seinen Kenntnissen anzugeben. Und
hat man wirklich so gute Freunde, wenn man sie dringend
braucht?
Als ich zehn Jahre alt wurde, wurde ich mit einer Zeremonie
in die Jungvolkgruppe aufgenommen, die sich im Lager
unter Führung eines 16-Jährigen im Geheimen gebildet hatte.
Hitlersprüche, die aus seinen Reden stammten, musste man
201
auswendig lernen, so unsinnig sie auch waren, und Kriegsspiele
wurden angesetzt, die sich vornehmlich bei Einbruch
der Dunkelheit in dem besagten Orangenhain abspielten.
Die ungarischen Buben hatten eine weitere Abwechslung
für mich bereit. Sie freundeten sich an mit einem nicht allzu
großen Mann zwischen 45 und 55 Jahren, einem geistig etwas
behinderten Deutschen, der für die Brunnenstation verantwortlich
war und über dem Pumpengebäude ein Zimmer bewohnte.
Sie forderten mich auf mitzukommen. Der Mann,
dessen Name mir entfallen ist, näherte sich den Jungs unsittlich
und begann an ihren Geschlechtsteilen herumzuspielen.
Ich war damals Zeuge seiner Handlungen.
Die nächsten Tage verfolgte mich der Mann immer wieder,
wenn ich beim Schwimmen war, und versprach mir ein Taschenmesser,
wenn ich mit auf seine abgelegene, von außen
nicht einsehbare Bude ginge. Aber auch andere Jungen und
Mädchen in meinem Alter hatte er angesprochen und ähnliche
Versprechungen gemacht.
Wahrscheinlich haben einige davon zu Hause erzählt. Dies
blieb natürlich nicht ohne Folgen. Eine Anzeige einer Mutter
bei der Kommandantur genügte.
Er wurde von der Militärpolizei abgeführt und verschwand
aus dem Lager. Wohin? In ein Militärgefängnis? Oder abgeschoben
in ein anderes Internierungslager?
Die Sexualität in meinem Alter war noch nicht voll ausgebrochen.
Doch ich muss zugeben, dass ich immer wieder in
den Ausschnitt der schönen, rothaarigen Ruth schauen musste,
die so aufreizend am Abendtisch saß, und das, was ich sah,
gefiel mir.
202
Bombenangriffe auf Tel-Aviv
Ein Trunk Wasser in meiner Heimat ist mir lieber als Honig in
der Fremde.
Zum täglichen Zählappell Punkt 17:00 Uhr ertönte eine Sirene.
Niemand durfte sich um diese Zeit auf der Straße aufhalten.
Die Engländer hatten ihre arabischen Söldner angewiesen,
nach kurzem Warnruf die Waffe zu gebrauchen. Ich
glaube aber nicht, dass sie dann auch geschossen hätten.
Ein englischer Soldat kam die Straße entlang und zählte laut
die Internierten, die sich vor den Häusern im Vorgarten aufgestellt
hatten. Nach einer Stunde war der Appell zu Ende,
wenn die Sirene erneut heulte. Gewöhnlich nahm ich dann
mein kleines, von Jerusalem mitgebrachtes Fahrrad, wenn es
nicht gerade kaputt war, und radelte beim ersten Heulton so
schnell ich konnte los, um zu Tante Sofie zu fahren, die mich
im Haus des Carl Küblers mit den Hesselschwerdts und deren
Töchter Olga (19) und Nelli (16) erwartete. Tante Katharina
(zur Erinnerung: sie ist die Schwester meines Vaters) und
ihr Mann Onkel Hans, der in Jerusalem eine große Reparaturwerkstätte
für Fahrzeuge aller Art betrieben hatte, luden mich
manchmal zum Essen ein, wenn es Bratkartoffeln gab, die für
die Familie etwas ganz Besonderes waren. In Palästina wuchsen
zwar Süßkartoffeln prächtig, doch die normale Kartoffel
nur ganz schlecht.
Was sie an Bratkartoffeln fand, blieb mir ein Rätsel. Ein größeres
Rätsel aber war, wo sie sie herhatte. Ich wuchs mit Reis
auf, und den zog ich den Kartoffeln bei Weitem vor.
Tante Sofie, die älteste Schwester meines Vaters, hatte mich
in ihr Herz geschlossen. Ein Taschenmesser hatte ich immer
in meiner Hosentasche. Irgendetwas musste ich immer schnitzen.
Sie wusste das und versorgte mich damit. Wie viele Ta-
203
schenmesser habe ich im Laufe der Jahre von ihr bekommen?
Zehn? Fünfzehn?
Welch fürchterliches Schicksal diesen Fünf in wenigen Jahren
bevorstand, konnte damals niemand ahnen. Beim Gefangenaustausch
nach Deutschland kamen sie in Stuttgart an.
Am selben Tag wurde Stuttgart von den Alliierten bombardiert.
Sie wurden verschüttet und erstickten alle jämmerlich.
Nachzulesen in meinem Büchlein „In Überlingen“.
Carl Kübler war nur entfernt mit uns verwandt. Trotzdem
nannte ich ihn Onkel Carl. Er hatte viele Lieder am Klavier
komponiert. Manche wurden sogar in das eigene Gesangbuch
der Templer aufgenommen. In seinem hinter dem Haus liegenden
Garten hatte er, als eines seiner weiteren Hobbys, exotische,
von Afrika importierte Obstbäume gepflanzt, die
Früchte trugen, die ich zum Teil nie mehr in meinem Leben
sehen oder schmecken sollte. Darunter waren Maracujas,
Guaven, Ananas, Feigen, Zitrusfrüchte, Cashewnüsse, Mangos,
Papayas und andere mehr. Viele der meistens arabischen
Namen sind mir jedoch entfallen.
Onkel Carl hatte viele Begabungen. Das Lied „Heimat“ hatte
er 1942 in der Internierung komponiert. Es ist in dem genannten
Buch von Helmut Glenk abgedruckt. Auch hat er eine
Ansicht von Sarona im Jahr 1937 gezeichnet, die auch in diesem
Buch zu finden ist.
Wenn ich heute in einem tropischen Land eine mir unbekannte
Frucht probiere, habe ich manchmal das Empfinden,
sie irgendwann schon einmal gegessen zu haben.
Als ich wieder einmal mit meinem Fahrrad vorgefahren
kam, heulte die Sirene erneut auf. Was war geschehen?
„Das ist Fliegeralarm!“, rief Onkel Carl. Und wenn man sich
ganz still verhielt, konnte man ein leises Summen von Flugzeugmotoren
hören. Onkel Carl und die meisten anderen konn-
204
ten das Geräusch nicht wahrnehmen. Man musste dazu junge
Ohren haben. Ganz oben am Himmel, fast nicht sichtbar,
konnte man einige der Flugzeuge entdecken.
„Wie hoch fliegen die wohl? 4 000 Meter?“, räusperte er
sich.
Zuerst konnte ich die kleinen silbernen Punkte nicht sehen,
aber Gisela hatte viel bessere Augen als ich. „Siehst du sie
nicht?“, fragte sie mich und deutete mit dem Zeigefinger in
die Richtung eines hohen Baumes. Und dann entdeckte ich
sie. Es waren vier oder fünf. Wie war das doch noch vor wenigen
Jahren in Jerusalem, wenn der Frühling einkehrte? Wenn
wir hinter den Tennisplätzen mit unseren Eltern spazieren
gingen, suchten wir nach den ersten Anemonen. Es sind die
roten Anemonen des Heiligen Landes, die ganze Landstriche
zusammen mit dem roten Mohn in Blumenteppiche innerhalb
von wenigen Tagen verwandeln können. Gisela entdeckte die
ersten. Manchmal war eine gerade aufgegangene Anemone
nur wenige Meter von mir entfernt, und ich sah sie nicht. Selbst
meine Mutter war schneller.
Dann glaubten wir, Einschläge gehört zu haben, waren uns
aber nicht sicher. „Sie bombardieren Tel-Aviv“, sagte Onkel
Carl bedeutungsvoll. „Sie waren schon einmal da. Es sind
wahrscheinlich wieder Italiener.“
Vielleicht hatte er recht mit seiner vagen Vermutung. Sie
hatten schon einmal Bomben aus großer Höhe fallen gelassen,
und zwar bei den vorhergegangenen Angriffen auf die
Öl-Lager von Haifa. Sie wollten kein Risiko eingehen, abgeschossen
zu werden. Die Piloten dachten wohl, irgendwas wird
schon zerstört werden.
Bei einem der Bombenangriffe am 9. Sept. 1940, einem Montag,
wurden 119 Menschen in Tel-Aviv getötet, darunter 55
Kinder.
205
Anschaulich ist der Augenzeugenbericht, in gekürzter und
übersetzter Fassung, von Felix Haar, der, wie bereits erwähnt,
zwei Jahre älter ist als ich – damals also etwa 12 Jahre alt –
und mit seinen Eltern gegenüber von uns wohnte:
„Ich war gerade in Friedrich Orths neuem Haus mit seinem
Sohn Manfred und dessen Mutter, als Flugalarm gegeben
wurde und die Sirenen heulten im Ton an- und abschwellend.
Wir rannten ins Freie, um zu sehen, was los war. Wir entdeckten
zwei Bomber am Himmel, die niedrig flogen. Selbst kleine
Details konnten wir ausmachen. Aber wir hatten nicht viel
Zeit. Die Bombenschächte öffneten sich, und Bomben fielen
heraus. Eine Ansammlung von hohen Häusern war offenbar
das Ziel. Wir sahen Staub und Trümmer von den getroffenen
Häusern aufsteigen. Die Zeitungen berichteten am nächsten
Tag von vielen Opfern und zerstörten Häusern. Die Bomben
fielen vielleicht eineinhalb Kilometer von unserm Internierungslager
entfernt. Die Italiener rechtfertigten sich für diesen
Angriff als Vergeltung für die Versenkung ihres größten
Lazarettschiffes vor Tunis.“
Vielleicht hat er damit den oben erwähnten Angriff beschrieben.
Haar berichtet noch von einem weiteren Angriff:
„Ein weiteres Bombardement fand in einer Nacht statt. Das
Lager wurde nicht getroffen (was natürlich versehentlich gewesen
wäre), aber nur 200 Meter südlich vom Camp wurde
ein Old People Home getroffen. Weitere Bomben fielen. Mein
Vater befand sich im ersten Stock des Hauses der Stellers, in
dem wir wohnten. Ich wachte auf. Das Motorengeräusch des
Flugzeugs konnte man mit dem Geräusch eines lauten Motorrads
vergleichen. Mein Vater hörte den Einschlag eines
Projektils in die Hausmauer nur zwei oder drei Meter von ihm
entfernt. Am nächsten Morgen fanden wir tatsächlich einen
206
Bombensplitter, der etwa 50 mm im Durchmesser maß und
etwa 15 mm dick war.“
Ich kann mich an den Splitter erinnern, der natürlich in
unserem Lager für Aufsehen gesorgt hatte. Beinahe hätten die
Bomben der mit uns Deutschen verbündeten Italiener Verletzte
im Internierungslager gefordert.
Doch noch einige Worte über mein kleines Fahrrad. Im ersten
Jahr der Internierung in Sarona funkunierte es noch. Mit
meinen Taschenmessern war es das Wertvollste, was ich besaß.
Aber die Reifen waren nicht mehr in Ordnung. Mehrere
Löcher in den Schläuchen ließen die Luft entweichen. Damit
wollte ich mich nicht zufrieden geben. Mit neun Jahren versuchte
ich die Schläuche zu flicken. Von einem alten Schlauch
schnitt ich runde Aufkleber heraus, schliff ihre Ränder an einem
Schleifstein ab, raute die Klebefläche auf und klebte sie
mit einer Gummilösung, die Tante Caroline noch irgendwo
herauskramte, auf die punktierten Stellen. Dann pumpte ich
den geflickten Schlauch auf, hielt ihn unter Wasser und - hélas
- er war nicht dicht. Immer wieder versuchte ich diese
Prozedur. Ohne Erfolg. Onkel Hans bot mir seine Hilfe nicht
an, auch nicht Onkel Carl. Warum konnten diese Männer bei
ihren Familien bleiben und waren nicht in Akko in dem separaten
Männerlager interniert wie mein Vater? Sie waren doch
alle im gleichen Alter, nämlich um die 55. Nach welchen Richtlinien
sind die Engländer verfahren? Gab es gefährliche und
weniger gefährliche Deutsche? Kamen diese Informationen
vom englischen CID, dem englischen Geheimdienst, der im
Hintergrund in Palästina allgegenwärtig tätig war? Hatte die
CID über jeden Deutschen ein geheimes Dossier angelegt?
207
Trachom bricht im Lager aus.
Seelenruhe bekommt man, wenn man aufhört zu hoffen.
Immer wieder waren es die beiden ungarischen Buben, die
für neue Aufregung sorgten. So war es auch diesmal. Sie hatten
sich eine Augenentzündung zugezogen, die Dr. Hoffmann
als Trachom diagnostizierte.
Das ist eine Augenkrankheit, die hauptsächlich in tropischen
und subtropischen Ländern weit verbreitet ist und die nach
einigen Jahren zur Blindheit führt.
Die Bevölkerung Ägyptens ist von dieser Krankheit seit Jahrtausenden,
schon unter den Pharaonen, besonders stark betroffen,
weshalb sie auch als „Ägyptische Augenkrankheit“ in
Europa bekannt wurde. Viele Millionen Menschen sind schon
durch die Krankheit erblindet und haben in ihrem Leben keine
Chance, jemals wieder das Licht der Welt zu erblicken. Die
meisten von ihnen müssen sich durch Betteln am Leben erhalten.
Eine andere Möglichkeit gibt es für sie nicht.
Deshalb sitzen auch an den Straßenrändern von Kairo heute
noch Hunderte von Blinden, die um eine milde Gabe bitten.
Es ist für einen Touristen ein trauriger Anblick, dieses Leid
hautnah zu erfahren. Aber wie kann man helfen?
Heute vielleicht mit modernen Arzneimitteln. Aber in meiner
Jugend?
Es gab eine umstrittene Methode, die man anwenden konnte,
wenn die Krankheit noch im Anfangszustand war. Der
Erfolg war aber mehr als zweifelhaft. Der Arzt zieht dabei
das untere Augenlid nach unten und klappt das obere auf.
Dann nimmt er einen zurechtgeschliffenen Blausteinkristall,
reines Kupfersulfat, das auch zur Algenbekämpfung dient und
früher in Bootsfarben für den Unteranstrich des Bootskörpers
enthalten war, und bestreicht damit beide Lider. Der Stein soll
208
die Infektion wegbrennen. Wenn sich nach einigen Monaten
der täglich durchgeführten Prozedur keine Besserung einstellen
sollte, wird er durch den noch schärferen Höllenstein, ein
Silbernitrat, ersetzt. Nach der Behandlung hört das Brennen
des Auges erst nach Stunden auf und nachts kann man vor
Schmerzen kaum schlafen. Man hatte dauernd das Gefühl,
Sandkörner in den Augen zu haben und rieb und rieb mit den
Händen, bis die Augen rot anschwollen.
Die ungarischen Buben konnte man bedauern.
Dr. Hoffmann, seiner gestellten Diagnose nicht ganz sicher,
zog einen englischen Militärarzt hinzu und ließ sie sich bestätigen.
Nach einigen Wochen klagten auch andere Jungs und
Mädchen über Augenbrennen. Eine Epidemie war im Lager
ausgebrochen und die Katastrophe da.
Bald waren es 50 Kinder. Gisela und ich waren darunter.
Jeden Nachmittag führte uns unser Weg zum Saal, in dem
eine Notstation zur Behandlung eingerichtet worden war.
Unsere Augenlider wurden nach unten gezogen und nach
oben über ein Streichholz geklappt und das Einstreichen mit
dem Stein von Dr. Hoffmann vorgenommen. Weinend vor
Schmerzen schlichen wir nach Hause. Das Brennen in Verbindung
mit dem Gefühl von Sandkörnern in den Augen, die
gar nicht vorhanden waren, hörte nicht auf. Die tröstenden
Worte meiner Mutter nutzten nicht viel:
„Ihr müsst das durchhalten. Es würde noch viel schlimmer
sein, wenn ihr nicht mehr sehen könntet!“ und hielt uns liebevoll
und tröstend im Arm, während sie das sagte. „Es wird
vorbeigehen. Alles wird gut werden.“
Dr. Hoffmann war über einige Ecken mit uns verwandt. Ida,
die Schwester meines Vaters, hatte Dr. Hoffmanns Bruder
geheiratet. –
Der schnelle Vormarsch von Rommel in Nordafrika Rich-
209
tung Ägypten ließ die Engländer aufschrecken und reagieren.
Würde Ägypten fallen, fiele auch Palästina. Eine Verstärkung
der deutschen Truppen durch die gefangenen Deutschen in
Akko konnte nicht hingenommen werden. Sie mussten verlegt
werden.
Die ansteckende Augenkrankheit hatte unerwartete Folgen
für das weitere Schicksal unserer Familie.
210
Mein Vater wird nach Australien verlegt.
Ein Fremder ist der, der keinen Freund hat.
Australien schien der geeignete Ort zu sein. Die Queen Elizabeth,
der zum Truppentransporter umgebaute Ozeanriese,
damals das größte Schiff der Welt, sollte von Perth in Australien
zum Roten Meer kommen, um vor Reede der Stadt Suez,
wo der Suezkanal ins Rote Meer mündet, die etwa 700 nach
Australien zu verlegenden Deutschen aufzunehmen. Vielleicht
hätte das große Schiff auch den Kanal befahren können, doch
man wollte das Schiff keiner Gefahr von Luftangriffen durch
die Deutsche Luftwaffe aussetzen. So war es außerhalb deren
Reichweite.
Das 313 m lange und 84 000 Registertonnen große Schiff mit
einem Tiefgang von zwölf Metern hätte man vielleicht durch
den damals nur 16 m tiefen Suezkanal lotsen können. Heute
ist der Kanal auf 20 m Tiefe ausgebaggert, und Schiffe bis
150 000 Bruttoregistertonnen können passieren. Nur die riesigen
Supertanker, die einen Tiefgang bis zu 30 m haben, müssen
immer noch den Umweg um das Kap der Guten Hoffnung
nehmen.
Die Internierungslager in Palästina, auch Sarona, sollten so
schnell wie möglich aufgelöst, die Familien mit ihren Männern
zusammengeführt und alle auf das Schiff gebracht werden,
das seine Fahrt nach Australien im Zickzack-Kurs aufnahm,
um eventuellen Torpedos auszuweichen, abgeschossen
von sogar im Indischen Ozean operierenden, deutschen
U-Booten. Die deutschen U-Boote indes hatten kaum eine
Chance, das 32 Knoten schnelle Schiff zu stellen oder zu verfolgen.
Diese Geschwindigkeit konnte ein U-Boot nie erreichen.
So geschah es denn auch; die Deutschen wurden auf das
Schiff gebracht. Die australische Einwanderungsbehörde be-
211
stand allerdings darauf, dass keine Trachom-Kranke ins Land
kamen. Die hochansteckende Krankheit durfte nach Australien
nicht eingeschleppt werden. Auch nicht unter außergewöhnlichen
Umständen, wie bei einem Krieg.
Dr. Hoffmann fiel nun, zusammen mit dem unerfahrenen
englischen Arzt, die Aufgabe zu, eine Liste mit den Namen
der trachomkranken Kinder zu erstellen.
Als meine Schwester und ich zum täglichen Auspinseln in
den Saal kamen, schob er uns auf die Seite und sagte barsch:
„Was wollt ihr hier? Verschwindet!“
Ich verstand nicht, was er wollte. „Sind wir denn jetzt gesund?“,
fragte ich verwundert. „Müssen wir nicht mehr eingepinselt
werden?“ Der Engländer schaute misstrauisch auf.
Zu Dr. Hoffmann gewandt sagte er: „Please put them on
the list!“
Dr. Hoffmann wollte unserer Familie einen Gefallen tun und
uns nicht auf die Liste setzen, damit wir mit unserem Vater
zusammengeführt nach Australien fahren konnten. Als Jugendlicher
hatte ich seine gute Absicht missverstanden.
Die Augenerkrankung und unsere Namen auf der Liste hatten
dazu geführt, dass unser Vater fast neun Jahre von uns
getrennt blieb.
Nach drei Wochen dockte die Queen Elizabeth mit dem
Decknamen HMT P.P. unversehrt im australischen Hafen von
Freemantle bei Perth an, was nicht selbstverständlich war, denn
Hitler hatte es sich in den Kopf gesetzt, mit allen Mitteln den
ganzen Stolz der Engländer zu versenken, koste es, was es
wolle – das Schiff war erst im September 1938 vom Stapel gelaufen
und 1940 in Dienst gestellt worden. Zu Anfang des
Kriegs war das Schiff auf Schleichwegen nach New York gekommen
und dann nach Singapur, wo es zum Truppentransporter
umgebaut wurde. Bis Ende 1941 pendelte es zwischen
212
Die "Queen Elizabeth"
Australien und dem Suezkanal hin und her und danach bis
Kriegsende über den Atlantik zwischen Southampton und
New York. Das gleich große Schwesterschiff, die Queen Mary,
ebenfalls zum Truppentransporter umgebaut, transportierte
auf einer ihrer vielen Überfahrten sage und schreibe 16 683
Mann. Nie wieder haben sich mehr Menschen auf einmal auf
einem Schiff befunden. Während dieser Überfahrt war in den
Rettungsbooten nur Platz für 8 000 Personen.
Das Ende der stolzen Queen Elizabeth war tragisch. Es wurde
nach dem Krieg verkauft und nach Hongkong geschleppt, wo
es zu einer schwimmenden Universität umgebaut werden sollte.
Ein Feuer war gelegt worden, bevor der Universitätsbetrieb
im Jahr 1972 aufgenommen werden konnte, das stolze Schiff
brannte, ein Ölkessel explodierte, die immensen Wassermen-
213
gen, welche die Hafenfeuerwehr zum Löschen einpumpte,
brachten das Schiff zum Kentern, sodass es schließlich sank.
Den Namen Tatura, wie das große Kriegsgefangenenlager
etwa 200 km nördlich von Melbourne im Staat Victoria hieß,
sollte mein Vater so schnell nicht wieder vergessen. Deutsche
und Japaner waren hier interniert. In der Halbwüste war an
ein Fliehen nicht zu denken, obwohl das einige junge Gefangene
immer wieder wagten. Spätestens nach einigen Tagen
wurden sie dann halb verdurstet wieder aus der Wüste eingefangen
und zurückgebracht.
Für die Palästinadeutschen war der Aufenthalt im Lager
erträglich. Immerhin waren die Familien vereint mit ihren
Männern. Man konnte einem geregelten Leben nachgehen,
wenn auch mit Einschränkungen, denn man war mit vielen
anderen gemeinsam in großen Baracken untergebracht. Die
Templer richteten für die Kinder eine Schule ein und am Sonntag
fand regelmäßig ein Gottesdienst statt.
Mein Vater war einer der wenigen Palästinadeutschen, die
allein und ohne Familie waren. Er hatte nach kurzer Zeit aber
das Glück, in einem Einzelzimmer wohnen zu können.
Was tut ein alleinstehender Mann den ganzen Tag lang in
einem Lager? Briefe an uns schreiben, war eine seiner Tätigkeiten.
Aber sie erreichten uns in Palästina nicht mehr. Sie
waren zu lange unterwegs. Bis zu einem Jahr.
Er begann Fremdsprachen zu büffeln, hauptsächlich Englisch
und Französisch, wobei er auch vor Russisch und Japanisch
nicht haltmachte. Einige im Lager erinnerten sich, dass
er in Jerusalem in der Blaskapelle mitgemacht hatte. Sie baten
ihn, eine Blaskapelle in Tatura ins Leben zu rufen, und er erhielt
dabei die Unterstützung des Lagerkommandanten.
Schließlich brauchte man Instrumente, die dann von der Kom-
214
mandantur zur Verfügung gestellt wurden. Er wurde Dirigent
der Blaskapelle.
Er hatte bei einem Unfall im Lager drei Finger verloren. Ein
Liegestuhl, den er benutzte, klappte unversehens zusammen
und schnitt ihm die Finger ab, sodass er selbst nicht mehr spielen
konnte. In späteren Jahren machte ihm das noch zu schaffen,
weil er gerne mit dem Klavierspielen wieder angefangen
hätte.
215
Das Internierungslager Athlit
Hast du viel Sorgen, so frage eine Frau um Rat, die das Alter
deiner Mutter hat.
Das Lager in Sarona wurde von den Engländern aufgelöst,
und wir wurden, vielleicht 150 Personen an der Zahl, in ein
mit Stacheldraht bewehrtes enges Barackenlager bei Akko im
Norden von Palästina mit Namen Athlit verlegt.
Es hieß, dass wir gegen andere Gefangene – Juden und einige
Engländer –, über die neutrale Türkei nach Deutschland
ausgetauscht werden sollten. Die Verhandlungen zogen sich
über Monate hin, während wir in Athlit eingezwängt waren.
Wie ich das als Bub verkraftete, habe ich in einer Geschichte
festgehalten, die in dem von mir geschriebenen Büchlein das
Mädchen, das der Sonne nachlief enthalten ist und nachfolgend
wiedergegeben wird:
Das Meer hinter dem Stacheldraht
Hinter einer hohen Düne aus gelbem, grobem Meersand erhob
sich ein Lager, in dem Frauen und Kinder im Zweiten Weltkrieg
interniert waren. Die Regenzeit hatte begonnen. Vom Meer her
zogen dunkle Wolken über den Himmel. Es regnete. Frierend standen
die arabischen Soldaten in ihren zu großen englischen Uniformen
in ihren Wachhäuschen. Ihre Schuhe waren nass und mit Lehm
beschmiert bis hinauf zu den Gamaschen.
Zwischen dem Geprassel der Tropfen auf das verzinkte Wellblechdach
einer Baracke tönte das fröhliche Geschrei von Buben.
Sie saßen am Boden und spielten mit Murmeln. Dazu hatten sie
sich kleine Löcher in den harten, getrockneten Lehmboden gescharrt.
Das Spiel war ernst, denn es ging immer um einen hohen Einsatz,
um eine Murmel, und Murmeln konnte man nicht kaufen, man
musste sie haben. Sie spielten so wie alle Jungen auf dieser Welt,
216
unbekümmert und ganz bei der Sache, nur darauf wartend, dass
der Regen aufhörte.
Frauen verschiedenen Alters und Standes lagen halb angezogen
auf den Holzbänken, saßen auf dem Bettrand und stopften Strümpfe
oder kämmten sich und ihren Töchtern die Haare. Sie unterhielten
sich, soweit das möglich war bei dem Lärm, der durch den Regen
auf dem Wellblechdach verursacht wurde. Einige saßen an einem
langen Holztisch in der Mitte der Baracke. Manche stillten ihre
Kinder, verprügelten ihre Jungen und kreischten mit hoher Stimme.
Sonst gab es nichts zu tun.
Ein Junge, etwa zehn Jahre alt, barfuß, mit einer Kakihose und
einem viel zu kleinen Trikothemd bekleidet, saß am Boden abseits
von den anderen Jungen, die Murmeln spielten. Seine Murmeln
hatte er beim Spiel verloren. Er spielte schlecht, und er gewann
nie.
Er hielt ein schmales Holzbrett einer Orangenkiste in der Hand
und schnitzte mit seinem Taschenmesser daran herum. Das Holz
war erstaunlich hart, wahrscheinlich stammte es von einem Orangenbaum.
Manchmal nahm er eine grüne Glasscherbe einer zerbrochenen
Flasche und schabte damit das Holz glatt. Hin und
wieder lutschte er an seinem Zeigefinger. Er hatte sich geschnitten.
Dann färbte sich das weißliche Holz an einigen Stellen rot.
Mit einem Nagel durch die Mitte befestigte er das geformte Brettchen
an einer Stange.
Er sprang hinaus in den Regen. Würde sich das Brettchen im
Wind drehen? Hatte er es fertiggebracht, einen richtigen Propeller
zu schnitzen? Ja, es drehte sich! Geschickt stieg er an einer
etwas erhöhten Stelle auf die Baracke, die zum Essen und zum Gottesdienst
bestimmt war, und klemmte seinen Propeller zwischen
zwei Wellblechbahnen fest, um den Wind vom Meer aufzufangen.
Von hier aus versuchte er auch, über die Düne hinwegzublicken,
um das Meer zu sehen. An keiner Stelle des Lagers waren die Vor-
217
aussetzungen günstiger als hier. Aber auch dieses Dach war zu
niedrig, er konnte das Meer nicht sehen.
Der Propeller drehte sich, er hielt den Wind vom Meer fest. Das
Meer kam dadurch dem Jungen näher; er bildete sich ein, es jetzt
deutlich rauschen zu hören. Sein Wunsch, es einmal zu erblicken,
brannte immer stärker in ihm. Er brach in Tränen aus und stieg
vom Dach herunter. Nie hatte er die Freiheit so vermisst wie jetzt.
Er lief auf die Baracke zu, in der er wohnte, und warf sich auf seine
niedrige Pritsche, das Gesicht in die Wolldecke vergraben, und
weinte. Seine Schwester beugte sich über ihn, streichelte die nassen
Haare und sagte: ,,Siegfried, was hast Du denn?“ Er schluchzte
noch mehr und schob ihre Hand weg.
Am gleichen Abend entdeckten Vorbeigehende den Propeller auf
dem Dach. Einige freuten sich, andere schimpften über den Unfug.
Niemandem kam in den Sinn, dass der Junge versuchte, mit dem
Propeller den Wind festzuhalten, um dem Meer näher zu sein.
Schließlich stieg einer der Buben, die Murmeln gespielt hatten, auf
das Dach, packte den Propeller mit beiden Händen und warf ihn
im hohen Bogen über den Stacheldraht auf die Düne. Seine Kameraden
lachten laut und klatschten Beifall.
Siegfried, verletzt und enttäuscht von den Jungen, lief am Stacheldraht
entlang und versuchte, irgendwo ein Loch zu finden. Es
schien vergebens zu sein. Endlich sah er eine Stelle, wo der Draht
nur lose über dem Sand lag. Wenn er hier den Sand wegräumte,
könnte er seinen schmalen Körper durch die entstandene Öffnung
schieben, er würde die Düne hinauflaufen, seinen Propeller holen
und dabei auch das Meer erblicken. Ihm wurde ganz warm ums
Herz bei diesem Gedanken.
In der Nacht konnte er kaum schlafen. Er hatte einen Plan gefasst.
Gegen Morgen, als es noch dunkel war, schlich er sich von
der Seite seiner Schwester, öffnete leise die Barackentür, schob sich
hinaus und eilte im Schutz der Barackenwände zu der Stelle hin.
218
Ein sternklarer Himmel wölbte sich über ihm. Hinter der Düne
begann es, schon heller zu werden. Schnell grub er mit beiden Händen
den Sand weg und schielte dabei vorsichtig nach beiden Seiten,
um sich zu vergewissern, dass er von niemandem beobachtet
wurde. Der Soldat im Wachhäuschen schlief. Im Lager war nie etwas
geschehen. Keiner hatte bisher einen Fluchtversuch unternommen.
Er hatte keine Veranlassung, sich mit aller Kraft wach zu
halten.
Vorsichtig schob der Junge seinen kleinen Körper durch die Öffnung
und rannte die Düne hinauf.
Beinahe am Kamm angelangt, hörte er einige Schüsse, die dumpf
in den Sand fielen. Er fiel vor Schreck hin. Er war aber nicht getroffen
worden. Er blickte über das ersehnte Meer. So sah es also
aus. So weit hatte er es sich nicht vorgestellt. Es schien in der Ferne
kein Ende zu nehmen. Am Horizont war es sogar blauer als der
Himmel. Die Sonne erschien als glühender Ball und ein Schiff zog
eine lange Rauchfahne hinter sich her. Die Wellen brachen sich an
den Klippen, überschlugen sich und rollten sanft an der schwachen
Neigung der Düne aus. Er zitterte am ganzen Leib, so hatte
das Bild von ihm Besitz ergriffen. Er wollte es am liebsten verschlingen.
Er fühlte, wie Männerhände seinen Körper betasteten, er drehte
sich um und schaute verwundert dem arabischen Soldaten ins Gesicht,
der sich über ihn beugte. Warum weinte der Araber? Der
Gesichtsausdruck des Soldaten änderte sich und ging in ein Lachen
über, als er merkte, dass der Junge nicht getroffen war. Er hob
ihn auf und stellte ihn hin, um wirklich sicher zu sein. Der Junge
war unverletzt. Der Araber kniete nieder, neigte sich der aufgehenden
Sonne zu und verrichtete sein Morgengebet.
Der Junge wartete und faltete verstohlen selbst die Hände. Der
Araber nahm sein Gewehr vom Boden und zog den Jungen von der
Düne weg. Als sie am Wachhäuschen vorbeikamen, verschwand
219
der Soldat kurz. Er brachte den Propeller heraus und gab ihn dem
Jungen.
Der englische Lagerkommandant sprach viel und lange mit dem
Jungen. Siegfried verstand nichts. Endlich wurde er in die Baracke
zurückgebracht. Er holte eine dicke Muschel aus seiner Tasche
hervor und schenkte sie seiner Schwester.
Der Stacheldraht wurde zwar in der Folgezeit verstärkt, aber
dafür durften die Kinder wöchentlich einmal in Begleitung einer
Rotkreuzschwester und zweier arabischer Soldaten über die Düne
ans Meer.
In einer der großen Baracken waren ungefähr 60 Personen
untergebracht. Sie war viel zu klein für so viele Menschen.
Der Geräuschpegel war hoch und die Stimmung unter den
Gefangenen schlecht. Und es roch nach Menschen! Die Tage
vergingen mit Warten.
Eine Frau schrie wie von Sinnen, als sie in einem ihrer Schuhe
einen Skorpion entdeckte. Sie wäre sicher gestochen worden,
wenn sie nicht zufällig vor dem Anziehen des Schuhs
hineingeschaut hätte, wie das wegen der in dieser Gegend
häufig vorkommenden Skorpione empfohlen worden war.
Ein älterer Junge rief: „Wollen wir doch einmal sehen, ob
ein Skorpion sich wirklich umbringt, wenn es keinen Ausweg
mehr gibt.“
Er nahm einen Kanister mit Petroleum, das für die Lampen
gebraucht wurde, und goss einen Ring um den Skorpion. Er
zündete die Flüssigkeit an. Der Skorpion drehte sich einige
Male im Kreis, seinen Stachel hoch erhoben, und als er erkannte,
dass rings um ihn Feuer brannte, stach er sich selbst, fiel
zur Seite und starb.
220
Der Gefangenenaustausch nach Deutschland
Die Verzeihung ist vollständig, wenn die Sünde vergessen ist.
Dann war es eines Tages so weit. Busse fuhren vor. Das
Wenige, was wir mitnehmen durften, war bald gepackt. Die
Eisenbahnwaggons der Schmalspurbahn standen bereit.
Die Abteile waren so angeordnet, dass jedes nur von außen
bestiegen werden konnte. Unter ihnen gab es keinerlei Verbindung.
Drei Frauen mit ihren Kindern kamen in jedes Abteil
und dazu ein bewaffneter arabischer Söldner. Der Zug
setzte sich im Schritttempo in Bewegung. Toiletten gab es keine,
und der Zug hielt kaum einmal an. Schließlich tauchte ein
Töpfchen auf, das dann von Fenster zu Fenster den ganzen
Zug entlang weitergereicht wurde. Trotzdem war es für die
Frauen eine heikle Situation mit dem anwesenden Araber im
Abteil.
Schließlich erreichten wir Aleppo und dann die Türkei. Der
Austausch fand statt und als wir Istanbul passiert hatten,
waren auf einmal deutsche Beamte in dem jetzt normalen Zug.
Wir waren jetzt auf der Strecke, wo in Friedenszeiten der Orientexpress
verkehrte.
An einem kalten, wolkenbedeckten Tag fuhren wir
schließlich in den Hauptbahnhof von Wien ein und fanden
ein Telegramm von Tante Gertrud Wieland vor, die uns in ihr
Haus in Aufkirch bei Überlingen aufnehmen wollte. War die
Internierung jetzt endgültig zu Ende? Waren wir wieder freie
Menschen? Konnte ich jetzt hinlaufen, wohin ich wollte?
Ich nahm die Gelegenheit gleich wahr, riss mich von meiner
Mutter los und rannte auf den Bahnhofsvorplatz. Ich
schaute in den Himmel. Alles grau! Wie schrecklich. Nirgends
war die Sonne zu sehen. Nirgends brach sie durch. Das war
ich von Palästina nicht gewohnt. Das Grau legte sich wie ein
221
schwerer Mantel auf mein Gemüt. Ich atmete tief und schwer,
als ob das Grau der Luft den Weg in meine Lunge versperrte.
Und auch die einzelnen herabfallenden Schneeflocken, die im
schwarzen Asphalt der nassen Straße schmolzen, konnten
meine düstere Stimmung nicht aufhellen. Hier in diesem Land
sollte ich in Zukunft leben? Die Helligkeit und die Sonne Palästinas
würde ich sehr vermissen, das war mir plötzlich bewusst
geworden.
Und welch andere Widerwärtigkeiten erwarteten uns in
dem vom Krieg zerrütteten Deutschland?
Den Beamten war natürlich berichtet worden, dass die meisten
der Kinder mit Trachom infiziert waren. Wir wurden nach
Tübingen ins Tropeninstitut zur Untersuchung gebracht. Die
Untersuchungen ergaben, dass weder meine Schwester noch
ich und auch alle anderen Kinder nie an Trachom erkrankt
waren und es auch nicht hatten. Wir wurden einfach als gesund
entlassen. Es war eine Fehldiagnose gewesen mit schwerwiegenden
Folgen für die betroffenen Familien. Wahrscheinlich
war es nur eine Bindehautentzündung gewesen, die wegen
der Behandlung mit den Ätzsteinen nicht heilen konnte.
Ein Abschnitt in meinem Leben war zu Ende gegangen. Ich
war gerade elf Jahre alt geworden und hatte schon viel erlebt.
Das Herausragende an meinem bisherigen Leben war die Liebe
zu meiner Mutter. Ich hatte immer ein wunderbares Zuhause
gehabt, konnte immer mit all meinen Problemen zu ihr
kommen und wurde mit Liebe und Verständnis empfangen.
Ich hatte erfahren müssen, wie emotional Araber reagieren
können. Welche Todesangst hatte ich gehabt, als ich auf dem
Band der Häckselmaschine lag und Ali fast bereit war, mich
loszulassen und es auch getan hätte, wenn Achmed nicht gekommen
wäre.
Ich musste erst einen lebensgefährlichen und sinnlosen
222
Kampf auf dem schrägen Dach des Wasserturms durchstehen,
um erkennen zu können, zu welchen Auswüchsen Menschen
fähig sind.
Ich wurde als Templer zu freiem Denken erzogen. Im Vordergrund
stand der Glaube an das Gute im Menschen, die
Ehrlichkeit und die Bereitschaft zu empfangen und zu geben.
Mein Vater hatte mir Jerusalem gezeigt. Die Heilige Stadt
mit ihren vielen Religionen und noch mehr Kirchen. Würde
ich die Stadt heute auch als meine Heimat betrachten? Nein,
Jerusalem ist mir, im Gegensatz zu meinen Eltern, immer
fremd, ja beinahe könnte man sagen, unnahbar, vielleicht
sogar etwas unheimlich geblieben.
Vielleicht hat der Jude Graf Lüttichau mich mit seinem Wissen,
seinem scharfen Verstand und seinen Geschichten so beeindruckt,
dass in mir ein Wissensdurst entfacht wurde, der,
wenn ich es richtig sehe, bis heute nicht erloschen ist. Vielleicht
war das das Schlüsselerlebnis in meinen jungen Jahren.
Ich hatte kennenlernen müssen, was der Verlust der Freiheit
bedeutet, hinter Stacheldraht gefangen zu sein und wie
süß die wiedergewonnene Freiheit danach ist.
Jetzt stand die Reise an den Bodensee bevor. Ich war gespannt.
Konnte man darin angeln, darin schwimmen? Würde
es dort heller und freundlicher sein als in dem grauen Wien?
Würde ich in jener fremden Stadt Überlingen Freunde finden?
Würde ich dort Murmeln kaufen können?
Wann würde der Krieg zu Ende gehen? Würde unser Vater
uns nach Australien holen, um dort endlich wieder vereint
ein neues Leben beginnen zu können? In einer neuen Heimat?
223
Die überraschende, neue Geschichte des
Hauses Kuebler
Der Einäugige ist eine Schönheit im Land der Blinden.
Dieser Abschnitt wurde im Jahr 2007 geschrieben, als Ehud
Olmert noch israelischer Ministerpräsident war:
Die Nummer 8 Cremieux Street – vor 1948 mit dem Namen
Seestraße – Jerusalem, ist in den letzten Jahren eine der bekanntesten,
wenn nicht sogar berühmtesten Adressen Israels
geworden. Wie konnte das geschehen, werden Sie als Leser
fragen? Das Haus ist doch bestimmt sehr alt und hat nichts
Außergewöhnliches zu bieten. Oder doch? Mein Großvater hat
es in den 1880er-Jahren aus mit Meißeln gehauenen, sehr breiten
Kalksteinen gebaut. Es sollte den häufigen Erdbeben in
dieser Gegend widerstehen, was es offensichtlich auch tat.
Ich traute meinen Ohren nicht, als Shay Farkash, der sich im
Auftrag der israelischen Regierung unter anderem für die Erhaltung
und Restaurierung der Templersiedlungen in Israel
einsetzt, mir am Telefon Ende 2006 erklärte, dass Ehud Olmert,
der heutige Ministerpräsident Israels, in der Zeit, als er noch
Bürgermeister von Jerusalem war, etwa 2004 dieses Haus gekauft
und darin mit seiner Familie gelebt hat, bevor er Prime
Minister geworden und in das ihm zustehende Regierungsgebäude
umgezogen ist.
Am 17.April 2006 berichtete ein Reporter des bekannten
amerikanischen Time Magazine über einen Besuch bei Ehud
Olmert:
„Es ist gerade 11 Uhr an einem wolkenlosen Morgen in Jerusalem.
Ehud Olmert sitzt mit seiner Frau Aliza am Frühstückstisch
mir gegenüber in einem luftigen, dreistöckigen
Haus, das in der German Colony steht und innen mit Ölgemälden
seiner Frau dekoriert ist. [Wie sich doch die Bilder glei-
224
Mein Vaterhaus in der 8, Cremieux Street, „Deutsche
Kolonie“, heute offiziell genannt „German Colony“ in
Jerusalem, aufgenommen ca. 2004. Für die freundliche
Überlassung der Aufnahme danke ich Shay Farkash,
conservator, Tel-Aviv.
chen. Auch meine Mutter hatte alle Zimmer in diesem Haus
mit ihren selbst gemalten Ölbildern geschmückt. Bernhardiner
Hunde waren eines ihrer bevorzugten Malmotive.] Während
Olmert Gurkensalat serviert, bietet Aliza an, mir ein
Omelette zuzubereiten, zusammen mit geräuchertem Lachs,
gekochtem Gemüse, Oliven und Käse. Es fällt mir leicht zu
vergessen, dass dieses Paar das einflussreichste und mächtigste
in ganz Israel ist.“
Aus Zeitungsberichten kann man ersehen, dass Olmert für
das Haus mit seinem Grund und Boden – das Grundstück mag
nach meiner Schätzung ca. 2 800 qm groß sein – 1,2 Millionen
US-Dollar bezahlt haben soll. Der Marktwert wurde aber auf
225
1,6 bis 1,8 Millionen geschätzt. Schließlich ist die „German
Colony“ die beste Wohnlage in Jerusalem. Es wird gemunkelt,
dass für das Haus in der Amtszeit Olmerts eine Abrissgenehmigung
erwirkt worden war, die in den Zuständigkeitsbereich
der Stadtverwaltung fiel, obwohl es zunächst unter vorläufigem
Denkmalschutz stand.
Die israelische Presse warf jetzt die Frage auf, weshalb Olmert
das Anwesen so billig erwerben konnte. Hatte er seine
Stellung als Bürgermeister missbraucht? Die Affäre wird jetzt
von einem Anwalt untersucht, der von der Regierung für Korruptionsfälle
eingesetzt ist. Die Untersuchungsergebnisse sollen
dem Staatsanwalt unterbreitet werden, dem bei entsprechender
Sachlage nichts anderes übrig bleiben wird, als Anklage
gegen Olmert zu erheben. Das könnte allerdings das
vorzeitige politische Ende des kometenhaften Aufstiegs von
Ehud Olmert bedeuten.
Ehud Olmert
bei einer Rede etwa 2007
226
Ullrich W. Sahm, Nahost-Korrespondent für deutsche Medien
in Israel, schreibt im Sept. 2007:
„Das zweistöckige leer stehende Haus mit dem roten Ziegeldach
in der Cremieuxstraße 8 wirkt ein wenig wie ein Märchenschlösschen.
Umgeben von alten Bäumen, steht es inmitten
der Deutschen Kolonie in einer kleinen schmalen Gasse
zwischen der Bethlehemstraße und der Straße des Geistertals.
Die braune Farbe blättert von den hölzernen Fensterrahmen
ab. Zwei Vorhängeschlösser verschließen das Tor zu dem verkommenen
Garten, in dem Bauschutt liegt und Gräser aus dem
Gehweg wuchern. Ein verbogenes Schild verbietet das Parken
vor dem Haus und sogar auf der gegenüberliegenden Straßenseite.
Das Namensschild aus bunter Kachel trägt noch den
Namen des Vorbesitzers: Ganani-Elad. Ehe Ministerpräsident
Ehud Olmert es beziehen kann, müsste das alte verfallene Haus
einer gründlichen Renovierung unterzogen werden, denn im
Augenblick sieht es eher wie eine Bauruine aus.“
Der folgende Abschnitt wurde im Jahr 2010 geschrieben,
nachdem Ehud Olmert von seinem Posten als Ministerpräsident
im März 2009 wegen einer anderen Korruptionsaffäre,
die nichts mit dem Kauf des Kuebler-Hauses zu tun hatte,
zurückgetreten war.
Die Anklage gegen Olmert wegen in Vorteilnahme seines
Amts beim Kauf des Hauses wurde durch den zuständigen
Staatsanwalt im Oktober 2007 eingeleitet. Die Untersuchung
dauerte drei Jahre. Generalstaatsanwalt M. Mazuz stellte im
Juli 2009 das Verfahren mangels Beweisen ein. Er fügte aber
bei der Bekanntgabe seiner Entscheidung dem Sinn gemäß
hinzu: Die Untersuchung beseitige nicht alle Zweifel, die den
zu niedrigen Kaufpreis des Hauses betreffen. Die Vermutung
bleibe bestehen, dass die Baufirma Alumot als Verkäuferin
227
Olmert einen beträchtlichen Nachlass eingeräumt habe und
dafür von ihm als Oberbürgermeister von Jerusalem erwartete,
seinen Einfluss bei den Stadtbaubehörden bei außergewöhnlichen
Bauanträgen in ihrem Sinne geltend mache.
Olmert dagegen argumentierte, dass er den Kaufpreis im
Voraus entrichtet habe, obwohl Alumot noch nicht die vollen
Besitzerrechte erworben hatte. Dieses Risiko habe er getragen
und deshalb auch einen niedrigeren Preis bezahlt.
Mit dem Freispruch für Ehud Olmert dürfte die undurchsichtige
Angelegenheit um das Kuebler-Haus zu Ende gegangen
sein.
228
Zeitungsausschnitte, die meinen Vater betreffen.
Der Fremde ist blind, auch wenn er Augen hat.
Mein Vater hat gut arabisch gesprochen, so wie meine Mutter
auch, nämlich die in Palästina gebräuchliche Umgangssprache.
Schreiben und lesen konnten sie sie aber nicht. Manche
arabische Ausdrücke blieben mir in Erinnerung, von denen
ich hier einige wiedergeben will, sozusagen als Einstimmung
für dieses Kapitel, das aus Zeitungsausschnitten aus der
Palestine Post besteht, die meinen Vater betreffen.
Wallahe! – das war wirklich so!
Elhamdulillah – Allah sei gelobt!
Rasul Allah – der Gesandte Gottes
Marschallah! – Ausruf der Bewunderung
Salam alikoum – Willkommen, seid alle gegrüßt
Labass
– wie gehts?
Allah rallabe – so Gott will
Hada hareke – welch ein Durcheinander!
Alla akbar – Allah ist der Allergrößte
Die nachstehenden Ausschnitte wurden im Jahr 2006 von
Ariel Atzil und Shay Farkash, member of the Society for Preservation
of Historic Sites in Israel, zur Verfügung gestellt.
ca. 1931
ca. 1931
229
The Palestine Post,
14. Feb. 1934,
page No. 5:
Übersetzung:
„Der berühmte Schweizer Flieger und Forscher Mittelholzer flog
gestern in einem dreimotorigen Flugzeug über Palästina. Er startete
in Gaza nach Petra, umkreiste dabei Jaffa, Tel-Aviv und Jerusalem.
Schweizer Berufsfotografen, die an Bord waren, schossen
dreitausend Bilder von dem neuen und dem alten Palästina.
Das Flugzeug war von dem abessinischen Kaiser – Haile Selassie –
gekauft worden, und Mittelholzer überführte es nach Addis Abeba. Die
Teilnehmer werden bis Freitag hier bleiben, um die Filme
fertigzustellen. Dann werden sie über Ägypten und den Sudan nach
Abessinien weiterfliegen.
Dr. Gogler und Professor Morf, wissenschaftlicher Berater der
Expedition, begleiteten Mittelholzer auf dem Flug. Mr. F. Kuebler,
Kaufmann aus Jerusalem, begleitete Mittelholzer nach Petra. Das
große blaue Flugzeug konnte man gestern von verschiedenen Teilen
des Landes am Himmel beobachten.“
230
Noch einige Einzelheiten zu meinem Vater
Mein Vater wurde am 1. September 1939 am Tag des Kriegsausbruches
von den Engländern interniert. In der Palestine Post
erschien wenige Tage später diese kleine Notiz von seiner Festnahme.
Palastine Post,
Anfang Sept. 1939:
Mein Vater mit ca. 68 Jahren
Mein Vater mit ca. 78
Jahren
231
Shay Farkash
stellte mir die nachfolgenden Bilder zur Verfügung, die
Aufnahmen von Innenräumen meines Vaterhauses zeigen. Sie
stammen wahrscheinlich aus dem Jahr 1930. Er interessiert
sich für die Bordüren an den Wänden der Templerfamilien,
die zum großen Teil von jüdischen Künstlern entworfen und
gemalt worden sind. Bordüren sind auf beiden Aufnahmen
zu erkennen.
Auf dem unteren Bild links oben ist ein Ölgemälde eines
Bernhardiners (Kopf nicht vollständig gezeigt) zu sehen, das
meine Mutter, wie bereits erwähnt, gemalt hatte. Das Foto
wurde in unserem Wohnzimmer im obersten Stock des Hauses
aufgenommen. Im Jahr 1934/35 bezogen wir dann die
Wohnung im mittleren Geschoss. Das Foto zeigt die ganze
Familie von links nach rechts:
Hugo Kunz Hoffmann, Sohn von Hugo und Ida Hoffmann,
Schwester meines Vaters.
Friedrich Kuebler, mein Vater.
Hugo Hoffmann.
Katharina Dyck, die Ehefrau von Johannes Dyck.
Abram Dyck, Bruder meiner Mutter.
Baby auf dem Schoß meines Großvaters Johannes Dyck ist mir nicht
bekannt.
Friedel Dyck, Ehefrau von Abram Dyck.
Paula Kuebler, meine Mutter.
Ida Hoffmann mit Nellie auf dem Schoß, Tochter von Hans und
Katharina Hesselschwerdt, Schwester meines Vaters.
Marianne Dyck, Ehefrau von Dieter Dyck.
Dieter Dyck, Bruder meiner Mutter.
232
Bordüren im Wohnzimmer
Familie Kuebler - Dyck
233
Anmerkungen zu Walter Mittelholzer
Gekürzt aus Wikipedia 2009: „Mittelholzer wurde 1894 in
St. Gallen geboren und starb nach einem Flugzeugunfall in
der Steiermark. Er war Flugpionier, Schriftsteller und Fotograf.
Er gründete eine der ersten Fluggesellschaften. Er war
der Erste, der Afrika in der Nord-Südrichtung überflog. Er startete
am 7. Dez. 1926 in Zürich und landete nach vielen Zwischenstopps
in Kapstadt am 15 Febr. 1927. 1931 avancierte er
zum ersten technischen Direktor der neu gegründeten Swissair.“
In seinem Buch Abessinienflug von 1930 hat er seine Eindrücke
aus der Luft beschrieben. Er soll mit seinen Begleitern allein
über Palästina und dem heutigen Jordanien 3 000 Luftaufnahmen
gemacht haben, die bis heute (2010) noch nicht
aufgefunden worden sind und die das besondere Interesse von
Ariel Atzil erweckt haben, selbst ehemaliger Pilot bei der israelischen
Luftwaffe und Mitglied der Society for Preservation
of Historic Sites in Israel. Nicht verwunderlich, denn wenn
man als Beispiel Mittelholzers
Ausführungen über Gaza liest,
Walter Mittelholzer
kann man das kaum glauben:
„Noch vor wenigen Jahren
war Gaza ein kleines Araberdorf,
dessen Name mit der
Schlacht und dem Sieg der Engländer
über die Truppen der
Deutschen und Türken verbunden
war.“
Wie hat Gaza damals aus der
Luft ausgesehen? Waren es
2 000 Einwohner? Und wie
234
sieht Gazastadt heute aus? Mehr als eine halbe Million Einwohner?
Aber auch andere Landaufnahmen vom ehemaligen Palästina
aus den 1930er Jahren würden Aufschluss über die Entwicklung
des Landes geben und auch andere Forschungsgruppen
in aller Welt interessieren.
Ariel hatte uns mit seiner Frau im Mai 2009 in Überlingen
besucht. Wo sind die Luftaufnahmen geblieben? Waren die
Bilder vielleicht im Nachlass meines Onkels Jona Kuebler zu
finden, der damals Schweizer Konsul war und der damals
Mittelholzer in seiner Eigenschaft als Konsul betreut hatte?
Vielleicht wusste irgendjemand aus seiner Nachkommenschaft
etwas über den Verbleib der Bilder?
Doch ich konnte ihm nicht weiterhelfen. Ich wusste nur, dass
mein Onkel in der Limmattalstraße in Zürich ein Haus besessen
hatte. Ich wusste auch, dass seine Tochter Liselotte hieß.
Kurz nach meinem Studium war ich 1953 in Zürich gewesen,
um an einem Kongress der Gesellschaft für Weltraumfahrt
teilzunehmen. An das Haus erinnere ich mich noch. Die Räume
waren mit dicken Orientteppichen ausgelegt und arabische
Tischchen mit Elfenbeineinlagen und aufliegenden gehämmerten
und verzierten Messingtellern standen verstreut
herum. Palästina ließ sich nicht verleugnen.
Onkel Jona war schon lange tot. Liselotte, an deren Nachnamen
– sie hatte geheiratet – ich mich nicht mehr erinnern
kann, hatte eine Tochter, deren Namen Rosemarie war. Liselotte
fragte mich, ob ich nicht Lust hätte, mit ihrer Tochter,
die wahrscheinlich ein oder zwei Jahre jünger als ich war
(damals vielleicht 20 Jahre alt), einen Kaffee in der Innenstadt
von Zürich zu trinken. Ich erinnere mich noch so gut an diese
Situation, da ich bis auf einige Rappen, genau noch so viel Geld
besaß, um die Rechnung für die beiden Kaffees zu begleichen.
235
Demnach musste die junge Dame im Zeitpunkt des Besuchs
von Ariel etwa 75 Jahre alt sein. Diese wenigen Informationen
reichten jedoch nicht aus, um sie ausfindig zu machen.
Aber wie so oft im Leben kam durch einen Zufall etwas Licht
in die Geschichte. Ein Tennisschläger-Fan, Jürg Schälchli, der
so wie ich alte Schläger sammelt, besuchte mich kürzlich in
Überlingen, um meine Sammlung anzusehen. Zufällig wohnte
er in Zürich in der Limmattalstraße, wo Jona Kuebler ja
bekanntlich auch sein Haus besaß. Ich glaube mich erinnern
zu können, dass es die Nummer 42 war.
„Ja, ich kenne dieses Haus. Ich werde mich umhören.
Vielleicht kann ich Rosemarie ausfindig machen.“
So erfuhr ich dann, dass Liselotte einen gewissen Mann namens
Schweizer etwa 1929 geheiratet habe und aus dieser Ehe
ein Mädchen mit dem Namen Rosemarie hervorgegangen sei.
Rosemarie sei 1932 geboren worden, habe in ihrem Leben aber
nie geheiratet, keine Nachkommen gehabt und habe bis zu
ihrem Tod im Sept. 2009 in dem Haus in der Limmattalstraße
42 gelebt.
Ihre Mutter hatte sich nach etwa sechs Jahren Ehe von ihrem
Mann scheiden lassen, der 19 Jahre später noch einmal
heiratete. Aus dieser Verbindung ging etwa 1951 die Tochter
Maya Schweizer hervor, die nun das Erbe von Rosemarie als
Halbschwester antreten konnte.
Ich konnte nach einigen Recherchen mit Maya telefonisch
in Verbindung treten.
„Nein, irgendwelche Luftaufnahmen von Mittelholzer waren
in dem Nachlass nicht dabei gewesen. Das hätte ich bestimmt
bemerkt.“
So geht die Geschichte zu Ende. Die wertvollen Aufnahmen
werden wohl für immer verschollen bleiben und damit ein Teil
historischen Erbes.
236
Literaturverzeichnis
Der Geizige bewacht sein Eigentum und ist Diener seiner Erben.
Der Koran, von Ludwig Ullmann, neu bearbeitet und erläutert von
L.W. Winter, Wilhelm Goldmann Verlag, München, 1959
Handschriftliche Aufzeichnungen meines Großvaters Johannes
Dyck, geb. 3. März 1858 in Rudnerweide, gest. 17. Mai 1931 in Jerusalem.
Handschriftliche Aufzeichnungen meines Vaters Friedrich Kuebler,
geb. 14. Juni 1884 in Jerusalem, gest. 30. Juni 1971 in Überlingen
Der Orangenpflanzer von Sarona, von Rudolf de Haas, mit Bildern
von Karl Mühlmeister, Enßlin & Laiblins Verlagsbuchhandlung/
Reutlingen, 1930
Templer und andere Erweckungsbewegungen im nördlichen
Schwarzwald und weit darüber hinaus, von Fritz Barth, Eigenverlag,
April 2004
From Desert Sands to Golden Oranges, the history of the German
settlers of Sarona in Palestine 1871-1947, Helmut Glenk in conjunction
with Horst Blaich and Manfred Haering, ISBN 1-4120-3506-
6, published 2005
The Holy Land Called - the Story of the Temple Society, von
Paul Sauer, verlegt von der Temple Society of Australia, Melbourne,
1991. Translation of Uns rief das Heilige Land, Konrad Theiss Verlag,
Stuttgart 1985.
Die Siedlungen der württembergischen Templer in Palästina
1868-1918, von Alex Carmel – Ihre lokalpolitischen und internationalen
Probleme; Kohlhammer - Verlag Stuttgart, 2000, 3te Auflage.
Jerusalem – The German Colony and Emek Refaim Street, by
David Kroyanker, 2008, 399 pages. (David Kroyanker hat ein Buch
237
über die Architektur der württembergischen Häuser der „Deutschen
Kolonie Jerusalem“ verfasst, das in hebräischer Sprache im Jahr 2008
veröffentlicht worden ist.)
Abessinien-Flug, von Walter Mittelholzer, Verlag A,G. Schweizer
Aero-Revue, Zürich, 1930
Mit den Türken zum Suezkanal, von Friedrich Freiherr Kreß von
Kressenstein, Vorhut Verlag, Berlin, 1938
Felix Haar, Melbourne, Brief vom 25. Juli 2009 an Shay Farkash,
Tel-Aviv. (Felix Haar, zwei Jahre jünger als ich, in Haifa geboren,
lebte seit 1939 in Sarona im Karl Steller Haus, schräg gegenüber dem
Haus von Jon Weller, in dem wir während der Internierung untergebracht
waren.)
238
Weitere Bücher von Siegfried Kuebler
nächste Seite
239
Titel Thema ISBN S. Verlag Jahr
Flugweltreise Südseeroute Reisebericht 97 Eigenverlag 1983
Das Mädchen, das der Sonne
nachlief Märchen 3-88325-302-2 71 World of Books 1985
Und dann? Abenteuerroman 3-88325-334-0 151 World of Books 1985
Medina Nueba Gedichte 3-89406-140-5 121 R. G. Fischer 1990
Die Lötkolbentherapie Satire 3-89406-190-1 49 R. G. Fischer 1990
Zwanzig Jahre Tennisschläger Tennisschläger
1972 - 1991 3-9802903-0-1 153 Kuebler GmbH 1992
Das Buch der Tennisrackets Tennisschläger
Book of Tennis Rackets
1555 bis 1990 3-9802903-2-8 423 Kuebler GmbH 1995
Tennis Rackets
1555 to1990 3-9802903-9-5 635 Kuebler GmbH 2000
Mörder unter sich Mordgeschichten 318 Dritte Auflage 2008
Geschichten aus Fuerteventura Abenteuer 253 Erste Auflage 2010
Tage in Süafrika und Namibia Geschichten 237 Limitierte Auflage 2012
Aufzeichnungen und GeschichtenWeingüter/Abenteuer 386 Erste Auflage 2013
Update 2010
to the Book of Tennis Rackets Tennis Rackets 322 Second Edition 2010
Autobiografie:
Unter dem Jerusalemer Kreuz 1931-1942 234 Dritte Auflage 2010
In Überlingen 1942-1953 372 Dritte Auflage 2008
Immer nur ein Fremder 1953-1956 162 Zweite Auflage 2012
Ein Immigrant in Kanada 1957-1960 232 Dritte Auflage 2009
Ein Kirschbaum blüht im Garten 1960-1984 350 Zweite Auflage 2011
von
Siegfried Kuebler
Erfahrungen, nicht unbedingt zur
Nachahmung empfohlen.
Nicht für Feiglinge und Wehleidige.
240
Zweite erweiterte Auflage.
Dieses Büchlein wird nicht kommerziell vertrieben.
241
Das Jerusalemer Kreuz
Das übliche christliche Kreuz ist an allen vier Enden mit einem zusätzlichen
Balken versehen, die wenn sie sich überkreuzen weitere Kreuze
bilden können.
Es sind dann insgesamt fünf Kreuze zu erkennen.
Das Jerusalemer Kreuz wird deshalb auch als Christus
und die vier Evangelisten gedeutet.
Es wurde erstmals 1099 von dem
Kreuzritter Gottfried von Bouillon als Wappen verwendet.