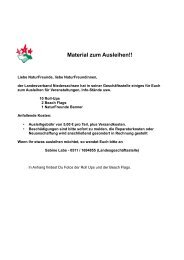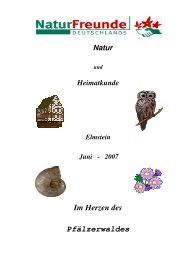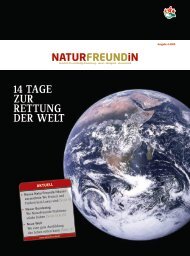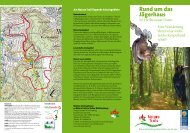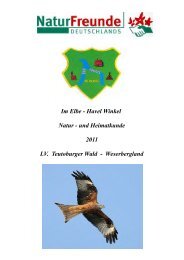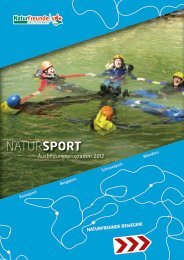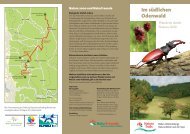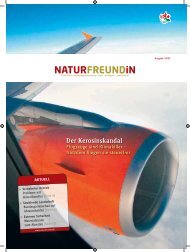Natur - und Heimatkunde - NaturFreunde Deutschlands
Natur - und Heimatkunde - NaturFreunde Deutschlands
Natur - und Heimatkunde - NaturFreunde Deutschlands
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Die Osteifel<br />
Eine Zeitreise durch das<br />
" Grüne Herz Europas "<br />
Vom 31. Mai bis 08. Juni 2008<br />
<strong>Natur</strong> - <strong>und</strong> Heimatk<strong>und</strong>e
Rhein-Zeitung vom 16. Juni 2008 / Ausgabe Mayen<br />
<strong>Natur</strong>Fre<strong>und</strong>e <strong>Deutschlands</strong><br />
Landesverband :<br />
Teutoburger Wald -<br />
Weserbergland<br />
Fachgruppe :<br />
<strong>Natur</strong>- <strong>und</strong> Heimatk<strong>und</strong>e<br />
Leitung:<br />
Jürgen Hapke<br />
Hotel :<br />
" Zum Anker "<br />
Mayenerstrasse<br />
56729<br />
Langenfeld<br />
Eifel<br />
3
<strong>Natur</strong>Fre<strong>und</strong>e <strong>Deutschlands</strong> <strong>Natur</strong>- <strong>und</strong> Heimatk<strong>und</strong>liches <strong>Natur</strong>- <strong>und</strong> Heimatk<strong>und</strong>liches Treffen 2008 Treffen 2008<br />
Fachgruppe <strong>Natur</strong>- <strong>und</strong> Heimatk<strong>und</strong>e<br />
Landesverband :<br />
Standort - Hotel Zum Anker, Langenfeld<br />
Teutoburger Land<br />
Willi Dießelmeier<br />
Zeit : 31. Mai bis 08. Juni<br />
Samstag, den 31. Mai<br />
16.00 : Uhr Eintreffen der Teilnehmer<br />
18.00 : Uhr Abendessen<br />
19.30 : Uhr Begrüßung, Vorstellungsr<strong>und</strong>e<br />
20.00 : Uhr Die Vulkanstrasse, Referent Walter Müller - Niederzissen<br />
Sonntag, den 01. Juni<br />
08.00 : Uhr Frühstück<br />
09.00 : Uhr Das Herz der Vulkaneifel mit Ihren Kraterseen<br />
Wanderung um die Dauner Maare<br />
18.00 : Uhr Abendessen<br />
Montag, den 02. Juni<br />
08.00 : Uhr Frühstück<br />
09.00 : Uhr Im <strong>Natur</strong>schutzgebiet Booser Maar<br />
Das Booser Doppelmaar ( Trockenmaar ) mit Eifelturm <strong>und</strong> Schlackenkegel<br />
Führung mit Hubert Schmitt aus Boosen<br />
20.00 : Uhr Dia Vortrag von Alfred Leisten<br />
Dienstag, den 03. Juni<br />
08.00 : Uhr Frühstück<br />
09.00 : Uhr Vulkanpark Osteifel, Info Zentrum Rauschermühle - Die Nette<br />
Krufter Tal - Römerbergwerk Meurin - ( Führung )<br />
18.00 : Uhr Abendessen<br />
Mittwoch, den 04. Juni<br />
08.00 : Uhr Frühstück<br />
09.00 : Uhr Arbeitskreise :<br />
18.00 : Uhr Abendessen<br />
Botanik in der Wacholderheide<br />
Mit der Wacholderwacht unterwegs<br />
Geologie im Mayener Grubenfeld <strong>und</strong> Ettringer Ley - ( Führung )<br />
Geologischer Wanderweg<br />
Heimatk<strong>und</strong>e : Vormittags mit den Geologen<br />
Nachmittags Bürresheimer Schloss<br />
Ornithologie in der Osteifel - mit Alfred Leisten<br />
20.00 : Uhr Der Vulkan mit Fauna <strong>und</strong> Flora, ein Vortrag von Walter Müller<br />
Donnerstag, den 05. Juni<br />
08.00 : Uhr Frühstück<br />
09.00 : Uhr Der Hufeisenkrater<br />
Der Bausenberg - Ein Vulkan <strong>und</strong> Heimat seltener Pflanzen <strong>und</strong> Tiere<br />
Führung mit Walter Müller<br />
18.00 : Uhr Abendessen<br />
Eine Zeitreise durch das grüne Herz Europas - Die Osteifel<br />
4
<strong>Natur</strong>Fre<strong>und</strong>e <strong>Deutschlands</strong><br />
Fachgruppe <strong>Natur</strong>- <strong>und</strong> Heimatk<strong>und</strong>e<br />
Landesverband :<br />
Teutoburger Land<br />
Willi Dießelmeier<br />
Freitag, den 06. Juni<br />
08.00 : Uhr Frühstück<br />
09.00 : Uhr Mayen - Stadtführung<br />
Genovevaburg mit Eifelmuseum <strong>und</strong> Schieferbergwerkmuseum -<br />
Katzenberg<br />
18.00 : Uhr Abendessen<br />
20.00 : Uhr Rückblick auf den Pfälzerwald - von Werner Sidowski<br />
Samstag, den 07. Juni<br />
08.00 : Uhr Frühstück<br />
09.00 : Uhr Mendig - Wingertsbergwand - ( Führung )<br />
12.30 : Uhr Brauhaus mit Basaltkeller - ( Kellerführung )<br />
18.00 : Uhr Abendessen<br />
20.00 : Uhr Gemütlicher Ausklang<br />
Sonntag, den 08. Juni<br />
08.00 : Uhr Frühstück<br />
Abreise<br />
Anmeldung : LV Teutoburger Wald - Weserbergland<br />
Postfach 14 09 44 - 33629 Bielefeld, Tel : 0521 - 3 04 40 03<br />
Jürgen Hapke - Kupferheide 68 - 33649 Bielefeld<br />
Tel. 0521 - 453923<br />
E - Mail : hapke-quelle@t-online.de<br />
Ursel Semler - Orionweg 1A - 70565 Stuttgart<br />
Tel. 0711 - 744393<br />
Karl Müller - Turnhallstr. 11 - 66482 Zweibrücken<br />
Tel. 06332 - 45995<br />
E - Mail . k.muell@web.de<br />
Anmelden bis zum 30. 03. 2008<br />
Literaturempfehlung :<br />
Der Bausenberg - Görres Verlag Koblenz<br />
Karten :<br />
Nat. Geopark - Vulkanland Osteifel 1 : 100 000<br />
Osteifel mit Laacher See - Gebiet 1 : 25 000<br />
<strong>Natur</strong>- <strong>und</strong> Heimatk<strong>und</strong>liches Treffen 2008<br />
Eine Zeitreise durch das grüne Herz Europas - Die Osteifel<br />
Standort - Hotel Zum Anker, Langenfeld<br />
Zeit : 31. Mai bis 08. Juni<br />
ISBN 3-935690-23-1<br />
ISBN 3-89637-368-4<br />
ISBN 3-921805-28-7<br />
Vorläufiges Programm - Änderungen vorbehalten 5
Vulkanische Aktivität in der Eifel<br />
Der Vulkanismus der Eifel begann vor 50 Millionen Jahren im Tertiär <strong>und</strong> hielt bis in<br />
die geologische Gegenwart an. Er schuf zahlreiche Landschaftsbestimmende<br />
Vulkanbauten, Lavaströme <strong>und</strong> ausgedehnte Decken vulkanischer Auswurfmassen<br />
aus Tuff <strong>und</strong> Bims, die schon seit der Römerzeit die Gr<strong>und</strong>lage einer bedeutenden<br />
Abbautätigkeit zur Gewinnung von Baustoffen bilden.<br />
Ursachen des Vulkanismus in der Eifel<br />
Als Ursache des Eifelvulkanismus wird von einigen<br />
Wissenschaftler ein so genannter Hot Spot oder Plume<br />
angenommen. Der sich tief unter der Eifel befindet. Andere<br />
weisen darauf hin, dass die Verteilung der der Vulkane<br />
<strong>und</strong> ihre Abfolge nicht dem eines Hot Spots entsprechen.<br />
Unstrittig ist, dass Magma aus den oberen Bereichen des Erd -<br />
Mantels direkt aufsteigt oder sich in einer immer noch mehrere Kilometer tief lie -<br />
genden Magmakammer sammelt, aus der in unregelmäßigen Abständen Magma nach<br />
oben Steigt <strong>und</strong> Vulkanausbrüche verursacht.<br />
Mittels seismographischer Messungen konnte nachgewiesen werden, dass unter der<br />
Eifel eine 1.000 bis 1.400 ° C heiße Zone ( Plume ) liegt, die 200 ° C heißer ist als ihre<br />
unmittelbare Umgebung.<br />
Aufschmelzungsvorgänge sind mit Volumenvergrößerung verb<strong>und</strong>en, was sich in Form<br />
von Landhebungen bemerkbar machen muss. Tatsächlich ist die Eifel schon seit<br />
langem als Hebungsgebiet bekannt. Mit vergleichsweise rasanter Geschwindigkeit<br />
wird die etwa 32 km. dicke Erdkruste hier um 1 bis 2 mm pro Jahr gehoben.<br />
Schon die Statistik zeigt, dass dies noch nicht der letzte Ausbruch war. Vulkanologen<br />
haben für den Zeitraum der Letzten 700.000 Jahre in der Eifel r<strong>und</strong> 100 gut datier -<br />
bare Vulkanausbrüche festgestellt. In der Regel herrschen zwischen den Eruptions-<br />
phasen etwa 10.000 <strong>und</strong> 20.000 Jahre Ruhe. Obwohl die Vulkaneifel heute keine<br />
aktiven Vulkane aufweist, sind erneute Vulkanausbrüche also nicht unwahrscheinlich.<br />
Heute noch aktive Vulkanische Erscheinungen sind zahlreiche Gasaustritte, Mineral -<br />
quellen <strong>und</strong> Kaltwassergeysire.<br />
Quelle : Wikipedia / Osteifel 6
D i e D e u t s c h e<br />
V u l k a n s t r a s s e<br />
Der Nationale Geopark VULKANLAND EIFEL lädt geologieinteressierte Besucher<br />
zu einer Entdeckungstour auf der 280 km langen " Deutschen Vulkanstrasse "<br />
ein. Sie werden gezielt zu den Highlights in der Welt der Eifelvulkane geführt.<br />
Die ausgeschilderte Ferien <strong>und</strong> Erlebnisstrasse verbindet 39 erschlossene<br />
geologische, kulturhistorische <strong>und</strong> industriegeschichtliche Sehenswürdigkeiten<br />
r<strong>und</strong> um das Thema Eifelvulkanismus. Dabei eröffnet sich dem Besucher eine<br />
Vielfalt an vulkanischen Zeugnissen wie Maare, Schlackenkegel, Lavaströme, Dome<br />
<strong>und</strong> zahlreiche sprudelnde Quellen. In Museen, Infozentren <strong>und</strong> Bergwerken wird<br />
das feurige <strong>Natur</strong>erbe anschaulich <strong>und</strong> allgemeinverständlich aufbereitet.<br />
Ob Schwimmen im Maarsee, Besuch eines Vulkanmuseums, Mountainbiking,<br />
Steinmetzkurse oder Wandern auf verschiedenen Geo-Routen, die Vulkane der<br />
Eifel bieten ein Erlebnis für die ganze Familie. In mehreren Auto-Etappen kann<br />
der Besucher den Nationalen Geopark erfahren <strong>und</strong> Einblicke in die Entstehungs-<br />
Geschichte <strong>Deutschlands</strong> jüngster Landschaft <strong>und</strong> das Leben der Menschen von<br />
<strong>und</strong> mit dem vulkanischen Erbe erlangen.<br />
Ein DVG - Vertreter wörtlich :<br />
" Wer vor solch einer gewaltigen Vulkanbombe steht, dessen Vulkan beginnt zu<br />
zittern - weniger aus Angst, sondern viel mehr aus Begeisterung. "<br />
Außergewöhnlicher F<strong>und</strong><br />
in den Mendiger Bimsgruben:<br />
Wingertsberg<br />
Eine außergewöhnliche<br />
große Basaltbombe wurde<br />
jetzt von der Fa. Zieglolowski<br />
beim Bimsabbau am<br />
Wingertsberg bei Mendig<br />
freigelegt.<br />
Mit einem Umfang von ca. 12 m umschließt der Brocken ein Volumen ca. 23 m³ ,<br />
<strong>und</strong> mit einer mittleren Dichte von 2,8 tm³ dürfte sein Gewicht über 80 t betragen.<br />
Quelle: DVG ( Deutsche Vulkanologische Gesellschaft ) Bild u. Bericht von Walter Müller, 1995<br />
7
NATURFREUNDE<br />
N + H – Seminar vom 31. Mai bis 8. Juni 2008<br />
Bericht: Ernst Steller<br />
Eine Zeitreise durch das grüne Herz Europas - Die Osteifel<br />
Die Flusslandschaft des Jahres 2008 / 09 („NATURFREUNDIN“ 1/08, S.9 ) – Die Nette - <strong>und</strong> darüber<br />
hinaus die ganze Osteifel, auch als Vulkaneifel bekannt, war vom 31. Mai bis zum 8.Juni Ziel<br />
der Fachgruppe <strong>Natur</strong>- <strong>und</strong> Heimatk<strong>und</strong>e.<br />
Willi Dießelmeier, der viele Jahre die Seminare leitete, konnte in diesem Jahr wegen schwerer<br />
Krankheit leider nicht mehr dabei sein <strong>und</strong> die 25 Teilnehmer aus 8 Landesverbänden in Langenfeld<br />
begrüßen. So lag diesmal die ganze Verantwortung bei Jürgen Hapke <strong>und</strong> Karl Müller.<br />
Die vom Vulkanismus geprägte Osteifel ist ein landschaftliches Kleinod von besonderer Schönheit,<br />
reizvoll für Wanderer, geeignet für Erholungsuchende <strong>und</strong> randvoll von Geschichte. Besonders<br />
aber bietet sie interessierten NATURFREUNDEN eine Fülle von Erlebnissen <strong>und</strong> Erkenntnissen.<br />
Ebenso ist diese geologisch unruhigste Region mit den jüngsten Vulkanen Mitteleuropas<br />
weltweit für Geologen interessant, die hier ein vorzügliches Objekt für das wissenschaftliche Studium<br />
des Vulkanismus vorfinden.<br />
Die wirtschaftliche Nutzung der <strong>Natur</strong>rohstoffe Basalt, Trass <strong>und</strong> Bims hat besonders seit die Firma<br />
Nebel 1845 letzteren als vorzügliches Material für Bausteinfertigung entdeckte, zu erheblicher<br />
Landschaftszerstörung im Reich der 105 Osteifler Vulkankegel geführt, viele davon sind schon<br />
ganz verschw<strong>und</strong>en. Zahlreiche regionale <strong>und</strong> lokale Initiativen kämpfen mittlerweile um den Erhalt<br />
<strong>und</strong> die Unterschutzstellung ihrer unvergleichlichen <strong>Natur</strong>landschaft.<br />
DIE NATURFREUNDE haben sich hier schon immer für Umwelt- <strong>und</strong> <strong>Natur</strong>schutz engagiert <strong>und</strong><br />
sich an der wissenschaftlichen Erk<strong>und</strong>ung der Landschaft aktiv beteiligt. So sind sie auch heute in<br />
diese Aktivitäten eingeb<strong>und</strong>en. Zu erwähnen ist hier besonders das <strong>Natur</strong>fre<strong>und</strong>ehaus LAACHER-<br />
SEEHAUS <strong>und</strong> seine Umweltstation, das sich auch als Ausgangsstandort für eigene Erk<strong>und</strong>ungen<br />
in der Region anbietet.<br />
Der junge, landschaftsprägende Vulkanismus der Osteifel (Laacherseegebiet) begann vor r<strong>und</strong><br />
700.000 Jahren <strong>und</strong> hatte seine Hauptphasen vor etwa 400.000, 200.000 <strong>und</strong> 13.000 Jahren als der<br />
Riedener, der Wehrer <strong>und</strong> dann der Laacher See Vulkan entstanden, deren „ Einbruchkessel“ (Caldera)<br />
heute landschaftsbestimmende Elemente sind.<br />
Vor 12.850 Jahren erschütterte die gewaltigste Explosion, die Europa bisher erlebt hatte, die Eifel.<br />
Die Eruption des Laacher See Vulkans schleuderte in nur wenigen Tagen 16 Kubikkilometer Bims<br />
bis zu 35 km in die Höhe. Eine 20 Meter hohe, heute weitgehend abgebaute, Bimsdecke bedeckte<br />
seitdem das angrenzende Neuwieder Becken. Bimsniederschläge dieser Eruption wurden in<br />
Schweden <strong>und</strong> Norditalien nachgewiesen.<br />
Die Vielfalt des vulkanischen Formenschatzes: Maare, Schlackenkegel, Lavaströme, Dome, Calderen,<br />
ungezählte Quellen sowie alte Stollen <strong>und</strong> Bergwerke in der Eifel waren die Gründe für die<br />
Errichtung des Nationalen Geoparks VULKANLAND EIFEL im Jahre 2004. Unter dessen Dach<br />
sind der Vulkaneifel European Geopark in der Westeifel sowie der Vulkanpark Brohltal/ Laachersee<br />
<strong>und</strong> der Vulkanpark Mayen-Koblenz, wo unsere Exkursionen hauptsächlich stattfanden, zusammengefasst.<br />
Diese verschiedenen Landschaftsstrukturen <strong>und</strong> die entstandenen Böden sind auch<br />
Heimat einer vielfältigen, artenreichen <strong>und</strong> häufig seltenen Flora <strong>und</strong> Fauna.<br />
8
Vulkanismus<br />
In geologischer Hinsicht gehört die Eifel zum Rheinischen Schiefergebirge. Wie dieses baut sie<br />
sich hauptsächlich aus Tonschiefer, Sandsteinen <strong>und</strong> Kalkgesteinen auf, die sich aus den Ablagerungen<br />
in einem relativ flachen Meer der Devonzeit vor 400 bis 300 Millionen Jahren gebildet haben.<br />
Die Eifel war in erdgeschichtlichen Zeiten von all den tektonischen Ereignissen dieses Gebirges<br />
ebenfalls betroffen, so auch von der lebhaften Vulkantätigkeit im Tertiär. Das Vulkanfeld der<br />
Hocheifel mit z.B. Hohe Acht, Nürburg <strong>und</strong> Aremberg ist das älteste der Eifel <strong>und</strong> etwa 40 Millionen<br />
Jahre alt.<br />
„Vulkanische “ Vorgänge spielen sich in dem oberen Erdmantel ab, der unter der bei uns etwa 30<br />
km starken Erdkruste bis zu 700 km tief ins Innere unseres Erdballs hinabreicht. Die oberste etwa<br />
50 km dicke Schicht einschließlich der darüber liegenden Erdkruste wird als Lithosphäre bezeichnet<br />
<strong>und</strong> besteht aus festem, starrem Gestein. Aktueller Stand der Vulkanforschung ist, dass unter<br />
Vulkanfeldern wie der Eifel oder der Auvergne in Frankreich, sogenannte „Plumes“ den Zustand<br />
von „Wärmeanomalien“ bezeichnen, in denen in breiten Zonen des Erdmantels die Temperaturen<br />
um 100 bis 150 ° C höher liegen als in seinen umgebenden Partien . In einem großflächig angelegten<br />
Projekt der Deutschen Forschungsgemeinschaft von November 1997 bis Juni 1998, an dem 158<br />
Erdbebenstationen beteiligt waren, wurde durch Beobachtung <strong>und</strong> Auswertung von Erdbebenwellen<br />
festgestellt, dass sich unter der Eifel, mit Mittelpunkt bei Daun, eine solche ca. 100 km breite<br />
Zone befindet ,die etwa 400 km tief hinabreicht. Das bedeutet, dass hier zumindest ein Teil des<br />
Gesteins aufgeschmolzen ist. Zitat (aus „ Deutsche Vulkanstraße“, Prof. Dr. W. Meyer): „ Heißes<br />
Gestein hat ein größeres Volumen als kaltes, über dem Plume wölbt sich daher die Kruste nach<br />
oben. Dabei reißen Spalten auf. Dadurch erfolgt in der Tiefe Druckentlastung, <strong>und</strong> die unter starkem<br />
Druck stehende Schmelze schießt nach oben wie der Inhalt einer Sektflasche, wenn man den<br />
Verschluss lockert. Sie kann dabei direkt bis zur Erdoberfläche empor dringen, sie kann sich aber<br />
auch in einigen Kilometern Tiefe innerhalb der Erdkruste in einer großen Magmenkammer, einem<br />
Herd, sammeln <strong>und</strong> von hier aus später zur Oberfläche durchbrechen. Beim Aufstieg nimmt der<br />
Außendruck auf die Schmelze weiter ab, dadurch werden in ihr gelöste Gase frei <strong>und</strong> die Vulkantätigkeit<br />
bekommt zunehmend explosiven Charakter; auch hier gilt der Vergleich mit der Sprudel-<br />
oder Sektflasche. Es trennt sich eine Gasphase von der Schmelze ab, die man nun als Lava bezeichnet,<br />
gleichgültig, ob sie oben ausfließt ( Vulkanismus ) oder dicht unter der Erdoberfläche<br />
erstarrt ( Subvulkanismus ). “<br />
Häufig bauen sich die Lavamassen auf der Erdoberfläche um den Auswurfschlot herum kegelförmig<br />
auf <strong>und</strong> erkalten in diesem Zustand. Man spricht dann von Schlackenvulkanen. Diese sind in<br />
der Osteifel die am häufigsten vorkommende Vulkanform. Von weiterer aufsteigender Lava werden<br />
dann Spalten im Schlackenkegel ausgefüllt, es bilden sich Lavagänge, Lavazungen oder Lavaströme.<br />
Lavaströme können den Kegel seitlich aufreißen <strong>und</strong> ihn soweit wegschwemmen, dass nur<br />
noch halbmondförmige Segmente davon stehen bleiben. Die meisten Eifelvulkane bestehen aus<br />
Basalt. Basaltische Lavaströme sind dünnflüssig <strong>und</strong> können, wenn sie von Tälern aufgenommen<br />
werden, diese kilometerweit ausfüllen. Beim Erkalten setzt die Lava oft noch Gas frei, das dann in<br />
kleinen Blasen im Gestein eingeschlossen, diesem eine poröse, raue Oberfläche verleiht. Diese ist<br />
leicht zu bearbeiten <strong>und</strong> hat den Eifelbasalt seit Jahrtausenden zu einem beliebten Werkstoff für<br />
Getreidereib- <strong>und</strong> später für Mühlsteine gemacht.<br />
Ein anderer Vulkantyp fördert zähflüssigere Schmelzen, welche kuppelförmige Vulkankörper, so<br />
genannte Dome bilden. Dabei entstanden unter der Erdoberfläche Herde mit phonolithischem<br />
Magma, aus denen durch gewaltige Explosionen große Mengen Aschen ausgestoßen wurden, welche<br />
ausgedehnte Decken bildeten. Durch die rasche Entleerung der Herde brachen diese Decken zu<br />
oft kilometerweiten r<strong>und</strong>en Kesseln ein, die als Caldera bezeichnet werden.<br />
9
Die Maare, auch „ Augen der Eifel“ genannt, sind faszinierende Sehenswürdigkeiten im Land der<br />
erloschenen Vulkane, auch ihnen galten einige Exkursionen unseres Seminars. Maare entstehen,<br />
wenn heißes Magma beim Aufstieg auf Oberflächenwasser trifft.<br />
Das Wasser verdampft dann schlagartig <strong>und</strong> heftige Explosionen in der Erdkruste sind die Folge.<br />
Umgebendes Gestein wird dabei zerbrochen, nach oben gefördert <strong>und</strong> ausgeworfen. Anschließend<br />
kann die ausgesprengte Explosionskammer in sich zusammenbrechen. Sie lässt dann an der Erdoberfläche<br />
einen Trichter zurück, der von einem ringförmigen Wall umgeben ist. Der Trichter füllt sich,<br />
ein Maarsee entsteht.<br />
Samstag, den 01. Juni<br />
Einen ersten beeindruckenden Einstieg in „ das grüne Herz Europas “ bot uns an diesem Abend<br />
unser Referent, Herr Walter Müller aus Niederzissen. Sein Thema „ Deutsche Vulkanstraße“ wurde<br />
mit großer Sachkenntnis <strong>und</strong> exzellenten Bildern vorgetragen <strong>und</strong> machte uns Appetit auf die<br />
vor uns liegende Woche. Die Deutsche Vulkanstraße, eine junge Einrichtung des Nationalen<br />
Geopark Vulkanland Eifel umfasst auf einer Strecke von 280 Kilometern über die gesamte Eifel<br />
verteilt 39 Stationen. Wolfgang Blum <strong>und</strong> Prof. Dr. Wilhelm Meyer, „ Papst“ der Eifelgeologie,<br />
haben darüber in dem Buch „ Deutsche Vulkanstraße “ eine hervorragende Arbeit vorgelegt, die<br />
sich nicht nur als Wanderführer empfiehlt. Das Buch sei auch dem empfohlen, der sich ausführlicher<br />
mit den Gr<strong>und</strong>lagen der Eifelgeologie befassen möchte.<br />
Unser Referent überzeugte nicht nur mit kompetenter Vorstellung einer großen Anzahl der Stationen,<br />
er erwies sich auch bezüglich Flora <strong>und</strong> Fauna als hervorragender Eifelkenner.<br />
Sonntag, den 01.Juni<br />
In der Eifel sind 75 Maare nachgewiesen.<br />
Nur in neun dieser vulkani-<br />
Schalkenmehrener Maar<br />
schen Hohlformen befindet sich noch<br />
Wasser. Zu diesen gehören das Gemündener,<br />
das Weinfelder <strong>und</strong> das<br />
Schalkenmehrener Maar bei Daun,<br />
denen unsere heutige Exkursion galt.<br />
Entstanden sind sie wahrscheinlich<br />
vor etwa 12.000 Jahren. Ein Besuch<br />
galt auch dem romantischen Kirchlein<br />
(<strong>und</strong> Fotomotiv), das einst zu<br />
dem im frühen<br />
16. Jahrh<strong>und</strong>ert nach einer Pestepidemie<br />
aufgegebenen Dorf Weinfelden<br />
gehörte.<br />
In Schalkenmehren erinnert eine Gedenktafel<br />
an den Zoologen<br />
August Thienemann, der von 1910 bis 1914 die Maarseen untersuchte <strong>und</strong> damit die Erforschung<br />
der Ökologie der Binnengewässer begründete. Entsprechend diesen Untersuchungen bieten sich das<br />
trichterartig tiefe Gemündener <strong>und</strong> das Weinfelder Maar als oligotrophe = nährstoffarme Gewässer<br />
dar. Die flacheren Seen ( Schalkenmehrener <strong>und</strong> Meerfelder Maar ) sind dagegen eutroph = nährstoffreich.<br />
Dort entwickeln sich Schwimmblatt-Pflanzengesellschaften <strong>und</strong> Verlandungszonen.<br />
Es ist die Zeit des „ Eifelgoldes“, überall, wohin man schaut, leuchtet das Gold des Besenginsters in<br />
der Landschaft. Den Landschaftspflegern wird er allerdings langsam zur Plage, weil er sich fast<br />
jede freie Fläche erobert. Das <strong>Natur</strong>schutzgebiet auf dem Mäuseberg bot manche botanische Delikatesse.<br />
Aber auch sonst erfreute eine artenreiche Flora mit z.B. Heidegünzel , Sommerwurz,<br />
Kreuzlabkraut <strong>und</strong> Flügelginster des Botanikers Herz. Vom Dronketurm, wie auf der ganzen Wanderung<br />
auf den Höhen gab es schöne Weitblicke über die Eifelhöhen.<br />
10
Montag, den 02.Juni<br />
Für die heutige Tour durch das Boosener Doppelmaar <strong>und</strong> zum Schneeberg stand uns ein „ Einheimischer“<br />
zur Verfügung. Hubert Schmitt erwies sich als kenntnisreicher Führer, der uns gleichermaßen<br />
<strong>Natur</strong>, Geschichte <strong>und</strong> alltägliches Geschehen in <strong>und</strong> um Boos nahe brachte.<br />
Im Westmaar hat sich durch Oberflächenwasser <strong>und</strong> kleine Zuflüsse aus dem Hangwald ein kleiner<br />
Teich gebildet, der heute verpachtet ist <strong>und</strong> der Fischzucht dient. Westlich des Teiches liegt eine<br />
mit Hecken geschützte Fläche, auf der sich die Tiefenbohrung befindet, mit der die Booser ihre<br />
Wasserversorgung betreiben, mit hervorragender Wasserqualität, wie Herr Schmitt versicherte.<br />
Das 152 ha große, seit 2000 ausgewiesene NSG „ Booser Maar “ gehört mit seiner einzigartigen<br />
Tier- <strong>und</strong> Pflanzenwelt zu den größten in Rheinland–Pfalz. Dieser Artenreichtum <strong>und</strong> das Vorkommen<br />
seltener Arten ist überhaupt ein Kennzeichen für den Typus Trockenmaar. Einst gab es<br />
auf der Fläche ca. 200 Eigentümer, heute ist das Land einziger Besitzer. Die früher in der Region<br />
heimischen Glahnrinder, die den Bauern als Milch-, Fleisch- <strong>und</strong> Zugtiere dienten <strong>und</strong> fast ausgestorben<br />
waren, werden jetzt wieder auf den NSG-Flächen gezüchtet.<br />
Der Ringwall zwischen Maar <strong>und</strong> dem Ort Boos sollte ursprünglich aus kommerziellen Gründen<br />
abgebaut werden. Ein einsichtiger Gemeinderat hat ihn dann aber, sehr zum Nutzen ökologischer<br />
Entwicklung, unter <strong>Natur</strong>schutz gestellt. Über den Ringwall verlief einst eine alte Römerstrasse,<br />
über die von Belgien bis nach Mayen Soldaten <strong>und</strong> Waren transportiert wurden. Vor den Römern<br />
gab es hier auch schon die Kelten, Boos selber wird als Ort erstmals1238 erwähnt.<br />
Der Schneeberg, 557 m hoch ist nicht nur der Hausberg des Ortes, auf seinem 25,3 m hohen „<br />
Booser Eifelturm“ kann man die ganze Eifel bis zum Westerwald <strong>und</strong> Hunsrück überblicken. Auf<br />
dem Berggipfel hat es einst ein römisches Heiligtum gegeben, wie archäologische F<strong>und</strong>e beweisen.<br />
Am südlichen Berghang ( auf der Wart ) bietet ein Aufschluss mit schönen Lavaschichtungen <strong>und</strong><br />
eingeschlossenen Bomben einen Einblick in die geologische Geschichte des Berges. Botanisch fiel<br />
auf der Wanderung u.a. ins Auge: schöne Bestände der Knäuel-Glockenblume, reichlich Zypressenwolfsmilch<br />
an den Waldrändern, Milchstern, Flügelginster, grüne Waldhyazinthe, ein schöner<br />
Bestand des großen Zweiblatt <strong>und</strong> im Waldschatten mehrere bemerkenswert große Bestände der<br />
Einbeere (paris quadrifolia ) mit jeweils 60-80 Einzelexemplaren.<br />
Die Landstraße am Rand des Westmaar – Teiches wird von 10 Krötenleitsystemen unterquert. Hier<br />
streben zur „ Krötenwanderzeit“ bis zu 2.000 Tiere der Arten Erdkröte, Bergmolch <strong>und</strong> Grasfrosch<br />
von den Wäldern des Maar-Ringwalles zu dem Gewässer.<br />
Dienstag, den 03. Juni<br />
Als Einstieg in die „ Zeitreise durch die Osteifel“ wählten wir das INFOZENTRUM RAU-<br />
SCHERMÜHLE in Plaidt, dort wo die Nette sich ihr Bett durch hartes Vulkangestein gesägt hat.<br />
Diese zentrale Anlaufstelle des Vulkanparks Mayen/Koblenz bietet mit Filmen, Computeranimationen,<br />
Leuchtbildern, Modellen <strong>und</strong> Vorträgen sowie antiken <strong>und</strong> mittelalterlichen Originalf<strong>und</strong>en<br />
ein umfassendes Bild der Welt der Vulkane <strong>und</strong> führt in längst vergangene Zeiten, als schon Römer<br />
das vulkanische Gestein brachen. 24 unterschiedliche Originalschauplätze in der freien <strong>Natur</strong> bietet<br />
der Vulkanpark auf seinen Routen an. Es stehen dafür qualifizierte Vulkanführer auf Anforderung<br />
zur Verfügung. Darüber hinaus befinden sich an jeder Station auf Basaltblöcke montierte Informationstafeln<br />
mit sehr anschaulichen <strong>und</strong> auch dem Laien verständlichen Texten <strong>und</strong> Bildern zum<br />
Selbststudium.<br />
Unser Vulkanführer an diesem Tag ( <strong>und</strong> auch später noch mal ) war Herr Eyke Michael.<br />
Die Geschichte der Osteifel ist auch <strong>und</strong> vor allem die technische, soziale <strong>und</strong> wirtschaftliche Geschichte<br />
des Abbaues <strong>und</strong> der Verwertung von Basalt, Bims <strong>und</strong> Tuff.<br />
11
Während üblicherweise nur 5% der Basaltvorkommen CO2-Gasbläschen (siehe vorne) enthält,<br />
finden wir im „Mühlsteinbasalt“ zwischen Plaidt <strong>und</strong> Mayen/Mendig diese Eignung zur „Mahlfunktion“<br />
im gesamten Vorkommen. Die natürliche Porosität des Gesteins gab den fertigen Produkten<br />
eine stets griffig bleibende Reib- bzw. Mahlfläche. Der minimale Abrieb sorgte für hohe<br />
Lebensdauer <strong>und</strong> wenig unerwünschte Bestandteile im Mehl.<br />
Leicht zugängliche, weil gering mit Abraum überdeckte Brüche <strong>und</strong> die Nähe zum Handelsweg<br />
Rhein ließen die Lavaströme des Bellerberges zum ältesten <strong>und</strong> größten Steinbruchgebiet nördlich<br />
der Alpen werden. Der Handel mit Getreidereiben reichte schon zur Keltenzeit bis an die Nordseeküste<br />
<strong>und</strong> wurde von den Römern bis auf die britischen Inseln ausgedehnt.<br />
So beginnt die Mühl-/Mahlsteingeschichte bereits vor 7.000 Jahren. Bis zur Keltenzeit baute man<br />
das Material von der Oberfläche des Lavastromes ab. Das mit Feuern stark aufgeheizte Gestein<br />
wurde mit Wasser übergossen <strong>und</strong> damit schlagartig abgeschreckt. Die abplatzenden flachen Rohlinge<br />
wurden mit Schlagsteinen aus Hartbasalt zu Getreidereiben hergerichtet.<br />
Die Technik der Gewinnung <strong>und</strong> Verarbeitung des Materials entwickelte sich ständig weiter. Auf<br />
die Feuermethode folgten Schlag- <strong>und</strong> Keiltaschenspaltung, die benutzten Werkzeuge aus Stein<br />
wurden von Metallwerkzeugen <strong>und</strong> in der Neuzeit durch Preßufthämmer <strong>und</strong> Elektromaschinen<br />
abgelöst. Als die Römer ins Land kamen, konnten sie auf eine Jahrtausendealte Erfahrung der heimischen<br />
Steinhauer zurückgreifen. Ihre eigenen organisatorischen Erfahrungen setzten sie ein für<br />
eine effektive Organisation der Arbeitsabläufe <strong>und</strong> Ausbau eines schwunghaften Handels. Aber<br />
auch ihr Eigenbedarf war groß: neben dem zivilen Bedarf musste auch das Heer mit Mahlsteinen<br />
versorgt werden. Jede Zenturie ( die kleinste Armeeeinheit aus jeweils 100 Mann ) war für ihre<br />
Verpflegung selbst verantwortlich. So musste neben anderen Lebensmitteln auch Getreide ständig<br />
mitgeführt werden <strong>und</strong> zur Bearbeitung mussten dann auch immer Mahlsteine zur Verfügung stehen.<br />
Das alles wurde mit Eselskraft transportiert, so erklärt sich, dass die römischen Mahlsteine aus<br />
Gewichtsgründen 30 –35 cm Durchmesser nicht überschritten.<br />
Im Rauscherpark - das Gelände hinter dem INFOZENTRUM am Netteufer – ist ein Lehrpfad<br />
angelegt, in dem wir Spuren römischen Basaltabbaues besichtigen konnten. Hier wurde der Stein<br />
auch gleich weiterverarbeitet <strong>und</strong> später dann auf Flössen abtransportiert. Dazu wurde die benötigte<br />
Wasserhöhe durch Fluten eines oberhalb angelegten Teiches erreicht. An einem vorhandenen<br />
Mühlstein konnten wir die von den Steinhauern angewandte Qualitätsprobe des Materials nachvollziehen:<br />
der durch Klopfen am Stein entstehende Ton ließ entsprechende Rückschlüsse zu.<br />
Nun brachen wir zu einer längeren Wanderung auf:<br />
1. Krotzsteinhäuser .Nach dem Verlassen des wilden Nettetales führte uns der Weg durch<br />
Plaidt <strong>und</strong> später Kretz. Hier waren viele alte Häuser -verputzt <strong>und</strong> unverputzt – aus vulkanischem<br />
Material zu sehen. In früheren Zeiten war es der hiesigen Bevölkerung erlaubt, die<br />
oberste Schicht der Basalt-Lavaströme die sogenannte „ Krotze “ kostenlos zu verwerten.<br />
So hatten auch die ärmeren Bevölkerungsschichten die Möglichkeit sich eine eigene Behausung<br />
zu errichten.<br />
12
2..Krufter Bachtal.<br />
Der Weg ging weiter durch das Krufter Bachtal. Dieses ist Teil einer alten Talrinne, die durch<br />
den Lavastrom des Laacher See Vulkans vor 13.000 Jahren 20 m hoch aufgefüllt wurde. Das<br />
Material hat sich zu Tuff verfestigt, der in der Nähe von Kretz von 1627 bis 1859 abgebaut <strong>und</strong><br />
zu Trassmehl gemahlen wurde. Die in einem Geländeanschnitt noch sichtbaren unterirdischen<br />
Gänge gehören zum südlichen Ende eines mehr als 140 Jahre alten Stollensystems.<br />
1. Römerbergwerk Meurin<br />
Als die Römer vor 2.000 Jahren diese Region besiedelten, erkannten sie den weißen Tuff schon<br />
bald als wertvolles Baumaterial. Seither wird er abgebaut <strong>und</strong> als Werkstein verwendet <strong>und</strong> zu<br />
hydraulischem Zement verarbeitet, der unter Wasser abbindet <strong>und</strong> deshalb z.B. besonders für Hafenbauten<br />
unverzichtbar ist. Durch moderne Abbaumethoden mit schwerem Gerät wurden die<br />
meisten römischen Bergwerke zerstört. Auf dem Gelände der Trassgrube Meurin bei Kretz wurde<br />
bei oberirdischen Abbauarbeiten ein solches freigelegt <strong>und</strong> unter Denkmalschutz gestellt.<br />
Heute schützt eine futuristische Glas-Stahl-Kunststoff-Hallenkonstruktion die Reste dieses einst<br />
größten römischen Tuffbergwerkes. Hier wurde der Stein in großen Blöcken mittels „Keiltaschentechnik“<br />
aus dem Berg gelöst. Enge Gänge, schlechte Lichtverhältnisse <strong>und</strong> staubige Luft<br />
prägten den Alltag der Untertagearbeiter. Wer als Besucher dort unten war, kann sich vorstellen,<br />
was die Menschen damals leisten mussten.<br />
.<br />
Römerbergwerk Meurin untertage<br />
Keiltaschentechnik<br />
Von den Brüchen im Krufttal gelangten die für den Export bestimmten Tuffsteine ebenso wie die<br />
Mühlsteine aus Basalt nach Antunnacum – das heutige Andernach – an den Rhein. Dort gab es in<br />
einer Rheinbucht schon seit vorrömischer Zeit einen natürlichen Hafen. Hier erfolgte die Verladung<br />
auf große Flachbodenschiffe.( Im INFOZENTRUM RAUSCHERMÜHLE kann das Modell eines<br />
solchen besichtigt werden.) Große Mengen dieser Waren gingen in die steinarme Provinz Niedergermanien<br />
<strong>und</strong> bis in die heutigen Niederlande <strong>und</strong> bescherten den Römern beachtlichen Reichtum.<br />
13
Mittwoch , den 04. Juni<br />
Heute steht auf dem Programm unserer „ Zeitreise “ die Welt des Basaltabbaus.<br />
Wir haben uns in Arbeitskreise aufgeteilt; mit Eyke Michael besuchen die Heimatk<strong>und</strong>ler <strong>und</strong> die<br />
Geologen gemeinsam die Ettringer Lay <strong>und</strong> das Mayener Grubenfeld, zwei Gebiete in denen Menschen<br />
in kräftezehrender Abbautechnik <strong>und</strong> unter erbärmlichen Bedingungen den Basalt aus dem Berg<br />
gebrochen haben.<br />
Die Bellerberg–Vulkangruppe liegt zwischen Ettringen, Kottenheim <strong>und</strong> Mayen. Der Ettringer Bellerberg<br />
<strong>und</strong> der Kottenheimer Büden bilden die westliche <strong>und</strong> die östliche Flanke des Vulkans, der somit<br />
nach Norden <strong>und</strong> Süden offen ist. Diese Vulkanform ist in der Osteifel einmalig. Im Bereich der<br />
heutigen Ettringer Lay befand sich vor 200.000 Jahren noch ein kleines Tal. Als der Bellerberg sein<br />
basaltisches Magma förderte, wurde es durch einen Lavastrom nahezu vollständig verfüllt.<br />
Der Hochsimmer liegt westlich des Bellerbergs, seine vulkanische Entstehung liegt bereits mehr als<br />
400.000 Jahre zurück. Der genaue Grenzverlauf zwischen dem Lavastrom des Hochsimmer <strong>und</strong> dem<br />
Ettringer <strong>und</strong> Mayener Lavastrom ist nicht bekannt. Vermutlich ist der Ettringer Lavastrom bei seinem<br />
Ausfluss nach Südwesten auf den längst erstarrten Basalt des Hochsimmer gestoßen <strong>und</strong> dabei<br />
nach Südosten abgelenkt worden. Dabei wurde er möglicherweise am Mayener Lavastrom aufgestaut.<br />
Damit könnte man die außergewöhnlich hohe Mächtigkeit der Ettringer Lava von ca. 40 m erklären.<br />
Auf dem Weg über den Lehrpfad der Ettringer Lay finden wir neben einem Blockschaltbild folgende<br />
Kurzinformation auf einem Infoblock<br />
1.<br />
--In mehr als 50 km Tiefe wird festes Gestein<br />
unter hohen Drucken <strong>und</strong> Temperaturen von<br />
mehr als 1200°C teilweise aufgeschmolzen.<br />
Dadurch bilden sich unzählige Magmatropfen,<br />
die sich sammeln <strong>und</strong> größer werden. Sie steigen<br />
auf, weil sie eine geringere Dichte als das<br />
umgebende Festgestein besitzen.<br />
2.<br />
An der Basis der Erdkruste sammeln sich die<br />
Magmatropfen in einer riesigen Magmakammer.<br />
Dort entwickelt sich die heiße Gesteinsschmelze<br />
weiter: Kristalle wachsen <strong>und</strong> Gasblasen<br />
(z.B. Kohlendioxid) bilden sich.<br />
.<br />
3.<br />
Nach dem Aufstieg in die Erdkruste stagniert<br />
das Magma erneut in einer Tiefe von 10 – 20<br />
km. Dort bilden sich Magmakammern, in denen<br />
viele Kristalle wachsen. Gasblasen reichern<br />
sich im Dachbereich stark an <strong>und</strong> üben<br />
einen hohen Druck auf das Nebengestein aus.<br />
Dadurch entstehen Risse.<br />
4.<br />
In den Rissen entwickeln sich Kanäle, in denen<br />
das Magma zusammen mit den Gasblasen<br />
immer weiter aufsteigt. An der Erdoberfläche<br />
schießt es in Form von Lavaströmen heraus.<br />
Ein Schlackenkegel entsteht <strong>und</strong> Lavaströme<br />
fließen aus.<br />
14
Als die Lavaströme zum Erliegen kamen, kühlten sie langsam zu festem Lavagestein ab. Der Aufbau<br />
der basaltischen Lavaströme in der Osteifel ähnelt sich in vielen Fällen. Den typischen Aufbau kann<br />
man an einer hohen Basaltwand in der Ettringer Steinbruchlandschaft studieren: Die abgekühlte Oberfläche<br />
des Lavastromes reißt beim Fließvorgang immer wieder auf <strong>und</strong> zerfällt in einzelne<br />
Bruchstücke, die wie Schlacken aussehen <strong>und</strong> sehr porös sind, in der Eifel werden diese als „ Krotzen“<br />
bezeichnet, der Vulkanologe spricht von „ Topbrekzie“. Darunter bilden dünne unregelmäßig geformte<br />
Säulen den nächsten Abschnitt der Wand, diese bezeichnet man als „ Siegel“. Diese sind<br />
durch schnelle Abkühlung in den oberen Bereichen des Lavastromes entstanden. Im zentralen Bereich<br />
des Lavastromes befinden sich mächtige unregelmäßig geformte Säulen, die „Schienen“, die<br />
ihre Entstehung der langsameren Abkühlung verdanken. Manches Mal zeigt eine Wölbung der<br />
Schienen in Fließrichtung des Lavastromes an, dass dieser noch schwach floss. Die unterste Schicht,<br />
der Dielstein, ist der am schnellsten abgekühlte Teil der Lava. Deshalb ist er auch sehr brüchig <strong>und</strong><br />
zeigt keine Säulenstruktur.<br />
Die Römer waren nicht nur erfolgreiche Eroberer, sie hatten auch erfolgreiche Bürokraten in ihrem<br />
Gefolge, die das gesamte Grubenfeld vermessen <strong>und</strong> parzellieren ließen. Zwischen den Brüchen blieben<br />
Grenzen von Basalt stehen, sogenannte „ Seierte “ . Als die Römer 450 n. Chr. ziemlich plötzlich<br />
das Land verlassen hatten, lief die Mühlsteinproduktion ohne Unterbrechung weiter <strong>und</strong> ab dem<br />
8.Jahrh<strong>und</strong>ert wurde wieder bis in den Nord- <strong>und</strong> Ostseeraum geliefert. 855 wurden die Mayener<br />
Mühlsteinbrüche erstmals schriftlich erwähnt.<br />
Im späten mittelalterlichen Abbaubetrieb ging man im Mayener Grubenfeld von der oberirdischen<br />
Basaltgewinnung zum Untertagebau über. Die entstehenden Hallen nannte man „ Geglöcks “, später<br />
dann „ Felsenkeller“. Den Transport der schweren Rohlinge <strong>und</strong> Mühlsteine bewerkstelligte man mit<br />
Winden. Spätestens ab 1700 wurden mit Tier- <strong>und</strong> Menschenkraft betriebene Göpelwerke zum Heben<br />
der immer größer werdenden Mühlsteine eingesetzt.<br />
Das Wort Ley (Lay) bedeutet Fels, Steinbruch, die Steinhauer in den Steinbrüchen wurden, davon<br />
abgeleitet, „ Layer “ genannt.<br />
Als 1880 die Eisenbahnstrecke Andernach-Niedermendig bis nach Mayen ausgebaut wurde, erlebten<br />
die Steinbrüche in den Lavaströmen des Bellerbergs einen großen Aufschwung. Frühindustrieller<br />
Tagebau ( 1850 bis ca.1950 ) setzte ein, bei dem ab Anfang des 20. Jh. auch elektrisch betriebene<br />
Hebekräne zum Einsatz kamen. Im gleichen Zeitraum wurden Mühlsteine als früheres Hauptprodukt<br />
von moderner Massenware – Pflastersteine <strong>und</strong> Schotter abgelöst. Zur Schottergewinnung konnte<br />
auch das in Jahrh<strong>und</strong>erten aufgehäufte Material der Abraumhalden ( ab etwa1900 in Brechwerken )<br />
verwendet werden<br />
Im Steinbruchgebiet der Ettringer Lay gab es zwar auch zur Kelten- <strong>und</strong> Römerzeit schon Steinbruchaktivitäten,<br />
aber diese waren von geringer wirtschaftlicher Bedeutung. Nennenswerter Abbau<br />
begann dort erst um 1850 <strong>und</strong> endete in den 1970er Jahren. Auf einer Fläche von knapp 20 Hektar<br />
wurde im Lavastrom bis über 20 m tief gebrochen, große Tagebauten entstanden. Es wurden ca. 3<br />
Millionen Kubikmeter Material gewonnen, damit ist die Ettringer Lay fast bis zur Erschöpfung ausgebeutet.<br />
Dies war nur mit der Elektrifizierung <strong>und</strong> dem Einsatz von Pressluft möglich.<br />
Seit ca. 1950 setzt sich die Entwicklung von privaten Kleinbrüchen zu großen modernen Tiefbrüchen<br />
auch im Mayener Grubenfeld fort, dort wird heute bis zu – 40 m tief abgebaut. Im Abbau<br />
kommen Bagger <strong>und</strong> Radlader zum Einsatz, zum Herauslösen der Basaltsäulen werden Pressluftkissen<br />
<strong>und</strong> hydraulische Stempel benutzt. Den Steintransport zum Betrieb besorgen Radlader, Absetzkipper<br />
<strong>und</strong> LKW. Die Betriebsanlagen der Steinwerke liegen immer weiter von den Brüchen entfernt.<br />
Durch den modernen Abbau werden immer wieder alte Brüche freigelegt <strong>und</strong> so die Einblicke<br />
in vergangene Arbeitswelten des Grubenfeldes ermöglicht.<br />
15
.<br />
Hohe Abbauwände von 25 m lassen erahnen wie gefährlich die Arbeit war, tödliche Unfälle waren<br />
keine Seltenheit. Wenn abgekeilte Basalt-Lavasäulen mit Brechstangen oder großen Wagenhebern<br />
weggedrückt oder mit den Kränen aus dem Verband gerissen wurden, so war das nicht minder gefahrvoll:<br />
Dabei konnte z.B. der Kran vom Sockel reißen <strong>und</strong> in die Tiefe stürzen. Steinbrucharbeiter<br />
wurden in früheren Jahren nicht sehr alt.<br />
Den Schautafeln waren darüber hinaus weitere Informationen zu entnehmen:<br />
So erfährt man, dass bis in die Zeit nach dem 2.Weltkrieg die Ettringer Frauen den Männern das<br />
Essen in den Steinbruch brachten. Meist jedoch mussten die Kinder ab dem 10. Lebensjahr diese<br />
Aufgabe übernehmen <strong>und</strong> brachten dann oft gleich für mehrere Arbeiter das Essen mit. Bis zu 8 Portionen<br />
wurden dabei in einem Korb getragen, Vor dem 1. Weltkrieg betrug der Lohn für den Transport<br />
pro Portion 10 Pfennig. In der einstündigen Mittagspause mussten die Kinder Schutt vom Arbeitsplatz<br />
wegtransportieren. Wegen dieser Aufgaben musste die Schulzeit der Kinder dem Zeitplan<br />
der Arbeiter angepasst werden.<br />
Auf dem Steinbruchgelände gab es auch eine Schmiede, hier wurden die metallenen Werkzeuge der<br />
Arbeiter in Form gehalten. Dazu musste in der Regel täglich die Schmiede aufgesucht werden <strong>und</strong><br />
war so auch das Kommunikationszentrum der Arbeiter.<br />
Mitte des 19.Jh. verdiente ein Steinhauer bei 12stündigem Arbeitstag 2,00 bis 2,50 Mark pro Tag.<br />
Damals kostete das kg Brot 34 Pfennig. Ende des 19. Jh. betrug der Tageslohn bei 10stündiger Arbeit<br />
5,00 Mark. Nach dem 2. Weltkrieg war der St<strong>und</strong>enlohn der Layer dann auf 10 Mark gestiegen.<br />
Sonst noch ... ... ...<br />
-- Seit den1980er Jahren werden die Steinbrüche um den Bellerberg-Vulkan von Kletterern genutzt.<br />
Die große Wand in der Ettringer Lay bietet 70 vom Deutschen Alpenverein abgesicherte Routen unterschiedlicher<br />
Schwierigkeitsgrade. Sie gehört zu den „ Risskletter-Gebieten“ <strong>und</strong> besitzt überregionale<br />
Bedeutung <strong>und</strong> internationalen Bekanntheitsgrad.<br />
-- In den alten „ Römerhöhlen“ des Mayener Grubenfeldes, die gerade unter <strong>Natur</strong>schutz gestellt<br />
wurden, haben heute 10.000 Fledermäuse, die größte Population nördlich der Alpen, ihre Winterquartiere<br />
<strong>und</strong> Mayen hat damit unter den Experten den Ruf „ Fledermaus –Stadt “ erworben.<br />
--Auf dem Gelände des Mayener Grubenfeldes gibt es noch den Skulpturenpark Lapidea. Hier<br />
arbeiten internationale Künstler aus Basalt ihre Kunstwerke <strong>und</strong> stellen aus, was sie nicht verkaufen.<br />
Skulpturenpark Lapidea<br />
Am Abend ... .... ...<br />
Am Abend stellte uns der schon bekannte<br />
Referent Herr Walter Müller aus Niederzissen,<br />
wieder mit exzellenten Bildern, den Gegenstand<br />
unserer morgigen Exkursion mit<br />
ihm vor:<br />
Der Bausenberg- Ein Vulkan <strong>und</strong> Heimat seltener Pflanzen <strong>und</strong> Tiere.<br />
16
Donnerstag, den 05. Juni<br />
Der Bausenberg bei Niederzissen ist eine Sehenswürdigkeit im Vulkanpark Brohltal/Laachersee.<br />
Der Schlackenkegel von „ Europas schönstem <strong>und</strong> besterhaltenstem Hufeisenkrater“ hat eine ähnliche<br />
Entstehungsgeschichte wie die anderen Vulkane der Osteifel, sein Lavastrom ergoss sich vor<br />
150.000 Jahren nach Nordosten. Heute wird er einige km vom Berg entfernt von der Autobahn A 61<br />
durchschnitten.<br />
Der Wärme speichernde Boden bietet einer Vielfalt von Flora <strong>und</strong> Fauna besonders auch mediterranen<br />
Kleintieren <strong>und</strong> Pflanzen ideale Lebensbedingungen. Hier werden Arten beobachtet, die sonst<br />
nirgendwo in Deutschland heimisch sind, unter anderem wurden hier 640 Schmetterlingsarten beobachtet.<br />
Schon 1975 haben die Biologen Thiele <strong>und</strong> Becker in ihrem Buch: „ Der Bausenberg –<br />
<strong>Natur</strong>geschichte eines Eifelvulkans “ diese Besonderheiten untersucht <strong>und</strong> besonderen Schutz für den<br />
ganzen Berg gefordert. Das Buch gilt heute noch als Standardwerk.<br />
Die moderne Geschichte des Bausenbergs ist eine Geschichte des Kampfes um seine Erhaltung <strong>und</strong><br />
letztendlich um seine Sicherung durch Ausweisung als <strong>Natur</strong>schutzgebiet. Immer schon gab es auch<br />
hier die Begehrlichkeiten nach der kommerziellen Verwertung des vulkanischen Materials, die bis<br />
heute schon viele Schlackenkrater der Osteifel haben verschwinden lassen.<br />
1938 gab es einen Deal zwischen Verwaltung <strong>und</strong> den <strong>Natur</strong>schützern: 12 Vulkane wurden unter<br />
Schutz gestellt <strong>und</strong> dafür wurde der Plaidter Hummerich dem Abbaubegehren geopfert. Der Bausenberg<br />
erhielt den Status „ Einstweilige Sicherstellung des Bausenberg“. Auch unterstützt durch das<br />
Engagement von Prof. Dr. H.U.Thiele vom Zoologischen Institut der Uni Köln wurde der Berg 1981<br />
endgültig als Geotop <strong>und</strong> wegen seiner seltenen Pflanzen <strong>und</strong> Tiere unter <strong>Natur</strong>schutz gestellt. Leider<br />
ist davon bis heute die Fläche des Eulenkessels <strong>und</strong> des Vulkanhofes wegen Privatbesitz ausgenommen.<br />
Bei unserer Exkursion an diesem Tag erwies sich<br />
Walter Müller auch vor Ort als kompetenter <strong>Natur</strong>führer. Er führte uns ebenso zu den wesentlichen<br />
geologischen Aufschlüssen, wie wir Gelegenheit bekamen, mancherlei botanische <strong>und</strong> zoologische<br />
Schönheiten <strong>und</strong> Raritäten in natura zu studieren.<br />
.<br />
Der Bausenberg<br />
Viele Insektenarten hatten sich erst wieder angesiedelt<br />
als die <strong>Natur</strong>schützer die geologischen<br />
Aufschlüsse freigestellt, d.h. von Büschen <strong>und</strong><br />
Bäumen befreit hatten <strong>und</strong> das Biotop sich wieder<br />
erwärmen konnte. Der Bausenberg als Ganzes<br />
ist ein großer Wärmespeicher, der in seiner<br />
Umgebung eine ganz spezielle Thermik entwickelt.<br />
Diese Luftströmungen wissen Kraniche<br />
<strong>und</strong> Gleitflieger besonders zu schätzen. Es sei<br />
ein überwältigendes Bild, wenn sich die Kraniche<br />
bei ihrem Flug schwarmweise in die Höhe<br />
tragen lassen<br />
Mit den Gleitfliegern hat der <strong>Natur</strong>schutz ein Arrangement<br />
getroffen: Als Abflugplatz steht ihnen<br />
eine Fläche am Südhang zur Verfügung, die sie<br />
von Bewuchs freizuhalten sich verpflichtet haben.<br />
Damit haben sie erstens einen Trockenrasen erheblich<br />
vergrößert <strong>und</strong> verhindern dort dauerhaft<br />
unerwünschte Sukzession.<br />
Auf einer 4 ha großen eingezäunten Fläche verrichtet<br />
eine Ziegenherde „ Arbeit für die Nachhaltigkeit“.<br />
Blauroter Steinsame<br />
17
Die nächste Station nach dem Bausenberg war das Brohltal. Der Laacher See Vulkan hatte dieses<br />
Tal bei seinem Ausbruch vor ca. 13.000 Jahren mit einem Aschenstrom fast 60 m hoch zugeschüttet.<br />
Bis auf wenige Reste sind die Trass-Massen heute abgebaut. Lediglich bei dem Viadukt der Brohltal-<br />
Bahn gibt es noch einen Wandkomplex, dessen Höhlen, in denen einst abgebauter Trass trocken<br />
gelagert wurde, wir besichtigen konnten.<br />
Mit einem Besuch der Mineralwasserbrunnen bei der ehemaligen Kurklinik Tönisstein <strong>und</strong> des<br />
Lydiaturm ( Aussichtsturm des Eifelvereins auf dem Veitskopf) beendeten wir das heutige Exkursionsprogramm.<br />
Freitag, den 06.Juni<br />
In der kreisfreien Stadt Mayen gab es heute einen Stadtr<strong>und</strong>gang mit einer Stadtführerin, den Besuch<br />
des Deutschen Schieferbergwerks <strong>und</strong> der Genovevaburg.<br />
Mayen zählt heute ca. 20.000 Einwohner, die Gründung der ersten Ansiedlungen wird auf etwa<br />
3.000 v.Chr. datiert. 1291 wurden Mayen die Stadtrechte verliehen.<br />
Der Wohlstand der Stadt gründete sich schon sehr früh auf die Basalt – <strong>und</strong> Schiefervorkommen in<br />
der nahen Umgebung. Das Thema Basalt haben wir schon in vorhergehenden Kapiteln ausführlich<br />
behandelt.<br />
Der hervorragende Schiefer aus Mayen entstand vor 400 Millionen Jahren im Devonmeer. Als<br />
Werkstoff gehört er weltweit zu den besten Qualitäten. So wurde <strong>und</strong> wird er immer noch weltweit<br />
gehandelt, wobei Spanien als mit Abstand größter Abnehmer gilt. Da das Material ursprünglich per<br />
Fuhrwerk an die Mosel transportiert <strong>und</strong> dort verschifft wurde, hat sich der Name „ Moselschiefer“<br />
eingebürgert. Erst ab 1880, als die Eisenbahnstrecke Andernach – Niedermendig bis Mayen verlängert<br />
wurde, änderte sich das. Die Hälfte der deutschen Schieferproduktion stammt auch heute noch<br />
aus Mayen. In den Bergwerken Margareta <strong>und</strong> Katzenberg südlich von Mayen, fördern die Hauer der<br />
Firma Rathscheck noch in unseren Tagen aus 200 m Tiefe die schwarzen Schieferblöcke.<br />
An den anderen <strong>Natur</strong>stoff Basalt erinnern heute noch im Stadtbild unter anderem viele Brunnen,<br />
Skulpturen <strong>und</strong> Gedenktafeln für berühmte Bürger:<br />
-- „ Dem Steinhauer“ erweist die Stadt mit einer monumentalen Skulptur ihre Reverenz<br />
-- Vor der Genovevaburg ist eine Skulptur dem Schauspieler Mario Adorf gewidmet, der hier seine<br />
Kindheit <strong>und</strong> Jugend verbrachte <strong>und</strong> auch heute noch der Stadt sehr zugetan sein soll.<br />
-- Auf einer Gedenktafel wird an den Strumpfwirker Balthasar Krems erinnert, der 1815 in Mayen<br />
die erste deutsche Nähmaschine erfand.<br />
-- Zu Füßen des Mühlentores steht als Denkmal ein echter Kollergang aus der Papierfabrik Nettemühle<br />
(Mayen ). Solche Mahlwerke wurden bis in die jüngste Zeit, bis auch hier der Stahl den <strong>Natur</strong>werkstoff<br />
ablöste, bei der Papierherstellung zur Zerkleinerung von Zellstoff <strong>und</strong> Altpapier genutzt.<br />
Für die Maschinenteile aus Stein war die Mayener Basaltlava wegen ihrer Porosität besonders geeignet<br />
<strong>und</strong> wurde in die ganze Welt geliefert.<br />
Kollergang Die sieben Schwaben<br />
18
-- Die Stadt Mayen war schon in alter Zeit von einer wehrhaften Mauer aus heimischem Tuff- <strong>und</strong><br />
Basaltmaterial umgeben. Bei unserem Stadtr<strong>und</strong>gang konnten wir noch ansehnliche Reste davon<br />
betrachten <strong>und</strong> begehen. Trotz dieser Befestigung eroberten die Franzosen die Stadt im Jahr 1689<br />
<strong>und</strong> zerstörten sie. Jahre zuvor allerdings war es den Mayener Frauen gelungen durch eine List die<br />
Franzosen zu überwinden: Sie zeigten den französischen Wachen auf der Stadtmauer ihren nackten<br />
Hintern <strong>und</strong> als die restlichen Franzosen neugierig herbeiliefen, konnten die Mayener Männer durch<br />
einen gewagten Ausfall, die Feinde so bedrängen <strong>und</strong> verwirren, dass sie abzogen. Von diesem historischen<br />
Ereignis soll sich der Spruch herleiten: „.......hintenrum haben die Mayener immer gewonnen....“.<br />
Der Weiberbrunnen auf der Marktstraße ist dieser Geschichte gewidmet.<br />
Weiberbrunnen<br />
Das Schieferbergwerks-Museum<br />
Das mächtigste Bauwerk in Mayen ist die Genovevaburg,<br />
die mit ihrem 34 m hohen Goloturm die Stadt<br />
dominiert. In der Burg befindet sich heute das Eifelmuseum.<br />
Unter der Burg hat man im 2. Weltkrieg ein Stollensystem<br />
als Luftschutzraum angelegt. In diesem Schutzraum<br />
überlebten viele der letzten in der Stadt verbliebenen<br />
Bürger die Luftangriffe der Alliierten am 2. Januar<br />
1945, als 87 % der Stadt zerstört wurden. Viele von<br />
ihnen verließen die unterirdische Bleibe der Kriegsgefahren<br />
wegen erst im März 1945. Die Angriffe hatten<br />
übrigens der Eisenbahnstrecke nach Andernach gegolten,<br />
die jedoch unzerstört blieb.<br />
--Bei der Herz Jesu Kirche erkennt man in<br />
der Stadtmauer noch ursprüngliche R<strong>und</strong>-<br />
bogennischen. In diesen Nischen haben<br />
sich noch bis vor 100 Jahren obdachlose<br />
Mayener wohnlich in sogenannten „ Ein –<br />
Mann- Häusern“ wohnlich eingerichtet,<br />
bis es ihnen die Obrigkeit aus „hygie-<br />
nischen Gründen“ verbot.<br />
--In der Herz Jesu Kirche sind sehr schöne<br />
Fenster zu bew<strong>und</strong>ern, die der Künstler<br />
Schwarzkopf vor 20 Jahren schuf.<br />
--Ein markantes Mayener Wahrzeichen ist<br />
der schiefe Turm der St.- Clemens –<br />
Kirche. Das Gestühl ist aus dem Lot geraten<br />
<strong>und</strong> hat sich in sich um 170 Grad verw<strong>und</strong>en.<br />
Obwohl der Turm im 2. Weltkrieg<br />
zerstört wurde, hat man ihn in der ursprünglichen<br />
Form wieder aufgebaut. Übrigens<br />
gibt es auch eine fromme Legende,<br />
in der der Teufel eine Rolle spielt.<br />
St. Clemenskirche<br />
19
Heute ist in dem 340 m<br />
langen Stollen-Labyrinth<br />
das Museum Deutsches<br />
Schieferbergwerk eingerichtet.<br />
16 m unter der<br />
Burg geht es durch verschlungene<br />
Gänge – vorbei<br />
an Seilsägen,<br />
Schreitbaggern <strong>und</strong><br />
schweren Presslufthämmern.<br />
Auf Knopfdruck<br />
rattert <strong>und</strong> poltert es, ein<br />
Monitor zeigt eindrucksvoll<br />
die Sprengung eines<br />
Stollens. Man erfährt<br />
beim Durchschreiten der<br />
Gänge wie sich das<br />
Handwerk der Hauer <strong>und</strong><br />
Steiger verändert hat <strong>und</strong><br />
wie mühselig dabei immer auch der Transport des Gesteins nach über Tage war. Eine simulierte Lorenfahrt<br />
bietet dem Besucher eine besondere Faszination.<br />
Auch über Auseinandersetzungen der Arbeiter mit ihren Bergwerksherren wird, wenn auch sehr<br />
kurz, berichtet. Gleichwohl kann man sich nach dem „ Bergwerks-Erlebnis “ vorstellen wie hart das<br />
Los der Schieferarbeiter <strong>und</strong> ihrer Familien einst war.<br />
Samstag, den 07.Juni<br />
Die Wingertsbergwand ist der weltbekannte vulkanologische Aufschluss des Laacher See Vulkans,<br />
ein Landschaftsdenkmal von internationaler Bedeutung. Anhand der Ablagerungen wird die Chronologie<br />
des Ausbruches des Laacher See Vulkans vor 13.000 Jahren dargestellt, nirgendwo sonst hat<br />
sich dieser eindrucksvoller dargestellt. Heute treffen wir uns dort mit unserem Vulkanführer Eyke<br />
Michael zu unserem ersten Exkursionsthema.<br />
Nördlich des Basalt-Schlackenkegels Wingertsberg blieb eine lange <strong>und</strong> hohe Abbauwand in den<br />
Bimsablagerungen stehen. Der Wingertsberg selbst ist fast verschw<strong>und</strong>en, z.Zt. werden noch letzte<br />
Lavareste abgebaut <strong>und</strong> zu Straßenschotter verarbeitet. Einst war der quartäre Vulkan Ausgangsstation<br />
der Niedermendiger Lavaströme.<br />
Zitat (aus Deutsche Vulkanstrasse):<br />
„Mehrere Lehrtafeln erläutern den Aufbau der Wand <strong>und</strong> die Entstehung ihres einzigartigen Anschnitts.<br />
In ihrem unteren Drittel zeigt die Wand Ablagerungen, die von ersten Eruptionen aus Schloten<br />
im Raum Mendig <strong>und</strong> von der Haupt-Eruption, die von einem Schlot im Nordteil des heutigen<br />
Laacher Sees ausging, herstammen.<br />
Die oberen zwei Drittel sind Produkte der letzten Ausbrüche des Laacher See Vulkans. Sie fallen<br />
durch ihre braungraue Farbe auf <strong>und</strong> durch meterhohe Dünenstrukturen. Sie sind folgendermaßen<br />
entstanden: Nach der Haupteruption, die wahrscheinlich nur wenige Tage gedauert hat, wobei die<br />
heiße aufsteigende Gassäule in der Atmosphäre heftige Gewitter ausgelöst haben muss, hat sich im<br />
Schlottrichter viel Niederschlagswasser gesammelt. Durch dessen Kontakt mit dem heißen Gestein<br />
wurden heftige Wasserdampfexplosionen ausgelöst, die Gestein aus den Schlotwänden sprengten<br />
<strong>und</strong> den Schlot so erweiterten. Deshalb bestehen diese letzten Förderprodukte des Laacher See Vulkans<br />
überwiegend aus dem zertrümmerten Nebengestein, also den unterdevonischen Sandsteinen <strong>und</strong><br />
Tonschiefern, daher rührt ihre braungraue Farbe. “<br />
Des weiteren wurde uns erläutert, wie heftige, flache Explosionsstöße entstanden, die das Material in<br />
sich rasch über die Erdoberfläche bewegenden Eruptionswolken nach außen schleuderten. Dabei<br />
wurde dann die „ Dünenstruktur“ aufgeworfen, die für die Wingertsbergwand so typisch ist.<br />
20
Sehr markant sind die Spuren der bis heute stattfindenden Erosion zu erkennen, welche die Wand<br />
permanent verändern.<br />
Geologen haben nachgewiesen, dass der gesamte Ausbruch des Laacher See Vulkans 12 Tage gedauert<br />
hat, an der Feinschichtung der Wingertsbergwand lassen sich stündliche Ablagerungsrythmen<br />
ablesen.<br />
Der Lava-Dome Deutsches Vulkanmuseum Mendig,<br />
erst 2005 eröffnet, war unsere nächste Exkursionsstation<br />
an diesem Tag.<br />
Ein Prospekt des Museums verspricht:„ Fantastische<br />
Erlebnisse mit multimedialem Vulkanausbruch<br />
<strong>und</strong> sprechenden Steinen, eine Fernseh-<br />
Reportage mit allen Sinnen erleben. In der Vulkanwerkstatt<br />
erhalten Sie mehr Informationen zu<br />
Vulkanen, erfahren mehr zu wissenschaftlichen<br />
Erkenntnissen <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>lagen <strong>und</strong> können dies<br />
an Experimentiertischen nachvollziehen.“<br />
Es war ein sehr beeindruckender Besuch. Die<br />
Versprechen des Prospektes wurden weitgehend<br />
eingelöst. Es ist ein Museum, dessen Besuch<br />
auch Kindern Spaß machen wird.<br />
Die besondere <strong>und</strong> weltweit einmalige Attraktion<br />
in Mendig ist der historische Felsenkeller.<br />
Der Niedermendiger Lavastrom, der vom Wingertsberg<br />
stammt, ist neben dem des Ettringer<br />
Bellerbergs der zweite weltweit berühmte Basaltstrom<br />
der Eifel. Er ist einer der wenigen Lavaströme<br />
auf der Erde, der überwiegend unter<br />
Tage aufgeschlossen ist. Die bis zu 20 Meter<br />
mächtige Basaltschicht wird von einer nahezu<br />
20 m starken Bims- <strong>und</strong> Lössdecke überlagert.<br />
Wingertsbergwand<br />
.<br />
Über 150 schmale Treppenstufen gelangt man in das unterirdische Labyrinth des Lavakellers. Das<br />
tief unter der Stadt von Menschenhand geschaffene Netz von 6 m hohen Basalthallen erstreckt sich<br />
über fast 4 Quadratkilometer. Öffentlich zugänglich ist nur ein kleiner Teil der Fläche, der weitaus<br />
größere Teil bleibt den Forschern <strong>und</strong> den Fledermäusen vorbehalten.<br />
Ab dem Mittelalter begann der Abbau des kostbaren Gesteins. Alle sechs bis acht Meter blieben<br />
Säulen als Stützen für die frei tragende Decke stehen. Die Steinhauer schufteten an sechs Tagen in<br />
der Woche 10 bis 14 St<strong>und</strong>en lang in den dunklen, nassen Gewölben. Ihre Lebenserwartung lag bei<br />
35 bis 40 Jahren, dann starben sie an Gicht, Rheuma <strong>und</strong> Schwindsucht. Auch Frauen <strong>und</strong> Kinder<br />
mussten mithelfen, sie schleppten den Abraum über Einstiegslöcher ins Freie.<br />
Um einen Mühlstein zu fertigen mussten 2 Layer (Steinhauer) sechs Tage lang arbeiten. Als Lohn<br />
erhielten sie im Jahr 1802 dafür 60 Mark.<br />
Ab 1850 nutzten die Herrenhuter die Felsenkeller als ideale Lagerräume für ihre Bierproduktion<br />
<strong>und</strong> zogen damit schnell auch andere Bierbrauer nach Niedermendig. Zeitweise teilten sich 28 von<br />
ihnen die unterirdischen Kühlräume. Damals war die Bahnstrecke Mendig – Andernach die einträglichste<br />
im gesamten preußischen Staat. Unablässig wurden auf ihr Bierfässer als auch Basaltsteine zu<br />
den Frachtschiffen am Rhein transportiert. Mit der Ausbreitung der Elektrizität <strong>und</strong> der Entwicklung<br />
moderner Kühlgeräte schwand auch diese Nutzungsart der Felsenkeller.<br />
Der Abbau des Basaltgesteins wurde endgültig erst 1958 eingestellt.<br />
Von den Brauereien existiert heute noch eine - die Vulkanbrauerei, die auch eine große Speisegaststätte<br />
a la Hofbräuhaus betreibt—dort nahmen wir inmitten einer großen Touristenansammlung unser<br />
Mittagsmahl ein.<br />
21
Laacherseehaus <strong>und</strong> Thelenberg<br />
Zwar haben wir es während dieser Seminarwoche nicht mehr geschafft das <strong>Natur</strong>fre<strong>und</strong>ehaus des<br />
Landesverbands NRW am Thelenberg zu besuchen, aber einige Anmerkungen sollen dazu noch gemacht<br />
werden.<br />
Das Haus, am 8. Juli 1928 eingeweiht, mit tatkräftiger Unterstützung der Gemeinde Niedermendig<br />
auf eigenem Gr<strong>und</strong> <strong>und</strong> Boden errichtet, liegt am Fuße des Thelenberges.<br />
Der Thelenberg ist wie der Wingertsberg, sein unmittelbarer Nachbar, ein Schlackenkegelvulkan.<br />
Um ihren „ Hausberg“ vor dem Schicksal seines Nachbarn zu bewahren, haben die <strong>Natur</strong>fre<strong>und</strong>e von<br />
Anfang an Parzelle um Parzelle des Berges als Eigentum erworben. Heute befindet sich soviel Gelände<br />
des Berges in <strong>Natur</strong>fre<strong>und</strong>ehand, dass ein Lavaabbau nicht mehr in Betracht kommt. Auch der<br />
Berggipfel gehört, bis auf einen Quadratmeter auf dem sich der Trigonometrische Vermessungspunkt<br />
befindet, den <strong>Natur</strong>fre<strong>und</strong>en.<br />
Außerdem ist der Berg seit einiger Zeit <strong>Natur</strong>schutzgebiet.<br />
Literaturempfehlung:<br />
-- Laacherseehaus-Wanderführer, Herausgeber : Verein <strong>Natur</strong>fre<strong>und</strong>ehaus Laacherseehaus,<br />
Köln/Mendig<br />
--Deutsche Vulkanstraße 280 erlebnisreiche Kilometer im Vulkanland Eifel<br />
Wolfgang Blum, Prof. Dr. Wilhelm Meyer<br />
Görres- Verlag, Carl- Spaeter- Str.1, 56070 Koblenz, ISBN ; 3-935690-53-3, 12,80 Euro<br />
-- Vulkane im Laacher See- Gebiet, Ihre Entstehung <strong>und</strong> heutige Bedeutung<br />
Hans-Ulrich Schmincke<br />
Doris Bode Verlag GmbH, Haltern, ISBN 3- 925094-21-0<br />
-- Der Bausenberg , Vulkan <strong>und</strong> Heimat seltener Pflanzen <strong>und</strong> Tiere, Walter Müller <strong>und</strong> Heinz<br />
Schröder. Görres Verlag Koblenz, ISBN 3-935690-23-1<br />
Anschrift Vulkanpark Mayen /Koblenz:<br />
Infozentrum Rauschermühle, Rauschermühle 6, 56637 Plaidt, Tel.: 02632/98750<br />
22
Eifelgold mit Kapelle am Weinfelder Maar<br />
Wingertsbergwand<br />
23
Vulkansee "Gemündener Maar" bei Daun<br />
Das Weinfelder Maar ist das höchstgelegene <strong>und</strong><br />
jüngste der drei Dauner Maare. Mit einer Tiefe von 51<br />
Metern ist es fast so tief wie der Laacher See.<br />
Das Maar entstand vor r<strong>und</strong> 10.500 Jahren bei einer<br />
vulkanischen Gasexplosion. Es ist r<strong>und</strong> 625 Meter lang<br />
<strong>und</strong> 575 Meter breit.<br />
Am Ufer des Maares führt ein Fußweg entlang.<br />
Das kleinste der drei Dauner Maare ist das Gemündener<br />
Maar. Es entstand wie die anderen beiden Maare aus der<br />
Gruppe vor etwa 10.500 bis 11.000 Jahren.<br />
Es ist 7,2 Hektar groß, hat eine maximale Wassertiefe von<br />
38 Metern <strong>und</strong> einen Durchmesser von 325 Meter.<br />
Der üppige Mischwald reicht bis an die steil ins Wasser<br />
fallenden Ufer heran.<br />
Vulkansee "Weinfelder Maar"<br />
Das Weinfelder Maar hat seinen Namen<br />
von dem ehemaligen Dorf Wyneveld. Das<br />
Kirchlein am Nordrand des Sees ist als<br />
einziges Gebäude des verschw<strong>und</strong>enen<br />
Dorfes stehen geblieben. Nach der Pest<br />
von 1562 verließen die letzten Bewohner<br />
Weinfeld <strong>und</strong> siedelten nach Mehren <strong>und</strong><br />
Schalkenmehren.<br />
Den Namen Totenmaar hat das Maar<br />
nachträglich bekommen, wegen des<br />
kleinen, neben der Kirche liegendem<br />
Friedhofs. Hier haben die ausgewanderten, einstmaligen Bewohner von Weinfeld auch nach ihrer<br />
Abwanderung ihre Toten bestattet.<br />
24
Beim Schalkenmehrener Maar handelt es sich um ein Doppelmaar, bestehend aus einem westlichen,<br />
heute mit Wasser gefüllten Vulkantrichter <strong>und</strong> mit einem östlichen älteren Maarkessel. Der östliche<br />
Maarkessel wird von einem Hochmoor eingenommen.<br />
Nach seiner Entstehung war das Schalkenmehrener Maar um vieles größer, wurde aber dann durch die<br />
Ausbruchsaschen der benachbarten jüngeren Vulkane teilweise zugeschüttet.<br />
Der Dronketurm<br />
Der Adolf - Dronke Turm auf dem 561 Meter hohen Mäuseberg,<br />
wurde 1902 als Denkmal für Dr. Adolf Dronke erbaut, der 1888 den<br />
den Eifelverein mit begründete.<br />
Von diesem, ca. 11 Meter hohen Aussichtsturm, hat man einen<br />
herrlichen Panoramablick über die weite Eifeler Vulkanland -<br />
Schaft. Auf seiner Aussichtsplattform befindet man sich genau<br />
166,5 Meter über dem Gemündener Maar.<br />
25
Sie heißen Warzenbeißer, kurzflügelige Beißschrecke,<br />
braune Mosaikjungfer oder schlicht Erdkröte.<br />
Diese Tiere sind äußerst selten im MYK-Kreis.<br />
Deshalb wurde das Gebiet um das Booser Doppelmaar<br />
unter <strong>Natur</strong>schutz gestellt.<br />
Schutzzweck ist die Erhaltung des Booser Maares mit<br />
seinen Wasser- <strong>und</strong> Flachwasserzonen <strong>und</strong> seinen<br />
feuchtlandtypischen Charakter als Lebensraum seltener,<br />
in ihrem Bestand bedrohter Tierarten, insbesondere<br />
Amphibien, Reptilien, Heuschrecken <strong>und</strong> Vögel.<br />
Unter Schutz gestellt wird das Gebiet ferner aus<br />
wissenschaftlichen Gründen zue Entwicklung <strong>und</strong><br />
Darstellung eines Netzes von Biotopen <strong>und</strong> Geotopen<br />
sowie seiner landschaftsbestimmenden <strong>und</strong> besonderen<br />
landschaftlichen Eigenart.<br />
26
Die Eifel wird seit Jahrtausenden vom Vulkanismus geprägt<br />
Vor ca. 40 Mio. Jahren waren die ersten Vulkane in Boos aktiv.<br />
Die letzten vulkanischen Aktivitäten liegen nur etwa 8.000 bis<br />
10.000 Jahre zurück.<br />
Im Bereich der Kratertour findet man insgesamt 8 Schlacken-<br />
Kegelvulkane <strong>und</strong> die beiden Maare.<br />
Maare <strong>und</strong> Schlackenkegel waren zeitweise nebeneinander<br />
Tätig<br />
Hubert Schmidt aus Boos bei seiner Führung<br />
Ein besonderer Höhepunkt stellt<br />
der 25 Meter hohe Eifelturm dar<br />
<strong>und</strong> bietet einen einmaligen Panoramablick<br />
über die Eifel bis in den<br />
Westerwald <strong>und</strong> Hunsrück.<br />
Büschel-Glockenblume 27
Die Rauschermühle - Die Nette - Die <strong>Natur</strong>Fre<strong>und</strong>e<br />
Die Rauschermühle<br />
Info - Zentrum Vulkanpark Osteifel<br />
Die Nette<br />
Ein Fluss in der Eifel<br />
Die <strong>Natur</strong>Fre<strong>und</strong>e<br />
Michael Müller - Rudi Klug<br />
Mit der Flussweihe der Nette an der Rauschermühle mit Wasser aus der Schwarza ( Thüringen )<br />
wird die Nette offiziell zur Flusslandschaft der Jahre 2008 <strong>und</strong> 2009 erklärt.<br />
Flusslandschaft des Jahres 2008 / 2009 : Die Nette<br />
Das 55 km lange Flüsschen Nette in Rheinland Pfalz ist in den Jahren 2008 / 2009<br />
" Flusslandschaft des Jahres".<br />
Das hat der gemeinsame "Fachbeirat für Gewässerökologie" vom deutschen Anglerverband ( DAV )<br />
<strong>und</strong> den <strong>Natur</strong>Fre<strong>und</strong>en <strong>Deutschlands</strong> beschlossen.<br />
Die "Flusslandschaft des Jahres" wird von beiden Organisationen alle zwei Jahre ausgerufen,<br />
um regionale Aktivitäten zum <strong>Natur</strong>- <strong>und</strong> Gewässerschutz in Zusammenhang<br />
mit nachhaltigem Tourismus zu stärken. Ausschlaggebend sind dabei geologische<br />
Besonderheiten, die Pflanzen- <strong>und</strong> Tierwelt sowie vor allem die<br />
aquatischen Lebensgemeinschaften.<br />
Für die Nette hatten sich die <strong>Natur</strong>Fre<strong>und</strong>e im Amt Bergpflege in Kettig eingesetzt,<br />
die in einer Arbeitsgemeinschaft "ARGE Nette" seit langem mit <strong>Natur</strong>schutzverbänden,<br />
Anglern, Kommunen <strong>und</strong> Elektrizitätswerken zusammenarbeiten.<br />
28
Auf einer Strecke von 55 km., von der Quelle bei Lederbach <strong>und</strong> Hohenleimbach im Landkreis<br />
Ahrweiler bis zur Mündung in den Rhein bei Weißenturm im Landkreis Mayen-Koblenz,<br />
durchquert die Nette, mal ruhig <strong>und</strong> behäbig fließend <strong>und</strong> mal wild rauschend, die Eifel.<br />
Seit Jahrtausenden bahnt sie sich so ihren Weg durch die Vordereifel, das Maifeld <strong>und</strong><br />
die Pellenz, vorbei an Mayen, Ochtendung <strong>und</strong> Plaidt. So fließt sie auch durch den Bereich<br />
des Vulkanparks Mayen-Koblenz. Im Bereich der Verbandsgemeinde Pellenz, bei den Ortten<br />
Plaidt <strong>und</strong> Saffig, ist die Nette sogar Bestandteil eines ehemaligen <strong>Natur</strong>denkmals des<br />
Vulkanparks. Im Rauscherpark direkt hinter dem Vulkan-Info Zentrum in Plaidt - Saffig<br />
schneidet sich die Nette seit ca. 200.000 Jahren durch einen Lavastrom der Wannen - Vulkangruppe.<br />
Im laufe der Zeit hat sie gewaltige Basaltblöcke freigespült, tiefe Rinnen gegraben<br />
<strong>und</strong> kleine Becken ausgespült. Laut rauschend ergießt sich der Fluss heute in kleinen<br />
Wasserfällen über die Basaltblöcke. Der von der Nette freigespülte Basalt weckte schon<br />
vor über 2.000 Jahren das Interesse der damaligen Bewohner. Deutlich zeigen 2.000 Jahre<br />
alte Abbauspuren an den Basaltlavasäulen entlang der Uferzone von der römischen Abbautätigkeit.<br />
Basalt war schon damals <strong>und</strong> ist noch heute ein begehrter Baustoff.<br />
oben : Die Nette im Rauscherpark<br />
Wenn man bei den <strong>Natur</strong>fre<strong>und</strong>en über die Flusslandschaft Nette spricht, fällt immer zuerst der<br />
Name Hillesheim Elmar.<br />
Elmar ist Vorsitzender der Ortsgruppe Kettig, <strong>und</strong> Mitglied der "ARGE Nette". Er war es, der den<br />
Landesvorstand der <strong>Natur</strong>fre<strong>und</strong>e dazu gebracht hat, sich für die Nette als Flusslandschaft der Jahre<br />
2008 -2009 zu bewerben.<br />
Als wir unseren Wunsch mit dem Eifelseminar öffentlich machten, war Elmar sofort dabei.<br />
Wegen einer schweren ges<strong>und</strong>heitlichen Einschränkung konnte<br />
er an der Proklamationsfeier zur Flusslandschaft Nette nur als<br />
Zuschauer teilnehmen, umso mehr ist er jetzt im Nettetal für die<br />
<strong>Natur</strong>fre<strong>und</strong>e unterwegs.<br />
Wenn man Elmar in Kettig besucht, wird man<br />
an seinem Haus in der Schnürstrasse mit<br />
diesem Schild begrüßt.<br />
unten : Nettemündung in den Rhein<br />
Wir haben Dank zu sagen an Elmar <strong>und</strong> seiner Frau Beate für<br />
die vielen Anregungen <strong>und</strong> aktive Mitarbeit bei unserem<br />
Eifel - Treffen 2008.<br />
29
Nette-Baumaßnahme im Mündungsbereich ist erfolgreich verlaufen.<br />
Elmar Hillesheim, Burkhard Henning <strong>und</strong> Stefan Rosenzweig ist eines gemeinsam: Sie<br />
haben den Eisvogel nach der Renaturierungsmaßnahme im 700 Meter langen Mündungsbereich<br />
der Nette gesichtet. Damit können die Bedenken einiger Anwohner entkräftet werden.<br />
"Die Beobachtungen der <strong>Natur</strong>fre<strong>und</strong>e an der Nette beweisen, dass die Baumaßnahme<br />
erfolgreich verlaufen ist", freuen sich die Verantwortlichen bei der Kreisverwaltung<br />
Mayen - Koblenz.<br />
In nur zwei Monaten wurde auf einer Fläche von 25.000 Quadratmetern die Geländeoberfläche<br />
links der Nette in der Gemarkung Andernach / Weißenthurm um zwei Meter gesenkt<br />
<strong>und</strong> massive Böschungsbefestigungen entfernt. Damit neue, verzweigte Wege zum Rhein<br />
entstehen <strong>und</strong> sich Sand- <strong>und</strong> Kiesbänke, wechselfeuchte Auebereiche sowie Bereiche<br />
mit Totholz bilden können, sind Baumstämme ins Flussbett eingesetzt worden. Die abgegrabene<br />
Fläche wurde inzwischen neu eingesät <strong>und</strong> mit Schilf bepflanzt.<br />
Auszug einer Pressemitteilung der Kreisverwaltung Mayen - Koblenz vom 15. Nov. 2007<br />
Umweltministerin Conrad: <strong>Natur</strong>nahe Entwicklung der Gewässer <strong>und</strong> Auen<br />
ist Schwerpunktaufgabe der Biodiversitätsstrategie des Landes<br />
Die Renaturierung der Nettemündung ist abgeschlossen: auf einer Länge von r<strong>und</strong> 700 m<br />
wurden Uferbefestigungen entfernt. Gelände sowie Ufer neu profiliert <strong>und</strong> Gehölze angelegt.<br />
Der Einbau so genannter Strömungslenker ermöglicht es dem Fluss, sich zukünftig je nach<br />
Wasserführung eigendynamisch zu entwickeln. Die Nette, die im März durch den<br />
Deutschen Anglerverband <strong>und</strong> die <strong>Natur</strong>Fre<strong>und</strong>e <strong>Deutschlands</strong> zur Flusslandschaft des<br />
Jahres ausgerufen wurde, zeichnet sich durch ihre Fischfauna aus. Hier sind die Fisch -<br />
arten Meerforelle, Flussneunauge <strong>und</strong> der atlantische Lachs heimisch - alle drei auf der<br />
Liste der bedrohten Fischarten. Das Umweltministerium hat der Kreisverwaltung Mayen -<br />
Koblenz für die Renaturierung <strong>und</strong> Strukturverbesserung der Nettemündung in den Rhein -<br />
im Rahmen der Aktion Blau - eine Fördersumme von 750.000 € bereitgestellt. Das Projekt<br />
wurde zusätzlich mit 125.000 Euro von der Deutschen B<strong>und</strong>esstiftung Umwelt gefördert.<br />
Die europäische Wasserrahmenrichtlinie fordert die Wiederherstellung des<br />
guten ökologischen Zustandes aller europäischen Gewässer bis zum<br />
Jahr 2015<br />
"Bei der Nette sind wir durch die Renaturierung der Nettemündung <strong>und</strong> einer Reihe vorgezogene<br />
Maßnahmen in den vergangenen Jahren zuversichtlich dieses Ziel auch zu erreichen.<br />
Mit der Wiederansiedlung des Lachses - ohne Besatzmaßnahmen - gibt es erste<br />
sichtbare Erfolge", so die Umweltministerin.<br />
Conrad dankte all denen, die sich bei der Umsetzung der Renaturierungsmaßnahmen der<br />
Nette engagiert haben - ganz besonders den <strong>Natur</strong>fre<strong>und</strong>en Kettig.<br />
Darüber hinaus betonte die Umweltministerin, dass ihr Haus weitere Projekte zur Wiederherstellung<br />
der Durchgängigkeit der Nette fördern werde.<br />
Momentan finden zwei Baumaßnahmen zur Wiederherstellung der Durchgängigkeit an<br />
zwei Queranlagen in Mayen statt. Beide Anlagen werden vollständig zurückgebaut, so dass<br />
die gewässerbezogenen Lebensräume auch an diesen Stellen zukünftig vernetzt sind.<br />
Die Wiedergewinnung des Auen- <strong>und</strong> Flächenrückhaltes sowie der Renaturierung der<br />
Gewässer in Rheinland Pfalz verbessert gleichzeitig den Hochwasserschutz.<br />
Seit Beginn der Aktion Blau sind hierfür über 85 Millionen Euro investiert worden.<br />
Pressemitteilung vom 08. 09. 2008<br />
30
Wie entstanden die Vulkane in der Osteifel ?<br />
In einer Tiefe von über 50 km. wird das Gestein des Erdmantels aufgeschmolzen. Es bildet<br />
sich mehr als 1 300° C heißes Magma <strong>und</strong> sammelt sic h im unteren Teil der Erdkruste.<br />
Von dort steigt es weiter in die obere Erdkruste auf, wo Magmakammern entstehen. Nach<br />
einer Verweildauer von zu mehreren 10 000 Jahren dringt das Magma durch das Gr<strong>und</strong>gebirge<br />
<strong>und</strong> durchstößt in heftigen Ausbrüchen die Landschaftsoberfläche der Osteifel.<br />
In den letzten 500 000 Jahren entstanden in der Osteifel neben drei größeren Ausbruchs-<br />
Zentren - Riedener Kessel, Wehrer Kessel <strong>und</strong> Laacher See - r<strong>und</strong> 40 Schlackenkegel.<br />
Rauschermühle<br />
Info - Zentrum<br />
Vulkanpark<br />
31
Der Laacher See Ausbruch - ein Inferno vor 13 000 Jahren<br />
Die 50 Meter hohe Wingertsbergwand ist Zeuge des gewaltigsten Vulkanausbruchs der<br />
jüngeren Erdgeschichte in Mitteleuropa.<br />
Unzählige Bims- <strong>und</strong> Tuffschichten erzählen von dem Inferno, das nur wenige Tage<br />
dauerte, aber die Landschaft gr<strong>und</strong>legend veränderte.<br />
In wenigen Kilometern Tiefe hatte sich in einer riesigen<br />
Magmakammer jahrtausende lang ein äußerst gas- <strong>und</strong><br />
mineralreiches Magma ( phonolithisches Magma )<br />
entwickelt.<br />
Dieses drang vor 13 000 Jahren nach oben <strong>und</strong> traf<br />
auf Wasser.<br />
Das Inferno nahm seinen Lauf<br />
Mit Überschallgeschwindigkeit wurden Asche, Bimse<br />
<strong>und</strong> sonstiges Gesteinsmaterial in einer bis zu 40<br />
Kilometer hohen Eruptionssäule ausgeschleudert,<br />
ähnlich dem Ausbruch des Mount St. Helens 1980.<br />
Das Material prasselte aus der Eruptionswolke heraus<br />
<strong>und</strong> begrub jegliches Leben unter den mächtigen<br />
Bimsschichten. Feinste Ascheteilchen gelangten sogar<br />
bis nach Schweden <strong>und</strong> Italien.<br />
Die verheerendsten Auswirkungen bei diesem Ausbruch<br />
waren jedoch die bis zu 600° C heißen Glut-<br />
Lawinen <strong>und</strong> Ascheströme. Sie schossen mit hohen<br />
Geschwindigkeiten übers Land <strong>und</strong> hinterließen eine<br />
karge Mondlandschaft. Die mitgeführten Aschen<br />
verfestigten sich schließlich durch den Kontakt mit<br />
Wasser zu Tuff<br />
Bedingt durch die enorme<br />
Eruption kam es zu einer<br />
weltweiten klimatischen<br />
Veränderung.<br />
Auf diese Klima -<br />
Veränderung deuten auch<br />
die Jahresringe einer ca.<br />
12 900 Jahre alten Kiefer<br />
hin, die man in der Schweiz gef<strong>und</strong>en hat.<br />
Mount St. Helens<br />
32
Wanderung von der Rauschermühle<br />
durch den Rauscherpark<br />
zum Römerberwerk Meurin<br />
mit Führung von<br />
Michael Eyke<br />
33
Deutsche Vulkanstrasse - Blaue Route - Station 9<br />
Das Römerbergwerk Meurin<br />
Beim Aufsteigen der Magma vom Laacher See Vulkan reicherte sie sich mit reichlich Gasen<br />
an. Bei dem Kontakt mit Gr<strong>und</strong>wasser gab es eine gewaltige Explosion. Es gab dabei keinen<br />
klassischen Vulkankegel.<br />
Im Bereich des heute zugänglichen römischen Bergwerkes befand sich vor dem Vulkanaustritt<br />
das Urtal des Krufter Baches. Zu Beginn der Eruptionen wurde hier 4 Meter Bims abgelagert,<br />
gefolgt von 14 Ascheströmem <strong>und</strong> Glutlawinen. Insgesamt erreichte die Mächtigkeit<br />
der Ablagerungen ca. 36 Meter.<br />
Durch die Einwirkung von Gr<strong>und</strong>- <strong>und</strong> Oberflächenwasser wurde der Bims umgewandelt<br />
<strong>und</strong> mehr oder weniger verfestigt.<br />
So entstand aus Bims der Tuff. Eine der verfestigten Tufflagen ist der in der römischen Zeit<br />
abgebaute Römertuff.<br />
34
Die Wacholderheiden in der Vordereifel - Geschichte.<br />
Wir können davon ausgehen, dass das Vordereifelgebiet schon lange vor unserer Zeitrechnung<br />
besiedelt war. Aus nomadisierenden Jägern <strong>und</strong> Sammlern hatten sich nach der letzten Eiszeit<br />
gut 5.00 Jahren v. Ch. erste Siedlungsformen von Landnutzern gebildet, die Ackerbau <strong>und</strong> Vieh-<br />
zucht betrieben. Spätestens nach der 400 - jährigen römischen Phase wurde die Eifel wahrscheinlich<br />
ab Mitte des 5. Jahrh<strong>und</strong>erts bevorzugtes Siedlerland für Ackerbauern. Fruchtbare<br />
Böden für den Getreideanbau gab es zunächst nur in den Tallagen, wo zusätzlich frisches<br />
Wasser in ausreichender Menge <strong>und</strong> Güte für Mensch <strong>und</strong> Tier vorhanden war. Die zur Verfüggung<br />
stehenden Flächen dort reichten allerdings bei weitem nicht aus. Um mehr Vieh zu halten<br />
<strong>und</strong> ausreichend Vorräte für den Winter zu beschaffen rodeten unsere Vorfahren die Wälder<br />
auf den Höhen r<strong>und</strong> um ihre Siedlungen.<br />
Das vermutlich ursprünglich am Südhang des Rassberges gelegene Arft<br />
könnte einen ähnlich historischen Hintegr<strong>und</strong> haben. Die Methode der<br />
Ackerlandgewinnung durch Brandrodung ist keine "Erfindung des Mittelalters".<br />
Bereits Vergil, der<br />
berühmte römische Dichter, beschreibt in<br />
seinem zwischen 37 bis 29 v. Ch. entstandenen Werk Georgica<br />
(" Über den Landbau") sehr detailliert die Methode der -<br />
" Düngung mit Holzasche in Forstgärten".<br />
Die Wacholderheiden in der Vordereifel - Entstehung.<br />
Die ursprüngliche Buchen-Waldlandschaft der Eifelregion wurde im Zuge ihrer Besiedlung durch<br />
Rodungen zur Schaffung von Siedlungsflächen, durch Holzeinschlag zur Beschaffung von Bau<strong>und</strong><br />
Brennmaterial <strong>und</strong> vor allem zur Gewinnung von Holzkohle für die Eisenproduktion zwischen<br />
Mittelalter <strong>und</strong> Neuzeit weitgehend leergeräumt. Die Landwirtschaft tat ihr Übriges: Um die kargen<br />
Erträge der Bauern zu steigern, die durch das praktizierte Recht der Realteilung ohnehin in ihrer<br />
Existenz bedroht waren, praktizierte man in der Osteifel die sogenannte " Schiffelwirtschaft ".<br />
Zunächst wurde der Wald im Frühjahr komplett gerodet, also auch die Wurzeln der Bäume entfernt<br />
<strong>und</strong> verbrannt. Übrig blieb Asche, die einer primitiven Düngung gleichkommt. Das reichte<br />
für ein bis zwei Jahre für den Anbau von Hafer <strong>und</strong> Roggen, vielleicht noch zusätzlich für eine<br />
magere Buchweizenernte. Wenn der Boden nach zwei bis drei Jahren ausgelaugt war, überließ<br />
man das Land seinem Schicksal. So entstanden Heidelandschaften. Während dieser Zeit diente<br />
das Land als Schafweide. War die spärliche Weide abgefressen, ließ man sie brach liegen.<br />
Anschließend wurden die torfähnlichen Reste mit der Schaufel abgeplaggt ( abgeschiffelt ).<br />
Die im Sommer getrockneten Heideplaggen wurden verbrannt <strong>und</strong> im Herbst erneut als Dünger<br />
ausgebracht. Damit begann der Bearbeitungszyklus wieder von vorn, solange bis nichts mehr<br />
auf den völlig ausgelaugten Böden anzubauen lohnte. Nur die Pflanzen, die von Kühen, Schafen<br />
oder Ziegen wegen ihres Geschmackes oder ihrer stacheligen Blätter verschmäht wurden, die<br />
der Kälte <strong>und</strong> <strong>und</strong> dem Wind trotzten <strong>und</strong> auf dem nährstoffarmen Boden gedeihen konnten, hatten<br />
eine Chance zum Überleben. Typische Heidepflanzen sind der immergrüne Wacholder, der<br />
goldgelb blühende Ginster im Frühjahr, das purpurn leuchtende Heidekraut (Calluna) im Sommer<br />
<strong>und</strong> das im Herbst fahlgelb wogende Borstgras. Sie bildeten einst große Heideflächen, die oft<br />
bis zum Horizont reichten.<br />
Mit der Verabschiedung der Fauna - Flora - Habitat ( FFH ) - Richtlinie 1992 haben sich die Mitgliedsstaaten<br />
der Europäischen Union (EU) verpflichtet, ein zusammenhängendes ökologisches<br />
Netz besonderer europäischer Schutzgebiete aufzubauen. Dieses Schutzgebiet-Netzwerk trägt<br />
die Bezeichnung : " NATURA 2000 "<br />
35
Die Wacholderheiden der Osteifel liegen in FFH-Gebieten <strong>und</strong> unterstehen den<br />
Richtlinien der NATURA 2000.<br />
<strong>Natur</strong>schutz ist zugleich Heimatpflege.<br />
Dazu gehört die Erkenntnis, dass die Wacholderheide der Osteifel nicht natürlichen Ursprungs<br />
ist, sondern sich über Jahrh<strong>und</strong>erte hinweg durch die extensive Bewirtschaftungsweise entwickelt<br />
haben. In der Eifel sind ertragreiche Böden rar. Alle anderen Flächen wurden als Weideflächen<br />
genutzt. Dort aber wurde den Pflanzen jeder Nährstoff entzogen, denn " Düngen " im<br />
heutigen Sinne war unbekannt, <strong>und</strong> so konnten sich über die Zeit auf den Weideflächen nur<br />
solche Pflanzen, Insekten <strong>und</strong> Vögel halten, die mit dortigen der mageren Kost <strong>und</strong> den klimatischen<br />
harten Lebensverhältnissen auskommen konnten.<br />
Historische Verpflichtung.<br />
Unsere Wacholderheiden sind eine Art "Erinnerung" der <strong>Natur</strong> an eine lange Zeitperiode, die<br />
hier für jeden - Pflanze, Tier <strong>und</strong> Mensch - oft hart <strong>und</strong> entbehrungsreich war.<br />
Erhaltung seltener Tiere <strong>und</strong> Pflanzen.<br />
Niemand von uns ist berechtigt, jenen seltenen Pflanzen- <strong>und</strong> Tierarten die Lebensgr<strong>und</strong>lage<br />
"auszuschalten", was aber geschehen würde, würden wir die Düngungen, Aufforstungen oder<br />
Verbuschungen weiterlaufen lassen.<br />
Unsere Verpflichtung für das Erbe der Vorfahren.<br />
Diese Wacholderheiden sind Erbe der Vorfahren, <strong>und</strong> wir sind als deren Erbe <strong>und</strong> aus Respekt<br />
vor deren erfolgreichen Überlebenskampf verpflichtet, dieses Erbe weiterzugeben.<br />
Diese - karge, magere - Landschaft ist entstanden als Folge Jahrh<strong>und</strong>erte langer Landbearbeittung,<br />
damit durch Gestaltung des Lebensraumes <strong>und</strong> damit " Kulturarbeit " im sehr ursprünglichen<br />
Sinne. Wir sehen darin unsere Pflicht, die Wurzeln dieser Kultur für unsere Nachwelt<br />
<strong>und</strong> unsere Kinder zu erhalten.<br />
Schutz <strong>und</strong> Pflege von Wacholderheiden der Osteifel<br />
Projektnummer: LIFE05 NAT / De / 000055<br />
Laufzeit. 2005 - 30. 06. 2010<br />
Projektträger:<br />
Verbandsgemeinde Vordereifel<br />
Bürgermeister Dr. Alexander Saftig<br />
Projektleiter:<br />
Hans-Friedrich Hollederer<br />
Verbandsgemeinde Vordereifel / Mayen<br />
Homepage: www.wacholderheiden.eu<br />
36
Ettringer Lay<br />
Vor 150 Jahren entstanden in der Ettringer Lay die tiefsten Steinbrüche r<strong>und</strong> um den Bellerberg<br />
Vulkan. Steile Abbauschluchten <strong>und</strong> zahlreiche Hinterlassenschaften machen die "Lay"<br />
( Lay = Steinbruch ) zu einem imposanten vulkanologischen <strong>und</strong> technikgeschichtlichen<br />
Denkmal.<br />
39
oben: Kleiner Abendsgler - unten: Zwergfledermaus 41
oben. Teichfledermaus - mitte: Rauhhautfledermaus<br />
Mayener Grubenfeld<br />
Bis ins 20. Jahrh<strong>und</strong>ert wurde dort Basaltlava abgebaut. Die Lava ist r<strong>und</strong> 200 000 Jahre alt<br />
<strong>und</strong> war beim Ausbruch des zwischen Ettringen <strong>und</strong> Kottenheim gelegenen Bellerberg -<br />
Vulkan entstanden.<br />
Archäologische Grabungen<br />
belegen, dass die Römer<br />
in diesen Steinbrüchen<br />
bereits Basalt zur Herstellung<br />
ihrer Mühlsteine<br />
abgebaut haben.<br />
Gebietes in Mitteleuropa.<br />
Ein Infoweg erzählt den<br />
Besucherinnen <strong>und</strong> Besucher<br />
die Abbaugeschichte<br />
des ältesten Steinbruch -<br />
42
Römische<br />
Abbauspuren<br />
43
Bei Dornröschen zu Hause - Schloss Bürresheim<br />
Majestätisch thront Schloss Bürresheim<br />
auf einem Felssporn im idyllischen<br />
Nettetal. Kaum ein anderes Schloss in<br />
Europa liegt heute noch derart schön<br />
seit Jahrh<strong>und</strong>erten in einer unberührten<br />
<strong>und</strong> unzersiedelten <strong>Natur</strong>landschaft mit<br />
Bächen <strong>und</strong> waldigen Berghängen.<br />
Wer das Schloss, das in seiner langen<br />
Geschichte nie erobert oder zerstört<br />
wurde, vor sich sieht, wähnt sich in<br />
einem Mittelalterepos, so perfekt sind die Mauern erhalten. Hoch ragt der Bergfried in den<br />
Himmel <strong>und</strong> vereint die unterschiedlichen Dachformen unter sich. Schon 1157 findet man<br />
die erste urk<strong>und</strong>liche Erwähnung der als Burg gebauten Anlage. Seitdem hat sie eine belebte<br />
Geschichte hinter sich: Bald kam ein Teil des Wehrbaus in den Besitz des Kölner Erzbischofs,<br />
bald der andere in den des Trierer Erzbistums. Oft wechselten die Hausherren, bis die Burg<br />
schließlich 1659 in die Hand der Familie von Breitbach - Bürresheim fiel.<br />
Bis ins 20. Jahrh<strong>und</strong>ert bewohnte dieses Geschlecht die Anlage. Ein Glück für die heutigen Besucher,<br />
denn nur so konnte sich über Jahrh<strong>und</strong>erte eine einzigartige Ausstattung ansammeln,<br />
die Objekte <strong>und</strong> Kunstwerke von der Spätgotik bis zum Historismus umfasst. Aber auch die<br />
Teilung hat ihre Spuren hinterlassen. Die Kölner Burg - bestehend aus einer Vor- <strong>und</strong> einer<br />
Kernburg - wurde nach der Übernahme durch die Bürresheimer dem Verfall preisgegeben.<br />
Heute existieren nur noch Reste der Ringmauer. Die Trierer Burg dagegen blühte auf. Immer<br />
weiter wuchs der Bau r<strong>und</strong> um den ursprünglichen Bergfried. Im Zuge der Umgestaltung zu<br />
einem barocken Schloss entstanden Wohnbauten <strong>und</strong> Kapellen, Türme <strong>und</strong> Gewölbe, die<br />
belebte Dachlandschaft <strong>und</strong> die Gärten.<br />
Steht man als Besucher im Schlosshof <strong>und</strong> lässt einen Blick über das bunte Fachwerk <strong>und</strong><br />
die unterschiedlichen Dachformen schweifen, fühlt man sich wie bei Dornröschen zu Hause.<br />
Auch bei einer Führung durch das Schloss scheint die Vergangenheit zu erwachen. Die reich<br />
ausgestatteten Räume sind ein einzigartiges Zeugnis der Wohnkultur des Rheinischen Adels.<br />
Die Raumaufteilung des spätmittelalterlichen Palast zeigt dagegen noch, wie einfach man um<br />
1490 wohnte. In jedem Stock liegt ein großer Saal mit Eichenholzpfeilern, Balkendecken <strong>und</strong><br />
riesigen Kaminen. Erst in späteren Jahrh<strong>und</strong>erten teilte man gemütliche Zimmer ab. Möbel<br />
vom 15. bis zum 19. Jahrh<strong>und</strong>ert werden bis<br />
heute liebevoll aufbewahrt. Zahlreiche Porträts<br />
zeigen Familienmitglieder <strong>und</strong> Fürsten<br />
vergangener Jahrh<strong>und</strong>erte.<br />
Das Schloss kann täglich besichtigt werden,<br />
außer Dezember.<br />
Die Besichtigung erfolgt immer mit Führung.<br />
44
Der Hufeisenkrater - Bausenberg<br />
Der erloschene Vulkan Bausenberg liegt als Hufeisen-Schlackenkegel unmittelbar an der<br />
AS Niederzissen zur A 61 zwischen Bad Neuenahr-Ahrweiler <strong>und</strong> Koblenz.<br />
Dort durchbricht die B<strong>und</strong>esautobahn den Lavastrom des " Niederzissener Hausbergs ".<br />
Er schreibt in seinem Buch :<br />
" Um den Schlackenkegel Bausenberg,<br />
den viele, die ihn besucht haben, als<br />
<strong>Deutschlands</strong>, wenn nicht sogar Europas<br />
schönsten <strong>und</strong> besterhaltenen Hufeisen-<br />
Krater bezeichnen, kennen zu lernen,<br />
bedarf es eigentlich nicht mehr als eines<br />
halben Tages. Um ihn aber zu erleben<br />
<strong>und</strong> auch zu genießen, sollte man ihm<br />
häufiger die Ehre erweisen".<br />
Ein Spaziergang mit Walter Müller.<br />
Autor des Buches:<br />
Der Bausenberg<br />
Vulkan <strong>und</strong> Heimat seltener<br />
Pflanzen <strong>und</strong> Tiere<br />
45
1981 wurde der Bausenberg unter <strong>Natur</strong>schutz gestellt.<br />
Schutzzweck ist - Zitat aus der Rechtsverordnung -<br />
"(…) die Erhaltung Erhaltung des Schlackenkegel-Vukans Schlackenkegel-Vulkansmit<br />
seinem mit seinem gut ausgebildeten gut ausgebildeten Ringwall Ringwall <strong>und</strong><br />
<strong>und</strong> dem nach Nordosten ausgeflossenen Lavastrom, wegen seiner besonderen<br />
geologischen Bedeutung<br />
<strong>und</strong> als Standort seltener Pflanzenarten <strong>und</strong> Pflanzengesellschaften<br />
sowie als Standort seltener Tierarten aus wissenschaftlichen Gründen."<br />
Nickende Distel<br />
Heinz Eicke<br />
Sommerwurz<br />
Perlmutter<br />
Waldvogel<br />
Walter Müller<br />
46
Vor knapp 13.000 Jahren rasten Glutwolken des Laacher See - Vulkans das Brohltal hinab <strong>und</strong> füllten<br />
es mit ihren vulkanischen Lockermassen.<br />
Noch heute lässt sich dieses beeindruckende<br />
Schauspiel hier ablesen.<br />
Station 10 der deutschen Vulkan -<br />
Straße :<br />
Aschestrom<br />
Junge Asche auf altem Stein<br />
Folgen sie der Straße rechts hinter<br />
dem Gebäudekomplex <strong>und</strong> gehen<br />
Sie wenige Meter bergauf. Am Hang<br />
auf der rechten Seite sind die<br />
Ascheschichten ( Trass ), die sich<br />
auf die Felsen des älteren Gr<strong>und</strong>gebirges gelegt haben, deutlich zu erkennen.<br />
Und wo Vulkane aktiv waren, sind auch Mineralbrunnen meist nicht fern. Am nahe gelegenen<br />
barocken Brunnentempel der Bad Tönissteiner Mineralquellen können sie sich mit<br />
Wasser aus der Tiefe erfrischen.<br />
48 v. Ch.<br />
408<br />
Auf diese frühe Zeit, als die Römer Germanien kolonisierten <strong>und</strong> ihre Kultur mit<br />
ins Land brachten, geht die belegte Nutzung der Tönissteiner Quelle zurück.<br />
Bis zum Ende der Kaiserzeit schöpften die Römer in Germanien, <strong>und</strong> das über<br />
viereinhalb Jahrh<strong>und</strong>erte, aus der Tönissteiner Quelle.<br />
Bad Tönisstein<br />
Bad Tönisstein gehört zu Kell, einem Stadtteil von Andernach. Der Ort besteht gerade mal<br />
aus einer Hand voll Häusern. Und der Name verspricht mehr, als er zu halten vermag.<br />
Denn zur Kur fährt hierher schon lange niemand mehr. Dabei hat der Ort große Zeiten erlebt.<br />
Die Kölner Kurfürsten kamen im 17. <strong>und</strong> 18. Jahrh<strong>und</strong>ert nach Bad Tönisstein, um es sich<br />
im Brohltal gut gehen zu lassen.<br />
Der nach ihnen benannte Kurfürstenhof war<br />
besonders nach dem 2. Weltkrieg eine beliebte<br />
Adresse. Hier trafen sich die Leute, die<br />
über das nötige Kleingeld verfügten.<br />
In den 70er Jahren wurde an das Hotel eine<br />
Klinik angebaut. Hier wurden bis 2005<br />
alkohol- <strong>und</strong> drogenabhängige Menschen<br />
therapiert.<br />
Seit die Klinik nach Bad Neuenahr-Ahrweiler<br />
umgezogen ist, steht das Gebäude zum<br />
Verkauf.<br />
47
Für das Leben in Bad Tönisstein sorgt heute vor allem das Jägerheim. - ein Ausflugslokal.<br />
In direkter Nachbarschaft zum Jägerheim ist die Nr. 11 der deutschen Vulkanstraße.<br />
Trasshöhle<br />
Der Himmel im Brohltal verdunkelte sich, als nur fünf Kilometer entfernt der Laacher-See<br />
Vulkan ausbrach. Ein glühend heißes Gemisch aus Lavapartikeln <strong>und</strong> Gasen schoss in Intervallen<br />
bis in die Atmosphäre. Jedes Mal, wenn die Eruptionssäule zusammenbrach, raste das<br />
Material wie auf einem Luftkissen durch die umliegenden Täler. Asche <strong>und</strong> Lavapartikel füllten<br />
die Täler bis zu 60 Meter hoch auf. Die einst lockeren Materialien der Glutlawine sind im Laufe<br />
der Zeit zu einem Gestein verbacken, das man in unserer Region "Trass" nennt.<br />
Schon die Römer bauten im Brohltal Trass ab <strong>und</strong> verwendeten ihn unter anderem zum<br />
Hausbau. Feingemahlen ergibt es unter Zugabe von Wasser <strong>und</strong> Kalk einen Mörtel, der auch<br />
unter Wasser aushärtet.<br />
Es liegt nahe, dass es Niederländer waren, die den Abbau seit dem 16. Jh. im Brohltal<br />
forcierten, denn Trass ist zum Bau von Deichen <strong>und</strong> Hafenanlagen ideal.<br />
Sie waren es auch, die dem vulkanischen Zement den Namen gaben: "Tyrass" ist<br />
niederländisch <strong>und</strong> heißt "Kleber".<br />
Die Trasswände, die Sie von hier aus sehen, sind durch Abbau ausgehöhlt <strong>und</strong> können<br />
besucht werden. Wegen ihrer schlechteren Qualität waren sie für den Abbau nicht mehr<br />
interessant <strong>und</strong> sind heute ein beeindruckendes Zeugnis der gewaltigen Glutlawine,<br />
die einst das ganze Tal ausfüllte.<br />
48
Der Lydiaturm<br />
Der Eifelverein Ortsgruppe Brohltal baute 1896 einen Aussichtsturm aus Holz am Laacher<br />
See. 1925 wurde er wegen Baufälligkeit geschlossen.<br />
1927 baute man deshalb hinter dem Hotel " Waldfrieden " einen 16 Meter hohen Turm aus<br />
heimischem Lavastein, der an klaren Tagen einen Fernblick bis fast zum Kölner Dom<br />
gewährt. Seinen Namen bekam der Turm nach Lydia, der Frau des 1. Vorsitzenden <strong>und</strong><br />
damaligen Amtbürgermeisters Fritz Beck.<br />
Aber nach 60 Jahren hatte der umgebende Buchenwald eine beachtliche Höhe erreicht<br />
<strong>und</strong> versperrte den Blick in die Ferne,<br />
So entschloss man sich, 1986 den Turm mittels einer Holzkonstruktion auf 23 Meter zu<br />
erhöhen.<br />
Im Mauerwerk kann man einen Hauyn<br />
bew<strong>und</strong>ern. In Bimsablagerungen -<br />
r<strong>und</strong> um den Laacher See kommt er<br />
in seiner schönsten Form vor.<br />
Die typische Farbe des Hauyn ist<br />
hell - bis dunkelblau.<br />
49
Mayen<br />
Mayen ist eine Stadt im rheinland-pfälzischen Landkreis Mayen-Koblenz in der Vulkaneifel<br />
<strong>und</strong> Verwaltungssitz der Verbandsgemeinde Vordereifel.<br />
Bis 1973 war Mayen Kreisstadt des Landkreises Mayen.<br />
Das kleine Flüsschen Nette durchfließt die Stadt von der Eifel kommend in Richtung<br />
Weißenthurm an Rhein.<br />
Bereits in der römischen Zeit war Mayen ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Hier waren von<br />
dem Ende des 3. Jh. bis ins Mittelalter Töpfereien angesiedelt, deren Produkte in ganz<br />
Mitteleuropa verbreitet wurden. Eine noch ältere - vorgeschichtliche Nutzung erfuhren die<br />
Steinbrüche im Umfeld, deren Basalt in Mayen zu Mühlsteinen <strong>und</strong> deren Tuff zu Sarkophagen<br />
weiterverarbeitet wurden. Diese Sarkophage fanden sich mit bedeutenden gläsernen Beigaben<br />
auf dem Gräberfeld. Heute im Museum auf der Genovevaburg.<br />
Der Name Mayen leitet sich wahrscheinlich aus dem Namen Megima her, der 847 erstmalig urk<strong>und</strong>lich<br />
den Ort in der Eifel bzw. auf dem Feld ( keltisch magos ) bezeichnet.<br />
Im 8. Jh. Ist die Sage der Genoveva angesiedelt, die Mayen als Regierungssitz des<br />
Pfalzgrafen Siegfried sieht.<br />
50
Die Genovevaburg oberhalb des Marktplatzes, mit dem 24 Meter hohen Goloturm,<br />
prägen das Stadtbild. Erbaut wurde sie von Heinrich von Finstingen 1280 als<br />
Schutzburg. Ihre wechselvolle Geschichte ist umrankt von der Genovevasage.<br />
In den Räumen befindet sich heute das Eifelmuseum.<br />
Im Stollen unter der Burg gibt es Geschichte <strong>und</strong> Geschichten zum Stollen selbst <strong>und</strong><br />
zum Schiefer im " Deutschen Schieferbergwerk ".<br />
51
Die<br />
Wingertsbergwand<br />
ist der weltbekannte vulkanologische<br />
Aufschluss des<br />
Laacher See - Vulkans.<br />
Nirgendwo sonst hat sich der Ausbruch des Laacher See - Vulkans vor 13.000 Jahren -<br />
der gewaltigsten Eruption der gesamten jüngeren Erdgeschichte in Mitteleuropa -<br />
eindrucksvoller verewigt.<br />
10 Tage dauerte das Inferno des Laacher See - Ausbruchs.<br />
Heute 13.000 Jahre später, kann man den Spuren dieser <strong>Natur</strong>katastrophe an der<br />
Wingertsbergwand folgen <strong>und</strong> die Tragik der Geschichte ergründen.<br />
52
Lava - Dome Deutsches Vulkanmuseum in Mendig<br />
Im neuen Vulkanmuseum ( 2005 ) in Mendig werden<br />
alle Fragen zum Vulkanismus in spielerischer Form<br />
<strong>und</strong> für jeden Laien verständlich, mit Hilfe aller nur<br />
denkbaren technischen Raffinessen beantwortet.<br />
Im Lava - Dome löst man auch seine Eintrittskarte für<br />
die Mendiger Unterwelt.<br />
Auf einer Fläche von nahezu 3 km 2 spannt sich unterhalb von Mendig ein Netz von unterirdischen<br />
Lavakellern. In 32 Meter Tiefe befindet die sich auf der Welt einmalige unterirdische<br />
" Landschaft "<br />
Als vor ca. 150.000 Jahren der Wingertsbergvulkan ausbrach, floss auch ein Lavastrom in<br />
Richtung Mendig. Was früher Unglück <strong>und</strong> Not bedeutete, war für die Menschen unserer<br />
Gegend ein wichtiger Broterwerb. In einer Vielzahl von Stollen <strong>und</strong> Schächten machten sich<br />
die Mendiger daran, das kostbare schwarze Baumaterial unterirdisch als Basaltlava abzubauen.<br />
So entstanden die Lavakeller.<br />
Mitte des 19. Jh. nutzten viele Brauereien, die stets gleichbleibende Temperatur von 6 - 9<br />
Grad um ihr Bier zu lagern. Erst mit der Erfindung von Lindes Kühltechnik verschwanden<br />
bis auf eine die Brauereien.<br />
Übrig bleibt ein Gewirr von Kellern, die heute im Rahmen von Führungen besucht werden<br />
können. 53
Ornithologischer Bericht des B<strong>und</strong>esseminares für <strong>Natur</strong>-<strong>und</strong> Heimatk<strong>und</strong>e vom 31.Mai bis<br />
08.Juni 2008 in der Osteifel<br />
Das Seminar in der Osteifel kann man aus ornithologischer Sicht als sehr gelungen bezeichnen.<br />
Nicht nur unsere Beobachtungen um unser Quartier in Langenfeld <strong>und</strong> Umgebung (siehe<br />
Vogelliste), sondern besonders der Vortrag am Dienstag über den Kuckuck <strong>und</strong> unsere Exkursion<br />
mit dem Vogelliebhaber Alfred Leisten um die <strong>Natur</strong>schutzgebiete Jungfernweiher <strong>und</strong><br />
Sangweiher waren von Besonderheiten nur so gespickt. Der Jungfernweiher, in der Nähe von<br />
Ulmen, ist ein Trinkwasserspeicher mit Schilfgürtel. Der Sangweiher ist ein ehemals entwässerter<br />
Feuchtbereich, der seit 1987 vom NABU- Daun<br />
mit einem Auslaufsperrwerk wieder vernässt wird.<br />
Die Beobachtungsgebiete im Einzelnen:<br />
Sonntag 01. Juni: Wanderung um die Dauner Maare. (Gemündender Maar, Weinfelder Maar<br />
<strong>und</strong> Schalkenmehrener Maar)<br />
Montag 02. Juni: Wanderung um das Boosener Doppelmaar mit Besteigung des Eilfelturms.<br />
(Beobachtung eines Rotmilans, welcher unter uns um den Eifelturm seine<br />
Kreise zog). Am Abend hielt NABU-Mitglied Alfred Leisten einen<br />
interessanten Lichtbildervortrag über den Kuckuck.<br />
Dienstag 3. Juni: Wanderung vom Infozentrum Rauschermühle, an der Nette entlang durch<br />
das Krufter Tal zum Römerbergwerk Meurin. (Beobachtung von<br />
Uferschwalben, Nachtigall <strong>und</strong> Schwarzmilan)<br />
Mittwoch 04.Juni: Das herausragende Ereignis der Woche war die Exkursion mit Alfred<br />
Leisten am Jungfernweiher <strong>und</strong> Sangweiher, bei der wir 55 Vogelarten<br />
sichteten. Am Jungfernweiher hörten wir den Ruf der Wasserralle, auch<br />
Wasserschwein genannt wegen seines schweinartigen Quiekens.<br />
Außerdem sahen wir einen Schwarzspecht im Fluge, einen Baumfalken bei<br />
seiner pfleilartiger Jagd <strong>und</strong> zum Abschluss ein Rothalstaucher um nur<br />
einige Beobachtungen besonders zu nennen. Am Abend Vortrag über Flora<br />
<strong>und</strong> Fauna am Bausenberg mit tollen Vogelaufnahmen.<br />
Donnerstag 05. Juni: Der Bausenberg, ein Vulkan in Hufeisenform, mit Walter Müller.<br />
Freitag 06. Juni: Stadtbesichtigung Mayn. Am Abend bei einer Spätwanderung in St. Jost<br />
konnten wir den Ausflug von mindestens 65 Zwergfledermäusen aus ihrem<br />
Tagesversteck beobachten.<br />
Samstag 07 Juni: Wingersbergwand bei Mendig. Ende unserer Beobachtungen mit<br />
Uhunisthöhle bei strömenden Regen.<br />
Zum Abschluss möchten wir uns bei unseren Exkursionsleitern recht herzlich bedanken,<br />
besonders bei Alfred Leisten, welche uns Beobachtungen ermöglichten, die wir sonst nicht<br />
gesehen hätten.<br />
Eckerhard Deppe<br />
OG Enger 54
Vogelliste v. B<strong>und</strong>esseminar für <strong>Natur</strong> <strong>und</strong> Heimatk<strong>und</strong>e 2008 in der Osteifel<br />
Vogelart 01.06. 02.06. 03.06. 04.06. 05.06. 06.06. 07.06.<br />
Amsel X X X X<br />
Bachstelze X X X<br />
Baumfalke X<br />
Baumläufer-Garten<br />
Baumläufer-Wald<br />
Baumpieper X X<br />
Bläßralle X X<br />
Buchfink X X X X<br />
Buntspecht<br />
Dohle X X<br />
Dompfaff<br />
Dorngrasmücke X X<br />
Eichelhäher X X<br />
Elster<br />
Fasan<br />
Feldlerche X<br />
Feldsperling X<br />
Fitis X<br />
Flussuferläufer X<br />
Flußregenpfeiffer<br />
Gartengrasmücke X X X<br />
Gänsesäger<br />
Gans-Grau<br />
Gans-Kanada<br />
Gans-Nil<br />
Gebirgsstelze<br />
Gelbspötter X<br />
Goldammer X X<br />
Goldhähnchen-Sommer<br />
Goldhähnchen-Winter<br />
Graureiher X X X<br />
Grünling X X<br />
Grünspecht X<br />
Haubentaucher X<br />
Hausrotschwanz X X X<br />
Haussperling X X X<br />
Heidelerche X X<br />
Heckenbraunelle<br />
Höckerschwan X<br />
Hohltaube<br />
Kiebitz X<br />
Kleiber<br />
Kormoran<br />
Krickente X<br />
Mauersegler X X X X<br />
Mäusebussard X X X<br />
S.55
Vogelart 01.06. 02.06. 03.06. 04.06. 05.06. 06.06. 07.06.<br />
Meise-Blau X X X<br />
Meise-Hauben<br />
Meise-Sumpf<br />
Meise-Kohl X X<br />
Meise-Sumpf X<br />
Meise-Tannen X<br />
Mönchsgrasmücke X X X X X X<br />
Nachtigall X<br />
Neuntöter X<br />
Nilgans X<br />
Rauchschwalbe X X<br />
Raufußbussard X<br />
Rabenkrähe X X<br />
Reiherente X X<br />
Rothalstaucher X<br />
Rohrammer X<br />
Rohrweihe X<br />
Ringeltaube X X<br />
Rotkehlchen X X<br />
Rotmilan X X<br />
Schwarzmilan X X<br />
Schwalbe-Mehl X X X<br />
Schwalbe-Rauch<br />
Schwalbe-Ufer X<br />
Schwarzdrossel<br />
Schwarzspecht X<br />
Singdrossel X<br />
Star X X<br />
Stockente X X X<br />
Sumpfrohrsänger X<br />
Teichhuhn X<br />
Teichrohrsänger X<br />
Temminck-Strandläufer<br />
Türkentaube<br />
Turmfalke X X<br />
Waldbaumläufer X X<br />
Wacholderdrossel X<br />
Wasserralle X<br />
Wiesenpieper X X<br />
Zaunkönig X<br />
Zilpzalp X<br />
S. 56
www.vulkanpark.com<br />
www.daun.de<br />
Impressum<br />
Autoren der Bilder <strong>und</strong> Berichte:<br />
www.gruen-as.de Karl Müller<br />
www.kreativ.de Waltraud Müller<br />
www.fotonatur.de Walter Müller<br />
www.nafodu.de Ernst Steller<br />
www.wikipedia/eifel.de Heinz Eicke<br />
www.naturfre<strong>und</strong>e-nrw.de Eckerhard Deppe<br />
www.booser-doppelmaar.de DVG/ Deutsche V. Gesellschaft<br />
www.boos/eifel.de Archiv GeoMontanus<br />
www.aku-bochum.de Zusammengestellt: Karl Müller<br />
www.meine.photos.de<br />
www.webmuster.de<br />
www.der-takt.de/schloß-bürresheim<br />
www.swr.de/landesschau-rp/hierzuland<br />
V.i.S.d.P. Druckvorbereitung <strong>und</strong> Druck für den Herausgeber<br />
www.deutsche-vulkanstrasse.com<br />
Landesverband :<br />
www.eifel/brohltal.de<br />
Teutoburgerwald -Weserbergland<br />
www.rheinzeitung.de<br />
Fachbereich: <strong>Natur</strong>- <strong>und</strong> Heimatk<strong>und</strong>e<br />
www.lava-dome.de Werner Sidowski, Hochstr.77, 32120 Hiddenhausen<br />
www.mayen.de Verantwortlich: Die Autoren der einzelnen Beiträge<br />
Dort ist sie !!!<br />
Quellen- <strong>und</strong> Literaturhinweise<br />
Wo kommt sie denn weg ?<br />
57
Auf<br />
2 0 0 9<br />
am Niederrhein<br />
Wiedersehen<br />
58