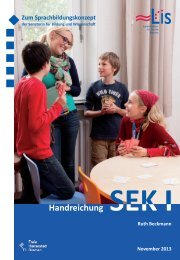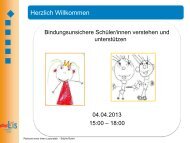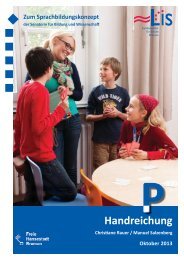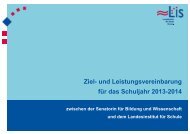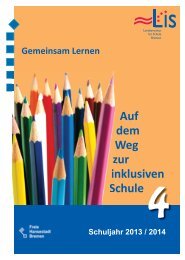Universität zu Köln - LIS - Bremen
Universität zu Köln - LIS - Bremen
Universität zu Köln - LIS - Bremen
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Köln</strong><br />
Institut für deutsche Sprache und Literatur II<br />
Dozentin: Prof. Dr. Christine Garbe<br />
Abb.1 Abb.2<br />
Bausteine <strong>zu</strong> einem gender-sensiblen und<br />
entwicklungsorientierten Lesecurriculum<br />
Fortbildung „Leseförderung für Mädchen UND Jungen – aber wie?“<br />
Landesinstitut für Schule, <strong>Bremen</strong>, 27.9.2012<br />
Abb.3 1<br />
Abb.4<br />
Abb.5 Abb.6
Gliederung des Vortrages<br />
� Teil I: Grundlagen eines gendersensiblen Lesecurriculums<br />
� 1.Ein didaktisches Modell der Lesekompetenz und eine<br />
Systematik schulischer Maßnahmen <strong>zu</strong>r Leseförderung<br />
(Rosebrock & Nix)<br />
2<br />
2. Die Entwicklungs-/Erwerbsperspektive: Ein Erwerbsmodell<br />
der Lesekompetenz (Graf; Garbe & Holle)<br />
� Teil II: Umrisse eines Curriculums <strong>zu</strong>r<br />
entwicklungsorientierten und gendersensiblen Leseförderung<br />
� Leitfrage: Welches sind die wichtigsten Ziele und Maßnahmen<br />
<strong>zu</strong>r Leseförderung in den verschiedenen Entwicklungsphasen?<br />
� 1. Plateau 1: Vorschulische Entwicklung (0 – 6 Jahre)<br />
� 2. Plateau 2: Grundschule bis Vorpubertät (7-12 Jahre)<br />
� 3. Plateau 3: Pubertät und Adoleszenz (13-18 Jahre)<br />
Genderspezifische Leseförderung<br />
27.9.12
1. Ein didaktisches Modell der Lesekompetenz<br />
Rosebrock & Nix 2008, S. 16<br />
3 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
1. Literaturhinweis<br />
� Das wichtigste Buch <strong>zu</strong> den<br />
Methoden einer systematischen<br />
Leseförderung in der Schule:<br />
�Rosebrock, Cornelia; Nix, Daniel<br />
(2008): Grundlagen der Lesedidaktik<br />
und der systematischen<br />
schulischen Leseförderung,<br />
Baltmannsweiler:<br />
Schneider Hohengehren<br />
�(5. Aufl. 2012)<br />
4 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
1. Eine Systematik der Dimensionen schulischer<br />
Leseförderung<br />
Dekodierübungen<br />
auf<br />
Wortebene<br />
Automatisierung<br />
der<br />
Worterkennung(hierarchieniedriger<br />
Bereich)<br />
Aufbau des<br />
Sichtwortschatzes<br />
Alphabetisierung<br />
Lautleseverfahren<br />
Verbesserung<br />
von<br />
Leseflüssigkeit<br />
Sichtwortschatz<br />
und<br />
Sequenzieren<br />
von Sätzen<br />
Deutschunterricht<br />
plus<br />
Fachunterricht<br />
Vielleseverfahren<br />
Steigerung<br />
der<br />
Leseleistungen<br />
und der<br />
Lesemotivation<br />
Selbststeuerung<br />
auf<br />
Prozessebene,<br />
Selbstbild als<br />
LeserIn<br />
Deutschunterricht<br />
plus<br />
Schulkultur<br />
Lesestrategien<br />
trainieren<br />
Verbesserung<br />
des<br />
Leseverstehens<br />
metakognitive<br />
Steuerung,<br />
Überprüfen<br />
von Leseprozessen<br />
Deutschunterricht<br />
plus<br />
Fachunterricht<br />
Sachtextlektüreunterstützen<br />
domänenspezifisches<br />
Sprach-,<br />
Text- und<br />
Weltwissen<br />
„Top-down“-<br />
Leistungen<br />
beim<br />
Textverstehen<br />
Fachunterricht<br />
plus<br />
Deutschunterricht<br />
5 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12<br />
Leseanimation<br />
Motivationssteigerung<br />
und<br />
Selbststeuerung<br />
indirekte<br />
(prozessferne)<br />
Förderung;<br />
Selbstbild als<br />
LeserIn<br />
Schulkultur<br />
plus<br />
Deutschunterricht<br />
Literarisches<br />
Lesen<br />
unterstützen<br />
Textsortenkenntnis,<br />
Vertiefung<br />
des Textverstehens,<br />
Intensivierung<br />
der subj.<br />
Beteiligung<br />
Top-down-<br />
Leistungen,<br />
literarischkulturelle<br />
Praxis<br />
Literaturunterricht
Rosebrock & Nix (2008): Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen Leseförderung<br />
Lesestrategien<br />
Für: SchülerInnen mit Verstehensproblemen<br />
Formen:<br />
a) Wiederholungs-, Ordnungs- und<br />
Elaborationsstrategien<br />
b) Metakognitive Strategien<br />
literarisches<br />
Lesen unterstützen<br />
Für: alle SchülerInnen<br />
Formen:<br />
a) Handlungs- und produktionsorientierter<br />
Literaturunterricht<br />
b) traditionell-offene Unterrichtsgespräche<br />
(vgl. Ohlsen 2008), z.B. das Literarische<br />
Unterrichtsgespräch nach Härle (2004)<br />
6<br />
Prozessebene<br />
• Wort- u. Satzidentifikation<br />
• lokale Kohärenz<br />
• globale Kohärenz<br />
• Superstrukturen<br />
erkennen<br />
• Darstellungsstrategien<br />
identifizieren<br />
Subjektebene<br />
Selbstkonzept als<br />
(Nicht-)LeserIn<br />
• Wissen<br />
• Beteiligung<br />
• Motivation<br />
• Reflexion<br />
Soziale Ebene<br />
Anschlusskommunikation<br />
• Familie<br />
• Schule<br />
• Peers<br />
• Kulturelles Leben<br />
Lautleseverfahren<br />
Für: SchülerInnen mit Problemen auf der hierarchieniedrigeren<br />
Prozessebene und mit mangelhafter Leseflüssigkeit<br />
Formen:<br />
a) wiederholtes Lautlesen b) begleitendes Lautlesen<br />
Sachtextlektüre unterstützen<br />
Für: alle SchülerInnen, Verstehen von Sachtexten,<br />
Lernen an Texten<br />
Formen:<br />
a) Aufbau von Vorwissen<br />
b) Aufbau von Textsortenwissen<br />
Vielleseverfahren<br />
Für: schwache und buchferne LeserInnen<br />
Formen: z.B.. Leseolympiade, Stille Lesezeiten etc.<br />
Leseanimation<br />
Für: angemessen Lesekompetente, aber nicht<br />
motivierte SchülerInnen<br />
Formen: Ansatz an 3 Ebenen<br />
a) Deutschunterricht (Leseecke, Vorlesen, etc.)<br />
b) Schulöffentlichkeit (Lesecafes, Projekttage etc.)<br />
c) öffentliche Institutionen (Bibliotheken, Lesungen)<br />
Rosebrock, Cornelia; Nix, Daniel (2008): Grundlagen der Lesedidaktik und der systematischen Leseförderung. 2., korrigierte Auflage Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
2. Ein Modell gelingender Lesesozialisation<br />
aus der Lesebiografieforschung<br />
7 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
2. Ein Erwerbsmodell der Lesekompetenz<br />
(Garbe & Holle 2006)<br />
Vorschulalter /<br />
frühe Kindheit<br />
Familie /<br />
Kindergarten<br />
Kindheit<br />
Grundschule Weiterführende<br />
Schulen<br />
Adoleszenz Erwachsenenalter<br />
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Jahre<br />
Plateau der Emergenz / Interpersonalität<br />
emergierende<br />
Literalität /<br />
interpersonale<br />
Literarität<br />
„Wir“<br />
Plateau der Heuristik / Autonomisierung<br />
heuristische<br />
Literalität /<br />
autonome<br />
Literarität<br />
„Ich“<br />
Plateau der Konsolidierung /<br />
Ausdifferenzierung<br />
funktionale Literalität /<br />
diskursive Literarität<br />
„die anderen“<br />
8 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12<br />
Beruf / Studium
2. Phasen der Lese-Entwicklung<br />
und Plateau-Überlappungen<br />
Unterstütztes<br />
Lesen<br />
Selbstständiges<br />
Erlesen<br />
Flüssiges /<br />
strategieorient.<br />
Lesen<br />
Adaptives /<br />
urteilsfähiges<br />
Lesen<br />
KG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13<br />
9 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
Plateau 1: „WIR lesen <strong>zu</strong>sammen und ich spiele mit“<br />
(erwachende Literalität / interpersonale Literarität)<br />
� Übergang Mündlichkeit - Schriftlichkeit‚ „prä- und paraliterarische<br />
Kommunikation“, unterstütztes Lesen:<br />
Entwicklungsaufgaben<br />
� (Familie, Kindergarten, Schule bis 2. Schuljahr)<br />
� Erwachende Literalität: Situations unabhängiges mündliches Erzählen, Entdecken<br />
des alphabetischen Prinzips<br />
� Interpersonale Literarität: (Schrift-) Sprache als Medium <strong>zu</strong>m Spielen,<br />
Phantasieren, Symbolisieren von Emotionen<br />
� Die Kinder können selbst noch nicht lesen, machen aber in Vorlese- und<br />
Erzählsituationen relevante Erfahrungen mit schriftlichen Texten und erlernen<br />
das Lesen im schulischen Erstunterricht. Lese-Erfahrungen <strong>zu</strong> sammeln ist auf<br />
diesem Plateau nur mit ‚kompetenten Anderen‘ und als Spiel möglich: „WIR<br />
lesen <strong>zu</strong>sammen und ich spiele mit.“<br />
10 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
Plateau 2: „ICH kann allein alles lesen, was mich interessiert“<br />
(heuristische Literalität / autonome Literarität)<br />
�Übergang Dekodieren - Leseflüssigkeit‚ lustvolle und<br />
extensive Kinderlektüre, selbstbestimmtes Lesen:<br />
Entwicklungsaufgaben<br />
�(Familie, peer group, Schule 1. bis ca. 6. Schuljahr)<br />
�Heuristische (= entdeckende) Literalität: Erlernen schriftsprachlicher<br />
Konventionen, selbstständiges Lesen von Texten; Automatisierung der<br />
elementaren Lesevorgänge (Lesegeschwindigkeit und –genauigkeit),<br />
Übergänge Lesenlernen - Lernen mit Hilfe des Lesens (learning to read<br />
– reading to learn)<br />
�Autonome Literarität: Erlebnisqualität des ‚eintauchenden‘ lustvollen<br />
Lesens <strong>zu</strong>r Phantasiebefriedigung, Ausbildung eigener Lesevorlieben und<br />
Genrepräferenzen, Fähigkeit <strong>zu</strong>r „Vorstellungsbildung“ mit Texten:<br />
Projektion, Empathie. Auf diesem Plateau werden <strong>zu</strong>gleich wichtige<br />
lebensgeschichtliche Motivationen <strong>zu</strong>m lustvollen privaten Lesen<br />
ausgebildet, die den Kern eines stabilen Lese-Selbstkonzeptes darstellen.<br />
11 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
Plateau 3: „Ich erlese mich und meine Welt im Spiegel der<br />
ANDEREN“<br />
(funktionale Literalität / diskursive Literarität)<br />
� Übergang flüssiges – adaptives / strategisches Lesen;<br />
Lesen <strong>zu</strong>r Identitätsbildung und Weltaneignung;<br />
Reflexion und Anschlusskommunikation:<br />
Entwicklungsaufgaben im 7.-13. Schuljahr<br />
� Funktionale Literalität: Aneignung und Konsolidierung von<br />
kognitiven und metakognitiven Lesestrategien im Rahmen<br />
privater Interessen sowie fachunterrichtlicher (und<br />
beruflicher) Anforderungen – Lesen in allen Unterrichtsfächern<br />
� Diskursive Literarität: Texte als Medium <strong>zu</strong>r Identitätsbildung<br />
und Weltorientierung; Wertschät<strong>zu</strong>ng der Teilnahme<br />
an der literarischen Kultur und Geselligkeit.<br />
12 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
Teil II: Umrisse eines Curriculums <strong>zu</strong>r<br />
gendersensiblen Leseförderung<br />
�Die gute Nachricht vorweg:<br />
�Eine aktuelle britische Studie von<br />
Carrington, Tymms und Merrell (2005a<br />
und b) kommt <strong>zu</strong> dem Schluss, „dass das<br />
Geschlecht der Lehrkräfte sich nicht<br />
signifikant auf die Leistung von Jungen<br />
bzw. Mädchen auswirkt.“<br />
�Die AutorInnen resümieren:<br />
„Vergesst Gender! Ob eine<br />
Lehrkraft männ-lich oder weiblich<br />
ist, spielt keine Rolle!“ (Carrington et<br />
al. 2005b)<br />
13 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
Gender-übergreifende Ziele und genderspezifische<br />
Maßnahmen<br />
�Die zentralen Ziele einer nachhaltigen Leseförderung sind<br />
prinzipiell gender-übergreifend: Verbesserung der Lesekompetenz<br />
durch Leseflüssigkeit und strategisches Lesetraining,<br />
Entwicklung von Engagement (Motivation) für das<br />
Lesen und Aufbau eines stabilen Lese-Selbstkonzeptes. Die<br />
Mittel und Wege dahin sind jedoch teilweise genderspezifisch:<br />
hinsichtlich der Lesestoffe wie auch der<br />
„authentischen Leseanlässe“, die die Schule bereitstellen<br />
muss.<br />
14<br />
Genderspezifische Leseförderung<br />
27.9.12
Teil II: Umrisse eines Curriculums <strong>zu</strong>r<br />
systematischen Leseförderung<br />
� Ziel aller Fördermaßnahmen ist, dass jeder Junge /<br />
jedes Mädchen ein engagierter Leser / eine<br />
engagierte Leserin wird und ein stabiles<br />
Selbstkonzept als LeserIn entwickeln kann.<br />
15<br />
Genderspezifische Leseförderung<br />
27.9.12
1. Maßnahmen einer gendersensiblen<br />
Leseförderung auf Plateau 1<br />
� Kindern beider Geschlechter Zugänge <strong>zu</strong> (sprach-)<br />
symbolischen Welten eröffnen<br />
� „Situations-abstraktes“ Sprechen praktizieren:<br />
Geschichten erzählen<br />
� (Prä-)literarische Kommunikation: Kniereiterverse,<br />
Kindergedichte und –lieder, Sprachspiele und Rätsel<br />
� „gemeinsames“ Bilderbuch-Lesen<br />
� Geschichten vorlesen und darüber sprechen<br />
� Beteiligung von Vätern und männlichen Erziehern<br />
���� Geschichten und Lesestoffe auswählen, die auch<br />
Jungen mögen<br />
16 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
2. Maßnahmen einer gendersensiblen<br />
Leseförderung auf Plateau 2<br />
� In der Erwerbsperspektive (Entwicklungsperspektive)<br />
ist unter den gegenwärtigen soziokulturellen<br />
und medialen Bedingungen der<br />
Zeitraum der mittleren Kindheit und<br />
Vorpuber-tät (Klasse 3 – 6, Alter: 8 – 12/13<br />
Jahre) entscheidend:<br />
� Nach dem Erwerb der Schriftsprache (Klasse<br />
1-2) und vor der traditionellen (Buch-)“Lesekrise“<br />
der Pubertät kommt es darauf an, das<br />
Lesen (in unterschiedlichen Medien und<br />
Modalitäten) als eine stabile kulturelle Praxis<br />
<strong>zu</strong> verankern!<br />
17<br />
Genderspezifische Leseförderung<br />
27.9.12
2. Viele Jungen (und Mädchen) entwickeln in der<br />
Kindheit keine stabile Lesepraxis mehr<br />
� Die Schule muss darum – im Verbund mit den<br />
Familien und unter Nut<strong>zu</strong>ng des (wachsenden)<br />
Peer-Einflusses – daran arbeiten, dass in diesem<br />
kritischen „Entwicklungsfenster“ reichhaltige und<br />
für beide Geschlechter attraktive literale<br />
Erfahrun-gen gemacht werden können!<br />
� Die wachsende Medienkonkurrenz durch<br />
auditive, audiovisuelle und digitale Medien führt<br />
da<strong>zu</strong>, dass die in dieser Entwicklungsphase<br />
grundlegenden Automatisierungsprozesse beim<br />
Lesen heut<strong>zu</strong>tage nicht mehr naturwüchsig<br />
ausgebildet werden!<br />
18<br />
Genderspezifische Leseförderung<br />
27.9.12
2. Maßnahmen einer gendersensiblen<br />
Leseförderung auf Plateau 2<br />
� In den Klassenstufen 3 bis 6 muss „Leseflüssigkeit“<br />
erworben werden, das heißt die elementaren<br />
Lesevorgänge müssen so weit automatisiert werden, dass<br />
müheloses Lesen auch umfangreicher Texte möglich wird.<br />
� � Training durch Lautleseverfahren<br />
� In den Klassenstufen 3 bis 6 sollte das autonome und<br />
lustvolle Lesen <strong>zu</strong>r Phantasiebefriedigung entdeckt werden<br />
können.<br />
� Training durch Vielleseverfahren<br />
� Da<strong>zu</strong> Lesestoffe auswählen, die auch Jungen<br />
mögen<br />
19 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
2. Leseflüssigkeit trainieren durch<br />
Lautleseverfahren<br />
� Nach Rosebrock & Nix 2008 (S. 39) umfasst<br />
Leseflüssigkeit vier Dimensionen:<br />
1. die exakte Dekodierfähigkeit von Wörtern;<br />
2. die Automatisierung der Dekodierprozesse;<br />
3. eine angemessen schnelle Lesegeschwindigkeit;<br />
4. die Fähigkeit <strong>zu</strong>r sinngemäßen Betonung des gelesenen<br />
Satzes, also <strong>zu</strong> einem ausdrucksstarken Vorlesen.<br />
� „Reading fluency“ gilt in der angelsächsischen<br />
Leseforschung als „bridge between decoding and<br />
comprehension“ – Dieses Element fehlte bislang in<br />
der deutschen Lesedidaktik!<br />
20 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
2. Leseflüssigkeit trainieren durch Lautlese-<br />
Verfahren<br />
� Zwei Grundformen von Lautleseverfahren:<br />
� Wiederholtes Lautlesen („Repeated Reading“)<br />
� Beispiel: A. Bertschi-Kaufmann u.a.: Lesen – Das Training<br />
(2006). Trainingsteil „Lesegeläufigkeit“<br />
� - Kreative Variante: Das Lesetheater (D. Nix 2006)<br />
� 2. Begleitendes Lautlesen („Paired Reading“)<br />
� Beschreibung: Rosebrock & Nix 2008, S. 42<br />
� Beispiel: Lautlese-Tandems, ebd., S. 43 f.<br />
� ACHTUNG: „Lautleseverfahren“ haben NICHTS mit dem<br />
lesedidaktisch äußerst problematischen Reihum-Vorlesen<br />
in der Klasse <strong>zu</strong> tun!<br />
21 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
Ein Trainingsprogramm <strong>zu</strong>m Wiederholten<br />
Lautlesen<br />
�Andrea Bertschi-Kaufmann u.a.:<br />
�Lesen – Das Training I.<br />
Lesefertigkeiten –<br />
Lesegeläufigkeit – Lesestrategien.<br />
Schülermappe mit 4 Arbeitsheften,<br />
5. und 6. Schuljahr<br />
�(Teil II: 7. und 8. Schuljahr)<br />
�Friedrich Verlag 2006,<br />
�14,95 Euro<br />
22 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
Ein Trainingsprogramm <strong>zu</strong>m begleitenden<br />
Lautlesen<br />
�Cornelia Rosebrock, Andreas<br />
Gold, Daniel Nix, Carola<br />
Rieckmann:<br />
�Leseflüssigkeit fördern.<br />
Lautleseverfahren für die Primarund<br />
Sekundarstufe. (Mit CD-<br />
ROM)<br />
�Klett-Kallmeyer / Praxis Deutsch<br />
Februar 2011<br />
�29,95 Euro<br />
23<br />
Genderspezifische Leseförderung<br />
27.9.12
2. Stabile Lesegewohnheiten und Lese-<br />
Selbstkonzept unterstützen<br />
� In dieser Phase der Leseentwicklung werden lesekulturelle<br />
Haltungen und Fähigkeiten erworben, die<br />
für ein stabiles Selbstkonzept als (Buch-)LeserIn<br />
grundlegend sind:<br />
� Lesemedien entsprechend den eigenen Interessen<br />
und Fähigkeiten aussuchen können<br />
� Ausdauer und Engagement auch für längere Lektüre<br />
aufbringen können<br />
� Den Leseprozess im Hinblick auf das Verstehen und<br />
die emotionale Beteiligung evaluieren und<br />
Handlungsoptionen verfügbar haben<br />
� Sich über Leseerfahrungen austauschen können<br />
24 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
2. Stabile Lesegewohnheiten und Lese-<br />
Selbstkonzept unterstützen<br />
Im Frankfurter Projekt „Förderung eigenständigen<br />
Lesens“ (Rosebrock, Rieckmann & Jörgens) wurden vier<br />
Felder lesekultureller Fähigkeiten modelliert, die man<br />
insbeson-dere mit Nicht- und Weniglesern einüben muss:<br />
�Strategien <strong>zu</strong>r Buchauswahl<br />
�Strategien <strong>zu</strong>r Moderation des Leseprozesses<br />
�Wissen um Leseinteressen und Lesevorlieben<br />
�Personale Verarbeitung von Texten<br />
� Literaturhinweis: Ray Reutzel et al. (2008): Scaffolded Silent<br />
Reading: A Complement to Guided Repeated Oral Reading That<br />
Works! In: The Reading Teacher 62/3, 194-207<br />
25 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
2. Stabile Lesegewohnheiten und Lese-<br />
Selbstkonzept unterstützen<br />
� Der Aufbau stabiler Lesegewohnheiten und eines<br />
positiven Lese-Selbstkonzeptes wird unterstützt<br />
durch Viellese-Verfahren und Verfahren der Lese-<br />
Animation.<br />
� Viellese-Verfahren zielen auf die Steigerung der<br />
Lesequantität, z.B.: Jedes Kind soll pro Woche 1<br />
Buch lesen / 100 Seiten lesen.<br />
� Beispiele:<br />
� Die Lese-Olympiade nach R. Bamberger (2000, s.<br />
Rosebrock & Nix, S. 47 f.<br />
� Sustained Silent Reading: freie stille Lesezeiten /<br />
Lesestunden während des Unterrichts (ebd.)<br />
26 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
Publikationen <strong>zu</strong> Viellese-Programmen<br />
Richard Bamberger: „Erfolgreiche Leseerziehung in Theorie und<br />
Praxis“, Wien 2000, proklamierte die „Lese- und<br />
Lernolympiade“ nach dem Motto: „Lesen lernt man durch<br />
Lesen.“ Reinhardt Lange führte sie 2002 an der Geschwister-<br />
Scholl-GS Göttingen ein.<br />
Reinhardt Lange: Die Lese- und Lernolympiade.<br />
Aktive Leseerziehung mit dem Lesepass nach<br />
Richard Bamberger. Leitfaden für eine erfolgreiche<br />
Umset<strong>zu</strong>ng. Baltmannsweiler: Schneider 2007.<br />
27 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
Modifikation: Das „große Kilometer-Lesen“ an<br />
Frankfurter Hauptschulen<br />
�Beschreibung: Rosebrock &<br />
Nix 2008, S. 57<br />
�Neue Publikation da<strong>zu</strong>:<br />
�Carola Rieckmann:<br />
Leseförderung in sechsten<br />
Hauptschulklassen. Zur<br />
Wirksamkeit eines<br />
Vielleseverfahrens.<br />
Baltmannsweiler: Schneider<br />
Verlag Hohengehren 2010.<br />
28<br />
Genderspezifische Leseförderung<br />
27.9.12
2. Stabile Lesegewohnheiten und Lese-<br />
Selbstkonzept unterstützen<br />
Verfahren der Lese-Animation zielen darauf, Lesefreude<br />
und Lesemotivation <strong>zu</strong> erzeugen durch eine<br />
„Verführung <strong>zu</strong>m Lesen“.<br />
Beispiele:<br />
�Bücherkisten im Klassenraum, Klassenbibliotheken<br />
�Autorenlesungen, Lesewochen, Lesenächte<br />
�Lesekultur als Schulprofil, Zusammenarbeit mit<br />
außerschulischen Einrichtungen<br />
�Vorlesewettbewerbe, Leseprojekte, „Mein selbstgemachtes<br />
Buch“ u.v.a.<br />
29 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
2. Gender-sensible Leseförderung ist in<br />
dieser Phase besonders wichtig!<br />
Viellese-Verfahren und Verfahren der Lese-<br />
Animation müssen ein breites Angebot an<br />
Lesestoffen bereitstellen (für offenen Unterricht /<br />
unterrichtsübergreifende Leseförderung), die den<br />
geschlechtsspezifischen Lesepräferenzen von<br />
Mädchen und Jungen Rechnung tragen.<br />
�ACHTUNG:<br />
In dem hier angesprochenen Alter (8-14 Jahre)<br />
agieren Mädchen und Jungen besonders geschlechterstereotyp<br />
(i.S. des „doing Gender“). Dies sollte in<br />
der Entwicklungsperspektive (pragmatisch) akzeptiert<br />
werden!<br />
30 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
3. Maßnahmen einer gendersensiblen<br />
Leseförderung auf Plateau 3<br />
� Lese- und Lernstrategien trainieren: funktionales<br />
Lesen in allen Unterrichtsfächern<br />
� Sachtextlektüre unterstützen: fachspezifisches<br />
Vokabular, Textstrukturwissen und Weltwissen<br />
ausbilden<br />
� Literarisches Lesen unterstützen: Textsorten-<br />
Kenntnis / Gattungswissen, Vertiefung des Textverstehens,<br />
kommunikative und kreative Aneignung<br />
von Literatur<br />
� Quelle: Rosebrock & Nix, Grundlagen der<br />
Lesedidaktik (2008), Kap. 5, 6 und 8<br />
31 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12
Fazit: Genderübergreifende und<br />
genderspezifische Leseförderung<br />
Lesekompetenzen müssen in allen drei (oder fünf) Dimensionen<br />
systematisch gefördert werden:<br />
32<br />
1. Kognitionen<br />
� 2./3. Emotionen / Motivation<br />
� 4./5. Reflexion / Anschlusskommunikation.<br />
Kognitive Lesekompetenzen müssen systematisch und fächerübergreifend<br />
trainiert werden.<br />
� Plateau 1: Dekodierfähigkeiten erwerben / Alphabetisierung<br />
� Plateau 2: Training von Leseflüssigkeit, z.B. durch Lautleseverfahren<br />
� Plateau 3: Kognitive und metakognitive Lesestrategien erwerben.<br />
Das Training kognitiver Lesekompetenzen kann genderübergreifend<br />
erfolgen; bei Textauswahl und Methodik der<br />
Förderung können Gender-Differenzen vernachlässigt werden.<br />
Genderspezifische Leseförderung<br />
27.9.12
Fazit: Genderübergreifende und<br />
genderspezifische Leseförderung<br />
� Für den Aufbau von Lesemotivation und die Unterstüt<strong>zu</strong>ng<br />
positiver Emotionen beim Lesen ist es wichtig, eine Passung<br />
von Leser/in und Text <strong>zu</strong> gestalten. Dies ist möglich<br />
innerhalb von Verfahren der Leseanimation sowie von<br />
Vielleseverfahren, die insbesondere auf Plateau 2<br />
erfolgversprechend sind.<br />
Da<strong>zu</strong> müssen Lesestoffe in der Schule radikal verändert /<br />
erweitert werden:<br />
�Für Vielleseverfahren muss ein breites und gender-gerechtes<br />
Angebot an Büchern u.a. Printmedien bereit gestellt werden<br />
�„Authentische Textwelten“ beider Geschlechter sollten<br />
erkundet und im Unterricht aufgenommen werden.<br />
�Multiliteracies / aktuelle Medienformate sollten in der Schule<br />
verankert werden.<br />
33<br />
Genderspezifische Leseförderung<br />
27.9.12
Fazit: Genderübergreifende und<br />
genderspezifische Leseförderung<br />
Die Reflexion und Kommunikation über Lesestoffe findet auf allen<br />
drei Plateaus statt.<br />
� Plateau 1: Vorlese-Dialoge und „gemeinsames“ Bilderbuch-Lesen<br />
mit einem kompetenten Anderen des eigenen oder anderen<br />
Geschlechts (Genderspezifik ist nachgeordnet)<br />
� Plateau 2: Kommunikation über Lektüre und Medien in der peer<br />
group: In der späten Kindheit und Pubertät sind peer-Beziehungen<br />
stark gender-orientiert („Die peer group als Gender-Polizei“);<br />
darum sollten hier Gelegenheiten <strong>zu</strong> gender-spezifischer<br />
Anschlusskommunikation gegeben werden.<br />
� Plateau 3: In der Adoleszenz findet eine Annäherung beider<br />
Geschlechter statt; darum kann nun – bspw. im „Literarischen<br />
Gespräch“ im Deutschunterricht - wieder gender-übergreifend<br />
gearbeitet werden.<br />
34<br />
Genderspezifische Leseförderung<br />
27.9.12
� Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!<br />
� Prof. Dr. Christine Garbe<br />
� Institut für deutsche Sprache und Literatur II<br />
� <strong>Universität</strong> <strong>zu</strong> <strong>Köln</strong><br />
� Email:<br />
� christine.garbe@uni-koeln.de<br />
35 Genderspezifische Leseförderung 27.9.12