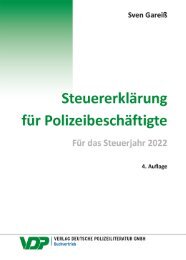Bearbeitung von Jugendsachen - Leseprobe
Einsatzkräfte der Polizei kommen im täglichen Dienst ständig aus vielfältigen Anlässen mit jungen Menschen in Kontakt. Das dabei notwendige Einfühlungsvermögen, das sichere rechtlich fundierte Einschreiten sowie die Durchführung der erforderlichen präventiven und repressiven Maßnahmen setzen fundierte Kenntnisse sowohl zur Phänomenologie, zu den Ursachen und der Entwicklung der Kinder- und Jugenddelinquenz als auch zu den spezifischen Bestimmungen des Jugendgerichtsgesetzes und der entsprechenden Polizeidienstvorschrift (PDV 382) voraus. Mit diesem Studienbrief stellen die Autoren die wesentlichen Tätigkeitsfelder polizeilicher Jugendarbeit – Kriminalprävention, Jugendschutz durch Gefahrenabwehr, Strafverfolgung von Jugendkriminalität – dar und rüsten Polizeibeamte mit dem dazu notwendigen Grundwissen aus. Der praxisorientierte Schwerpunkt dieses Studienbriefes liegt in der Bereitstellung von Handlungsanleitungen für die im operativen Dienst und im Ermittlungsdienst der Polizei tätigen Beamtinnen und Beamten.
Einsatzkräfte der Polizei kommen im täglichen Dienst ständig aus vielfältigen Anlässen mit jungen Menschen in Kontakt. Das dabei notwendige Einfühlungsvermögen, das sichere rechtlich fundierte Einschreiten sowie die Durchführung der erforderlichen präventiven und repressiven Maßnahmen setzen fundierte Kenntnisse sowohl zur Phänomenologie, zu den Ursachen und der Entwicklung der Kinder- und Jugenddelinquenz als auch zu den spezifischen Bestimmungen des Jugendgerichtsgesetzes und der entsprechenden Polizeidienstvorschrift (PDV 382) voraus.
Mit diesem Studienbrief stellen die Autoren die wesentlichen Tätigkeitsfelder polizeilicher Jugendarbeit – Kriminalprävention, Jugendschutz durch Gefahrenabwehr, Strafverfolgung von Jugendkriminalität – dar und rüsten Polizeibeamte mit dem dazu notwendigen Grundwissen aus.
Der praxisorientierte Schwerpunkt dieses Studienbriefes liegt in der Bereitstellung von Handlungsanleitungen für die im operativen Dienst und im Ermittlungsdienst der Polizei tätigen Beamtinnen und Beamten.
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Definition<br />
Besonderheiten des jugendlichen Rechtsbrechers einfließen zu lassen und neben<br />
der Tat vor allem die Täterpersönlichkeit zu berücksichtigen.<br />
Kreuzer führt dazu aus: „Gerade in dieser Altersstufe (14 bis 21, der Verf.) muss es<br />
darum gehen, junge Menschen behutsam an die Strafrechtsordnung für Erwachsene<br />
heranzuführen, den Übergang in die volle strafrechtliche Verantwortlichkeit<br />
gleitend zu gestalten, Erziehung an die Stelle des Strafens treten zu lassen oder<br />
mit diesem bestmöglich zu verbinden. Die Verquickung vorrangig jugendhilferechtlicher<br />
mit strafenden Bestandteilen in Verfahren und Rechtsfolgen hat sich<br />
bewährt.“ 16<br />
Die Definition des Jugendalters durch Altersgrenzen ist rechtlich geboten, aber<br />
sie gibt nicht ausreichend Antwort auf die Frage nach der Entwicklungsreife der<br />
Person.<br />
So kann zum Beispiel das „Alter der Person“ vom eigentlichen „Lebensalter“ erheblich<br />
abweichen, da der Prozess der biologischen Entwicklung des Menschen<br />
individuell verschieden abläuft.<br />
Diese Betrachtungsweise führte zu abgestuften juristischen Reaktionsmöglichkeiten<br />
auf Kinder- und Jugenddelinquenz.<br />
Eine untere Altersbegrenzung findet die Jugendkriminalität mit der Regelung des<br />
§ 19 Strafgesetzbuch (StGB): „Schuldunfähig ist, wer bei Begehung der Tat noch<br />
nicht vierzehn Jahre alt ist.“<br />
Des Weiteren verweist das StGB mit § 10 auf Sondervorschriften für Jugendliche<br />
und Heranwachsende. Diese Sondervorschriften sind im Jugendgerichtsgesetz<br />
(JGG) als Spezialgesetz hinsichtlich der Rechtsfolgen und einiger Voraussetzungen<br />
bezüglich der Schuldfähigkeit verankert.<br />
Gemäß den §§ 1, 3 und 105 JGG sind strafrechtlich folgende Altersgruppen zu<br />
unterscheiden:<br />
14 bis unter 18 Jahre: Jugendliche,<br />
18 bis unter 21 Jahre: Heranwachsende.<br />
(Siehe auch die Ausführungen zu Kapitel IV, Jugendstrafverfahren.)<br />
<strong>Leseprobe</strong><br />
Streng genommen dürfte sich der Begriff Jugendkriminalität nur auf die Gesamtheit<br />
der jungen Menschen im Altersbereich zwischen 14 bis unter 18 Jahren<br />
beziehen. Das Jugendgerichtsgesetz lässt durch § 105 aber die Anwendung des<br />
Jugendstrafrechts unter bestimmten Voraussetzungen auch für Heranwachsende<br />
zu. Jugendkriminalität im engeren Sinne bezieht sich somit auf alle strafbaren<br />
Handlungen der 14- bis unter 18-Jährigen. In Statistiken und Analysen zur Jugendkriminalität<br />
werden die Heranwachsenden mit einbezogen, da deren Straftaten<br />
häufig als Jugendverfehlungen bewertet werden.<br />
Kinder und Jugendliche bis unter 18 Jahre gelten als Minderjährige. Ab dem<br />
vollendeten 18. Lebensjahr gilt die Volljährigkeit, Deliktsfähigkeit und volle Geschäftsfähigkeit<br />
(§§ 2, 828 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), § 3 JGG).<br />
Bei der <strong>Bearbeitung</strong> <strong>von</strong> <strong>Jugendsachen</strong> ist die strafrechtliche Verantwortungsreife<br />
(§ 3 JGG) der Jugendlichen zu prüfen und festzustellen, ob in der Tat schädliche<br />
Neigungen hervorgetreten sind (§ 17 JGG).<br />
16 Kreuzer 2008, S. 124.<br />
13