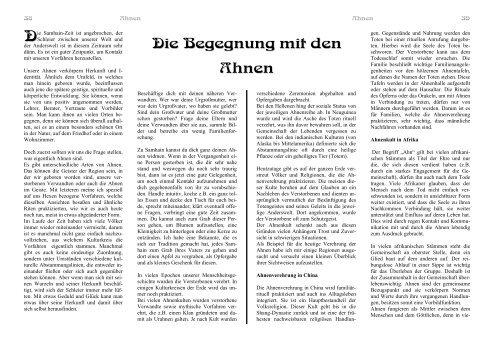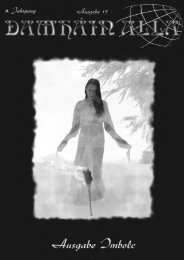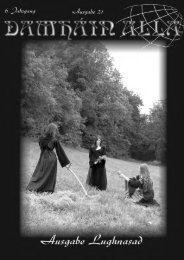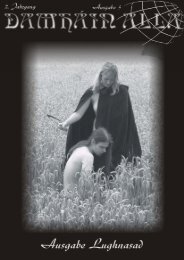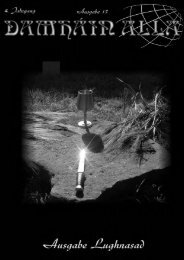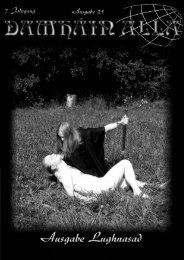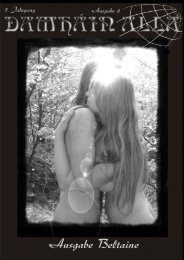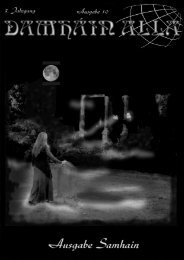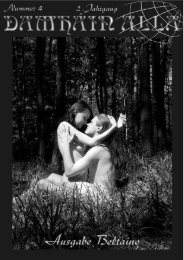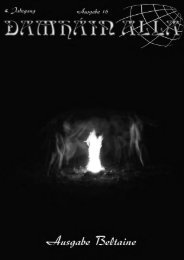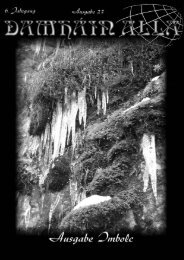Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
20 Die indischen Satis Die indischen Satis 21<br />
Tod und Sterben zählen zu den wichtigsten<br />
Ereignissen, die es gut vorzubereiten gilt.<br />
Bereits der Sterbende sollte sich möglichst<br />
gereinigt und mit positiven Gedanken dem<br />
Tod stellen.<br />
Stirbt jemand durch einen Unfall, Gewalt<br />
oder Selbstmord aus Verzweiflung, dann<br />
spricht man von einem „schlimmen Tod“.<br />
Dann kann es sein, dass er eine rastlose Seele<br />
bleibt, dasselbe gilt, wenn die Totenrituale<br />
nicht korrekt ausgeführt wurden.<br />
Nach einem „heldenhaften Tod“, zum Beispiel<br />
Sati, dem Kriegertod oder einem rituellen<br />
Selbstmord, kann der Verstorbene das<br />
Zwischenreich umgehen.<br />
Kinder oder Asketen haben eine Sonderstellung,<br />
denn sie haben ihr negatives Karma<br />
verbraucht. Darum müssen sie auch nicht<br />
verbrannt, d.h. geopfert werden. Für Leprainfizierte<br />
und Pockenerkrankte gilt, dass sie<br />
von der Göttin Śitala gezeichnet wurden,<br />
weil sie zu Lebzeiten nicht ausreichend Opfer<br />
darbrachten.<br />
Das Geschehen selbst<br />
Sobald der Ehemann verstarb, musste die<br />
Hinterbliebene innerhalb weniger Stunden<br />
ihre Entscheidung zum Ausdruck bringen,<br />
da eine Leichenverbrennung traditionellerweise<br />
binnen 24 Stunden durchgeführt wurde.<br />
Hin und wieder wurde das Mitsterben<br />
schon unter den Eheleuten vereinbart. Dennoch<br />
gehörte es zum Brauch, dass die Frau<br />
ihren Entschluss nach dem Tod des Mannes<br />
bekräftigte.<br />
Die meisten Ehefrauen starben auf dem<br />
Scheiterhaufen. Das ist das Resultat der üblichen<br />
Bestattungsweise der Leichenverbrennung.<br />
Es gab Vorrichtungen, von denen<br />
die Frauen in das Feuer sprangen,<br />
manchmal wurden sie auch an die Leiche<br />
des Mannes gebunden oder man schloss sie<br />
in eine Art Hütte auf dem Scheiterhaufen<br />
ein. Sehr oft wird davon berichtet, dass die<br />
Ehefrau den Kopf des Mannes in ihren<br />
Schoß legte.<br />
Oft wurden ihr Nachrichten und Geschenke<br />
für den Toten mitgegeben.<br />
In aller Regel entzündete ein männlicher Angehöriger<br />
oder ein Priester das Feuer, selten<br />
die Frau selbst.<br />
Darstellung eines Sati-Rituals<br />
In manchen Gegenden wurde kein Scheiterhaufen<br />
errichtet, sondern eine Grube mit<br />
brennbaren Materialien gefüllt. Dahinein<br />
sprang die Frau nach dem Entzünden des<br />
Feuers und die Umstehenden warfen Holzklötze<br />
und ähnliches auf sie.<br />
Bei den wenigen Kasten, welche Erdbestattungen<br />
praktizierten, kam es vor, dass die<br />
Ehefrau lebendig begraben wurde. Dazu<br />
setzte sie sich in das Grab des Mannes und<br />
nahm auch hier wieder seinen Kopf in den<br />
Schoß. Das Grab wurde mit Erde bedeckt:<br />
Wurde der Kopf der Frau freigelassen, dann<br />
wurde sie erdrosselt oder es wurde ihr das<br />
Genick gebrochen. In Grüften wurde nicht<br />
bestattet.<br />
Stets waren Priester anwesend. Aus dem<br />
„Mitgehen“ wurde im Prinzip immer eine<br />
feierliche Zeremonie für viele Anwesende<br />
gemacht.<br />
Die Frage nach der (Un-)Freiwilligkeit<br />
Es sollte klar sein, dass sich diese Frage<br />
nicht eindeutig beantworten lässt. Darum<br />
werde ich lediglich einige Gedanken zusammentragen.<br />
Sehr gut dokumentiert ist die Zeit von 1815-<br />
1828, vor dem Verbot der Witwenverbrennung.<br />
Schaut man sich Indien insgesamt an,<br />
stellt man fest, dass etwa jede tausendste<br />
Witwe ihrem Mann in den Tod folgte, wobei<br />
es natürlich große regionale Unterschiede<br />
gab. Schon auf Grund dieser Zahlen kann<br />
nicht von einem generellen Zwang ausgegangen<br />
werden.<br />
Es finden sich in der indischen Literatur<br />
Hinweise und Anregungen für das Praktizieren<br />
des Mitsterbens, allerdings keine Gesetze.<br />
Im Gegenzug gab es relativ viele Gesetze<br />
für das Weiterleben der Hinterbliebenen<br />
nach dem Tod des Ehemannes.<br />
Gab die Frau den Entschluss zum Sterben<br />
nach dem Tod des Mannes bekannt, wurde er<br />
allerdings als endgültig betrachtet und<br />
durchaus auch gewaltsam umgesetzt. Es existieren<br />
zahlreiche Berichte, dass Frauen ins<br />
Feuer zurückgestoßen wurden, wenn sie versuchten<br />
zu fliehen, auch wurde mancherorts<br />
eine Flucht von vornherein zu verhindern<br />
versucht (z.B. durch Festbinden, in eine Hütte<br />
einschließen, mit schweren Gegenständen<br />
bewerfen). Aber ebenso viele Berichte kündeten<br />
vom heroischen Tod der Frauen, die<br />
gelassen, ruhig und stolz in den Tod gingen.<br />
Ich bin der Meinung, dass die Schmerzen<br />
beim Verbrennungstod häufig schlichtweg<br />
unterschätzt wurden und dass eben jene zu<br />
Abbruchversuchen während der Zeremonie<br />
geführt haben. Das mag in der relativen Seltenheit<br />
und in der gleichzeitigen Mystifizierung<br />
des Brauches begründet sein.<br />
Immer wieder wird die schwierige Lage von<br />
indischen Witwen als Argument für einen<br />
gesellschaftlichen Zwang ins Feld geführt.<br />
Das ist zweifellos berechtigt, auch heute<br />
noch steht die Witwe in der indischen Hierarchie<br />
ganz unten. Inzwischen wurde zwar<br />
das Erbrecht zugunsten der Ehefrauen geregelt<br />
und auch eine Wiederverheiratung von<br />
Witwen erlaubt, dennoch wurden und werden<br />
diese Frauen immer noch häufig von ihren<br />
Familien verstoßen und von der Öffentlichkeit<br />
geächtet.<br />
Um die sehr kontrovers diskutierte Frage<br />
nach der Freiwilligkeit einigermaßen zu beantworten,<br />
müsste man die indischen Frauen<br />
selbst zu Wort kommen lassen. Und selbst<br />
dann bekämen wir keine befriedigende Auskunft,<br />
denn während sich Bürgerrechtlerinnen<br />
und Hilfsorganisationen für ein würdiges<br />
Leben der Witwen einsetzen, demonstrieren<br />
gleichzeitig Inderinnen gegen das Verbot<br />
von Sati, so geschehen 1987, anlässlich einer<br />
Witwenverbrennung in Rajasthan.<br />
Seit 1862 ist Sati in ganz Indien offiziell verboten.<br />
Erst seit 1987 steht die Verherrlichung<br />
der Tradition, die Teilnahme an Zeremonien<br />
und die Errichtung von Gedenktempeln unter<br />
Strafe.<br />
Ausgestorben ist Sati nicht.<br />
Quellen:<br />
Styx<br />
www.wikipedia.de (Stand August 2009)<br />
http://wissen.spiegel.de/wissen/ (Stand August<br />
2009)<br />
http://www.geistigenahrung.org/ftopic10140.<br />
html (Stand August 2009)<br />
Sylvia Stapelfeld, Kamakhya - Sati - Mahamaya:<br />
Konzeptionen der Grossen Göttin im<br />
Kalikapurana, 2001<br />
Jörg Fisch, Tödliche Rituale, 1998<br />
Axel Michaels, Der Hinduismus, Geschichte<br />
und Gegenwart, 1998