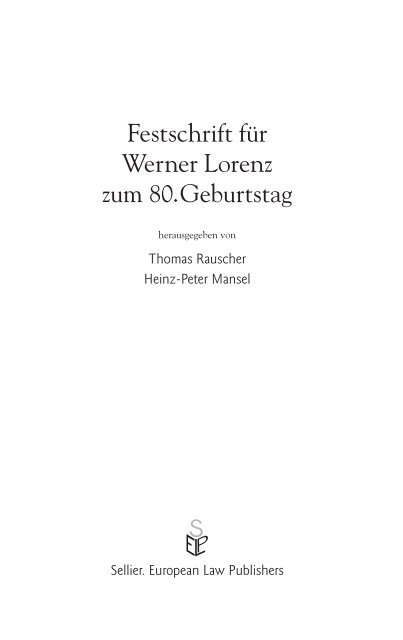Seiten 1-18 Arthur Kaufmann Festschrift.indd - Sellier
Seiten 1-18 Arthur Kaufmann Festschrift.indd - Sellier
Seiten 1-18 Arthur Kaufmann Festschrift.indd - Sellier
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Festschrift</strong> für<br />
Werner Lorenz<br />
zum 80.Geburtstag<br />
herausgegeben von<br />
Thomas Rauscher<br />
Heinz-Peter Mansel<br />
<strong>Sellier</strong>. European Law Publishers
Die Deutsche Bibliothek – CIP-Einheitsaufnahme<br />
<strong>Festschrift</strong> für Werner Lorenz zum 80. Geburtstag / Hrsg.: Thomas Rauscher;<br />
Heinz-Peter Mansel. – München: <strong>Sellier</strong>, 2001<br />
ISBN 3-935808-02-X<br />
© 2001 by <strong>Sellier</strong>. European Law Publishers GmbH, München.<br />
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung<br />
außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages<br />
unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen,<br />
Mikroverfi lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.<br />
Satz: <strong>Sellier</strong>. European Law Publishers GmbH, München. Druck und Bindung: WB-Druck,<br />
Rieden im Allgäu. Gestaltung: Sandra Fehlinger, München. Gedruckt auf säurefreiem,<br />
alterungsbeständigem Papier. Printed in Germany
Die Bedeutung Gustav Radbruchs für die<br />
Rechtsphilosophie beim Ausgang des Kaiserreichs<br />
I. Glückwunsch für Werner Lorenz<br />
<strong>Arthur</strong> <strong>Kaufmann</strong> †<br />
Indem ich diesen Beitrag zu Ehren meines Weggefährten durch viele Jahre<br />
und viele Jahrzehnte hindurch, Werner Lorenz, niederschreibe, gehen meine<br />
Gedanken zurück in unsere gemeinsame Zeit des Studiums, der Promotion<br />
und der Habilitation in Heidelberg (darüber vergesse ich nicht die dreißig<br />
Jahre unserer späteren Zeit in München). Wenn ich hier über Gustav Radbruch<br />
schreibe, dann nicht zuletzt deshalb, weil er die überragende Persönlichkeit<br />
unserer Studienjahre war. Da muß gesagt werden, daß wir die erste<br />
Kriegsgeneration waren, die mehr oder weniger angeschlagen aus dem Krieg<br />
zurückgekehrt ist. Wir waren geistig ausgehungert und stürzten uns deshalb<br />
mit Ungestüm auf das Studium. Wir hatten durch Krieg und Gefangenschaft<br />
viel Zeit verloren, weshalb wir es uns nicht leisten konnten, das Erste Staatsexamen<br />
solange hinauszuzögern, wie das heute vielfach geschieht. Damals<br />
waren nur sechs Semester vorgeschrieben, und viele, ja wohl die meisten von<br />
uns sind tatsächlich nach sechs Semestern ins Examen gegangen. Das war die<br />
Zeit vom Wintersemester 1945/46 bis Sommersemester 1948, und genau diese<br />
sechs Semester hat Radbruch noch einmal gelehrt, obwohl er bereits das Emeritenalter<br />
erreicht hatte. Während der Zeit der Diktatur hatte er ein Lehrverbot.<br />
Radbruch hat in seiner unvergeßlichen Abschieds-Vorlesung vom 13. Juli 1948<br />
uns, die Kriegsgeneration, „ein Saatfeld wie nie zuvor“ genannt, „kulturhungrig,<br />
lernhungrig, berufen wie keine zweite und vorbildlich in der Überwindung<br />
des Physischen“. Allerdings hat er an anderer Stelle auch gesagt, diese<br />
Generation sei „schrecklich ungebildet“. Was Werner Lorenz angeht, stimmt<br />
diese Äußerung nicht. Aber alles in allem waren wir in der Tat ungebildet,<br />
kein Wunder, haben wir doch im Gymnasium Hitlers „Mein Kampf“ und<br />
nicht Shakespeare gelesen.
4 <strong>Arthur</strong> <strong>Kaufmann</strong><br />
Noch einmal zu der Zeit, da Werner Lorenz und ich in Heidelberg promoviert<br />
und uns habilitiert haben. Ich möchte noch vier anderer gedenken, die sich<br />
ebenfalls in dieser Zeit in Heidelberg auf den Hochschullehrerberuf vorbereitet<br />
haben (sie leben nicht mehr alle): Wolfram Henckel, Marie-Luise Hilger,<br />
Günther Jahr und Hubert Niederländer. Es kamen noch viele hinzu, doch sie<br />
gehören nicht zu dieser allerersten Kriegsgeneration.<br />
Über Gustav Radbruch ist in jüngster Zeit sehr viel geschrieben worden. Das<br />
erklärt sich nur zu einem kleinen Teil daraus, daß die „Radbruchsche Formel“<br />
vom „gesetzlichen Unrecht“ und „übergesetzlichen Recht“ im Zusammenhang<br />
mit der Aufarbeitung des DDR-Unrechts eine neue Aktualität erfahren<br />
hat (ursprünglich hat Radbruch diesen Gedanken im Hinblick auf das nationalsozialistische<br />
Unrecht entwickelt, wobei man nicht verschweigen darf,<br />
daß das NS-Unrecht sehr viel gravierender war als das DDR-Unrecht). Es<br />
sind indessen keineswegs überwiegend deutsche Stimmen und auch nicht in<br />
der Mehrzahl Äußerungen zur „Radbruchschen Formel“ in der neuesten Literatur<br />
zu Radbruch. Die ausländischen Stellungnahmen haben die Dominanz,<br />
und es ist nicht allzu übertrieben, wenn man sagt, Radbruch sei den Juristen,<br />
namentlich den Rechtsphilosophen, in der ganzen Welt als einer der Großen<br />
bewußt.<br />
Dadurch kann Radbruchs Wirken in seiner Frühperiode leicht ins Hintertreffen<br />
geraten. Dem sollen die folgenden Ausführungen entgegenwirken.<br />
II. Die Grundlegung der Radbruchschen Rechtsphilosophie vor<br />
dem Ersten Weltkrieg<br />
Ich greife unter den Stimmen zu Gustav Radbruch ein wenig beliebig die des<br />
mir unbekannten Thomas Koch heraus, um im Anschluß daran meine thematische<br />
Frage zu formulieren. Er schreibt: „Die Rechtslehre Gustav Radbruchs<br />
kann cum grano salis als die wirkungsvollste Rechtsphilosophie dieses Jahrhunderts<br />
qualifi ziert werden. Nach einer gänzlich unphilosophisch und positivistisch<br />
geprägten Zeit des 19. Jahrhunderts ist Radbruch einer der Ersten, der<br />
wieder die Frage nach den Gehalten des Rechts stellt und die Rechtswerte in<br />
das Zentrum der Rechtsphilosophie rückt.“ 1 Und nun mein Thema: War Radbruch<br />
auch schon vor der Revolution vom November 1919 dieser führende<br />
Rechtsdenker?<br />
Als Kaiser Wilhelm II. ins holländische Exil ging, war Radbruch genau 41 Jahre<br />
alt. Für einen Wissenschaftler bedeutet dieses Alter in der Regel noch nicht<br />
1 Th. Koch, Rechtsbegriff und Rechtsidee bei Radbruch, in: Staat und Recht 3 (1991),<br />
S. <strong>18</strong>3 ff.
Die Bedeutung Gustav Radbruchs<br />
den Zenit seines Schaffens. Das gilt auch für Radbruch. Die wichtigsten Perioden<br />
seines Wirkens – wissenschaftlich, politisch, kulturell – waren die Weimarer<br />
Zeit und die vier Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber immerhin<br />
umfaßte das wissenschaftliche Œuvre Radbruchs zu Ende des Kaiserreichs<br />
(1919) acht Bücher und rund 50 Abhandlungen in Sammelwerken und Periodika.<br />
Und nahezu alle großen Themen der Radbruchschen Philosophie und<br />
Wissenschaft waren bereits angesprochen: Republik, Demokratie, Rechtsstaat,<br />
Gerechtigkeit, Menschenrechte, Freiheit, Relativismus, Toleranz, rechtsphilosophische<br />
Parteienlehre, Naturrecht und Positivismus, Sein und Sollen,<br />
Form und Stoff, Rechtsgeltung, Krieg und Frieden, Religionsphilosophie des<br />
Rechts, Völkerverständigung und Weltstaat, humanes Strafrecht und noch<br />
manches andere mehr. Und vor allem: Außer der strafrechtsdogmatischen<br />
Dissertation („Die Lehre von der adäquaten Verursachung“, 1902) und der<br />
hauptsächlich systemtheoretischen Habilitationsschrift („Der Handlungsbegriff<br />
in seiner Bedeutung für das Strafrechtssystem. Zugleich ein Beitrag zur<br />
Lehre von der rechtswissenschaftlichen Systematik“, 1903) lagen zwei wichtige,<br />
zukunftsweisende Bücher Radbruchs vor: „Die Einführung in die Rechtswissenschaft“<br />
von 1910 (2. Aufl age 1913, 3. Aufl age 1919) und die grundlegenden<br />
„Grundzüge der Rechtsphilosophie“ von 1914.<br />
Beide Bücher sind später noch mehrfach aufgelegt (und in Fremdsprachen<br />
übersetzt) worden: die „Einführung“ in 13. Aufl age 1980 und die „Grundzüge“<br />
(später unter dem Titel „Rechtsphilosophie“) in 8. Aufl age 1973. Zwar<br />
kann man nicht sagen, daß Radbruch schon vor 1919 einen unmittelbaren<br />
Einfl uß auf das politische, geistige, kulturelle Geschehen der damaligen Zeit<br />
gehabt hätte. Aber er war, wie einige andere, gerüstet, als die neue Ära 1919<br />
begann.<br />
III. Das „monarchische Prinzip“<br />
Daß Radbruch als Sohn Lübecks, also als Hanseat, gewissermaßen von Mutters<br />
Brust an, Republikaner und als solcher nicht eben ein Enthusiast des<br />
„monarchischen Prinzips“ war, ist weiter nicht verwunderlich. Er nannte das<br />
„monarchische Prinzip“, das den Fürsten über die Verfassung stellt, „eine gefährliche<br />
Waffe der Reaktion“. 2 Allerdings dünkte es Radbruch, daß dem „monarchischen<br />
Prinzip“ die gefährliche Spitze dadurch genommen sei, daß der Kaiser<br />
nur zusammen mit dem Bundesrat die Regierung des konstitutionellen Staates<br />
2 G. Radbruch, Einführung in die Rechtswissenschaft, 1. Aufl age 1910, S.28 = Gustav-<br />
Radbruch-Gesamtausgabe (im folgenden abgekürzt GRGA) hrsg. von <strong>Arthur</strong> <strong>Kaufmann</strong>,<br />
Band 1, bearb. von <strong>Arthur</strong> <strong>Kaufmann</strong>, 1987, S. 113 f. Siehe auch dens., Grundzüge der<br />
Rechtsphilosophie, 1914, S. 128 f.= GRGA, Band 2, bearb. von <strong>Arthur</strong> <strong>Kaufmann</strong>, 1993,<br />
S. 127 ff.<br />
5
6 <strong>Arthur</strong> <strong>Kaufmann</strong><br />
darstelle; der Kaiser sei mithin „nicht der Monarch des deutschen Reiches, vielmehr<br />
(liege) die Regierung bei den ‚verbündeten Regierungen‘ der Einzelstaaten,<br />
so daß das Reich in eine ‚republikanische Spitze‘ (Bismarck)“ auslaufe 3 .<br />
Aber trotz dieser etwas rabulistischen Konstruktion, durch die die Monarchie<br />
in eine Republik umgedeutet werden sollte, sah Radbruch im Ersten deutschen<br />
Reich kein ideales Staatsgebilde. Er hat auch die Revolution von 19<strong>18</strong> ausdrücklich<br />
begrüßt 4 , und er hat sogleich tatkräftig an der neuen Verfassung<br />
mitgearbeitet 5 (es ist übrigens interessant, daß Radbruch hier, lange vor der<br />
Geburt der „Gesetzgebungstheorie“, explizit Fragen der Gesetzgebungstechnik,<br />
der symbolischen Gesetze und der Gesetzessprache (Schweiz als Vorbild)<br />
diskutiert hat 6 . Das bewahrte ihn freilich nicht vor dem Vorwurf, zu<br />
jenen „vaterlandslosen Gesellen“ zu gehören 7 , denen die Menschheit über<br />
die Nation geht (seit 1913, anläßlich seiner Teilnahme an dem Begräbnis<br />
von August Bebel in Zürich, bekannte er sich öffentlich zur Sozialdemokratie. 8<br />
Immerhin hatte er die Dreistigkeit, den Durchmarsch der deutschen Truppen<br />
durch Belgien 1914, den man von maßgeblicher Seite mit der Parole<br />
„Not kennt kein Gebot“ zu sanktionieren suchte, als völkerrechtswidrig zu<br />
bezeichnen 9 . Wie die damaligen Juristen darauf reagierten und wie sehr sich<br />
3 G. Radbruch, Einführung (Fn. 2), S.30 = GRGA, Band 1 (Fn.2), S. 115 ff.<br />
4 Brief Radbruchs an seinen Vater vom 6. Oktober 19<strong>18</strong>, in: GRGA, Band 17, bearb.<br />
von Günter Spendel, 1991, S. 280 f.: „Das Große, was wir in diesen Tagen erleben,<br />
eine unblutige Revolution, der Anbruch einer ganz neuen Zeit, die Verwirklichung alles<br />
dessen, wofür ich eintrat, seit ich denken kann, ist doch ein Ergebnis des Krieges, das ihm<br />
von seiner Sinnlosigkeit etwas nimmt.“<br />
5 Vgl. z.B. G. Radbruch, Der Sturm gegen den Verfassungsentwurf, in: Vorwärts vom<br />
25. Januar 1919 = GRGA, Band 14 (noch nicht erschienen); dens., Drei Forderungen<br />
zum Verfassungsentwurf, in: Vorwärts vom 28. Januar 1919 = GRGA, Band 14 (noch<br />
nicht erschienen); dens., Reichsverfassung und staatsbürgerliche Erziehung, in: Freies<br />
Deutschland, 1. Jg., H. 3, vom 13. März 1919, S. 28 f. = GRGA, Band 13, bearb. von<br />
Alessandro Baratta, 1993, S. 176 ff. Im letztgenannten Artikel diagnostizierte Radbruch<br />
bereits: „Den Thron, den der absolute Monarch räumen mußte, bestieg das absolute<br />
Kapital.“<br />
6 G. Radbruch, Reichsverfassung (Fn. 5), S. 28 = GRGA, Band 13 (Fn. 5), S. 178.<br />
7 Dabei hat Radbruch immer und immer wieder seine Vaterlandsliebe betont. In: GRGA,<br />
Band 12, bearb. von Alessandro Baratta, 1992, fi nden sich viele Beiträge, die das<br />
belegen. Siehe z.B. Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold, a.a.O., S. 57 f. (Erstveröffentlichung<br />
in: Schleswig-Holsteinische Volkszeitung vom 28. Juni 1924).<br />
8 G. Radbruch, Der innere Weg, 1. Aufl . 1951, S. 75 = GRGA, Band 16, bearb. von<br />
Günter Spendel, 1988, S. 227. Zu Radbruchs Betätigung nach dem Ersten Weltkrieg<br />
siehe A. <strong>Kaufmann</strong>, Gustav Radbruch – Rechtsdenker, Philosoph, Sozialdemokrat, 1987,<br />
S. 66 ff.<br />
9 Vgl. G. Radbruch, Ihr jungen Juristen!, 1919, bes. S.13 = GRGA, Band 13 (Fn. 5), S.36.
Die Bedeutung Gustav Radbruchs<br />
Radbruch gegen den Ésprit de corps vergangen hatte, zeigt beispielhaft der<br />
Schreckensruf des Romanisten Gerhard von Beseler: „eine ungeheuerliche<br />
Behauptung“. 10<br />
IV. Rechtsstaat und Demokratie<br />
Radbruch war, nach den Worten von Hermann Krämer, „ein glühender Verfechter<br />
demokratisch-republikanischer Staatsgedanken“ 11 , er war einer der<br />
beredtesten Anwälte für Rechtsstaat, Demokratie, Freiheit, Toleranz, und dies<br />
schon lange vor 1919.<br />
Der Kerngedanke der Radbruchschen Staatsphilosophie ist in Abraham Lincolns<br />
berühmter Kennzeichnung der Demokratie als „the government of the<br />
people, by the people, for the people“ zusammengefaßt. Und auch Perikles,<br />
der in seiner nicht weniger berühmten, von Thukydides überlieferten Rede auf<br />
die Gefallenen die Demokratie gepriesen hat, fühlte Radbruch sich geistig verwandt.<br />
Als „Theoretiker und Verteidiger des Rechtsstaates“ 12 forderte Radbruch die<br />
Verwirklichung des konstitutionellen Gedankens und damit eine strenge Gewaltenteilung,<br />
Bindung nicht nur der Judikative, sondern auch der Exekutive an<br />
das Recht 13 , Garantie der Menschenrechte 14 , insbesondere der Freiheitsrechte,<br />
Gleichheit der Menschen vor dem Gesetz und nicht zuletzt eine umfassende<br />
Verwaltungsgerichtsbarkeit. 15 In dem Streit zwischen Demokratismus und Liberalismus<br />
entschied sich Radbruch für einen mittleren Weg (zwischen Montesquieu<br />
und Rousseau). 16 Mit dem Demokratismus betonte er das Mehrheitsprinzip,<br />
wobei er ursprünglich nicht einmal die Konsequenz scheute, derzufolge in<br />
der Demokratie die Mehrheit sogar die Demokratie selbst beseitigen könne.<br />
Bemerkenswert für Radbruchs Demokratieauffassung ist es auch, daß er das<br />
Plebizit als einen stillschweigenden und selbstverständlichen Bestandteil jeder<br />
10 G. von Beseler, Römisches Recht und Revolution, 1919, S. 11 f.<br />
11 H. Krämer, Gustav Radbruch als Parteipolitiker, in: Gedächtnisschrift für Gustav<br />
Radbruch, 1968, S. 221 ff.<br />
12 M. A. Cattaneo, Gustav Radbruch als Theoretiker und Verteidiger des Rechtsstaates, in:<br />
Gedächtnisschrift (Fn. 11), S. <strong>18</strong>2 ff.<br />
13 G. Radbruch, Einführung (Fn. 2), S. 25 ff. = GRGA, Band 2 (Fn. 2), S. 111 ff.<br />
14 Vgl. z.B. G. Radbruch, Das Recht im sozialen Volksstaat, in: Der Geist der neuen<br />
Volksgemeinschaft, 1919, S. 72 ff., bes. S. 78 = GRGA, Band 13 (Fn. 5), S. 59 ff.<br />
15 G. Radbruch, Einführung ( Fn. 2), S. 90 f. = GRGA, Band 1 (Fn. 2), S. 167 f.<br />
16 Siehe G. Radbruch, Grundzüge (Fn. 2), S. 92 ff. = GRGA, Band 2 ( Fn. 2), S. 98 ff.<br />
Vgl. dazu auch A. <strong>Kaufmann</strong>, Gustav Radbruch (Fn. 8), S. 96 ff.<br />
7