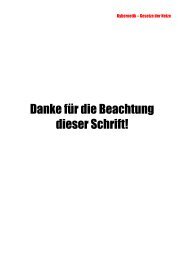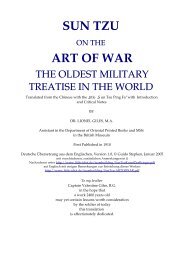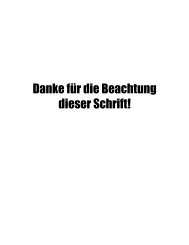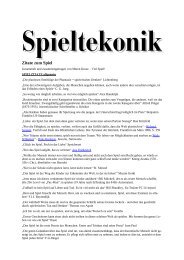Dialektik vs. dualistischem vs. ambivalentem Denken - Little-Idiot.de
Dialektik vs. dualistischem vs. ambivalentem Denken - Little-Idiot.de
Dialektik vs. dualistischem vs. ambivalentem Denken - Little-Idiot.de
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ein, ohne sich ihr ein- o<strong>de</strong>r unterzuordnen. Sogar Denkfehler und Irrtümer o<strong>de</strong>r Mißverständnisse bei <strong>de</strong>r Be<strong>de</strong>utung von<br />
Begriffen sind erwünscht, weil – sie zeigen in <strong>de</strong>r laufen<strong>de</strong>n Diskussion auch noch an an<strong>de</strong>ren Stellen Denkfehler auf.<br />
Denkfehler und Irrtümer wer<strong>de</strong>n ent<strong>de</strong>ckt, wenn die Prämissen zu Argumenten keine Gültigkeit mehr haben. Oft verbergen<br />
sich diese ungültigen Annahmen auch noch hinter an<strong>de</strong>ren Argumenten, sodaß durch die Auf<strong>de</strong>ckung von Denkfehlern und<br />
Irrtümern an einer Stelle auch Irrtümer an an<strong>de</strong>rer Stelle mit ent<strong>de</strong>ckt und ausgemerzt wer<strong>de</strong>n können. Das Wissen um die<br />
Einbeziehung <strong>de</strong>r Denkweisen <strong>de</strong>s an<strong>de</strong>ren in die eigene ist nicht verpflichtend, was be<strong>de</strong>uten soll, daß es nicht darum geht,<br />
„Recht” zu haben, weil man damit an<strong>de</strong>re automatisch ins „Unrecht” setzt, son<strong>de</strong>rn ausschließlich <strong>de</strong>r eigene Beitrag zur<br />
Entwicklung bzw. Fortentwicklung von Gedanken zählt. In dialektischen Diskussionen ist es völlig untypisch, daß die<br />
Diskutieren<strong>de</strong>n auch mal <strong>de</strong>n Standpunkt <strong>de</strong>s Gegenüber einnehmen, und aus <strong>de</strong>r „an<strong>de</strong>ren” Perspektive einen Standpunkt<br />
beleuchten, wie man oft in politischen „Showdiskussionen“ profilneurotischer Hohlköpfe beobachten kann. In ambivalenten<br />
Diskussionen hingegen darf und soll man auch die Rolle <strong>de</strong>s Gegenüber einnehmen, es ist ausdrücklich erlaubt und<br />
gewünscht. Man könnte es als argumentatives Rollenspiel auffassen, es geht um eine gemeinsame, möglichst vielseitige<br />
Beleuchtung <strong>de</strong>s Problems, nicht um Beharrung o<strong>de</strong>r Verharrung auf einem Standpunkt in <strong>de</strong>r Argumentation: „Die Kunst<br />
beim Diskutieren ist nicht, einen Standpunkt zu vertreten, son<strong>de</strong>rn ihn genau zu kennen.“<br />
Diese Denkstrukturen müssen erst erlernt und gemeinsam trainiert, bzw. „erarbeitet” wer<strong>de</strong>n. Wer mehrmals „erlebt” hat,<br />
wie erkenntnisreich für je<strong>de</strong>n Beteiligten diese Art <strong>de</strong>r prozessualen, gemeinschaftlichen Denkweise mit ständig zwischen<br />
<strong>de</strong>n Beteiligten wechseln<strong>de</strong>n Standpunkten ist, <strong>de</strong>r wird gerne seine alten Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>r Erkenntnisgewinnung über Bord<br />
werfen. „Vernetztes <strong>Denken</strong>” (Fre<strong>de</strong>ric Vester) ist ein Schlagwort, welches nur unzureichend die impliziten Metho<strong>de</strong>n <strong>de</strong>s<br />
„ambivalenten <strong>Denken</strong>” beschreibt. „Für und mit an<strong>de</strong>ren Menschen <strong>de</strong>nken, mit<strong>de</strong>nken” beschreibt es schon eher.<br />
Menschen, die das dualistische schwarz/weiß - <strong>Denken</strong> gewohnt sind, bereitet es die größten Schwierigkeiten, das<br />
Standpunkte in <strong>de</strong>r Argumentation je<strong>de</strong>rzeit frei wechseln können, da alle Ansatzpunkte aus <strong>de</strong>r Einheit <strong>de</strong>s<br />
gemeinschaflichen <strong>Denken</strong>s heraus allen gleichermaßen a priori zur Verfügung stehen. Mit an<strong>de</strong>ren Worten: „Dualistisches<br />
<strong>Denken</strong>“ ergibt eine in ihren eigenen Axiomen gefangene Folge von jeweils für sich betrachteten, vermeintlich richtigen<br />
o<strong>de</strong>r falschen Logiken o<strong>de</strong>r Schlüssen. „Logik“ sei hierbei <strong>de</strong>finiert als die Lehre <strong>de</strong>r „bedingten und unbedingten<br />
Folgerichtigkeiten“, welche als reine „Setzungen“ aufzufassen sind.<br />
„Ambivalentes <strong>Denken</strong>“ löst sich von <strong>de</strong>m eigentlichen Problem und konzentriert sich mehr auf das Umfahren <strong>de</strong>s Problems<br />
mit verschie<strong>de</strong>nen, gedanklichen Ansätzen, wobei ausdrücklich keine festen, an einzelne Personen fixierte Standpunkte<br />
eingenommen wer<strong>de</strong>n sollen: „Löse das Problem, in<strong>de</strong>m Du dich vom Problem löst!“. Das Ergebnis ist eine komplexe<br />
Anschauung im Team, die nicht nach richtig o<strong>de</strong>r falsch wertet, son<strong>de</strong>rn ständig um neue Erkenntnisse bemüht ist, ohne<br />
(moralische) Wertungen, ohne vorgefasste Axiome (ungeschriebene Regeln), nichts „beweisen“, „beurteilen“ o<strong>de</strong>r<br />
„verurteilen” will.<br />
Das be<strong>de</strong>utet nicht, daß ein Apfel zur Birne wird. Es bleibt ein Apfel, er wird auch weiterhin zur Gattung „Obst” gehören,<br />
jedoch wird <strong>de</strong>r Schwerpunkt auf die möglichen Verarbeitungsformen von Apfel gelegt, vielleicht zu einem Bratapfel, o<strong>de</strong>r<br />
zu Apfelmus - und zwar in einem schöpferischem Prozess <strong>de</strong>r Gewinnung von Erkenntnissen. Nur <strong>Idiot</strong>en diskutieren<br />
darüber, was ein Apfel „ist“ - ontologisches Schubla<strong>de</strong>n<strong>de</strong>nken halt.<br />
Ein unschlagbarer Vorteil <strong>de</strong>s „Ambivalenten <strong>Denken</strong>s“ ist: man muss niemals „nie” sagen - „Einen Apfel kann man nicht<br />
braten” o<strong>de</strong>r „auf Eis gehört kein Pfeffer” (doch, Erdbeereis mit rotem Pfeffer ist eine Delikatesse) und selten „nein”! Denn<br />
es gibt keine Axiome, nach <strong>de</strong>nen man sich im Sinne eines „das ist gut und das ist schlecht“ zu richten hätte. Es gibt nur die<br />
Tatsachen und Sachverhalte <strong>de</strong>r Welt selbst, keine Theorien o<strong>de</strong>r Thesen, <strong>de</strong>ren Gültigkeit ihrer Prämissen fraglich ist.<br />
Irrtümer wer<strong>de</strong>n auf diesem Wege nicht per Definition als Irrtümer bezeichnet, son<strong>de</strong>rn sie schließen sich im<br />
Erkenntnisprozess von selbst aus - <strong>de</strong>r ganze Weg <strong>de</strong>s Erkennens gerät von alleine ins Stocken. Das be<strong>de</strong>utet, dass <strong>de</strong>r<br />
Irrtum ein selbstverständlicher Begleiter <strong>de</strong>s Erkenntnisprozesses ist.<br />
Ambivalentes <strong>Denken</strong> kann, an<strong>de</strong>rs als dualistisches, mit <strong>de</strong>m Irrtum leben, ja ihn dann und wann sogar zum Verbün<strong>de</strong>ten<br />
machen, in<strong>de</strong>m es ihn gewähren lässt, bis er sich selbst entlarvt. Sehr beliebt ist das gemeinsame „durch<strong>de</strong>nken” eines<br />
Gedankens bis zum En<strong>de</strong>: Viele Eltern re<strong>de</strong>n z.B. gerne von <strong>de</strong>r „freien Entwicklung <strong>de</strong>r Persönlichkeit” ihrer Kin<strong>de</strong>r,<br />
wären aber geschockt, wenn sie auf einen Menschen träfen, <strong>de</strong>ssen Persönlichkeit sich wirklich frei entwickelt hat. Die<br />
„reductio ad adsurdum” ergibt sich automatisch, wenn ein Gedanke wirklich frei zuen<strong>de</strong> gesponnen wer<strong>de</strong>n darf, und diesem<br />
bisher unent<strong>de</strong>ckte Irrtümer in <strong>de</strong>r Denke zugrun<strong>de</strong> liegen.<br />
Auch dialektisches <strong>Denken</strong>, als etwas flexiblere Fortführung <strong>de</strong>r dualistischen Denke, bekommt mit <strong>de</strong>m Irrtum<br />
Schwierigkeiten, <strong>de</strong>nn ein falsch gewählter Gegensatz bringt nur eine unzureichen<strong>de</strong> Synthese hervor, und die Ableitungen<br />
von <strong>de</strong>rselben gehen in die verkehrte Richtung. Beobachtbar ist dies in <strong>de</strong>r Politik, wo, ausgehend von alten Denkweisen,<br />
versucht wird, diese an neue Erkenntnisse anzupassen, streng dialektisch, These, Antithese, Synthese. Diese dauern<strong>de</strong>n<br />
Kompromisse entwicklen sich immer mehr zu faulen Kompromissen. Es ist ein impliziter Fehler in <strong>de</strong>r prozessualen Logik<br />
<strong>de</strong>r politischen Meinungsfindung in <strong>de</strong>r repräsentativen Demokratie mit ihren Parteien (dualistische Denkweise =<br />
Fraktionszwang). Demokratie kann so nicht effizient funktionieren, weil sie zu sehr die Fehler <strong>de</strong>r dualistischen bzw.<br />
dialektischen Denkweise in sich trägt. Es sind prinzipielle Fehler im Prozess<strong>de</strong>sign. Dasselbe gilt auch für<br />
Unternehmensstrukturen, die oft ähnliche logische Fehler in <strong>de</strong>n Entscheidungsfindungs – Verfahren enthalten.<br />
Ambivalentes <strong>Denken</strong> braucht sich darum keine Sorgen zu machen. Profilneurotische Diskutanten, die heftigst ihre Meinung