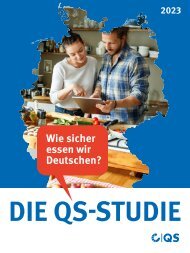Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AUSGABE 1 / FEBRUAR <strong>2022</strong><br />
www.landschaft-westfalen.de<br />
Einzelpreis: 2,40 Euro<br />
Regional lesen, entscheiden, bewegen!<br />
Tierheime:<br />
Betreuung zwischen<br />
Mangel und Fülle<br />
Seite 3<br />
Landwirtschaft:<br />
Beauftragter für den<br />
Dialog der Akteure<br />
Seite 7<br />
Mobilität:<br />
Bangen zwischen Stau<br />
und Brückenabriss<br />
Seite 8<br />
Sport:<br />
Bob-Athletin auf dem<br />
Weg nach Olympia<br />
Seite 11<br />
Förderprojekte:<br />
Bewerbungsrunde für<br />
Leader-Regionen<br />
Seite 12<br />
Ärzte sorgen sich<br />
um ihre Zukunft<br />
Münster. Die Ärzte in <strong>Westfalen</strong>-<br />
Lippe geben der Zukunftsfähigkeit<br />
des Gesundheitswesens keine<br />
guten Noten. Nach einer anonymen<br />
Onlineumfrage der Ärztekammer<br />
unter den rund 48.000 Medizinern<br />
gab es im Durchschnitt bei dieser<br />
Frage die Note 4,0 (ausreichend).<br />
Rund 10 Prozent der Kammermitglieder<br />
hatten sich an der<br />
Befragung beteiligt, wie Präsident<br />
Johannes Albert Gehle mitteilte.<br />
Bei der Frage, welche Themen die<br />
Ärztekammer am dringendsten<br />
anpacken muss, lag das Thema<br />
Nachwuchs vorne. 71,9 Prozent der<br />
Befragten nannten diese Frage<br />
„sehr wichtig“. Das Thema Pandemie<br />
rangiert deutlich dahinter. dpa<br />
Mehr Geld für den<br />
Nahverkehr<br />
Düsseldorf. Um den Nahverkehr<br />
zu verbessern, stellt das Land<br />
Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> in den Jahren<br />
bis 2031 insgesamt 568 Millionen<br />
Euro bereit. Für 18 entsprechende<br />
Projekte sei nun „die notwendige<br />
finanzielle Vorsorge getroffen“<br />
worden, heißt es in einem Brief von<br />
Landesverkehrsministerin Ina<br />
Brandes (CDU) an die drei NRW-<br />
Verkehrsverbünde VRR, NWL<br />
und NVR.<br />
Es geht um mehr Züge, etwa auf der<br />
Linie RE 60.2 zwischen Rheine<br />
und Braunschweig ab 2024 und bei<br />
der RB 64 zwischen Münster und<br />
Enschede ab 2026. Zudem sollen<br />
Strecken reaktiviert werden,<br />
etwa die Röhrtalbahn von Neheim-<br />
Hüsten nach Sundern im Hochsauerlandkreis.<br />
dpa<br />
LPV GmbH Hülsbrockstraße 2–8 48165 Münster<br />
ZKZ 32935 PVst+4 DPAG Entgelt bezahlt<br />
Vier Monate nach dem desaströsen<br />
Abschneiden<br />
bei der Bundestagswahl<br />
hat die CDU sich eine<br />
neue Führung gegeben.<br />
Nach dem Votum des Parteitags lässt<br />
sich sagen: Die Impulse für die Neuausrichtung<br />
der Partei werden maßgeblich<br />
von zwei <strong>Westfalen</strong> kommen.<br />
Der Sauerländer Friedrich Merz steht<br />
als Parteichef an der Spitze. Derweil<br />
soll der Paderborner Bundestagsabgeordnete<br />
Carsten Linnemann als einer<br />
seiner Stellvertreter die Programmund<br />
Grundsatzkommission leiten.<br />
Der frühere Chef der Mittelstandsund<br />
Wirtschaftsunion MIT will die<br />
Chance nutzen, der Partei seinen<br />
Stempel aufzudrücken, wie er im Interview<br />
mit <strong>Landschaft</strong> <strong>Westfalen</strong><br />
klarmacht.<br />
„In vielen Bereichen sind wir inhaltlich<br />
nicht gut aufgestellt. Es ist<br />
nicht klar, wofür die Union steht und<br />
wofür nicht“, moniert Linnemann, der<br />
sich für einen „modernen Konservatismus“<br />
starkmacht. „Gerade eine<br />
Volkspartei braucht eine Erkennungsmelodie.<br />
Und die ist bei der Union<br />
nicht mehr zu hören“, so die düstere<br />
Diagnose des 44-Jährigen. Eine Warnung<br />
schiebt er gleich hinterher:<br />
Wenn die Union es nicht schaffe, auch<br />
ihre konservative Wurzel wieder<br />
sichtbar zu machen, werde sie ihren<br />
Status als Volkspartei verlieren.<br />
Was Linnemann unter „modernem<br />
Konservatismus“ versteht, illustriert<br />
er am Beispiel Migration – einem<br />
Thema, das für die Union seit der<br />
Flüchtlingskrise 2<strong>01</strong>5 ähnlich traumatisch<br />
ist wie für die SPD die Hartz-<br />
1316 erstmals urkundlich erwähnt: Wildpferde im<br />
Merfelder Busch. Foto: Shutterstock<br />
Impulsgeber<br />
aus <strong>Westfalen</strong><br />
Carsten Linnemann soll die CDU erneuern<br />
Von Manuel Glasfort<br />
Klare Vorstellung von konservativ: Carsten Linnemann. Foto: Julia Steinigeweg/Agentur Focus<br />
Gesetze. Wenn sich Parallelgesellschaften<br />
bildeten und die gemeinsame<br />
Wertebasis der Gesellschaft erodiere,<br />
könne das gefährlich werden für den<br />
Sozialstaat. „Daher ist es wichtig, dass<br />
wir kontrollieren, wer zu uns ins Land<br />
kommt. Ohne Grenzschutz geht das<br />
nicht.“ Seinen humanitären Pflichten<br />
solle Deutschland mit Kontingentlösungen<br />
nachkommen.<br />
Bleibt wild!<br />
Dülmen. Wildpferde hinter einem<br />
Zaun, das ist ein Widerspruch in sich.<br />
In Dülmen wird es wohl so kommen,<br />
denn man befürchtet, dass zukünftig<br />
dort lebende Wölfe die 400 Pferde<br />
starke Herde aus dem Merfelder Busch<br />
auf die nahe Autobahn A 43oder auf<br />
die Bundesstraße B 67n hetzen könnten.<br />
Nun soll ein zehn Kilometer langer<br />
Zaun Pferde und Autofahrer<br />
schützen. Der Naturschutzbeirat des<br />
Kreises Coesfeld hat zugestimmt, dass<br />
dafür die Bauverbote in den Naturschutzgebieten<br />
aufgehoben werden.<br />
Wölfe gibt es in der Gegend übrigens<br />
noch nicht. Doch schon Sokrates<br />
wusste: Prävention ist besser als Intervention.<br />
nri<br />
Nach der Bundestagswahl wurde Linnemann<br />
mitunter als Laschet-Nachfolger<br />
gehandelt. Von einer eigenen<br />
Kanzlerkandidatur in vier Jahren will<br />
der Paderborner nichts wissen. Das sei<br />
„Quatsch“, sagt Linnemann. Er wolle<br />
sich auf die Erneuerung seiner Partei<br />
konzentrieren. „Dieser Aufgabe muss<br />
ich gerecht werden.“<br />
Mehr auf den Seiten 4 und 5<br />
„Nach der Rückkehr<br />
des Wolfes<br />
bleibt das Ziel,<br />
Naturschutz<br />
sowie Herdenschutz<br />
in Einklang<br />
zu bringen.“<br />
Ursula Heinen-Esser, NRW-Ministerin<br />
für Landwirtschaft und Umwelt<br />
Nageln Sie den<br />
Minister<br />
doch mal fest!<br />
Neulich fuhr ich im Dunkeln mitten<br />
durch den Windpark Asseln auf<br />
der Paderborner Hochfläche. Es war<br />
etwas neblig, die Szenerie erinnerte<br />
mich an die Bilder, die wir als Kinder<br />
in den 1970er-Jahren malten, wenn<br />
wir uns unser Leben im Jahr 2000 vorstellten.<br />
Den Windpark Asseln gibt es<br />
seit 1997, damals war dies die größte<br />
Onshore-Anlage Europas. Wer heute<br />
dort vorbeikommt, sieht immer noch<br />
ein Stück Zukunft. Denn Windkraft<br />
wird ein wesentlicher Baustein sein,<br />
um den bevorstehenden Energiehunger<br />
klimafreundlich zu gestalten.<br />
Der neue Wirtschafts- und Klimaschutzminister<br />
Robert Habeck hat bei<br />
seiner Eröffnungsbilanz Mitte Januar<br />
mit Grafiken auf Pappen gezeigt, dass<br />
es mit dem Ausbau deutlich schneller<br />
vorangehen muss. Viele Menschen<br />
würden Windkraftanlagen als Veränderungen<br />
von Heimat ansehen und sie<br />
nicht da haben wollen, wo sie „immer<br />
mit ihrem Waldi spazieren gehen“.<br />
Eine nicht ganz neue, aber gute Idee,<br />
wie man es den Menschen etwas leichter<br />
machen könnte, einen anderen<br />
Spazierweg zu suchen, hat er auch<br />
gleich mitgebracht: Die neue Bundesregierung<br />
will Bürgerenergieanlagen<br />
stärker fördern. Wenn das Geld nicht<br />
in die Taschen von Projektierern fließt,<br />
sondern in der Bürgerschaft bleibt,<br />
lebt es sich mit dem Windrad vor der<br />
eigenen Haustüre leichter.<br />
Minister Habeck will übrigens bis<br />
zum Sommer als Waldi-Versteher<br />
durchs Land reisen und für seine Energiepläne<br />
werben. Vielleicht führt ihn<br />
sein Weg ja auch ins Westfälische.<br />
Da könnte man mit ihm gleich noch<br />
eine paar andere Themen diskutieren:<br />
dass seine Regierung bei der Förderung<br />
des ländlichen Raumes anscheinend<br />
vor allem die strukturschwachen<br />
Regionen Ostdeutschlands vor<br />
Augen hatte, zum Beispiel. Wie er<br />
sich das nun wirklich vorstellt mit<br />
dem klimafreundlichen Umbau der<br />
Landwirtschaft, dem Flächenverbrauch<br />
für erneuerbare Energien wie<br />
Solarpanels. Und wie sich das alles auf<br />
Bodenpreise auswirkt. Und dann nageln<br />
Sie ihn ruhig mal fest, damit er<br />
sich nicht darauf zurückziehen kann,<br />
was nicht nur für den Grünen Habeck,<br />
sondern für uns alle eine Katastrophe<br />
wäre: dass das nichts wird mit der<br />
Energiewende.<br />
Nicole Ritter<br />
KOLUMNE
BUCH EINS<br />
2 | Akzente<br />
AUSGABE 1 / FEBRUAR <strong>2022</strong><br />
KOMMENTARE<br />
DIE WAHRHEIT ÜBER …<br />
PERSÖNLICH<br />
… ERFINDERINNEN in Ruhrgebiet und<br />
Münsterland untersucht ein Forschungsteam<br />
der Westfälischen Hochschule.<br />
Frauen kämen zu wenig vor,<br />
wenn es um Innovationen gehe, so die<br />
leicht zu belegende Ausgangsthese:<br />
Nur 4 Prozent der Patente in Deutschland<br />
werden von Frauen angemeldet.<br />
Das soll sich ändern.<br />
Kerstin Ettl befasst sich mit der Rolle von Frauen<br />
als Innovatorinnen. Foto: WH/Julia Voß<br />
Die Leiterin des Forschungsteams, Kerstin<br />
Ettl, ist seit dem vergangenen Jahr<br />
Professorin für Betriebswirtschaftslehre<br />
mit dem Schwerpunkt Gender und<br />
Diversity an der Westfälischen Hochschule<br />
Gelsenkirchen. Sie muss nicht<br />
wirklich auf die berühmte Mathematikerin<br />
Ada Lovelace verweisen, die als<br />
erste Programmiererin der Welt gilt,<br />
nachdem sie erste Programme für die<br />
„analytische Maschine“ vorgelegt und<br />
den Unterschied der Maschine zu einer<br />
bloßen Rechenmaschine aufgezeigt hat.<br />
Denn es gibt die Erfinderinnen und<br />
Innovatorinnen auch in <strong>Westfalen</strong>. In<br />
der eigenen Hochschule wurde das<br />
Team bereits fündig: Heike Beismann,<br />
Professorin aus Bocholt, ließ sich von<br />
der menschlichen Anatomie zu einem<br />
neuartigen Federelement inspirieren,<br />
das heute in der Automobilindustrie<br />
zum Einsatz kommt. Vorbild waren<br />
die Puffereigenschaften des Brustkorbs.<br />
„Derartige Innovationen und<br />
die Erfinderinnen selbst sichtbar zu<br />
machen und vorzustellen, soll andere<br />
innovative Frauen ermutigen, ähnliche<br />
Wege einzuschlagen und ihre<br />
Ideen durchzusetzen“, erläutert Projektleiterin<br />
Ettl. „Zusätzlich soll mit<br />
dem Projekt die Innovationskraft des<br />
Hochschulumfeldes Ruhrgebiet und<br />
Mün ster land gestärkt werden.“ Ziel<br />
sei es auch, aus dem Verständnis für<br />
die Rolle und den Beitrag von wissenschaftlich<br />
tätigen Frauen entsprechende<br />
Förderinstrumente abzuleiten.<br />
Innovatorin in der deutschen Forschung:<br />
Emmanuelle Charpentier erhielt 2020 den<br />
Nobelpreis für Chemie. Foto: Kay Nietfeld/dpa<br />
„Dabei geht es auch um Macht- und<br />
soziale Strukturen in regionalen Innovationsökosystemen“,<br />
sagt Ettl, womit<br />
sie die Lebenswirklichkeit und den Alltag<br />
innovativer Frauen in ihren jeweiligen<br />
privaten wie auch beruflichen<br />
Umfeldern meint. Das Forschungsprojekt<br />
„WE!“ läuft insgesamt drei<br />
Jahre und erhält Fördermittel vom<br />
Bundes ministerium für Bildung und<br />
Forschung.<br />
„Motor des Wandels“<br />
Der Münsteraner Oberbürgermeister Markus Lewe<br />
sieht die Städte in einer Schlüsselrolle<br />
Ein neues Jahr liegt frisch vor uns. Ein neues<br />
Jahr birgt Chancen und neue Herausforderungen.<br />
Das gilt auch für die Städte. Denn<br />
hier wird sich entscheiden, wie wir die großen<br />
gesellschaftlichen Themen unserer Zeit<br />
bewältigen: Klimaschutz, Mobilitätswende, Digitalisierung,<br />
Wohnungsbau, Chancengleichheit – all das wird<br />
vor Ort konkret.<br />
Diesen Wandel zu gestalten, ist die Aufgabe, die vor uns<br />
liegt. Als Oberbürgermeister von Münster bedeutet das für<br />
mich, dass wir gemeinsam mit der Stadtgesellschaft, mit<br />
den Bürgerinnen und Bürgern, mit Wirtschaft, Wissenschaft<br />
und Kulturszene eine nachhaltige und soziale Stadt<br />
schaffen möchten. Auf diesem Weg sind<br />
wir nicht allein. Alle Städte in Deutschland<br />
stellen sich diesen Herausforderungen.<br />
Wichtig ist, die Menschen bei tiefgreifenden<br />
Veränderungen aktiv einzubeziehen.<br />
Das ist unser Job als kommunale Profis.<br />
Und deswegen ist die Zusammenarbeit und<br />
der Erfahrungsaustausch im Deutschen<br />
Städtetag so wertvoll. Ich freue mich, das<br />
Vertrauen der Kolleginnen und Kollegen<br />
bekommen zu haben und als Städtetagspräsident<br />
für die Städte bei Bund und Ländern in<br />
den kommenden eineinhalb Jahren zu streiten. Denn das<br />
ist direkter Einsatz für die Lebensqualität der Menschen<br />
in unseren Städten.<br />
Drei große Themen sind mir besonders wichtig. Als<br />
Erstes Chancengleichheit und Bildungsgerechtigkeit. Über<br />
Bildung können wir Zukunftschancen für alle sichern. Kita,<br />
schulische Ganztagsangebote, lebenslanges Lernen, aber<br />
auch die Angebote der Jobcenter – all das gibt es in den<br />
Städten und wollen wir noch besser machen. Gerade für<br />
Kinder. Es kann doch nicht sein, dass die Schulen digital<br />
immer noch hinterm Mond sind. Wir brauchen einen Masterplan<br />
für digitale Bildung.<br />
Als erstes Bundesland will Nordrhein-<strong>Westfalen</strong><br />
die Digitalisierung<br />
der Schulen im Gesetz verankern.<br />
So sieht es die Novelle vor, die<br />
Ministerin Yvonne Gebauer noch vor<br />
der Landtagswahl verabschieden lassen<br />
will. Das klingt innovativ, doch ist<br />
es das auch? Angesichts der Zustände<br />
in den Schulen, die landauf, landab<br />
beklagt werden, sind Zweifel angebracht.<br />
Es ist schön, so etwas im Gesetz<br />
zu verankern und ein paar Millionen<br />
für die Fortbildung der Lehrerinnen<br />
und Lehrer bereitzustellen,<br />
übrigens rein rechnerisch rund 1000<br />
Euro pro allgemeinbildender Schule.<br />
Pro Schule, nicht pro Lehrkraft. Wer<br />
eine grobe Ahnung hat, wie groß der<br />
Kreativkai Münster: ein Beispiel für Strukturveränderungen. Foto: Henrik Dolle/Adobe Stock<br />
Markus Lewe ist Präsident<br />
des Deutschen Städtetages.<br />
Foto: PPBraun<br />
Zweitens: Wohnen wird immer teurer. Für Menschen mit<br />
niedrigem Einkommen fehlen Wohnungen. Wir brauchen<br />
bezahlbare Mieten und den sozialen Wohnungsbau in den<br />
Städten. Wir brauchen kommunale Bodenfonds, mit denen<br />
wir vor Ort steuern können, was und wann und wo<br />
gebaut wird. Städte sind nicht irgendein Investor, sondern<br />
betreiben Daseinsvorsorge – wir haben die notwendigen<br />
rechtlichen Zügel in unseren Händen, etwa beim Zugriff<br />
auf Grundstücke.<br />
Und drittens: die Transformationen bei Klima, Mobilität,<br />
Innenstädten, Digitalisierung. Jedes für sich ist ein<br />
Riesenthema. Die Pandemie und der Klimawandel zeigen<br />
uns jeden Tag, dass wir krisenfester werden müssen. Wir<br />
wollen nicht im Nachhinein die Stadt reparieren,<br />
sondern vorbereitet, also resilient<br />
sein. Städte müssen Klimawandel meistern<br />
können; das muss gesetzlich verankert werden.<br />
Wir brauchen mehr Unterstützung zur<br />
Vorsorge vor Hochwasser und Starkregen,<br />
zum Umbau zur Schwammstadt und für<br />
mehr Grün in der Stadt.<br />
Energetische Sanierung von Quartieren,<br />
klimafreundliche Energieversorgung, neue<br />
Busse und Bahnen, Ausbau des Radwegenetzes,<br />
neue Konzepte für Innenstädte, digitale<br />
Bürgerservices – an all diesen Baustellen arbeiten die Städte.<br />
Was die Ampel-Parteien dazu in den Koalitionsvertrag<br />
geschrieben haben, macht Hoffnung. Wir nehmen<br />
die neue Bundesregierung beim Wort, wir wollen mehr<br />
Wandel wagen. Die Städte wollen Motor des Wandels sein.<br />
Eine Handvoll Förderprogramme helfen allerdings<br />
nicht weiter. Die Städte brauchen mehr frei verfügbare<br />
Mittel durch einen größeren Anteil am Steueraufkommen.<br />
Bund und Länder müssen das in die Bahn bringen. Förderprogramme<br />
sind stets die zweitbeste Lösung – denn die<br />
Städte wissen gut, was zu tun ist. Und wir wollen starke<br />
und handlungsfähige Städte sein.<br />
Bildung gut gemeint: Das reicht nicht<br />
Von Nicole Ritter<br />
Fortbildungsbedarf ist und was solche<br />
Maßnahmen kosten, darf sich jetzt ein<br />
wenig wundern. Weiter geht es mit<br />
der Ausstattung der Schulen mit digitalem<br />
Gerät und der entsprechenden<br />
Infrastruktur. Es ist kein Geheimnis,<br />
dass es auch da vorne und hinten<br />
klemmt. Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> ist<br />
nicht ohne Grund Schlusslicht bei den<br />
Investitionen in die Primarbildung.<br />
Doch es geht nicht nur um Geld.<br />
Aufrechter Gang gehe nicht mit Handynacken,<br />
kommentierte jemand in<br />
einem Pädagogenforum. Und genau<br />
da liegt das eigentliche Problem. Natürlich<br />
sollen Kinder und Jugendliche<br />
in den Schulen digitale Kompetenzen<br />
erlernen. Aber reicht das? Was ist mit<br />
vielen anderen Kompetenzen, die sie<br />
zukünftig benötigen werden? Wir<br />
müssen gar nicht auf die Folgen der<br />
Corona-Pandemie für Kinder und Jugendliche<br />
schauen, denen wertvolle<br />
Lernerfahrungen vorenthalten wurden<br />
und werden.<br />
Wenn sie für das, was auf die<br />
Menschheit zukommt, gerüstet sein<br />
sollen, geht es um viel mehr als ein<br />
paar Freiräume, die Schulen jetzt mit<br />
dem neuen Gesetz noch bekommen<br />
sollen. Es geht darum, dass man junge<br />
Menschen nicht mit Konzepten von<br />
vorgestern auf die Welt von morgen<br />
vorbereiten kann. Wenn es sein muss,<br />
auch mit einem neuen Schulgesetz,<br />
vor allem aber mit richtig guten Ideen.<br />
Umwelt kaputt,<br />
aber Haushalt<br />
ausgeglichen?<br />
„Es bringt doch überhaupt nichts,<br />
wenn ich in 20 Jahren den heute<br />
geborenen Kindern sage: Du hast zwar<br />
keinen Schulabschluss, und deine<br />
Umwelt ist kaputt, aber unser Haushalt<br />
ist ausgeglichen“, sagte der SPD-<br />
Spitzenkandidat für die Landtagswahl<br />
in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong>, Thomas<br />
Kutschaty, im Gespräch mit der Nachrichtenagentur<br />
dpa. Bei Investitionen<br />
in zusätzliche Lehrer und eine bessere<br />
Ausstattung der Schulen zeige sich<br />
der Mehrwert nicht immer sofort.<br />
„Aber wenn wir gut ausgebildete<br />
Kinder in einigen Jahren haben, dann<br />
ist das die höchste Rendite, die<br />
ein Staat haben kann.“ Kinder aus<br />
benachteiligten Stadtteilen aus<br />
Armutsspiralen he raus zureißen,<br />
spare langfristig aber auch Kosten –<br />
etwa für Arbeitslosengeld. „Ich wäre<br />
auch bereit, notfalls Kredite dafür<br />
aufzunehmen, um diese wichtigen<br />
Investitionen in das Bildungs- und<br />
Gesundheitssystem zu finanzieren“,<br />
sagte Kutschaty. dpa<br />
Thomas Kutschaty, SPD<br />
Foto: dpa<br />
Impressum<br />
VERTRIEB:<br />
Lorena Gerversmann, Telefon: 0 25 <strong>01</strong>/8<strong>01</strong> 44 82,<br />
E-Mail: vertrieb@lp-verlag.de<br />
VERLAG:<br />
BUNTEKUH Medien in der LPV GmbH.<br />
Geschäftsführer: Dr. Thorsten Weiland<br />
Anschrift: Hülsebrockstraße 2–8, 48165 Münster.<br />
E-Mail: thorsten.weiland@lp-verlag.de,<br />
Telefon: 0 25 <strong>01</strong>/8<strong>01</strong> 61 71<br />
Internet: www.buntekuh-medien.de<br />
DRUCK:<br />
Druckzentrum Nordsee, Am Grollhamm 4,<br />
27574 Bremerhaven<br />
REDAKTION:<br />
Dr. Thorsten Weiland (Chefredakteur,<br />
v.i.S.d.P.), Nicole Ritter (Stellv. Chefredak teurin,<br />
Leitung BUNTEKUH Medien), Manuel Glasfort,<br />
Stefan Legge<br />
Schlussredaktion: Schlussredaktion.de<br />
Redaktionsadresse: wie Verlagsadresse<br />
E-Mail: redaktion@landschaft-westfalen.de,<br />
Telefon: 0 25 <strong>01</strong>/8<strong>01</strong> 61 71<br />
Internet: www.landschaft-westfalen.de<br />
Konzeption: Anja Steinig, Studio F, Berlin<br />
Illustrationen: Neil Gower, Marianna Weber<br />
Layout: Martha Lajewski<br />
Marketing: Lukas Wünnemann<br />
ANZEIGEN:<br />
Dr. Peter Wiggers (Leitung, verantwortlich<br />
für den Anzeigenteil)<br />
Anzeigenservice: Telefon: 0 25 <strong>01</strong>/8<strong>01</strong> 63 00,<br />
E-Mail: anzeigen@lv.de<br />
UNTERSTÜTZERKREIS:<br />
<strong>Landschaft</strong> <strong>Westfalen</strong> wird aktiv unterstützt von<br />
der Stiftung Westfälische <strong>Landschaft</strong> und dem<br />
Raiffeisenverband <strong>Westfalen</strong>-Lippe (RVWL).<br />
Bankverbindung: Volksbank Münsterland<br />
Nord eG, IBAN DE86 4036 1906 1071 6969 <strong>01</strong>;<br />
BIC GENODEM1IBB.<br />
Rechnungseingang ausschließlich per E-Mail an:<br />
rechnungseingang@lp-verlag.de<br />
Einzelpreis: 2,40 Euro; jährlich 6 Ausgaben<br />
Nachdruck: Kein Teil dieser Zeitung darf ohne<br />
Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder<br />
verbreitet werden.
FEBRUAR <strong>2022</strong> / AUSGABE 1<br />
BUCH EINS<br />
Agenda | 3<br />
WESTFALEN<br />
Fundsache Fellnase: wenig Platz<br />
für Hund und Katz<br />
Die befürchtete Abgabewelle an<br />
Tier heime aufgrund von Corona blieb<br />
aus. Die meisten betreuten Tiere<br />
sind Fundtiere.<br />
Viele Tierschutzvereine kämpfen<br />
dennoch mit finanziellen Problemen<br />
Von Stefan Legge<br />
Die Zahl der Hunde, die in den Tierheimen abgegeben wurden, stieg im vergangenen Jahr an.<br />
Auch der illegale Welpenhandel aus Osteuropa hat dazu beigetragen. Foto: Getty Images<br />
Mitte des Jahres 2021 schlugen die Tierschutzverbände<br />
Alarm. Die Lockerung<br />
der Corona-Maßnahmen und die<br />
beginnenden Sommerferien führten zu<br />
einem Anstieg der Neuankömmlinge<br />
in den Tierheimen. Hunde, Katzen und andere Haustiere,<br />
die während des Lockdowns für willkommene<br />
Abwechslungen im tristen Alltag zwischen Homeschooling<br />
und Homeoffice gesorgt hatten, wurden vielen Menschen<br />
nun wieder lästig. „Die befürchtete Riesenwelle ist<br />
ausgeblieben, sie war letztlich kleiner als befürchtet“, sagt<br />
Ralf Unna, Vizepräsident des Landestierschutzverbandes<br />
in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong>, bei dem die meisten Tierschutzvereine<br />
organisiert sind.<br />
Viele Tierheime in <strong>Westfalen</strong> hätten aber wohl<br />
mit einer größeren Welle auch gar nicht umgehen können.<br />
Personal, Platz und Geld sind knapp. „Wir sind voll<br />
belegt“, sagt Karin Keuter vom Tierheim Paderborn,<br />
das vom Tierschutzverein Tiere in Not e. V. betrieben wird.<br />
Zu Beginn des ersten Lockdowns seien viele Tiere vermittelt<br />
worden. Tatsächlich habe das Angebot oft nicht die Nachfrage<br />
decken können. „Da haben wir von Corona profitiert“,<br />
sagt Keuter. Mittlerweile müsse man bei Abgabeanfragen<br />
von Tierhaltern auf eine Vermittlung ohne Aufnahme verweisen.<br />
„Weil wir keinen Platz haben, können wir nur anbieten,<br />
Abgeber und Aufnehmer zueinanderzubringen“,<br />
erklärt Keuter. Viele Tierheime in <strong>Westfalen</strong> machen das<br />
über ihre Homepage, auf der dann Fotos und Daten der Tiere<br />
zu sehen sind.<br />
Sondereffekte durch Corona<br />
Vor allem bei Hunden setzte zu Beginn der Corona-Pandemie<br />
eine Fehlentwicklung ein, die die Tierheime nun zu<br />
spüren bekommen. „Zum einen ist die Entscheidung für<br />
ein Tier oft zu schnell und zu unüberlegt gefallen“, sagt<br />
Ralf Unna ist Tierarzt<br />
und Vizepräsident des<br />
Landestierschutzverbandes<br />
NRW. Foto:<br />
Cornelis Gollhardt<br />
Hester Pommerening vom Deutschen Tierschutzbund.<br />
Unerfahrene Hundehalter seien dann schnell überfordert.<br />
„Viele Menschen haben sich zudem über Online-Angebote<br />
Welpen von illegalen Händlern aus Osteuropa bestellt“, berichtet<br />
Pommerening. Diese Tiere seien unter schlechten<br />
Bedingungen geboren, oft nicht geimpft und unterernährt<br />
in Deutschland angekommen. Auch diese Tiere kommen<br />
nun teilweise in den Tierheimen an.<br />
Verantwortungsvolle Tierhalter, die sich ihre Überforderung<br />
eingestehen und Tiere zum Tierheim bringen, sind<br />
aber nach wie vor eine Ausnahme. „Mehr als zwei Drittel<br />
der Tiere in unseren Tierheimen sind Fundtiere“, erklärt<br />
Ralf Unna. Ausgesetzt, verstoßen, manchmal sogar weggeworfen.<br />
Da für Fundsachen die Kommunen zuständig<br />
sind und auch dafür aufkommen müssen, geht es hier ums<br />
Geld. Die wenigsten Kommunen in <strong>Westfalen</strong> leisten sich<br />
wie Unna oder Dortmund ein eigenes<br />
Tierheim. Die allermeisten haben<br />
Verträge mit Tierschutzvereinen geschlossen,<br />
in denen die Konditionen<br />
für die Unterbringung der Fundsachen,<br />
also der Tiere, geregelt sind.<br />
„ES GIBT TIERSCHUTZVEREINE,<br />
DIE KÖNNEN VOR KRAFT<br />
KAUM LAUFEN, UND DANN<br />
GIBT ES WELCHE, DIE HABEN<br />
SCHON IM AUGUST<br />
IHR JAHRESBUDGET<br />
FÜR FUTTER VERBRAUCHT.“<br />
Ralf Unna,<br />
Landestierschutzverband NRW<br />
Keine einheitlichen Standards<br />
„Die Spannweite der Konditionen ist<br />
enorm“, sagt Ralf Unna. Da die<br />
meisten Tierheime von Tierschutzvereinen<br />
betrieben werden, hat der<br />
Landesverband hier einen guten Überblick.<br />
Er unterstützt auch hin und<br />
wieder bei den Verhandlungen. „Seit<br />
Jahren kämpfen wir für einheitliche<br />
Standards“, so Unna. Bisher vergeblich. Was kostet die<br />
Unterbringung eines Hundes pro Tag? Was kostet sie in<br />
einem Tierheim auf dem Land oder in der Stadt? „Diese<br />
Zahlen sind ja kein Geheimnis. Sie liegen zwischen 15 und<br />
22 Euro. Das müsste auch nicht verbindlich, sondern lediglich<br />
als Richtwert etwa vom Landesamt für Natur, Umwelt<br />
und Verbraucherschutz veröffentlicht werden. Dann hätten<br />
alle Beteiligten eine Diskussionsgrundlage bei den Vertragsverhandlungen“,<br />
sagt Unna.<br />
Trotz runder Tische beim Bundesministerium für Ernährung<br />
und Landwirtschaft und bei anderen Initiativen<br />
kann der Tierschutzbund diese Forderung aber bisher<br />
nicht durchsetzen. Der Städte- und Gemeindebund<br />
verweist auf die Vertragsfreiheit und die rechtlichen<br />
Grauzonen bei der Beurteilung von Fund- und Abgabetieren.<br />
Das Ergebnis ist ein Flickenteppich mit unterschiedlichsten<br />
Konstellationen. „Es gibt Tierschutzvereine,<br />
die können vor Kraft kaum laufen, und dann gibt es<br />
welche, die haben schon im August ihr Jahresbudget für<br />
Futter verbraucht“, sagt Unna.<br />
Ohne Spenden geht es nicht<br />
Eine Einschätzung, die Hester Pommerening bestätigt:<br />
„Wir sehen, dass es oft dieselben Vereine sind, die im<br />
Herbst um Hilfe rufen.“ Wenn beispielsweise das Heizöl<br />
knapp wird, hat der Tierschutzbund einen „Feuerwehr-<br />
Fonds“, und auch das Land Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> fördert<br />
Tierheime jährlich mit einer Summe von 500.000 Euro.<br />
Da für die oft ehrenamtlichen Helfer das Wohl der<br />
Tiere im Vordergrund steht und das Geld knapp ist,<br />
befinden sich viele Heime in keinem guten Zustand. Auch<br />
bauliche Erweiterungen sind trotz Platzknappheit oft<br />
nicht zu stemmen. Mehr Tiere als<br />
üblich aufzunehmen, geht dann einfach<br />
nicht.<br />
Einige Vereine gehen transparent<br />
mit ihren Einnahmen und Ausgaben<br />
um. So gibt das Tierheim in Paderborn<br />
an, etwa 420.000 Euro im Jahr für Personal,<br />
Futter, Einstreu, Tierarzt und<br />
Energie aufzuwenden. Allein 224 Säcke<br />
(2400 Kilogramm) Katzenstreu<br />
würden jeden Monat verbraucht. Ein<br />
Drittel der Kosten bekomme man<br />
über die Rechnungen, die man der<br />
Stadt Paderborn und den umliegenden<br />
Kommunen für Fundtiere in<br />
Rechnung stellen kann, wieder rein.<br />
„Der Rest muss aus Spenden, Abgabe gebühren und Veranstaltungen<br />
kommen“, sagt Karin Keuter vom Tierheim<br />
Paderborn. In Zeiten von Corona eine besondere Herausforderung.<br />
„Von fünf geplanten Festen sind uns im letzten<br />
Jahr zwei geblieben.“<br />
So wie in Paderborn machen es auch andere. Sommerfeste<br />
oder Nikolausfeiern mit Kuchenverkauf und einem<br />
Basar sind wichtige Einnahmequellen für die Vereine.<br />
Bis zu einem gewissen Grad sei der Einsatz von Spendengeldern<br />
auch sinnvoll, findet Ralf Unna. „Wenn allerdings<br />
die Betreuung von Fundtieren so schlecht vergütet wird,<br />
dass die Vereine dafür Spendengelder einsetzen müssen,<br />
dann passt etwas grundsätzlich nicht. Dann finanzieren<br />
die Spender eine hoheitliche Aufgabe.“ Die Diskussion um<br />
die Finanzierung der Tierheime bleibt also angespannt, die<br />
Situation in den Heimen ist es sowieso.
BUCH EINS<br />
4 | Schwerpunkt<br />
AUSGABE 1 / FEBRUAR <strong>2022</strong><br />
Wechsel vom Fraktionsvorstand der Union ins Konrad-Adenauer-Haus: Carsten Linnemann ist einer der Stellvertreter von CDU-Chef Friedrich Merz und will seiner Partei als Leiter der<br />
Programm-und Grundsatzkommission ein neues inhaltliches Profil geben. Die inhaltliche Positionierung sei in der Ära Merkel vernachlässigt worden, meint Linnemann. Foto: Julia Steinigeweg/Agentur Focus<br />
„Eine Volkspartei braucht<br />
eine Erkennungsmelodie“<br />
CDU-Vize Carsten Linnemann über modernen<br />
Konservatismus und den Umgang mit der AfD<br />
Von Manuel Glasfort<br />
Herr Linnemann, Sie wollen als Chef der Grundsatzkommission<br />
unter dem neuen CDU-Chef<br />
Friedrich Merz ein neues Programm für die CDU<br />
ausarbeiten. Ihren Posten als Chef der Mittelstandsunion<br />
haben Sie abgegeben. Was hat Sie zu<br />
diesem Schritt bewogen?<br />
Ich bin grundsätzlich der Meinung, dass politische Ämter<br />
wie die Kanzlerschaft zeitlich begrenzt sein sollten.<br />
Das gilt auch für Spitzenämter in den Parteien, damit diese<br />
nicht ermatten und regelmäßig ein frischer Wind<br />
reinkommt. Deswegen war für mich klar, dass nach acht<br />
Jahren an der Spitze der Mittelstandsunion Schluss ist<br />
und ich eine neue Herausforderung suche. Wer mich<br />
kennt, weiß, dass Programmatik genau mein Ding ist.<br />
Deshalb freue ich mich auf die Leitung der Programmund<br />
Grundsatzkommission.<br />
Vielfach war von konservativer Seite zu hören, die<br />
CDU habe unter Merkel ihr Profil verloren, sei<br />
inhaltlich ausgezehrt. Teilen Sie diese Diagnose?<br />
In vielen Bereichen sind wir inhaltlich nicht gut aufgestellt.<br />
Es ist nicht klar, wofür die Union steht und wofür<br />
nicht. Gerade eine Volkspartei braucht eine Erkennungsmelodie.<br />
Und die ist bei der Union nicht mehr zu hören.<br />
Wir haben mit Angela Merkel Wahlen gewonnen,<br />
aber wir haben uns zu sehr auf die Person Angela Merkel<br />
gestützt und die Inhalte vernachlässigt. Das fällt uns heute<br />
auf die Füße. Wir müssen nicht nach rechts oder links<br />
rücken, sondern unser Profil schärfen. Wenn wir das<br />
dann noch verbinden mit den richtigen Persönlichkeiten,<br />
dann können wir in Bereiche kommen von 35 Prozent<br />
Wählerzuspruch und mehr.<br />
Die CDU hat drei Wurzeln: eine konservative, eine<br />
christlich-soziale, eine liberale. Vom Konservativen<br />
war zuletzt wenig zu spüren. Wie wollen Sie allen<br />
dreien in einem neuen Programm wieder Geltung<br />
verschaffen?<br />
Wenn wir das nicht schaffen, allen drei Wurzeln wieder<br />
Geltung zu verschaffen, wird die Union ihren Status als<br />
Volkspartei verlieren. Das ist meine feste Überzeugung.<br />
Wir haben ein starkes Fundament mit der sozialen<br />
Marktwirtschaft und der christlichen Soziallehre. Darauf<br />
aufbauend müssen die Positionen jetzt sehr deutlich<br />
formuliert werden. Konservativ zu sein, heißt übrigens<br />
auch, Haltung zu zeigen und Stil zu bewahren. Öffentlich<br />
übereinander herzufallen, ist damit nicht vereinbar. Und<br />
was in vertraulicher Runde besprochen wird, darf nicht<br />
an die Öffentlichkeit durchgestochen werden. Das sind<br />
Tugenden, die wir zuallererst wieder beherzigen müssen.<br />
Wie müsste nach Ihrer Ansicht ein moderner<br />
Konservatismus im 21. Jahrhundert aussehen?<br />
Wir dürfen der konservativen Wurzel nicht das Etikett<br />
„rückwärtsgewandt“ oder „altbacken“ aufkleben, wie es<br />
zu oft geschieht. Konservativ zu sein, heißt, das menschliche<br />
Bedürfnis nach Sicherheit, Beständigkeit und<br />
Zugehörigkeit politisch zu adressieren. Wir müssen<br />
bewahren, was sich bewährt hat, ohne uns dem Neuen<br />
zu verschließen, wenn es sich als besser erweist.<br />
„IN VIELEN<br />
BEREICHEN<br />
SIND WIR<br />
INHALTLICH<br />
NICHT GUT<br />
AUFGE-<br />
STELLT.“<br />
Carsten Linnemann<br />
Zugleich müssen wir große Veränderungen stärker als<br />
früher mit inhaltlichen Debatten verknüpfen.<br />
Die Aussetzung der Wehrpflicht beispielsweise war<br />
zwar richtig, weil nur noch 15 Prozent eines Jahrgangs<br />
eingezogen wurden. Allerdings haben wir nicht<br />
ausreichend darüber debattiert. Am Ende einer solchen<br />
Debatte hätten wir dann vielleicht ein verpflichtendes<br />
Gesellschaftsjahr für alle jungen Menschen eingeführt.<br />
Was bedeutet ein moderner Konservatismus beispielsweise<br />
konkret in der Europapolitik? Wie stellt<br />
sich die CDU die Zukunft des Nationalstaats in der<br />
EU vor?<br />
Die EU muss sich auf die Aufgaben beschränken,<br />
bei denen es einen europäischen Mehrwert gibt. Das gilt<br />
zum Beispiel in der Außen-, Verteidigungs- und<br />
Handelspolitik. Aber sicher nicht in der Sozialpolitik,<br />
denn der Sozialstaat in Deutschland ist ein ganz anderer<br />
als beispielsweise in Rumänien oder Bulgarien. Wir müssen<br />
aufpassen, dass die EU nicht schleichend immer mehr<br />
Kompetenzen an sich zieht.<br />
Und was bedeutet ein moderner Konservatismus in<br />
Ihren Augen in der Migrations- und Asylpolitik?<br />
Der moderne Konservative weiß, dass es in einer Gesellschaft<br />
eine gemeinsame Wertebasis braucht.<br />
Denn ansonsten bilden sich Parallelgesellschaften,<br />
die sich absondern. Das fördert das Misstrauen in einer<br />
Gesellschaft, die Bindekräfte lassen nach, die Solidarität<br />
schwindet. Für einen Sozialstaat, der genau auf dieser
FEBRUAR <strong>2022</strong> / AUSGABE 1<br />
BUCH EINS<br />
Schwerpunkt | 5<br />
Solidarität fußt, kann so etwas gefährlich werden. Daher<br />
ist es wichtig, dass wir kontrollieren, wer zu uns in Land<br />
kommt. Ohne Grenzschutz geht das nicht. Und da müssen<br />
wir mit einem Missverständnis aufräumen. Manche<br />
glauben, wir haben die Grenzen abgeschafft. Das ist aber<br />
nicht der Fall, wir haben die Grenzen nur an die Außengrenze<br />
der Europäischen Union beziehungsweise an die<br />
Schengen-Grenze verschoben. Dort muss also kontrolliert<br />
werden. Wenn das nicht passiert, droht ein Staatsversagen<br />
wie 2<strong>01</strong>5, als wir den Überblick verloren haben, wer sich<br />
in Deutschland aufhält und wer nicht. Für einen modernen<br />
Konservatismus können offene Grenzen keine Lösung<br />
sein. Stattdessen müssen wir unseren humanitären<br />
Pflichten mit Kontingentlösungen nachkommen. So können<br />
wir den wirklich Bedürftigen helfen.<br />
Die ehemalige Familienministerin Kristina Schröder<br />
hat zusammen mit dem Mainzer Historiker und<br />
CDU-Mitglied Andreas Rödder einen Thinktank<br />
für bürgerliche Politik gegründet. Werden Sie den<br />
Input des Thinktanks in die Programmarbeit einfließen<br />
lassen?<br />
Natürlich werde ich Herrn Rödder eng einbinden in die<br />
Arbeit der Programmkommission. Er zählt zu den<br />
he raus ragenden Historikern Deutschlands und kann<br />
einen wertvollen Beitrag leisten.<br />
Muss die CDU nach den langen Jahren an der Macht<br />
das inhaltliche Debattieren erst wieder neu lernen?<br />
Nicht nur die Union, sondern auch die Gesellschaft insgesamt<br />
muss das wieder lernen. Die Aufmerksamkeitsspanne<br />
ist bei vielen Menschen heute sehr kurz, das hat<br />
auch mit den sozialen Medien zu tun. Die Frustrationstoleranz<br />
gegenüber anderen Meinungen nimmt in den<br />
Echokammern, die sich dort bilden, immer weiter ab.<br />
Viele haben dabei verlernt, auf ein Argument des Gegenübers<br />
einzugehen und auch kurz darüber nachzudenken,<br />
ob der andere vielleicht recht hat. Aber ja, in der CDU<br />
müssen wir die Debattenkultur wieder stärken.<br />
Der Niedergang der Mitte-rechts-Parteien ist in<br />
anderen Ländern Europas schon weit fortgeschritten.<br />
In den sechs Gründungsländern der EU<br />
regiert inzwischen kein Konservativer mehr.<br />
Was gibt Ihnen da Zuversicht?<br />
Die CDU hat meiner Meinung nach noch die Chance,<br />
sich als konstruktive Opposition zu erneuern. Damit wir<br />
uns nicht selbst marginalisieren, müssen wir nicht nur<br />
die Breite der CDU wieder abbilden, sondern auch<br />
entsprechende Persönlichkeiten nach vorne bringen.<br />
Biedenkopf, Geißler und Blüm sind echte Typen gewesen,<br />
und die wurden innerhalb der Partei akzeptiert. Wenn<br />
wir das wieder schaffen, wird es uns nicht so ergehen wie<br />
unseren Schwesterparteien in Italien und Holland.<br />
Die Außengrenzen der Europäischen Union – hier ein polnischer Soldat<br />
an der Grenze zu Belarus – müssten besser kontrolliert werden,<br />
findet Carsten Linnemann. Seinen humanitären Pflichten solle Deutschland<br />
mit Kontingenten nachkommen. Foto: Wojtek Jargilo/dpa<br />
Friedrich Merz dürfte allerdings vor allem ältere<br />
Semester ansprechen. Hat die CDU mit ihrem neuen<br />
Parteichef einen guten Griff getan?<br />
Wenn wir denselben Fehler machen wie in den letzten<br />
zehn Jahren und uns nur auf eine Person konzentrieren,<br />
dann war es das mit der CDU als Volkspartei. Das weiß<br />
auch Friedrich Merz. Und er wird viele Menschen überraschen,<br />
indem er nicht sich in den Vordergrund stellt,<br />
sondern die CDU. In den nächsten vier Jahren müssen<br />
fünf bis zehn Persönlichkeiten so hervorkommen,<br />
dass auch junge Menschen sagen: Ja, das ist meine Partei.<br />
Die Union sitzt im Bundestag nun zwischen der<br />
FDP auf der linken und der AfD auf der rechten<br />
Seite. Wie wollen Sie sich programmatisch von der<br />
einen wie der anderen Partei abgrenzen?<br />
Indem wir erstens das Abstimmungsverhalten der AfD<br />
ignorieren. Unser Abstimmungsverhalten darf einzig<br />
von unserem Kompass abhängen und nicht von dem,<br />
was andere Parteien wie die FDP oder die AfD machen.<br />
Zweitens müssen wir uns durch unsere Sprache von der<br />
ressentimentgeladenen Rhetorik der AfD abgrenzen.<br />
Drittens müssen wir in den Bundesländern, in denen wir<br />
regieren, zeigen, dass wir Probleme auch anpacken.<br />
Ein Beispiel: In NRW schieben wir islamistische Gefährder<br />
konsequent ab. So bekommen wir Glaubwürdigkeit.<br />
Die Ampel dagegen adressiert das Thema<br />
überhaupt nicht.<br />
Bleiben wir kurz bei der AfD. Die anderen Parteien<br />
haben bisher jeden Kandidaten der AfD für das<br />
Bundestagspräsidium abgelehnt, obwohl ihr laut<br />
Geschäftsordnung ein Vizeposten zusteht.<br />
Ist das aus Ihrer Sicht richtig?<br />
Nein. Die AfD ist eine demokratisch legitimierte Partei,<br />
die nicht verboten ist. Ich schaue mir die Kandidaten an<br />
und mache die Abstimmung von der Person abhängig.<br />
Wenn jemand dabei ist, den ich für geeignet halte, dann<br />
spricht aus meiner Sicht nichts gegen eine Zustimmung.<br />
Andernfalls lehne ich ab. Wir machen die AfD sonst nur<br />
größer, als sie tatsächlich ist, und geben ihr Gelegenheit,<br />
sich als Opfer zu inszenieren.<br />
Wie sehen Sie Ihre persönliche Zukunft in der<br />
CDU: Kanzlerkandidat in vier Jahren?<br />
Ach, das ist doch Quatsch. Die Frage ist doch vielmehr,<br />
ob wir in vier Jahren überhaupt einen Kanzlerkandidaten<br />
stellen können, der eine reelle Chance hat zu gewinnen.<br />
Ich kandidiere als stellvertretender Parteivorsitzender und<br />
mache mir im Moment viele Gedanken um diese<br />
Programmkommission. Ich habe angeprangert, was in<br />
den letzten zehn Jahren falsch gelaufen ist, und will nun<br />
dabei helfen, das Ruder herumzureißen. Dieser Aufgabe<br />
muss ich gerecht werden.<br />
In Paderborn – hier der Neptunbrunnen auf dem Marktplatz – kam Carsten Linnemann zur<br />
Welt, hier hat er seinen Wahlkreis. Foto: Shutterstock<br />
KURZBIOGRAFIE<br />
Ein waschechter<br />
Ostwestfale<br />
Der CDU-Politiker Carsten Linnemann<br />
kam am 10. August 1977 in Paderborn<br />
zur Welt. Dort eröffneten seine Eltern<br />
im selben Jahr eine Buchhandlung, die<br />
sie bis 2<strong>01</strong>9 führten. „Früh haben mein<br />
Bruder und ich gelernt, was unternehmerische<br />
Selbstständigkeit bedeutet“,<br />
schreibt Linnemann auf seiner Homepage.<br />
In Paderborn und seinem nahe<br />
gelegenen Heimatort Schwaney sei er<br />
auch heute noch zu Hause. „Hier leben<br />
meine Familie und Freunde. Hier bekomme<br />
ich beim Skat in meiner Stammkneipe<br />
den Kopf frei und kann beim<br />
Joggen auftanken.“<br />
Nach dem Abitur am Reismann-Gymnasium<br />
Paderborn und dem Wehrdienst<br />
arbeitete Linnemann ein Jahr<br />
lang in der elterlichen Buchhandlung,<br />
ehe er ein Studium der Betriebswirtschaftslehre<br />
an der Fachhochschule<br />
der Wirtschaft in Paderborn aufnahm,<br />
das er als Diplom-Kaufmann beendete.<br />
An der TU Chemnitz erwarb er anschließend<br />
seinen Doktortitel. Von<br />
2007 bis 2009 arbeitete Linnemann als<br />
Volkswirt bei der IKB Deutsche Industriebank.<br />
Bei der Bundestagswahl 2009<br />
holte der Katholik das Direktmandat für<br />
die CDU im Wahlkreis Paderborn mit<br />
52,1 Prozent der Erststimmen. Seinen<br />
Wahlkreis hat er seither bei allen Bundestagswahlen<br />
verteidigt.<br />
Von 2<strong>01</strong>3 bis 2021 führte Linnemann die<br />
Mittelstands- und Wirtschaftsunion<br />
(MIT), eine Vereinigung der Unionsparteien.<br />
Seit 2<strong>01</strong>8 war er stellvertretender<br />
Fraktionsvorsitzender für die Bereiche<br />
Wirtschaft, Mittelstand und Tourismus.<br />
Dem neuen Fraktionsvorstand gehört<br />
er nicht mehr an, stattdessen wurde er<br />
zum stellvertretenden Parteichef gewählt.<br />
Der sportbegeisterte Linnemann<br />
hat außerdem die Stiftung Lebenslauf<br />
gegründet, die benachteiligten Jugendlichen<br />
durch Sportprojekte helfen<br />
will. Seit 2<strong>01</strong>8 ist er Vizepräsident des<br />
SC Paderborn 07.
BUCH EINS<br />
6 | Berichte AUSGABE 1 / FEBRUAR <strong>2022</strong><br />
Weniger Apotheken<br />
in <strong>Westfalen</strong><br />
Münster. Die Apothekerkammer<br />
<strong>Westfalen</strong>-Lippe (AKWL) hat im 17. Jahr<br />
in Folge einen Rückgang auf<br />
nunmehr nur noch 1797 Betriebsstätten<br />
registriert. Vier Neueröffnungen<br />
standen im vergangenen Jahr<br />
34 Schließungen gegenüber. Zugleich<br />
gebe es eine große Nachfrage nach<br />
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.<br />
Über 1000 unbesetzte Stellen<br />
gebe es im Kammergebiet – und zwar<br />
in allen Berufsgruppen. AKWL-Hauptgeschäftsführer<br />
Andreas Walter erklärt:<br />
„Wir sehen einen klaren Trend<br />
zu größeren Betriebsstätten, die mit<br />
mehr Personal mehr Patientinnen<br />
und Patienten versorgen.“ Mehr als<br />
jede vierte Apotheke in <strong>Westfalen</strong>-<br />
Lippe werde inzwischen als Filiale<br />
geführt (474, Stand 31.12.2021). Somit<br />
stünden hinter den 1797 Apotheken<br />
nur noch 1323 Inhaber. „Das wiede rum<br />
ist der niedrigste Wert an Selbstständigen<br />
seit fast 60 Jahren”, so Walter.<br />
Im Durchschnitt versorgt eine Apotheke<br />
in <strong>Westfalen</strong>-Lippe gut 4700 Patientinnen<br />
und Patienten. Das sind laut<br />
AKWL etwa 10 Prozent mehr als im<br />
Bundesdurchschnitt. Die geringe<br />
Apothekendichte korrespondiere mit<br />
der im Bundesdurchschnitt geringen<br />
Hausarztdichte in den Regierungsbezirken<br />
Arnsberg, Detmold und<br />
Münster.<br />
Zeche Blumenthal<br />
wird umgestaltet<br />
Recklinghausen. Das Projekt<br />
„ Heimat-Ruhr: B7.lab – Kultur, Co-<br />
Working, Technik auf Blumenthal 7“<br />
hat einen Förderbescheid über<br />
294.197 Euro für die Umgestaltung der<br />
ehemaligen Zeche General Blumenthal<br />
erhalten. Die Münsteraner Regierungspräsidentin<br />
Dorothee Feller sagte<br />
bei der Übergabe: „Fragmente der<br />
Bergbaugeschichte zu erhalten, vor<br />
allem jedoch weiterzuentwickeln<br />
und für die heutige Zeit nutzbar zu<br />
machen, ist ein wichtiger Baustein<br />
des Strukturwandels.“ Das Projekt hat<br />
das Ziel, die historische Zeche zu<br />
erhalten und einen Ort für soziale<br />
Begegnungen, Wissenstransfer und<br />
den kreativen Umgang mit Tech nik<br />
zu verwandeln. Eine Bürgerwerkstatt,<br />
ein Co-Working-Space, Platz für Startups,<br />
Vereine und für kulturelle Aktivitäten<br />
sind die wichtigsten Bausteine.<br />
Getragen wird das Projekt vom Verein<br />
Blumenthal 7 e.V. in Recklinghausen.<br />
Selbstständig leben trotz<br />
Einschränkung<br />
Münster. Immer mehr Menschen<br />
mit einer wesentlichen Behinderung<br />
leben in <strong>Westfalen</strong>-Lippe in ihren<br />
eigenen vier Wänden. Das teilt der<br />
<strong>Landschaft</strong>sverband <strong>Westfalen</strong>-Lippe<br />
(LWL) mit. Demnach lebten im Jahr<br />
2020 rund 62 Prozent der insgesamt<br />
57.000 Menschen mit wesentlichen<br />
Behinderungen in einer eigenen<br />
Wohnung. Fünf Jahre zuvor waren es<br />
nur 56 Prozent. LWL-Direktor Matthias<br />
Löb freut sich über die Entwicklung.<br />
„Ein wichtiger Schlüssel für eine inklusive<br />
Gesellschaft sind selbstverständliche<br />
Begegnungen von Menschen mit<br />
und ohne Behinderungen. Das gelingt<br />
aber nur dann, wenn auch Menschen<br />
mit schwereren Beeinträchtigungen<br />
mitten im Dorf oder im Stadtteil in<br />
ihrer Wohnung leben können.“<br />
LWL-Sozialdezernent Matthias Münning<br />
ergänzt: „Zu einem selbstbestimmten<br />
Leben gehört auch die<br />
Art, wie ich wohne. Das wollen wir<br />
den Menschen mit wesentlichen<br />
Behinderungen nicht vorschreiben.<br />
Sie sollen möglichst selbst entscheiden.”<br />
MÜNSTER<br />
Bauern fordern<br />
klare Perspektive<br />
WLV-Präsident appelliert an<br />
die neue Bundesregierung<br />
Von Manuel Glasfort<br />
Die Landwirte in <strong>Westfalen</strong>-Lippe<br />
wollen das neue Jahr nutzen, um<br />
gemeinsam mit anderen Kräften in der<br />
Gesellschaft neue Perspektiven für ihre<br />
Betriebe zu schaffen. Dieses Ziel für<br />
<strong>2022</strong> gab Hubertus Beringmeier, Präsident<br />
des Westfälisch-Lippischen<br />
Landwirtschaftsverbands (WLV), im<br />
Rahmen des Jahrespressegesprächs des<br />
Verbands in Münster aus. Trotz teilweise<br />
sehr schwieriger Rahmenbedingungen<br />
sieht der Verband im neuen<br />
Jahr auch Chancen für eine neue Wertschätzung<br />
der Landwirtschaft. Der<br />
Bundesregierung bot er an, konstruktiv<br />
an der Lösung aktueller Herausforderungen<br />
zu arbeiten. Er unterstrich, dass<br />
die Bauern zu Veränderungen bereit<br />
seien. Allerdings dürften sie nicht auf<br />
den Kosten für neue Auflagen im Bereich<br />
Tierwohl oder Umweltschutz<br />
sitzen bleiben.<br />
Die wirtschaftliche Situation der<br />
Bauernfamilien in <strong>Westfalen</strong>-Lippe sei<br />
je nach Produktionsschwerpunkt er-<br />
nüchternd bis dramatisch, sagte Beringmeier.<br />
Rinderhalter hätten nach<br />
langer Durststrecke zwar wieder<br />
Grund zu Optimismus, und auch die<br />
heimischen Ackerbauern könnten aktuell<br />
gute Preise für Getreide und Raps<br />
erzielen, kämpften allerdings mit explosionsartig<br />
gestiegenen Kosten für<br />
Energie und Düngemittel. Schlicht<br />
dramatisch sei nach Einschätzung des<br />
WLV-Präsidenten dagegen die Lage in<br />
der Schweinehaltung. Hier habe die<br />
Corona-Pandemie dazu geführt, dass<br />
die Absatzzahlen und in der Folge<br />
auch die Erzeugerpreise so stark eingebrochen<br />
seien, dass immer mehr<br />
Johannes Schulte-Althoff:<br />
Ein Urgestein geht von Bord<br />
Münster. Mit Finanzvorstand Johannes<br />
Schulte-Althoff ist zum Jahresende<br />
bei der Agravis ein echtes genossenschaftliches<br />
und westfälisches Urgestein<br />
in den Ruhestand verabschiedet<br />
worden. Angefangen als Auszubildender<br />
bei einer Raiffeisengenossenschaft<br />
legte der heute 64-Jährige eine beachtliche<br />
Karriere hin. Über den Westfälischen<br />
Genossenschaftsverband kam<br />
er zur damaligen Raiffeisen Central-<br />
Genossenschaft. Seit Gründung der<br />
Agravis Raiffeisen AG im Jahr 2004<br />
war er Mitglied des Vorstandes.<br />
„Der künftige Finanzvorstand Hermann<br />
Hesseler übernimmt ein Unternehmen<br />
mit guter Eigenkapitalausstattung<br />
und einer hohen Liquidität. Beides<br />
ist für die nächsten Jahre gesichert“,<br />
sagte Schulte-Althoff bei seiner Verabschiedung.<br />
Die genossenschaftliche<br />
Struktur habe sich als sehr stabil und<br />
robust erwiesen. Es zahle sich aus, dass<br />
sich die Genossenschaften und die<br />
Agravis selbst direkt und indirekt im<br />
Eigentum von Landwirtinnen und<br />
Landwirten befänden. „Wenn der Wille<br />
zur beiderseitigen vertrauensvollen<br />
Zusammenarbeit weiter bestehen<br />
bleibt und auch gelebt wird, dann ist<br />
der genossenschaftliche Verbund im<br />
Markt unschlagbar. Das ist meine feste<br />
Überzeugung“, so Schulte-Althoff.<br />
Die Agravis werde sich in Zukunft<br />
zum Digitalisierungsführer entwickeln.<br />
„Mit unserer umfangreichen<br />
Produktpalette und lösungsorientierten<br />
Dienstleistungsangeboten sind<br />
wir auch in zehn und mehr Jahren<br />
weiter der starke Partner für Genossenschaften<br />
und die Landwirtschaft.“<br />
Persönlich wünscht sich der begeisterte<br />
Jäger vor allem mehr Zeit für<br />
die Familie: „Ich habe bereits viele<br />
Hobbys, denen ich intensiver nachgehen<br />
möchte. Und ich habe sieben Enkelkinder,<br />
die gern noch mehr Zeit mit<br />
ihrem Opa verbringen wollen.“ sle<br />
Der Aufsichtsratsvorsitzende Franz-Josef Holzenkamp und seine Stellvertreterin<br />
Friederike Brocks verabschiedeten Johannes Schulte-Althoff (links). Foto: Agravis<br />
Vieles in der Landwirtschaft liegt derzeit weit jenseits von Idylle. Die wirtschaftliche Lage ist schwierig. Foto: Adobe Stock<br />
Betriebe die Schweinehaltung aufgäben.<br />
Die Preise seien „jenseits von Gut<br />
und Böse und nicht annähernd kostendeckend“,<br />
sagte Beringmeier.<br />
Münster. Aus Großstadtredaktionen<br />
betrachtet ist das Leben auf dem Land<br />
wahlweise idyllisch oder öde. Die<br />
spannende Wahrheit dazwischen<br />
nimmt der neue Landbrief der Wochenblatt-Redaktion<br />
in den Blick: gut<br />
recherchiert, unabhängig und verständlich.<br />
Ob Digitales, Garten oder Energie,<br />
ob ländliche Infrastruktur, Ehrenamt<br />
oder Dorfkultur: Wer auf dem Land<br />
wohnt, hat besondere Fragen, besondere<br />
Themenwünsche und besondere<br />
Interessen. Um diese Themen kümmert<br />
sich jetzt ein neues Medienformat<br />
aus dem Landwirtschaftsverlag:<br />
der Landbrief.<br />
Das neue Medienformat wird ausschließlich<br />
digital erscheinen. Er ist<br />
kein schnell am Rechner zusammengebastelter<br />
Newsletter, wie es sie zu<br />
Tausenden gibt. Sondern: Er ist ein<br />
Brief. Er greift also eine allseits bekannte<br />
und persönliche Form der Mitteilung<br />
auf und interpretiert sie neu:<br />
journalistisch und digital.<br />
Scharfe Kritik am Handel<br />
Grundsätzlich kritisierte der WLV-<br />
Präsident, dass von jedem Euro, den<br />
Verbraucherinnen und Verbraucher<br />
heute für Nahrungsmittel ausgeben,<br />
im Durchschnitt nur noch 20 Cent bei<br />
den Bauernfamilien ankämen. Durch<br />
die Marktmacht des Lebensmitteleinzelhandels<br />
und die Kürzungen der<br />
EU-Agrarzahlungen ab 2023 sieht er<br />
die Landwirtschaft unter wachsendem<br />
Druck. Beringmeier sparte nicht<br />
mit Kritik am Lebensmitteleinzelhandel.<br />
Dieser habe angesichts hoher Inflation<br />
den Slogan ausgegeben: „Alles<br />
wird teurer, nur wir bleiben günstig.“<br />
Das funktioniere so nicht, sagte der<br />
WLV-Präsident und monierte, die<br />
großen Händler wie Edeka, Rewe und<br />
Aldi hätten in der Corona-Krise Rekordumsätze<br />
und teils auch -gewinne<br />
eingefahren.<br />
Der neuen Ampelregierung bot er<br />
Kooperation an, sowohl beim Umbau<br />
der Landwirtschaft zu mehr Tierhaltung,<br />
als auch beim Ausbau der erneuerbaren<br />
Energien.<br />
Landbrief: Digitales Medium<br />
für das Land gestartet<br />
Marit Schröder und<br />
Gisbert Strotdrees vom<br />
Wochenblatt wenden<br />
sich jede Woche neu<br />
mit einem Brief an ihre<br />
Leser innen und Leser.<br />
Foto: LV<br />
Medien, die aus dem Land, mit dem<br />
Land und für das Land sprechen, die<br />
also aus einer regionalen, ländlichen<br />
Perspektive die großen Themen aus<br />
Politik, Wirtschaft und Kultur aufgreifen,<br />
sind Mangelware. Wer sollte<br />
das auch tun? Viele Tageszeitungen<br />
leiden unter Auflagenschwund und<br />
ziehen sich aus der Fläche zurück. Lokalredaktionen<br />
werden zusammengelegt,<br />
manche sogar ganz aufgelöst.<br />
Und die großen sogenannten Leitmedien<br />
– egal, ob gedruckt, gesendet oder<br />
online verbreitet? Aus deren Sicht<br />
scheint sich das wahre Leben in den<br />
Metropolen abzuspielen: in München,<br />
Hamburg, Berlin, Frankfurt oder<br />
Köln. Dabei mangelt es nicht an Themen<br />
– über einstürzende Windräder,<br />
schließende Geburtsstationen oder<br />
warum Kultur als Identifikationsfaktor<br />
auf dem Land so wichtig ist.<br />
Eine Anmeldung ist unter www.<br />
landbrief.de kostenfrei möglich. Dann<br />
bekommen Sie den Landbrief immer<br />
mittwochs per E-Mail zugeschickt. nri
FEBRUAR <strong>2022</strong> / AUSGABE 1<br />
BUCH EINS<br />
Berichte | 7<br />
MÜNSTER<br />
„Ich habe eine Scharnierfunktion“<br />
Der Landwirtschaftsbeauftragte der Stadt Münster<br />
über seine Aufgaben und Ziele<br />
Von Stefan Legge<br />
Herr Pröbsting, seit einem halben<br />
Jahr sind Sie der erste Landwirtschaftsbeauftragte<br />
der Stadt Münster.<br />
Warum gibt es diese Stelle?<br />
Als zweitgrößte Kommune in NRW<br />
mit über 300 Quadratkilometer Fläche<br />
hat die Stadt Münster viele Berührungspunkte<br />
mit den etwa 600 Landwirten.<br />
Das Verhältnis zwischen den<br />
Bäuerinnen und Bauern und der Stadtverwaltung<br />
ist nicht immer einfach<br />
und reibungslos. Es ist gut und wichtig,<br />
dass Münster wächst, aber der<br />
Flächenverbrauch birgt eine Menge<br />
Zündstoff. Auf Initiative des landwirtschaftlichen<br />
Ehrenamtes und des<br />
Oberbürgermeisters hat man diese<br />
Stelle geschaffen, um das Verhältnis<br />
zwischen der Stadtverwaltung und<br />
den Landwirten weiter zu verbessern.<br />
Was bringen Sie mit für diesen Job?<br />
Ich habe Landwirtschaft gelernt und<br />
studiert. Danach war ich 20 Jahre bei<br />
der Landwirtschaftskammer NRW als<br />
Unternehmensberater in den Kreisen<br />
Warendorf und Steinfurt und in der<br />
Stadt Münster unterwegs. Ich habe ein<br />
stabiles Netzwerk und viel Erfahrung<br />
im Umgang mit landwirtschaftlichen<br />
Unternehmern. Zudem weiß ich um<br />
die Sorgen und Nöte der landwirtschaftlichen<br />
Familienbetriebe.<br />
Stefan Pröbsting vermittelt zwischen<br />
landwirtschaftlichen und kommunalen<br />
Interessen. Foto: Stadt Münster<br />
Wo ist die Stelle angesiedelt, und<br />
was sind Ihre Aufgaben?<br />
Die Stelle ist direkt im Dezernat des<br />
Oberbürgermeisters angesiedelt. Hier<br />
berate ich die Verwaltungsleitung und<br />
deren Ämter in allen landwirtschaftlichen<br />
Sachfragen. Des Weiteren<br />
werde ich projektbezogen vom Bauordnungsamt,<br />
dem Amt für Immobilienmanagement<br />
oder zu anderen<br />
Vorgängen hinzugezogen. Hier bin<br />
ich häufig in der Vermittlerrolle, bringe<br />
mich aber auch mit meinem Fachwissen<br />
ein und arbeite zu. Manchmal<br />
sind Verhandlungen festgefahren,<br />
und man braucht jemanden, der eine<br />
Scharnierfunktion übernimmt, damit<br />
man einen Schritt weiterkommt. Ziel<br />
ist es für mich, die beidseitigen gesellschaftlichen,<br />
politischen und landwirtschaftlichen<br />
Belange übereinzubringen.<br />
Damit dieses reibungsärmer<br />
funktioniert, ist eine gemeinsame<br />
strategische Planung in allen Bereichen,<br />
die die Landwirtschaft betreffen,<br />
von hoher Priorität.<br />
Wie fällt Ihr erstes Fazit aus?<br />
Mittlerweile bin ich sehr zufrieden und<br />
habe das Gefühl, sowohl im Job als<br />
auch bei den Landwirten gut angekommen<br />
zu sein! Die ersten Wochen habe<br />
ich genutzt, um mich in der Stadtverwaltung<br />
bekannt zu machen. Da bin<br />
ich durchaus auch auf Skepsis gestoßen.<br />
Vieles hat sich aber schon gut eingespielt.<br />
Einige Gespräche und Verhandlungen,<br />
die ich begleiten konnte,<br />
nehmen einen positiven Verlauf und<br />
sind zum Teil auch abgeschlossen.<br />
Sind Sie auch Ansprechpartner für<br />
die Landwirte?<br />
Ausdrücklich ja. Da, wo Vorstellungen<br />
und Interessen nicht auf einer gemeinsamen<br />
Linie sind oder die Fronten verhärtet<br />
sind, kann ich hoffentlich das<br />
Eis brechen. Zwar habe ich die Interessen<br />
der Stadt Münster zu vertreten,<br />
aber ich habe auch ein offenes Ohr für<br />
die Betriebe. Aus meiner vorherigen<br />
Tätigkeit weiß ich, dass die Landwirte<br />
dankbar sind, wenn man ihnen eine<br />
Perspektive aufzeigen kann oder praxisorientierte<br />
Lösungsansätze einbringt.<br />
Dann ist in manchen Fällen der<br />
Druck schon raus. Ziel ist es für mich,<br />
die beidseitigen politischen und landwirtschaftlichen<br />
Belange übereinzubringen<br />
und Prozesse für beide Seiten<br />
gewinnbringend zu begleiten!<br />
Zahl der Milchbetriebe<br />
geht weiter zurück<br />
Krefeld. Weniger Betriebe, weniger<br />
Kühe, weniger Milch: Die Milchwirtschaft<br />
Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> hat im<br />
vergangenen Jahr deutliche Rückgänge<br />
verzeichnet. Die Zahl der<br />
Milchviehhalter sank um 3,5 Prozent<br />
und damit erstmals unter die Marke<br />
von 5000 Betrieben, teilte die Landesvereinigung<br />
der Milchwirtschaft NRW<br />
mit. Die bislang relativ stabile Zahl der<br />
Milchkühe nahm zugleich laut der<br />
Novemberzählung um 2,3 Prozent auf<br />
gut 384.200 ab. Geschäftsführer<br />
Rudolf Schmidt sprach von einer<br />
Trendumkehr bei der Milchkuhzahl.<br />
Die Milchmenge schrumpfte um<br />
2,2 Prozent auf 2,7 Millionen Tonnen.<br />
Immer weniger Landwirte halten<br />
Milchkühe. Dieser Trend ist bereits<br />
seit vielen Jahren zu beobachten.<br />
Allerdings ging dieser Prozess bisher<br />
mit immer größeren Tierbeständen<br />
bei den Landwirten einher, die an der<br />
Milchproduktion festhalten.<br />
Im Durchschnitt sind das aktuell<br />
77 Milchkühe je Betrieb.<br />
Unterdessen hat Aldi den Preis für<br />
Frischmilch in der untersten Preislage<br />
um 3 Cent je Liter angehoben.<br />
Frischmilch mit 1,5 Prozent Fett kostet<br />
jetzt 75 Cent je Liter und mit<br />
3,5 Prozent Fett 83 Cent je Liter, wie<br />
Aldi Nord mitteilte. Zugleich kündigten<br />
Aldi Nord und Aldi Süd an, in absehbarer<br />
Zeit bei ihren Eigenmarken auf<br />
Milch verzichten zu wollen, bei deren<br />
Herstellung nur die gesetzlichen<br />
Mindestanforderungen an die Tierhaltung<br />
erfüllt werden. Die Umstellung<br />
soll bis 2024 erfolgen. Edeka will diesen<br />
Schritt schon <strong>2022</strong> gehen.<br />
Regional. Original<br />
Herzblut, Handwerk und<br />
Heimatliebe: unsere Tipps für<br />
besondere regionale Produkte<br />
<strong>Westfalen</strong>-Tipp auf Seite 15.
BUCH EINS<br />
8 | <strong>Westfalen</strong> in Zahlen<br />
AUSGABE 1 / FEBRUAR <strong>2022</strong><br />
Verkehr und Mobilität<br />
Wie wir uns fortbewegen<br />
Das Auto ist das<br />
Mittel der Wahl<br />
20 Tsd. 4,7 Mio. 24 Tsd. 6300<br />
Trotz ausgerufener Mobilitätswende:<br />
In <strong>Westfalen</strong> ist das Auto unangefochten<br />
das Fortbewegungsmittel der<br />
Wahl. Laut Deutschem Mobilitätspanel<br />
des BMDV werden über die Hälfte<br />
der Wege mit dem Pkw zurückgelegt.<br />
In ländlichen Räumen ist der Anteil<br />
aufgrund fehlender Alternativen noch<br />
höher. Hier ist das Auto oft die einzige<br />
Möglichkeit, in einer angemessenen<br />
Zeit den Arbeitsplatz zu erreichen.<br />
Mehr als die Hälfte der Erwerbstätigen<br />
in NRW ist selbst im Corona-Jahr 2020<br />
täglich zur Arbeit gependelt.<br />
Fahrzeuge schwerer<br />
als 12 Tonnen<br />
passieren täglich die A 2 zwischen<br />
Porta Westfalica und Bad Oeynhausen.<br />
Damit ist dieser Autobahnabschnitt<br />
der am stärksten beanspruchte in<br />
<strong>Westfalen</strong>.<br />
Tonnen Güter<br />
im Jahr<br />
werden am Hafen Gelsenkirchen<br />
umgeschlagen. Er ist damit vor Hamm<br />
(3,8 Mio. Tonnen) und Dortmund<br />
(1,7 Mio. Tonnen) der größte Binnenhafen<br />
in <strong>Westfalen</strong>. Etwa 75 Prozent der<br />
Güter werden in NRW per Lkw transportiert.<br />
Verkehrsunfälle<br />
mit Verletzten<br />
gab es im Jahr 2020 in <strong>Westfalen</strong>.<br />
Der Regierungsbezirk Arnsberg führt<br />
mit 9811 erfassten Karambolagen die<br />
Statistik an. Im Münsterland ereigneten<br />
sich 8304 Unfälle mit Verletzten,<br />
in Ostwestfalen waren es 5840.<br />
Kilometer<br />
Eisenbahnstrecke<br />
gibt es in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong>.<br />
780 Kilometer davon dienen dem<br />
Straßenbahnverkehr. An etwa<br />
2000 Haltestellen können die<br />
Menschen ein- und aussteigen.<br />
4,7 Mio.<br />
Autos<br />
sind in <strong>Westfalen</strong> zugelassen. An der<br />
Spitze liegt mit 1,98 Millionen Pkw der<br />
Regierungsbezirk Arnsberg. In Ostwestfalen<br />
(1,16 Mio.) und im Münsterland<br />
(1,48 Mio.) gibt es etwas weniger<br />
Autos.<br />
2,3 Mrd.<br />
Fahrgäste<br />
Pit Clausen, Oberbürgermeister der Stadt Bielefeld und Vorsitzender des Städtetages NRW:<br />
„Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, muss die Verkehrswende richtig durchstarten.<br />
Damit viele Menschen auf das eigene Auto verzichten, müssen die Angebote stimmen:<br />
moderne Busse und Bahnen, dichter Takt, gute Anbindungen von Stadt ins Umland und<br />
mehr Rad- und Pooling-Anbieter für kurze Strecken.“<br />
Pendlerquoten nach Regierungsbezirken<br />
in Prozent<br />
Detmold<br />
50,3<br />
49,8<br />
in Bussen und Bahnen zählt das Statistische<br />
Bundesamt in NRW pro Jahr.<br />
Sie legen zusammen etwa 19 Milliarden<br />
Kilometer an Fahrstrecke zurück.<br />
Das beliebteste Verkehrsmittel im<br />
ÖPNV ist der Bus, gefolgt von<br />
Straßenbahnen und Eisenbahnen.<br />
Münster<br />
Arnsberg<br />
53,7<br />
54,3<br />
54,5<br />
51,1<br />
644<br />
Pkw<br />
Auspendlerquote<br />
(Anteil der Auspendler an allen in<br />
der Gemeinde wohnhaften<br />
Erwerbspersonen)<br />
Einpendlerquote<br />
(Anteil der Einpendler an allen in<br />
einer Gemeinde Beschäftigten)<br />
je 1000 Einwohner zählen die Statistiker<br />
im Kreis Olpe. Das ist der höchste<br />
kreisweite Wert in <strong>Westfalen</strong>. Auf der<br />
Ebene der Regierungsbezirke liegt<br />
Detmold (590) hier vor Arnsberg (564)<br />
und Münster (556).<br />
Straßen in Kilometern je Regierungsbezirk<br />
2962<br />
1,3 %<br />
2183 2183<br />
2155<br />
reine Elektroautos<br />
Das war der Anteil am gesamten<br />
Pkw-Bestand in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong><br />
im Jahr 2021. Bei den Neu zulas sungen<br />
lag der Anteil bei über 7 Prozent –<br />
Tendenz stark steigend.<br />
227<br />
774<br />
2382 2262<br />
356<br />
756<br />
464<br />
1091<br />
Autobahnen<br />
Bundesstraßen<br />
Landstraßen<br />
Kreisstraßen<br />
Quellen: IT.NRW, BMDV, VM NRW<br />
Detmold<br />
Münster<br />
Arnsberg
AUSGABE 1 / FEBRUAR <strong>2022</strong><br />
www.landschaft-westfalen.de<br />
BUCH ZWEI<br />
Münster: Westfälischer Heimatbund sieht Denkmalschutz gefährdet Seite 10 | Unna: Medaillenhoffnung in Peking Seite 11 |<br />
Ahaus-Heek-Legden: Leader geht in eine neue Runde Seite 12 | Gütersloh: Schüttgut per Mausklick Seite 14<br />
UNNA<br />
Gold<br />
im Visier<br />
Bobpilotin Laura Nolte darf<br />
sich Hoffnungen auf eine<br />
Medaille bei den Olympischen<br />
Winterspielen machen<br />
Von Stefan Legge<br />
Auch wenn sie den Gesamtsieg im Weltcup knapp<br />
verpasst hat: Laura Nolte ist eine ganz heiße<br />
Kandidatin auf olympisches Edelmetall. Bei den<br />
Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar)<br />
zählt sie zu den großen Favoritinnen in den Bobwettbewerben<br />
der Damen. Die 23-Jährige aus Unna fuhr in diesem<br />
Winter in 18 Rennen dreizehnmal aufs Podest, elfmal<br />
landete sie dabei auf den Rängen eins oder zwei.<br />
Die Kristallkugel für den Gesamtsieg im Weltcup ist<br />
ihr vor allem deshalb durch die Lappen gegangen, weil die<br />
deutschen Pilotinnen den Wettkampf in Sigulda kurz nach<br />
dem Jahreswechsel ausgelassen hatten. So reichten Laura<br />
Nolte und ihrer Anschieberin Deborah Levi der dritte Platz<br />
im abschließenden Rennen in St. Moritz nicht mehr, um<br />
an der führenden Amerikanerin Elana Meyers Taylor in<br />
der Gesamtwertung vorbeizuziehen. Ihre volle Konzentration<br />
gilt in diesem Winter aber ohnehin den Olympischen<br />
Spielen.<br />
Dass sie dort im Zweierbob- und auch im erstmals stattfindenden<br />
Monobob-Wettbewerb an den Start geht, ist der<br />
vorläufige Höhepunkt eines echten Senkrechtstarts. Als<br />
Quereinsteigerin aus der Leichtathletik gab ihr der Bundestrainer<br />
René Spies gleich als Pilotin eine Chance. Sie enttäuschte<br />
ihn nicht. Bereits in ihrem ersten Jahr wurde sie<br />
Jugend-Olympiasiegerin in Lillehammer. Nun mischt sie<br />
seit zwei Jahren auf der großen Weltcupbühne mit, aufgrund<br />
ihres Alters formell immer noch als Juniorin. Wie<br />
sie den Weg zum Bobsport gefunden hat, wie ihr Alltag<br />
aussieht und was sie bei den Olympischen Spielen erwartet:<br />
weiter auf Seite 11<br />
Laura Nolte will bei den Olympischen Winterspielen an ihre Erfolge im Weltcup anknüpfen. Foto: Matthias Schrader/dpa<br />
Potenzial ländlicher Räume<br />
Höxter wird Standort des neuen Thünen-Instituts<br />
Von Stefan Legge<br />
Das neue Thünen-Institut wird unweit des historischen Rathauses in der Altstadt von Höxter<br />
angesiedelt sein. Foto: Adobe Stock<br />
Höxter. Mit einem neuen Standort im<br />
ostwestfälischen Höxter will das<br />
Thünen-Institut seine Forschung zu<br />
den ländlichen Räumen ausbauen.<br />
Das neue Fachinstitut für Innovation<br />
und Wertschöpfung im ländlichen<br />
Raum ist bereits gegründet und wird<br />
in das Marktquartier der Kreisstadt<br />
ziehen. Zu den Beweggründen<br />
schreibt das Thünen-Institut in einer<br />
Mitteilung: „Mehr als die Hälfte der<br />
Bevölkerung Deutschlands lebt in<br />
ländlichen Räumen. Die Situation<br />
und das Potenzial ländlicher Räume<br />
sind in den letzten Jahren zunehmend<br />
in den Fokus der Politik des Bundes<br />
gerückt. Um den steigenden Forschungs-<br />
und Beratungsbedarf zu decken,<br />
stärkt das Bundesministerium<br />
für Ernährung und Landwirtschaft<br />
(BMEL) seine Kapazitäten.“<br />
Gab es bislang ein Fachinstitut,<br />
das in aller Breite zu ländlichen Räumen<br />
forscht, so sind es künftig zwei<br />
Institute mit unterschiedlichem, sich<br />
ergänzendem Fokus. In Höxter wird<br />
das ökonomisch ausgerichtete Institut<br />
für Innovation und Wertschöpfung in<br />
ländlichen Räumen aufgebaut. Komplementär<br />
hierzu konzentriert sich<br />
das bisherige Fachinstitut für Ländliche<br />
Räume künftig stärker auf sozialwissenschaftliche<br />
Fragestellungen. Es<br />
wird in Institut für Lebensverhältnisse<br />
in ländlichen Räumen umbenannt,<br />
personell ausgebaut und mittelfristig<br />
nach Höxter verlegt. Mit der gestärkten<br />
Forschungskraft könne die Politik<br />
künftig noch besser beraten und der<br />
Wissensstand über diese wichtigen<br />
Bereiche erweitert werden.<br />
Neuer Leiter des Thünen-Instituts<br />
für Innovation und Wertschöpfung in<br />
ländlichen Räumen ist Christian<br />
Hundt. Er hatte sich in einem gemeinsam<br />
durchgeführten Berufungsverfahren<br />
des Thünen-Instituts und der<br />
Leibniz Universität Hannover durchgesetzt<br />
und erhält in Hannover nun<br />
gleichzeitig eine Professur für Wirtschaft<br />
in ländlichen Räumen. „Ich<br />
freue mich darauf“, so der gebürtige<br />
Ostwestfale, „in Höxter das neue Institut<br />
aufzubauen.“
BUCH ZWEI<br />
10 | Wir in <strong>Westfalen</strong><br />
AUSGABE 1 / FEBRUAR <strong>2022</strong><br />
DÜSSELDORF<br />
Erosion des baukulturellen Erbes<br />
Die Neufassung des Gesetzes weicht den Denkmalschutz auf<br />
Von Silke Eilers, Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes<br />
Foto: Stadt Münster/Münsterview<br />
Proteste begleiten das Gesetzgebungsverfahren.<br />
Foto: Federico Gambarini/dpa<br />
Architektur ist der Produktionsversuch<br />
menschlicher Heimat“, hat Ernst Bloch einmal<br />
formuliert. Die gebaute Umwelt hat Einfluss auf<br />
unsere Lebensqualität und wirkt sich auf unser<br />
Wohlbefinden aus. Die Alltagsarchitektur trägt zur<br />
Identifikation mit der Umgebung bei. Dies meint,<br />
sich den Ort anzueignen, sich zugehörig zu fühlen.<br />
Baukultur in ihrer Vielschichtigkeit – mit ihren<br />
Denkmälern, dem Altbestand ortsbildprägender<br />
Gebäude und aktuellen Architekturen – prägt<br />
das Erscheinungsbild der Kulturlandschaftsräume.<br />
Als architektonisches Gedächtnis, als historischer,<br />
künstlerischer, technikbezogener oder städtebaulicher<br />
Wissensspeicher ist die überlieferte Bausubstanz<br />
Teil der kollektiven Erinnerung. Damit ist sie<br />
zugleich relevanter Standortfaktor, dies auch mit<br />
Blick auf ihre sozialen, ökologischen und ökonomischen<br />
Dimensionen. Auch hinsichtlich der Klimakrise<br />
liegt die Zukunft im Bestand – denn Denkmalpflege<br />
ist Ressourcenschutz und Nachhaltigkeit.<br />
Doch werden bei der Energiebilanz von Bestandsbauten<br />
Nutzungszyklen und die in ihnen gebundene<br />
graue Energie noch zu wenig berücksichtigt.<br />
In Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> hat der Schutz von<br />
Denkmälern Verfassungsrang. Seit 1980 existiert<br />
ein Denkmalschutzgesetz. Das Land zeichnet<br />
sich aus durch einen guten fachlichen Standard im<br />
Denkmalschutz. Dieser wird jedoch nun ohne<br />
Not durch eine Gesetzesneufassung aufs Spiel gesetzt,<br />
welche die Denkmallandschaft, mit 90.000<br />
Bauwerken gerade einmal 1,5 Prozent des gesamten<br />
Baubestandes, gefährdet und den Schutz des<br />
baukulturellen Erbes aus den Augen verliert. Vielmehr<br />
scheinen politisch motivierte und wirtschaftliche<br />
Interessen Vorfahrt zu erhalten. Weisungsfreie<br />
Fachlichkeit wird beschnitten, um<br />
vorgeblich Verfahren zu beschleunigen. Doch sind<br />
hier Arbeitsverdichtung und Überforderung in<br />
vielfach personell wie fachlich schlecht aufgestellten<br />
und widerstreitenden Ansprüchen ausgesetzten<br />
kommunalen Behörden die Folge.<br />
Ohne ein Korrektiv lassen sich künftig vor Ort<br />
leichter Fakten schaffen. Demnach wird es wohl<br />
einfacher, sich „unbequemer“ Gebäude zu entledigen,<br />
Bauwerke etwa, die keine vermeintlichen<br />
Leuchtturmprojekte sind oder einem lukrativen<br />
Neubau im Wege stehen. Bereits heute setzt die<br />
Denkmalpflege auf intelligente Nutzungskonzepte.<br />
Den Druck zur Nutzung um jeden Preis zu<br />
erhöhen, ist das falsche Signal, auch über das Land<br />
hinaus. Bedarf es etwa einer Freigabe der wenigen<br />
Denkmäler im Land für energetische Sanierungen<br />
ohne Augenmaß? Dem Gleichheitsgrundsatz entgegen<br />
steht die vorgesehene Privilegierung bestimmter<br />
Denkmalgruppen wie jener in kirchlichem<br />
Besitz. All dies stößt auf breite Kritik.<br />
Rund 24.000 Menschen haben sich in einer Petition<br />
gegen das Gesetzesvorhaben ausgesprochen.<br />
Gegenüber den Zeugnissen der Vergangenheit<br />
besteht gesellschaftliche Verantwortung. Eine<br />
Verantwortung, die uns alle betrifft. Nur gemeinsam<br />
kann dieses reichhaltige kulturelle Erbe auch<br />
für künftige Generationen bewahrt werden. Damit<br />
die Denkmallandschaft in unserem Land eine Zukunft<br />
hat, sollte kein Gesetz in Kraft treten, das den<br />
Namen Denkmalschutzgesetz nicht verdient hat.<br />
Münsters erste<br />
Generalintendantin<br />
… ist die Opernspezialistin Katharina<br />
Kost-Tolmein. Sie folgt auf Ulrich Peters,<br />
der das Theater Münster seit<br />
2<strong>01</strong>2 leitete. Kost-Tolmein war zuletzt<br />
am Theater Lübeck tätig, davon<br />
sieben Jahre lang als Operndirektorin.<br />
Das Theater bekomme eine erfahrene<br />
und renommierte Theaterfrau an die<br />
Spitze, freut sich Münsters Kulturdezernentin<br />
Cornelia Wilkens und kündigt<br />
neue Sehgewohnheiten an. Ein<br />
großes Einstiegsprojekt der neuen<br />
Generalintendanz wird die Beteiligung<br />
des Theaters am Jubiläumsprogramm<br />
zum Westfälischen Frieden<br />
sein – 2023 jährt sich der Friedensschluss<br />
zum 375. Mal.<br />
… Daniela Niestroy- Althaus<br />
Zukunftsnetz Mobilität NRW<br />
Niestroy-Althaus leitet beim Zukunftsnetz<br />
die Koordinierungsstelle <strong>Westfalen</strong>-Lippe.<br />
Foto: Nahverkehr <strong>Westfalen</strong>-Lippe<br />
Was wurde in fünf Jahren Zukunftsnetz<br />
Mobilität NRW erreicht?<br />
Mit dem Beitritt zum Zukunftsnetz verpflichten<br />
sich alle Mitgliedskommunen<br />
dazu, die nachhaltige Mobilitätsentwicklung<br />
durch kommunales Mobilitätsmanagement<br />
zu fördern. Dass alternative<br />
Mobilitätsangebote einen immer höheren<br />
Stellenwert bekommen, machen<br />
stetig steigende Mitgliederzahlen deutlich:<br />
Landesweit setzen mittlerweile über<br />
270 Kommunen auf die Unterstützung<br />
des Zukunftsnetzes Mobilität NRW, 130<br />
davon in <strong>Westfalen</strong>-Lippe. Diese positive<br />
Entwicklung zeigt uns, dass das Bewusstsein<br />
für den Mehrwert nachhaltiger<br />
Mobilität nicht nur vorhanden ist, sondern<br />
auch weiterwächst.<br />
Welche Projekte wurden in <strong>Westfalen</strong><br />
mit Ihrer Hilfe auf den Weg gebracht?<br />
Als Unterstützungsnetzwerk, das Kommunen<br />
bei der Entwicklung und Umsetzung<br />
von Mobilitätskonzepten berät<br />
und begleitet, ist die Vernetzung einer<br />
DREI FRAGEN AN …<br />
unserer größten Erfolgsfaktoren. Dass<br />
zum Beispiel Höxter als erster Kreis in<br />
<strong>Westfalen</strong>-Lippe flächendeckend auf<br />
unsere Unterstützung setzt, eröffnet<br />
große Chancen, das Thema Klimaschutz<br />
über Stadtgrenzen hinaus voranzutreiben.<br />
Gemeinsam mit dem Nahverkehr<br />
<strong>Westfalen</strong>-Lippe als Aufgabenträger und<br />
Fördermittelgeber bieten wir den Kommunen<br />
mit unserer Beratungsleistung<br />
ein maßgeschneidertes Gesamtpaket.<br />
So haben wir beispielsweise Rheda-<br />
Wiedenbrück bei der Errichtung der<br />
dortigen Mobilstation unterstützt.<br />
Setzt der Koalitionsvertrag der Ampel<br />
mit dem „Aufbruch in der Mobilitätspolitik“<br />
die richtigen Akzente?<br />
Politik ist ein starker Treiber, wenn es<br />
darum geht, nachhaltige Mobilitätskonzepte<br />
bedarfsgerecht in die Tat umzusetzen.<br />
Denn um ehrgeizige Ziele hin zu<br />
weniger CO 2 -Ausstoß und mehr Klimaschutz<br />
erreichen zu können, ist es<br />
wichtig, an einem Strang zu ziehen. Auf<br />
kommunaler Ebene unterstützt das Zukunftsnetz<br />
Mobilität NRW diesen Prozess<br />
mit Know-how und Beratungsleistungen.<br />
Denn nur wenn alternative<br />
Mobilitätskonzepte vor Ort erlebbar<br />
werden, schaffen wir es, mehr Menschen<br />
dauerhaft zum Umstieg vom privaten<br />
Auto auf klimafreundlichere Angebote<br />
zu bewegen. Dazu ist neben<br />
klaren Zielsetzungen vor allem ein Umdenken<br />
in den Köpfen nötig.<br />
IN DEN SCHUHEN VON …<br />
… Britta Haßelmann<br />
Mit Herz und Hirn für<br />
mehr Demokratie kämpfen<br />
Viele Bürgerinnen und Bürger haben<br />
uns bei der Bundestagswahl ihr<br />
Vertrauen gegeben in der Erwartung,<br />
dass wir Veränderung auf den Weg<br />
bringen. Unsere grüne Fraktion im<br />
Bundestag ist deutlich gewachsen<br />
und nimmt diese Verantwortung an.<br />
Gemeinsam mit Katharina Dröge<br />
leite ich unsere 118-köpfige Fraktion,<br />
die nun fast doppelt so groß und<br />
deutlich jünger ist als zuvor. Nach<br />
16 Jahren in der Opposition sind<br />
wir Grünen zudem wieder in Regierungsverantwortung.<br />
Mit unseren<br />
Koalitionspartnern SPD und FDP<br />
haben wir einen Koalitionsvertrag<br />
vorgelegt, in dem wir die Jahrhundertaufgaben<br />
der sozial-ökologischen<br />
Transformation, des klimaneutralen<br />
Umbaus unserer Wirtschaft und des<br />
Schutzes unserer Lebensgrundlagen<br />
angehen. Jetzt müssen wir die vielen<br />
Projekte, die wir uns vorgenommen<br />
haben, in konkretes Regierungshandeln<br />
umsetzen.<br />
Die dramatische Corona-Krise<br />
beschäftigt uns intensiv im Parlament,<br />
in den Diskussionen, in den Fraktionen,<br />
persönlich. Entscheidungen über<br />
die Bekämpfung der Corona-Krise<br />
werden die Fraktionen der Ampel-<br />
Koalition transparent und umfassend<br />
im Parlament beraten und zur Abstimmung<br />
bringen. Es braucht klare<br />
und konsequente Maßnahmen. Die<br />
Bundesregierung hat zudem die Be-<br />
ratungen mit den Ländern verstärkt,<br />
um die Umsetzbarkeit der Corona-<br />
Maßnahmen zu sichern. Wir müssen<br />
bei allem, was wir tun, vorsichtig<br />
bleiben und uns immer weiter um die<br />
Impfbereitschaft der Menschen bemühen,<br />
um das Boostern und darum,<br />
dass die Menschen weiter sehr sorgsam<br />
mit dieser Situation umgehen.<br />
Weiterhin behalten wir natürlich<br />
die drängenden Aufgaben unserer<br />
Zeit im Blick: die Lage der Kinder<br />
und jungen Menschen, die He rausforderungen<br />
in den Kommunen bei<br />
der Sicherung der Daseinsvorsorge<br />
in Stadt und Land, den Ausbau des<br />
öffentlichen Verkehrs, die Gestaltung<br />
der Energiewende und die Digitalisierung,<br />
um nur einige zu nennen.<br />
All das wird unsere Arbeit in den<br />
kommenden vier Jahren leiten. Wir<br />
haben uns viel vorgenommen, und<br />
ich freue mich darauf, es mit auf den<br />
Weg zu bringen.<br />
Die Bielefelderin Britta Haßelmann führt die<br />
Bundestagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen.<br />
Foto: Simon Thon<br />
Foto: Achim Scheidemann/dpa<br />
NRW-Fußballer<br />
des Jahres 2021<br />
… ist Simon Terodde von Schalke 04.<br />
Der Stürmer der Königsblauen setzte<br />
sich in einem öffentlichen Voting der<br />
Fans durch. Den „Felix-Award“ für<br />
Sportlerinnen und Sportler, die sich<br />
besonders hervorgetan haben, hat sich<br />
der geborene Bocholter redlich verdient:<br />
Mit 154 Toren in der 2. Bundesliga<br />
hält er den Rekord noch vor der<br />
Zweitliga-Legende Dieter Schatzschneider<br />
(153 Tore). Die Trophäe<br />
wurde vom Landessportbund und dem<br />
Land NRW zum 14. Mal vergeben.<br />
Foto: <strong>Westfalen</strong>-Blatt<br />
Ein westfälisches<br />
Urgestein<br />
... war Friedel Schütte. Die Pressebüros<br />
der westfälischen Genossenschaftsbanken<br />
haben seit 1972 in der<br />
PR Maßstäbe gesetzt. Friedel Schütte<br />
aus Löhne hat sie gemeinsam mit seinem<br />
Kollegen Karl-Heinz Vockel aus<br />
Paderborn aus den Korrespondentenbüros<br />
der Zeitung Westkurier heraus<br />
aufgebaut. Er schrieb über Jahrzehnte<br />
für Tageszeitungen, lange fürs Landwirtschaftliche<br />
Wochenblatt. Beim<br />
Landwirtschaftsverlag war er Buchautor.<br />
Friedel Schütte konnte erzählen<br />
und wurde gehört. Am 15. Januar ist<br />
er im Alter von 88 Jahren verstorben.
FEBRUAR <strong>2022</strong> / AUSGABE 1<br />
BUCH ZWEI<br />
Porträt | 11<br />
Highspeed durch den Eiskanal: dritter Durchgang bei der Weltmeisterschaft in Altenberg (Sachsen) 2021. Fotos: Sebastian Kahnert/dpa<br />
UNNA<br />
Medaillenhoffnung aus <strong>Westfalen</strong><br />
Laura Nolte geht bei den Olympischen Winterspielen<br />
in Peking als Favoritin ins Rennen<br />
Von Stefan Legge<br />
Von Unna über Winterberg und Lillehammer nach Peking – das<br />
ist die Kurzversion der Antwort auf die Frage, wie es Laura Nolte<br />
zu den Olympischen Winterspielen <strong>2022</strong> gebracht hat. Bevor die<br />
23-Jährige im Februar den Eiskanal von Yanqing im Bobfinale<br />
hinuntersausen wird, werden ihr die Stationen ihrer noch kurzen<br />
Karriere vielleicht noch einmal im Traum erscheinen. Denn ein bisschen<br />
unwirklich klingt der Verlauf ihrer bisherigen Laufbahn schon.<br />
„Ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort“, sagt sie rückblickend. In ihrer<br />
Heimatstadt Unna kam sie zur Leichtathletik. Als 16-Jährige traf sie dann<br />
beim Stützpunkttraining in Dortmund mit anderen Wintersportlern zusammen.<br />
„Da es beim Anschieben des Bobs auf Schnellkraft ankommt,<br />
ist es nicht ungewöhnlich, dass Sprinter im Bobsport landen.“ Dass Laura<br />
aber nach nur einem Sommertrainingstag in Winterberg gleich in die Pilotinnenrolle<br />
schlüpfte, war dann doch eher eine glückliche Fügung. „Ich hatte<br />
so was vorher noch nie gemacht. Aber der Bundestrainer René Spies gab mir<br />
eine Chance“, erinnert sich Laura Nolte.<br />
Erfolgreich im Weltcup<br />
Nachdem sie im thüringischen Oberhof ihre erste Fahrt an den Lenkseilen absolviert<br />
hatte, ging alles ganz schnell. Noch im selben Jahr fuhr sie bei der<br />
Jugendolympiade in Lillehammer im Monobob auf den ersten Platz. Seitdem<br />
ist sie im Rennzirkus des Bobsports dabei; erst im Europacup, jetzt schon<br />
im dritten Jahr im Weltcup. „Mein Alltagsrhythmus wird seitdem vom Sport<br />
bestimmt“, sagt sie.<br />
Laura Nolte legt dabei eine beachtliche Schlagzahl vor. Sie wohnt in Dortmund,<br />
wo sie ihr Leichtathletiktraining absolviert. Zum Bobtraining fährt sie<br />
nach Winterberg. Als Sportsoldatin ist sie in Warendorf stationiert, und<br />
außerdem studiert sie Wirtschaftspsychologie an der Ruhr-Universität in Bochum.<br />
Ein strammes Programm. „Im Weltcup oder für Trainingslager bin ich<br />
oft wochenlang gar nicht zu Hause“, sagt sie. Das alles unter einen Hut zu<br />
kriegen, sei manchmal nicht einfach. „Meine wenige freie Zeit verbringe ich<br />
mit Freunden und Familie“, so Nolte.<br />
Ein gutes Team<br />
Für ihr großes Ziel Olympia kämpft sie aber nicht allein. Seit drei Jahren ist<br />
Deborah Levi ihre Anschieberin im Zweierbob. „Wir sind ein starkes und<br />
eingespieltes Team“, sagt Laura Nolte. „Das wollen wir auch bei den Spielen in<br />
Peking unter Beweis stellen.“ Der Anschub ist im Bobsport extrem wichtig.<br />
„DIE GROSSE<br />
HERAUSFORDERUNG<br />
BEI OLYMPIA<br />
IST DIE BAHN.“<br />
Laura Nolte<br />
Zum Sieg im Gesamtweltcup fehlten nur<br />
wenige Punkte. Foto: Caroline Seidel/dpa<br />
Am Start wird häufig schon das Rennen entschieden. Schließlich geht es am<br />
Ende oft nur um Hundertstelsekunden. Dafür muss jedes Detail stimmen.<br />
„Ein Drittel Anschub, ein Drittel Material und ein Drittel Fahrerleistung.“<br />
Das sei die Faustformel für den Erfolg, sagt Nolte.<br />
In puncto Material werde man zwar von den Mechanikern unterstützt,<br />
beim Schleifen und Polieren der Kufen seien die Sportler allerdings auch<br />
selbst gefordert. Die Abstimmung der Komponenten aufeinander ist eine<br />
wahre Wissenschaft für sich. Der Rekordweltmeister und Doppelolympiasieger<br />
Francesco Friedrich aus Pirna gilt dabei in der Szene als Maß der Dinge.<br />
„Er ist ein echter Tüftler und geht sehr akribisch vor“, sagt Laura Nolte über<br />
ihren Teamkollegen im Nationalteam. Bei den Athletinnen und Athleten mit<br />
mehr Erfahrung können sie sich da noch einiges abschauen.<br />
Starke Konkurrenz<br />
Mit Blick auf Olympia und den Kampf um die Medaillen lauert die Konkurrenz<br />
auch im eigenen Team: Die Wiesbadenerin Kim Kalicki und Mariama Jamanka<br />
aus dem thüringischen Oberhof, Olympiasiegerin von 2<strong>01</strong>8, dürfen sich aufgrund<br />
ihrer gezeigten Leistungen im Weltcup ebenfalls Hoffnungen auf das<br />
Podest in Peking machen. Auch die Amerikanerin Kaillie Humphries und die<br />
Kanadierin Christine de Bruin haben Siegchancen. Als wenn das noch nicht<br />
genug wäre, kommt eine weitere große Unbekannte hinzu.<br />
„Die große Herausforderung bei Olympia ist die Bahn“, weiß Laura Nolte.<br />
Sind die Bob-Piloten es gewohnt, im Weltcup in bestens bekannten Eiskanälen<br />
wie Winterberg, Altenberg oder Königssee unterwegs zu sein, wartet in Yanqing<br />
ein Neubau. „Ich war bisher erst einmal dort, und auch unmittelbar vor<br />
dem Wettkampf werden wir nur wenige Trainingsläufe dort absolvieren können“,<br />
sagt Nolte. Ein klarer Wettbewerbsnachteil gegenüber den Chinesinnen.<br />
Diese sind seit Monaten dort und können jeden Tag auf der Anlage trainieren.<br />
Doch davon will sich die Senkrechtstarterin Laura Nolte nicht irritieren<br />
lassen. Auch die Corona-Pandemie soll die Vorfreude auf das Großereignis<br />
Olympia nicht trüben. „Wir werden in einem kleinen olympischen Dorf untergebracht<br />
sein, zusammen mit Athletinnen und Athleten aus den Sportarten<br />
Skeleton, Rodeln und Ski alpin. Darauf freue ich mich“, sagt Nolte.<br />
Wer die Monobob-Wettbewerbe der Damen im deutschen Fernsehen live<br />
verfolgen möchte, muss am 13. und 14. Februar übrigens früh aufstehen.<br />
Ab 2 Uhr 30 geht es hier um olympische Ehren. Beim Zweierbob ist es eine<br />
Woche später einfacher. Hier heißt es ab 13 Uhr deutscher Zeit Daumen<br />
drücken für die Medaillenhoffnung aus <strong>Westfalen</strong>.
BUCH ZWEI<br />
12 | Feature<br />
AUSGABE 1 / FEBRUAR <strong>2022</strong><br />
WESTFALEN<br />
Wer will<br />
noch mal,<br />
wer hat<br />
noch nicht?<br />
Die Leader-Regionen<br />
wollen ihren Status erhalten,<br />
andere bewerben sich<br />
um eine Aufnahme in die<br />
nächste Förderperiode.<br />
Was kann das Programm,<br />
was kann es nicht?<br />
Von Stefan Legge<br />
N<br />
Aus<br />
achdem sich die Landespolitik zunächst viel Zeit gelassen<br />
hat, soll jetzt alles ganz schnell gehen: Bis zum 4. März<br />
haben ländliche Regionen in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> die<br />
Möglichkeit, sich als Leader-Region für die nächste<br />
Förderperiode von 2023 an zu bewerben. 46 Bewerber<br />
halten dazu gerade Workshops und Konferenzen ab,<br />
denn: Bürgerbeteiligung im Bewerbungsprozess ist Pflicht.<br />
Bereits im April sollen dann Ergebnisse des Auswahlprozesses<br />
einer Jury aus Experten verkündet werden.<br />
Es scheint so, als wolle die Landesregierung vor der Landtagswahl<br />
im Mai noch viele gute Nachrichten verkünden.<br />
„Der Bewerbungsprozess und das Auswahlverfahren<br />
sowie die Haushaltmittel sind so angelegt, dass die allermeisten<br />
Regionen auch einen Zuschlag erhalten können“,<br />
sagt Frank Bröckling, Regionalmanager in der Leader-Region<br />
„Kulturlandschaft Ahaus-Heek-Legden“. 20 Leader-<br />
Regionen gibt es in <strong>Westfalen</strong> bereits. Nach dem Wunsch<br />
Alt mach Neu: Die Sanierung der Brücke an der Wassermühle in Nienborg ist eines der Leader-Projekte, die im Jahr 2020 umgesetzt wurden.<br />
Fotos: Leader Region AHL<br />
von Ministerin Ursula Heinen-Esser dürften es ruhig<br />
noch mehr werden. „Ein Sprung von jetzt 28 Regionen<br />
in NRW auf 45 ist möglich“, schätzt Bröckling, der<br />
auch Mitglied im Sprecherkreis des Regionalforums ist,<br />
einem Zusammenschluss aller Lokalen Aktionsgruppen<br />
(LAG) der Leader-Regionen in NRW. Angesichts der<br />
besseren finanziellen Ausstattung sei das auch in<br />
Ordnung. Abhängig von der Einwohnerzahl dürfen sich<br />
ausgewählte Leader-Regionen über eine Förderung von<br />
2,3 bis 3,1 Millionen Euro für sieben Jahre freuen.<br />
Zehn Anwärterregionen in OWL<br />
Alle, die bisher von Leader profitiert haben, wollen dabeibleiben,<br />
viele, die noch nicht profitieren, wollen dazukommen.<br />
„Allein in Ostwestfalen sind wir derzeit mit<br />
zehn Anwärterregionen im Gespräch“, sagt Konstantin<br />
Plümer, zuständiger Dezernent bei der Bezirksregierung<br />
in Detmold. Auch er sieht aktuell die Tendenz, möglichst<br />
vielen den Weg in das Leader-Programm zu ebnen.<br />
„Beim letzten Mal hat man für die aussichtsreichen, aber<br />
letztlich nicht erfolgreichen Bewerber mit VITAL.NRW<br />
ein eigenes Programm ins Leben gerufen“, sagt Plümer.<br />
Mit der Erfahrung der letzten Bewerbungsrunden und der<br />
Unterstützung durch die Bezirksregierungen sollen<br />
diesmal möglichst alle direkt den Weg zu Leader finden.<br />
VITAL.NRW wird nach derzeitiger Planung nicht neu<br />
aufgelegt.<br />
„OHNE<br />
EHRENAMT<br />
LÄUFT BEI<br />
LEADER<br />
NICHTS.“<br />
Frank Bröckling,<br />
Regionalmanager<br />
Seit 1994 fließt in NRW durch Leader Geld in den ländlichen<br />
Raum. „Leader ist eine Erfolgsgeschichte“,<br />
stellte die Ministerin Heinen-Esser beim Einläuten der<br />
neuen Wettbewerbsrunde Mitte Oktober fest.<br />
Tatsächlich ist dieser Erfolg auch eindrucksvoll dokumentiert.<br />
In einer Broschüre der Landesregierung<br />
aus dem Jahr 2020 wird eine Auswahl der insgesamt<br />
rund 1000 umgesetzten kleinen und großen Projekte<br />
der vergangenen Jahre vorgestellt.<br />
Viele erfolgreiche Projekte<br />
Es geht um Mobilität, wie beim E-Carsharing-Projekt der<br />
Gemeinden Ahaus, Heek und Legden. Dort nutzen<br />
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kommunen die<br />
mit regenerativer Energie geladenen Autos für Dienstfahrten<br />
– abends und an den Wochenenden können die Bürgerinnen<br />
und Bürger der Region die Elektroautos nutzen.<br />
Auch geht es oft darum, Menschen zusammenzubringen.<br />
So ist mit dem Karrierenetzwerk Lenne e.V. in Altena und<br />
Umgebung ein großflächiger Zusammenschluss von Ausbildungsbetrieben,<br />
Schulen, Verbänden und Vereinen<br />
entstanden, der bei der Suche nach einem Ausbildungsplatz<br />
hilft und junge Menschen mit einer Jobperspektive in<br />
der Region hält. Es geht aber auch um dörfliche Infrastruktur.<br />
In Westereiden, einem Ortsteil von Rüthen, hat<br />
man nach der Schließung der letzten Gaststätte im Ort<br />
einen Treffpunkt für die Bewohner gesucht. Mit viel
FEBRUAR <strong>2022</strong> / AUSGABE 1<br />
BUCH ZWEI<br />
Feature | 13<br />
Frank Bröckling ist Inhaber und Geschäftsführer<br />
des Büros planinvent aus Münster.<br />
Die Leader-Region Ahaus-Heek-Legden<br />
(AHL) hat das Büro mit dem Regionalmanagement<br />
beauftragt.<br />
Eigenleistung entstand der neue analoge und digitale Treffpunkt<br />
„Westereiden 2.0“. Hier finden nun unterschiedliche<br />
Veranstaltungen statt, und ein digitales Schwarzes<br />
Brett macht den Austausch im kleinen Ort einfacher.<br />
„Lernen, das Instrument zu spielen”<br />
Die Liste ließe sich fortsetzen. Leader sorgt vielerorts für<br />
zufriedene Gesichter. Das war nicht immer so. Der Start<br />
verlief holprig. „Die anfängliche Euphorie über den<br />
Zuschlag als Leader-Region war oft schnell verflogen“,<br />
erinnert sich Regionalmanager Bröckling. Die bürokratischen<br />
Hürden und das komplizierte Verfahren sorgten<br />
erst mal für Ernüchterung. Auch die Bezirksregierungen<br />
in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> hätten anfangs sehr unterschiedlich<br />
agiert. Nachdem eine LAG vor Ort ein Projekt<br />
ausgewählt hat, muss die Bezirksregierung die Förderfähigkeit<br />
prüfen. „Durch den guten Austausch unter<br />
den Leader-Regionen haben wir schnell gemerkt, dass<br />
bei der Beurteilung der eingereichten Anträge unterschiedliche<br />
Maßstäbe angelegt wurden“, erinnert sich<br />
Bröckling. „Wir alle mussten lernen, das Instrument<br />
zu spielen“, fasst es der Planer zusammen. Dies sei inzwischen<br />
auf allen Ebenen gelungen. Aktuell kämpfe man<br />
um abgeschwächte Sanktionen bei Verstößen gegen die<br />
formalen Förderauflagen.<br />
Doch der Pragmatismus hat Grenzen. „Letztlich geht<br />
es um Steuergelder, und die europäischen Richtlinien<br />
sind hier streng“, sagt Konstantin Plümer von der Bezirksregierung<br />
in Detmold. Ausschreibungen, Nachweise,<br />
Kontrollen – für Ehrenamtliche und Vereine seien das oft<br />
große Herausforderungen. Doch gerade sie sollen ja beim<br />
Spielen des Instruments den Ton angeben.<br />
Bottom-up-Prinzip<br />
„Leader steht anders als andere Förderprogramme für das<br />
Bottom-up-Prinzip“, so Konstantin Plümer. „Nicht wir<br />
oder schlaue Leute in Düsseldorf, Berlin oder Brüssel sagen<br />
den Menschen, was sinnvoll ist, sie bringen ihre eigenen<br />
Ideen ein und setzen sie um.“ Da Eigenleistungen von<br />
Ehrenamtlichen bei Leader voll auf die Investition angerechnet<br />
werden können, sei es möglich, mit der 65-prozentigen<br />
Leader-Förderquote Projekte ohne eigene<br />
nennenswerte finanzielle Mittel anzugehen. Das sei vor<br />
allem für Ehrenamtliche und Vereine interessant.<br />
Frank Bröckling formuliert es noch deutlicher: „Ohne<br />
Ehrenamt läuft bei Leader nichts.“ Es brauche die positiv<br />
verrückten Überzeugungstäter, die für ein Projekt<br />
brennen. Christian Witthaut, einer der Mitinitiatoren<br />
des bereits erwähnten Bürgertreffpunkts in Westereiden,<br />
steht mit seiner Einschätzung exemplarisch für viele<br />
andere Leader-Projekte: „Ohne die vielen geleisteten<br />
Arbeitsstunden durch die Dorfbewohner wäre dieses<br />
Projekt niemals zu stemmen gewesen.“<br />
„Leader kann nur das Sahnehäubchen sein.”<br />
Bestärkt Leader also positiv gesehen die ohnehin Engagierten<br />
in ihrer Arbeit und unterstützt sie bei ihren<br />
Vorhaben, oder bringt man Ehrenamtliche dazu, mehr<br />
und mehr Aufgaben zu übernehmen, die vorher die<br />
Kommune (öffentlicher Nahverkehr, Infrastruktur) oder<br />
die Privatwirtschaft (Kneipe, Dorfladen) übernommen<br />
hat? Frank Bröckling sieht dieses Spannungsfeld nicht<br />
und warnt vor zu großen Erwartungen: „Leader kann<br />
immer nur das Sahnehäubchen sein.“ Die Finanzausstattung<br />
des Programms in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> sei viel zu<br />
gering, um auf die Fragen der Daseinsvorsorge vollumfängliche<br />
Antworten zu liefern. Weder sei Leader eine<br />
Strategie für die ländlichen Räume, noch sichere das<br />
Programm deren Zukunftsfähigkeit.<br />
„Wir sind ja schon froh, dass durch Leader eine Aufmerksamkeit<br />
in der Landespolitik für <strong>Westfalen</strong>-Lippe<br />
erzeugt wurde. Viel zu oft hat man den Eindruck, dass<br />
Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> nur aus Rheinland und Ruhrgebiet<br />
besteht. Leader hat den ländlichen Raum in das politische<br />
Bewusstsein geholt“, sagt Bröckling. Doch nicht nur<br />
finanziell habe das Programm Grenzen. „Für privatwirtschaftliche<br />
und unternehmerische Ideen ist es eher untauglich.<br />
Da ist man mit Leader schnell am Ende.“<br />
So hätten sich beispielsweise viele Landwirte mit neuen<br />
Vermarktungsideen entnervt abgewandt und es auf<br />
eigene Faust versucht.<br />
Viele Akteure hadern zudem nach wie vor mit der<br />
Bürokratie. Das bestätigt eine Befragung der Deutschen<br />
Vernetzungsstelle Ländliche Räume (DVS) unter den<br />
Regionalmanagern und Vorständen LAG. Flexibilität und<br />
Schnelligkeit seien keine Merkmale von Leader. Einige<br />
der Befragten warnten vor einer Überforderung des Systems:<br />
Leader könne nicht alles.<br />
Was dürfen die Regionen, die sich um einen Verbleib<br />
oder um eine Aufnahme in das Programm bemühen,<br />
also erwarten? Leader fördert die Initiative der Menschen<br />
vor Ort und stärkt das ehrenamtliche Engagement.<br />
Es ermöglicht, Projekte eigenständig zu entwickeln und<br />
umzusetzen. Nicht mehr, aber auch nicht weniger.<br />
Förderung für den<br />
ländlichen Raum<br />
Das Kürzel „Leader“ steht für „Liaison entre actions de développement<br />
de l‘économie rurale”, zu Deutsch: Verbindung<br />
zwischen Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft.<br />
Das EU-Förderprogramm wird im Rahmen des Europäischen<br />
Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen<br />
Raums (ELER) in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> bereits seit 1994 angeboten.<br />
Seitdem wurden rund 1500 Projekte mit einem Volumen<br />
von mehr als 100 Millionen Euro gefördert. Die Förderquote<br />
wird ab 2023 von 65 auf 70 Prozent angehoben.<br />
In der Region AHL wurde ein Carsharing-<br />
Angebot auf Basis von E-Fahrzeugen<br />
initiiert, die mit erneuerbaren Energien<br />
gespeist werden.
BUCH ZWEI<br />
14 | Berichte AUSGABE 1 / FEBRUAR <strong>2022</strong><br />
Nach Flut: Mehr Firmen<br />
beantragen Hilfen<br />
Düsseldorf. Für flutgeschädigte<br />
Betriebe in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> sind<br />
bislang Fördermittel von Bund und<br />
Land in Höhe von rund 81 Millionen<br />
Euro bewilligt worden. An 7000 Firmen<br />
seien Soforthilfen ausgezahlt worden,<br />
teilte das Wirtschaftsministerium<br />
in Düsseldorf mit. Nun rücke der<br />
Wiederaufbau in den Mittelpunkt.<br />
„4500 Beratungsgespräche haben<br />
die Kammern in den vergangenen<br />
Wochen geführt“, erklärte Landeswirtschaftsminister<br />
Andreas Pinkwart<br />
(FDP) ein halbes Jahr nach der<br />
Flutkatastrophe. Ministerium und<br />
NRW.Bank rechnen demnach mit<br />
mehr Anträgen. Denn die Sechsmonatsfrist<br />
für die Berechnung der<br />
förderfähigen Einkommenseinbußen<br />
verstreiche. Begutachtungen von<br />
Schäden würden abgeschlossen. Von<br />
den bewilligten Fördermitteln entfallen<br />
37,8 Millionen Euro auf das Wiederaufbauprogramm,<br />
bei der Soforthilfe<br />
sind es 35,7 Millionen. 7,5 Millionen<br />
Euro kommen von der NRW.Bank.<br />
Weniger Feinstaub<br />
wegen Böllerverbot<br />
Recklinghausen. Das Verkaufsverbot<br />
von Böllern vor dem Jahreswechsel<br />
hat in NRW nach Einschätzung<br />
des Landesumweltamtes für deutlich<br />
bessere Luft gesorgt. Nach Messungen<br />
der Behörde gingen die Werte für<br />
Feinstaub und Stickstoffdioxid (NO 2<br />
)<br />
bis auf wenige Ausnahmen im<br />
Vergleich zum Vorjahr nochmals zurück.<br />
Auch vor der Silvesternacht<br />
2020/ 2021 gab es wegen der Corona-<br />
Pandemie ein Verkaufsverbot.<br />
Das Landesumweltamt wertete an<br />
den 62 Messstellen im Land die Daten<br />
in der Neujahrsnacht für die Zeit<br />
von 0.00 bis 1.00 Uhr aus. So gab es<br />
in Duisburg-Buchholz 31 Mikrogramm<br />
pro Kubikmeter Feinstaub nach 81<br />
im Vorjahr. Vor der Pandemie lag der<br />
Messwert hier 2<strong>01</strong>9 noch bei 227.<br />
An einigen Messstellen gab es im<br />
Vergleich zum Vorjahr aber Verschlechterungen<br />
wie in Solingen mit<br />
103 auf 133 (2<strong>01</strong>9: 688) oder Bielefeld-<br />
Ost mit 18 auf 30 Mikrogramm<br />
pro Kubikmeter beim Feinstaub<br />
(2<strong>01</strong>9: 65). Wie hoch die Werte beim<br />
Feinstaub sind, hängt allerdings nicht<br />
nur von der Zahl der gezündeten<br />
Böller ab. Je nach Wind und Temperatur<br />
bleiben die Staubteilchen in der<br />
Umgebung oder werden weggeweht.<br />
Wüst: 14 Milliarden Euro<br />
Corona-Hilfen ausgezahlt<br />
Düsseldorf. Infolge der Corona-<br />
Pandemie sind nach Angaben der<br />
Landesregierung allein in Nordrhein-<br />
<strong>Westfalen</strong> schon rund 14 Milliarden<br />
Euro an Wirtschaftshilfen ausgezahlt<br />
worden. „Ein solch gigantisches Hilfsprogramm<br />
gibt es kaum woanders<br />
auf der Welt“, sagte Ministerpräsident<br />
Hendrik Wüst (CDU) beim Jahresempfang<br />
der Industrie- und Handelskammer<br />
Düsseldorf laut Staatskanzlei.<br />
Das habe – gemeinsam mit<br />
dem hohen Engagement der Unternehmen<br />
auch mit schneller, kreativer<br />
Reaktion auf die neue Situation und<br />
allen Instrumenten wie Kurzarbeitergeld<br />
– dazu geführt, „dass wir im<br />
Vergleich zu anderen Volkswirtschaften<br />
glimpflich durch die Krise<br />
gekommen sind.” Klare Priorität sei<br />
es, „die Schulen und Kitas solange es<br />
eben geht offenzuhalten“, bekräftigte<br />
Wüst und fügte hinzu: „Diese<br />
Priorität bedeutet, dass im Zweifel<br />
eben an anderen Stellen zunächst<br />
das Infektionsgeschehen eingedämmt<br />
werden muss.“ Kinder hätten schon<br />
zu viel gelitten in der Pandemie.<br />
GÜTERSLOH<br />
Klick und<br />
brumm<br />
Start-up Schüttflix mischt<br />
die Braubranche auf<br />
Von Manuel Glasfort<br />
Fällt das Wort „Start-up“, dürften<br />
die meisten Menschen smart gekleidete<br />
Metropolenbewohner vor<br />
Augen haben, die mithilfe digitaler<br />
Technik die Finanzbranche oder die<br />
Industrie aufmischen wollen. Schüttflix<br />
passt da irgendwie nicht so recht<br />
ins Bild. Das Start-up aus dem beschaulichen<br />
Gütersloh hat sich zum<br />
Ziel gesetzt, die rustikale Baubranche<br />
umzukrempeln. Genauer gesagt: den<br />
Markt für Schüttgüter wie Sand,<br />
Schotter oder Kies.<br />
Schüttflix hat dafür eigens eine<br />
App entwickelt, die alle Marktteilnehmer<br />
zusammenbringt. Es handle sich<br />
um „die erste digitale Logistikdrehscheibe,<br />
die Erzeuger, Anbieter, Speditionen<br />
und Bauunternehmer vernetzt“,<br />
heißt es. Mehr Effizienz auf<br />
dem Markt für Schüttgüter soll auch<br />
dem Klima nützen. „Durch die<br />
deutschlandweite Vernetzung von<br />
Angebot und Nachfrage sparen wir<br />
jährlich Tausende überflüssige Lkw-<br />
Kilometer und Leerfahren auf<br />
Deutschlands Straßen ein“, erklärt<br />
Gründer Christian Hülsewig. „Unsere<br />
Vision ist, die Marktteilnehmer<br />
DÜSSELDORF<br />
Eigenständig und profiliert<br />
So stellt sich Ministerin Gebauer die Zukunft der Schulen im Land vor<br />
Von Manuel Glasfort<br />
Schulen in NRW sollen idividuelleres Profil bekommen. Foto: Adobe Stock<br />
Die Landesregierung will den Schulen<br />
in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> mehr<br />
Freiheiten und Eigenverantwortung<br />
einräumen. Das vom Kabinett auf den<br />
Weg gebrachte 16. Schulrechtsänderungsgesetz<br />
soll außerdem die Digitalisierung<br />
im Schulwesen stärken und<br />
die Elternmitwirkung neu regeln. Es<br />
handelt sich um einen der letzten offenen<br />
Punkte des Koalitionsvertrages,<br />
wie Schul- und Bildungsministerin<br />
Yvonne Gebauer (FDP) bei der Vorstellung<br />
des Regelwerks sagte. Das<br />
Gesetz soll voraussichtlich im Frühjahr<br />
verabschiedet werden, also kurz vor der<br />
Landtagswahl.<br />
künftig so zu vernetzen, dass auch<br />
Zwischenlagerungen von Böden reduziert<br />
werden. Wenn jemand eine<br />
Baugrube aushebt, kann jemand anderes<br />
in der Nähe möglicherweise<br />
genau dieses Material benötigen.“<br />
So einfach wie Amazon<br />
Schüttflix richtet sich ausschließlich<br />
an Bauunternehmer, nicht an Privatleute.<br />
Wer über die App Schüttgut<br />
bestellt, zahlt eine Provision. Mit der<br />
Idee ist das Start-up so erfolgreich,<br />
dass es im Dezember 2021 den Gründerpreis<br />
NRW gewann. Angewiesen<br />
auf das Preisgeld von 30.000 Euro ist<br />
das Start-up aber längst nicht mehr.<br />
Erst im September hatte Schüttflix 50<br />
Millionen US-Dollar von internationalen<br />
Investoren eingesammelt.<br />
Dass der traditionelle Markt für<br />
Schüttgut nicht immer reibungslos<br />
läuft, erlebte Hülsewig bei Bauarbei-<br />
Die Schulen im Land sollen nach Gebauers<br />
Willen „mehr Möglichkeiten<br />
bekommen, ein eigenständiges Profil<br />
zu entwickeln, um mehr Chancengerechtigkeit<br />
herzustellen“. Nach aktueller<br />
Gesetzeslage beschreiben die<br />
Schulen die Ziele und Schwerpunkte<br />
ihrer pädagogischen Arbeit, wie Gebauer<br />
erläuterte. „Mit der Änderung<br />
können die Schulen sich zukünftig ein<br />
eigenständiges Profil geben, das über<br />
die einzelnen Fächer hinausweist.“<br />
Schulen sollen ein besonderes Profil<br />
ausweisen und in einem bestimmten<br />
Rahmen von den vorgegebenen Stundentafeln<br />
abweichen dürfen. Eine<br />
Schüttflix ermöglicht es Bauunternehmern, per App Sand und andere Schüttgüter zu bestellen. Foto: Schüttflix<br />
Schule mit sprachlichem Schwerpunkt<br />
und Profil Französisch dürfte<br />
beispielsweise ab Klasse 5 eine gewisse<br />
Stundenzahl auf Französisch verlagern,<br />
wie die Ministerin erläuterte.<br />
Gebauer betonte, dass die Standards<br />
für die bundesweite Anerkennung von<br />
Abschlüssen gewahrt bleiben müsse.<br />
Kritikern reicht das nicht<br />
Kritik am Koalitionsvorhaben kommt<br />
aus den Reihen der Opposition. SPD-<br />
Fraktionsvize Jochen Ott monierte<br />
gegenüber <strong>Landschaft</strong> <strong>Westfalen</strong>, das<br />
Gesetz sei alles andere als modern oder<br />
fortschrittlich. „Es enttäuscht in weiten<br />
Teilen.“ Dabei bräuchten die Schulen<br />
dringend mehr Eigenverantwortung<br />
– „vor allem in dieser Pandemie,<br />
in der die Lehrkräfte und Schulleitungen<br />
viel zu lange durch starre Vorgaben<br />
an einem flexiblen Handeln gehindert<br />
werden“. Ott kündigte entsprechende<br />
Änderungsanträge im Landtag an.<br />
Einen zweiten Schwerpunkt setzt<br />
Gebauers Ressort bei der Digitalisierung,<br />
die im Schulgesetz verankert<br />
werden soll. Der Bildungs- und Erziehungsauftrag<br />
in Paragraf 2 des Schulgesetzes<br />
wird dahingehend ergänzt.<br />
Ausdrücklich bestimmt das Gesetz<br />
künftig, dass die Schüler digitale Kompetenzen<br />
erwerben sollen. „Mit dieser<br />
Änderung an zentraler Stelle stellen<br />
ten auf dem heimischen Bauernhof in<br />
Herford. Die Lieferungen kamen oft<br />
unpünktlich oder wurden falsch abgeladen.<br />
Aus dem Frust entstand Hülsewigs<br />
Ansporn: die Bestellung von<br />
Sand, Kies oder Schotter so einfach zu<br />
machen wie eine Amazon-Bestellung.<br />
Hülsewig gewann den Gütersloher<br />
Bauunternehmer Thomas Hagedorn<br />
als Investor und gründete 2<strong>01</strong>8<br />
Schüttflix. Ein Expertenteam entwickelte<br />
die App binnen weniger Monate.<br />
Hülsewig erinnert sich an den<br />
Start: „Wir mussten uns zu Beginn<br />
natürlich beweisen: dass Bestellungen<br />
tatsächlich so einfach sein können<br />
und dass der Lkw dann auch wirklich<br />
ankommt. Hierfür haben wir die ersten<br />
Fahrten persönlich begleitet.“<br />
Seither ist das Start-up enorm gewachsen.<br />
Aktuell nutzen 4300 Bauunternehmer<br />
in Deutschland die<br />
Plattform, außerdem 1600 Lieferanten<br />
und 2800 Spediteure. „Für mich<br />
war es immer am wichtigsten, den<br />
Kunden einen Mehrwert zu liefern<br />
und ihnen den Arbeitsalltag leichter<br />
zu machen“, sagt Hülsewig. Aktuell<br />
beschäftigt seine Firma 150 Mitarbeiter.<br />
Der Kurs ist gesetzt auf Expansion<br />
ins europäische Ausland.<br />
Prominente Investorin<br />
Beflügelt wird Schüttflix auch durch<br />
einen Promifaktor: Model Sophia Thomalla<br />
ist seit 2<strong>01</strong>9 das Werbegesicht<br />
der Firma – und Mitgesellschafterin.<br />
Thomas Hagedorn und Thomalla<br />
brennen beide für Schalke 04 und kennen<br />
sich aus dem Stadion. Thomalla<br />
habe das Potenzial der Idee schnell erkannt,<br />
erzählt Hülsewig. „Hinzu kam,<br />
dass die Baubranche einfach zu ihr<br />
passt. Sie ist eine echte Anpackerin.“<br />
So wurde sie nicht nur Werbegesicht,<br />
sondern auch Investorin.<br />
wir klar, dass es zu den wichtigsten<br />
Aufgaben der Schulen gehört, die<br />
Schüler auf die Herausforderungen<br />
unserer digitalen Lebens- und Arbeitswelt<br />
vorzubereiten“, sagte Gebauer.<br />
„Wir sind damit das erste Bundesland,<br />
das die Digitalisierung im Schulwesen<br />
im Gesetz verankert“, ergänzte ihr<br />
Pressesprecher Daniel Kölle.<br />
Auch der Einsatz digitaler Medien,<br />
bisher durch Erlasse geregelt, erhält<br />
Gesetzesrang. Ob die Änderungen<br />
eher kosmetischer Natur sind oder<br />
Auswirkungen auf die Schulpraxis<br />
haben, muss sich noch zeigen.<br />
Stärken will Gebauer nach eigenem<br />
Bekunden auch die Mitwirkungsrechte<br />
von Eltern und Schülern. So<br />
sollen Gymnasien und Gesamtschulen<br />
bei Bedarf Mitwirkungsgremien<br />
wie Konferenzen, Schulpflegschaften<br />
und Schülerräte einrichten dürfen.<br />
Außerdem soll die Mitwirkung von<br />
Eltern und Schülern in kommunalen<br />
Schulausschüssen im Gesetz verankert<br />
werden. In diesen Gremien können<br />
sie beratend mitwirken.<br />
Die Schulkonferenz erhält ein Mitspracherecht,<br />
wenn es um den Einsatz<br />
digitaler Arbeits- und Lernsysteme<br />
geht. Die Pandemie habe gezeigt, dass<br />
es auf eine enge Zusammenarbeit zwischen<br />
Eltern und Schulen ankomme,<br />
sagte Gebauer.
FEBRUAR <strong>2022</strong> / AUSGABE 1<br />
BUCH ZWEI<br />
Berichte | 15<br />
GELSENKIRCHEN<br />
Ungeschmierte<br />
Wahrheit<br />
Der<br />
Geschmack<br />
des Waldes in<br />
Flaschen<br />
Dass die Nachfrage aus Übersee einmal das deutsche<br />
Brot revolutionieren würde, hätte man<br />
sich bei der Traditionsbäckerei Prünte in Gelsenkirchen<br />
wohl eher nicht träumen lassen.<br />
Doch die pure Kreation ohne Konservierungsstoffe,<br />
semifresh und somit 42 Tage lang haltbar, eroberte die<br />
Regale des Einzelhandels nicht nur hierzulande wie im<br />
Flug. Dinkel, Roggen, Hafer, Chiasamen und Ölsaaten –<br />
und ein glückliches Händchen, immer wieder etwas<br />
Neues zu finden, was den zeitgenössischen Brotgeschmack<br />
trifft, ließen aus dem Start-up B Just Bread einen<br />
robusten Player werden – made im Pott.<br />
www.bjustbread.com<br />
Foto: B Just Bread<br />
Das pure<br />
Brot, gefragt<br />
in aller Welt<br />
Tolle Menschen,<br />
tolle Ideen:<br />
Produkte aus den<br />
westfälischen<br />
Regionen, die uns<br />
aufgefallen sind<br />
Sie stellen etwas Besonderes her?<br />
Dann schreiben Sie uns:<br />
redaktion@landschaft-westfalen.de<br />
LÜDENSCHEID<br />
Sauerländer<br />
Schnapsideen<br />
Wie schmeckt wohl ein<br />
sauerländer Gin?<br />
Wenn man der feinen<br />
Zunge folgt, nach den<br />
Aromen der heimischen Wälder:<br />
Fichtenspitzen, Baumpilz und Löwenzahnwurzel,<br />
frischer Brennnessel,<br />
Sauerampfer und Zitrusaromen.<br />
Weil zu jedem Produkt eine gute<br />
Geschichte gehört, macht das Lesen,<br />
was die Ginmacher aus dem Sauer-<br />
Foto: Woodland Gin<br />
land zu ihren Produkten erzählen,<br />
mindestens so viel Spaß wie das<br />
Probieren. Wussten Sie zum<br />
Beispiel, dass Seeleute einst mittels<br />
Schießpulver die Qualität des Gins<br />
prüften? Er entzündet sich nur,<br />
wenn er genug Prozente hat.<br />
Warum es im Sauerland auch einen<br />
pinkfarbenen Gin gibt, das können<br />
Sie selbst herausfinden bei:<br />
www.woodland-gin.com<br />
JETZT<br />
KOSTENLOS<br />
TESTEN!<br />
5G = 5 GÄNSE.<br />
NETZAUSBAU AUF DEM LAND.<br />
www.landbrief.de<br />
Es mangelt an flächendeckendem und erschwinglichem Datennetz auf dem Land. Wir berichten darüber.<br />
Der Landbrief packt Themen an, die das Land interessieren. Der digitale Brief vom Land fürs Land.<br />
Ein Aboangebot der Landwirtschaftsverlag GmbH, Hülsebrockstr. 2 – 8, 48165 Münster, www.lv.de<br />
DIE STIMME FÜRS LAND.<br />
22<strong>01</strong>-022_Landbrief-EA <strong>Landschaft</strong> <strong>Westfalen</strong> <strong>2022</strong>.indd 1 10.<strong>01</strong>.<strong>2022</strong> 15:23:19
BUCH ZWEI<br />
16 | Ein Ort in ...<br />
MÜNSTER<br />
Denken für die Zukunft<br />
Eine Gesellschaft ohne Wachstum<br />
ist das Grundthema der Ausstellung<br />
„Nimmersatt?“, dem sich die<br />
Kunsthalle Münster, das LWL-Museum<br />
für Kunst und Kultur und der<br />
Westfälische Kunstverein noch bis<br />
zum 27. Februar <strong>2022</strong> widmen. Rund<br />
30 künstlerische Arbeiten der Ausstellung<br />
nehmen Bezug auf aktuelle<br />
Krisen, soziale Ungleichheit, Klimaveränderung,<br />
Krankheit, Krieg,<br />
Fluchtbewegungen, Fremdenhass<br />
und damit einhergehende Entwicklungen.<br />
Die Werke hinterfragen, welche<br />
anderen Optionen jenseits des<br />
Wachstums bestehen.<br />
Wachstum sei endlich und baue auf<br />
sozialer Ungleichheit sowie der Ausbeutung<br />
von Mensch und Umwelt auf,<br />
so die Kuratorinnen Merle Radtke<br />
(Kunsthalle Münster), Kristina Scepanski<br />
(Westfälischer Kunstverein)<br />
und Marianne Wagner (LWL-Museum<br />
für Kunst und Kultur). Dies mache es<br />
erforderlich, bestehende Denkmuster<br />
zu verlassen und den Glaubenssatz<br />
vom „Immer mehr und immer weiter“<br />
zur Diskussion zu stellen.<br />
In der Ausstellung werden Videoinstallationen,<br />
Zeichnungen, Fotografien<br />
und Skulpturen sowie Arbeiten im<br />
öffentlichen Raum gezeigt. Neben einer<br />
Reihe von Leihgaben präsentieren<br />
Kabinett mit<br />
Videoinstallationen.<br />
Foto: Westfälischer<br />
Kunstverein<br />
die Häuser mehrere Neuproduktionen,<br />
die im Dialog mit den Kuratorinnen<br />
entstanden sind. LWL-Direktor Matthias<br />
Löb: „In der Ausstellung wird ein,<br />
wenn nicht sogar das Thema unserer<br />
Zeit aufgegriffen. Kunst will dabei nicht<br />
fertige Antworten liefern, sie kann aber<br />
gewohnte Seh- und Denkweisen aufbrechen<br />
und unseren Geist frei machen,<br />
Zukunft neu zu denken.“<br />
Quelle: Geographische Kommission<br />
für <strong>Westfalen</strong> 2020<br />
„Kunst kann gewohnte Seh- und Denkgewohnheiten<br />
aufbrechen und unseren Geist frei machen,<br />
Zukunft neu zu denken.“ Matthias Löb, LWL-Direktor<br />
SOEST<br />
Lichtkonzepte im Raum<br />
Das Museum Wilhelm Morgner zeigt das umfangreiche und<br />
vielgestaltige Werk des Glaskünstlers Jochem Poensgen<br />
Der Künstler Jochem Poensgen,<br />
1931 in Düsseldorf geboren,<br />
zählt zu den stilgebenden Glasgestaltern<br />
der Gegenwart. Seit 1991 lebt er<br />
in Soest. Dort gestaltete er sämtliche<br />
Fenster der Hohnekirche. Zu seinen<br />
in Deutschland realisierten Hauptwerken<br />
zählen daneben die Lichtwände<br />
von St. Andreas in Essen-Rüttenscheid,<br />
die Chorfenster der Hof- und<br />
Stiftskirche St. Bartholomäi in Zerbst/<br />
Anhalt, wo er 2<strong>01</strong>8 für fünf neue Fenster<br />
im Chorbereich verantwortlich<br />
zeichnete, sowie die Gestaltung der<br />
Fenster der Klosterkirche St. Marien<br />
und St. Nikolai in Jerichow.<br />
Die Dreieinigkeitskirche Hamburg-St.<br />
Georg, der Bamberger Dom,<br />
aber auch das Rathaus in Wiesbaden<br />
und die Polizei-Führungsakademie in<br />
Münster-Hiltrup stehen auf seiner<br />
Rundfenster in einer Kapelle in Luleå (Schweden). Foto: Stadt Soest<br />
Werkliste. Zahlreiche Glasgestaltungen<br />
in Kirchen und öffentliche Bauten<br />
weltweit zählen zu seinem Werk. Sein<br />
experimentelles Arbeiten führte ihn<br />
an die wichtigsten Stätten der Glaskunst<br />
weltweit, unter anderem unterrichtete<br />
er am Swansea Institute in<br />
UK. „Die deutsche Glasmalerei der<br />
Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg verdankt<br />
ihm Weltgeltung und international<br />
schulebildende Wirkung. Kein<br />
anderes Œuvre der zeitgenössischen<br />
Glasmalerei ist an Stilwandel und experimentellen<br />
Neuansätzen so reich<br />
wie das Poensgens“, schreibt Holger<br />
Brülls bereits 2<strong>01</strong>2 über den Künstler<br />
und blickt auf ein „vielgestaltiges,<br />
phantasievolles und experimentierfreudiges<br />
Lebenswerk“. Seit 2<strong>01</strong>3 befasst<br />
sich Poensgen vermehrt mit<br />
Hinterglasmalerei.<br />
„Ein vielgestaltiges, phantasievolles und<br />
experimentierfreudiges Lebenswerk.“<br />
Holger Brülls<br />
Nicht alles, was Poensgen schuf, ist<br />
übrigens erhalten − einige seiner Betonglaswände<br />
aus den 1960er-Jahren<br />
sind, man glaubt es kaum, der Abrissbirne<br />
zum Opfer gefallen.<br />
Das Museum Wilhelm Morgner in<br />
Soest zeigt in einer Retrospektive bis<br />
zum 6. März <strong>2022</strong> Originalglasfenster<br />
und Glas- sowie Hinterglasbilder, Grafiken,<br />
Zeichnungen und Malerei seit<br />
1951. Dazu zählen auch Arbeiten, die<br />
bisher nicht ausgestellt wurden. Poensgen<br />
öffnete dafür seine Schubladen<br />
und förderte bis hin zu Comic-Entwürfen<br />
eine beeindruckende Vielfalt<br />
und Vielgestaltigkeit zutage. Eine<br />
temporäre Installation im Eingangsbereich<br />
des Museums demonstriert<br />
zudem seine Auffassung von der Umsetzung<br />
der Glasgestaltung in Bezug<br />
auf den architektonischen Kontext.<br />
BIELEFELD<br />
Träume aus Kristall<br />
Den Expressionisten Wenzel Hablik begeistern Gesteine.<br />
Das Kunstforum Hermann Stenner zeigt eine Retrospektive<br />
Seine Architekturentwürfe waren<br />
von den Science-Fiction-Romanen<br />
Jules Vernes und H. G. Wells’ inspiriert,<br />
auf den Trümmern des Ersten<br />
Weltkriegs errichtete der Maler und<br />
Gestalter Wenzel Hablik kristalline<br />
Kathedralen. In Berlin ausgestellt<br />
neben Picasso, Kokoschka und Gauguin,<br />
hatte er schon 1907 seine Wahlheimat<br />
in Itzehoe gefunden.<br />
Dort entwarf er Raumkonzepte<br />
für Wohnungen und Firmensitze und<br />
starb bereits 1934 mit 52 Jahren, nach<br />
Jahren intensiver gemeinsamer künstlerischer<br />
Arbeit mit seiner Ehefrau,<br />
der Handweberin Elisabeth Lindemann.<br />
Während seine Architektur-<br />
„Muss ich schon<br />
an der Erde<br />
kleben, dann<br />
wenigstens nicht<br />
mit dem Hirn.“<br />
Wenzel Hablik<br />
entwürfe nie realisiert wurden, in spirierte<br />
er die Webemeisterin zu<br />
Werkstücken mit floralen und ornamentalen<br />
Motiven und begeisterte<br />
auch Bauhaus-Architekten wie Bruno<br />
Taut und Walter Gropius dafür.<br />
Sternenhimmel, Berglandschaften<br />
und intergalaktische Luftkolonien inspirierten<br />
Habliks gestischen Pinselschwung,<br />
die Nähe zu bekannten Expressionisten<br />
ist vielfach sichtbar.<br />
Ein noch viel zu wenig entdeckter<br />
Künstler und ein vielfältiges Werk,<br />
fand man im Bielefelder Kunstforum<br />
Hermann Stenner und zeigt bis zum<br />
6. März <strong>2022</strong> eine Werkschau Wenzel<br />
Habliks.<br />
Eine Wolke, 1910. Foto: Wenzel-Hablik-Stiftung Itzehoe