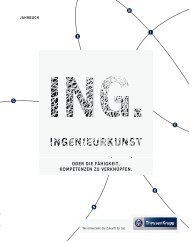Forum-Technische Mitteilungen - ThyssenKrupp AG
Forum-Technische Mitteilungen - ThyssenKrupp AG
Forum-Technische Mitteilungen - ThyssenKrupp AG
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
forum<br />
<strong>Technische</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>ThyssenKrupp</strong> Juli 2000<br />
TK
02<br />
Impressum<br />
Impressum<br />
Herausgeber<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> <strong>AG</strong><br />
Zentralbereich<br />
<strong>Technische</strong> Entwicklungen<br />
August-Thyssen-Straße 1<br />
40211 Düsseldorf<br />
Postfach 10 10 10<br />
40001 Düsseldorf<br />
Telefon 02 11/8 24-3 62 91<br />
Telefax 02 11/8 24-3 62 85<br />
Erscheinungsweise<br />
„forum – <strong>Technische</strong> <strong>Mitteilungen</strong><br />
<strong>ThyssenKrupp</strong>“ erscheint<br />
ein- bis zweimal jährlich<br />
in deutscher und<br />
englischer Sprache.<br />
Nachdruck nur mit<br />
Genehmigung des<br />
Herausgebers.<br />
Fotomechanische<br />
Vervielfältigung<br />
einzelner Aufsätze<br />
ist erlaubt.<br />
Der Versand des<br />
„forum – <strong>Technische</strong> <strong>Mitteilungen</strong><br />
<strong>ThyssenKrupp</strong>“<br />
erfolgt über eine<br />
Adressdatei, die mit<br />
Hilfe der automatisierten<br />
Datenverarbeitung<br />
geführt wird.<br />
ISSN 1438-5635<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Titelbild<br />
Krupp VDM hat eine führende Position bei<br />
der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungswerkstoffen.<br />
Hierzu gehören auch<br />
Trägerfolien für die im Titelbild dargestellten<br />
Metallkatalysatoren. Die Entwicklung<br />
eines Folienwerkstoffes mit erhöhtem<br />
Aluminiumgehalt für Katalysatoren, die<br />
heute schon zukünftige Abgasnormen<br />
erfüllen können, ist ein Beweis dafür, wie<br />
die Innovationskraft eines Unternehmens<br />
und die Kreativität seiner Mitarbeiter in<br />
zukunftsträchtige Produkte umgesetzt<br />
werden können.<br />
„Innovationen im <strong>ThyssenKrupp</strong> Konzern“<br />
ist das Leitthema dieser Ausgabe von<br />
forum – <strong>Technische</strong> <strong>Mitteilungen</strong><br />
<strong>ThyssenKrupp</strong>. Beispielhaft hierfür werden<br />
alle für den <strong>ThyssenKrupp</strong> Innovationswettbewerb<br />
2000 eingereichten Vorschläge<br />
vorgestellt.<br />
Als besonders anerkennenswerte Leistung<br />
wurden folgende Vorschläge ausgezeichnet:<br />
● Luftfeder-Dämpfermodule für die S-Klasse<br />
von DaimlerChrysler mit dem 1. Preis,<br />
● Blechradträger aus NIROSTA ® H400<br />
und Pkw-Seitenaufprallträger aus Mehrphasenstählen<br />
jeweils mit dem 2. Preis,<br />
● Die Smartstep-Stufe mit dem 3. Preis.<br />
Einzelheiten hierzu und zu den anderen<br />
Vorschlägen können Sie den Beiträgen<br />
dieses Heftes entnehmen.
03<br />
Vorwort<br />
Prof. Dr.-Ing. Ekkehard Schulz, Vorsitzender des Vorstands der <strong>ThyssenKrupp</strong> <strong>AG</strong><br />
Liebe Leserinnen, liebe Leser,<br />
Innovationen sind Motor für Wachstum und<br />
Wettbewerbsfähigkeit. Sie setzen Kreati-<br />
vität, Inspiration und geistige Leistung<br />
jedes einzelnen Mitarbeiters voraus. Nur in<br />
einem innovationsfreundlichen Klima eines<br />
Unternehmens lassen sich Neuerungen mit<br />
Erfolg im Markt umsetzen.<br />
Die Innovationsdynamik in vielen Branchen<br />
führt dazu, dass Innovationszyklen in der<br />
Vermarktung von Neuentwicklungen zuneh-<br />
mend kürzer werden. Ein Technologie-<br />
konzern wie <strong>ThyssenKrupp</strong> ist daher neben<br />
anderen Ressourcen vor allem auf die<br />
Kreativität seiner Mitarbeiter angewiesen,<br />
um in der technischen Entwicklung ganz<br />
vorne mitzuspielen. Insofern ist Innovation<br />
stärker denn je ein strategisches Instru-<br />
ment für den Erfolg unseres Unterneh-<br />
mens.<br />
Die Stärkung der Innovationskraft wird<br />
zukünftig eine bestimmendere Größe im<br />
Wettbewerb ausmachen. Die zunehmende<br />
Integration von Lieferanten und Kunden als<br />
Systempartner im Innovationsprozess setzt<br />
eine Konzentrierung auf eigene Kernkom-<br />
petenzen voraus. Ressourcen müssen auf<br />
diese Innovationsfelder gebündelt werden.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> stellt sich dieser Herausfor-<br />
derung.<br />
Der Konzern hat für das Jahr 2000 erst-<br />
mals einen Innovationswettbewerb aus-<br />
geschrieben, dessen Ergebnisse im vor-<br />
liegenden Themenheft aufgeführt sind. Ziel<br />
dieses Wettbewerbs war die Anerkennung<br />
kreativer Leistungen bei der Entwicklung<br />
neuer Werkstoffe, bei der Anwendung<br />
aktueller Fertigungstechnologien und bei<br />
der Weiterentwicklung von Produkten und<br />
Verfahren. Die Themenschwerpunkte<br />
zeigen neue Werkstoffentwicklungen und<br />
deren Umsetzung in neue Produkte auf, die<br />
die Kriterien Leichtbau, Reduzierung von<br />
Arbeitsschritten und damit auch Kosten-<br />
einsparungen erfüllen. Zusätzlich werden<br />
neue Lösungen in der Verfahrensent-<br />
wicklung und im Dienstleistungsbereich<br />
durch elektronisch gestützte Systeme im<br />
e-Business herausgestellt.<br />
Ekkehard Schulz<br />
Prof. Dr.-Ing.<br />
Ekkehard Schulz,<br />
Vorsitzender des<br />
Vorstands der<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> <strong>AG</strong>
04<br />
Inhalt<br />
Dr.-Ing. Bernhard Engl, HBL Werkstoffentwicklung,<br />
Dipl.-Ing. Jürgen Esdohr, BL Produktbetreuung WB,<br />
Dr.-Ing. Thomas Heller, BL Werkstoffentwicklung WB,<br />
Dipl.-Ing. Klaus Köhler, HBL Qualitätsstelle WB,<br />
Dipl.-Ing. Günter Stich, BL Produktentwicklung WB,<br />
Thyssen Krupp Stahl <strong>AG</strong>, Duisburg<br />
Dr.-Ing. Jens-Arend Feindt,<br />
Leiter F&E, Vertrieb, Planung - Geschäftsfeld<br />
Karosserie,<br />
Thyssen Umformtechnik + Guss GmbH, Bielefeld<br />
Seite 9<br />
Pkw-Seitenaufprallträger aus<br />
Mehrphasenstählen<br />
Die guten Herstellungsbedingungen und<br />
Eigenschaften herkömmlicher höherfester<br />
Stähle haben bereits zu weit reichenden<br />
Anwendungen zur Erzielung von Leichtbau<br />
geführt. In den letzten Jahren wurden die<br />
so genannten Mehrphasenstähle mit Festigkeiten<br />
>700 MPa zur Serienreife entwickelt.<br />
Die besonderen Eigenschaften dieser<br />
Stähle resultieren aus der Kombination<br />
harter und weicher Phasen in der Mikrostruktur.<br />
Dualphasen (DP)-, Restaustenitphasen<br />
(RA)-, Complexphasen (CP)- und<br />
Martensitphasen (MS)-Stähle gehören zu<br />
dieser neuen Gruppe von Mehrphasen-<br />
Stählen. Sie können als warm- oder kaltgewalzte<br />
Bänder mit unterschiedlichen<br />
Oberflächenveredelungen erzeugt werden.<br />
Ihr gutes Kaltumform- und Verfestigungsvermögen<br />
prädestinieren diese Stähle für<br />
das wirtschaftliche Kaltformgebungsverfahren.<br />
Die im Bauteil erzielbaren hohen<br />
Festigkeitskennwerte unter statischer und<br />
dynamischer Beanspruchung erlauben<br />
einen technisch und wirtschaftlich günstigen<br />
Einsatz dieser Stähle für crashrelevante<br />
Teile. Besonders Seitenaufprallträger sind<br />
geradezu ideale Anwendungen für diese<br />
hochfesten Stähle, da es hierbei auf eine<br />
hohe Energieaufnahme bei geringen<br />
Deformationen ankommt.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Dr.-Ing. Jochen Krautschick,<br />
Leiter Werkstoff- und Anwendungstechnik,<br />
Krupp Thyssen Nirosta GmbH, Düsseldorf<br />
Dipl.-Ing. Peter Harbig,<br />
Leiter Entwicklung und Vertrieb - Geschäftsfeld<br />
Fahrwerk,<br />
Thyssen Umformtechnik + Guss GmbH,<br />
Bielefeld<br />
Seite 13<br />
Blechradträger aus NIROSTA ®<br />
H400<br />
Der Ersatz herkömmlicher Radträger von<br />
Einzelradaufhängungen, die aus einer<br />
Stahlgusskonstruktion mit angeschraubtem<br />
Längslenker bestehen, durch eine<br />
Blech-Schweiß-Konstruktion vereinfacht<br />
die Herstellung und kann zu einem Gewinn<br />
an Sturz- und Spursteifigkeit führen.<br />
Um das Gewicht weiter zu optimieren,<br />
wurde ein Blechradträger aus NIROSTA ®<br />
H400 entwickelt. Durch Blechdickenreduzierung<br />
– wobei der Steifigkeitsverlust<br />
durch konstruktive Maßnahmen kompensiert<br />
werden konnte – war es möglich,<br />
nahezu das Gewicht eines Aluminium-Teils<br />
zu erreichen. Ein weiterer Vorteil von Edelstahl<br />
ist seine Korrosionsbeständigkeit.<br />
Kosten und Gewicht von Bauteilen aus<br />
NIROSTA ® H400 liegen zwischen den Vergleichswerten<br />
von Stahl und Aluminium,<br />
sodass sich bei Leichtbau-Lösungen mit<br />
diesem Werkstoff eine interessante Alternative<br />
anbietet, verbunden mit den Vorteilen<br />
des Einsatzes der bei Stahl eingeführten<br />
Fertigungstechnologien.<br />
Dr.-Ing. Harald Espenhahn,<br />
Leiter Geschäftsbereich Bänder,<br />
Krupp VDM GmbH, Werdohl<br />
Seite 16<br />
Aluchrom 7Al YHf – Neuer Katalysatorträger-Werkstoff<br />
von<br />
Krupp VDM<br />
Um die künftigen Abgasnormen einhalten<br />
zu können, ist die Entwicklung neuartiger<br />
Katalysatorkonzepte erforderlich. Als<br />
Katalysatorträger setzen sich dabei zunehmend<br />
gewickelte Metallfolien durch. Sie<br />
heizen sich schnell auf und bieten die<br />
Möglichkeit des elektrischen Vorheizens.<br />
Angestrebt wird eine weitere Verringerung<br />
der Foliendicke, um die Betriebstemperatur<br />
des Katalysators noch schneller zu<br />
erreichen.<br />
Um die Lebensdauer dieser dünneren<br />
Folie nicht zu beeinträchtigen, müssen die<br />
Trägerfolien eine hohe Oxidationsbeständigkeit<br />
aufweisen. Durch eine Erhöhung<br />
des Aluminiumgehaltes kann die Oxidationsbeständigkeit<br />
deutlich gesteigert werden.<br />
Die wirtschaftliche Herstellung derartiger<br />
Folien erfordert jedoch ein gegenüber<br />
Folien aus konventionellen Legierungen<br />
angepasstes Fertigungsverfahren.<br />
Im Rahmen eines vom Bundesminister<br />
für Bildung und Forschung geförderten<br />
Forschungsprojektes hat Krupp VDM<br />
GmbH, Werdohl, mit Aluchrom 7Al YHf<br />
einen geeigneten Werkstoff entwickelt, der<br />
bei nur 25 µm Foliendicke alle Anforderungen<br />
hinsichtlich Oxidationsbeständigkeit<br />
und Umformbarkeit erfüllt.
05<br />
Inhalt<br />
Dr. Ken Rusch,<br />
Technical Programs Manager,<br />
Budd Plastics Division, Troy, Michigan, USA<br />
Seite 20<br />
Ladekästen aus Verbundwerkstoffen<br />
für neue SUV- und<br />
Pickup-Modelle<br />
Seit der Einführung von SMC-Verbundwerkstoffen<br />
im Automobilbau Anfang der<br />
70er-Jahre hat ihr Einsatz ständig zugenommen.<br />
Eine neue Großanwendung von SMC<br />
sind Ladekästen (Cargo-Box) für Pickups<br />
und SUV-Fahrzeuge. Der Ford Explorer<br />
Sport Trac des Modelljahres 2001 ist das<br />
erste Serienfahrzeug mit einer SMC-Cargo-<br />
Box. Sie wird im Budd-Werk North Baltimore<br />
gefertigt. Das Innere dieser Box ist<br />
ein ca. 31 kg schweres einteiliges SMC-<br />
Formteil, das zur Erhöhung der Strukturfestigkeit<br />
mit integrierten Versteifungsrippen<br />
versehen ist. Auch die äußeren<br />
Seitenverkleidungen der Box bestehen aus<br />
SMC.<br />
In umfangreichen Tests konnte nachgewiesen<br />
werden, dass die Cargo-Box aus<br />
SMC einem konventionellen Ladebereich<br />
aus Stahl überlegen ist: Sie ist unempfindlich<br />
gegen schonungslose Behandlung,<br />
kann nicht verbeulen und ist korrosionsbeständig.<br />
Auf Grund geringerer Werkzeugkosten<br />
sind die Herstellkosten im Allgemeinen<br />
geringer als bei einer mehrteiligen Stahlkonstruktion.<br />
Dies ist bei geringen Stückzahlen<br />
(Sonderausführungen) von besonderem<br />
Vorteil.<br />
Die Reduzierung des Systemgewichts<br />
gegenüber einer Stahlausführung um bis<br />
zu 30 % senkt den Kraftstoffverbrauch,<br />
verbessert das Fahrverhalten und ermöglicht<br />
den Einbau weiterer Zusatzausstattung<br />
in das Fahrzeug, ohne die Gewichtsklasse<br />
zu überschreiten.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Dipl.-Ing. ETH Daniel Brunnschweiler,<br />
Entwicklungsleiter, EPAS,<br />
Krupp Presta <strong>AG</strong>, Eschen, Liechtenstein<br />
Seite 27<br />
TubPAS – die elektromechanische<br />
Lenkhilfe von Krupp Presta<br />
TubPAS ist eine neuartige von Krupp<br />
Presta entwickelte elektrische Lenkhilfe als<br />
Alternative zur konventionellen hydraulischen<br />
Lenkunterstützung.<br />
TubPAS erfüllt die Anforderungen des<br />
Verbrauchers bezüglich Komfort, Funktionalität<br />
und Preis ebenso wie die Forderung<br />
des Gesetzgebers nach Verbrauchsminderung.<br />
Dem Fahrzeughersteller bietet die<br />
kompakte Bauweise von TubPAS – röhrenförmige,<br />
konzentrisch um die Zahnstange<br />
angeordnete Lenkhilfe mit bürstenlosem<br />
Seltenerden-Motor – die Möglichkeit des<br />
Einbaus in den Bauraum, der heute für<br />
hydraulische Lenkhilfen zur Verfügung<br />
steht. Die ganze Lenkhilfe besteht aus nur<br />
7 bis 8 Einzelteilen und kann wirtschaftlich<br />
auf automatisierten Anlagen für sehr hohe<br />
Stückzahlen gebaut werden.<br />
TubPAS verbindet minimale Reibung,<br />
und damit gutes Lenkgefühl für den Fahrer,<br />
mit optimalem Wirkungsgrad, sodass<br />
sich die erforderliche Unterstützungsleistung<br />
mit den heutigen Bordnetzen darstellen<br />
lässt.<br />
Dipl. Verw.-Wiss. Michael Sailer,<br />
Marketing,<br />
Thyssen Umformtechnik + Guss GmbH,<br />
Bielefeld<br />
Seite 32<br />
Stahl-Leichtbau-Verbundlenkerachse<br />
für Pkw von<br />
Thyssen Umformtechnik + Guss<br />
Die Thyssen Umformtechnik + Guss<br />
GmbH, Werk Brackwede, hat ein neues<br />
Konzept für die Konstruktion von Verbundlenkerachsen<br />
entwickelt.<br />
Die wesentlichste Innovation dieser Konstruktion<br />
ist ein neuartiges Torsionsprofil,<br />
das eine deutlich geringere Wanddicke<br />
besitzt als vergleichbare herkömmliche<br />
Bauteile. Dies wird neben dem Einsatz<br />
eines höherfesten Dualphasenstahls durch<br />
eine neuartige Profilgestaltung in Form<br />
eines walzprofilierten doppelten U-Querschnitts<br />
mit einem Hohlraum zwischen<br />
innerer und äußerer Schale ermöglicht.<br />
Hierdurch ergibt sich ein Torsionsträgheitsmoment,<br />
das über dem konventionell<br />
geformter Torsionsprofile liegen kann. Die<br />
Konstruktion des Bauteils ermöglicht überdies<br />
den Verzicht auf den ansonsten üblichen<br />
Stabilisator.<br />
Eine weitere Neuerung besteht im Einsatz<br />
von Längslenkern aus flanschlos<br />
geschweißten Halbschalen.<br />
Das neue Konzept bietet größere Gestaltungsfreiheit<br />
und spart bis zu 25 % Kosten<br />
und bis zu 30 % Gewicht.
06<br />
Inhalt<br />
Dipl.-Ing. Klaus Schmidt,<br />
Entwicklung Stoßdämpfer,<br />
Krupp Bilstein GmbH, Ennepetal<br />
Seite 34<br />
Innovative Luftfeder-Dämpfermodule<br />
für die S-Klasse von<br />
DaimlerChrysler<br />
Die Krupp Bilstein GmbH ist als kompetenter<br />
Entwicklungspartner und Serienlieferant<br />
der internationalen Automobilindustrie<br />
anerkannt. Hohe Flexibilität und Innovationsfreudigkeit<br />
zeichnen das Unternehmen<br />
aus.<br />
In Zusammenarbeit mit DaimlerChrysler<br />
galt es für die S-Klasse ein neuartiges<br />
Luftfeder-Dämpfermodul zu entwickeln,<br />
das die Qualitäten konventioneller Komponenten<br />
hinsichtlich Fahrkomfort und Fahrdynamik<br />
deutlich übertrifft und dadurch<br />
einen spürbaren Kundenvorteil erzielt.<br />
Für die Zielerreichung bedurfte es einer<br />
völligen Neuentwicklung der Luftfeder und<br />
des vierstufig verstellbaren Dämpfers. Bisher<br />
bekannte Technologien, besonders die<br />
der Luftfederfertigung, konnten nicht<br />
genutzt werden, weil der bekannte Stand<br />
der Technik den Anforderungen an das<br />
Produkt nicht mehr gerecht wurde.<br />
Unter Berücksichtigung des Kostenziels<br />
und der hoch angesetzten Qualitätsanforderungen<br />
mussten für die Fertigung der<br />
Luftfeder-Dämpfermodule automatische<br />
Fertigungseinrichtungen prozesstechnisch<br />
entwickelt und installiert werden.<br />
Die positiven Bewertungen des Systems<br />
vom Endkunden rechtfertigen den für die<br />
Realisierung notwendigen hohen technischen<br />
Aufwand. Die Luftfederung mit verstellbaren<br />
Dämpfern ist als Wegweiser in<br />
eine neue Technologie zu verstehen, an<br />
der auch die Krupp Bilstein GmbH zukünftig<br />
intensiv arbeiten wird.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Dr. Wolfgang Stein,<br />
Geschäftsführer / Leiter Technik,<br />
Dipl.-Ing. Hartmuth Willnauer,<br />
Leiter Entwicklung,<br />
Thyssen Fahrtreppen GmbH, Hamburg<br />
Seite 40<br />
Die Smartstep-Stufe – Innovation<br />
im Fahrtreppenbau<br />
Mit der „Smartstep“ hat Thyssen Fahrtreppen<br />
die erste Kunststoffstufe der Welt<br />
auf den Markt gebracht.<br />
Die Smartstep wird im Spritzgießverfahren<br />
aus einem von der Bayer <strong>AG</strong> eigens<br />
hierfür entwickelten glasfaserverstärkten<br />
Polyester-Material hergestellt. Durch beigefügte<br />
Farbpigmente ist der Stufenkörper<br />
in verschiedenen Farben durchgefärbt,<br />
sodass spätere Abnutzungsspuren farblich<br />
nicht auffallen. Für die Steifheit der Stufe<br />
sorgt eine präzise berechnete Verrippung<br />
auf der Innenseite und ein Stahlrohr an der<br />
Stufenhinterkante.<br />
Anders als bei bekannten Aluminiumstufen<br />
hat die Smartstep eine porenfreie<br />
Oberfläche. Daher ist die Smartstep sauberer,<br />
Schmutz haftet schlechter und die<br />
Reinigung wird erleichtert. Zudem ist das<br />
neue Material rutschfester und dämpft<br />
Geräusche besser.<br />
Im Material eingeschlossene Brandschutzmittel<br />
wirken nach Flammeinwirkung<br />
selbstverlöschend. Das Material ist dennoch<br />
schwer entflammbar und erfüllt somit<br />
internationale Brandschutznormen.<br />
Auch für den Produktionsprozess ergeben<br />
sich Vorteile. Die Spritzgussform wird<br />
weniger stark beansprucht als die Druckgussform<br />
bei Aluminiumstufen und hat<br />
demzufolge eine längere Standzeit.<br />
Die Smartstep ist leichter als eine Aluminium-Stufe,<br />
ein Vorteil beim Einbau und<br />
bei späteren Service-Arbeiten.<br />
Dr. rer. pol. Claus Algenstaedt,<br />
Abteilungsdirektor Zentrales Marketing,<br />
Thyssen Schulte GmbH, Düsseldorf<br />
Seite 44<br />
„TS Online“ – die Plattform für<br />
den elektronischen Geschäftsverkehr<br />
von Thyssen Schulte<br />
Für Thyssen Schulte bedeutet „TS Online“<br />
eine zeitgemäße Optimierung des<br />
Geschäftsmodells und kundenorientierte<br />
Weiterentwicklung. „TS Online“ ist als<br />
neuer elektronisch gesteuerter Informations-,<br />
Verkaufs- und Transaktionskanal<br />
gedacht. Das Konzept ist auf Integration<br />
der gesamten Geschäftsabwicklung ausgerichtet.<br />
Dieser „Business to Business“-<br />
Ansatz wird seit Frühjahr 1999 konsequent<br />
verfolgt.<br />
Als Komplettanbieter von über 120.000<br />
Artikeln aus dem Werkstoffprogramm ist<br />
die Geschäftsstrategie von Thyssen Schulte<br />
auf die direkte Bearbeitung von Verarbeitern<br />
in Industrie, Handwerk und Bauwirtschaft<br />
ausgerichtet.<br />
Durch Zugangscode gesichert, können<br />
sich die Kunden bei „TS Online“ über die<br />
aktuelle Verfügbarkeit der Artikel informieren.<br />
Auf dieser Basis besteht die Möglichkeit<br />
– abweichend vom klassischen Muster<br />
der Auftragserteilung –, Aufträge elektronisch<br />
über „TS Online“ zu platzieren.<br />
Thyssen Schulte ist also 24 Stunden geöffnet.<br />
Auch im Online-Zeitalter bleibt allerdings<br />
der größte Erfolgsfaktor für ein Unternehmen<br />
die leistungsfähige Logistik, damit der<br />
Zeitgewinn aus elektronischen Geschäftsprozessen<br />
nicht bei der Lieferung verloren<br />
geht.
07<br />
Inhalt<br />
Peter Buderath,<br />
Leiter Abteilung ORG/DV,<br />
Thyssen Krupp Stahlunion GmbH, Düsseldorf<br />
Seite 50<br />
Online-Dokumenten-Management-System<br />
für Abnahmeprüfzeugnisse<br />
von <strong>ThyssenKrupp</strong><br />
Stahlunion<br />
Der Prozess der Herstellung, Distribution<br />
und Verarbeitung von Stahl oder Metallen<br />
unterliegt der Qualitätssicherung und wird<br />
von laufenden Kontrollen begleitet. Von<br />
besonderer Bedeutung für die Rückverfolgbarkeit<br />
des Materials ist dabei das Abnahmeprüfzeugnis<br />
(Werkszeugnis). Es begleitet<br />
den jeweiligen Werkstoff vom Hersteller<br />
bis hin zum Verarbeitungsbetrieb des Kunden<br />
irgendwo in der Welt.<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> Stahlunion (TKSU) mit<br />
einem weltumspannenden Verkaufsnetz<br />
benötigt jährlich Zehntausende von Werkszeugnissen.<br />
Zur Optimierung der Geschäftsprozesse<br />
bei Archivierung, Suche und Verteilung<br />
von Werkszeugnissen in der in- und<br />
ausländischen Organisation einerseits und<br />
zur Pflege von Kundenverbindungen andererseits<br />
hat TKSU in Düsseldorf ein neues<br />
Dokumenten-Archivierungs-Management-<br />
System auf Basis der Internet-Technologie<br />
entwickelt und eingeführt.<br />
Ziel des globalen Systems ist es, Werkszeugnisse<br />
für alle TKSU-Gesellschaften im<br />
In- und Ausland rund um die Uhr online<br />
verfügbar zu haben. Das „World-Wide-<br />
Web“ bietet dafür eine hervorragende<br />
Technologieplattform. Auf einem zentralen,<br />
weltweit zugänglichen Internet-Server<br />
neuester Technologie sind inzwischen die<br />
Abnahmeprüfzeugnisse von nahezu allen<br />
TKSU-Landesgesellschaften mit den erforderlichen<br />
Suchkriterien in einer Datenbank<br />
hinterlegt. Kostenfreie Standard-Tools<br />
ermöglichen die komfortable Bedienung<br />
und Navigation. Das Projekt ist mit nennenswerten<br />
Einsparungen verbunden und<br />
soll erweitert werden.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Dr.-Ing. Holger Lieberwirth,<br />
Leiter Engineering*),<br />
Krupp Fördertechnik GmbH, Essen<br />
*) bis 31. 03. 2000<br />
Seite 56<br />
Innovative Lösungen für den<br />
Abraumtransport in einem<br />
Kupfer- und Goldtagebau<br />
Im Tagebau Grasberg in Indonesien wird<br />
eines der reichsten Gold- und Kupfervorkommen<br />
der Welt abgebaut. Die erheblichen<br />
Abraummengen machen einen diskontinuierlichen<br />
Abraumtransport zunehmend<br />
unwirtschaftlich. So entschied man<br />
sich für die Installation eines kontinuierlichen<br />
Fördersystems, bestehend aus<br />
Brechanlage, Bandanlagen und einem<br />
semimobilen Absetzer mit Transportraupe.<br />
Der Oberbau des Absetzers mit einer<br />
Gesamtlänge von 160 m stützt sich auf ein<br />
Portal ab, unter das die Transportraupe<br />
fahren kann, um den Absetzer zu bewegen.<br />
Die Tragkonstruktion des Abwurfauslegers<br />
wurde als leichte Rohrkonstruktion<br />
mit horizontaler und vertikaler Seilverspannung<br />
gestaltet. Hierdurch konnte eine<br />
Gewichtseinsparung um 50 % gegenüber<br />
einem vergleichbaren Absetzer mit Fahrund<br />
Schwenkwerk erzielt werden. Außerdem<br />
sind durch das neue Konzept die<br />
Betriebskosten deutlich geringer.<br />
Die Außenkonturen der zum Bewegen<br />
des Absetzers und zum Versetzen der<br />
Brechanlagen notwendigen Transportraupe<br />
musste an die freien Querschnitte der<br />
vorhandenen Systeme angepasst werden.<br />
So entstand eine sehr kompakte Transportraupe<br />
mit extremer Tragfähigkeit und Leistung.<br />
Linda Frederick, B. Comm,<br />
Marketing und Kommunikation,<br />
Krupp Canada, Inc., Calgary, Kanada<br />
Seite 60<br />
Öko-Schiffsbelader von Krupp<br />
Canada<br />
Kupferkonzentrat stellt für die Meeresflora<br />
und -fauna eine potenzielle Gefährdung<br />
dar. Für eine Hafenanlage in Chile, in<br />
der bis zu 1 Mio t Kupferkonzentrat pro<br />
Jahr verladen werden, wurde Krupp Canada<br />
mit der Entwicklung und dem Bau eines<br />
Schiffsbeladers beauftragt, bei dem das<br />
Verschütten von Kupferkonzentrat vollständig<br />
vermieden werden sollte.<br />
Kritisches Element eines Schiffsbeladers<br />
ist der Ausleger, der bis zu den Luken des<br />
Schiffes reichen muss. Um einerseits den<br />
statischen Anforderungen zu genügen und<br />
andererseits das Gewicht des Auslegers<br />
möglichst gering zu halten, wird üblicherweise<br />
der Ausleger als leichte Fachwerkkonstruktion<br />
ausgebildet. Da mit dieser<br />
traditionellen Bauweise ein Verschütten<br />
des Transportgutes nicht auszuschließen<br />
ist, entschied sich Krupp Canada für ein<br />
völlig geschlossenes, staubdichtes System<br />
mit einem Ausleger in Röhrenform. Die<br />
Röhre erfüllt dabei alle mechanischen Auslegerfunktionen<br />
und fungiert zugleich als<br />
tragendes Bauteil.<br />
Der Ausleger wurde zur Sicherstellung<br />
der Umweltaspekte mit einer Staubsaugvorrichtung<br />
ausgestattet, mit der während<br />
der Wartungsperioden das Innere des Auslegers<br />
gereinigt werden kann.
08<br />
Inhalt<br />
Dr.-Ing. Holger Thielert,<br />
Stellv. Hauptabteilungsleiter Gastreatment<br />
Plants,<br />
Thyssen Krupp Encoke GmbH, Bochum<br />
Seite 63<br />
Automatisierung und Optimierung<br />
von Gasreinigungsanlagen<br />
mit GasControl<br />
Gasreinigungsanlagen als Bestandteil<br />
von Kokereien werden heute noch weitgehend<br />
manuell gefahren, das Betriebsergebnis<br />
ist somit in hohem Maße abhängig<br />
von der Motivation, Qualifikation und<br />
Erfahrung des Bedienpersonals.<br />
Mit GasControl wurde erstmalig ein<br />
System für den automatisierten und optimierten<br />
Betrieb von Gasreinigungsanlagen<br />
entwickelt. Das System besteht im Wesentlichen<br />
aus einem Datenserver, einem<br />
Modellrechner und einer Auswerte-/<br />
Bedienstation. Der Datenserver beinhaltet<br />
eine Echtzeitdatenbank, die kontinuierlich<br />
mit Prozessdaten versorgt wird. Diese<br />
Daten werden im Modellrechner als<br />
Eingangsgrößen in einem dynamischen<br />
Simulationsmodell verarbeitet und hieraus<br />
Sollwerte für die Prozessregelung berechnet,<br />
die nachfolgend an das Leitsystem<br />
übertragen werden. Das Gesamtsystem ist<br />
flexibel aufgebaut, sodass es sich automatisch<br />
auf unterschiedliche Standardbetriebsweisen<br />
einstellen kann.<br />
GasControl wurde bereits auf zwei<br />
Anlagen installiert. Die Betriebserfahrungen<br />
zeigen, dass es mit GasControl<br />
möglich ist, Gasreinigungsanlagen immer<br />
am optimalen Betriebspunkt zu betreiben.<br />
Der modulare Aufbau und die Verwendung<br />
kommerzieller Standardsoftware<br />
machen die Übertragung auf Chemie-/<br />
Petrochemieanlagen aller Art möglich.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Dr.-Ing. Lutz Palm,<br />
Geschäftsführer,<br />
JAFO Technologie, Hamburg<br />
Dipl.-Ing. Norbert Platz,<br />
Leiter Fertigung,<br />
Blohm+Voss Repair GmbH, Hamburg<br />
Seite 69<br />
Innovative Technologien zur Entlackung<br />
und Farbbeschichtung<br />
von Schiffen im Dock<br />
Die Reinigung und Farbbeschichtung der<br />
Schiffsaußenhaut sind arbeitsintensive<br />
und umweltsensitive Prozesse, die zudem<br />
meist in kurzen Dockliegezeiten durchgeführt<br />
werden müssen.<br />
Die Blohm+Voss Repair GmbH hat hierfür<br />
innovative Technologien mit den<br />
Zielsetzungen: Reduzierung der Umweltbelastungen,<br />
Schonung von Materialressourcen,<br />
Verbesserung der Arbeitsbedingungen<br />
sowie Erhöhung der<br />
Produktivität entwickelt.<br />
Zur Reinigung findet das Waterblasting<br />
in Form von Hochdruckwasserstrahlen mit<br />
integrierter Prozess- und Abwasserbehandlung<br />
Anwendung. Gegenüber dem<br />
konventionellen Gritblasting kann die<br />
Menge anfallender und zu entsorgender<br />
Reststoffe deutlich reduziert werden.<br />
Außerdem erhöht Waterblasting die<br />
Qualität der gereinigten bzw. entlackten<br />
Schiffsaußenhaut.<br />
Mit dem PAINTMASTER wurde eine automatisierte<br />
mobile Beschichtungsanlage<br />
entwickelt, deren wesentliches Element ein<br />
mehrdüsiger Spritzkopf mit Oversprayabsaugung<br />
ist. Die Strahlführung im gekapselten<br />
Beschichtungskopf verbessert die<br />
Homogenität und Reproduzierbarkeit des<br />
Farbauftrags, und durch Oversprayminimierung<br />
kann der Farbverlust drastisch<br />
reduziert werden. Infolge der realisierten<br />
Teilautomatisierung werden der Personalbedarf<br />
verringert und verbesserte Arbeitsbedingungen<br />
geschaffen.
9<br />
Dr.-Ing. Bernhard Engl,<br />
Dipl.-Ing. Jürgen Esdohr,<br />
Dr.-Ing. Jens-Arend Feindt,<br />
Pkw-Seitenaufprallträger aus Mehrphasenstählen<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Dr.-Ing. Thomas Heller,<br />
Dipl.-Ing. Klaus Köhler,<br />
Dipl.-Ing. Günter Stich<br />
Seitenaufprallträger aus CP-Stahl werden bereits in<br />
der Großserie, wie z. B. beim VW Golf IV, eingesetzt<br />
(Bild 1). Quelle: Financial Times, Juni 1999
10<br />
1 Einleitung<br />
Pkw-Seitenaufprallträger aus Mehrphasenstählen<br />
Leichtbau verbindet man häufig zu<br />
Unrecht mit Werkstoffen wie Magnesium,<br />
Aluminium oder Kohlefasern. Die Anwendungsforschung<br />
konzentriert sich in vielen<br />
Fällen viel zu einseitig auf die Verwendung<br />
und Verarbeitung dieser „modernen“ Werkstoffe.<br />
In letzter Zeit wird zunehmend<br />
erkannt, dass auch bei dem vermeintlich<br />
bekannten Werkstoff Stahl noch längst<br />
nicht alle Potenziale ausgeschöpft sind. Es<br />
gibt absolut keinen Zweifel daran, dass vor<br />
allem Stahl zu den modernen und höchst<br />
attraktiven Leichtbauwerkstoffen gehört.<br />
Die Entwicklungsarbeiten der Stahlindustrie<br />
haben sich in den letzten Jahren darauf<br />
konzentriert, die Umform-, Festigkeits- und<br />
die Verarbeitungseigenschaften von Stahl<br />
zu verbessern (Bild 2). Dies fängt bei den<br />
weichen Stählen an und geht bis zu<br />
höchstfesten Martensitphasenstählen mit<br />
Festigkeiten von mehr als 1.200 MPa.<br />
Dabei ist es beispielsweise gelungen, den<br />
verfügbaren Festigkeitsbereich für Warmband<br />
um bis zu 50 % zu erweitern. Darüber<br />
hinaus konnten die Umformeigenschaften<br />
über einen weiten Festigkeitsbereich deut-<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
lich verbessert werden.<br />
Mit den Mehrphasenstählen wurde eine<br />
neue Stahlfamilie geschaffen. Neben den<br />
bekannten Verfestigungsmechanismen, wie<br />
Kornfeinung, Ausscheidungshärtung und<br />
Mischkristallverfestigung, nutzt man hier im<br />
Wesentlichen die Gefügehärtung. Die spezifischen<br />
Eigenschaften dieser Stähle resultieren<br />
aus der Kombination unterschiedlich<br />
harter Gefügebestandteile (Bild 3). Damit<br />
ist es möglich, einen Festigkeitsbereich von<br />
500 bis 1.200 MPa abzudecken. Die spezifischen<br />
Eigenschaften der Stähle resultieren<br />
aus der maßgeschneiderten Kombination<br />
von harten und weichen Gefügebestandteilen.<br />
Für die sehr hohen Festigkeiten<br />
der Complexphasenstähle (CP) sind die<br />
extrem feinkörnige, bainitische Grundstruktur<br />
mit eingelagerten Ferrit- und Martensitinseln<br />
und eine Ausscheidungshärtung verantwortlich.<br />
Die höchsten Festigkeiten<br />
erreicht man schließlich durch die im<br />
Wesentlichen martensitische Gefügestruktur<br />
der Martensitphasenstähle (MS).<br />
Da der Korrosionsschutz eine immer<br />
wichtigere Rolle im Automobilbau spielt,<br />
bietet <strong>ThyssenKrupp</strong> Stahl alle Mehrphasenstähle<br />
auch oberflächenveredelt an.<br />
2 Festigkeits- und Crasheigenschaften<br />
Entwicklung höherfester Stähle (Bild 2) Gefügehärtung bei Mehrphasenstählen (Bild 3)<br />
Typisch für die Familie der Mehrphasenstähle<br />
ist ihr hohes Verfestigungsvermögen<br />
(work-hardening). Die Stähle verfestigen<br />
besonders bei geringen Verformungen sehr<br />
stark und zeigen darüber hinaus einen<br />
Bake-Hardening-Effekt, der im Gegensatz<br />
zu den bekannten BH-Stählen mit zunehmender<br />
Verformung ansteigt. Die bereits<br />
außerordentlich hohen Ausgangsfestigkeiten<br />
bei diesen Stählen führen zusammen<br />
mit hohem Work- und Bake-Hardening zu<br />
hohen Bauteilfestigkeiten.<br />
Im Hinblick auf das Crashverhalten sind<br />
die dynamischen Kennwerte der neuen<br />
Stähle von besonderem Interesse. Mit<br />
zunehmender Dehngeschwindigkeit nimmt<br />
die Fließspannung zu. Der Festigkeitsanstieg<br />
durch Vorverformung und anschließendes<br />
Bake-Hardening (20 Min./<br />
170 °C/Luft) bleibt auch bei hohen Dehngeschwindigkeiten<br />
erhalten. Damit sind<br />
wichtige Voraussetzungen für den Einsatz<br />
dieser Stähle für crashrelevante Bauteile<br />
erfüllt.<br />
In Versuchen unter einem Crash-Ham-
11<br />
Pkw-Seitenaufprallträger aus Mehrphasenstählen<br />
Seitenaufprallträger aus MS-W 1200 nach Crashversuch bei Raumtemperatur und bei -40 °C (Bild 4)<br />
mer, bei dem ein Fallgewicht mit einer definierten<br />
Geschwindigkeit einen bauteilähnlichen<br />
Standard-Crashkörper verformt,<br />
konnte die Auswirkung der erhöhten Werkstofffestigkeit<br />
nachgewiesen werden. Complexphasen-<br />
und Martensitphasenstähle<br />
zeichnen sich durch große Energieaufnahme<br />
sowie hohe Resthöhen nach der Crashverformung<br />
auch bei niedrigen Temperaturen<br />
aus.<br />
Auch Seitenaufprallträger aus höchstfestem<br />
Martensitphasenstahl, die an Stelle<br />
einer Stauchverformung mit einer Biegebeanspruchung<br />
geprüft wurden, zeigen bis zu<br />
-40 °C duktiles Verhalten im Crash-Fall<br />
(Bild 4).<br />
3 Der Anwendungsfall Seitenaufprallträger<br />
Eine nahezu ideale Anwendung für die<br />
hochfesten warmgewalzten CP- und MS-<br />
Stähle sind Seitenaufprallträger (Bild 5), die<br />
im Innenbereich von Pkw-Türen im unteren<br />
Drittel der Türrahmen befestigt werden und<br />
bei einem auftretenden Seitencrash den<br />
Überlebensraum bewahren sollen. Hier<br />
kommt es auf ein hohes Energieaufnahmevermögen<br />
im elastischen und gering plastischen<br />
Bereich an. Mit der Produktinnovation<br />
sind mehrere, sonst konkurrierende<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Ziele gleichzeitig erreicht worden: Gewichtsreduzierung,<br />
Kostenreduzierung und Prozessvereinfachung.<br />
Während Seitenaufprallträger<br />
aus konventionellen Stahlwerkstoffen<br />
nach oder während der Fertigung<br />
zusätzlich wärmebehandelt werden müssen,<br />
lassen sich die Träger aus den neuen<br />
Warmband-Stählen lediglich durch Stanzen<br />
und Kaltverformen herstellen, was erheblich<br />
Kosten einspart.<br />
Seitenaufprallträger aus elektrolytisch<br />
verzinktem CP-Stahl werden bereits heute<br />
in der Großserie, wie z.B. beim VW Golf IV,<br />
eingesetzt (Bild 1). Durch die Kombination<br />
von verzinktem Warmband mit hoher Festigkeit<br />
und guten Umformeigenschaften ist<br />
es gelungen, bei einem Automobilhersteller<br />
das aufwendigere Verfahren der Herstellung<br />
warmgepresster Teile mit anschließender<br />
Direkthärtung zu verdrängen.<br />
Neben der Reduzierung der Blechdicke<br />
von 1,9 auf 1,65 mm mit einer Gewichtsreduzierung<br />
von 13 % ergeben sich in der<br />
Herstellung beim Kunden beachtliche<br />
Kostenvorteile durch die bei der Kaltumformung<br />
erzielbare Reduzierung von Arbeitsgängen<br />
im Vergleich zur Warmumformung<br />
mit integrierter Härtung (Bild 6).<br />
Die noch höheren Festigkeiten des Martensitphasen-Stahles<br />
und die bei diesen<br />
Stählen einstellbaren geringen Walzdicken<br />
hat Thyssen Umformtechnik + Guss genutzt<br />
und einen gewichtsoptimierten Seitenaufprallträger<br />
auf Basis des warmgewalzten<br />
MS-Stahls zur Serienreife entwickelt.<br />
Dadurch lassen sich Bauteilfestigkeiten von<br />
bis zu 1.450 MPa realisieren, womit eine<br />
weitere Gewichtsreduzierung der Träger<br />
erreicht werden konnte. Das Bauteil ist<br />
damit nur wenige Gramm schwerer als ein<br />
bisher eingesetzter Seitenaufprallträger aus<br />
Aluminium, dafür aber bei verbesserten<br />
Eigenschaften um annähernd 50 % kostengünstiger<br />
(Bild 7). Zwei Automobilhersteller<br />
stellten die Produktion in der laufenden<br />
Serie auf das MS-W-1.200-Konzept um<br />
und haben damit Seitenaufprallträger aus<br />
Aluminium-Strangpressprofilen bzw. Rohren<br />
substituiert.<br />
Pkw-Seitenaufprallträger aus hochfesten Complex- und Martensitphasenstählen (Bild 5)
12<br />
Pkw-Seitenaufprallträger aus Mehrphasenstählen<br />
Einsparungen durch den Einsatz kaltumgeformter Seitenaufprallträger<br />
(Beispiel: Golf IV, Material: CP-W 1000) (Bild 6)<br />
Zerteilen<br />
4 Herstellungs- und Verarbeitungsentwicklungen<br />
Es ist damit zu rechnen, dass sich die<br />
neue Fertigungstechnologie der Herstellung<br />
kaltgeformter Seitenaufprallträger aus<br />
hochfesten Mehrphasenstählen bei weiteren<br />
Neufahrzeugen und Fahrzeugherstellern<br />
aufgrund der großen wirtschaftlichen<br />
Vorteile durchsetzt. Die vollständige Nutzung<br />
der in den hochfesten Mehrphasenstählen<br />
enthaltenen Potenziale beschränkt<br />
sich nicht auf die Herstellung von Seitenaufprallträgern.<br />
Simulationsrechnungen<br />
haben aufgezeigt, dass bei optimaler Werkzeugauslegung<br />
auch Stoßfänger und<br />
B-Säulenverstärkungen daraus herstellbar<br />
sind. Versuchs- und Serienfertigungen<br />
haben dies mittlerweile bestätigt.<br />
Voraussetzungen sind jeweils auf den<br />
Werkstoff abgestimmte Verarbeitungsprozesse,<br />
wobei die Werkstoff- und die Verfahrensentwicklung<br />
in enger Beziehung zur<br />
verfügbaren Anlagentechnik stehen. Dies<br />
gilt sowohl für den Hersteller des Werkstoffes<br />
als auch für den Anwender. In der Herstellung<br />
von Warmband kommt dem Verfahren<br />
des endabmessungsnahen Gießens<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
eine zunehmende Bedeutung zu. Die im<br />
letzten Jahr in Betrieb genommene<br />
Gießwalzanlage der Thyssen Krupp Stahl<br />
<strong>AG</strong> ist ein Beispiel dafür, wie innovative<br />
Werkstoff- und Anlagenentwicklung ineinander<br />
greifen und voneinander profitieren:<br />
Hier gibt es nunmehr beste Voraussetzungen<br />
zur Darstellung neuester hochfester<br />
Kaltumformstähle für Warm- und Kaltbandprodukte<br />
in noch geringeren Dicken bei<br />
geringeren Streuungen der Werkstoff- und<br />
Geometrieeigenschaften im Vergleich zur<br />
konventionellen Erzeugung.<br />
Konzeptvergleich Seitenaufprallträger (Bild 7)<br />
In der Verarbeitung, wie z.B. beim Stanzen<br />
und Kaltumformen, müssen natürlich<br />
die Verarbeitungsmaschinen den deutlich<br />
gestiegenen Festigkeiten der hochfesten<br />
Mehrphasenstähle gerecht werden. Bei<br />
einem der Kaltformung vorgeschalteten<br />
Schneidprozess sollte in der Schnittkante<br />
der Verfestigungsbetrag minimiert werden,<br />
um ggf. Anrisse bei der Umformung zu vermeiden.<br />
Weiterhin sollte die Werkzeugoberfläche<br />
den erhöhten Anforderungen durch<br />
die hohe Werkstoffhärte entsprechen, um<br />
Standzeiten zu optimieren.<br />
Diese beispielhaften, im Vergleich zu<br />
konventionellen Kaltumformstählen gestiegenen<br />
Anforderungen in den Verarbeitungsbedingungen<br />
zeigen, dass zur vollständigen<br />
Nutzung der Werkstoffpotenziale<br />
auch Entwicklungen in der Verarbeitung<br />
erforderlich sind.<br />
Die zuvor vorgestellten Resultate beweisen,<br />
dass Stahl ein leistungsfähiger Werkstoff<br />
ist, da sich mit ihm Begriffe wie Festigkeit,<br />
Sicherheit und gute Verarbeitbarkeit<br />
verbinden.
13<br />
Dr.-Ing. Jochen Krautschick,<br />
Dipl.-Ing. Peter Harbig<br />
Blechradträger aus NIROSTA ® H400<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Radträger aus NIROSTA ® H400 (Bild 1)
14<br />
Blechradträger aus NIROSTA ® H400<br />
1 Ausgangssituation<br />
Herkömmliche Radträger von Einzelradaufhängungen<br />
bestehen in der Regel<br />
aus einer Stahlgusskonstruktion mit einem<br />
angeschraubten Längslenker (Schwert).<br />
Diese Konstruktion hat den Nachteil, dass<br />
das Bauteil zum einen relativ schwer und<br />
zum anderen, bedingt durch die mechanische<br />
Bearbeitung, relativ teuer ist.<br />
2 Neuer Lösungsansatz<br />
Bei der vorgestellten Lösung wurde das<br />
Gussteil durch eine Blech-Schweiß-Konstruktion<br />
ersetzt. Außerdem wurde das<br />
Schwert integriert, sodass während der<br />
Montage das Anschrauben des Schwertes<br />
als Arbeitsgang entfällt. Bedingt durch die<br />
doppelseitige Aufnahme der Lenkerarme –<br />
bei der Gussteilkonstruktion werden die<br />
Lenkerarme einseitig verschraubt – gewinnt<br />
die Blechkonstruktion zusätzlich an Sturzund<br />
Spursteifigkeit. Das Gehäuse zur<br />
Aufnahme des Gummi-Metall-Lagers wird<br />
direkt aus dem Blech des Längslenkers<br />
durch Ziehen hergestellt und so ausgebildet,<br />
dass die Krafteinleitung mittig am freien<br />
Ende des Längslenkers erfolgt. Auch<br />
hierdurch wurde ein zusätzlicher Arbeitsgang<br />
(Einschweißen eines Rohrabschnittes)<br />
vermieden.<br />
3 Bauteiloptimierung<br />
In dem Bestreben, das Gewicht des Bauteiles<br />
weiter zu optimieren und selbst einen<br />
möglichen Gewichtsnachteil zu einer Aluminium-Guss-Ausführung<br />
zu minimieren,<br />
wurde das Bauteil aus NIROSTA ® H400<br />
weiterentwickelt. Durch Blechdickenreduzierungen<br />
war es möglich, nahezu das<br />
Gewicht des Aluminium-Teiles zu erreichen.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Herkömmliche Konstruktion eines Radträgers, bestehend aus einem Guss-Radträger<br />
mit angeschraubtem Biegelenker (Bild 2)<br />
Der Verlust an Steifigkeit, bedingt durch die<br />
Blechdickenreduzierung, konnte durch konstruktive<br />
Änderungen kompensiert werden.<br />
Die bereits angeführten Vorteile bezüglich<br />
des Herstellungsprozesses einer Stahl-<br />
Schweiß-Konstruktion bleiben erhalten.<br />
Ein weiterer Vorteil des Edelstahles ist die<br />
Korrosionsbeständigkeit. Gerade im<br />
Bereich des Fahrwerkes, das Steinschlägen<br />
und ständigen Umwelteinflüssen ausge-<br />
setzt ist, kann dieser Vorteil des Edelstahles<br />
genutzt werden, um bisher nie erreichte<br />
Blechstärken zu realisieren.<br />
4 Neuer Werkstoff<br />
NIROSTA ® H400<br />
NIROSTA ® H400 ist ein neuer nichtrostender<br />
Stahl, der speziell für konstruktive<br />
Anwendungen im Automobil im Wettbe-<br />
Blechpressteil-Lösung eines Radträgers, bestehend aus zwei Blechschalen mit integriertem Biegelenker<br />
(Bild 3)
15<br />
Blechradträger aus NIROSTA ® H400<br />
Hinterachse mit eingebauten Radträgern (gelb) als Blech-Schweiß-Konstruktion<br />
(Bild 4)<br />
werb mit Aluminium entwickelt wurde. Die<br />
Entwicklung folgte dabei konsequent den<br />
Anforderungen, wie sie in der ULSAB-Studie<br />
(Ultra-Light-Steel-Automotive-Body) der<br />
internationalen Stahlindustrie formuliert<br />
wurden. Dort werden für den Leichtbau mit<br />
Stahl Werkstoffe mit hohen Streckgrenzen<br />
und Festigkeiten bei sehr gutem Umformvermögen<br />
gefordert. Zusätzlich sind hohe<br />
Schwingfestigkeit und Energieaufnahme im<br />
Crash von herausragender Bedeutung.<br />
NIROSTA ® H400 weist Streckgrenzen von<br />
min. 400 N/mm2 auf. Auf Grund der besonderen<br />
Verfestigungsmechanismen der austenitischen<br />
Gitterstruktur hat man auch bei<br />
diesen Festigkeiten noch ein ausgezeichnetes<br />
Umformvermögen, das sich in einer<br />
Bruchdehnung von ca. 50 % widerspiegelt.<br />
Die Vorteile in der Schwingfestigkeit und in<br />
der Crashenergieaufnahme sind auch im<br />
Vergleich zu hochfestem Feinblech erheblich.<br />
Die Eigenschaften ermöglichen bei den<br />
potenziellen Anwendungen deutliche<br />
Blechdickenreduzierungen im Vergleich zu<br />
ferritischem Stahl. Bei flächigen Bauteilen,<br />
wie der Außenhaut, ist das Leichtbaupotenzial<br />
gering, denn die elastischen Eigen-<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
schaften und die Dichte sind vergleichbar<br />
dem ferritischen Stahl.<br />
Die Korrosionsbeständigkeit entspricht<br />
den bekannten Edelstählen wie 1.4301.<br />
Probleme bei der Lackierbarkeit, die den<br />
Einsatz im Automobil beeinträchtigen<br />
könnten, sind nicht bekannt.<br />
5 Ausblick<br />
Mechanische Eigenschaften der NIROSTA ® H-Stähle im Vergleich (Bild 5)<br />
Generell zeichnet sich ab, dass Kosten<br />
und Gewicht von Bauteilen aus NIROSTA ®<br />
H400 zwischen den Vergleichswerten von<br />
Stahl und Aluminium liegen. Der Fahrzeugentwickler<br />
muss also bei Zwang zum<br />
Leichtbau nicht mehr sofort den Sprung<br />
zum Aluminium wagen, sondern hat erstmals<br />
als Alternative eine Zwischenlösung,<br />
verbunden mit der eingeführten Fertigungstechnologie<br />
von Stahl.<br />
NIROSTA ® H400 wird daher genau dort<br />
zum Zuge kommen, wo bereits Aluminium-<br />
Lösungen eingesetzt werden oder wo man<br />
über solche Lösungen nachdenkt. Der<br />
erwartete Zuwachs für NIROSTA ® H400<br />
wird daher im Wesentlichen auf Kosten des<br />
Wachstums von Aluminium erfolgen.<br />
Die strategische Bedeutung einer Ausweitung<br />
der Anwendungsgebiete für den<br />
Edelstahl im Automobil ist hoch: Eine Steigerung<br />
des durchschnittlichen Einsatzes<br />
um 10 kg bei den in Europa gefertigten<br />
Fahrzeugen wird den europäischen<br />
Gesamt-Edelstahlverbrauch um ca.<br />
7 % p.a. anheben.
16<br />
Dr.-Ing. Harald Espenhahn<br />
Aluchrom 7Al YHf – Neuer Katalysatorträger-Werkstoff von Krupp VDM<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Schnitt durch einen metallischen Abgaskatalysator mit Blick auf die<br />
Trägerfolie (Bild 1)
17<br />
1 Einleitung<br />
Aluchrom 7Al YHf – Neuer Katalysatorträger-Werkstoff von Krupp VDM<br />
In heutigen Automobilabgaskatalysatoren<br />
werden 95–99 % der bei der Verbrennung<br />
anfallenden Kohlenwasserstoffe<br />
umgewandelt. Dieser hohe Prozentsatz ist<br />
jedoch immer noch nicht ausreichend für<br />
die kommenden Abgasbestimmungen, d.h.<br />
für die ab dem Jahre 2005 geltende<br />
europäische Vorschrift EURO LEVEL IV und<br />
für die aktuelle kalifornische ULEV (Ultra<br />
Low Emission Vehicle) oder die SULEV<br />
(Super Ultra Low Emission Vehicle), die im<br />
Jahre 2003 in Kalifornien in Kraft tritt und<br />
möglicherweise in den gesamten USA gelten<br />
soll.<br />
Um die künftigen Abgasnormen einhalten<br />
zu können, ist die Entwicklung neuartiger<br />
Katalysatorkonzepte erforderlich. Da<br />
etwa 70 % der emittierten Schadstoffe<br />
während der Startphase anfallen, müssen<br />
Maßnahmen zur Reduzierung der Schadstoffemissionen<br />
auf ein schnelleres Erreichen<br />
der Betriebstemperatur des Katalysators<br />
abzielen. Dies wird möglich durch elektrisches<br />
Vorheizen, näheres Heranrücken<br />
des Katalysators an den Motor und vor<br />
allem durch die Reduzierung der Dicke der<br />
Trägerfolien.<br />
2 Neue metallische Katalysatorträger<br />
Neue Katalysatorkonzepte erfordern neue<br />
Werkstoffe. Der wabenförmige Trägerkörper,<br />
auf den der eigentliche Katalysator,<br />
das Edelmetall Platin oder Rhodium, aufgebracht<br />
wird, bestand in der Vergangenheit<br />
überwiegend aus Keramik. Zunehmend<br />
setzen sich jedoch Katalysatorträger aus<br />
gewickelten Metallfolien durch (Bild 1).<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
2.1 Eigenschaften metallischer<br />
Katalysatorträger<br />
Metallische Katalysatorträger heizen sich<br />
schneller auf und bieten darüber hinaus<br />
noch die Möglichkeit des elektrischen Vorheizens.<br />
Zudem zeigen sie eine gute Temperaturschockbeständigkeit,<br />
eine große<br />
spezifische Oberfläche und stellen damit<br />
geringere Anforderungen an die Bauraumgröße<br />
gegenüber keramischen Systemen.<br />
Ein entsprechend geringerer Rückstaudruck<br />
ermöglicht darüber hinaus einen bei wirtschaftlicher<br />
Fahrweise geringeren Kraftstoffverbrauch.<br />
Die übliche Dicke der Metallfolien beträgt<br />
zurzeit 50 µm. Um die erforderliche<br />
Betriebstemperatur des Katalysators noch<br />
schneller zu erreichen, sollen künftig Trägerfolien<br />
mit einer Dicke von nur 30 µm<br />
oder weniger zum Einsatz kommen.<br />
Kumulierte Kohlenwasserstoff-Emissionen [g]<br />
2.2 Oxidationsbeständigkeit und<br />
Lebensdauer<br />
Die Anforderungen an die Hitzebeständigkeit<br />
der metallischen Katalysatorträger<br />
bei Abgastemperaturen bis zu 1.100 °C<br />
sind bereits jetzt so hoch, dass die Reduzierung<br />
der Foliendicke auf 30 µm mit konventionellem<br />
Material und ein dichteres<br />
Heranrücken des Katalysators an den<br />
Motor nicht möglich sind, ohne damit ein<br />
Durchkorrodieren der Folie in Kauf zu nehmen.<br />
Mit abnehmender Foliendicke wird die<br />
Wahrscheinlichkeit für das Auftreten der<br />
„Breakaway Corrosion“ immer größer<br />
(Bild 2).<br />
Trägerfolien für Katalysatoren in SULEV-<br />
Fahrzeugen müssen demnach eine hohe<br />
Oxidationsbeständigkeit aufweisen, damit<br />
bei einer Reduzierung der Foliendicke von<br />
50 µm auf 30 µm keine Reduzierung der<br />
Lebensdauer auftritt. So wird ein neuer<br />
Werkstoff benötigt, der sich unter den<br />
Erfüllung zukünftiger Abgasgrenzwerte mit neuen metallischen Katalysatorträgern (Bild 2)<br />
Quelle: Emitec, Lohmar
18<br />
Aluchrom 7Al YHf – Neuer Katalysatorträger-Werkstoff von Krupp VDM<br />
Einfluss der Foliendicke auf die Lebensdauer dünner Folien aus einer Fe-Cr-Al-Legierung (Bild 3)<br />
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500<br />
Oxidationszeit in h<br />
genannten Bedingungen für die Verwendung<br />
als Folie in Dicken von weniger als<br />
30 µm eignet.<br />
Als Trägermaterialien für metallische<br />
Automobilabgaskatalysatoren finden zurzeit<br />
Metallfolien mit einer Dicke von 50 µm aus<br />
Fe-20Cr-5Al-Legierungen mit Zusätzen der<br />
reaktiven Elemente Cer, Lanthan oder Yttrium<br />
Verwendung. Ihre hohe Oxidationsbeständigkeit<br />
bei Temperaturen bis zu<br />
1.100 °C erhalten diese Werkstoffe durch<br />
eine schützende, langsam wachsende<br />
Schicht aus Aluminiumoxid (α-Al2O3),<br />
deren Haftung durch die reaktiven Elemente<br />
verbessert wird. Da während des Betriebes<br />
jedoch laufend Aluminium für das<br />
Wachstum der Aluminiumoxidschicht verbraucht<br />
wird, kann es nach langen<br />
Betriebszeiten zu einer Aluminiumverarmung<br />
mit anschließender Zerstörung der<br />
Trägerfolie durch die Bildung nichtschützender<br />
Oxide, der so genannten „Breakaway<br />
Corrosion“, kommen.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
2.3 Einfluss von Aluminium auf<br />
die Oxidationsbeständigkeit<br />
Die alleinige Anhebung des Aluminiumgehaltes<br />
von 5 % auf 7 % wirkt sich nur<br />
geringfügig auf das Oxidationsverhalten<br />
der Fe-Cr-Al-Legierungen aus. Eine niedrige<br />
Oxidationsgeschwindigkeit setzt eine<br />
genaue Abstimmung der reaktiven Elemente<br />
Yttrium, Titan, Zirkonium und Hafnium<br />
voraus. Bei zu geringen Gehalten an reaktiven<br />
Elementen kommt es zum Abplatzen<br />
schützender Oxidschichten. Eine zu hohe<br />
Konzentration an reaktiven Elementen führt<br />
zu hohen Oxidationsraten und innerer Oxidation.<br />
Durch eine geeignete Kombination<br />
aus abgestimmten Gehalten an reaktiven<br />
Elementen und Aluminium lässt sich die<br />
Oxidationsbeständigkeit deutlich verbessern<br />
und der spezifische elektrische Widerstand<br />
auf ein für elektrische Vorheizungen<br />
günstiges Niveau anheben.<br />
Es ist deutlich zu sehen, dass sich<br />
bereits ohne signifikante Anhebung des<br />
Aluminiumgehaltes allein durch Abstim-<br />
mung der reaktiven Elemente die Foliendicke<br />
bei gleicher Lebensdauer von 50 µm<br />
auf etwa 40 µm reduzieren lässt. Wird der<br />
Aluminiumgehalt auf 7 % erhöht, so ist eine<br />
Reduzierung der Foliendicke auf weniger<br />
als 30 µm ohne Lebensdauereinbuße möglich<br />
(Bild 3). Aus den Basisdaten des Entwicklungsprogramms<br />
lässt sich die<br />
Lebensdauer als Funktion der Foliendicke<br />
berechnen.<br />
Der spezifische elektrische Widerstand in<br />
Fe-20Cr-Legierungen steigt mit der Höhe<br />
des Aluminium- und Siliziumgehaltes und<br />
erreicht bei der Kombination aus Legierungsgehalten<br />
von rund 7 % Aluminium<br />
und 0,3 % Silizium einen Wert von zirka<br />
1,6 Ωmm2 /m gegenüber 1,4 Ωmm2 /m bei<br />
den üblichen, niedriger legierten<br />
Fe-20Cr-5Al-Werkstoffen (Bild 4).<br />
2.4 Herstellung von Katalysatorband<br />
mit höherem Aluminiumgehalt<br />
Konventionell werden Fe-20Cr-5Al-Legierungen<br />
über die Erschmelzung von Blöcken<br />
mit anschließender Warm- und Kaltumformung<br />
hergestellt. Dieser Weg stößt jedoch<br />
bei Aluminiumgehalten von mehr als 6 %<br />
auf Grund von Versprödungserscheinungen<br />
an seine Grenzen. So steigt bei angegebenem<br />
Aluminiumgehalt die Kerbschlagübergangstemperatur<br />
auf Werte weit oberhalb<br />
von 100 °C an, was zu entsprechenden<br />
Schwierigkeiten sowohl im Bereich der<br />
Warm- als auch in der anschließenden<br />
Kaltformgebung führt. Die Verarbeitung ist<br />
deutlich einfacher und das Ausbringen<br />
höher, wenn der Aluminiumgehalt unter<br />
6 % liegt.<br />
Um den gewünschten, höheren Aluminiumgehalt<br />
einzustellen, wird ein konventionell<br />
hergestelltes Fe-Cr-Band, welches
19<br />
Aluchrom 7Al YHf – Neuer Katalysatorträger-Werkstoff von Krupp VDM<br />
Lebensdauer von dünnen Fe-Cr-Al-Folien als Funktion der Foliendicke (Bild 4)<br />
schon die notwendigen reaktiven Elemente<br />
wie Yttrium und Hafnium enthält, an Zwischendicken<br />
mit Aluminium beschichtet<br />
und dann als Werkstoffverbund an Endabmessung<br />
gewalzt. Das Beschichten kann<br />
durch Plattieren oder Schmelztauchaluminieren<br />
erfolgen. Die eigentliche Fe-20Cr-<br />
7Al-Legierung bildet sich nach einer geeigneten<br />
Diffusionsgleichung, die sowohl an<br />
Zwischenabmessungen als auch am fertigen<br />
Bauteil durchgeführt werden kann.<br />
Über die Parameter der Diffusionsglühung<br />
wird die Aluminiumverteilung über<br />
die Bauteildicke gezielt eingestellt und die<br />
Oxidationsbeständigkeit günstig beeinflusst.<br />
Damit kann ein neuer Werkstoff zur<br />
Verfügung gestellt werden, der die Anfor-<br />
Oxidationsbeständige Fe-Cr-Al-Legierungen für Katalysatorfolien (Bild 5)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
derungen im Hinblick auf Oxidationsbeständigkeit<br />
und Umformbarkeit in gleichem<br />
Maße erfüllt.<br />
3 Neuer Katalysatorträger-<br />
Werkstoff von Krupp VDM<br />
Unter Federführung der Krupp VDM<br />
GmbH wurde ein völlig neuer Stahl mit<br />
20 % Chrom, 7 % Aluminium und genau<br />
festgelegten Gehalten an den so genannten<br />
„reaktiven Elementen“ Yttrium und Hafnium<br />
entwickelt. Diese neue Stahllegierung<br />
(Aluchrom 7Al YHf) kann in Foliendicken<br />
von nur 25 µm eingesetzt werden, ohne<br />
Einbußen bei der Lebensdauer des Katalysators.<br />
Darüber hinaus weist sie mit<br />
1,6 Ωmm2 /m einen spezifisch elektrischen<br />
Widerstand auf, der ein Vorheizen des<br />
Katalysators erlaubt. Parallel zur Werkstoffentwicklung<br />
erfolgte die Entwicklung eines<br />
Fertigungsverfahrens zur wirtschaftlichen<br />
Herstellung von dünnen Stahlfolien mit<br />
einem Aluminiumgehalt von 7 %.<br />
Mit dem Einsatz des neu entwickelten<br />
Stahls wird die Einhaltung der für die Jahre<br />
2003 und 2005 geltenden SULEV- und<br />
EURO-LEVEL IV-Normen schon jetzt<br />
erreicht und die rasante Marktdurchdringung<br />
des metallischen Katalysators über<br />
die Bereitstellung einer maßgeschneiderten<br />
Legierung in entsprechender Weise unterstützt<br />
(Bild 5).<br />
Das Forschungsprojekt wurde mit Mitteln<br />
des Bundesministeriums für Bildung und<br />
Forschung gefördert.<br />
Projektpartner: Emitec GmbH, Lohmar,<br />
Fraunhofer-Institut für Angewandte Materialforschung,<br />
Bremen und Universität/GH,<br />
Wuppertal.
20<br />
Dr. Ken Rusch<br />
Ladekästen aus Verbundwerkstoffen für neue SUV- und Pickup-Modelle<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
SMC-Ladekasten (Cargo-Box) des Ford Explorer Sport Trac,<br />
hergestellt von Budd im Werk North Baltimore, Ohio (Bild 1)
21<br />
1 Einführung<br />
Ladekästen aus Verbundwerkstoffen für neue SUV- und Pickup-Modelle<br />
SMC-Verbundwerkstoffe (Sheet molding<br />
composite) wurden erstmals Anfang der<br />
70er Jahre im Außenbereich von Kraftfahrzeugkarosserien<br />
eingesetzt. Zu den ersten<br />
Anwendungen gehörten Kühlergrillöffnungen,<br />
Heckspoiler und verschiedene Komponenten<br />
der Chevrolet Corvette. Im Laufe<br />
der Zeit fand SMC im Automobilbereich<br />
immer mehr Anwendungen, und die Prognosen<br />
für den nordamerikanischen Markt<br />
belaufen sich für das Modelljahr 2000 auf<br />
110.000 t. Die Plastics Division der Budd<br />
Company deckt etwa 1 /3 dieses Marktes für<br />
Verbundwerkstoffe ab.<br />
Jetzt – 30 Jahre nach den ersten erfolgreichen<br />
Anwendungen von SMC – wird den<br />
Verbundwerkstoffen im Automobilbereich<br />
ein noch schnelleres Wachstum und durch<br />
Großanwendungen weiterer Auftrieb prognostiziert,<br />
wie z.B. durch die SMC-Cargo-<br />
Box (Ladekasten) des Ford Explorer Sport<br />
Trac, die im Budd-Werk North Baltimore,<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Ohio, gefertigt wird (Bild 1). Die Automotive<br />
Composites Alliance (ACA), ein industrieller<br />
Verband von Formereien und Rohstofflieferanten,<br />
sagt eine 44 %ige Zunahme der<br />
Produktion von Verbundwerkstoffen in den<br />
nächsten fünf Jahren vorher. Lkw-Ladekästen<br />
haben einen erheblichen Anteil an<br />
diesem Wachstum.<br />
In Nordamerika wurden im Jahr 1999<br />
etwa 17 Millionen Fahrzeuge verkauft, von<br />
denen 49 % als Lkw eingestuft wurden. Die<br />
sogenannten SUV-Fahrzeuge (Sport Utility<br />
Vehicles) mit 2,8 Millionen Stück und die<br />
Pickups mit 2,9 Millionen Stück machen<br />
etwa 1 /3 aller verkauften Fahrzeuge aus.<br />
Der neue Ford Explorer Sport Trac mit einer<br />
Cargo-Box aus Verbundwerkstoff charakterisiert<br />
eine neue Fahrzeugkategorie und<br />
kommt den Wünschen sowohl von Pickupals<br />
auch von SUV-Käufern entgegen<br />
(Bild 2).<br />
Kaufinteressenten begutachten die SMC-Cargo-Box des Ford Explorer Sport Trac (Bild 2)<br />
2 Verbundwerkstoffe<br />
SMC ist ein warmhärtender Verbundwerkstoff,<br />
der aus Polyesterharz,<br />
Glasstapelfaser, Füllstoff und Additiven zur<br />
Erzielung guter Oberflächenqualität<br />
besteht. Andere Zusätze regeln die Härtegeschwindigkeit,<br />
die Formtrennung, Farbund<br />
Verarbeitungseigenschaften. Die Budd<br />
Plastics Division produziert für ihre drei Formereien<br />
SMC in einer einzigen Kompoundieranlage<br />
in Van Wert, Ohio. Die von Budd<br />
entwickelten Rezepturen ergeben Verbundwerkstoffe<br />
mit ausgewogenen Eigenschaften<br />
hinsichtlich der Oberflächenqualität,<br />
Wärmebeständigkeit für Lacktrockenöfen,<br />
Strukturfestigkeit und Zähigkeit für die verschiedensten<br />
Autokarossie-Anwendungen.<br />
Außerdem zeichnen sich Verbundwerkstoffe<br />
im Vergleich zu konventionellen Stahlblechkonstruktionen<br />
durch niedrigere Kosten,<br />
geringeres Gewicht, hohe Bauteilfestigkeit,<br />
Beulfestigkeit und Korrosionsschutz aus.<br />
RRIM (Reinforced Reaction Injection<br />
Molding) ist ein weiterer von der Budd Plastics<br />
Division eingesetzter Formgebungsprozess.<br />
RRIM ist ein Reaktions-Spritzgieß-<br />
Verfahren für warmhärtendes Zweikomponenten-Polyurethan-<br />
oder Polykarbamidmaterial,<br />
dem Füllstoffe zugesetzt werden,<br />
um die Festigkeit, Steifheit sowie die erforderliche<br />
Wärmebeständigkeit für den<br />
Lackierungsprozess zu erreichen. Vom<br />
Budd-Werk in North Baltimore, Ohio, werden<br />
derzeit RRIM-Heckseitenteile für<br />
Pickups (Ladekasten-Außenelemente) eingeführt,<br />
und zwar für die GM-Modelle Fleetside<br />
und Dually. Zur Verstärkung dient entweder<br />
Mica- oder Wollastonit-Mineralfüllstoff.<br />
SRIM (Structural Reaction Injection<br />
Molding) ist ein Formgebungsverfahren für<br />
Verbundwerkstoffe, bei dem die Glasfaser-
22<br />
Ladekästen aus Verbundwerkstoffen für neue SUV- und Pickup-Modelle<br />
Einzelteile der SMC-Cargo-Box (Bild 3)<br />
SMC-Laderaumabdeckung äußere Befestigungsleiste<br />
SMC-Cargo-Box<br />
äußere Befestigungsleiste<br />
hinteres Radhaus<br />
SMC-Seitenverkleidung<br />
verstärkung in einen Vorformling integriert<br />
wird, den man in die Form legt, bevor das<br />
warmhärtende Polyurethan- oder Polykarbamidharz<br />
eingespritzt wird. GM hat<br />
angekündigt, dass das Innere der Cargo-<br />
Box des 2001er Modells des Chevrolet<br />
Silverado Pickups der 1500er Serie aus<br />
SRIM-Verbundwerkstoff bestehen wird.<br />
Das Budd Technical Center hat für die<br />
Glasfaserverstärkung ein Saugling-<br />
Vorformungsverfahren (Slurry Preforming<br />
Process) entwickelt, um die Kosten des<br />
SRIM-Prozesses zu senken (siehe „forum –<br />
<strong>Technische</strong> <strong>Mitteilungen</strong> <strong>ThyssenKrupp</strong>“,<br />
April 1999).<br />
3 Ford Explorer Sport Trac<br />
Der Sport Trac des Baujahres 2001, der<br />
zurzeit in den Ausstellungsräumen der<br />
Händler besichtigt werden kann, ist das<br />
erste Fahrzeug mit einer SMC-Cargo-Box<br />
(Bild 1). Dieser Truck wird als Sport-Utility-<br />
Vehicle beworben, kombiniert jedoch die<br />
Attribute eines Pickups mit denen eines<br />
SUV-Fahrzeugs. Mit seinen vier Türen,<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
hinteres Radhaus<br />
Stahlverstärkung<br />
SMC-Seitenverkleidung<br />
einem 1,2 m langen Ladekasten und der<br />
SMC-Laderaumabdeckung bietet der Sport<br />
Trac die Geräumigkeit eines SUV und<br />
zusätzlich einen verriegelbaren Laderaum,<br />
den SUV normalerweise nicht bieten. Durch<br />
das Entfernen der Abdeckung erhält man<br />
einen offenen Laderaum, der kratz-, stoßund<br />
korrosionsfest ist. Ford rechnet mit<br />
Verkaufszahlen von ca. 100.000 Stück pro<br />
Jahr.<br />
Im SMC-Ladebereich befindet sich ein<br />
12-Volt-Anschluss, an den ein Wandler für<br />
den Betrieb von elektrischen Werkzeugen<br />
oder Außenanlagen angeschlossen werden<br />
kann – eine Branchenpremiere im offenen<br />
Ladebereich. An der SMC-Box sind 10<br />
Befestigungsmöglichkeiten für das Ladegut<br />
angebracht – sechs an der oberen Schiene<br />
und vier im Inneren des Ladebereichs.<br />
Jeder Befestigungspunkt hat eine Belastbarkeit<br />
von 3.200 N. Mit einem separat<br />
erhältlichen Kunststoffteiler kann der<br />
Ladebereich in zwei separate Stauzonen<br />
unterteilt werden.<br />
Eine SMC-Laderaumabdeckung verleiht<br />
dem Sport Trac ein elegantes Aussehen<br />
und deckt den Ladebereich vollständig ab.<br />
Sie besteht aus zwei Teilen und wird in der<br />
Mitte aufgehängt, so dass der Fahrer sie<br />
von vorn oder hinten zusammenklappen<br />
kann; außerdem kann sie mit demselben<br />
Schlüssel wie die Fahrzeugtüren verriegelt<br />
werden. Jeder Abschnitt der Laderaumabdeckung<br />
besteht aus einem verklebten<br />
SMC-Verbund. Die Ford-Ingenieure entschieden<br />
sich für die Entwicklung einer<br />
eigenen SMC-Abdeckung, nachdem sie<br />
eine Reihe von verschiedenen Produkten<br />
auf dem Zubehörmarkt getestet hatten,<br />
und dabei feststellten, dass davon keines<br />
sämtliche Leistungskriterien von Ford<br />
erfüllt. Dies ist die erste Laderaumabdeckung,<br />
die als Originalausstattung von<br />
Ford angeboten wird (Bild 3).<br />
„Wenn die Leute den neuen Explorer<br />
Sport Trac sehen, dann bleiben sie stehen,<br />
um sich das Fahrzeug genauer anzusehen.<br />
Wenn sie die Möglichkeit haben, ihn zu<br />
erproben, dann finden sie, dass das Fahrzeug<br />
durch den offenen Ladebereich eine<br />
nie dagewesene Vielseitigkeit bietet. Es eignet<br />
sich gut zum Transport von Gegenständen<br />
wie langen Holzteilen, Gartengeräten<br />
oder Angelausrüstungen. Es bietet viele<br />
Befestigungsmöglichkeiten und eine wetterfeste<br />
Außensteckdose. Wenn man die<br />
verriegelbare harte Laderaumabdeckung<br />
aufsetzt, wird daraus ein riesengroßer Kofferraum“,<br />
sagte Steve Ross, der leitende<br />
Ingenieur des Ford-Sport-Trac-Programms.
23<br />
Ladekästen aus Verbundwerkstoffen für neue SUV- und Pickup-Modelle<br />
Ausstoßen der SMC-Cargo-Box aus dem Formwerkzeug (Bild 4)<br />
4 Der Beitrag von SMC bei der<br />
Konstruktion des Sport Trac<br />
Die einzigartigen Möglichkeiten des Sport<br />
Trac sind eine Folge der von Ford getroffenen<br />
Entscheidung, SMC-Material zu verwenden.<br />
Neben dem aus einem Stück<br />
bestehenden Ladekasten-Inneren bestehen<br />
die äußeren Seitenverkleidungen der Box<br />
und die zweiteiligen verklebten Laderaumabdeckungen<br />
aus SMC. Alle Teile werden<br />
im Budd-Werk in North Baltimore hergestellt<br />
(Bild 4). Im Carey-Werk von Budd<br />
werden die Kühlergrillöffnung (Grille<br />
Opening Panel – GOP) für den Sport Trac<br />
und ähnliche GOP-Elemente für die Ford-<br />
Modelle Explorer, Mountaineer und Ranger<br />
hergestellt.<br />
Als „Full Service Supplier“ für Ford hat<br />
die Budd Plastics Division bei der Konstruktion<br />
der Komponenten, beim Prototyping<br />
und bei der Erprobung eng mit den<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Ford-Ingenieuren zusammengearbeitet.<br />
Dadurch konnten alle SMC-Teile unter Ausnutzung<br />
der Vorzüge des SMC-Materials<br />
und einer optimierten Auswahl des Ver-<br />
Entnahme der SMC-Cargo-Box aus der Presse (Bild 5)<br />
bundwerkstoffs hergestellt werden. Die<br />
Komponentenerprobung wurde teilweise im<br />
Budd Technical Center durchgeführt.<br />
Das Innere der SMC-Cargo-Box ist ein<br />
einteiliges Formteil mit einem Gewicht von<br />
ca. 31 kg, das zur Erhöhung der Strukturfestigkeit<br />
mit integrierten Versteifungsrippen<br />
versehen ist (Bild 5). Es ist schwarz<br />
pigmentiert und wird bei Budd außerdem<br />
mit einem kratzfesten wetterbeständigen<br />
schwarzen Überzug versehen (Bild 6).<br />
Das Gleiche gilt für die Laderaumabdeckung.<br />
Im Ford-Montagewerk erfolgt<br />
keine weitere Lackierung des Ladebereichs.<br />
Im Gegensatz zu den weichen Laderaumabdeckungen,<br />
die auf dem Zubehörmarkt<br />
erhältlich sind, kann die Abdeckung des<br />
SMC Sport Trac nicht mit einem Messer aufgeschlitzt<br />
werden. Die verriegelbare Laderaumabdeckung<br />
wiegt ca. 32 kg und erfüllt<br />
die Anforderungen von Ford’s 150.000<br />
Meilen-Härtetest. Die SMC-Rezeptur besteht<br />
aus Polyesterharz mit 28 % Glasstapelfaser<br />
und ähnelt derjenigen, die für andere<br />
Karosserieaußenelemente verwendet wird.
24<br />
Ladekästen aus Verbundwerkstoffen für neue SUV- und Pickup-Modelle<br />
Anhängen der SMC-Cargo-Box an die Fördereinrichtung<br />
zur Lackiererei (Bild 6)<br />
Die äußeren Seitenteile der Karosserie<br />
werden von Budd mit einer halbleitenden<br />
Grundierung versehen. Um die richtige<br />
Farbgebung zu gewährleisten, werden diese<br />
Elemente dann im Ford-Montagewerk im<br />
Farbton der Karosserie lackiert und durchlaufen<br />
dabei zusammen mit dem Fahrzeug<br />
alle Lackierstufen. SMC ist durch seine<br />
Wärme- und Formbeständigkeit mit den<br />
Lackierstationen des Automobilwerks,<br />
einschließlich der Elcolackierungsöfen, die<br />
mit einer Temperatur von 200 °C arbeiten,<br />
kompatibel. Nach dem Lackieren werden<br />
die Außenteile mit dem inneren Ladekasten<br />
verbunden und dann am Fahrzeug<br />
montiert.<br />
5 Harte Erprobung des<br />
Verbundwerkstoff-Ladebereichs<br />
Der gesamte Ladebereich des Sport Trac<br />
besteht aus Verbundkunststoff, mit Ausnahme<br />
der D-Säulen-Einheit aus Stahl und<br />
der hinteren Ladeklappe (derselben wie<br />
beim Ford F-150 Flareside Pickup). Das<br />
aus einem Stück bestehende Innenelement<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
des Ladebereichs stellte die größte Herausforderung<br />
für die Ingenieure von Budd dar.<br />
Die Ziele des Ford-Programms bestanden<br />
darin, den SMC-Ladebereich robuster und<br />
widerstandsfähiger zu machen als eine<br />
traditionelle Ladefläche aus Stahl. Zu den<br />
Tests gehörten auch Fallversuche mit<br />
einem wassergefüllten 200-l-Fass aus<br />
einer Höhe von mehreren Zoll; dabei<br />
durften in der SMC-Ladeoberfläche keine<br />
sichtbaren Risse entstehen.<br />
Das Ford-Team verlangte umfassende<br />
Tests, um zu beweisen, dass das SMC-<br />
Material die hohen Ansprüche erfüllt, die<br />
von den Kunden gestellt werden. Da zum<br />
ersten Mal Verbundwerkstoffe im offenen<br />
Ladebereich eines Trucks eingesetzt wurden,<br />
war die Überprüfung der Konstruktion<br />
von entscheidender Bedeutung. Die Versuche<br />
stellten sicher, dass es keine Schwachpunkte<br />
hinsichtlich der Zähigkeit und<br />
Endkontrolle des Zusammenbaus (Bild 7)<br />
Widerstandsfähigkeit gab, die von dem<br />
SMC-Material erwartet wurden (Bild 7).<br />
Ford verlangte viele Tests, denen ein<br />
Modell aus lackiertem Stahl nie ausgesetzt<br />
würde. Bei dem Testprogramm wurden<br />
z.B. Schlackensteine über den Kastenboden<br />
gezogen, oder man ließ große Rohre<br />
auf den Boden fallen und warf 16 kg<br />
schwere Eckbeschläge in die Ladezone.<br />
Man führte Hammerfallversuche durch,<br />
kratzte mit einem Rechen über das Material,<br />
schaufelte Grubenkies hinein, ließ Steine<br />
herabfallen und setzte das Testobjekt<br />
verschiedenen schonungslosen Behandlungen<br />
aus. Insgesamt setzten die Ford-<br />
Ingenieure den Verbundwerkstoff-Ladebereich<br />
einer Belastung aus, die der<br />
Beanspruchung über eine Fahrstrecke von<br />
450.000 Meilen entspricht.<br />
Solche Tests sind nicht normal für den<br />
Ladebereich eines Pickups oder SUV. Aber
25<br />
Ladekästen aus Verbundwerkstoffen für neue SUV- und Pickup-Modelle<br />
Vorteile des Einsatzes von Verbundmaterialien bei Cargo-Boxen (Bild 8)<br />
• Niedrigere Kosten für das gesamte Programm<br />
• Gewichtsverringerung gegenüber Stahlblech<br />
• Größere Flexibilität bei der Konstruktion<br />
• Reduzierung der Teileanzahl gegenüber Stahlblech<br />
• Kompatibel mit Auto-Lackierungsöfen<br />
• Zähigkeit und Integrität der Struktur<br />
• Lineare Wärmeausdehnung ähnlich wie bei Stahl<br />
• Korrosionsbeständigkeit<br />
• Beul- und Kratzfestigkeit<br />
• Recyclingfähigkeit<br />
das Ford-Team wollte unbedingt demonstrieren,<br />
dass diese einzigartige Verbundwerkstoff-Konstruktion<br />
einem konventionellen<br />
offenen Ladebereich weit überlegen<br />
ist. „Es entstanden zwar ein paar Kratzer.<br />
Da die Innenfläche des Ladebereichs jedoch<br />
aus schwarzem Material mit genarbter<br />
Oberfläche besteht, fügten sich diese<br />
Kratzer perfekt in das Finish ein“, sagte<br />
Mike Musleh, der Leiter des Ford-Markteinführungsteams<br />
für den Sport Trac.<br />
Die Schlussfolgerung lautet: SMC übertraf<br />
jeden stählernen Laderaum, der dieser<br />
Art von Kundenbeanspruchung ausgesetzt<br />
wird. „Es ist nicht nur so, dass der Innenbereich<br />
widerstandsfähiger (als Stahl) ist,<br />
sondern seine Innen- und Außenelemente<br />
können auch nicht verbeulen oder rosten.<br />
Wenn man sein Fahrrad in den Laderaum<br />
hievt, dann wird dieser dadurch innen nicht<br />
beschädigt, wie es bei einem lackierten<br />
Stahlkasten der Fall wäre“, sagte David<br />
Paul, Ford-Systemingenieur für das Sport<br />
Trac-Programm.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
6 Entwicklungsprogramm für<br />
SMC-Material erforderlich<br />
Die hohen Ansprüche, die an die Leistungscharakteristika<br />
gestellt wurden, erforderten,<br />
dass Budd eine spezielle SMC-<br />
Rezeptur für die Cargo-Box entwickelte. Die<br />
Eigenschaften des Materials in Bezug auf<br />
Widerstandsfähigkeit und Festigkeit waren<br />
von entscheidender Bedeutung. Aber die<br />
Größe und die tief gerippte Geometrie, die<br />
sich aus der einteiligen Konstruktion ergeben,<br />
erforderten ein SMC-Material mit ausgezeichnetem<br />
Fließverhalten und einer ausreichenden<br />
Oberflächenqualität. Konkurrenzfähige<br />
Kosten stellten ebenfalls ein<br />
wichtiges Kriterium dar. Nach einem umfassenden<br />
Testprogramm erreichte Budd<br />
diese Ziele schließlich durch Verwendung<br />
eines modifizierten Vinylesterharzes mit<br />
47 % Glasstapelfaser (25 mm Länge). Das<br />
SMC-Material wird im Budd-Werk Van Wert<br />
in Ohio hergestellt.<br />
Es wurden zahlreiche Materialtests,<br />
Formversuche und Komponententests<br />
durchgeführt, um die Wahl der Rezeptur zu<br />
überprüfen. Dazu gehörten auch Versuche<br />
zur Simulation aller Wetterbedingungen –<br />
von minus 40 °C bis plus 65 °C. Eine<br />
Strukturmodellierung unter Anwendung der<br />
Finite-Elemente-Analyse (FEA) und Cad-<br />
Press-Formfließanalyse kamen ebenfalls<br />
zum Einsatz.<br />
Die SMC-Cargo-Box ist der Höhepunkt<br />
einer 15-jährigen Entwicklungsarbeit bei<br />
Ford. Es wurden auch andere Materialien<br />
getestet, wie z. B. RRIM und SRIM, die für<br />
den Ladebereich des Chevrolet Silverado<br />
geplant sind. Auf Grund der Zusammenarbeit<br />
mit Budd entschied Ford, dass SMC<br />
das optimale Material für die Konstruktion<br />
des Sport Trac darstellt. Durch die integrale<br />
Rippenstruktur der SMC-Konstruktion entfällt<br />
die Notwendigkeit von Versteifungsträgern<br />
aus Stahl, abgesehen von der Ladeklappenöffnung.<br />
Dies führt zu Kosteneinsparungen<br />
gegenüber einer SRIM-Konstruktion,<br />
die aus einer geformten Schale<br />
mit Stütz- und Versteifungsträgern aus<br />
Metall besteht. Außerdem hat SMC denselben<br />
linearen Ausdehnungskoeffizienten<br />
wie Stahl, wodurch Spannungsgradienten<br />
durch Temperaturveränderungen vermieden<br />
werden.<br />
7 Die Zukunft von Verbundwerkstoff-Ladebereichen<br />
Da die Kunden nach robusteren Fahrzeugen<br />
verlangen, die speziell auf ihre<br />
Bedürfnisse zugeschnitten sind, dürfte es<br />
immer weitere Anwendungsmöglichkeiten<br />
von SMC im Ladebereich geben. Die Einführung<br />
des Sport Trac wird den Konsumenten<br />
die Robustheit und Unempfindlichkeit<br />
gegen schonungslose Behandlung von<br />
Verbundwerkstoffen vor Augen führen.<br />
Separate Ladeflächenauskleidungen aus<br />
Kunststoff, ein beliebtes Accessoire des
26<br />
Ladekästen aus Verbundwerkstoffen für neue SUV- und Pickup-Modelle<br />
Zubehörmarkts, werden nicht mehr benötigt,<br />
da jetzt die Technologie zur Verfügung<br />
steht, um große strukturierte Ladekästen<br />
aus einem Stück zu formen (Bild 8). Die<br />
Möglichkeit, bei der Formung zusätzliche<br />
Merkmale zu integrieren, wie z.B. separate<br />
Stau- und Ablagebereiche, wird die Wertschätzung<br />
bei den Kunden noch weiter<br />
erhöhen.<br />
Die gesamten Herstellkosten für eine<br />
Cargo-Box aus Verbundwerkstoff sind im<br />
Allgemeinen geringer als bei einer konventionellen<br />
mehrteiligen Stahlkonstruktion.<br />
Die Haupteinsparungen ergeben sich bei<br />
den Werkzeuginvestitionen, die um bis zu<br />
25 Millionen Dollar geringer ausfallen können.<br />
Da Stahl-Ladekästen meistens im<br />
Montagewerk geschweißt und montiert<br />
werden, sind zusätzliche Einsparungen<br />
durch eine Reduzierung innerbetrieblicher<br />
Abläufe möglich, die sich aus zahlreichen<br />
Ladekastengrößen ergeben, die in das Fertigungsprogramm<br />
aufgenommen werden,<br />
Recycling von Bauteilen aus Verbundmaterialien (Bild 9)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
um die Nachfrage nach mehr Kundenoptionen<br />
zu erfüllen. SMC-Formteile bieten auch<br />
die Möglichkeit, einzigartige Produktmerkmale<br />
zu niedrigeren Werkzeuginvestitionskosten<br />
anbieten zu können – besonders bei<br />
Optionen mit geringen Stückzahlen.<br />
Das Systemgewicht kann durch die Verwendung<br />
von Verbundwerkstoffen anstelle<br />
von Stahl um bis zu 30 % verringert werden.<br />
Dies senkt den Kraftstoffverbrauch,<br />
verringert die Emissionen und verbessert<br />
die Straßenlage. Durch die Gewichtseinsparungen<br />
beim Fahrzeug hat der Hersteller<br />
außerdem die Möglichkeit, weitere<br />
Ausstattungselemente in das Fahrzeug zu<br />
integrieren, ohne die Gewichtsklasse zu<br />
überschreiten.<br />
Verbundwerkstoffe sind umweltfreundlich.<br />
Bei der Herstellung und Verarbeitung<br />
von Verbundwerkstoffen wird im Vergleich<br />
zu den meisten Metallen weniger Energie<br />
verbraucht, und die Emissionen sind geringer.<br />
Verbundwerkstoffe können Anteile von<br />
recycelten Materialien enthalten und am<br />
Ende ihres Lebenszyklus wieder recycelt<br />
werden (Bild 9). Zurzeit besteht der beste<br />
Recycling-Ansatz für SMC darin, die<br />
Schrottteile zu einem feinen Füllstoff zu<br />
zermahlen, der bei der Herstellung von<br />
neuem SMC verwendet werden kann. Die<br />
Machbarkeit der Technologie für das<br />
Recycling von Verbundwerkstoffen wurde<br />
bereits nachgewiesen, aber die Infrastruktur<br />
zur Sammlung des Schrottmaterials<br />
muss erst noch entwickelt werden.<br />
Die vielen Vorteile, die SMC für Anwendungen<br />
im Ladebereich bietet, dürften zu<br />
einigen Veränderungen bei der Materialauswahl<br />
für zukünftige Lkw-Konstruktionen<br />
führen. Die Budd Plastics Division beabsichtigt,<br />
bei der Konstruktion und der Fertigung<br />
von Verbundwerkstoff-Ladekästen die<br />
Führung zu übernehmen.
27<br />
Dipl.-Ing. ETH Daniel Brunnschweiler<br />
TubPAS – die elektromechanische Lenkhilfe von Krupp Presta<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Innovatives Lenkungskonzept: TubPAS von Krupp Presta (Bild 1)
28<br />
1 Einführung<br />
TubPAS – die elektromechanische Lenkhilfe von Krupp Presta<br />
Der Name TubPAS besteht aus 2 Teilen:<br />
Tub kommt aus dem Englischen und<br />
steht für „tube“, das heißt Rohr. Damit ist<br />
die Bauform gemeint: rohrförmig. Krupp<br />
Presta (KPR) kennt die Wichtigkeit des Bauraums<br />
aus der Beschäftigung mit Lenksäulen<br />
sehr gut. Die Bauform ist entscheidend<br />
für den benötigten Bauraum.<br />
PAS steht für Power Assisted Steering:<br />
Power heißt Leistung. Konkret benötigt<br />
TubPAS 1.000 W elektrischer Leistung.<br />
Assisted heißt unterstützt. Mit einem<br />
Servoregelkreis wird der Fahrer unterstützt<br />
und damit seine Muskelkraft verstärkt. Ein<br />
Steuergerät muss dazu die 1.000 W möglichst<br />
feinfühlig ansteuern.<br />
Steering heißt Lenkung. Die Lenkung ist<br />
ein aktives Element, weil sie mit Kräften auf<br />
das Fahrzeug einwirkt. Sie ist ganz wesentlich<br />
verantwortlich für das Fahrgefühl und<br />
den Fahrspaß. Das Lenkrad gibt dem Fahrer<br />
die wichtigste sensorische Rückmeldung<br />
über den Fahrzustand.<br />
TubPAS ist somit eine röhrenförmige<br />
elektrische Lenkhilfe.<br />
Ausgehend von den Anforderungen des<br />
Kunden werden im Folgenden die technischen<br />
Randbedingungen und die Lösung<br />
von KPR vorgestellt.<br />
2 Marktanforderungen<br />
Der Markt verlangt die Ablösung der<br />
konventionellen, hydraulischen Lenkunterstützung<br />
durch eine neue Technologie:<br />
elektromechanische Lenkunterstützung.<br />
Anlass dazu sind die Anforderungen,<br />
denen moderne Fahrzeuge gerecht werden<br />
müssen.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Es gibt drei Quellen von Anforderungen:<br />
● Verbraucher<br />
● Gesetzgeber<br />
● Fahrzeughersteller<br />
Deren Anforderungen werden im Folgenden<br />
kurz erläutert.<br />
2.1 Anforderungen des<br />
Verbrauchers<br />
Der Kaufentscheid für ein Fahrzeug ist<br />
das Ergebnis eines Abgleichs zwischen<br />
Komfort, Funktionalität und Preis. Ganz<br />
wesentlich, aber für unsere Thematik nicht<br />
relevant, ist natürlich auch das Design des<br />
Fahrzeugs.<br />
Komfort<br />
Das Fahrzeug soll sich unter allen Bedingungen<br />
mit geringem Kraftaufwand lenken<br />
lassen. Dabei soll der Fahrer den Bewegungszustand<br />
spüren. Dazu muss die Lenkung<br />
feinfühlig sein. Das Fahrzeug soll<br />
sicher lenkbar sein, auch an der Grenze der<br />
Fahrstabilität.<br />
Funktionalität<br />
Sicherheit, Kommunikation und Navigation<br />
sind nur einige Stichworte, die die Funktionen<br />
der Fahrzeuge rasch wachsen lassen.<br />
Dadurch steigen Gewicht und Verbrauch.<br />
Die unterschiedlichen Ausstattungsgrade<br />
steigern die Variantenvielfalt<br />
und damit die Komplexität in Fertigung und<br />
Logistik.<br />
Preis<br />
Der Wettbewerb unter den Automarken<br />
ist sehr intensiv. Oft erlauben zusätzliche<br />
Funktionen keine Aufpreise mehr, sondern<br />
machen ein Fahrzeug erst verkaufsfähig.<br />
Dabei ist die elektromechanische Lenkhilfe<br />
nicht einmal eine zusätzliche Funktion.<br />
Damit ist dieser Technologie der klassische<br />
Weg zur Markteinführung verwehrt: Ersteinsatz<br />
bei Fahrzeugen der Oberklasse mit<br />
schrittweiser Erschließung der unteren<br />
Segmente.<br />
Neben technischen Gründen ist dies der<br />
Hauptgrund, weshalb die elektromechanische<br />
Lenkhilfe vom Start weg in den unter<br />
extremem Kostendruck stehenden Segmenten<br />
der Kleinwagen zum Einsatz<br />
kommt.<br />
2.2 Anforderungen des<br />
Gesetzgebers<br />
Von dieser Seite stehen die Fahrzeughersteller<br />
unter hohem Druck zur Reduktion<br />
des Kraftstoffverbrauchs ihrer Flotten. Eine<br />
hydraulische Lenkhilfe mit direkt am Fahrmotor<br />
angeflanschter Pumpe nimmt immer<br />
Leistung auf. Dies führt vor allem auf Autobahnen<br />
zu einer Energieverschwendung,<br />
weil hier sehr wenig Lenkunterstützung<br />
benötigt wird. Mit einer Lenkung, die nur<br />
Leistung aufnimmt, wenn Unterstützung<br />
nötig ist, können ungefähr 5 % Kraftstoff<br />
eingespart werden.<br />
Dies ist der Hauptgrund zur Einführung<br />
dieser neuen Technologie.<br />
2.3 Anforderungen des Fahrzeugherstellers<br />
Bauraum und Lenkgefühl sind die wichtigsten<br />
Anforderungen des Herstellers.<br />
Nicht zuletzt die zurzeit starken Motorisierungen<br />
führen zu sehr beengten Platzverhältnissen<br />
im Motorraum. Die beste Lenkung<br />
nützt nichts, wenn sie keinen Platz<br />
hat.<br />
Das Lenkgefühl hat wesentlichen Anteil
29<br />
TubPAS – die elektromechanische Lenkhilfe von Krupp Presta<br />
Systemarchitektur mit Lenksäule, TubPAS Lenkgetriebe mit Drehmomentsensor und Steuergerät (Bild 2)<br />
am subjektiven Eindruck, den der Käufer<br />
vom Fahrzeug erhält. Daher wird es auch<br />
sorgfältig gepflegt und zur Markenidentifikation<br />
genutzt. Bei der Ablösung der<br />
hydraulischen Lenkhilfe soll der Fahrer mit<br />
der elektromechanischen Lenkhilfe das<br />
gleiche Gefühl haben.<br />
3 <strong>Technische</strong> Umsetzung der<br />
Anforderungen<br />
All diese Anforderungen gilt es mit einer<br />
elektromechanischen Lenkhilfe darzustellen.<br />
Die Zusammenhänge werden am<br />
besten in einem Funktionsdiagramm<br />
(Bild 2) sichtbar.<br />
3.1 Verbrauchsminderung<br />
Um die 5 % Kraftstoff einzusparen, darf<br />
die Lenkhilfe nur Leistung aufnehmen,<br />
wenn der Fahrer Unterstützung braucht.<br />
Dies ist dann der Fall, wenn der Fahrer am<br />
Lenkrad ein Drehmoment aufbringt. Der<br />
Sensor misst dieses Moment und sendet<br />
ein entsprechendes Signal zum Steuer-<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
gerät. Auf Grund der Algorithmen der Software<br />
wird der Elektromotor der Lenkunterstützung<br />
bestromt und erzeugt so die Hilfskraft.<br />
Der Motor nimmt also nur im<br />
Bedarfsfall Leistung auf. Darin liegt der<br />
große Vorteil eines elektromechanischen<br />
Systems.<br />
3.2 Lenkunterstützung<br />
Der Fahrer will die Räder mit einer<br />
Geschwindigkeit bewegen, die dem beabsichtigten<br />
Lenkmanöver entspricht. Das<br />
heißt, er braucht eine gewisse Zahnstangenkraft<br />
bei einer gewissen Geschwindigkeit<br />
des Lenkrades und damit der Zahnstange.<br />
Maximaler Wert für die Auslegung<br />
sind 8.000 N bei einer Umdrehung des<br />
Lenkrades pro Sekunde. Unter Berücksichtigung<br />
der Untersetzung des Lenkgetriebes<br />
entspricht dies 440 W. Die Lenkunterstützung<br />
muss also zugleich eine bestimmte<br />
Kraft und eine bestimmte Leistung erzeugen.<br />
In den heutigen Bordnetzen stehen maximal<br />
80 A bei 13 V und somit rund 1.000 W<br />
zur Verfügung. Um damit die geforderten<br />
440 W zu erzeugen, muss der gesamte<br />
Wirkungsgrad mindestens 44 % betragen.<br />
Dies ist möglich, wenn man gewisse Technologien<br />
für die Elektromechanik einsetzt:<br />
● Seltenerden-Magnete für die Motoren<br />
● optimale Auslegung der Motoren<br />
● optimierte und auf die Motorauslegung<br />
abgestimmte Endstufen der Leistungselektronik<br />
In jedem Fall wird der Motor ein gewisses<br />
Bauvolumen erfordern. Dieses ist größer<br />
als bei einem entsprechenden Hydraulikantrieb.<br />
Dies ist ein wesentlicher Nachteil der<br />
elektromechanischen Systeme.<br />
3.3 Lenkgefühl<br />
Vier Konstruktionseigenschaften sind für<br />
das Lenkgefühl bestimmend: Trägheit, Reibung,<br />
Ripple, Stabilität des Regelkreises.<br />
Trägheit<br />
Im Vergleich zur hydraulischen Lenkhilfe<br />
hat die elektrische einen Motor mit drehenden<br />
Teilen und ein Getriebe zur Kraftübersetzung.<br />
Diese Trägheit ist spürbar, wenn<br />
nicht entsprechende Abhilfemaßnahmen<br />
getroffen werden:<br />
● Massenträgheitsmoment des Rotors<br />
minimieren<br />
● Übersetzung möglichst niedrig. Verlangt<br />
einen starken Motor mit entsprechend<br />
mehr Magneten (➟ Kosten)<br />
● Kompensation der Trägheit mit Hilfe der<br />
Software
30<br />
TubPAS – die elektromechanische Lenkhilfe von Krupp Presta<br />
Reibung<br />
Der größte Teil der Reibung ist Trockenreibung.<br />
Fahrbahnrückmeldungen, die<br />
unterhalb dieser Reibung liegen, spürt der<br />
Fahrer nicht. Das heißt, die Reibung ist entscheidend<br />
für die Feinfühligkeit der Lenkung<br />
und damit für den Fahrspaß. Sie<br />
muss so klein wie möglich sein.<br />
Die Lagerung des Motors und das Getriebe<br />
sind die Quellen für die Reibung. Die<br />
Lagerreibung geht mit dem Verhältnis der<br />
Übersetzung ein. Die Reibung wird minimal,<br />
wenn<br />
● die Konstruktion nur Rollreibung hat,<br />
● die Übersetzung minimal ist,<br />
● möglichst wenig Lager eingesetzt werden,<br />
● die Konstruktion statisch nicht überbestimmt<br />
ist.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Ripple<br />
Dies ist die Welligkeit bürstenloser<br />
Gleichstrommotoren mit klassischer Blockkommutierung,<br />
wie sie hier eingesetzt werden.<br />
Diesen Ripple spürt man am Lenkrad.<br />
Mit aufwändiger Ansteuerlogik lässt sich<br />
der Ripple eliminieren. Dies erfordert aber<br />
mehr Rechnerkapazität mit entsprechenden<br />
Folgekosten.<br />
Stabilität des Regelkreises<br />
Das Lenkgefühl hängt ganz wesentlich<br />
vom Anstieg des Lenkmomentes am Lenkrad<br />
ab. Bei Geradeausfahrt, um den Nullpunkt<br />
der Lenkung, möchte man keine<br />
Lenkunterstützung, um einen exakten,<br />
unverwaschenen Centerpoint zu erzeugen.<br />
Die Kinematik der Vorderachse erzeugt<br />
Kräfte, die die Vorderräder in die Nulllage<br />
zurückstellen wollen. Dies entspricht einem<br />
stabilen Fahrzustand. Der Fahrer möchte<br />
dies möglichst unverfälscht spüren, um ein<br />
Mit QFD werden Kundenanforderungen systematisch mit Produktmerkmalen verknüpft (Bild 3)<br />
sicheres Fahrgefühl zu haben.<br />
Das heißt, um Null soll der Gradient der<br />
Lenkunterstützung sehr klein sein. Um bei<br />
höheren Fahrermomenten genügend<br />
Unterstützung zu haben, muss der Gradient<br />
da entsprechend hoch sein. Dieser Gradient<br />
ist aber einer der Faktoren, die in die<br />
Kreisverstärkung des Regelsystems eingehen.<br />
Das heißt, er kann nicht beliebig hoch<br />
sein, ohne dass das System instabil wird.<br />
Damit der Spielraum für die Fahrzeugabstimmung<br />
genügend groß ist, muss die<br />
Stabilität des Lenkungssystems hoch sein.<br />
Neben einer steifen und spielfreien Mechanik<br />
ist dafür vor allem die Struktur des<br />
Reglers wichtig.<br />
4 Innovative Lösung von KPR<br />
Die Lösung von KPR entstand in engem<br />
Kontakt mit dem Markt und unter Verwendung<br />
von Hilfsmitteln für die systematische<br />
Produktentwicklung. Dabei war vor allem<br />
das Quality Function Deployment (QFD)<br />
hilfreich. Damit gelingt es, die umfangreichen<br />
und zum Teil gegenläufigen Kundenanforderung<br />
mit den zahlreichen Konstruktionseigenschaften<br />
in einen Gesamtzusammenhang<br />
zu bringen. Bild 3 zeigt einen<br />
Ausschnitt davon.<br />
Die Lösung von KPR ist eine röhrenförmige,<br />
konzentrisch um die Zahnstange<br />
angeordnete Lenkhilfe mit einem bürstenlosen<br />
Seltenerden-Motor (Bild 4). Wesentliche<br />
Konstruktionsmerkmale sind:<br />
Kleiner Bauraum<br />
Durch das Konzept mit Kugelumlauf ist<br />
es möglich, die ganze Lenkhilfe ähnlich wie<br />
einen Hydraulikantrieb konzentrisch um die<br />
Zahnstange zu bauen. Das benötigte Bauvolumen<br />
ist minimal und von ähnlicher<br />
Topologie wie bei der Hydraulik. Damit ist
31<br />
TubPAS – die elektromechanische Lenkhilfe von Krupp Presta<br />
TubPAS ist sehr einfach und robust aufgebaut und besteht aus nur 7 Komponenten (Bild 4)<br />
Gehäuse Stator Rotor Kugellager Kugelumlauf Deckel Zahnstange<br />
ihr Einsatz in vielen Einbausituationen<br />
möglich. Oft sind für die Umstellung von<br />
Hydraulik auf Elektrik nur minimale Eingriffe<br />
am Hilfsrahmen notwendig. Somit wird<br />
sogar ein Einsatz als „running change“<br />
kostenmäßig darstellbar.<br />
Zahnstange mit Kugelumlauf<br />
Mit diesem Element erfolgt die Kraftübersetzung.<br />
Das im traditionellen Maschinenbau<br />
bewährte aber teure Teil wird zurzeit für<br />
verschiedene X-by-Wire Anwendungen für<br />
automobile Zwecke und Massenfertigung<br />
neu entwickelt. Es vereint kompakte Bauweise<br />
mit optimalem Wirkungsgrad. Der<br />
Einsatz in der Lenkhilfe erfordert allerdings<br />
eine sehr sorgfältige konstruktive Ausgestaltung,<br />
um die Querkräfte am Lenkgetriebe<br />
effizient abzuleiten.<br />
Die Zahnstange wird zu einem komplexen<br />
Teil: Eine Partie erhält die Verzahnung<br />
für das konventionelle Ritzel-Zahnstange-<br />
System, die andere Partie erhält das<br />
Gewinde für den Kugelumlauf und wird mit<br />
der Gewindemutter verbaut.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Rotor<br />
Der Rotor ist ein dünnwandiger Zylinder.<br />
Die Magnete werden darauf aufgeklebt.<br />
Diese Baugruppe wird auf die Gewindemutter<br />
aufgeschoben und dann gemeinsam<br />
mit der Zahnstange ins Lenkgetriebegehäuse<br />
eingefügt.<br />
Kugellager<br />
Der Rotor läuft an einem Ende in einem<br />
zweireihigen Kugellager. Damit ist er gegenüber<br />
dem Lenkgetriebegehäuse drehbar<br />
gelagert. Zur Minimierung der Reibung<br />
müssen die Lager so klein wie möglich<br />
sein. Die fliegende Lagerung verringert den<br />
Einfluss der Bautoleranzen und verbessert<br />
somit auch die Reibung.<br />
Stator<br />
Der Stator mit den Blechen und der<br />
Wicklung wird als Baugruppe in das Lenkgetriebegehäuse<br />
eingeschoben. Entscheidend<br />
ist die Auslegung des Motors für optimalen<br />
Wirkungsgrad in den relevanten<br />
Betriebspunkten. Nur so können die<br />
verlangten Leistungen mit vertretbaren<br />
Magnetkosten dargestellt werden.<br />
Fertigungsgerechte Konstruktion<br />
Die ganze Lenkhilfe besteht aus 7 bis 8<br />
Teilen (Bild 4). Damit kann sie wirtschaftlich<br />
auf automatisierten Anlagen für sehr hohe<br />
Stückzahlen gebaut werden. Der größte<br />
Teil der spanenden Bearbeitungen mit<br />
funktionaler Relevanz kann in einer Aufspannung<br />
erfolgen. Bei der Konstruktion<br />
wurde darauf geachtet, dass Toleranzketten<br />
möglichst kurz bleiben. Parallel zur Konstruktion<br />
wurde ein Modell zur statistischen<br />
Simulation der Form und Lagetoleranzen<br />
aufgebaut. Damit lassen sich gezielt Aussagen<br />
bezüglich der erforderlichen Toleranzen<br />
machen. Umgekehrt lässt sich so auch<br />
die Herstellbarkeit fundiert beurteilen.<br />
5 Fazit<br />
TubPAS ist die röhrenförmige elektrische<br />
Lenkhilfe, die am besten in viele Bauräume<br />
passt, wo heute hydraulische Lenkhilfen<br />
zum Einsatz kommen. Mit minimaler Reibung<br />
verbindet sich der optimale Wirkungsgrad.<br />
Nur so lassen sich die erforderlichen<br />
Unterstützungsleistung mit den heutigen<br />
Bordnetzen darstellen. Gleichzeitig<br />
bringt die niedrige Reibung ein gutes Lenkgefühl.<br />
TubPAS ist ein einfaches, tragfähiges<br />
Prinzip, mit dem KPR Anbieter von Lenksystemen<br />
wird.
32<br />
Dipl.-Verw.-Wiss. Michael Sailer<br />
Stahl-Leichtbau-Verbundlenkerachse für Pkw von<br />
Thyssen Umformtechnik + Guss<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Die neue Verbundlenkerachse von Thyssen Umformtechnik + Guss<br />
spart bis zu 25 % Kosten und 30 % Gewicht (Bild 1)
33<br />
1 Einleitung<br />
Bis zu 25 % Kosten und bis zu 30 %<br />
Gewicht spart ein neues Konzept für die<br />
Konstruktion von Verbundlenkerachsen,<br />
das die Thyssen Umformtechnik + Guss<br />
GmbH (TUG), Werk Brackwede, ausgearbeitet<br />
hat (Bild 1). Gegenwärtig läuft ein<br />
gemeinsames Entwicklungsprojekt mit<br />
einem deutschen Automobilhersteller, in<br />
dem das Konzept serienreif gemacht werden<br />
soll. Wesentlichste Innovation ist ein<br />
neuartiges Torsionsprofil, das eine deutlich<br />
geringere Wanddicke besitzt als vergleichbare<br />
herkömmliche Bauteile.<br />
2 Torsionsprofil<br />
Stahl-Leichtbau-Verbundlenkerachse für Pkw von Thyssen Umformtechnik + Guss<br />
Das Torsionsprofil und die an seinen beiden<br />
Enden verschweißten Längslenker sind<br />
die Kernkomponenten von Verbundlenkerachsen.<br />
Die bislang am weitesten verbreitete<br />
Methode zur Herstellung der Profile<br />
besteht darin, dass dickwandige Blechplatinen<br />
zu Bauteilen mit v-förmigem Querschnitt<br />
gebogen werden. Die Blechstärke<br />
liegt dabei zwischen fünf und sieben Millimetern.<br />
Das von TUG entwickelte Konzept<br />
Elemente der Verbundlenkerachse (Bild 2)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
lässt sich dagegen mit Blechstärken ab 1,5<br />
Millimetern realisieren. Dabei verwendet<br />
man einen höherfesten Dualphasenstahl<br />
mit einer Festigkeit von 600 N/mm2 .<br />
Ausschlaggebend für die Verringerung<br />
der Wanddicke ist jedoch die neuartige und<br />
von TUG zum Patent angemeldete Gestaltung<br />
des Profils: Bei der Herstellung wird<br />
Stahlband durch Walzprofilieren zu einem<br />
Bauteil geformt, dessen Querschnitt einem<br />
doppelten U entspricht, mit einem Hohlraum<br />
zwischen innerer und äußerer Schale<br />
(Bild 2, Detail 1 und Bild 3). Durch diesen<br />
Querschnitt ergibt sich ein Torsionsträgheitsmoment,<br />
das deutlich über den Werten<br />
konventionell geformter Torsionsprofile<br />
liegen kann. Die neuartige Konstruktion<br />
macht sogar den Verzicht auf den Stabilisator<br />
möglich, der bei der herkömmlichen<br />
Bauweise insbesondere für Fahrzeuge mit<br />
leistungsstarken Motoren als zusätzliche<br />
Verstärkung in das Torsionsprofil gelegt<br />
und mit den beiden Längslenkern verschweißt<br />
wird.<br />
Durch Variation von h kann die Torsionssteifigkeit<br />
gezielt eingestellt werden (Bild 3)<br />
3 Längslenker<br />
Als weitere Neuerung beinhaltet das Verbundlenkerachsen-Konzept<br />
von TUG<br />
Längslenker, die aus flanschlos geschweißten<br />
Halbschalen bestehen (Bild 2, Detail 2).<br />
Während gegenwärtig die meisten Längslenker<br />
aus Rohren gefertigt werden, bietet<br />
die TUG-Lösung größere Gestaltungsfreiheit<br />
für die Gewichtsreduktion und die<br />
Integration zusätzlicher Funktionen. So<br />
lassen sich Verstärkungen oder Stützbleche<br />
zwischen Torsionsprofil und Längslenkern<br />
durch eine den auftretenden Belastungen<br />
angepasste Geometrie der Blechschalen<br />
einsparen. Außerdem sind die Anschlüsse<br />
von Federsitz und Dämpferhalter optimal<br />
gestaltbar (Bild 2, Detail 3).<br />
Das neue Verbundlenkerachsen-Konzept<br />
ist ein Produkt des Bereiches Vorentwicklung<br />
bei Thyssen Umformtechnik + Guss,<br />
Brackwede. Aufgabe dieses, im Jahr 1997<br />
geschaffenen Bereiches ist es, mit den<br />
Kunden bereits in der Konzeptionsphase<br />
für neue Fahrzeugmodelle sehr eng zusammenzuarbeiten.
34<br />
Dipl.-Ing. Klaus Schmidt<br />
Innovative Luftfeder-Dämpfermodule für die S-Klasse<br />
von DaimlerChrysler<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Luftfederung mit adaptiver Dämpfungsverstellung der S-Klasse von DaimlerChrysler (Bild 1)
35<br />
1 Einleitung<br />
Innovative Luftfeder-Dämpfermodule für die S-Klasse von DaimlerChrysler<br />
Die Krupp Bilstein GmbH ist ein Unternehmen<br />
der <strong>ThyssenKrupp</strong> Automotive<br />
Gruppe und trägt gemeinsam mit anderen<br />
Konzernunternehmen zur umfassenden<br />
Kompetenz im Fahrwerkbereich bei. Die<br />
Präsenz von <strong>ThyssenKrupp</strong> Automotive im<br />
immer wichtiger werdenden internationalen<br />
Systemgeschäft wird somit gestärkt.<br />
Bereits 1954 begannen die Ingenieure<br />
der Firma Bilstein mit der Entwicklung des<br />
ersten serienreifen Einrohr-Gasdruckstoßdämpfers<br />
nach dem Carbon-Prinzip. Er<br />
revolutionierte die Dämpfungstechnik mit<br />
überragenden Sicherheits- und Komfortmerkmalen.<br />
Ab 1957 erstmals in Serie bei<br />
Mercedes-Benz eingesetzt, wurde „der<br />
Bilstein“ zum Synonym für Gasdruckstoßdämpfer.<br />
Auf seinem Funktionsprinzip<br />
basieren auch heute noch die Serienstoßdämpfer.<br />
Als leistungsfähiger Entwicklungsund<br />
Systempartner der internationalen<br />
Automobilindustrie steht Bilstein weltweit<br />
für Innovation und High Tech in der<br />
Fahrwerktechnik.<br />
Um mit dem Fahrkomfort ein möglichst<br />
hohes Niveau zu erreichen, wurden in<br />
intensiver Zusammenarbeit mit der Automobilindustrie<br />
komplexe, mit modernster<br />
Elektronik arbeitende Luftfederungssysteme<br />
für den Pkw-Serieneinsatz entwickelt.<br />
Dabei wurde auch technologisches<br />
Neuland betreten.<br />
Auf Grund der hohen Akzeptanz als<br />
kompetenter Entwicklungslieferant wurde<br />
Krupp Bilstein als Entwicklungspartner und<br />
Serienlieferant für die Feder-Dämpfer-<br />
Module der neuen DaimlerChrysler<br />
S-Klasse auserwählt.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
2 Aufgabenstellung<br />
Für die Entwicklung der neuen S-Klasse<br />
galt es, trotz des um ca. 300 kg reduzierten<br />
Fahrzeuggewichts den Fahrkomfort des<br />
Vorgängermodells zu übertreffen und<br />
zusätzlich die fahrdynamischen Qualitäten<br />
zu verbessern.<br />
Da dies mit konventionellen Feder-/<br />
Dämpfungselementen nicht erreichbar<br />
war, wurde in einer frühen Phase der<br />
Fahrzeugentwicklung eine Luftfederung<br />
mit vierstufig verstellbaren Dämpfern als<br />
Serienausstattung ins Lastenheft<br />
aufgenommen (Bild 1).<br />
Nur mit einem solchen System war es<br />
möglich, die technische Spitzenstellung der<br />
S-Klasse zu sichern und den Kundenerwartungen<br />
hinsichtlich Fahrkomfort und Fahrdynamik<br />
gerecht zu werden.<br />
Skyhook-Dämpfungsprinzip (Bild 2)<br />
3 Das Luftfederungssystem mit<br />
adaptiver Dämpfung<br />
Das Komfortpotenzial einer Luftfeder<br />
basiert darauf, dass bei der Auslegung der<br />
Federrate im Vergleich zur Stahlfeder deutlich<br />
niedrigere Werte realisierbar sind. Dies<br />
ist zulässig, weil das unerwünschte Absenken<br />
der Karosserie bei Zuladung durch das<br />
Nachfüllen von Luft kompensiert werden<br />
kann. Der Kompromiss der Stahlfeder, bei<br />
allen Beladungszuständen ausreichenden<br />
Restfederweg bereitstellen zu müssen,<br />
besteht hier nicht.<br />
Um trotz der niedrigen Federrate alle Forderungen<br />
im Hinblick auf Fahrdynamik und<br />
Fahrsicherheit zu erfüllen, wird sinnvollerweise<br />
die Luftfederung durch einen in der<br />
Dämpfkraft verstellbaren Stoßdämpfer<br />
ergänzt. Nur die Kombination beider präzise<br />
aufeinander abgestimmten Elemente liefert<br />
den gewünschten Gewinn an Komfort<br />
und Fahrdynamik. Das System ermöglicht<br />
das komfortable Gleiten auf ebenen<br />
Straßen (Dämpferstellung weich), das kontrollierte<br />
Beruhigen des Aufbaus nach dem
36<br />
Innovative Luftfeder-Dämpfermodule für die S-Klasse von DaimlerChrysler<br />
Luftfederbein Vorderachse (Bild 3) Luftfederbein Hinterachse (Bild 4)<br />
Überfahren von Fahrbahnunebenheiten<br />
(Dämpfer im Skyhookmodus) und das gute<br />
Handling bei sportlicher Fahrweise.<br />
Durch den Einsatz des Luftfedersystems<br />
mit adaptiver Dämpfung ergibt sich eine<br />
Reihe von Vorteilen gegenüber konventionellen<br />
Systemen:<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
● Die Aufbaueigenfrequenz bleibt bei<br />
Beladung weitgehend konstant.<br />
● Automatisches Absenken des Fahrzeugs<br />
bei hoher Geschwindigkeit zur Reduzierung<br />
des Luftwiderstandes und<br />
Erhöhung der Fahrdynamik<br />
● Vom Fahrer gesteuertes Anheben des<br />
Fahrzeugs für Schlechtwegstrecken und<br />
Garageneinfahrten<br />
● Designvorteile durch stets optimalen<br />
Fahrzeughöhestand<br />
● Anpassung der Dämpfkräfte an die Fahrsituation,<br />
dadurch Verbesserung von<br />
Fahrkomfort und Fahrsicherheit<br />
● Reduzierung der Wankneigung bei<br />
dynamischen Fahrmanövern<br />
● Verbesserung des Fahrzeughandlings<br />
Die Intensität der Aufbauschwingungen<br />
beim Überfahren von Fahrbahnunebenheiten<br />
ist eines der wesentlichen Kriterien für<br />
die Beschreibung des Fahrkomforts. Um<br />
den maximalen Komfort für die Insassen zu<br />
ermöglichen, werden die vierstufigen ADS-<br />
Dämpfer (Adaptives Dämpfungssystem)<br />
nach dem so genannten ADS-Skyhookprinzip<br />
angesteuert.<br />
Wie der Name Skyhook schon verrät,<br />
basiert der Regelalgorithmus darauf, die<br />
Karosserie des Fahrzeugs an einem imaginären<br />
Himmelshaken aufzuhängen, um<br />
sie horizontal zu fixieren und die Räder der<br />
Fahrbahnoberfläche folgen zu lassen. Da<br />
dieser theoretische Ansatz in der Praxis<br />
nicht umsetzbar ist und einige andere<br />
fahrdynamische Gesetzmäßigkeiten nicht<br />
unberücksichtigt bleiben dürfen, arbeitet<br />
der ADS-Skyhook-Algorithmus nach einem<br />
etwas vereinfachten, aber für die Aufbauberuhigung<br />
sehr wirkungsvollen Prinzip<br />
(Bils 2). Entscheidendes Kriterium zur Festlegung<br />
der geeigneten Dämpfkraftstufe für<br />
die jeweilige Situation ist die Bewegungs-<br />
richtung der Fahrzeugkarosserie. Bei einer<br />
Bewegung nach oben muss der Dämpfer<br />
eine harte Zugstufe und eine weiche Druckstufe<br />
bereitstellen, bei einer Bewegung<br />
nach unten ist eine weiche Zugstufe und<br />
eine harte Druckstufe erforderlich.
37<br />
Innovative Luftfeder-Dämpfermodule für die S-Klasse von DaimlerChrysler<br />
4 Luftfeder-/Dämpfermodul<br />
Wegen der konstruktiven Bauraumvorgaben<br />
unterscheiden sich die Federbeine von<br />
Vorder- und Hinterachse erheblich in Form<br />
und Dimensionierung. Funktional betrachtet<br />
wurden sie jedoch aus vergleichbaren<br />
Basiselementen zusammengesetzt<br />
(Bilder 3 und 4).<br />
Der ADS-Dämpfer trägt die Luftfeder und<br />
leitet die Federkraft auf die Achse. Zugleich<br />
übernimmt der Dämpfer die Aufgabe, die<br />
Luftfeder zu zentrieren und die in ihr<br />
entstehenden Querkräfte aufzunehmen.<br />
Die obere Anbindung des Dämpfers zur<br />
Luftfeder stellt ein kardanisch weiches<br />
Kapsellager dar, über das die Dämpfkräfte<br />
in den Luftfedertopf eingeleitet werden.<br />
Die Luftfederbeine sind im oberen<br />
Bereich mit einem Restdruckventil ausgestattet,<br />
über das die Federbeine mit der<br />
Fahrzeugluftversorgung verbunden werden.<br />
Die Hauptaufgabe des Ventils besteht<br />
darin, das Unterschreiten eines definierten<br />
Minimaldrucks im Federbein zu vermeiden.<br />
Diese Funktion ist bei der Anlieferung an<br />
das Montageband des Kunden und bei<br />
Störungen in der Luftversorgung im Fahrzeug<br />
von hoher Bedeutung. Der Abfall des<br />
Fülldrucks auf den Atmosphärendruck<br />
hätte eine Schädigung des empfindlichen<br />
Luftfederbalges zur Folge. Gegen die<br />
äußeren Einflüsse wie Feuchtigkeit und<br />
Schmutz wird der Balg durch eine<br />
Manschette geschützt.<br />
5 Luftfeder<br />
Bereits in den 60er-Jahren wurden Pkw<br />
mit volltragenden Luftfedern serienmäßig<br />
ausgerüstet. Folglich stellt der Einsatz von<br />
Luftfedern in der S-Klasse keine Revolution<br />
in der Fahrwerktechnik dar.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Der Unterschied zwischen den bisher<br />
bekannten Luftfedern und denen der neuen<br />
S-Klasse liegt im Aufbau des wesentlichen<br />
Bauteils einer Luftfeder: dem Luftfederbalg.<br />
Die Flexibilität des Luftfederbalgs<br />
bestimmt im hohen Maße das Ansprechverhalten<br />
der Luftfeder auf Fahrbahnanregungen.<br />
Bisher wurden Luftfederbälge üblicherweise<br />
mit Wanddicken von ca. 2 bis 3 mm<br />
und kreuzförmig angeordneten Textilfadenlagen<br />
hergestellt. Ein derartiger Balgaufbau<br />
ADS-Dämpfungsverstelleinheit (Bild 5)<br />
erfährt infolge seiner hohen Eigenreibung<br />
eine Verhärtung von bis zu 300 % bei kleinen<br />
Anregungsamplituden. Dies hat einen<br />
deutlich reduzierten Abrollkomfort des<br />
Fahrzeugs zur Folge.<br />
Um dem Komfortanspruch der S-Klasse<br />
gerecht zu werden, wurde im Hinblick auf<br />
optimales Ansprechverhalten ein neues<br />
Balgkonzept entwickelt. Die Balgdicke<br />
wurde auf 1,7 mm reduziert und die Festigkeitsträger<br />
in Form von 0,3 mm dicken<br />
Polyamidfäden axial angeordnet. Durch<br />
diesen Aufbau benötigt der Balg infolge der<br />
unzureichenden Selbstabstützung eine<br />
Außenführung, die eine unzulässig<br />
große Ausdehnung in radialer Richtung<br />
verhindert.<br />
Die Gummimischung des Balges wird<br />
aus Chloropren-Kautschuk hergestellt.<br />
Durch umfangreiche Versuchsreihen wurde<br />
die Rezeptur der Mischung an die Erfordernisse<br />
angepasst, um so den Zielkonflikt bei<br />
der Erfüllung der Lebensdauerforderungen<br />
bei Hoch- und Tieftemperatur zu lösen.<br />
Für die Fertigung des Luftfederbalgs<br />
musste beim Lieferanten eine nur für dieses<br />
Projekt vorgesehene vollautomatische<br />
Fertigungslinie errichtet werden. Durch<br />
umfangreiche automatisch ablaufende<br />
Prüfprozesse nach jedem Fertigungsschritt<br />
wird das erforderliche hohe Qualitätsniveau<br />
jedes einzelnen Luftfederbalgs nachgewiesen.<br />
6 ADS-Dämpfer<br />
Um die vom Kunden DaimlerChrysler<br />
geforderten Spezifikationen bezüglich Bauraum,<br />
Gewicht, Verstellbarkeit, Reibung<br />
und Kosten zu erfüllen, musste ein gänzlich<br />
neues Dämpferkonzept erarbeitet werden.<br />
Das Einzige, was vom konventionellen<br />
Dämpfer übernommen werden konnte, war
38<br />
Innovative Luftfeder-Dämpfermodule für die S-Klasse von DaimlerChrysler<br />
Kraft-Geschwindigkeitsdiagramme der vier unterschiedlichen Dämpfkraftkennlinien (Bild 6)<br />
das Grundprinzip des Gasdruckdämpfers.<br />
Alles andere wurde überarbeitet oder völlig<br />
neu entwickelt.<br />
Das auffälligste äußere Merkmal des<br />
ADS-Dämpfers ist das seitlich adaptierte<br />
Ventilmodul mit zwei integrierten elektromechanischen<br />
Ventilen (Bild 5). Je nach<br />
Schaltstellung können ein oder zwei Bypassarbeitskolben<br />
zu dem an der Kolbenstange<br />
befindlichen Hauptarbeitskolben hydraulisch<br />
parallel geschaltet werden. Daraus<br />
resultieren vier unterschiedliche Dämpfkraftkennlinien<br />
(Bild 6). Die Schaltstellung<br />
der Ventile wird über das zentrale Fahrzeugsteuergerät<br />
nach dem Skyhook-Algo-<br />
Schaltstellung der Ventile bei den verschiedenen Dämpfkraftkennlinien (Bild 7)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
rithmus vorgegeben. Die Zuordnung der<br />
Kennlinie geht aus Bild 7 hervor.<br />
Hinsichtlich des Ansprechverhaltens und<br />
des daraus resultierenden Fahrkomforts<br />
wurden durch den Einsatz eines neu entwickelten<br />
Dichtungs-/Führungspaketes<br />
neue Maßstäbe für die automobile Oberklasse<br />
definiert (Bild 8). Die Dichtfunktion<br />
wird durch einen mit spezieller Dichtkantengeometrie<br />
versehenen Teflonring übernommen.<br />
Sehr niedrige Werte für Reibung<br />
und Losbrechkräfte zeichnen dieses Dichtungskonzept<br />
aus. Zur weiteren Reibungsreduzierung<br />
wird sowohl die Führung der<br />
Kolbenstange im Dichtungs-/Führungs-<br />
Stufe 1: Ventil 1 und 2 bestromt Zug weich /Druck weich<br />
für komfortables Abrollen bei<br />
geringen dynamischen Anregungen<br />
Stufe 2: Ventil 1 bestromt Zug weich / Druck hart<br />
Skyhookmodus<br />
Stufe 3: Ventil 2 bestromt Zug hart / Druck weich<br />
Skyhookmodus<br />
Stufe 4: Ventil 1 und 2 stromlos Zug hart / Druck hart<br />
starke dynamische Anregungen<br />
paket als auch die des Arbeitskolbens von<br />
PTFE-Bändern übernommen.<br />
Eine zusätzliche Maßnahme zur Reibungsoptimierung<br />
war die Integration eines<br />
Bodenventils in den Dämpfer, wodurch der<br />
Gasdruck um ca. 30 % reduziert werden<br />
konnte. Eine verminderte Anpresskraft der<br />
Dichtung an die Kolbenstange ist die Folge.<br />
7 Fertigung<br />
Die Großserienfertigung der S-Klasse-<br />
Federbeine stellte hohe Anforderungen an<br />
die Prozessentwicklung. Viele Fertigungsprozesse<br />
mussten neu definiert und bis zur<br />
Serientauglichkeit entwickelt werden.<br />
Die nach dem Kaltfließpressverfahren<br />
hergestellten Dämpferaußenrohre wurden<br />
aus Gewichtsgründen mit einer inkonstanten<br />
Wandstärke gefertigt. So konnte in<br />
allen Funktionsbereichen des Rohres die<br />
Wanddicke auf das erforderliche Maß<br />
reduziert werden.<br />
Zur Darstellung der einzelnen Ölkanäle<br />
waren diverse Durchbrüche in den Dämpferinnen-<br />
und -außenrohren erforderlich. Um<br />
eine absolute Gratfreiheit mit einem definierten<br />
Kantenbruch für das beschädigungsfreie<br />
Überfahren der Bohrungen mit<br />
Trenn- und Arbeitskolben zu gewährleisten,<br />
wurde ein spezielles Lochverfahren entwickelt.<br />
Hierbei wird der Lochstempel ins<br />
Innere des Rohres gefahren, und der Lochvorgang<br />
erfolgt von innen nach außen.<br />
Mehrere Rohre der Dämpfer mussten<br />
umlaufend oder in Segmenten aufgeweitet<br />
werden. Hier kommen das Rohrendenumformverfahren<br />
und das Segmentprägeverfahren<br />
mittels eines Druckgummieinsatzes<br />
zum Tragen. Aufwändig war in diesem<br />
Zusammenhang die Ermittlung und Festlegung<br />
der Rohrspezifikationen, um den gewünschten<br />
Umformgrat unter Berücksichti-
39<br />
Innovative Luftfeder-Dämpfermodule für die S-Klasse von DaimlerChrysler<br />
Neu entwickeltes Dichtungs-/Führungspaket<br />
(Bild 8)<br />
gung der sehr engen Durchmessertoleranzen<br />
zu erzielen.<br />
Besondere Beachtung fand die Schmutzeinbringung<br />
während des Montageprozesses.<br />
Wegen der Schmutzempfindlichkeit<br />
der in den Dämpfer integrierten Schaltventile<br />
war das Waschen aller im Dämpfer verbauten<br />
Komponenten unerlässlich. Zur<br />
Sicherstellung der Fertigungsqualität<br />
werden die Dämpfer zu 100 % hinsichtlich<br />
Dämpferkennlinie, Ventilschaltzeiten<br />
und Reibung geprüft. Außerhalb der<br />
Fertigungstoleranzen liegende Dämpfer<br />
werden zerlegt und mit erneuerten<br />
Komponenten wieder aufgebaut.<br />
Auf den komplettierten Dämpfer wird auf<br />
einer halbautomatisierten Montagelinie die<br />
Luftfeder montiert. Nur durch einen präzise<br />
ausgeführten Streck- und Einstellprozess<br />
in mehreren Montagestationen kann<br />
die richtige Lage und Ausformung des<br />
Luftfederbalgs sichergestellt werden.<br />
Für die anschließende Dichtigkeitsprüfung<br />
wird die Luftfeder mit Helium befüllt.<br />
In einer Vakuumkammer kann bei auftretender<br />
Undichtigkeit das Helium mittels<br />
eines Massenspektrometers nachgewiesen<br />
werden. Eine abschließende Rundlaufmessung<br />
der Luftfeder mit Hilfe eines Lasermesssystems<br />
stellt die Einhaltung der vorgeschriebenen<br />
Fertigungstoleranzen sicher.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Die wesentlichen Montage- und Prüfwerte<br />
werden für jedes Luftfederbein gespeichert<br />
und können über den auf das Federbein<br />
aufgebrachten Barcode jederzeit<br />
zugeordnet werden.<br />
8 Schluss<br />
Mit dem Einsatz der Luftfederung mit<br />
adaptivem Dämpfungssystem in der neuen<br />
S-Klasse demonstrierte DaimlerChrysler<br />
eindrucksvoll die technologische Führerschaft<br />
im Bereich der innovativen Fahrwerkssysteme.<br />
Krupp Bilstein leistete mit<br />
der Entwicklung und Serienlieferung der<br />
Feder-Dämpfer-Module einen wesentlichen<br />
Beitrag zum Gesamtsystem und konnte<br />
hierdurch die Kompetenz als innovativer<br />
Partner der Automobilindustrie unter<br />
Beweis stellen. Auf Grund der durch die<br />
Serieneinführung der S-Klasse gestiegenen<br />
Akzeptanz derartiger Systeme wird die Luftfederung<br />
mit adaptivem Dämpfungssystem<br />
eine weite Verbreitung am Markt finden,<br />
und dies nicht nur in Fahrzeugen der Oberklasse.<br />
Wegen der frühen Präsenz konnte<br />
sich Krupp Bilstein innerhalb dieses<br />
Marktsegments erfolgreich positionieren<br />
und so den Kunden bei derzeitigen und<br />
zukünftigen Projekten mit der erlangten<br />
Kompetenz einen hohen Nutzen liefern.
40<br />
Dr. Wolfgang Stein,<br />
Dipl.-Ing. Hartmuth Willnauer<br />
Die Smartstep-Stufe – Innovation im Fahrtreppenbau<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Smartstep’s im Schuhhaus Görtz, Hamburg (Bild 1)
41<br />
1 Einleitung<br />
Die Smartstep-Stufe – Innovation im Fahrtreppenbau<br />
Kein Mensch kann heute sagen, welche<br />
Spieler für die Mannschaft des FC Schalke 04<br />
im Sommer nächsten Jahres auflaufen<br />
werden. Sicher aber ist, dass im August<br />
2001 in Gelsenkirchen nicht mehr im Parkstadion<br />
angepfiffen wird, sondern im dann<br />
modernsten Fußballstadion der Welt, der<br />
Arena „AufSchalke“. Sicher ist auch, dass<br />
die Spieler den Weg beim Betreten und<br />
Verlassen des Stadions über die modernste<br />
Fahrtreppe der Welt zurücklegen werden.<br />
Königsblaue Stufen – weil Thyssen Fahrtreppen<br />
im vergangenen Jahr die erste<br />
Kunststoffstufe der Welt „Smartstep“ auf<br />
den Markt brachte, werden bald bei Fernsehübertragungen<br />
aus der neuen Schalke-<br />
Arena Fahrtreppen in der Vereinsfarbe der<br />
Die Smartstep ist TÜV-geprüft und gemäß EN 115 zertifiziert (Bild 2)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
„Schalker Knappen“ zu bewundern sein<br />
(Bild 2).<br />
Frisch am Markt, ist die neue Fahrtreppenstufe<br />
jetzt gleich zweimal ausgezeichnet<br />
worden. Thyssen Fahrtreppen wurde, zusammen<br />
mit dem Kunststoffhersteller Bayer<br />
und dem Kunststoffverarbeiter Coko, vom<br />
Verein Deutscher Ingenieure mit dem VDI-<br />
Kunststoff-Innovationspreis geehrt (Bild 3).<br />
Verliehen wird diese Auszeichnung für Entwicklungsarbeiten,<br />
die dazu beitragen, bei<br />
Fertigungsprozessen Kosten einzusparen,<br />
ökologische Verbesserungen zu erreichen<br />
oder neue Anwendungsfelder für Kunststoffe<br />
zu erschließen. Die Innovationshöhe<br />
dieses neuen Produkts wurde von der Jury<br />
besonders gelobt. Zusätzlich belegte Thys-<br />
VDI-Kunststoffpreis (Bild 3)<br />
sen Fahrtreppen im <strong>ThyssenKrupp</strong> Innovationswettbewerb<br />
2000 den dritten Platz. 2 Werkstoff und Farbgestaltung<br />
Bislang hatten Architekten keine große<br />
Wahl bei der Gestaltung von Gebäuden mit<br />
Fahrtreppen. Die herkömmlichen Stufen<br />
werden aus Aluminium gefertigt. Damit ist<br />
die Farbe – Silbergrau – vorgegeben. Wer<br />
es bunter liebt, kann zwar eine lackierte<br />
Variante bestellen. Doch unter vielen Füßen<br />
leidet die Farbe, der Lack ist irgendwann<br />
ab. Smartstep hingegen ist aus einem völlig<br />
neuen, eigens in Zusammenarbeit mit<br />
der Bayer <strong>AG</strong> entwickelten Material gebaut.<br />
Der neue Werkstoff wird mit Glasfasern verstärkt,<br />
sodass er den vielfältigen Beanspruchungen<br />
im Leben einer Fahrtreppenstufe<br />
ebenso gut widersteht wie Aluminium.<br />
Sogar besser: Dem Gemisch aus Polyester<br />
und Glasfasern können bei der Herstellung<br />
Farbpigmente verschiedener Couleur beigefügt<br />
werden. Dadurch ist der ganze Stufenkörper<br />
durchgefärbt, spätere Abnutzungsspuren<br />
fallen farblich nicht auf. Die<br />
traditionelle Druckgussstufe hat also Konkurrenz<br />
bekommen durch eine neue Gene-
42<br />
Die Smartstep-Stufe – Innovation im Fahrtreppenbau<br />
ration von roten, grünen, blauen und<br />
schwarzen Fahrtreppenstufen, die im<br />
Spritzgieß-Verfahren hergestellt werden.<br />
Für die nötige Steifheit der Stufe – Kunststoff<br />
ist natürlich elastischer als Aluminium<br />
– sorgt eine präzise berechnete Verrippung<br />
auf der Innenseite. Um Material zu sparen<br />
und das Gewicht zu senken, wird an der<br />
Hinterkante nach dem Spritzgießen ein<br />
dünnes aber starkes Stahlrohr eingesetzt.<br />
So ist garantiert, dass die neue Stufe jeden<br />
Beanspruchungen einer vielbenutzten Fahrtreppe<br />
ohne Verformungen standhält.<br />
3 Reinigung und Sicherheit<br />
Das Spritzgieß-Verfahren schafft neben<br />
dem farbenfrohen Design noch weitere Vorteile,<br />
die das neue Produkt ungemein<br />
attraktiv für den Markt machen. Anders als<br />
bei den herkömmlichen Stufen ist die Oberfläche<br />
der Smartstep porenfrei. Die Fahrtreppe<br />
ist dadurch sauberer, weil der<br />
Schmutz schlechter haftet. Reinigungskolonnen<br />
in Einkaufszentren, Flughäfen und<br />
Bürogebäuden zwischen Hamburg und<br />
Schanghai wird das freuen: Die Glasfaserstufen<br />
lassen sich besser und schneller<br />
säubern. Zudem ist das neue Material<br />
rutschfester. Gerade an kritischen Einsatzorten<br />
wie dem Eingangsbereich von Kaufhäusern<br />
ist dies von Vorteil. Kunden mit<br />
Tüten voller Einkäufe und regenfeuchten<br />
Schuhsohlen werden rutsch-resistentere<br />
Fahrtreppenstufen zu schätzen wissen.<br />
Hinzu kommt, dass die Glasfaserstufe<br />
Geräusche besser dämpft als die Verwandte<br />
aus Aluminium. Gut zwei Drittel aller<br />
Thyssen-Treppen werden innerhalb von<br />
Geschäftsgebäuden installiert. Der Klang<br />
von Tausenden klappernder Absätze täglich<br />
ist nicht zu unterschätzen. Die Kunststoffstufe<br />
vermindert diese unausweichliche<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Muster der Farbgestaltung (Bild 4)<br />
Geräuschkulisse merklich – ein Vorteil gerade<br />
in Einkaufspassagen und Kaufhäusern,<br />
wo der gestresste Kunde so wenig wie<br />
möglich zusätzliche Irritation erfahren soll<br />
(Bilder 1 und 4).<br />
4 Brandschutz<br />
Natürlich muss der neu entwickelte Thermoplast<br />
nicht nur den alltäglichen Beanspruchungen<br />
genügen. Wie verhält die<br />
Kunststoffstufe sich im Falle eines Gebäudebrandes<br />
oder eines Feuers in der Fahrtreppe<br />
selbst? Fahrtreppen sind zwar nicht<br />
als Fluchtwege zugelassen. Aber natürlich<br />
dürfen sie auch im Brandfall keine zusätzliche<br />
Gefahr bergen. Daher sind im Material<br />
Brandschutzmittel eingeschlossen, die bei<br />
Erhitzung zerfallen und ein selbstständiges<br />
Brennen der Stufe unmöglich machen.<br />
Smartstep erfüllt somit die internationalen<br />
Brandschutz-Normen für Gebäude.<br />
In einem umfangreichen Testprogramm<br />
musste die Glasfaserstufe während ihrer<br />
Entwicklung tatsächlich durchs Feuer<br />
gehen. Die Ingenieure zündeten einen<br />
Brandbeschleuniger unter einer mit<br />
Gewichten belasteten Stufe. Auch nach<br />
einigen Minuten blieb die Smartstep unversehrt.<br />
Erst beim Abkühlen kam es zu leichten<br />
Verformungen. Funktionstüchtig aber<br />
blieb die Stufe in jedem Fall – nicht einmal<br />
warme Füße würde man bekommen. Durch<br />
die geringe Wärmeleitfähigkeit ihres Materials<br />
erhitzte sich die Stufen-Oberfläche<br />
kaum. Anders verhalten sich Aluminiumstufen,<br />
die sich nach zwei Minuten Feuereinwirkung<br />
aufheizen. Smartstep bringt<br />
aber nicht nur Vorteile für den Kunden.<br />
5 Vorteile in der Fertigung<br />
Auch der Produktionsprozess für Fahrtreppenstufen<br />
konnte vereinfacht und verbessert<br />
werden. Vor allem die Spritzgussform,<br />
das Herzstück in der Herstellung,<br />
wird nicht so stark beansprucht wie die<br />
Druckgussform zur Produktion von Aluminiumstufen.<br />
Kunststoff kann bei einer niedrigeren<br />
Temperatur verarbeitet werden – das<br />
spart Energie. Hinzu kommt eine geringere<br />
Fließgeschwindigkeit des Materials.<br />
Dadurch hat die Spritzgussform ein zehnmal<br />
längeres Leben. Zudem müssen Spritzgießstufen<br />
nach Abkühlung kaum nachgearbeitet<br />
werden – eine Aluminiumstufe hingegen<br />
muss nach dem Gießen zeitintensiv<br />
gerichtet werden. Die Stufe selbst ist am<br />
Ende wesentlich leichter – um fast 20 Prozent.<br />
Dadurch lässt sie sich einfacher in die<br />
Fahrtreppe einbauen. Auch spätere Service-<br />
Arbeiten sind leichter und schneller zu handhaben.<br />
Zusammenfassend lässt sich sagen:<br />
Mit der Smartstep konnte ein Produkt auf<br />
den Markt gebracht werden, das auch ein<br />
erhebliches wirtschaftliches Potenzial besitzt.
43<br />
Die Smartstep-Stufe – Innovation im Fahrtreppenbau<br />
Automatische Entnahmevorrichtung in der<br />
Fertigung (Bild 5)<br />
6 Marktresonanz<br />
Wer selbst einmal einen Fuß auf eine<br />
Smartstep-Fahrtreppe setzen möchte, kann<br />
dies bei der EXPO 2000. Der <strong>ThyssenKrupp</strong><br />
Pavillon auf der Hannover Messe wurde für<br />
die Dauer der Ausstellung bis zum 31. Oktober<br />
in „Youth Infotainment <strong>Forum</strong>“ umbe-<br />
Fahrtreppen mit Smartstep’s in den Farben Rot, Grün und Blau (Bild 6)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
nannt. Hier trifft sich die Jugend der Welt in<br />
Workshops, zum Spielen und Relaxen. Und<br />
hier ist auch nach wie vor die erste in der<br />
Öffentlichkeit montierte Fahrtreppe mit den<br />
bunten Stufen im täglichen Einsatz.<br />
Bereits heute liegen Aufträge über fast<br />
200 Fahrtreppen mit den neuartigen Smartstep’s<br />
aus der ganzen Welt vor. In einer<br />
Lübecker Einkaufspassage zum Beispiel<br />
soll es ganz bunt zugehen – die Kundschaft<br />
wird auf Fahrtreppen mit grünen, roten und<br />
blauen Stufen fahren. Ein türkischer Supermarkt<br />
in Istanbul will die Kunden mit der<br />
Nationalfarbe Rot locken, ein Moskauer<br />
Hotel setzt mit „smartsteps“ in Schwarz<br />
und Gelb auf klassischen Schick mit fröhlicher<br />
– und für die Sicherheit sinnvoller –<br />
Farbpointe. In allen Einsatzlagen eröffnet<br />
Smartstep die Möglichkeit, das Corporate<br />
Design eines Gebäudes konsequent bis in<br />
die letzte Treppenstufe zu verfolgen.<br />
Für Fußballspieler, für Kunden von Einkaufszentren<br />
oder für die Belegschaft in<br />
Bürogebäuden ist es ein kleiner und attraktiver<br />
Schritt auf eine farbige Treppenstufe.<br />
Für Architekten, Bauherren und nicht zuletzt<br />
Thyssen Fahrtreppen ist die Entwicklung<br />
der neuen Glasfaserstufe Smartstep ein<br />
kluger und zugleich großer Schritt ins<br />
21. Jahrhundert.
44<br />
Dr. rer. pol. Claus Algenstaedt<br />
„TS Online“ – die Plattform für den elektronischen Geschäftsverkehr<br />
von Thyssen Schulte<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Internet-basierte elektronische Medien sind in immer mehr<br />
Wirtschaftsbereichen stark im Vormarsch. Das gilt zunehmend<br />
auch im Handel (Bild 1)
45<br />
„TS Online“ – die Plattform für den elektronischen Geschäftsverkehr von Thyssen Schulte<br />
1 Ausgangssituation<br />
Mit über 100-jähriger Geschäftstradition<br />
ist Thyssen Schulte heute das führende<br />
Werkstoff-Unternehmen in Deutschland.<br />
Zahlreiche Gesellschaften im In- und Ausland<br />
gehören zum Geschäftsbereich. Der<br />
Jahresumsatz von Thyssen Schulte beläuft<br />
sich auf 5,1 Milliarden DM; es werden mehr<br />
als 6.000 Mitarbeiter beschäftigt.<br />
Als Komplettanbieter von Grund- und<br />
Qualitätsstählen, Stahlrohren, Edelstahl,<br />
NE-Metallen und Kunststoffen – insgesamt<br />
über 120.000 Artikel – ist die Geschäftsstrategie<br />
von Thyssen Schulte auf die<br />
direkte Bearbeitung eines weitgefächerten<br />
Spektrums von Verarbeiter-Kunden in Industrie,<br />
Handwerk und Bauwirtschaft ausgerichtet.<br />
Durch konsequente Investitionspolitik<br />
verfügt Thyssen Schulte in Deutschland<br />
über ein sehr leistungsfähiges System aus<br />
Zentral- und Regionallägern. Dabei kommt<br />
dem Zentrallager Dortmund für Edelstähle<br />
und NE-Metalle ein besonderer Stellenwert<br />
zu (Bild 2). Es gilt als das modernste seiner<br />
Art in Europa.<br />
Ein wichtiges Element, um das reibungslose<br />
Zusammenspiel der Verkaufsabteilungen<br />
– allein über 300 Abteilungen in mehr<br />
als 40 Niederlassungen bei Thyssen<br />
Schulte selbst – mit den Lagerbetrieben zu<br />
Ausbauschritte des Projektes „TS Online“ (Bild 3)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Zentrallager für Edelstahl und NE-Metalle von Thyssen Schulte in Dortmund (Bild 2)<br />
sichern, bildet das Bestandsmanagement<br />
von Thyssen Schulte auf der Basis einer<br />
vernetzten Informationstechnik und Logistik.<br />
Hierdurch sind die Niederlassungen<br />
online in der Lage, die Materialverfügbarkeit<br />
festzustellen und die Dispositionen bei<br />
den Lägern im System von Thyssen<br />
Schulte (Zentrallägern) elektronisch auszulösen.<br />
Über die reine Materialverfügbarkeit und<br />
den schnellen Zugriff hinaus wächst die<br />
Bedeutung ergänzender Dienstleistungen<br />
für Kunden ständig. Dazu zählt vor allem<br />
die Anarbeitung der Werkstoffe nach den<br />
jeweiligen Vorgaben der Kunden. Thyssen<br />
Schulte unterhält eigene leistungsfähige<br />
Service-Center, die in enger logistischer<br />
Verbindung mit den jeweiligen Produktlägern<br />
arbeiten.<br />
2 Projekt „TS Online“<br />
Je stärker das Bedarfsspektrum eines<br />
Kunden differenziert ist, umso flexibler und<br />
leistungsfähiger muss das Angebot des<br />
Handels gestaltet sein. Die zusätzliche<br />
Bereitstellung Internet-basierter elektronischer<br />
Medien als Plattform für Informationen,<br />
Beratung und Austausch von Daten<br />
sowie für Aufträge und die Abwicklung der
46<br />
„TS Online“ – die Plattform für den elektronischen Geschäftsverkehr von Thyssen Schulte<br />
damit verbundenen kommerziellen Prozesse<br />
bietet neue Ansatzpunkte, um Kundenverbindungen<br />
auch zukünftig über den<br />
heute noch dominierenden klassischen<br />
Verkaufsweg hinaus zu pflegen und damit<br />
verbundene Potenziale zu aktivieren. Dieser<br />
„Business to Business“-Ansatz wird von<br />
Thyssen Schulte seit Frühjahr 1999 konsequent<br />
verfolgt.<br />
Ausgangspunkte der Internet-basierten<br />
Geschäftsunterstützung (Projekt „TS Online“,<br />
Bild 3) bilden der vielfältige Informations-<br />
und Kommunikationsbedarf der Kunden<br />
einerseits sowie das arbeitsaufwendige<br />
Anfrage- und Bestellwesen andererseits.<br />
Jährlich werden im Unternehmen etwa<br />
7 Millionen Anfragen, die sich auf ca.<br />
15 Millionen Einzelpositionen addieren, und<br />
2,1 Millionen Aufträge mit 4,8 Millionen<br />
Positionen bearbeitet (ohne Tochtergesellschaften).<br />
Online-Informationen und -Verkauf<br />
haben für die Benutzer den Vorteil, dass<br />
Betriebs- und Öffnungszeiten ihre Bedeutung<br />
verlieren und die Systeme rund um<br />
die Uhr genutzt werden können. Bei gut<br />
konzipierten Systemen entfallen viele der<br />
zeit- und kostenintensive Rückfragen.<br />
Klassische Kundenberatung in einer Niederlassung (Bild 4)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Leistungskomponenten im Lager- und Dienstleistungsgeschäft (Bild 5)<br />
2.1 Kunden nutzen Online-<br />
Katalog<br />
Die erste Stufe im realisierten Ansatz „TS<br />
Online“ bildet der Internet-Auftritt, der den<br />
spezifischen Informationsbedarf über das<br />
weitgefächerte Programm von Thyssen<br />
Schulte regional und artikelbezogen steuert.<br />
Dadurch wird für Interessenten der<br />
wichtige Direktkontakt zu örtlichen<br />
Ansprechpartnern einer Verkaufsabteilung<br />
in seiner Nähe identifiziert. Programm und<br />
Organisation sind also online verfügbar.<br />
Kunden können ihre Anfragen/Aufträge<br />
direkt per E-Mail an die Niederlassung von<br />
Thyssen Schulte senden, ohne das System<br />
zu verlassen.<br />
Über den Online-Katalog hinaus werden<br />
zusätzlich Angebote und werbliche Informationen<br />
aktuell in die Homepage eingestellt.<br />
2.2 Internet-basiertes<br />
Bestellwesen<br />
Die zweite Stufe ist das Kernstück von<br />
„TS Online“. Durch Zugangscode gesichert,<br />
können die Kunden von Thyssen<br />
Schulte sich über die aktuelle Verfügbarkeit<br />
der einzelnen Artikel im Lager (bzw. im zentral<br />
unterstützenden Lagersystem) informieren.<br />
Die Artikelinformation bietet darüber<br />
hinaus die relevanten, kundenindividuellen<br />
Preise (brutto/netto).<br />
Auf dieser Basis besteht die Möglichkeit<br />
– abweichend vom klassischen Muster der<br />
Auftragserteilung – Aufträge elektronisch<br />
über „TS Online“ zu platzieren. Dazu gehören<br />
auch Termin- und Versandvorgaben
47<br />
„TS Online“ – die Plattform für den elektronischen Geschäftsverkehr von Thyssen Schulte<br />
und Bestellung angearbeiteter Produkte<br />
(Zuschnitte etc.).<br />
In dieser Stufe bietet Thyssen Schulte<br />
den Online-Kunden zusätzlich ein umfangreiches<br />
Informationsangebot – Werkstoffinformationen<br />
für Verarbeiter. Dazu gehören<br />
u. a.:<br />
● Informationen über mechanische und<br />
chemische Produkteigenschaften<br />
● grafische Angaben, Darstellungen oder<br />
Maßzeichnungen<br />
● Maße, Gewichte, Umrechnungen (sog.<br />
elektronischer Stahlschieber)<br />
● Verarbeitungshinweise<br />
● Normenvergleiche, d.h. Gegenüberstellungen<br />
auf Basis von DIN- und<br />
EURO-Normen<br />
● Werkstoffauswahl-Programm<br />
Im Zusammenhang mit der elektronischen<br />
Auftragserteilung bzw. Auftragserfassung<br />
entstehen für den Kunden weitere<br />
Vorteile: „TS Online“-Nutzer können sich<br />
elektronisch über den Bearbeitungsstatus<br />
ihrer Aufträge informieren. Dazu gehören<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
die Anzeige der offenen Aufträge mit dem<br />
Status, die Aufgliederung offener Aufträge<br />
mit allen Positionen und Detailinformationen<br />
je Auftragsposition.<br />
Einen anderen wichtigen Aspekt stellt<br />
das elektronische Rechnungsarchiv dar. Es<br />
zeigt die Rechnungen und die Aufgliederung<br />
sowie die Einzelheiten zu den berechneten<br />
Artikeln (Positionen) an. Ferner wird<br />
in Kürze der Zugriff auf das Archiv der Kundenempfangsbestätigungen<br />
zur Verfügung<br />
stehen. Bei allen diesen Informationen liegt<br />
der Kundennutzen auf der Hand – „TS<br />
Online“ stellt die aktuellen Informationen<br />
schnell und ohne Umweg zur Verfügung.<br />
2.3 Online-Support<br />
Nach dem automatischen Bestellwesen<br />
sind weitere Module und Ausbaustufen mit<br />
höherem Dienstleistungsanteil vorgesehen<br />
(vgl. Bild 3). Dabei wird die Individualisierung<br />
der elektronisch unterstützten<br />
Kundenbetreuung durch Thyssen Schulte<br />
verstärkt werden und an auftrags- oder<br />
bedarfsorientierte Hilfestellung (Support)<br />
Ausrichtung von Thyssen Schulte auf Industrie, Handwerk und Bauwirtschaft (Bild 6)<br />
Für Thyssen Schulte typischer Kundenauftrag<br />
(Bild 7)<br />
bzw. andere Formen des Mikro-Marketings<br />
gedacht.<br />
Customer Relationship Management wird<br />
zukünftig immer mehr in den Vordergrund<br />
treten. Das gilt auch für individuelles Kundenmarketing<br />
(Mikro-Marketing).<br />
Längerfristig sind hierfür interaktive<br />
Benutzeroberflächen und Module erforderlich,<br />
um online den Austausch individueller<br />
Informationen zu ermöglichen.<br />
2.4 Online-Regulierung<br />
In einer späteren Stufe wird der Zahlungsverkehr<br />
und die Regulierung in die<br />
elektronisch gesteuerte Prozesskette einbezogen.<br />
Dazu gehören die elektronische<br />
Erstellung bzw. Übermittlung von Lieferscheinen,<br />
Rechnungen und Gutschriften<br />
sowie – besonders wichtig – die elektronische<br />
Regulierung (Abbuchung).<br />
3 Kosteneinsparung<br />
Das Projekt „TS Online“ bietet – trotz<br />
primärer Kundenorientierung – wichtige<br />
Ansatzpunkte für Optimierung und Rationalisierung<br />
im administrativen Bereich. Diese<br />
Chancen ergeben sich aus den enormen<br />
Mengengerüsten, über die Thyssen Schulte
48<br />
„TS Online“ – die Plattform für den elektronischen Geschäftsverkehr von Thyssen Schulte<br />
bei dem jährlich zu bewältigenden Geschäftsvolumen<br />
verfügt (vgl. Abschnitt 2).<br />
Setzt man nach der Einführungsphase<br />
für einen überschaubaren Zeitraum den<br />
Anteil der Online-Bestellungen und die<br />
anteiligen Kosten für die Bearbeitung von<br />
Anfragen, Angeboten und entsprechenden<br />
Arbeiten im Vergleich zu der traditionellen<br />
Auftragsabwicklung vorsichtig an, so ergibt<br />
sich ein Einsparungspotenzial von bis zu<br />
1,5–3 Millionen DM p.a. Die Projektkosten<br />
belaufen sich auf rund 1 Million DM. Als<br />
laufende Kosten müssen etwa 0,2–0,3 Millionen<br />
DM p.a. kalkuliert werden.<br />
Thyssen Schulte geht davon aus, dass<br />
der Geschäftsumfang in den nächsten Jahren<br />
– bei weiter wachsender Marktdurchdringung<br />
– ausgeweitet werden kann. Insoweit<br />
wird „TS Online“ dazu beitragen, dass<br />
der Leistungsumfang im Verkauf und in<br />
den verkaufsnahen Bereichen weiter steigt.<br />
Hannover Messe 2000: Vorstellung von „TS Online“ (Bild 8)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
4 Innovationsgrad<br />
„TS Online“ ist als neuer elektronisch<br />
gesteuerter Informations-, Verkaufs- und<br />
Transaktionskanal gedacht. Das Konzept ist<br />
auf Integration der gesamten Geschäftsabwicklung<br />
ausgerichtet. Insoweit unterscheidet<br />
sich der Ansatz von Thyssen Schulte<br />
konzeptionell deutlich von anderen „Business<br />
to Business“-Ansätzen, die den Verkauf<br />
von Sonderangeboten oder Auktionsgeschäfte<br />
Internet-basiert abwickeln.<br />
Wie dargestellt, ist mit dem elektronisch<br />
gesteuerten Bestellwesen und dessen Weiterentwicklung<br />
im bisher von traditionellen<br />
Organisationsstrukturen geprägten Handelsgeschäft<br />
mit Stahl und anderen Werkstoffen<br />
eine erhebliche Innovation verbunden.<br />
Sie betrifft den gesamten Kommunikations-<br />
und Transaktionsprozess zwischen<br />
den Kunden und Verkaufsabteilungen von<br />
Thyssen Schulte-Niederlassungen.<br />
An Stelle der bislang stark auf persönlichen<br />
Kontakten (Besuche/Telefonate/<br />
Schriftverkehr) aufgebauten und in der<br />
Abwicklung sehr beleg- und betreuungsintensiven<br />
Geschäftsverbindungen treten<br />
zukünftig vermehrt elektronische Datensysteme<br />
mit Online-Verbindungen und<br />
entsprechenden Operationen. Dies wird<br />
längerfristig zu einer erheblichen Veränderung<br />
im Geschäftsverkehr und in der<br />
Kommunikation zwischen den Geschäftspartnern<br />
führen.<br />
5 Neue Herausforderungen<br />
Das Projekt „TS Online“ ist in den Stufen<br />
1 und 2 fertig gestellt (Bild 9) und befindet<br />
sich in der Umsetzung. Im Laufe des Jahres<br />
2000 werden weitere Teilmodule (z.B.<br />
Werkstoffzusatzinformationen) fertig (Bild<br />
10) und zusätzliche Kunden in den Niederlassungen<br />
aufgeschaltet. Darüber hinaus<br />
ist die Vernetzung zu Großkunden aus dem<br />
EDI-Konzept geplant.<br />
Der Vorteil professionell genutzter elektronischer<br />
Transaktionen liegt zweifellos in<br />
dem enormen Gewinn an Zeit und Transparenz<br />
für beide Seiten – Anbieter und Käufer.<br />
Der Kunde erhält in Bruchteilen von<br />
Sekunden seine Informationen; Vergleichsdaten<br />
von Wettbewerbern sind nur noch<br />
„einen Mausklick“ entfernt. Durch „TS Online“<br />
und E-Commerce ist Thyssen Schulte<br />
24 Stunden für Kunden und Interessenten<br />
geöffnet und bietet so die Möglichkeit, rund<br />
um die Uhr Anfragen zu platzieren oder<br />
Aufträge zu buchen.<br />
Unverändert aber gilt: Schnelle Information<br />
und Kommunikation ist die eine Seite<br />
der geschäftlichen Verbindungen, die termintreue<br />
Auslieferung der Waren die andere<br />
Seite. Auch im Online-Zeitalter bleibt die<br />
leistungsfähige Logistik einer der größten
49<br />
„TS Online“ – die Plattform für den elektronischen Geschäftsverkehr von Thyssen Schulte<br />
Geschäftsfunktionen, die „TS Online“ abbildet (Bild 9)<br />
Erfolgsfaktoren für ein Unternehmen, das<br />
wie Thyssen Schulte mit 100.000 Kunden<br />
zusammenarbeitet, damit der Zeitgewinn<br />
aus elektronischen Geschäftsprozessen<br />
nicht bei der Lieferung verloren geht.<br />
Bisher waren Lieferanten-Kunden-<br />
Verbindungen in aller Regel dann am erfolgreichsten,<br />
wenn sie auf langjährigen persönlichen<br />
Kontakten basierten. Zukünftig<br />
wird man – elektronisch vernetzt, quasi in<br />
Selbstbedienung – ohne den persönlichen<br />
Kontakt zum Verkäufer im Innen- oder<br />
Außendienst auf Datenbank-Informationen<br />
Geplante Weiterentwicklung (Bild 10)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
bzw. digitale Vertriebssysteme zurückgreifen<br />
können. Insoweit wird es auch bei<br />
Stahl, Metallen und Kunststoffen durch die<br />
Einführung von Online-Geschäftsverbindungen<br />
zu einer Neugestaltung der Kunden-/Lieferantenbeziehungen<br />
kommen, die<br />
weit über die bloße technische Nutzung von<br />
elektronischen Systemen hinausgeht.<br />
Die zentrale Aufgabe von Verkauf und<br />
Marketing in der Zukunft wird es also sein,<br />
Kundenverbindungen zu erhalten oder neu<br />
zu schaffen, die sich trotz vernetzter<br />
Geschäftsprozesse in der laufenden Tages-<br />
arbeit als trag- und entwicklungsfähig<br />
erweisen. Persönliche Verbindungen zwischen<br />
Geschäftspartnern bleiben auch<br />
zukünftig unverzichtbar, werden aber vielfach<br />
neue Anknüpfungspunkte haben müssen:<br />
Bisher werden Bestellungen oder<br />
Anfragen häufig lieferantenseitig durch persönliche<br />
Kontakte am Telefon oder bei<br />
Besuchen vorbereitet oder begleitet.<br />
Dadurch ist eine laufende Kommunikationsbasis<br />
zum Kunden gegeben.<br />
6 Fazit<br />
Für Thyssen Schulte bedeutet „TS Online“<br />
eine zeitgemäße Optimierung des<br />
Geschäftsmodells und seine Weiterentwicklung,<br />
die für die angestrebte Wertschöpfungspartnerschaft<br />
mit den Verarbeiterkunden<br />
neue Ansatzpunkte eröffnet.<br />
Gegenwärtig ist „TS Online“ als zusätzlicher<br />
Vertriebskanal im Aufbau für Kundenkreise,<br />
die über den klassischen Weg<br />
der Auftragserteilung hinaus eine Zusammenarbeit<br />
durch Nutzung elektronischer<br />
Medien wünschen.<br />
Den Veränderungen durch E-Commerce<br />
kann man als aktiv im Markt stehendes<br />
Handels- und Dienstleistungsunternehmen<br />
nur offensiv begegnen. Dies gilt für Organisationsfragen,<br />
die mit der vernetzten<br />
Datenwelt zusammenhängen, ebenso wie<br />
im weiten Feld der Problemstellung von<br />
Marketing und Verkauf. Thyssen Schulte<br />
hat begonnen, sich im Werkstoffgeschäft<br />
darauf einzustellen.
50<br />
Peter Buderath<br />
Online-Dokumenten-Management-System für Abnahmeprüfzeugnisse<br />
von <strong>ThyssenKrupp</strong> Stahlunion<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Bildschirmmaske für das weltweit eingesetzte „Information<br />
System Certificates“-System von <strong>ThyssenKrupp</strong> Stahlunion<br />
an einem Arbeitsplatz im <strong>ThyssenKrupp</strong> Trade Center,<br />
Düsseldorf (Bild 1)
51<br />
1 Einleitung<br />
Online-Dokumenten-Management-System für Abnahmeprüfzeugnisse von <strong>ThyssenKrupp</strong> Stahlunion<br />
Produktion, Distribution und Verarbeitung<br />
von Werkstoffen ist ein facettenreiches<br />
Geschäft: Allein Edelstahl umfasst 500<br />
Güten und bietet heute eine nahezu unübersehbare<br />
Vielfalt von Verwendungsmöglichkeiten.<br />
Und dabei sind Stahl und andere<br />
Werkstoffe stets nur Vorprodukte. Massengefertigt<br />
in High-Tech-Werken, exportiert<br />
nach Europa oder Übersee, sind Werkstoffe<br />
die Basis für die Verarbeitung in Handwerk<br />
und Industrie. Gleichzeitig wächst der Anteil<br />
der Dienstleistungen immer mehr, die von<br />
Handelsunternehmen in Verbindung mit<br />
Werkstofflieferungen für Verarbeiterkunden<br />
angeboten werden. Im Mittelpunkt dieser<br />
Dienstleistungen steht die Anarbeitung mit<br />
einer breiten Palette von Zuschnitt-Leistungen<br />
nach Kundenwunsch. In zunehmendem<br />
Maße wird auch die Oberflächenbehandlung<br />
vom Handel dienstleistend<br />
bearbeitet.<br />
Der gesamte Prozess der Herstellung und<br />
Distribution von Stahl oder Metallen unterliegt<br />
der Qualitätssicherung und wird von<br />
ständigen Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen<br />
begleitet. Von besonderer<br />
Bedeutung für die Rückverfolgbarkeit ist<br />
Gabriele Kübler betreut im <strong>ThyssenKrupp</strong> Trade<br />
Center das Online-Dokumenten-System (Bild 2)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Verladung von Coils im Hafen von Duisburg-Schwelgern (Bild 3)<br />
dabei das Abnahmeprüfzeugnis (Inspection<br />
Certificate) – der „Personalausweis“ für<br />
jedes erzeugte Produkt oder – noch konkreter<br />
– für jede einzelne Charge. Es begleitet<br />
den jeweiligen Werkstoff vom Hersteller<br />
über das Verkaufsbüro des Händlers,<br />
die Anarbeitung im Lager bis hin zum<br />
Verarbeitungsbetrieb des Kunden irgendwo<br />
in der Welt. Nur mit dieser lückenlosen Dokumentation<br />
sind Hersteller, Händler und<br />
Verarbeiter stets darüber im Bilde, welchen<br />
Werkstoff sie exakt verwenden oder in die<br />
nächste Produktionsstufe schleusen.<br />
Die <strong>ThyssenKrupp</strong> Stahlunion (TKSU) mit<br />
einem weltumspannenden Netz an Gesellschaften<br />
und Vertretungen und einem<br />
Jahresumsatz von gut 6 Milliarden DM<br />
benötigt jährlich Zehntausende von Werkzeugnissen,<br />
die verwaltet, weitergeleitet<br />
und archiviert werden müssen. Zur Optimierung<br />
der Geschäftsprozesse im Bereich<br />
der Werkszeugnisse, die hier häufig mehrere<br />
Unternehmensteile im In- und Ausland<br />
gleichzeitig betreffen, einerseits und zur<br />
Pflege von Kundenverbindungen andererseits<br />
hat TKSU in Düsseldorf ein neues<br />
Dokumenten-Archivierungs-Management-<br />
System auf Basis der Internet-Technologie<br />
entwickelt und seit einiger Zeit erfolgreich<br />
in der weltweiten Organisation des Unternehmens<br />
eingeführt.<br />
2 Identifikation durch Abnahmeprüfzeugnisse<br />
Mit der Freigabe eines Stahlproduktes<br />
zum Verkauf durch ein Werk erfolgt auch<br />
die Bereitstellung einer Prüfungsbescheinigung<br />
nach DIN EN 10204. Unter diesen<br />
Sammelbegriff fallen Werksbescheinigungen,<br />
Werks[prüf]zeugnisse, Abnahmeprüfzeugnisse<br />
und Abnahmeprüfprotokolle.<br />
Das Abnahmeprüfzeugnis – im Folgenden<br />
wird synonym auch der Begriff „Werkszeugnis“<br />
verwendet – enthält alle wesentlichen<br />
Informationen über das gelieferte
52<br />
Online-Dokumenten-Management-System für Abnahmeprüfzeugnisse von <strong>ThyssenKrupp</strong> Stahlunion<br />
Kontrolle von Abnahmeprüfbescheinigungen bei TKSU, Düsseldorf (Bild 4)<br />
Produkt. Dazu gehören – neben der<br />
Adresse des Produzenten – unter anderem<br />
Chargenummer, Schmelzenummer, Zusammensetzung<br />
des Werkstoffes und<br />
natürlich die Mengenangabe der betreffenden<br />
Charge.<br />
Hersteller und Händler sind verpflichtet,<br />
ein Werkszeugnis gemeinsam mit der Ware<br />
zur Verfügung zu stellen. Und dies „just in<br />
time“. Das Einzige, was danach im Distributionsprozess<br />
einer Charge an einem<br />
Werkszeugnis verändert werden darf, ist die<br />
Adresse und die Mengenangabe, für die<br />
das neue „Teil“- Werkszeugnis gilt. Dies gilt<br />
typischerweise für Handelsaktivitäten,<br />
wenn eine Partie (Charge) in Teilmengen an<br />
mehrere Kunden verkauft wird oder wenn<br />
eine Charge durch Anarbeitung im<br />
Zuschnittdienst des Handels in kleine<br />
Abschnitte zerlegt wird bzw. in einem weiter<br />
verwendbaren Reststück zurück ins Lager<br />
geht.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Arbeitsvorbereitung am Bildschirmarbeitsplatz (Bild 5)<br />
3 Archivierung ist Pflicht<br />
Auf Abnahmeprüfzeugnisse als Dokumente<br />
muss über einen längeren Zeitraum<br />
immer wieder ohne Probleme zurückgegriffen<br />
werden können, dies schon allein aus<br />
Gründen der Gewährleistung, Garantie und<br />
Produkthaftung. Sie müssen daher bis zu<br />
zehn Jahren im In- und Ausland aufbewahrt<br />
werden. In der Vergangenheit erfolgten<br />
Verwaltung und Archivierung der<br />
Abnahmeprüfzeugnisse bei TKSU – wie<br />
branchenüblich – manuell. Konkret bedeutete<br />
dies: Tausende von Werkszeugnissen<br />
wurden jeweils von Hand – soweit zulässig<br />
– neu ausgefüllt und weltweit per Post verschickt.<br />
Vor einigen Jahren begann man<br />
bei den TKSU-Landesgesellschaften damit,<br />
Werkszeugnisse zu scannen und als E-Mail<br />
zu versenden. Ablage und ein wachsendes<br />
„Papierarchiv“ einschl. der Bearbeitung<br />
und Pflege durch Mitarbeiter blieben jedoch<br />
weiterhin überall das Problem.
53<br />
Online-Dokumenten-Management-System für Abnahmeprüfzeugnisse von <strong>ThyssenKrupp</strong> Stahlunion<br />
4 Das Internet als TKSU-<br />
Technologieplattform<br />
Um dem bei steigendem Geschäftsumfang<br />
parallel zunehmenden Verwaltungsaufwand<br />
im Bereich der Werkszeugnisse<br />
hier und anderswo Herr zu werden, wurde<br />
in den letzten Jahren vielfach versucht,<br />
hierfür Dokumenten-Management-Systeme<br />
einzuführen. Im Stahlgeschäft wurden<br />
dabei einige Erfolge erzielt. Allerdings<br />
waren die Systeme herstellerabhängig; es<br />
konnte sich kein branchenübergreifender<br />
Standard etablieren. Die Folge waren<br />
Insellösungen, teilweise mit dem zusätzlichen<br />
Nachteil, dass sie nur in einem<br />
bestimmten Land einsatzfähig waren. Um<br />
einen solchen Zustand inkompatibler Dokumentensysteme<br />
im TKSU-Geschäftsbereich<br />
zu verhindern, entwickelte man in der<br />
TKSU-Zentrale eine eigene, herstellerunabhängige,<br />
weltweit einsatzfähige Lösung für<br />
Werkszeugnisse.<br />
Ziel dieses firmeneigenen globalen Dokumenten-Management-Systems<br />
war es,<br />
Abnahmeprüfzeugnisse für alle TKSU-<br />
Gesellschaften im In- und Ausland rund um<br />
die Uhr online verfügbar zu haben. Das<br />
Formrahmen für die Kunststofftechnik aus Thyroplast-Werkstoff 2312, hergestellt<br />
im Kundenauftrag von Thyssen France, und Reststücke der Charge<br />
(Bild 7)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Kontrolle von Werkzeugstahl-Zuschnitten in einem Handelslager (Bild 6)<br />
„World-Wide-Web“ mit seinen grenzübergreifenden<br />
Möglichkeiten bietet dafür eine<br />
hervorragende Technologieplattform. Die<br />
Vorteile für eine weltumspannende Verkaufsorganisation<br />
liegen auf der Hand: Ein<br />
vor Missbrauch geschütztes Online-Dokumentensystem<br />
auf Internet-Basis ist ständig<br />
und ohne Rücksicht auf Zeitzonen und<br />
variable Feiertage verfügbar, leicht zu<br />
bedienen und kostengünstig in der Abwicklung.<br />
4.1 Im Mittelpunkt der zentrale,<br />
weltweit zugängliche Internet-<br />
Server<br />
Voraussetzung war, dass in der Zentrale<br />
der Gesellschaft im <strong>ThyssenKrupp</strong> Trade<br />
Center in Düsseldorf ein weltweit zugänglicher<br />
Internet-Server neuester Technologie<br />
installiert wurde. Auf diesem Server sind<br />
inzwischen die Abnahmeprüfzeugnisse<br />
nahezu aller TKSU-Landesgesellschaften<br />
mit den erforderlichen Suchkriterien in<br />
einer Datenbank hinterlegt. Sie wird von
54<br />
Online-Dokumenten-Management-System für Abnahmeprüfzeugnisse von <strong>ThyssenKrupp</strong> Stahlunion<br />
der TKSU-Abteilung ORG DV überwacht.<br />
Der mit Firewalls und separaten Ports<br />
abgesicherte Zugang erfolgt per Benutzerkennung<br />
über die Homepage der Thyssen-<br />
Krupp Stahlunion (www.thyssenkruppstahlunion.de).<br />
Die Abnahmeprüfzeugnisse der Hauptlieferanten<br />
– die Konzerngesellschaften<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> Stahl, Edelstahlwerke Witten<br />
Krefeld und Krupp Thyssen Nirosta – werden<br />
ab Werk im PDF-Bildformat geliefert<br />
und sind damit für den Anwender im elektronischen<br />
Originallayout verfügbar. Ein<br />
ausgeklügeltes System von Suchbegriffen<br />
ermöglicht es, dass eine integrierte Suchmaschine<br />
jedes Dokument schnell findet<br />
und für jede Form der Übernahme (Druck,<br />
Downloads etc.) am Arbeitsplatz irgendwo<br />
in der Welt zur Verfügung stellt. Die Weiter-<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
leitung kann auch per E-Mail erfolgen.<br />
Im neuen TKSU-Dokumenten-Management-System<br />
wurden kostenfreie Internet-<br />
Standardtools, wie der Microsoft Internet<br />
Explorer, der Netscape Navigator (beides<br />
Browser) oder der Acrobat Reader (Software<br />
zum Öffnen von PDF-Dateien), eingesetzt.<br />
Sie ermöglichen eine komfortable<br />
Bedienung sowie leichte Navigation für die<br />
weltweit im System arbeitenden Mitarbeiter.<br />
Sprachprobleme sind nicht gegeben, da<br />
der Browser für die Umsetzung in die jeweilige<br />
Landessprache sorgt.<br />
Die Etablierung in der TKSU-Auslandsorganisation<br />
wurde dadurch erleichtert, dass<br />
die an den Arbeitsplätzen vorhandene<br />
Infrastruktur und die Internet-Zugänge<br />
genutzt werden konnten.<br />
Plasmageschnittene Edelstahl-Bleche von Thyssen France, Güte ASTM 240 316 L, Charge 782677 (Bild 8)<br />
4.2 Der Mehrwert für den<br />
Anwender<br />
Durch die Bereitstellung eines solchen<br />
Internet-Services wird der gesamten TKSU-<br />
Organisation – und somit auch dem Kunden<br />
– ein erheblicher Nutzen geboten: Die<br />
unmittelbare Zustellung von Werkszeugnissen<br />
ist grenzübergreifend und ohne Zeitverzögerung<br />
möglich. „Just in time“ bedeutet<br />
in diesem Fall sogar, dass das Zertifikat<br />
noch vor der Anlieferung des Werkstoffes<br />
bei einem Kunden im Ausland sein kann.<br />
Mit diesem Zeitgewinn kann der TKSU-<br />
Kunde hausintern weiter disponieren!<br />
Das TKSU-Dokumenten-Management-<br />
System für Abnahmeprüfzeugnisse bietet<br />
darüber hinaus weitere wichtige Vorteile:<br />
Technik<br />
● Sicherheit durch modernste Firewall- und<br />
Verschlüsselungstechnologie<br />
● Hard- und Software-Unabhängigkeit<br />
durch Standardlösungen<br />
Handling<br />
● Einfachste Bedienung<br />
● Fehlerreduktion bei der Eingabe<br />
● „Just in time“-Zustellung<br />
● Leichte Übernahme von Altdatenbeständen<br />
aus früheren „Insellösungen“<br />
● Archivierung landes- und gesellschaftsübergreifend<br />
je nach Bedarf<br />
Einsparung im Vergleich zu Insel-<br />
Lösungen der TKSU-Gesellschaften,<br />
● Geringerer Personalaufwand<br />
● Geringerer Wartungsaufwand<br />
● Geringerer Investitionsaufwand<br />
● Niedriger Papierverbrauch sowie Entfall<br />
des „Papierarchivs“ zu Gunsten von<br />
wenigen Backup-CD-ROM (außerhalb<br />
Server-Archivierung)
55<br />
Online-Dokumenten-Management-System für Abnahmeprüfzeugnisse von <strong>ThyssenKrupp</strong> Stahlunion<br />
Produktion von Waschmaschinen-Trommeln aus nichtrostendem Stahl (Bild 9)<br />
5 Kosteneinsparungen<br />
Durch eine einmalige Investition in Höhe<br />
von 60.000 DM in einen zentralen Internet-<br />
Server mit integrierter Datenbank konnten<br />
Einzelinvestitionen für Individual-Lösungen<br />
der TKSU-Landesgesellschaften von jeweils<br />
Archivierungskosten verschiedener Archivierungssysteme (Bild 10)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
60.000 DM (inklusive Projektabwicklung)<br />
vermieden werden. Allein bei den zehn<br />
europäischen Landesgesellschaften<br />
ergibt sich dadurch eine Einsparung von<br />
600.000 DM.<br />
Was die Kosten je Werkszeugnis (Dokument)<br />
betrifft, so ist die Einsparung men-<br />
genabhängig: Je mehr Dokumente in das<br />
System eingestellt werden, desto günstiger<br />
ist der Stückpreis. Hier greift also der „Solidareffekt“<br />
im Geschäftsbereich TKSU. Im<br />
neuen System kostet die elektronische<br />
Archivierung pro Werkszeugnis und Monat<br />
maximal 10 Pfennige oder durchschnittlich<br />
1,20 DM pro Werkszeugnis/Jahr (Bild 10).<br />
6 Schlussbemerkungen<br />
Mit der Implementierung des Online-<br />
Dokumenten-Management-Systems für<br />
Abnahmeprüfzeugnisse wurde die erste<br />
Phase des TKSU-Internet-Services realisiert.<br />
Damit wurde eine Plattform geschaffen,<br />
um auch weitere organisatorische<br />
Abläufe weltweit zu standardisieren und die<br />
Prozesskette – Hersteller, Händler und<br />
Kunde – weiter zu optimieren (workflow-<br />
Prozesse). Unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten<br />
ist kurzfristig geplant, weitere aufbewahrungspflichtige<br />
Geschäftsdokumente<br />
zu archivieren und zu bearbeiten, zum Beispiel<br />
Rechnungen.<br />
Geplante Ausbaustufen sind:<br />
● Einbeziehung weiterer Lieferanten aus<br />
dem Stahlgeschäft der TKSU in das<br />
Dokumentensystem<br />
● Anbindung von SAP R/3-Systemen; Ausdruck<br />
des Werkszeugnisses direkt im<br />
SAP-System vor Ort<br />
● Erweiterung des Benutzerkreises: Einbeziehung<br />
zusätzlicher Gesellschaften von<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> Werkstoffe<br />
● Verstärkung der Leistungsfähigkeit des<br />
Dokumentensystems im Bereich Archivierung<br />
in Richtung auf „business to<br />
business“-Management-Lösungen
56<br />
Dr.-Ing. Holger Lieberwirth<br />
Innovative Lösungen für den Abraumtransport in einem<br />
Kupfer- und Goldtagebau<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Der semimobile Absetzer in 4.000 m Höhe kurz vor<br />
dem Einsatz (Bild 1)
57<br />
Innovative Lösungen für den Abraumtransport in einem Kupfer- und Goldtagebau<br />
1 Grasberg – der größte Goldtagebau<br />
der Welt<br />
Mit dem Aufschluss des Tagebaus Grasberg<br />
auf Irian Jaya (Indonesien) durch<br />
Freeport McMoRan Copper & Gold begann<br />
der Abbau eines der reichsten Gold- und<br />
Kupfervorkommen der Welt. 1998 war<br />
Freeport mit 88 t weltgrößter Goldproduzent.<br />
Der Tagebau liegt in einer der auch heute<br />
noch abgeschiedensten Gegenden der Welt<br />
in den Bergen von Irian Jaya in der Nähe<br />
des 3. Breitengrades südlich des Äquator<br />
auf einer Höhe von ca. 4.000 m über NN.<br />
Die klimatischen Bedingungen sind durch<br />
Temperaturen zwischen 0 °C und 15 °C,<br />
regelmäßige schlechte Sichtverhältnisse<br />
durch Nebel und erhebliche Niederschlagsmengen<br />
(ca. 11.000 mm/a) gekennzeichnet<br />
(Bild 2).<br />
Für Transport und Montage war zu<br />
beachten, dass die Transportabmessungen<br />
der Einzelteile auf Grund von zu passierenden<br />
Tunneln extrem limitiert waren. So<br />
mussten die Ringsegmente der Brecher in<br />
Halbschalen geteilt werden, und die Stahlkonstruktion<br />
des Fachwerkauslegers vom Absetzer musste nicht nur quer sondern<br />
auch längs in Segmente zerlegt werden.<br />
Besondere Anforderungen an die Montage<br />
stellte das Verbinden der ebenfalls in Segmenten<br />
anzuliefernden Plattform der Transportraupe.<br />
Hier mussten auf einer Höhe<br />
von 4.000 m über NN bis zu 60 mm dicke<br />
Platten verschweißt werden.<br />
Luftaufnahme des Tagebaus (Bild 2)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Gesamtansicht Brecher 6 (Bild 3)<br />
2 Kontinuierliches Fördersystem<br />
für den Abraum<br />
Durch den Aufschluss des Grasberg-<br />
Tagebaus konnte die Erzförderung von<br />
Freeport von 22.000 t/d auf derzeit<br />
250.000 t/d erhöht werden. Die nächste<br />
Erweiterung ist bereits geplant. Bei einem<br />
Abraum: Nutzmineral-Verhältnis von 3:1<br />
ergeben sich erhebliche Abraummengen,<br />
die täglich zu fördern sind. Während Freeport<br />
sich für die Erzförderung bereits vor<br />
einiger Zeit für kontinuierliche Fördersysteme<br />
entschieden hatte – mit Brecher 5 wurde<br />
die erste semimobile Anlage 1994 in<br />
Betrieb genommen, mit Brecher 6 (Bild 3)<br />
folgte die zweite semimobile Anlage 1998 –,<br />
wurden die erheblichen Abraummengen<br />
nach wie vor mit diskontinuierlichen Systemen<br />
transportiert.<br />
Mit zunehmender Täufe des Tagebaus<br />
wurde dieses Verfahren zunehmend unwirtschaftlich.<br />
Deshalb entschied man sich im
58<br />
Innovative Lösungen für den Abraumtransport in einem Kupfer- und Goldtagebau<br />
Hauptparameter des Fördersystems (Bild 4)<br />
Band- Achs- Hub Installierte Gurtbreite Förder<br />
anlage Nr. abstand Antriebs- geschwinleistung<br />
digkeit<br />
Jahr 1997 zur Installation eines kontinuierlichen<br />
Fördersystems für den Abraum. Dieses<br />
System besteht aus einer semimobilen<br />
Brechanlage mit einem Kreiselbrecher<br />
63-114, drei Bandanlagen, semimobilem<br />
Absetzer und Transportraupe T1250.<br />
Das System übertrifft in vielen Parametern<br />
bisher auf der Welt errichtete vergleichbare<br />
Anlagen. Der Kreiselbrecher ist<br />
mit dem weitgehend baugleichen Brecher 6<br />
der größte im Betrieb befindliche Brecher<br />
dieses Typs auf der Welt. Die Transportraupe<br />
übertrifft die Tragfähigkeit der größten bisher<br />
gelieferten Transportraupe um ca.<br />
50 %. Mit dem System werden stündlich bis<br />
zu 10.000 t Abraum auf eine bandtransportfähige<br />
Stückgröße zerkleinert und von<br />
ca. 3.800 m auf eine Höhe von 4.000 m<br />
gefördert. Weitere Hauptparameter des<br />
Fördersystems sind in Bild 4 angegeben.<br />
3 Kostenoptimierung durch einen<br />
semimobilen Absetzer<br />
Der Absetzer mit einer Gesamtlänge von<br />
160 m verstürzt mit Hilfe seines 127 m langen<br />
Abwurfauslegers den Abraum in eine<br />
Tiefe von 400 m. Dabei ragt dieser Ausleger<br />
bis zu 80 m über die Böschungskante<br />
hinaus und ist extremen Windbelastungen,<br />
u.a. gefährlichen Aufwinden, ausgesetzt<br />
(Bild 5).<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
m m kW m m/s<br />
200 49 5 4 x 600 2,134 3,81<br />
201 789 138 4 x 1566 2,134 3,81<br />
202 553 29 2 x 1118 2,134 3,81<br />
Angesichts dieser Haldenhöhe kann der<br />
Absetzer von einer Position aus relativ<br />
lange kippen, ohne zu schwenken oder<br />
verfahren zu werden. Deshalb entschloss<br />
sich der Kunde zur kostengünstigen<br />
Lösung des semimobilen Absetzers. Dieser<br />
verfügt weder über ein eigenes Schwenkwerk<br />
noch über ein eigenes Fahrwerk.<br />
Stattdessen stützt sich der Oberbau auf ein<br />
Portal ab, unter das eine Transportraupe<br />
fahren kann, um den Absetzer zu bewegen.<br />
Bedingung für die Wirtschaftlichkeit dieses<br />
Konzeptes war, dass der Absetzer die<br />
für das Versetzen der Brechstationen erfor-<br />
Semimobiler Absetzer (Bild 5)<br />
derliche Tragfähigkeit der Transportraupe<br />
nicht überschreitet. Um dies zu erreichen,<br />
wurde die gesamte Tragkonstruktion des<br />
Abwurfauslegers in einer leichten Rohrkonstruktion<br />
gestaltet, die mit Seilen horizontal<br />
und vertikal verspannt wurde (Bild 6). Die<br />
Gestaltung der recht komplizierten Schnittstellen<br />
der Tragwerksstöße wurde dreidimensional<br />
mittels CAD vorgenommen.<br />
Insgesamt konnte eine Gewichtsersparnis<br />
von ca. 50 % gegenüber Absetzern vergleichbarer<br />
Leistung und Auslegerlänge mit<br />
Fahrwerk, Schwenkwerk und Beladebrücke<br />
erzielt werden. Von dieser Gewichtsreduktion<br />
hat der Kunde selbstverständlich profitiert,<br />
indem er einen entsprechend günstigeren<br />
Preis erzielen konnte. Darüber hinaus<br />
ist zu beachten, dass durch dieses<br />
neue Konzept die Betriebs- und Wartungsanforderungen<br />
und mithin die Betriebskosten<br />
des Absetzers deutlich niedriger sind,<br />
als bei vergleichbaren Geräten. Der Betrieb<br />
des Absetzers erfolgt durch den Operator<br />
des Gesamtsystems vom Leitstand des<br />
Brechers aus.
59<br />
Innovative Lösungen für den Abraumtransport in einem Kupfer- und Goldtagebau<br />
4 Einsatzbedingungen und Konzept<br />
der Transportraupe<br />
Der Absetzer wird von einer Transportraupe<br />
mit einer nominellen Tragfähigkeit<br />
von 1.250 t bewegt (Bild 7). Da diese auch<br />
zum Versetzen älterer Brechanlagen eingesetzt<br />
werden soll, war es erforderlich, die<br />
Außenkonturen auch an die freien Querschnitte<br />
der vorhandenen Systeme anzupassen.<br />
So entstand eine sehr kompakte Transportraupe<br />
mit extremer Tragfähigkeit.<br />
Während die größte bisher gebaute Transportraupe<br />
mit einer Tragfähigkeit von 850 t<br />
eine Bauhöhe von 2.720 mm hatte, ist die<br />
neue Raupe nur um 180 mm höher. Demgegenüber<br />
sind die installierte Motorleistung<br />
und der Kettenzug etwa doppelt so<br />
hoch.<br />
Diese extreme Leistungskonzentration<br />
stellte besondere Anforderungen an die<br />
Gestaltung aller Fahrwerkskomponenten,<br />
insbesondere auch des Antriebes.<br />
Transportraupe T1250 (Bild 7)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Abgespannter Fachwerkausleger des Absetzers (Bild 6)<br />
5 Zusammenfassung<br />
Mit der Inbetriebnahme des kontinuierlichen<br />
Fördersystems für Abraum im Tagebau<br />
Grasberg wurde ein weiterer Meilenstein<br />
in der Entwicklung kontinuierlicher<br />
Gewinnungssysteme für Erztagebaue<br />
gesetzt. Insbesondere die Lieferung des<br />
ersten semimobilen Absetzers verdeutlicht,<br />
wie sich kontinuierliche Fördersysteme<br />
optimal an natürliche Gegebenheiten<br />
anpassen lassen und hierdurch sogar<br />
Kostenvorteile für den Betreiber zu erzielen<br />
sind.<br />
Die nächste Erweiterung des Tagebaus<br />
befindet sich bereits in der Planung.<br />
Literatur<br />
● George A. Mealey, Grasberg,<br />
Freeport McMoRan Copper & Gold, 1996<br />
● Luftaufnahme PT Freeport Indonesia,<br />
1999
60<br />
Linda Frederick, B. Comm<br />
Öko-Schiffsbelader von Krupp Canada<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Der Öko-Schiffsbelader in Collahuasi, Chile, spart Kosten und schützt<br />
die Umwelt (Bild 1)
61<br />
1 Einleitung<br />
Öko-Schiffsbelader von Krupp Canada<br />
Der Schutz der Umwelt ist auch bei den<br />
Betreibern von Hafenanlagen ein ernsthaftes<br />
Anliegen. Diese haben ein großes Interesse,<br />
Lösungen zu finden, welche die<br />
Verunreinigung der Luft und das Verschütten<br />
von Material vermeiden helfen. Hinzu<br />
tritt der Kostenaspekt, denn verschüttetes<br />
und damit verlorenes Material kosten Geld,<br />
welches eingespart werden könnte.<br />
Der Exporthafen der Compañia Minera<br />
Doña Inés de Collahuasi in Caleta Patache,<br />
65 Kilometer südlich von lquique gelegen,<br />
ist für eine Kapazität von bis zu einer Million<br />
Tonnen Kupferkonzentrat pro Jahr ausgelegt.<br />
Das Konzentrat ist potenziell schädlich<br />
für die Meeresflora und -fauna. Daher<br />
kommt dem Umweltschutz höchste Priorität<br />
zu.<br />
Ausleger des Öko-Schiffsbeladers (Bild 2)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Blick in das Innere des Auslegers (Bild 3)<br />
2 Traditionelles Konzept<br />
Kritisches Element der Konstruktion<br />
eines Schiffsbeladers ist der Ausleger,<br />
welcher über den Schiffsrand hinaus bis zu<br />
den Luken reichen muss. Insbesondere die<br />
Reichweite, aber auch das Gewicht und die<br />
sonstigen Komponenten, bestimmen die<br />
konstruktiven und statischen Anforderun-<br />
gen an die Tragkonstruktion des Schiffsbeladers.<br />
Folglich ist das Gewicht des Auslegers<br />
entscheidend für die Auslegung des<br />
gesamten Systems.<br />
Übliche Praxis ist es daher, den freitragenden,<br />
heb- und senkbaren, schwenkbaren<br />
und verfahrbaren Ausleger als leichte<br />
Fachwerkkonstruktionen auszubilden. Zum<br />
Umwelt- und Materialschutz wird dieser<br />
Ausleger dann traditionell mit seitlicher Verkleidung,<br />
Bandabdeckung und Materialauffang-<br />
und Waschvorrichtung ausgestattet.<br />
Diese traditionelle Bauweise kann jedoch<br />
das Verschütten von Material nicht vollständig<br />
ausschließen.<br />
Die Aufgabe für Krupp Canada, Calgary,<br />
bestand darin, einen Schiffsbelader zu entwickeln<br />
und zu bauen, der das Verschütten<br />
von Kupferkonzentrat ins Meer nicht nur<br />
minimiert, sondern absolut unmöglich<br />
macht.
62<br />
Öko-Schiffsbelader von Krupp Canada<br />
3 Neues Konzept von Krupp<br />
Canada<br />
Krupp Canada entschied sich, völlig<br />
neue Wege zu gehen. Der Ausleger wurde<br />
als Ganzes in völlig geschlossener, staubdichter<br />
Röhrenform ausgeführt, wobei die<br />
Röhre alle mechanischen Funktionen des<br />
Auslegers erfüllt und gleichzeitig als tragendes<br />
Bauteil fungiert (Bilder 2 und 3).<br />
Als begleitende Maßnahme zur Sicherstellung<br />
der Umweltaspekte wurde der<br />
Ausleger mit einer Staubsaugvorrichtung<br />
versehen, mit der während der Wartungsperioden<br />
das Innere des Auslegers gereinigt<br />
werden kann.<br />
Zur besseren Verteilung des Materials im<br />
Laderaum des Schiffes wird eine Planierraupe<br />
mittels einer Winde, die am Ausleger<br />
des Schiffsbeladers angebracht ist, in den<br />
Laderaum heruntergelassen. Um zu verhindern,<br />
dass beim Wiederherausholen der<br />
Raupe verschüttetes Material ins Meer fällt,<br />
wurde eine Auffangvorrichtung unterhalb<br />
der Raupe vorgesehen.<br />
Gesamtansicht des Öko-Schiffsbeladers (Bild 5)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
<strong>Technische</strong> Daten der Anlage (Bild 4)<br />
Eine weitere strikte Anforderung an die<br />
Konstruktion des Schiffsbeladers stellte die<br />
Forderung nach einer erdbebensicheren<br />
Ausführung dar, auch in einem solchen<br />
Falle muss die Umweltschutzfunktion<br />
gewährleistet sein.<br />
Die technischen Daten der Anlage sind in<br />
Bild 4 aufgeführt.<br />
Krupp Canadas Öko-Schiffsbelader ging<br />
Ende 1998 in Betrieb. Durch diese Neuentwicklung<br />
eines völlig abgeschlossenen<br />
Systems sind sowohl die Gesichtspunkte<br />
des Stahlbaus, die zum Beladen verschiedener<br />
Schiffsgrößen erforderlichen Funktionen<br />
des Schiffsbeladers, als auch der ökologische<br />
Effekt in gelungener Weise vereint.<br />
Die Meeresumwelt wird nicht durch mögliche<br />
Gefahrstoffe beeinträchtigt, und der<br />
Betreiber erfährt Kosteneinsparungen, da<br />
ihm kein Material verloren geht und sich<br />
das Reinigen der Maschine mit dem Staubsaugsystem<br />
einfach bewerkstelligen lässt.<br />
Das Konzept kommt auf dem Markt an,<br />
der Beweis ist die Erteilung eines weiteren<br />
Auftrags für einen Öko-Schiffsbelader,<br />
dieses Mal für Koks, für das Projekt Hovensa<br />
auf den Virgin Islands.
63<br />
Dr.-Ing. Holger Thielert<br />
Automatisierung und Optimierung von Gasreinigungsanlagen<br />
mit GasControl<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Gasreinigungsanlage (Bild 1)
64<br />
1 Einleitung<br />
Automatisierung und Optimierung von Gasreinigungsanlagen mit GasControl<br />
Höhere Anforderungen an die Umweltverträglichkeit<br />
und die Forderung nach<br />
geringerem Energieverbrauch verfahrenstechnischer<br />
Anlagen können nur durch<br />
optimal ausgelegte und automatisierte<br />
Anlagen erfüllt werden. Der internationale<br />
Wettbewerb erfordert immer bessere<br />
Qualität bei gleich bleibenden Investitionskosten.<br />
Das GasControl-System wurde weltweit<br />
erstmalig entwickelt, um den komplexen<br />
Betrieb von Gasreinigungsanlagen im<br />
Bereich der Kokereitechnik zu automatisieren<br />
und zu optimieren. Es wurde bereits auf<br />
zwei Anlagen installiert und wird seit ca.<br />
einem Jahr in industrieller Anwendung<br />
erprobt. Der modulare Aufbau und die Verwendung<br />
von kommerzieller Standardsoftware<br />
gewährleisten die Übertragbarkeit auf<br />
Chemie-/Petrochemieanlagen aller Art. Das<br />
GasControl-Konzept erlaubt somit flexibel<br />
die Automatisierung auch schwierigster<br />
verfahrenstechnischer Prozesse und eröffnet<br />
neue Möglichkeiten der Prozessoptimierung/Kosteneinsparung.<br />
Alte Anlagen<br />
lassen sich mit vertretbarem Aufwand<br />
mit dem System nachrüsten.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Die Nutzung neuer Informationstechnologien<br />
und der globalen Vernetzung ermöglicht<br />
die Prozesssteuerung/-analyse auch<br />
aus der Ferne. Es ist somit möglich, dem<br />
Anlagenbetreiber Online-Unterstützung in<br />
Bezug auf die Prozessführung direkt vom<br />
Anlagenplaner anzubieten. Beispielsweise<br />
kann ein Chemiebetrieb in Italien vom<br />
Know-how-Zentrum in Bochum überwacht<br />
und optimiert werden. Eine Inbetriebnahmeunterstützung<br />
kann ebenfalls gegeben<br />
werden. Der Support (Wartung, Beratung,<br />
Optimierung, Problemlösung) in Form von<br />
Dienstleistungsverträgen ist ein weiterer<br />
Vorteil, der die Palette der Betreuung des<br />
Endkunden abrundet.<br />
GasControl leistet einen wertvollen Beitrag<br />
zur Erweiterung des Prozessverständnisses,<br />
zu frühzeitiger Fehlererkennung und<br />
optimalem Betrieb. Die Operatorschulung<br />
am prozessnahen Simulator ist ein weiterer<br />
Nutzen des Systems.<br />
2 Ziele und Vorteile<br />
Betriebsfahrweise mit Labor-Analytik (Bild 2a) Betriebsfahrweise mit GasControl (Bild 2b)<br />
Das GasControl-System hat folgende<br />
Zielsetzungen und Vorteile:<br />
● Prozessoptimierung im Hinblick auf<br />
Energieverbrauch, Umweltbelastung,<br />
Kosten etc.<br />
● Optimale, kostengünstige Prozessregelung<br />
durch Reduzierung der Messtechnik<br />
auf einfach zu messende Größen (Temperatur,<br />
Druck, Durchfluss)<br />
● Verhinderung/Verminderung von Bedienfehlern<br />
durch den manuellen Betrieb<br />
● Qualifizierung des Bedienpersonals<br />
durch Verwendung als Simulationssystem<br />
(Operatorschulung)<br />
● Möglichkeit der globalen Verknüpfung des<br />
Systems über Datenleitung mit „Wartungszentren“;Prozessanalyse/-optimierung<br />
aus der Ferne als Dienstleistung<br />
Da es kein vergleichbares Produkt im<br />
beschriebenen Einsatzgebiet gibt, sind die<br />
Marktchancen sehr gut. Der Systempreis,<br />
der sich nach dem Umfang der zu integrierenden<br />
Anlagenteile richtet, kann sich<br />
innerhalb von zwei Jahren, z.B. durch<br />
Einsparung von Energie (Strom, Dampf),
65<br />
Automatisierung und Optimierung von Gasreinigungsanlagen mit GasControl<br />
Versuchskolonne auf der Kokerei August Thyssen (Bild 3)<br />
Verringerung der Umweltbelastung (Pönalen)<br />
und Verbesserung der Endprodukte<br />
(Reinheit), amortisieren. Dies ist ein entscheidendes<br />
Kriterium für die gute Marktfähigkeit<br />
des Systems.<br />
3 Entwicklungsgeschichte<br />
Gasreinigungsanlagen als Bestandteil<br />
von Kokereien werden auch heute noch<br />
weitgehend manuell gefahren, d.h., die<br />
von einem Leitsystem erfassten Messwerte<br />
werden vom Bedienpersonal bewertet. Der<br />
Operator entscheidet auf Grund seiner<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Erfahrungen und/oder verfahrenstechnischen<br />
Kenntnisse, wie die Sollwerte für die<br />
einzelnen Regelkreise gesetzt werden müssen,<br />
um einen möglichst optimalen Betrieb<br />
zu gewährleisten. Das Betriebsergebnis ist<br />
somit in hohem Maße abhängig von der<br />
Motivation, Qualifikation und Erfahrung des<br />
Bedienpersonals.<br />
Um den Prozess im Rahmen eines Automatisierungskonzeptes<br />
abzubilden, ist die<br />
Verwendung eines geeigneten Simulationsmodells<br />
unerlässlich. Bisher existierten nur<br />
unzureichende Prozessmodelle, welche die<br />
komplizierten verfahrenstechnischen Vor-<br />
gänge der Gasreinigung nicht mit ausreichender<br />
Genauigkeit wiedergeben konnten.<br />
Eine Automatisierung erschien bislang<br />
wenig Erfolg versprechend. Prozessoptimierung<br />
konnte bisher nur „per Hand“ mit<br />
kostenintensiver Analytik durchgeführt werden<br />
(Bild 2a). Daher wurde auf der Basis<br />
eines kommerziellen Simulators ein Modell<br />
entwickelt, mit dessen Hilfe die Prozesse<br />
nicht nur dynamisch simuliert werden können,<br />
sondern das auch eine kostengünstige<br />
Möglichkeit zur Prozessoptimierung bietet<br />
(Bild 2b).<br />
Im Jahre 1993 wurde in einer Kooperation<br />
mit der <strong>Technische</strong>n Universität Berlin<br />
ein erstes FuE-Projekt zur Entwicklung und<br />
zur Validierung eines dynamischen Prozessmodells<br />
begonnen. Dieses Modell sollte die<br />
chemisch physikalischen Zusammenhänge<br />
möglichst rigoros beschreiben und so<br />
modular aufgebaut sein, dass es leicht auf<br />
vorhandenen oder neuen Anlagen angepasst<br />
oder erweitert werden kann.<br />
Parallel dazu wurde bei unserem Hochschulpartner<br />
eine Pilotanlage gebaut, die<br />
zur Überprüfung der Simulationsergebnisse<br />
Automatische Probennahme (Bild 4)
66<br />
Automatisierung und Optimierung von Gasreinigungsanlagen mit GasControl<br />
Regelkonzept GasControl am Beispiel einer Desorptionskolonne (Bild 5)<br />
und damit zur Modellvalidierung dient. Neu<br />
entwickelte Automatisierungsstrategien<br />
können im Technikumsmaßstab erprobt<br />
werden. Die Anlage ist so konzipiert, dass<br />
eine flexible Anpassung an unterschiedlichste<br />
Betriebsweisen möglich ist. Die Verwendung<br />
industrieller Ausrüstungstechnik<br />
gewährleistet die Vergleichbarkeit mit realen<br />
Prozessen. Zunächst wurden umfangreiche<br />
experimentelle Untersuchungen<br />
durchgeführt. Die Pilotanlage wurde über<br />
ein Jahr im Bypass zu einer Gasreinigungsanlage<br />
im Kokereibetrieb eingesetzt. Der<br />
Vergleich der validierten Messdaten mit<br />
den Simulationswerten ergab eine gute<br />
Übereinstimmung. Auf Grund dieser<br />
positiven Erfahrungen wurde das<br />
Simulationsmodell im Rahmen des<br />
GasControl-Systems zur Optimierung<br />
einer bestehenden Anlage eingesetzt.<br />
Inzwischen sind zwei großtechnische<br />
Anlagen mit GasControl ausgerüstet<br />
worden. Eine weitere befindet sich in der<br />
Planung.<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
4 Systembeschreibung<br />
Ausgehend von den Forderungen der<br />
Anlagenbauer und Anlagenbetreiber nach<br />
möglichst großer Anpassungsfähigkeit auf<br />
verschiedenste Anlagenteile und Anlagenkonfigurationen<br />
wurde ein modularer<br />
Systemaufbau wie in Bild 5 dargestellt<br />
realisiert.<br />
Das GasControl-System besteht im<br />
Wesentlichen aus einem Datenserver,<br />
einem Modellrechner und einer Auswerte-/<br />
Bedienstation.<br />
Der Server beinhaltet eine Echtzeitdatenbank<br />
und wird vom PLS über eine spezielle<br />
Schnittstelle kontinuierlich mit Prozessdaten<br />
versorgt. Der Modellrechner ist über<br />
ein Netzwerk mit dem Server verbunden.<br />
Prozessdaten werden so vom PLS über die<br />
Datenbank zum Modellrechner übertragen.<br />
Dort werden diese als Eingangsgrößen im<br />
Simulationsmodell verarbeitet und die<br />
Berechnungsergebnisse anschließend zum<br />
Server in die Datenbank zurückgeschrieben.<br />
In Abhängigkeit der betrieblichen/<br />
gesetzlichen Zielvorgaben (z.B. minimaler<br />
Energie- und Betriebsmittelverbrauch unter<br />
Einhaltung der gegebenen Umweltvorgaben)<br />
werden die Sollwerte für die Prozessregeleinrichtungen<br />
flexibel und bestmöglich<br />
berechnet. Diese Sollwerte werden<br />
dann nachfolgend an das Leitsystem<br />
übertragen. Schwierige Größen, wie z.B.<br />
Konzentrationen, werden im dynamischen<br />
Modell errechnet, das die gesamten Informationen<br />
des Prozesses enthält. Aufwendige<br />
und teure Konzentrationsmessungen im<br />
Betrieb können entfallen.<br />
Mit der Bedien-/Auswertestation ist es<br />
möglich, jederzeit Trendkurven der<br />
Prozesswerte und der berechneten Werte<br />
darzustellen.<br />
4.1 Modell<br />
Ein Differenzialgleichungssystem,<br />
bestehend aus Massen- u. Energiebilanzen,<br />
chemischen Gleichgewichten und Phasengleichgewichtsbeziehungen,<br />
wird mit Hilfe<br />
spezieller Algorithmen numerisch gelöst.<br />
Unterschiedliche Geometrien der Prozesseinbauten<br />
werden berücksichtigt und<br />
hydraulische Parameter berechnet. Es<br />
wurde in die vorhandene Struktur eines<br />
kommerziellen Prozesssimulators integriert<br />
und verwendet dadurch eine benutzerfreundliche<br />
Oberfläche. Solche Modelle<br />
sind heutzutage für das Prozessverständnis<br />
und für die Auslegung von Automatisierungsstrukturen<br />
unerlässlich. Die „offline“<br />
Operatorschulung ist ein weiterer Nutzen<br />
dieser Anwendung. Durch die genaue<br />
Abbildung des Prozesses in dem Modell<br />
können unterschiedliche Betriebszustände<br />
durchgefahren werden, um einen positiven<br />
Trainingseffekt zu erzielen.
67<br />
Automatisierung und Optimierung von Gasreinigungsanlagen mit GasControl<br />
Soft- und Hardwarekonfiguration des GasControl-Systems (Bild 6)<br />
4.2 Datenbank<br />
Das Client/Server-Konzept „Daten-Server“<br />
beherbergt die Datenbank und alle<br />
Anwendungsprogramme. Sämtliche Werte<br />
aus dem Prozess und alle Werte aus dem<br />
Modell werden in einer gemeinsamen<br />
Datenbank gehalten. Der Vorteil besteht in<br />
einer einheitlichen Schnittstelle für alle<br />
Anwendungsprogramme. Datenintegrität<br />
und homogene Verwaltung der Daten sind<br />
gewährleistet.<br />
4.3 Benutzeroberfläche<br />
Der „Bedien-Client“ beherbergt die<br />
Bedienoberfläche und garantiert eine optimale<br />
Skalierbarkeit des Systems. Es können<br />
beliebig viele Bedienstationen (PC`s)<br />
mit einer Bedienoberfläche kostengünstig<br />
ausgerüstet und angeschlossen werden.<br />
Von den „Bedien-Clients“ können das<br />
Modell konfiguriert und die Ergebnisse<br />
dargestellt werden. Ein Soll-/Ist-Vergleich<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
(Soll = Modellwerte, Ist = Prozesswerte)<br />
erleichtert die Beurteilung der Regelqualität<br />
und hilft, Abweichungen zwischen Modell<br />
und Realität zu entdecken. Eine einheitliche<br />
Bedienoberfläche deckt sowohl die Bedienung<br />
im Online-Betrieb als auch die Bedienung<br />
im Simulations-/Schulungsbetrieb ab.<br />
Auslegungsdaten von GasControl (Bild 7)<br />
4.4 Modell-Server<br />
Das Modell läuft auf einem eigenen<br />
„Modell-Server“. Es können mehrere<br />
„Modell-Server“ am Daten-Server angeschlossen<br />
werden, ohne die Leistungsfähigkeit<br />
des Gesamtsystems negativ zu<br />
beeinflussen. So kann z.B. auf einem<br />
„Modell-Server“ das Online-Modell mit<br />
dem Prozess (d. h. den Prozessdaten)<br />
arbeiten und parallel ein anderer „Modell-<br />
Server“ zu Schulungszwecken eine Simulation<br />
betreiben. Da es zwei gleichartige,<br />
aber voneinander getrennte Datenbestände<br />
für den Prozess bzw. die Simulation gibt,<br />
kann auf dem Simulations-Server geschult<br />
werden, ohne den realen Betrieb zu beeinträchtigen.<br />
Eine Kopierfunktion erlaubt es gezielt,<br />
Prozessdaten zum Simulationsmodell zu<br />
senden, um so dicht wie möglich am realen<br />
Prozess zu schulen. Bild 6 zeigt die Hardware-<br />
und Softwarekonfiguration des in<br />
einem kontinuierlichen Produktionsbetrieb<br />
integrierten Systems.
68<br />
Automatisierung und Optimierung von Gasreinigungsanlagen mit GasControl<br />
5 Ergebnisse und<br />
Betriebserfahrungen<br />
Das GasControl-System ist auf zwei<br />
Gasreinigungsanlagen installiert. Die Auslegungsdaten<br />
dieser Anlagen sind aus Bild<br />
7 ersichtlich.<br />
Die Leistungsfähigkeit des Modells wird<br />
deutlich an der Menge des installierten<br />
Equipments und der Menge der simultan<br />
berechneten Prozessdaten. Als Beispiel für<br />
das Potenzial wurde die Auswertung einer<br />
Versuchsreihe in Bild 8 dargestellt. In dieser<br />
Versuchsreihe wurde eine Gasreinigungsanlage<br />
auf einen neuen Arbeitspunkt<br />
optimal mit Hilfe des Modells eingestellt. Es<br />
zeigte sich eine sehr gute Übereinstimmung<br />
des Prozesses mit dem Modell<br />
(Schwefelwasserstoff H2S und Ammoniakwerte<br />
NH3 im gereinigten Gas). Mit Hilfe<br />
des Modells wurden Reduzierungen des<br />
Absorbens Abtreiberabwasser, kurz AAW,<br />
durchgeführt. Die sich einstellende Gasqualität<br />
wurde durch das Labor sowie<br />
durch das Modell bestätigt. Weitere Reduzierungen<br />
ergaben am Ende der Versuchsreihe<br />
eine Energieeinsparung von circa<br />
Betriebsergebnisse der Modellregelung mit GasControl (Bild 8)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
20 %, die sich aus der Einsparung von<br />
Strippdampf bei der Aufbereitung des<br />
Absorbens ergeben.<br />
6 Zusammenfassung<br />
Es konnte gezeigt werden, dass es mit<br />
GasControl möglich ist, Gasreinigungsanlagen/Chemieanlagen<br />
immer am optimalen<br />
Arbeitspunkt zu betreiben. Das System ist<br />
flexibel aufgebaut, sodass es sich automatisch<br />
auf unterschiedliche Standardbetriebsfahrweisen<br />
einstellen kann. Bei Divergenz<br />
des Modells startet das Modell selbst<br />
und ermöglicht somit eine hohe Verfügbarkeit.<br />
Die Genauigkeit des Modells entspricht<br />
der gleichen Genauigkeit der Laboranalysen.<br />
Durch diese Grundvoraussetzung<br />
konnte ein Online-Betrieb von GasControl<br />
zur Regelung der Konzentration eines<br />
Absorbens mit Erfolg implementiert<br />
werden.<br />
Literatur<br />
● Liszio, P.; Thielert. H.; Wozny, H.:<br />
Automation of gas treatment plants by<br />
process simulation.<br />
3rd International Cokemaking Congress,<br />
September 16-18, 1996 - Gent, Belgium<br />
● Thielert, H.:<br />
Simulation und Optimierung der Kokereigasreinigung.<br />
Dissertation TU-Berlin, 1997<br />
● Liszio, P.; Leuchtmann, P.; Thielert, H.;<br />
Werthmann, A.:<br />
Betriebsergebnisse und Erfahrungen<br />
aus dem Automatisierungsmodell<br />
GasControl am Beispiel der Kokereigasentschwefelungen<br />
TKS und Taranto<br />
Phase III.<br />
Kokereifachtagung HDT, 4.-5.5.2000
69<br />
Dr.-Ing. Lutz Palm,<br />
Dipl.-Ing. Norbert Platz<br />
Innovative Technologien zur Entlackung und Farbbeschichtung von<br />
Schiffen im Dock<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
PAINTMASTER-Pilotanlage von Blohm+Voss Repair (Bild 1)
70<br />
Innovative Technologien zur Entlackung und Farbbeschichtung von Schiffen im Dock<br />
1 Problemstellung<br />
Auf Schiffsreparaturwerften sind die Entlackung<br />
und die Farbbeschichtung der<br />
Schiffsaußenhaut äußerst arbeitsintensive<br />
und umweltsensitive Prozesse, die in den<br />
meisten Fällen in kurzen, vom Reeder vorgegebenen<br />
Dockzeiten durchgeführt werden.<br />
Der vor der Farbbeschichtung zu erfolgende<br />
Arbeitsgang hinsichtlich der Schiffsoberflächenbehandlung<br />
kann dabei unterschiedliche<br />
Zielstellungen beinhalten:<br />
● Reinigung des Unterwasserschiffes von<br />
Bewuchs (Bild 2)<br />
● Abtrag der obersten Farbschichten<br />
● Entfernung der gesamten alten Farbbeschichtung<br />
und des Rostes<br />
Die technologiebestimmenden Basisdaten<br />
lassen sich wie folgt quantifizieren:<br />
● Anzahl der Schiffsdockungen<br />
ca. 70 p.a.<br />
● Zu bearbeitende Schiffsflächen<br />
ca. 1.000.000 m2 p.a.<br />
● Einzusetzendes Farbvolumen<br />
ca. 500.000 l p.a.<br />
Neben der großflächigen Außenhautbearbeitung<br />
können auch spezielle punktuelle<br />
Oberflächenbehandlungen erforderlich<br />
sein. Der Prozess der Schiffsreinigung bzw.<br />
Entlackung erzeugt Reststoffe, die mit dem<br />
verwendeten Strahlgut vermischt und je<br />
nach Intensität des Abtrages mehr oder<br />
weniger stark mit Schadstoffen kontaminiert<br />
sind. Die diesbezügliche Problemzone<br />
des Schiffes ist der Unterwasserbereich, in<br />
dem mit Bioziden (Kupfer, Zink, Organozinnverbindungen)<br />
angereicherte Schiffsfarben<br />
eingesetzt werden, die den Antifoulingeffekt<br />
bewirken. Die derzeit vorherr-<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
schende Technologie zur Schiffsentlackung<br />
ist das Gritblasting, bei dem feinkörnige<br />
Schlacke (meistens Kupfer) in einem<br />
Druckluftstrahl für den Abtrag der Farbschichten<br />
sorgt. Für einen großflächigen<br />
Einsatz dieses Verfahrens am Schiff werden<br />
erhebliche Mengen an Strahlgut benötigt.<br />
Entsprechende Strahlmittelrückstände<br />
müssen entsorgt und als Sondermüll deponiert<br />
werden.<br />
Die sich an die Vorbehandlung der<br />
Schiffsaußenhaut anschließende Farbbeschichtung<br />
ist aus gleicher Ursache<br />
umweltbeeinflussend, wenn Antifoulingfarben<br />
appliziert werden. Die Schadstoffemission<br />
erfolgt hier in erster Linie durch den<br />
Overspray, der unter Freiluftbedingungen<br />
und bei mitunter widrigen Witterungsverhältnissen<br />
zu beträchtlichen Farbverlusten<br />
führen kann. Nach dem bisherigen Stand<br />
der Technik wird zur Farbbeschichtung im<br />
Dock das Airless-Spritzverfahren unter<br />
Benutzung manuell geführter Spritzlanzen<br />
und -pistolen eingesetzt. Der hierbei auftretende<br />
Oversprayanteil wird durch Wind und<br />
Waschgerät zur Reinigung des Unterwasserschiffes (Bild 2)<br />
thermische Einflüsse, die Geometrie der<br />
Beschichtungsflächen sowie durch die<br />
Qualifikation und die physische Verfassung<br />
des Personals stark beeinflusst. Er stellt bei<br />
dieser Technologie einen nicht vermeidbaren<br />
erhöhten Verbrauch an Materialressourcen<br />
dar.<br />
Die Blohm+Voss Repair GmbH unternimmt<br />
seit vielen Jahren erhebliche<br />
Anstrengungen, diese unter ökonomischen<br />
und ökologischen Aspekten unzulänglichen<br />
Technologien durch innovative, insbesondere<br />
erhöhten Effizienz- und Umweltschutzansprüchen<br />
gerecht werdende Verfahren<br />
für die Schiffsentlackung und Farbbeschichtung<br />
zu ersetzen. Alle diesbezüglichen<br />
Entwicklungen haben dabei folgende<br />
Anforderungen zu erfüllen:<br />
● Nachhaltige Reduzierung von Umweltbelastungen<br />
durch Emission und Reststoffanfall<br />
● Schonung von Materialressourcen<br />
● Verbesserung der Arbeitsbedingungen<br />
● Erhöhung der Produktivität
71<br />
2 Innovationsidee<br />
Die neuen nunmehr eingesetzten innovativen<br />
Technologien sind wie folgt spezifiziert:<br />
Waterblasting<br />
Innovative Technologien zur Entlackung und Farbbeschichtung von Schiffen im Dock<br />
B + V<br />
2000<br />
Zur Reinigung und Entlackung der Schiffsaußenhaut<br />
findet das Waterblasting in Form<br />
von Hochdruckwasserstrahlen mit Drücken<br />
bis zu 2.500 bar und integrierter Prozessund<br />
Abwasserbehandlung Anwendung.<br />
Gegenüber dem konventionellen Gritblasting<br />
bietet dieses Verfahren eine Reihe wirtschaftlicher<br />
und ökologischer Vorteile. So<br />
kann die Menge anfallender und zu entsorgender<br />
Reststoffe durch das Waterblasting<br />
deutlich reduziert werden (Bild 3).<br />
Waterblasting setzt jedoch eine Hardwarekonfiguration<br />
voraus, die im Normalfall<br />
einen nahezu geschlossenen Wasserkreislauf<br />
ermöglicht. Bei der B+V Repair GmbH<br />
wird die Wasch- und Entlackungstechnologie<br />
in der aktuellen Ausbaustufe mit folgenden<br />
Hardware-Systemen umgesetzt:<br />
● Hochdruckwasser-Pumpen<br />
(bis zu 2.500 bar)<br />
● Waschanlage für die senkrechten /<br />
schrägen Außenhautbereiche<br />
(DOCKMASTER) (Bild 4)<br />
● Waschanlage für den Schiffsboden<br />
● Handwaschausrüstung<br />
● Dockabwasserbehandlungsanlage<br />
Zielsetzungen bei der Entwicklung und<br />
Einführung der Entlackungstechnologie<br />
mittels Hochdruckwasser sind:<br />
● Minimierung von zu entsorgenden Reststoffen<br />
● Vermeidung von Schadstoff- und Staubemissionen<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
● Verminderung des Restsalzgehaltes der<br />
Oberflächen unter Einhaltung geforderter<br />
Oberflächengüten<br />
● Verbesserung der Arbeitsbedingungen<br />
für das Betriebspersonal und für das im<br />
Umfeld tätige Reparaturpersonal<br />
Ein wesentliches Element der Waterblasting-Technologie<br />
ist die Dockabwasserreinigung.<br />
Im Rahmen ständiger Verbesserungen<br />
der Technologie beginnt derzeit ein<br />
durch EU und Hansestadt Hamburg gefördertes<br />
FuE-Projekt, das die weitestgehende<br />
Eliminierung von Organozinnverbindungen<br />
(TBT) sowie von Kupfer und Zink zum Inhalt<br />
hat. Mit dieser Entwicklung wird das Problem<br />
der derzeit umweltpolitisch stark im<br />
Vordergrund stehenden TBT-Kontaminierung<br />
von Hafen- und Küstengewässern<br />
gelöst.<br />
Umweltentlastende Farbbeschichtung<br />
Ausgehend von den Gegebenheiten der<br />
bislang manuellen Farbbeschichtung mittels<br />
Airless-Spritztechnik sind die Vorgaben<br />
für eine innovative Beschichtungstechnologie<br />
die signifikante Verminderung des<br />
Anfallende Reststoffmengen bei der Reinigung und Entlackung der Schiffsaußenhaut<br />
(Bild 3)<br />
Oversprays, Schonung von Materialressourcen<br />
sowie die Verbesserung der<br />
Arbeitsbedingungen der Beschichter und<br />
Mitarbeiter der Werft. Diese Anforderungen<br />
werden erfüllt in einer automatisierten<br />
mobilen Beschichtungsanlage, deren<br />
wesentliches Element ein vierdüsiger<br />
Spritzkopf mit Oversprayabsaugung ist. Die<br />
Pilotanlage des PAINTMASTER (Bild 1)<br />
wurde mit Förderung aus dem EU-Umweltprogramm<br />
„LIFE“ realisiert. In der derzeitigen<br />
Ausbaustufe können die senkrechten<br />
Seitenwände des Rumpfes bearbeitet werden.<br />
Gegenüber der bisherigen Praxis der<br />
Farbbeschichtung ergeben sich durch die<br />
Einführung eines automatisierten<br />
Beschichtungsvorganges die folgenden<br />
ökologischen und ökonomischen Vorteile,<br />
die das erklärte Ziel dieses Entwicklungprojektes<br />
waren:<br />
● Signifikante Minderung des emittierten<br />
Oversprayanteiles<br />
● Senkung des Farbverbrauches<br />
● Flächenhafte Homogenisierung der Farbschichtdicke<br />
● Humanisierung der Arbeit
72<br />
3 Kundennutzen<br />
Innovative Technologien zur Entlackung und Farbbeschichtung von Schiffen im Dock<br />
Erhöhung der Oberflächenqualität der<br />
gereinigten bzw. entlackten Schiffsaußenhaut<br />
Wesentliche Gütekriterien bei der Vorbereitung<br />
der Schiffsaußenhaut für eine Neubeschichtung<br />
sind die Rauigkeit und der<br />
der Oberfläche anhaftende Salzgehalt. Die<br />
Waterblasting-Technologie kann durch Einstellung<br />
entsprechender Drücke die vorhandene<br />
Oberflächenrauigkeit wieder freilegen.<br />
Wesentliche Vorteile weist sie jedoch<br />
beim Reinheitsgrad in Form des Restsalzgehaltes<br />
auf.<br />
Verbesserung der Homogenität des<br />
Farbauftrages<br />
Der bislang manuell durchgeführte Farbauftrag<br />
impliziert inhomogene Schichtdicken,<br />
da die handgeführte Spritzpistole<br />
auf verschiedene äußere Bedingungen<br />
auch unterschiedlich reagiert. Im Gegen-<br />
DOCKMASTER von Blohm+Voss Repair (Bild 4)<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
satz dazu bewirkt die Strahlführung im<br />
gekapselten Beschichtungskopf des PAINT-<br />
MASTER eine sehr viel größere Homogenität<br />
und Reproduzierbarkeit der Schichtdicke.<br />
Im Rahmen der Produktionseinführung<br />
des Gerätes wird durch eine Parameteroptimierung(schichtdickenabhängiger<br />
Farbvolumenstrom) eine weitere Verbesserung<br />
angestrebt.<br />
Verkürzung von Dockliegezeiten<br />
Die neuen eingesetzten Technologien zur<br />
Schiffsreinigung und -entlackung sowie zur<br />
Farbbeschichtung sind weitgehend automatisiert.<br />
Diese dadurch erreichte Produktivitätssteigerung<br />
kommt auch dem Kunden<br />
zugute, indem teure Dockliegezeiten verkürzt<br />
werden.<br />
Senkung des Farbverbrauchs<br />
Bei der bislang praktizierten Technologie<br />
kann der Oversprayanteil technologiebedingt<br />
und infolge häufig vorliegender un-<br />
günstiger Witterungsbedingungen bis zu<br />
30 % der eingesetzten Farbmenge betragen.<br />
Mit der neuen automatisierten und<br />
oversprayminimierten Beschichtungstechnologie<br />
wird dieser Farbverlust auf unter<br />
5 % reduziert.<br />
4 Kosteneinsparungen<br />
Vermeidung großer Mengen schadstoffbelastender<br />
Reststoffe und Abminderung<br />
des Entsorgungsproblems<br />
Diese Art der Kosteneinsparung wird verdeutlicht<br />
durch eine Gegenüberstellung<br />
entsprechender Kennwerte für Gritblasting<br />
als konventionelle Technologie und Waterblasting<br />
als innovative neue Technologie<br />
(Bild 5).<br />
Minimierung von Schadstoff-Direkteinträgen<br />
als Flüssigphase in die Elbe<br />
Zwecks Schonung von Wasserressourcen<br />
und Vermeidung von Schadstoffeinträgen<br />
in Form einer Direkteinleitung in die Elbe<br />
erfolgt eine weitestgehende Kreislaufführung<br />
des Prozesswassers, die nur mit<br />
Hilfe einer eigenentwickelten Abwasserbehandlungsanlage<br />
möglich ist (Bilder 6 und<br />
7). Im Prozessführungsregime sind jedoch<br />
Direkteinleitungen in die Elbe infolge von<br />
Regen- und Infiltrationswässer unumgänglich.<br />
Dazu findet speziell für kritische<br />
Inhaltsstoffe, wie Cu, Zn und TBT, eine<br />
Gritblasting<br />
Strahlmittelrückstände,<br />
Farbreste<br />
100 %<br />
Waterblasting<br />
Farbreste<br />
1,5 %<br />
Reduzierung der Reststoffmengen durch die<br />
Waterblasting-Technologie (Bild 5)
73<br />
Innovative Technologien zur Entlackung und Farbbeschichtung von Schiffen im Dock<br />
Flussschema der Abwasserreinigungsanlage<br />
(Bild 6)<br />
gezielte Schadstoffabtrennung statt, die<br />
insbesondere von hoher umweltpolitischer<br />
Relevanz ist.<br />
Minimierung der Oversprayemission bei<br />
der Farbbeschichtung<br />
Vor Einführung der oversprayminimierten<br />
automatisierten Farbbeschichtung erfolgte<br />
der Farbauftrag im Handspritzverfahren mit<br />
Oversprayanteilen infolge ungünstiger Witterungseinflüsse<br />
(Wind, Thermik) oder<br />
infolge Nichteinhaltung der 90°-Spritzrichtung<br />
zum Objekt. Durch die Neuentwicklung<br />
und Inbetriebnahme der automatisierten<br />
Farbbeschichtungsanlage kann die<br />
Oversprayemission auf ca. 5 % abgesenkt<br />
werden.<br />
Verringerung des Personalbedarfs durch<br />
konsequente Automatisierung<br />
Die konventionellen Technologien zur<br />
Oberflächenbehandlung sind neben der<br />
Umweltproblematik durch einen relativ<br />
hohen manuellen Arbeitsanteil geprägt. Da<br />
die neuen Technologien weitestgehend<br />
forum<br />
<strong>ThyssenKrupp</strong> 1/2000<br />
Dockwasserbehandlungsanlage von Blohm+Voss Repair (Bild 7)<br />
automatisiert betrieben werden, ist insbesondere<br />
bei der Farbbeschichtung der<br />
Schiffsaußenhaut eine Personaleinsparung<br />
gegeben.<br />
Wegfall anstrengender manueller Tätigkeiten<br />
unter widrigen Arbeitsbedingungen<br />
Der Einsatz funkferngesteuerter automatisierterOberflächenbearbeitungsmaschinen<br />
führt unter Berücksichtigung der Art<br />
der zu erledigenden Tätigkeiten zwangsläufig<br />
zu einer erheblichen Humanisierung der<br />
Arbeit (physische Beanspruchung, Staub).<br />
5 Unternehmenspolitische<br />
Nutzeffekte<br />
Über die in den Abschnitten 3 und 4 aufgeführten<br />
Aspekte des Kundennutzens<br />
sowie der direkten monetären Vorteile hinaus<br />
erfüllen die neue innovativen Technologien<br />
weitere für das Unternehmen äußerst<br />
wichtige Leistungsansprüche. Entwickelt<br />
wurden sie im Rahmen eines unternehmerischen<br />
Konzeptes als Reaktion auf die sich<br />
verschärfende Umweltgesetzgebung sowie<br />
auf Auflagen seitens der Behörden. Der<br />
Standort von B+V Repair befindet sich in<br />
unmittelbarer Nachbarschaft eines der touristischen<br />
Zentren Hamburgs, ist mithin<br />
selbst ein Objekt mit touristischer Relevanz.<br />
Somit steht das Unternehmen im Blickpunkt<br />
der Öffentlichkeit. Die eingesetzten<br />
Technologien vermitteln das Image eines<br />
innovationsfreudigen und umweltbewussten<br />
Unternehmens. Diese Außenwirkung<br />
erreicht auch die Reederschaft, die infolge<br />
zunehmenden Drucks der Öffentlichkeit bei<br />
der Auftragsvergabe vermehrt auf die Erfüllung<br />
von Umweltstandards auf den Werften<br />
achten. Die Wettbewerbssituation ist durch<br />
die Existenz von Billiglohnländern auch in<br />
Europa angespannt. Unter diesen Bedingungen<br />
können Wettbewerbsvorteile heutzutage<br />
nur mit sich abhebender Effizienz<br />
und Qualität erzielt werden. Die innovativen<br />
Technologien Waterblasting sowie automatisierte<br />
Farbbeschichtung erfüllen diese<br />
beiden Ansprüche. Sie sind somit ein wichtiger<br />
Beitrag zur Existenz- und Standortsicherung<br />
des Unternehmens.