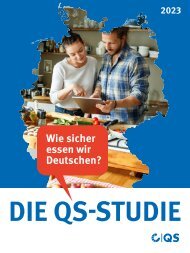Landschaft Westfalen 02/2022
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
AUSGABE 2 / APRIL 2<strong>02</strong>2<br />
www.landschaft-westfalen.de<br />
Einzelpreis: 2,40 Euro<br />
Regional lesen, entscheiden, bewegen!<br />
Genossenschaften:<br />
Antworten für die<br />
Landwirtschaft<br />
Seite 3<br />
Landtagswahl:<br />
Parteidisput<br />
um ländliche Räume<br />
Seite 4<br />
Corona-Proteste:<br />
Auswirkungen auf den<br />
Zusammenhalt<br />
Seite 7<br />
Autobahnen:<br />
Schwachpunkte in der<br />
Infrastruktur<br />
Seite 12<br />
Synodaler Weg:<br />
Aufbegehren gegen die<br />
Kirchenoberen<br />
Seite 14<br />
Verlage bitten um Hilfe<br />
für die Ukraine<br />
Münster. Der Landwirtschaftsverlag<br />
Münster stellt zusammen mit<br />
seinen Töchtern und Beteiligungen<br />
insgesamt 50.000 Euro für die vom<br />
Krieg in der Ukraine betroffenen<br />
Menschen zur Verfügung. Das Geld<br />
geht an die Caritas in Polen, die<br />
zusammen mit der Landwirtschaftskammer<br />
Lublin im Osten Polens<br />
nahe der ukrainischen Grenze sowie<br />
den dortigen Landfrauen und Landwirten<br />
konkrete Hilfsmaßnahmen<br />
umsetzt. An der Aktion beteiligen<br />
sich auch die Deutsche Medien<br />
Manufaktur, die LV digital, der Lebensmittel<br />
Praxis Verlag, der Polnische<br />
Landwirtschaftsverlag, der Max<br />
Eyth Verlag und die AgriDirect mit<br />
eigenen Spenden.<br />
„Der russische Überfall bringt unermessliches<br />
Leid über die Menschen<br />
in der Ukraine. Und je länger<br />
der Krieg dauert, desto schwieriger<br />
wird es, die Schutz suchenden Bürgerinnen<br />
und Bürger zu versorgen.<br />
Wir laden unsere Leser, Kunden und<br />
Partner aus unseren drei großen<br />
Verlagsbereichen Landwirtschaft,<br />
Lebensmittel und Landleben ein,<br />
sich mit weiteren Spenden an<br />
unserer Aktion ‚Gemeinsam für die<br />
Ukraine‘ zu beteiligen. Jeder Euro<br />
hilft“, bitten Werner Gehring,<br />
Ludger Schulze Pals und Malte<br />
Schwerdtfeger, Geschäftsführer des<br />
Landwirtschaftsverlags, um Unterstützung<br />
der Hilfsmaßnahmen.<br />
In Deutschland führt das Spendenkonto<br />
die Caritas Münster:<br />
Caritasverband für die Diözese<br />
Münster e. V.<br />
IBAN: DE47 4006 <strong>02</strong>65 0004 1005 05<br />
BIC: GENODEM1DKM<br />
Verwendungszweck:<br />
„Flüchtlingshilfe Caritas Lublin“<br />
LPV GmbH Hülsbrockstraße 2–8 48165 Münster<br />
ZKZ 32935 PVst+4 DPAG Entgelt bezahlt<br />
Sie entscheiden!<br />
Dem ländlichen Raum <strong>Westfalen</strong>s kommt bei<br />
der Landtagswahl eine Schlüsselrolle zu<br />
Eine stärkere Berücksichtigung in den politischen<br />
Entscheidungsprozessen, der Vorrang<br />
kooperativer Lösungen vor Ordnungsrecht<br />
und der Respekt und Schutz des Eigentums an<br />
Grund und Boden – das sind die Forderungen,<br />
die das „Aktionsbündnis Ländlicher Raum“ zur Landtagswahl<br />
in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> aufstellt. Die 16 Verbände<br />
der Agrar-, Wald- und Gartenbauwirtschaft, die sich im<br />
Aktionsbündnis zusammengeschlossen haben, fordern<br />
zudem, dass die Schlüsselrolle des ländlichen Raums beim<br />
Ausbau erneuerbarer Energien anerkannt wird.<br />
Hier sollen Hürden im Genehmigungsverfahren abgebaut<br />
werden. In ihrem Positionspapier fordern sie außerdem<br />
eine Infrastruktur, die eine regionale und klimafreundliche<br />
Versorgung mit lokal erzeugten Produkten sicherstellt.<br />
Eine ökonomisch, ökologisch und sozial ausgerichtete<br />
Landwirtschaft könne ihren Beitrag zu Klimaschutz,<br />
Wiedergewählt: Hubertus Beringmeier.<br />
Foto: Marlies Grüter<br />
Von Stefan Legge<br />
Das Klischee von der ländlichen Idylle hat die Parteien eingeholt. Foto: Adobe Stock<br />
Zweite Amtszeit<br />
Münster. Hubertus Beringmeier aus<br />
Hövelhof-Espeln (Kreis Paderborn)<br />
bleibt Präsident des Westfälisch-Lippischen<br />
Landwirtschaftsverbands<br />
(WLV). Mit 96 Prozent der Stimmen<br />
wählten die Delegierten des Landesverbandsausschusses<br />
den 60-jährigen<br />
Schweinemäster und Ackerbauern für<br />
zwei weitere Jahre zum obersten Vertreter<br />
des regionalen Bauernverbands.<br />
Stand bereits die erste Amtszeit des<br />
Präsidenten aufgrund der Corona-<br />
Pandemie ganz im Zeichen des Krisenmanagements,<br />
so sieht Beringmeier<br />
auch für die kommenden Jahre die<br />
Landwirtschaft vor großen Herausforderungen<br />
– nicht zuletzt wegen des<br />
Ukrainekrieges.<br />
Biodiversität und Tierwohl nur erbringen, wenn sie von<br />
der Politik und der Gesellschaft unterstützt werde.<br />
Wenn am 15. Mai in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> ein neuer<br />
Landtag gewählt wird, fällt dem ländlichen Raum auch<br />
bei der Wahlentscheidung eine Schlüsselrolle zu. Bei<br />
dem zu erwartenden engen Rennen werden die Wählerinnen<br />
und Wähler aus <strong>Westfalen</strong> das Zünglein an der<br />
Waage sein. Folgerichtig werben die Parteien im Vorfeld<br />
eifrig um Stimmen. Die SPD hat mit dem parlamentarischen<br />
Instrument der Großen Anfrage die Regierungsparteien<br />
zu detaillierten Auskünften ihrer Politik im<br />
ländlichen Raum gezwungen. Die Schlussfolgerung der<br />
Sozialdemokraten: „Klischees von Landidylle und durch<br />
Land- und Forstwirtschaft geprägte Regionen entsprechen<br />
nicht mehr der Realität.“ CDU und FDP hätten keine<br />
Strategie. Die Regierungsparteien halten dagegen.<br />
Mehr auf den Seiten 4 und 5<br />
„Die Kostenexplosion<br />
bei Energie<br />
und Getreide ist<br />
ein Vorgeschmack<br />
darauf, was<br />
vielleicht noch<br />
kommen kann.“<br />
Hubertus Beringmeier,<br />
WLV-Präsident<br />
Es geht um<br />
Menschen, um<br />
nichts anderes<br />
Gern wird in diesen Tagen Egon<br />
Bahr zitiert: „In der internationalen<br />
Politik geht es nie um Demokratie<br />
oder Menschenrechte. Es geht um die<br />
Interessen von Staaten. Merken Sie<br />
sich das, egal, was man Ihnen im Geschichtsunterricht<br />
erzählt“, schrieb er<br />
im Jahr 2013 Schülerinnen und Schülern<br />
ins Gewissen. Das mag wohl<br />
stimmen, und es geht nicht nur um<br />
die Interessen von Staaten, sondern<br />
die Interessen der in den Staaten maßgeblichen<br />
Gruppen. Und es geht nicht<br />
darum, da hatte Egon Bahr ganz bestimmt<br />
recht, dass wir unsere Vorstellungen<br />
von Demokratie irgendwohin<br />
exportieren. „Die Hoffnung auf eine<br />
friedliche Welt verlangt neben dem<br />
Stolz auf den eigenen Weg die Demut<br />
gegenüber allen, die eine andere politische<br />
Struktur und einen anderen<br />
Weg gehen wollen.“<br />
Es ist hier nicht der Platz und der<br />
Ort, die Widersprüche zwischen den<br />
Interessenlagen verschiedener Akteure<br />
aufzulösen. Wenn wir jedoch fast<br />
täglich lesen, dass die Hoffnung auf<br />
eine friedliche Welt im kleinsten<br />
Raum nicht gelingt, wie, bitte schön,<br />
erwarten wir dann, dass dies im Großen<br />
geschieht? Wenn Grundschulkinder<br />
andere auf dem Schulhof „blöde<br />
Russen“ schimpfen (so geschehen<br />
auch in Ostwestfalen) oder sogar Lehrerinnen<br />
von Schülerinnen Rechtfertigungen<br />
für die russische Kriegspolitik<br />
verlangen, zeigt das doch, wie weit<br />
politische Ideale und Alltagsrealität<br />
voneinander entfernt sind – und das<br />
geht ausnahmsweise mal nicht als<br />
mahnende Adresse an die Politik.<br />
Glücklicherweise ist die Hilfs- und<br />
Spendenbereitschaft groß, und man<br />
kann solche Vorfälle als Einzelfälle<br />
abtun. Sollte man aber nicht. Denn<br />
der Frieden beginnt im Alltag, auf<br />
Schulhöfen, in Belegschaften, aber<br />
auch, und da schließt sich der Kreis,<br />
dort, wo interessengeleitete Entscheidungen<br />
über Investitionen und Geschäftsbeziehungen<br />
getroffen werden.<br />
Irgendwann wird dieser Krieg vorbei<br />
sein, und dann gilt es, daraus Lehren<br />
zu ziehen. Die wichtigste Lehre wird<br />
sein: Es geht um Menschen. Den Respekt<br />
vor anderen und dem Weg, den<br />
sie gehen wollen, können wir jeden<br />
Tag üben, auch jetzt schon und bei<br />
jedem anderen kontroversen Thema.<br />
Für eine friedlichere Welt.<br />
Nicole Ritter<br />
KOLUMNE
BUCH EINS<br />
2 | Akzente<br />
AUSGABE 2 /APRIL 2<strong>02</strong>2<br />
KOMMENTARE<br />
DIE WAHRHEIT ÜBER …<br />
PERSÖNLICH<br />
… DAS BAUMATERIAL DER ERDE untersuchen<br />
Forscherinnen und Forscher<br />
unter der Leitung der Westfälischen<br />
Wilhelms-Universität Münster (WWU).<br />
Die Entstehung der Planeten gibt immer noch<br />
Rätsel auf. Foto: Getty Images/Nasa<br />
Erde und Mars sind demnach aus Materie<br />
entstanden, die zum größten Teil aus<br />
dem inneren Sonnensystem stammt.<br />
Bisher beschreiben zwei Theorien, wie<br />
aus Staub und Gasen, die vor etwa 4,6<br />
Milliarden Jahren die Sonne umkreisten,<br />
im Laufe von Millionen von Jahren die<br />
inneren Gesteinsplaneten entstanden<br />
sein könnten. Die ältere Theorie besagt,<br />
der Staub habe sich zu immer größeren<br />
Brocken zusammengeballt. Daraus seien<br />
die Planeten Erde, Venus, Merkur<br />
und Mars hervorgegangen. Eine neuere<br />
Theorie geht davon aus, dass millimeterkleine<br />
Staubklümpchen aus dem<br />
äußeren Sonnensystem Richtung Sonne<br />
wanderten und sich an den Planetenvorgänger<br />
des inneren Sonnensystems<br />
anlagerten. Doch welche Theorie ist<br />
nun die wahrscheinlichere? Dieser Frage<br />
gingen internationale Forschungsteams<br />
nach, mit dabei Christoph Burkhardt<br />
von der WWU. Er erklärt: „Wir<br />
wollten herausfinden, ob das Baumaterial<br />
von Erde und Mars dem äußeren<br />
oder inneren Sonnensystem entstammt.<br />
Hinweise darauf entnehmen die Forscher<br />
zwei Arten von Meteoriten: Während<br />
sogenannte kohlige Chondrite, die<br />
bis zu einigen Prozent Kohlenstoff enthalten<br />
können, jenseits der Jupiterbahn<br />
entstanden , sind ihre kohlenstoffärmeren<br />
Cousins, die nicht kohligen Chondrite,<br />
echte Kinder des inneren Sonnensystems.<br />
In ihrer aktuellen Studie<br />
untersuchten die Forscher nun Proben<br />
von insgesamt 17 Marsmeteoriten. Die<br />
Ergebnisse zeigen, dass die äußeren<br />
Gesteinsschichten von Erde und Mars<br />
Chondriten-Meteoriten geben Auskunft, wie es<br />
gewesen sein könnte. Foto Getty Images<br />
nur wenig mit den kohligen Chondriten<br />
des äußeren Sonnensystems gemein<br />
haben. Ihr Anteil am ursprünglichen<br />
Baumaterial beider Planeten beträgt<br />
nur ungefähr 4 Prozent. Es müsse außerdem<br />
weiteres Baumaterial gegeben<br />
haben, das aufgrund seiner Zusammensetzung<br />
seinen Ursprung ebenfalls im<br />
inneren Sonnensystem gehabt haben<br />
muss, erläutert Christoph Burkhardt<br />
und schlussfolgert: „Das passt gut zur<br />
Planetenentstehung aus den Zusammenstößen<br />
großer Körper im inneren<br />
Sonnensystem.“<br />
Die Lage ist ernst<br />
IHK-Hauptgeschäftsführer Fritz Jaeckel will<br />
die Wettbewerbsfähigkeit der Industrie sichern<br />
Meine ganz persönliche Brückengeschichte<br />
geht so: Anfang Dezember<br />
fuhr ich nichtsahnend in die<br />
Umgehung der Rahmedetal-Brücke<br />
bei Lüdenscheid, auf dem Hinweg<br />
kostete mich das die ohnehin eingeplante<br />
halbe Stunde Puffer, auf dem<br />
Rückweg legte ich die wenigen Kilometer<br />
durch die Innenstadt in sagenhaften<br />
zwei Stunden zurück. Mehr<br />
stehend als fahrend, mit schlechtem<br />
Gewissen wegen der Menschen, vor<br />
deren Haustüren sich das abspielt. Irgendwann<br />
nahezu mit dem Zähnen<br />
im Lenkrad und kurz davor, schreiend<br />
aus dem Auto zu springen.<br />
Eine der Gretchenfragen: Wie schnell gelingt der Ausbau erneuerbarer Energien? Foto: Roberto Pfeil/dpa<br />
Schon vor dem Angriffskrieg Russlands<br />
auf die Ukraine kannte die Entwicklung<br />
der Energiepreise nur eine<br />
Richtung: nach oben. Besonders unter<br />
Druck steht dabei die Industrie.<br />
Bei der IHK-Konjunkturumfrage im Januar bezeichneten<br />
bereits 10 Prozent der Industriebetriebe<br />
die Entwicklung der Energiekosten als<br />
existenzgefährdend. 61 Prozent rechneten mit<br />
weiter stark steigenden Energiekosten. Der<br />
Krieg hat die Lage nun noch einmal dramatisch<br />
verschärft: Nach einer aktuellen IHK-Umfrage<br />
bekommen bereits mehr als 90 Prozent der Industrieunternehmen<br />
die höheren Energiekosten<br />
zu spüren.<br />
Für Produktionsbetriebe, besonders für die energieintensiven,<br />
ist der aktuelle Anstieg der Energiekosten besonders<br />
kritisch, weil sie die Kosten oft nicht auf die Kunden<br />
abwälzen können. Damit verschlechtert sich nicht nur<br />
die Wettbewerbsfähigkeit einzelner Unternehmen und<br />
ganzer Wertschöpfungsketten, es fehlt auch zunehmend<br />
an den finanziellen Möglichkeiten für Investitionen, die<br />
betrieblich notwendig und politisch gewünscht sind. Wer<br />
auf seinen Kosten sitzen bleibt, kann nicht in Digitalisierung<br />
oder CO2-sparende Technologien investieren. Eine<br />
Vervielfachung der Energiekosten droht energieintensiven<br />
Unternehmen sogar die Betriebsfähigkeit zu nehmen. So<br />
mancher mittelständische Produktionsbetrieb denkt inzwischen<br />
über eine temporäre Stilllegung von Teilen der<br />
Produktion nach.<br />
Deutschland hat seit Jahren die höchsten Strompreise<br />
in Europa. Die Steigerung der Erdgaspreise wurde seit der<br />
zweiten Jahreshälfte 2<strong>02</strong>1 zum Problem und traf die industriellen<br />
Wertschöpfungsketten in der gesamten Breite.<br />
Die aktuelle Krise in Osteuropa verstärkt diese Entwicklung<br />
erheblich. So droht nun Energie in unserer arbeitsteiligen<br />
Ökonomie zum Engpass zu werden, unabhängig<br />
davon, was wir noch zukünftig in der Klima- und Energiepolitik<br />
entscheiden werden.<br />
Fritz Jaeckel ist Hauptgeschäftsführer<br />
der IHK<br />
Nord <strong>Westfalen</strong>.<br />
Foto: Roman Mensing<br />
LÜDENSCHEID<br />
Diese Brücke ist erst der Anfang<br />
Von Nicole Ritter<br />
Seither umfahre ich die Vollsperrung<br />
weiträumig. Wer in Lüdenscheid<br />
wohnt, kann den rund 20.000 Fahrzeugen,<br />
die jeden Tag an seinem<br />
Wohn- oder Geschäftshaus vorbeilärmen,<br />
nicht einfach ausweichen.<br />
Auch die Aussicht, dass der Neubau<br />
der Brücke, wenn es gut läuft, nur<br />
fünf statt der üblichen acht oder zehn<br />
Jahre dauert, ist dann vermutlich ein<br />
schwacher Trost. So viel Dauerlärm<br />
und Feinstaub verträgt kein Mensch,<br />
das zu erwarten ist illusorisch. Und so<br />
viel Verständnis, wie es jetzt immer<br />
wieder von Verantwortlichen erbeten<br />
wird, kann auch niemand aufbringen.<br />
Bezeichnend ist, dass inzwischen Teile der Industrie<br />
die Versorgungssicherheit zunehmend<br />
als gefährdet einstufen. Grund sind Kündigungen<br />
von Lieferverträgen und Schwierigkeiten,<br />
neue Verträge abzuschließen. Dabei geht es<br />
einerseits um einen Mangel an Grünstrom. Der<br />
fehlt auf breiter Front, denn nur weniger als die<br />
Hälfte des Strombedarfs wird deutschlandweit<br />
heute aus erneuerbaren Energien erzeugt. Andererseits<br />
geht es auch um die Lieferfähigkeit<br />
zum Beispiel bei Gas, das als Brückentechnologie<br />
dienen soll, bis eine leistungsfähige und<br />
wirtschaftliche Wasserstofftechnologie zur<br />
Verfügung steht. Bis dahin ist es noch ein weiter<br />
Weg, aber die Region ist dafür gut aufgestellt.<br />
Betreiber der Infrastruktur, Forschungseinrichtungen<br />
und Unternehmen arbeiten bereits an der Wasserstoffversorgung.<br />
Auch unsere niederländischen Nachbarn<br />
setzen auf Wasserstoff. Das darf natürlich nicht darüber<br />
hinwegtäuschen, dass die regional erzeugte Menge an Wasserstoff<br />
für eine Vollversorgung unserer Region nicht ausreichen<br />
wird.<br />
Hinzu kommt das sogenannte Reshoring, also die<br />
Rückverlagerung von Produktionen ins Inland, das den<br />
Energiebedarf noch weiter erhöhen wird. Mit der Corona-<br />
Krise entbrannte die Diskussion um das Reshoring und<br />
wird jetzt durch den Ukraine-Konflikt weiter befeuert.<br />
Deutschland wird auch deshalb weiterhin ein Energieimportland<br />
bleiben.<br />
Unsere Industrie hat keine Wahl. Sie muss sich schnell<br />
an die veränderten Rahmenbedingungen anpassen. Dazu<br />
müssen Produktionsprozesse energieeffizienter werden,<br />
Innovationen an vielen Stellen greifen, Stoffkreisläufe<br />
geschlossen, bürokratische Hürden abgebaut und den<br />
Marktkräften mehr Raum gegeben werden. Dann besteht<br />
eine Chance, dass die Industrie auch mit hohen Energiekosten<br />
langfristig wettbewerbsfähig bleiben kann. Daran<br />
müssen wir arbeiten, dann hat die Industrie bei uns eine<br />
Zukunft.<br />
Was es jetzt braucht, sind wirklich<br />
gute Ideen. Für die Betroffenen in Lüdenscheid,<br />
aber auch für die Infrastruktur<br />
und Mobilitätskonzepte der<br />
Zukunft.<br />
Das Beste, was man jetzt tun kann,<br />
ist, die Brückenkrise – und es ist ja beileibe<br />
nicht die einzige Brücke, die in<br />
die Knie zu gehen droht – als Chance<br />
zu verstehen und Infrastruktur zukunftsfähig<br />
und klimagerecht neu zu<br />
denken und umzugestalten. Die Lüdenscheiderinnen<br />
und Lüdenscheider<br />
könnten aus ihrer Not eine Tugend<br />
machen und zielstrebig vorangehen<br />
– sie haben allen Grund dazu.<br />
Kann Krieg<br />
gerecht sein?<br />
Wer in den 1980er-Jahren der Bundesrepublik<br />
politisch sozialisiert ist,<br />
mag sich angesichts der Weltlage<br />
fragen, welche pazifistische Position<br />
heute möglich ist. Ruhrbischof Franz-<br />
Josef Overbeck ist auch Militärbischof.<br />
Im Interview mit der Rheinischen<br />
Post gibt er einen klaren<br />
Hinweis, wie das geht:<br />
„Frieden ist ein Werk der Gerechtigkeit,<br />
so können wir in der Bibel beim<br />
Propheten Jesaja lesen. Von daher<br />
kann es durchaus Kriege geben,<br />
die der Wiederherstellung von gerechten<br />
Zuständen dienen. Aber nur, um<br />
allein dieses Ziel zu erreichen – und<br />
nicht, um andere Länder zu erobern,<br />
Menschen zu ermorden, Recht zu<br />
brechen, die Würde der Menschen mit<br />
Füßen zu treten. Ein solcher Krieg<br />
kann niemals gerecht sein.“<br />
Franz-Josef Overbeck ist seit 2009 Bischof in<br />
Essen. Foto: Nicole Cornauge/Bistum Essen<br />
Impressum<br />
VERTRIEB:<br />
Meike Wildschütz, Telefon: 0 25 01/801 44 82,<br />
E-Mail: vertrieb@lp-verlag.de<br />
VERLAG:<br />
BUNTEKUH Medien in der LPV GmbH.<br />
Geschäftsführer: Dr. Thorsten Weiland<br />
Anschrift: Hülsebrockstraße 2–8, 48165 Münster.<br />
E-Mail: thorsten.weiland@lp-verlag.de,<br />
Telefon: 0 25 01/801 61 71<br />
Internet: www.buntekuh-medien.de<br />
DRUCK:<br />
Druckzentrum Nordsee, Am Grollhamm 4,<br />
27574 Bremerhaven<br />
REDAKTION:<br />
Dr. Thorsten Weiland (Chefredakteur,<br />
v.i.S.d.P.), Nicole Ritter (Stellv. Chefredakteurin,<br />
Leitung BUNTEKUH Medien), Manuel Glasfort,<br />
Stefan Legge<br />
Schlussredaktion: Schlussredaktion.de<br />
Redaktionsadresse: wie Verlagsadresse<br />
E-Mail: redaktion@landschaft-westfalen.de,<br />
Telefon: 0 25 01/801 61 71<br />
Internet: www.landschaft-westfalen.de<br />
Konzeption: Anja Steinig, Studio F, Berlin<br />
Illustrationen: Neil Gower, Marianna Weber<br />
Layout: Martha Lajewski<br />
Marketing: Lukas Wünnemann<br />
ANZEIGEN:<br />
Dr. Peter Wiggers (Leitung, verantwortlich<br />
für den Anzeigenteil)<br />
Anzeigenservice: Telefon: 0 25 01/801 63 00,<br />
E-Mail: anzeigen@lv.de<br />
UNTERSTÜTZERKREIS:<br />
<strong>Landschaft</strong> <strong>Westfalen</strong> wird aktiv unterstützt von<br />
der Stiftung Westfälische <strong>Landschaft</strong> und dem<br />
Raiffeisenverband <strong>Westfalen</strong>-Lippe (RVWL).<br />
Bankverbindung: Volksbank Münsterland<br />
Nord eG, IBAN DE86 4036 1906 1071 6969 01;<br />
BIC GENODEM1IBB.<br />
Rechnungseingang ausschließlich per E-Mail an:<br />
rechnungseingang@lp-verlag.de<br />
Einzelpreis: 2,40 Euro; jährlich 6 Ausgaben<br />
Nachdruck: Kein Teil dieser Zeitung darf ohne<br />
Genehmigung des Verlages vervielfältigt oder<br />
verbreitet werden.
APRIL 2<strong>02</strong>2 / AUSGABE 2<br />
BUCH EINS<br />
Agenda | 3<br />
BORKEN<br />
„Wir gehen da gemeinsam durch!“<br />
Wie die Agri V Raiffeisen Genossenschaft auf Veränderungen in der Landwirtschaft reagiert<br />
Von Stefan Legge<br />
Für viele landwirtschaftliche Betriebe<br />
in der Region ist die Viehhaltung das<br />
wichtigste Standbein. Hier der<br />
Standort der Agri V Raiffeisen Genossenschaft<br />
in Borken-Burlo mit eigenem<br />
Mischfutterwerk. Fotos: Agri V<br />
Wenn Stefan Nießing und Berthold Brake<br />
alle ihre Geschäftsstellen auf einer Rundtour<br />
mit dem Auto abklappern wollten,<br />
hätten sie am Ende mehr als 400 Kilometer<br />
auf dem Tacho. Die geschäftsführenden<br />
Vorstände der Agri V Raiffeisen eG leiten ein Unternehmen,<br />
das links und rechts des Rheins von Metelen bis<br />
Kamp-Lintfort und von Bottrop bis Kleve Standorte unterhält.<br />
Bei ihrer Tour durch die Region, in der die meisten Kühe<br />
und Schweine pro Hektar in Deutschland gehalten werden,<br />
kämen Nießing und Brake bei vielen ihrer Kunden vorbei.<br />
Futtermittel, Dünger, Pflanzenschutz und Vieh – die Agri V<br />
ist im Bezug- und Absatzgeschäft für die Landwirte der Region<br />
mit einem Jahresumsatz von rund 300 Millionen Euro<br />
ein Schwergewicht. Das Unternehmen gehört mit seinen<br />
360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum viel zitierten<br />
vor- und nachgelagertem Bereich der Landwirtschaft.<br />
„Wir hatten immer mit Herausforderungen zu tun, aber<br />
was da jetzt auf die Landwirtschaft zukommt, ist schon<br />
besonders“, sagt Nießing. Umbau der Tierhaltung, Insektenschutzpaket,<br />
Düngeverordnung – die Liste ließe sich<br />
fortsetzen. Noch bevor dieser Transformationsprozess<br />
überhaupt in Gang geraten kann, hatten die Schweinehalter<br />
mit einer langwierigen Preismisere bei gleichzeitig steigenden<br />
Kosten für Futter und Betriebsmittel zu kämpfen.<br />
„Der Markt für Schweinefleisch dreht sich gerade, sonst<br />
hätten wir sicher bis Mitte des Jahres schon 20 Prozent der<br />
Schweinehalter verloren“, schätzt Nießing.<br />
Weniger Schweine – weniger Geschäft<br />
Dass viele Schweinebauern derzeit eher ans Aufhören als<br />
ans Durchhalten denken, hat auch mit den Zukunftsaussichten<br />
zu tun. Der Konsum von Schweinefleisch in<br />
Deutschland ist rückläufig, die Änderung der Haltungsbedingungen<br />
erfordern hohe Investitionen, und der Handel<br />
erhöht den Druck durch die Einführung eigener Standards.<br />
Die Afrikanische Schweinepest und der daraus<br />
folgende Exportstopp nach Asien führen zudem dazu, dass<br />
günstiges Schweinefleisch beispielsweise aus Spanien in<br />
Deutschland landet.<br />
„Das alles treibt einem schon die Schweißperlen auf die<br />
Stirn“, sagt Nießing. Denn weniger Schweine bedeutet<br />
weniger Geschäft. Immerhin hat die Agri V im vergangenen<br />
Geschäftsjahr 274.000 Ferkel, 345.000 Schweine und<br />
36.000 Kälber gehandelt. Aber auch beim Futtermittelumsatz<br />
wird sich der Rückgang der Tierhaltung bemerkbar<br />
machen. In Burlo, Barlo, Dingden und Raesfeld unterhält<br />
das Unternehmen eigene Mischfutterwerke. Dieses Geschäftsfeld<br />
machte zuletzt immerhin 80 Millionen Euro<br />
Umsatz pro Jahr.<br />
Genossenschaftlicher Gedanke steht vorn<br />
Wenn die Farm-to-Fork-Strategie der Europäischen Union<br />
nun für 2030 eine Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln<br />
um 50 Prozent und eine Verringerung<br />
der Düngemittel um 20 Prozent vorsieht, dann trübt das<br />
die Aussichten auf das landwirtschaftliche Geschäft ebenfalls.<br />
Was also tun?<br />
„DER<br />
MARKT FÜR<br />
SCHWEINE-<br />
FLEISCH<br />
DREHT SICH<br />
GERADE,<br />
SONST<br />
HÄTTEN WIR<br />
SICHERLICH<br />
BIS MITTE<br />
DES JAHRES<br />
SCHON<br />
20 PROZENT<br />
DER HALTER<br />
VERLOREN.“<br />
Stefan Nießing<br />
„Wir orientieren uns am Bedarf unserer Mitglieder und<br />
Kunden“, sagt Stefan Nießing. „Bei allen unseren Ideen<br />
steht der genossenschaftliche Gedanke ganz vorn. Wir sind<br />
zur Versorgung der Landwirtschaft und der bestmöglichen<br />
Vermarktung ihrer Produkte gegründet worden. An diesem<br />
Grundsatz halten wir fest.“ Konkret bedeute dies, dass man<br />
die Landwirte an günstigen Konditionen durch Vorkäufe<br />
partizipieren lasse. Außerdem lasse man sie mit den Herausforderungen<br />
nicht allein. „Beispielsweise schaffen wir<br />
mit einer elektronischen Ackerschlagkartei Lösungen für<br />
die Betriebe.“ 500 Landwirten werde damit eine wertvolle<br />
Hilfestellung beim wachsenden Dokumentationsaufwand<br />
gegeben. Zwei Vollzeit- und eine Teilzeitkraft unterstützen<br />
auch dann, wenn es für den Betrieb in einer Kontrolle brenzlig<br />
wird. „Das schätzen die Landwirte sehr“, sagt Nießing.<br />
Auch im Bereich Pflanzenbau setzt die Agri V auf Dienstleistung:<br />
„Unsere 17 Berater geben Empfehlungen, die abgestimmt<br />
sind auf den Standort des jeweiligen Betriebes.<br />
Das nehmen wir sehr ernst und machen auch eigene Feldversuche,<br />
um fundierte Hinweise geben zu können.“<br />
Nießing bringt es auf den Punkt: „Wir versuchen einfach<br />
mehr anzubieten als der Wettbewerb.“<br />
„Wir brauchen alle Kanäle!“<br />
Die Konkurrenten sitzen aber längst nicht mehr nur in der<br />
Nachbarschaft. „Zur Realität gehört auch, dass Amazon<br />
und Co. uns das Leben ganz schön schwer machen“, sagt<br />
Nießing. Deshalb hat sich die Agri V vor drei Jahren der<br />
Plattform akoro angeschlossen. 34 Genossenschaften haben<br />
mit einer Investition von über 3,5 Millionen Euro einen<br />
digitalen Marktplatz geschaffen, auf dem sie den Kunden<br />
perspektivisch rund um die Uhr zur Verfügung stehen.<br />
„Die Landwirte wünschen sich mehr Flexibilität und einen<br />
besseren Zugang zum Markt. Das können wir mit akoro<br />
zukünftig abbilden“, erläutert Nießing.<br />
Schafft das mehr Preistransparenz für die Kunden? „Ja“,<br />
sagt Nießing. Mindert diese Transparenz nicht die Marge?<br />
Nießing: „Sehr wahrscheinlich. Aber das ist die Zukunft,<br />
und wir können es uns als Unternehmen nicht leisten,<br />
einen Trend wie den Onlinehandel zu ignorieren. Wir<br />
brauchen alle Kanäle!“<br />
Rollrasen ist der Renner<br />
„Unsere Unternehmensphilosophie war außerdem immer<br />
die Suche nach neuen Geschäftsfeldern“, sagt Nießing. Die<br />
Diversität habe sich schon oft ausgezahlt. „Als wir im Viehgeschäft<br />
im letzten Jahr Federn lassen mussten, haben wir<br />
mit den Raiffeisenmärkten und unserem Energiegeschäft<br />
konstant Geld verdienen dürfen.“ Der Rollrasenverkauf<br />
mit einem Partner aus Venlo laufe deutschlandweit hervorragend.<br />
In mehr als 200 Raiffeisenmärkten kann der zuvor<br />
online bestellte Rasen samt Dünger vom Kunden abgeholt<br />
werden. Das bestehende Rollrasenangebot werde nun auf<br />
Heckenpflanzen und Bäume sowie Bewässerungstechnik<br />
und Mähroboter ausgeweitet. Auch Dachbegrünung sei für<br />
die Zukunft ein Riesenthema.<br />
An Innovationen mangelt es nicht. Ob eigens gemischtes<br />
Pferdefutter oder ein patentierter Futterspender – die<br />
Agri V lässt sich etwas einfallen. „Auch da hilft uns die genossenschaftliche<br />
Struktur. Über unseren Vorstand, Aufsichtsrat<br />
und Beirat haben wir immer das Ohr an der Basis<br />
und treffen die Entscheidungen gemeinsam“, sagt Nießing.<br />
Ein Steckenpferd von Nießing ist seit Jahren die Öffentlichkeitsarbeit.<br />
Er ist Mitinitiator der Branchenkampagne<br />
„Mag doch jeder“, und auch die Agri V engagiert sich<br />
in den verschiedensten Projekten und Aktionen: kostenlose<br />
Blühmischungen, Baumpflanzaktionen, Informationskampagnen.<br />
„Wir sehen uns in der Verantwortung,<br />
unsere landwirtschaftlichen Kunden und Mitglieder wieder<br />
in die Mitte der Gesellschaft zu rücken.“<br />
Mit der aktuellen Situation in der Ukraine und den<br />
damit verbundenen Ausschlägen an den Rohstoffmärkten<br />
werden die Herausforderungen nicht kleiner werden.<br />
Stefan Nießing sieht die Agri V gut gerüstet: „Wir gehen<br />
da mit unseren Mitgliedern und unseren Kunden gemeinsam<br />
durch.“<br />
Berthold Brake (l.) und Stefan Nießing bilden das Duo im<br />
geschäftsführenden Vorstand der Genossenschaft.
BUCH EINS<br />
4 | Schwerpunkt<br />
AUSGABE 2 / APRIL 2<strong>02</strong>2<br />
APRIL 2<strong>02</strong>2 / AUSGABE 2<br />
BUCH EINS<br />
Schwerpunkt | 5<br />
ASPEKTE<br />
Kampf um die<br />
ländlichen Räume<br />
Guido Hitze ist seit<br />
2<strong>02</strong>0 Leiter der<br />
Landeszentrale für<br />
politische Bildung.<br />
Foto: lpb<br />
Im Vorfeld der Landtagswahl buhlen die Parteien um<br />
die Gunst der Wähler auf dem Land. Regierung und<br />
Opposition werfen sich gegenseitig vor, die ländlichen<br />
Wenn von Nordrhein-<strong>Westfalen</strong><br />
als Herzkammer der Sozialdemokratie<br />
die Rede ist, meinen<br />
die politischen Kommentatoren<br />
eher nicht die ländlichen<br />
Räume. Denn bis auf Teile in<br />
Ostwestfalen-Lippe waren die Landstriche jenseits von<br />
Ruhrgebiet und Rheinschiene in der Regel CDU-<br />
Hochburgen. Für die kommenden Landtagswahlen haben<br />
sich die Sozialdemokraten vorgenommen, die sechs<br />
Millionen Menschen in den ländlichen Räumen in NRW<br />
und ihre Wählerstimmen nicht kampflos herzugeben.<br />
Mit 296 Fragen hat die SPD-Landtagsfraktion der Landesregierung<br />
auf den Zahn gefühlt. Über das parlamen ta -<br />
rische Instrument der Großen Anfrage hat sie Auskunft<br />
verlangt, zu allen brennenden Themen der Landbevölkerung.<br />
Mobilität, Arbeit, Wohnen, Gesundheit –<br />
die Genossen wollten es genau wissen, und natürlich sind<br />
sie mit den Antworten nicht zufrieden. Pünktlich zur<br />
Landtagswahl halten sie den Regierungsparteien nun ihre<br />
Versäumnisse vor. „Die Landesregierung macht vor<br />
allem Politik für den ländlichen Raum mit Blick auf die<br />
Interessen der Landwirtschaft. Das geht an der Realität<br />
vorbei“, sagt André Stinka, SPD-Landtagsabgeordneter<br />
aus Coesfeld. Handwerk, gewerbliche Produktion und<br />
Dienstleistungen stellten mit rund 80 Prozent der Wertschöpfung<br />
längst viel bedeutendere Wirtschaftszweige<br />
dar. Die Landwirtschaft sei mit 1,5 Prozent an der Wertschöpfung<br />
nur noch eine Branche unter vielen.<br />
„Klischees von Landidylle und durch Land- und Forstwirtschaft<br />
geprägte Regionen entsprechen nicht mehr<br />
der Realität. Wir brauchen einen anderen Blick auf das<br />
Land“, sagt Stinka.<br />
„Die Genossen entdecken das Land für sich“<br />
Ein grundlegender Fehler sei zudem die holzschnittartige<br />
Trennung zwischen ländlichen und nichtländlichen<br />
Gebieten. Stinka: „Die Landesregierung hat keinen differenzierten<br />
Blick auf die ländlichen Räume.“<br />
Dabei gebe es hier große Unterschiede. Sehr ländliche<br />
Regionen mit einer guten sozioökonomischen Lage wie<br />
der Kreis Steinfurt könnten beispielsweise nicht mit<br />
dem ebenfalls ländlichen, aber wirtschaftlich schwächeren<br />
Kreis Höxter gleichgesetzt werden. „Das macht es<br />
notwendig, auch regionale Handlungskonzepte zu entwickeln“,<br />
ist Stinka überzeugt. Ein Konzept oder gar eine<br />
Räume nicht zu verstehen<br />
Von Stefan Legge<br />
Strategie vermag er bei CDU und FDP nicht zu erkennen.<br />
Die Regierungsparteien kontern mit beißender Ironie.<br />
„Es ist erfreulich, dass endlich auch die SPD den Blick auf<br />
den ländlichen Raum richtet, er ist schließlich ein<br />
wesentlicher Teil Nordrhein-<strong>Westfalen</strong>s“, kommentiert<br />
Markus Diekhoff, Sprecher der FDP-Landtagsfraktion<br />
unter anderem für Umwelt und Landwirtschaft. Auch<br />
Klaus Voussem, verkehrspolitischer Sprecher der<br />
CDU-Fraktion, wundert sich über die Sozialdemokraten:<br />
„Nach Jahren SPD-geführter Landesregierungen haben<br />
wir seit 2017 umgesteuert und Förderprogramme erst für<br />
den ländlichen Raum geöffnet.“ Zuvor hätte Rot-Grün<br />
versucht, mit dem Landesentwicklungsplan eine Weiterentwicklung<br />
kleinerer Orte zu verhindern. Auch das<br />
habe man korrigieren müssen. „Auf einmal entdecken<br />
die Genossen das Land für sich. Mein Eindruck ist aber:<br />
Die können ländliche Räume einfach nicht“, sagt<br />
Voussem.<br />
In der Zustandsbeschreibung der Unterschiede der<br />
ländlichen Räume geht er allerdings mit: „Wir haben uns<br />
viel zu lange von Bertelsmann-Studien einreden lassen:<br />
Das Land stirbt. Das Gegenteil ist der Fall. Es gibt echte<br />
Boom-Regionen und starke Wirtschaftsräume in <strong>Westfalen</strong>.<br />
Aber eben nicht überall.“ Wichtig sei, dass man<br />
den Kommunen einen Handlungsspielraum gebe, das<br />
habe man über das Gemeindefinanzierungsgesetz getan.<br />
Außerdem habe man mit der Heimatförderung viele<br />
Anreize gesetzt und vor allem für Ehrenamtliche wertvolle<br />
Unterstützung geschaffen.<br />
„KLISCHEES<br />
VON LAND-<br />
IDYLLE ENT-<br />
SPRECHEN<br />
NICHT MEHR<br />
DER<br />
REALITÄT.“<br />
André Stinka, SPD<br />
„Ehrenamt bricht weg“<br />
Heimat-Scheck, Heimat-Preis, Heimat-Werkstatt – für<br />
André Stinka und die SPD sind das nur Überschriften.<br />
„Der Begriff Heimat ist gut, auch das Ehrenamt zu<br />
fördern ist richtig, aber dafür brauchen wir echte Strukturen.“<br />
Ähnlich den Kommunalen Integrationszentren<br />
kann er sich Ehrenamtsagenturen vorstellen. Die sollen<br />
die wertvolle Arbeit vor Ort koordinieren. „Es ist doch<br />
absehbar, dass uns alleine schon aus demografischen Gründen<br />
beim Ehrenamt etwas wegbricht“, meint Stinka.<br />
Die Große Anfrage habe gezeigt, dass die Landesregierung<br />
oft nicht wisse, wie groß ein Problem tatsächlich<br />
ist oder noch wird. Beispiel Gesundheit: Hier könne die<br />
Landesregierung nicht beziffern, wie viele Hausärzte<br />
in Zukunft fehlen werden. Beispiel Fachkräftemangel:<br />
Auch hier wisse man nur, dass in Zukunft die Arbeitskräfte<br />
knapp werden. „Was wir brauchen, ist ein ressortübergreifender<br />
Kabinettsausschuss, wie er in Baden-<br />
Württemberg schon lange erfolgreich arbeitet“, sagt<br />
Stinka. Ein solcher Ausschuss könne die Zusammenarbeit<br />
der Ministerien zum Wohl der ländlichen Räume<br />
koordinieren.<br />
Klaus Voussem sieht die CDU und die Landesregierung<br />
dagegen auf dem richtigen Weg: „Wir haben in vielen<br />
Bereichen das Pendel wieder in Richtung Maß und Mitte<br />
gedreht. Beispielsweise beim Straßenbau wollte die<br />
Vorgängerregierung mit einer Streichliste wichtige Vorhaben<br />
wie Ortsumgehungen einkassieren. Das haben wir<br />
korrigiert.“ Mit der neuen Fakultät für Allgemeinmedizin<br />
in Bielefeld und der eingeführten Landarztquote<br />
unternehme man konkrete Schritte zur Aufrechterhaltung<br />
der medizinischen Versorgung. „Und hinter dem Fachkräftemangel<br />
steht oft ein Mobilitätsproblem, da haben<br />
wir mit unserem Azubi-Ticket schon erfolgreich<br />
gegengesteuert“, sagt Voussem.<br />
Sowohl die Antworten der Landesregierung auf die<br />
Fragen, als auch die Schlussfolgerungen der SPD aus<br />
ihrer Großen Anfrage gehen sehr ins Detail. Da haben sich<br />
die Autoren wirklich mit der Materie auseinandergesetzt.<br />
Die Lösungsansätze für die Herausforderungen liegen<br />
auch oft gar nicht weit auseinander. Wenn der Kampf um<br />
die Wählerstimmen auch ein Kampf um die besten<br />
Ideen ist, soll es den Menschen in den ländlichen Räumen<br />
<strong>Westfalen</strong>s nur recht sein.<br />
Der Coesfelder André Stinka sitzt für die SPD im Landtag<br />
und hat die Große Anfrage zum ländlichen Raum mitinitiiert.<br />
Foto: Max Hoffmeier<br />
Nichts los auf dem Land? Mit diesen und anderen Klischees will die SPD aufräumen. Dass Mobilität eine der großen Herausforderungen in den ländlichen Räumen ist,<br />
darin stimmen die Parteien im Landtagswahlkampf überein. Foto: Adobe Stock<br />
Finanzzuweisungen des Landes Nordrhein-<strong>Westfalen</strong><br />
ländliche Kommunen insgesamt<br />
nicht-ländliche Kommunen insgesamt<br />
1.015<br />
800<br />
854<br />
590<br />
451<br />
627<br />
424 556<br />
444<br />
381<br />
2000<br />
2005<br />
2010<br />
2015<br />
2019<br />
Finanzzuweisungen des Landes in Euro je Einwohner (Quelle: Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der SPD-Fraktion)<br />
Typisierung ländlicher Räume in <strong>Westfalen</strong> (Thünen-Institut)<br />
Typ<br />
Kreise<br />
Sehr ländlich/gute sozioökonomische Lage<br />
Olpe, Siegen-Wittgenstein, Steinfurt<br />
Sehr ländlich/weniger gute sozioökonomische Lage<br />
Höxter, Hochsauerlandkreis<br />
Eher ländlich/gute sozioökonomische Lage<br />
Borken, Coesfeld, Warendorf, Gütersloh, Herford, Paderborn<br />
Eher ländlich/weniger gute sozioökonomische Lage<br />
Soest, Lippe, Minden-Lübbecke<br />
Quelle: Antwort der Landesregierung auf die Große Anfrage der SPD-Fraktion<br />
Wie demokratisch<br />
sind wir?<br />
Der Demokratiebericht der Landeszentrale für politische<br />
Bildung hat untersucht, wie die Menschen im Land unser<br />
politisches System verstehen.<br />
Die Demokratie als Staatsform wird von den allermeisten<br />
Menschen in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> nicht infrage gestellt. Das<br />
ist ein zentrales Ergebnis des ersten „Demokratieberichts zur<br />
Lage der politischen Bildung in NRW“. Für Guido Hitze, den<br />
Leiter der Landeszentrale für politische Bildung, ist das aber<br />
kein Grund, sich entspannt zurückzulehnen: „Unsere Demokratie<br />
ist kein garantierter Dauerzustand. Sie steht und fällt<br />
mit dem Verhalten der Menschen.“ Denn das zeigen die Ergebnisse<br />
des Berichts auch: Wie die Demokratie funktioniert,<br />
sehen viele Menschen kritisch.<br />
Teil der Studie ist eine repräsentative Befragung durch das<br />
Meinungsforschungsinstitut forsa. 88 Prozent der Befragten<br />
in NRW gaben an, mit ihrer persönlichen Situation zufrieden<br />
zu sein. 84 Prozent befürworteten die Demokratie als Staatsform.<br />
Auf die Frage, ob man mit der Demokratie, wie sie tatsächlich<br />
funktioniert, zufrieden ist, gaben nur noch 70 Prozent<br />
der Befragten eine zustimmende Antwort. „Quer durch alle<br />
gesellschaftlichen Schichten gibt es Menschen, die ihre eigenen<br />
Bedürfnisse und Vorstellungen nicht ausreichend befriedigt<br />
sehen. Viele von ihnen sehen auch das Funktionieren<br />
der Demokratie kritisch“, kommentiert Hitze.<br />
Ein ähnliches Bild ergibt sich bei den Merkmalen, die der<br />
Demokratie zugeschrieben werden. Wahlen, Rechtsstaatlichkeit<br />
und Gewaltenteilung werden mit Zustimmungswerten<br />
über 90 Prozent als sehr wichtig bewertet. Je näher Demokratie<br />
an die Menschen aber heranrückt, beispielsweise in<br />
einem Konflikt, und je stärker die eigene Haltung und Toleranz<br />
gefragt ist, desto geringer ist die Zustimmung. So gehört nur<br />
für 63 Prozent der Befragten die Kompromissfähigkeit unbedingt<br />
zur Demokratie dazu. Hitze: „Demokratie wird abstrakt<br />
als richtig und wichtig verstanden, aber ein nicht geringer<br />
Teil der Bevölkerung sieht die damit verbundenen Konsequenzen<br />
als weniger wichtig an.“<br />
Verkürzung des Demokratieprinzips<br />
Eine deutliche Mehrheit der Menschen in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong><br />
(78 Prozent) ist an dem politischen Geschehen interessiert.<br />
Etwa ebenso viele glauben, dass es etwas bringt, sich<br />
politisch zu engagieren. Hier gibt es allerdings deutliche Abstufungen:<br />
Je höher der sozioökonomische Status, desto<br />
höher das Selbstwirksamkeitsgefühl.<br />
Bei der Frage, wie sich die Menschen über die Politik informieren,<br />
greift der Demokratiebericht auch auf andere Medienstudien<br />
zurück. Zwar ist das Fernsehen insgesamt nach<br />
wie vor das dominierende Medium, jüngere Befragte nutzen<br />
für die Informationsbeschaffung über politische Themen aber<br />
schwerpunktmäßig Online-Angebote und persönliche Gespräche.<br />
Nach Einschätzung von Guido Hitze lässt sich an<br />
diesem Punkt ein sozioökonomischer Effekt nicht so deutlich<br />
belegen: „Gerade in intellektuellen Kreisen verfestigen sich<br />
Strukturen, die die eigene Meinung absolut setzen. Das hängt<br />
viel davon ab, wie sich die Menschen informieren.“ Schnell<br />
sei man in einer Informationsblase gefangen. Hitze: „Wir haben<br />
es dann oft mit einer Verkürzung des Demokratieprinzips<br />
zu tun. Getreu dem Motto: Wir sind das Volk und damit die<br />
wahren Demokraten.“<br />
Auch bei der anstehenden Landtagswahl werde die Demokratie<br />
wieder auf die Probe gestellt. „Wenn Interessengruppen,<br />
Lobbyverbände oder auch Parteien ihre Positionen als<br />
alternativlos darstellen oder diese moralisch überhöhen, dann<br />
birgt das eine Eskalationsdynamik. Dann ist da kein Platz mehr<br />
für den demokratischen Kompromiss“, warnt Hitze.<br />
Ihre Meinung zum Thema?<br />
Schreiben Sie uns!<br />
Per E-Mail: redaktion@landschaft-westfalen.de oder Post:<br />
Redaktion <strong>Landschaft</strong> <strong>Westfalen</strong>, Hülsebrockstraße 2–8, 48165 Münster
BUCH EINS<br />
6 | Berichte AUSGABE 2 / APRIL 2<strong>02</strong>2<br />
Schweinestall der<br />
Zukunft im Kreis Soest<br />
Bad Sassendorf. Mehr Platz, Licht<br />
und Auslauf für die Schweine und<br />
zugleich weniger Emissionen im Sinne<br />
des Umweltschutzes: Gut zwei Jahre<br />
nach der Vorstellung des NRW-Musterprojekts<br />
im Kreis Soest ist nun der<br />
erste Spatenstich für den „Schweinestall<br />
der Zukunft“ erfolgt.<br />
In Bad Sassendorf entstehen zwei<br />
Ausbildungs- und Demonstrationsställe,<br />
in denen künftig erprobt wird,<br />
wie Schweine tier- und umweltgerechter<br />
gehalten werden können.<br />
Die Fertigstellung sei für August 2<strong>02</strong>3<br />
geplant, teilte das Landwirtschaftsministerium<br />
mit. Auf Praxistauglichkeit<br />
getestet werden unter anderem<br />
auch Liegebetten für Schweine und ein<br />
Wühlgarten. Realisiert werden die<br />
Musterställe von der Landwirtschaftskammer<br />
NRW auf dem Gelände<br />
des Versuchs- und Bildungszentrums<br />
Haus Düsse. Das Land fördert das<br />
Projekt.<br />
Neben Maßnahmen für mehr Tierwohl<br />
sollen auch technische Mittel erprobt<br />
werden, um Emissionen der Höfe zu<br />
reduzieren. Zudem werden beide<br />
Ställe mit verglasten Besucherplattformen<br />
ausgestattet. Das Projekt sei<br />
Teil einer Strategie des Landes<br />
zur Förderung des Tierwohls in der<br />
Nutztierhaltung, betonte das Ministerium.<br />
dpa<br />
Millioneninvestitionen<br />
für Autobahnen<br />
Hamm. Die für die Autobahnen im<br />
westfälischen Landesteil zuständige<br />
Autobahn GmbH des Bundes wird in<br />
diesem Jahr 530 Millionen Euro in<br />
den Neubau und Erhalt des Straßennetzes<br />
investieren. Das teilte die<br />
Niederlassung am Freitag in Hamm mit.<br />
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum<br />
sei das ein Plus von 25 Millionen.<br />
Der Großteil der Summe fließt demnach<br />
in die Autobahn A45 und die<br />
zahlreichen maroden Talbrücken auf<br />
der Verbindung zwischen dem<br />
östlichen Ruhrgebiet und Frankfurt.<br />
Die Niederlassung <strong>Westfalen</strong> ist für<br />
1400 Kilometer Autobahnen zwischen<br />
Ostfriesland in Niedersachsen und<br />
Gießen in Hessen zuständig.<br />
Deshalb kommt auch nicht die ganze<br />
Summe von 530 Millionen NRW<br />
zugute. Ein großer Teil wird derzeit für<br />
den sechsspurigen Ausbau der A1<br />
nördlich von Osnabrück in Niedersachsen<br />
ausgegeben. dpa<br />
Mitgliederschwund der<br />
evangelischen Kirchen<br />
Detmold/Bielefeld. Auch in <strong>Westfalen</strong><br />
verlieren die evangelischen<br />
Kirchen Mitglieder. Die Evangelische<br />
Kirche von <strong>Westfalen</strong> hatte 2<strong>02</strong>1 noch<br />
2,05 Millionen Mitglieder.<br />
Das entspricht einem Minus von 2,3<br />
Prozent. Neben 35.500 Todesfällen gab<br />
es 20.800 Austritte. Getauft wurden<br />
dagegen nur 11.350 Menschen. Wie die<br />
Landeskirche in Bielefeld mitteilte,<br />
gab es 1620 Neueintritte.<br />
In der kleinsten Landeskirche in NRW,<br />
der Lippischen Landeskirche,<br />
gab es im vergangenen Jahr 148.749<br />
Mitglieder. Das entspricht einem<br />
Rückgang von 2,9 Prozent. 2<strong>02</strong>1 traten<br />
im Kreis Lippe 1529 Menschen<br />
aus und 2009 Menschen starben.<br />
Dem standen 95 Aufnahmen und 592<br />
Taufen gegenüber, wie die Landeskirche<br />
in Detmold mitteilte.<br />
Die evangelische Kirche im Rheinland<br />
hatte im vergangenen Jahr 2,33 Millionen<br />
Mitglieder. Das ist ein Rückgang<br />
von 2,7 Prozent im<br />
Vorjahresvergleich. Bundesweit hat<br />
die evangelische Kirche noch<br />
19,72 Millionen Mitglieder. dpa<br />
MÜNSTER<br />
„Starke Frauen machen<br />
starke Gesellschaften“<br />
Die SPD-Politikerin Svenja Schulze aus<br />
Münster hat das Ressort gewechselt<br />
Von Stefan Legge<br />
Aus dem Umweltministerium in<br />
das Bundesministerium für wirtschaftliche<br />
Zusammenarbeit und Entwicklung<br />
– Svenja Schulze aus Münster<br />
ist derzeit die einzige Vertreterin<br />
aus <strong>Westfalen</strong> im Bundeskabinett. Für<br />
ihr neues Amt hat sie sich einiges vorgenommen:<br />
„Ich will eine feministische<br />
Entwicklungspolitik betreiben.<br />
Das bedeutet, dass wir bei unseren<br />
Projekten immer auch darauf achten,<br />
Frauen gezielt zu fördern oder mindestens<br />
gleichberechtigt einzubinden.<br />
Das ist weit mehr als Fürsorge gegenüber<br />
Frauen: Starke Frauen machen<br />
starke Gesellschaften. Unzählige Studien<br />
zeigen, dass es weniger Hunger,<br />
weniger Armut und mehr Stabilität<br />
gibt, wenn Frauen gleichberechtigt<br />
Verantwortung tragen.“<br />
Nachhaltige Lieferketten<br />
Beim Lieferkettengesetz gibt sie auf<br />
Anfrage von <strong>Landschaft</strong> <strong>Westfalen</strong> für<br />
kleine Unternehmen Entwarnung:<br />
„Das Gesetz ist auf jeden Fall ein<br />
Schritt in die richtige Richtung. Mir<br />
ist es wichtig, dass wir jetzt auch auf<br />
europäischer Ebene eine Regelung<br />
55 Sparkassen gibt es aktuell in <strong>Westfalen</strong>-Lippe.<br />
Foto: Julian Stratenschulte/dpa<br />
für faire und nachhaltige Lieferketten<br />
bekommen. Das würde noch deutlich<br />
größere entwicklungspolitische Fortschritte<br />
möglich machen. Aber es<br />
würde auch den Unternehmen in<br />
<strong>Westfalen</strong> nützen, wenn es europaweit<br />
gleiche Wettbewerbsbedingungen<br />
gibt.<br />
Dabei geht es übrigens nicht um<br />
den Bäcker oder den Kiosk um die<br />
Ecke, sondern ausdrücklich um große<br />
Unternehmen, die das auch leisten<br />
können. Ich verstehe, dass das ein<br />
Lernprozess ist, darum bietet mein<br />
Ministerium Beratungen an, um die<br />
Unternehmen bei der Umsetzung des<br />
Gesetzes zu unterstützen.“<br />
Impfstoffe aus Afrika<br />
Zur weltweiten Bekämpfung der Corona-Pandemie<br />
hat Svenja Schulze<br />
eine klare Meinung: „Die ungleiche<br />
Verteilung der Impfstoffe war weder<br />
gerecht noch nachhaltig, das beweist<br />
jede neue Virusvariante aufs Neue.<br />
Meine Botschaft ist: Impfgerechtigkeit<br />
ist der Ausweg aus der Pandemie.<br />
Mittelfristig ist die beste Lösung,<br />
eine eigene Impfstoffproduktion in<br />
Sparkassen: Die Inflation nagt an den Guthaben<br />
Münster. Die hohe Inflation nagt auch<br />
an den Guthaben von Sparkassenkunden<br />
in <strong>Westfalen</strong>. Man stelle insbesondere<br />
bei kleineren Einkommen niedrigere<br />
Kontostände fest, sagte Liane<br />
Buchholz, Präsidentin des Sparkassenverbands<br />
<strong>Westfalen</strong>-Lippe (SVWL) bei<br />
der Jahrespressekonferenz. Sie gehe<br />
davon aus, dass sich die Inflation in<br />
diesem Jahr spürbar zeigen werde.<br />
Buchholz äußerte sich kurz vor dem<br />
Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Die<br />
seither rasant gestiegenen Spritpreise<br />
dürften das Phänomen verschärfen.<br />
Buchholz rief die Europäische Zentralbank<br />
dazu auf, die Inflation energischer<br />
zu bekämpfen. Eine Leitzinserhöhung<br />
sei „zwingend notwendig“.<br />
Sturmschäden: Besonders<br />
Fichten sind betroffen<br />
Fichtenbestände sind geschwächt und bei Wind sehr anfällig. Foto: Jens Büttner/dpa<br />
Vertreterin <strong>Westfalen</strong>s im Bundeskabinett: Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze.<br />
Foto: Britta Pedersen/dpa<br />
Afrika aufzubauen – hier machen wir<br />
mit deutscher Unterstützung gerade<br />
wichtige Fortschritte. Kurzfristig geht<br />
es vor allem darum, die internationale<br />
Impfplattform Covax mit den nötigen<br />
Mitteln auszustatten. Deutschland<br />
geht hier mit gutem Beispiel<br />
voran und legt zudem einen Schwerpunkt<br />
auf Impflogistik. Denn Impfstoff<br />
ist zum Glück nicht mehr knapp,<br />
die Engpässe bestehen deshalb eher in<br />
logistischen Fragen von Kühlketten bis<br />
zu Schutzausrüstung: Die Herausforderung<br />
ist, den Impfstoff in die Länder<br />
und dort bis in die Dörfer und letztlich<br />
in die Oberarme zu bekommen.“<br />
Trotz anziehender Inflation und<br />
niedrigerer Kontostände bei Geringverdienern<br />
konnten Kundinnen und<br />
Kunden der westfälischen Sparkassen<br />
2<strong>02</strong>1 Geld beiseitelegen. Die<br />
Sparquote lag bei 15,2 Prozent – ein<br />
leichter Rückgang gegenüber dem<br />
Allzeithoch im ersten Pandemiejahr.<br />
Grund dafür seien auch die im Sommer<br />
gelockerten Corona-Maßnahmen,<br />
erklärte SVWL-Vizepräsident<br />
Jürgen Wannhoff: „Die Leute haben<br />
wieder mehr Geld ausgegeben.“ Die<br />
Sparquote sei aber immer noch historisch<br />
hoch.<br />
Immer mehr vom Ersparten fließt<br />
zudem in Wertpapiere. Die Sparkassen<br />
verzeichneten hier einen regel-<br />
Münster. Die gute Nachricht zuerst:<br />
Der Holzmarkt scheint sich etwas<br />
entspannt zu haben, jedenfalls rät das<br />
Umweltministerium des Landes<br />
Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> Waldbesitzern<br />
dazu, die aktuelle Aufnahmefähigkeit<br />
der Sägewerke zu nutzen und bei den<br />
jüngsten Stürmen gefallenes Holz zu<br />
beseitigen. Neben den großflächigen<br />
Windwürfen melden die Regionalforstämter<br />
zahlreiche kleine, nestartige<br />
Windwürfe. Die rasche Aufarbeitung<br />
und der Abtransport auch einzelner<br />
Fichten sei jetzt vordringlich,<br />
damit Borkenkäfer kein zusätzliches<br />
Brutmaterial haben.<br />
Regionale Schwerpunkte der<br />
Sturmschäden bilden die Wälder in<br />
den Regionen Sauerland und Siegen-<br />
Wittgenstein. Von den Sturmschäden<br />
sind überwiegend Nadelbäume betroffen.<br />
Die Schäden im Nadelholz<br />
Zahl der Hungernden steigt<br />
Um den Hunger in der Welt zu bekämpfen,<br />
ist für Schulze nicht die<br />
Ausweitung der Produktion von Nahrungsmitteln<br />
entscheidend: „Die<br />
Gründe dafür, dass die Zahl der Hungernden<br />
auf der Welt seit einigen Jahren<br />
wieder steigt, sind in erster Linie<br />
Kriege und Konflikte. Dann kam noch<br />
Corona hinzu. Allein im ersten Pandemiejahr<br />
sind knapp 100 Millionen<br />
Menschen in extreme Armut gerutscht<br />
und konnten für sich und ihre<br />
Familien weniger zu essen kaufen.<br />
Wenn wir also die Ursachen für den<br />
Hunger angehen wollen, geht es eben<br />
nicht nur um Fragen der Produktionssteigerung,<br />
sondern immer auch um<br />
die politischen Rahmenbedingungen<br />
für den Zugang zu Nahrung und um<br />
soziale Sicherungssysteme.“<br />
rechten Boom: Der Nettoabsatz von<br />
Wertpapieren an Privatpersonen hat<br />
gegenüber 2<strong>02</strong>0 von 1,4 auf 2,6 Milliarden<br />
Euro zugelegt – ein Plus von<br />
knapp 84 Prozent. Für die Sparkassen<br />
bedeutete das: mehr Einnahmen aus<br />
dem Provisionsgeschäft. Insgesamt<br />
erwirtschafteten die 55 Institute im<br />
Jahr 2<strong>02</strong>1 ein Ergebnis in Höhe von<br />
197 Millionen Euro, 28 Prozent mehr<br />
als im Vorjahr.<br />
Ob und wie viel davon an die Trägerkommunen<br />
ausgeschüttet wird,<br />
müssen die Verwaltungsräte der Sparkassen<br />
im Frühsommer entscheiden.<br />
Im Jahr 2<strong>02</strong>0 hätten rund 20 Institute<br />
zusammen etwa 60 Millionen Euro<br />
ausgeschüttet, sagte Wannhoff. mgl<br />
betragen NRW-weit 525.000 Festmeter,<br />
im Laubholz sind es 139.000<br />
Festmeter. Die Schäden beim Laubholz<br />
betreffen besonders die Regionen<br />
Hochstift und Ostwestfalen-Lippe.<br />
Insgesamt sind die Schäden damit<br />
deutlich geringer als nach dem letzten<br />
schweren Orkan „Friederike“ im Jahr<br />
2018. Damals waren im NRW 2 Millionen<br />
Festmeter Holz gefallen.<br />
„Damit der Wald seine vielfältigen<br />
Leistungen dauerhaft erfüllen<br />
kann, muss er vital und widerstandsfähig<br />
sein. Der Wiederaufbau des<br />
Waldes und seine Anpassung an die<br />
Folgen des Klimawandels sind zentrale<br />
Zukunftsaufgaben“, betont<br />
NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser.<br />
Die Landesregierung unterstützt<br />
den privaten und kommunalen<br />
Waldbesitz dabei mit finanziellen<br />
Hilfen. nri
APRIL 2<strong>02</strong>2 / AUSGABE 2<br />
BUCH EINS<br />
Berichte | 7<br />
MÜNSTER<br />
Reden, reden, reden<br />
Die Corona-Maßnahmen spalten.<br />
Was bedeutet das für die Zukunft?<br />
Von Nicole Ritter<br />
Eine Soziologenweisheit lautet:<br />
Die Stimmung ist schlechter als die<br />
Lage – ist die Spaltung der Gesellschaft<br />
nur ein Medienphänomen?<br />
Dazu gibt es unterschiedliche Ansichten.<br />
Aus meiner Sicht ist es so,<br />
dass es auch früher schon Themen<br />
gab, zu denen unterschiedliche<br />
Gruppen unterschiedlicher Ansicht<br />
waren. In den letzten Jahren diskutieren<br />
wir aber zunehmend Fragen,<br />
die moralisch oder in Hinblick auf die<br />
Identität aufgeladen sind. Wenn Sie<br />
an frühere Fragen wie die Arbeitsmarkt-<br />
oder Finanzpolitik denken,<br />
dann hat man darüber gestritten, aber<br />
es spielte dabei keine Rolle, ob man<br />
zusammen Fußball spielen oder im<br />
Chor singen konnte.<br />
Heute ist es aber so, dass wenn<br />
Ihre Ansichten zur Pandemie so oder<br />
so sind und Sie sich dann entsprechend<br />
verhalten, Sie vom Alltagsleben<br />
ausgeschlossen werden. Und das<br />
führt dazu, dass diese unterschiedlichen<br />
Ansichten viel direktere Auswirkungen<br />
haben auf Ihr soziales<br />
Leben und viel mehr Emotionen damit<br />
verbunden sind. Insofern ist die<br />
Spaltung derzeit sehr real.<br />
Bernd Schlipphak ist<br />
Professor am Institut für<br />
Politikwissenschaft der<br />
WWU Münster.<br />
Foto: WWU/Benedikt<br />
Weischer<br />
Wenn wir andere von der öffentlichen<br />
Teilhabe ausschließen, welche<br />
Möglichkeiten haben wir,<br />
Spaltung zu überwinden?<br />
Bis vor Kurzem hätte ich noch gesagt,<br />
dass es sehr schwierig ist, diese Differenzen<br />
kurzfristig zu überwinden und<br />
wieder in einen Normalzustand zu<br />
kommen. Tatsächlich bin ich jetzt aber<br />
angesichts der noch größeren Wahrnehmung<br />
einer Bedrohung, die sich<br />
durch den Ukraine-Krieg ergeben hat,<br />
in diesem Punkt nicht mehr ganz so<br />
skeptisch. Die Wahrnehmung einer<br />
noch größeren Bedrohung kann dazu<br />
führen, dass andere Konflikte nicht<br />
mehr so wichtig erscheinen. Eine mögliche<br />
Folge ist, dass die eine Situation<br />
die andere überlagert. Oder die Konfliktpositionen<br />
richten sich aneinander<br />
aus, sodass die Position, die ich in dem<br />
einen Konflikt einnehme, bedingt,<br />
welche ich in dem anderen einnehme.<br />
Dann würde sie multipliziert.<br />
Gibt es einen Unterschied, wenn<br />
man in Städte oder aufs Land<br />
schaut?<br />
Wir haben in unserer Studie am Cluster<br />
„Religion und Politik“ zur Identitätsbildung<br />
gezeigt, dass Menschen,<br />
die offener sind gegenüber anderen,<br />
häufiger in der Stadt leben, während<br />
Menschen, die sich vor anderen Religionen<br />
und geflüchteten Menschen<br />
fürchten, eher auf dem Land wohnen.<br />
Zugleich haben wir aber auf dem<br />
Land, vermutlich auch aufgrund einer<br />
homogeneren Bevölkerungsstruktur,<br />
ein stärkeres Maß an sozialer Fürsorge,<br />
aber auch sozialer Kontrolle beobachtet.<br />
Ob und wie die Pandemie solche<br />
Unterschiede verstärkt oder verringert,<br />
wissen wir noch nicht.<br />
Müssen wir wieder mehr auf andere<br />
zugehen?<br />
Zugehen ist vielleicht das falsche<br />
Wort, aber ich glaube schon, dass wir<br />
darauf achten sollten, dass wir alle<br />
Positionen innerhalb des demokratischen<br />
Rahmens als Positionen ernst<br />
nehmen. Aus meiner Sicht wäre es<br />
sinnvoll, wenn alle Grundbedürfnisse,<br />
die eine größere Gruppe von Menschen<br />
beschäftigen, auch auf der politischen<br />
Ebene in der Diskussion berücksichtigt<br />
würden – wie gesagt,<br />
immer im Rahmen der freiheitlich-demokratischen<br />
Grundordnung. Wenn<br />
wir das schaffen, so glaube ich, lässt<br />
sich auch ein solcher Konflikt dadurch,<br />
dass er auf politischer Ebene ausverhandelt<br />
wird, auf gesellschaftlicher<br />
Eben besser verhandeln, und er lässt<br />
sich auch besser aushalten.<br />
Es geht einfach darum zu erkennen,<br />
wo die Bedürfnisunterschiede zwischen<br />
Menschen liegen und wie wir sie<br />
diskutieren und ernst nehmen können,<br />
ohne in radikale, nicht mehr demokratische<br />
Positionen abzudriften. Wenn<br />
es gelingt, dass sich die Menschen wieder<br />
repräsentiert und vertreten fühlen<br />
in der Debatte, dann lässt sich die Spaltung<br />
in den Griff bekommen.<br />
Hohe Drittmittelquote an<br />
westfälischen Unis<br />
Düsseldorf. Im Jahr 2<strong>02</strong>0 gaben die<br />
nordrhein-westfälischen Hochschulen<br />
(ohne medizinische Einrichtungen<br />
der Hochschulen) 7,7 Milliarden Euro<br />
für Lehre und Forschung aus. Wie<br />
Information und Technik Nordrhein-<br />
<strong>Westfalen</strong> als Statistisches Landesamt<br />
mitteilt, waren das etwa 425 Millionen<br />
Euro bzw. 5,8 Prozent mehr als im<br />
Jahr 2019. Von diesen Ausgaben entfielen<br />
4,7 Milliarden Euro (60,2 Prozent)<br />
auf Personalkosten, 2,4 Milliarden<br />
Euro (30,7 Prozent) auf Sachausgaben<br />
und 0,7 Milliarden Euro (9,2<br />
Prozent) auf Investitionen.<br />
Die Einnahmen der Hochschulen<br />
(ohne Zuweisungen und Zuschüsse<br />
vom Hochschulträger) beliefen sich<br />
im Jahr 2<strong>02</strong>0 auf rund 2,2 Milliarden<br />
Euro. Knapp zwei Drittel (1,4 Milliarden<br />
Euro) der Einnahmen waren Drittmittel;<br />
das waren 3 Prozent mehr als im<br />
Jahr 2019.<br />
Unter den westfälischen Hochschulen<br />
konnte die Ruhr-Universität Bochum<br />
mit 133 Millionen Euro die meisten<br />
Drittmittel verzeichnen, das sind knapp<br />
90 Prozent der Einnahmen der Hochschule.<br />
Die Westfälische Wilhelms-Universität<br />
Münster erreichte mit 99,5<br />
Millionen Euro eine Drittmittelquote<br />
von 85 Prozent der Einnahmen. Die Zuweisungen<br />
und Zuschüsse der Hochschulträger<br />
(einschließlich der Zuwendungen<br />
an die medizinischen Einrichtungen<br />
der Hochschulen) summierten<br />
sich im Jahr 2<strong>02</strong>0 auf gut 7 Milliarden<br />
Euro. Davon fließen rund 5,3 Milliarden<br />
Euro in die staatlichen Universitäten,<br />
Technischen Hochschulen und die<br />
Sporthochschule.<br />
JETZT<br />
KOSTENLOS<br />
TESTEN.<br />
PASSWORT FÜRS W-LAN(D):<br />
KEIN NETZ<br />
Es mangelt an flächendeckendem und erschwinglichem Datennetz auf dem Land.<br />
Wir berichten darüber. Der Landbrief packt Themen an, die das Land interessieren.<br />
Der digitale Brief vom Land fürs Land.<br />
Ein Angebot der Landwirtschaftsverlag GmbH, Hülsebrockstr. 2–8, 48165 Münster, www.lv.de<br />
LandBrief_Anzeigen1.1_2<strong>02</strong>2.indd 21 09.03.2<strong>02</strong>2 09:41:22
BUCH EINS<br />
8 | <strong>Westfalen</strong> in Zahlen<br />
AUSGABE 2 / APRIL 2<strong>02</strong>2<br />
Haushaltslage<br />
Eckdaten zu Arbeit und Einkommen in <strong>Westfalen</strong><br />
Wenig Geld für<br />
harte Arbeit<br />
71 % 4.429 3,2 Mio. 66 %<br />
Arbeiten um zu leben oder leben um<br />
zu arbeiten? Von den mehr als<br />
8 Millionen Menschen in <strong>Westfalen</strong><br />
sind rund die Hälfte erwerbstätig.<br />
Viele verdienen gutes Geld. Nach Angaben<br />
des NRW-Arbeitsministeriums<br />
müssen aber 21 Prozent der Beschäftigten<br />
mit einem Niedriglohn unter<br />
12,27 Euro zufrieden sein. Besonders<br />
im Gastgewerbe ist das Niedriglohnrisiko<br />
hoch. Auch Küchenhilfen, Kraftfahrer<br />
und Reinigungskräfte bekommen<br />
häufig lediglich den Mindestlohn.<br />
der Beschäftigten<br />
arbeiten Vollzeit<br />
Diese Zahl bezieht sich auf sozialversicherungspflichtige<br />
Arbeitsverhältnisse.<br />
Minijobberinnen und Minijobber,<br />
Selbstständige und deren mitarbeitende<br />
Familienangehörige werden nicht zu<br />
den Beschäftigten gezählt.<br />
Euro brutto<br />
im Monat<br />
ist der durchschnittliche Verdienst der<br />
vollzeitbeschäftigten Arbeitnehmerinnen<br />
und Arbeitnehmer in Nordrhein-<br />
<strong>Westfalen</strong>. Im Durchschnitt müssen sie<br />
dafür 38,1 Stunden in der Woche<br />
arbeiten. Der geschlechterspezifische<br />
Lohnunterschied wird mit 18 Prozent<br />
angegeben.<br />
Sozialversicherungspflichtige<br />
Mitte 2<strong>02</strong>1 standen 78 Prozent der<br />
Erwerbstätigen in <strong>Westfalen</strong> in einem<br />
sozialversicherungspflichtigen<br />
Arbeitsverhältnis. Alle Personen älter<br />
als 14 Jahre, die mehr als eine Stunde<br />
in der Woche gegen Entgelt irgendeiner<br />
beruflichen Tätigkeit nachgehen,<br />
gelten als erwerbstätig.<br />
der Hauptverdiener<br />
sind Männer<br />
Je mehr Personen in einer Wohnung<br />
oder einem Haus in <strong>Westfalen</strong> zusammenleben,<br />
desto wahrscheinlicher ist<br />
es, dass ein Mann den größeren Anteil<br />
zum Lebensunterhalt besteuert.<br />
6 %<br />
Beamte<br />
Die größte Gruppe der Erwerbstätigen<br />
stellen die Angestellten in NRW mit<br />
70 Prozent. Arbeiterinnen und Arbeiter<br />
(12 Prozent) und Selbstständige<br />
(8 Prozent) rangieren noch vor den<br />
beamteten Beschäftigten.<br />
Lisa Kristin Kapteinat, stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende im NRW-Landtag:<br />
„1,6 Millionen Menschen in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> werden nach der Erhöhung des<br />
Mindestlohns auf 12 Euro mehr Geld im Portemonnaie haben. Gerade in Branchen ohne<br />
Tarifvertrag hilft der höhere Mindestlohn, weil mehr als 40 Prozent der dort<br />
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sofort mehr verdienen als bislang.“<br />
Erwerbsstatus der Menschen in <strong>Westfalen</strong> je Regierungsbezirk<br />
3,9 Mio.<br />
1.219<br />
1.326<br />
Erwerbstätige<br />
1.<strong>02</strong>3<br />
Erwerbstätige<br />
1.722<br />
Nichterwerbspersonen<br />
Nichterwerbspersonen<br />
1.736<br />
Erwerbstätige<br />
Haushalte<br />
Regierungsbezirk Münster Regierungsbezirk Detmold Regierungsbezirk Arnsberg<br />
gibt es in <strong>Westfalen</strong>. Der Regierungsbezirk<br />
Arnsberg führt hier die Statistik<br />
mit 1,75 Millionen vor dem Münsterland<br />
(1,25 Millionen) und Ostwestfalen<br />
(0,9 Millionen) an.<br />
49 %<br />
der Erwerbstätigen<br />
werden in Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> von<br />
der Statistik den sonstigen Dienstleistungen<br />
zugeordnet. Handel, Gastgewerbe<br />
und Verkehr kommen genau<br />
wie das produzierende Gewerbe auf<br />
etwa 25 Prozent. Land- und Forstwirtschaft<br />
auf 0,7 Prozent.<br />
46<br />
Erwerbslose<br />
970<br />
Nichterwerbspersonen<br />
Monatliches Nettoeinkommen der Haushalte<br />
in <strong>Westfalen</strong> je Regierungsbezirk<br />
32<br />
Erwerbslose<br />
506<br />
71<br />
Erwerbslose<br />
Zahlen aus 2<strong>02</strong>1 in Tausend.<br />
Erwerbstätige: Alle Personen, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen. Erwerbslose: Alle Personen, die weniger als eine Stunde pro<br />
Woche arbeiten, aber mehr arbeiten wollen. Nichterwerbspersonen: Alle Personen, die weder erwerbstätig noch erwerbslos sind.<br />
390<br />
40 %<br />
270<br />
276<br />
309<br />
der Wohnungen<br />
in <strong>Westfalen</strong> werden nur von einer<br />
Person bewohnt. Unterteilt man die<br />
Singlehaushalte nach Geschlecht,<br />
haben in allen Regierungsbezirken die<br />
Frauen die Nase vorn.<br />
14 10 20 84<br />
Unter 500€<br />
183<br />
133 126<br />
92<br />
58<br />
500€ bis<br />
unter 900€<br />
900€ bis<br />
unter 1.300€<br />
74 55<br />
110<br />
1.300€ bis<br />
unter 1.500€<br />
174<br />
141<br />
1.500€ bis<br />
unter 2.000€<br />
180<br />
145<br />
2.000€ bis<br />
unter 2.600€<br />
141<br />
122<br />
200<br />
2.600€ bis<br />
unter 3.200€<br />
3.200€<br />
und mehr<br />
68<br />
57<br />
26<br />
ohne Angabe<br />
Münster<br />
Detmold<br />
Arnsberg<br />
Quellen: BBSR, ITNRW<br />
Zahlen aus 2<strong>02</strong>1, Haushalte in Tausend.<br />
356
AUSGABE 2 / APRIL 2<strong>02</strong>2<br />
www.landschaft-westfalen.de<br />
BUCH ZWEI<br />
Paderborn: Ein Erfinder will das Mikroplastikproblem lösen Seite 11 | Lüdenscheid: Eine marode Brücke und die Folgen Seite 12 |<br />
Borken: Ein Pilotprojekt für den Moorschutz Seite 14 | Selm: Ein 900 Jahre alter Kirchenbau in neuem Glanz Seite 16<br />
UNNA<br />
Was genau ist<br />
Heimat?<br />
Künstlerinnen und Künstler<br />
auf Spurensuche für das<br />
Westfälische Literaturbüro<br />
Von Nicole Ritter<br />
Aus der Serie „Von schlafenden Häusern und Menschen, die arbeiten“. Foto: Loredana Nemes<br />
Heimat: Ist das eine Emotion oder ein Ort? Realität<br />
oder Ideal? Ist sie dort, wo wir geboren oder<br />
aufgewachsen sind? Oder hier, wo wir jetzt<br />
leben? Existiert sie vielleicht gar nicht (mehr)?<br />
Ist sie unausweichliches Schicksal oder etwas, das man sich<br />
selbst schafft? Das sind nur einige der Fragen, mit denen<br />
sich das Literatur- und Fotografie-Projekt „Experiment<br />
Heimat“ auseinandersetzt.<br />
Im Auftrag des Westfälischen Literaturbüros Unna<br />
reisten international renommierte Fotografinnen und<br />
Fotografen, Autorinnen und Autoren an neun „heimatlich“<br />
konnotierte Orte in <strong>Westfalen</strong> und erforschten den schillernden<br />
und kontroversen Begriff. Mit dabei waren unter<br />
anderem Ute und Werner Mahler, Nora Gomringer und<br />
Wladimir Kaminer. Sie besuchten die Kolvenburg in Billerbeck<br />
und die Schlösser- und Burgenlandschaft im Münsterland,<br />
das Hermannsdenkmal und den Teutoburger Wald<br />
bei Detmold, die Widukindstadt Enger sowie die ehemaligen<br />
Arbeits- und heutigen Freizeitorte Schiffshebewerk<br />
Henrichenburg in Waltrop und Henrichshütte Hattingen.<br />
Die während der vielfältigen Spurensuche entstandenen<br />
Aufnahmen kuratierte Peter Bialobrzeski, selbst Fotograf<br />
und Professor an der Hochschule der Künste in Bremen, zu<br />
einer multimedialen Ausstellung. Begleitend dazu erscheint<br />
im Kunstverlag Hartmann Books ein 280 Seiten starker<br />
Band mit Fotos und Texten, die im Rahmen des Projekts<br />
entstanden sind. Darin auch der Essay „Der Geschmack<br />
von Heimat“ der Schriftstellerin Hatice Akyün, die das<br />
Projekt journalistisch begleitet hat.<br />
„Experiment Heimat“entstand in Kooperation mit Städten,<br />
LWL-Industriemuseen, Kulturämtern sowie zahlreichen<br />
Vereinen, Einrichtungen und Initiativen in <strong>Westfalen</strong>.<br />
Die Ausstellung startet am 10. April auf der Kolvenburg in<br />
Billerbeck und wird dann bis Februar 2<strong>02</strong>3 an mehreren<br />
Orten <strong>Westfalen</strong>s zu sehen sein.<br />
www.experimentheimat.de<br />
Milliardenschaden in der Region<br />
Bei Lüdenscheid ist auf der A45 der Verkehr für Jahre<br />
unterbrochen. Die Folgen sind immens<br />
Von Dirk Wohleb<br />
Lüdenscheid. Seit dem 2. Dezember<br />
2<strong>02</strong>1 ist die Brücke über dem Rahmedetal<br />
auf der A45 voll gesperrt. Das<br />
sorgt nicht nur für Ärger bei Lüdenscheidern,<br />
die den umgeleiteten Verkehr<br />
ertragen müssen, es hat auch<br />
enorme Folgen für die Wirtschaft.<br />
Das geht aus einer aktuellen Studie<br />
hervor: „Wir haben uns für einen konservativen<br />
Ansatz bei der Berechnung<br />
der volkswirtschaftlichen Schäden<br />
entschieden und kommen trotzdem<br />
auf mindestens 1,8 Milliarden Euro,<br />
die für die Dauer einer Neubauzeit von<br />
fünf Jahren entstehen würden“, sagt<br />
Hanno Kempermann, Geschäftsführer<br />
des Instituts der deutschen Wirtschaft<br />
Köln Consult GmbH. Dabei<br />
wurden Kosten durch längere Fahrzeiten<br />
berücksichtigt.<br />
Aber auch weitere Folgen gingen<br />
in die Berechnung ein: zum Beispiel<br />
geringere Umsätze in Einzelhandel<br />
und Gastronomie oder Zurückhaltung<br />
bei Investitionen. Die Region<br />
verliert an Attraktivität: „In Zeiten<br />
des Fachkräftemangels und der Transformation<br />
der Wirtschaft strapaziert<br />
die Brückensperrung die Region, die<br />
Umwelt und die Menschen über Gebühr“,<br />
sagt Ralf Geruschkat, Hauptgeschäftsführer<br />
der Südwestlichen<br />
Industrie- und Handelskammer<br />
(SIHK) zu Hagen. Gefragt sei nun ein<br />
strenger Zeitplan für den Neubau der<br />
Brücke, an dem sich die Verantwortlichen<br />
messen lassen müssten. Doch<br />
der liegt bislang nicht vor.<br />
Mehr zum Thema auf den Seiten 12 und 13<br />
Die Pfeiler stützen die Rahmedetalbrücke nicht mehr. Foto: Markus Klümper/dpa
BUCH ZWEI<br />
10 | Wir in <strong>Westfalen</strong><br />
AUSGABE 2 / APRIL 2<strong>02</strong>2<br />
IN DEN SCHUHEN VON …<br />
… Dirk Kaiser<br />
Verein Brückenschlag Ukraine<br />
Im Mai wählen die Bürgerinnen und Bürger des Landes Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> den Landtag neu - hier<br />
illuminiert zum 75. Bestehen des Bundeslandes im August 2<strong>02</strong>1. Foto: Federico Gambarini/dpa<br />
BOCHUM<br />
Die Richtung stimmt –<br />
eigentlich<br />
Worauf es bei der Landtagswahl in<br />
Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> ankommt<br />
Von Dirk W. Erlhöfer, AGV Ruhr/<strong>Westfalen</strong><br />
Richtungweisende Wahlen? Stehen die in Deutschland nicht regelmäßig an?<br />
Selbst in der 16 Jahre währenden Ära Angela Merkels mit ihren Credos „Weiter<br />
so“ und „Sie kennen mich“? In Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> haben wir in dieser Zeit<br />
gleich mehrere Regierungsbündnisse erlebt und durchlebt. 2005 CDU/FDP,<br />
2010 eine rot-grüne Minderheitsregierung, die vorgezogenen Neuwahlen 2012<br />
mit einem im Anschluss gestärkten rot-grünen Regierungsbündnis und zuletzt<br />
eine schwarz-gelbe Regierung. Richtungsentscheidungen sind wir gewohnt<br />
in NRW. Für die Landtagswahl 2<strong>02</strong>2 können wir Arbeitgeber konstatieren:<br />
Die Richtung stimmt – eigentlich.<br />
Die Modernisierung muss weitergehen …<br />
Wirtschaftsfeindliche Regulierung und bürokratische Sonderwege sind innovations-<br />
und gründerfreundlicher Politik und ersten entschlossenen Schritten<br />
beim Bürokratieabbau gewichen. Das Klima für Unternehmertum, Innovationen,<br />
Investitionen und Arbeitsplätze ist deutlich besser geworden. Die<br />
Modernisierung unseres Landes muss aber weitergehen. Die Pandemie hat<br />
unsere Unternehmen und natürlich auch die Politik mit riesigen Herausforderungen<br />
konfrontiert. Es war eine einmalige Ausnahmesituation, die in den<br />
vergangenen beiden Jahren die politische Agenda auf den Kopf gestellt hat.<br />
Und natürlich hat dies auch den Erneuerungsprozess im Land gebremst. Dabei<br />
bleibt viel zu tun.<br />
… und das sind die Themen<br />
Infrastruktur: Die Planung, Genehmigung und der Bau von Autobahnbrücken<br />
hat oberste Priorität. Zu einem Super-GAU wie auf der A45 darf es nicht wieder<br />
kommen. Das Zehn-Punkte-Programm der Landesregierung zur Beschleunigung<br />
von Planung, Genehmigung und Bau von Verkehrsinfrastruktur muss konsequent<br />
umgesetzt und weiterentwickelt werden.<br />
Bürokratieabbau: Gerade kleine und mittelständische Unternehmen leiden<br />
unter zunehmender Bürokratie. Die Entfesselungspakete der Landesregierung<br />
haben gezeigt, dass Bürokratieabbau funktioniert. Diese Entfesselungsinitiative<br />
muss fortgesetzt werden und sich als Daueraufgabe auf allen Ebenen verstetigen.<br />
Digitalisierung: Eine Koordinierung und Steuerung der Digitalpolitik aus<br />
einer Hand ist ein zentraler Erfolgsfaktor. Die Einführung eines Digitalministeriums<br />
hat sich bewährt. Der Netzausbau muss mit dem steigenden Bedarf<br />
Schritt halten, der neue Mobilfunkstandard 5G ist vor allem für Themen wie<br />
autonomes Fahren oder Industrie 4.0 entscheidend.<br />
Hochschulen/Fachkräftesicherung: NRW hat eine starke Hochschul- und<br />
Wissenschaftslandschaft. Mit diesem Pfund müssen wir noch stärker für die<br />
Fachkräftesicherung und Innovationsfähigkeit unseres Landes wuchern. Innovationen<br />
sind Grundlage für wirtschaftlichen Erfolg, dauerhaften Wohlstand<br />
sowie soziale und gesellschaftliche Entwicklung. Und ohne Innovationen wird<br />
es uns nicht gelingen, die Themen unserer Zeit wie Digitalisierung, Dekarbonisierung<br />
oder demografischer Wandel erfolgreich zu gestalten. Gleichzeitig<br />
darf die Förderung der dualen Ausbildung, insbesondere im MINT-Bereich,<br />
nicht vernachlässigt werden.<br />
Der Leitspruch für die neue Landesregierung aus unserer<br />
Sicht: Definieren Sie nicht nur Ziele, sondern zeigen<br />
Sie auch die Wege dorthin auf.<br />
Die Arbeitgeberverbände Ruhr/<strong>Westfalen</strong> vertreten die Interessen von<br />
mehr als 420 Mitgliedern aus dem Arbeitgeberverband der chemischen<br />
Industrie <strong>Westfalen</strong>s, dem Arbeitgeberverband der Metall- und<br />
Elektroindustrie Ruhr/Vest, dem Arbeitgeberverband Ruhr-Lippe und<br />
dem Arbeitgeberverband Papier, Pappe, Kunststoff <strong>Westfalen</strong>. Dirk W.<br />
Erlhöfer ist Hauptgeschäftsführer der AGV. Foto: AGV<br />
„Wir machen gerade das, was wir am<br />
besten können“, sagt Dirk Kaiser.<br />
„Wir organisieren Gastfamilien für<br />
Menschen aus der Ukraine.“ Kaiser<br />
ist der neue Vorsitzende des Vereins<br />
Brückenschlag Ukraine e.V. in Bad<br />
Salzuflen. Menschen aus der Ukraine<br />
und Deutschland zusammenzubringen<br />
– das ist seit 20 Jahren das Ziel<br />
des Vereins. Etwa 20 Studierende aus<br />
der Stadt Lutsk kamen Jahr für Jahr<br />
zu Gastfamilien in die Kreise Lippe<br />
und Herford. Zwei Monate lernten<br />
sie die deutsche Kultur kennen und<br />
durften in Unternehmen und Verwaltungen<br />
hospitieren.<br />
„Über die Jahre ist da ein enormes<br />
Netzwerk und ein intensiver Austausch<br />
entstanden“, sagt Dirk Kaiser.<br />
350 Studierende und 200 Lehrer<br />
sind zu Bekannten und Freunden<br />
geworden. „Wir haben daher schon<br />
früh die Gefahr des Krieges heraufziehen<br />
sehen.“<br />
Kaiser, künstlerischer Leiter der<br />
Bünder Stadtkultur, ist erst 2016<br />
zum Verein gestoßen. „Ich habe<br />
keinen familiären Bezug zur Ukraine,<br />
und auch meine Großväter waren<br />
nicht als Soldaten dort. Ich fand ein-<br />
… Bernd Kochanek<br />
Vorsitzender im neu gegründeten<br />
LWL-Inklusionsbeirat<br />
Bernd Kochanek setzt sich für<br />
Inklusion ein. Foto: privat<br />
Warum braucht der <strong>Landschaft</strong>sverband<br />
<strong>Westfalen</strong>-Lippe (LWL) einen<br />
Inklusionsbeirat?<br />
Die Behinderten-Selbsthilfegruppen in<br />
<strong>Westfalen</strong> haben damit eine alte Forderung<br />
durchgesetzt. Nach dem Motto:<br />
„Nichts über uns ohne uns“ brauchen<br />
wir eine Schnittstelle zwischen den<br />
Politikern der <strong>Landschaft</strong>sversammlung,<br />
den Fachabteilungen des <strong>Landschaft</strong>sverbandes<br />
und den Betroffenen.<br />
Die UN-Behindertenrechtskonvention<br />
schreibt eine stärkere<br />
Beteiligung von Menschen mit Behinderung<br />
vor, insbesondere dort, wo<br />
Leistungen bewilligt werden. Der<br />
Schritt, beim LWL einen Inklusionsbeirat<br />
einzurichten, war daher überfällig,<br />
zumal der Beirat beim <strong>Landschaft</strong>sverband<br />
Rheinland schon jahrelang besteht<br />
und dort wertvolle Arbeit leistet.<br />
DREI FRAGEN AN …<br />
Dirk Kaiser organisiert Austausch<br />
und Hilfe. Foto: privat<br />
fach die Arbeit des Vereins klasse,<br />
und wir waren selbst Gasteltern für<br />
die Studierenden aus Lutsk.“<br />
Auf seinen Reisen in die Ukraine<br />
und im Gespräch mit den Menschen<br />
habe er eine große Sympathie<br />
entwickelt. Er freut sich auch über<br />
die Solidarität in Deutschland.<br />
Im Austausch mit den Menschen in<br />
der Ukraine sei ihm allerdings auch<br />
klar geworden, dass es große Unterschiede<br />
gibt. „Die Menschen haben<br />
eine andere Schrift, eine andere Religion<br />
und auf viele Dinge auch eine<br />
ganz andere Perspektive. Wir dürfen<br />
uns auf Menschen aus einem anderen<br />
Kulturkreis freuen.“<br />
Welche Ziele haben Sie als Vorsitzender<br />
für den Beirat?<br />
Ich bin der Sprecher eines stark zusammengesetzten<br />
Gremiums. Was wir<br />
als Forderung herausgeben, entscheiden<br />
wir gemeinsam. Das Besondere ist:<br />
Im Beirat haben ausschließlich die Vertreter<br />
der Menschen mit Behinderung<br />
Stimmrecht. Wir geben Empfehlungen<br />
an Politik und Verwaltung. Prüfpunkt<br />
für uns ist, inwieweit inklusive Lebensverhältnisse<br />
vom LWL tatsächlich angestrebt<br />
werden. Und wir wollen früh<br />
im Entscheidungsprozess gehört werden.<br />
Es bringt ja nichts, wenn wir fertige<br />
fachliche Vorlagen bekommen.<br />
Was sind aus Ihrer Sicht die die größten<br />
Herausforderungen der kommenden<br />
Jahre?<br />
Wir haben vier Bereiche bereits identifiziert:<br />
Arbeit, Bildung, Wohnen und<br />
Gesundheit/Psychiatrie. Im Bereich<br />
Arbeit stehen wir beispielsweise vor<br />
dem Problem, dass es nicht gelingt,<br />
mehr Menschen mit Behinderung in<br />
andere Arbeitsverhältnisse zu bringen,<br />
weil die Lobbyisten der Werkstattbetreiber<br />
dies torpedieren. Im Bereich<br />
Bildung hingegen stimmen einfach die<br />
Rahmenbedingungen nicht. Die inklusive<br />
Schule muss personell viel besser<br />
ausgestattet werden, damit sie ihre<br />
Aufgaben erfüllen kann. Kurzfristig<br />
muss dafür vielleicht Personal von den<br />
Förderschulen eingesetzt werden.<br />
Medaille aus<br />
Peking<br />
Laura Nolte, Bobpilotin aus Unna (l.),<br />
holte gemeinsam mit ihrer Anschieberin<br />
Deborah Levi in Peking olympisches<br />
Gold im Zweierbob. Die beiden<br />
sind damit die jüngsten Olympiasiegerinnen<br />
des Bobsports. Eine<br />
Medaille in den vorangegangenen<br />
Monobob-Läufen war der 23-Jährigen<br />
nicht vergönnt, in diesem Wettkampf<br />
hatte sie nur den vierten Platz belegt.<br />
Vorangegangen waren den Olympischen<br />
Spielen Weltcupsiege und Medaillenplätze<br />
bei den Weltcups in<br />
Winterberg und St. Moritz – Nolte<br />
war also bereits als Favoritin nach Peking<br />
gereist (siehe auch <strong>Landschaft</strong><br />
<strong>Westfalen</strong> Ausgabe 1/2<strong>02</strong>2).<br />
Bildung in<br />
Frauenhand<br />
Foto: Bezirksregierung Detmold<br />
Verantwortung für<br />
Detmold<br />
Marianne Thomann-Stahl ist erneut<br />
Regierungspräsidentin in Detmold.<br />
Die Volkswirtin kommt als Beamtin<br />
aus dem Ruhestand zurück und tritt<br />
die Nachfolge von Judith Pirscher an,<br />
die als Staatssekretärin ins Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung<br />
nach Berlin gewechselt ist. Thomann-<br />
Stahl war bereits von 2005 bis 2009<br />
Regierungspräsidentin in Detmold.<br />
Foto: Michael Kappeler/dpa<br />
Foto: Besim Mazhiqi<br />
Barbara Leufgen, Ökotrophologin<br />
und erlebnispädagogische Kompetenztrainerin,<br />
ist die erste Frau an der<br />
Spitze der Katholischen Landvolkshochschule<br />
Hardehausen und damit<br />
auch erste Laiin in diesem Amt in der<br />
mehr als 70-jährigen Geschichte des<br />
Hauses. Neben der Weiterentwicklung<br />
des Bildungsprogramms ist ihr<br />
aber auch die Seelsorge wichtig. Diese<br />
Aufgabe wird sie gemeinsam mit dem<br />
geistlichen Rektor Peter Jochem betreuen.<br />
Er ist bislang Studierendenseelsorger<br />
und Leiter der Katholischen<br />
Hochschulgemeinde Dortmund und<br />
ab Mai 2<strong>02</strong>2 in Hardehausen.
APRIL 2<strong>02</strong>2 / AUSGABE 2<br />
BUCH ZWEI<br />
Porträt | 11<br />
Ein Roboter, der die Bucht von San Francisco, den Hafen von Dubai oder die Lagune von Venedig selbstständig und mit minimaler Energie von Müll und Mikroplastik befreit – das ist die Vision von Roland Damann.<br />
Ein erster Prototyp, ähnlich dieser Animation, soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen. Fotos: SPRIND<br />
PADERBORN<br />
Aufsteigende Luftbläschen<br />
Roland Damann hat einen beeindruckenden Weg als Unternehmer hinter sich.<br />
Mit seiner neuesten Idee möchte er das Mikroplastikproblem lösen<br />
Von Stefan Legge<br />
Er kann nicht anders. Kaum hat man in seinem Büro Platz genommen,<br />
sprudelt es aus ihm heraus. Roland Damann ist ein Erfinder.<br />
50 Patente hat er über die Jahre angemeldet. Aber er ist auch<br />
Unternehmer. 350 Projekte hat er mit seinem Unternehmen<br />
enviplan aus Lichtenau-Henglarn in über 50 Ländern in 35 Jahren<br />
realisiert. Und er ist ein Visionär. Mit fast 63 Jahren konnte er die neu<br />
gegründete Bundesagentur für Sprunginnovation (SPRIND) davon überzeugen,<br />
in seine neueste Idee zu investieren.<br />
Sprunghaft ist die spannende Geschichte von Roland Damann eher nicht.<br />
Erzählt man sie der Reihe nach, dann erscheint sie eher gradlinig. Aber sprudeln<br />
wird es die ganze Zeit. Denn um aufsteigende Luftbläschen im Wasser ging es<br />
von Anfang an. „Die Begegnung mit einem Norweger auf einer Messe in Berlin<br />
war die Initialzündung“, erinnert sich Damann. Die Skandinavier hatten<br />
Mitte der 1980er-Jahre Mühe, genug Sauerstoff in die Aufzuchtbecken ihrer<br />
jungen Fische zu bringen. Damann, der nach dem Studium der Betriebswirtschaftslehre<br />
in das Stahlbauunternehmen seines Vaters in Lichtenau eingestiegen<br />
war, experimentierte auf diesem Gebiet. „Mein ,Aquatector‘ war in der<br />
Lage, das Problem für die Lachszüchter zu lösen“, sagt Damann. Die eiligst<br />
patentierte Erfindung blies feinste Bläschen mit Sauerstoff ins Wasser und ließ<br />
die jungen Fische prächtig gedeihen. So gut, dass die Lachszüchter immer<br />
mehr auf Masse setzten und bald ein ruinöser Preisverfall für junge Lachse zu<br />
beklagen war. Doch nicht nur die Lachsfarmer litten, auch die Umwelt; vor<br />
allem durch die großen Mengen an Abwasser. „Im Rückblick hat die Ausweitung<br />
der Lachsproduktion enorme Umweltschäden angerichtet. In Norwegen<br />
war sogar von einem ,Aquatector-Effekt‘ die Rede.“ Hätte es zu der Zeit schon<br />
ein Internet gegeben, Damann und sein „Aquatector“, der sich mehr als 1000<br />
Mal verkaufte, wären wohl noch viel stärker ins Kreuzfeuer der Kritik geraten.<br />
Vom Saulus zum Paulus<br />
Damann blieb trotzdem am Ball und wandte seine Erfindung auf das Abwasserproblem<br />
an. Er wurde gewissermaßen vom Saulus zum Paulus. „Schon im<br />
Mittelalter hat man mit Blasebälgen Luftblasen in Fässer mit verschmutztem<br />
Wasser eingebracht und festgestellt, dass der Dreck sich an der Oberfläche<br />
sammelt“, erklärt er. Auch bei der Klärung von Abwasser können Luftbläschen<br />
also hilfreich sein. „Unsere herkömmliche Klärtechnik setzt darauf, dass sich<br />
Sedimente am Grund eines Klärbeckens ablagern. Dazu brauchen wir riesige<br />
Becken und viel Zeit. Schaffen wir es aber, kleinste und damit stabile Luftbläschen<br />
von unten in das Abwasser einzubringen, lagern sich die unerwünschten<br />
Schwebstoffe an die Bläschen an und steigen mit ihnen nach oben.“<br />
Damit war die Geschäftsidee für sein neues Unternehmen enviplan geboren.<br />
Damann nannte das Verfahren „Mikroflotation“ und konnte nach ersten<br />
Versuchen das Versprechen geben, dass 90 Prozent der hydrophoben, also nicht<br />
wasserlöslichen Stoffe, an der Oberfläche schwammen. Abgeschöpft oder<br />
abgesaugt, können diese Stoffe in Faultürmen der Klärwerke zusätzliche Energie<br />
liefern. Der Platzbedarf der neuen Technik beträgt nur einen Bruchteil der<br />
herkömmlichen Vorklärbecken. Ein Konzept, das Damann akribisch weiter<br />
perfektionierte und damit unter anderem den Innovationspreis NRW gewann.<br />
Als kleines mittelständisches Unternehmen machte Damann zu Beginn<br />
allerdings eine ernüchternde Erfahrung. „Wenn Sie als neuer Player auf einen<br />
Markt kommen, ist es immer schwer. Im kommunalen Bereich aber ganz<br />
Mit seinem Unternehmen enviplan hat<br />
Roland Damann 350 Projekte in 50 Ländern<br />
erfolgreich umgesetzt.<br />
„WIR KÖNNEN DEN EIN-<br />
TRAG VON MIKROPLASTIK<br />
STOPPEN UND GEWÄSSER<br />
SANIEREN.“<br />
Roland Damann,<br />
Microbubbles<br />
besonders“, berichtet er. „Wir bekamen kleinere Projekte, aber es wurde<br />
immer schön aufgepasst, dass wir nicht zu viel Unordnung stiften.“<br />
Schon bald orientierte er sich daher auch wieder über die deutschen Grenzen<br />
hinweg. Klärwerke, Industrieanlagen oder Kreuzfahrtschiffe in mehr als 50<br />
Ländern arbeiten mittlerweile mit dem Mikroflotationsverfahren.<br />
Abschied von enviplan<br />
enviplan und Roland Damann – das ist eine bewegte Geschichte. „Drei feindliche<br />
Übernahmen haben wir erfolgreich abgewehrt. Das hat Kraft gekostet“,<br />
erinnert sich der Familienvater. Einen akribisch vorbereiteten Verkauf an einen<br />
italienischen Investor ließ Damann kurz vor Abschluss platzen. „Die wollten<br />
zu stark in das operative Geschäft eingreifen“, sagt er. Gewinne investierte er<br />
immer in das Unternehmen. Doch jetzt soll Schluss sein: „Die Corona-Pandemie<br />
hat mir die Augen geöffnet. Mein Geschäftsführerkollege Andreas Stein<br />
und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind stark genug, das Unternehmen<br />
alleine zu führen.“ Zwar sagt er nach wie vor „wir“, wenn er über enviplan<br />
spricht, aber das will er sich noch abgewöhnen.<br />
Doch Schluss mit enviplan heißt nicht Schluss mit Bläschen. Auf seinem<br />
Büroschild im Paderborner Technologiepark steht nun „Microbubbles“. Was<br />
verbirgt sich dahinter? „Beim Anblick meines Staubsaugerroboters ist mir klar<br />
geworden, dass Mikroflotation nicht nur in geschlossenen Becken funktionieren<br />
kann“, sagt Damann. Und so sollen die aufsteigenden Luftbläschen jetzt<br />
ein Problem in den Griff bekommen, das weltweit gigantisch ist: Mikroplastik.<br />
Mission Mikroplastik<br />
Nach Schätzungen der Vereinten Nationen werden im Jahr 300 Millionen Tonnen<br />
Plastik produziert. Tüten, Flaschen, Autoreifen – 60 Prozent der bis heute<br />
hergestellten Kunststoffe sind nach Schätzungen bereits in der Umwelt gelandet.<br />
Über Bäche und Flüsse auch vieles davon als Mikroplastik im Meer. „Wenn<br />
wir es schaffen, die Hotspots zu identifizieren, können wir Mikroflotation auch<br />
auf Flüssen, Stauseen oder im Meer zum Einsatz bringen“, glaubt Damann.<br />
Seine Vision: ein autonomes System, angetrieben mit einer Brennstoffzelle,<br />
das Mikroplastik erkennt und aus dem Wasser holt. Ein Roboter, der die Bucht<br />
von San Francisco, den Hafen von Dubai oder die Lagune von Venedig selbstständig<br />
und mit minimaler Energie von Müll und Mikroplastik befreit.<br />
„Wir kriegen das Zeug nicht mehr komplett aus den Weltmeeren, aber wir<br />
können den Eintrag stoppen und Gewässer sanieren“, ist Damann sicher.<br />
Rafael Laguna de la Vera, den Chef der SPRIND, hat er schnell überzeugt. Nach<br />
einem 80 Punkte umfassenden Kriterienkatalog und kritischen Prüfungen<br />
durch die Innovationsmanager ist es so weit: Microbubbles ist eine 100-prozentige<br />
Tochtergesellschaft der noch jungen Bundesagentur und wird von<br />
ihr finanziert. Ziel ist es, gemeinsam mit Hochschulen, Netzwerkpartnern und<br />
anderen Dienstleistern für jede Herausforderung im Projekt die passende<br />
Lösung zu finden. Sein Mitarbeiterteam aus Ingenieuren und Verfahrenstechnikern<br />
soll von derzeit acht Personen in den nächsten Monaten auf 25 anwachsen.<br />
Ob das nun die Sprunginnovation oder der „game changer“ für das Mikroplastikproblem<br />
wird? Man wird sehen. Roland Damann lässt es einfach<br />
weiter sprudeln. Der erste Prototyp eines kompakten Schwimmrings, der in<br />
seiner Mitte mit einer nebelartigen Blasenwolke Mikroplastikartikel an die<br />
Oberfläche transportiert, soll noch in diesem Jahr in Betrieb gehen.
BUCH ZWEI<br />
12 | Feature<br />
AUSGABE 2 / APRIL 2<strong>02</strong>2<br />
APRIL 2<strong>02</strong>2 / AUSGABE 2<br />
BUCH ZWEI<br />
Feature | 13<br />
LÜDENSCHEID<br />
Eine Operation an der<br />
Lebensader Sauerlandlinie<br />
Die Sperrung der Rahmedetalbrücke<br />
belastet Menschen und Wirtschaft vor Ort.<br />
Bis der Neubau fertig sein wird, werden<br />
Jahre ins Land gehen<br />
Von Dirk Wohleb<br />
Ein Künstlerkollektiv nutzte die gesperrte<br />
Rahmedetalbrücke für eine riesige Friedensbotschaft.<br />
Foto: Markus Klümper/dpa<br />
Warten auf Hilfe<br />
Seit vier Monaten herrscht in Lüdenscheid<br />
der Ausnahmezustand. Autos und Lkws<br />
schleppen sich durch die Innenstadt – eine<br />
große Belastung für die Anwohner. „Viele<br />
Bürger haben das Gefühl, vernachlässigt zu<br />
sein“, sagt Gordan Dudas, Lüdenscheider<br />
Landtagsabgeordneter der SPD. Das Land<br />
Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> will die Bürger unterstützen,<br />
wenn sie Lärmschutzfenster anschaffen.<br />
Aber auch Unternehmen sind<br />
stark betroffen. Das Land will sie durch<br />
zinsvergünstigte Kredite und Mittel aus<br />
regionalen Förderprogrammen unterstützen.<br />
Bislang sind die Hilfen aber nicht<br />
angekommen. Foto: Dieter Menne/dpa<br />
Dramatische Folgen:<br />
Wie sich die Sperrung der Rahmedetalbrücke auf Unternehmen auswirkt<br />
Längere<br />
Anfahrtszeiten<br />
der Mitarbeit<br />
76 %<br />
Gestörte<br />
Lieferketten<br />
66 %<br />
Höherer<br />
Ressourcenbedarf<br />
37 %<br />
L<br />
Lüdenscheid erstickt im Verkehrschaos. Seit am 2. Dezember<br />
2<strong>02</strong>1 die Autobahnbrücke an der A45 gesperrt wurde,<br />
hat sich der Alltag der Menschen verändert. Die Umleitung<br />
des Verkehrs führt mitten durch die Stadt. Rund<br />
20.000 Fahrzeuge quälen sich täglich durch die eng<br />
bebaute Innenstadt. Staus sind die Regel. Lärm, schlechte<br />
Luft und Abfälle, die Autofahrer in die Vorgärten werfen,<br />
bestimmen das Bild.<br />
Die Stimmung in der Stadt hat sich schlagartig verändert:<br />
Bürgermeister Sebastian Wagemeyer berichtet von<br />
Bürgern, die nachts wegen des Lärms nicht mehr durchschlafen<br />
können. Die Wohnungen der Anwohnerinnen<br />
und Anwohner sind nicht mit lärmschutztauglichen<br />
Scheiben ausgestattet. Der Einzelhandel klagt über Umsatzeinbrüche.<br />
Viele Menschen haben keine Lust mehr<br />
auf den Einkaufsbummel durch die Stadt.<br />
Mit der Sperrung der Autobahnbrücke ist die Lebensader<br />
der Region unterbrochen. Die Autobahn A45,<br />
auch als „Sauerlandlinie“ bekannt, ist ein wichtiger Verkehrsweg<br />
für die Region, Deutschland und Europa. Südwestfalen<br />
mit seinen 450.000 Einwohnern ist die Region<br />
mit der drittstärksten Wirtschaftsleistung in Deutschland<br />
– und mit zahlreichen mittelständischen Unternehmen,<br />
die in ihren Nischen Weltmarktführer sind.<br />
Sie sind darauf angewiesen, dass sie Maschinen und andere<br />
Produkte schnell transportieren können. Aber auch, dass<br />
Lieferanten sie schnell mit Rohstoffen versorgen können.<br />
Gestörte Lieferketten<br />
Vor allem die Automobilzulieferer trifft die Sperrung zur<br />
Unzeit: „Nach der ohnehin leicht abgeschwächten Konjunktur<br />
im Automotive-Bereich Ende 2<strong>02</strong>0, der anhal-<br />
tenden Corona-Pandemie und der Flutkatastrophe<br />
2<strong>02</strong>1 ist diese Situation für Lüdenscheid dramatisch“,<br />
sagt Danny Fischer, Geschäftsführer des Unternehmens<br />
IT Südwestfalen und Sprecher der Wirtschaftsjunioren<br />
Lüdenscheid. 66 Prozent der Unternemen berichten<br />
von gestörten Lieferketten infolge der Sperrung, wie eine<br />
Umfrage der Südwestfälischen Industrie- und Handelskammer<br />
zu Hagen (SIHK) zeigt. Fast jedes fünfte<br />
Unternehmen klagt über Produktionsausfälle. Logistikunternehmen<br />
benötigen mehr Fahrer für die längeren<br />
Fahrzeiten. Das bedeutet höhere Kosten und geringere<br />
Gewinne.<br />
Doch damit nicht genug: Es droht den Unternehmen,<br />
dass sie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verlieren.<br />
Die Anfahrtswege haben sich stark verlängert, geben 76<br />
Prozent der Unternehmen an. Kein Wunder, dass die<br />
Arbeitsplätze in Lüdenscheid und Umgebung stark an<br />
Attraktivität verloren haben. Unternehmen entwickeln<br />
Programme, um mehr Arbeit im Homeoffice zu ermöglichen.<br />
Manche Unternehmen greifen auch zu unkonventionellen<br />
Mitteln: In der Schraubenfabrik<br />
Betzer in Lüdenscheid beginnt die Frühschicht bereits<br />
um vier Uhr morgens, damit die Mitarbeiter pünktlich<br />
zur Arbeit kommen können.<br />
Doch wie konnte es so weit kommen? So plötzlich<br />
die Sperrung der Brücke kam, so lange waren die<br />
Schäden doch bekannt. Und nicht nur die Brücke über<br />
das Rahmedetal ist marode, insgesamt 65 Brücken<br />
auf der Sauerlandlinie müssen renoviert werden. Schon<br />
seit Jahren steht der Ausbau der Autobahn auf sechs<br />
Spuren an. Die Schäden an der Brücke im Rahmedetal<br />
sind also schon lange bekannt, aber nichts ist passiert.<br />
Auch im Rahmedetal selbst leben<br />
Menschen, die von der Brückenbaustelle<br />
massiv betroffen sein werden.<br />
Foto: Dieter Menne/dpa<br />
Drohender<br />
Produktionsausfall<br />
17 %<br />
Umfrage unter Unternehmen in der Region. Mehrfachnennungen möglich.<br />
Umfrage unter Unternehmen in der Region. Mehrfachnennungen möglich.<br />
Quelle: Südwestfälische Industrie- und Handelskammer zu Hagen (SIHK)<br />
Nun blieb als Notbremse nur die Sperrung der Brücke.<br />
Der Grund dafür: Das Stahlgerüst ist zerbeult, das Metall<br />
rissig. Messungen haben ergeben, dass sich die dünnen<br />
Bleche im Gerüst verformt haben. Elfriede Sauerwein-<br />
Braksiek, Direktorin der Niederlassung <strong>Westfalen</strong> der<br />
Autobahn GmbH des Bundes, vergleicht das mit zwei<br />
aufeinandergestellten Getränkedosen, die das Gewicht<br />
eines Menschen aushalten können. Wenn aber die untere<br />
Dose einen Knick hat, bricht alles zusammen.<br />
Das war so nicht geplant. „In der Regel werden die<br />
Brücken unter rollendem Rad gebaut“, sagt Sauerwein-<br />
Braksiek. Das heißt, dass der Verkehrsweg nicht<br />
vollständig gesperrt werden muss. Besteht eine Brücke<br />
aus zwei Teilen, wird der Verkehr auf einen Teil gelegt,<br />
der andere abgerissen und neu gebaut. Bei einer einteiligen<br />
Brücke wird ein Überbau auf Hilfspfeilern errichtet<br />
und anschließend verschoben, so wie etwa bei der Lennetalbrücke<br />
bei Hagen. Dann müssten die Brücken theoretisch<br />
nicht geschlossen werden.<br />
Bau in Rekordzeit gefordert<br />
Doch was passiert nun in Lüdenscheid? „Der Neubau der<br />
Brücke muss in Rekordzeit und mit minimalem bürokratischem<br />
Aufwand realisiert werden“, sagt Danny Fischer<br />
von den Wirtschaftsjunioren Lüdenscheid. An den<br />
finanziellen Mitteln liegt es nicht. Der Bund hat entsprechende<br />
Mittel eingeplant: „Der sechsspurige Ausbau<br />
der A45 steht im vordringlichen Bedarf des aktuellen<br />
Verkehrswegeplans 2030 und ist damit finanziert“,<br />
erläutert Elfriede Sauerwein-Braksiek. Ein konkreter Zeitplan<br />
liege aber derzeit weder für den Neubau der<br />
Rahmedtalbrücke noch für die anderen Brücken und den<br />
sechsspurigen Ausbau der A45 vor. „Hier muss priorisiert<br />
werden, welche Brückenneubauten innerhalb der<br />
notwendigen Planfeststellungsverfahren möglich<br />
sind“, sagt Autobahn-Direktorin. Das Problem ist das<br />
komplizierte deutsche Bau- und Verwaltungsrecht. Die<br />
Frage, die im Raum steht, ist, ob eine vollständige Neuplanung<br />
für den Neubau der Brücke notwendig ist? „Nein,<br />
der Planungsauftrag, der im Jahr 2015 vergeben wurde,<br />
ist Grundlage der jetzt wieder forcierten Planungen.<br />
Gleichzeitig wird geprüft, wie das Genehmigungsverfahren<br />
verkürzt werden kann“, betont Sauerwein-Braksiek.<br />
„Ich<br />
rechne<br />
mit einer<br />
Beeinträchtigung<br />
von<br />
fünf bis<br />
sieben<br />
Jahren.“<br />
Danny Fischer,<br />
IT-Unternehmer in<br />
Lüdenscheid<br />
Das Land Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> hat ein Zehn-Punkte-<br />
Programm vorgelegt, um den Bau von Brücken zu<br />
beschleunigen. Wesentlicher Punkt ist der Verzicht auf<br />
ein erneutes Planfeststellungsverfahren bei Bauten,<br />
die veraltete ersetzen. Das ist möglich, wenn es bereits<br />
einen gesetzlichen Planungsauftrag gibt. „Der Ersatzbau<br />
der Rahmedetalbrücke darf dann ohne Planfeststellung<br />
auf sechs Spuren erweitert werden. Das erleichtert und<br />
beschleunigt die Planung erheblich“, teilt das Verkehrsministerium<br />
des Landes Nordrhein-<strong>Westfalen</strong> auf<br />
Anfrage mit. Auch ein Verzicht auf eine erneute Umweltverträglichkeitsprüfung<br />
soll Zeit sparen. Da bereits die<br />
Prüfung für das bestehende Bauwerk vorliegt, soll auf<br />
eine neue zeitaufwendige Prüfung verzichtet werden.<br />
Komplizierte Vergabe<br />
Es sind aber auch die umfangreichen Vorgaben bei der<br />
Auftragsvergabe, die viel Zeit kosten. Bei einer herkömmlichen<br />
Ausschreibung wird ein Bauwerk von Experten<br />
zunächst in allen Details geplant und beschrieben.<br />
Erst im Anschluss wird der Bauauftrag ausgeschrieben.<br />
Das soll sich jetzt im konkreten Fall ändern: „Planung<br />
und Bau werden aus einer Hand geliefert und effizient<br />
abgestimmt“, heißt es aus dem Verkehrsministerium<br />
Nordrhein-<strong>Westfalen</strong>s. Dieses vereinfachte Vergabeverfahren<br />
soll Zeit sparen.<br />
Auch der Bund will für Tempo sorgen. Bundesverkehrsminister<br />
Volker Wissing hat Lüdenscheids Bürgermeister<br />
Sebastian Wagemeyer zum Bürgerbeauftragten<br />
bestellt. Er ist Ansprechpartner für Bürger und Unternehmen<br />
und soll zwischen allen Beteiligten vermitteln.<br />
Nun geht es im ersten Schritt darum, die Brücke abzureißen.<br />
Auch das ist eine Zeitfrage. Das Abtragen der Brücke<br />
mit einem Gerüst würde viel Zeit in Anspruch<br />
nehmen. „Mit einer Sprengung können wir erheblich Zeit<br />
sparen und die Prozesse für den Neubau schneller voranbringen“,<br />
sagt Bundesverkehrsminister Wissing.<br />
Doch selbst wenn die Brücke noch dieses Jahr gesprengt<br />
und der gesamte Prozess beschleunigt wird,<br />
stellen sich Unternehmer wie Danny Fischer auf eine lange<br />
Wartezeit und auf eine Geduldsprobe ein: „Ich rechne<br />
mit einer tatsächlichen Beeinträchtigung durch die Brückensperrung<br />
von rund fünf bis sieben Jahren.“
BUCH ZWEI<br />
14 | Berichte<br />
AUSGABE 2 / APRIL 2<strong>02</strong>2<br />
So schön kann<br />
das Dorfleben sein<br />
Münster. Leben auf dem Land - das<br />
erscheint manchem müden Städter<br />
wieder richtig sexy. Nach jüngeren<br />
Umfragen möchte die Mehrzahl der<br />
Menschen in Deutschland in Dörfern<br />
oder Kleinstädten leben. Dabei sind<br />
jenseits der Idylle die durchaus vorhandenen<br />
Problemfelder in ländlichen<br />
Räumen keineswegs neu, sondern<br />
schon seit Längerem bekannt: Es gibt<br />
eben kein 3G an jeder Milchkanne,<br />
die ärztliche Versorgung wird abgebaut,<br />
der nächste Supermarkt ist<br />
kilometerweit entfernt, und die Busverbindung<br />
fehlt. Hier sind gute<br />
Konzepte und Menschen gefragt, die<br />
sich für ihr Dorf engagieren.<br />
„Ländliche Räume brauchen eine<br />
zukunftsfeste Gesamtstrategie“, sagt<br />
Matthias Löb, Vorsitzender des Westfälischen<br />
Heimatbundes (WHB).<br />
Was gerade das bürgerschaftliche<br />
Engagement in diesem Bereich<br />
leistet - das zeigt das Projekt „Dorfideen<br />
mit Weitblick“ des WHB in<br />
Kooperation mit dem Wochenblatt<br />
für Landwirtschaft und Landleben aus<br />
dem Landwirtschaftsverlag.<br />
Die Initiatoren haben nun eine Handreichung<br />
vorgelegt, die originelle<br />
Ideen und inspirierende Beispiele aus<br />
der Praxis vorstellt. Ergänzt werden<br />
diese durch Statements von Fachwissenschaftlern<br />
aus der aktuellen Forschung<br />
und einen umfangreichen<br />
Serviceteil mit Hinweisen zu Fördermöglichkeiten<br />
und Netzwerken.<br />
www.whb.nrw<br />
Auf nach draußen:<br />
ein neues Magazin<br />
für Kinder<br />
Münster-Hiltrup. MATSCH! in den<br />
Händen halten – ohne dabei dreckig<br />
zu werden. Das ist ab sofort möglich:<br />
MATSCH! ist ein neues Magazin aus<br />
der Wochenblatt-Familie des Landwirtschaftsverlags,<br />
das sich an alle<br />
Kinder ab fünf Jahren richtet.<br />
PADERBORN<br />
„Die Zukunft der Kirche<br />
entscheidet sich jetzt!“<br />
Kann sich die katholische Kirche selbst reformieren?<br />
Fragen an Jan Hilkenbach, stimmberechtigtes Mitglied beim „Synodalen Weg“<br />
Von Stefan Legge<br />
Herr Hilkenbach, ist der Synodalversammlung<br />
mit ihren Beschlüssen<br />
zu Zölibat, Frauenweihe, Sexualmoral<br />
und kirchlichem Arbeitsrecht<br />
ein Befreiungsschlag<br />
gelungen?<br />
Zunächst freue ich mich über die positive<br />
Berichterstattung zu unserem<br />
Treffen in Frankfurt. Aber das war nur<br />
ein ganz kleiner Schritt auf einem weiten<br />
Weg. Wir haben in Frankfurt nur<br />
drei von 14 Texten in der zweiten Lesung<br />
behandelt, und nur einer davon<br />
– über die Bestellung des Diözesanbischofs<br />
– war ein konkreter Handlungstext.<br />
Viele Beschlüsse stehen<br />
noch aus, und mindestens genauso<br />
wichtig ist die Umsetzung. Als Befürworter<br />
möglichst weitreichender Reformen<br />
möchte ich daher den Tag<br />
nicht vor dem Abend loben.<br />
Haben Sie Zweifel, dass die Bischöfe<br />
am Ende mitziehen?<br />
„Es gibt in der Synodalversammlung<br />
keine Konfliktlinie zwischen Bischöfen<br />
und Laien. Die 230 Mitglieder bilden<br />
einen Querschnitt der katholischen<br />
Kirche in Deutschland. Eine<br />
alphabetische Sitzordnung verhindert<br />
zudem eine Fraktionsbildung. Aber es<br />
gibt natürlich Gegensätze. Nicht immer<br />
sind es Bischöfe, die an aus meiner<br />
Sicht schwierigen Positionen festhalten<br />
wollen. Am Ende brauchen wir<br />
Zweidrittelmehrheiten sowohl der<br />
Versammlung insgesamt, der Bischöfe<br />
und auf Antrag auch der weiblichen<br />
Mitglieder.<br />
Ist denn der Synodale Weg geeignet,<br />
die Kirche zu reformieren?<br />
Er ist ohne Alternative. Dieser Prozess<br />
ZUR PERSON<br />
Jan Hilkenbach ist hauptamtlicher Vorsitzender des BDKJ-Diözesanverbandes<br />
Paderborn – dem Dachverband der katholischen Jugendverbände im Erzbistum.<br />
Er vertritt das Diözesankomitee des Erzbistums im Zentralkomitee der deutschen<br />
Katholiken und wurde dort als stimmberechtigtes Mitglied in den „Synodalen Weg“<br />
gewählt. Nach Rekordaustrittszahlen und Negativschlagzeilen wurden die Ergebnisse<br />
der dritten Synodalversammlung zur „Erneuerung der Kirche“ zuletzt gelobt.<br />
Foto: Besim Mazhiqi/Erzbistum Paderborn<br />
ist eingeleitet worden, um die systemischen<br />
Ursachen, die sexualisierte<br />
Gewalt in der katholischen Kirche<br />
möglich gemacht haben, zu verändern.<br />
Um die richtigen Ableitungen<br />
wird in einer mühevollen Textarbeit<br />
gerungen. Vielen gehen die vorgeschlagenen<br />
Formulierungen nicht<br />
weit genug, anderen ist das schon zu<br />
viel.<br />
Aber die katholische Kirche ist<br />
doch keine Demokratie. Welche<br />
Wirkung haben die Beschlüsse?<br />
Die Deutsche Bischofskonferenz hat<br />
einstimmig für diesen Synodalen Weg<br />
votiert und das ZdK dazu eingeladen.<br />
Wir erwarten daher, dass man diesen<br />
Weg mit einer großen Konsequenz<br />
geht. Mir ist auch wichtig, dass es kein<br />
weiterer Dialogprozess ist, sondern<br />
ein echter Reformprozess.<br />
Die Ernsthaftigkeit, mit der die<br />
Bischöfe daran teilnehmen, lässt erkennen,<br />
dass auch sie den Ernst der<br />
Lage verstanden haben. Trotzdem<br />
weiß ich natürlich, dass nicht alle Beschlüsse<br />
eins zu eins umgesetzt werden,<br />
nur weil die Synodalen die Hand<br />
gehoben haben.<br />
Was erwarten Sie denn konkret?<br />
Ich bin realistisch. Wir werden am<br />
Ende des Synodalen Weges nicht das<br />
Zölibat abgeschafft haben und Frauen<br />
zu Priesterinnen weihen. Es muss aber<br />
zu spürbaren Veränderungen kommen.<br />
Das, was auf Diözesanebene umsetzbar<br />
ist, muss jetzt umgesetzt werden.<br />
Das sind wir den Betroffenen<br />
schuldig. In den letzten zwölf Jahren,<br />
seit Bekanntwerden der Dimension<br />
der Missbrauchsfälle, ist zu wenig passiert.<br />
Meiner Ansicht nach entscheidet<br />
sich gerade, ob die Kirche im Deutschland<br />
des 21. Jahrhunderts noch eine<br />
Rolle spielt oder nicht.<br />
Kann Rom am Ende den Reformeifer<br />
stoppen?<br />
Weltkirche ist mehr als Rom, und die<br />
Themen des Synodalen Weges sind<br />
keine Themen speziell der deutschen<br />
Kirche. Aber es stimmt, dass wir in der<br />
Vergangenheit schon erlebt haben,<br />
dass unsere Vorschläge im Vatikan<br />
keinen Anklang fanden.<br />
Für diesen Prozess erwarte ich,<br />
dass nicht nur die Bischöfe, sondern<br />
auch das Synodalpräsidium empfangen<br />
werden und man sich intensiv mit<br />
unseren Beschlüssen auseinandersetzt<br />
– beispielsweise im ausgerufenen<br />
weltweiten synodalen Prozess. Wir<br />
können aber auch in Deutschland<br />
schon jetzt eine ganze Menge machen,<br />
zum Beispiel das kirchliche Arbeitsrecht<br />
reformieren.<br />
Gut Ammeloe: Vorzeigeprojekt<br />
für kommunale Wälder<br />
Auf 44 Seiten dreht sich alles um<br />
Themen wie Umwelt, Natur, Wald,<br />
Landwirtschaft und Ernährung. Dazu<br />
gibt es einen Mix aus Geschichten<br />
zum Lesen oder Vorlesen, jede Menge<br />
Rätsel und Experimente sowie zahlreiche<br />
Anleitungen zum Selbermachen.<br />
Das Magazin ist als Begleiter von der<br />
Vorschulzeit bis hin zum Übergang an<br />
die weiterführenden Schulen gedacht.<br />
„Matsch im eigentlichen Sinne besteht<br />
aus zwei ganz einfachen und gleichzeitig<br />
hoch spannenden Elementen:<br />
Wasser und Erde. Wir möchten mit<br />
dem Heft vermitteln, dass die wahren<br />
Schätze direkt vor unseren Füßen<br />
in der Natur liegen, und wollen sie mit<br />
allen Sinnen erfahren“, erläutert Patrick<br />
Liste, Chefredakteur des Wochenblatts.<br />
Sein Team hat das Magazin gemeinsam<br />
mit der Landleben-Bloggerin,<br />
dreifachen Mutter und Journalistin<br />
Julia Nissen entwickelt. Im April geht<br />
es bundesweit an den Start und soll<br />
von da an monatlich erscheinen - garantiert<br />
ohne Einhörner und Glitzer.<br />
www.matsch-magazin.de<br />
Borken. Der <strong>Landschaft</strong>sverband<br />
<strong>Westfalen</strong>-Lippe (LWL) möchte rund<br />
75 Hektar seines Forstguts Ammeloe<br />
im Kreis Borken zu einem Klima- und<br />
Biodiversitätsgebiet entwickeln. Erste<br />
Pläne dafür wurden den Mitgliedern<br />
des Klimaausschusses vorgestellt.<br />
„Ziel ist es, entwässerte Bereiche<br />
wieder so weit zu bewässern, dass<br />
dort ein artenreiches und klimafreundliches<br />
Moor entsteht“, erklärte<br />
LWL-Direktor Matthias Löb. In entwässerten<br />
Böden finden Zersetzungsprozesse<br />
statt, die große Mengen an<br />
CO2 freisetzen. In sogenannten wiedervernässten<br />
Böden hingegen werden<br />
organische Reste von Wurzeln,<br />
Holz oder Laub unter sauerstoffarmen<br />
Bedingungen zu Torf umgewandelt.<br />
Auf diese Weise wird der Kohlenstoff<br />
dauerhaft gebunden. Löb: „Der LWL<br />
kommt damit seinem ambitionierten<br />
Ziel, bis 2030 klimaneutral zu werden,<br />
ein Stück näher.“<br />
Das LWL-Forstgut Ammeloe ist<br />
mit mehr als 600 Hektar die größte<br />
Fläche im Besitz des Kommunalverbandes.<br />
Der LWL-Bau- und Liegenschaftsbetrieb<br />
hatte zwischen 2010<br />
und 2012 versuchsweise bereits eine<br />
stark vernässte Ausgleichsfläche von<br />
etwa 9 Hektar im Gebiet „Schwattes<br />
Gatt“ aufgestaut. Löb: „Die Bäume<br />
stehen dort nun wieder im Moor und<br />
sterben ab – in diesem Fall ein positives<br />
Zeichen, da Bäume viel Feuchtigkeit<br />
aus dem Moor herausziehen.“<br />
Moorreste erhalten<br />
Nun soll mit diesen Erfahrungen eine<br />
weitere Fläche im Naturschutzgebiet<br />
„Lüntener Wald“ wiedervernässt<br />
werden. Bislang läuft ein Entwässerungsgraben<br />
durch diese Bereiche der<br />
LWL-Liegenschaft. LWL-Baudezernent<br />
Urs Frigger erläutert dazu:<br />
„Durch Anstauung dieser Gräben ließe<br />
sich mit relativ wenig Aufwand der<br />
Grundwasserspiegel großflächig anheben.“<br />
Einerseits entstünde so ein<br />
großes CO2-speicherndes Ökosystem,<br />
eine sogenannte CO2-Senke,<br />
andererseits würden noch vorhandene<br />
Moorreste in dem Gebiet erhalten<br />
bleiben. „Dass für ein neues Klimaund<br />
Biodiversitätsgebiet Bäume weichen<br />
müssen, klingt erst mal paradox“,<br />
sagt Frigger. „Allerdings binden<br />
Moore doppelt so viel CO2 wie Wälder<br />
– sie sind die größten Speicher von<br />
Kohlenstoff, die die Natur zu bieten<br />
hat, und damit unglaublich wertvoll<br />
für ein gesundes Klima.“<br />
Auf dem Forstgut Ammeloe soll wieder ein Moor entstehen. Foto: LWL<br />
Das „LWL-Klima- und Biodiversitätsgebiet<br />
Forstgut Ammeloe“ soll zu einem<br />
bundesweiten Vorzeigeprojekt<br />
für kommunal geführte Wälder werden.<br />
Der LWL geht bei seiner Umsetzung<br />
aktuell von etwa 200.000 Euro<br />
Kosten aus. Wissenschaftlich begleitet<br />
werden soll das Projekt von Fachleuten<br />
des LWL-Museums für Naturkunde<br />
in Münster unter Einbindung<br />
der wichtigen Akteure.
APRIL 2<strong>02</strong>2/ AUSGABE 2<br />
BUCH ZWEI<br />
Berichte | 15<br />
MÜNSTER<br />
<strong>Landschaft</strong>sversammlung mit<br />
Sorgen um Haushalt<br />
Die LWL-<strong>Landschaft</strong>sversammlung wählte einen neuen Direktor und<br />
verabschiedete ein Rekord-Ausgabevolumen<br />
Von Stefan Legge<br />
Die Würfel waren schon gefallen,<br />
als sich die 116 anwesenden Mitglieder<br />
der <strong>Landschaft</strong>sversammlung<br />
des <strong>Landschaft</strong>sverbandes <strong>Westfalen</strong>-<br />
Lippe (LWL) auf den Weg an die Wahlurnen<br />
machten. Dass Georg Lunemann,<br />
Kämmerer und Erster Landesrat<br />
des LWL, zum neuen Direktor des<br />
Kommunalverbandes gewählt würde,<br />
war bereits bekannt und nur noch<br />
Formsache. Mit 82 Jastimmen installierten<br />
die Parlamentsmitglieder den<br />
neuen Chef für 18.000 Beschäftigte<br />
und läuteten das Ende der Amtszeit des<br />
amtierenden Direktors Matthias Löb<br />
zum 30. Juni ein. Die Mehrheitsfraktionen<br />
von CDU und Bündnis 90/Die<br />
Grünen haben damit eine umstrittene<br />
Personalentscheidung durchgesetzt,<br />
bei der offenkundig nicht die Amtsführung<br />
des scheidenden LWL-Direktors,<br />
sondern die politische Farbenlehre<br />
die entscheidende Rolle gespielt hat.<br />
Der 54-jährige Lunemann, derzeit<br />
zuständig für Finanzen, Personal,<br />
Digitalisierung und Klimaschutz,<br />
stammt aus Olfen. Bevor er von 2010<br />
bis 2015 als Kämmerer der Stadt Gelsenkirchen<br />
tätig war, arbeitete er bereits<br />
zwölf Jahre für den LWL. 2015<br />
kehrte er als Landesrat zum <strong>Landschaft</strong>sverband<br />
zurück.<br />
Dass der LWL vor enormen Herausforderungen<br />
steht, wurde in der<br />
Haushaltsdebatte deutlich. Für das<br />
Jahr 2<strong>02</strong>2 hat die LWL-<strong>Landschaft</strong>sversammlung<br />
mit großer Mehrheit<br />
ein Ausgabenvolumen von insgesamt<br />
rund 3,7 Milliarden Euro verabschiedet.<br />
Das ist der größte Haushalt seit<br />
Bestehen des LWL. Für die 27 Kreise<br />
und kreisfreien Städte in <strong>Westfalen</strong>-<br />
Lippe bedeutet das: Der LWL lässt den<br />
Hebesatz zur <strong>Landschaft</strong>sumlage von<br />
15,4 Prozent im Jahr 2<strong>02</strong>1 auf nunmehr<br />
15,55 Prozent im Jahr 2<strong>02</strong>2 ansteigen.<br />
Die Mitgliedskörperschaften<br />
des LWL müssen für das Jahr 2<strong>02</strong>2<br />
über 2,5 Milliarden Euro überweisen.<br />
Dies sind rund 155 Millionen Euro<br />
mehr als 2<strong>02</strong>1. Durch den neuerlichen<br />
Eingriff in sein Eigenkapital, die sogenannte<br />
Ausgleichsrücklage mit<br />
44,3 Millionen Euro, verbleibt dem<br />
LWL künftig noch eine Rücklage von<br />
rund 75 Millionen Euro.<br />
In ihren Reden blickten vor allem<br />
die Oppositionsparteien sorgenvoll in<br />
die Zukunft. Der SPD-Fraktionsvorsitzende<br />
Karsten Koch wies darauf<br />
Georg Lunemann, bisher Kämmerer und Erster Landesrat des LWL,<br />
wird den Verband ab 1. Juli als Direktor führen. Foto: LWL<br />
hin, dass Sozialausgaben in der Zukunft<br />
weiter wachsen würden, sodass<br />
die Zahllast bei der <strong>Landschaft</strong>sumlage<br />
nach der jüngsten Steuerschätzung<br />
steigen werde. „In einer Größenordnung,<br />
die einige Kreise und Städte<br />
nicht verkraften können“, sagte Koch.<br />
Für die FDP/FW-Fraktion mahnte der<br />
Vorsitzende Arne Hermann Stopsack:<br />
„Für die kommunale Familie kommen<br />
schwierige Jahre. Es muss unser politisches<br />
Ziel sein, den Aufwuchs der<br />
Zahllast gegenüber der Mittelfristplanung<br />
deutlich zu reduzieren.“<br />
Auch die CDU-Fraktionsvorsitzende<br />
Eva Irrgang, Landrätin im Kreis Soest,<br />
teilt diese Einschätzung: „Einbrechende<br />
Steuereinnahmen infolge der<br />
Corona-Pandemie, immer neue Sozialstandards<br />
und eine dynamische<br />
Kostenentwicklung werden uns an<br />
die Grenzen unserer finanziellen Leistungsfähigkeit<br />
führen.“ Irrgang forderte<br />
Bund und Land auf, „die notwendige<br />
finanzielle Unterstützung<br />
frühzeitig bereitzustellen, aber auch<br />
kostentreibende Sozialstandards mit<br />
Geld zu hinterlegen“.<br />
OWL feiert den<br />
„UrbanLand Sommer“<br />
Detmold. Auf sieben großen Festen<br />
sollen die Projekte und Ideen des<br />
Strukturförderprogramms Regionale<br />
2<strong>02</strong>2 in Ostwestfalen (OWL) präsentiert<br />
werden. Im Mittelpunkt steht die<br />
Idee des „UrbanLand”, das Leben<br />
und Arbeiten zwischen ländlichen<br />
Räumen und Städten ermöglicht. In<br />
ganz OWL wurden Ideen für die Zukunftsfähigkeit<br />
der Region rund um<br />
dieses Thema entwickelt. 135 Millionen<br />
Euro an Fördermitteln werden<br />
insgesamt in Regionale-Projekte<br />
investiert. Dazu zählen unter anderem<br />
der Bildungscampus Gesundheit<br />
Weser-Egge, das Welcome-Haus<br />
Espelkamp und das MonoCab OWL,<br />
das eine Einschienenbahn auf<br />
stillgelegte Bahntrassen schickt. Viele<br />
Ideen und Pläne kreisen um die<br />
Themen Mobilität, Fachkräfte und<br />
Klimaschutz – und um die Frage,<br />
wie ein Ausgleich unterschiedlicher<br />
Interessen gelingen kann.<br />
Der „UrbanLand Sommer“ soll zum<br />
Schaufenster der Regionale-Projekte<br />
werden. Bei Festen in Lemgo (1. Mai,<br />
Kreis Lippe), Löhne (7./8. Mai, Kreis<br />
Herford), Bielefeld (28./29. Mai),<br />
Warburg (1.-3. Juli, Kreis Höxter),<br />
Hille (27./28. August, Kreis Minden-<br />
Lübbecke), Gütersloh (4. September)<br />
und Paderborn (18. September) ist<br />
mit der „UrbanLand-Welt“ auf<br />
300 Quadratmeter eine Info- und<br />
Aktionsfläche zu Gast. Experimentierstationen<br />
laden ein, in die Themen<br />
des Programms einzutauchen. Seit<br />
fünf Jahren arbeitet OWL auf das<br />
Regionale-Jahr 2<strong>02</strong>2 hin. „Es geht<br />
darum, die Region kräftiger und<br />
widerstandsfähiger für die Zukunft zu<br />
machen“, sagt Herbert Weber, Leiter<br />
der OWL GmbH, bei der die<br />
Organisation des Programms liegt.<br />
Mehr unter: www.urbanland-owl.de<br />
WERTHER<br />
Regional auf<br />
den Teller<br />
Landwirtschaftliche Tradition und familiäre<br />
Wurzeln – dafür steht die Kartoffelmanufaktur<br />
Pahmeyer in Ostwestfalen. Vom Feld bis zum<br />
Teller werden die Kartoffeln eigens angebaut, auf<br />
dem Hof gelagert und zu frischen Kartoffelprodukten<br />
wie Reibekuchen, Aufläufen und geschälten Kartoffeln<br />
für den Lebensmitteleinzel- sowie für den Großhandel<br />
weiterverarbeitet. 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter<br />
verbinden die Strukturen der Landwirtschaft, Produktion<br />
und Verwaltung und arbeiten täglich Hand in Hand<br />
an höchster Qualität. Seit dem 1. Januar 2<strong>02</strong>1 ist das<br />
Unternehmen einschließlich des Produktsortiments<br />
klimaneutral. www.pahmeyer.com<br />
WITTEN<br />
Fenster, Türen und eine<br />
Kiste für Bienen<br />
Nein, das ist keine Kartoffelkiste,<br />
sondern sozusagen<br />
ein Bienenhochhaus.<br />
Diese „Hohenheimer<br />
Einfachbeute“ , im Volksmund:<br />
Bienenstock, stammt aus der<br />
Holzwerkstatt des QuaBeD, was für<br />
„Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft“<br />
der Diakonie<br />
Mark-Ruhr steht.<br />
In der Holzwerkstatt des QuaBeD<br />
entstehen Bühnenbilder für Theaterund<br />
Schulaufführungen, Kleinmöbel,<br />
Fenster und Türen – und eben auch<br />
die Einfachbeuten. Im Jahr 2018<br />
gemeinsam mit einem Imker entwickelt,<br />
werden sie aus PEFC-zertifizierter<br />
Weymouthskiefer aus regionalen<br />
Forstbetrieben des Sauerlandes<br />
und des Bergischen Landes<br />
gebaut und erfreuen sich bei Imkern<br />
und Imkervereinen großer Beliebtheit.<br />
Und sogar für ihre Holzabfälle<br />
hat die Werkstatt Verwendung:<br />
Diese landen in der Brikettierpresse.<br />
www.quabed.de<br />
Tolle Menschen,<br />
tolle Ideen:<br />
Produkte aus den<br />
westfälischen<br />
Regionen, die uns<br />
aufgefallen sind<br />
Sie stellen etwas Besonderes her?<br />
Dann schreiben Sie uns:<br />
redaktion@landschaft-westfalen.de
BUCH ZWEI<br />
16 | Ein Ort in ...<br />
SELM-CAPPENBERG<br />
Fast wie neu – aber 900<br />
Die heutige katholische Pfarrkirche<br />
St. Johannes Evangelist ist<br />
einer von nur zwei großen, in wesentlichen<br />
Teilen unverändert erhaltenen<br />
romanischen Kirchenbauten aus der<br />
Zeit vor 1150 in <strong>Westfalen</strong>. Sie war<br />
die Kirche des Prämonstratenserstifts,<br />
das 1122 in Cappenberg gegründet<br />
wurde. Dazu schenkte der in den Orden<br />
eingetretene Graf Gottfried von<br />
Cappenberg seinen Besitz dem Stift.<br />
Aus Anlass der 900. Wiederkehr dieses<br />
Ereignisses wurde der bald nach<br />
der Gründung begonnene Kirchenbau<br />
nun restauriert. Den größten Teil der<br />
Kosten der fast zweijährigen Maßnahme<br />
trug das Land Nordrhein-<strong>Westfalen</strong><br />
als Eigentümerin des Bauwerks.<br />
LWL-Denkmalpfleger Dirk Strohmann<br />
erläutert die umfangreichen<br />
Maßnahmen: „Das Land NRW hat<br />
die Dächer instand gesetzt, die zum<br />
Teil noch aus dem 19. Jahrhundert<br />
stammenden Bleiglasfenster reparieren<br />
und das Natursteinmauerwerk der<br />
Kirche aus heimischem Kalksandstein<br />
reinigen und neu verfugen lassen.<br />
Dringend erforderlich war ein barrierefreier<br />
Zugang zur Kirche, der jetzt<br />
nach Anhebung und Neupflasterung<br />
Die ehemalige Stiftskirche<br />
Cappenberg<br />
von Nordwesten nach<br />
der Restaurierung.<br />
Foto: LWL/Dülberg<br />
des Geländes vor dem Westportal<br />
über eine Rampe möglich ist.“ Im Inneren<br />
der Kirche haben Fachleute romanische<br />
und gotische Wandmalereien<br />
gesichert und kostbare Inventarstücke<br />
von der Romanik bis ins 19.<br />
Jahrhundert restauriert.<br />
Quelle: Geografische Kommission<br />
für <strong>Westfalen</strong> 2<strong>02</strong>0<br />
„Das Land NRW hat Bleiglasfenster<br />
instand gesetzt, die zum Teil noch aus dem<br />
19. Jahrhundert stammten.“ Dirk Strohmann, LWL<br />
MÜNSTERLAND<br />
Selfies aus einer anderen Zeit<br />
Drei Schlösser zeigen gemeinsam eine Ausstellung mit Werken des<br />
Porträtmalers Johann Christoph Rincklake<br />
Aus eins mach drei: Drei Schlösser<br />
im Münsterland sind ab 1. Juni<br />
Standorte jeweils einer Ausstellung<br />
mit Werken des Porträtmalers Johann<br />
Christph Rincklake. Der Künstler, der<br />
eigentlich <strong>Landschaft</strong>smaler werden<br />
wollte, dann aber im Porträtmalen<br />
den besseren Broterwerb fand, schafft<br />
im 18. Jahrhundert, was heute das<br />
Selfie erreicht: Die Form des Porträts<br />
wandelte sich. Rincklake und andere<br />
bildende Künstler seiner Zeit malten<br />
nicht mehr nur Adelige auf eine idealisierende<br />
Art und Weise, sondern<br />
immer häufiger auch Kaufleute, Kolonialwarenhändler<br />
oder Fabrikanten<br />
und ihre Familien. Diese wohlhabenden<br />
Bürger drückten damit ein erwachendes<br />
nicht adeliges Selbstbewusstsein<br />
der sich allmählich lockernden<br />
Ständegesellschaft aus.<br />
Porträts der Familie Korff im Haus Harkotten-von Korff. Foto: Birgit Gropp<br />
Rincklake selbst brachte es mit seinen<br />
Arbeiten schließlich zu einem der bedeuten<br />
Porträtmaler <strong>Westfalen</strong>s, zu<br />
seiner Zeit war er vielleicht sogar der<br />
berühmteste.<br />
Schlösser-Netzwerk<br />
Für die Ausstellung im Museum Abtei<br />
Liesborn (Wadersloh), Kulturgut<br />
Haus Nottbeck (Oelde) und dem Herrenhaus<br />
Harkotten ( Sassenberg) sammelte<br />
Projektmanagerin Christine<br />
Kolm Originale aus Schlössern, Burgen,<br />
Klöstern und Herrensitzen der<br />
Region zusammen. „Als Projektträger<br />
haben wir die Aufgabe, Akteure zusammenzubringen<br />
und Netzwerke<br />
aufzubauen. Und unsere Erfahrung<br />
hat gezeigt: Zusammen schafft man<br />
mehr als alleine. In diesem Fall war die<br />
Zusammenarbeit der drei Anwesen<br />
„Die Zusammenarbeit<br />
ist<br />
ein großer<br />
Gewinn<br />
für das<br />
Projekt.“<br />
Christine Kolm,<br />
Projektmanagerin<br />
ein großer Gewinn für das Projekt“,<br />
sagt Kolm. Und das überzeugte im<br />
übrigen auch das Regionale Kultur<br />
Programm des Landes Nordrhein-<br />
<strong>Westfalen</strong>, das die gemeinsame Konzeption<br />
unterstützt.<br />
Identität, Inszenierung und Interaktion<br />
sind die drei Themenschwerpunkte<br />
der Ausstellungen. Es geht<br />
dabei ebenso um das Handwerk der<br />
professionellen Porträtmalerei wie<br />
auch um die dargestellten Personen<br />
selbst, die multimedial zum Sprechen<br />
gebracht werden. Darüber hinaus werden<br />
das Leben und die Technik Rincklakes<br />
beleuchtet.<br />
Die Ausstellungen ergänzt ein<br />
gemeinsames Veranstaltungsprogramm,<br />
das pünktlich zum Schlösserund<br />
Burgentag am 19. Juni beginnt<br />
und bis zum 11. September läuft.<br />
EMMERTHAL<br />
Tour durch die Natur<br />
Für den Emmer-Radweg zwischen Steinheim und Emmerthal<br />
durch das Weserbergland gibt es eine neue Tourenkarte<br />
Unter passionierten Radlerinnen<br />
und Radlern gilt die Tour als<br />
leicht, denn sie führt meist über befestigte<br />
Straßen, doch die knapp 50<br />
Kilometer wollen abgestrampelt werden:<br />
der Emmer-Radweg verläuft von<br />
Steinheim über Wöbbel, Schieder,<br />
Lügde, Bad Pyrmont, Löwensen, Tahl,<br />
Welsede, Amelgatzen und Hämelschenburg<br />
nach Emmerthal und folgt<br />
dem Lauf des Flüsschens durch das<br />
Weserbergland.<br />
Wer am Zielort noch nicht genug<br />
hat, kann auf dem Weser-Radweg<br />
gleich weitertouren. An der Strecke<br />
gibt es natürlich viel Natur, aber auch<br />
einige kleinere und größer Attraktio-<br />
„Die Rückkehr des<br />
Bibers ist ein Beleg<br />
für die naturnahe<br />
Entwicklung um<br />
den Schiedersee.“<br />
Ute Röder, Kreis Lippe<br />
nen wie beispielsweise das Möbelmuseum<br />
und das Teddy- und Puppenmuseum<br />
in Steinheim, die Kilianskirche<br />
in Lügde und das Schloss Pyrmont.<br />
Kurz vor dem Zielort Emmerthal<br />
liegt mit Schloss Hämelschenburg ein<br />
Hauptwerk der Weserrenaissance. Besonderes<br />
Highlight der Tour: In Amelgatzen<br />
überquert man die Emmer an<br />
einer Furt. Der Schiedersee wurde<br />
zwischen 2012 und 2015 aufgestaut,<br />
dort wurden 2<strong>02</strong>0 auch die ersten Biber<br />
der Region gesichtet. Die Strecke<br />
ist in einem neuen Flyer des Touristikzentrums<br />
Westliches Weserbergland<br />
ausführlich beschrieben.<br />
www.westliches-weserbergland.de<br />
Der Schiedersee staut die Emmer in der Nähe<br />
des Städtchens Schieder-Schwalenberg. Foto: Adobe Stock