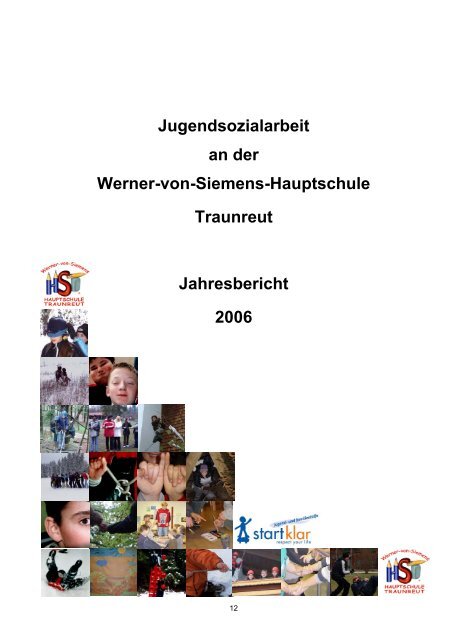1. Jugendsozialarbeit an der W.-v.-S. - startklar Schätzel gGmbH
1. Jugendsozialarbeit an der W.-v.-S. - startklar Schätzel gGmbH
1. Jugendsozialarbeit an der W.-v.-S. - startklar Schätzel gGmbH
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Jugendsozialarbeit</strong><br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
Werner-von-Siemens-Hauptschule<br />
Traunreut<br />
Jahresbericht<br />
2006<br />
12
Herausgeber:<br />
Startklar <strong>Schätzel</strong> gemeinnützige GmbH<br />
Hauptstr. 13<br />
83395 Freilassing<br />
Telefon: 08654/69034-0<br />
Fax: 08654/69034-40<br />
Email: info@<strong>startklar</strong>-schaetzel.de<br />
Homepage: www.<strong>startklar</strong>-schaetzel.de<br />
Redaktion: Claudia Wieslhuber<br />
Bil<strong>der</strong>: Claudia Wieslhuber<br />
<strong>1.</strong> Auflage 2007<br />
13
Inhalt:<br />
<strong>1.</strong> <strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> W.-v.-S.-Hauptschule 4<br />
<strong>1.</strong>1 Die Werner-von-Siemens-Hauptschule Traunreut 4<br />
<strong>1.</strong>2 <strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> Schulen (JaS) 8<br />
2. Rückblick auf das Jahr 2006 12<br />
2.1 Einzelfallhilfe 12<br />
2.<strong>1.</strong>1 Allgemeines 12<br />
2.<strong>1.</strong>2 Daten 13<br />
2.2 Soziale Gruppenarbeit 15<br />
2.2.1 Sozialkompetenztraining 15<br />
2.2.2 Starke Gruppe 17<br />
2.2.3 Streitschlichter 20<br />
2.2.4 Begleitung von Schulausflügen/ Klassenprojekte 22<br />
2.3 Projekte/ Offene Angebote 26<br />
2.3.1 Café Laila 26<br />
2.3.2 Hausaufgabenbetreuung 28<br />
2.3.3 Bewerbungstraining mit den Aktivsenioren e.V. 29<br />
2.3.4 Projekt S.A.L.Z. 31<br />
2.4 Elternarbeit 32<br />
2.5 Arbeitsbündnis zwischen Schule und Jugendhilfe 34<br />
2.6 Vernetzung 37<br />
2.7 Öffentlichkeitsarbeit 39<br />
3. Ausblick 41<br />
14<br />
Seite
<strong>Jugendsozialarbeit</strong><br />
Angesichts <strong>der</strong> wachsenden sozialen Probleme <strong>an</strong> Schulen will Bayerns Familienministerin<br />
Christa Stewens (CSU) die <strong>Jugendsozialarbeit</strong> weiter ausbauen. «Wir<br />
för<strong>der</strong>n so die soziale, schulische und berufliche Integration von jungen Menschen<br />
mit schwierigen persönlichen o<strong>der</strong> familiären Rahmenbedingungen», betonte<br />
Stewens.<br />
Für die Hauptschule Traunreut war es deshalb von größtem Vorteil, dass wir diese schwierige<br />
Aufgabe bereits im Jahr 2004 beginnen konnten. Denn auch <strong>an</strong> <strong>der</strong> Hauptschule Traunreut häufen<br />
sich viele Probleme, die Schule und Lehrer nicht mehr alleine bewältigen können. Deshalb waren und<br />
sind wir sehr froh darüber, dass uns mit <strong>der</strong> Schulsozialarbeiterin Frau Claudia Wieslhuber eine sehr<br />
fähige und vor allem auch engagierte Mitarbeiterin zur Seite steht.<br />
Ihr Aufgabenbereich ist ausgesprochen vielfältig:<br />
� Beratungsgespräche für Schüler und Eltern<br />
� Teamgespräche mit Klassenlehrern und Schulleitung<br />
� Vernetzung und Koordination<br />
� Soziale Gruppenarbeiten<br />
� Unterstützung durch Projekte und Arbeitsgemeinschaften<br />
In kurzer Zeit hat Frau Wieslhuber eine positive Arbeitsatmosphäre geschaffen, in <strong>der</strong> viele Schüler<br />
ein vertrauensvolles Gespräch mit ihr beginnen. Die Lehrkräfte wissen die zusätzliche professionelle<br />
Hilfe im Umg<strong>an</strong>g mit Schwierigkeiten wohl zu schätzen. Viele frisch begonnene und neu entwickelte<br />
Projekte beweisen ihr beständiges Engagement mit dem sie im Sinne und zum Wohle <strong>der</strong> Schüler,<br />
<strong>der</strong>en Eltern und auch <strong>der</strong> Lehrkräfte mit Nachdruck erfolgreich arbeitet.<br />
Die Schulleitung <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule Traunreut wünscht Frau Wieslhuber viel<br />
Geduld und Durchhaltevermögen bei <strong>der</strong> Bewältigung dieser schwierigen Aufgaben und hofft, dass<br />
die Fin<strong>an</strong>zmittel <strong>der</strong> Staatsregierung auch weiterhin den Weg zur Schulsozialarbeit nach Traunreut<br />
finden.<br />
Dieter Flessa, Schulleiter<br />
15
Vorwort<br />
Kin<strong>der</strong> sind unsere Zukunft. Alles was sie lernen, lernen Sie von uns – den<br />
Erwachsenen.<br />
Wir haben daher allen Grund, den Ort des Lernens, die Schule, <strong>an</strong>genehm und<br />
freundlich zu gestalten. Lernen gelingt besser, wenn m<strong>an</strong> es mit Freude tut und wenn<br />
Erfolg dabei hat. Das wissen wir aus vielen Studien.<br />
Also ist es unser Ziel, gemeinsam mit den Lehrern die Werner von Siemens Hauptschule<br />
in Traunreut so lebendig und lernfreundlich wie möglich zu gestalten. Schließlich sind<br />
Sozialarbeiter <strong>an</strong> Schulen nicht die Aufpasser für die schwierigen Schüler. Sie wachen<br />
eher darüber, dass ein positives Schulklima besteht. Das gelingt am besten, wenn es<br />
allen Beteiligten gut geht: den Schülern, den Lehrern, den Eltern. Ein gutes Schulklima<br />
ist die „halbe Miete“ für Lernerfolg.<br />
Das Ergebnis <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner von Siemens Hauptschule k<strong>an</strong>n sich sehen lassen.<br />
Unzählige Projekte, Gruppen, Aktionen, För<strong>der</strong>maßnahmen und sonstige Aktivitäten<br />
finden statt. Die Anzahl <strong>der</strong> best<strong>an</strong>denen Quali-Prüfungen steigt kontinuierlich <strong>an</strong>. Die<br />
Schule lebt – und das ist gut so und es ist ein Verdienst von allen, die dar<strong>an</strong> mitwirken:<br />
Schulleitung, Lehrer und Schulsozialarbeit bilden <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner von Siemens<br />
Hauptschule ein starkes Team für eine starke Schule.<br />
Die Kin<strong>der</strong> sind unsere Zukunft – und sie beginnt heute <strong>an</strong> unseren Schulen.<br />
Heinz <strong>Schätzel</strong><br />
Geschäftsführer<br />
16
Vorwort: „Schule ist mehr als nur Bildung“<br />
Die Schule ist in <strong>der</strong> heutigen Zeit in vielerlei Hinsicht gefor<strong>der</strong>t. Neben dem klassischen<br />
Bildungsauftrag verlagert sich <strong>der</strong> Schwerpunkt immer mehr auf den etwas unscharf<br />
definierten Erziehungsauftrag. Dazu gehört es, die Erziehung <strong>der</strong> Eltern zu unterstützen,<br />
Werte zu vermitteln, <strong>der</strong> Zunahme von Gewalt in <strong>der</strong> Gesellschaft entgegenzuwirken, die<br />
Schüler gegen legale und illegale Drogen stark zu machen, Rassismus und<br />
Fremdenfeindlichkeit zu bekämpfen und nicht zuletzt die Betreuung <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> und<br />
Jugendlichen zu gewährleisten. Die Schule soll zur individuellen Lebensbewältigung<br />
beitragen, zur Teilnahme am gesellschaftlichen Leben befähigen und stärker als jemals<br />
zuvor auf die Arbeitswelt vorbereiten.<br />
Ein erheblicher Teil <strong>der</strong> Tätigkeiten des Lehrerkollegiums geht daher weit über ihre<br />
Kernaufgaben des Unterrichtens hinaus. Der Umg<strong>an</strong>g mit Verhaltensauffälligkeiten und<br />
Erziehungsschwierigkeiten, die Diagnose von und Unterstützung bei<br />
Lernschwierigkeiten, die Beratung und Begleitung von Schülern aus schwierigen<br />
Familienverhältnissen samt <strong>der</strong> dazugehörigen Elternarbeit, die För<strong>der</strong>ung<br />
beeinträchtigter Kin<strong>der</strong> – diese Aufgaben überfor<strong>der</strong>n häufig die berufliche Kompetenz<br />
und das Zeitbudget <strong>der</strong> Lehrer.<br />
An dieser Stelle greift die Schulsozialarbeit ein. Sie orientiert sich als eine Form <strong>der</strong><br />
Jugendhilfe <strong>an</strong> „individuellen Erfahrungen und Erwartungen, zum <strong>an</strong><strong>der</strong>en <strong>an</strong> den (…)<br />
Lebenslagen junger Menschen“ (12. KJB, S.136), und stellt so eine Verbindung<br />
zwischen Schule, Jugendhilfe, Familie und sozialem Umfeld dar.<br />
Entst<strong>an</strong>den aus <strong>der</strong> Erfahrung, dass sich durch präventive Betreuung und Begleitung<br />
sozial benachteiligter und gefährdeter Kin<strong>der</strong> spätere Maßnahmen <strong>der</strong> Jugendhilfe<br />
vermeiden lassen, ermöglicht die <strong>Jugendsozialarbeit</strong> als „verlängerter Arm des<br />
Jugendamtes“ ein frühzeitiges Eingreifen direkt <strong>an</strong> <strong>der</strong> Schule.<br />
Doch die Schulsozialarbeit versteht sich nicht als kompensatorischer „Reparaturbetrieb“<br />
von schulintern nicht lösbaren Schwierigkeiten von Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichen. Zwar<br />
kümmert sie sich vorr<strong>an</strong>gig um solche junge Menschen, die im Prozess <strong>der</strong> beruflichen<br />
und sozialen Integration „in erhöhtem Maße auf Unterstützung <strong>an</strong>gewiesen sind“ (§ 13<br />
Abs. 1 KJHG), sie denkt, pl<strong>an</strong>t und h<strong>an</strong>delt jedoch weit über die schulischen Grenzen<br />
hinaus. Schulsozialarbeit agiert und interveniert nicht nur vor Ort in <strong>der</strong> Schule, son<strong>der</strong>n<br />
kooperiert ebenso mit Lehrern, Eltern und Angehörigen, um beispielsweise die Ursachen<br />
für Schulverweigerung o<strong>der</strong> Gewaltbereitschaft zu klären. Durch den Einbezug <strong>der</strong><br />
Lehrer vermittelt sie sozialpädagogische Kompetenzen und erweitert <strong>der</strong>en<br />
H<strong>an</strong>dlungsmöglichkeiten.<br />
17
Die Angebote <strong>der</strong> <strong>Jugendsozialarbeit</strong> erschöpfen sich daher nicht in <strong>der</strong> Bereitstellung<br />
ergänzen<strong>der</strong> Angebote, son<strong>der</strong>n wollen dar<strong>an</strong> mitwirken, Bildung in <strong>der</strong> Schule zu<br />
verän<strong>der</strong>n, Lernen lebens- und praxisnäher zu gestalten und ein besseres Schulklima zu<br />
schaffen. Dazu gehört die Öffnung <strong>der</strong> Schule nach innen (Partizipation von Schülern<br />
und Lehrern) und nach außen (Kooperation mit außerschulischen Partnern).<br />
Ein wichtiges Kriterium für die Schaffung erfolgreicher Kooperationsbeziehungen<br />
zwischen Schule und Jugendhilfe ist dabei die innere Entwicklungsbereitschaft <strong>der</strong><br />
Schule. Denn nur durch eine gute Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe<br />
werden wirklich gute Ergebnisse erzielt.<br />
Dieser Bericht bezieht sich auf den<br />
Zeitraum J<strong>an</strong>uar bis Dezember 2006.<br />
18<br />
Claudia Wieslhuber
<strong>1.</strong> <strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> W.-v.-S.-Hauptschule<br />
<strong>1.</strong>1 Die Werner-von-Siemens-Hauptschule Traunreut<br />
Die Werner-von-Siemens-Hauptschule vereint alle Formen und Möglichkeiten <strong>der</strong><br />
bayerischen Hauptschulen in sich: neben den Regelklassen finden sich zwei<br />
G<strong>an</strong>ztagesklassen, eine Praxis-Klasse sowie ein Mittlerer-Reife-Zug (ab <strong>der</strong> 7.<br />
Jahrg<strong>an</strong>gsstufe).<br />
Regelklassen, zweizügig<br />
M-Zug<br />
Abbildung 1: Werner-von-Siemens-Hauptschule<br />
Im Schuljahr 2006/2007 besuchen insgesamt 360 Schülerinnen und Schüler die Wernervon-Siemens-Hauptschule<br />
in Traunreut (St<strong>an</strong>d: 29.09.2006). Im Vergleich zum Vorjahr<br />
gibt es eine Klasse weniger, also insgesamt 18 Klassen. Die durch-schnittliche<br />
Klassenstärke liegt bei 20 Schülern (vgl. Tabelle 1).<br />
Gesamtschülerzahl Anzahl<br />
<strong>der</strong> Klassen<br />
19<br />
Durchschnittliche<br />
Klassenstärke<br />
Schuljahr 2003/2004 377 16 23,56<br />
Schuljahr 2004/2005 385 18 21,38<br />
Schuljahr 2005/2006 379 19 19,95<br />
Schuljahr 2006/2007 360 18 20,0<br />
Tabelle 1: Schülerzahlen im Vergleich<br />
Werner-von-Siemens-<br />
Hauptschule Traunreut<br />
18 Klassen<br />
ca. 360 Schülerinnen und Schüler<br />
G<strong>an</strong>ztagesklassen<br />
Praxisklasse
Schülerzahlen und Schulabschlüsse<br />
Der Anteil <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler nicht-deutscher Herkunft lag zu Beginn des<br />
Schuljahres 2006/2007 bei 36,4 %. Mehr als zwei Drittel davon waren Schüler mit<br />
Aussiedlungshintergrund (St<strong>an</strong>d 20.09.2006).<br />
Im Gegensatz zum Vorjahr gibt es zum aktuellen St<strong>an</strong>d nur noch zwei G<strong>an</strong>ztagesklassen,<br />
in denen insgesamt 35 Schülerinnen und Schüler <strong>an</strong>gemeldet sind. Da das<br />
Interesse <strong>der</strong> Eltern in den Grundschulen zu gering war, wurde in <strong>der</strong> 5. Jahrg<strong>an</strong>gs-stufe<br />
keine G<strong>an</strong>ztagesklasse gebildet.<br />
103 Schülerinnen und Schüler besuchten zum <strong>an</strong>gegebenen Zeitpunkt den M-Zug <strong>der</strong><br />
Schule, davon bef<strong>an</strong>den sich 22 Schülerinnen und 12 Schüler in den beiden 10. Klassen.<br />
Im Schuljahr 2005/2006 waren dies 20 Schülerinnen und 21 Schüler (St<strong>an</strong>d 19.07.2006).<br />
Von diesen insgesamt 41 Schülern best<strong>an</strong>den 37 die Abschluss-prüfungen im Sommer<br />
2006 und konnten die Schule mit <strong>der</strong> Mittleren Reife verlassen. Vier Schüler best<strong>an</strong>den<br />
die Prüfungen nicht.<br />
Abschlüsse im Schuljahr 2005/2006 (M-Zug)<br />
Schülerzahl <strong>der</strong> 10. Klassen gesamt Anzahl best<strong>an</strong>dener Abschlussprüfungen<br />
41 37<br />
davon männlich davon weiblich davon männlich davon weiblich<br />
21 20 17 20<br />
Tabelle 2: Abschlüsse im Schuljahr 2005/2006 (M-Zug)<br />
Im Schuljahr 2005/2006 besuchten insgesamt 39 Schüler die Klassen 9a und 9b (St<strong>an</strong>d:<br />
19.07.2006). Davon nahmen 34 Schüler <strong>an</strong> den Quali-Prüfungen teil. Dies entspricht<br />
einem Anteil von 87,2 % (im Vorjahr: 75,9 %).<br />
Insgesamt 24 Schüler best<strong>an</strong>den die Qualifizierenden Abschlussprüfungen; davon<br />
wechselten zwei Schülerinnen zum Schuljahr 2006/2007 in die 10. Klasse. 10 Schüler<br />
best<strong>an</strong>den die Qualifizierenden Abschlussprüfungen nicht – insgesamt acht (davon 5<br />
weiblich) wie<strong>der</strong>holen zum aktuellen Zeitpunkt die 9. Klasse.<br />
20
Quali-Abschlüsse im Schuljahr 2005/2006<br />
Schülerzahl <strong>der</strong> 9. Klassen gesamt Anzahl <strong>der</strong> Teilnehmer <strong>an</strong> den Quali-Prüfungen<br />
39 34<br />
Tabelle 3: Abschlüsse im Schuljahr 2005/2006 (9. Klassen)<br />
davon best<strong>an</strong>den davon nicht best<strong>an</strong>den<br />
21<br />
24 10<br />
Werden die Abschlussdaten des Schuljahres 2005/2006 mit den Abschlüssen <strong>der</strong> Jahre<br />
zuvor verglichen, so ergibt sich folgendes Bild:<br />
Schuljahr<br />
Schülerzahl<br />
<strong>der</strong><br />
9. Klassen<br />
gesamt<br />
Anzahl <strong>der</strong><br />
Teilnehmer<br />
am<br />
Quali<br />
Anzahl <strong>der</strong><br />
Teilnehmer<br />
in Prozent<br />
Anzahl <strong>der</strong><br />
best<strong>an</strong>denen<br />
Quali-<br />
Prüfungen<br />
Best<strong>an</strong>dene<br />
Quali-<br />
Prüfungen<br />
in Prozent<br />
Anzahl <strong>der</strong><br />
nicht<br />
best<strong>an</strong>denen<br />
Quali-<br />
Prüfungen<br />
2005/2006 39 34 87,2 24 70,6 10<br />
2004/2005 54 41 75,9 25 60,9 16<br />
2003/2004 49 35 71,4 17 48,6 18<br />
2002/2003 54 45 83,3 29 64,4 16<br />
2001/2002 55 40 72,7 26 65,0 14<br />
Tabelle 4: Abschlüsse <strong>der</strong> 9. Jahrg<strong>an</strong>gsstufe im Jahresvergleich<br />
Im Schuljahr 2005/2006 nahmen insgesamt 87,2% <strong>der</strong> Schüler des Jahrg<strong>an</strong>gs <strong>an</strong> den<br />
Prüfungen teil. Dieser Prozentsatz stellt im Vergleich zu den Vorjahren eine deutliche<br />
Steigerung dar. Gleichzeitig zeigen die in Tabelle 4 dargestellten Werte, dass die Anteile<br />
<strong>der</strong> best<strong>an</strong>denen Quali-Prüfungen <strong>an</strong> <strong>der</strong> Gesamt-Teilnehmerzahl jährlich deutlich<br />
steigen. Der aktuelle Prozent<strong>an</strong>teil liegt bei 70,6 %.
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
75<br />
70<br />
65<br />
60<br />
55<br />
72,7<br />
65<br />
83,3<br />
64,4<br />
71,4<br />
22<br />
75,9<br />
61<br />
87,2<br />
70,6<br />
Teilnehmer <strong>an</strong> Quali-<br />
Prüfungen in Prozent<br />
50<br />
45<br />
40<br />
48,6<br />
davon Quali<br />
best<strong>an</strong>den in Prozent<br />
2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007<br />
Abbildung 2: Erfolgsquoten im Vergleich<br />
Ziele <strong>der</strong> Schule<br />
Für die Mehrheit <strong>der</strong> Hauptschüler ist <strong>der</strong> „normale“ Integrationsverlauf <strong>der</strong> beruflichen<br />
Einglie<strong>der</strong>ung – von <strong>der</strong> Schule in die Ausbildung und <strong>an</strong>schließend in den Beruf –<br />
inzwischen zur Ausnahme geworden. Es gibt zu wenige Ausbildungs-plätze für alle<br />
Schulabgänger und bei <strong>der</strong> daraus resultierenden Konkurrenz unter den Bewerbern<br />
haben die Schüler mit schlechten o<strong>der</strong> fehlenden schulischen Abschlüssen schwierige<br />
Startch<strong>an</strong>cen und oft von vornherein kaum eine Ch<strong>an</strong>ce, auf dem Arbeitsmarkt zu<br />
bestehen. Dies betrifft beson<strong>der</strong>s diejenigen Jugendlichen, die ohnehin bereits in<br />
sozialen R<strong>an</strong>dlagen leben, weil ihre Eltern auch kaum etwas <strong>an</strong><strong>der</strong>es als Arbeitslosigkeit<br />
und Sozialhilfe kennen.<br />
Aus dieser schwierigen Situation heraus ergibt sich eine gewisse Perspektivlosigkeit, die<br />
fatale Folgen für die Leistungsbereitschaft <strong>der</strong> Schüler hat. Das wie<strong>der</strong>um macht es <strong>der</strong><br />
Schule noch schwerer, den Jugendlichen das für einen erfolgreichen Berufsstart nötige<br />
Rüstzeug zu vermitteln.<br />
Die Schule arbeitet dar<strong>an</strong>, schulische Defizite möglichst erst gar nicht entstehen zu<br />
lassen o<strong>der</strong> schnellstmöglich durch eine differenzierte För<strong>der</strong>ung zu beheben. Dafür ist<br />
eine kontinuierliche und systematische Vorbereitung auf die Arbeitswelt und ein hohes<br />
Maß <strong>an</strong> individueller Hilfe nötig. Ziel ist es, die Konkurrenzfähigkeit schwächerer Schüler<br />
– aufgrund schulischer Voraussetzungen o<strong>der</strong> <strong>der</strong> sozialen o<strong>der</strong> familiären Lage – zu<br />
stärken. Diese gezielte För<strong>der</strong>ung muss l<strong>an</strong>gfristig vorbereitet werden und früher als<br />
bisher beginnen. Berufsorientierung und Berufsentscheidung müssen bereits während<br />
<strong>der</strong> Schulzeit abgeschlossen sein. Dies beinhaltet Berufsfindungsprozesse,<br />
berufsbezogene Allgemeinbildung, berufliche Kompetenzfeststellungsverfahren bis hin<br />
zur Berufserprobung. Dazu gibt es <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule ein
Gesamtkonzept zur Berufsvorbereitung, welches mit ersten Schritten bereits in <strong>der</strong> 5.<br />
Jahrg<strong>an</strong>gsstufe beginnt und in dem die Projekte <strong>der</strong> Schulsozialarbeit fest ver<strong>an</strong>kert<br />
sind.<br />
<strong>1.</strong>2 <strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> Schulen (JaS)<br />
Die <strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> Schulen (JaS) ist eine Leistung <strong>der</strong> Jugendhilfe auf <strong>der</strong><br />
Grundlage <strong>der</strong> Paragraphen 1, 11 und 13 SGB VIII. Die Zusammenarbeit von<br />
Jugendhilfe und Schule ist festgelegt durch den § 81 SGB VIII, sowie den Art. 31<br />
BayEUG.<br />
Fin<strong>an</strong>ziert wird JaS zu je 40% durch das Bayerische Staatsministerium für Arbeit und<br />
Sozialordnung, Familie und Frauen und den L<strong>an</strong>dkreis Traunstein. 20% <strong>der</strong> Fin<strong>an</strong>zierung<br />
übernimmt die Stadt Traunreut. För<strong>der</strong>grundlage bildet die Richtlinie zur För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong><br />
<strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> Schulen des Bayerischen Staats-ministeriums für Arbeit und<br />
Sozialordnung, Familie und Frauen.<br />
Anstellungsträger ist die Startklar <strong>Schätzel</strong> gemeinnützige GmbH. Zwischen Startklar,<br />
<strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule und dem Amt für Kin<strong>der</strong>, Jugend und Familie<br />
Traunstein wurde eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, in <strong>der</strong> die Rahmenbedingungen,<br />
die konzeptionellen Grundlagen sowie die Aufgabenbereiche <strong>der</strong><br />
Schulsozialarbeit festgelegt sind.<br />
Seit Juli 2004 gibt es <strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule<br />
Traunreut. Ihre Angebote richten sich prinzipiell auf alle Schülerinnen und Schüler –<br />
insbeson<strong>der</strong>e jedoch auf Kin<strong>der</strong> und Jugendliche mit gravierenden sozialen und<br />
erzieherischen Problemen, solche, die davon bedroht sind o<strong>der</strong> einen Bedarf <strong>an</strong><br />
Unterstützung <strong>an</strong>melden. <strong>Jugendsozialarbeit</strong> verfolgt somit einen präventiven Auftrag.<br />
Leitziel dieser Arbeit ist es, <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule ein Schulklima zu<br />
schaffen, in dem sich Schüler wie Lehrer wohlfühlen können, in dem Lernen Spaß macht<br />
und in dem Schüler gute Ch<strong>an</strong>cen auf beruflichen und sozialen Erfolg haben. Die Schule<br />
soll zu einem positiven Umfeld werden, das den Schülern erfolgreiche Schulkarrieren<br />
ermöglicht und so die Risiken negativer Schullaufbahnen minimiert.<br />
Um dies zu erreichen, entwickeln Schule (Schulleitung und Lehrer) und Jugendhilfe<br />
(Jugendamt, Freier Träger, Schulsozialarbeiterin) eine gemeinsame Strategie und<br />
arbeiten im Sinne <strong>der</strong> getroffenen Kooperationsvereinbarung zusammen. In<br />
regelmäßigen Zielvereinbarungsgesprächen zwischen Schulleitung, Startklar <strong>Schätzel</strong><br />
<strong>gGmbH</strong> und dem Amt für Kin<strong>der</strong>, Jugend und Familie werden Ziele und<br />
H<strong>an</strong>dlungsstrategien erarbeitet und die Abstimmung <strong>der</strong> gemeinsamen Arbeit gesichert.<br />
Gearbeitet wird nach einem g<strong>an</strong>zheitlichen Ansatz, d.h. die Schwierigkeiten <strong>der</strong> Schüler<br />
werden nicht isoliert, son<strong>der</strong>n stets im Kontext <strong>der</strong> sozialen Beziehungen und<br />
23
Lebensbedingungen verst<strong>an</strong>den. Indem individuelle Risiken frühzeitig erk<strong>an</strong>nt und<br />
Problemlösungen gezielt entwickelt werden, wird das schulische Wohlbefinden <strong>der</strong><br />
Schüler gestärkt und ihre Leistungsbereitschaft und Motivation geför<strong>der</strong>t. Als Folge wird<br />
eine Verbesserung <strong>der</strong> Schulnoten bzw. <strong>der</strong> Schulabschlüsse erwartet.<br />
T<strong>an</strong>demarbeit<br />
Um die Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium zu gewährleisten, wurde im Jahr 2005<br />
die sogen<strong>an</strong>nte „T<strong>an</strong>demarbeit“ eingeführt. Der Schulsozialarbeit wurde eine Lehrerin<br />
<strong>der</strong> Schule zur Seite gestellt, um Ideen und Inhalte mit den jeweiligen Voraussetzungen<br />
abzustimmen und besser <strong>an</strong> die schulischen Bedürfnisse <strong>an</strong>zupassen. Frau Fischl bietet<br />
Unterstützung bei <strong>der</strong> Org<strong>an</strong>isation und Umsetzung <strong>der</strong> sozialpädagogischen Arbeit und<br />
hilft dabei, die Schulsozialarbeit <strong>an</strong> <strong>der</strong> Schule zu ver<strong>an</strong>kern. Ziel ist es,<br />
Verständigungsprozesse zu schaffen und so einen Minimalkonsens über grundsätzliche<br />
gemeinsame Zielsetzungen zwischen Jugendhilfe und Schulen zu ermöglichen.<br />
Die T<strong>an</strong>demarbeit <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-<br />
Hauptschule ist als sehr positiv zu bewerten. Durch<br />
sie ergeben sich wertvolle Impulse für die Schulsozialarbeit.<br />
Die Arbeit des T<strong>an</strong>dems ersetzt jedoch<br />
nicht die Zusammenarbeit mit dem gesamten<br />
Kollegium, son<strong>der</strong>n steht stellvertretend für die<br />
Zusammenführung schul- und sozialpädagogischer<br />
Kompetenzen. Sie hat eine Vorbildfunktion für eine<br />
gute Kooperation von Jugendhilfe und Schule.<br />
Gemeinsame Fortbildungen und Fachtagungen<br />
tragen dazu bei, das Profil <strong>der</strong> <strong>Jugendsozialarbeit</strong><br />
zu schärfen, die Aufgaben, Kompetenzen und<br />
Abbildung 3: Frau Fischl,<br />
Rollenerwartungen zu klären, den Erfahrungs-<br />
JaS-T<strong>an</strong>dempartnerin<br />
austausch zu för<strong>der</strong>n und tragfähige Kooperationsformen<br />
zu entwickeln. Regelmäßige interdisziplinäre Treffen mit speziell geschulten<br />
Multiplikatoren, den sogen<strong>an</strong>nten „JaS-Coaches“, sorgen dafür, dass die JaS-<br />
Konzeption in Bayern einheitlich umgesetzt wird.<br />
H<strong>an</strong>dlungsfel<strong>der</strong><br />
Die <strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> Schulen beinhaltet ein breites Spektrum <strong>an</strong> Angeboten. Die<br />
Tätigkeiten setzen sich aus insgesamt acht verschiedenen Bausteinen zusammen:<br />
24
Elternarbeit<br />
Einzelfallhilfe<br />
21,2<br />
7,5<br />
13,7 Einzelfallhilfe (7,5%)<br />
12,7<br />
Gruppenarbeit<br />
Schulsozialarbeit<br />
<strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
Werner-von-Siemens-Hauptschule<br />
Schule /<br />
Jugendhilfe Dokumentation<br />
Abbildung 4: Bausteine <strong>der</strong> <strong>Jugendsozialarbeit</strong><br />
Im Jahr 2006 verteilte sich die Arbeitszeit folgen<strong>der</strong>maßen: Der größte Anteil fiel mit 21,2 %<br />
auf die Projektarbeit – gefolgt von den Bereichen Arbeitsbündnis zwischen Schule/<br />
Jugendhilfe (14,5 %), Org<strong>an</strong>isation (13,7 %), Gruppenarbeit (13,5 %) und Vernetzung und<br />
Öffentlichkeitsarbeit (12,7 %). Im Vergleich zum Vorjahr gesunken ist <strong>der</strong> Anteil von<br />
Dokumentation (von 12,1 auf 9,2 %), Einzelfallhilfe (von 9,6 auf 7,5 %) und Elternarbeit<br />
(von 10,5 auf 7,5 %).<br />
14,5<br />
13,5<br />
7,5<br />
9,2<br />
25<br />
Gruppenarbeit (13,5%)<br />
Dokumentation (9,2%)<br />
Elternarbeit (7,5%)<br />
Schule/Jugendhilfe (14,5%)<br />
Vernetzung/ Öffentlichkeitsarbeit (12,7%)<br />
Projektarbeit (21,2%)<br />
Org<strong>an</strong>isation (13,7%)<br />
Abbildung 5: Anteil <strong>der</strong> Tätigkeiten in Prozentwerten im Jahr 2006<br />
Projektarbeit<br />
Org<strong>an</strong>isation<br />
Vernetzung/<br />
Öffentlichkeitsarbeit
Erfolge<br />
Die <strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> W.-v.-S.-Hauptschule arbeitet v.a. ergebnisorientiert. Um<br />
Ergebnisse feststellen zu können, wurden messbare Kriterien festgelegt, <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d <strong>der</strong>en<br />
beurteilt werden k<strong>an</strong>n, ob durchgeführte Maßnahmen den Erwartungen entsprechen<br />
konnten.<br />
So wurden beispielsweise Daten über Schulabschlüsse und Anzahl von Wie<strong>der</strong>holern <strong>der</strong><br />
verg<strong>an</strong>genen Schuljahre erhoben, um Schulkarrieren individuell verfolgen und künftige<br />
Daten am Soll-Zust<strong>an</strong>d messen zu können. Ziel ist eine stetige Verbesserung <strong>der</strong><br />
schulischen Leistungen, die ausschlaggebend sind für den späteren schulischen Erfolg <strong>der</strong><br />
Kin<strong>der</strong>. Wie im Punkt <strong>1.</strong>1 deutlich wurde, haben sich die Schulabschlüsse im Jahr 2006 im<br />
Vergleich zum Vorjahr verbessert.<br />
Die Sicherstellung des Erfolgs erfolgt weiterhin durch die enge Zusammenarbeit<br />
zwischen Schulleitung, Lehrerkollegium und Schulsozialarbeit. In halbjährlich<br />
durchgeführten Treffen werden mit <strong>der</strong> Schulleitung gemeinsame Zielvereinbarungen<br />
getroffen, Zielkriterien festgelegt und überprüft. Die enge Abstimmung mit dem<br />
Lehrerkollegium erfolgt über eine jährlich durchgeführte Befragung mittels Fragebögen<br />
zur Überprüfung von Wünschen und Erwartungen <strong>der</strong> Lehrer.<br />
26
2. Rückblick auf das Jahr 2006<br />
2.1 Einzelfallhilfe<br />
2.<strong>1.</strong>1 Allgemeines<br />
Unter Einzelfallhilfe werden alle Maßnahmen verst<strong>an</strong>den, die zur Problembewältigung<br />
bei einzelnen Schülern ergriffen werden. Das Prinzip <strong>der</strong> Freiwilligkeit ist dabei stets<br />
gewährt.<br />
Die <strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule ist eine offene<br />
Anlaufstelle für Schüler, die Bedarf <strong>an</strong> Beratung, Unterstützung o<strong>der</strong> Begleitung haben.<br />
Die Schulsozialarbeiterin steht Schülern, Eltern und Lehrern als neutrale<br />
Ansprechpartnerin zur Verfügung, führt (Beratungs-)Gespräche, pl<strong>an</strong>t<br />
Unterstützungsmaßnahmen und org<strong>an</strong>isiert bei Bedarf die Zusammenarbeit mit<br />
Fachdiensten und Ämtern.<br />
Schüler können täglich ab 7.30 Uhr in das Büro <strong>der</strong> Schulsozialarbeit kommen und<br />
Gesprächstermine vereinbaren – in dringenden Fällen gestatten die Lehrer dies auch<br />
während <strong>der</strong> Unterrichtszeit. Die Schüler kommen dabei einzeln o<strong>der</strong> in kleineren<br />
Gruppen mit den unterschiedlichsten Anliegen. Auch Eltern nehmen häufig Beratung<br />
o<strong>der</strong> Hilfe in Anspruch.<br />
Die Einzelfallhilfe umfasst:<br />
• Einzelgespräche/ Beratung von Schüler und/ o<strong>der</strong> <strong>der</strong>en Eltern bei individuellen<br />
Schwierigkeiten,<br />
• Kooperationsgespräche / Vermittlung bei Konflikten zwischen Schülern und Lehrern/<br />
evtl. auch Teilnahme am Unterricht / Vermittlung von Fachdiensten,<br />
• Krisenintervention,<br />
• Unterstützung beim Überg<strong>an</strong>g Schule-Beruf,<br />
• Telefonate und Fallbesprechungen, Fallbeschreibungen, Verfassen von Berichten<br />
und Stellungnahmen.<br />
Die <strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule ist auch eine<br />
aufsuchende Arbeit, d.h. Schüler wie Eltern werden direkt <strong>an</strong>gesprochen, wenn <strong>der</strong><br />
Eindruck eines För<strong>der</strong>bedarfs entsteht o<strong>der</strong> die Lehrer auf mögliche Schwierigkeiten<br />
hinweisen.<br />
Ziel <strong>der</strong> Einzelför<strong>der</strong>ung ist die ergebnisorientierte Unterstützung bei individuellen<br />
Problemlösungen und die gemeinsame Erarbeitung von H<strong>an</strong>dlungsalternativen. Im<br />
Mittelpunkt <strong>der</strong> Gespräche stehen nicht die Defizite, son<strong>der</strong>n die Stärken und<br />
Ressourcen <strong>der</strong> Familien. Gemeinsam mit den Schülern und gegebenenfalls Eltern und/<br />
o<strong>der</strong> Lehrern werden im sozialen Nahbereich <strong>der</strong> Familie Unterstützungsmöglichkeiten<br />
gesucht und Möglichkeiten erarbeitet, die zu einer Lösung <strong>der</strong> Probleme beitragen.<br />
27
Schülern wird die grundlegende Fähigkeit vermittelt, sich in schwierigen<br />
Lebenssituationen frühzeitig und aktiv Hilfe zu holen und Probleme aktiv <strong>an</strong>zugehen.<br />
Die Schulsozialarbeit bietet auch fl<strong>an</strong>kierende sozialpädagogische Maßnahmen bei<br />
schulischen Disziplinarmaßnahmen wie Verweisen, Schulausschlüssen usw.<br />
Gespräche mit <strong>der</strong> Schulsozialarbeiterin unterliegen <strong>der</strong> Schweigepflicht und werden<br />
stets vertraulich beh<strong>an</strong>delt. In <strong>der</strong> Zusammenarbeit mit Lehrern wird mit den Schülern im<br />
Vorfeld vereinbart, inwieweit persönliche Informationen weitergegeben werden dürfen.<br />
Bei Selbst- o<strong>der</strong> Fremdgefährdung entfällt die Schweigepflicht.<br />
2.<strong>1.</strong>2 Daten<br />
In <strong>der</strong> Statistik zur Einzelfallhilfe geht es nicht darum, im Sinne einer Strichliste die<br />
Häufigkeit <strong>der</strong> Gespräche festzuhalten, die mit einem Schüler geführt werden. Vielmehr<br />
interessiert die Anzahl <strong>der</strong> Schüler, die Einzelfallhilfe <strong>an</strong>nehmen. Dabei stellt sich jedoch<br />
ein Problem mit dem Schwellenwert: ab w<strong>an</strong>n ist es ein Gespräch wert, in die Statistik<br />
aufgenommen zu werden? Nach welchem Kriterium (Dauer, Ergebnis, Inhalt, …) sollte<br />
m<strong>an</strong> sich richten?<br />
Für die Schulsozialarbeit in Traunreut lässt sich festhalten, dass ein Schüler erst d<strong>an</strong>n in<br />
<strong>der</strong> Statistik erfasst wird, wenn mindestens zwei Beratungsgespräche zu einer<br />
bestimmten Fragestellung stattgefunden haben: ein Erstgespräch zur Abklärung <strong>der</strong><br />
Situation und ersten Lösungssuche und ein Reflexionsgespräch bezüglich möglicher<br />
Verän<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Probleme.<br />
Im Jahr 2006 wurden insgesamt 33 Schülerinnen und Schüler regelmäßig und über<br />
einen längeren Zeitraum betreut. Der Anteil <strong>der</strong> Mädchen betrug mit 45,5 % deutlich<br />
mehr als im Vorjahr (34,3 %). Bei insgesamt 11 Schülern konnte die Einzelför<strong>der</strong>ung im<br />
Verlauf des Jahres 2006 bereits abgeschlossen werden.<br />
Der Schwerpunkt <strong>der</strong> Einzelfallhilfe liegt – wie auch in den Jahren zuvor – in <strong>der</strong><br />
Klassenstufe 5. Dieser Trend bestätigt die Vermutung, dass Schüler offenbar eine gewisse<br />
Zeit brauchen, um mit <strong>der</strong> Umstellung von <strong>der</strong> Grund- auf die Hauptschule zurechtzukommen.<br />
Ältere Schüler, die das Beratungs<strong>an</strong>gebot nutzen, werden häufig nicht in die<br />
Statistik aufgenommen, da ihre Anliegen meist keine längerfristige Betreuung nach sich<br />
ziehen. Die Schüler <strong>der</strong> 10. Klassen nutzen das Angebot nicht (vgl. Abbildung 6).<br />
Der Erstkontakt zu den Schülerinnen und Schülern erfolgt in <strong>der</strong> Regel durch die Schüler<br />
selbst. Oft weisen auch Lehrer auf mögliche Schwierigkeiten hin. Nur in Ausnahmefällen<br />
erfolgt <strong>der</strong> Erstkontakt auf Anregung <strong>der</strong> Eltern. Immer wie<strong>der</strong> ist es auch nötig,<br />
Krisenintervention zu betreiben, d.h. bei einer Krise im Schulhaus sofort einzugreifen. Diese<br />
Ereignisse sind oftmals ebenfalls <strong>der</strong> Beginn einer Einzelfallhilfe.<br />
28
14<br />
13<br />
12<br />
11<br />
10<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
5. Jahrg<strong>an</strong>gsstufe<br />
6. Jahrg<strong>an</strong>gsstufe<br />
7. Jahrg<strong>an</strong>gsstufe<br />
Abbildung 6: Verteilung nach Klassenstufen<br />
8. Jahrg<strong>an</strong>gsstufe<br />
29<br />
9. Jahrg<strong>an</strong>gsstufe<br />
Mädchen<br />
Jungen<br />
10. Jahrg<strong>an</strong>gsstufe<br />
Die in <strong>der</strong> Abbildung aufgeführten Fälle unterschieden sich zum Teil gravierend in Intensität<br />
und Dauer <strong>der</strong> jeweiligen Betreuungen. Wie viele Gespräche pro Schüler stattfinden, hängt<br />
davon ab, was individuell gewünscht und erfor<strong>der</strong>lich ist. Eine Beratung k<strong>an</strong>n bereits nach<br />
ein, zwei Gesprächen eine Verän<strong>der</strong>ung bewirken, in <strong>an</strong><strong>der</strong>en Fällen ist mehr Zeit mit dem<br />
Jugendlichen notwendig, in Form von regelmäßigen Terminen, intensiver Elternarbeit,<br />
Unterrichtsbegleitung usw.<br />
Die Beratung und Betreuung <strong>der</strong> Schülerinnen und Schüler umfasst eine große<br />
B<strong>an</strong>dbreite <strong>an</strong> Themen – beginnend mit schulischen Schwierigkeiten (Konflikte mit<br />
Lehrern, Probleme im Klassenverb<strong>an</strong>d, fehlende Zukunftsperspektiven) bis hin zu<br />
gravierenden persönlichen und familiären Problemen (Scheidung <strong>der</strong> Eltern,<br />
Suchterfahrungen, Mobbing und Ausgrenzung, Ängste, usw.). Immer wie<strong>der</strong> fällt dabei<br />
<strong>der</strong> Zusammenh<strong>an</strong>g zwischen schulischen und familiären Problemen auf. Offensichtlich<br />
beeinflussen sich die verschiedenen Lebensbereiche gegenseitig, woraus folgt, dass bei<br />
<strong>der</strong> Erarbeitung individueller Lösungs<strong>an</strong>sätze alle Ebenen betrachtet und berücksichtigt<br />
werden müssen.
2.2 Soziale Gruppenarbeit<br />
2.2.1 Sozialkompetenztraining<br />
Das Sozialkompetenztraining dient dazu, soziale Fertigkeiten aufzubauen und<br />
einzuüben. Da Hilfsbereitschaft, Ver<strong>an</strong>twortungsbewusstsein und Teamfähigkeit wichtige<br />
Schlüsselqualifikationen für die spätere berufliche Laufbahn <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> sind, wird die<br />
Durchführung des Sozialkompetenztrainings <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule<br />
als Baustein zur Berufsvorbereitung verst<strong>an</strong>den und jedes Schuljahr in allen 5. Klassen<br />
durchgeführt.<br />
Durch das Sozialkompetenztraining verbessert sich das Sozialklima in den Schulklassen.<br />
Die Schule ist ein Ort, <strong>an</strong> dem Schüler viel Zeit mitein<strong>an</strong><strong>der</strong> verbringen und<br />
Verhaltensauffälligkeiten beson<strong>der</strong>s deutlich zum Vorschein kommen. Daher ist es nötig,<br />
Schülern die Fähigkeit zu vermitteln sich <strong>an</strong>gemessen sozial zu verhalten.<br />
Dazu gehören:<br />
• Erkennen und Äußern von Gefühlen: Einschätzen eigener Gefühle sowie <strong>der</strong> Gefühle<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>er Personen,<br />
• Trainieren einer <strong>an</strong>gemessenen Selbstbehauptung: Ansprüche und For<strong>der</strong>ungen<br />
stellen und diese konfliktfrei durchsetzen,<br />
• Üben <strong>der</strong> Kooperationsfähigkeit: gegenseitige Unterstützung, Kompromisse<br />
eingehen, Aufgaben gemeinsam bewältigen,<br />
• Schulung des Einfühlungsvermögen: Gefühle nachempfinden, sich in die Lage einer<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>en (schwächeren) Person hineinversetzen.<br />
• Wahrnehmungsschulung: Stärkung einer differenzierten sozialen Fremd- wie auch<br />
Selbstwahrnehmung (Körpersignale usw.).<br />
Im Vor<strong>der</strong>grund dieser Methode stehen das Sich-Erleben und Begegnen. Durch<br />
gemeinsame Erfahrungen werden das Wir-Gefühl und <strong>der</strong> Gruppenzusammenhalt<br />
gestärkt. Störende Verhaltensweisen können dadurch nachhaltig verän<strong>der</strong>t werden.<br />
Das Soziale Kompetenztraining ist <strong>an</strong>gelehnt <strong>an</strong> Peterm<strong>an</strong>n & Peterm<strong>an</strong>n (2003). Es<br />
h<strong>an</strong>delt sich um ein präventiv wirksames Gruppentraining, das für die Klassenstufen 3<br />
bis 6 entwickelt und erprobt wurde. Die Umsetzung <strong>der</strong> aufein<strong>an</strong><strong>der</strong> aufbauenden Ziele<br />
verläuft phasenweise. In zwölf Sitzungen werden verschiedene Teilfertigkeiten trainiert.<br />
Schüler und Lehrer nehmen gemeinsam teil.<br />
30
Um das Training dem Bedarf und den<br />
Rahmenbedingungen <strong>der</strong> Schule<br />
<strong>an</strong>zupassen, wurden Themen und<br />
Schwerpunkte zum Teil abgeän<strong>der</strong>t.<br />
Einige Spiele wurden ergänzt o<strong>der</strong><br />
ersetzt.<br />
Das Soziale Kompetenztraining<br />
kommt nicht nur Kin<strong>der</strong>n mit<br />
Verhaltensauffälligkeiten,<br />
son<strong>der</strong>n allen Schülern zugute.<br />
Im Verlauf <strong>der</strong> 12 Wochen<br />
konnten viele Fortschritte<br />
beobachtet werden. Ob sich<br />
diese Verän<strong>der</strong>ungen l<strong>an</strong>gfristig auch auf das Verhalten und den Unterricht auswirken,<br />
muss sich zeigen. Die Schüler selbst beurteilten das Training durchwegs positiv und<br />
waren mit sich selbst sehr zufrieden.<br />
Einen gelungenen Abschluss des sozialen<br />
Kompetenztrainings stellte <strong>der</strong> „Eierfall“ dar.<br />
Aufgabe <strong>der</strong> Schüler war es, ein rohes Ei so zu<br />
verpacken, dass es einen Sturz aus dem 2. Stock<br />
„überlebt“. Dazu st<strong>an</strong>d den verschiedenen Gruppen<br />
jeweils das gleiche Material zur Verfügung:<br />
Zeitungspapier, Klebeb<strong>an</strong>d, Fe<strong>der</strong>n usw. Die<br />
gebastelten Flugobjekte wurden zunächst vor <strong>der</strong><br />
Klasse präsentiert, und <strong>an</strong>schließend dem<br />
Belastungstest unterzogen. Tatsächlich konnte<br />
auch in diesem Jahr jeweils eine Gruppe <strong>der</strong> beiden<br />
Klassen ein „gesundes“ Ei vorweisen.<br />
31<br />
Abbildung 7 und 8: Sozialkompetenztraining<br />
in den 5. Klassen<br />
Abbildung 9: Eierfall
2.2.2 Starke Gruppe<br />
Die „Starke Gruppe“ wurde im J<strong>an</strong>uar 2006 gegründet. Insgesamt 10 „starke“ Schüler –<br />
vorr<strong>an</strong>gig aus den 5. und 6. Klassen – trafen sich ab diesem Zeitpunkt einmal wöchentlich<br />
zu verschiedenen Aktionen, um sich mit dem Thema Übergewicht ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>zusetzen.<br />
Nach dem Motto „Du bist, was Du isst!“ lag <strong>der</strong> Schwerpunkt <strong>der</strong> Gruppe jedoch nicht auf<br />
dem Abnehmen, son<strong>der</strong>n auf dem Aspekt „Gesund leben“ auf Basis zweier Schwerpunkte:<br />
(1) Spaß <strong>an</strong> gesun<strong>der</strong> Ernährung und (2) Freude <strong>an</strong> Bewegung.<br />
a) Ernährung<br />
In themenspezifischen<br />
Treffen wird Wissenswertes<br />
rund um die Ernährung<br />
besprochen; Ideen, Fragen<br />
und Probleme <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong><br />
werden aufgegriffen.<br />
Ernährungsgewohnheiten<br />
werden betrachtet und<br />
diskutiert. Die Kin<strong>der</strong> lernen<br />
die Lebensmittelpyramide<br />
kennen und entdecken, wie<br />
sie das erworbene Wissen in<br />
ihren Alltag tr<strong>an</strong>sferieren Abbildung 10: Die Starke Gruppe mit Frau Tutsch<br />
können. Zeitweise wird ein<br />
„Essen & Bewegungs-Tagebuch“ geführt. In <strong>der</strong> Gruppe werden die dort eingetragenen<br />
Lebensmittel <strong>an</strong>alysiert und bewertet. Falsche Essgewohnheiten können auf diese Art<br />
l<strong>an</strong>gfristig verän<strong>der</strong>t werden.<br />
Um die praktische Umsetzung im familiären Alltag zu<br />
unterstützen, wird in regelmäßigen Abständen ein<br />
kalorienarmes und gesundes Essen gekocht. Eine<br />
Ernährungswissenschaftlerin unterstützt die Gruppe mit<br />
kindgerechtem Material.<br />
b) Bewegung<br />
Im sportlichen Bereich stehen nicht Leistungs<strong>an</strong>sprüche im<br />
Mittelpunkt, son<strong>der</strong>n Lust auf gemeinsame Spiele. Ziel ist<br />
es, reizvolle Bewegungs<strong>an</strong>gebote zu<br />
entwickeln und den Schülern eine verbesserte<br />
Einstellung zur Bewegung zu vermitteln. So<br />
wurde beispielsweise ein Ausflug zu einem<br />
nahe gelegenen Fitnessstudio durchgeführt, um den<br />
Kin<strong>der</strong>n die vor Ort gegebenen Möglichkeiten<br />
aufzuzeigen.<br />
32<br />
Abbildung 10 und 11:<br />
Was steckt in<br />
unseren<br />
Lebensmitteln?
Die Schüler sollen ihren eigenen Körper und<br />
seine Reaktionen besser kennenlernen, und<br />
Geschicklichkeit und Fitness erwerben. Durchgeführt<br />
wurden: Schlittenfahren, Ballsportarten<br />
(Basketball, Völkerball), Badminton, Tischtennis,<br />
Nordic Walking, Schwimmen, W<strong>an</strong><strong>der</strong>n, Schlittschuhlaufen,<br />
(Bauch)-T<strong>an</strong>z, Fahrradfahren,<br />
Gymnastik & Yoga. Eigene Ideen <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong><br />
werden selbstverständlich berücksichtigt.<br />
Da die tatsächliche Reduzierung des Körpergewichts<br />
für die Kin<strong>der</strong> ein nur schwer erreichbares<br />
Ziel darstellt, sollen die Kin<strong>der</strong> „g<strong>an</strong>z<br />
nebenbei“ unterstützt werden, nicht mehr<br />
zuzunehmen. Durch diese Gewichtsstabilisierung<br />
und das Wachstum <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> ist eine<br />
Reduzierung des Übergewichts und Annäherung<br />
<strong>an</strong> das Normalgewicht möglich.<br />
Die Beson<strong>der</strong>heit dieses Projektes ist die<br />
interdisziplinäre Vernetzung verschiedenster<br />
Fachrichtungen – involviert sind das<br />
Gesundheitsamt Traunstein (medizinische<br />
Begleitung durch Fr. Dr. Haindl) sowie weitere<br />
außerschulische Facheinrichtungen.<br />
Das Gewicht <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> wird monatlich<br />
kontrolliert. In einem Gewichtsprotokoll werden<br />
die Werte (Größe, Gewicht) eingetragen, so dass<br />
die Kin<strong>der</strong> ihren aktuellen Body Mass Index (BMI)<br />
errechnen können.<br />
Oberstes Ziel ist die För<strong>der</strong>ung des Gesundheitsbewusstseins<br />
<strong>der</strong> Kin<strong>der</strong>. Die Schüler sollen zur<br />
positiven Lebensgestaltung <strong>an</strong>geregt werden,<br />
ihre Lebensqualität steigern und so l<strong>an</strong>gfristig<br />
Kr<strong>an</strong>kheiten vorbeugen. Ein weiteres Ziel ist die Abbildung 12 bis 15:<br />
Stärkung <strong>der</strong> sozialen Lebensfähigkeiten. Dazu Die Starke Gruppe beim Basketball,<br />
gehören die Entwicklung eines Problem-<br />
beim Kreist<strong>an</strong>z, im Prienavera und auf<br />
<strong>der</strong> Fahrradtour<br />
bewusstseins, einer realistischen Selbsteinschätzung,<br />
die Stärkung <strong>der</strong> eigenen Körperwahrnehmung und des Selbstbewusstseins<br />
sowie eine <strong>an</strong>gemessene Problemlösungsorientierung.<br />
33
Die Kin<strong>der</strong> lernen <strong>an</strong><strong>der</strong>e Schüler mit ähnlichen Problemen kennen, können sich<br />
austauschen und informieren. Im Rahmen <strong>der</strong> Starken Gruppe setzen sie sich mit den<br />
eigenen körperlichen Fähigkeiten ausein<strong>an</strong><strong>der</strong> und entwickeln so ein komplexeres Bild von<br />
sich selbst.<br />
Die Starke Gruppe konnte auch im Schuljahr 2006/2007 als Kooperationsprojekt zwischen<br />
einer Lehrerin <strong>der</strong> Schule, Fr. Tutsch und <strong>der</strong> Schulsozialarbeiterin weitergeführt werden.<br />
Neben den Aspekten Ernährung und Sport liegt ein weiterer wichtiger Schwerpunkt auf<br />
<strong>der</strong> psychosozialen Begleitung <strong>der</strong> Teilnehmer. Durch abwechslungsreiche<br />
gruppenbildende Maßnahmen (z.B. Erlebnispädagogik, Ausflüge) können die Kin<strong>der</strong><br />
Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig unterstützen. Gespräche und Beratung<br />
durch die Sozialarbeiterin o<strong>der</strong> Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind je<strong>der</strong>zeit möglich.<br />
Da es beson<strong>der</strong>s wichtig ist, die Eltern in die Themen <strong>der</strong> Starken Gruppe mit<br />
einzubeziehen, werden die Eltern laufend schriftlich über gepl<strong>an</strong>te bzw. durchgeführte<br />
Aktionen informiert. Um die Starke Gruppe innerhalb <strong>der</strong> Schule publik zu machen, wurde<br />
von <strong>der</strong> Gruppe eine Schautafel gestaltet, auf <strong>der</strong> sich die Teilnehmer vorstellen. Ein<br />
Artikel in <strong>der</strong> Schülerzeitung soll über durchgeführte sowie gepl<strong>an</strong>te Aktionen informieren.<br />
Im Sommer 2006 wurde den Teilnehmern <strong>an</strong>lässlich einer Schülerehrung eine Urkunde<br />
durch den Schulleiter Herrn Flessa überreicht.<br />
Als krönenden Abschluss des Schuljahres 2005/2006 durften einige Teilnehmer <strong>der</strong><br />
Starken Gruppe ins Jugend-Zeltlager am Abtsdorfer See fahren und dort zwei Tage mit<br />
sportlichen Aktivitäten verbringen.<br />
34<br />
Abbildung 16 bis 18:<br />
Bil<strong>der</strong> vom Zeltlager
2.2.3 Streitschlichter<br />
Streitigkeiten und H<strong>an</strong>dgreiflichkeiten gehören zum Alltag in <strong>der</strong> Schule. Sie bilden<br />
häufig den Ausg<strong>an</strong>gspunkt für Gewalt und Mobbing. Zurechtweisungen und Strafen<br />
durch Erwachsene beenden m<strong>an</strong>che Konflikte nur oberflächlich und kurzfristig. Eine<br />
Einigung, die durch die Konfliktparteien selbst getroffen wird, bietet dagegen die Ch<strong>an</strong>ce<br />
einer echten, dauerhaften Lösung. Gleichaltrige werden im Jugendalter eher als Berater<br />
akzeptiert als Lehrer.<br />
Im J<strong>an</strong>uar 2006 wurde mit <strong>der</strong> Auswahl und Ausbildung einer Gruppe von<br />
Streitschlichtern begonnen. Nach einer etwa 12-wöchigen Ausbildungszeit und<br />
abgelegter Prüfung stehen die 14 Schülerinnen und Schüler <strong>der</strong> 7. bis 9. Klassenstufe<br />
nun täglich im wechselnden Dienst zur Verfügung, um kleinere und größere Streitereien<br />
ohne Hilfe <strong>der</strong> Lehrer zu schlichten. Jeden Tag in <strong>der</strong> zweiten Pause arbeiten zwei bis<br />
vier Streitschlichter im Schüler-Café und versuchen, im Gespräch mit den Betroffenen<br />
eine für alle tragbare Lösung zu finden. Die beschlossene Regelung wird in einem<br />
Ordner vermerkt; bei Bedarf wird ein weiterer Termin mit den Streitschlichtern<br />
ausgemacht. Sind die Streithälse nicht bereit, ihren Konflikt beizulegen, o<strong>der</strong> h<strong>an</strong>delt es<br />
sich um eine zu gravierende Sache, können die Schlichter den Fall ablehnen und <strong>an</strong> den<br />
zuständigen Klassenleiter weitergeben.<br />
In <strong>der</strong> Streitschlichtergruppe arbeiten dieses Jahr folgende Schüler:<br />
Andreas Albrich, Sabine Gontscharenko, Anne Bie<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n, Engelbert Huber, Viktor<br />
Bolosch, Evi Scherbauer, Sebasti<strong>an</strong> Thois, Markus Nowak, Niko Meier, Viktor Rem,<br />
Elena Baturin, Bi<strong>an</strong>ca Valusescu, Mel<strong>an</strong>ie Geppert und Christi<strong>an</strong> Gerlitz.<br />
Abbildung: 19: Die Streitschlichter <strong>der</strong> W.-v.-S.-Hauptschule<br />
35
Das Angebot <strong>der</strong> Streitschlichtung <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule wird sehr<br />
gut <strong>an</strong>genommen, so dass die Schlichter fast täglich zum Einsatz kommen. Lei<strong>der</strong> st<strong>an</strong>d<br />
die Lehrerin Barbara Enghardt, die die Ausbildung und Betreuung bis zum Ende des<br />
Schuljahres 2005/2006 in Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> Schulsozialarbeit übernommen hatte,<br />
ab den Sommerferien nicht mehr zur Verfügung. Mit Alex<strong>an</strong>dra Reichl-Spark hat die<br />
Gruppe jedoch eine sehr engagierte Lehrerin zur Seite gestellt bekommen, die seit<br />
September 2006 die Streitschlichtung org<strong>an</strong>isiert und betreut. Zwar arbeitet die Gruppe<br />
im Großen und G<strong>an</strong>zen selbständig – regelmäßige Treffen sind jedoch wichtig, damit<br />
sich die Schlichter austauschen und org<strong>an</strong>isatorische o<strong>der</strong> inhaltliche Probleme<br />
besprechen können.<br />
Ab J<strong>an</strong>uar 2007 sollen bereits neue Streitschlichter<br />
ausgewählt und ausgebildet werden, die im Schuljahr<br />
2007/ 2008 ihren Dienst <strong>an</strong>treten. In <strong>der</strong> Ausbildung<br />
lernen die Schüler <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d von Rollenspielen,<br />
Übungen, Gesprächskreisen und Arbeitsblättern<br />
wichtige Fähigkeiten wie Empathie, Kommunikationstechniken<br />
und Mediations<strong>an</strong>sätze. Die best<strong>an</strong>dene<br />
Prüfung wird mit einem Zertifikat belohnt – ebenso<br />
wird die Teilnahme <strong>an</strong> den Streitschlichtern in den<br />
Zeugnisbemerkungen <strong>der</strong> Schüler vermerkt. Zur<br />
Belohnung für die harte Arbeit dürfen die Streitschlichter<br />
außerdem jedes Jahr einen gemeinsamen<br />
Ausflug machen.<br />
36<br />
Abbildung 20 und 21:<br />
Die Streitschlichter im Bayern-Park und<br />
mit Frau Enghardt beim Eisessen
2.2.4 Begleitung von Schulausflügen/ Klassenprojekte<br />
Zur Verbesserung des Klassenklimas und um die Motivation <strong>der</strong> Kin<strong>der</strong> zu för<strong>der</strong>n,<br />
werden in einigen Klassen Klassenfahrten und Tagesausflüge durchgeführt. Diese<br />
werden von den jeweiligen Klassenlehrern org<strong>an</strong>isiert und bei Bedarf sozialpädagogisch<br />
unterstützt.<br />
Im Jahr 2006 wurden verschiedene Tagesausflüge<br />
begleitet, wie etwa ins Haus <strong>der</strong> Natur<br />
in Salzburg, in die Ausstellung „Wüste“ nach<br />
Rosenheim, zur Berufsinformationsmesse nach<br />
Salzburg o<strong>der</strong> ins Berufsinformationszentrum<br />
nach Traunstein.<br />
Abbildung 24: Besuch <strong>der</strong> Ausstellung<br />
„Die Wüste“ im Lokschuppen Rosenheim<br />
Da sich aus diesen Aktionen häufig<br />
ein vertiefter Kontakt zu einzelnen<br />
Schülern entwickelt, kommt die<br />
Begleitung von Ausflügen <strong>der</strong><br />
Schulsozialarbeit allgemein<br />
zugute.<br />
37<br />
Abbildung 22 und 23:<br />
Die Klasse 9m im BIZ<br />
in Traunstein<br />
Abbildung 25 bis 27:<br />
Bil<strong>der</strong> von <strong>der</strong> Berufsinformationsmesse<br />
in<br />
Salzburg
Ein beson<strong>der</strong>s schöner Ausflug 2006 war <strong>der</strong> Aufenthalt im Schull<strong>an</strong>dheim <strong>der</strong> Klasse 6b<br />
in <strong>der</strong> Nähe von Inzell. Eine g<strong>an</strong>ze Woche l<strong>an</strong>g ging es um sportliche „Höchstleistungen“:<br />
beim W<strong>an</strong><strong>der</strong>n, Badminton, Tischtennis, Fußball, Schwimmen, Röhnrad, Biathlon und<br />
natürlich bei <strong>der</strong> neuen Funsport-Attraktion Airtramp.<br />
Höhepunkt des Ausfluges war eine Ortsrallye, bei<br />
<strong>der</strong> die Kin<strong>der</strong> den Ort Inzell <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d vieler Fragen<br />
genau unter die Lupe nehmen mussten. Den<br />
Abschluss <strong>der</strong> Fahrt bildete die hauseigene<br />
Diskover<strong>an</strong>staltung im Feriendorf, die vielen<br />
großen Spaß bereitete und somit den Abschied<br />
schwer machte.<br />
Weiterhin wurden in Zusammenarbeit mit den Lehrern verschiedenste Aktionen und<br />
Spiele innerhalb <strong>der</strong> Klassen durchgeführt, um Teamgeist und Gruppenzusammenhalt<br />
zu verbessern und den Schülern neue Erlebnismöglichkeiten zu eröffnen.<br />
In diesem Bereich arbeiten Lehrer und Schulsozialarbeit eng zusammen. Denn aus <strong>der</strong><br />
Einübung von Regeln bzw. Verhaltensnormen, <strong>der</strong> För<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> sozialen Kompetenz<br />
sowie <strong>der</strong> Integration von Außenseitern resultieren auf l<strong>an</strong>ge Sicht Verän<strong>der</strong>ungen im<br />
Umg<strong>an</strong>g mitein<strong>an</strong><strong>der</strong>. Ziel ist es, die dabei erlernten Verhaltensweisen l<strong>an</strong>gfristig auf das<br />
Sozialverhalten innerhalb <strong>der</strong> Klassen zu tr<strong>an</strong>sferieren, damit sich die Schüler verstärkt<br />
auf den Unterricht und das Lernen konzentrieren.<br />
Bei den dabei durchgeführten Aktionen h<strong>an</strong>delt es sich meistens um „Kooperative<br />
Abenteuerspiele“. Diese basieren auf einer Verzahnung von spiel-, erlebnispädagogischen<br />
und gruppendynamischen Übungen. Sie laufen immer in denselben<br />
Phasen ab: Präsentationsphase, Aktionsphase und Reflexionsphase. Kooperative<br />
38<br />
Abbildung 28 bis 30:<br />
Bil<strong>der</strong> aus dem Schull<strong>an</strong>dheim
Abenteuerspiele und die darin enthaltenen Problemlösungsaufgaben sind ideale<br />
H<strong>an</strong>dlungs- und Lernfel<strong>der</strong>, um die Innenwelt von Interaktion, Kommunikation und<br />
Kooperation zu erkunden. Im Gegensatz zu <strong>an</strong><strong>der</strong>en Methoden <strong>der</strong> Erlebnispädagogik<br />
sind sie einfacher umzusetzen und ohne spezielles Wissen o<strong>der</strong> Techniken<br />
durchzuführen. Sie benötigen nur wenig Material und können daher <strong>an</strong> fast allen Orten<br />
absolviert werden – im Klassenzimmer, im Pausenhof, in <strong>der</strong> Aula, während eines<br />
Ausfluges usw.<br />
Ziele <strong>der</strong> „Kooperativen Abenteuerspiele“ sind:<br />
• Kooperationsfähigkeit trainieren (Aufgaben können nur gemeinsam in <strong>der</strong> Gruppe<br />
gelöst werden),<br />
• Konfliktfähigkeit stärken (die Aufgabenstellung provoziert leicht Konflikte, die<br />
jedoch gelöst werden müssen, um Erfolg zu haben),<br />
• Helfen und sich helfen lassen (Spiele sind so konzipiert, dass sie nur durch die<br />
Hilfe <strong>der</strong> Gruppenmitglie<strong>der</strong> gelöst werden können),<br />
• Übernahme von Initiative und Ver<strong>an</strong>twortung (um die Situation zu bewältigen,<br />
muss sich je<strong>der</strong> Einzelne einbringen),<br />
• Stärkung des Selbstwertgefühls (je<strong>der</strong> trägt zum Erfolg <strong>der</strong> Gruppe bei),<br />
• Trainieren einer realistischen Selbsteinschätzung (Schwächen und Stärken<br />
kennen lernen),<br />
• Entwicklung eines verbesserten Körperbewusstseins (Spiele erfor<strong>der</strong>n oft hohen<br />
Körpereinsatz),<br />
• Vertrauensaufbau (Schüler müssen sich gegenseitig vertrauen, um die Aufgabe<br />
zu lösen),<br />
• Ausbildung einer differenzierten Wahrnehmung (bei den Spielen ist <strong>der</strong> Einsatz<br />
verschiedenster Sinne gefor<strong>der</strong>t),<br />
• Koordinationschulung (Erfolg ist nur durch eine gute Koordination innerhalb <strong>der</strong><br />
Gruppe möglich).<br />
Die Spiele werden so ausgewählt, dass Motivation und Spielspaß <strong>an</strong>gesprochen werden,<br />
denn Schüler lassen sich nur d<strong>an</strong>n auf die Aufgaben und die damit verbundenen<br />
Schwierigkeiten ein, wenn sie dazu motiviert sind. Dadurch lernen sie quasi „durch die<br />
Hintertür“ – ohne dass ihnen dies bewusst sein muss.<br />
Ein wichtiger Punkt <strong>der</strong> „Kooperativen Abenteuerspiele“ ist die Reflexion, die unmittelbar<br />
im Anschluss <strong>an</strong> die Spielaktion erfolgt. Dabei werden Meinungen und Wahrnehmung<br />
<strong>der</strong> Gruppenmitglie<strong>der</strong> besprochen, Feedback gegeben und Probleme diskutiert.<br />
Angesetzt wird dabei stets am Positiven, um Stärken ausbauen zu können.<br />
39
Workshop Improvisationstheater<br />
In <strong>der</strong> Klasse 8m wurde im Anschluss <strong>an</strong> das Bewerbungstraining mit den Aktivsenioren<br />
e.V. (vgl. Punkt 2.3.3) ein Workshop durchgeführt, mit dem die Schüler nochmals gezielt<br />
auf das Bewerbungsgespräch vorbereitet wurden. Zunächst wurde ein<br />
Anfor<strong>der</strong>ungsprofil erstellt und die im Bewerbungsgespräch gezeigten Stärken und<br />
Schwächen <strong>der</strong> Teilnehmer herausgearbeitet. Dabei zeigte sich, dass <strong>der</strong> Kern des<br />
Gesprächs sowohl auf den kommunikativen Fähigkeiten (Sprache, mögliche Fragen und<br />
Antworten im Bewerbungsgespräch) als auch im Auftreten (Körperhaltung, Händedruck,<br />
Gesichtsausdruck, Augenkontakt, Sitzhaltung, Stimme, Gestik) liegt.<br />
Diese beiden Bereiche wurden mit Übungen aus <strong>der</strong><br />
Theaterpädagogik trainiert. So mussten sich die Schüler<br />
beispielsweise auf einer imaginären Bühne vorstellen<br />
und kleinere Szenen vorspielen, wobei die Mitschüler<br />
als Spiegel fungierten und die Körpersprache des<br />
„Schauspielers“ jeweils im Anschluss beurteilten.<br />
Mit immer schwierigeren Aufgaben wurden die Schüler so<br />
auf den Hauptteil des Workshops vorbereitet: das<br />
Improvisationstheater. Da ein Bewerbungsgespräch letztendlich<br />
nichts <strong>an</strong><strong>der</strong>es als ein Improvisationstheater<br />
darstellt, wurden in kleinen Gruppen verschiedenste Szenen<br />
gespielt, in denen die Rollen zwar vergeben, <strong>der</strong> Verlauf<br />
des Stücks aber nicht festgelegt war.<br />
Höhepunkt war d<strong>an</strong>n das Einüben eines konkreten<br />
Bewerbungsgesprächs. In kleinen Gruppen wurde die<br />
Situation eines Bewerbungsgesprächs<br />
nachgespielt, wobei die<br />
Schüler mal Personalchef,<br />
mal Bewerber sein durften<br />
und sich <strong>an</strong>schließend<br />
gegenseitig Feedback geben<br />
konnten.<br />
Abbildung 31 bis 35: Workshop Improvisationstheater 2006<br />
40
2.3 Projekte/ Offene Angebote<br />
Angepasst <strong>an</strong> die jeweiligen Jahrg<strong>an</strong>gsstufen<br />
f<strong>an</strong>den im Jahr 2005 verschiedenste offene<br />
Angebote statt, die hier nicht alle erläutert<br />
werden können. Einmalige Aktivitäten waren<br />
beispielsweise das Ostereierfärben für die 5. und<br />
6. Klassen, das in Zusammenarbeit mit Fr. Fischl<br />
org<strong>an</strong>isiert und durchgeführt wurde.<br />
Zu den längerfristigen Projekten zählen das<br />
Café Laila, die Hausaufgabenbetreuung, das<br />
Bewerbungstraining mit den Aktivsenioren e.V.<br />
o<strong>der</strong> das Projekt S.A.L.Z.<br />
Diese werden im Folgenden beschrieben.<br />
2.3.1 Café Laila<br />
Nachdem die Lehrerbefragung des Jahres 2005 erneut ein großes Interesse des<br />
Kollegiums am Aufbau eines Schüler-Cafés ergab und aufgrund einer Umstrukturierung<br />
des Mittagsessens in den G<strong>an</strong>ztagesklassen <strong>der</strong> ehemalige Speiseraum zur Verfügung<br />
st<strong>an</strong>d, beschloss die Schulleitung, das Projekt in Angriff zu nehmen.<br />
Zwei Lehrerinnen <strong>der</strong> Schule, Iris Haßlmeyer und Agnes Rogowsky erklärten sich bereit,<br />
den Aufbau des Schüler-Cafés zu betreuen. Das von ihnen bereits im Jahr 2005 erstellte<br />
Konzept zur Einrichtung wurde noch im ersten Halbjahr des Jahres 2006 umgesetzt. Da<br />
das Café im orientalischen Stil gestaltet werden sollte, musste ein passen<strong>der</strong> Name<br />
gefunden werden. In zahlreichen Treffen mit <strong>der</strong> Basisgruppe einigte m<strong>an</strong> sich<br />
schließlich auf den Namen „Café Laila“.<br />
In den folgenden Wochen war die Gruppe von etwa 10<br />
Schülerinnen und Schülern damit beschäftigt, den kargen<br />
Wänden des Raumes ein orientalisches Ambiente zu<br />
verleihen. Mit Hilfe von Herrn Rogowsky wurden passende<br />
Motive ausgewählt und in aufwendigen Streichaktionen <strong>an</strong><br />
die Wände gezaubert, so dass nach kurzer Zeit<br />
verschiedenste Bil<strong>der</strong> wie Bauchtänzerinnen, Palmen,<br />
Kamele und orientalische Basare zu bewun<strong>der</strong>n waren.<br />
Auch <strong>an</strong> <strong>der</strong> sonstigen Einrichtung des Raumes wurde bis<br />
Schuljahresende viel verän<strong>der</strong>t – passend zur Gesamtkonzeption<br />
des Projektes.<br />
41<br />
Abbildung 36: Ostereierfärben 2006<br />
Abbildung 37: Gestaltung<br />
des Schüler-Cafés
Am 4. Oktober wurde das Café Laila schließlich mit<br />
einer offiziellen Feier eingeweiht. Der <strong>1.</strong> Bürgermeister<br />
Hr. Parzinger begrüßte die Einrichtung und bed<strong>an</strong>kte<br />
sich bei <strong>der</strong> Basisgruppe und den betreuenden<br />
Lehrerinnen, die so viel Arbeit und Engagement in den<br />
Aufbau gesteckt hatten.<br />
Auch die Vorsitzende des Elternbeirats, Fr. Sittm<strong>an</strong>n,<br />
bed<strong>an</strong>kte sich bei den Mitwirkenden. Als krönen<strong>der</strong><br />
Abschluss überraschte eine von Herrn Flessa<br />
engagierte Bauchtänzerin, die die Eröffnung mit<br />
Showeinlagen aufheiterte. Zudem führte sie im<br />
Anschluss einen Baucht<strong>an</strong>z-Workshop mit den<br />
Schülern <strong>der</strong> Basisgruppe durch.<br />
Das Café Laila ist seit Oktober 2006 jeden<br />
Dienstag und Donnerstag geöffnet. Org<strong>an</strong>isiert<br />
wird das Projekt von den Schülern selbst.<br />
Zu den Aufgaben <strong>der</strong> Basis-Gruppe gehören:<br />
• Einkauf <strong>der</strong> Lebensmittel<br />
• Vorbereitung <strong>der</strong> Speisen/ Ausgabe<br />
von Getränken & Essen<br />
• Abrechnung/ Kontrolle <strong>der</strong> Kasse<br />
42<br />
Abbildung 38 und 39:<br />
Gestaltung des Schüler-Cafés<br />
• Geschirr einsammeln/ Spülmaschine<br />
• Aufsicht über Musik<strong>an</strong>lage/ Internet<br />
• Spieleverleih org<strong>an</strong>isieren (Ausgabe,<br />
Rückgabe, usw.)<br />
• Einhaltung <strong>der</strong> Regeln kontrollieren
Das l<strong>an</strong>gfristig <strong>an</strong>gelegte Projekt orientiert sich <strong>an</strong> den Bedürfnissen <strong>der</strong> Schüler. Ein<br />
wichtiges Ziel ist die För<strong>der</strong>ung des Sozialverhaltens <strong>der</strong> Schüler. Die Schüler<br />
schaffen einen eigenen Treffpunkt für ihre Mitschüler. Durch das Café entstehen<br />
Lernsituationen, in denen sich Schüler selbst erfahren und erleben und die sie auf ihr<br />
reales Leben übertragen können. Den Schülern werden Möglichkeiten zur<br />
Ver<strong>an</strong>twortung und eigenem H<strong>an</strong>deln in <strong>der</strong> Gemeinschaft gegeben. Dies verbessert<br />
l<strong>an</strong>gfristig das Zusammenleben und wirkt sich positiv auf die Kommunikation<br />
zwischen Schülern und Lehrern aus. Durch die Identifizierung mit dem Café werden<br />
sie stärker <strong>an</strong> die Schule gebunden und sammeln wichtige<br />
Gemeinschaftserfahrungen. Sie lernen, Selbstver<strong>an</strong>twortung zu übernehmen und<br />
gemeinsam in einem Team zu arbeiten.<br />
2.3.2 Hausaufgabenbetreuung<br />
Auch im Jahr 2006 konnte die Hausaufgabenbetreuung erfolgreich weitergeführt<br />
werden. Unter <strong>der</strong> qualifizierten Anleitung von Anne Kaßeckert können Schülerinnen<br />
und Schüler <strong>an</strong> vier Tagen pro Woche in einer kleinen Gruppe ihre Hausaufgaben<br />
erledigen o<strong>der</strong> sich auf den Unterricht des nächsten Tages vorbereiten. Die Eltern<br />
bezahlen für die Betreuung einen geringen Unkostenbeitrag von 1 Euro pro Tag.<br />
Auch leistungsschwache Schüler haben damit die Ch<strong>an</strong>ce, im Unterricht gut<br />
vorbereitet und mit vollständigen Hausaufgaben zu erscheinen, was sich wie<strong>der</strong>um<br />
positiv auf die Motivation und die weitere Leistungsbereitschaft auswirkt.<br />
43<br />
Abbildung 42 und 43:<br />
Hausaufgabenbetreuung<br />
2006 mit<br />
Frau Kaßeckert
Die Hausaufgabenbetreuung trägt direkt zur Verbesserung schulischer Leistungen<br />
und zum Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler bei und ist somit ein wichtiges Ergebnis <strong>der</strong><br />
<strong>Jugendsozialarbeit</strong>. Zum aktuellen Zeitpunkt sind 14 Kin<strong>der</strong> (davon 5 Mädchen) in<br />
<strong>der</strong> Hausaufgabenbetreuung <strong>an</strong>gemeldet. Die Schüler stammen überwiegend aus<br />
den 5. Klassen. Ab Dezember 2006 findet die Hausaufgabenbetreuung auch freitags<br />
statt.<br />
Dieses Projekt ist nur d<strong>an</strong>k <strong>der</strong> fin<strong>an</strong>ziellen Unterstützung des Vereins „Licht für<br />
Kin<strong>der</strong>“ <strong>der</strong> Stadt Traunreut möglich, dem dafür ausdrücklicher D<strong>an</strong>k gebührt.<br />
V.a. die Eltern reagieren sehr positiv auf dieses Angebot. In <strong>der</strong> im Jahr 2006 durchgeführten<br />
Elternbefragung zeigte sich erneut, dass nur ein geringer Anteil <strong>der</strong> Eltern<br />
ihren Kin<strong>der</strong>n bei den Hausaufgaben helfen k<strong>an</strong>n. Auch das Lehrerkollegium schätzt<br />
die Hausaufgabenbetreuung als sehr bedeutsam ein. Viele Lehrer beteiligen sich<br />
aktiv <strong>an</strong> <strong>der</strong> Betreuung, indem sie täglich das Hausaufgabenheft <strong>der</strong> <strong>an</strong>gemeldeten<br />
Schüler kontrollieren und bei fehlenden Hausaufgaben sofort Rückmeldungen geben.<br />
2.3.3 Bewerbungstraining mit den Aktivsenioren Bayern e.V.<br />
Ein Schwerpunkt <strong>der</strong> Schule ist die frühzeitige Vorbereitung auf die Berufswelt. Die<br />
rechtzeitige berufliche Orientierung k<strong>an</strong>n die Leistungsbereitschaft <strong>der</strong> Jugendlichen<br />
för<strong>der</strong>n und dazu beitragen, Ausbildungsabbrüche zu vermeiden. An <strong>der</strong> Werner-von-<br />
Siemens-Hauptschule existiert ein „Fahrpl<strong>an</strong>“, in dem die durchzuführenden Aktionen<br />
in den jeweiligen Jahrg<strong>an</strong>gsstufen geregelt sind. Dazu gehören beispielsweise<br />
Arbeitsplatzerkundungen, Internetrecherchen, Interessentests,<br />
Betriebshospitationen, Berufsberatung, Besuch <strong>der</strong> Berufsinformationsmesse und<br />
des Berufsinformationszentrums, Bewerbungsschreiben, Praktika und vieles mehr.<br />
Ein wichtiger Baustein ist das von <strong>der</strong> Schulsozialarbeit org<strong>an</strong>isierte videogestützte<br />
Bewerbungstraining in den 8.<br />
Klassen und <strong>der</strong><br />
Praxisklasse.<br />
Um die Schüler möglichst<br />
frühzeitig und realitätsnah<br />
auf die Anfor<strong>der</strong>ungen im<br />
Berufsleben vorzubereiten,<br />
wurde dieses Projekt im Jahr<br />
2006 in Zusammenarbeit mit<br />
dem Sozialarbeiter <strong>der</strong><br />
Praxisklasse, Udo Schwarz,<br />
ins Leben gerufen. Um eine<br />
44
möglichst authentische Situation zu erzielen, wurden die Gespräche von Mitglie<strong>der</strong>n<br />
<strong>der</strong> Aktivsenioren Bayern e.V.<br />
durchgeführt.<br />
Die Aktivsenioren Bayern e.V. machen sich stark für Jugendliche und junge<br />
Menschen und stehen ihnen mit ihren Kenntnissen und Erfahrungen zur Seite. Die<br />
Mitglie<strong>der</strong> engagieren sich für kleine bis mittlere Unternehmen und bieten Hilfe bei<br />
Problemen wie Existenzerhaltung o<strong>der</strong> Fragen <strong>der</strong> Unternehmensnachfolge. Im<br />
Bereich <strong>der</strong> Ausbildung übernehmen sie Ausbildungspatenschaften und begleiten<br />
junge Menschen bei <strong>der</strong> Ausbildungssuche, beim Berufswechsel o<strong>der</strong> auf dem Weg<br />
in die Selbständigkeit. Für die Senioren bietet diese Art <strong>der</strong> Weitergabe ihrer Berufsund<br />
Lebenserfahrung eine sinnvolle Lebensgestaltung nach dem Ausscheiden aus<br />
dem Beruf (www.aktivsenioren.de).<br />
Bereits im Vorfeld gaben die Schüler ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen ab,<br />
die den Aktivsenioren im Gespräch vorlagen und als Grundlage für das Gespräch<br />
dienten. Großer Wert wurde auf Aspekte wie Pünktlichkeit, Kleidung, Auftreten usw.<br />
gelegt. Nach dem Motto „einen Fehler, den Du heute machst, machst Du später nicht<br />
mehr“ gaben die Senioren den Jugendlichen viele Ratschläge aus ihrer l<strong>an</strong>gjährigen<br />
Berufserfahrung mit auf den Weg.<br />
Ver<strong>an</strong>twortlich für die Durchführung bei den Aktivsenioren Bayern e.V. war Herr<br />
H<strong>an</strong>sjoachim Blum, <strong>der</strong> je nach gewünschtem Beruf in verschiedenste Rollen<br />
schlüpfte und abwechselnd als Inhaber eines Blumenladens, als Personalchef eines<br />
Industriebetriebes o<strong>der</strong> als Sprechstundenhilfe einer Arztpraxis in Aktion trat.<br />
Alle Gespräche wurden auf Video aufgezeichnet und im Unterricht ausgewertet.<br />
Dadurch können die Schüler <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d <strong>der</strong> positiven Beispiele lernen, ihr Verhalten zu<br />
verbessern. Durch die Auswertung <strong>der</strong> Videos im Klassenverb<strong>an</strong>d erfahren die<br />
Schüler Eigen- und Fremdwahrnehmung und erkennen ihre Stärken und Schwächen.<br />
45<br />
Abbildung 45:<br />
Die Sozialarbeiter <strong>der</strong> Schule<br />
Udo Schwarz und Claudia<br />
Wieslhuber mit Frau Laxg<strong>an</strong>ger<br />
und Herrn Blum von den<br />
Aktivsenioren e.V.
Trotz <strong>an</strong>fänglich großer Nervosität bei den Teilnehmern waren die Rückmeldungen<br />
durchwegs positiv. Die Ch<strong>an</strong>ce, sich im Rollenspiel vor Fremden präsentieren zu<br />
können, betrachten die Schüler als eine sehr wertvolle Erfahrung.<br />
2.3.4 Projekt S.A.L.Z. (Sexualität – Aids – Liebe – Zärtlichkeit)<br />
Bei <strong>der</strong> Projektgruppe S.A.L.Z. h<strong>an</strong>delt es sich um einen Zusammenschluss<br />
verschiedener Institutionen im Stadtgebiet Traunreut, die Projekte zu den Themen<br />
„Sexualität – Aids – Liebe – Zärtlichkeit“ (S.A.L.Z.). org<strong>an</strong>isieren und durchführen.<br />
Durch die Beteiligung <strong>der</strong> Schulsozialarbeit <strong>an</strong> dieser Projektgruppe f<strong>an</strong>den im Herbst<br />
2006 vielfältige interess<strong>an</strong>te Aktionen für die Schüler <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-<br />
Hauptschule statt:<br />
• Themen-Parcour <strong>der</strong> Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BzgA) für alle 9. und 10.<br />
Klassen,<br />
• Interaktives „Mitmach-Theater“ <strong>der</strong> Theatergruppe Thevo e.V. mit dem Titel „Aids geht’s los“<br />
für alle 8., 9. und 10. Klassen,<br />
• Aids-Informationsst<strong>an</strong>d am Stadtplatz Traunreut <strong>an</strong>lässlich des Weltaids-Tages am <strong>1.</strong><br />
Dezember,<br />
• Workshop „Liebe & Sexualität“ im Jugendzentrum Traunreut als offenes Angebot für Schüler<br />
ab <strong>der</strong> 9. Klasse,<br />
• Teilnahme am Aids-Quiz <strong>der</strong> L<strong>an</strong>deszentrale für Gesundheit Bayern.<br />
46<br />
Abbildung 46 und 47:<br />
Mitmach-Theater<br />
„Aids geht’s los“
Ziel des Projektes ist es, die Vielschichtigkeit des „Lebensthemas“ Sexualität<br />
<strong>an</strong>zusprechen. Dabei geht es nicht um bloße Wissensvermittlung, son<strong>der</strong>n es werden<br />
die Beziehungen zwischen Menschen thematisiert. Im Mittelpunkt steht <strong>der</strong> individuelle<br />
Umg<strong>an</strong>g mit Sexualität. Jugendliche können sich mit ihrer eigenen, moment<strong>an</strong>en<br />
Situation, mit eigenen Werthaltungen und Gefühlen, persönlichen Unsicherheiten,<br />
Ängsten, Schwierigkeiten und Wünschen ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzen und sollen so zu einem<br />
eigen- und partnerver<strong>an</strong>twortlichen, gesundheitsgerechtem Umg<strong>an</strong>g mit Sexualität<br />
befähigt werden.<br />
Durch die Vernetzung <strong>der</strong> einzelnen Einrichtungen wird ein unterschiedlicher Zug<strong>an</strong>g<br />
zu den Jugendlichen ermöglicht. Thematisch ergänzt wird das Projekt mit Angeboten<br />
des Gesundheitsamtes Traunstein – beispielsweise durch Workshops zur<br />
Aidsprävention in den einzelnen Klassen.<br />
2.4 Elternarbeit<br />
Eltern haben insofern eine große Bedeutung, weil sie im Bedingungsgefüge <strong>der</strong><br />
sozialen Benachteiligungen von Schülern eine zentrale Position einnehmen. Für<br />
Eltern besteht grundsätzlich das Angebot <strong>der</strong> Beratung hinsichtlich schulischer o<strong>der</strong><br />
privater Schwierigkeiten. Termine können je<strong>der</strong>zeit telefonisch vereinbart werden.<br />
Oberstes Ziel <strong>der</strong> Elternarbeit ist die Motivierung <strong>der</strong> Eltern zur Mitwirkung <strong>an</strong><br />
schulischen Prozessen und Angeboten. Regelmäßige Informationsschreiben <strong>an</strong> die<br />
Eltern berichten über aktuelle und gepl<strong>an</strong>te Projekte sowie wichtige Termine <strong>der</strong><br />
Schulsozialarbeit. Durch die Beteiligung <strong>an</strong> Elternabenden und Elternsprechtagen<br />
wird <strong>der</strong> Kontakt zu den Eltern gepflegt.<br />
Im Bereich <strong>der</strong> Einzelfallhilfe wird <strong>der</strong> Kontakt zwischen Eltern und Lehrern<br />
unterstützt und begleitet, und es wird über bestehende Angebote im Bereich <strong>der</strong><br />
Hilfen zur Erziehung, des Jugendschutzes, <strong>der</strong> Gesundheitsvorsorge, <strong>der</strong><br />
Berufsvorbereitung, <strong>der</strong> Prävention, <strong>der</strong> erlebnis- und freizeitpädagogischen<br />
Angebote informiert. Bei Bedarf werden Fachkräfte empfohlen.<br />
Beim Thema Elternarbeit ist <strong>an</strong>zumerken, dass es sich lohnt, positive<br />
Rückmeldungen zu geben, v.a. wenn es sich um Schüler h<strong>an</strong>delt, die in <strong>der</strong> Regel<br />
negativ auffallen. Eltern von schwierigen Schülern sind es oft nicht gewohnt, auch<br />
etwas Gutes über ihr Kind zu hören. Dadurch spüren die Eltern, dass positives<br />
Verhalten bemerkt und belohnt wird. Für den Schüler sind diese Rückmeldungen<br />
eine zusätzliche Verstärkung des gewünschten Verhaltens.<br />
47
Zusammenarbeit mit dem Elternbeirat<br />
Ein wichtiger Schwerpunkt im Bereich <strong>der</strong> Elternarbeit ist die Zusammenarbeit mit<br />
dem Elternbeirat. An <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule gibt es einen sehr<br />
engagierten Elternbeirat, <strong>der</strong> sich aktiv für die Bel<strong>an</strong>ge <strong>der</strong> Schule einsetzt. Unter<br />
dem bewährten Vorsitz von Frau Christine Sittm<strong>an</strong>n präsentiert sich <strong>der</strong> Elternbeirat<br />
auf nahezu allen Ver<strong>an</strong>staltungen <strong>der</strong> Schule mit einer Schautafel und<br />
Informationsmaterialien für interessierte Eltern.<br />
Höhepunkt im Jahr 2006 war das vom Elternbeirat org<strong>an</strong>isierte rauch- und<br />
alkoholfreie Sommerfest <strong>der</strong> Schule, bei dem jede Klasse einen Spielest<strong>an</strong>d gepl<strong>an</strong>t<br />
und betreut hat. An den verschiedenen Stationen (Schwammwerfen, Basketball,<br />
Maßkrugweitschieben, Spielparcours, Nagelbrett, Stelzenlauf und vieles mehr) gab<br />
es attraktive Preise zu gewinnen. Zum Programm gehörten vielfältige Aufführungen<br />
u.a. <strong>der</strong> Theatergruppe von Herrn St<strong>an</strong>iczek und <strong>der</strong> T<strong>an</strong>zgruppen von Frau Fischl.<br />
Die gesamte Bewirtung übernahm <strong>der</strong> Elternbeirat, <strong>der</strong> mit dem Besucher<strong>an</strong>dr<strong>an</strong>g<br />
kaum nachkam. Mit den erzielten Einnahmen werden schulische Projekte unterstützt<br />
o<strong>der</strong> Klassenfahrten bezuschusst.<br />
48
Abbildung 48 bis 53: Bil<strong>der</strong> vom Sommerfest 2006<br />
2.5 Arbeitsbündnis zwischen Schule und Jugendhilfe<br />
Der Bereich „Arbeitsbündnis zwischen Schule und Jugendhilfe“ umfasst<br />
verschiedenste Aktivitäten und zielt darauf ab, die Richtung <strong>der</strong> Schulsozialarbeit<br />
gemeinsam mit dem Lehrerkollegium festzulegen und zu überprüfen. Nur durch gute<br />
Kooperation und Zusammenarbeit k<strong>an</strong>n sich die Schule so verän<strong>der</strong>n, dass sie zu<br />
einem für Schüler und Lehrer <strong>an</strong>genehmen Arbeitsumfeld wird.<br />
Dazu gehört die jährliche Befragung des Kollegiums hinsichtlich ihrer Erwartungen und<br />
ihrer Zufriedenheit bezüglich <strong>der</strong> <strong>Jugendsozialarbeit</strong>. Auch 2006 wurde ein Fragebogen<br />
ausgeteilt, eingesammelt und ausgewertet. Die Ergebnisse wurden in <strong>der</strong><br />
pädagogischen Konferenz vorgestellt und dienen als Feedback, um neue Ideen und<br />
Wünsche <strong>der</strong> Lehrer aufzugreifen und die <strong>Jugendsozialarbeit</strong> stets dem –<br />
möglicherweise verän<strong>der</strong>ten – Bedarf <strong>an</strong>passen zu können.<br />
Ein wichtiger Baustein dieses Bereiches sind die halbjährlich durchgeführten<br />
pädagogischen Konferenzen. Ihre Pl<strong>an</strong>ung und Gestaltung wird gemeinsam mit <strong>der</strong><br />
T<strong>an</strong>dempartnerin Frau Lydia Fischl (vgl. Punkt <strong>1.</strong>2) erarbeitet. In Absprache mit <strong>der</strong><br />
Schulleitung werden Inhalte festgelegt – die Ausarbeitung <strong>der</strong> Präsentationen und die<br />
Vorträge obliegen dem Team. Dem Lehrerkollegium wird die durchgeführte Arbeit<br />
vorgestellt und gepl<strong>an</strong>te Aktionen können diskutiert werden.<br />
Schwerpunktmäßig liegt je<strong>der</strong> pädagogischen Konferenz ein Thema zugrunde, das von<br />
<strong>der</strong> Schulsozialarbeit <strong>an</strong>geboten und vorbereitet wird. Durch gemeinsame Fortbildungen<br />
und Fachtagungen, überregionale JaS-Treffen und schulinterne Teamtreffen mit <strong>der</strong><br />
49
T<strong>an</strong>dempartnerin werden Konzepte erarbeitet, die speziell am Bedarf <strong>der</strong> Werner-von-<br />
Siemens-Hauptschule ausgerichtet sind.<br />
Im Jahr 2006 wurden beispielsweise zwei große Themenblöcke besprochen: die<br />
Problematik <strong>der</strong> Schulverweigerer/ Schulschwänzer und <strong>der</strong> Umg<strong>an</strong>g mit Mobbing unter<br />
Schülern.<br />
a) Schulverweigerer und Schulschwänzer<br />
Schulverweigerern wird zunehmend <strong>der</strong> Status einer neuen gefährlichen Gruppe<br />
zugewiesen. Dazu gehören klassische Störer, die sich regelwidrig verhalten, den<br />
Unterricht bewusst stören, kein Material mitbringen o<strong>der</strong> keine Hausaufgaben erledigen,<br />
aber auch „Träumer“, die im Unterricht geistig abwesend wirken und dementsprechend<br />
schlechte Leistungen erbringen. An <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule werden<br />
diese Anzeichen als „Frühwarnung“ verst<strong>an</strong>den, denn aus Schulverweigerung<br />
entwickelt sich häufig Schulschwänzen: Stunden- o<strong>der</strong> Tagesschwänzen, stetiges Zu-<br />
Spät-Kommen, zweifelhafte Entschuldigungen, regelmäßiges Schwänzen bis hin zum<br />
Totalausstieg.<br />
Im Falle von Schulverweigerung steht ein auf die Schule zugeschnittenes Konzept über<br />
Interventionsmaßnahmen bereit, die in Zusammenarbeit mit <strong>der</strong> <strong>Jugendsozialarbeit</strong><br />
entwickelt und von <strong>der</strong> Lehrerkonferenz verabschiedet wurden.<br />
Um Schülern wie auch Lehrern ungestörten Unterricht zu ermöglichen, arbeitet die<br />
Schule auf zwei Ebenen:<br />
• Präventive Maßnahmen: es wird versucht, die Entstehung von Schulverweigerung im Vorfeld<br />
zu verhin<strong>der</strong>n. Unter dem Motto „wer gern zur Schule geht, schwänzt auch nicht“ steht das<br />
Wohlbefinden <strong>der</strong> Schüler im Vor<strong>der</strong>grund. Kin<strong>der</strong> und Jugendliche sollen sich mit ihrer<br />
Schule identifizieren können und ein Zugehörigkeitsgefühl entwickeln. Dies geschieht zum<br />
einen innerhalb <strong>der</strong> Klassen, wo die Schüler durch verschiedenste Erfolgserlebnisse<br />
Motivation und Selbstwertgefühl aufbauen können, zum <strong>an</strong><strong>der</strong>en durch außerunterrichtliche<br />
Maßnahmen wie dem Schüler-Café o<strong>der</strong> <strong>an</strong><strong>der</strong>en offenen Angeboten.<br />
• Interventive Maßnahmen: die Reaktion auf Schulverweigerung o<strong>der</strong> –schwänzen ist<br />
schulintern durch verbindliche St<strong>an</strong>dards und Regeln festgelegt. Wichtig ist v.a. eine<br />
einheitliche Dokumentation, aber auch klärende Gespräche mit dem Schüler o<strong>der</strong> seinen<br />
Eltern, denn um Schüler in den Unterricht „zurückzuholen“ ist es unbedingt notwendig, die<br />
individuell unterschiedlichen Ursachen zu verstehen.<br />
b) Mobbing<br />
Mobbing unter Schülern war Thema <strong>der</strong> zweiten Pädagogischen Konferenz im Jahr<br />
2006. Die Rollen und Stufen im Mobbingprozess wurden im Kollegium besprochen und<br />
Alarmzeichen diskutiert. Da Mobbing ein oft übersehenes, aber immer vorh<strong>an</strong>denes<br />
Problem <strong>an</strong> Schulen darstellt, ging es darum, mögliche Opfer und Täter als solche zu<br />
erkennen.<br />
50
Auch <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule gibt es, wie sich herausstellte, einige<br />
Schüler, die als klassische Mobbing-Opfer bezeichnet werden können (vgl. Abbildung<br />
54).<br />
39<br />
306<br />
Abbildung 54:<br />
Anteil <strong>der</strong> Störer/ Auffälligen bzw. Außenseiter / Mobbing-Opfer <strong>an</strong> <strong>der</strong> Gesamtschülerschaft<br />
Das achtstufige Interventionsprogramm beinhaltet Gespräche mit dem Opfer und<br />
dessen Eltern, aber auch mit dem/ den Täter(n) und <strong>der</strong> gesamten Klasse. Durchgeführt<br />
wird es im Bedarfsfall von <strong>der</strong> Schulsozialarbeiterin, ihrer T<strong>an</strong>dempartnerin und einigen<br />
Lehrern <strong>der</strong> Schule.<br />
Die 8 Schritte <strong>der</strong> Intervention<br />
<strong>1.</strong> Info JaS<br />
2. Opfergespräch<br />
3. Elterngespräch<br />
4. Tatfolgenkonferenz<br />
5. Tätergespräch<br />
6. Ausgleichsgespräch<br />
7. Klassen-Info<br />
8. Aufarbeitung<br />
51<br />
15<br />
durch Lehrer, Schüler, …<br />
JaS & Vertrauenslehrer<br />
JaS<br />
JaS<br />
Auffällige / Störer<br />
Außenseiter / Mobbing-Opfer<br />
Sonstige<br />
JaS, Vertrauenslehrer, Konflikthelfer, SL<br />
JaS, T<strong>an</strong>dempartner, Konflikthelfer<br />
JaS & Klassenlehrer<br />
JaS<br />
JaS – <strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule<br />
Abbildung 55: Das achtstufige Interventionsprogramm bei Mobbing unter Schülern
2.6 Vernetzung<br />
Eine wichtige Aufgabe <strong>der</strong> <strong>Jugendsozialarbeit</strong> ist es, die im L<strong>an</strong>dkreis Traunstein und<br />
<strong>der</strong> Stadt Traunreut vorh<strong>an</strong>denen Angebote im Bereich <strong>der</strong> Hilfen zur Erziehung, <strong>der</strong><br />
Berufsvorbereitung, <strong>der</strong> Prävention, <strong>der</strong> Gesundheitsvorsorge, sowie <strong>der</strong> Erlebnisund<br />
Freizeitmöglichkeiten für die Schüler nutzbar zu machen.<br />
Wie bereits im Punkt 2.3.4 beschrieben wurde, ist die Schulsozialarbeit <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
Projektgruppe S.A.L.Z. beteiligt, einem Zusammenschluss verschiedener<br />
Einrichtungen in Traunreut, die sich in regelmäßigen Abständen trifft, um<br />
gemeinsame Aktionen zum Thema „Sexualität – Aids – Liebe – Zärtlichkeit“ zu<br />
pl<strong>an</strong>en.<br />
Im Bereich <strong>der</strong> Gesundheitsvorsorge ist es d<strong>an</strong>k <strong>der</strong><br />
Unterstützung des Gesundheitsamtes Traunstein auch in<br />
diesem Jahr wie<strong>der</strong> gelungen, eine monatliche<br />
Gesundheitssprechstunde <strong>an</strong> <strong>der</strong> Schule <strong>an</strong>zubieten.<br />
Diese wird von Frau Dr. Haindl abgehalten. Sie berät<br />
Schülerinnen und Schüler sowie Eltern zu allen Fragen<br />
<strong>der</strong> Gesundheit, empfohlenen Untersuchungen und<br />
Impfungen, chronischen Erkr<strong>an</strong>kungen (z.B. Übergewicht,<br />
Diabetes, Epilepsie, Allergien, usw.), Sexualität,<br />
Essstörungen o<strong>der</strong> Schul<strong>an</strong>gst. Die Beratung ist<br />
kostenfrei. Versichertenkarte o<strong>der</strong> Überweisungsschein<br />
werden nicht benötigt.<br />
G<strong>an</strong>z aktuell gibt es eine regelmäßige Sprechstunde des Amtes für Kin<strong>der</strong>, Jugend<br />
und Familie <strong>an</strong> <strong>der</strong> Schule. Hier können sich Schüler und/ o<strong>der</strong> Eltern, die in<br />
Konflikten o<strong>der</strong> Krisen stecken, kostenlos zu möglichen Hilfemaßnahmen beraten<br />
lassen. Durchgeführt wird die Sprechstunde abwechselnd von Mitarbeitern des<br />
Amtes für Kin<strong>der</strong>, Jugend und Familie: Frau Kotzebue-Thiomb<strong>an</strong>e, Frau Goltz und<br />
Herrn Schnei<strong>der</strong>.<br />
Vernetzung ist v.a. auch d<strong>an</strong>n wichtig, wenn es um Einzelför<strong>der</strong>ung geht. Hier findet<br />
ein reger Austausch zwischen den beteiligten Personen statt. Regelmäßige<br />
Absprachen zwischen den Bezirkssozialarbeitern des Amtes für Kin<strong>der</strong>, Jugend und<br />
Familie, <strong>der</strong> Erziehungsberatungsstelle Traunstein/ Traunreut, <strong>der</strong> Jugendgerichtshilfe,<br />
dem SPZ Traunstein o<strong>der</strong> den Mitarbeitern <strong>der</strong> Flexiblen Hilfen verschiedener Träger<br />
sichern eine gute Zusammenarbeit und gewährleisten die bestmögliche Hilfe für das<br />
Kind. Bei Bedarf werden die beteiligten Personen kontaktiert o<strong>der</strong><br />
Kooperationsgespräche org<strong>an</strong>isiert.<br />
Eine intensive Zusammenarbeit findet auch mit dem Leiter des Jugendzentrums, Herrn<br />
Stef<strong>an</strong> Stadler und <strong>der</strong> Jugendbeauftragten <strong>der</strong> Stadt Traunreut, Frau Andrea<br />
52<br />
Abbildung 56: Frau Dr. Haindl<br />
vom Gesundheitsamt Traunstein
Haslw<strong>an</strong>ter statt. Beson<strong>der</strong>s hervorzuheben ist dabei v.a ein<br />
Projekt des Traunreuter Ferienprogramms, <strong>der</strong> Circus<br />
Zappzarapp, <strong>der</strong> vom 5. bis 1<strong>1.</strong> Juni 2006 in Traunreut<br />
gastierte. Die Beson<strong>der</strong>heit dieses Circus besteht darin, dass<br />
nicht mit professionellen Artisten gearbeitet wird, son<strong>der</strong>n die<br />
teilnehmenden Kin<strong>der</strong> selbst ein sensationelles<br />
Showprogramm zusammenstellen.<br />
Insgesamt fünf Tage übten sich die Teilnehmer im<br />
Einradfahren, Zaubern, Jonglieren, als Fakire, Kugelläufer,<br />
Feuerspucker, Akrobaten, Trapezkünstler, Clowns und vieles<br />
mehr. Mit Feuereifer wurde ein zweistündiges Programm<br />
einstudiert und nach <strong>der</strong> Generalprobe insgesamt<br />
zweimal <strong>der</strong> Öffentlichkeit präsentiert. Beide Aufführungen<br />
waren ausverkauft. Mit einer atemberaubenden Show<br />
verzauberten die Kin<strong>der</strong> ihr Publikum mit spektakulären<br />
Präsentationen.<br />
53<br />
Abbildung 57:<br />
Der Circus Zappzarapp<br />
Abbildung 58 bis 60:<br />
Teilnehmer am<br />
Circus Zappzarapp
Eine intensive Kooperation findet auch mit <strong>der</strong> Polizei statt, und zwar v.a. im Bereich<br />
<strong>der</strong> Gewalt- und auch Diebstahlprävention.<br />
So wurden in Zusammenarbeit mit dem Jugend- und<br />
Präventionsbeamten <strong>der</strong> Polizeidirektion Traunstein,<br />
Markus Tettenhammer, im Jahr 2006 in allen drei<br />
5. Klassen Workshops zur Diebstahlprävention<br />
durchgeführt.<br />
Ziel dieser Aktion war es, dass sich die Kin<strong>der</strong> mit dem<br />
Thema Eigentum und den möglichen Ursachen für<br />
Eigentumsdelikte beschäftigen und <strong>an</strong>h<strong>an</strong>d von<br />
ausgewähltem Beispielmaterial mögliche Konsequenzen<br />
kennen lernen.<br />
Die Schüler bekamen die Möglichkeit, ausreichend<br />
Fragen zu stellen und alternative Verhaltensweisen zu<br />
diskutieren, um Gefahren zukünftig leichter erkennen und<br />
Lösungsstrategien entwickeln zu können. Durch diese<br />
frühzeitige Prävention werden Schüler und Schülerinnen für<br />
die vielfältigen Gefahren in ihrem Lebensumfeld sensibilisiert.<br />
Durch die Teilnahme am Arbeitskreis „Jugend“ des L<strong>an</strong>dkreises Traunstein ist ein<br />
regelmäßiger Austausch mit <strong>der</strong> Kreisjugendpflegerin Traunstein, Frau Uli Himstedt<br />
und den zahlreichen weiteren Beteiligten gewährleistet.<br />
2.7 Öffentlichkeitsarbeit<br />
Um die Schulsozialarbeit <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule bek<strong>an</strong>nt zu machen,<br />
gehört auch Öffentlichkeitsarbeit zu ihren Arbeitsfel<strong>der</strong>n.<br />
Öffentlichkeitsarbeit findet zum einen intern, d.h. innerhalb <strong>der</strong> Schule statt, um das<br />
Interesse und die Mitarbeit des Lehrerkollegiums zu stärken. Ein Schaukasten in <strong>der</strong><br />
Schule informiert über die Tätigkeitsbereiche <strong>der</strong> Schulsozialarbeit und bietet Platz für<br />
die Veröffentlichung von Fotos. Die Lehrer werden außerdem durch Aushänge im<br />
Lehrerzimmer o<strong>der</strong> Informationsschreiben auf dem Laufenden gehalten.<br />
Öffentlichkeitsarbeit stellt zum <strong>an</strong><strong>der</strong>en aber auch eine Kommunikationsplattform dar,<br />
mit <strong>der</strong>en Hilfe die Tätigkeiten <strong>der</strong> <strong>Jugendsozialarbeit</strong> in <strong>an</strong><strong>der</strong>en Institutionen, aber<br />
auch den Eltern o<strong>der</strong> interessierten Personen bek<strong>an</strong>nt gemacht werden k<strong>an</strong>n. So wurde<br />
die Arbeit im Jahr 2006 beispielsweise mit einer PowerPoint-Präsentation im<br />
Jugendhilfeausschuss <strong>der</strong> Stadt Traunstein vorgestellt. Durch regelmäßige<br />
Presseartikel, eine <strong>an</strong>sprechende Internetpräsenz und die jährlich erscheinende<br />
Schülerzeitung k<strong>an</strong>n die <strong>Jugendsozialarbeit</strong> als Angebot <strong>der</strong> Jugendhilfe und als<br />
54<br />
Abbildung 61: Workshop<br />
zur Diebstahlprävention<br />
in <strong>der</strong> Klasse 5a
wichtiger Teil des Schulprofils dargestellt werden. Eltern werden zudem mit<br />
regelmäßigen Briefen über neue Aktionen und wichtige Termine informiert.<br />
Auch <strong>der</strong> vorliegende Jahresbericht trägt dazu bei, die Schule in <strong>der</strong> Öffentlichkeit als<br />
lebendigen Ort zu präsentieren.<br />
55<br />
Abbildung 62: Die Schüler <strong>der</strong><br />
Werner-von-Siemens-Hauptschule
3. Ausblick<br />
Wie <strong>der</strong> vorliegende Jahresbericht deutlich macht, liegt <strong>der</strong> Schwerpunkt <strong>der</strong><br />
Schulsozialarbeit <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-Siemens-Hauptschule nicht auf <strong>der</strong><br />
Einzelfallhilfe, obwohl auch sie ein wichtiger Teil davon ist. Vielmehr geht es um die<br />
„Umgestaltung“ <strong>der</strong> Schule von einem Bildungs- und Lernort zum Lern- und<br />
Lebensort. Ziel ist es, die Verbindung <strong>der</strong> beiden gleichwertigen Aufträge <strong>der</strong> Schule<br />
– Bildung und Erziehung – zu unterstützen und sozialpädagogische Kompetenzen<br />
systematisch in das unterrichtliche Kerngeschäft zu integrieren.<br />
Durch die intensive Mitarbeit vieler Lehrer konnte sich die <strong>Jugendsozialarbeit</strong> im<br />
Verlauf <strong>der</strong> letzten Jahre als wirkungsvolles Instrument zur Verbesserung <strong>der</strong> Lernund<br />
Lebenssituation von Schülern und als ein bedeuten<strong>der</strong> Best<strong>an</strong>dteil des<br />
Schulalltags etablieren.<br />
Im Jahr 2007 werden laufende Aktivitäten, wie die Hausaufgabenbetreuung, die<br />
Soziale Gruppenarbeit o<strong>der</strong> das Bewerbungstraining mit den Aktivsenioren e.V.<br />
weitergeführt.<br />
Weitere Vorhaben für das neue Jahr sind:<br />
- Workshop zum Training von Bewerbungsgesprächen<br />
- AG Film<br />
- Besuch des Missio-Aids-Trucks<br />
- Unterstützung <strong>der</strong> Gestaltung von Bewerbungsunterlagen in den 8. Klassen<br />
- Mitgestaltung <strong>der</strong> nächsten pädagogischen Konferenzen<br />
- Workshops zur Gewaltprävention in den 7. Klassen in Kooperation mit <strong>der</strong><br />
Polizei<br />
- Präsentation <strong>der</strong> Schulsozialarbeit am Tag <strong>der</strong> offenen Tür 2007<br />
und vieles mehr ....<br />
Abschließend möchte ich festhalten, dass die <strong>Jugendsozialarbeit</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> Werner-von-<br />
Siemens-Hauptschule nur durch die Unterstützung <strong>der</strong> Schulleitung und die gute<br />
Zusammenarbeit mit den Lehrkräften möglich ist. Ich bed<strong>an</strong>ke mich g<strong>an</strong>z beson<strong>der</strong>s<br />
bei meiner T<strong>an</strong>dempartnerin Frau Fischl, aber auch bei allen <strong>an</strong><strong>der</strong>en Lehrern, die<br />
sich nach dem Motto „gemeinsam geht’s besser“ aktiv in diese Arbeit einbringen.<br />
In diesem Sinne hoffe ich auch im Jahr 2007<br />
auf eine gelingende gemeinsame Arbeit!<br />
56