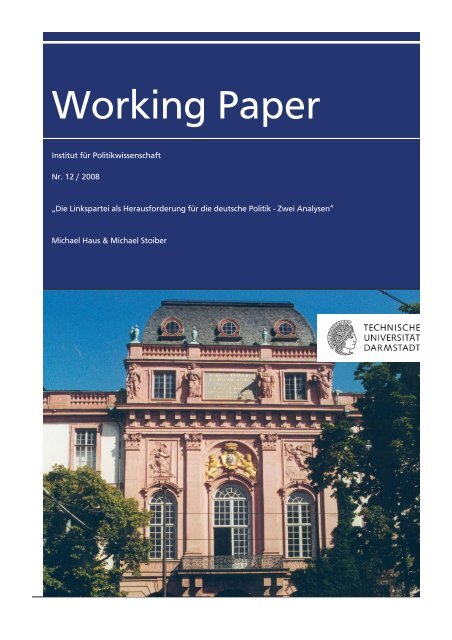Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Working Paper - Institut für Politikwissenschaft - Technische ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>Working</strong> <strong>Paper</strong><br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Politikwissenschaft</strong><br />
Nr. 12 / 2008<br />
„Die Linkspartei als Herausforderung <strong>für</strong> die deutsche Politik - Zwei Analysen“<br />
Michael Haus & Michael Stoiber
Michael Haus & Michael Stoiber<br />
„Die Linkspartei als Herausforderung <strong>für</strong> die deutsche Politik - Zwei Analysen“<br />
<strong>Working</strong> <strong>Paper</strong> Nr. 12 / 2008<br />
<strong>Technische</strong> Universität Darmstadt<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Politikwissenschaft</strong><br />
Michael Haus ist wissenschaftlicher Assistent, Michael Stoiber ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am<br />
<strong>Institut</strong> <strong>für</strong> <strong>Politikwissenschaft</strong> der <strong>Technische</strong>n Universität Darmstadt.<br />
Vorwort<br />
Mit dem Einzug der PDS/Linkspartei in den Bundestag 2005 und ihrer Fusion mit der Wahlalternative<br />
Arbeit und Soziale Gerechtigkeit (WASG) ist die deutsche Parteienlandschaft, ja das Machtgefüge des<br />
politischen Systems insgesamt beträchtlich in Bewegung geraten. Die Frage, wie es zu dieser weiteren<br />
Fragmentierung des Parteiensystems kommen konnte, das sich über die Jahrzehnte bundesrepublikanischer<br />
Geschichte als relativ stabil gezeigt hatte, und welche Konsequenzen sich aus der von vielen<br />
nicht erwarteten Etablierung einer bundesweiten Alternative links von SPD und Bündnis 90/GRÜNE<br />
ergeben, bewegt nicht nur in Deutschland die politischen Gemüter. Auch in China interessieren sich<br />
zumindest akademische Kreise <strong>für</strong> dieses Phänomen. Dies konnten die Autoren der beiden hier vorgelegten<br />
<strong>Working</strong> <strong>Paper</strong>s erfahren, als sie im Abstand von einem Jahr zu einer Vortragsreihe nach<br />
Shanghai eingeladen wurden. Einer der Vorträge behandelte jeweils - auf Wunsch der chinesischen<br />
Gastgeber am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Deutschlandstudien der Tongji-Universität - die Entwicklung und Bedeutung<br />
der "Linken" <strong>für</strong> die deutsche Politik. Wir bedanken uns an dieser Stelle noch einmal herzlich bei Dr.<br />
Chunrong Zheng vom <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Deutschlandstudien und der Friedrich Ebert Stiftung <strong>für</strong> die Einladung<br />
nach Shanghai.<br />
1
1. „Die Linke“ in Deutschland – eine politische Partei mit Sprengkraft? 1<br />
1.1 Einleitende Bemerkungen<br />
Michael Haus<br />
Der Einzug der mit dem Zusatz „Linkspartei“ angetretenen PDS in den Bundestag bei den Wahlen<br />
2005 und ihre Überführung in eine neue Partei, „Die Linke“, knapp zwei Jahre danach können als<br />
wichtige Etappe einer bedeutenden Veränderung des Parteiensystems in Deutschland betrachtet werden.<br />
Mit fünf Fraktionen im Bundestag und einer nachlassenden politischen Integrationsfähigkeit der<br />
beiden großen Parteien CDU/CSU und SPD hat sich das gemäßigte Mehrparteiensystemen zu einem<br />
stärker polarisierten und fragmentierten Parteiensystem entwickelt. Mit dem Einzug der GRÜNEN in<br />
den Bundestag 1983 war es zum ersten Mal gelungen, eine weitere Partei auf Bundesebene zu etablieren.<br />
Es war nicht zuletzt der Zusammenschluss mit dem aus der ostdeutschen Bürgerrechtsbewegung<br />
hervorgegangen Bündnis 90, welcher es den GRÜNEN ermöglichte, die Existenzkrise nach der deutschen<br />
Vereinigung zu überwinden. Mit der aus der Sozialistischen Einheitspartei (SED) hervorgegangen<br />
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS) zog 1990 bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl<br />
eine weitere Partei ins Parlament ein. Auch im Hinblick auf ihr Schicksal spielt das Zusammenspiel<br />
zwischen ostdeutscher und westdeutscher Parteienlandschaft eine zentrale Rolle. Die<br />
PDS hatte faktisch den Status einer auf Ostdeutschland beschränkten regionalen, ja regionalistischen<br />
Partei (vgl. Koß 2007: 118 mit weiteren Verweisen). Das heißt: Sie war nur auf dem Gebiet der ehemaligen<br />
DDR politisch erfolgreich, und sie zehrte thematisch stark von der Wahrnehmung und Thematisierung<br />
des Gegensatzes zwischen Ost- und Westdeutschland. Im Hinblick auf letzteres wurden gar<br />
Vergleiche mit der Partei der Heimatvertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg gezogen, der nach anfänglichen<br />
Erfolgen ein schnelles Ende bereitet war, als die soziale und ökonomische Integration der<br />
Heimatvertriebenen erreicht worden war. Doch nach erfolgreicher Wahlkooperation mit der neu gegründeten<br />
Partei „Arbeit und soziale Gerechtigkeit – Die Wahlalternative“ (WASG), die ihrerseits in<br />
Westdeutschland ihren Schwerpunkt hatte, und anschließender Fusionierung muss diese Prognose als<br />
vorerst widerlegt betrachtet werden.<br />
„Die Linke“ ist heute eine Partei, deren Unterstützer bzw. Mitglieder in mancher Hinsicht sozial repräsentativer<br />
<strong>für</strong> die deutsche Bevölkerung sind als die aller anderen relevanten Parteien; und sie hat mit<br />
der Kritik an den Reformen der Regierung Schröder, v. a. der „Agenda 2010“, die im Kern von allen<br />
Fraktionen im Bundestag mitgetragen wurden, auch ein von regionalen Bezügen losgelöstes inhaltliches<br />
Profil gewonnen, welches auch im alten Bundesgebiet auf Resonanz stößt. Mit dem „Neoliberalismus“<br />
kann sie auf ein allgemeines Feindbild rekurrieren, welches von globalisierungskritischen Bewegungen<br />
mitgetragen wird und in der öffentlichen Meinung negativ besetzt ist. Die Linke hat damit<br />
in mehrfacher Hinsicht vermeintliche Gewissheiten und feste Lager des politischen Lebens in Deutschland<br />
aufgesprengt. Sie hat insbesondere in Hessen zu erheblichen Turbulenzen beim Versuch der Umsetzung<br />
von Wahlergebnissen in Regierungskonstellationen beigetragen und damit auch die gesamte<br />
SPD in eine Führungskrise gestürzt. Ob sie wirklich eine Partei mit „politischer Sprengkraft“ ist, wird<br />
sich allerdings darin erweisen müssen, dass sie die Machtverhältnisse der deutschen Politik im Hinblick<br />
1 Dieser Text ist die überarbeitete Fassung eines gleichnamigen, auf chinesisch verfassten Beitrags <strong>für</strong> die Zeitschrift<br />
Deutschland-Studien, Nr. 1/2008, S. 20-28. Er geht zurück auf einen Vortrag am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Deutschlandstudien<br />
an der Tongji-Universität Shanghai am 11.10.2007.<br />
2
auf Entscheidungsprozesse neu zu sortieren vermag. Da<strong>für</strong> ist aber auch entscheidend, inwiefern die<br />
inhaltliche Gestaltung der Politik durch sie eine neue Ausrichtung erfahren wird.<br />
Im Folgenden sollen zunächst Gründung und bisherige Erfolge bzw. Misserfolge der Linkspartei zusammenfassend<br />
dargestellt werden. Anschließend soll ein umfassender politikwissenschaftlicher Erklärungsansatz<br />
des Erfolges der Partei, das Argument der Existenz einer spezifischen „Gelegenheitsstruktur“,<br />
vorgestellt und kritisch diskutiert werden. In einem nächsten Schritt soll die Frage nach der inhaltlich-programmatischen<br />
Profilierung und der kollektiven Identität der neuen Partei aufgeworfen<br />
werden. Zum Schluss sollen verschiedene Aspekte in der Frage nach der „Sprengkraft“ der Linkspartei<br />
unterschieden und adressiert werden. Insgesamt hat es den Anschein, dass die Erfolge der Linken die<br />
etablierten Politikmuster ins Wanken gebracht haben, ohne dass dies mit einer Stärkung linker Reformziele<br />
einhergehen müsste. Möglicherweise ist gerade das Gegenteil der Fall.<br />
1.2 Zur Gründungsgeschichte der Linkspartei – Schritte zu einer unwahrscheinlichen<br />
Kooperation<br />
Am 16. Juni 2007 wurde mit dem bereits erwähnten Zusammenschluss der beiden Parteien Linkspartei.PDS<br />
und WASG „Die Linke“ gegründet. Vorsitzende dieser neuen Partei sind bis heute Lothar Bisky<br />
(ehemals PDS) und Oskar Lafontaine, der bis 2005 der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands<br />
(SPD) angehört und zeitgleich mit der Unterstützung <strong>für</strong> das Wahlbündnis der beiden Parteien seinen<br />
Austritt aus der SPD und Eintritt in die WASG angekündigt hatte. Im Rahmen dieses Wahlbündnisses<br />
hatten die beiden Parteien bereits bei der Bundestagswahl 2005 kooperiert, indem die Linkspartei.PDS<br />
ihre Listen <strong>für</strong> Kandidaten aus der WASG öffnete. Sie erreichte dabei 8,7 %. Die daraus hervorgegangene<br />
Fraktion im Bundestag nennt sich ebenfalls „Die Linke“.<br />
Wie kam es zur Gründung der Partei? Zunächst empfiehlt sich an dieser Stelle ein kurzer Rückblick auf<br />
die Vorgeschichte der beiden ungleichen Partner. Beginnt man mit der PDS, so fängt dieser Rückblick<br />
am besten mit dem Zusammenbruch des SED-Regimes in der DDR an. Die in der Nachfolge der SED<br />
stehende, nun mit anderen um Wählerstimme konkurrierende, Partei entschied sich in der Folgezeit<br />
wiederholt <strong>für</strong> die Änderung ihres Namens, um den Willen zum Wandel auch deutlich zu machen. Im<br />
Februar 1990 nannte sie sich schließlich nur noch „Partei des Demokratischen Sozialismus“ (PDS). Bei<br />
der ersten Bundestagswahl nach der Vereinigung im Dezember 1990 konnte die PDS nur aufgrund der<br />
Besonderheit einer jeweils <strong>für</strong> das Gebiet der alten und der neuen Bundesländer getrennt geltenden<br />
Fünf-Prozent-Klausel ins Parlament einziehen, da sie in Ostdeutschland die Überwindung der Sperrklausel<br />
schaffte. 1994 hingegen war sie nur aufgrund dreier Direktmandate im Bundestag vertreten 2 ,<br />
1998 gelang ihr mit 5,1 % äußerst knapp der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde, während sie 2002<br />
mit nur 4,0 % deutlich an ihr scheiterte und nur zwei Direktmandate gewinnen konnte. Damit konnte<br />
sie im Bundestag keine Fraktion mehr stellen.<br />
Von einer triumphalen Wahlgeschichte der PDS kann also keine Rede sein, eher von einem unablässigen<br />
Überlebenskampf mit fraglicher Erfolgsaussicht. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in<br />
Ostdeutschland waren alle linken Kräfte und Ideen in eine fundamentale Krise geraten. Trotz des nur<br />
knappen Einzugs der PDS war der politischen Linken dann bereits 1998 allerdings insofern ein historischer<br />
Erfolg beschieden, als es erstmals im Nachkriegsdeutschland möglich wurde, auf Bundesebene<br />
eine politische Mehrheit ohne die Beteiligung „bürgerlicher“ Parteien zu bilden (Dürr 2002: 7). An<br />
2 Wenn eine Partei an der Sperrklausel scheitert, kann sie trotzdem gemäß ihrem Zweitstimmenanteil in den<br />
Bundestag einziehen, wenn sie (über die Erststimme) mindestens drei Direktmandate erreicht hat.<br />
3
dieser war die PDS nicht beteiligt, SPD und GRÜNEN konnten allein die Regierung bilden. Der PDS<br />
gelang der Sprung über die Fünf-Prozent-Hürde nur aufgrund ihrer Erfolge im Osten. Dies bestätigte<br />
den Eindruck, dass die Partei zusammen mit der Generation der ehemaligen DDR-Bediensteten als<br />
wichtigsten System-Nutznießern aussterben würde, während zugleich das politische System durch die<br />
erstmalige Abwahl einer amtierenden Regierung und deren Ersetzung durch eine deutlich anders gefärbte<br />
Mehrheit endgültig seine Reifeprüfung bestanden zu haben schien. Die SPD unter Gerhard<br />
Schröder konnte sich in der Öffnung <strong>für</strong> die „neue Mitte“ zunächst bestätigt sehen, auch wenn sich<br />
bald innerparteiliche Risse zeigten (Rücktritt Lafontaines als Finanzminister).<br />
Allerdings ist zu vermerken, dass die PDS bereits 1998 einen bedeutsamen, wenn auch der Öffentlichkeit<br />
verborgenen, Wandel ihrer Wählerbasis innerhalb Ostdeutschlands durchgemacht hatte. Wurde sie<br />
1990 klar als Partei eines Milieus gleichsam ohne Zukunft gewählt, so konnte das Jahr 1998 festgestellt<br />
werden, dass sie „in den neuen Bundesländern topographisch und sozial mehr Mitte als jede andere<br />
Partei“ sei (Walter 2007a: 328). „Mehr Mitte“ ist in dieser Einschätzung natürlich als beißende<br />
Ironie gegenüber der politischen Rhetorik der Volksparteien zu verstehen, welche sich beständig darum<br />
streiten, wer zu Recht den Platz in der ‘politische Mitte’ <strong>für</strong> sich beanspruchen könne. Gemeint ist<br />
mit Blick auf die ostdeutsche PDS die Widerspiegelung gesellschaftlicher Gruppen in der Wählerschaft,<br />
also kein auf die „Mitte“ zwischen „links“ und „rechts“ gerichtetes Programm. Die PDS war Mitte, die<br />
anderen Parteien redeten über sie. Mit dieser Repräsentativität überholte die PDS jedoch nicht nur die<br />
Volksparteien der Bundesrepublik, sondern – auch in dieser Einschätzung ist die süffisante Ironie deutlich<br />
zu spüren – auch frühere kommunistische Parteien: „In einer gewissen Weise war die PDS das, was<br />
die KPD in der Weimarer Republik gern sein wollte, ohne es jemals geschafft zu haben: Eine Partei mit<br />
gut ausgebildeten, z. T. intellektuellen Kadern, die Zulauf bei den Opfern des Kapitalismus fand und<br />
doch zugleich im Zentrum der Gesellschaft stand“ (ebd.: 329). Nichtsdestotrotz: Im Jahr 2002 kam,<br />
wie bereits erwähnt, der große Rückschlag. Die PDS war über den ostdeutschen Raum hinaus im politischen<br />
Wettbewerb chancenlos geblieben; und in Ostdeutschland haben ihr offensichtlich Regierungsbeteiligungen<br />
in den Ländern bei nachfolgenden Wahlen geschadet, weil sie die Glaubwürdigkeit der<br />
Protesthaltung untergruben (vgl. die Zahlen ebd.: 333).<br />
Der zweite Partner des Zusammenschlusses, die WASG, weist eine sehr viel kürzere, vom Überschlagen<br />
der Ereignisse gekennzeichnete Vorgeschichte auf. Im Jahr 2004 wurde sie zunächst als Verein aufgebaut,<br />
wobei regierungskritische SPD-Mitglieder und Gewerkschafter eine führende Rolle spielten. Sie<br />
richteten sich gegen die „Agenda“-Politik von Bundeskanzler Schröder, vor allem die Reform der Arbeitslosenversicherung,<br />
die eine verkürzte Bezugsdauer von Versicherungsleistungen und diverse Zumutungen<br />
<strong>für</strong> Arbeitslose beinhaltete. Im Januar 2005 erfolgte dann die Gründung als Partei, die im<br />
Mai 2005 erstmals bei einer Landtagswahl antrat und in Nordrhein-Westfalen 2,2 % der Stimmen holte.<br />
Während dieses Ergebnis absolut betrachtet als nicht sonderlich hoch erscheint, hatte es doch eminente<br />
politische Konsequenzen und eine hohe Signalwirkung: Rot-Grün verlor dadurch die Mehrheit<br />
im größten Bundesland und zugleich die letzte Landesregierung dieser Färbung. Unter dem Eindruck<br />
dieser Machtverschiebung kündigte Kanzler Schröder Neuwahlen an. Über die Motive wie auch den<br />
Sinn dieser Entscheidung streitet man bis heute. 2006 zeigte sich (zumindest beim Blick auf Arbeitslosenquoten<br />
und Beschäftigung) erstmals eine deutliche Besserung auf dem Arbeitsmarkt, so dass Schröder<br />
und die SPD bei der eigentlich <strong>für</strong> den Herbst dieses Jahres vorgesehenen Wahl möglicherweise<br />
Aussicht auf eine erste kleine Ernte der Früchte des Reformwerks hätte einfahren können.<br />
Im Rahmen der deutschen Verfassung waren Neuwahlen nur über eine (absichtlich) verlorene Vertrauensfrage<br />
möglich, was weitere Konflikte und Ansehensverluste <strong>für</strong> die Regierung zur Folge hatte.<br />
Es kam zu weiteren Kettenreaktionen: Noch während des Landtagswahlkampfes in Nordrhein-<br />
Westfalen lehnte die Führung der WASG eine Kooperation mit der PDS ab. Schröders Ankündigung<br />
4
von Neuwahlen veränderte jedoch die Situation. Mit Oscar Lafontaine, dem früheren SPD-<br />
Vorsitzenden, der bereits 1999 nach etwas über sechs Monaten als Finanzminister aus der Regierung<br />
Schröder ausgeschieden war, schaltete sich eine Person mit hoher Öffentlichkeitswirksamkeit in die<br />
Diskussion ein und warb <strong>für</strong> eine von ihm und Gregor Gysi (PDS) geführte Wahlallianz. Damit bewies<br />
der erfahrene Lafontaine offensichtlich Instinkt <strong>für</strong> den rechten politischen Augenblick und setzte sich<br />
an die Spitze des gerade abfahrenden Zuges. Im Juni 2005 kam es zur Einigung von PDS und WASG<br />
auf das Wahlbündnis. Im Juli 2005 benannte sich die PDS absprachegemäß in „Linkspartei.PDS“ um<br />
und öffnete ihre Wahllisten <strong>für</strong> WASG-Mitglieder. Die Vorsitzenden Lothar Bisky und Klaus Ernst kündigen<br />
an, eine Vereinigung forcieren zu wollen. Das Sensationsergebnis von 8,7 % bei den Bundestagswahlen<br />
im September 2005 gab dieser Initiative neuen Treibstoff. Schließlich wurden auf dem<br />
WASG-Parteitag in Dortmund am 24. und 25. März 2007 die Gründungsdokumente <strong>für</strong> die zukünftige<br />
gemeinsame Partei verabschiedet, d.h. die „Programmatischen Eckpunkte“, die Satzung und diverse<br />
Ordnungen sowie der Verschmelzungsvertrag. Letzterer erhielt die Zustimmung von 87,7 % der Delegierten.<br />
Angesichts zahlreicher Widerstände in den Parteien sowie erheblicher Unwägbarkeiten in der Abstimmung<br />
der Fusion, waren es die (gemeinsamen) Erfolge aber auch (getrennt erlittenen) Misserfolge bei<br />
Wahlen, welche eine klare Botschaft sprachen: Nur zusammen war man stark. Diese Einsicht konnten<br />
sich die „Techniker der ‘kalten Fusion’“ (Lorenz 2007) zunutze machen. Sie wurde durch die Landtagswahlen<br />
in Hessen und Niedersachsen im Januar 2008 eindrucksvoll bestätigt (Einzug in beide Parlamente).<br />
1.3 Zur Erklärung des Wahlerfolgs der Linkspartei: die These der Repräsentationslücke<br />
und der Ansatz der politischen Gelegenheitsstruktur<br />
Wie ist der bisherige Erfolg der Linken zu erklären? – Nachtwey und Spier (2007) verweisen da<strong>für</strong> auf<br />
eine besondere „politische Gelegenheitsstruktur“ (zum Konzept vgl. Tarrow 1991) und weisen in diesem<br />
Zusammenhang dem Phänomen der „Repräsentationslücke“ eine besondere Rolle zu. Dabei können<br />
vier Erklärungsebenen unterschieden werden, die zusammen ein erweitertes Modell des politischen<br />
Marktes von Nachfrage und Angebot bilden:<br />
a) Auf der Ebene der gesellschaftlichen Nachfrage zeige sich bei Umfragen, dass insbesondere die Arbeiterschaft<br />
und die Arbeitslosen, darüber hinaus aber auch weite Teile der deutschen Bevölkerung die<br />
staatliche Absicherung von Risiken und Beförderung von „sozialer Gerechtigkeit“ verlangen. Die befragte<br />
Meinung – weniger die „öffentliche Meinung“ der Medienwelt – unterstütze eher eine Ausweitung<br />
des Staatshandelns statt dessen Rückführung. Statistiken zeigten zudem, dass die Wahlunterstützung<br />
<strong>für</strong> die SPD bei Arbeitern und zu Arbeitslosen seit den 1980er Jahren zunehmend erodiert ist –<br />
was parteientheoretisch durch den Begriff des „dealignment“ gekennzeichnet werden könne (Nachtwey/Spier<br />
2007: 22, 30).<br />
b) Hinsichtlich des politischen Angebots sei festzustellen, dass die genannten politischen Erwartungen<br />
von der SPD wie auch den anderen Parteien im Bundestag nicht mehr bedient worden seien. Der Parteienwettbewerb<br />
habe sich insgesamt in Richtung wirtschaftsliberaler Positionen als Gravitationszentrum<br />
verschoben, und die SPD habe sich von einer „marktskeptische[n] keynesianischkorporatistische[n]<br />
Sozialdemokratie“ zu einer „marktaffine[n] Sozialdemokratie des Dritten Weges“<br />
entwickelt (Nachtwey/Spier 2007: 37).<br />
c) Eine weitere Erklärungsebene ist die des institutionellen Kontextes. So ging etwa aufgrundder Eigenheiten<br />
des bundesdeutschen Wahlsystems von der durch die absichtlich gescheiterte Vertrauensfrage<br />
5
edingten vorgezogenen Bundestagswahl ein starker Kooperationsdruck aus. Die Öffnung der Liste der<br />
PDS <strong>für</strong> Mitglieder der WASG war die einzige Möglichkeit einer solchen Kooperation, mit der Folge,<br />
dass der „Eindruck einer bereits vereinigten Partei“ (Nachtwey/Spier 2007: 58) entstand. Auch die<br />
Modi der Parteienfinanzierung (Wahlkampfkostenerstattung) setzten Anreize <strong>für</strong> eine baldige Fusion,<br />
da die WASG ansonsten nicht vom Erfolg „ihrer“ Mandate profitieren hätte können.<br />
d) Schließlich muss das diese Situation in spezifischer Weise nutzende Akteurshandeln berücksichtigt<br />
werden. Die Gewerkschaften können hier als Schlüsselakteure aufgefasst werden. Im Zuge einer langjährigen<br />
Entfremdung von der Sozialdemokratischen Partei sei aufflammender Protest gegen die Modernisierungspolitik<br />
der Regierung Schröder von den Gewerkschaften toleriert oder sogar gefördert<br />
worden. Bei der Gründung der WASG spielten gut organisierte, über Kontaktnetzwerke und politische<br />
Erfahrung verfügende Gewerkschafter eine entscheidende Rolle. Die immer neuen Wahlniederlagen<br />
der SPD bei den Landtagswahlen 2003 und 2004 waren außerdem auch <strong>für</strong> SPD-Politiker ein Anlass,<br />
mit der neuen Partei links von der SPD zu liebäugeln.<br />
Wie ist dieses Argument der politischen Gelegenheitsstruktur und insbesondere das der Repräsentationslücke<br />
einzuschätzen? Ganz allgemein kann zunächst festgehalten werden, dass es wohl immer eine<br />
spezifische „Gelegenheitsstruktur“ geben muss, wenn Handlungsstrategien ein Erfolg beschieden ist,<br />
der ihnen üblicherweise versagt bleibt. Der interessante Punkt liegt eher in der Bedeutung bestimmter<br />
Momente einer solchen Struktur, ihrer Eindeutigkeit oder Offenheit im Hinblick auf zukünftige Entwicklungen<br />
und die darauf gerichteten Versuche, Politik zu deuten. Politik ist immer ein Testen von<br />
Entscheidungen unter Bedingungen von Ungewissheit über kausale Zusammenhänge (Luhmann<br />
2000). Dabei spielen „frames“, also strategisch eingesetzte Deutungsangebote politischer Entscheidungen,<br />
und der Versuch ihrer Änderung („reframing“) eine wichtige Rolle (vgl. Rein/Schön 1993). Die<br />
Tatsache, dass das Erlangen von Regierungsämtern von geringen Verschiebungen in der prozentualen<br />
Verteilung von Stimmenanteilen und dies wiederum von Faktoren wie Wahlbeteiligung oder der antizipierten<br />
Wirkung von Sperrklauseln abhängen kann, macht zusätzlich deutlich, dass der strategischen<br />
Kalkulation entlang durchschaubarer Ursache-Wirkungs-Beziehungen prinzipielle Schranken gesetzt<br />
sind. Hinter dem wissenschaftlichen Konzept der „Gelegenheitsstruktur“ verbirgt sich die interessantere<br />
Frage, wie Erfolg der Linkspartei und Krise der SPD „erzählt“ werden können (vgl. Bevir/Rhodes<br />
2002) und welches Bild dies auf die beteiligten Akteure wirft.<br />
Mit Blick auf die Ergebnisse von Wahlanalysen ist wohl unbestreitbar, dass „die Linkspartei bei der<br />
Bundestagswahl 2005 Wähler angesprochen [hat], die ihre politischen Positionen nicht gewechselt,<br />
aber ihre Bindung an die SPD aufgegeben haben“ (Nachtwey/Spier 2007: 14). Dieser Befund wird<br />
gerne dahingehend pointiert, dass die Linkspartei „metaphorisch gesprochen, ‘Fleisch vom Fleische der<br />
Sozialdemokratie‘“ darstellt (ebd.). Insgesamt hat die Linkspartei 4,1 Mio. Zweitstimmen bekommen. 3<br />
Dabei gewann sie knapp eine Millionen Stimmen netto von der SPD; allerdings erhielt sie auch<br />
430.000 von vorherigen Nichtwählern (Hilmer/Müller-Hilmer 2006: 202f.). Schoen und Falter sprechen<br />
davon, dass die Linkspartei in den alten Ländern, von der parteipolitischen Herkunft ihrer Wählerschaft<br />
her betrachtet, „wie eine Ausgründung der SPD [erscheint], was mit der Entstehungsgeschichte<br />
der WASG und deren Selbstverständnis als Bewahrerin ‘echter’ sozialdemokratischer Politik<br />
durchaus in Einklang steht“ (Schoen/Falter 2005: 37). Allerdings macht die Begrenzung dieser zugespitzten<br />
Aussage auf die alten Bundesländer bereits deutlich, dass die Erzählung von der Linkspartei<br />
als Reinkarnation bzw. Klon der SPD mit Vorsicht zu genießen ist.<br />
3 Siehe http://www.bundeswahlleiter.de/bundestagswahl2005/ergebnisse/bundesergebnisse/b_tabelle_99.html.<br />
In Deutschland entscheidend bekanntlich der Zweitstimmenanteil über die Stärke der Fraktionen im Parlament.<br />
6
Dass Vorsicht geboten ist und die These der Repräsentationslücke möglicherweise eine zentrale Erklärungslücke<br />
aufweist, wird auch deutlich, wenn man sich noch einmal genauer die Befunde zu dem als<br />
Untermauerung der These angeführten „Wohlfahrtsstaatskonsens“ ansieht. In der Tat ist der allgemeine<br />
Konsens hinsichtlich der Unterstützung des Wohlfahrtsstaates überwältigend. In Westdeutschland<br />
waren 2004 73,9 % der Bevölkerung der Meinung, dass die sozialen Leistungen des Staates so bleiben<br />
sollten, wie sie sind oder gar noch ausgeweitet werden sollten; in Ostdeutschland stimmten sogar 89,6<br />
% diesen Aussagen zu (Nachtwey/Spier 2007: 34). Allerdings muss bedacht werden, dass keineswegs<br />
alle, die sich angesichts des angeblichen neoliberalen Elitenkonsenses nicht mehr repräsentiert fühlen<br />
müssten, <strong>für</strong> die Linkspartei gestimmt haben. Das Argument der Repräsentationslücke verweist angesichts<br />
dessen insbesondere auf Arbeiter und Arbeitslose als Stammwählerschaft der SPD, die an die<br />
PDS übergegangen sei. Hierzu kann jedoch festgehalten werden, dass in Westdeutschland 2005 immer<br />
noch 55 % der gewerkschaftlich organisierten Arbeiter <strong>für</strong> die SPD stimmten und nur 10 % <strong>für</strong> die<br />
PDS. Im Osten lagen die Zahlen zwar nahezu gleichauf (32 % <strong>für</strong> die SPD, 31 % <strong>für</strong> die Linkspartei);<br />
dies galt allerdings tendenziell auch <strong>für</strong> den Anteil in allen anderen Bevölkerungsgruppen (30,4 <strong>für</strong> die<br />
SPD, 25,3 % <strong>für</strong> die Linkspartei) (vgl. ebd.: 22). Schaut man als Nächstes auf die zeitliche Veränderung<br />
der Wahlergebnisse, so ergibt sich, dass die Linkspartei von 2002 auf 2005 ihr Ergebnis bei den<br />
gewerkschaftlich organisierten Arbeitern in West und Ost in etwa verdreifachte. Jedoch hat die SPD<br />
zwischen 2002 und 2005 nur in Ostdeutschland bei den gewerkschaftlich organisierten wie auch bei<br />
den unorganisierten Arbeitern deutlich verloren (von 57 auf 32 % bzw. 41 auf 26 %).<br />
Fasst man diese Befunde zusammen, so zeigt sich, dass der Einbruch der SPD bei den Arbeitern in erster<br />
Linie ein ostdeutsches Phänomen war. Im Westen wich er nicht vom allgemeinen Muster ab. In Ostdeutschland<br />
zeigen gerade die Wähler aus der Arbeiterschaft ein extrem instabiles Wählerverhalten,<br />
was sich sowohl bei den Ergebnissen der SPD als auch der Linkspartei bemerkbar macht. Im Vergleich<br />
der Jahre 1998, 2002 und 2005 zeigen sich zudem <strong>für</strong> Ost- und Westdeutschland ganz unterschiedliche<br />
Muster der Unterstützung der SPD. Bei den Arbeitslosen hatte die SPD 2005 im Westen sogar eine<br />
höhere Unterstützung als 2002, obwohl erst nach 2002 die (vermeintlichen) Leistungskürzungen entschieden<br />
wurden. Lag die Unterstützung bei den Arbeitslosen zudem 2002 unter der allgemeinen Unterstützung<br />
<strong>für</strong> die SPD, so betrug sie im Jahr 2005 knapp 3 % mehr. Ein längerer Atem hätte zudem<br />
dazu geführt, dass zum Zeitpunkt der Wahlen die Besserung am Arbeitsmarkt bereits spürbar gewesen<br />
wäre. Diese Befunde wecken doch erhebliche Zweifel daran, dass der Wahlerfolg der Linkspartei im<br />
Kern als eine rationale Reaktion der Nachfrager auf das unzulängliche Angebot der politischen Klasse<br />
begriffen werden kann. Eher handelt es sich um eine machtstrategische Fehlspekulation und -<br />
wahrnehmung der SPD-Führung, allen voran Kanzler Schröders, im Kontext der Vertrauensfrage, und<br />
um das schwer berechenbare Handeln eines vergleichsweise „entwurzelten“ Wählerspektrums in Ostdeutschland.<br />
Man kann diese Zweifel allgemeiner fassen: Auch ein Großteil derjenigen Wähler, welche im Prinzip<br />
den wohlfahrtsstaatlichen Konsens mittragen, haben ja <strong>für</strong> Parteien gestimmt, die angeblich einem<br />
„neoliberalen“ Konsens anhängen. Das ist merkwürdig. Handelt es sich bloß um die Macht der Gewohnheit?<br />
Das würde allerdings bedeuten, dass ein Teil der Wähler „rational“, der größere Teil „irrational“<br />
gewählt hat. Vielleicht wäre es passender, von unterschiedlichen Mustern des Umgangs mit Unsicherheit<br />
zu sprechen, sowohl bei den Arbeiter- und Arbeitslosen-Wählern als auch in der Wählerschaft<br />
insgesamt. Diese Unsicherheit betraf vor allem die Frage der tatsächlichen Effekte einer zumutungsreichen<br />
Reformpolitik und deren Deutung. In den Landtagswahlen äußerte sie sich immer wieder in Protestwahlverhalten<br />
und Enthaltung. Dies verunsicherte dann auch zusehends die SPD, welche in den<br />
Ländern bittere Niederlagen hinnehmen musste.<br />
7
Diese Überlegungen stellen auch einen wichtigen Hintergrund dar, wenn man sich der Frage zuwendet,<br />
welche Handlungsmöglichkeiten sich <strong>für</strong> die zentrale Akteure ergeben haben, insbesondere inwiefern<br />
sich der SPD alternative Handlungsoptionen boten. So wird von den oben genannten Forschern<br />
einerseits suggeriert, dass die Schröder-SPD sich mit dem Schwenk zum „Neoliberalismus“ aus eigenem<br />
Verschulden in eine Sackgasse manövriert habe. Zugleich sprechen die Kritiker jedoch andererseits<br />
von einer „Modernisierungsfalle“, in die die SPD geraten sei, und müssen selbst einräumen: „Um<br />
mehrheitsfähig zu werden, musste [die SPD] sich den Mittelschichten öffnen. Aber genau durch diese<br />
Öffnung hat sie sich gegenüber ihren traditionellen Anhängern abgeschottet“ (Nachtwey/Spier 2007:<br />
50). Nun muss festgestellt werden, dass die SPD im Bund Wahlen schon immer nur dann gewinnen<br />
konnte, wenn sie sich gegenüber den Mittelschichten geöffnet hat, wobei bis 1998 immer die Koalitionspolitik<br />
der FDP den entscheidenden Ausschlag gab. Die Entgegensetzung von Interessen der Mittelschichten<br />
und Interessen der Arbeiter ist aber ohnehin zu rigide. Denn beide haben ein Interesse an<br />
ökonomischen Wachstum und Absicherung gegen Risiken. Soziale Absicherung ist unter Bedingungen<br />
einer kapitalistischen Ökonomie überhaupt nur durch Wachstum denkbar. Beide haben zudem ein Interesse<br />
am Wohlfahrtsstaat (als Leistungsempfänger und Bedienstete). Auch keynesianischwohlfahrtsstaatliche<br />
Strategien stellten einen Versuch dar, progressive Teile des Bürgertums mit einer<br />
pragmatischen Konzeption politischer Steuerung <strong>für</strong> sich zu gewinnen. Nur war der keynesianische<br />
Kompromiss angesichts der oben angesprochenen Krisenphänomene offensichtlich nicht mehr überzeugend.<br />
4<br />
Auch die sozialdemokratischen Parteien anderer Länder haben nach einer Reformulierung ihrer programmatischen<br />
Ausrichtung gesucht, ob nun explizit als „Dritter Weg“ zwischen alter Sozialdemokratie<br />
und Neokonservatismus oder ohne derartige Rhetorik. Die damit gewiss auch verbundene Ausrichtung<br />
auf die Überzeugungen und Anliegen der „neuen Mittelschichten“ darf dabei nicht mit „Neoliberalismus“<br />
gleichgesetzt werden, sondern ist eher als Suche nach einem neuen Kompromiss – in etwas überhöhter<br />
Rhetorik: als Versuch eines „neuen Gesellschaftsvertrages“ (Giddens 2001: 8) – zu verstehen.<br />
Entscheidend ist in diesem Zusammenhang nicht nur, wie Reformkonzepte formuliert werden, sondern<br />
inwiefern sie überhaupt Umsetzungschancen haben. Das gescheiterte „Bündnis <strong>für</strong> Arbeit“ in der ersten<br />
Hälfte der rot-grünen Regierungszeit stellte den Versuch einer Verständigung mit Gewerkschaften und<br />
Arbeitgebern über die notwendigen Reformen in Deutschland dar. In einem Land mit einer durch zahlreiche<br />
andere Instanzen in ihrer Handlungsfähigkeit beschränkten Zentralregierung und einer nicht<br />
unbedingt über parteiübergreifende Verständigung ausgerichteten politischen Kultur war das Scheitern<br />
eines solchen Bündnisses jedoch zu erwarten (vgl. Czada 2000). Die Hartz-Kommission war mit 15<br />
Mitgliedern aus unterschiedlichsten Bereichen pluralistisch besetzt und kam zu einem gemeinsamen<br />
Ergebnis; sie behandelte aber eigentlich nur die Arbeitsmarktreform, nahm gesellschaftliche Kräfte<br />
nicht in Verantwortung <strong>für</strong> eine gemeinsame Wirtschafts- und Sozialpolitik und wurde dann in den<br />
Konsenszwängen des deutschen Regierungssystems kleingearbeitet. Demgegenüber war es etwa in<br />
Dänemark und anderen skandinavischen Ländern möglich, die Kombination von nach wie vor hoher<br />
sozialstaatlicher Absicherung bei weitgehender Deregulierung der Arbeitsmärkte als Kern eines neuen<br />
Wohlfahrtskonsenses zu etablieren. In Dänemark gelang dies sogar einer sozialdemokratischen Minderheitsregierung<br />
(Henkes 2006). Es ist aber selbst <strong>für</strong> Deutschland fragwürdig, von einem „neoliberale[n]<br />
Elitekonsens“ (Nachtwey/Spier 2007: 66) zu sprechen. Der Begriff „Neoliberalismus“ ist ein polemischer.<br />
Er suggeriert, dass es eine ausgefeilte ideologische Grundlage des Handelns gebe.<br />
4 Interessanterweise hat in den 1980er Jahren gerade der damalige SPD-Politiker und jetzige Linkspartei-<br />
Vorsitzende Oscar Lafontaine die Gewerkschaften durch die Forderung nach Arbeitszeitverkürzung ohne vollen<br />
Lohnausgleich auf Betriebsebene im Einvernehmen mit Betriebsräten und Belegschaften brüskiert.<br />
8
Problematisch war aber in jedem Fall, dass es die politischen Eliten, allen voran Kanzler Schröder, versäumten,<br />
an einem neuen wohlfahrtsstaatlichen Konsens als Teil eines von den Wählern zu erhaltenden<br />
politischen Mandats zu arbeiten. Das Schröder-Blair-Papier von 1999 war ein Ad-hoc-Versuch, der<br />
sofort einem feindseligen Zynismus zum Opfer fiel. Während z.B. in der Grundsatzkommission der SPD<br />
über Jahre hinweg immer wieder über Gerechtigkeitsfragen debattiert wurde, strahlte dies nicht auf<br />
die politische Führung und eine tragfähige Programmatik ab Angesichts manipulativ anmutender Inszenierungen<br />
wie dem Schröder-Blair-Papier sprach die Wählerschaft schließlich der Linkspartei eine<br />
besondere „Kompetenz“ <strong>für</strong> Gerechtigkeitsfragen zu – als ob „Gerechtigkeit“ als ein von anderen Fragen<br />
abgetrenntes Politikfeld darstellen würde. Dadurch konnte die vormals völlig in Strömungen, Flügel,<br />
Plattformen usw. fragmentierte PDS trotz „schlichtweg anarchisch(er)“ Organisation (Koß 2007:<br />
119) so etwas wie ein Profil über das der postkommunistischen Bösewichte und der Ost-Partei hinaus<br />
gewinnen, erst recht mit den abtrünnigen Sozialdemokraten der WASG. Sie profitierte fraglos davon,<br />
dass „noch nie […] ein einschneidender politischer Richtungswechsel der Nachkriegszeit dermaßen<br />
wortkarg, begründungsschwach und inspirationslos vermittelt [wurde]“ (Wiesendahl 2004: 22). Für<br />
die Kommunikation innerhalb der SPD hingegen gilt, dass der „rücksichtslose Umgang mit der Partei“<br />
nicht nur „singulär <strong>für</strong> die SPD-Nachkriegsgeschichte“ (Wiesendahl 2004: 24) war, sondern auch nicht<br />
<strong>für</strong> einen tragfähigen Wandel der Partei sorgen, wie sich an den heutigen Zerwürfnissen über das Erbe<br />
der Schröderschen Politik zeigt.<br />
1.4 PDS und WASG in der „Linken“ – ungleichgewichtig aber gleich wichtig?<br />
Was <strong>für</strong> ein Gebilde wurde durch die Fusion von PDS und WASG geschaffen? Angesichts der Ungleichheit<br />
der beiden Partner kann man diese Frage zunächst auch so formulieren: Ist davon auszugehen,<br />
dass Die Linke von der PDS dominiert wird? Zur Beantwortung dieser Frage sollen im Folgenden<br />
die Mitgliederstruktur und die jeweiligen Beiträge zu den Wahlergebnissen angeschaut werden. Dabei<br />
kommen Zweifel an der vermeintlichen Dominanz der PDS-Seite auf.<br />
So zeigt sich bereits beim Blick auf die Mitgliederanteile, dass der erste Eindruck einer klaren PDS-<br />
Dominanz bei näherem Hinschauen trügerisch ist. Gewiss, bei der Vereinigung der beiden Parteien,<br />
brachte die PDS rund sechs Mal so viele Mitglieder in die neue Partei ein wie die WASG. Dies wirkt<br />
sich auch in einer deutlichen regionalen Asymmetrie aus: Nur etwa ein Fünftel der heute rund 74.500<br />
Mitglieder stammen aus den westlichen Bundesländern. 5 Die ostdeutschen Landesverbände der PDS<br />
haben also bei weitem die meisten Mitglieder in die neue Linkspartei eingebracht und bilden ein eindeutiges<br />
quantitatives Übergewicht. Zieht man nun allerdings die Altersstruktur in Betracht, so zeigt<br />
sich, dass 71 % der PDS-Mitglieder Rentner waren. Keine der anderen großen Parteien hat auch nur<br />
einen halb so hohen Wert. Die harte Wahrheit hinter den imposanten Zahlen lautet also, dass der PDS-<br />
Anteil der Vergreisung unterliegt. Nun mag man mit Franz Walter „Vergreisung als Chance“ diskutieren<br />
wollen. So stellt Walter die These in den Raum, dass „die Zukunftschancen einer Linkspartei […]<br />
gerade darin liegen, dass sie eben nicht primär als Partei eines ungestümen jungendlichen [sic!] Radikalismus<br />
agiert“ (Walter 2007b: 341). Im Kontext der Debatte um eine alternde Gesellschaft, kann<br />
man diese These <strong>für</strong> einen interessanten Anstoß halten. Dennoch mildert dieser Befund den ersten, auf<br />
der zahlenmäßigen Übermacht der ehemaligen PDS-Mitglieder beruhenden Eindruck, da auch die Al-<br />
5 Quellen <strong>für</strong> diese Angaben sind die Bundeszentrale <strong>für</strong> politische Bildung (http://www.bpb.de/ themen/<br />
T5T65A,0,0,Fakten%3A_DIE_LINKE.html), die freie Enzyklopädie Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/<br />
Die_Linke) und die Homepage der Linkspartei (http://die-linke.de /partei/fakten/mitgliederzahlen/).<br />
9
ten der Linkspartei zumindest in der Hinsicht nur begrenzt zukunftsfähig sind, als sie irgendwann einmal<br />
den Gang alles Irdischen nehmen werden.<br />
Schaut man sich als nächstes die Wahlergebnisse in ihrer Verteilung auf die beiden fusionierten Parteien,<br />
auf Gruppen der Wählerschaft sowie auf regionale Schwerpunkte an und reflektiert ihre Bedeutung<br />
<strong>für</strong> die Machtverhältnisse innerhalb der neuen Partei, so zeigt sich ebenfalls ein ambivalentes Bild:<br />
Zwar stimmt es, dass sich die PDS von 1990 bis 1998 von einer Milieupartei, die vor allem ehemalige<br />
DDR- und SED-Funktionäre und DDR-Staatsbedienstete ansprach, zu einer allgemeinen Protestpartei<br />
(Micus 2007: 223) und in Ostdeutschland möglicherweise zu einer Volkspartei entwickelt hat. Bei der<br />
Bundestagswahl erreichte das Wahlbündnis in den neuen Ländern 25,3 %, in den alten hingegen „nur“<br />
4,9 %. Die PDS ist zudem seit der Wende in allen ostdeutschen Landtagen vertreten und zum Teil<br />
zweitstärkste Kraft. Sie erhielt in Mecklenburg-Vorpommern 1998 erstmals Regierungsverantwortung,<br />
seit 2001 hat sie Regierungsämter in Berlin. Dies alles verweist auf eine überlegene Position der PDS,<br />
nicht zuletzt schon deshalb, weil sich Wahlerfolge in Wahlkampfkostenerstattungen auszahlen und mit<br />
Regierungsämtern weitere Ressourcenzuwächse verbunden sind. Allerdings kann zugleich festgehalten<br />
werden, dass die Macht der PDS-Seite in der Linkspartei unter zwei Phänomen leidet: Zum einen ist es<br />
der PDS bis zum Schluss nicht gelungen, in den westlichen Bundländern zu Wahlerfolgen zu gelangen;<br />
zum anderen leidet sie gerade dort, wo sie Regierungsverantwortung innehat, unter massiven Stimmeneinbußen,<br />
so dass von einem Abnutzungseffekt gesprochen werden kann, der gerade eine Protestpartei<br />
besonders hart treffen muss. 6 Die WASG hingegen schnitt als selbständig antretende Partei in<br />
Baden-Württemberg (3,1 %) und Rheinland-Pfalz (2,5 %) bei den 2006er-Wahlen deutlich schlechter<br />
ab als die Linkspartei in diesen Ländern bei den Bundestagswahlen im Jahr zuvor. In Berlin und Mecklenburg-Vorpommern<br />
trat sie sogar gegen die PDS an und erreichte 2,9 bzw. 0,5 %. In Bremen hingegen<br />
gelangt es einer vereinten „Linken“ im Mai 2007 8,4 % der Stimmen auf sich zu vereinen. Aus alledem<br />
wird deutlich, dass beide Seiten mit Blick auf Wahlerfolge voneinander abhängig gewesen sind.<br />
1.5 Programm und Persönlichkeiten der Linkspartei – Gerechtigkeit oder Sozialismus?<br />
„Die Linke“ verfügt bislang noch nicht über ein Parteiprogramm. Ihr programmatisches Profil kann<br />
insofern nur am Eckpunktepapier, an der Satzungspräambel sowie programmatischen Äußerungen von<br />
Parteiführern abgelesen werden. Bevor man sich diesen Aspekten zuwendet, ist es wiederum sinnvoll,<br />
auf die Programme der beiden Parteien einzugehen, welche die neue Linkspartei gebildet haben. Wie<br />
schon bei den strukturellen und personellen Merkmalen zeigt sich auch hier, dass die PDS zwar einerseits<br />
als der WASG überlegen erscheint, dass andererseits aber auch deutliche Grenzen ihrer Handlungsfähigkeit<br />
sichtbar werden. Dass die neue Partei ein konzeptionell durchdachtes Programm auf<br />
den Weg bringen kann, erscheint im Lichte der Erfahrungen von PDS und WASG zweifelhaft.<br />
6 Wie bereits erwähnt, ist die PDS bei der Bundestagswahl 2002 mit 4 % deutlich an der Fünf-Prozent-Hürde<br />
gescheitert. Bei der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen erreichte sie nicht einmal 1 %, während die WASG aus<br />
dem Stand 2,2 % schaffte. Die WASG war zu diesem Zeitpunkt also eine ernsthafte Konkurrenz <strong>für</strong> die PDS<br />
(Schön/Falter 2005: 33). In Berlin erlitt die PDS als Regierungspartei einen deutlichen Einbruch bei den folgenden<br />
Wahlen. So kam sie im September 2006 nur noch auf 13,4 %, was einen Verlust von 9,2 % bedeutete. Bereits<br />
bei den Wahlen nach Beteiligung an der Regierung in Mecklenburg-Vorpommern war die PDS um 8 % abgerutscht<br />
und liegt seitdem deutlich unter den Ergebnissen in den anderen östlichen Ländern.<br />
10
In der PDS galt zuletzt das Chemnitzer Programm von 2003. Ihm konnte ein thematisch umfassender<br />
Charakter zugesprochen werden. Zwar konnte das Chemnitzer Programm zumindest teilweise als theoretisch-analytisch<br />
fundiert betrachtet werden, wobei hier besonders eine Analyse des gegenwärtigen<br />
kapitalistischen Staates hervorzuheben ist. Zweifellos finden sich auch symbolische Bekenntnisformeln<br />
wie jene zum „Sozialismus“. Doch insgesamt kann davon gesprochen werden, dass das Chemnitzer<br />
Programm sich durch die Integration unterschiedlichster weltanschaulicher Ausrichtungen auszeichnete.<br />
Man kann durchaus von einer Selbstdarstellung als linker Volkspartei sprechen. So weist Micus<br />
(2007: 199) darauf hin, dass das letzte PDS-Programm in den Grundzügen dem Godesberger und dem<br />
Berliner Programm der SPD entspreche. Wie das Godesberger Programm (1957) bekannte sich auch<br />
das Berliner Programm der SPD von 1989 zu den Grundwerten des „Demokratischen Sozialismus“.<br />
Auch das Ende Oktober 2007 beschlossene neue Grundsatzprogramm der Sozialdemokraten, das<br />
Hamburger Programm, beruft sich auf die „stolze Tradition des demokratischen Sozialismus“ (SPD<br />
2007: 5). Wie die SPD im Hamburger Programm (das an dieser Stelle frühere Formulierungen übernimmt),<br />
bekannte sich auch die PDS im Chemnitzer Programm zu „Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität“<br />
als ihren Grundwerten. Wie die SPD bereits im Godesberger Programm so vollzieht auch die PDS<br />
eine weltanschauliche Öffnung: „Unser Eintreten <strong>für</strong> einen demokratischen Sozialismus ist an keine<br />
bestimmte Weltanschauung, Ideologie oder Religion gebunden. Die PDS ist eine pluralistische Partei<br />
demokratischer Sozialistinnen und Sozialisten“ (PDS 2003: 54). Dies ist eine beschönigende Umschreibung<br />
des Umstands, dass die PDS zeitweise noch nicht einmal wie die anderen Parteien als „lose<br />
gekoppelte Anarchie“ bezeichnet werden konnte, „sondern mangels loser Kopplung schlichtweg anarchisch<br />
organisiert war“ (Koß 2007: 119).<br />
Wenn es einen charakteristischen Unterschied zwischen den Grundsatzprogrammen der SPD und dem<br />
der PDS von 2003 gibt, dann liegt dieser wohl eher auf der Ebene der Einschätzung politischer Handlungsmöglichkeiten.<br />
Dabei ist das Chemnitzer Programm der PDS allerdings eher durch Ratlosigkeit<br />
und hilflose Beschwörungsformeln denn durch sozialistischen Fortschrittsoptimismus geprägt. Während<br />
mit dem „Neoliberalismus“ als irregeleiteter Ideologie und auf falschen Annahmen beruhender<br />
Problemdiagnose ein klares Feindbild existiert, konzediert man zugleich, dass „die Bedingungen <strong>für</strong><br />
Alternativen schlecht sind und auf absehbare Zeit schlecht bleiben werden“ (PDS 2003: 28). Die „Beteiligung<br />
der demokratischen Öffentlichkeit“ und „die internationale gewerkschaftliche Zusammenarbeit<br />
und die Kooperation der Linksparteien“ (ebd.) dienen als Hoffnungsanker, der Weg als das Ziel.<br />
Wenn die PDS die „anhaltende Wachstumsschwäche“, den „enorme[n] Schuldendienst“ und den Konkurrenzdruck<br />
globalisierter Märkte <strong>für</strong> die Kraftlosigkeit politischer Alternativen verantwortlich macht<br />
(ebd.), dann zieht sie freilich nicht in Betracht, dass es durchaus Länder gibt, in denen zumindest<br />
Haushaltsdefizite abgebaut und Wachstum erzielt werden konnte und dabei vermeintlich „neoliberale“<br />
sozialdemokratische Parteien eine wichtige Rolle gespielt haben (vgl. Merkel et al. 2006). Statt sich<br />
mit unterschiedlichen Reformerfahrungen oder „Dritten Wegen“ sozialdemokratischer Regierungen<br />
auseinanderzusetzen, werden im Chemnitzer Programm einige Elemente der Umverteilung, der Arbeitsplatzschaffung<br />
und der Nachfrageförderung genannt und als „Konzept“ ausgegeben, ohne zu erwähnen,<br />
dass dies zur weiteren Verschuldung führen würde (PDS 2003: 18).<br />
Im Gegensatz zur PDS konnte die WASG als neu gegründete Partei, die vorrangig auf Protesthaltung<br />
gegenüber ihrer „Mutter“, der SPD, gerichtet war, nur mit einem eng an wirtschafts- und sozialpolitischen<br />
Fragen orientierten Programm aufwarten, bei dem „soziale Gerechtigkeit“ als Schlüsselbegriff<br />
fungierte, während „Sozialismus“ an keiner Stelle im Programm auftaucht (Micus 2007: 180). Der<br />
Begriff der sozialen Gerechtigkeit wird dabei nicht von philosophischen, weltanschaulichen oder konzeptionellen<br />
Grundlagen her bestimmt, sondern mit dem „Sozialstaat“ und dieser mit dem Sozialstaat<br />
der 1960er und 1970er Jahre gleichgesetzt (Micus 2007: 195). Ob man angesichts dessen von „linkem<br />
Keynesianismus“ oder eher von „Vulgärkeynesianismus“ sprechen sollte, sei dahingestellt. Festzuhalten<br />
11
leibt in jedem Fall, dass keynesianische Vorstellungen der Wirtschaftssteuerung und des Sozialstaats<br />
weitgehend irritationsfrei präsentiert werden, das heißt ohne Aufarbeitung der mit dem Keynesianismus<br />
verbundenen historischen Krisenerfahrungen sowie gegenwärtiger Analysen der Probleme keynesianischer<br />
Steuerung in einer postfordistischen Ökonomie, wie sie auch und gerade von Wissenschaftlern<br />
mit marxistischem Hintergrund formuliert werden (vgl. etwa Jessop 2002, Hirsch 2005). 7<br />
Folgte die PDS eher dem Prinzip „Sozialismus statt Programmatik“, so kann <strong>für</strong> die WASG vom Prinzip<br />
„Gerechtigkeit statt Sozialismus“ gesprochen werden. Da beide Programme letztlich keine kohärenten<br />
Konzepte beinhalten, kann man vermuten, dass die anlaufende Programmdebatte in der „Linken“ keine<br />
gravierenden Konflikte jenseits symbolischer Reizfragen hervorrufen wird. Bereits das Eckpunktepapier<br />
von 2007 präsentiert die salomonische Formel der „Zusammenführung von Grundideen alternativer<br />
Politik“ (vgl. Die Linke 2007: 2), die sie mit der Addition von WASG- und PDS-Ausgangspunkten<br />
zu verwirklichen können meint. 8 Obwohl gerade die Linkspartei auf „Politikalternativen“ drängt und<br />
damit Wahlen gewinnt, ist sie organisatorisch womöglich am wenigstens zur Formulierung solcher<br />
Alternativen in der Lage.<br />
Freilich war und ist auch die versöhnende Zusammenführung von Grundideen alternativer Politik nach<br />
dem Prinzip friedlicher Koexistenz immer wieder von Abgrenzungsbestrebungen gefährdet worden. Es<br />
kommt in dieser Situation auch auf symbolische Gesten und Rhetoriken des Führungspersonals an.<br />
Besonders hervorgetan hat sich im Hinblick hierauf immer wieder Oscar Lafontaine. Bereits beim<br />
Wahlparteitag im August 2005 gelang es ihm, den emotionalen Brückenschlag zwischen den Parteien<br />
durch eine Referenzerweisung gegenüber Hans Modrow, dem letzten von der SED gestellten Vorsitzenden<br />
des Ministerrates der DDR (Micus 2007: 217). Er forderte, die „Systemfrage“ zu stellen, ohne<br />
jedoch Ausstiegsoptionen aus dem gegenwärtigen System zu benennen. In einem ganzseitigen Artikel<br />
in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (9. Juli 2007, S. 7) bekannte sich Lafontaine schließlich zur<br />
Formel „Freiheit durch Sozialismus“ – womit er nicht nur versuchte, eine rhetorische Umdeutung des<br />
Freiheitsbegriffs vorzunehmen (die freilich im Einklang mit der Idee des „demokratischen Sozialismus“<br />
stand), sondern vor allem auch die gemeinsame Identität von WASG und PDS zu stärken und den Sozialismus-Begriff<br />
zu entstigmatisieren. Auch in der Außenpolitik spielt Lafontaine insofern eine zentrale<br />
Rolle, als er den anti-interventionistischen Grundkonsens der PDS vertritt, der in der WASG nicht<br />
unumstritten gewesen ist.<br />
Wie ist die bisher erkennbare programmatische Ausrichtung der neuen Linkspartei abschließend einzuschätzen?<br />
Hat „Die Linke“ die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Erfahrungen aus<br />
beiden deutschen Staaten angemessen analysiert und Konsequenzen aus dieser Analyse gezogen?<br />
Zweifel daran nährt zunächst die bereits erwähnte Unterlassung einer ernsthaften Auseinandersetzung<br />
mit den Krisensymptomen des Wohlfahrtsstaatsmodells der Nachkriegszeit und deren Ursachen. Ökonomische,<br />
fiskalische und politische Krisenphänomene dieses Modells resultierten teilweise aus einer<br />
Veränderung der Wirtschaftsform, teilweise aus hausgemachten Ursachen (vgl. Jessop 2002: 81-90).<br />
Die seit der Mitte der 1970er Jahre aufgetretenen Krisenphänomene, mit denen sich die Linkspartei<br />
7 Es lässt sich überhaupt bezweifeln, dass „soziale Gerechtigkeit“ als Begriff eines keynesianischen Steuerungsparadigmas<br />
verstanden werden kann, stellt dieses doch im Kern ein Konzept der Bewältigung kapitalistischer Krisen<br />
dar.<br />
8 „Der Kampf gegen den Abbau sozialer Rechte, <strong>für</strong> eine gerechte Verteilung der Arbeit in einer humanisierten<br />
Arbeitswelt und <strong>für</strong> einen erneuerten solidarischen Sozialstaat ist der im Gründungsprogramm formulierte Ausgangspunkt<br />
der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit. Die Linkspartei.PDS bring in Übereinstimmung<br />
damit ihr historisches Verständnis des demokratischen Sozialismus als Ziel, Weg und Wertesystem und als Einheit<br />
von Freiheits- und sozialen Grundrechten ein – niedergelegt in ihrem Chemnitzer Parteiprogramm“ (Die<br />
Linke 2007: 2).<br />
12
efassen müsste, lauten etwa notorische Haushaltsdefizite, Inflationsgefahr, ständiger Anstieg der<br />
Steuersätze und der Staatsquote, wachsende Arbeitslosigkeit, bürokratische Auswüchse des Wohlfahrtsstaates<br />
bei gleichzeitigem Staatsversagen in der Absicherung gegen Risiken sowie die lange Zeit<br />
vernachlässigte Demographieproblematik. Hinsichtlich der Einschätzung politischer Handlungs- und<br />
Gestaltungsräume, ist die Programmatik der Linkspartei von der Spannung zwischen einem Festhalten<br />
am Nationalstaat als Ebene, auf der (immer noch) ausreichend Ressourcen vorhanden sind, um eine<br />
demokratisch-sozialistische Politik zu betreiben, und der Diagnose, dass die Globalisierung der nationalstaatlichen<br />
Politik die Handlungsspielräume genommen hat, womit dann letztlich nur die Übertragung<br />
sozialdemokratischer Regulierungskonzepte auf die internationale Ebene einen scheinbaren<br />
Ausweg offeriert. Beide Defizite können die bereits erwähnten Abnutzungseffekte verstärken, da eine<br />
Regierungsbeteiligung nicht halten kann, was dem Wähler versprochen wurde.<br />
1.6 Mögliche Konsequenzen – Parteiensystem und Unregierbarkeit<br />
Ist die Linkspartei eine Partei mit politischer Sprengkraft? In der abschließenden Beurteilung dieser<br />
Frage, gilt es, verschiedene Aspekte auseinander zu halten.<br />
Zunächst erscheint es evident, dass der Erfolg der Linkspartei die SPD in eine schwere Identitätskrise<br />
gestürzt hat. Das Schicksal der Schröderschen Agenda 2010 zeigt ebenso wie die Ereignisse in Hessen,<br />
wie schwer es <strong>für</strong> die deutschen Sozialdemokraten ist, mit d er Herausforderung durch eine Parteigründung<br />
umzugehen, die in mancher Hinsicht aus „Fleisch vom Fleische“ der SPD besteht. Während<br />
die Sozialdemokraten in der gegenwärtigen Entwicklung (sinkende Arbeitslosigkeit) auf die Erfolge<br />
ihrer Politik verweisen könnten, beschäftigen sie sich mit dem von der Linkspartei besetzten Thema<br />
der „sozialen Gerechtigkeit“.<br />
Die Linke ist aber keine revolutionäre Partei, sondern eine Protestpartei ohne kohärentes programmatisches<br />
Konzept, wie der Kapitalismus zu überwinden oder zu transformieren wäre. Von der PDS wurde<br />
dies in ihrem Chemnitzer Programm ehrlicherweise auch eingestanden. Die Linke lebt programmatisch<br />
von der Verklärung der wohlfahrtsstaatlich-keynesianischen Vergangenheit und einer vagen Berufung<br />
auf den demokratischen Sozialismus, emotional von gewerkschaftlichem Milieu, relativ diffuser Protestaktivierung<br />
und DDR-Nostalgie. Ein „Systembruch“ wird noch am ehestens in der Forderung nach<br />
der Zulässigkeit politischer bzw. Generalstreiks deutlich (Die Linke 2007: 13). Deren Unzulässigkeit ist<br />
jedoch konstitutives Moment der Tarifautonomie, die wiederum auch den Gewerkschaften Sicherheit<br />
bietet. Als politischer Arm der (Anti-)Globalisierungs-Bewegung könnte die Linkspartei programmatisches<br />
Profil gewinnen, doch stellt sich dann frei nach Luhmann (1996) die Frage, inwiefern neben dem<br />
„Dagegensein“ auch das „Dabeisein“ (also das Streben nach Regierensämtern) praktikabel bleibt.<br />
Als neomarxistische Partei ist die Linkspartei ebenfalls nicht ernsthaft zu bezeichnen. Denn sie kritisiert<br />
zwar den gegenwärtigen Kapitalismus, begründet ihre eigenen Politikvorstellungen jedoch nicht im<br />
Rahmen einer materialistischen Analyse von kapitalistischer Staatlichkeit. Da derartige Analysen eher<br />
zu einer Kritik keynesianischer Steuerungsvorstellungen führen, würde der Glaube an die eigenen<br />
Konzepte bei tiefer gehender politökonomischer Reflexion wohl noch weiter leiden. Wenn sich aus<br />
derartigen Prozessen des „Ver-Lernens“ Mobilisierungspotential und Handlungskraft ergibt, dann wohl<br />
auf Kosten der analytischen Tiefe.<br />
Sprengkraft könnte Die Linke freilich in Bezug auf das politische System und dessen Steuerungsfähigkeit<br />
entfalten, insbesondere was die Möglichkeit zu kohärent-kontinuierlicher Politikformulierung be-<br />
13
trifft. Die Linke hat bereits zu einer Transformation des Parteiensystems und dabei paradoxerweise<br />
gerade zu einer Verschlechterung der Durchsetzungsmöglichkeiten auch von dezidiert linken Konzepten<br />
beigetragen. Wie einleitend erwähnt, gehen inzwischen auch skeptische Beobachter davon aus,<br />
dass sich mit dem Erfolg der Linken ein Fünf-Parteien-System etabliert hat. Damit geht eine Veränderung<br />
der Koalitionsoptionen einher. Einerseits bedeutet dies eine Ausweitung grundsätzlich möglicher<br />
Koalitionsoptionen. Andererseits werden die tatsächliche Koalitionsbildung und das Regieren dadurch<br />
schwieriger, dass sich nicht alle Parteien sich als grundsätzlich „koalitionsfähig“ betrachten bzw. eine<br />
Zusammenarbeit <strong>für</strong> pragmatisch sinnvoll erachten. Dadurch wird paradoxerweise gerade die SPD koalitionsstrategisch<br />
gestärkt, denn sie verfügt über die weitreichendsten Optionen, während es <strong>für</strong> die<br />
CDU z.B. schwierig ist, mit den GRÜNEN zu koalieren und dies mit der Linkspartei praktisch ausgeschlossen<br />
ist. Bis zum Fall Hessen(s) hat die SPD zumindest im Westen und im Bund Koalitionen mit<br />
der Linkspartei abgelehnt. Durch die Konkurrenz der Linkspartei bei Wahlen ist es jedoch schwieriger<br />
geworden, rot-grüne Mehrheiten oder gar eine absolute Mehrheit zu gewinnen. Wie bereits bei der<br />
Bundestagswahl, so war auch bei diversen Landtagswahlen eine Große Koalition zwischen Union und<br />
Sozialdemokraten das Ergebnis. Auf der anderen Seite versucht die CDU, Gemeinsamkeiten mit Bündnis<br />
90/GRÜNE auszuloten und umgekehrt.<br />
Vieles gerät also in Bewegung, aber ob dadurch etwas bewegt wird, erscheint fraglich. In Verbindung<br />
mit dem hohen Grad der Politikverflechtung und den damit einhergehenden hohen Konsenserfordernissen<br />
ist <strong>für</strong> die nächsten Jahre zu erwarten, dass in Deutschland durch den Erfolg der Linkspartei<br />
Reformpolitik (allgemein, vor allem aber „linke“ Reformpolitik) eher schwieriger geworden ist. Man<br />
fühlt sich an Claus Offes Szenario einer sich selbst verstärkenden „Unregierbarkeit“ spätkapitalistischer<br />
Gesellschaften erinnert, der in diesem Zusammenhang auch die schlechte Alternative von Repolarisierung<br />
des Parteiensystems einerseits und nicht-parlamentarisch operierenden sozialen Bewegungen<br />
andererseits aufmacht (Offe 1979: 287f.). Positiv gesehen, kann der Linkspartei die Funktion zugesprochen<br />
werden, eine systemkompatible Ausdrucksmöglichkeit <strong>für</strong> Unzufriedenheit mit dem politischen<br />
System zu schaffen. Auch die Stimmenverhältnisse im Bundesrat weisen aufgrund der Vielfältigkeit<br />
von Länderkoalitionen neben gestiegenem Verhandlungsbedarf vielleicht auch Chancen der Überwindung<br />
eingefahrener Reflexe auf. 9 Was die Zukunft der Linkspartei betrifft, so wird ihr zukünftiger<br />
Erfolg nicht nur von der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland und deren<br />
kollektiver Deutung abhängen, sondern auch von der Frage, inwiefern sie auch jenseits ihres Protestprofils<br />
– nämlich im Ernstfall der Regierungsbeteiligung – den Wählern als eine glaubwürdige Alternative<br />
links von der SPD erscheinen wird.<br />
Literatur<br />
Bevir, Mark/Rhodes. R. A. W. (2002): Interpretive Theory, in: Marsh, David/Stoker, Gerry (Hrsg.):<br />
Theory and Methods in Political Science, London, S. 131-152.<br />
Czada, Roland (2000): Konkordanz, Korporatismus und Politikverflechtung: Dimensionen der Verhandlungsdemokratie,<br />
in: Holtmann, Everhard/Voelzkow, Helmut (Hrsg.):<br />
Zwischen Wettbewerbs- und Verhandlungsdemokratie: Analysen zum Regierungssystem der<br />
Bundesrepublik Deutschland, Wiesbaden, S. 23-49.<br />
9 In diesem Zusammenhang gewinnt eine Änderung des Umgangs mit Stimmenthaltungen bei zustimmungsbedürftigen<br />
Gesetzen im Bundesrat neue Aktualität. Aufgrund der Erfordernis, die Zustimmung der Mehrheit der<br />
Stimmen zu erhalten (Art. 52 III GG), kommt in der gegenwärtigen Rechtslage eine Enthaltung der Ablehnung<br />
gleich.<br />
14
Dürr, Tobias Dürr (2002): Die Linke nach dem Sog der Mitte. Zu den Programmdebatten von SPD,<br />
Grünen und PDS in der Ära Schröder, in: Aus Politik und Zeitgeschichte, (B 21/2002), S. 5-<br />
12.<br />
Die Linke (2007): Programmatische Eckpunkte. Programmatisches Gründungsdokument der Partei DIE<br />
LINKE, Berlin. Internet: http://die-linke.de/fileadmin/download/dokumente/<br />
programmatisch_eckpunkte_broschuere.pdf<br />
Giddens, Anthony (2001): The Question of Inequality, in: Ders. (Hrsg.): The Global Third Way Debate,<br />
Cambridge, S. 178-188<br />
Henkes, Christian (2006): Dänemark, in: Merkel et al. (2006): 315-350.<br />
Hilmer, Richard/Müller-Hilmer, Rita (2006): Die Bundestagswahl vom 18. September 2005. Votum <strong>für</strong><br />
Wechsel in Kontinuität, in: Zeitschrift <strong>für</strong> Parlamentsfragen, Nr. 1, S. 183-218.<br />
Hirsch, Joachim (2005): Materialistische Staatstheorie. Transformationsprozesse des kapitalistischen<br />
Staatensystems, Hamburg.<br />
Jessop, Bob (2002): The Future of the Capitalist State, Oxford.<br />
Koß, Michael (2007): Durch die Krise zum Erfolg? Die PDS und ihr langer Weg nach Westen, in: Spier<br />
et al. (2007): 117-54.<br />
Lorenz, Robert (2007): Techniker der „kalten Fusion“. Das Führungspersonal der Linkspartei, in: Spier<br />
et al. (2007): 275-323.<br />
Luhmann, Niklas (1996): Dabeisein und Dagegensein. Anregungen zu einem Nachruf auf die Bundesrepublik,<br />
in: Hellmann, Kai-Uwe (Hrsg.): Protest, Systemtheorie und soziale Bewegungen,<br />
Frankfurt/Main, S. 156-159.<br />
Luhmann, Niklas (2000): Die Politik der Gesellschaft, Frankfurt/Main.<br />
Merkel, Wolfgang/Egle, Christoph/Henkes, Christian/Ostheim, Tobias/Petring, Alexander (2006): Die<br />
Reformfähigkeit der Sozialdemokratie. Herausforderungen und Bilanz der Regierungspolitik<br />
in Westeuropa, Wiesbaden.<br />
Micus, Matthias (2007): Stärkung des Zentrums. Perspektiven, Risiken und Chancen des Fusionsprozesses<br />
von PDS und WASG, in: Spier et. al. (2007): 185-237.<br />
Nachtwey/Spier (2007): Günstige Gelegenheit? Die sozialen und politischen Entstehungshintergründe<br />
der Linkspartei, in: Spier et al. (2007): 13-70.<br />
Offe, Claus (1979): ‘Unregierbarkeit.’ Zur Renaissance konservativer Krisentheorien, in: Habermas,<br />
Jürgen (Hrsg.): Stichworte zur ‘Geistigen Situation der Zeit’. 1. Band: Nation und Republik,<br />
Frankfurt/Main, S. 294-318.<br />
Rein, Martin/Schön, Donald (1993): Reframing Policy Discourse, in: Fischer, Frank/Forester, John<br />
(Hrsg.): The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning, Durham und London: 145-<br />
166.<br />
Schoen, Harald/Falter, Jürgen W. (2005): Die Linkspartei und ihre Wähler, in: Aus Politik und Zeitgeschichte,<br />
51-52/2005, S. 33-40.<br />
SPD (2007): Hamburger Programm. Grundsatzprogramm der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands.<br />
Beschlossen auf dem Hamburger Bundesparteitag der SPD am 28. Oktober 2008, Berlin.<br />
Spier, Tim Spier/Butzlaff, Felix/Micus, Matthias/Walter, Franz (Hrsg.) (2007): Die Linkspartei. Zeitgemäße<br />
Idee oder Bündnis ohne Zukunft?, Wiesbaden.<br />
Tarrow, Sidney (1991): Kollektives Handeln und politische Gelegenheitsstruktur in Mobilisierungswellen.<br />
Theoretische Perspektiven, in: Kölner Zeitschrift <strong>für</strong> Soziologie und Sozialpsychologie, Nr.<br />
4, S. 647-670.<br />
15
Walter, Franz (2007a): Eliten oder Unterschichten? Die Wähler der Linken, in: Spier et al. (2007), S.<br />
325-338.<br />
Walter, Franz (2007b): Die Linkspartei zwischen Populismus und Konservatismus. Ein Essay über<br />
„Vergreisung als Chance“, in: Spier et al. (2007), S. 339-344.<br />
Wiesendahl, Elmar (2004): Parteien und die Politik der Zumutungen, in: Aus Politik und Zeitgeschichte,<br />
B 40, S. 19-24.<br />
16
Michael Stoiber<br />
2. „Die Linke“ - welche Auswirkungen hat die Partei auf das zukünftige deutsche<br />
Parteiensystem und die Regierungsbildung? 10<br />
2.1 Einleitung<br />
Das deutsche Parteiensystem steht spätestens seit den Erfolgen der Partei „Die Linke“ bei den Landtagswahlen<br />
in Hessen, Niedersachsen und Hamburg zu Beginn des Jahres 2008 vor einer dauerhaften<br />
Veränderung: sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene scheint sich ein Fünfparteiensystem mit<br />
den beiden Volksparteien CDU und SPD sowie den drei Kleinparteien FDP, Die Grünen und Die Linke<br />
zu etablieren. Wie kann dieser gesamtdeutsche Erfolg der neuen Linkspartei, der Fusion aus PDS und<br />
WASG, erklärt werden? Welche Auswirkungen hat das auf die etablierten Parteien, den zukünftigen<br />
Parteienwettbewerb und die Prozesse der Regierungsbildung in Bund und Ländern?<br />
In diesem Beitrag werde ich zunächst kurz die Gründe <strong>für</strong> das Erstarken und die Etablierung der Partei<br />
Die Linken analysieren. Dazu greife ich sowohl auf die Cleavage-Theorie von Lipset/Rokkan 11 als auch<br />
Downs’ Theorie des Parteienwettbewerbs 12 zurück. Denn erst durch die Kombination beider Konzepte<br />
kann der Erfolg sowohl in den neuen als auch den alten Bundesländern erklärt werden. Anschließend<br />
wird mit Hilfe von Sartoris Kriterien überprüft, inwieweit die Linke tatsächlich als eine „relevante“<br />
Partei zu bezeichnen ist. 13 Hier geht es um ihr blackmail-Potential, also die Effekte auf den Parteienwettbewerb<br />
und die Positionierung der anderen Parteien, sowie ihr Koalitionspotential. Denn dass sich<br />
das Erstarken der Linken auf die etablierten Parteien und das Parteiensystem insgesamt erheblich auswirkt,<br />
ist spätestens mit dem Versuch und dem Scheitern der Einrichtung einer SPD-Grünen Minderheitsregierung<br />
in Hessen unter Andrea Ypsilanti deutlich geworden. Daher werde ich im dritten Teil<br />
meiner Analyse mit Hilfe koalitionstheoretischer Überlegungen die Auswirkungen einer etablierten<br />
Linkspartei auf zukünftige Regierungsbildungen und die Strategien der Parteien diskutieren. Dazu<br />
skizziere ich zwei unterschiedlichen Szenarien <strong>für</strong> den Ausgang der Bundestagswahlen 2009 und wende<br />
auf diese unterschiedliche koalitionstheoretische Ansätze an.<br />
2.2 Die Etablierung der Linken als gesamtdeutsche Partei 14<br />
In der politikwissenschaftlichen Literatur wurde die PDS jahrelang als ein spezifisch ostdeutsches Phänomen<br />
behandelt. 15 Als empirisches Indiz da<strong>für</strong>, die PDS als eine reine Regionalpartei zu betrachten,<br />
10<br />
Dieser Text ist die leicht veränderte Fassung eines gleichnamigen Beitrags, der auf chinesisch in der Zeitschrift<br />
Deutschland-Studien, Nr. 4/2008, S. 14-20 erschienen ist. Er basiert auf einem Vortrag am <strong>Institut</strong> <strong>für</strong> Deutschlandstudien<br />
an der Tongji-Universität Shanghai am 16.10.2008.<br />
11<br />
S.M. Lipset / S. Rokkan, „Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction”, in: dies.:<br />
Cleavage Structures, Party Systems and Voter Alignments: Cross National Perspectives, New York, 1967, S. 1-64.<br />
12<br />
A. Downs, Ökonomische Theorie der Demokratie, Tübingen, 1968.<br />
13<br />
G. Sartori, Parties and Party Systems, Cambridge, 1976.<br />
14<br />
Vgl. M. Haus: „Die Linke in Deutschland – eine politische Partei mit Sprengkraft?“, in: Deutschland-Studien,<br />
Nr. 1/2008, S. 20-28.<br />
17
war das Fehlen jeglichen Erfolgs bei Wahlen in den alten Bundesländern, seien es Bundes- oder Landtagswahlen.<br />
Wie konnte es dann zu einem solchen Erfolg der Linken als gesamtdeutsche Partei kommen?<br />
Für die Etablierung der Linkspartei auch im Westen wird in der Regel die These der so genannten Repräsentationslücke<br />
herangeführt. Sie besagt, dass es auf Grund der Bewegung der SPD in der Regierungszeit<br />
Schröders zur Mitte mittels der Hartz-Gesetze, der Agenda 2010 und der Politik der Haushaltskonsolidierung<br />
auch in den alten Bundesländern zu einer großen Anzahl an links-orientierten<br />
Wählern kam, die sich durch diese Politik nicht mehr vertreten fühlten. In den neuen Bundesländern<br />
hatten solche Interessen in der PDS parteipolitisch eine schon etablierte Heimat gefunden. In den alten<br />
Bundesländern musste dagegen eine neue Partei in Form der „Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit“<br />
(WASG) in diese Lücke der Unzufriedenheit stoßen. 16 Die vorgezogene Bundestagswahl<br />
2005 bildete dann jene Gelegenheitsstruktur, die zunächst zu einer Kooperation der in Linkspartei.PDS<br />
umbenannten PDS und der WASG und 2007 mit der offiziellen Fusion zur Partei „Die Linke“ führte.<br />
Doch ist das die ganze Wahrheit? Warum schlug sich die Zusammenarbeit von WASG und PDS bei der<br />
Bundestagswahl 2005 so schnell in einem Erfolg nieder und warum kam es denn überhaupt zur Fusion<br />
2007 und der Etablierung als gesamtdeutsche Partei?<br />
Zur Entstehung politischer Parteien ist nach Lipset/Rokkan ein gesellschaftlicher Konflikt notwendig,<br />
so dass sich entweder gegen einen bestehenden Status Quo oder zur Bewahrung dessen die betroffenen<br />
gesellschaftlichen Interessen in Form von Parteien organisieren, um diese Interessen in den politischen<br />
Prozess einzuspeisen. 17 In ihrer historischen Anwendung auf die Entstehung der europäischen<br />
Parteiensysteme zum Ende des 19. Jahrhunderts identifizierten Lipset Rokkan vier solcher cleavages:<br />
erstens den Konflikt zwischen Staat und Kirche im Kontext der Säkularisierung und der Frage nach der<br />
Kontrolle des Bildungswesens und zweitens den Konflikt zwischen den neuen Eliten im Zuge der Nationenbildung<br />
und den zu diesem Prozess oppositionellen alten Eliten der Peripherie. Durch die zunehmende<br />
Industrialisierung entstanden zudem drittens der Konflikt zwischen primären (Land) und sekundären<br />
Sektor (Stadt) und viertens der Klassenkonflikt zwischen Arbeit und Kapital. Greift man auf<br />
eine enthistorisierende Logik der Cleavage-Theorie zurück kann man die Entstehung neuer Parteien<br />
auch noch heute mit der Existenz von gesellschaftlichen Konfliktlinien in Verbindung bringen. 18 Betrachtet<br />
man die PDS in ihren Anfangsjahren nach der deutschen Wiedervereinigung, kann ihre Existenz<br />
mit einem Zentrum-Peripherie Konflikt erklärt werden. Als SED-Nachfolgepartei vertrat sie anfangs<br />
insbesondere die Interessen der alten DDR-Elite, die sich nun als politische Verlierer der Vereinigung<br />
wieder fanden. Die PDS vertrat also eine neue Peripherie, die sich auch regional auf die neuen<br />
Bundesländer beschränkte und so zur Etablierung der PDS als Regionalpartei führte. So fand der auch<br />
in der Gesellschaft und in den Medien thematisierte Ost-West Gegensatz seinen parteipolitischen Ausdruck.<br />
In der Anfangszeit hatte die PDS noch einen recht geringen Anteil an Wählern in der Arbeiterschicht,<br />
so dass eine Positionierung der Partei auf dem linken Pol der Arbeit-Kapital Konfliktlinie erst<br />
15<br />
Als ein repräsentatives Beispiel <strong>für</strong> viele Publikationen dieser Zeit, vgl. P. Moreau, Die PDS im Wahljahr 1999:<br />
"Politik von links, von unten und von Osten", München, 1999.<br />
16<br />
O. Nachtwey / T. Spier, „Günstige Gelegenheit? Die sozialen und politischen Entstehungshintergründe der<br />
Linkspartei“, in: T. Spier / F. Butzlaff / M. Micus / F. Walter (Hrsg.): Die Linkspartei. Zeitgemäße Idee oder<br />
Bündnis ohne Zukunft?, Wiesbaden, 2007, S. 13-70.<br />
17<br />
S.M. Lipset / S. Rokkan, „Cleavage Structures”, S. 5.<br />
18<br />
Vgl. G. Mielke, „Gesellschaftliche Konflikte und ihre Repräsentation im deutschen Parteiensystem“, in: U. Eith /<br />
G. Mielke (Hrsg.): Gesellschaftliche Konflikte und Parteiensysteme. Länder- und Regionalstudien, Opladen, 2001,<br />
S. 77-95.<br />
18
ab Mitte der 1990er Jahre festzustellen ist. 19 Doch sind die zunehmenden Erfolge bei Landtagswahlen<br />
in den neuen Bundesländern mit über 20% der Stimmen ab 1998 genau dieser neuen Positionierung<br />
zuzuschreiben. Die PDS nutzte eine Überlagerung des Zentrum-Peripherie Konflikts durch die sozioökonomische<br />
Konfliktlinie Arbeit vs. Kapital aus und konnte viele der so genannten Wiedervereinigungsverlierer<br />
in den neuen Bundesländern an sich binden. Auf Grund der eindeutigen Positionierung<br />
auf der Ost-West Konfliktlinie gelang es der PDS dagegen nicht, in den alten Bundesländern richtig<br />
Fuß zu fassen, zudem existierte mit der SPD bis 1998 eine eindeutige Alternative links der Mitte.<br />
Eine Erklärung der Entstehung der WASG in den alten Bundesländern ist jedoch nur unzureichend mit<br />
der Cleavage-Theorie zu erklären, da es sich bei der sozioökonomischen Konfliktlinie schließlich um<br />
keinen neuen Konflikt handelte. Man kann zwar im Zuge der Regierungspolitik Schröders den klassischen<br />
cleavage Arbeit-Kapital uminterpretieren als einen Konflikt um das Ausmaß wohlfahrtsstaatlicher<br />
Leistungen. Hier stünde dann die WASG als Bewahrerin des alten wohlfahrtsstaatlichen Status Quo,<br />
während alle anderen Parteien inklusive der SPD auf der Seite eines marktliberalen Abbaus dieser Leistungen<br />
stehen. 20<br />
Als besser geeignet, den dynamischen Prozess im westdeutschen Parteiensystem nach 1999 abzubilden,<br />
erweist sich Downs’ Theorie des Parteienwettbewerbs. Downs geht in seinem eindimensionalen<br />
räumlichen Modell davon aus, dass sich die Parteien an der Wählerverteilung orientieren und sich so<br />
positionieren, dass sie ihren Stimmenanteil maximieren können. 21 Die Bewegung der SPD zur Mitte<br />
hin war bei den Bundestagswahlen 1998 aus dieser Theorie heraus ein konsequenter Schritt der SPD,<br />
da dort in der Konkurrenz zur CDU die meisten Stimmen zusätzlich zu gewinnen waren. Der weitere<br />
Rechtsruck der SPD während der Regierungszeit wird jedoch häufiger auf Zwänge der Regierungsbeteiligung<br />
zurückgeführt. 22 Die Reaktion im Parteiensystem ist wieder in Übereinstimmung mit Downs’<br />
Modell. Für die Wähler auf der linken Seite des ideologischen Spektrums in den alten Bundesländern<br />
sind SPD und CDU kaum mehr zu unterscheiden. Ihr Parteiendifferenzial tendiert zu Null, d.h. der<br />
erwartete Nutzen aus einer SPD und einer CDU-Regierung unterscheidet sich kaum und ist darüber<br />
hinaus sehr gering. Auf Grund mangelnder Alternativen würden viele dieser Wähler nicht mehr zur<br />
Wahl gehen. Die Gründung einer neuen Partei auf der linken Seite – hier in Form der WASG – führt<br />
dagegen zu einem neuen Gleichgewichtszustand, bei dem die linken Wähler wieder ein Angebot haben.<br />
Dieses Angebot wurde in den alten Bundesländern bei den Bundestagswahlen 2005 von immerhin<br />
4,9% der Wähler in Form der Linkspartei.PDS, die auf ihren Landeslisten auch WASG-Mitglieder als<br />
Kandidaten aufnahmen, auch angenommen.<br />
Konnte sich die PDS vor 2005 im Westen kaum etablieren, bot eine Zusammenarbeit mit der WASG die<br />
Chance, das linke Wählerpotential zu erschließen. Nach der erfolgreichen Fusion von 2007 zur Partei<br />
„Die Linke“ scheint die Positionierung sowohl als linke, wohlfahrtsstaatlich orientierte Alternative insbesondere<br />
zur SPD der Großen Koalition als auch als Partei, die spezifische Regionalinteressen in den<br />
neuen Bundesländern vertritt, erfolgreich zu verlaufen: Umfragen im Oktober/November 2008 zeigen<br />
sie bei 10 bis 14%. 23 Es ist der Linken folglich gelungen, sich auf zwei Konfliktlinien (Ost-West und<br />
Ausmaß des Wohlfahrtsstaates) zu positionieren, was im Westen jedoch nur aufgrund der Mitte-<br />
19<br />
Vgl. M. Micus, „Stärkung des Zentrums: Perspektiven, Risiken und Chancen des Fusionsprozesses von PDS und<br />
WASG, in: T. Spier u.a. (Hrsg.): Die Linkspartei, 2007, S. 185-238.<br />
20<br />
Vgl. M. Micus, „Stärkung des Zentrums“, S. 189.<br />
21<br />
A. Downs, Ökonomische Theorie der Demokratie, S. 115ff.<br />
22<br />
F.U. Pappi / S. Shikano, Ideologische Signale in den Wahlprogrammen der deutschen Bundestagsparteien<br />
1980 bis 2002, MZES-Arbeitspapier Nr. 76, Mannheim, 2004.<br />
23<br />
Vgl. http://www.wahlrecht.de/umfragen/index.htm, Stand 12.11.2008.<br />
19
Orientierung der SPD erfolgen konnte. Zudem ist es sicherlich hilfreich, dass sich die unterschiedliche<br />
Basis der fusionierten Partei auch im Führungspersonal widerspiegelt. So bildet der alte PDS-<br />
Vorsitzende Lothar Bisky zusammen mit dem ehemaligen SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine den Vorsitz<br />
der neuen Partei, unterstützt im Bundestag vom Fraktionsvorsitzenden Gregor Gysi.<br />
2.3 Die Linke – wirklich eine relevante Partei?<br />
2005 zog das Wahlbündnis mit 8,7% in den Bundestag ein und seit 2008 ist die Linke in 10 der 16<br />
Länderparlamente vertreten. Doch muss nicht jede Partei, die in einem Parlament mehr als 5% auf sich<br />
vereinigt, als eine relevante Partei angesehen werden. Sartori identifiziert zwei Kriterien, von denen<br />
zumindest eins erfüllt sein muss, damit eine Partei als relevanter Bestandteil eines Parteiensystems<br />
gilt. 24 Entweder muss sie über so genanntes blackmail-Potential oder Koalitionspotential verfügen.<br />
Koalitionspotential kann eine Partei unabhängig von ihrer elektoralen Stärke erringen. Ganz gleich wie<br />
klein eine Partei ist: führt erst ihre Beteiligung zu einer Regierungskoalition, ist sie als relevant zu zählen.<br />
Als besten Beispiel kann die FDP in Deutschland gelten, die als „Zünglein an der Wage“ bis in die<br />
1990er Jahre hinein entschied, ob die CDU oder die SPD als große Volkspartei den Bundeskanzler in<br />
einer Koalition mit der FDP stellte. Blackmail- oder „Erpressungs“-Potential kann eine Partei aber auch<br />
in einer Oppositionsrolle zur Relevanz verhelfen, wenn ihre Existenz die Mechanismen des Parteienwettbewerbs<br />
und der Regierungsbildung oder die Positionierung einzelner Parteien beeinflusst. Im<br />
Folgenden werde ich die Frage nach der Relevanz der Partei Die Linke sowohl auf Bundes- als auch<br />
Landesebene diskutieren, da erst bei einem positiven Befund von einer tatsächlichen – auch langfristig<br />
wirksamen – Veränderung des deutschen Parteiensystems gesprochen werden kann.<br />
Die Situation in den neuen Bundesländern und Berlin unterscheidet sich von jener in den alten Bundesländern<br />
und auf Bundesebene. Im ersten Fall kann die Linke 25 durch die Wahlerfolge und parlamentarische<br />
Repräsentation der letzten 18 Jahre als etablierte Partei im Osten gelten. Auf Grund ihrer<br />
elektoralen Bedeutung mit Ergebnissen zwischen 17 und 28% bei den jeweils letzten Landtagswahlen<br />
hat sie sich endgültig als dritte große politische Kraft etabliert. Damit bildet in allen neuen Bundesländern<br />
ein Dreiparteiensystem von Linke, SPD und CDU den Kern des parlamentarischen Parteienspektrums,<br />
ergänzt in einigen Ländern um entweder FDP, Grüne oder die rechtsextreme DVU. Damit verfügt<br />
die Linke sicherlich über blackmail-Potential, denn insbesondere die SPD hat in einigen Bundesländern<br />
ihre Position als zweitstärkste Partei verloren und muss um ihre Wähler auf der linken Seite gegen die<br />
Linke als auch in der Mitte gegen die CDU versuchen zu behaupten. In dieser Positionierung droht sie<br />
zerrieben zu werden, was ihre letzten Ergebnisse in Thüringen (14,5%) und Sachsen (9,8%) zeigen.<br />
Nur dort, wo die SPD sich in der Mitte gegen die CDU behaupten kann wie in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern,<br />
kann sie ihre Position zwischen Linke und CDU nutzen und den Partner zur<br />
Regierungsbildung wählen. Für die anderen Parteien (CDU, FDP, Grüne) stellt die Linke zwar eine<br />
elektorale Bedrohung dar, in ihrer strategischen Positionierung gibt es aber auf Basis einer klaren Abgrenzung<br />
keine Auswirkungen. Daneben hat die Linke auch ihr Koalitionspotential zeigen können: Seit<br />
2002 gibt es eine SPD-Linke Regierung unter Klaus Wowereit in Berlin, zuvor regierte eine solche Koalition<br />
schon von 1998-2002 in Mecklenburg-Vorpommern. Zudem gibt es das Modell der Tolerierung<br />
einer Minderheitsregierung durch die Linke, wie sie in Sachsen-Anhalt betrieben wurde, von 1994-<br />
24<br />
G. Sartori, Parties and Party Systems, S. 121ff.<br />
25<br />
Im Folgenden wird zu Gunsten einer sprachlichen Vereinfachung immer von der Partei Die Linke gesprochen,<br />
auch wenn es sich in der Zeit vor 2005 um die PDS handelte.<br />
20
1998 in Form einer Tolerierung einer SPD/Grünen-Minderheitsregierung, bzw. von 1998-2002 einer<br />
SPD-Minderheitsregierung. Sowohl die elektoralen Erfolge und das damit verbundene blackmail-<br />
Potential wie auch das vorhandene Koalitionspotential zeigen eindeutig, dass es sich bei der Partei Die<br />
Linke in den neuen Bundesländern auch nach Sartoris Kriterien um eine relevante Partei handelt.<br />
Auf den ersten Blick weniger deutlich stellt sich die Situation in den alten Bundesländern und auf<br />
Bundesebene dar, da sie hier von ihrer elektoralen Stärke als kleine Partei einzustufen ist. Auswirkungen<br />
auf den Parteienwettbewerb und die strategische Positionierung der anderen Parteien sind jedoch<br />
zu beobachten. So ist die Reaktion seitens CDU und FDP in Form einer Abgrenzungsstrategie relativ<br />
eindeutig und verändert die Dynamik des Wettbewerbs kaum. Anders stellt es sich aber <strong>für</strong> die Grünen<br />
und insbesondere <strong>für</strong> die SPD dar. Für die Grünen stellt die Linke eine direkte Bedrohung um linkes<br />
Wählerpotential dar, so verloren sie in den Landtagswahlen in Hessen 19.000 Stimmen an die Linke,<br />
was immerhin 0,7 Prozentpunkten entspricht. 26 Dabei handelt es sich wohl um stark ideologisch Linksgeprägte<br />
Wähler, die weniger der ökologischen als der basisdemokratischen und pazifistischen Richtung<br />
angehören. Noch stärker ist die Auswirkung jedoch auf die SPD, die sich durch die Linke einem<br />
massiven Druck auf Teile ihrer klassischen Wählerklientel ausgesetzt sieht. Die SPD hat daher zwei<br />
strategische Entscheidungen zu treffen. Die erste betrifft ihre Positionierung im Parteiensystem. Durch<br />
ihre Bewegung zur Mitte während der Schröder-Ära hat die SPD große Teile ihrer klassisch wohlfahrtsstaatlich<br />
orientierten Mitglieder und Wähler, insbesondere aus der Unter- und unteren Mittelschicht,<br />
vor große Identifikationsprobleme gestellt. Nicht zuletzt daraus resultierte die Gründung der<br />
WASG. Deren Ziel war es, die SPD wieder nach links zu bewegen, ein klassisches Merkmal <strong>für</strong> eine<br />
Partei mit blackmail-Potential. Die SPD steht im Grunde vor einem Dilemma: rückt sie wieder nach<br />
links, kann sie möglicherweise Wähler wieder zurückgewinnen. So hatte sie z.B. bei den Landtagswahlen<br />
in Hessen zwar 32.000 Wähler (1,1 Prozentpunkte) an die Linke verloren, doch legte die SPD insgesamt<br />
um über sieben Prozentpunkte zu und das obwohl (oder weil?) sie ein durchaus linkes Programm<br />
vertrat. Auch auf Bundesebene konnten solche Bemühungen beobachtet werden, als unter dem<br />
Vorsitzenden Kurt Beck Forderungen nach Abänderungen der Schröderschen Hartz-Gesetzgebung gefordert<br />
wurden. Doch besteht die Gefahr dieser Strategie darin, die von Schröder eroberten Wähler der<br />
„neuen Mitte“ wieder an die CDU zu verlieren. Der Kampf um diese Wechselwähler galt zuvor als entscheidend,<br />
um Regierungsmehrheiten gewinnen zu können. Die Diskussion um die inhaltliche Ausrichtung<br />
der SPD ist nach wie vor in vollem Gange. Mit der Kür von Frank-Walter Steinmeier zum Kanzlerkandidaten,<br />
dem Rücktritt von Kurt Beck als Parteivorsitzendem und der damit verbundenen Rückkehr<br />
von Franz Müntefering an die Parteispitze scheint sich jedoch zumindest bis zur Bundestagswahl<br />
2009 der zur Mitte hin orientierte Flügel der Partei durchgesetzt zu haben. Die zweite strategische<br />
Entscheidung betrifft die Frage nach einer möglichen Zusammenarbeit mit der Linken, um eine parlamentarische<br />
Mehrheit links von CDU und FDP auch in eine Regierungsmehrheit umwandeln zu können.<br />
Hier scheint es keine einheitliche Position auf Bundes- und Landesebene zu geben. So existiert auf<br />
Bundesebene eine allgemeine Ablehnung jeglicher Kooperation mit der Linken durch die SPD, die<br />
nicht nur mit der SED-Vergangenheit sondern auch mit Inkompatibilitäten bei der Außen- und Sicherheitspolitik<br />
begründet wird. Während hier auch schon unter Kurt Beck jegliche zukünftige Zusammenarbeit<br />
ausgeschlossen wurde, ist die Lage in den Landesverbänden weniger einheitlich.<br />
So ist die Frage nach dem Koalitionspotential der Linken etwas schwieriger zu beantworten als die<br />
nach ihrem blackmail-Potential. Das aktuelle Beispiel um die gescheiterte Regierungsbildung in Hessen<br />
verdeutlicht die Misere, die vor allem innerhalb der SPD zu verorten ist. Auf Grund der nach wie vor<br />
skeptischen Haltung der westlichen Partei-Landesverbände und großer Teile der Öffentlichkeit gegen-<br />
26<br />
Einen Überblick über die Wählerwanderungen in der hessischen Landtagswahl bietet infratest-dimap unter<br />
http://stat.tagesschau.de/wahlarchiv/wid253/analysewanderung6.shtml<br />
21
über der Linken, scheint eine „linke“ Mehrheitskoalition aus SPD, Grüne und Linke nicht durchführbar.<br />
Daher wurde in Hessen als einzige Möglichkeit, Andrea Ypsilanti zur Ministerpräsidentin zu wählen,<br />
das in Sachsen-Anhalt erfolgreiche angewandte Tolerierungsmodell angestrebt. Denn weder <strong>für</strong> CDU<br />
und FDP noch <strong>für</strong> SPD und Grüne ergab sich eine parlamentarische Mehrheit. Als Problem erwies sich<br />
vor allem die Aussage der SPD-Spitzenkandidatin Ypsilanti vor den Wahlen im Januar 2008, in der sie<br />
betonte, nicht mit Hilfe der Linken die Macht ergreifen zu wollen. Damit ergaben sich in der Folge<br />
große innerparteiliche Differenzen über den einzuschlagenden Kurs. Nachdem die Diskussionen in<br />
Regionalkonferenzen schließlich in eine Zustimmung von 95% zu Gunsten des Tolerierungsmodells<br />
auf dem Landesparteitag am 02. November 2008 mündeten, überraschte das Scheitern der Wahl durch<br />
die Ankündigung von vier Abweichlern am 04. November, Frau Ypsilanti nicht wählen zu wollen. Dass<br />
sich unter diesen Abgeordneten der stellvertretende Landesvorsitze Walter befand, zeigt die Zerrissenheit<br />
der SPD in der Frage einer Zusammenarbeit mit der Linken. Das Scheitern mündete schließlich in<br />
vorgezogene Landtagswahlen, die <strong>für</strong> den 18. Januar 2009 geplant sind. Auch wenn der Kurs der SPD<br />
unklar ist, scheint die Möglichkeit einer Zusammenarbeit mit der Linken nach diesen Wahlen momentan<br />
eher als unwahrscheinlich, selbst wenn es erneut keine Mehrheit <strong>für</strong> CDU und FDP geben sollte.<br />
Insbesondere die Bundes-SPD wird sich <strong>für</strong> den Bundestagswahlkampf wünschen, dass es nicht wieder<br />
zu einer solchen Situation in Hessen wie schon 2008 kommt. Doch wie sieht es prinzipiell <strong>für</strong> eine<br />
mögliche Regierungsbeteiligung der Linken nach der Bundestagswahl 2009 aus? Von Seiten der SPD<br />
scheint der Kurs eindeutig: Die politische Führung der SPD um Müntefering und Steinmeier wird nicht<br />
zuletzt wegen des Debakels der hessischen SPD versuchen, einen Abgrenzungswahlkampf gegenüber<br />
der Linken zu führen, der eine Koalition oder Duldung nahezu ausschließt. Aber auch von Seiten der<br />
Linken selbst erscheint eine Kooperation als unwahrscheinliche Option. Als Beispiel mag die Äußerung<br />
von Harald Wolf, Bürgermeister in der SPD-PDS Regierung in Berlin, dienen:<br />
„Wenn wir 2009 in Regierungsverantwortung gehen müssten, hätten wir ein Problem. Wir haben als<br />
Partei eine sehr ungleichzeitige Entwicklung genommen, im Osten arbeiten wir seit 18 Jahren in den<br />
Parlamenten und genießen Akzeptanz. Die westlichen Landesverbände sind stark vom Widerstand gegen<br />
Rot-Grün und der Enttäuschung über die SPD geprägt. Das sind unterschiedliche Kulturen, eine<br />
gemeinsame Identität braucht Zeit. Und vor allem: Es gibt gegenwärtig keine gemeinsame politische<br />
Basis mit der SPD im Bund.“ 27<br />
2.4 Zur Zukunft des Parteiensystems – koalitionstheoretische Überlegungen<br />
Im letzten Teil meiner Analyse möchte ich aus koalitionstheoretischer Perspektive die spezielle Bedeutung<br />
der Partei Die Linke <strong>für</strong> kommende Regierungsbildungen, auch über die nächste Wahl 2009 hinaus,<br />
herausstellen. Dazu werde ich zunächst die beiden zentralen koalitionstheoretischen Richtungen<br />
skizzieren, die sich hinsichtlich der Handlungsmotivation der Parteien grundlegend unterscheiden.<br />
Prinzipiell lassen sich die office- von den policy-seeking Theorien unterscheiden. 28 In ersteren streben<br />
die Parteien allein wegen der zu erwarteten Vorteile einer Regierungsbeteiligung an die Macht. Dazu<br />
versuchen sie zunächst ihren Stimmenanteil zu maximieren, um daraus einen möglichst großen Anteil<br />
an Regierungsämtern zu gewinnen. Aus dieser Motivation heraus gibt es zwei klassische Ansätze, die<br />
zu leicht unterschiedlichen Vorhersagen in den Regierungskoalitionen kommen. 29 Laut minimum win-<br />
27 Interview mit Harald Wolf in der FAZ vom 22. Juli 2008.<br />
28 Als gelungene Einführung in die zentralen Konzepte kann dienen: W.C. Müller, „Koalitionstheorien“, in: L.<br />
Helms / U. Jun, Politische Theorie und Regierungslehre, Frankfurt a.M., 2004, 267-301.<br />
29 Vgl. W. Riker, The Theory of Political Coalitions, New Haven, 1962.<br />
22
ning Ansatz wird jene Mehrheits-Koalition prognostiziert, bei der die beteiligten Parteien zusammen<br />
die geringste Anzahl an Mandaten umfasst, die über 50% hinausreichen. Das Argument ist, dass so die<br />
beteiligten Parteien die eigene prozentuale Stärke innerhalb einer Regierungskoalition maximieren<br />
und somit den maximalen Anteil an Regierungsämter erhalten können. In der Regel wird daher nur<br />
eine Koalition vorhergesagt, da nur bei Mandatsgleichheit von Parteien mehrere Koalitionen gleicher<br />
Stärke möglich sind. Dagegen wird beim minimal winning Ansatz allein auf die minimale Anzahl an<br />
Parteien geachtet, die <strong>für</strong> eine Mehrheitskoalition benötigt werden. Hier werden dann z.B. alle Zweiparteienkonstellationen<br />
als Koalition prognostiziert, die eine absolute Mehrheit an Mandaten auf sich<br />
vereinen können. Als Argument wird angeführt, dass eine Partei die Regierungsmacht mit möglichst<br />
wenigen anderen Parteien teilen möchte. Als Problem dieses Ansatzes wird gesehen, dass er unter Umständen<br />
sehr viele alternative Koalitionen prognostiziert und damit in seiner Prognosegenauigkeit unscharf<br />
wird. 30<br />
Demgegenüber stehen policy-seeking Ansätze, laut derer die Parteien versuchen, ihren inhaltlichen Einfluss<br />
auf die Regierungspolitik zu maximieren. Eine Regierungsbeteiligung wird dann angestrebt, wenn<br />
dadurch die eigenen Politikvorstellungen besser umgesetzt werden können. In der Regel wird dies erreicht,<br />
indem Koalitionen mit ideologisch benachbarten Parteien eingegangen werden. Das erleichtert<br />
die Konsenssuche und maximiert die Chancen aller beteiligten Regierungsparteien, eine Lösung möglichst<br />
nahe an den eigenen Idealvorstellungen zu erreichen. Zur Analyse möglicher Koalitionen werden<br />
die Parteien daher auf der <strong>für</strong> ein Parteiensystem zentralen ideologischen Dimension, also in der Regel<br />
auf der Links-Rechts Skala, angeordnet. Das bedeutendste Modell dieser Richtung, der Ansatz der minimal<br />
connected winning coalitions, verbindet die prinzipielle policy-Orientierung nun mit einem officeseeking<br />
Kriterium. 31 Denn es werden jene Koalitionen vorhergesagt, in denen die minimale Anzahl an<br />
nebeneinander liegenden Parteien die absolute Mehrheit erreicht. Das Kernargument ist, dass das<br />
Streben nach Regierungsmacht immer verbunden ist mit einer glaubwürdigen Umsetzung der eigenen<br />
Politikvorstellungen. Zu große Kompromisse in einer Regierungsamtszeit sind verbunden mit der Gefahr<br />
von großen Stimmenverlusten bei der nächsten Wahl, da durch die eingegangenen Kompromisse<br />
die eigenen Wähler mit der Regierungspolitik unzufrieden werden können. Geht man nun von einer<br />
eindimensionalen Anordnung der Parteien auf der Links-Rechts Skala aus, die grundlegend <strong>für</strong> das<br />
Verhandeln über Regierungskoalitionen ist, so wird immer die so genannte Median-Partei an der Regierung<br />
beteiligt sein. Bei der Median-Partei handelt es sich um jene Partei, bei der es links und rechts<br />
von ihr keine Mehrheit ohne ihre Beteiligung gibt. 32 Daher kann es keine Koalition direkt benachbarter<br />
Parteien ohne den Median geben, eine alternative Koalition müsste die Median-Partei überspringen<br />
und Parteien links und rechts des Medians vereinen. Diese strategische Position gibt der Median-Partei<br />
eine besonders hohe Verhandlungsmacht sowohl über Regierungsämter als auch Politikinhalte.<br />
Für die Anwendung auf Deutschland zur Analyse der zukünftigen Rolle der Linken werde ich zwei<br />
Szenarien <strong>für</strong> das nächste Bundestagswahlergebnis 2009 wählen, die im Moment auf Basis aktueller<br />
Umfrageergebnisse durchaus als realistisch erscheinen. In beiden wird davon ausgegangen, dass fünf<br />
Parteien in den Bundestag einziehen, die Mandatsverteilung der Parteien im Bundestag wird von links<br />
nach rechts in Prozenten der Mandate angegeben.<br />
Szenario 1: Linke 13% - Grüne 11% - SPD 24% - CDU 38% - FDP 14%<br />
Szenario 2: Linke 15% - Grüne 10% - SPD 27% - CDU 36% - FDP 12%<br />
30 vgl. W.C. Müller, „Koalitionstheorien“, S. 269.<br />
31 Vgl. A. de Swaan, Coalition Theories and Cabinet Formations, Amsterdam, 1973.<br />
32 Zur Herleitung des Median-Wähler-Theorems vgl. M.J. Hinich / M.C. Munger, Analytical Politics, Cambridge,<br />
1997, S.35ff.<br />
23
Für alle folgenden Überlegungen gilt, dass nur Mehrheitskoalitionen in Erwägung gezogen werden.<br />
Das reflektiert zunächst die Tatsache, dass es in Deutschland bislang ausschließlich Mehrheitsregierungen<br />
gab. Das liegt aber vor allem an der institutionellen Festlegung im Grundgesetz, dass der Bundeskanzler<br />
mit absoluter Mehrheit zu wählen ist.<br />
Wendet man auf das Szenario 1 nun den gängigen minimal winning Ansatz an, findet man drei Mehrheitskoalitionen,<br />
die aus zwei Parteien gebildet werden können. Es ist jeweils die CDU als stärkste Partei<br />
mit entweder der FDP, der SPD oder der Linken. Nimmt man das Argument des minimum winning<br />
Ansatzes zu Hilfe, dass die CDU ihre Macht nicht nur mit möglichst wenig Parteien teilen will, sondern<br />
auch das Machtgleichgewicht innerhalb der Koalition eine Rolle spielt, wäre die Koalition mit der SPD<br />
als weniger wahrscheinlich zu betrachten. Geht man also von einer reinen Ämterorientierung aus,<br />
bleiben CDU-FDP, CDU-Linke und weniger wahrscheinlich CDU-SPD als prognostizierte Regierungskoalition<br />
bestehen.<br />
Doch zeigt sich an Hand dieser Überlegungen sehr schnell, dass <strong>für</strong> die Bundesrepublik Deutschland<br />
reine office-seeking Modelle nur unzureichend die realen Motivationen der Parteien berücksichtigen.<br />
Eine Koalition der CDU mit der Linken ist undenkbar. Also spielen policy-Überlegungen eine zentrale<br />
Rolle, so dass auf Basis des minimal connected winning Ansatzes die Koalitionen CDU-FDP und CDU-<br />
SPD prognostiziert werden können. Deutlich wird in dieser Prognose die hervorgehobene Position der<br />
CDU als Medianpartei. Eine alternative Regierungsbildung unter der SPD ohne die CDU müsste dagegen<br />
eine in der Realität undenkbare Koalition umschließen, die sowohl die Linke als auch die FDP umfasst.<br />
Auch wenn in diesem Ansatz die ideologische Distanz zwischen zwei benachbarten Parteien keine<br />
Rolle spielt, kann auf Grund der inhaltlichen Nähe von CDU und FDP davon ausgegangen werden,<br />
dass aus policy-Überlegungen die Koalition aus diesen beiden Parteien verwirklicht werden würde. 33<br />
Verstärkt wird diese Prognose durch ein office-seeking Argument. Denn die CDU verfügt über mehr<br />
koalitionsinterne Macht, wenn sie mit der FDP als kleinem Partner und nicht mit der SPD in einer Großen<br />
Koalition regiert.<br />
Im Szenario 2 ändern sich die Mehrheitsverhältnisse nur minimal, was aber große Wirkung auf die<br />
Regierungsbildung hat. So gibt es nur noch zwei minimal winning Koalitionen: CDU-SPD und CDU-<br />
Linke, es reicht nicht mehr <strong>für</strong> CDU-FDP. Auch wenn es sich bei CDU-Linke um die optimale minimum<br />
winning Koalition (zusammen 51%) handelt, ist diese doch aus ideologischen Gründen völlig unrealistisch.<br />
Daher wenden wir den Blick auf die möglichen Mehrheitskoalitionen von ideologisch benachbarten<br />
Parteien. Hier finden wir die Koalition von CDU und SPD und die linke Dreierkoalition von SPD-<br />
Grüne-Linke. Deutlich wird, dass die SPD in diesem Szenario die CDU als Medianpartei abgelöst hat.<br />
An ihr liegt es nun, zwischen den beiden policy-orientierten Koalitionen auszuwählen. Nimmt man das<br />
office-Kriterium der Anzahl der Parteien hinzu, sollte die SPD <strong>für</strong> eine große Koalition votieren, nimmt<br />
man das Argument der Koalitions-internen Macht zu Hilfe, sollte sie sich <strong>für</strong> die Linkskoalition entscheiden,<br />
da sie hier den Kanzler und eine Mehrzahl der Minister stellen kann. Versucht man die ideologische<br />
Distanz als zusätzliches policy-Kriterium heranzuziehen, ist nur schwer ein Urteil zu treffen,<br />
da nicht klar ist, ob zwischen der SPD und der Linken oder zwischen SPD und CDU die größere Distanz<br />
liegt. In diesem Szenario reicht es dagegen nicht <strong>für</strong> eine so genannte Ampel-Koalition aus SPD-<br />
Grüne-FDP. Doch spricht die große ideologische Distanz unter policy-Aspekten gegen diese Koalition,<br />
selbst wenn sie rechnerisch möglich sein sollte.<br />
So wird an dieser Stelle das Dilemma der SPD und die besondere Bedeutung der Linken sichtbar: Zwar<br />
stellt die SPD den Median, sie kann aber mit einem schwächeren Ergebnis als die CDU nur als Junior-<br />
33<br />
Das entspricht dem closed minimal range Ansatz, bei dem jene Mehrheitskoalition prognostiziert wird, die die<br />
geringste ideologische Distanz aufweist, vgl. W.C. Müller, „Koalitionstheorien“, S. 274.<br />
24
partner in eine große Koalition gehen oder auf Bundesebene eine Zusammenarbeit mit der Linken eingehen,<br />
eine Option, die unter der momentanen Führung von Müntefering und Steinmeier nicht denkbar<br />
ist. 34 So bleibt in der momentanen Situation der SPD kaum Hoffnung auf die Kanzlerschaft nach<br />
der Bundestagswahl 2009 – es sei denn ihr gelänge eine Überraschung und sie überflügelt die CDU an<br />
Mandaten. Damit ergibt sich der Ausblick, dass die Frage nach einer potentiellen Zusammenarbeit mit<br />
der Linken nicht nur unter elektoralen, sondern auch unter koalitionstheoretischen Perspektiven nach<br />
2009 vielleicht neu bewertet werden muss. Die Linke selbst muss sich fragen, ob sie bei dem momentanen<br />
eher prinzipiellen Oppositionskurs bleiben möchte, oder sich zukünftig aktiv <strong>für</strong> die Möglichkeit<br />
einer linken Mehrheitskoalition stark macht. Die Gefahr besteht sicherlich darin, an elektoraler Stärke<br />
zu verlieren. Falls es nicht <strong>für</strong> eine CDU-FDP Regierung reicht, ergibt sich <strong>für</strong> die CDU als Alternative<br />
zur Großen Koalition allein die so genannte Jamaika-Koalition aus CDU-FDP-Grüne, auf die jedoch die<br />
gleichen Probleme einer großen ideologischen Heterogenität zukämen wie auf eine Ampel-Koalition.<br />
Solche alternativen Gedankenspiele können dann an Bedeutung gewinnen, wenn man die Annahme<br />
des eindimensionalen Politikraums verlässt. Denn im mehrdimensionalen Raum sind zwar Gleichgewichtslösungen<br />
prinzipiell schwer zu erreichen, können aber über institutionelle Arrangements hergestellt<br />
werden. So kann eine Politikgestaltung auf Basis der Ressortzuständigkeit dann stabile Mehrparteienregierungen<br />
erbringen, wenn die Parteien, die den jeweiligen Minister stellen, autonom über die<br />
Ressortpolitik bestimmen können. 35 Dies scheint jedoch auf Grund der großen Interdependenzen heutiger<br />
Politikentscheidungen über die Ressorts hinweg eine problematische Annahme. Aus dieser skeptischen<br />
Sicht gegenüber einer erfolgreichen Realisierung von „Jamaika“ oder der „Ampel“, bleibt die<br />
zukünftige Rolle der Linken auf Bundesebene ein zentraler Aspekt <strong>für</strong> die unterschiedlichen Koalitionsoptionen<br />
und hier insbesondere <strong>für</strong> die Chancen SPD, den Kanzler zu stellen.<br />
2.5 Schlussbetrachtung<br />
In diesem Beitrag konnte gezeigt werden, dass die Etablierung der Linke als gesamtdeutsche Partei auf<br />
ihre Positionierung auf aktuellen gesellschaftlichen Konfliktlinien zurückgeführt werden kann. Das<br />
reicht jedoch nicht aus, sondern muss ergänzt werden mit der Dynamik des Parteienwettbewerbs und<br />
dem Entstehen einer Repräsentationslücke in den alten Bundesländern durch die Bewegung der SPD<br />
zur Mitte, die erst die Neugründung der WASG ermöglichte. Es besteht kein Zweifel mehr, dass die<br />
Linke als relevante Partei zu zählen ist, was sie momentan vor allem auf Grund ihres blackmail-<br />
Potentials ist. Insbesondere <strong>für</strong> die SPD ergeben sich durch die Linke große Herausforderungen in ihrer<br />
zukünftigen Positionierung. Inwiefern die Linke auch in den alten Bundesländern und auf Bundesebene<br />
zu Koalitionspotential gelangt, hängt einerseits von ihrer eigenen Bereitschaft ab, Regierungsverantwortung<br />
zu übernehmen. Entscheidender wird jedoch sein, wie sich die SPD zukünftig strategisch<br />
gegenüber der Linken verhält. Koalitionstheoretische Überlegungen zeigen, dass sich die SPD eigentlich<br />
gegenüber der Linken öffnen müsste, wenn sie mittelfristig nicht nur als Juniorpartner der CDU<br />
mitregieren möchte, sondern auch den Kanzler stellen will. Das gilt zumindest solange sie hinter der<br />
CDU in der Wählergunst zurückbleibt. Die Alternative einer Ampelkoalition mit den Grünen und der<br />
FDP erscheint momentan auf Grund der Heterogenität der policy-Positionen als eher unwahrscheinlich.<br />
34 Ein Tolerierungsmodell läuft auf Grund des absoluten Mehrheitskriteriums bei der Wahl des Bundeskanzlers<br />
auf die gleichen Koordinationsmechanismen wie bei einer Regierungskoalition hinaus und wird daher im Folgenden<br />
nicht gesondert betrachtet.<br />
35 Vgl. M. Laver / K.A. Shepsle, Making and Breaking Governments: Cabinets and Legislatures in Parliamentary<br />
Democracies, Cambridge, 1996.<br />
25
Die Linke selbst befindet sich auf der elektoralen Ebene in einer strategisch sicheren Situation, solange<br />
die beiden <strong>für</strong> ihre Positionierung wichtigen Konflikte, nämlich der Ost-West Gegensatz und das Ausmaß<br />
an Wohlfahrtsstaatlichkeit, gesellschaftlich relevant bleiben.<br />
26