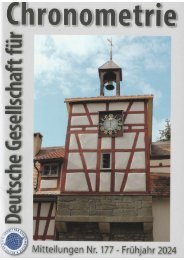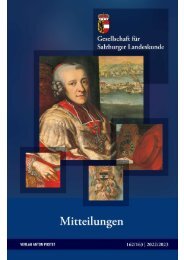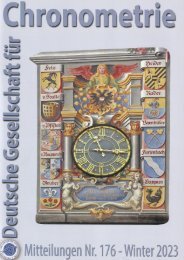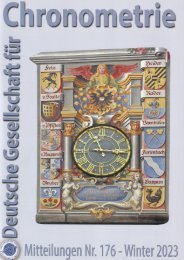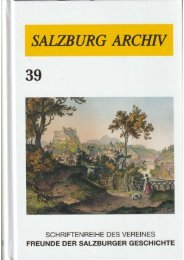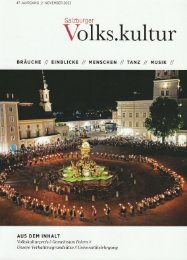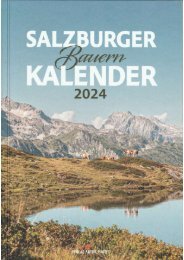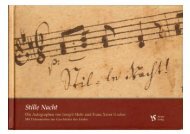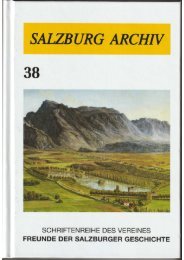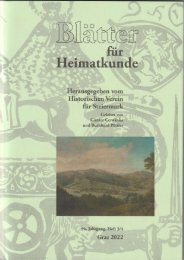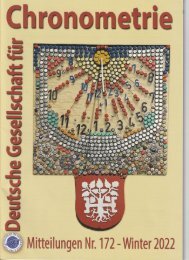DGCMitteilungen173UhrenSalzburg
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
AUS DEN FACHKREISEN<br />
Abb. 9 (links): Das<br />
Turmuhrwerk 1811 von<br />
Zell am See ist außergewöhnlich<br />
durch das<br />
„Nachschlagwerk“.<br />
Abb. 10 (rechts): Das neugotische<br />
Innenzifferblatt<br />
Lofer hat einen Minutenring<br />
mit arabischen<br />
Zahlen.<br />
Abb. 11: Das Kon -<br />
trollzifferblatt Mülln<br />
aus 1799 hat nur den<br />
Minutenzeiger.<br />
In der 2. Hälfte des 18. Jahrhunderts gab es<br />
viele Umbauten vom Spindel- auf den Hakengang,<br />
oft mit Ergänzung eines Viertelschlagwerks.<br />
Gerade die Uhrmacherdynastie Bentele<br />
sorgte aber auch für zahlreiche Neubauten<br />
wie die Domuhr 1782 oder die Uhr für die<br />
Stiftskirche St. Peter 1780, beide von Johann<br />
Bentele sen., beide mit Hakengang und langem<br />
Pendel.<br />
Die Familie Bentele wohnte und arbeitete<br />
in der Kaigasse Nr. 3 in Salzburg, wo sich<br />
heute das Gasthaus Zwettler’s befindet.<br />
Von Johann Bentele jun., ab 1804 der letzte<br />
Hofuhrmacher, stammt neben der Salzburger<br />
Rathausuhr 1802 die monumentale<br />
Turmuhr 1811 der<br />
Stadtpfarrkirche<br />
Zell am See, die mit<br />
171 cm Breite das<br />
zweitgrößte Werk<br />
landesweit ist. Das<br />
Nachschlagwerk<br />
wiederholt den<br />
Stundenschlag.<br />
Eher selten sind im<br />
Land Salzburg – von<br />
Orgeluhren abgesehen<br />
– Innenzifferblätter.<br />
In Mülln gibt<br />
es eines oberhalb<br />
des Hochaltars. In<br />
Leogang, Lofer und<br />
Tamsweg/St. Leonhard<br />
sind sie an<br />
Seitenwänden angebracht.<br />
Solche Anzeigen<br />
erforderten<br />
lange Zeigerleitungen von 20 und mehr Metern<br />
vom Uhrwerk zu den Zifferblättern.<br />
Häufig sind dagegen vor allem seit dem 18.<br />
Jahrhundert Kontrollzifferblätter: Sie machten<br />
es möglich, beim meist täglichen Aufziehen<br />
der Uhr auch die Zeigerstellung an den Zifferblättern<br />
außen am Turm oder an der Fassade<br />
zu überprüfen und sie ggf. nachzustellen. Zum<br />
Minutenzeiger kam schließlich auch noch der<br />
Stundenzeiger.<br />
Im 19. Jahrhundert kam es nach und nach zur<br />
Industrialisierung auch des Turmuhrenbaus:<br />
In Zederhaus wurde erst 1888 ein Schmiedeeisenwerk<br />
von Wendelin Jäger, Innsbruck,<br />
eingebaut, das noch heute mit einem später<br />
eingebauten Elektroaufzug läuft. Es löste<br />
ein Turmuhrwerk aus Holz (aus 1724?) ab,<br />
das sich heute im Lungauer Heimatmuseum<br />
in Tamsweg befindet. Dagegen wurde in der<br />
Salzburger Kollegienkirche nach wahrscheinlich<br />
mehr als 130 Jahren „turmuhrloser Zeit“<br />
seit der Kirchweihe 1707 erst um 1840 ein<br />
Werk aus Eisenguss eingebaut, konstruiert<br />
von Simon Stampfer, dem Lehrer und Förderer<br />
Christian Dopplers, und hergestellt in<br />
Böhmen.<br />
Im Land Salzburg sind zahlreiche Industrie-<br />
Turmuhren erhalten. Ein Großteil davon<br />
stammt von der Firma Philipp Hörz, Ulm, importiert<br />
durch Uhrmacher Thomas Fauner,<br />
St. Johann in Tirol und Saalfelden. Es gibt<br />
aber auch Werke von Johann Mannhardt,<br />
München, von J.F. Weule, Bockenem, von<br />
Bernhard Zachariä, Leipzig, und anderen.<br />
Von Hörz stammt das Turmuhrwerk 1912<br />
des Salzburger Borromäums, das bis 1957<br />
MITTEILUNGEN Nr. 173 52 FRÜHJAHR 2023