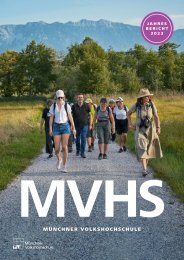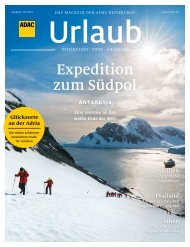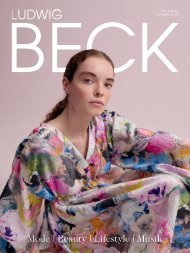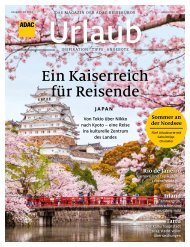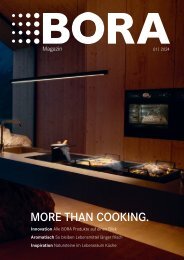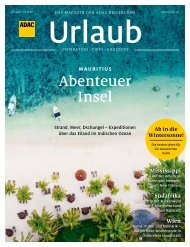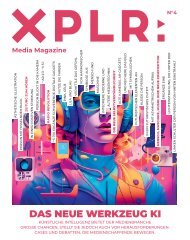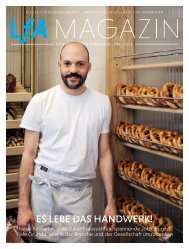NewHealthGuide 02/2023
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
Ausgabe <strong>02</strong>/2<strong>02</strong>3<br />
Ihr Weg in das digitale Gesundheitssystem<br />
„Wir brauchen einen<br />
Digitalisierungsprozess mit<br />
einheitlicher Struktur“<br />
Prof. Dr. Henriette Neumeyer<br />
von der DKG im Interview<br />
Datenharmonie pur?<br />
Von der Interoperabilität<br />
können alle profitieren – nur<br />
wann? Ein Überblick<br />
OP mit Joystick<br />
Wo Neuroradiologen präziser<br />
operieren – dank Roboter<br />
Multiple Sklerose an der<br />
Stimme erkennen?<br />
Über den Einsatz von KI bei<br />
Krankheitsdiagnosen<br />
Digitale Highlights<br />
Telemedizin-Kabine statt<br />
Arztpraxis, KI für die Wundversorgung<br />
und neue DiGA<br />
PREIS: 8,50 EUR
newhealth.guide #2<br />
Liebe Leserinnen,<br />
liebe Leser<br />
Wie weit wäre die Digitalisierung<br />
im Krankenhaus ohne<br />
das Krankenhauszukunftsgesetz<br />
(KHZG)? Diese Frage<br />
konnte man sich unter anderem<br />
auf der DMEA stellen,<br />
Europas führender Veranstaltung<br />
für die Digitalisierung<br />
des Gesundheitswesens.<br />
Von dort sind wir Ende April<br />
mit vielfältigen Eindrücken<br />
zurückgekehrt. Ins Auge fiel dabei<br />
besonders die Vielzahl der Anbieter<br />
von Patientenportalen – ohne<br />
das KHZG wäre dieser Schwerpunkt<br />
wohl nicht so ausgeprägt. Insofern<br />
hat das Gesetz einen wichtigen<br />
Impuls gesetzt, der nicht nur den<br />
Anbietern solcher Lösungen zugutekommt,<br />
sondern demnächst auch<br />
den Mitarbeitenden im Krankenhaus<br />
und den Patienten.<br />
Was aber passiert, wenn die<br />
jetzt genehmigten Patientenportale<br />
demnächst alle installiert<br />
sind? Werden Mitarbeitende und<br />
Patienten ohne Probleme damit<br />
zurechtkommen? Wohl kaum.<br />
Denn es geht dabei um nicht weniger<br />
als um eine Reise in völliges<br />
Neuland – und auf einer Reise<br />
braucht man häufig eine Übersetzungs-App.<br />
All das Neue muss<br />
noch in eine verständliche Sprache<br />
für diejenigen übersetzt werden,<br />
die es dann nutzen sollen. Gerade<br />
diese wichtige Frage scheint häufig<br />
noch nicht geklärt: Wie kann das,<br />
was sich IT und Technik ausgedacht<br />
haben, den Anwendern vermittelt<br />
werden? Auch hierbei wollen wir als<br />
NewHealth.Guide helfen.<br />
Ein wichtiges Thema in diesem<br />
Zusammenhang: die Verbesserung<br />
der Interoperabilität. Denn auch<br />
die technischen und die IT-Systeme<br />
müssen sich untereinander<br />
verstehen, damit gewinnbringender<br />
Datenaustausch stattfinden<br />
kann. Am Ende müssen sinnvolle<br />
Informationen in einer Form herauskommen,<br />
die die Gegenseite<br />
lesen und verstehen kann.<br />
Lesen Sie dazu in unserem<br />
Schwerpunkt, warum es sich lohnt,<br />
die Interoperabilität zu verbessern,<br />
und welche Schritte<br />
konkret zu gehen sind.<br />
Die anderen Systembeteiligten<br />
sozusagen zu ertüchtigen<br />
und die „digitale<br />
Literacy“ zu verbessern, ist ein<br />
weiterer wesentlicher Schritt.<br />
Darauf weist auch Frau Prof.<br />
Henriette Neumeyer, stellvertretende<br />
Vorsitzende der<br />
DKG, hin. In unserem großen<br />
Interview in dieser Ausgabe<br />
schildert sie außerdem, wie<br />
der Umgang mit Studierenden<br />
ihr frische Ideen bringt,<br />
welche Herausforderungen<br />
die Umsetzung der Krankenhausplanung<br />
mit sich bringt<br />
und warum es so ein wichtiger<br />
Impuls des KHZG war, dass Digitalisierung<br />
nicht umsonst zu haben ist.<br />
Weitere Eindrücke, die von der<br />
DMEA in Erinnerung bleiben, sind<br />
die Aufnahme der aktuellen Podcast-Folgen<br />
direkt auf der Messe<br />
und die interessanten Gespräche<br />
an verschiedenen Ständen. Dazu<br />
möchte ich Ihnen abschließend<br />
den NewHealth.Guide zum Hören<br />
ans Herz legen: Folge 6 mit<br />
Dr. Markus Leyck Dieken, dem Geschäftsführer<br />
der gematik, die als<br />
nationale Agentur das Mandat für<br />
die Umsetzung der elektronischen<br />
Patientenakte (ePA) erhalten hat,<br />
und Folge 7 direkt von unserem<br />
DMEA-Rundgang, der Eindrücke<br />
von der Bandbreite der Angebote<br />
und Entwicklungen vermittelt.<br />
Viel Spaß beim Lesen und Hören!<br />
Dr. med. Gudrun Westermann<br />
Chefredakteurin<br />
2
newhealth.guide #2<br />
Inhalt<br />
COVER: GENE GLOVER; FOTOS: EVELYN DRAGAN, SOPHIA RACKL, KLINIKUM RECHTS DER ISAR/THOMAS EINBERGER<br />
04<br />
Aktuelles aus der Gesundheitsbranche:<br />
z. B. eine Telemedizin-Kabine für die medizinische<br />
Versorgung in ländlichen Regionen<br />
08<br />
Entbürokratisierung, eine neue digitale Infrastruktur<br />
und Kliniken als Teil eines Netzwerks:<br />
Prof. Dr. Henriette Neumeyer, stellvertretende<br />
Vorsitzende der DKG, im Interview<br />
14<br />
Die Verbesserung der Interoperabilität kann<br />
Kosten sparen und Ressourcen<br />
freisetzen. Aber wie gelingt das? Ein Überblick<br />
Newsletter<br />
Erhalten Sie das monatliche<br />
Update zu allen<br />
Fragen der Digitalisierung im<br />
Gesundheitswesen<br />
Podcast<br />
Experten und Vorreiter im Interview.<br />
Jeden Monat ein spannendes<br />
Hintergrundgespräch zum Thema<br />
New Health<br />
20<br />
OP mit Joystick: Im Münchner<br />
Universitätsklinikum rechts der Isar gehen<br />
Roboter Neuroradiologen zur Hand<br />
24<br />
Ein Besuch bei audEERING: Das Unternehmen<br />
hat eine KI entwickelt, die Krankheiten wie<br />
Depression oder MS anhand der Stimme erkennt<br />
28<br />
Digital fit für jetzt und die Zukunft?<br />
Hier sind Fortbildungen für Klinikpersonal<br />
30<br />
Wichtige Konferenzen und Tagungen<br />
im Überblick<br />
Website<br />
Die Plattform für alle Inhalte des<br />
NewHealth.Guide: schnell Wissen<br />
finden und abrufen, Podcasts<br />
laden oder Newsletter bestellen!<br />
3
newhealth.guide #2<br />
News + Trends + Future<br />
4
newhealth.guide #2<br />
Telemedizin<br />
Ersatz für<br />
die Arztpraxis<br />
Das französische Unternehmen<br />
H4D hat die erste<br />
Telemedizin-Kabine entwickelt.<br />
Patienten können hier<br />
Arzttermine wahrnehmen,<br />
ohne in die Praxis zu müssen.<br />
Per Videocall führt der<br />
Arzt die Patienten durch die<br />
Behandlung. Ein Video-Tutorial<br />
hilft ihnen, mit einfach zu<br />
bedienenden Messgeräten<br />
in der Kabine Herzrhythmus,<br />
Blutzucker oder Sauerstoffgehalt<br />
im Blut selbst zu messen<br />
und über den Bildschirm<br />
die weitere Behandlung mit<br />
dem Arzt zu besprechen.<br />
Vor allem für ländliche<br />
Regionen ein spannendes<br />
Versorgungskonzept.<br />
www.h4d.com<br />
FOTO: MAURITIUS IMAGES/SCIENCE PHOTO LIBRARY/KATERYNA KON<br />
Künstliche Intelligenz<br />
Schnelles Handeln<br />
bei Sepsis<br />
Blutvergiftungen sind die dritt häufigste<br />
Todesursache in Deu tschland.<br />
Laut Weltgesundheitsorganisation<br />
(WHO) sterben circa<br />
35 Prozent der Patientinnen<br />
und Patienten mit einer Sepsis.<br />
Die Deutsche Telekom und das<br />
Start-up Telehealth Competence<br />
Center Analytics (TCC AI & Analytics)<br />
aus Hamburg haben nun<br />
eine KI-Lösung entwickelt, die<br />
Ärztinnen und Ärzten dabei hilft<br />
einzuschätzen, ob ihre Patienten<br />
gefährdet sind. Standardschnittstellen<br />
erfassen die Vitaldaten<br />
der Patienten und analysieren<br />
sie in der sicheren Open Telekom<br />
Cloud mit einem selbstlernenden<br />
Algorithmus. Dieser soll rund zehn<br />
Stunden vor dem Ausbruch einer<br />
Sepsis das individuelle Risiko vorhersagen<br />
können und über ein<br />
Dashboard den Ärztinnen und<br />
Ärzten anzeigen, sodass sie schnell<br />
handeln können. Aktuell wird die<br />
KI in zwei Krankenhäusern pilotiert.<br />
www.tcc-clinicalsolutions.de<br />
https://tinyurl.com/sepsis-telekom<br />
5
newhealth.guide #2<br />
News + Trends + Future<br />
Pflege<br />
Radar statt<br />
Video<br />
Ziel des Projekts Omni-<br />
Connect des Fraunhofer-<br />
Instituts ist es, zukünftig<br />
Gefahrensituationen<br />
bei pflegebedürftigen<br />
Menschen schneller zu<br />
erkennen – ohne Video.<br />
Mithilfe von Radarstrahlen<br />
werden Räume und<br />
Bewegungen von<br />
Menschen darin erfasst.<br />
Passive Tags in der Kleidung<br />
schicken relevante<br />
Infos an Sende-Empfangs-Module<br />
an der<br />
Zimmerdecke. Das System<br />
schlägt sofort Alarm,<br />
falls eine Person stürzt.<br />
www.fraunhofer.de<br />
Forschungsprojekt<br />
Wundanalyse mit KI<br />
„Nur etwa 20 Prozent aller<br />
chronischen Wunden, mit<br />
denen die Pflegenden in der<br />
ambulanten Alten pflege<br />
konfrontiert sind, werden<br />
adäquat behandelt“, sagt<br />
Julien Maarten Akay. Der<br />
26-jährige Data-Science-<br />
Masterstudent an der Fachhochschule<br />
Bielefeld will<br />
das ändern. Im Rahmen eines<br />
Forschungsprojekts entwickelt<br />
er gemeinsam mit<br />
der Softwarefirma Connext<br />
Communication eine Software<br />
zur Wundanalyse, -einschätzung<br />
und -versorgung.<br />
So soll zukünftig die Pflegekraft<br />
lediglich ein Foto von<br />
der Wunde aufnehmen und<br />
dieses in der Software Vivendi<br />
hochladen. Dort ordnet<br />
eine KI das Bild einer Wundart<br />
zu. Die Pflegekraft erhält<br />
somit eine Zweitmeinung für<br />
die weitere Behandlung der<br />
Wunde.<br />
www.hsbi.de<br />
Befundung<br />
Erstes deutsches KI-Teleradiologienetz<br />
In über 900 medizinischen Zentren weltweit wird die KI-Technologie des israelischen<br />
Unternehmens Aidoc bei bildgebenden Verfahren genutzt.<br />
Jetzt setzt auch das erste Teleradiologienetz in Deutschland, das Unternehmen<br />
Reif & Möller, bei der Befundung darauf. Die KI unterstützt vor allem in der<br />
Detektion, Priorisierung und Kommunikation verschiedener Anomalien – und soll<br />
so Radiologen von Routineaufgaben entlasten.<br />
www.diagnostic-network-ag.de<br />
6
newhealth.guide #2<br />
Digitale Medizinprodukte<br />
DiGA<br />
Kaia Rückenschmerzen<br />
Die Kaia Rückenschmerzen<br />
App behandelt nach<br />
einem individuellen Therapieprogramm<br />
sowohl<br />
Symptome als auch Ursachen<br />
der Beschwerden.<br />
Bewegungsübungen,<br />
Atem- und Entspannungstechniken<br />
sowie Wissenseinheiten,<br />
die Tipps für<br />
den Alltag bereithalten,<br />
sind Teil des Konzepts.<br />
Die App ist dauerhaft<br />
in das DiGA-Verzeichnis<br />
aufgenommen.<br />
Diagnostik<br />
Chip erkennt Krebs<br />
Das Forschungszentrum für Medizintechnik und<br />
Biotechnologie (fzmb) im thüringischen Bad<br />
Langensalza entwickelt derzeit einen Chip zur Früherkennung<br />
von hämatologischen Malignomen. Er basiert<br />
auf der Microarray-Technologie und soll exakte Informationen<br />
darüber liefern, welche Biomarker in der<br />
Patientenprobe vorliegen. Das Projekt wird vom Horizon<br />
Europe Programme der Europäischen Kommission<br />
gefördert und bald in klinischer Umgebung getestet.<br />
https://tinyurl.com/knochenmarkkrebs<br />
FOTOS: FRAUNHOFER IZM, P. POLLMEIER/FH BIELEFELD, KAIA HEALTH, ISTOCK/DA-KUK<br />
Elevida<br />
Ein Symptom der Multiplen<br />
Sklerose ist das<br />
Fatigue-Syndrom. Die Online-Anwendung<br />
Elevida<br />
unterstützt Patienten mithilfe<br />
von therapeutischen<br />
Techniken und Übungen<br />
im Umgang mit ihrer Fatigue<br />
und reduziert diese<br />
im besten Fall. Elevida<br />
ist ebenfalls dauerhaft<br />
in das DiGA-Verzeichnis<br />
aufgenommen.<br />
Cara Care für Reizdarm<br />
Die DiGA Cara Care<br />
liefert Anleitungen, wie<br />
man die Symptome<br />
Bauchkrämpfe, Blähbauch<br />
& Co. mit darmfreundlicher<br />
Ernährung<br />
und einem stressärmeren<br />
Lebensstil (z. B. durch audiogeführte<br />
Hypnose) verbessern<br />
kann. Die App ist<br />
vorläufig in das DiGA-Verzeichnis<br />
aufgenommen.<br />
Radiologie<br />
Update der RZV-EFA<br />
Die elektronische Fallakte (EFA)<br />
des Rechenzentrums Volmarstein<br />
(RZV) kann ab sofort<br />
auch radiologische Bilder verarbeiten.<br />
Hierfür wurde ein DI-<br />
COM-Archiv über IHE-Standards<br />
an das EFA-Backend angebunden.<br />
Bilder und Serien aus Röntgen,<br />
CT oder MRT lassen sich<br />
nun sicher importieren und über<br />
einen webbasierten Viewer betrachten.<br />
RZV ist einer der ersten<br />
Anbieter von intersektoralen<br />
Aktensystemen, die eine direkte<br />
Verknüpfung mit einem zentralen<br />
DICOM-Archiv bieten. Dies<br />
ermöglicht Ärzten einen umfassenden<br />
Blick auf das Behandlungsgeschehen.<br />
www.rzv.de<br />
7
newhealth.guide #2<br />
WANDELKOSTET<br />
Seit Juni 2<strong>02</strong>2<br />
ist Prof. Dr. med.<br />
Henriette Neumeyer<br />
stellvertretende<br />
Vorsitzende<br />
der DKG. Sie leitet<br />
auch den neuen<br />
Geschäftsbereich<br />
„Krankenhauspersonal<br />
und Politik“<br />
& GELD<br />
ZEIT<br />
Interview<br />
Fotos<br />
Gudrun Westermann<br />
Gene Glover<br />
8
newhealth.guide #2<br />
Wie die Digitalisierung medizinische<br />
Fachkräfte entlasten kann, ist nur<br />
eines der vielen Themen, die<br />
Prof. Dr. med. Henriette Neumeyer,<br />
stellvertretende Vorstandsvorsitzende der<br />
Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG),<br />
beschäftigen und die sie in der Politik<br />
platziert. Ein Gespräch über Reformen<br />
und das Krankenhaus der Zukunft<br />
Frau Prof. Neumeyer, Sie haben<br />
einmal gesagt, dass Sie im<br />
Gesundheitswesen übergeordnet<br />
etwas bewegen wollten, deshalb<br />
einen MBA gemacht haben und<br />
schließlich bei der DKG gelandet<br />
sind. Jetzt sind Sie seit mehr als<br />
einem Jahr in einer der höchsten<br />
Funktionen der DKG im Amt. Was<br />
konnten Sie bereits anstoßen?<br />
Generell geht es mir bei der Arbeit für<br />
die DKG darum, ein Bewusstsein für<br />
die Situation der Krankenhäuser und<br />
von deren Mitarbeitenden zu schaffen.<br />
Die Pandemie hat Spuren hinterlassen.<br />
Im Personalbereich haben wir<br />
uns daher für eine bedarfsgerechte<br />
Personalausstattung eingesetzt und<br />
das Thema mit unseren Partnern<br />
ver.di und DPR vorangetrieben. Außerdem<br />
konnten wir für den eiskalten<br />
Strukturwandel, also die Bedrohung<br />
von Versorgungsangeboten durch<br />
Unterfinanzierung, sensibilisieren.<br />
Die Kampagne „Alarmstufe Rot“,<br />
die wir 2<strong>02</strong>2 gestartet haben, und<br />
die damit verbundene Aufklärungsarbeit<br />
waren dabei ein Meilenstein.<br />
Wir konnten dafür sorgen, dass die<br />
Politik sich dessen angenommen<br />
hat, müssen aber weiter am Ball<br />
bleiben. Gleichzeitig haben wir uns<br />
durch unsere Auswirkungsanalyse<br />
für die Krankenhausreform konstruktiv<br />
in den Diskurs eingeschaltet,<br />
auch um die regionalen Besonderheiten<br />
in Deutschland in den Blick zu<br />
nehmen.<br />
Zur geplanten Gesundheitsreform:<br />
Die DKG hat die Reform ja<br />
scharf kritisiert. Was genau ist<br />
das Problem, wenn sie so wie geplant<br />
umgesetzt würde?<br />
Seit wir die Auswirkungen analysiert<br />
haben, sehen wir, dass die Reform<br />
eine deutliche Reduktion von<br />
Standorten über die Fläche bedeuten<br />
würde, was viele Menschen<br />
beunruhigt hat. Uns geht es darum,<br />
die Balance von wohnortnahem Zugang<br />
zu Versorgungsangeboten mit<br />
noch höheren Spezialisierungsgraden<br />
als heute zu ermöglichen.<br />
Sie betonen, dass die DKG nicht<br />
nur kritisieren möchte. Sie haben<br />
einen alternativen Vorschlag für<br />
eine Reform erarbeitet. Was sind<br />
die größten Unterschiede?<br />
Der Zugang zu Gesundheitsangeboten<br />
mit adäquater Wartezeit ist eine<br />
von der WHO geforderte Qualitätsdimension,<br />
ebenso wie Versorgungsgerechtigkeit,<br />
also, ob ich unabhängig<br />
von meinem sozioökonomischen<br />
Status Versorgung erhalte, wenn ich<br />
sie brauche. Wir werben daher dafür,<br />
die Bedarfsgerechtigkeit mehr in den<br />
Blick zu nehmen und jetzt die Versorgungsangebote<br />
zu stützen. Insgesamt<br />
muss die Politik den Bürgerinnen<br />
und Bürgern klar erklären, welche<br />
Versorgungsziele erfüllt werden sollen,<br />
und dazu gehört neben Strukturqualität<br />
eben auch der Zugang. Daher<br />
ist es uns zum einen ein Anliegen,<br />
die Kopplung von Leistungsgruppen<br />
und Leveln aufzuheben, da diese<br />
zu einer unverhältnismäßig starken<br />
Ausdünnung von wichtigen Versorgungsangeboten<br />
geführt hätte.<br />
Zum anderen muss das durch die<br />
Pandemie und den Ukrainekrieg<br />
verursachte Finanzierungsdefizit mit<br />
einem Vorschaltgesetz schnell und<br />
nachhaltig behoben werden. Nur<br />
so kann ein guter Boden für eine<br />
Reform bereitet werden ohne vorherige<br />
Strukturbereinigung am Bedarf<br />
vorbei. Die Basis der Vorhaltefinanzierung<br />
muss es sein, Versorgung<br />
im Grundsatz finanziell so abzusichern,<br />
dass in jeder Lebensrealität,<br />
ob Stadt oder Land, gleichwertiger<br />
Zugang zu Versorgung herrscht. Wir<br />
gehen davon aus, dass die reine<br />
Umschichtung innerhalb des Fallpauschalensystems<br />
nicht ausreichen<br />
wird und zusätzliche Mittel<br />
entlang der Notfallstufen als Komplexitätsindikator<br />
notwendig sind.<br />
Wenn jetzt zudem die Versorgungslandschaft<br />
umgebaut werden soll,<br />
müssen die anstehenden Investitionen<br />
in Infrastruktur und Medizintechnik<br />
so finanziert werden, dass die<br />
Bürgerinnen und Bürger auch den<br />
Mehrwert sehen.<br />
Wichtig ist schließlich die Frage, wie<br />
genau die ambulante Transformation<br />
und die sektorenübergreifende<br />
Planung gedacht werden können.<br />
9
newhealth.guide #2<br />
Wenn Krankenhäuser Leistungen<br />
aus dem vertragsärztlichen Bereich<br />
in der ambulanten Notfallversorgung<br />
mit absichern, muss das auch<br />
für die Versorgung planerisch mitgedacht<br />
und langfristig in der Vergütung<br />
berücksichtigt werden.<br />
Sie setzen sich schon länger für<br />
einen Wandel hin zu einer integrierten<br />
Gesundheitsversorgung<br />
ein, bei der verschiedene Akteure<br />
enger und besser als heute<br />
zusammenarbeiten. Was könnte<br />
dadurch verbessert werden?<br />
Die integrierte Versorgung bezeichnet<br />
ein umfassendes Konzept, bei<br />
dem verschiedene Gesundheitsdienstleister<br />
zusammenarbeiten,<br />
um eine nahtlose und koordinierte<br />
Versorgung für Patienten sicherzustellen.<br />
Dies umfasst die Verbindung<br />
medizinischer Behandlung, der<br />
Pflege und unterstützender Dienste,<br />
um die Effizienz und Qualität<br />
der Versorgung zu verbessern.<br />
Durch engere Zusammenarbeit<br />
der Akteure in der integrierten Gesundheitsversorgung<br />
könnten wir<br />
Effizienzsteigerungen, bessere Qualität<br />
der Patientenversorgung und<br />
höhere Patientenzufriedenheit erreichen.<br />
Durch Case- und Care<br />
Management, z. B. durch spezialisierte<br />
Schlaganfall-Lotsen, können<br />
schon jetzt individuelle Bedürfnisse<br />
berücksichtigt und reibungslose<br />
Übergänge zwischen verschiedenen<br />
Versorgungsbereichen ermöglicht<br />
werden. Dies ist jedoch neben der<br />
Abschottung der Sozialgesetzbücher<br />
und datenschutzrechtlichen<br />
Fragen leider zu häufig eine Vergütungsfrage,<br />
obwohl hier ein wirklicher<br />
Mehrwert liegt. Den Gedanken mehr<br />
auf Versorgungsprozesse und -ziele<br />
zu richten, so wie es die integrierte<br />
Versorgung sektorenübergreifend<br />
ermöglicht, und die genannten Hindernisse<br />
zu bearbeiten, würde auch<br />
der Reformdebatte Schub geben.<br />
Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen<br />
ist heute schon<br />
ein riesiges Thema – in Zukunft<br />
wird sich die Situation noch verschärfen.<br />
Wie ist hier Ihre Strategie?<br />
Was fordern Sie von der<br />
Politik und von den Trägern der<br />
Kliniken?<br />
Um den Fachkräftemangel im Gesundheitswesen<br />
anzugehen, haben<br />
wir eine klare Strategie: Zum<br />
einen arbeiten wir operativ und mit<br />
Bildungseinrichtungen für die Ausbildung<br />
von Gesundheitsberufen<br />
zusammen, unterstützen die Anerkennung<br />
ausländischer Abschlüsse<br />
und geben Empfehlungen aus für<br />
eine qualitative Ausbildung. Zudem<br />
setzen wir uns für die Attraktivität der<br />
Gesundheitsberufe ein, z. B. für einen<br />
ausgewogenen Mix aus Qualifikationen<br />
in der Pflege und die Stärkung<br />
der akademischen Ausbildung.<br />
Mit den gesammelten Daten und<br />
dem Feedback unserer Mitglieder<br />
und aus unserem Netzwerk entwickeln<br />
wir konkrete Positionen und<br />
Forderungen an die Politik, um die<br />
Personalpolitik in Krankenhäusern<br />
„Durch Datenfreigabe<br />
sichere ich mir als Patient<br />
oder Patientin<br />
einen Behandlungsvorteil.“<br />
aktiv mitzugestalten und zu unterstützen.<br />
Auch verstehen wir uns als<br />
Dialogplattform. Dringend erforderlich<br />
ist es, bürokratische Dokumentationsanforderungen<br />
an der Stelle<br />
zu reduzieren, wo sie keinen medizinischen<br />
Mehrwert schaffen. Denn<br />
Gesundheitsfachkräfte in den Krankenhäusern<br />
dürfen keinen „Bürokratie-Burn-out“<br />
erleiden.<br />
Wie kann die Digitalisierung helfen,<br />
den Fachkräftemangel zu<br />
entschärfen?<br />
Die Digitalisierung kann einen wesentlichen<br />
Beitrag leisten, um den<br />
Fachkräftemangel zu entschärfen.<br />
Es ist jedoch wichtig, dass die Digitalisierung<br />
in die Arbeitsprozesse<br />
integriert wird und nicht als zusätzliche<br />
Belastung wahrgenommen<br />
wird. Tatsächliche Entlastung durch<br />
Digitalisierung wird erlebbar, wenn<br />
sie durch die Berücksichtigung der<br />
Erfahrungen und Rückmeldungen<br />
der Nutzer die Arbeitsprozesse erleichtert<br />
und mehr Zeit für die Patientinnen<br />
und Patienten schafft.<br />
Auch kann Remote-Arbeit für medizinische<br />
Fachkräfte ein Attraktivitätsfaktor<br />
sein. Wir sprechen häufig<br />
von Telemedizin und KI, aber bereits<br />
heute sind manche medizintechnischen<br />
Geräte remote-steuerungsfähig.<br />
Auch hier sind eine Flexibilisierung<br />
und eine Unterstützung der<br />
immer rarer werdenden Fachkräfte<br />
möglich. Diese Potenziale müssen<br />
wir mehr in den Blick nehmen und<br />
auf allen regulatorischen Ebenen<br />
mitdenken, denn mit der digitalen<br />
Abbildung der bisherigen Überbürokratie<br />
ist nichts gewonnen und das<br />
Gesundheitswesen nicht konkurrenzfähig<br />
im Wettbewerb um Fachkräfte<br />
mit anderen Branchen. Eine<br />
10
newhealth.guide #2<br />
weitere Maßnahme zur Entlastung<br />
des Personals ist die Förderung digitaler<br />
Kompetenz. Sowohl die nächste<br />
als auch die heutige Generation<br />
müssen befähigt werden, die Digitalisierung<br />
so zu erlernen, dass sie in<br />
der Lage sind, ihre eigenen Arbeitsprozesse<br />
kompetent umzugestalten.<br />
Einflussreich<br />
In ihrer Position<br />
bei der DKG ist<br />
Prof. Henriette<br />
Neumeyer eine<br />
neue, starke<br />
Meinungsmacherin<br />
im<br />
Gesundheitswesen<br />
Inspiriert und<br />
inspirierend<br />
Sie lehrt<br />
zudem an der<br />
Nordakademie<br />
„Healthcare<br />
Management“<br />
– und bekommt<br />
dort „viele Impulse<br />
von den<br />
Studierenden“<br />
In welchen Bereichen kann die<br />
Digitalisierung den Krankenhäusern<br />
helfen, größere Probleme zu<br />
lösen und die integrierte Versorgung<br />
voranzubringen?<br />
Die Digitalisierung bietet im Bereich<br />
der integrierten Versorgung<br />
die Möglichkeit für mehr präventive<br />
Gesundheitsversorgung in der<br />
Interaktion aller für den Patienten<br />
beteiligten Berufsgruppen. Statt<br />
erst zu reagieren, wenn ein Patient<br />
bereits einen krankheitsspezifischen<br />
Bedarf hat, können durch geringfügige<br />
Anpassungen, wie Coachings<br />
oder Medikamentenumstellungen,<br />
frühzeitig Maßnahmen ergriffen<br />
werden, um eine Verschlechterung<br />
des Gesundheitszustands zu verhindern.<br />
Ein herausragendes Beispiel<br />
dafür ist die Herzinsuffizienz. Durch<br />
ein kleines Monitoring, das zu Hause<br />
durchgeführt werden kann, können<br />
wertvolle Parameter gewonnen<br />
werden, um frühzeitig Vorhersagen<br />
über den zukünftigen Zustand des<br />
Patienten zu treffen. Auf diese Weise<br />
kann man rechtzeitig intervenieren<br />
und „vor der Welle“ handeln, um<br />
Notfälle im ambulanten oder stationären<br />
Bereich zu vermeiden. Dieses<br />
proaktive Handeln müsste jedoch<br />
auch über die Vergütungssysteme<br />
belohnt werden.<br />
Wie können wir uns das Krankenhaus<br />
der Zukunft vorstellen?<br />
Das Krankenhaus der Zukunft wird<br />
mit Sicherheit Teil eines Netzwerks<br />
sein: Teil einer Struktur, die sowohl<br />
stationär versorgt als auch ambulant<br />
geöffnet ist – auch für fachärztliche<br />
Leistungen, damit in diesem<br />
Versorgungsnetzwerk der Patient<br />
regional gut versorgt und gut gesteuert<br />
ist. Es gibt aus der integrierten<br />
Versorgung in Deutschland auch<br />
schon Regionen und Projekte, die<br />
versuchen, diese integrierte Realität<br />
zu befördern. Das einzige Problem<br />
11
newhealth.guide #2<br />
Nah dran an der Politik<br />
Prof. Henriette Neumeyer in ihrem<br />
Büro in der Geschäftsstelle<br />
der Deutschen Krankenhausgesellschaft<br />
in Berlin<br />
Prof. Dr. med. Henriette Neumeyer<br />
absolvierte ihr Studium der Humanmedizin an der Universität zu Lübeck und entschied sich nach Promotion und initialer<br />
chirurgischer Ausrichtung für den Einstieg in die Krankenhausberatung. Ein berufsbegleitendes MBA-Studium schloss sie 2016<br />
mit einer mit dem Innovationspreis der DGIV prämierten Thesis zum Thema „Integrierte Versorgung und Medizintechnik“ ab.<br />
Sie war als ärztliche Beraterin im Gesundheitswesen für ein führendes Medizintechnikunternehmen tätig und für die Neuentwicklung<br />
und Implementierung IT-gestützter Versorgungsprojekte zuständig. 2019 entwickelte Prof. Neumeyer den Masterstudiengang<br />
„Healthcare Management“ für die Nordakademie und lehrt seitdem in Elmshorn und Hamburg. Im Alter von<br />
36 Jahren übernahm sie im Juni 2<strong>02</strong>2 den stellvertretenden Vorstandsvorsitz der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG).<br />
12
newhealth.guide #2<br />
„Das KHZG hat einen<br />
wichtigen Akzent gesetzt.<br />
Es hat verdeutlicht, dass<br />
digitale Transformation nicht<br />
umsonst zu haben ist.“<br />
ist, dass wir aktuell den Sprung in die<br />
Regelversorgung noch nicht schaffen.<br />
Aber das ist definitiv das Ziel, um<br />
das es auf die Dauer gehen muss,<br />
gerade auch weil wir ressourcenschonender<br />
und weniger redundant<br />
arbeiten könnten.<br />
Hat das Krankenhauszukunftsgesetz<br />
hier nicht – gezwungenermaßen<br />
– für eine gewisse Begeisterung<br />
bei den Kliniken gesorgt?<br />
Das KHZG hat auf jeden Fall einen<br />
wichtigen Akzent gesetzt. Es hat verdeutlicht,<br />
dass digitale Transformation<br />
nicht umsonst zu haben ist. Das<br />
ist ein komplexer Change-Prozess,<br />
der finanziert werden will – durch Allokation<br />
von Zeit, aber auch durch<br />
Allokation von Geld in neue, digitale<br />
Infrastruktur. Insofern war das ein sehr<br />
wichtiger Schritt. Der starre Planungsrahmen<br />
wird dem sehr agilen Thema<br />
jedoch nicht gerecht. Technologien<br />
verändern sich rapide. Da ist es für<br />
die Krankenhäuser wichtig, flexiblere<br />
Möglichkeiten innerhalb der genehmigten<br />
Fördervolumen neu zu gestalten,<br />
um auf den technologischen<br />
Fortschritt in Echtzeit zu reagieren.<br />
Wie wichtig sind Datenschutz und<br />
Datensicherheit – und wo werden<br />
sie manchmal überbetont?<br />
Man muss aus diesem Diskurs rauskommen:<br />
Datenschutz oder Gesundheit.<br />
Was sehr wenig diskutiert<br />
wird, ist die Qualität der Versorgung,<br />
die ich persönlich erhalten kann,<br />
wenn meine ÄrztInnen, meine PflegerInnen,<br />
meine TherapeutInnen<br />
meinen Krankheitsverlauf, meine<br />
Medikamente, Unverträglichkeiten<br />
oder Ähnliches schon kennen,<br />
wenn ich dort eintreffe. Das Wichtigste<br />
überhaupt ist, verständlich zu<br />
machen, dass ich mir durch meine<br />
Datenfreigabe einen Behandlungsvorteil<br />
sichere. Daher setzen wir uns<br />
auch für ein Gesundheitsdatennutzungsgesetz<br />
ein, das das Arbeiten<br />
für unsere Mitarbeitenden leichter,<br />
aber auch die Behandlung sicherer<br />
macht.<br />
Gleichwohl ist es so, dass es in<br />
Deutschland eine gewisse Grundskepsis<br />
gibt. In anderen Ländern<br />
ist das Vertrauenslevel viel höher.<br />
Deswegen muss man transparente,<br />
verständliche Datennutzung kommunizieren,<br />
aber auch sagen: Es<br />
gibt eine Transparenz, wer auf deine<br />
Daten zugreift, und die Möglichkeit<br />
zum Opt-out. Auch Dänemark hat<br />
so eine Lösung. Dort merkt die Bevölkerung<br />
ganz klar: Es bringt mir so<br />
viel, die Daten im System zu haben,<br />
dass ich sie gar nicht mehr rausziehen<br />
möchte.<br />
Die elektronische Gesundheitskarte<br />
und Dinge wie das E-Rezept<br />
sollen nun endlich bald kommen.<br />
Worauf kommt es an, damit solche<br />
Projekte ein Erfolg werden?<br />
Wir haben leider vielfach Systeme<br />
eingeführt, die überhaupt noch<br />
nicht nutzbar und nutzbringend waren<br />
– auch ohne Rücksicht auf die<br />
belasteten Gesundheitsfachkräfte.<br />
Sobald es datensichere Lösungen<br />
gibt, die auf den Endgeräten der<br />
Patientinnen und Patienten gut<br />
funktionieren – also einfach zu bedienen<br />
und einzurichten sind –, werden<br />
wir diese auch nutzen, weil sie<br />
das Leben leichter machen.<br />
Es gibt einen Mangel an IT-Experten,<br />
insbesondere solchen,<br />
die sich auch noch medizinisch<br />
auskennen. Wie lässt sich mehr<br />
IT-Personal mit medizinischer Expertise<br />
„heranziehen“?<br />
Wir sehen einen großen Bedarf, sich<br />
genau an diesen Schnittstellen weiterzubilden.<br />
Aber wir müssen neben<br />
der Begeisterung des Nachwuchses<br />
auch auf die Berufserfahrenen setzen.<br />
Es gibt aktuell auf dem Arbeitsmarkt<br />
ja auch eine große Gruppe<br />
von qualifizierten Menschen, denen<br />
Wissen zur Verfügung gestellt werden<br />
muss, auch mit Angeboten,<br />
die nicht gleich ein mehrjähriges<br />
berufsbegleitendes Studium umfassen.<br />
Durch Digitalisierung gibt es hier<br />
ebenfalls Möglichkeiten einer anderen<br />
Wissensvermittlung – kürzer,<br />
prägnanter, etwa mit Video.<br />
Sie lehren an der Nordakademie<br />
in Hamburg und Elmshorn als<br />
Professorin. Eigentlich haben Sie<br />
mehr als genug zu tun – warum<br />
tun Sie sich das an?<br />
Ich empfinde es als Privileg, das<br />
machen zu dürfen. Denn die Impulse,<br />
die ich bekomme, sind wirklich<br />
vielfältig. Wir haben Studierende<br />
mit unterschiedlichen Professionen;<br />
Gesundheitsberufe, IT-Spezialisten<br />
und Ökonomen – man bekommt<br />
ein ganz breites Bild, was sich diese<br />
Generation wünscht und womit sie<br />
sich befasst. Von unschätzbarem<br />
Wert ist meine Teilhabe an den Lebenswegen<br />
der Studierenden – das<br />
zu begleiten, macht mir wahnsinnig<br />
viel Freude. Da komme ich oft mit<br />
neuen Ideen raus.<br />
13
newhealth.guide #2<br />
Datenharmonie<br />
pur? Schön wär’s!<br />
Die Verbesserung der Interoperabilität im<br />
Gesundheitswesen kann Kosten sparen und<br />
Ressourcen freisetzen. Aber wie gelingt das?<br />
Und wo stehen wir gerade? Ein Überblick<br />
Text Christian Heinrich<br />
Illustration Sophia Rackl<br />
Wenn zwei sich verstehen,<br />
geht alles<br />
leichter von der<br />
Hand. Das gilt für<br />
Arbeitskolleginnen,<br />
Ehepartner, Freunde – und es trifft<br />
auch auf IT-Systeme im Gesundheitswesen<br />
zu. Wenn beispielsweise<br />
das Krankenhausinformationssystem<br />
(KIS) den Datenstandard der<br />
EKG-Geräte auf der Intensivstation<br />
unterstützt, können die erfassten<br />
Daten eines Patienten nicht nur<br />
direkt in dessen elektronische Akte<br />
übermittelt werden – sie lassen sich<br />
auch von überall in der Klinik aufrufen.<br />
So sieht erfolgreiche Interoperabilität<br />
in der Praxis aus. Datenharmonie<br />
pur.<br />
14
newhealth.guide #2<br />
Im Alltag gestaltet sich die Sache<br />
etwas anders. Wohl jede Mitarbeiterin<br />
und jeder Mitarbeiter einer<br />
Klinik kämpft an manchen Stellen<br />
damit, Daten mühsam zusammenzutragen<br />
und so zu speichern oder<br />
zu verschicken, dass der Empfänger<br />
– sei es eine Arztpraxis, der Medizinische<br />
Dienst der Krankenkassen<br />
oder die nächste Schicht in der<br />
Pflege – gut darauf zugreifen kann.<br />
Oder das Problem liegt im Empfangen:<br />
Man erhält Daten, kann sie<br />
aber nicht öffnen, nicht verarbeiten,<br />
nicht in einem gängigen Format<br />
speichern.<br />
Die Interoperabilität der Daten<br />
im Klinikum zu optimieren, kann<br />
enorm effizienzsteigernd sein. Und<br />
ist nicht nur wegen der Betonung<br />
des Themas im Krankenhauszukunftsgesetz<br />
eine Investition in die<br />
Zukunft. Hier beantworten wir die<br />
wichtigsten Fragen – und zeigen,<br />
wo Sie anfangen sollten, wenn Sie<br />
die Interope rabilität verbessern<br />
wollen.<br />
Worum geht es bei der<br />
Interoperabilität von Daten?<br />
In der Unfallchirurgie eines mittelgroßen<br />
Klinikums werden Patienten<br />
für einen chirurgischen Eingriff im CT<br />
voruntersucht. Findet die Operation<br />
statt, können sich die Ärzte die CT-Bilder<br />
aber nur begrenzt auf dem Bildschirm<br />
im OP-Saal anzeigen lassen.<br />
Im ungünstigsten Fall wird dadurch<br />
das Outcome der Operation beeinträchtigt.<br />
Ließen sich die Daten von<br />
der Software im OP besser verstehen,<br />
wäre das von großem Vorteil.<br />
Ein anderes Szenario: Man will in<br />
einer Klinik das Formularwesen umstellen.<br />
Bislang wurden Aufklärungsbögen<br />
ausgedruckt, vom Patienten<br />
beim Aufklärungsgespräch unterschrieben,<br />
eingescannt und in der<br />
Akte hinterlegt. Vor der Operation<br />
müssen die Aufklärungsbögen unter<br />
den Anhängen der Akte gesucht<br />
werden. Mithilfe einer Software, die<br />
Handschrift erkennt, werden unterschriebene<br />
Aufklärungsbögen<br />
schnell identifiziert. Ein Haken bestätigt<br />
„Aufklärung erfolgt?“, zusätzlich<br />
werden eventuelle handschriftliche<br />
Notizen des aufklärenden Arztes<br />
eingeblendet.<br />
Diese beiden Beispiele zeigen,<br />
was die Interoperabilität von Daten<br />
im Kern ist: In den allermeisten Fällen<br />
geht es um sogenannte Medienbrüche.<br />
Daten können nicht von allen<br />
Medien und von jeder Software gelesen<br />
werden. Oder sie werden unterschiedlich<br />
interpretiert; es werden<br />
andere Standards vorausgesetzt –<br />
auf diese Weise werden die Daten<br />
verzerrt oder sind mit bestimmten<br />
Softwaretools nur begrenzt<br />
zugänglich. Entsprechend<br />
bedeutet die Interoperabilität<br />
von Daten grundsätzlich:<br />
Zwei Systeme können<br />
ohne Barrieren Daten austauschen<br />
und nutzen.<br />
Wenn es auf den nächsten<br />
Seiten um die Schritte<br />
geht, wie in der Praxis eine<br />
bessere Interoperabilität<br />
aufzubauen ist, werden Beispiele<br />
wie die oben geschilderten<br />
eine zentrale Rolle<br />
spielen: als Anwendungs-<br />
15
fälle bzw. Use Cases (s. Seite 17).<br />
Zuvor in aller Kürze ein Überblick<br />
über die vier verschiedenen Ebenen,<br />
die für die Interoperabilität von<br />
Daten eine Rolle spielen:<br />
1. Strukturelle<br />
Interoperabilität<br />
Damit zwei medizinische Geräte<br />
miteinander Daten austauschen<br />
können, müssen sie miteinander<br />
verbunden sein. Dabei geht es<br />
vor allem um eine Hardwareverbindung,<br />
entweder über ein<br />
Kabel oder über ein drahtloses<br />
Netzwerk. Die strukturelle Interoperabilität<br />
ist die Grundvoraussetzung<br />
für den Austausch von<br />
medizinischen Daten.<br />
2. Syntaktische<br />
Interoperabilität<br />
Wenn Daten ausgetauscht werden<br />
können, muss auch gewährleistet<br />
sein, dass die Informationseinheiten<br />
von Sender und Empfänger<br />
richtig erkannt werden. Die Systeme<br />
müssen also die Zahlenfolgen<br />
gleich interpretieren. Die Bitfolge<br />
01001000 01100101 01110010 01111010<br />
kann für das Wort Herz stehen, sie<br />
kann aber auch für die Zahlen 72,<br />
101, 114 und 122 stehen.<br />
3. Semantische Interoperabilität<br />
Wenn nun der Datensatz richtig erkannt<br />
wurde, muss er auch korrekt<br />
interpretiert werden. Bei der genannten<br />
Zahlenfolge zum Beispiel<br />
könnte es sich um Pulswerte handeln,<br />
sie könnte aber ebenso verschiedene<br />
Kostenschlüssel in einem<br />
Abrechnungssystem darstellen.<br />
4. Organisatorische<br />
Interoperabilität<br />
Hier geht es darum, dass die Organisation<br />
so gestaltet ist, dass<br />
die Daten entsprechend fließen<br />
können. Dabei handelt es sich<br />
unter anderem darum, dass Ärzte<br />
und medizinisches Personal über<br />
entsprechende Berechtigungen<br />
verfügen, die Daten abzurufen.<br />
Warum lohnt es sich für<br />
eine Klinik, die Interoperabilität<br />
zu verbessern?<br />
Eine gute Interoperabilität hilft<br />
grundsätzlich, Prozesse zu vereinfachen.<br />
Was früher mühselig per<br />
Hand eingegeben wurde, kann<br />
nun mit einem Mausklick erledigt<br />
werden. Das gilt auch für abzurechnende<br />
Leistungen: Häufig ist<br />
es komplex und zeitintensiv, die<br />
Leistungen zu dokumentieren.<br />
Programme wie das Notaufnahmen-Informationssystem<br />
ERPath<br />
helfen dabei mit einfachen Checklisten,<br />
an denen Merkmale wie Abrechnungsziffern<br />
und Diagnosen<br />
hängen. „Je besser die Interoperabilität,<br />
desto einfacher kann diese<br />
Dokumentation dann in Abrechnungssystemen<br />
verarbeitet werden.<br />
Damit sinkt der Aufwand für<br />
die Abrechenbarkeit noch weiter“,<br />
sagt Susanne Büchner von ERPath<br />
Software.<br />
Dabei ist es wichtig, auf die sogenannte<br />
semantische Dateninteroperabilität<br />
zu achten. „Wenn der<br />
Entlassbrief in der Urologie ‚Formular<br />
37a‘ heißt und in der Unfallchirurgie<br />
‚Elab‘, kann ein solches Dokument<br />
im Zielsystem nicht ohne weitere<br />
Maßnahmen automatisch in der<br />
richtigen Kategorie einsortiert werden.<br />
Es bedarf einer menschlichen<br />
Intervention, um diese fehlende Interoperabilität<br />
auszugleichen. Das<br />
kann Abläufe verlangsamen und<br />
bindet Ressourcen“, erklärt der Radiologe<br />
Dr. Marc Kämmerer, Leiter<br />
des Innovationsmanagements bei<br />
VISUS Health IT. Im Grunde ließen<br />
sich für jeden Anwendungsfall die<br />
Benefits festlegen und teilweise<br />
auch beziffern.<br />
16
newhealth.guide #2<br />
Doch eine hohe Interoperabilität<br />
von Daten räumt nicht nur Hindernisse<br />
aus dem Weg, sondern kann<br />
auch zusätzlich unterstützend wirken:<br />
„Wenn die Patientendaten<br />
in einer für die Software verständlichen<br />
Form vorliegen, kann ein<br />
Programm den Ärzten auch Hilfestellungen<br />
bei der Diagnostik und<br />
der Auswahl der richtigen Therapie<br />
geben. Gerade bei seltenen Erkrankungen<br />
kann das manch eine<br />
Ärzte-Odyssee verkürzen oder ganz<br />
verhindern“, sagt Fabian Pritzel,<br />
Geschäftsführer des Bereichs Technologie<br />
& Innovationsmanagement<br />
bei den Paracelsus-Kliniken.<br />
Welche Schritte sind konkret<br />
zu gehen, um eine Interoperabilität<br />
der Daten aufzubauen?<br />
Das Ideal am Horizont sieht so aus:<br />
Durch eine sogenannte Interoperabilitätsplattform<br />
fließen alle Daten<br />
und sind automatisch überall so<br />
verfügbar, dass sie nach aktuellen<br />
Datenstandards vergleichbar<br />
sind und verarbeitet werden können.<br />
Unter Berücksichtigung des<br />
Datenschutzes sind die Daten bei<br />
Anfragen schnell und im für alle<br />
Programme lesbaren Format verfügbar.<br />
Damit gäbe es keine Hürden<br />
mehr bei der Bereitstellung und<br />
dem Verarbeiten von Daten.<br />
„Die Herausforderung ist, dass<br />
man in vielen Fällen die IT-Infrastruktur<br />
einer Klinik von Grund auf erneuern<br />
muss. Angesichts des enormen<br />
Aufwands ist das für kaum ein<br />
Krankenhaus in Gänze machbar“,<br />
berichtet Jan Oswald, der bei Deloitte<br />
Gesundheitseinrichtungen<br />
zur Prozess optimierung und Interoperabilität<br />
berät. Kurz: Sich als Ziel<br />
zu setzen, alle Daten im Haus interoperabel<br />
zu machen, ist in der Regel<br />
unrealistisch. Oswald und auch sein<br />
Kollege Marc Kämmerer von VISUS<br />
Health IT empfehlen daher dringend,<br />
in Use Cases, also Anwendungsfällen,<br />
zu denken.<br />
Schritt 1: Einen Anwendungsfall<br />
beschreiben<br />
Zunächst gilt es, die Anwendungsfälle<br />
zu identifizieren, bei denen Dateninteroperabilität<br />
zu einer Reduktion<br />
von Kosten und Zeit sowie zu<br />
einer Verbesserung der Patientenversorgung<br />
führen kann. Das sind<br />
typischerweise solche, bei denen<br />
Daten durch verschiedene IT-Systeme<br />
prozessiert und an weiterverarbeitende<br />
Systeme übergeben<br />
werden. So kann zum Beispiel ein<br />
Klinikum in der Notaufnahme ein<br />
eigenes IT-System verwenden, das<br />
nicht gut mit dem Krankenhausinformationssystem<br />
kommuniziert.<br />
Entweder aufgrund fehlender oder<br />
nicht interoperabler Schnittstellen<br />
(strukturelle Interoperabilität), aufgrund<br />
fehlender oder uneinheitlicher<br />
Metadaten zur eindeutigen<br />
Zuordnung der Daten im Zielsystem<br />
(semantische Interoperabilität) oder<br />
aufgrund nicht miteinander kompatibler<br />
Dateiformate. In der Praxis<br />
sieht das dann so aus: Die Stationsärzte<br />
erhalten die Notaufnahmebefunde<br />
nur als PDF, wo Copyand-paste<br />
nur schwer möglich ist.<br />
Für die eigene Dokumentation z.B.<br />
in Entlassbriefen müssen sie alles<br />
selbst eingeben – das ist zeit- und<br />
nervenraubend. Der Anwendungsfall<br />
wäre hier: Die Daten, die in der<br />
Notaufnahme generiert werden,<br />
sind im KIS und damit auf Station<br />
in strukturierter Form so verfügbar,<br />
dass sie dort direkt automatisch in<br />
die Dokumentvorlagen übernommen<br />
werden können.<br />
Welche dringlichen Anwendungsfälle<br />
es gibt, ist generell einrichtungsspezifisch.<br />
„Es geht darum,<br />
die Problemzonen in der eigenen<br />
Einrichtung zu finden. Dabei sollten<br />
das ärztliche und das Pflegepersonal<br />
unbedingt in die Suche und die<br />
Definition von Anwendungsfällen<br />
einbezogen werden“, so Oswald.<br />
Ist ein Anwendungsfall gefunden<br />
und beschrieben, geht es an die<br />
Umsetzung.<br />
Schritt 2: Die Umsetzung<br />
Auch wenn sich die Umsetzung<br />
auf einen Anwendungsfall fokussiert,<br />
kann die Projektdurchführung<br />
wiederum viele kleine Schritte umfassen.<br />
„Entscheidend ist, dass in<br />
kurzen Abständen der jeweilige<br />
Fortschritt kontrolliert wird. So kann<br />
das Projektteam jederzeit korrigierend<br />
eingreifen und die Entscheider<br />
können besser und frühzeitiger<br />
den Nutzen der Investition bewerten“,<br />
sagt Oswald.<br />
Je nach Anwendungsfall und<br />
Klinikum kann das Vorgehen stark<br />
17
newhealth.guide #2<br />
variieren: Manchmal braucht es<br />
ein komplettes externes IT-Team,<br />
in anderen Fällen stemmt die eigene<br />
IT-Abteilung die Umsetzung.<br />
„In den meisten Kliniken binden<br />
aktuelle Herausforderungen – etwa<br />
die Umsetzung des Krankenhauszukunftsgesetzes<br />
– die Kapazitäten<br />
der IT-Abteilungen. Projekte zur Herstellung<br />
oder Verbesserung der Interoperabilität<br />
haben es – sofern sie<br />
nicht bereits Teil einer KHZG-Förderung<br />
sind – daher schwerer“, sagt<br />
Marc Kämmerer.<br />
Hat man mehrere Anwendungsfälle<br />
erfolgreich umgesetzt,<br />
ergeben sich oft Synergieeffekte<br />
bei neuen Anwendungsfällen.<br />
Fließen die Daten zwischen dem<br />
Programm in der Notaufnahme<br />
und dem KIS bereits, ist ein Anwendungsfall,<br />
in dem es um das<br />
verbesserte Einarbeiten externer<br />
Daten ins KIS geht, schon ein<br />
Stück weit gelöst. „So kann man<br />
auch in großen Krankenhäusern<br />
unter Berücksichtigung des Investitionsschutzes<br />
die Interoperabilität<br />
Schritt für Schritt verbessern<br />
und dabei die Prozesse effizienter,<br />
schneller und ressourcenschonender<br />
gestalten“, so Oswald.<br />
Welche Rolle spielt bei alldem<br />
das Krankenhausinformationssystem?<br />
Das KIS ist eine wesentliche Drehscheibe<br />
für die Daten in einem<br />
Krankenhaus. „Wenn man an der<br />
Interoperabilität von Daten arbeitet,<br />
macht man das im Idealfall<br />
gemeinsam mit dem Betreiber des<br />
KIS“, sagt Fabian Pritzel von den Paracelsus-Kliniken.<br />
Daher sollte unbedingt<br />
Kontakt zum Hersteller oder<br />
Betreiber des KIS gesucht werden.<br />
Doch leider findet man hier nicht<br />
immer schnelle und wirksame Hilfe.<br />
„Ein KIS hat viele Daten im Bestand.<br />
Wenn es zu transparent wird und es<br />
zu leicht ist, diese Daten zu exportieren,<br />
macht sich das KIS potenziell<br />
entbehrlich. Doch genau diese<br />
Transparenz braucht es, um die Interoperabilität<br />
von Daten zu verbessern“,<br />
erklärt Oswald. Hier seien gewachsene,<br />
gegenläufige Interessen<br />
im Spiel – die Regulatorik versuche<br />
aber, sie im Sinne einer optimierten<br />
Patientenversorgung und Kostenersparnis<br />
immer mehr zu verbessern:<br />
„Vorgaben wie im KHZG, das für die<br />
Fördertatbestände zwei bis sechs<br />
interoperable Schnittstellen und Daten<br />
zwingend als Basis voraussetzt,<br />
sind hier hilfreich“, sagt Oswald.<br />
Doch vonseiten der Hersteller<br />
der KIS sind die Vorgaben manchmal<br />
nur mit größerem Aufwand<br />
umzusetzen. Das liegt auch daran,<br />
dass vor allem in Deutschland die<br />
KIS häufig im Lauf der Zeit gewachsen<br />
sind. „Anders als bei amerikanischer<br />
Software, wo in regelmäßigen<br />
Abständen eine komplett neue<br />
Version angeboten wird, werden in<br />
Deutschland durch Anpassungen<br />
im bestehenden System Dinge immer<br />
wieder verbessert und Fehler<br />
beseitigt. Auf diese Weise sind einige<br />
KIS über die Jahre zu einem<br />
komplexen, eher undurchsichtigen<br />
Konstrukt geworden, bei dem Anpassungen<br />
zunehmend aufwendiger<br />
werden. Wenn man sich dann<br />
als Klinik mit einer konkreten Fragestellung<br />
an den Hersteller wendet,<br />
wird es in der Regel teuer“, sagt Fabian<br />
Pritzel.<br />
Daher kann es häufig sinnvoll sein,<br />
andere Bausteine und Programme<br />
hinzuzuziehen, die für eine verbesserte<br />
Interoperabilität sorgen. Kurz: Das<br />
KIS sollte bei der Umsetzung aller Anwendungsfälle<br />
mit einbezogen werden.<br />
In manchen Fällen ist es aber<br />
18
newhealth.guide #2<br />
122<br />
80 76<br />
nicht Teil der Lösung, sondern Teil des<br />
Problems. Dann gilt es, innovative Lösungen<br />
zu entwickeln, die einerseits<br />
die individuelle Situation berücksichtigen,<br />
sich andererseits aber an aktuellen<br />
Standards orientieren und so<br />
nicht zu einer neuen Problemquelle<br />
in der Zukunft werden können.<br />
Wie geht die Entwicklung<br />
bei der Interoperabilität weiter?<br />
Dank internationaler Standards<br />
können Daten zunehmend geteilt<br />
werden. Der Standard FHIR HL7 zum<br />
Beispiel legt fest, wie Datenobjekte<br />
ausgetauscht werden können. Auf<br />
der Senderseite definiert FHIR, wie<br />
die Daten verpackt und kategorisiert<br />
werden müssen, damit sie auf<br />
der Empfängerseite reibungslos weiterverarbeitet<br />
und in das dort vorhandene<br />
System integriert werden<br />
können. HL7 ist die Abkürzung für<br />
Health Seven International, das ist<br />
die gemeinnützige Organisation, die<br />
den Standard ins Leben gerufen hat.<br />
Ein weiterer wichtiger Standard<br />
im Gesundheitswesen ist DICOM,<br />
den es schon seit den 1980er-Jahren<br />
gibt und der entsprechend etabliert<br />
ist: „Radiologische Bilddaten<br />
im DICOM-Format können heute<br />
weltweit von einem DICOM-Bildbetrachter<br />
eines beliebigen Herstellers<br />
angezeigt werden“, sagt Marc<br />
Kämmerer von VISUS Health IT.<br />
Die Lesbarkeit der Daten hat<br />
sich in den vergangenen Jahren<br />
wegen Standards wie DICOM gesteigert.<br />
Aber der Datenfluss selbst<br />
läuft häufig noch nicht reibungslos.<br />
Doch dass man etwa als Ärztin in<br />
der Praxis auf die Daten einer Patientin<br />
in der Klinik zugreifen kann,<br />
bleibt in Deutschland bislang eine<br />
ferne Vision. Das liegt auch an den<br />
Datenschutzbeschränkungen. „Ich<br />
hoffe, in Zukunft wird es möglich<br />
sein, dass die Gesundheitsdaten<br />
in der Cloud gespeichert werden<br />
können – das ist auch mit höchsten<br />
sicherheitstechnischen Anforderungen<br />
vereinbar. Das würde vieles<br />
erleichtern und die Anwendung<br />
künstlicher Intelligenz auf die Daten<br />
ermöglichen“, sagt Fabian Pritzel<br />
von den Paracelsus-Kliniken.<br />
Es ist davon auszugehen, dass<br />
sich aktuelle Standards nicht von<br />
heute auf morgen ändern. Eine Investition<br />
in die Interoperabilität ist<br />
also eine nachhaltige Maßnahme.<br />
Trotzdem sollte darauf geachtet<br />
werden, dass das IT-System flexibel<br />
ist und mögliche künftige Standards<br />
integrieren kann.<br />
Wie groß ist der Aufwand,<br />
welche Investitionen sind nötig?<br />
Die Investitionen richten sich nach<br />
den Anwendungsfällen und den<br />
gesetzten Zielen. Häufig geht es<br />
darum, zwei Grundbedingungen<br />
zu erfüllen: erstens die Installation<br />
oder Nachrüstung der passenden<br />
Schnittstellen und deren Konfiguration.<br />
Zweitens die Herstellung der<br />
semantischen Interoperabilität der<br />
Daten. Bis alle Prozesse angepasst<br />
sind und störungsfrei funktionieren,<br />
braucht es nicht nur Zeit und IT-Expertise,<br />
sondern auch medizinischen<br />
Input. Die Kosten können je<br />
nach Anwendungsfall von wenigen<br />
Tausend Euro bis zu mehreren Millionen<br />
Euro variieren. Im Extremfall<br />
kann auch ein grundlegender Neuaufbau<br />
der gesamten IT-Architektur<br />
des Krankenhauses notwendig<br />
sein, etwa durch einen Wechsel des<br />
Krankenhausinformationssystems.<br />
Da sich sowohl die Schnittstellen<br />
als auch die Daten über die Zeit verändern<br />
können, muss zudem für ein<br />
kontinuierliches Change Management<br />
gesorgt werden. Dazu sollten<br />
von Anfang an die Möglichkeiten<br />
und Prozesse mitgedacht werden,<br />
für den Fall, dass Schnittstellen einmal<br />
wieder ausgetauscht werden<br />
müssen.<br />
Dr. Marc Kämmerer empfiehlt, eigene<br />
Ressourcen – insbesondere<br />
die eigene IT-Abteilung – möglichst<br />
federführend einzubinden: „Das<br />
lohnt sich langfristig: Wenn es um<br />
den Betrieb und die Wartung der<br />
neuen Schnittstellen geht, kennen<br />
die Mitarbeiter die Hintergründe<br />
und die zum Fehlerfall führenden<br />
Prozesse besser. Auch wenn dies bei<br />
umfangreicheren Projekten mit sich<br />
bringt, dass man neue IT-Mitarbeiter<br />
einstellen muss. Es rechnet sich in<br />
den allermeisten Fällen.“<br />
Bis in einem Krankenhaus alle<br />
IT-Prozesse angepasst sind und<br />
reibungslos funktionieren, braucht es<br />
auch medizinischen Input.<br />
19
newhealth.guide #2<br />
„Der Roboter bietet<br />
uns eine<br />
zusätzliche Sicherheit“<br />
Millimeterarbeit aus dem Cockpit: An der Technischen<br />
Universität München operieren Neuroradiologen Hirnaneurysmen erstmals<br />
robotergestützt. Ein Vorbote für eine schnellere, telemedizinische<br />
Schlaganfallbehandlung, vor allem in ländlichen Regionen? Die Experten<br />
sagen: Ja, die Vorteile überwiegen!<br />
Text<br />
Christian Heinrich<br />
Der interventionelle Neuroradiologe<br />
Dr. Tobias Boeckh-Behrens ist<br />
an schwierige Eingriffe gewöhnt.<br />
Nur wenig von dem, was er operiert,<br />
ist Routine. Aber wenn es besonders<br />
herausfordernd wird, steht er während<br />
eines Eingriffs nicht mehr neben seiner<br />
Patientin, sondern er sitzt im Cockpit.<br />
So nennen Boeckh-Behrens und seine<br />
Kollegen die Armatur mit Bildschirmen, Joystick<br />
und weiteren Bedienelementen, die im<br />
Kontrollraum etwas abseits des Geschehens<br />
steht und dem Operateur Schutz vor Strahlung<br />
und Ablenkung gibt. „Ich brauche keine<br />
Bleischürze, neben mir wird nicht gespült<br />
und kein Kontrastmittel gespritzt. Ich kann<br />
mich voll auf den Eingriff fokussieren. Wenn<br />
man dann auf die großen Monitore schaut,<br />
auf denen Livebilder des Gefäßes von innen<br />
zu sehen sind, den Joystick in der Hand hält<br />
und sich Stück für Stück vorarbeitet, hat man<br />
das Gefühl, mitten im Geschehen zu sein und<br />
zu handeln“, sagt Boeckh-Behrens. Er ist leitender<br />
Oberarzt in der Neuroradiologie und<br />
dort Chef der Sektion Intervention am Universitätsklinikum<br />
rechts der Isar der Technischen<br />
Universität München (TUM).<br />
Mit dem Joystick steuert Boeckh-Behrens<br />
den kleinsten, innersten, letzten von mehreren<br />
Kathetern, die über die Leiste bis in die<br />
Gehirngefäße vorgeschoben werden. Die<br />
Steuerung ist dabei robotergestützt: Das Gerät<br />
erlaubt einen Vorschub von weniger als<br />
einem Millimeter. Derart präzise kann ein Arzt<br />
ohne Unterstützung selbst mit viel Feingefühl<br />
meist nicht durchgängig agieren. „Dabei ist<br />
es nicht so, dass der Roboter mir komplett<br />
die Arbeit abnimmt. Jeden einzelnen Schritt<br />
bestimme nach wie vor ich. Nur kann ich mithilfe<br />
des Roboters den winzigen Mikrokatheter<br />
präziser und geplanter bewegen. Das ist<br />
gerade bei herausfordernden Eingriffen eine<br />
große Hilfe“, erklärt Boeckh-Behrens.<br />
Bislang wird das Operationsrobotersystem<br />
mit dem Namen „CorPath GRX Neurovascular“<br />
am Universitätsklinikum rechts der Isar<br />
nur bei einzelnen Patientinnen und Patienten<br />
mit einem Hirnaneurysma eingesetzt. Dabei<br />
handelt sich um eine Aussackung in einem<br />
Gefäß im Gehirn, die oftmals nicht einmal<br />
drei Millimeter groß ist. Mithilfe des winzigen<br />
Katheters werden sogenannte Coils – Spiralen<br />
aus Platindraht – in das Aneurysma gebracht.<br />
Die Spiralen verhindern einerseits,<br />
dass weiteres Blut in das Aneurysma gelangt<br />
und die Aussackung sich vergrößert oder sogar<br />
platzt. Andererseits wächst im Lauf der<br />
Zeit die Gefäßwand über dem Aneurysma<br />
zu. Problem nachhaltig gelöst.<br />
Normalerweise steuert der Operateur den<br />
winzigen Katheter ohne maschinelle Hilfe. „Als<br />
ich von dem Roboter hörte, war ich neugierig,<br />
aber auch etwas skeptisch. Denn wenn man<br />
den Katheter selbst steuert, hat man noch<br />
eine direktere haptische Rückmeldung: Ich<br />
spüre in meinem Finger, wenn ich auf einen<br />
Widerstand stoße“, erklärt Boeckh-Behrens.<br />
Aber als er sich mit dem Roboter vertraut<br />
machte, merkte er nach kurzer Zeit, dass<br />
die Vorteile eindeutig überwiegen. Doch bis<br />
Boeckh-Behrens und sein Oberarzt-Kollege,<br />
Privatdozent Dr. Christian Maegerlein, den<br />
Hightech-Hilfe<br />
Präziser und schonender<br />
Eingriff ins<br />
Gehirn: Radiologe<br />
Dr. Tobias<br />
Boeckh-Behrens<br />
kann über den Arm<br />
des Roboters Katheter,<br />
Stents etc.<br />
millimetergenau<br />
bewegen<br />
FOTOS: KLINIKUM RECHTS DER ISAR/KATHRIN CZOPPELT, KLINIKUM RECHTS DER ISAR/THOMAS EINBERGER<br />
20
FOTOS: XXXXX<br />
21
newhealth.guide #2<br />
Starkes Team<br />
Die Oberärzte<br />
PD Dr. Christian<br />
Maegerlein, PD<br />
Dr. Tobias Boeckh-<br />
Behrens mit Prof.<br />
Dr. Jan Kirschke<br />
und Prof. Dr. Claus<br />
Zimmer, Leiter<br />
der Abteilung für<br />
Diagnostische und<br />
Interventionelle<br />
Radiologie am<br />
Universitätsklinikum<br />
rechts der Isar (von<br />
links nach rechts)<br />
Roboter das erste Mal bei einem Patienten<br />
einsetzten, brauchte es mehrere Monate<br />
Ein arbeitungszeit. Zunächst übten sie einige<br />
Stunden an einem Silikonmodell des Gefäßsystems<br />
im Gehirn, um in der Bedienung<br />
sicher zu werden und den Roboter kennenzulernen.<br />
Auch heute noch fertigen die beiden<br />
von jeder Patientin und jedem Patienten<br />
mittels 3-D-Drucker ein Modell der jeweiligen<br />
individuellen Gefäßstruktur an, um daran<br />
den bevorstehenden Eingriff einmal im Detail<br />
durchzugehen.<br />
Bisher hat sich der Aufwand gelohnt: Zwei<br />
Patienten haben die Ärzte bislang mithilfe<br />
des Roboters behandelt. In beiden Fällen<br />
konnte das Aneurysma erfolgreich verschlossen<br />
werden. „Gerade der jüngste Fall war<br />
besonders anspruchsvoll. Da war ich sehr<br />
froh, dass ich den Roboter an der Seite hatte“,<br />
sagt Boeckh-Behrens.<br />
Ob und in welchem Umfang der Einsatz<br />
des Roboters das Outcome der Aneurysma-<br />
Behandlung verbessert, wird gerade in ersten<br />
Studien erprobt. Bis konkrete Ergebnisse<br />
vorliegen und sich womöglich ein Benefit<br />
zeigt – etwa in der Komplikationsrate oder in<br />
der Überlebensdauer –, dürften jedoch noch<br />
einige Monate ins Land gehen: Da die Geräte<br />
weltweit noch nicht in großem Stil genutzt<br />
werden, braucht es Zeit, bis die Fallzahlen<br />
zusammenkommen. Nach seiner klinischen<br />
Erfahrung mit dem Roboter fällt Boeckh-Behrens‘<br />
Urteil aber klar aus: „Ich bin ziemlich sicher,<br />
dass es hier einen Benefit gibt. Ich selbst<br />
jedenfalls denke gerade bei besonders<br />
schwierigen Fällen inzwischen häufig: Das ist<br />
sehr komplex, aber der Roboter bietet uns<br />
hierfür eine zusätzliche Sicherheit.“<br />
Größere Wirkung durch Kooperationen<br />
Die Abteilung für Diagnostische und Interventionelle<br />
Neuroradiologie am Universitätsklinikum<br />
rechts der Isar ist hierzulande nach<br />
Boeckh-Behrens‘ Wissen die einzige Klinik, wo<br />
der Operationsroboter bereits im klinischen<br />
Einsatz ist. Im deutschsprachigen Ausland arbeiten<br />
auch das Inselspital in Bern und das<br />
Uniklinikum Salzburg mit dem CorPath GRX<br />
Neurovascular. In Salzburg ist man ebenfalls<br />
begeistert. Man wagt sogar einen Blick in die<br />
Zukunft, über die Versorgung von Aneurysmen<br />
hinaus: „Mit einem gut ausgebildeten<br />
Team könnten, wenn medizinisches und<br />
Pflegepersonal rarer werden, sogar mehrere<br />
Krankenhäuser von einem zentralen Standort,<br />
quasi von einem ‚Schaltraum‘ aus, mitversorgt<br />
werden“, sagt Professorin Monika<br />
Killer-Oberpfalzer, die Leiterin des Instituts für<br />
Neurointervention an der Paracelsus Medizinischen<br />
Privatuniversität, wo der Roboter gemeinsam<br />
mit der Uniklinik Salzburg eingesetzt<br />
wird. Dabei geht es vor allem um die Akutversorgung<br />
von Schlaganfällen.<br />
Auch Boeckh-Behrens aus München sieht<br />
in der Versorgung von Schlaganfällen Potenzial<br />
für den Roboter. Denn der Roboter kann<br />
nicht nur präzise arbeiten – der Operateur<br />
kann über ihn auch aus großer Entfernung<br />
FOTOS: KLINIKUM RECHTS DER ISAR/THOMAS EINBERGER, KLINIKUM RECHTS DER ISAR/KATHRIN CZOPPELT<br />
22
newhealth.guide #2<br />
wirken. Gerade im ländlichen Raum ist es ein<br />
großes Problem, die akute Versorgung von<br />
Schlaganfällen mit spezialisiertem Personal<br />
zu gewährleisten. So hat das Universitätsklinikum<br />
rechts der Isar etwa eine Kooperation<br />
mit dem Krankenhaus Weilheim-Schongau in<br />
Oberbayern. Wenn in dem Klinikum beispielsweise<br />
eine Schlaganfallpatientin eingeliefert<br />
wird, bei der ein Gefäß im Gehirn mit einem<br />
Stent wieder geöffnet werden muss, werden<br />
sofort die Kollegen in München benachrichtigt.<br />
Es gilt: „Time is Brain“ – je früher der<br />
Eingriff erfolgt, desto eher kann irreversibler<br />
Schaden im Gehirn vermieden werden.<br />
Die Patientin nach München zu verlegen,<br />
dauert bei einem akuten Schlaganfall oft zu<br />
lange. „Also setzt sich einer von uns zügig ins<br />
Auto und fährt los, während die Kollegen in<br />
Weilheim den Eingriff vorbereiten. Nach rund<br />
einer Stunde sind wir da“, sagt Boeckh-Behrens.<br />
Wäre hingegen der Roboter in Weilheim<br />
vor Ort, bräuchte sich Boeckh-Behrens in<br />
München nur ins Cockpit zu setzen und könnte<br />
den Eingriff aus der Ferne durchführen.<br />
„Das würde sicher eine wertvolle Stunde Zeit<br />
einsparen und auch die personelle Belastung<br />
reduzieren. Aus diesen Gründen ist der Einsatz<br />
des Systems in der Schlaganfallbehandlung<br />
das große Ziel“, sagt Boeckh-Behrens. Aber<br />
er schränkt auch ein: „Bis so etwas überhaupt<br />
einmal erprobt und später dann in die Regelversorgung<br />
aufgenommen wird, ist es noch<br />
ein sehr langer Weg.“<br />
Auch deshalb dürfte das System zunächst<br />
nur für größere, forschende Kliniken infrage<br />
kommen: Zwar hat das Universitätsklinikum<br />
rechts der Isar das System vom Hersteller nur<br />
geleast, das heißt, die Kosten halten sich in<br />
Grenzen. Doch die Zeit, die das Personal in die<br />
Vorbereitung der Eingriffe investiert, ist enorm.<br />
Bei einzelnen, besonders herausfordernden<br />
Fällen, wie sie etwa in hoch spezialisierten Häusern<br />
auflaufen, ist der Aufwand aber ohnehin<br />
groß. Gerade für solche Anwendungen scheint<br />
das Robotersystem einen wertvollen Benefit zu<br />
bringen. Nun sind Boeckh-Behrens und seine<br />
Kollegen gespannt, ob sich dieser Eindruck<br />
auch in den klinischen Studien bestätigt.<br />
Intensive<br />
Vorbereitung<br />
Der Roboter ist<br />
geleast, was<br />
Kosten einspart. Für<br />
die Einarbeitung<br />
in die Bedienung<br />
muss das Personal<br />
jedoch viel Zeit<br />
investieren<br />
23
newhealth.guide #2<br />
„Die Stimme ist<br />
das neue Blut“<br />
KI ist in aller Munde, auch in der Gesundheitsbranche. Was sie hier zu<br />
leisten vermag, zeigt zum Beispiel das bayerische Unternehmen audEERING.<br />
Es hat eine Technologie entwickelt, die Krankheiten aus der<br />
menschlichen Stimme herauslesen kann – zum Beispiel Depressionen,<br />
Multiple Sklerose oder Corona<br />
Text<br />
Kathrin Schwarze-Reiter<br />
24
newhealth.guide #2<br />
FOTOS: ISTOCK (4), AUDEERING/MARTIN NINK<br />
Kann eine Fernsehserie<br />
aus den 80er-Jahren<br />
Forschende dazu bringen,<br />
die Medizin der<br />
Zukunft zu gestalten?<br />
So abenteuerlich das klingt: ja.<br />
Aber dazu später.<br />
„Die Stimme ist das neue Blut –<br />
man kann aus ihr unglaublich viel<br />
herauslesen“, sagt Dagmar Schuller,<br />
Mitgründerin von audEERING.<br />
Das Unternehmen, dessen Name<br />
für Intelligent Audio Engineering<br />
steht, hat eine KI-basierte Technologie<br />
entwickelt, die Merkmale<br />
in der Stimme erkennt und diese<br />
bewertet: Dabei spielen Tonhöhe,<br />
Klangfarbe, Betonung und Sprachrhythmus<br />
eine Rolle. „Das sind<br />
wichtige Biomarker – also messbare<br />
Parameter biologischer Prozesse“,<br />
erklärt Schuller. Nahezu 7.000 solcher<br />
Merkmale filtert audEERING<br />
automatisiert und in Echtzeit heraus.<br />
In Kombination können sie auf<br />
bestimmte Erkrankungen oder Zustände<br />
hindeuten, auch Gefühle<br />
kann die Software erkennen.<br />
All diese Erkenntnisse fußen bei<br />
audEERING auf wissenschaftlich<br />
validierter Forschung. Das Team<br />
hat zahlreiche wissenschaftliche<br />
Paper in namhaften Publikationen<br />
veröffentlicht. Der Europäische<br />
Forschungsrat zeichnete das Unternehmen<br />
mit einem seltenen Proof<br />
of Concept Grant aus. Außerdem<br />
wurde es 2019 vom Bundesministerium<br />
für Bildung und Forschung und<br />
dem DLR Projektträger als eine von<br />
zehn Erfolgsgeschichten für künstliche<br />
Intelligenz genannt, die es von<br />
bahnbrechender Grundlagenforschung<br />
zu einem reellen Produkt<br />
geschafft haben.<br />
audEERING sitzt in einem Industriepark<br />
in Gilching bei München.<br />
Hier entwickeln vor allem Luftfahrtunternehmen<br />
unbemannte Flugobjekte<br />
und nachhaltig angetriebene<br />
Flugzeuge. Auch das Deutsche Luftund<br />
Raumfahrtzentrum startet seine<br />
Testobjekte auf einem Sonderflughafen<br />
in der Nähe. In einem kastenartigen<br />
Gebäude hat audEERING<br />
fast den ganzen zweiten Stock gemietet,<br />
die Räume sind großzügig.<br />
Auf die ehemalige Start-up-Mentalität<br />
deuten lediglich ein Kicker und<br />
Erkennt Ideen mit<br />
Zukunft<br />
Dagmar Schuller ist<br />
CEO und Co-Founder<br />
des KI-Unternehmens<br />
audEERING<br />
Flyer zu einem Wim-Hof-Atem-Workshop<br />
hin. Neben Gilching gibt es inzwischen<br />
auch einen Sitz in Berlin,<br />
ganz zentral in der Friedrichstraße.<br />
Die Geschäftsidee zu audEERING<br />
entstand bereits vor mehr als einem<br />
Jahrzehnt, als Dagmar Schuller mit<br />
Professor Björn Schuller und drei<br />
seiner Doktoranden an der Technischen<br />
Universität München (TUM) in<br />
einem Münchner Café zusammensaß<br />
und über ihre Forschungsarbeit<br />
sprach. Die gelernte Informatikerin,<br />
Wirtschaftswissenschaftlerin und<br />
einst jüngste Managerin bei der Beratungs-<br />
und Prüfungsgesellschaft<br />
Ernst & Young in New York – sie wurde<br />
bereits vor ihrer österreichischen<br />
Matura abgeworben – versuchte,<br />
die Wissenschaftler von dem Wert<br />
ihrer Erfindung zu überzeugen. Florian<br />
Eyben, Martin Wöllmer und Felix<br />
Weninger forschten damals an der<br />
TUM zur intelligenten Spracherkennung.<br />
Leiter dieser speziellen Forschungsgruppe<br />
am Lehrstuhl für<br />
Mensch-Maschine-Kommunikation<br />
war Björn Schuller. Er hatte schon<br />
während seiner eigenen Habilitation<br />
an der TUM und auch später<br />
als einer der führenden Professoren<br />
am Imperial College London die<br />
Themen Affective Computing und<br />
KI wissenschaftlich wesentlich geprägt.<br />
Seine Schwerpunkte waren<br />
dabei der Audiobereich und die<br />
menschliche Stimme. Inspiriert hatte<br />
Björn Schuller die TV-Serie „Knight<br />
Rider“ mit David Hasselhoff. In seiner<br />
Rolle als Michael Knight kommuniziert<br />
er mit dem sprechenden Auto<br />
K.I.T.T., das mit künstlicher Intelligenz<br />
ausgestattet ist und zum Beispiel erkennt,<br />
wenn sein Fahrer müde wird<br />
und eine Pause braucht. Und damit<br />
wären wir bei der Eingangsfrage<br />
dieses Textes.<br />
Dagmar Schuller erkannte in<br />
den Experimenten mit der KI-basierten<br />
Technologie sofort das Potenzial.<br />
„Ich bin vielleicht nicht so genial<br />
im Coden, aber Zukunftsideen<br />
erkennen, das kann ich“, sagt die<br />
Wissenschaftlerin, gebürtig aus Weiz,<br />
einer kleinen Stadt in der Steiermark.<br />
Sie war überzeugt, dass das Potenzial<br />
der intelligenten Sprachanalyse<br />
nicht hinter verschlossenen Uni-Türen<br />
bleiben dürfte. Ein richtiges Softwareprodukt<br />
sollte entstehen, das<br />
man in Alltagsgeräte und -produkte<br />
integrieren kann.<br />
Doch nicht nur ein Cafébesuch<br />
war nötig, um die Wissenschaftler<br />
zu überzeugen. Zu groß war die Ungewissheit:<br />
Die drei Doktoranden<br />
mussten noch ihre Promotionen<br />
beenden, und würde das mit der<br />
Firma überhaupt klappen? Weil Risikokapital<br />
nicht infrage kam, einigte<br />
man sich darauf, pragmatisch zu<br />
starten. Die fünf gründeten Ende<br />
Dezember 2012 eine UG: mit 500<br />
Euro Stammkapital und 7.500 Euro<br />
privatem Startkapital. Heute macht<br />
die Firma siebenstellige Umsätze,<br />
die Mitarbeiterzahl ist auf 75 angewachsen.<br />
Doch wie ist es möglich, körperliche<br />
und psychische Erkrankungen<br />
aus der Stimme herauszulesen?<br />
Ein neues Deep-Learning-Verfahren<br />
wird mit fast 7.000 Merkmalen<br />
kombiniert, die audEERING durch<br />
unzählige Stimm- und Sprechproben<br />
identifiziert hat. Damit hat<br />
das Unternehmen eine flexibel erweiterbare<br />
Softwareplattform gebaut,<br />
die Emotionen und mögliche<br />
Krankheitszustände aus den Stimmdaten<br />
erkennt und versteht. Jedes<br />
Husten, Räuspern und Stocken<br />
kann ein Hinweis sein, der von der<br />
künstlichen Intelligenz analysiert<br />
wird. So spricht ein Mensch, der<br />
an Depressionen leidet, anders als<br />
ein gesunder. Auch neuronale Erkrankungen<br />
wie Parkinson oder Vi-<br />
25
newhealth.guide #2<br />
rusinfektionen wie COVID-19 schlagen<br />
sich in der Stimme nieder. Da<br />
diese durch Zunge, Stimmlippen,<br />
Wangenmuskulatur und Lungenvolumen<br />
gebildet wird, verändert<br />
eine Krankheit die Artikulation: Fieber<br />
macht die Sprache monotoner,<br />
Corona den Husten trockener.<br />
„Inzwischen können wir verschiedene<br />
Merkmale und Zustände wie<br />
Stress oder Erschöpfung erkennen<br />
– aber auch Veränderungen in der<br />
Stimme, die mit Krankheiten wie<br />
Depression, Multipler Sklerose oder<br />
neurodegenerativen Erkrankungen<br />
in Verbindung stehen – manchmal<br />
zeigen sich hierfür schon in einem<br />
früheren Stadium Anzeichen“, sagt<br />
Dagmar Schuller.<br />
Im Jahr 2<strong>02</strong>0 machte audEERING<br />
Schlagzeilen, weil die KI-Technologie<br />
mit einer Wahrscheinlichkeit<br />
von gut 82 Prozent bereits in<br />
der Proof-of-Concept-Phase sagen<br />
konnte, ob ein Sprecher an Corona<br />
leidet oder nicht. In Zusammenarbeit<br />
mit der Universität Augsburg<br />
hat audEERING eine Forschungsstudie<br />
zu einem sprachbasierten CO-<br />
VID-19-Test durchgeführt. „Wir ließen<br />
die Menschen husten sowie weitere<br />
Sprachtests über ihren Laptop oder<br />
ihr Smartphone machen und konnten<br />
dadurch erkennen, ob eventuell<br />
eine Infektion vorliegt – ganz ohne<br />
Nasenabstrich“, so die 47-Jährige.<br />
Die WHO verzeichnet seit einigen<br />
Jahren einen starken Anstieg<br />
bei Depressionen, nicht zuletzt befeuert<br />
durch die Pandemie. Stress<br />
und Erschöpfungszustände nehmen<br />
ebenfalls zu, häufig sind auch<br />
junge Personen betroffen. „Unspezifische<br />
Symptome wie Erschöpfung<br />
objektiv zu messen, ist oft<br />
nicht einfach. Auch zu erkennen,<br />
ob eine Depression beispielsweise<br />
eine Begleiterscheinung einer anderen<br />
Krankheit ist oder sich isoliert<br />
durch andere Einflussfaktoren<br />
entwickelt hat, ist wichtig, um die<br />
richtige Therapie zu finden“, sagt<br />
Schuller. Um diesen Prozess zu erleichtern,<br />
hat audEERING mit AI<br />
SoundLab eine Studienplattform<br />
entwickelt. Mit ihr können die Patientinnen<br />
und Patienten validierte<br />
Sprachtests machen, die Plattform<br />
liefert dann Erkenntnisse durch die<br />
Stimmbiomarker. Außerdem haben<br />
die Testpersonen die Möglichkeit,<br />
ein Audiotagebuch zu führen, das<br />
Aufschluss über die Entwicklung der<br />
Emotionszustände liefert.<br />
audEERING hat die Technologie<br />
ein Jahr lang in einer besonders<br />
aufreibenden Umgebung getestet:<br />
an den Crew-Mitgliedern<br />
eines Frachtschiffs, die durch die<br />
beengten Lebensumstände und<br />
die anstrengende körperliche Arbeit<br />
hohem Stress ausgesetzt sind.<br />
„Durch unsere Technologie und<br />
verschiedene Tests konnten nicht<br />
nur Stresssituationen automatisiert<br />
identifiziert werden, was bessere Interventionen<br />
ermöglicht. Sondern<br />
die Crew-Mitglieder reagierten<br />
auch positiv auf die Möglichkeit,<br />
sich selbst in emotionalen Situationen<br />
objektiv zu analysieren“, erzählt<br />
Schuller.<br />
Vor großen Herausforderungen<br />
steht audEERING allerdings bei<br />
der Datengewinnung: „Die strengen<br />
Vorschriften machen es vor<br />
allem Unternehmen im medizinischen<br />
Bereich echt schwer – die<br />
Gesundheits- und Krankheitsdaten<br />
sind der Grundstock jeder technischen<br />
Entwicklung“, sagt Schuller.<br />
Für sie sei es kein Wunder, dass so<br />
viele junge, aber auch etablierte<br />
Firmen ins Ausland abwandern, wo<br />
die Vorschriften weniger streng sind.<br />
audEERING nimmt das Thema Datenschutz<br />
sehr ernst, setzt sich aber<br />
für eine freiwillige Herausgabe der<br />
Gesundheitsdaten und die Möglichkeit<br />
zur aktiven Partizipation ein.<br />
„Viele Patientinnen und Patienten,<br />
die an chronischen oder seltenen<br />
Krankheiten leiden, würden gerne<br />
freiwillig ihre Daten spenden, nur<br />
um der Linderung ihrer Erkrankung<br />
einen Schritt näherzukommen.“<br />
audEERING möchte nun auf seiner<br />
AI-SoundLab-Plattform eine Möglichkeit<br />
anbieten, die eigenen Daten<br />
zu spenden. Ein Stimmtest kann<br />
dann der Forschung allgemein<br />
oder für ein bestimmtes Krankheitsfeld<br />
zur Verfügung gestellt werden.<br />
In einem völlig anderen Bereich<br />
ist die audEERING-Technologie<br />
bereits weltweit im Einsatz: in der<br />
Marktforschung und im Callcenter.<br />
Die KI-Technologie für das Produkt<br />
engage.AI des dänischen Unternehmens<br />
Jabra basiert auf der<br />
Stimme. Wenn der Mitarbeitende<br />
einen Anruf entgegennimmt, analysiert<br />
die Technologie in Echtzeit<br />
die Stimmen. So weiß er unmittelbar,<br />
wie der Anrufende am anderen<br />
Ende der Leitung drauf ist.<br />
Gleichzeitig sieht er, wie er selbst<br />
klingt – freundlich, gereizt, fröhlich?<br />
So kann er seine Stimme an den<br />
Kunden anpassen. Der Inhalt des<br />
Gesprächs wird nicht gespeichert,<br />
sowohl Anrufer als auch Mitarbeiter<br />
bleiben anonym. Das alles scheint<br />
viel zu bringen, zeigt eine Studie anhand<br />
von rund 70.000 Anrufen: Die<br />
Kundenzufriedenheit steigt, die Anliegen<br />
der Anrufer sind schneller erledigt.<br />
So sollen die Telefongespräche<br />
in Zukunft entspannter werden<br />
und konstruktiver verlaufen – eine<br />
Verbesserung für alle Seiten.<br />
FOTOS: ISTOCK<br />
26
Anzeige<br />
Patienten- und Behandlungsinformationen nutzbar<br />
machen<br />
Daten zählen zu den wichtigsten Gütern unserer Zeit. Im Gesundheitswesen ist deren Nutzung allerdings<br />
bisweilen schwierig bis unmöglich, auch wenn diese mittlerweile digital bzw. digitalisiert vorliegen.<br />
ID hat in Kooperation mit DMI eine Portallösung entwickelt, die Krankenhäusern beliebige, semantische<br />
Auswertungen ihrer Patientendaten zur Verfügung stellt. Zudem ist die Implementierung der<br />
Software-as-a-Service-Lösung DaWiMed ohne großen Aufwand möglich.<br />
Im Behandlungsverlauf wird eine<br />
Vielzahl an Informationen zum<br />
Patienten aufgenommen. Diese<br />
Daten können allerdings nur dann<br />
von Computersystemen verarbeitet<br />
werden, wenn sie in standardisiert<br />
strukturierter Form vorliegen. Erst<br />
dann sind sinnvolle Auswertungen<br />
oder zielgerichtete Abfragen möglich,<br />
insbesondere dann, wenn das<br />
Ziel der Abfrage eine intelligente<br />
Interpretation der Daten erfordert.<br />
Das Langzeitarchiv als Datenquelle<br />
für semantische Analysen<br />
Die abgeschlossene und freigegebene<br />
Behandlungsdokumentation<br />
wird im Rahmen der Aufbewahrungspflicht<br />
im digitalen revisionssicheren Langzeitarchiv<br />
aufbewahrt. Dort liegen damit umfassende strukturierte<br />
und unstrukturierte Daten über die Patientenversorgung<br />
vor. Grundsätzlich ist das digitale Langzeitarchiv Datenquelle<br />
für Auswertungen, weil diese Daten u. a. die Anforderungen:<br />
Verfügbarkeit, Vertraulichkeit und Integrität erfüllen<br />
müssen. Um bereits eine strukturierte Aufbewahrung<br />
zu fördern, ist es erforderlich, freitextbasierte Behandlungsdokumentationen<br />
automatisch mittels Natural Language<br />
Processing (NLP) inhaltlich zu analysieren.<br />
NLP ist seit 2011 bei DMI fester Bestandteil des Archivierungsprozesses.<br />
Die NLP-Analyse medizinischer Freitexte<br />
und weiterer Dokumentenmerkmale ist für die automatisierte<br />
Dokumententypindexierung im Einsatz. In diesem<br />
Archivierungsschritt erhalten die zu archivieren-den papierbasierten<br />
oder elektronischen Dokumente weitere<br />
beschreibende Dokumentenmerkmale. Durch die Klassifizierung<br />
der Dokumente mit der Klinischen Dokumentenklassenliste<br />
(KDL) werden im nächsten Archivierungsschritt<br />
freitextbasierte Dokumente der semantischen Analyse zugeführt.<br />
Dadurch wird die Ergebnisqualität der semantischen<br />
Analyse gesteigert.<br />
Im Jahr 2<strong>02</strong>2 implementierte DMI in Zusammenarbeit<br />
mit ID Berlin weitere NLP-Anwendungen in den Archivierungsprozess.<br />
Zahlreiche Patienteninformationen liegen<br />
nach wie vor in Form von Freitexten vor, ob in Arztbriefen,<br />
OP-Berichten oder Befunden. Mit dem Terminologieserver<br />
ID LOGIK ® werden auch die dort enthalten<br />
Informationen verwertbar. Alle anfallenden Texte zum<br />
Patienten werden mit computerlinguistischen Methoden<br />
analysiert und strukturiert. Das Ergebnis ist eine<br />
vollständige Abbildung der Inhalte auf verschiedene Terminologien,<br />
wie ICD-10-GM, OPS, Wingert-Nomenklatur<br />
(WNC), Anatomisch-Therapeutisch-Chemische Klassifikation<br />
(ATC) und SNOMED CT.<br />
Die Bereitstellung der strukturierten Behandlungsinformationen<br />
erfolgt über ein Health Data Warehouse von DMI.<br />
Die syntaktische Interoperabilität wird durch den Einsatz<br />
von HL7 FHIR ® und HL7 CDA Level 3 sichergestellt.<br />
DaWiMed (Daten – Wissen – Medizin)<br />
Gemeinsam wurde ein flexibles Analysetool entwickelt, das<br />
sich auf viele Fragestellungen anwenden lässt. Was auf<br />
dem ersten Blick einzig als Forschungsinstrument nutzbar<br />
scheint, wird nun auch für Krankenhäuser interessant.<br />
DaWiMed ist eine Portallösung zur Auswertung von Patienten-<br />
und Behandlungsinformationen. Das Besondere<br />
daran: Es werden nicht nur abrechnungsrelevante Informationen<br />
in den Datenbestand einbezogen, sondern alle<br />
in der Klinik vorliegenden Daten. Die Suche in diesen Daten<br />
erfolgt anschließend vollständig Terminologie basiert. Dabei<br />
können Patientenstammdaten, Falldaten, Symptome,<br />
Diagnosen, Prozeduren, Medikamenten und Laborwerte<br />
beliebig miteinander kombiniert werden.<br />
Die Anwendungsmöglichkeiten sind vielfältig und sprechen<br />
gleich mehrere Berufsgruppen im Krankenhaus an.<br />
Neben Studien und Forschung ist DaWiMed auch für die<br />
Qualitätssicherung und das Controlling relevant. Neben<br />
der typischen Kohorten Selektion auf Basis von Ein- und<br />
Ausschlusskriterien kann auch gezielt nach bestimmten<br />
klinischen Situationen gesucht werden.<br />
Mit DaWiMed sind nicht mehr Abrechnungsdaten der limitierende<br />
Faktor, sondern die Inhalte selbst.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.id-berlin.de
newhealth.guide #2<br />
Digitale<br />
Kompetenz<br />
erwerben<br />
Text<br />
Lena Kaeß<br />
In der Gesundheitsbranche entwickeln sich neue Technologien rasant<br />
weiter. Die Anwendung digitaler Tools und das Wissen darüber<br />
werden im klinischen Alltag immer wichtiger. Wo sich Gesundheitsfachkräfte<br />
weiterbilden können und welche Angebote es gibt, erfahren Sie hier<br />
Berufsbegleitende Weiterbildung<br />
Zertifikatsstudium „Digital Health“<br />
Fach- und Führungskräfte aus dem Gesundheitssektor<br />
müssen zunehmend auf neue digitale<br />
Herausforderungen reagieren können. Das<br />
Zertifikatsstudium „Digital Health“ der Leuphana<br />
Professional School bietet hierfür ein berufsbegleitendes<br />
Curriculum: Themen wie die digitale<br />
Gesundheitsförderung, digitales Lernen, Medienpädagogik,<br />
IT und Formen der Online-Kommunikation<br />
für gesundheitsrelevante Aspekte<br />
stehen auf dem Lehrplan. Diese Weiterbildung<br />
auf Master-of-Public-Health-Niveau dauert zwei<br />
Semester und kostet 3.120 Euro zzgl. Semesterbeiträge.<br />
Start ist im Oktober. Die diesjährige Bewerbungsfrist<br />
endet am 15. Juli.<br />
Infos unter: www.leuphana.de<br />
Online-Seminar<br />
Datenschutz im Gesundheitswesen<br />
Datenmissbrauch und Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen<br />
– der Austausch medizinischer<br />
Informationen über Datennetze birgt<br />
enorme Gefahren. Aus diesem Grund sind gesetzlich<br />
zahlreiche Spezialregelungen zu beachten.<br />
Das Online-Seminar „Datenschutz im<br />
Gesundheitswesen“ bietet hierfür den nötigen<br />
Überblick. Der zweitägige Kurs klärt die Teilnehmenden<br />
über Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes,<br />
europäische Regelungen<br />
und auch landesrechtliche Sonderbestimmungen<br />
und Vorschriften auf. Ausgewiesene<br />
Expertinnen und Experten aus der betrieblichen<br />
und anwaltlichen Praxis informieren über<br />
Herausforderungen bei der Übermittlung von<br />
Patientendaten an Dritte: von behördlichen<br />
Auskunftsersuchen über die Nutzung von Gesundheitsdaten<br />
zu Forschungszwecken bis hin<br />
zu betriebsinternen Untersuchungen. Die Zielgruppe<br />
des Kurses sind Akteure im Gesundheitswesen,<br />
die sich mit Compliance- oder Datenschutzfunktionen<br />
auseinandersetzen oder<br />
generell mit Gesundheitsdaten in Berührung<br />
kommen. Das Online-Seminar findet vom 18. bis<br />
19. September statt und teilt sich in zwei Module<br />
auf: Grundlagen- und Vertiefungswissen. Anmeldeschluss<br />
ist der 15. September 2<strong>02</strong>3.<br />
Infos unter: www.bvmed.de<br />
FOTOS: LEUPHANA/ALFRED BRANDL, UNIVERSITÄTSKLINIKUM JENA/ANNA SCHOLL (2)<br />
28
newhealth.guide #2<br />
Weiterbildungsstudiengang<br />
„eHealth and<br />
Communication“<br />
Sicher und souverän ins digitale<br />
Zeitalter: Im berufsbegleitenden<br />
Masterstudiengang „eHealth and<br />
Communication“ der Friedrich-Schiller-Universität<br />
Jena erwerben die<br />
Teilnehmenden die notwendigen<br />
Kompetenzen des digitalen Gesundheitssystems.<br />
Durch eine Kombination<br />
aus Online-Seminaren und flexibel<br />
gestaltbaren Praxisübungen werden<br />
Theorie und Anwendung verknüpft.<br />
Nach drei Semestern können die Studierenden<br />
E-Health-Technologien<br />
unter ethischen, technischen, ökonomischen<br />
und rechtlichen Aspekten<br />
analysieren. Sie lernen, wie die<br />
adäquate digitale Kommunikation<br />
und Vermittlung von Gesundheitsinformationen<br />
funktioniert und worauf<br />
man bei der Implementierung von<br />
E-Health-Anwendungen in unterschiedlichen<br />
Settings achten muss.<br />
Der Studiengang richtet sich an alle<br />
Berufsgruppen des Gesundheitssystems<br />
mit einem ersten Hochschulabschluss,<br />
z. B. in Medizin, Pharmazie,<br />
Psychologie, Pflegewissenschaften.<br />
Kosten: 4.300 Euro pro Semester.<br />
Infos unter: www.master-ehealth.uni-jena.de<br />
DEIN TINNITUS.<br />
DEINE MUSIK.<br />
DEINE APP.<br />
Erholung vom Tinnitus.<br />
www.harmody.de<br />
Lade dir jetzt<br />
Harmody auf dein<br />
Smartphone.<br />
ERHÄLTLICH IM<br />
APPLE STORE<br />
ERHÄLTLICH BEI<br />
GOOGLE PLAY
newhealth.guide #2<br />
Termine 2<strong>02</strong>3<br />
Die jüngsten Entwicklungen im Digital-Health-Bereich aus erster Hand<br />
erfahren, Denkanstöße bekommen und Ideen austauschen:<br />
Hier ist ein Überblick über wichtige Kongresse, Tagungen und Konferenzen<br />
10.<br />
Juli<br />
Health-IT Talk Berlin<br />
Einmal im Monat treffen<br />
sich beim Health-IT Talk<br />
Berlin-Brandenburg verbands-<br />
und fachrichtungsübergreifend<br />
rund<br />
50 Branchenkollegen, um<br />
sich zur Digitalisierung der<br />
Gesundheitswirtschaft<br />
auszu tauschen. Die Teilnahme<br />
ist kostenlos.<br />
healthittalk.imatics.de<br />
17.–21.<br />
Juli<br />
Digital Health Lunch<br />
Online<br />
Immer auf dem Laufenden<br />
bleiben mit dem Digital<br />
Health Lunch: Die Remote-<br />
Event-Reihe des Nürnberger<br />
Unternehmens SIXOWLS<br />
informiert mit verschiedenen<br />
Speakern über digitale<br />
Zukunftstechnologien der<br />
Healthcare-Branche.<br />
www.sixowls.de<br />
6.–8.<br />
September<br />
BIG BANG HEALTH Essen<br />
Das BIG BANG HEALTH-Festival will die Revolution im Gesundheitswesen<br />
erlebbar machen. Bei spannenden Keynotes und<br />
Panel-Talks im Colosseum Theater in Essen geben Experten<br />
Einblicke in die aktuellen Entwicklungen der Health-Branche –<br />
mit dabei: Gloria Seibert, CEO von Temedica, und viele mehr.<br />
bigbang.health<br />
Entspannte Festival-Atmosphäre<br />
Durch das Programm des Festivals führt unter anderem<br />
Co-Host Prof. Dr. David Matusiewicz<br />
13.<br />
September<br />
Digital Health Day Leipzig<br />
Das Fachsymposium „Innovation<br />
durch Digitalisierung“<br />
erscheint im neuen Gewand:<br />
dem Digital Health Day. Das<br />
beliebte Eventformat verspricht<br />
freie Gestaltungsmöglichkeiten<br />
der Teilnehmenden<br />
sowie einen Überblick über<br />
die Chancen und Risiken der<br />
Digitalisierung.<br />
www.gesundheitsforen.net<br />
17.–21.<br />
September<br />
68. GMDS-Jahrestagung<br />
Heilbronn<br />
Das Motto der diesjährigen<br />
Tagung der Deutschen<br />
Gesellschaft für Medizinische<br />
Informatik, Biometrie und<br />
Epidemiologie (GMDS) lautet<br />
„Wissenschaft. Nah am Menschen“.<br />
Die internationalen<br />
Keynotes und Diskussionen setzen<br />
sich mit sechs Schwerpunktthemen<br />
auseinander, etwa<br />
„Human Factors in Health“.<br />
www.gmds2<strong>02</strong>3.de<br />
Impressum<br />
#2 / 2<strong>02</strong>3<br />
Herausgeber: DHD Digital Health Development AG, Stolkgasse 25–45,<br />
D-50667 Köln, mail@dhd.ag, Tel. +49 <strong>02</strong>21 466 884-0<br />
Vorstand: Detlef Koenig, detlef.koenig@dhd.ag<br />
Chefredakteurin: Dr. Gudrun Westermann,<br />
gudrun.westermann@newhealth.guide<br />
Redaktion und Gestaltung: Storyboard GmbH, Wiltrudenstraße 5,<br />
D-80805 München<br />
Anzeigen: Thomas Müller, thomas.mueller@newhealth.guide<br />
Druck: Druckerei Laub GmbH & Co KG, Brühlweg 28, D-74834 Elztal-Dallau<br />
Copyright: © DHD Digital Health Development AG 2<strong>02</strong>3; alle Rechte<br />
vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit schriftlicher<br />
Genehmigung des Herausgebers.<br />
Handelsnamen: Die Wiedergabe von Handelsnamen, Warenbezeichnungen<br />
usw. auch ohne besondere Kennzeichnung berechtigt nicht zu der Annahme,<br />
dass solche Namen frei und von jedermann benutzt werden dürften. Für den<br />
Inhalt außerhalb des redaktionellen Teiles (insbes. Anzeigen, Industrieinformationen<br />
usw.) übernehmen Redaktion und Herausgeber keine Gewähr.<br />
Autoren, die mit vollem Namen genannt werden und nicht Mitglied der<br />
Redaktion sind, veröffentlichen ihren Beitrag in alleiniger Verantwortung.<br />
Datenschutzinformation: Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzrechts<br />
ist Acxiom Deutschland GmbH, Speicherstraße 57–59, 60327 Frankfurt<br />
am Main. Nähere Informationen auch zu unserer Datenschutzbeauftragten<br />
erhalten Sie unter: www.acxiom.de/datenschutz. Die Verarbeitung Ihrer<br />
Daten erfolgt auf Grundlage von Artikel 6 I 1 f) DSGVO, damit wir Ihnen<br />
interessengerechte Informationen und Angebote zukommen lassen<br />
können. Wenn Sie künftig keine Informationen des werbenden Unternehmens<br />
erhalten möchten, wenden Sie sich bitte direkt an dieses Unternehmen.<br />
Einen generellen Widerspruch zur Verarbeitung Ihrer Daten für<br />
Werbezwecke können sie an die Acxiom Deutschland GmbH richten.<br />
Weitere Informationen:<br />
www.newhealth.guide<br />
FOTO: BIG BANG HEALTH/CAROLINE SCHLÜTER<br />
30
Hör’ mal!<br />
JETZT<br />
ABONNIEREN<br />
NEW<br />
HEALTH<br />
PODCAST<br />
Überall da, wo<br />
es Podcasts<br />
gibt<br />
magazin podcast website<br />
newsletter<br />
www.newhealth.guide<br />
IHR WEG IN DAS DIGITALE GESUNDHEITSSYSTEM
POLYTOUCH ®<br />
FLEX21.5 HEALTHCARE<br />
DAS PATIENTENTERMINAL AM POINT OF CARE<br />
VERSCHIEDENE MONTAGEOPTIONEN<br />
OPTIMIERT FÜR DAS GESUNDHEITSWESEN<br />
DATENSCHUTZ-KONFORM<br />
Jetzt mehr erfahren unter:<br />
www.pyramid-computer.com/healthcare<br />
Pyramid Computer GmbH | Boetzinger Strasse 60 | D-79111 Freiburg<br />
+49 761 4514 0 | sales@pyramid.de | www.pyramid-computer.com