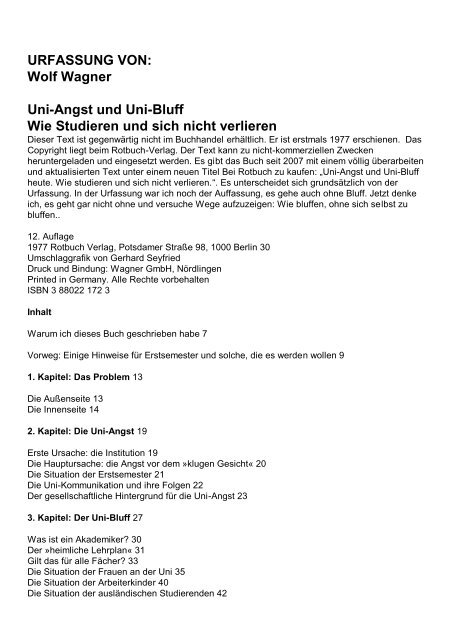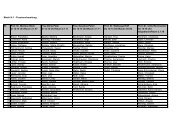URFASSUNG VON: Wolf Wagner Uni-Angst und Uni-Bluff Wie ...
URFASSUNG VON: Wolf Wagner Uni-Angst und Uni-Bluff Wie ...
URFASSUNG VON: Wolf Wagner Uni-Angst und Uni-Bluff Wie ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
<strong>URFASSUNG</strong> <strong>VON</strong>:<br />
<strong>Wolf</strong> <strong>Wagner</strong><br />
<strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> <strong>und</strong> <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong><br />
<strong>Wie</strong> Studieren <strong>und</strong> sich nicht verlieren<br />
Dieser Text ist gegenwärtig nicht im Buchhandel erhältlich. Er ist erstmals 1977 erschienen. Das<br />
Copyright liegt beim Rotbuch-Verlag. Der Text kann zu nicht-kommerziellen Zwecken<br />
heruntergeladen <strong>und</strong> eingesetzt werden. Es gibt das Buch seit 2007 mit einem völlig überarbeiten<br />
<strong>und</strong> aktualisierten Text unter einem neuen Titel Bei Rotbuch zu kaufen: „<strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> <strong>und</strong> <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong><br />
heute. <strong>Wie</strong> studieren <strong>und</strong> sich nicht verlieren.“. Es unterscheidet sich gr<strong>und</strong>sätzlich von der<br />
Urfassung. In der Urfassung war ich noch der Auffassung, es gehe auch ohne <strong>Bluff</strong>. Jetzt denke<br />
ich, es geht gar nicht ohne <strong>und</strong> versuche Wege aufzuzeigen: <strong>Wie</strong> bluffen, ohne sich selbst zu<br />
bluffen..<br />
12. Auflage<br />
1977 Rotbuch Verlag, Potsdamer Straße 98, 1000 Berlin 30<br />
Umschlaggrafik von Gerhard Seyfried<br />
Druck <strong>und</strong> Bindung: <strong>Wagner</strong> GmbH, Nördlingen<br />
Printed in Germany. Alle Rechte vorbehalten<br />
ISBN 3 88022 172 3<br />
Inhalt<br />
Warum ich dieses Buch geschrieben habe 7<br />
Vorweg: Einige Hinweise für Erstsemester <strong>und</strong> solche, die es werden wollen 9<br />
1. Kapitel: Das Problem 13<br />
Die Außenseite 13<br />
Die Innenseite 14<br />
2. Kapitel: Die <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> 19<br />
Erste Ursache: die Institution 19<br />
Die Hauptursache: die <strong>Angst</strong> vor dem »klugen Gesicht« 20<br />
Die Situation der Erstsemester 21<br />
Die <strong>Uni</strong>-Kommunikation <strong>und</strong> ihre Folgen 22<br />
Der gesellschaftliche Hintergr<strong>und</strong> für die <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> 23<br />
3. Kapitel: Der <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> 27<br />
Was ist ein Akademiker? 30<br />
Der »heimliche Lehrplan« 31<br />
Gilt das für alle Fächer? 33<br />
Die Situation der Frauen an der <strong>Uni</strong> 35<br />
Die Situation der Arbeiterkinder 40<br />
Die Situation der ausländischen Studierenden 42
Wer den Erfolg erwartet, erlebt ihn auch! 43<br />
Die Prüfung: Was wird da eigentlich geprüft? 44<br />
Erfolg <strong>und</strong> Mißerfolg: Was bedeutet das? 46<br />
Die gesellschaftliche Funktion des <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong>s 49<br />
... <strong>und</strong> wie ist das an der Massenuniversität? 51<br />
4. Kapitel: <strong>Wie</strong> sich wehren? 53<br />
Das Ziel: die <strong>Angst</strong> überwinden 53<br />
Gesellschaftliche Ursachen - oder: wo es lang gehen soll 57<br />
Gebrauchswert des Studiums: eigene Probleme lösen! 60<br />
Noch einmal Gebrauchswert des Studiums:<br />
Praxisbezug <strong>und</strong> Befreiung 63<br />
Über Schwierigkeiten beim Sichwehren 65<br />
5. Kapitel: Hochschuldidaktik auch für Lehrende 74<br />
6. Kapitel: <strong>Wie</strong> wissenschaftliches Arbeiten<br />
Spaß machen kann 84<br />
Drei Gr<strong>und</strong>prinzipien:<br />
Erstens - den Respekt vor der Wissenschaft verlieren 85<br />
Zweitens - die geistige Arbeit in Handarbeit verwandeln 87<br />
Drittens - sich Erfolgserlebnisse verschaffen 89<br />
<strong>Wie</strong> lesen? 89<br />
Die Arbeit an einem größeren Thema 93<br />
Die Literatursuche 94<br />
<strong>Wie</strong> lesen, ohne zu lesen 96<br />
Das Schreiben 98<br />
<strong>Wie</strong> Prüfungen überstehen 100<br />
7. Kapitel: Chaos als Prinzip 103<br />
(Nachtrag zur 8. Auflage)<br />
Verzeichnis der angeführten Literatur 111<br />
Nachtrag 115<br />
Warum ich dieses Buch geschrieben habe<br />
Ich habe sieben Jahre lang an verschiedenen <strong>Uni</strong>versitäten <strong>und</strong> in einer ganzen Latte von<br />
Fächern herumstudiert. Anfangs als CDU-Mitglied <strong>und</strong> in deprimierender Einsamkeit. Damals<br />
trugen auch noch beinahe alle Studenten Krawatten an der <strong>Uni</strong>. In Bonn z. B. habe ich manchmal<br />
wochenlang mit niemandem geredet außer vielleicht mal in der Mensa: »Kann ich bitte das Salz<br />
haben?« Dann 1967 <strong>und</strong> danach habe ich in Berlin die Studentenbewegung mitgemacht, bin links<br />
geworden <strong>und</strong> habe dabei viele Verkrampfungen verloren <strong>und</strong> Anschluß an solidarisch arbeitende<br />
Gruppen gewonnen. In der Auseinandersetzung mit den autoritären Profs, dem ganzen<br />
Wissenschaftsbetrieb, unter dem ich zuvor so sehr gelitten hatte, <strong>und</strong> in dem Bemühen etwas zu<br />
finden, was wir dem entgegensetzen könnten, lernte ich am wissenschaftlichen Arbeiten Spaß<br />
haben <strong>und</strong> hatte dann auch prompt noch das Glück, 1970 nach meinem Diplom eine<br />
Assistentenstelle am Fachbereich Politische Wissenschaft der Freien <strong>Uni</strong>versität Berlin zu
ergattern. Dort bin ich seither Dozent <strong>und</strong> arbeite in einer Gruppe linker Dozenten <strong>und</strong><br />
Dozentinnen. Wir stehen dabei ständig vor den Problemen, die hier behandelt werden sollen.<br />
Unsere Lehrveranstaltungen mißlingen immer wieder, die Teilnehmer sind frustriert, bleiben weg,<br />
die Gruppen brechen auseinander, die Papiere sind lustlos <strong>und</strong> ohne das Interesse am Stoff, das<br />
wir erwecken wollten, zusammengekloppt. Wir reagieren darauf meist mit einer Mischung von<br />
Ärger über »die Studenten« <strong>und</strong> einem Verantwortungstaumel, der uns glauben macht, wir<br />
könnten es das nächste Mal durch vermehrte eigene Anstrengung schaffen. Zugleich erfahren wir<br />
bei Gesprächen mit Studentinnen <strong>und</strong> Studenten, wie sehr sie selbst unter der Situation leiden,<br />
wie ihnen der ganze Studienbetrieb immer unerträglicher wird <strong>und</strong> immer sinnloser erscheint trotz<br />
aller ursprünglichen Freude über den Beginn des Studiums <strong>und</strong> aller Mühe, die sie zu Beginn<br />
eines jeden Semesters immer wieder aufs neue aufwenden. Viele von ihnen machen einen ganz<br />
verlorenen Eindruck: sie haben nicht nur die Orientierung auf ein Ziel hin, sie haben sich oft<br />
tatsächlich selbst verloren. Sie rennen überall gegen eine Wand der Sinnlosigkeit <strong>und</strong> des<br />
Mißerfolges <strong>und</strong> sind sich ihrer selbst völlig unsicher, spielen aber gleichzeitig sich selbst <strong>und</strong><br />
anderen die sichere, lockere Überlegenheit vor. Mit der Arbeit an diesem Buch will ich auch mir<br />
selbst klarzumachen versuchen, warum das so ist <strong>und</strong> was dagegen getan werden kann. <strong>Wie</strong><br />
man das möglich machen kann: studieren <strong>und</strong> sich nicht verlieren.<br />
7<br />
Dieses Buch kann aber nicht eine Einführung in die Arbeitsmethoden deines Faches sein. Dazu<br />
mußt du ein Buch lesen oder eine Veranstaltung besuchen, wo die speziellen Probleme <strong>und</strong><br />
Erfahrungen mit dem Fach auch vom Anspruch her behandelt werden. Ich habe versucht, so weit<br />
wie möglich die allgemeinen Probleme anzusprechen, die in allen Fächern <strong>und</strong> an allen<br />
<strong>Uni</strong>versitäten auftreten. Ich bin aber sicher, daß vieles durch meine speziellen Erfahrungen <strong>und</strong><br />
meine sozialwissenschaftliche Sichtweise geprägt ist. An diesen Stellen vertraue ich darauf, daß<br />
du meine Erfahrungen auf die Verhältnisse deiner <strong>Uni</strong> <strong>und</strong> deines Faches übertragen kannst.<br />
Inzwischen ist dieses Buch einige Zeit im Verkauf. Dabei habe ich aus einer Reihe von kritischen<br />
Anmerkungen gemerkt, wo der Text zu Mißverständnissen Anlaß gibt <strong>und</strong> wo grobe Fehler<br />
stecken. Deshalb habe ich an einigen Stellen, wo das drucktechnisch möglich war, den Text<br />
verändert (größere Veränderungen hätten bedeutet, daß der ganze Text neu hergestellt werden<br />
müßte). Ein besonders schwerwiegendes Mißverständnis, das durch den vorliegenden Text tat<br />
sächlich leicht produziert werden kann, war durch solche kleine Änderungen aber nicht<br />
auszuschließen. Ich möchte deshalb gleich vorweg davor warnen: Wenn der Eindruck entsteht,<br />
ich wollte behaupten, die ganzen Schwierigkeiten an der <strong>Uni</strong> entstünden alleine dadurch, daß die<br />
Leute nicht ehrlich genug oder gar nicht »nett« genug miteinander umgehen, dann ist das<br />
selbstverständlich Quatsch! Die Konkurrenz um den Erfolg an dieser Institution erzeugt die<br />
Verhaltensweisen, die für sie typisch sind. Diese Konkurrenz wird noch vielfach angeheizt durch<br />
die drohende Akademikerarbeitslosigkeit <strong>und</strong> die Studienreform von oben mit Regelstudienzeit,<br />
Kurzstudium, Verschulung <strong>und</strong> Ordnungsrecht samt drohendem Berufsverbot für alle, die sich<br />
konsequent wehren. Das wird in den Flugblättern <strong>und</strong> Denkschriften zur aktuellen<br />
Hochschulentwicklung zu Recht hervorgehoben <strong>und</strong> auch oft sehr gut <strong>und</strong> detailliert dargestellt.<br />
Mir kommt es hier aber darauf an, nicht nur eine weitere Analyse zu liefern, die bloß zeigt, wie wir<br />
von allen Seiten umstellt sind, daß wir sowieso nichts mehr machen können. Mir kommt es darauf<br />
an zu fragen: <strong>Wie</strong> können wir uns im <strong>Uni</strong>alltag wehren <strong>und</strong> nicht nur bei den großen<br />
hochschulpolitischen Aktionen.<br />
Berlin, Oktober 1978
P. S.: Die Klammerausdrücke im Text (Autorenname, Jahreszahl, Seitenzahl) verweisen auf die<br />
Buch- bzw. Aufsatz-Titel im alphabetisch geordneten »Verzeichnis der angeführten Literatur« (S.<br />
103-106).<br />
8<br />
Vorweg: Einige Hinweise für Erstsemester <strong>und</strong> solche, die es werden wollen<br />
Dieses Buch soll eigentlich helfen, sich durch die <strong>Uni</strong>versität nicht mehr einschüchtern zu lassen.<br />
Die Gefahr ist aber, daß bei allen, die noch keine längere Zeit an der <strong>Uni</strong> waren, genau das<br />
Gegenteil erreicht wird. Die ersten drei Kapitel müssen dann fremd <strong>und</strong> bedrohlich wirken. Die<br />
Situation in der Schule, sowohl im ersten wie im zweiten Bildungsweg, ist ganz anders als in der<br />
<strong>Uni</strong>. In der Schule kennen sich alle gegenseitig <strong>und</strong> wissen, was sie voneinander zu halten <strong>und</strong><br />
zu erwarten haben. Die Anforderungen sind einigermaßen überschaubar. Es ist ganz klar, wofür<br />
gelernt wird, nämlich für die Schule, für die Noten <strong>und</strong> die Numerus-clausus-Hürde.<br />
In der <strong>Uni</strong> ist das in den meisten Studienfächern überhaupt nicht mehr so klar: In jeder<br />
Veranstaltung triffst du auf andere Leute, <strong>und</strong> kaum hast du dich an sie gewöhnt, ist das<br />
Semester vorbei, <strong>und</strong> im nächsten sind es wieder ganz andere. Der Stoff <strong>und</strong> die Anforderungen<br />
sind unüberschaubar <strong>und</strong> scheinen unendlich. Die Noten <strong>und</strong> Abschlußprüfungen sind zwar<br />
wichtig, aber stehen lange nicht so im Zentrum, denn du hast dir ja ein besonderes Fach gewählt,<br />
weil du da hoffentlich einen besonderen Sinn drin sahst <strong>und</strong> weil du damit später einen Beruf<br />
ausfüllen willst. Da wird dann das Gefühl wichtig, wirklich etwas Sinnvolles zu lernen. Dabei weißt<br />
du aber nicht so richtig, was nun sinnvoll ist <strong>und</strong> was nicht.<br />
All das bringt eine Menge Schwierigkeiten mit sich, die in den ersten drei Kapiteln beschrieben<br />
<strong>und</strong> in ihren Folgen ausführlich dargestellt werden. Für Leute, die das alles schon selbst längere<br />
Zeit erlebt haben, ist das nicht erschreckend. Im Gegenteil, es zeigt ihnen, daß sie nicht allein<br />
sind mit ihren Schwierigkeiten, daß es nicht an ihrem individuellen Versagen liegt. Für<br />
Studienanfänger kann das ganz anders sein: Das ist nichts Bekanntes, in dem du dich<br />
verstanden fühlst, sondern erscheint als Drohung mit den Schwierigkeiten, die du vielleicht auch<br />
haben wirst. Laß dich beim Lesen aber nicht einschüchtern, denn diese Schwierigkeiten sind<br />
nicht unabwendbar wie das Wetter vom morgigen Tag. Du kannst selbst etwas dagegen tun,<br />
schon vom ersten Tag des Studiums an.<br />
Das wichtigste ist: Du mußt dich mit anderen zusammentun! Am besten gleich zu zweit oder zu<br />
dritt von der Schule aus oder vom Heimatort aus an das Studium rangehen. Wenn das nicht geht,<br />
quatsch jemanden an, der genauso verloren rumsteht wie du, <strong>und</strong> zusammen sucht euch weitere<br />
Leute. Wenn du das auch nicht bringst, dann geh in die Studienberatung aller politischen<br />
Gruppen <strong>und</strong> aller offiziellen Stellen an deinem Institut -solange, bis du zu<br />
9<br />
sammen mit anderen Studierenden beraten wirst, mit denen du ins Gespräch kommst.<br />
Das ist auch schon das nächstwichtigste: Besuch alle Studienberatungen, die es überhaupt gibt.<br />
Und wenn in einer etwas anderes gesagt wird als in anderen, dann frag nach: Anderswo hat man<br />
mir aber gesagt ... ! Das Ziel dabei muß sein, herauszufinden: Was sind die offiziellen<br />
Minimalvoraussetzungen an Scheinen <strong>und</strong> Leistungen im Gr<strong>und</strong>studium (erste 4 Semester) <strong>und</strong><br />
für die Gewährung des Bafög? Um das Hauptstudium <strong>und</strong> erst recht die Prüfungsordnungen<br />
solltest du dich überhaupt noch nicht kümmern. Es gibt keinen schnelleren Weg zur Depression
als das Lesen von Examensanforderungen (die sind purer <strong>Bluff</strong>, <strong>und</strong> es gibt niemanden, der sie je<br />
erfüllt hat - also vorerst nicht lesen!).<br />
Weiter ist wichtig: Wenn du herausgef<strong>und</strong>en hast, was die Minimalanforderungen in deinem Fach<br />
(oder in deinen Fächern) für das erste Semester sind, dann beleg <strong>und</strong> besuch nur die. Frag<br />
andere aus höheren Semestern, <strong>und</strong> sie werden dir alle erzählen, daß sie im ersten Semester viel<br />
zuviel belegt <strong>und</strong> besucht haben <strong>und</strong> bald gemerkt haben, was für ein Quatsch das ist. Du<br />
verzettelst dich da nur <strong>und</strong> lernst nirgendwo was Richtiges. Also nur das absolut vorgeschriebene<br />
Minimum besuchen <strong>und</strong> belegen - das ist in vielen Fächern schon mehr als du wirklich schaffen<br />
kannst. Denn es ist entscheidend, daß du in den Veranstaltungen auch wirklich von der ersten<br />
Sitzung an intensiv mitarbeitest <strong>und</strong> dazwischen die Sitzungen gründlich vorbereitest. Nimm dir<br />
also auf jeden Fall die Zeit, das zu lesen, was von einer Sitzung zur anderen zur Lektüre<br />
empfohlen wird.<br />
Es ist sehr schwierig, in den Plenarsitzungen etwas zu sagen vor all den Leuten, die du nicht<br />
kennst <strong>und</strong> die alle so klug gucken. Laß dich da aber nicht einschüchtern <strong>und</strong> unter<br />
Leistungsdruck setzen mit: »Was ich sage, muß aber einschlagen <strong>und</strong> Niveau haben!« Wenn du<br />
so anfängst, blockierst du dich von Anfang an selbst. Du kannst dann vor Anstrengung gar nicht<br />
mehr denken. Dabei weiß auch noch niemand, was nun eigentlich Niveau ist, außer daß es heißt,<br />
besser zu sein als die anderen. Diese Art Konkurrenz macht aber alles gründlich kaputt.<br />
Es ist wirklich sehr schwierig, im Plenum ehrlich <strong>und</strong> ohne das Gefühl zu reden, sich anders<br />
darstellen zu müssen als man sich fühlt. Es ist deshalb auch keine Katastrophe, wenn du im<br />
ersten Semester kaum jemals was im Plenum sagst. Wichtiger ist es, daß du in der Arbeitsgruppe<br />
mitdiskutierst. Vielleicht könnt ihr da vereinbaren, euch gegenseitig beim Gruppenbericht fürs<br />
Plenum abzulösen. Wenn du nicht mehr weiter weißt, kann ein anderes Mitglied der<br />
Arbeitsgruppe einspringen, so wie vorher vereinbart. Das passiert jetzt auch immer öfter bei<br />
Vollversammlungen, wo es noch viel schwieriger ist, vor all den Leuten zu reden: Da gehen eben<br />
zwei hoch ans<br />
10<br />
Mikrofon <strong>und</strong> helfen sich gegenseitig. Auf diese Weise wird die <strong>Angst</strong>schwelle abgebaut, <strong>und</strong> mit<br />
der Zeit wird es zur gewohnten Sache. Ein guter Anfang ist es auch, das erste Mal (wenn möglich<br />
schon in der ersten Sitzung) irgend etwas Technisches zu fragen, etwa: »<strong>Wie</strong>viel Seiten muß<br />
denn so ein Referat haben?« Dann ist es das nächste Mal schon viel leichter, eine Frage zum<br />
Stoff zu stellen. Wenn es in der Veranstaltung Arbeitsgruppen gibt, dann ist das zuerst einmal<br />
gut. <strong>Wie</strong> es dann läuft, hängt ganz wesentlich auch von dir ab! Sorg dafür, daß die Gruppe sich<br />
jede Woche regelmäßig trifft, daß ihr mehrere St<strong>und</strong>en Zeit habt sowohl für die Arbeit am Fach,<br />
aber auch für persönliches <strong>und</strong> allgemeines Ausquatschen. Besprich mit den anderen in der<br />
Arbeitsgruppe schon am Anfang, was sie sich von der Arbeit erwarten. Mach dir selbst <strong>und</strong> den<br />
anderen deine eigene Zielsetzung ganz klar, <strong>und</strong> wenn es da erhebliche Unterschiede gibt <strong>und</strong><br />
wenn ihr mehr als fünf seid, dann teilt die Gruppe lieber auf. Vereinbart einen festen Termin <strong>und</strong><br />
besteht darauf, daß von Anfang an alle pünktlich kommen. Nichts ist so ärgerlich <strong>und</strong> auf die<br />
Dauer sprengend wie die ewige Warterei der einigermaßen Pünktlichen auf die anderen. Und bei<br />
der Arbeit am Stoff vergeßt in der Gruppe nicht: Ihr seid keine Akkordgruppe zur Erlangung eines<br />
Scheines, sondern ihr wollt zusammen ein Problem lösen, das euch interessiert. Dazu müßt ihr<br />
aber auch über euch selbst reden <strong>und</strong> dürft euch nicht voreinander hinter dem Stoff verstecken.<br />
Schon in der ersten Sitzung solltet ihr in einer Kneipe reihum über euch selbst erzählen. Im<br />
weiteren Verlauf müßt ihr mit Vorrang über Schwierigkeiten in der Gruppe, Aggressionen,<br />
Konkurrenzgefühle etc. reden (in den drei letzten Kapiteln des Buches könnt ihr darüber Näheres
lesen). Wenn ihr so vorgeht <strong>und</strong> euch einigermaßen dabei leiden könnt, dann wird aus euch<br />
vielleicht sogar ein Studienkollektiv. Das heißt: Ihr lauft nicht nach erfüllter Scheinanforderung<br />
auseinander, sondern ihr überlegt euch, welche Veranstaltung ihr gemeinsam im folgenden<br />
Semester besuchen könntet <strong>und</strong> bearbeitet eure Studienprobleme <strong>und</strong> politischen Aktivitäten<br />
über längere Zeit gemeinsam.<br />
Wenn du nun wirklich dem Rat gefolgt bist <strong>und</strong> tatsächlich das Minimum dessen belegt hast <strong>und</strong><br />
besuchst, was von dir im ersten Semester verlangt wird, dann hast du - im Gegensatz zu den<br />
meisten anderen Erstsemestern -genügend Zeit gewonnen, um die <strong>Uni</strong> im Laufe des ersten<br />
Semesters wirklich kennenzulernen: Du kannst deiner Neugier vollen Lauf lassen. Du kannst die<br />
meisten politischen Veranstaltungen besuchen (möglichst zusammen mit anderen, vielleicht<br />
sogar mit deiner Arbeitsgruppe, damit ihr hinterher darüber diskutieren könnt) <strong>und</strong> dir ein Bild<br />
davon machen, was sich hinter all den Abkürzungen <strong>und</strong> großen Sprüchen verbirgt. Du kannst<br />
die verschiedenen Veranstaltungen an deinem Institut, die dir vom Titel her interessant<br />
erscheinen, einfach einmal besuchen (eben nur mal<br />
11<br />
für eine Sitzung mit hineinsitzen <strong>und</strong> zuhören - da hat niemand was dagegen) <strong>und</strong> sehen, ob der<br />
Dozent oder die Dozentin so ist, daß du Lust hast, da mal irgendwann etwas zu machen. Und du<br />
kannst - was sehr wichtig ist - die Bibliotheksführungen <strong>und</strong> Informationsveranstaltungen für<br />
Erstsemester mitmachen. Da erhältst du gute <strong>und</strong> wichtige technische Hinweise für dein Studium,<br />
die in aller Regel in den Erstsemesterübungen trotz aller Versprechungen nicht gegeben werden.<br />
Z. B. wie du ein Buch ausleihst, wie du selbständig wichtige Literaturtitel zu einem Thema finden<br />
kannst, das dich interessiert, wo du fotokopieren kannst <strong>und</strong> wo im Lesesaal die wichtigen<br />
Nachschlagwerke stehen. (Informier dich dabei auch über die zentrale <strong>Uni</strong>versitätsbibliothek, also<br />
nicht nur über die Einrichtungen an deinem Institut.) Ohne diese - auf den ersten Blick<br />
oberflächlichen <strong>und</strong> bloß technischen - Informationen geht das Studieren nicht, das ist das<br />
wichtigste Handwerkszeug.<br />
12<br />
Erstes Kapitel<br />
Das Problem<br />
Die Außenseite<br />
Von der Erscheinung her, von außen gesehen, sieht die <strong>Uni</strong>versität eigentlich ganz idyllisch aus.<br />
Wenn ich versuchen würde, typische Aufnahmen von der <strong>Uni</strong> zu machen, kämen wahrscheinlich<br />
solche Bilder zustande: Ein grüner Rasen mit jungen Leuten, die herumliegen <strong>und</strong> sich<br />
unterhalten oder lesen. Dazwischen auf den Wegen gehen andere zielstrebig, aber ohne<br />
besondere Eile zu den verschiedenen Gebäuden, wahrscheinlich zu irgendwelchen Hörsälen<br />
oder Bibliotheken. Oder aber: In einem etwas kahlen Raum sitzen dieselbe Art selbstbewußt <strong>und</strong><br />
überlegen aussehender junger Leute entspannt an einem Kreis von Tischen. Sie hören zu, wie<br />
einige diskutieren, notieren sich gelegentlich etwas, <strong>und</strong> je nach Lust <strong>und</strong> Laune stehen sie auf<br />
<strong>und</strong> gehen. Dann das andere Bild: Der eng gezogene, rauchige Lichtkreis einer<br />
Schreibtischlampe irgendwann lange nach Mitternacht, darin der überquellende Aschenbecher,<br />
die Kaffeetasse mit den unzähligen eingetrockneten Kaffeekreisen auf der Untertasse <strong>und</strong><br />
dazwischen ein Chaos von aufgeschlagenen Büchern, Karteikarten <strong>und</strong> Notizzetteln. Und dazu<br />
das Bild vom Aufstehen am nächsten Tag nach zwölf. Selbst das immer wieder gezeigte<br />
Schreckensbild vom völlig überfüllten Riesenhörsaal, wo die Zuhörer <strong>und</strong> Zuhörerinnen sogar auf<br />
Treppen <strong>und</strong> auf dem Boden dicht gedrängt sitzen, sieht von außen gar nicht so schrecklich aus:
Eigentlich machen die Leute einen ganz lockeren <strong>und</strong> sicheren Eindruck, schauen interessiert<br />
oder skeptisch drein, <strong>und</strong> schließlich weiß man ja, daß sie da freiwillig sitzen in der Erwartung,<br />
etwas Interessantes zu lernen. Bei diesen Bildern stellt sich die Frage: Weshalb das Gerede von<br />
»<strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong>«?<br />
Erst recht idyllisch sieht die <strong>Uni</strong>versität aus, wenn sie aus der Perspektive Gleichaltriger gesehen<br />
wird, die nicht studieren, sondern ein »normales« Leben führen. Ob sie ihren Lebensunterhalt am<br />
Fließband, in einer Werkstatt, im Laden oder am Schreibtisch verdienen, sie müssen morgens<br />
raus <strong>und</strong> ihre acht oder mehr St<strong>und</strong>en runterreißen, nach fremden Anweisungen <strong>und</strong> unter<br />
ständiger Kontrolle. Sie können sich glücklich schätzen, wenn wenigstens Teile ihrer Arbeit<br />
interessant sind <strong>und</strong> sie selbst entscheiden können, wann <strong>und</strong> wie sie die festgesetzten Aufgaben<br />
erledigen. Da gibt es kein morgens-liegen-bleiben-bis-zwölf <strong>und</strong> kein: »Ich hab' heut keinen<br />
Bock«. Und wenn einem die Arbeit, die Kollegen <strong>und</strong> der Chef noch so stinken, wenn die ganze<br />
Situation voller <strong>Angst</strong> steckt, da muß<br />
13
man doch jeden Morgen ran <strong>und</strong> es durchstehen oder eine andere Arbeit suchen - die dann<br />
vielleicht noch schlimmer ist.<br />
Sicher: Sie haben mehr Geld <strong>und</strong> einen besseren Lebensstandard als die meisten Studierenden.<br />
Aber selbst wenn diese nach dem Examen einige Zeit arbeitslos sind <strong>und</strong> danach nicht einmal<br />
ihrer Ausbildung entsprechend beschäftigt werden, selbst unter diesen schlechtesten Umständen<br />
ist zu erwarten, daß sie in der Pyramide der Jobs wegen ihrer höheren Allgemeinqualifikation die<br />
obere Hälfte besetzen werden. In diesen Jobs haben sie dann eine ganz andere<br />
Lebensperspektive als die Gleichaltrigen mit industriellen Arbeitsplätzen. Industriearbeiterinnen<br />
<strong>und</strong> Arbeiter können ab dem vierzigsten Lebensjahr nur noch einem Abstieg entgegensehen, <strong>und</strong><br />
zwar einem Abstieg in jeder Hinsicht, ges<strong>und</strong>heitlich, finanziell <strong>und</strong> auch in bezug auf Inhalt <strong>und</strong><br />
Prestige der Arbeit. Dagegen ist es bis jetzt bei Akademikern genau umgekehrt: Mit wenigen<br />
Ausnahmen wächst ihr Einkommen, das Prestige ihrer Tätigkeit mit der Zeit. Je älter sie werden,<br />
desto mehr steigen sie auf <strong>und</strong> desto gesicherter wird ihre Position. Sie leben denn auch im<br />
Durchschnitt um zehn Jahre länger als gleichaltrige Industriearbeiter (Angaben der<br />
Lebensversicherungen). So gesehen erscheinen die Studierenden eindeutig privilegiert.<br />
Die Innenseite<br />
Das ist aber nur die eine Seite. Die einzige, die von außen <strong>und</strong> aus der Entfernung zu sehen ist.<br />
Sie ist der Gr<strong>und</strong> für die vielen erbitterten Kommentare, die uns vom Straßenrand bei<br />
Demonstrationen zugerufen werden. Schaut man näher hin, dann zeigt sich die andere, die<br />
innere Seite der Studiensituation: »Von h<strong>und</strong>erttausend Studenten begehen jährlich<br />
durchschnittlich 25 Studenten Selbstmord, aber vergleichsweise nur 19 Personen der<br />
Altersgruppe 18-30 Jahre« (Morgenstern, 1972, S. 28). Bei Studentinnen ist das sogar noch<br />
krasser (Lungershausen, 1969, S. 105). Die Anzahl der Selbstmorde <strong>und</strong> Selbstmordversuche<br />
nimmt dabei noch ständig zu. Eine Untersuchung über die Selbstmordmotive zeigt, daß<br />
Studienschwierigkeiten <strong>und</strong> Kontaktarmut meist die entscheidende Ursache waren (Friedrich,<br />
1974, S. 220 f.).<br />
Viele andere, die nicht diesen selbstzerstörerischen Ausweg nehmen, leiden dennoch schwer<br />
unter dem Studium. Sie haben Depressionen, Minderwertigkeitsgefühle, sehen keinen Sinn mehr<br />
<strong>und</strong> sind völlig arbeitsunfähig. So berichtet eine psychotherapeutische Beratungsstelle einer<br />
<strong>Uni</strong>versität: »Geklagt wird z. B. über Verstimmbarkeit <strong>und</strong> Erschöpfbarkeit bei<br />
Konzentrationsaufgaben; über Kopfschmerzen, Schwindel <strong>und</strong> Schweißausbruch bei der Lektüre<br />
von Lehrbüchern, über Unrast, Merkfähigkeitseinbuße, Lust<br />
14<br />
losigkeit, allgemeine Mattigkeit <strong>und</strong> Schlafbeeinträchtigung. Man könne es allein in seiner Bude<br />
nicht mehr aushalten, die Decke stürze ein, man brauche Menschen um sich oder Radiomusik.<br />
Andere spüren keinen Antrieb mehr, erwachen morgens bleischwer, bleiben lange liegen <strong>und</strong><br />
ziehen sich am Abend bald wieder mit schlechtem Gewissen ins Bett zurück, weil sie den Tag<br />
hindurch nichts hinter sich bringen konnten. Die Zukunft bedrückt sie wie ein Berg. Häufig ist das<br />
Gefühl der Sinnlosigkeit, der allgemeinen tiefen Skepsis über den Zweck <strong>und</strong> die<br />
Verwendungsmöglichkeiten des aufgespeicherten Wissensstoffes, dessen gesellschaftliche<br />
Nutzanwendung dunkel blieb. Der Einstieg in komplexere Fachprobleme gelingt dann immer<br />
schwerer <strong>und</strong> unwilliger; die innere Distanz zum Studienobjekt wächst <strong>und</strong> lähmt dann das<br />
Engagement, sich mit innerer Anteilnahme einem mühsamen Lernprozeß hinzugeben, der in die<br />
Irre zu führen droht« (Böker, 1969, S. 140).
Keil (1973, S. 56) berichtet, daß jeder zweite Studierende im Studium Kontakt oder Klarheit<br />
vermißt. Und immer mehr geben freiwillig die äußerlich gesehen so privilegierte Situation auf <strong>und</strong><br />
brechen das Studium ab, weil sie es nicht mehr aushalten (Saterdag/Apenburg, 1972, S. 5). Für<br />
die meisten Studierenden sehen denn auch die Bilder, die ich vorhin beschrieben habe, ganz<br />
anders aus: Die da geschäftig auf den Wegen herumwuseln, wissen nicht, was sie in der<br />
Veranstaltung oder in der Bibliothek eigentlich sollen, was ihnen das bringt, <strong>und</strong> fühlen sich so<br />
isoliert, daß sie neidisch sind auf diejenigen, die sich auf dem Rasen so locker zu unterhalten<br />
scheinen, trauen sich aber nicht, sich dazuzusetzen. Die auf dem Rasen sind aber gar nicht so<br />
locker wie sie scheinen, sondern spielen das nur, während sie sich voller Konkurrenz entweder<br />
»geistreich« unterhalten oder »auf hohem Niveau« diskutieren. Eine Studentin im ersten<br />
Semester fragte mich deshalb einmal ganz erstaunt: »Warum können sich die Studenten<br />
eigentlich nicht einmal im Erfrischungsraum wie normale Menschen unterhalten? Warum müssen<br />
sie selbst da noch über Einschätzungen, Politik <strong>und</strong> Großes reden?« Einige Zeit später sagte sie:<br />
»Die <strong>Uni</strong> macht mich ganz anders als ich auf der Schule war. Sie macht mich traurig <strong>und</strong><br />
verkrampft. Ich war mir noch nie so fremd!« Kurz danach hat sie das Studium abgebrochen.<br />
Dann das Bild mit den Leuten, die so locker an den Tischen sitzen <strong>und</strong> zuhören, wie andere<br />
diskutieren: Es wird oft genug nicht über den Stoff diskutiert, sondern der Stoff ist nur ein Mittel,<br />
um herauszufinden, wer akzeptiert ist, wer »Bescheid weiß«, wer sich durchsetzen kann. Die<br />
scheinbar interessiert zuhören <strong>und</strong> mitschreiben, überlegen sich in Wirklichkeit angespannt <strong>und</strong><br />
voller <strong>Angst</strong>, was sie selbst sagen könnten. Vor lauter Anstrengung, etwas wirklich Bedeutendes<br />
zu sagen, kriegen sie überhaupt nichts mehr heraus, werden immer stiller oder hauen - je nach<br />
Durchhaltevermögen<br />
15<br />
frustriert ab. Dabei geben sie sich aber den Anschein, als ob sie darüber stünden, als ob sie<br />
keine Lust mehr hätten, weil »es sowieso nichts bringt«. Von innen sieht das so aus: »Ich fange<br />
an, mir meine Gedanken vorzuformulieren. Ich kann gar nicht mehr zuhören vor lauter Aufregung.<br />
( ... ) Ich denke, so, jetzt, jetzt, jetzt. Ich sage es nicht. Jetzt - ich kann es nicht sagen. ( ... ) Ich<br />
ärgere mich. Ich will mich in den Griff kriegen. Mein Gott, ich bin doch kein blutiger Anfänger. Ich<br />
möchte wissen, was sie über mich denken, so wie ich hier herumsitze. Ob die mich für doof<br />
halten. Mir fallen Situationen ein, in denen ich mitgearbeitet habe. Situationen in kleineren<br />
Arbeitsgruppen, in denen ich teilweise sogar dominiert habe. Da ist mir eine Idee gekommen <strong>und</strong><br />
ich habe sie gesagt, ganz impulsiv.<br />
Vielleicht habe ich das Referat nicht verstanden, denke ich noch, <strong>und</strong> wenn ich jetzt was sage,<br />
stöhnen alle, <strong>und</strong> ihre Blicke sagen mir, das hat der doch in seinem Vortrag schon erklärt. Ich<br />
überlege hin <strong>und</strong> her. Kann ich das überhaupt vertreten? Da gibt's ja 1000 Gegenargumente. Mir<br />
wird immer heißer. ( ... ) Das Belächeln, fällt mir ein, das mache ich auch manchmal. Einer sagt<br />
was, ich finde es doof <strong>und</strong> grins mir einen ab. Aber vielleicht ist das genau die Reaktion, die man<br />
als Legitimation dafür braucht. Daß man selbst in einer solchen Situation nichts sagt, was nicht<br />
hieb- <strong>und</strong> stichfest ist. ( ... ) Ich bin nur noch vier St<strong>und</strong>en in der Woche als Studentin in der <strong>Uni</strong>.<br />
Das ist wirklich so, als würdest du ab <strong>und</strong> zu mal zum Zahnarzt gehen. Gleich unangenehm«<br />
(aus: Klöckner, 1977).<br />
Auch das Bild vom nächtlichen Referat-Schreiben, auf den ersten Blick beinahe symbolhaft für<br />
völliges Versunkensein in der Arbeit, sieht von innen ganz anders aus. Da wird so spät nachts<br />
noch gearbeitet, weil den ganzen Tag über ungeheuer »wichtige« andere Sachen wie Aufräumen,<br />
Briefe schreiben, Einkaufen etc. dazu benutzt wurden, sich vor der Arbeit zu drücken. Und erst<br />
wenn es wirklich nicht mehr anders ging <strong>und</strong> eigentlich auch schon viel zu spät war, hat sie oder<br />
er sich an die Arbeit gesetzt. Jetzt aber schon mit ungemein schlechtem Gewissen, <strong>und</strong> zum
Ausgleich hat sie oder er sich vorgenommen, jetzt aber besonders viel wegzuarbeiten. Das ist<br />
aber schon wieder so viel, daß es in einer Nacht überhaupt nicht zu schaffen ist.<br />
Oft genug kommt dann noch Bier oder Wein mit auf den Schreibtisch, weil sonst der Frust<br />
überhaupt nicht auszuhalten wäre. Mit dem Frust wird aber auch gleich der Rest an<br />
Arbeitsfähigkeit weggeschwemmt. Wenn dann die Müdigkeit die Zeilen endgültig verschwimmen<br />
läßt, dann werden die nicht erfüllten Vorsätze mit noch gewaltigeren Vorsätzen für den folgenden<br />
Tag ausgeglichen. Und deshalb kommt sie oder er am nächsten Tag auch nicht aus dem Bett:<br />
Der Berg der guten Vorsätze lastet jetzt erst recht, macht das Aufstehen <strong>und</strong> nachher das<br />
Anfangen beinahe unmöglich - wieder die Flucht in alle möglichen »wichtigen« anderen<br />
Aufgaben. Dieser<br />
16<br />
Teufelskreis von schlechtem Gewissen <strong>und</strong> entlastenden »guten« Vorsätzen macht für viele den<br />
Berg immer lastender <strong>und</strong> größer, die Ausweichstrategien immer raffinierter, bis sie nur noch auf<br />
eine mehr oder weniger schlimme Art ausflippen können.<br />
Dazu ein Beispiel aus der psychotherapeutischen Beratungsstelle der <strong>Uni</strong>versität Göttingen: »Ein<br />
Student der Germanistik <strong>und</strong> einer alten Sprache (Griechisch) kommt wegen akuter<br />
<strong>Angst</strong>zustände <strong>und</strong> Arbeitsstörungen in die Beratungsstelle. Die <strong>Angst</strong>zustände, unter denen er<br />
seit Wochen andauernd leidet <strong>und</strong> die schon einmal vor einem Jahr kurzfristig bestanden,<br />
gleichen einer Verkrampfung, gegen die man sich intellektuell nicht wehren könne. Wenn im<br />
Seminar allgemeine Fragen gestellt würden, verspüre er den Drang, wegzulaufen, immer<br />
getrieben von dem Gefühl, daß sein Wissen auf keinem Gebiet ausreiche. Nur bei reinen<br />
Fachfragen sei das anders. ( ... ) Er könne sich nicht mehr konzentrieren <strong>und</strong> müsse sich ständig<br />
zwingen, etwas für sein Studium zu tun. Er schweife aber dauernd ab, wenn er ein Fachbuch<br />
lese. Bei jedem Tun habe er mit dem Gefühl zu kämpfen, eigentlich etwas anderes vordringlich<br />
machen zu müssen« (Sperling, Jahnke, 1974, S. 128).<br />
Ein anderes Beispiel: »Ein 22jähriger Zahnmediziner, der kurz vor dem Physikum wegen<br />
schwerer Konzentrationsstörungen <strong>und</strong> >innerer Müdigkeit< mit zur Panik gesteigerter <strong>Angst</strong> vor<br />
der Prüfung in die Sprechst<strong>und</strong>e kommt <strong>und</strong> sich auch mit Suizidgedanken trägt. Seine<br />
Überzeugung, das Einfachste nicht mehr leisten zu können, da er z. B. beim Lernen zwanghaft<br />
jedem Nebengedanken nachgehen muß <strong>und</strong> ihm bald die Buchstaben vor den Augen<br />
verschwimmen, kontrastiert mit höchsten Ansprüchen. Alles bisher Geleistete scheint ihm wertlos.<br />
Eine unproduktive zerstreute Unruhe treibt ihn durch Kaufhäuser <strong>und</strong> Straßen, immer >auf der<br />
Suche nach dem großen Losalle< ganz isoliert von >allen< herumsitzen) <strong>und</strong> weil es da um den<br />
»neuesten Stand der Diskussion« geht (obwohl niemand das versteht, was die wenigen sagen,<br />
die da mitreden) - kurz: es ist ein Albtraum, <strong>und</strong> es ist nicht verw<strong>und</strong>erlich, daß solche Bilder nur<br />
zu Semesteranfang entstehen können, denn dann bleiben die Leute weg.<br />
Viele - wenn nicht gar die meisten - Studierenden sind also gar
17<br />
nicht fähig, ihre »privilegierten« Arbeitsbedingungen zu nutzen, d. h. aus ihrem Studium etwas<br />
gesellschaftlich Sinnvolles <strong>und</strong> persönlich Befriedigendes zu machen. Geradezu beispielhaft<br />
dafür schreibt eine Gruppe Studenten aus Gießen: »Wir, die wir nun seit einigen Wochen den<br />
Status von Studenten besitzen, haben gehofft, daß sich damit in unserem Leben etwas ändert.<br />
Wir hatten es satt, uns durch Elternhaus <strong>und</strong> Schule dressieren zu lassen. (...) Wir haben gehofft,<br />
daß der Übergang zur <strong>Uni</strong>versität unser Dasein verändert, uns Möglichkeiten eröffnet,<br />
selbständig denken, lernen <strong>und</strong> leben zu lernen.<br />
Wer das gehofft hat, ist nun schon nach einigen Wochen eines >Besseren< belehrt worden. Wir<br />
sitzen in überfüllten Hörsälen <strong>und</strong> Seminarräumen, die mit Menschen gefüllt sind, die wir nicht<br />
kennen <strong>und</strong> auch nicht kennenlernen können unter diesen Umständen. Wir sitzen eng<br />
nebeneinander, ohne zu wissen, wer der andere neben uns ist, was er fühlt <strong>und</strong> denkt, welche<br />
Probleme er hat. Wir riskieren mal einen scheuen Seitenblick, mehr nicht.<br />
Wir hören uns Monologe von Professoren, Assistenten <strong>und</strong> älteren Studenten über Themen an,<br />
von denen sie glauben, daß sie uns interessieren müßten. Wir lassen Seminare über uns<br />
ergehen, deren Strukturen von vornherein verhindern, daß wir mitdiskutieren können, daß wir<br />
unsere Interessen <strong>und</strong> Bedürfnisse artikulieren. Wir können unseren Lebenszusammenhang nicht<br />
vernünftig organisieren, da die fast stündlich wechselnden Lehrinhalte, die unseren Interessen,<br />
Bedürfnissen <strong>und</strong> Problemen jeweils äußerlich bleiben, unseren Alltag völlig zersplittern. Wir<br />
trösten uns damit, daß wir nach Lektüre einiger Kubikmeter Bücher später einmal an die Stelle<br />
derer treten, die uns heute unterdrücken, um dann unsererseits den Anfängern ihre Ohnmacht<br />
vor Augen zu führen.<br />
Wir haben uns nach langem Suchen in Zimmer pressen lassen, die klein <strong>und</strong> zu teuer sind, die<br />
uns voneinander isolieren, so daß wir abends die Platzangst kriegen, weil wir niemand kennen,<br />
mit dem wir sprechen können...<br />
Von all den Veränderungen, die wir uns von dem Eintritt in die <strong>Uni</strong>versität erhofft haben, ist nichts<br />
oder kaum etwas eingetroffen. Wir werden genauso fremdbestimmt weiter vor uns hinleben wie<br />
bisher, wir werden Prüfungen <strong>und</strong> Examina über uns ergehen lassen, die dazu da sind, zu<br />
überprüfen, wie weit unsere Selbstaufgabe <strong>und</strong> unsere Anpassung an die Gesellschaft gediehen<br />
ist.« (Eisenberg, Thiel, 1973, S. 155 f.).<br />
Dieses Auseinanderklaffen von dem, was eigentlich an der <strong>Uni</strong> möglich sein könnte, <strong>und</strong> dem,<br />
was wirklich während des Studiums passiert, ist das zentrale Problem der <strong>Uni</strong>versität, das<br />
deswegen auch hier im Mittelpunkt stehen soll.<br />
18<br />
Zweites Kapitel<br />
Die <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong><br />
Erste Ursache: die Institution<br />
In den meisten Fächern gibt es Studienpläne, die festlegen, wieviel Scheine gemacht <strong>und</strong> welche<br />
Veranstaltungen besucht werden müssen. Und doch ist es durchaus unsicher, ob die dort<br />
erworbenen Kenntnisse dann auch für die Prüfung ausreichen. Was die Institution wirklich fordert,
ist meist trotz aller Studienpläne ungewiß. Die Prüfungsanforderungen sind Kataloge, die dir<br />
ganze Berge von Wissen abfordern. Unterhältst du dich aber einmal mit Leuten, die die Prüfung<br />
schon hinter sich haben, dann findest du bald heraus, daß sie nie so praktiziert wird wie sie auf<br />
dem Papier festgelegt ist. In den meisten Fächern ist es auch völlig unklar, was eigentlich für eine<br />
spätere Berufstätigkeit in dem Bereich des Faches an Anforderungen erfüllt werden soll, um den<br />
Aufgaben gewachsen zu sein, vor die du dann gestellt bist. Die Institution <strong>Uni</strong>versität macht also<br />
normalerweise überhaupt nicht klar, was du über die formalen Minimalanforderungen hinaus<br />
leisten mußt, um in ihr bestehen zu können.<br />
Sie kümmert sich aber auch nicht um die Erwartungen der Studierenden. In einer Umfrage<br />
wurden diese gefragt, was sie sich vom Studium erhofft hatten <strong>und</strong> ob sich diese Hoffnungen<br />
erfüllt hatten. Die drei hauptsächlichen Erwartungen waren: die Hoffnung, auf einen interessanten<br />
Beruf vorbereitet zu werden; diejenige, durch das Studium die persönlichen Fähigkeiten<br />
weiterentwickeln zu können, <strong>und</strong> die Hoffnung auf eine praxisbezogene theoretische Ausbildung<br />
(Infratest, 1974, S. 20 ff.). Alle drei Erwartungen sind nach den Angaben der Befragten bitter<br />
enttäuscht worden.<br />
Überall dort, wo die eigenen Erwartungen nicht erfüllt werden, die Anforderungen der Institution<br />
aber auch unklar sind, muß bei den Studierenden ein Gefühl der Sinnlosigkeit entstehen, denn<br />
die Studieninhalte schweben in der Luft. Auch noch so angestrengte Arbeit läßt ein Gefühl<br />
zurück, eigentlich nichts »Wesentliches geleistet zu haben« (Saterdag, Apenburg, 1972, S. 139).<br />
Mit den wachsenden Studentenzahlen <strong>und</strong> den gleichzeitigen Mittelstreichungen greift dieses<br />
institutionelle Chaos aber immer mehr um sich. Es erfaßt nach <strong>und</strong> nach auch bisher privilegierte<br />
Fächer in den Naturwissenschaften <strong>und</strong> in der Medizin <strong>und</strong> sogar so abliegende Bereiche wie<br />
Altgriechisch <strong>und</strong> Theaterwissenschaften. Sie alle werden zu »Massenfächern«: ungenügende<br />
Ausstattung, keine klaren wissenschaftlichen <strong>und</strong> gesellschaftlichen Anforderungen, keine<br />
individuelle, wissenschaftliche Betreuung <strong>und</strong> Anleitung vom<br />
19<br />
Beginn des Studiums an. Bereits 1969 beschrieb eine Untersuchung den Betrieb in solchen<br />
Fächern: Die Ziellosigkeit <strong>und</strong> Ineffektivität führe zu Unsicherheit <strong>und</strong> Kommunikationsmangel.<br />
Das Studium ziehe sich in die Länge <strong>und</strong> sei durchweg mit <strong>Angst</strong> verb<strong>und</strong>en, weil nie klar würde,<br />
was nun die Anforderungen seien <strong>und</strong> wie sie erfüllt werden könnten. So hätte über die Hälfte der<br />
Befragten das Gefühl, nie ausreichend in die Arbeitsmethoden ihres Faches eingeführt worden zu<br />
sein (Jenne u. a., 1969, S. 316 f.). Unter solchen Bedingungen kann die Studiensituation<br />
tatsächlich nur noch als »Streß-Situation« erlebt werden. Statt Lust an der Arbeit <strong>und</strong> Einsicht in<br />
den Sinn aller Studienschritte erzeugt sie nur das Gegenteil: Entfremdung, Einsamkeit <strong>und</strong> <strong>Angst</strong>.<br />
Die Hauptursache: die <strong>Angst</strong> vor dem<br />
»klugen Gesicht«<br />
So sehr die <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> durch die sinnentleerten <strong>und</strong> chaotischen institutionellen Bedingungen<br />
begünstigt wird, die hauptsächliche Ursache für ihr Entstehen liegt im Verhältnis der<br />
Studierenden zueinander. Die erste Sitzung eines Seminars im Semester sieht zum Beispiel für<br />
die meisten so aus: Da kommst du rein in einen Raum voller Gesichter, die dir völlig fremd sind,<br />
über die du nichts weißt, die dich aber angucken, <strong>und</strong> du mußt dich wie selbstverständlich<br />
dazwischen setzen (wenn noch ein Platz frei ist bei dem Gedränge). Sitzt du erst mal, dann<br />
schaust du dir ebenfalls die Gesichter von denen an, die reinkommen <strong>und</strong> auch von denen, die<br />
schon dasitzen. Und es beeindruckt dich, wie selbstbewußt <strong>und</strong> locker die aussehen. Auf den
Gedanken kommst du gar nicht, daß es denen genauso gehen könnte wie dir. Denn du siehst ja<br />
nicht den Eindruck, den du nach außen machst. Du spürst nur deine eigene Unsicherheit.<br />
Dieses Beeindrucktsein ist der Moment, in dem dich die <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> anspringt. Du siehst nicht<br />
anders aus als die anderen, <strong>und</strong> doch bist du für sie <strong>und</strong> sind sie für dich »das kluge Gesicht«.<br />
Ein Gesicht, das seine <strong>Angst</strong> nicht zeigt, sondern diese durch betont selbstverständliches,<br />
lockeres <strong>und</strong> sicheres Auftreten überspielt. Es wird sofort zur Projektionsleinwand für all die<br />
unbestimmten Anforderungen <strong>und</strong> Erwartungen, die wir alle in unserer Lebensgeschichte<br />
angesammelt haben. Alle Bereiche, wo du das Gefühl hast, versagt zu haben oder irgendwelchen<br />
wirklichen oder vermuteten Anforderungen nicht gerecht zu werden, all das wird jetzt von dir als<br />
Forderung von den »klugen Gesichtern« abgelesen. Denn die sehen so aus, als ob sie all das<br />
ohne Probleme hinkriegen, wo du zu versagen meinst. Sie werden deshalb als lebendiger Beweis<br />
für die Richtigkeit <strong>und</strong> Gültigkeit dieser Anforderung erlebt.<br />
20<br />
Ist diese Projektion einmal gelaufen, dann hat sich die Situation ganz entscheidend verändert.<br />
Jetzt sind sie nämlich nicht mehr etwas Eigenes, dessen Geschichte - <strong>und</strong> damit auch dessen<br />
Fragwürdigkeit - man auf die Spur kommen könnte, sondern sie sind etwas Selbständiges,<br />
Fremdes <strong>und</strong> Mächtiges geworden: jetzt sind sie die Erwartungen der anderen an dich.<br />
All das passiert noch bevor die »klugen Gesichter« angefangen haben zu reden. Von außen<br />
gesehen hat sich eigentlich noch überhaupt nichts Bedeutendes ereignet. Studentinnen <strong>und</strong><br />
Studenten sind in einen Seminarraum gegangen <strong>und</strong> warten auf den Dozenten oder auf die<br />
Dozentin. Und trotzdem ist die Hauptsache schon gelaufen.<br />
Denn alles, was du in dieser Situation noch sagen kannst - wenn sie dich nicht schon stumm<br />
gemacht hat -, muß sich an den so wahrgenommenen Erwartungen der anderen messen. Daß es<br />
deine eigenen Erwartungen, diejenigen der Eltern <strong>und</strong> Geschwister aus der Vergangenheit <strong>und</strong><br />
ein ganzer Knäuel anderer verinnerlichter Anforderungen sind, die einfach auf die anonymen<br />
Anderen übertragen worden sind, das merkst du nicht mehr. Denn das Verhalten <strong>und</strong> das Denken<br />
in der <strong>Uni</strong> wird nur selten rational bestimmt, sondern durch die <strong>Angst</strong> vor dem »klugen Gesicht«,<br />
von der <strong>Angst</strong> davor, was die anderen über dich denken. Und selbst wenn du es im Kopf weißt,<br />
wie das läuft - bis in den Bauch, dorthin, wo die <strong>Angst</strong> sitzt, reicht dieses Wissen nicht.<br />
Der Gedanke, die anderen könnten dich für naiv oder unwissend halten, ist unerträglich. Schon<br />
zugeben zu müssen, daß du ein Buch nicht gelesen hast, das »man eigentlich drauf haben<br />
müßte«, ist schwer genug <strong>und</strong> halbe Blamage. So sind Gespräche über neue Bücher ein<br />
besonderes Ritual: Einer sagt: »Kennst du das Buch so<strong>und</strong>so? Das mußt du unbedingt lesen, das<br />
ist stark. Ich kann es dir gerne mal leihen.« Dann reicht die Palette der Möglichkeiten, wie du<br />
diese Aussage aufnimmst, vom Ausdruck einer Hilfsbereitschaft bis zum Eindruck, daß der dich<br />
eigentlich etwas dumm findet, weil du das Buch noch nicht kennst (Sienknecht, 1976, S. 37).<br />
Die Situation der Erstsemester<br />
Für sie ist alles fremd <strong>und</strong> bedrohlich an der <strong>Uni</strong>. Weil sie in dieser fremden Welt als<br />
Gleichwertige akzeptiert sein wollen, haben sie ganz besonders <strong>Angst</strong> sich zu blamieren <strong>und</strong><br />
bemühen sich angestrengt, sich wie »normale« Studierende zu verhalten. Dazu müßten sie aber<br />
die Wissenschaftssprache mit ihren unzähligen Fremdwörtern <strong>und</strong> feststehenden<br />
Redewendungen schon können. Sie müßten die vielen Abkürzungen <strong>und</strong> die gegensätzlichen<br />
politischen Richtungen mit ihren Parolen drauf haben <strong>und</strong> auch schon
21<br />
dieses vorsichtig-skeptische Über-alles-reden-können beherrschen. Deshalb wird das erste<br />
Semester eine Zeit, in der sich die Schüler <strong>und</strong> Schülerinnen von einst mit ungeheurer<br />
Geschwindigkeit in Studentinnen <strong>und</strong> Studenten verwandeln, in den Äußerungsformen, in der<br />
Sprache, in der Kleidung, dem politischen Verständnis, der Wohnungseinrichtung. Der Motor für<br />
diesen erstaunlich schnellen Lernprozeß ist die <strong>Angst</strong> vor der Isolation, in der die Erstsemester<br />
stecken <strong>und</strong> in die sie jedes überlegene Lächeln eines höheren Semesters weiter hineintreibt.<br />
Auch wenn mit der gelungenen Anpassung an das <strong>Uni</strong>-Milieu die Kontakte häufiger werden, so<br />
bleibt die Anonymität <strong>und</strong> die Isolierung doch eines der zentralen Studienprobleme. Über 30 %<br />
aller Studierenden sagen von sich selbst, sie hätten Kontaktschwierigkeiten (Teuwsen, 1975, S.<br />
251). Jedoch auch bei denen, die bei sich selbst solche Schwierigkeiten nicht sehen, verläuft die<br />
Kommunikation in einer für die <strong>Uni</strong>versität spezifischen Form: Weil der Kontakt mit der <strong>Angst</strong> vor<br />
der Blamage <strong>und</strong> der Zurückweisung belastet ist, wird er über »unverdächtige« Umwege gesucht.<br />
»Oft ist die Frage nach der Bibliothek, dem Seminar usw. ein Vorwand, Kontakt aufzunehmen ( ...<br />
) Eigene Ziele <strong>und</strong> Zwecke der Kommunikation bleiben oft im unklaren. Diese Art der<br />
Kontaktaufnahme bringt eine Unverbindlichkeit zwischen den Personen mit sich, die bei<br />
Studienanfängern das Gefühl der Isolation mehr <strong>und</strong> mehr verstärkt. Die sachbezogene<br />
Kommunikation zwischen Studenten hat zur Folge, daß selbst persönliche Probleme <strong>und</strong><br />
Schwierigkeiten auf einer abstrakten, von der eigenen Person abgehobenen Ebene artikuliert<br />
werden« (Bull, Weber-Unger, 1976, S. 59 f.).<br />
Die <strong>Uni</strong>-Kommunikation <strong>und</strong> ihre Folgen<br />
Diese sachlich-distanzierte Art zu reden, mit der die Blamage vermieden werden soll, erlaubt nie<br />
die Erfahrung, daß auch ohne schlimme Folgen auf ganz andere Art geredet werden kann. Die<br />
<strong>Angst</strong> vor dem »klugen Gesicht« <strong>und</strong> vor den projizierten Leistungserwartungen bleibt also auch<br />
dann erhalten, wenn du dich in die <strong>Uni</strong>-Situation eingewöhnt hast. Jede auch noch so belanglose<br />
Gesprächssituation wird so zu einer Prüfung, ob du die Erwartungen der anderen erfüllt hast. Die<br />
<strong>Angst</strong> davor, in dieser Prüfung durchzufallen, ist nur zu verständlich. Scheint es doch so, als ob<br />
das den Verlust auch noch dieser entfremdeten Kommunikationsmöglichkeiten nach sich ziehen<br />
würde. Diese sind aber, so verkrüppelt sie auch sein mögen, für das Selbstbewußtsein, die<br />
Arbeitsfähigkeit, für das psychische Wohlbefinden an der <strong>Uni</strong>versität zentral: Die Arbeit am Stoff<br />
allein kann kaum die notwendige Sicherheit geben. Du brauchst dazu das Gespräch. Erst recht in<br />
solchen<br />
22<br />
Fächern, wo es keine festdefinierten Wahrheiten gibt, sondern der größte Teil des Lernprozesses<br />
über Diskussionen <strong>und</strong> Gespräche läuft. Wer also aus der <strong>Uni</strong>-Kommunikation herausfällt, droht<br />
auch aus der <strong>Uni</strong> insgesamt herauszufallen.<br />
So klagten Studierende, die das Fach gewechselt oder das Studium ganz abgebrochen hatten,<br />
besonders häufig über das schlechte Sozialklima (Saterdag, Apenburg, 1972, S. 118). Bei all<br />
denjenigen, die in ihrer bisherigen Lebensgeschichte Ansätze von psychischen Labilitäten<br />
herausgebildet haben, kann die Isolation in der <strong>Uni</strong>Kommunikation »wie der Schlüssel ins<br />
Schloß« dieser psychischen Störung passen <strong>und</strong> sie bis zum katastrophalen Zusammenbruch<br />
aufschaukeln (Mahler, 1971, S. 7).
Aber auch ohne solche schwerwiegenden Folgen sind Kontaktschwierigkeiten <strong>und</strong> die Anonymität<br />
der <strong>Uni</strong>-Kommunikation bedrohlich genug. Kaum jemand kann längere Zeit ohne Anerkennung,<br />
Selbstbestätigung <strong>und</strong> Wärme leben, ohne daß sich schwere Störungen im Selbstwertgefühl <strong>und</strong><br />
wachsende Arbeitsschwierigkeiten aus einem Gefühl der Leere <strong>und</strong> Sinnlosigkeit entwickeln<br />
(Moeller, Scheer, 1974, S. 42).<br />
Die Kommunikations-Situation in der Cafeteria oder im scheinbar lockeren Gespräch, das in<br />
Wirklichkeit als Prüfung erlebt wird, ist aber nur die abgeschwächte Folge der eigentlich<br />
traumatischen <strong>Uni</strong>-Situation: der wissenschaftlichen Diskussion im Seminar. Die sieht so aus: Da<br />
sitzen Leute im Kreis um einen Tisch <strong>und</strong> werfen »Diskussionsbeiträge« auf diesen Tisch, sie<br />
»bringen sie ein«, »geben ein Votum ab«. Manche dieser Diskussionsbeiträge werden von<br />
anderen »aufgenommen«, indem sie »darauf eingehen« oder »sich darauf beziehen«. Einige<br />
wenige »kommen ganz besonders gut an«. Alle reden darüber, erwähnen den Beitrag. Es kommt<br />
zu einem »regen Gedankenaustausch«. Andere Diskussionsbeiträge bleiben unbeachtet auf dem<br />
Tisch liegen. Die sie eingebracht haben, konnten ihre Position »nicht gut verkaufen«. Von ihnen<br />
kommen daraufhin auch immer seltener <strong>und</strong> immer kürzere Diskussionsbeiträge, bis sie sich ganz<br />
zurückziehen.<br />
Der gesellschaftliche Hintergr<strong>und</strong> für die <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong><br />
Die formale Struktur dieser Seminar-Kommunikation, wo alle versuchen, mit ihrem<br />
Diskussionsbeitrag möglichst gut anzukommen, gleicht auf frappante Weise der Gr<strong>und</strong>struktur<br />
der kapitalistischen Gesellschaft.<br />
23<br />
Die kleinen Kreise - im Seminar die Diskutierenden, die ihren Beitrag auf den Tisch bringen -<br />
bedeuten im vereinfachten Modell der Warengesellschaft die einzelnen Produzenten <strong>und</strong><br />
Warenbesitzer, die ihre Ware auf den Markt bringen - der große Kreis, der im Seminar für den<br />
Tisch steht.<br />
Die äußerliche Übereinstimmung ist, so behaupte ich, kein Zufall. Wer sich in dem Kreis<br />
erfolgreich reproduzieren will, wer es zu etwas bringen will, egal ob an der <strong>Uni</strong> oder auf dem<br />
Warenmarkt, der muß Marktgängiges produzieren <strong>und</strong> in den Kreis einbringen. Weiter behaupte<br />
ich, daß sich aus dieser Übereinstimmung der gesellschaftliche Hintergr<strong>und</strong> für die <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong><br />
besser verstehen läßt.<br />
Um diese Behauptungen einsichtig machen zu können, muß ich zuerst auf einige<br />
Gr<strong>und</strong>verhältnisse des Warenaustausches eingehen: Ob es den Warenbesitzern oder<br />
Produzenten gut geht oder schlecht, hängt letztlich davon ab, wie ihre Ware auf dem Markt<br />
ankommt. Sie kann für ihren eigenen Geschmack so gut sein wie sie wollen, nicht sie entscheiden<br />
darüber, wie sie sich verkauft, sondern die anderen Teilnehmer des Marktes. Die<br />
Warenproduzenten müssen also immer versuchen, so gut wie möglich <strong>und</strong> so viel wie möglich zu<br />
produzieren. Ob sie das Zeug dann loswerden <strong>und</strong> damit Erfolg haben, darauf können sie nur<br />
hoffen.<br />
Dabei geschehen zwei Verwandlungen, die sich auch auf andere Bereiche auswirken, die nicht<br />
unmittelbar zum Warenmarkt gehören. Die erste macht aus dem Mann mit der großen roten Nase<br />
<strong>und</strong> vielen anderen persönlichen Eigenschaften einen abstrakten Warenbesitzer. Den Schuster<br />
erkennt man nicht mehr an seiner roten Nase, sondern daran, daß er Schuhe produziert <strong>und</strong>
verkauft. In einer Gesellschaft, in der das Überleben allein durch den Warenaustausch möglich<br />
ist, werden diese Waren zum Wichtigsten.<br />
Diese Verlagerung dessen, wofür man angesehen wird, von der Gesamtheit der persönlichen<br />
Eigenschaften auf das, was man produziert <strong>und</strong> besitzt, gibt es in Europa nun schon seit über<br />
fünfh<strong>und</strong>ert Jahren. In dieser Zeit hat sie sich selbstverständlich auch auf andere<br />
Verhaltensbereiche außerhalb des unmittelbaren Warenmarktes ausgewirkt. Das geht bis hin in<br />
die Erziehung der Kinder: Sie werden für ihre Leistungen belohnt, entweder ganz offen in einer<br />
Art Tausch mit Geschenken oder versteckter mit Zuwendung. Kindergarten, Schule <strong>und</strong> Beruf, sie<br />
alle befestigen dieses Verhalten, bestätigen <strong>und</strong> verstärken es: Du bist das, was du produzierst,<br />
was du bringst. Danach wirst du beurteilt, <strong>und</strong> dafür erhältst du Anerkennung, Selbstbestätigung<br />
<strong>und</strong> schließlich auch die Noten <strong>und</strong> das Geld. Dabei lernst du dann auch gründlich: Ob du das<br />
bekommst oder nicht, hängt keineswegs davon ab, wie du selbst das beurteilst, was du tust;<br />
entscheidend ist, wie die anderen darüber denken, die Eltern, Lehrer, Klassenkameraden. Du<br />
bekommst also mit der Er<br />
24<br />
ziehung das Gr<strong>und</strong>muster einer Verhaltensweise aufgeprägt, das genau dem Verhalten auf dem<br />
Markt entspricht. Diese Entsprechung ist durch jahrh<strong>und</strong>ertelange tagtägliche Praxis <strong>und</strong> durch<br />
die Erziehung von zig Generationen zur »Lebenstüchtigkeit« in einer warenproduzierenden,<br />
kapitalistischen Gesellschaft hervorgebracht worden <strong>und</strong> ist nicht bloße Analogie aus dem<br />
analysierenden Kopf. Sie existiert in der Wirklichkeit!<br />
Die zweite Verwandlung, die, ausgehend vom Marktverhalten, schließlich die universitäre<br />
Kommunikations-Situation prägt, macht die Produzenten in ihrem Verhalten völlig von den<br />
Erwartungen der anderen abhängig: Alle Anerkennung, alle Zuwendung <strong>und</strong> Selbstbestätigung<br />
läuft über das Produkt. Es ist aber durchaus unsicher, ob die einmal erbrachte Leistung sich auf<br />
dem Markt auch bewähren wird, ob die anderen die erwartete Zuwendung <strong>und</strong> Anerkennung<br />
dafür auch geben. Weil dies so unsicher ist, müssen sich die Diskussionsteilnehmer im Seminar<br />
genauso wie die Warenproduzenten in ihrer Leistung voll auf die anderen einstellen.<br />
Der Schuster muß immer damit rechnen, daß er auf seinen Schuhen sitzenbleibt <strong>und</strong> dann in der<br />
nächsten Produktionsperiode in Schwierigkeiten gerät. Er hat also allen Gr<strong>und</strong> zur <strong>Angst</strong> vor den<br />
Veränderungen am Markt. Dieselbe Unsicherheit stellt sich auch in den sozialen Beziehungen<br />
ein. Es ist durchaus ungewiß, ob man mit seiner Leistung ankommt, ob sie auf Anerkennung,<br />
Nichtbeachtung oder gar Ablehnung stößt. Zwar werden im Sozialverhalten keine Waren<br />
getauscht, keine Wertäquivalente in Geld <strong>und</strong> wieder neue Waren verwandelt. Es ist auch nicht<br />
so unmittelbar <strong>und</strong> materiell existenzgefährdend, wenn man mit seiner Leistung nicht ankommt,<br />
essen kann man dann immer noch. Aber ohne die Anerkennung <strong>und</strong> Zuwendung der anderen läßt<br />
sich auf die Dauer schwer leben. Und wenn sich Anerkennung in Ablehnung <strong>und</strong> Zuwendung in<br />
Feindlichkeit verwandelt, ist das Selbstwertgefühl <strong>und</strong> die Ich-Identität meist schwer gefährdet.<br />
Die Abhängigkeit vom Urteil der anderen über das, was ich leiste, erlebe ich immer als Urteil über<br />
mich als ganze Person. Auch ist meine Abhängigkeit von diesem Urteil durchaus der<br />
vergleichbar, in der sich der Warenproduzent gegenüber dem Markt befindet, denn auch ich muß<br />
»Marktgängiges« bringen, sei es im Seminar oder beim scheinbar »lockeren« Quatschen in der<br />
Cafeteria. Deshalb finde ich die Beschreibung von Duhm sehr treffend: »Warenbesitzer sind<br />
existenziell darauf angewiesen, den Tauschwert (d. h. den Gegenwert, W. W.) ihrer Waren zu<br />
realisieren. Zwei Schwierigkeiten sind dabei zu überwinden: Erstens muß die Ware einen Markt<br />
finden, sie muß also gesellschaftlich akzeptiert werden. Zweitens muß die Tauschwertrealisierung
durchgesetzt werden gegen die Konkurrenten, die ebenfalls ihre Tauschwerte realisieren wollen.<br />
Es sind dies zwei Momente existentieller Bedrohung ( ... )<br />
25<br />
Es ist die <strong>Angst</strong>, daß die Verwertung nicht gelingt, daß die soziale Anerkennung, die man sich<br />
einhandeln will, nicht erfolgt, die <strong>Angst</strong> vor gesellschaftlichem Liebes- <strong>und</strong> Existenzverlust (Duhm,<br />
1974, S. 94).<br />
Diese beiden Momente der Leistungsangst treten unter den Bedingungen der <strong>Uni</strong>versität<br />
besonders stark hervor. Die <strong>Angst</strong>, nicht zu wissen, was du leisten sollst, verstärkt <strong>und</strong> verkoppelt<br />
sich mit der <strong>Angst</strong>, das Geforderte nicht bringen zu können. Auf die sowieso meist schon weit<br />
überzogenen institutionellen Anforderungen der <strong>Uni</strong> türmen sich überall noch die vermuteten <strong>und</strong><br />
durch die Projektion auf die »klugen Gesichter« ins Gigantische aufgeblasenen<br />
Leistungserwartungen der Mitstudierenden. Du fühlst dich umstellt.<br />
In dieser Situation lernst du kaum jemals eine Person so gut kennen, daß ihr euch als Person mit<br />
ihren Schwächen <strong>und</strong> Stärken <strong>und</strong> ihrer Geschichte kennen <strong>und</strong> akzeptieren könnt.<br />
Normalerweise wirst du also nach ganz äußerlichen Gesichtspunkten beurteilt: wie du auftrittst,<br />
dich kleidest, was du sagst <strong>und</strong> tust - also nach dem, was du bringst <strong>und</strong> leistest. Die <strong>Angst</strong>, nur<br />
über die Leistung akzeptiert zu werden, ist für die <strong>Uni</strong>versitäts-Situation unvermeidlich. All das<br />
wird an der <strong>Uni</strong>versität aber dadurch zum Alptraum, weil dort noch am wenigsten klar ist, was nun<br />
eigentlich gefordert wird. Denn kaum irgendwo anders ist es so schwierig herauszufinden, was<br />
gerade »marktgängig« ist. Deshalb ist die Leistungsangst auch kaum irgendwo so groß wie an<br />
der <strong>Uni</strong>versität.<br />
26<br />
Drittes Kapitel<br />
Der <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong><br />
<strong>Angst</strong> haben ist eine so unangenehme Situation, daß sie niemand lange aushält, ohne dagegen<br />
Abwehrmechanismen zu entwickeln. Meist unbewußt werden Verhaltensweisen aufgebaut, die<br />
eine angstmachende Situation erst gar nicht entstehen lassen sollen. »Die allgemeinste Form der<br />
<strong>Angst</strong>abwehr ist die marktgerechte Ausstaffierung der eigenen Person, also die Anpassung. Die<br />
gesellschaftlich positiv bewerteten Eigenschaften werden herausgeputzt (Imponiergehabe), die<br />
negativen versteckt <strong>und</strong> verschleiert, aus der Kommunikation ausgeklammert, exkommuniziert«<br />
(Duhm, 1974, S. 126).<br />
Die »positiv bewerteten Eigenschaften« an der <strong>Uni</strong> sind: Bescheid wissen, Durchblick haben,<br />
über der Sache stehen, alles hinterfragen <strong>und</strong> einschätzen können. Als <strong>Angst</strong>abwehrfassade zum<br />
Imponiergehabe herausgeputzt geht das Positive, was in solchen Eigenschaften durchaus<br />
stecken kann, immer mehr verloren. Es wird nebensächlich <strong>und</strong> wird durch die Funktion ersetzt, ja<br />
nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, man erfülle die Leistungserwartungen nicht. Um die<br />
<strong>Angst</strong> vor diesen unerfüllbar überzogenen Erwartungen abzuwehren, tut man vielmehr so, als ob<br />
es überhaupt gar kein Problem wäre, sie zu erfüllen. Durch meine Sprache, mein Auftreten, durch<br />
mein ganzes Verhalten signalisiere ich: »Ich weiß Bescheid, beherrsche den Stoff genügend, um<br />
notfalls alles, was du dazu sagst, kritisch zerpflücken zu können. Fordere mich also nicht<br />
heraus!« In diesem - meist unbewußten - Verhalten steckt die Erfahrung, daß diese Fassade von<br />
Sicherheit <strong>und</strong> Überlegenheit den anderen genügend <strong>Angst</strong> macht. Sie wagen es dann<br />
tatsächlich nicht, mich herauszufordern.
Dieses Verhalten entspricht genau dem »<strong>Bluff</strong>« im Kartenspiel: Ich stelle mich als so stark dar,<br />
daß die anderen gar nicht wagen, nachzufragen, mitzureizen oder mich gar zum Aufdecken<br />
meiner Karten zu zwingen. Ich signalisiere mit meinem Verhalten: Das käme dich teuer zu stehen,<br />
denn ich würde sicher Sieger bleiben. Dabei ist es gar nicht so wichtig, ob meine Karten wirklich<br />
so stark sind oder ob ich nur so tue als ob. Entscheidend ist die Wirkung auf die anderen: Sie<br />
müssen so eingeschüchtert werden, daß sie den Test gar nicht erst wagen.<br />
Beim <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> ist das genauso. Nach meiner Erfahrung wird von denjenigen am meisten <strong>und</strong><br />
nachhaltigsten geblufft, die es eigentlich gar nicht nötig hätten, weil sie in dem Gebiet wirklich<br />
Bescheid wissen. Man nehme sich nur mal eine wissenschaftliche Zeitschrift<br />
27<br />
vor, in der sich die Professoren über Spitzfindigkeiten ihres Spezialgebietes streiten. Da wird in<br />
einer Sprache geschrieben, die vordergründig zwar einen Inhalt mitteilt, die aber vor allem<br />
ausdrückt: Hier bin ich souverän, hier kann mir keiner! Das Wissen wird nicht mit dem - eigentlich<br />
einzig sinnvollen -Ziel dargestellt, sich verständlich zu machen <strong>und</strong> andere lernen zu lassen. Statt<br />
dessen wird die Herrschaft über den Stoff als Mittel eingesetzt, um Herrschaft in der<br />
Kommunikation auszuüben. Diese Form des <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong>s ist am weitesten verbreitet <strong>und</strong> prägt alle<br />
anderen Formen. In ihr wird also keineswegs nur so getan »als ob«. Das wirklich vorhandene<br />
Wissen wird in einer Form präsentiert, die Überlegenheit <strong>und</strong> Unangreifbarkeit signalisiert.<br />
Die Dozenten <strong>und</strong> Dozentinnen haben diese Sprache während ihres eigenen Studiums <strong>und</strong> dann<br />
für ihre wissenschaftliche Karriere so gründlich lernen müssen, daß sie für sie meist zur völlig<br />
unbewußten Gewohnheit geworden ist. Sie benützen sie auch gegenüber Erstsemestern <strong>und</strong><br />
setzen damit für alle Studierenden Maßstäbe, die diese nur noch bewältigen können, wenn sie so<br />
tun, als ob auch sie Bescheid wüßten <strong>und</strong> den großen Durchblick hätten. Aus lauter <strong>Angst</strong> wird<br />
also so getan, als ob man die völlig unerfüllbaren Leistungserwartungen bereits erfüllt hätte.<br />
Dabei entstehen auß~r der bereits beschriebenen Sprache" die Überlegenheit <strong>und</strong><br />
Unangreifbarkeit signalisiert, folgende <strong>Bluff</strong>Formen: Der <strong>Bluff</strong>er formuliert allgemein <strong>und</strong><br />
unbestimmt. Er verweist pauschal durch Einstreuen von Namen auf ganze Wissensgebiete <strong>und</strong><br />
schwierigste theoretische Auseinandersetzungen mit dem Beteuern, daß er aus Platz- oder<br />
sonstigen Gründen leider nicht näher darauf eingehen könne. Oder aber: er beweist seine<br />
Wissenschaftlichkeit, indem er sich nie festlegt <strong>und</strong> sich immer ein Hintertürchen offen hält (»Ins<br />
unreine gesprochen«, »ich würde sagen wollen«). Dieses Offenhalten eines Rückzugweges (»So<br />
eindeutig habe ich das ja auch nicht gesagt!«) ist als <strong>Angst</strong>abwehrfassade im <strong>Bluff</strong> so wichtig,<br />
weil sich diejenigen, die auf diese Weise bluffen, trotz ihrer <strong>Angst</strong> langsam <strong>und</strong> vorsichtig in eine<br />
Kommunikationssituation hineintasten können. Sie können sich nach <strong>und</strong> nach immer mehr auf<br />
die Situation einlassen, Schritt für Schritt selbstbewußter <strong>und</strong> unbekümmerter auftreten wie im<br />
Winter beim ersten Eis auf dem See, wenn man ausprobiert, ob es trägt. Jedes bedenkliche<br />
Augenbrauenzucken des Gesprächspartners ist wie ein Knacken im Eis: schnell zurück ins<br />
Allgemeinere, Unbestimmtere, Vorsichtigere: »Sicher, man muß das differenzierter sehen, aber<br />
als Hypothese meine ich doch . . . «<br />
Ist jemand aber mal unvorsichtig gewesen, hat sich zu weit vorgewagt <strong>und</strong> wird auf einen Fehler<br />
festgelegt, ohne sich zurückziehen zu können, dann reagiert er nur zu leicht mit einer<br />
aggressiven <strong>Bluff</strong>-Form: Wenn er schon als jemand entlarvt ist, der nicht Be<br />
28
scheid weiß, dann zeigt er dem anderen, daß der erst recht nichts weiß! Auf einer Fahrt von<br />
Berlin nach Helmstedt stellte sich zum Beispiel bei einem Anhalter, den ich mitgenommen hatte,<br />
heraus, daß er in Berlin sein Politologie-Examen machen wollte. In dümmlicher Dozentenmanier<br />
fragte ich ihn, ob er denn schon das Kapital von Marx gelesen habe, das sei nämlich wichtig. Er<br />
verneinte das, fügte aber sofort hinzu, er wolle das aber jetzt in den Ferien machen. Voller<br />
grobklotziger Gutwilligkeit empfahl ich ihm daraufhin ein bestimmtes Buch als Begleitliteratur. Und<br />
in die Ecke getrieben antwortete er, der doch gerade eben erklärt hatte, daß er das Kapital nicht<br />
kenne.- Nein, dieses Buch tauge nichts, das interpretiere das Kapital viel zu hegelianisch <strong>und</strong><br />
idealistisch! Und ich begann natürlich sofort, meine Empfehlung zu verteidigen mit: ja, da sei<br />
schon was dran, aber andererseits ... Erst sehr viel später ging mir das Absurde dieser Situation<br />
auf.<br />
Alle Formen des <strong>Bluff</strong>s haben aber eines gemeinsam: Sie verschlimmern die Situation nur noch,<br />
sie verstärken den Leistungsdruck. Denn jetzt erscheinen die in Wirklichkeit unerfüllbaren<br />
Leistungserwartungen doch als »machbar«, <strong>und</strong> mit jedem neuen <strong>Bluff</strong> türmen sich wieder neue<br />
Leistungsdimensionen auf. Das Einschwenken auf den <strong>Bluff</strong> wird immer dringlicher.<br />
Im Augenblick der angstmachenden Situation hilft der <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> zwar durchaus als<br />
<strong>Angst</strong>abwehrfassade. Er hilft die Situation überleben. Gleichzeitig bestätigt <strong>und</strong> verstärkt er aber<br />
genau das, was die angstmachende Situation überhaupt erst erzeugt: die überzogenen<br />
Leistungsansprüche <strong>und</strong> die Kommunikationsform, die sich nicht mitteilen will, sondern nur<br />
Überlegenheit <strong>und</strong> Herrschaft darstellt. <strong>Angst</strong> <strong>und</strong> <strong>Angst</strong>abwehrfassade verstärken sich<br />
gegenseitig <strong>und</strong> schaukeln sich hoch bis zu dem Punkt, wo man entweder nur noch fliehen kann -<br />
in Arbeitsschwierigkeiten, in den Fachwechsel oder Studienabbruch, oder gar in Depression <strong>und</strong><br />
Selbstmord. Oder aber man lernt den <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> bis zur Perfektion <strong>und</strong> verinnerlicht die<br />
Verhaltensstrategien der <strong>Angst</strong>abwehrfassade so sehr, daß sie wie selbstverständlich als Teil der<br />
eigenen Persönlichkeit erscheinen: Man ist zum Akademiker oder zur Akademikerin geworden!<br />
Das sind jedenfalls die Alternativen, wenn man sich nicht gegen den <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> wehrt. Bevor ich<br />
darauf eingehe, will ich aber noch weiter untersuchen, wie der <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> normalerweise wirkt,<br />
welche Funktion er hat <strong>und</strong> was eigentlich dahinter steckt. Zuerst jedoch muß die Frage<br />
beantwortet werden:<br />
29
Was ist ein Akademiker?<br />
Es gibt darüber eine empirische Untersuchung aus Konstanz. In einer repräsentativen Umfrage<br />
wurde das Bild ermittelt, das sich die Bevölkerung vom »Akademiker« macht, <strong>und</strong> dann mit dem<br />
verglichen, was die von sich selbst denken. Vier Fünftel der Bevölkerung haben ganz besondere<br />
Vorstellungen über die Eigenschaften <strong>und</strong> Fähigkeiten von Leuten mit <strong>Uni</strong>versitätsabschluß:<br />
»Dieses Erwartungsbild konzentriert sich auf drei Komponenten: Bildungsstandard,<br />
Allgemeinbildung (64 %), Denkvermögen, Problemlösung, Urteilsfähigkeit (59 %),<br />
Ausdrucksvermögen, Formulierungsgabe (54 %).« Als weitere Eigenschaften wurden genannt:<br />
»Verantwortungsbewußtsein, bestimmte soziale Fähigkeiten wie Menschenkenntnis,<br />
Kontaktfähigkeit <strong>und</strong> die Fähigkeit Menschen zu führen, Entscheidungs- <strong>und</strong> Handlungsfähigkeit,<br />
dazu auch ein gewisser Stil im Benehmen <strong>und</strong> Umgangsformen (alle etwa 40 %). Aufgr<strong>und</strong><br />
solcher Qualifikationen wird dem Akademiker der Status einer >Führungsfigur< zugewiesen.<br />
Diese Zuweisung ist jedoch nicht gekoppelt mit einer ebenso ausgeprägten Erwartung, nach der<br />
Akademiker ihr Handeln stärker als andere am Allgemeinwohl orientieren würden (nur ca. 20 %).«<br />
(Framhein, 1975, S. 160)<br />
Diese scharfe Zuspitzung im Bild des typischen Akademikers auf elitäres Führungsverhalten, das<br />
sich um gesamtgesellschaftliche Belange kaum schert, wird noch deutlicher, wenn die<br />
Eigenschaften betrachtet werden, die nicht in das allgemeine Bild vom Akademiker eingehen: »Es<br />
sind dies vor allem praktische Momente wie Arbeitstechnik oder Organisationsfähigkeit <strong>und</strong><br />
Haltungen, die zuweilen als >Arbeitstugendem bezeichnet werden, wie etwa Arbeitsmotivation<br />
<strong>und</strong> Einsatzbereitschaft, Pflichtbewußtsein <strong>und</strong> Ehrlichkeit. Schließlich, als Einzelelemente<br />
bemerkenswert, fehlt auch Kreativität <strong>und</strong> Phantasie« (ebda.). Die ganzen nützlichen<br />
Eigenschaften von Wissenschaft fallen heraus. Sie sind im Herrschaftshabitus der<br />
b<strong>und</strong>esrepublikanischen Akademiker offensichtlich nicht zu entdecken. Die Bevölkerung hat also<br />
aus eigener bitterer Erfahrung gelernt, zwischen Akademikern <strong>und</strong> Wissenschaftlern zu<br />
unterscheiden - anders ist das Ergebnis dieser Repräsentativbefragung bei der wohlbekannten<br />
übertriebenen Wissenschaftsgläubigkeit in Deutschland kaum erklärbar.<br />
Bezeichnenderweise stimmen die befragten Akademiker diesem ihrem »Image« voll zu: Ihr Bild<br />
von sich selbst ist dasselbe auch in den nicht genannten Eigenschaften - wie ihr Fremdbild:<br />
»Führungsfigur«. Mit einem wichtigen Unterschied: »Akaderniker fügen diesem Fremdbild jedoch<br />
ganz prononciert Qualifikationen hinzu, die alle in Richtung einer kritisch-autonomen<br />
Intellektualität weisen. Dies sind Qualifikationen wie Kritikfähigkeit,<br />
30<br />
Selbstkritik, Sachlichkeit, Toleranz, Selbständigkeit. Dadurch heben sich Akademiker in ihrem<br />
Selbstbild entscheidend vom Fremdbild ab, in dem sie allgemeine theoretisch-instrumentelle<br />
Kompetenz in einen kritisch-rationalen Habitus einbinden <strong>und</strong> sich damit - wiederum im Sinne<br />
einer sozialen Figur - eher als Intellektuelle verstehen« (ebda., S. 161). Die konstruieren damit für<br />
sich selbst »ein allgemein >superioreres< Qualifikationsbewußtsein«. Nach den Konstanzer<br />
Untersuchungen spricht bisher nichts dafür, daß dieses Selbstbild auch tatsächlich eingelöst wird:<br />
»Wenn sich dies in weiteren Analyseschritten bestätigt, so würde dies darauf hindeuten, daß es<br />
der <strong>Uni</strong>versität gelingt, ihren Absolventen ein spezifisches Bild des Akademikers im Sinne einer<br />
idealvorstellung zu vermitteln, ohne daß dieses Ideal im Sinne einer Aufgabennorm eingelöst<br />
wird« (ebda., S. 164).<br />
Der »heimliche Lehrplan«
Nach außen hin <strong>und</strong> für alle sichtbar werden an den <strong>Uni</strong>versitäten Inhalte vermittelt, die für eine<br />
spätere Berufstätigkeit qualifizieren sollen. Diese Inhalte sind in einem Lehrplan festgelegt.<br />
Daneben aber - <strong>und</strong> von niemandem bewußt betrieben <strong>und</strong> von den meisten unbemerkt - gibt es<br />
etwas, wofür sich in der pädagogischen Diskussion die Bezeichnung »heimlicher Lehrplan«<br />
eingebürgert hat. Weil die Inhalte des offiziellen Lehrplans in einer Situation der gegenseitigen<br />
<strong>Angst</strong> gelehrt <strong>und</strong> gelernt werden, nimmt dieses Lernen <strong>und</strong> Lehren unversehens die Form von<br />
Herrschaftsverhalten an. Dabei verliert es gleichzeitig den Kern seines Inhalts. Die Form, in der<br />
es betrieben wird, setzt sich gegenüber dem aufklärerischen Inhalt durch <strong>und</strong> macht selbst aus<br />
der emanzipatorischen Wissenschaft Herrschaftswissen. Wenn dieser »heimliche Lehrplan« nicht<br />
bewußt gemacht <strong>und</strong> bekämpft wird, können noch so gesellschaftskritische Inhalte nicht<br />
garantieren, daß sie genauso wie die üblichen Ausbildungsstoffe zum Stoff werden, mit dem vor<br />
allen Dingen ein elitärer Herrschaftshabitus vermittelt wird.<br />
Aber selbst dann, wenn nicht dieser extrem herrschaftsbezogene Führungshabitus herauskommt,<br />
verwandelt die <strong>Uni</strong> die Leute gründlich, wenn sie sich nicht bewußt dagegen wehren. Ich habe in<br />
ungezählten Studienberatungen erlebt, wie sich Studentinnen <strong>und</strong> Studenten beim Gespräch<br />
über ihre bisherige Studienentwicklung <strong>und</strong> ihre Motive für das Studium nach <strong>und</strong> nach daran<br />
erinnerten, wie sie waren <strong>und</strong> was sie wollten, als sie mit dem Studium angefangen haben.<br />
Da war zum Beispiel ein Student, der früher jahrelang in einem Betrieb der Metallbranche<br />
gearbeitet hatte <strong>und</strong> dort gewerk<br />
31<br />
schaftlicher Jugendsprecher gewesen war. Die ständigen Konflikte mit der<br />
Gewerkschaftsbürokratie <strong>und</strong> der Betriebsleitung brachten ihn zur Verzweiflung. Als es nicht mehr<br />
weiter ging, wollte er unbedingt studieren <strong>und</strong> herausfinden, warum das alles so ist <strong>und</strong> ob sich<br />
da nichts Wirksames dagegen tun läßt. Er nahm also die ungeheuren Mühen auf sich, das Abitur<br />
im zweiten Bildungsweg nachzumachen. Als er dann an die <strong>Uni</strong> kam, stürzte er sich hochmotiviert<br />
auf den Stoff <strong>und</strong> in die Theorien. Diese Theorien wurden aber mit dem ganzen <strong>Bluff</strong>-Ballast <strong>und</strong><br />
der ganzen Praxisferne dargeboten, die sie auch dann wie mit einer Staubschicht überziehen,<br />
wenn sie eigentlich von unmittelbar praktischen Problemen handeln. Weil aber die formalen<br />
Scheinanforderungen <strong>und</strong> auch die Art der universitären Kommunikation keine Alternative boten,<br />
paßte er sich dieser Art Theorie zu treiben an. Um mitreden zu können <strong>und</strong> um das Bafög weiter<br />
beziehen zu können, wurde er -ohne es zu merken - immer mehr in die <strong>Uni</strong> hineingezogen <strong>und</strong><br />
von seiner ursprünglichen Motivation weggetrieben. Die praxisbezogene Fragestellung wurde<br />
nach <strong>und</strong> nach durch eine rein inneruniversitäre Theoriedebatte abgelöst, deren Sinn- <strong>und</strong><br />
Zwecklosigkeit ihn aber immer wieder depressiv überrollte. So war er, der einmal ungeheure<br />
Mühen auf sich genommen hatte, allein um an der <strong>Uni</strong> für ihn brennende Fragen zu bearbeiten,<br />
von diesen Fragen unwillkürlich abgekommen <strong>und</strong> in ein akademisches Studium hineingezogen<br />
worden. Weil er aber dessen Sinnlosigkeit wohl spürte, war er zum Zeitpunkt der Studienberatung<br />
dabei, sein Studium abzubrechen <strong>und</strong> »irgend etwas anderes« zu machen.<br />
Ein anderes Beispiel für die Wirkung des »heimlichen Lehrplans«: Eine Studentin erinnerte sich<br />
in dem Beratungsgespräch, wie sie als Schülerin in einer politischen Schülergruppe gearbeitet<br />
hatte.Und als sie so erzählte, ging ihr plötzlich auf, daß sich die Art <strong>und</strong> Weise, politisch<br />
gemeinsam zu arbeiten, gegenüber damals völlig verändert hatte. In der Schülergruppe hatten sie<br />
sich umeinander gekümmert, wußten übereinander Bescheid <strong>und</strong> hatten sich gegenseitig<br />
unterstützt, wenn sie mal durchhingen. An der <strong>Uni</strong> hatte sich das völlig verändert. Jetzt war alles<br />
sehr distanziert <strong>und</strong> unverbindlich geworden. Leute flippten aus, ohne daß es irgend jemand<br />
merkte. Die Arbeit war nicht mehr so sehr durch Gemeinsamkeit <strong>und</strong> den Wunsch bestimmt,<br />
dabei auch Spaß zu haben. Statt dessen lief sie mehr <strong>und</strong> mehr über den Kopf <strong>und</strong> wurde durch
harte Diskussionen voller theoretisierender Konkurrenz bestimmt. Als wir darüber sprachen,<br />
wurde uns klar, daß gerade in linken <strong>Uni</strong>-Gruppen die theoretischen Leistungsanforderungen<br />
besonders hochgeschraubt sind <strong>und</strong> deshalb die <strong>Angst</strong> vor dem »klugen Gesicht« besonders<br />
bedrohlich ist, mitsamt der beinahe automatischen Gegenreaktion, die <strong>Angst</strong><br />
32<br />
abwehrfassade des <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> aufzubauen. Also auch dort, wo oft genug der gegenteilige<br />
Anspruch besteht, wirkt der »heimliche Lehrplan« der <strong>Uni</strong>.<br />
Gilt das für alle Fächer?<br />
Gegen diese These, der »heimliche Lehrplan« bringe den Studierenden, egal welches Fach sie<br />
studieren, mit <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> <strong>und</strong> <strong>Uni</strong><strong>Bluff</strong> zusätzlich zum jeweiligen Fachwissen einen elitären<br />
Herrschaftshabitus bei, gibt es den Einwand, dies sei möglicherweise für die Fächer der früheren<br />
Philosophischen Fakultät richtig, aa eerr n der Medizin <strong>und</strong> in den naturwissenschaftlichen <strong>und</strong><br />
technischen Fächern sei das gar nicht möglich, weil es dort das gesicherte Wissen gar nicht<br />
erlaube, zu bluffen (Reiss, 1975 <strong>und</strong> Apel, Groebel, 1975).<br />
Das wird auch durch die empirischen Beobachtungen gestützt, wonach es in diesen Fächern<br />
erheblich seltener zu schweren psychischen Problemen kommt, die die Studierenden in die<br />
psychotherapeutischen Beratungsstellen führen oder sie gar in den Selbstmord treiben<br />
(Lungershausen, 1968, S. 106 <strong>und</strong> 109). Das erklärt sich aber zum Teil schon allein dadurch, daß<br />
sich bei der Wahl der Fachrichtung eine psychische <strong>und</strong> schichtenspezifische Selektion ergibt:<br />
Technische <strong>und</strong> naturwissenschaftliche Fächer ziehen offensichtlich eher als alle anderen Fächer<br />
Kinder von Arbeitern <strong>und</strong> unteren Angestellten an (Student, 1966, S. 2), die ihre psychischen<br />
Konflikte auf ganz andere Weise verarbeiten als Mittelschichtkinder (Moeller, Scheer, 1974). Bei<br />
ersteren werden im Elternhaus <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>eskreis psychische Konflikte nur schwer als echte<br />
Krankheiten akzeptiert, bevor sie nicht auch in einem physischen Zusammenbruch münden. Die<br />
sachliche Materie dieser Fächer kommt einer solchen Verdrängung entgegen. Es findet also in<br />
den Fächern schon vor Beginn des eigentlichen Studiums eine Art Vorselektion statt (Beckmann<br />
u. a., 1972, S. 38 f.). Das würde den Einwand, es gebe keinen uniweiten »heimlichen Lehrplan«,<br />
gut stützen.<br />
Aber gerade an den Ingenieurwissenschaften - für die im Prinzip ähnliches gilt - läßt sich zeigen,<br />
daß auch dort mit dem technischen Wissen zusammen ein elitärer Herrschaftshabitus mitgelehrt<br />
wird. Die Ingenieure lernen Theorie <strong>und</strong> Methoden, die sie niemals wieder in der Produktion<br />
gebrauchen können, die sie auch nicht dazu befähigen, die praktische Arbeit ihrer Untergebenen<br />
besser zu durchschauen oder gar selbst zu verrichten. Daraus schließt eine Gruppe von<br />
Dozenten an einer Technischen <strong>Uni</strong>versität: »Die Vermittlung wissenschaftlicher Theorien an der<br />
<strong>Uni</strong>versität dient weniger der Qualifizierung für die Erfordernisse des Arbeitsplatzes als<br />
33<br />
der Erzeugung elitär-akademischer >Überlegenheit< <strong>und</strong> Distanz gegenüber den nicht an der<br />
Hochschule ausgebildeten Produzenten <strong>und</strong> der Rechtfertigung hierarchischer Strukturen« (Naef,<br />
Schoembs, Wagemann, 1975, S. 143).<br />
Auch in den theoretischen Naturwissenschaften wie Mathematik <strong>und</strong> Physik wirkt das<br />
Zusammenspiel von <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> <strong>und</strong> <strong>Uni</strong><strong>Bluff</strong> als »heimlicher Lehrplan« auf den elitären<br />
Herrschaftshabitus hin. Dort verläuft das aber sehr viel komplizierter als in den<br />
Sozialwissenschaften, weil der <strong>Bluff</strong> in der Form des vorgetäuschten Wissens kaum möglich ist.
Die richtigen Antworten auf bestimmte Probleme stehen fest. Da gibt es kein<br />
Sich-darumHerumreden (Reiss, 1975, S. 218 ff). Auch ist der Spielraum für eigene<br />
Studienentscheidungen viel kleiner. Gerade in den unteren Semestern gibt es meist extrem rigide<br />
<strong>und</strong> arbeitsintensive Studienvorschriften. Da bleibt kaum Zeit für andere Kontakte, <strong>und</strong> vor lauter<br />
institutionellem Leistungsdruck verlieren alle anderen studienbezogenen Fragen an Bedeutung<br />
(ebenda, S. 226 ff.).<br />
Das erklärt, warum es keinen anderen Fachbereich gibt, aus dem Studierende in einem solch<br />
extremen Ausmaß ihr Studium abbrechen, um in ein anderes Studiengebiet zu flüchten (Infratest,<br />
1974, S. 12), <strong>und</strong> warum diejenigen, die übrigbleiben, ihr Studium bereits mit einer ausgeprägt<br />
sachlichen <strong>und</strong> unemotionalen Haltung beginnen <strong>und</strong> diese Haltung während des Studiums<br />
immer ausgeprägter wird (Beckmann, u. a., 1972, S. 14).<br />
Aber genau in dieser »Sachlichkeit« steckt der spezifische <strong>Bluff</strong> der Naturwissenschaften. Das<br />
wird vielleicht am besten an einem Beispiel aus der Schule deutlich: Deutschlehrer müssen die<br />
unterschiedlichen Interpretationsmöglichkeiten <strong>und</strong> Probleme eines Textes durch kontroverse<br />
Diskussionen herausarbeiten. Mathematiklehrer führen den einzig richtigen <strong>und</strong> gültigen Beweis<br />
vor <strong>und</strong> können ihre Herrschaft in der Diskussionssituation damit rechtfertigen, daß dies eben in<br />
»der Natur der Sache« liege (Bürmann, 1975, S. 60 ff.).<br />
Vieles in diesen Wissenschaften ist aber gar nicht durch die Natur selbst bestimmt, sondern ist<br />
genauso gesellschaftlich bedingt wie in anderen Wissenschaftsgebieten (vgl. Greiff, 1976, für<br />
Naturwissenschaftler sehr zu empfehlen, weil auch leicht verständlich). Von den<br />
Naturwissenschaften werden aber solche kritischen Überlegungen abgeblöckt. In Schule <strong>und</strong><br />
<strong>Uni</strong>versität verstecken sie ihre gesellschaftlichen <strong>und</strong> politischen Forderungen immer wieder<br />
hinter ihrer »Sachlichkeit«. Abgesehen von der arrogant-unverständlichen Sprache, die auch bei<br />
ihnen weitverbreitet ist, besteht die naturwissenschaftliche Form des <strong>Bluff</strong>s darin, zu<br />
signalisieren: Mir kann keiner, denn was ich sage, das kommt nicht von mir als einem<br />
gesellschaftlichen <strong>und</strong> darum fehlbaren Wesen, sondern das kommt von der allmächtigen Natur<br />
selbst (Reiss, 1975).<br />
34<br />
In Fächern wie der Juristerei ist der Herrschaftsbezug ganz eindeutig, <strong>und</strong> die Einübung eines<br />
Herrschaftshabitus als wesentlicher Inhalt des Studiums drückt sich schon in den<br />
unvermeidlichen Schauspielerallüren der Anwälte vor den Gerichten, aber auch in der Rede von<br />
der »herrschenden Lehre« aus, die im Gr<strong>und</strong>e genommen das einzige <strong>und</strong> letzte Argument ist<br />
(Branahl, Francke, 1975, S. 265 ff.).<br />
Besonders brutal zeigt sich der »heimliche Lehrplan« bei den Medizinern: Am Anfang ihres<br />
Studiums behaupten sie von sich häufiger als die Erstsemester anderer Fächer, daß sie am<br />
Wohlergehen ihrer Mitmenschen interessiert seien. Das universitäre Milieu ihrer Studienrichtung,<br />
wo nicht mehr von Personen, sondern von »Blinddärmen« oder gar vom »Krankengut« geredet<br />
wird, bringt es jedoch fertig, daß sie gegen Ende ihres Studiums auf die gleiche Frage sehr viel<br />
seltener als die Examenssemester aller anderen Fächer positiv reagieren (Beckmann u. a., 1972,<br />
S. 15 f.).<br />
Es zeigt sich also, daß der heimliche Lehrplan in allen Fächern wirksam ist, wenn auch auf<br />
unterschiedliche Weise. Sein Resultat ist aber überall die Erziehung zum Herrschaftsverhalten.
Nun ist es aber so, daß nicht alle Studienanfänger <strong>und</strong> -anfängerinnen den Lehrplan voll<br />
durchstehen. Viele fallen vor dem Ende des Studiums heraus. Darunter sind weit überproportional<br />
Frauen, Kinder aus der Unterschicht <strong>und</strong> Ausländer. Um noch genauer herauszukriegen, wie der<br />
<strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> zustande kommt <strong>und</strong> was seine Rolle in dieser Gesellschaft ist, will ich jetzt zuerst<br />
einmal diese drei Gruppen, die im besonderen Maße herausfallen, danach untersuchen, was sie<br />
gemeinsam haben <strong>und</strong> was sie von denjenigen unterscheidet, die an der <strong>Uni</strong> ohne größere<br />
Schwierigkeiten bestehen können. Dabei ist die Situation der Frauen an der <strong>Uni</strong> ganz besonders<br />
bezeichnend. Ich will sie deshalb ausführlich beschreiben <strong>und</strong> versuchen, soweit mir das möglich<br />
ist, zu erklären.<br />
Die Situation der Frauen an der <strong>Uni</strong><br />
Solange sie sich nicht gemeinsam dagegen wehren, gilt für Frauen an der <strong>Uni</strong>versität<br />
offensichtlich ein ganz anderer »heimlicher Lehrplan« als für Männer. Das zeigt eine<br />
Untersuchung über die Selbsteinschätzung von Studierenden am Anfang <strong>und</strong> am Ende ihres<br />
Studiums:<br />
»Die Männer befinden sich zu Beginn des Studiums - wie sie angeben - stark mit inneren<br />
Schwierigkeiten beschäftigt, aber das läßt bei ihnen nach, während die Studentinnen genau den<br />
umgekehrten Verlauf erleben. Sie erleben sich als Studienanfängerinnen sehr viel unbeschwerter<br />
als kurz vor Studienabschluß. Am Ende finden sie viel mehr Anlaß, über innere Probleme<br />
nachzugrübeln,<br />
35<br />
<strong>und</strong> fühlen sich wesentlich häufiger bedrückt als die männlichen Studierenden. Man könnte grob<br />
sagen: Die Männer gewinnen, die Frauen verlieren während ihres Studiums an Unbekümmertheit<br />
<strong>und</strong> stimmungsmäßiger Ausgeglichenheit. Die männlichen Studierenden werden - so ihre eigenen<br />
Angaben - sorgenfreier, weniger anfällig für Niedergeschlagenheit <strong>und</strong> zugleich<br />
konkurrenzfreudiger. Für die weiblichen Studierenden gilt in allen Merkmalen das Gegenteil«<br />
(Beckmann u. a., 1972, S. 22). Gleichzeitig beobachteten die Autoren eine andere Veränderung<br />
zwischen den Frauen <strong>und</strong> Männern an der <strong>Uni</strong>: Bei den Männern »überholen allmählich die<br />
Rivalitätsgefühle die fürsorglichen Gefühle, während bei den Studentinnen die Tendenz zum<br />
Rivalisieren zugunsten eines Anwachsens fürsorglicher Gefühle zurücktritt« (ebenda, S. 21). Am<br />
Ende des Studiums fühlt sich die Studentin an der <strong>Uni</strong> verloren <strong>und</strong> unsicher <strong>und</strong> sucht den<br />
Kontakt zu anderen. Sie leidet unter der Institution <strong>Uni</strong>versität. »Die Studentin erhält ja nicht nur<br />
für ihre höhere Angewiesenheit auf menschliche Beziehungen keine höhere Zuwendung, man<br />
kommt ihr im Gegenteil weniger entgegen« (Moeller, Scheer, 1974, S. 64). Studentinnen sind sich<br />
unsicher »in bezug auf die Richtigkeit ihrer Arbeit <strong>und</strong> deren Erfolg <strong>und</strong> haben es häufig noch<br />
schwerer, den Anfang zu finden, als männliche Studenten« (Beckmann u. a., 1972, S. 33). Vor<br />
Prüfungen haben sie »wesentlich mehr <strong>Angst</strong>« <strong>und</strong> eine ausgeprägtere körperliche Symptomatik<br />
als Studenten (Scheer, Zenz, 1973, S. 71 f.). Die Abbruchquoten liegen bei Studentinnen in allen<br />
Fächern um 100 % höher als bei Studenten, <strong>und</strong> in den Geisteswissenschaften bricht sogar die<br />
Hälfte aller Studentinnen ihr Studium vorzeitig ab (Hervé, 1973, S. 83). Die<br />
psychotherapeutischen Beratungsstellen müssen sie auch häufiger besuchen, insbesondere die<br />
verheirateten Studentinnen: »Kein anderer Schluß scheint uns möglich, als daß eine höhere<br />
psychische Belastung der Studentin durch die Ehe, eine Entlastung des Studenten durch die Ehe<br />
vorliegt« (Moeller/Scheer, 1974, S. 53 f.). Schließlich haben Studentinnen ein sehr viel höheres<br />
Selbstmordrisiko als Studenten.<br />
Gleichzeitig sind Frauen an der <strong>Uni</strong>versität weit unterrepräsentiert, <strong>und</strong> zwar je weiter nach oben<br />
es in der Bildungshierarchie geht: Der Anteil der Frauen an der Gesamtbevölkerung ist 49 %, ihr
Anteil an den Abitursabschlüssen ist bereits auf 37,3 % reduziert, bei den Studienanfängern <strong>und</strong><br />
-anfängerinnen auf 32,6 %, beim Examen auf 26,7 % <strong>und</strong> bei den Promotionen auf 16,5 %<br />
(Weber, 1973, S. 108 - Zahlen von 1967). Unter den Lehrenden reduziert sich dann der Anteil auf<br />
einstellige Prozentzahlen, unter den Ordinarien sogar auf weniger als 1 % Und diese wenigen<br />
Frauen, die es bis an die <strong>Uni</strong> schaffen, sind dann noch weit überwiegend auch nur diejenigen, die<br />
aus, ihrem Elternhaus die besten Voraussetzungen für ein Studium mitbringen: Studentinnen<br />
kommen noch häufiger als Stu<br />
36<br />
denten aus der städtischen Oberschicht (Berger, 1970, S. 14, <strong>und</strong> Wilcke, 1976, S. 214). Das<br />
liegt wohl daran, daß es immer noch überwiegend nur in wohlhabenderen <strong>und</strong><br />
bildungsbeflisseneren Familien als sinnvoll angesehen wird, die Töchter auf die <strong>Uni</strong> zu schicken.<br />
Die <strong>Uni</strong> verhält sich auch bei Männern diskriminierend gegen die Mitglieder aus der<br />
Arbeiterklasse <strong>und</strong> gegenüber der Landbevölkerung (1974 waren 10 % der Studierenden<br />
Arbeiterkinder, obwohl die Arbeiterschaft 39 % der Wahlbevölkerung ausmachte - Infratest, 1974,<br />
S. 36), aber für die Tochter eines Arbeiters oder Bauern ist es geradezu unwahrscheinlich, daß<br />
sie es jemals bis an die <strong>Uni</strong> schafft (Weber, 1973, S. 111). Diejenigen Frauen, die also schließlich<br />
an die <strong>Uni</strong> kommen, haben meistens die besten Voraussetzungen für diese Situation<br />
mitbekommen, die bei Frauen in dieser Gesellschaft überhaupt möglich sind. Und trotzdem spielt<br />
selbst ihnen die <strong>Uni</strong>versität dermaßen übel mit.<br />
Woran liegt das? Frauen - auch diejenigen aus den Gesellschaftsschichten, aus denen die<br />
meisten Studentinnen kommen - sind in ihren Erwartungen <strong>und</strong> Verhaltensweisen in der<br />
Kommunikation geprägt durch eine andere Art der Erziehung <strong>und</strong> durch gr<strong>und</strong>sätzlich andere<br />
Erfahrungen als Männer. In der Erziehung setzt sich beinahe überall die gesellschaftliche<br />
Arbeitsteilung durch, in der den Frauen eben nicht nur das Gebären der Kinder, sondern auch<br />
noch ihre Erziehung <strong>und</strong> Versorgung zugeteilt ist. Die meisten Eigenschaften <strong>und</strong> Fähigkeiten,<br />
die bei uns als »typisch weiblich« gelten, sind durch diese Arbeitsteilung bedingt <strong>und</strong> werden teils<br />
durch die vorgegebenen Erziehungsmuster, teils durch das Vorbild der anderen Frauen<br />
weitergegeben. Dazu gehören: Geduld, Einfühlungsvermögen, Behutsamkeit, Angewiesensein<br />
auf Wärme <strong>und</strong> Zuwendung, Emotionalität etc. Selbstverständlich gibt es Frauen, bei denen diese<br />
»typisch weiblichen« Eigenschaften weniger stark ausgeprägt sind als bei manchen Männern.<br />
Aber in der Regel hat sich die Jahrh<strong>und</strong>erte alte Arbeitsteilung bei der Aufzucht der nächsten<br />
Generation so in Erziehung <strong>und</strong> Alltagsverhalten festgesetzt, daß sie häufiger bei Frauen als bei<br />
Männern anzutreffen sind. Solche Eigenschaften <strong>und</strong> Fähigkeiten müßten eigentlich besonders<br />
günstig sein für die Kommunikation, denn sie sind vornehmlich auf die Mitmenschen bezogen. In<br />
der universitären Kommunikation sind sie aber offensichtlich ein Hindernis <strong>und</strong> lassen besonders<br />
viele Frauen scheitern. In der akademischen Kommunikation sind eher die gegenteiligen<br />
Eigenschaften <strong>und</strong> Fähigkeiten erforderlich: distanzierte Aggressivität, Sachbezogenheit <strong>und</strong><br />
Bestätigung per Leistung in der Konkurrenz. Solche Fähigkeiten <strong>und</strong> Eigenschaften sind aber<br />
keineswegs naturgesetzlich »typisch männlich
sich also bei den Männern außer den spezifischen Fähigkeiten, die der jeweilige Arbeitsprozeß<br />
erforderlich machte, allgemeine Eigenschaften <strong>und</strong> Fähigkeiten herausbilden. Diese wurden<br />
durch die Anforderungen des Warenmarktes geprägt (Ludmilla Müller, 1976). Das sind vor allem:<br />
- Sachlichkeit, denn auf dem Markt geht es um Dinge, nicht um Emotionen, -<br />
Abstraktionsvermögen, denn beim Kaufen <strong>und</strong> Verkaufen geht es um abstrakte Gegenwerte, ums<br />
Geld, <strong>und</strong> nicht um die Qualität der Dinge, - der Wille zur Selbstbehauptung, denn auf dem Markt<br />
muß jeder für sich sorgen, - das Genügen an der Bestätigung über Leistung <strong>und</strong> Konkurrenz,<br />
denn nur wenn sich die Produkte gegen die der anderen durchsetzen <strong>und</strong> wenn man genügend<br />
produziert hat, klappt die Reproduktion.<br />
Im zweiten Kapitel habe ich gezeigt, daß sich an der <strong>Uni</strong>versität die Marktsituation in einer<br />
irrational verzerrten Form, aber zugleich in ihren Zwängen noch verstärkt wiederholt: Die<br />
Leistungsangst ist so stark, daß sie alle universitären Verhaltensbereiche, Seminar, schriftliche<br />
Arbeit <strong>und</strong> selbst die Versuche zur emanzipatorischen Politik, beherrscht <strong>und</strong> prägt. Der <strong>Bluff</strong>, die<br />
Abwehrfassade gegen diese <strong>Angst</strong>, ist also letztlich nichts anderes als eine Flucht in besonders<br />
ausgeprägte, besonders krasse Marktverhaltensweisen.<br />
Weil der Kern der <strong>Angst</strong> gerade darin liegt, daß man auf dem universitären Leistungsmarkt mit<br />
seiner Leistung nicht »ankommen« könnte, muß man all das an Bemühungen, Techniken,<br />
Eigenschaften <strong>und</strong> Fähigkeiten mobilisieren, was üblicherweise <strong>und</strong> nach jahrh<strong>und</strong>ertelanger<br />
Übung die Durchsetzungsfähigkeit am Markt erhöht. Weil solche Fähigkeiten bei Männern durch<br />
den in der Arbeitsteilung der Geschlechter herausgebildeten Erziehungsstil normalerweise<br />
stärker ausgebildet sind, erscheint die <strong>Uni</strong>versität als eine besonders frauenfeindliche Institution.<br />
In Wirklichkeit ist ihre Frauenfeindlichkeit nur Ausdruck <strong>und</strong> Ergebnis ihres Angepaßtseins an die<br />
Erfordernisse des Warenmarktes: Man lernt an ihr, wie man sich selbst am besten verkauft <strong>und</strong><br />
wie man das, was man zu verkaufen hat, in die durchsetzungsfähigste Verpackung bringt! Und<br />
»man«, das ist nun mal in dieser Gesellschaft vorwiegend der Mann.<br />
Außer dieser Diskrepanz zwischen »Markteigenschaften« der Männer <strong>und</strong> »Mutterfähigkeiten«<br />
der Frauen wirkt auf die universitäre Situation der Frauen noch ganz besonders stark der<br />
Sexismus die<br />
38<br />
ser Gesellschaft. Das mag auf den ersten Blick völlig absurd klingen, denn ich kann mir kaum<br />
etwas sexualfeindlicheres, oder besser - nachdem sich Sexualität seit ihrer »Befreiung« auf mehr<br />
oder weniger mechanische Zusammenhänge reduziert hat - kaum etwas unerotischeres<br />
vorstellen als die <strong>Uni</strong>versitätsatmosphäre.<br />
Trotzdem sehe ich da einen Zusammenhang: Frauen erfahren schon längst vor ihrer<br />
Geschlechtsreife, daß sie Objekte sind für den »Genuß« der Männer. Das kriegen sie schon als<br />
Kinder zur Genüge vermittelt. Später erleben sie es bewußt durch die Werbung, durch die<br />
Tanzst<strong>und</strong>e <strong>und</strong> durch all die anderen ritualisierten Instanzen unserer abendländischen<br />
Zivilisation -<strong>und</strong> viel zu häufig müssen sie es auch noch körperlich durchmachen, in zweifelhaften<br />
Liebschaften oder gar Vergewaltigungen. Der Status eines Objektes, das »schön« zu sein hat,<br />
wenn es akzeptiert sein will, ist so allgegenwärtig in der Werbung, in den anderen Frauen, in den<br />
Frauenzeitschriften <strong>und</strong> in den Blicken der Männer, aber auch <strong>und</strong> vor allem -in den Blicken der<br />
anderen Frauen. Da bleibt für das eigene minimale Selbstwertgefühl nichts übrig, als sich<br />
wenigstens nach den Minimalanforderungen an ein solches »Objekt« auszustatten, denn sonst<br />
besteht die Gefahr, weder von Männern noch auch von Frauen akzeptiert zu werden (Achterberg,<br />
1974, S. 29 ff.). Oberflächlich gesehen entspricht das genau den marktbezogenen
Leistungsängsten der Männer: Aber zusätzlich zu dem »<strong>Wie</strong> rede ich möglichst klug?» ist da das:<br />
»Sehe ich gut genug aus, um anzukommen?« (Und zwar nicht bei den Männern, sondern<br />
überhaupt.) »Das ist dann auch genau wieder die Ebene, wo du mit dir selbst in Konflikt gerätst.<br />
Wo du dich eigentlich distanzieren willst von deiner Rolle als Frau: Nur was zu sagen, wenn du<br />
keine fettigen Haare hast <strong>und</strong> dich wirklich gut fühlst. Alles schon 100mal <strong>und</strong> öfter durchgekaut.<br />
Aber das läuft nur über den Kopf. In der Situation selbst hast du dann einfach nur <strong>Angst</strong>,<br />
abgelehnt zu werden. Über den Kopf ist alles klar: Was hast du denn groß von der Anerkennung<br />
der Deppen, die über deine duftig fallenden Locken läuft, deine großen strahlenden Augen. ( ... )<br />
Indem ich mich distanziere, habe ich aber noch keine andere Ebene gef<strong>und</strong>en, auf der ich mich<br />
stark fühlen kann, auf die ich mich beziehen kann« (Klöckner, 1977, S. 367).<br />
So gibt es für Studentinnen eine doppelte Diskrepanz: Einmal die zwischen den von der <strong>Uni</strong><br />
geförderten männlichen Marktverhaltensweisen <strong>und</strong> den eigenen, zwar anerzogenen, aber doch<br />
vorhandenen »weiblichen« Eigenschaften. Und dann die zwischen der voller Kränkung erlebten<br />
<strong>und</strong> abgelehnten Objektrolle einerseits, die aber in der angstbesetzten <strong>Uni</strong>-Situation wenigstens<br />
noch ein Minimum an Sicherheit gibt. Und andererseits dem Leiden unter dieser Kränkung, unter<br />
der allgegenwärtigen Verobjektivierung <strong>und</strong> der deswegen unvermeidlichen Auflehnung gegen<br />
dieses eigene Verhal<br />
39<br />
ten. Diese doppelte Diskrepanz macht es verständlich, warum Frauen unter der <strong>Uni</strong>-Situation<br />
besonders leiden.<br />
Die Reaktionen auf diese Diskrepanzen <strong>und</strong> die doppelte Überforderung samt der dazugehörigen<br />
viel bedrohlicheren <strong>Angst</strong> ist bei Frauen an der <strong>Uni</strong> sehr unterschiedlich. Einmal gibt es die<br />
verschiedenen, mehr oder weniger schlimmen Fluchtverhaltensweisen. Dann kommt es auch<br />
häufig vor, daß Frauen zwar in politischen Gruppen <strong>und</strong> Studienkollektiven mitmachen, aber dort<br />
eben auch wieder die Rolle spielen, die Männer, die mackerhaft herumwirbeln, zu unterstützen,<br />
ihnen voller Sensibilität zuzuhören, wenn sie mal durchhängen, <strong>und</strong> sie wieder aktionsfähig zu<br />
machen. Oft genug reagieren Frauen auf die universitäre Drucksituation auch damit, daß sie die<br />
<strong>Angst</strong>abwehrfassade <strong>Bluff</strong> in besonders aggressiver Form erlernen. Meist aber schwanken die<br />
Studentinnen zwischen diesen unterschiedlichen <strong>und</strong> zum Teil gegensätzlichen Reaktionsweisen<br />
hin <strong>und</strong> her, weil keine eine Lösung anbietet <strong>und</strong> das wird von vielen Männern als besonders<br />
»typisch weiblich« empf<strong>und</strong>en. Erst der Entschluß, ohne <strong>und</strong> unter Umständen auch gegen die<br />
Männer - gerade auch die »gutwilligen« - die besondere Betroffenheit der Frauen durch die<br />
universitäre Situation zu untersuchen <strong>und</strong> gezielt dagegen zu kämpfen, hat an dieser scheinbar<br />
ausweglosen Situation etwas geändert <strong>und</strong> wird für viele Männer auch zum Vorbild - trotz aller<br />
Probleme dabei -, wie sie ihre <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> angehen könnten. Doch dazu im nächsten Kapitel. Hier<br />
geht jetzt die Untersuchung der Gruppen weiter, die aus der universitären Situation besonders<br />
häufig herausfallen.<br />
Die Situation der Arbeiterkinder<br />
Außer Frauen haben Studierende aus den unteren Sozialschichten - <strong>und</strong> bei ihnen wieder<br />
verstärkt die Frauen - besondere Schwierigkeiten mit dem Studium. Ihre Abbrecherquote liegt in<br />
allen Fächern höher als die Studierender anderer Herkunft (Saterdag, Apenburg, 1972, S. 32,<br />
<strong>und</strong> Goldschmidt, 1969, S. 55), <strong>und</strong> bei genauer Betrachtung sind sie auch bei den psychisch<br />
gefährdeten Studierenden deutlich überrepräsentiert (Moeller, Scheer, 1974, S. 1001. Dabei gilt<br />
auch für sie, daß sie an den b<strong>und</strong>esrepublikanisehen <strong>Uni</strong>versitäten weiterhin kaum vertreten sind:<br />
Zwar ist ihr Anteil von 1966 bis 1974 von 5 % (Student, 1966, S. 2) auf 10 % gestiegen, an den<br />
Fachhochschulen sogar auf 24 %, aber weiterhin gilt, daß Kinder ungelernter <strong>und</strong> angelernter<br />
Arbeiter ganz selten <strong>und</strong> Kinder von Facharbeitern immer noch nur mit einer Chance von eins zu
drei an die <strong>Uni</strong> kommen (Infratest, 1974, S. 36 f.). Der zweite Bildungsweg kann daran kaum<br />
etwas ändern (Weber, 1973, S. 102 ff.). Diese extremen Verhältnisse sind keineswegs notwendi<br />
40<br />
ges Produkt der kapitalistischen Produktionsweise, sondern zeigen eher, daß sich die BRD zu<br />
den besonders rückständigen Ländern auf diesem Gebiet zählen muß.<br />
Aber egal, ob es ganz wenige sind oder mehr, diejenigen Kinder aus der Arbeiterklasse, die es<br />
bis an die <strong>Uni</strong> schaffen, haben dort besonders große Schwierigkeiten. Woran liegt das?<br />
Zuerst einmal gibt es dafür eine Reihe naheliegender ökonomischer Gründe: Es ist allgemein<br />
bekannt, daß auch die Höchstsätze beim Bafög nicht zum Leben ausreichen. Studierende, die<br />
also auf das Bafög angewiesen sind, weil sie nicht wie die anderen 62 % vom Geld der Eltern<br />
leben (Infratest, 1974, S. 32), müssen in den Seinesterferien <strong>und</strong> häufig genug im Semester<br />
einen Job suchen. Mit dem Ergebnis, daß ihr Studium sich verlängert, wodurch sich die<br />
Geldschwierigkeiten verschärfen. Sie können erheblich weniger intensiv studieren <strong>und</strong> sind<br />
deshalb weniger erfolgreich (Saterdag, Apenburg, 1972, S. 78: Studienabbrecher haben am<br />
wenigsten Geld gehabt!). Und oft genug fallen sie unter eine zweite Form des Numerus clausus,<br />
selbst dann, wenn sie die Hürde ZVS geschafft haben: Sie finden keine Wohnung oder keine<br />
»Bude«, die sie bezahlen könnten. Oder aber eine so schlechte, daß schon dadurch das Studium<br />
erheblich beeinträchtigt wird (Möller, Korte, 1972). Das genügt aber noch nicht zur Erklärung.<br />
Das Studienverhalten der Kinder aus Arbeiterfamilien kann man auch so erklären: »Häufiges<br />
Fehlen eines elterlichen Vorbildes für selbständige geistige Arbeit, geringere Vertrautheit mit dem<br />
akademischen Milieu, niedrigere Bildungsaspirationen, geringe sprachliche Fähigkeiten« (Wilcke,<br />
1976, S. 215). Das würde auch zu meiner These passen, daß entscheidend für den Studienerfolg<br />
vor allem das Erlernen der sprachlichen Techniken ist, die den <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> ausmachen. Die<br />
bekannten schichtenspezifischen Unterschiede im Sprachverhalten würden demnach bis auf die<br />
Erfolgschancen beim Studium durchschlagen.<br />
Dagegen spricht aber: Die sek<strong>und</strong>äre Sozialisation durch Gymnasium <strong>und</strong> durch die Gruppe der<br />
Gleichaltrigen wirkt so stark, daß sich bis zur <strong>Uni</strong>versität die Prägung durch die Sprachsituation in<br />
der Familie meist verliert oder sich nur in einer Art Zweisprachigkeit neben der Hochsprache<br />
erhält. Dafür sorgt allein schon der schulisehe Ausleseprozeß. Proletarisches Sprachverhalten<br />
<strong>und</strong> intellektuelle Prägung durch die Arbeitswelt dürften also nur bei denjenigen Studierenden so<br />
stark sein, daß sie zum Studienproblem werden können, die nach Lehre <strong>und</strong> Berufstätigkeit über<br />
den zweiten Bildungsweg an die <strong>Uni</strong>versität kommen. Die haben aber am Studienanfang eine so<br />
ausgeprägte Studienmotivation - sei es aus konkret inhaltlichen Fragestellungen oder um des<br />
sozialen Aufstiegs willen - <strong>und</strong> haben in dem schwierigen Weg bis an die <strong>Uni</strong> eine so hohe<br />
Frustrationstoleranz beweisen müssen, daß sie sich<br />
41<br />
auch an der <strong>Uni</strong> meist unter widerwärtigsten Bedingungen durchbeißen können. In den<br />
Examensergebnissen unterscheiden sie sich dann auch nicht von den anderen Studierenden.<br />
Dies gilt auch für die anderen Unterschichtenkinder, die es bis zum Examen schaffen (Ottwaska,<br />
1971, S. 32).<br />
Die Frage, warum Arbeiterkinder an der traditionellen <strong>Uni</strong> besonders häufig herausfallen, bleibt<br />
also noch ungeklärt. Um sie beantworten zu können, will ich zuerst eine andere Gruppe<br />
untersuchen, die ebenfalls besonders häufig an der deutschen <strong>Uni</strong> scheitert <strong>und</strong> bei der die<br />
Sprache unbestreitbar ein zentrales Problem ist.
Die Situation der ausländischen Studierenden<br />
Ihre Studiendauer liegt weit über der deutscher Studierender. Über die Hälfte von ihnen bricht<br />
das Studium ohne Examen ab. Damit liegt ihre Abbruchquote um das Doppelte höher als bei<br />
deutschen Studierenden. Für psychische Störungen sind sie ebenfalls anfälliger (Jahnke, Ziolko,<br />
1969, S. 251 f.), <strong>und</strong> auch ihr Selbstmordrisiko ist deutlich höher (Lungershausen, 1968, S. 22<br />
ff.).<br />
Auf den ersten Blick scheint das die Erklärung von Studienschwierigkeiten durch Probleme der<br />
Sprache eindrucksvoll zu bestätigen. Gliedert man die Statistiken aber genauer auf, dann zeigt<br />
sich, daß die Sprachschwierigkeiten nicht der entscheidende Gr<strong>und</strong> sein können: Denn es gibt<br />
einen ausgeprägten Unterschied zwischen den Studierenden aus industrialisierten <strong>und</strong><br />
unterentwickelt gehaltenen Ländern (Pätzoldt, 1972). Beide Gruppen haben<br />
Sprachschwierigkeiten, aber die Studierenden aus der armen Welt haben darüber hinaus sehr<br />
viel größere Probleme mit dem Studium (ebenda, S. 147 ff.). Untersucht man ihre Situation<br />
genauer, dann zeigt sich, daß sie unter sehr viel höherem Erwartungsdruck stehen als<br />
Studierende aus industrialisierten Ländern: Sie kommen zwar meist aus den traditionellen<br />
Oberschichten ihrer Heimat - ein Ergebnis der gezielten Förderung durch die BRD-Regierung, die<br />
auf diese Weise die Führungsschichten an sich binden will (ebenda, S. 108 f.) -, aber sie stehen<br />
unter erheblichem Erfolgsdruck von daheim. Wenn sie dort etwas gelten wollen, müssen sie auf<br />
jeden Fall irgendein Diplom, irgendeinen Titel mit zurückbringen. Zugleich sind die Stipendien<br />
meist als Erfolgsprämien ausgezeichnet - ohne Abschluß müssen sie zurückgezahlt werden<br />
(ebenda, S. 110 ff.). Aber nicht der Druck ist das entscheidende, sondern wie sie darauf<br />
reagieren: Eben nicht zuversichtlich, daß es mit einiger Anstrengung zu schaffen sei, sondern in<br />
der Konfrontation mit der völlig fremden Kultur, in der sie als offensichtlich Fremde durch die<br />
Vorurteilsstruktur der einheimischen Bevölkerung auch noch als minderwertig diskriminiert<br />
werden (sie haben z. B. größte Schwierigkeiten,<br />
42<br />
ein Zimmer zu finden). In dieser für sie völlig ungewohnten Situation reagieren sie mit einer sehr<br />
verständlichen Verhaltensstrategie: Sie tun alles, um Mißerfolge zu vermeiden, jeder Situation,<br />
die ein Scheitern möglich macht, weichen sie aus.<br />
Wer den Erfolg erwartet, erlebt ihn auch!<br />
Diese <strong>Angst</strong> vor dem Mißerfolg ist aber genau das, was alle Gruppen gemeinsam haben, die im<br />
Studium besonders häufig herausfallen: Frauen, Arbeiterkinder, ausländische Studierende aus<br />
der armen Welt. Dazu auch noch all diejenigen, die wegen psychischer Störungen die<br />
psychotherapeutischen Beratungsstellen der <strong>Uni</strong>versitäten beanspruchen mußten (Moeller,<br />
Scheer, 1974). Diese »Mißerfolgsängstlichkeit« ist bei Studierenden, die das Studium ohne<br />
Examen abgebrochen oder das Fach gewechselt haben, das hervorstechende gemeinsame<br />
Merkmal (Saterdag, Apenburg, 1972, S. 32 f., 43 <strong>und</strong> 148 f.).<br />
Für die Kinder aus Arbeiterfamilien erklären Saterdag <strong>und</strong> Apenburg das so: »Durch die<br />
überwiegend tadelnde Reaktion der Eltern auf schlechte Schulnoten wird eine positive Haltung zu<br />
Leistungszielen außerordentlich erschwert. Es entsteht statt dessen bei den Kindern die<br />
Tendenz, Aufgaben möglichst so anzugehen, daß Mißerfolge vermieden <strong>und</strong> Risiken<br />
ausgeschaltet werden können« (ebenda, S. 33).
ich meine aber, daß die richtig beschriebenen Verhaltensstrategien nicht allein aus der Haltung<br />
der Eltern erklärt werden können. Dazu gehört das immer wiederholte Erlebnis in allen Bereichen,<br />
daß der Erfolg fraglich ist, daß er nicht so sehr von der eigenen Leistung als von der<br />
Einschätzung <strong>und</strong> der Gewogenheit einzelner Personen abhängig ist. Daß es folglich letztlich<br />
besser ist, das wenige, was man sicher hat, zu schützen ünd zu sichern, als auch das noch durch<br />
gewagte Aktionen zu gefährden. Solche Erfahrungen machen Arbeiterkinder, die trotz größter<br />
Anstrengung nur mit Glück über alle schichtenspezifischen Klippen des Ausbildungssystemes<br />
hinweggekommen sind. Frauen machen diese Erfahrung, auch wenn sie aus der Oberschicht<br />
kommen, weil die Zuwendung, die sie erleben, weniger von ihrer intellektuellen oder sonstigen<br />
Arbeitsleistung abhängt, <strong>und</strong> mehr von äußerlichen oder zufälligen Eigenschaften, deren<br />
Beständigkeit <strong>und</strong> Wertschätzung schwer beeinflußbar scheint <strong>und</strong> stark an einzelne Personen<br />
geb<strong>und</strong>en ist. Ausländer aus den unterentwickelt gehaltenen Ländern der armen Welt können<br />
sich zu einer ihnen fremden <strong>und</strong> oft genug feindlichen Welt nur schwer verhalten. Sie tasten sich<br />
voran wie im dichten Nebel <strong>und</strong> schrecken zurück, wenn sie auf ein Hindernis stoßen.<br />
Bei Personen mit psychischen Schwierigkeiten, familiengeschicht<br />
43<br />
lich bedingten Neurosen, Minderwertigkeitsgefühlen <strong>und</strong> <strong>Angst</strong>psychosen gilt es sowieso als<br />
klassisches Kennzeichen, daß sie alle Situationen, die einen Mißerfolg mit sich bringen können,<br />
voller Panik vermeiden (Krohne, 1976). »Das Studienverhalten der hoch Mißerfolgsängstlichen<br />
zeugt von geringer Leistungsorientierung, geringer Selbsteinschätzung, geringem<br />
Anspruchsniveau, geringerer Zukunftsperspektive <strong>und</strong> geringerer Fähigkeit zur Selbstregulation<br />
des eigenen Verhaltens im Leistungsbereich; sein Hauptkennzeichen ist eine geringere<br />
sachbezogene Eigenaktivität« (Wilcke, 1976, S. 215).<br />
Dieses Unterscheidungsmerkmal wird durch Untersuchungen über die beiden wichtigsten Phasen<br />
des Studiums bestätigt, den Studienanfang <strong>und</strong> die Abschlußprüfung. Beim Studienanfang<br />
zeichnen sich die Jugendlichen, die sich für ein Studium entschlossen haben, im Gegensatz zu<br />
denjenigen Abiturienten, die gleich ins Berufsleben eintreten, so aus: »Sie erleben sich deutlich<br />
zurückhaltender im Kontaktbereich. Man hat den Eindruck, daß sie es teils schwerer haben,<br />
engen Kontakt zu finden, teils sich aber auch bewußt mehr von ihrer Umgebung abgrenzen. ( ... )<br />
Sie fühlen sich dabei instabiler in ihrer Gemütsverfassung. Denn sie glauben, daß sie häufiger<br />
bedrückt sind <strong>und</strong> leichter in ihrem Befinden von außen beeinflußt werden können. Dieser<br />
Introvertiertheit <strong>und</strong> emotionellen Labilität steht eine Betonung ihres Eigenwillens <strong>und</strong> eines<br />
gewissen Anspruchs zum Dominieren gegenüber. Sie glauben, eher eigensinnig zu sein <strong>und</strong><br />
lieber zu lenken als gelenkt zu werden« (Beckmann u. a., 1972, S. 11 f.).<br />
Die Prüfung: Was wird da eigentlich geprüft?<br />
Bei denjenigen, die das Abschlußexamen erfolgreich <strong>und</strong> ohne besondere Schwierigkeiten<br />
durchstehen, haben sich die Unsicherheiten verloren, <strong>und</strong> das Bedürfnis, zu dominieren, sich<br />
durchzusetzen, hat vollständig die Oberhand gewonnen: »Hoch Leistungsmotivierte bringen<br />
bessere Leistungen im Rahmen langfristig beruflicher oder akademischer Zielsetzungen; sie<br />
bringen kurzfristig immer dann bessere Leistungen, wenn einsichtig ist, daß mit der Tätigkeit ein<br />
Bedürfnis, sich auszuzeichnen, befriedigt werden kann« (Scheer, Zenz, 1973, S. 25).<br />
Diejenigen Studierenden aber, die besondere Schwierigkeiten mit dem Studium hatten <strong>und</strong> dabei<br />
nicht gelernt haben, sich gegen die <strong>Uni</strong>-Situation zu wehren, die werden zuletzt durch die<br />
Prüfungsangst aus der Bahn geworfen. Diese <strong>Angst</strong> haben in Wirklichkeit alle. Der
entscheidende Punkt ist nicht, ob man sie hat oder nicht. Aber je nachdem, ob man<br />
mißerfolgsängstlich oder erfolgszuversichtlich ist, verhält man sich ganz anders zu ihr: Mißerfolgs<br />
44<br />
ängstliche »sind gekennzeichnet durch Zentrierung der Gedanken auf die eigene Person,<br />
schwaches Selbstwertgefühl <strong>und</strong> erhöhte Bereitschaft sich selbst zu kritisieren <strong>und</strong> in Frage zu<br />
stellen. ( ... ) Korrespondierend scheinen sie von ihrer Umgebung auch weniger positiv beurteilt<br />
zu werden als Nichtängstliche« (Gärtner-Harnach, 1972, S. 102). Dieses Verhalten ist besonders<br />
typisch für Kinder aus Arbeiterfamilien <strong>und</strong> Frauen (ebenda, S. 124).<br />
Der entscheidende Punkt ist aber, daß die erfolgszuversichtlichen Studierenden die<br />
Prüfungsangst im Moment der Prüfungssituation selbst überwinden, sie schütteln das für die<br />
Prüfungsangst kennzeichnende »allgemeine Unterlegenheitsgefühl« (Scheer, Zenz, 1973, S. 51<br />
<strong>und</strong> 56) ab <strong>und</strong> mobilisieren in der Prüfung sogar noch zusätzliche Energien: »Bei<br />
Erfolgszuversichtlichen können durch Streß unter Umständen erst die letzten Reserven zu einer<br />
positiven Leistung mobilisiert werden« (<strong>Wagner</strong>, 1., 1969, S. 17).<br />
Und genau in dieser zugespitzten Extrernsituation zeigt sich, wofür die <strong>Uni</strong>versität unabhängig<br />
vom einzelnen Fachinhalt qualifizieren soll, warum die Einstellung zum Erfolg das Trennkriterium<br />
ist, an dem sich entscheidet, ob das Studium zum Erlebnis des Scheiterns oder zum Schlüssel für<br />
einen gehobenen gesellschaftlichen Status wird. Die fächerübergeifende Untersuchung von<br />
akademischen Prüfungen hat nämlich ergeben: Dasjenige Verhalten, das in der Prüfung Erfolg<br />
brachte, war »im großen <strong>und</strong> ganzen gekennzeichnet durch selbstsicheres, optimistisches,<br />
anspruchsvolles Auftreten. Wir können daher davon ausgehen, daß dieses Verhalten genau das<br />
war, was die Prüfer von den Prüfungskandidaten erwartet haben. Die Prüfung wirkt wie eine<br />
Probe auf ein späteres Interaktionsverhalten. Nimmt man die vor der Prüfung von der Mehrheit<br />
der Studenten erlebte <strong>Angst</strong> hinzu, dann stellt sich folgendes heraus: Gefordert wird nicht, daß<br />
die Prüfungskandidaten <strong>Angst</strong> zeigen, daß sie sich, gleichsam am Boden zerstört, den Prüfern<br />
unterwerfen, sondern im Gegenteil: vielleicht vor der Prüfung <strong>Angst</strong> haben, diese aber<br />
überw<strong>und</strong>en haben, wenn sie in die Prüfung gehen, bzw. ... demonstrieren oder zumindest den<br />
Eindruck erwecken können, daß sie die <strong>Angst</strong> überw<strong>und</strong>en haben. Bei der Mehrzahl der<br />
Studierenden spielt sich das spätere berufliche Leben in gehobenen Positionen ab, die in<br />
größerem oder geringerem Maße Entscheidungsfähigkeit <strong>und</strong> fast immer Machtausübung über<br />
andere Leute verlangen. Wer sich in der Prüfung selbst ängstlich, gedrückt <strong>und</strong> selbstunsicher<br />
verhält, der zeigt, daß er die in seinen Berufspositionen erwarteten Führungsqualitäten nicht in<br />
erwünschter Weise besitzt. Mit anderen Worten: Das Prüfungssystem will den Kandidaten nicht<br />
das Rückgrat brechen, es will keine gebrochenen Individuen, sondern es will zukünftige<br />
Führungskräfte erzeugen, die die <strong>Angst</strong> kennen, sie aber überw<strong>und</strong>en haben. Prüfungen<br />
scheinen tatsächlich eine Art von Mutproben zu sein <strong>und</strong> ähneln hierin noch<br />
45<br />
heute den Initiationsriten sogenannter primitiver Völker. Ihre Funktion besteht heute wie damals<br />
in der Vermittlung eines neuen, gehobenen Statusbewußtseins« (Scheer, Zenz, 1973, S. 66).<br />
Diese für die spätere gesellschaftliche Herrschaftsfunktion entscheidende Qualifikation wird<br />
allerdings nicht erst durch das Prüfungssystem erzeugt, wie die Autoren der Untersuchung<br />
meinen, sondern durch das gesamte Studium. Die permanente <strong>Angst</strong>situation in der alltäglichen<br />
Kommunikation zwischen Studierenden, die für die <strong>Uni</strong>-Situation so kennzeichnend ist, wird durch<br />
das Erlernen der <strong>Angst</strong>abwehrfassade <strong>Bluff</strong> genauso überw<strong>und</strong>en wie später die Prüfungsangst.
Erfolg <strong>und</strong> Mißerfolg: Was bedeutet das?<br />
Die bisherige Analyse hat ergeben, daß der »heimliche Lehrplan« an der <strong>Uni</strong> über das<br />
Zusammenspiel von <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> <strong>und</strong> <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> die Studierenden in zwei Gruppen trennt: solche, die<br />
es schaffen, <strong>und</strong> die anderen, die während des Studiums herausfallen. Solange es keine<br />
kollektive <strong>und</strong> solidarische Gegenwehr gibt, entscheidet über Erfolg <strong>und</strong> Mißerfolg im Studium ein<br />
absurder Kreisschluß nach Art der sich selbst bestätigenden Prophezeihung: Die voller <strong>Angst</strong> auf<br />
den Mißerfolg starren, scheitern am Studium; die anderen, die voller Zuversicht den Erfolg<br />
erwarten, erleben ihn auch. Der Verlauf des Studiums entscheidet sich also - so scheint es jetzt -<br />
an der Einstellung zum Erfolg.<br />
Woran mißt sich aber der Erfolg? Was bestimmt den Mißerfolg? Aus sich selbst heraus geht das<br />
nicht. Es stellt sich also die Frage: Was bedeutet Erfolg? An welcher gesellschaftlichen Größe<br />
mißt sich das?<br />
Dazu muß ich wieder auf das Bild zurückgreifen, das die Gr<strong>und</strong>struktur der kapitalistischen<br />
Gesellschaft als eine warenproduzierende Gesellschaft erfaßt: die zersplitterten Produzenten, die<br />
voneinander nichts wissen <strong>und</strong> nur über den Umweg der von ihnen für den Verkauf auf dem Markt<br />
produzierten Dinge, über ihre Waren <strong>und</strong> das Geld, miteinander in Verbindung treten lind erst<br />
dadurch eigentlich zu einer Gesellschaft werden.<br />
Ich habe im zweiten Kapitel bereits gezeigt, wie diese Struktur weit über die unmittelbaren<br />
ökonomischen Warenbeziehungen unsere<br />
46<br />
Kornmunikationsformen <strong>und</strong> Verhallensweisen geprägt hat. Sie hat aber nicht immer gegolten:<br />
Vor dem Kapitalismus hat es Gesellschaftsformen gegeben, in denen zwar auch Waren<br />
produziert <strong>und</strong> ausgetauscht wurden, aber eben nur zum geringsten Teil. Das Überleben der<br />
Gesellschaft wurde vor allem dadurch gesichert, daß die Menschen diejenigen Produkte, die sie<br />
zum Überleben brauchten, selbst produzierten. Damals war das Erfolgskriterium ein ganz<br />
anderes als heute: Damals war an den Produkten, die man produzierte <strong>und</strong> mit denen<br />
umgegangen wurde (Werkzeuge) oder die man konsumierte (Lebensmittel), ihre Nützlichkeit<br />
entscheidend, also diejenigen Eigenschaften, die ein Problem lösen oder ein Bedürfnis<br />
befriedigen konnten. Wichtig war also die Qualität, die konkret nützliche Eigenschaft der Taten<br />
<strong>und</strong> der Dinge <strong>und</strong> nicht primär die Frage, wieviel Geld die einbringen würden. Erfolg <strong>und</strong> die<br />
gesellschaftliche Anerkennung, die mit dem Erfolg auch damals einherging, entstand aus der<br />
bewiesenen Fähigkeit, Probleme zu lösen, Nützliches zu tun, oder wie Marx das nennt:<br />
Gebrauchswerte zu produzieren.<br />
Dieses am Gebrauchswert orientierte Erfolgskriterium gilt auch heute noch in vielen Bereichen.<br />
Dort ist es aber reduziert auf einen Bereich der unmittelbaren mitmenschlichen Kommunikation,<br />
der einer gesamtgesellschaftlich gültigen Bewertung weitgehend entzogen ist: Im »privaten«<br />
Bereich, zwischen Fre<strong>und</strong>en <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>innen <strong>und</strong> in der Familie gibt es das noch, daß<br />
Anerkennung <strong>und</strong> Erfolg auf der Lösung konkreter Probleme basiert.<br />
Ansonsten aber ist das gebrauchswert-orientierte Erfolgskriterium überlagert <strong>und</strong> verdrängt<br />
worden durch ein Urteil über Erfolg <strong>und</strong> Mißerfolg, das mit dem jeweils konkret zu lösenden<br />
Problem, mit den Bedürfnissen der betroffenen Menschen <strong>und</strong> der Nützlichkeit der zu<br />
beurteilenden Handlung nur sehr vermittelt <strong>und</strong> eben auch sehr wenig zu tun hat: Zuerst einmal
ist die Austauschbarkeit entscheidend, d. h., daß die Leistung verkauft werden kann, daß sie sich<br />
über den Markt gegen anderes Produkt austauscht.<br />
Nutzloses kann man nicht verkaufen. Also müssen die Waren doch irgendwie Gebrauchswert<br />
haben; welchen, das ist aber egal. Entscheidend für die kapitalistische Gesellschaft ist letztlich,<br />
was dabei herausspringt <strong>und</strong> nicht die konkrete Nützlichkeit der verkauften Ware. Allein das gilt<br />
als Erfolg, wo am meisten Profit gemacht worden ist, <strong>und</strong> wenn dafür Nervengift <strong>und</strong><br />
Napalmbomben produziert worden sind. In der kapitalistischen Gesellschaft ist also das Kriterium<br />
für den Erfolg <strong>und</strong> Mißerfolg nicht so sehr das konkret Nützliche, sondern der Gegenwert, das,<br />
was man dafür kriegt oder wie Marx das nennt: der Tauschwert.<br />
Mit der Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft wird das Erfolgskriterium deshalb auch<br />
immer gleichgültiger gegenüber dem konkreten Inhalt der Tätigkeit, die den Erfolg oder Mißerfolg<br />
be<br />
47<br />
gründet, genauso wie es für den Kapitalisten egal ist, woraus er seinen Profit zieht. Beim Erfolg<br />
oder Mißerfolg in der zwischenmenschlichen Kommunikation gibt es kein so einfach in Quantität<br />
<strong>und</strong> in Geld ausdrückbares Erfolgskriterium, aber trotzdem gilt auch da: Entscheidend ist nicht so<br />
sehr, was du machst, sondern das, was du dafür kriegst.<br />
Damit stellt sich das in unserer Gesellschaft dominierende Erfolgskriterium direkt in denselben<br />
Zusammenhang wie die im zweiten Kapitel dargestellte Leistungsangst. Sie war in der<br />
Übertragung: die <strong>Angst</strong> davor, daß sich die Waren vielleicht nicht verkaufen lassen. Klar: in der<br />
universitären Kommunikation wird nichts wirklich verkauft oder getauscht, <strong>und</strong> die aufgewandte<br />
Arbeitskraft <strong>und</strong> durchschnittlich notwendige Arbeitszeit spielt hier überhaupt keine Rolle. Und<br />
doch: genauso wie sich die Leistungsangst auf alle Bereiche überträgt, die nicht direkt mit dem<br />
Marktgeschehen zusammenhängen, so entwickelt sich auch überall neben dem<br />
gebrauchswert-orientierten ein tauschwert-orientiertes Erfolgskriterium als die notwendige andere<br />
Seite der Leistungsangst. Derjenige, der die marktgerechten Fähigkeiten <strong>und</strong> Verhaltensweisen<br />
erlernt hat, sich den gängigen Konkurrenzerwartungen immer hat anpassen können, kann sich<br />
auch in der angstbesetzten <strong>Uni</strong>versitätssituation leicht gegen die aufkommende Leistungsangst<br />
wehren. Er braucht nur die bewährten Verhaltensweisen zu betonen, ihnen die Form zu geben,<br />
wie sie in der universitären <strong>Angst</strong>abwehrfassade <strong>Bluff</strong> tagtäglich vorexerziert wird, <strong>und</strong> die<br />
Anpassung an die <strong>Uni</strong>versität ist gelungen. Die Fähigkeiten, die dazu notwendig sind, habe ich<br />
vorhin bereits benannt: Sachlichkeit, Abstraktionsvermögen, distanzierte Aggressivität <strong>und</strong> - vor<br />
allem - Bestätigung des Selbstwertgefühls über Konkurrenz <strong>und</strong> Leistung. Das sind alles<br />
klassische Verhaltensweisen des Marktes: Sie beziehen sich auf Sachen <strong>und</strong> nicht auf Personen<br />
<strong>und</strong> setzen sich über das tauschwertorientierte Erfolgskriterium durch.<br />
So gesehen bekommt das Trennkriterium für das Überleben an der <strong>Uni</strong> ein ganz anderes Gesicht:<br />
Die <strong>Uni</strong> selektiert nicht mehr oder weniger zufällig nach den jeweils individuellen Erfahrungen der<br />
bisherigen Erziehung. Sondern da wird dasjenige Verhalten gefördert <strong>und</strong> belohnt, das in dieser<br />
Gesellschaft herrschaftskonform ist <strong>und</strong> dasjenige bestraft <strong>und</strong> unterdrückt, was sich diesem<br />
Kriterium des Marktes <strong>und</strong> damit dem Kriterium des Erfolges <strong>und</strong> der Herrschaft in dieser<br />
Gesellschaft nicht fügen kann oder nicht fügen will. Es ist deshalb keineswegs ein Zufall, daß die<br />
an der <strong>Uni</strong>versität Erfolgreichen gewöhnlich Menschen der Art sind, die in dieser Gesellschaft<br />
sowieso schon die Herrschaft ausüben: Männer, deren Väter zu oberen Gesellschaftsschichten<br />
gehören. Sie - die nicht ohne Gr<strong>und</strong> Erfolgszuversichtlichen - lernen im <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> den letzten<br />
Schliff einer Erfolgsfassade.
48<br />
Die gesellschaftliche Funktion des <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong>s<br />
Die Verhaltensweisen, die dazu selbst noch in den alltäglichen Situationen notwendig sind, z. B.<br />
im Restaurant, in der Oper oder beim Gartenfest, das selbstverständlich gewordene Auftreten,<br />
das überall Erfolgsgewohnheit, Überlegenheit <strong>und</strong> Sicherheit signalisiert, dieser<br />
Herrschaftshabitus wird an der <strong>Uni</strong>versität als »heimlicher Lehrplan« vermittelt, egal in welchem<br />
Fach.<br />
Wer dabei herausfällt, dient sogar noch als Sündenbock <strong>und</strong> Rechtfertigung für den Aufstieg der<br />
anderen <strong>und</strong> wird für das Scheitern an der <strong>Uni</strong> auch noch bestraft, wenn es ihm nicht gelingt, sich<br />
zu wehren (Moeller, Scheer, 1974, S. 103 f.). Das zeigt sich besonders deutlich an der<br />
Einstellung vieler Professoren <strong>und</strong> Studenten, die hohe Durchfallquoten in Prüfungen <strong>und</strong> hohe<br />
Abbruchquoten beim Studium als Beweis ansehen für ein besonders hohes »Niveau« des<br />
Studienganges <strong>und</strong> für die hervorragende Begabung der wenigen, die es geschafft haben<br />
(Eckstein, 1975, S. 172).<br />
Dabei zeigen alle empirischen Untersuchungen, daß der Studienerfolg keinesfalls von den<br />
intellektuellen Fähigkeiten abhängt (Saterdag, Apenburg, 1972, S. 139). Entscheidend ist allein<br />
die soziale Fähigkeit, sich zuerst in der universitären Kommunikation zurechtzufinden <strong>und</strong> dabei<br />
die universitäre Herrschaftssprache so gründlich einzuüben, daß sie zur Gewohnheit wird - zu<br />
einem Teil des eigenen Verhaltens, das dann auch in der Bewährungssituation Prüfung gebracht<br />
<strong>und</strong> dort als Beweis des hohen Niveaus geprüft <strong>und</strong> honoriert wird. Der Studienerfolg ist also<br />
davon abhängig, ob es gelingt, sich den <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> zu eigen zu machen, auf die angsterzeugende<br />
<strong>Uni</strong>-Situation immer ganz automatisch mit einer Fassade der Überlegenheit, der Selbstsicherheit<br />
<strong>und</strong> der Erfolgszuversicht zu reagieren.<br />
In England wird dieser eigentliche Inhalt der akademischen Ausbildung besonders deutlich: Dort<br />
wird die zukünftige Herrschaftselite nicht in einem unmittelbar ökonomisch, juristisch oder<br />
politisch wichtigen Fach ausgebildet. Das lernen sie später in einem zusätzlichen Studium <strong>und</strong> in<br />
der praktischen Berufstätigkeit selbst. Ihre eigentliche Gr<strong>und</strong>ausbildung erwerben sie in Oxford<br />
oder Cambridge, wo sie Griechisch oder Philosophie studieren. Was sie dabei wirklich lernen, ist<br />
der selbstsichere <strong>und</strong> erfolgszuversichtliche Herrschaftshabitus, den sie für alle ihre späteren<br />
Positionen benötigen. Die einzelnen, konkreten Anforderungen der späteren Berufstätigkeit<br />
werden sich sowieso ständig verändern. Auf sie kann das Studium nur zufällig vorbereiten.<br />
Wichtiger ist, daß auf Situationen, die in ihren Anforderungen unklar <strong>und</strong> im Gr<strong>und</strong>e<br />
angsteinflößend sind, mit der immer gleichen erfolgszuversichtlichen <strong>Angst</strong>abwehrfassade des<br />
<strong>Bluff</strong>s reagiert wird: Eigentlich kann ich<br />
49<br />
das schon <strong>und</strong> werde es jedenfalls bald besser machen als andere, weil ich eine kritische <strong>und</strong><br />
kreative Haltung habe. Der <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> als Herrschaftshabitus wird auch bei uns als der »heimliche<br />
Lehrplan« in allen Fächern beigebracht. Sein Lernziel ist die Produktion »des Akademikers«.<br />
Bei dieser Form der Herrschaftsreproduktion fallen aber sehr viele heraus, die mit hohen Kosten<br />
bis in die <strong>Uni</strong>versität gebracht worden sind. Ein Einwand könnte deshalb lauten: Das ist doch<br />
unökonomisch, reine Verschwendung. Das ist doch gegen alle Gesetze des Kapitalismus.<br />
Dagegen muß man sich vor Augen führen: Der Kapitalismus ist nur innerhalb des einzelnen<br />
Betriebes voll durchrationalisiert. Gesamtgesellschaftlich verläuft er chaotisch <strong>und</strong> behält alle
möglichen historischen Merkwürdigkeiten bei, solange sie nicht die betriebliche<br />
Kapitalreproduktion beeinträchtigen.<br />
Für die <strong>Uni</strong>versität ist deshalb die folgende Beschreibung sehr plausibel, in der die Rolle des<br />
universitären »heimlichen Lehrplans« bei der Aufrechterhaltung <strong>und</strong> Rechtfertigung der<br />
bestehenden Herrschaftsverhältnisse aufgezeigt wird:<br />
»Kurz, die vergeudete Zeit (<strong>und</strong> das vergeudete Geld) ist zugleich der Preis für die<br />
Verschleierung der Relation zwischen sozialer Herkunft <strong>und</strong> Studienerfolg; denn, wollte man<br />
billiger <strong>und</strong> schneller vollziehen, was das System ohnehin leistet, würde man eine Funktion<br />
offenlegen <strong>und</strong> damit hinfällig machen, die nur im verborgenen wirken kann. Das Bildungswesen<br />
legitimiert die Machtübergabe von einer Generation auf die andere immer um den Preis einer<br />
Vergeudung von Geld <strong>und</strong> Zeit ( . ) Mit den durch seine relative Autonomie bedingten Ideologien<br />
<strong>und</strong> Auswirkungen ist das Bildungswesen für die bürgerliche Gesellschaft in ihrer heutigen Phase<br />
das, was andere Formen der Legitimierung der Sozialordnung <strong>und</strong> der Vererbung der Privilegien<br />
für Gesellschaften waren, die sich in der Form ihrer Klassenbeziehungen <strong>und</strong> Antagonismen <strong>und</strong><br />
in der Art des vererbten Privilegs unterschieden: Trägt es nicht dazu bei, jede soziale Gruppe<br />
davon zu überzeugen, daß es das beste für sie ist, an dem Platz zu bleiben, der ihr von Natur<br />
zukommt, <strong>und</strong> sich daran zu halten ( . )? Der Erbe bürgerlicher Privilegien kann sich nicht auf das<br />
Recht der Geburt berufen - das seine Klasse der Aristokratie historisch aberkannt hat -, noch<br />
kann er sich auf das Naturrecht berufen - diese früher gegen aristokratische Unterscheidung<br />
gerichtete Waffe könnte sich nur allzu leicht auch gegen die bürgerliche >Distinktion< richten -,<br />
ebensowenig kann er sich auf die asketischen Tugenden berufen, die den Unternehmern der<br />
ersten Generation erlaubten, Erfolg durch Verdienst zu rechtfertigen. Er kann sich also nur auf<br />
seine Schulerfolge berufen, die zugleich seine Fähigkeiten <strong>und</strong> seinen Verdienst bescheinigen. (<br />
... ) In einer Gesellschaft, in der der Erwerb sozialer Privilegien<br />
50<br />
immer enger vom Besitz eines akademischen Diploms abhängt, hat das Bildungswesen nicht nur<br />
die Funktion, auf diskrete Weise die Erbfolge bürgerlicher Rechte, die man nicht mehr direkt <strong>und</strong><br />
offen weitergeben kann, abzusichern. Als privilegiertes Instrument ( ... ), das den Privilegierten<br />
jenes höchste Privileg verschafft, nicht als Privilegierte zu erscheinen, überzeugt sie die<br />
Unterprivilegierten um so leichter davon, daß ihr soziales Schicksal <strong>und</strong> ihr Bildungsschicksal auf<br />
ihrem Mangel an Fähigkeiten oder Verdienst beruhen, ( ... » (Bourdieu, Passeron, 1971, S. 226<br />
ff.).<br />
Damit wird die <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> mit ihrer Abwehrfassade <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> zu einem wichtigen Mittel der<br />
Herrschaftsreproduktion in der b<strong>und</strong>esrepublikanischen Gesellschaft. Zwar liegt die eigentliche<br />
Basis der Herrschaft in einer kapitalistischen Gesellschaft in der Verfügung über die<br />
Produktionsmittel. Diese in der ökonomischen Verfügungsgewalt begründete Herrschaft muß sich<br />
aber gesellschaftlich über das Verhalten von Individuen in den verschiedensten Bereichen<br />
durchsetzen. Das Kapital als akkumuliertes Geld <strong>und</strong> als privat besessene Produktionsmittel ist<br />
für sich allein nichts als Papier <strong>und</strong> Maschinen. Es muß durch die handelnden Individuen im<br />
gesellschaftlichen Verkehr vertreten <strong>und</strong> als Herrschaft durchgesetzt werden. Dazu erzieht die<br />
<strong>Uni</strong>.<br />
Klar auch: Niemand steuert das bewußt oder hat sich in einer genialen Verschwörung diesen<br />
raffinierten Mechanismus von <strong>Uni</strong><strong>Angst</strong> <strong>und</strong> <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> ausgedacht. Dieser erfüllt seine Funktion,<br />
ohne daß das auch nur einem der Träger dieser Funktion je bewußt werden muß. Und solange
sie als ständiges Nebenprodukt der inhaltlichen Ausbildung abfällt, gibt es keinen Gr<strong>und</strong>, etwas<br />
zu verändern.<br />
... <strong>und</strong> wie ist das an der Massenuniversität?<br />
Wenn man die Prognosen über die Akademikerarbeitslosigkeit der achtziger Jahre kennt, dann<br />
kann man als Betroffener oder Betroffene wahrscheinlich nur ein müdes Lächeln bringen für die<br />
These, an der <strong>Uni</strong> würden die Führungskader von morgen herangezüchtet. Schauen wir uns<br />
Großbritannien, die USA oder auch Schweden an, wo die sprunghafte Ausdehnung der<br />
Ausbildungskapazitäten vor langer Zeit gelaufen ist (dort besuchen über 30 % eines Jahrganges<br />
die <strong>Uni</strong>versität, bei uns immer noch unter 10 %!).Nimmt man diese Länder als Modell für die<br />
mögliche Entwicklung in der B<strong>und</strong>esrepublik, dann wird folgendes deutlich: Die<br />
Akademikerarbeitslosigkeit ist wahrscheinlich eine Übergangserscheinung, bis sich die<br />
Differenzierung der <strong>Uni</strong>versitätsausbildung in Elitenreproduktion <strong>und</strong> Ausbildung normaler,<br />
höherqualifizierter Arbeitskräfte mit hoher Mobilität durchgesetzt hat.<br />
51<br />
Jetzt meinen noch beinahe alle Studierenden, das Studium berechtige sie zu einer gehobenen<br />
Stellung im spezifischen Bereich ihrer Ausbildung. In den USA berechtigt inzwischen der<br />
<strong>Uni</strong>versitätsBesuch zu irgendeinem Job auf der Angestelltenebene, mehr nicht. Nur die Leute, die<br />
über die erste Abschlußprüfung hinaus studieren oder in eins der berühmten Elite-Colleges<br />
gehen, haben Anspruch auf eine der sogenannten »höheren Stellungen«. Ich vermute, daß auch<br />
bei uns nach <strong>und</strong> nach die Unterscheidung in Rezeptemacher <strong>und</strong> Rezepteanwender sich<br />
durchsetzen wird. Das Vehikel dazu dürfte die Regelstudienzeit sein: Alle, die sich mit diesem<br />
Abschluß zufriedengeben, stellen das akademische Fußvolk. Die zukünftige Herrschaftselite läßt<br />
sich dann wohl über diejenigen rekrutieren, die ein Aufbaustudium weitertreiben, den Magister<br />
oder Doktor machen wollen.<br />
In der Zwischenzeit, bis sich dieser wahrscheinliche Wandel nach dem Vorbild der USA vollzogen<br />
hat, wird die deutsche <strong>Uni</strong>versität aber immer unerträglicher, wenn es nicht gelingt, aus der<br />
eigenen Lebensgeschichte <strong>und</strong> aus den eigenen Zukunftsvorstellungen für sich selbst in einer<br />
Gruppe einen Sinn für das Studium neu zu bestimmen. (Das wird das Hauptthema des nächsten<br />
Kapitels sein.) So wie sie jetzt ist, verliert die <strong>Uni</strong>versität für die meisten Studierenden immer<br />
mehr jeden Sinn: Die Führungspositionen, zu denen sie den passenden Habitus liefert, gibt es<br />
nur noch für ganz wenige. Viele wollen <strong>und</strong> können auf solche Positionen auch gar nicht mehr<br />
spekulieren. Die Alternative: ein sinnvolles, inhaltlich fruchtbares Studium, kann unter den<br />
chaotischen <strong>und</strong> bedrückenden gegenwärtigen Studienbedingungen auch nur ausnahmsweise<br />
gelingen. Es ist deshalb nicht verw<strong>und</strong>erlich, wenn sich immer mehr Studierende sagen: Diese<br />
<strong>Uni</strong>versität muß sich ändern, <strong>und</strong> zwar gründlich, sonst ist sie es nur noch wert, lahmgelegt zu<br />
werden.<br />
Jetzt im Herbst 1978 sind die wahrscheinlichen Entwicklungen in der Hochschulreform viel<br />
deutlicher geworden als sie es damals waren, als ich den ursprünglichen Text geschrieben habe.<br />
Der Wissenschaftsrat <strong>und</strong> das B<strong>und</strong>esministerium für Bildung <strong>und</strong> Wissenschaft stellen sich das<br />
so vor: Die Masse aller Studierenden soll schon nach einem nur dreijährigen Kurzstudium für<br />
mittlere Positionen im Berufsleben qualifiziert sein - ohne die bisherigen Ansprüche an eine<br />
Akadermikerstellung. Das Studium dazu wird entsprechend verschult <strong>und</strong> in<br />
unzusammenhängende Paukeinheiten aufgeteilt. Dabei ist Flexibilität <strong>und</strong> Anpassungsfähigkeit<br />
an neue Problemlagen oberstes Ziel. Gleichzeitig sollen die Absolventen dieses Kurzstudiums<br />
ihre Berufsansprüche entsprechend herunterschrauben. Denn nur die Besten \%erden zu einem<br />
weiterführenden Studium zugelassen, das aber auch wieder unter das Fallbeil der
Regelstudienzeit gelegt ist. Aus diesen wenigen wird dann die neue Herrschaftselite ausgewählt,<br />
die sich im völlig unreglementierten Aufbaustudium zum Vollakademiker mit Doktortitel<br />
qualifizieren darf.<br />
52<br />
viertes Kapitel<br />
<strong>Wie</strong> sich wehren?<br />
Nach dem, was ich bis hierher geschrieben habe, sieht es so aus, als gebe es nur zwei<br />
Entwicklungsmöglichkeiten im Studium. Entweder du fällst irgendwann heraus auf mehr oder<br />
weniger schlimme<br />
Weise, oder du veränderst dich so, daß du dich an die <strong>Uni</strong> anpaßt, den <strong>Bluff</strong> erlernst <strong>und</strong><br />
Akademiker wirst. Beides sind aber nur verschiedene Weisen, sich im Studium selbst zu<br />
verlieren. <strong>Wie</strong> also studieren <strong>und</strong> sich nicht verlieren?<br />
ich kann hier jetzt selbstverständlich nicht das große Zauberkaninchen aus dem Hut ziehen, das<br />
alle Probleme löst. Was ich tun will ist folgendes: Ich versuche, alles darzustellen <strong>und</strong> in einen<br />
Zusammenhang zu bringen, was ich an möglichen Ansatzpunkten für Gegenwehr an der <strong>Uni</strong><br />
erlebt, gehört <strong>und</strong> gelesen habe. Dabei will ich mich bemühen, auch gleich etwas über die<br />
Schwierigkeiten zu sagen, die dabei entstehen, damit ich nicht zu allem anderen auch noch den<br />
Frust über zerstörte Hoffnungen hinzufüge. Vieles von dem, was ich hier vorschlage, stammt also<br />
gar nicht aus meiner eigenen Erfahrung, sondern ich habe davon gehört oder habe es mir<br />
ausgedacht, ohne es bisher selbst probieren zu können. Das mußt du bedenken, wenn beim<br />
Selberprobieren Schwierigkeiten auftauchen, von denen hier gar nicht die Rede war. Da mußt du<br />
zusammen mit anderen genauso wie ich gucken, ob euch nicht etwas Besseres einfällt.<br />
Das Ziel: die <strong>Angst</strong> überwinden<br />
Für die <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> gibt es viele Gründe, die mit dem Verhältnis zwischen den Studierenden nichts<br />
zu tun haben: der Prüfungsdruck, die Konkurrenz um Noten <strong>und</strong> Stipendien, das Ordnungsrecht<br />
<strong>und</strong> die um sich greifenden Eingriffe des Staates <strong>und</strong> die immer durchschlagendere<br />
Reglementierung des Studiums. Vor allem aber übt die Ungewißheit, ob es nach dem Studium<br />
eine sinnvolle Berufsperspektive geben kann, einen ungeheuren Druck aus, der alles in Frage<br />
stellt, was du während des Studiums machst.<br />
Und doch wird der größte Teil dieser <strong>Angst</strong>, die dann den <strong>Bluff</strong> erzeugt gar nicht durch diese<br />
äußerliche Wirklichkeit erzeugt, sondern durch das Verhalten der Studierenden zueinander:<br />
unausgesprochene Konkurrenz <strong>und</strong> projizierte Leistungsanforderungen selbst in Bereichen, wo<br />
es gar niemanden gibt, der Noten oder ähnliches vergibt, produzieren Isolation <strong>und</strong> <strong>Angst</strong> auch<br />
dort, wo sie von<br />
53<br />
der äußerlichen Wirklichkeit her gar nicht erklärlich ist. Der erste Schritt beim Sichwehren muß<br />
also sein, diese überschüssige, auch angesichts der beschissenen Wirklichkeit unnötige <strong>Angst</strong><br />
abzubauen. Denn sie ist eines der entscheidenden Hindernisse für eine Solidarität, ohne die<br />
auch die beschissene Wirklichkeit nicht verändert werden kann.
Diese überschüssige <strong>Angst</strong> kann aber nur abgebaut werden, wenn wir aufhören, uns gegenseitig<br />
Stärke vorzuspielen; wenn wir die Erfahrung machen können, daß wir auch mit dem, was wir als<br />
»Schwäche« ansehen, akzeptiert werden. Der <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> ist nur die universitäre Spielart dieses<br />
sich <strong>und</strong> anderen Stärke Vorspielens. Wenn es also gelingt, das, was dir an der <strong>Uni</strong> <strong>Angst</strong> macht,<br />
auszusprechen <strong>und</strong> mit den anderen zu diskutieren, dann verschwindet mit der <strong>Uni</strong><strong>Angst</strong> auch die<br />
Notwendigkeit der <strong>Bluff</strong>-Fassade.<br />
Daß so etwas an der <strong>Uni</strong> durchaus geht, zeigt ein Erfahrungsbericht eines Studenten, der<br />
zusätzlich zu den spezifischen <strong>Uni</strong>Ängsten auch noch fürchten mußte, wegen seines Schwulseins<br />
abgelehnt zu werden: »Es weiß ja keiner, daß ich schwul bin, <strong>und</strong> ich traue mich auch nicht, es zu<br />
erzählen. Da ist sie wieder, diese <strong>Angst</strong>, ausgestoßen zu werden, nicht als vollwertig zu gelten,<br />
allein weiterstudieren zu müssen.« Diese Situation änderte sich für ihn völlig, nachdem er in<br />
Diskussionen bei der Homosexuellen Aktion Hamburg gelernt hatte, zusammen mit anderen<br />
Schwulen an der <strong>Uni</strong> auch über sein Schwulsein offen zu reden: Das Beispiel ermutigte andere<br />
dazu, auch von ihren Problemen zu reden, ȟber die sie vorher nicht sprechen mochten oder<br />
konnten. Es ist also nicht nur für mich, sondern auch für andere vorteilhaft gewesen, daß ich mein<br />
Versteckspiel aufgegeben habe. Ich kann jetzt auch in der <strong>Uni</strong> über meine Probleme offener<br />
reden, weshalb ich mich dort wohler fühle als früher« (aus: Rosa 7, Zeitschrift für Homosexuelle<br />
Aktion Hamburg).<br />
Die andere Voraussetzung für die Erfahrung, daß die <strong>Angst</strong> gar nicht nötig ist, kann nur mit<br />
großen Schwierigkeiten hergestellt werden, ist aber besonders wichtig. Du brauchst eine<br />
solidarische Gruppe von Leuten, bei denen du weißt, die kritisieren dich schon auch mal ganz<br />
schön scharf, aber sie wollen dich nie fertig machen. Nur dann kannst du nämlich nach <strong>und</strong> nach<br />
versuchsweise deine Ängste herauslassen. So kannst du dann die Erfahrung machen, daß du<br />
auch weiterhin akzeptiert bist, auch wenn du nicht all das weißt, was du meinst wissen zu<br />
müssen. Danach kannst du langsam freiere, offenere <strong>und</strong> selbstbewußtere Verhaltensweisen<br />
einüben. Zuerst geht das sicherlich nur in dem schützenden Klima der Gruppe, weil dir die klugen<br />
Gesichter der anderen immer noch <strong>Angst</strong> einjagen <strong>und</strong> weil du noch nicht gelernt hast, dich<br />
gegen die Diskussionsterroristen wirksam zu wehren. Das kommt aber vielleicht auch noch, wenn<br />
ihr als Gruppe euch gegenseitig in solchen Diskus<br />
54<br />
sionen unterstützt nach einem Plan, den ihr vorher ausgearbeitet habt.<br />
Bei mir lief das so: <strong>Wie</strong> gesagt, ich war vor der Studentenbewegung in der CDU <strong>und</strong> hing sehr<br />
vereinsamt, verkrampft <strong>und</strong> bis oben voll mit Ängsten <strong>und</strong> den entsprechenden<br />
<strong>Angst</strong>abwehrfassaden an der <strong>Uni</strong> herum. Ich hatte gerade eine Phase extremer Depressionen,<br />
die ich durch Leistung zu überwinden suchte, was selbstverständlich schief ging. In dieser Zeit<br />
stieß ich in einem Seminar zu einer Arbeitsgruppe, die sich nicht nur einfach mit dem<br />
wissenschaftlichen Thema beschäftigte. Darüber hinaus unterhielten wir uns in der Gruppe sehr<br />
intensiv über unsere persönliche Vergangenheit mit dem Ziel, herauszufinden, was uns in<br />
unseren Verhaltensweisen <strong>und</strong> politischen Einstellungen geprägt hatte. Damals zu Beginn der<br />
Studentenrevolte hatte nämlich die Entdeckung der Sozialwissenschaftler eine große Wirkung,<br />
daß der deutsche Faschismus sehr eng mit den autoritären Einstellungen zusammenhing, die in<br />
der traditionellen Kleinfamilie erlernt werden. Die Gruppen nannten sich damals vor allem<br />
deshalb antiautoritär, weil sie diesem Strickmuster autoritären Verhaltens, das den<br />
Nationalsozialismus mit möglich gemacht hatte, auf die Spur kommen <strong>und</strong> bekämpfen wollten.<br />
Dies nur zur Erklärung, wie wir in der Arbeitsgruppe überhaupt dazu gekommen waren, über<br />
unsere persönliche Entwicklung zu diskutieren. Deshalb konnten wir auch über unsere
Schwierigkeiten <strong>und</strong> »Schwächen« in einer solidarischen Weise offen reden, denn bei diesem<br />
Verständnis von Politik entlarvten wir nicht uns selbst, wenn wir unsere Macken offenlegten,<br />
sondern die Gesellschaft.<br />
Ich wurde in dieser Gruppe wegen meiner manchmal sehr verschrobenen Einstellungen <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen nicht persönlich abgelehnt, wenn auch fre<strong>und</strong>lich, aber unnachgiebig darüber<br />
diskutiert wurde. So war es mir überhaupt möglich, mich nicht auf meine Positionen bockig zu<br />
versteifen, um so wenigstens mir selbst gegenüber mein Selbstwertgefühl zu retten. Ich konnte<br />
über mich selbst lernen, wie ich zu den Positionen gekommen war, sie kritisch diskutieren, ohne<br />
daß damit ich als Mensch insgesamt zur Diskussion stand. Und deshalb konnte ich wohl auch<br />
viele dieser Positionen aufgeben ohne das Gefühl der Kapitulation, sondern mit dem.<br />
Selbstbewußtsein, daß ich ungeheuer viel gelernt hatte. Dabei waren die Diskussionen gar nicht<br />
einmal so sehr »politisch« in dem Verständnis, das sich inzwischen wieder eingebürgert hat. Wir<br />
redeten mehr über Sexualität, Erziehungsprobleme, Schulerfahrungen, Elternkonflikte als über<br />
Vietnam. Über das redeten wir aber selbstverständlich auch.<br />
Ich glaube übrigens, daß die universitäre Linke Ende der sechziger Jahre vor allem darum den<br />
Sprung zur Massenbewegung an der <strong>Uni</strong> geschafft hat, weil sie dieses breite Verständnis von<br />
Politik ent<br />
55<br />
wickelt hatte. Dadurch wurde es in ganz vielen Bereichen plötzlich so wie bei mir möglich, die<br />
Isolation <strong>und</strong> Kälte der <strong>Uni</strong>versität zu durchbrechen <strong>und</strong> über seine eigenen Probleme mit<br />
anderen zusammen offen <strong>und</strong> solidarisch zu reden <strong>und</strong> dabei ungeheuer viel über sich <strong>und</strong> die<br />
Gesellschaft zu lernen. Gleichzeitig konnte man die Wut in den radikalen Veranstaltungen nach<br />
außen wenden, die sich aus dem Begreifen entwickelte, was einem selbst <strong>und</strong> anderen in dieser<br />
Gesellschaft angetan wird, ohne daß man es davor richtig bemerkt hatte. Diese Möglichkeit, die<br />
in diesem Politikverständnis steckte, kam den dringenden Bedürfnissen der meisten Studierenden<br />
entgegen <strong>und</strong> löste dann bei vielen anderen wie bei mir einen rasenden Lerntaumel aus.<br />
Besonders wichtig für die Bewältigung der <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> war an dieser Gruppe damals, daß wir diese<br />
Diskussionen nicht auf die Gruppe beschränkten. Wir schrieben ein ausführliches Protokoll<br />
unseres eigenen Lernprozesses <strong>und</strong> brachten das dann als Vorspann zum Papier über das<br />
wissenschaftliche Thema in das Seminar ein. Das war damals unerhört. Es war ein richtiges<br />
Seminar mit hochgestochener Theorie <strong>und</strong> höchstem Niveau, wie immer wieder vom Professor<br />
betont wurde. Es war mir kaum jemals möglich gewesen, dort etwas zu sagen, ohne daß ich<br />
Schweißausbrüche bekam <strong>und</strong> so stockend <strong>und</strong> verkürzt sprach, daß mich nie jemand verstand.<br />
Und jetzt kamen wir in diesen Tempel der Wissenschaft <strong>und</strong> bestanden darauf, über unsere<br />
persönliche Entwicklung zu reden <strong>und</strong> unsere Probleme mit dem Seminar im Seminar selbst zu<br />
diskutieren. Für mich bedeutete es ein Schlüsselerlebnis <strong>und</strong> so etwas wie eine Wende in<br />
meinem Verhältnis zur <strong>Uni</strong>, als der Prof <strong>und</strong> seine Jünger zuerst über den »Niveauverlust«<br />
rumbrüllten <strong>und</strong> schließlich mit hochrotem Kopf aus dem Raum stürzten, als wir ihm die<br />
Diskussionsleitung entzogen hatten, weil er sich geweigert hatte, unser Papier diskutieren zu<br />
lassen. Ich hatte damals das Gefühl: Das ist eine neue <strong>Uni</strong> geworden, wir haben sie sozusagen<br />
enteignet. Jetzt war es unsere <strong>Uni</strong> geworden <strong>und</strong> nicht mehr die von dem Prof.<br />
Das ist heute alles sehr viel schwieriger geworden. Nicht nur weil es inzwischen das<br />
Ordnungsrecht gibt <strong>und</strong> weil die Verschulung der Studiengänge oft kaum noch Spielraum läßt für<br />
solche Gruppenprozesse, die ja unvorstellbar viel Zeit kosten. Zusätzlich erschwert wird so etwas<br />
heute durch die Vertreter der verknöcherten politischen Organisationen an den <strong>Uni</strong>s mit ihrem
Verständnis von Politik als Haupt- <strong>und</strong> Staatsaktion. Sie haben ungeheure <strong>Angst</strong> davor, über<br />
persönliche Probleme zu reden, weil das angeblich entpolitisiere. Das befürchten sie zu Recht.<br />
Denn wenn sie tatsächlich ernsthaft sich selbst einbringen würden, könnten sie ihre Art<br />
Stellvertreterpolitik <strong>und</strong> Selbstverleugnung nicht mehr lange machen.<br />
Trotz all dieser erschwerenden Bedingungen ist ein solcher Lernprozeß in solidarischen Gruppen<br />
noch möglich. Das wird sehr ein<br />
56<br />
drucksvoll von vielen Frauengruppen demonstriert, die sich innerhalb <strong>und</strong> außerhalb der <strong>Uni</strong><br />
zusammengeschlossen haben, um ihre bedrückende <strong>und</strong> angsteinflößende Situation gemeinsam<br />
zu diskutieren <strong>und</strong> zu verändern. Ich verstehe ihre Weigerung, dort auch zusammen mit Männern<br />
zu arbeiten, unter anderem als den Versuch, eine Atmosphäre zu schaffen, in der es leichter ist,<br />
bestimmte Ängste offenzulegen <strong>und</strong> anderes Verhalten zu versuchen. Das halte ich für<br />
außerordentlich wichtig. Davon sollten auch andere, gemischte Gruppen lernen: Wenn sich<br />
einzelne Personen oder Gruppen so terroristisch aufspielen <strong>und</strong> sich davon auch nicht durch<br />
Diskussionen abbringen lassen, daß eine angstabbauende solidarische Diskussion unmöglich<br />
wird, dann meine ich, ist es gerechtfertigt, sie notfalls auch mit Gewalt aus der Gruppe<br />
hinauszuwerfen.<br />
So brutal das klingt, es geht nicht anders. Die langsam wachsende Sicherheit in einem<br />
alternativen Verhalten, das aus der Erfahrung kommt, daß die <strong>Angst</strong> gar nicht notwendig ist, kann<br />
sich in der Gruppe nur entwickeln, wenn eine Gr<strong>und</strong>stimmung des sich gegenseitig Akzeptierens<br />
da ist auch dann, wenn es noch so harte inhaltliche Diskussionen gibt. Es ist dann immer noch<br />
schwierig genug, diese Verhaltensweisen <strong>und</strong> diese Sicherheit gemeinsam auch nach außen zu<br />
vertreten.<br />
Die entscheidenden Schwierigkeiten bei der Überwindung der <strong>Uni</strong><strong>Angst</strong> stecken aber ganz<br />
woanders: Einmal haben diese Ängste gesellschaftliche Ursachen, die sich nicht einfach durch<br />
Selbsterfahrung in solidarischen Gruppen überwinden <strong>und</strong> wirkungslos machen lassen. Ich will<br />
deshalb zuerst versuchen, diese Ursachen zu benennen, um daraus Konsequenzen für eine<br />
Gegenstrategie zu ziehen. Die andere Schwierigkeit besteht darin, daß diese Ängste <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen im Verlauf der Lebensgeschichte tief in die Köpfe eingeprägt sind <strong>und</strong> sich<br />
nicht so leicht verändern lassen. Es muß also dann ein Konzept für eine lang anhaltende<br />
Gruppenarbeit entwickelt werden, die einen solchen Prozeß trotz aller Rückschläge <strong>und</strong><br />
Schwierigkeiten durchstehen hilft.<br />
Gesellschaftliche Ursachen - oder: Wo es langgehen soll<br />
In den beiden vorangegangenen Kapiteln stellte sich immer wieder als letztliche Ursache sowohl<br />
für die <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> wie für den <strong>Uni</strong><strong>Bluff</strong> die Gr<strong>und</strong>struktur der kapitalistischen Gesellschaft heraus.<br />
Bei der <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> zeigte sich, daß sie nur die besondere universitäre Erscheinung der<br />
Leistungsangst ist. Beim <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> war es das tauschwertorientierte Erfolgskriterium, das ihn zum<br />
Hauptträger des »heimlichen Lehrplans« macht. Diese Orientierung am Tauschwert verschiebt in<br />
allen Bereichen den Sinn aller Handlungen auf<br />
57<br />
das, was man dafür kriegt - Profit, Prestige oder Wählerstimmen. <strong>Wie</strong> <strong>und</strong> wofür man das kriegt,<br />
spielt kaum eine Rolle.
An der <strong>Uni</strong> führt dieses dem Inhalt äußerliche Kriterium für Sinn <strong>und</strong> Erfolg des Handelns dazu,<br />
daß die nützlichen Eigenschaften von Wissenschaft in den Hintergr<strong>und</strong> treten <strong>und</strong> sie ebenfalls<br />
nur noch zum Mittel wird, um sich Titel, Stellen <strong>und</strong> Prestige einzuhandeln. Wissen verliert seinen<br />
problemlösenden Charakter <strong>und</strong> wird nur noch angehäuft, um es ganz ähnlich in den<br />
Konkurrenzkampf einzubringen, wie die Bauern auf der Schwäbischen Alb ihre Stellung im Dorf<br />
an der Größe ihres Misthaufens vor dem Haus mes- sen. Indem der nützliche Charakter von<br />
Wissen in den Hintergr<strong>und</strong> tritt <strong>und</strong> es zunehmend nur noch Vehikel für Prestige <strong>und</strong> Aufstieg<br />
wird, verschiebt sich die eigentliche Funktion der <strong>Uni</strong>versität von der Ausbildung inhaltlicher<br />
Fähigkeiten auf die Vermittlung eines bestimmten Herrschaftshabitus, der für die entsprechenden<br />
Herrschaftspositionen qualifiziert. Alle empirischen Untersuchungen zeigen, daß der<br />
Studienerfolg keinesfalls von den intellektuellen Fähigkeiten der Studierenden abhängt<br />
(Saterdag, Apenburg, 1972, S. 139). Entscheidend ist allein die soziale Fähigkeit, sich in der<br />
universitären Kommunikation zurechtzufinden <strong>und</strong> dabei die universitäre Herrschaftssprache so<br />
gründlich einzuüben, daß sie zur Gewohnheit wird, zu einem Teil des eigenen Verhaltens, das<br />
dann auch in der Bewährungssituation Prüfung gebracht <strong>und</strong> dort als Beweis des hohen Niveaus<br />
geprüft <strong>und</strong> honoriert wird.<br />
Aber nicht nur in der <strong>Uni</strong> prägt das tauschwertorientierte Erfolgskriterium die eigentliche Funktion<br />
der Institution. Marx hat mit seiner Kapitalismusanalyse gezeigt, daß diese Dominanz des<br />
Tauschwerts über den Gebrauchswert das entscheidende Kennzeichen für die kapitalistische<br />
Gesellschaft ausmacht <strong>und</strong> sie in allen ihren spezifischen Erscheinungsweisen <strong>und</strong><br />
Widersprüchen prägt. Ich meine deshalb, daß jeder Versuch der Gegenwehr, jede Strategie<br />
gegen diese Dominanz sich ganz an diesem Gegensatz zwischen Tauschwert <strong>und</strong><br />
Gebrauchswert entwickeln muß. Sie muß ihr Ziel darin sehen, gebrauswertorientierte Sinn- <strong>und</strong><br />
Erfolgskriterien zu bestärken, bedürfnisorientierte Verhaltensweisen, Zusammenhänge <strong>und</strong><br />
Kommunikation zu entwickeln <strong>und</strong> sie immer wieder mit den tauschwertorientierten<br />
Verhaltensweisen (die eigenen eingeschlossen) zu konfrontieren.<br />
Was heißt das nun konkret für die <strong>Uni</strong>?<br />
Gebrauchswert, das sind alle diejenigen Eigenschaften eines Dings, die menschliche Bedürfnisse<br />
befriedigen. Was kann dann der Gebrauchswert des Studiums sein? Ich meine, das ist die<br />
entscheidende Frage für eine Gegenstrategie.<br />
Das wird bestätigt durch die Tatsache, daß sich unter den Studienabbrechern <strong>und</strong> den<br />
Studierenden mit extrem langer Studienzeit überproportional viele fanden, die sehr vage<br />
Vorstellungen über ih<br />
58<br />
re Studienziele hatten (Saterdag, Apenburg, 1972, S. 60). Es ist also tatsächlich der<br />
entscheidende Punkt bei der Gegenwehr gegen die <strong>Uni</strong>-Strukturen, sich eine langfristige<br />
Zielsetzung zu verschaffen, was nichts anderes bedeutet als sich über den Gebrauchswert des<br />
Studiums klar zu werden. Erst dann ist es möglich, gezielt zu studieren, sich aus der chaotischen<br />
<strong>Uni</strong>-Situation selbst einen sinnvollen Studienplan zusammenzustellen <strong>und</strong> die sinnentleerten<br />
Situationen zu beenden.<br />
Der Sinn des Studiums darf sich aber nicht allein darin erschöpfen, daß man damit später einen<br />
Job bekommt, denn damit wird die Studienzeit zum bloßen Mittel, wird bloße Übergangssituation.<br />
Es lohnt gar nicht richtig, sich auf sie ernsthaft einzulassen, an der Verbesserung der<br />
Studiensituation zu arbeiten. Das Studium erhält dann einen Stellenwert wie es der Wehrdienst
für die Männer hat: eine Zeit, die man hinter sich bringen muß mit möglichst wenig<br />
Reibungswiderstand. Bedenkt man aber, daß ein Studium im Schnitt vier bis fünf Jahre dauert,<br />
läuft das darauf hinaus, fünf Jahre seines Lebens abzuschreiben - erst recht dann, wenn der<br />
Arbeitsmarkt nachher den erhofften Job nicht bereithält! Normalerweise, wenn es nicht um das<br />
Studium ginge, sondern um einen befristeten Arbeitsvertrag auch nur für zwei oder drei Jahre,<br />
würdest du dich auf den Arbeitsplatz voll einlassen <strong>und</strong> versuchen, das Beste daraus für dich <strong>und</strong><br />
deine Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen zu machen.<br />
Es ist also absurd <strong>und</strong> verhängnisvoll, wenn der Sinn des Studiums <strong>und</strong> die Probleme, an denen<br />
du arbeiten willst, allein oder auch nur vor allem über die je nach Arbeitsmarktlage zugänglichen<br />
Jobs bestimmt wird. Der Sinn des Studiums muß so viel mit dir selbst zu tun haben, daß es dir<br />
etwas bringt, auch wenn es dir keinen Job bringt.<br />
Ein wichtiger Teil im Gebrauchswert des Studiums kann es deshalb auch sein, Erfahrungen zu<br />
machen, wie sie B. Möller in einem Auf, satz mit dem Titel »Widersprüche überleben« seht<br />
sinnlich beschreibt: »In Akten der Verweigerung, in der Erfahrung, einmal den Mut zum<br />
Aufmucken gehabt zu haben, in Erfahrungen unerwarteter Solidarität, in Erfahrungen von Zorn<br />
<strong>und</strong> Abscheu, die einem den eigenen Willen zum Widerstand gewiß machen, in Erfahrungen<br />
befreiter Körperlichkeit, von Zärtlichkeit, die Besitzdenken ausschließt; auch <strong>und</strong> nicht zuletzt die<br />
Erfahrung glückenden Denkens. Die Erfahrung, einmal wirklich für sich selbst ein Stück<br />
>Schleier< zerrissen zu haben, ist als sinnliche Erfahrung des Denkenden nicht dauerhaft, kann<br />
es nicht sein. Aber sie allein erhält die Lust am Denken oder doch die Hoffnung auf diese Lust«<br />
(Möller, 1974 S. 48).<br />
59<br />
Gebrauchswert des Studiums: eigene Probleme lösen!<br />
In den Diskussionen über den Sinn des Studiums, die du in deiner Gruppe führst, genügen solche<br />
sinnlichen Erfahrungen nicht zur Beschreibung dessen, was mit dem Studium erreicht werden<br />
soll. Trotzdem setzt das Zitat an der richtigen Stelle an, wie ich meine, nämlich an der eigenen<br />
Person, den eigenen Erfahrungen <strong>und</strong> Bedürfnissen. Das Studium <strong>und</strong> das, was du dabei tust,<br />
muß etwas mit dir zu tun haben, muß Probleme lösen, die deine eigenen sind, wenn es dir etwas<br />
nützen soll. Es ist deshalb für eine Gegenwehr entscheidend, daß ihr in der Gruppe eure<br />
Lebensgeschichte bearbeitet, sie euch gegenseitig unter dem Gesichtspunkt erfragt <strong>und</strong> erzählt,<br />
wie ihr dazu gekommen seid, euch durch die reformierte Oberstufe oder das Abendgymnasium<br />
bis an die <strong>Uni</strong> durchgeschlagen habt. Und warum ihr dann gerade dieses Fach gewählt habt.<br />
Allein geht das auch, ist aber sehr viel schwieriger: z. B. der Student, über den ich vorhin<br />
berichtet habe, der früher gewerkschaftlicher Jugendvertreter in einem Metallbetrieb gewesen war<br />
<strong>und</strong> dem der Studienbetrieb seine ganze anfängliche inhaltliche Motivation zugeschüttet hat,<br />
hätte ohne das Studienkollektiv mit den ausführlichen Diskussionen über den Sinn des Studiums<br />
seine eigene Geschichte sehr viel schwerer begreifen können. Die Fragen der anderen zwingen<br />
zum Nachdenken <strong>und</strong> brechen Verdrängungen viel eher auf.<br />
Ein anderes Beispiel: In meine Sprechst<strong>und</strong>e kam eine Studentin <strong>und</strong> sagte, sie wolle ihre<br />
Diplomarbeit über Griechenlands Integration in den Gemeinsamen Markt schreiben. Zuerst flippte<br />
ich, wie sie es auch getan hatte, voll auf die Wissenschaftlichkeit ein, <strong>und</strong> wir unterhielten uns<br />
über Literatur, Themenabgrenzung etc. Bis ich schließlich fragte: Warum willst du denn über<br />
dieses Thema arbeiten? Es stellte sich heraus, daß sie in Griechenland gewesen war <strong>und</strong> sich<br />
das erste Mal seit ganz langer Zeit wieder` wohl gefühlt hatte zwischen den Menschen dort, <strong>und</strong><br />
deshalb wollte sie über etwas arbeiten, was mit denen etwas zu tun hat. Die EWG war ihr
eigentlich herzlich wurscht. Darauf war sie nur gekommen, weil das Thema ja irgendwie<br />
politologisch sein mußte. Nachdem wir uns lange unterhalten hatten, was sie in Griechenland<br />
erlebt hatte, kamen wir zu folgendem Ergebnis: Sie solle nach Griechenland runterfahren <strong>und</strong> die<br />
Verhältnisse auf einer kaum vom Tourismus berührten Insel mit denen auf einer voll touristisch<br />
erschlossenen Insel vergleichen, <strong>und</strong> zwar ökonomisch, kulturell <strong>und</strong> vom Bewußtsein der<br />
Einwohner her. Vorher solle sie schauen, was es zu dieser Fragestellung an Literatur gibt <strong>und</strong><br />
das mal durchgucken. Aus dem »wissenschaftlichen« Thema war eines geworden, das mit ihr<br />
selbst <strong>und</strong> ihrer Geschichte etwas zu tun hat, das für sie Gebrauchswert haben kann.<br />
60<br />
Dieses Beispiel macht vielleicht deutlicher, was ich damit meine, den Gebrauchswert des<br />
Studiums herausfinden. In den Sozialwissenschaften <strong>und</strong> der Psychologie ist es vom Stoff her<br />
leichter als in anderen Fächern, Fragestellungen zu bearbeiten, die direkt mit der eigenen<br />
Lebensgeschichte zu tun haben. So bin ich zu den Sozialwissenschaften gekommen: Ich hatte<br />
mich seit der Pubertät immer sehr unsicher gefühlt <strong>und</strong> wollte herausfinden, was eigentlich mit mir<br />
los ist, wer ich bin - nach der philosophischen Devise: Erkenne dich selbst. Ich las ungeheuer viel<br />
Psychologie <strong>und</strong> studierte Philosophie <strong>und</strong> drehte beinahe durch dabei, denn bei jeder<br />
Falldarstellung oder jeder philosophischen Kritik überprüfte ich mein Inneres, ob das bei mir auch<br />
da sei, was da kritisiert oder analysiert wurde. Und an Tagen, an denen ich mich wohl fühlte,<br />
beantwortete ich die Frage mit nein. Wenn ich mich aber einsam <strong>und</strong> depressiv fühlte, erkannte<br />
ich mich in all dem wieder. Gelernt habe ich dabei kaum etwas über mich, sondern habe mich nur<br />
ins Bockshorn jagen lassen.<br />
Später habe ich gelernt, daß Erkenntnis ein Wechselprozeß zwischen erkennendem Subjekt <strong>und</strong><br />
dem betrachteten Objekt ist, wobei sich vor allem das erkennende Subjekt in dem Prozeß<br />
verändert. Bei meiner Methode des Erkenne-dich-selbst hatte ich diese Beziehung zu einem<br />
Kreis kurzgeschlossen: Das erkennende' Subjekt bezieht sich nur auf dieses Subjekt selbst. Da<br />
war klar, daß ich mich als »schlecht« erkennen mußte, wenn ich mich schlecht fühlte, <strong>und</strong> umgek<br />
ehrt als »gut«, wenn es mir gut ging. So konnte ich nur durchdrehen. Wenn ich also wirklich<br />
etwas über mich herausfinden wollte, durfte ich nicht in solche Nabelschau verfallen. Gültige<br />
Erkenntnisse über mich selbst konnte ich nach dieser Einsicht nur gewinnen, wenn ich meinen<br />
Blick als erkennendes Subjekt auf die Objektwelt richtete <strong>und</strong> mich dort wiederfinde. D. h. wenn<br />
ich zum Beispiel die politische Wirklichkeit der BRD untersuche, weiß ich, daß ich damit ein Stück<br />
meiner eigenen Wirklichkeit analysiere. Erst recht gilt das für Themen wie Sozialisationstheorie<br />
oder wie hier: Analyse der <strong>Uni</strong>versität. In diesem Prozeß der Selbsterkenntnis, die über die<br />
Erkenntnis der äußeren Wirklichkeit läuft, um meine Rolle in ihr zu bestimmen, spielt<br />
Wissenschaft eine wichtige Rolle. Denn Wissenschaft ist dort, wo sie etwas taugt, Bericht über<br />
Erfahrungen mit Wirklichkeit <strong>und</strong> stellt sie in einen verallgemeinerungsfähigen Rahmen. Auf diese<br />
Weise hat für mich das Studium <strong>und</strong> die Beschäftigung mit Wissenschaft einen sehr persönlichen<br />
Sinn, einen Gebrauchswert bekommen.<br />
Einen solchen Stellenwert, wenn auch wahrscheinlich noch weniger unmittelbar, kann das<br />
Studium auch in anderen Fächern haben. Es erfordert dort sicher schwierigere Diskussionen <strong>und</strong><br />
führt vielleicht zu einer Akzentverschiebung im Studium, z. B. daß du als Jurist/in eben doch auch<br />
stärker als vorgeschrieben auf Rechtssoziologie<br />
61<br />
einsteigst oder als Biologe/Biologin dich auch mit der gesellschaftlichen Verwendung des<br />
Fachwissens beschäftigst.
Entscheidend für den Kampf gegen die <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> ist, daß es gelingt, in ausführlichen <strong>und</strong> immer<br />
neuen Diskussionen herauszufinden, weshalb du studierst, was es dir ganz persönlich bringen<br />
soll, welche Probleme das Studium für dich lösen soll, selbst dann, wenn du hinterher keinen Job<br />
kriegst, in dem du das verwenden kannst. Die fünf Jahre sollst du dann nicht als verschwendete<br />
Zeit abbuchen müssen. Wenn sich ein solcher persönlicher Sinn für das Studium auch nach<br />
intensiven Bemühungen nicht finden läßt, dann solltest du ohne schlechtes Gefühl dich dazu<br />
entschließen, mit dem Studieren aufzuhören <strong>und</strong> nur noch solange an der <strong>Uni</strong> zu bleiben, bis<br />
deine Suche nach etwas anderem geklappt hat. Denn bei einem Studium ohne richtigen Sinn<br />
kannst du nur durchhängen <strong>und</strong> bist allem kriterienlos ausgeliefert. Ein Studienabbruch ist ja<br />
dann auch keine Katastrophe, wenn er nicht unbegriffene <strong>und</strong> verzweifelte Flucht vor etwas<br />
bedrohlich Unbewältigbarem ist, das einen auch danach noch weiterverfolgt. Wenn du merkst,<br />
daß dir das Studium nichts bringt <strong>und</strong> deshalb abbrichst, ist das etwas ganz anderes, ist nicht<br />
Scheitern, sondern bewußte Entscheidung gegen die ganzen Aufstiegszwänge <strong>und</strong> für eine<br />
Tätigkeit, mit der du dich identifizieren kannst.<br />
Das ist von mir nicht als Rat gemeint, sich eben resignierend der schlechten Wirklichkeit<br />
anzupassen. Im Gegenteil: mit der Frage nach dem Gebrauchswert des Studiums stellt sich ganz<br />
zwangsweise eine viel tiefergehende Frage, nämlich die, was du mit deinem Leben anfangen<br />
willst, wofür du arbeiten <strong>und</strong> dich einsetzen willst. Erst von einer solchen Fragestellung her läßt<br />
sich bestimmen, ob ein Studium <strong>und</strong> eine bestimmte Berufstätigkeit ein sinnvolles Mittel dazu sein<br />
kann oder ob ein Studium bloße Zeitverschwendung wäre (wie z. B. bei dem Ziel, sich dauerhaft<br />
in der gewerkschaftlichen Arbeit zu engagieren, wo die betriebliche Gewerkschaftsarbeit<br />
Voraussetzung, ein Studium ohne direkten Gewerkschaftsauftrag eher Hindernis ist). Ich kenne<br />
viele Studierende der Gesellschaftswissenschaften, die sagen, »das Studium soll mir gerade<br />
dabei helfen, die Frage zu klären, was ich in dieser Gesellschaft mit meinem Leben anfangen<br />
kann«. Ich halte das für sehr sinnvoll, wenn ich auch bezweifle, ob das institutionell organisierte<br />
Studium bei der Beantwortung dieser Frage nützlich sein kann. Diese Frage kann wohl nur<br />
zusammen mit anderen gegen die <strong>Uni</strong>versität gestellt <strong>und</strong> beantwortet werden, denn die ist darauf<br />
angelegt, Leute für Jobs <strong>und</strong> wissenschaftliche Karrieren - also für's konkurrenzbestimmte,<br />
individuelle Glück -zu präparieren. Wenn ich aber sage, ich will dafür kämpfen, daß ich nicht<br />
unterdrückt werde <strong>und</strong> auch selbst niemanden unterdrücke, daß die Unterdrückung insgesamt<br />
abgebaut wird, dann steht das quer zur Institution <strong>Uni</strong>versität, denn sie ist selbst<br />
62<br />
Unterdrückungsinstanz. Die Gegenqualifikation gegen die <strong>Uni</strong>versität <strong>und</strong> gegen die<br />
herrschenden gesellschaftlichen Zwänge mußt du zusammen mit anderen aus der <strong>Uni</strong><br />
herausholen wie die nützlichen Teile aus einem Autowrack, ihr müßt sie ausschlachten. Und wie<br />
man ein Autowrack nur ausschlachten kann, indem man es zerstört, so muß auch die <strong>Uni</strong>versität<br />
in ihrer gegenwärtigen Form durch die radikale Kritik zerstört werden.<br />
Noch einmal Gebrauchswert des Studiums:<br />
Praxisbezug <strong>und</strong> Befreiung<br />
Studienkollektive können das, was sie als den persönlichen Sinn ihres Studiums gef<strong>und</strong>en haben,<br />
nur durchsetzen, wenn sie sich im Kampf an der Hochschule gegen die Verschulung des<br />
Studiums <strong>und</strong> die ganze obrigkeitsstaatliche Entwicklung beteiligen. Dazu müssen sie sich mit<br />
anderen Gruppen über alle Differenzen hinweg immer wieder zu Aktionen zusammenschließen<br />
<strong>und</strong> den Bezug zur hochschulpolitischen Praxis nicht den verknöcherten Organisationen<br />
überlassen.
Genausowenig kann auf den Bezug zur späteren Berufspraxis verzichtet werden, denn durch ihn<br />
bekommt dein Studium überhaupt erst seinen gesellschaftlichen Bezug <strong>und</strong> seine persönliche<br />
Zukunftsperspektive. Zu wissen, was du mit dem später machen willst, was du jetzt lernst, ist<br />
sicherlich eine außerordentlich wichtige Sache für den Gebrauchswert des Studiums. Ich habe<br />
vorhin diese Seite zurückgestellt, weil das - meine ich - nicht der einzige Sinn des Studiums sein<br />
darf <strong>und</strong> weil ich vor dem Schielen nach den Lücken des Arbeitsmarktes <strong>und</strong> dem Sichanpassen<br />
an die gegebenen Anforderungen warnen wollte. In einer kapitalistischen Gesellschaft ändern die<br />
sich nämlich dauernd <strong>und</strong> sind weder steuerbar noch vorherzusehen.<br />
Wegen dieser unvorhersehbaren Arbeitsmarktschwankungen halte ich es auch für wenig sinnvoll,<br />
nach einer kollektiven Berufsperspektive zu suchen, die dann sozusagen massenhaft verfolgt<br />
wird. Im gegebenen Arbeitsmarkt kann man nur individuell unterschlupfen. Damit daraus aber<br />
kein zielloses Anpassen wird, mußt du gemeinsam mit anderen für alle Mitglieder der Gruppe<br />
herausfinden, was für einen Beruf du ausüben möchtest, <strong>und</strong> zwar völlig unabhängig von der<br />
Arbeitsmarktlage <strong>und</strong> allen anderen pragmatischen Überlegungen. <strong>Wie</strong>der solltest du das allein<br />
auf Basis deiner eigenen Lebensgeschichte, aus deinen Überlegungen heraus bestimmen, was<br />
du für gesellschaftlich sinnvoll <strong>und</strong> persönlich befriedigend hältst. Wenn du das herausgef<strong>und</strong>en<br />
hast <strong>und</strong> dich durch<br />
63<br />
ein Praktikum in dem Bereich oder wenigstens durch Besuche <strong>und</strong> Gespräche überzeugt hast,<br />
daß es tatsächlich das ist, was du mal machen willst, dann setz alles daran, daß du das dann<br />
auch machen wirst. Sicher: Vielleicht klappt es nicht, <strong>und</strong> wahrscheinlich klappt es nicht auf<br />
Anhieb. Aber: Dein Studium sieht ganz anders aus, wenn du weißt, was du dabei lernen willst, um<br />
später etwas Bestimmtes arbeiten zu können - du hast damit den Praxisbezug selbst hergestellt,<br />
den die <strong>Uni</strong> wohl nie leisten wird. Deine Arbeitslosigkeit sieht ganz anders aus, wenn du weißt,<br />
welche Stelle du haben willst, denn du kannst dich weiter qualifizieren, kannst Umwege suchen,<br />
Beziehungen anknüpfen, um reinzukommen, <strong>und</strong> hängst nicht perspektivlos wartend mit einem<br />
Gefühl der Sinnlosigkeit durch; <strong>und</strong> selbst wenn du schließlich in einem anderen Job landest,<br />
kannst du den als Übergang oder Wartezeit für das betrachten, was du eigentlich machen willst.<br />
Auf diese Weise kann es möglich werden, sich gegenüber der Arbeitsmarktsituation <strong>und</strong><br />
Berufsperspektive genauso zu verhalten wie gegenüber der Institution <strong>Uni</strong>: aus ihr herausholen,<br />
was sinnvoll <strong>und</strong> befriedigend ist, statt sich ihr anzupassen.<br />
Gebrauchswert des Studiums heißt damit aber auch, das Studium dazu benützen, gegen das<br />
anzugehen, worunter du zusammen mit anderen in dieser Gesellschaft leidest, der zunehmenden<br />
Enge, der Pressehetze, dem Konsumterror, der Familienpolitik <strong>und</strong> all der anderen Scheiße.<br />
Zugleich bedeutet es aber auch gesellschaftliche Verantwortung: Im ersten Kapitel habe ich<br />
gezeigt, wie die Studierenden im Vergleich zu gleichaltrigen Industriearbeitern trotz aller<br />
staatlicher Restriktion doch noch privilegiert sind <strong>und</strong> in der Regel auch eine angenehmere<br />
Lebensperspektive haben. Ich halte es für absurd, deswegen etwa ein schlechtes Gewissen zu<br />
haben. Umgekehrt: Diese Privilegien müssen dazu benützt werden, dafür zu kämpfen, daß sie<br />
Allgemeingut werden <strong>und</strong> aufhören, auf wenige beschränkt zu sein. Anders ist es mit dem, was<br />
mit dem »heimlichen Lehrplan« an herrschaftsbezogenen Verhaltensweisen <strong>und</strong> Positionen<br />
bezweckt ist: Das ungerechtfertigt hohe Einkommen kann nicht ohne Diskussion einfach so<br />
individuell verbraten werden; die Herrschaftspositionen, die das Studium immer noch für viele<br />
eröffnet, müssen in ihrer gesellschaftlichen Wirkung diskutiert <strong>und</strong> durch einen über das Studium<br />
hinausreichenden Gruppenzusammenhang kontrolliert werden; das Prestige <strong>und</strong> die
Selbstsicherheit, die aus einem Gefühl der Überlegenheit gezogen werden, müssen schon<br />
während des Studiums in Frage gestellt <strong>und</strong> zerbrochen werden.<br />
Gebrauchswert des Studiums kann also nicht bloß heißen, individuell Spaß am Studieren haben.<br />
Da kommen notwendigerweise Infragestellungen <strong>und</strong> Orientierungen auf gesellschaftliche<br />
Aufgaben dazu, die oft sehr unbequem sein können, viel Arbeit machen <strong>und</strong><br />
64<br />
oft genug halt keinen Spaß mehr machen <strong>und</strong> doch getan werden müssen. Es ist wichtig, sich das<br />
klarzumachen. Oft genug meinen die Mitglieder eines frisch gegründeten Studienkollektivs voller<br />
Enthusiasmus, jetzt könnten sie sich im Gegensatz zu ihrer Isolierung davor voll verwirklichen,<br />
voll in eine solidarische Kollektivität aufgehen lassen <strong>und</strong> nur noch Spaß haben. Wenn sich dann<br />
herausstellt, daß es da oft mehr Frust <strong>und</strong> mehr Konflikte gibt als wenn man allein ist, brechen die<br />
Gruppen nur zu häufig gleich wieder auseinander. Deshalb will ich hier ietzt über diese<br />
Schwierigkeiten reden:<br />
Über Schwierigkeiten beim Sichwehren<br />
So einleuchtend das hier dargestellte Konzept klingen mag, so selten gelingt es. Die meisten<br />
Gruppen, die ich kenne, sind sehr schnell wieder auseinandergefallen. Die gesteckten Ziele<br />
wurden auch nicht annähernd ereicht. Oder aber: Sie haben sich mit der Zeit bei einzelnen<br />
Gruppenmitgliedern so gründlich verändert, daß ein gemeinsames Arbeiten nicht mehr möglich<br />
ist. Häufiger noch gehen sich die Gruppenmitglieder bald so auf die Nerven, entwickeln sich<br />
solche Konflikte, daß die meiste Zeit <strong>und</strong> Energie dabei draufgeht, sie einigermaßen in Griff zu<br />
kriegen - bis die Gruppe auseinanderläuft, weil sich die Leute nicht mehr sehen können. Ohne<br />
irgendwelche Rezepte geben zu wollen, meine ich, daß es zwei Hauptursachen für diese<br />
Schwierigkeiten gibt: einmal die »linke Überforderung« <strong>und</strong> zum anderen die Tatsache, daß die<br />
gebrauchswertorientierte Arbeit nicht nur gegen die Institution <strong>Uni</strong>versität, sondern auch gegen<br />
die in uns selbst hineinerzogenen tauschwertorientierten Verhaltensweisen <strong>und</strong> Erfolgskriterien<br />
durchgesetzt werden muß.<br />
Die »linke Überforderung« (Möller, 1974) entsteht sofort, wenn du etwas über den Kapitalismus<br />
als System kapiert hast. Du merkst, daß alle repressiven Erscheinungen zusammenhängen <strong>und</strong><br />
sich gegenseitig absichern <strong>und</strong> stützen, daß sie einzeln genommen nicht gr<strong>und</strong>sätzlich verändert<br />
werden können. Die Folgerung daraus, die sich geradezu aufdrängt, ist schon das Hauptelement<br />
der Überforderung: Man muß das ganze System bekämpfen, muß es in allen seinen<br />
Erscheinungsweisen <strong>und</strong> in seinem Wesen erfassen <strong>und</strong> überall, wo es verw<strong>und</strong>bar ist, treffen.<br />
So wird man schnell zum Hans-Kampf in allen Gassen, springt von den Mieterbewegungen in die<br />
Umweltbewegung, von dort in die Antiatomkraftbewegung etc., <strong>und</strong> nirgendwo bleibt man lange<br />
genug, um dort sinnvolle <strong>und</strong> langfristig wirksame Arbeit leisten zu können, ist aber scheinbar<br />
immer auf dem höchsten Stand der Bewegung. Dieses Mitmachen aller politischen<br />
Konjunkturschwankungen <strong>und</strong> Modetrends ent<br />
65<br />
steht aus der Überforderung, ständig durch den eigenen individuellen Einsatz die Klassenkämpfe<br />
vorantreiben zu wollen. Es macht jedes Kollektiv kaputt <strong>und</strong> jede langfristige Problemlösung<br />
unmöglich.
Die andere Überforderung entsteht aus dem Anspruch jeder antikapitalistischen Bewegung, den<br />
Kapitalismus in all seinen unterschiedlichen Ausprägungsbereichen theoretisch erfassen <strong>und</strong><br />
erklären zu können. Dieser Anspruch ist an der <strong>Uni</strong>versität für den solidarischen Zusammenhang<br />
besonders gefährlich, denn er hängt sich an die sowieso schon bestehenden angsterzeugenden<br />
Ansprüche <strong>und</strong> steigert sie ins Ungeheure: Zu allem muß man eine Einschätzung haben, <strong>und</strong><br />
zwar eine »materialistische« <strong>und</strong> »dialektische« - auch wenn man nicht so recht weiß, was das<br />
ist. Gleichzeitig muß man die marxistische Gesellschaftsanalyse samt ihrer historischen<br />
Entwicklung in unzähligen Schattierungen kennen. Darüber hinaus auch noch die bürgerliche<br />
Theorie nicht nur kennen, sondern auch noch kritisieren können, <strong>und</strong> dabei auch noch erklären<br />
können, warum <strong>und</strong> wie das Kritisierte notwendig aus dem kapitalistischen<br />
Gesellschaftszusammenhang entsteht. All das muß man »drauf« haben <strong>und</strong> es auch noch<br />
gekonnt gegen die Anhänger an, derer Ansichten <strong>und</strong> Organisationen verteidigen können, egal in<br />
welchem Semester man ist oder ob man eigentlich mit dem Fachstudium schon genug um die<br />
Ohren hat. Weil das aber ganz offensichtlich nicht geht, ist der <strong>Bluff</strong> gerade unter den linken<br />
Studierenden besonders weit verbreitet <strong>und</strong> zerstört dadurch gerade dort die Möglichkeit zur<br />
solidarischen <strong>und</strong> angstfreien Kommunikation besonders nachhaltig. Und das ausgerechnet dort,<br />
wo sie von der theoretischen Einsicht der Teilnehmer her noch am ehesten möglich sein müßte.<br />
<strong>Wie</strong> kann diese »linke Überforderung« abgewehrt werden? Ich meine nur dadurch, daß sich die<br />
Gruppe ganz ausführlich darüber unterhält <strong>und</strong> darauf einigt, was für die nächste Zeit<br />
gemeinsames Ziel sein soll. Danach müssen alle Ansprüche, ob sie nun von außen oder aus der<br />
Gruppe selbst kommen, darauf überprüft werden, ob sie sich konkret-inhaltlich aus der gestellten<br />
Aufgabe ergeben <strong>und</strong> ob sie in der zur Verfügung stehenden Zeit ausgeführt werden können. Alle<br />
anderen Ansprüche, die dieses Kriterium nicht erfüllen, sollten auch durchaus aggressiv<br />
zurückgewiesen werden. Keine Gruppe kann den gesellschaftsverändernden Weltgeist spielen.<br />
Und doch wird sich dieses Problem immer wieder einschleichen, denn als Linke sind wir gerade<br />
in der BRD durch die bloße allgegenwärtige Willkür der gesellschaftlichen Wirklichkeit<br />
überfordert. Vielleicht hilft in solchen Situationen doch ein sehr schönes BrechtZitat, sich wieder<br />
auf das Machbare zu besinnen:<br />
»Tu kam zu Me-ti <strong>und</strong> sagte: Ich will am Kampf der Klassen teilnehmen. Lehre mich. Me-ti sagte:<br />
Setz dich. Tu setzte sich <strong>und</strong><br />
66<br />
fragte: <strong>Wie</strong> soll ich kämpfen? Me-ti lachte <strong>und</strong> sagte: Sitzt du gut? ich weiß nicht, sagte Tu<br />
erstaunt, wie soll ich anders sitzen? Me-ti erklärte es ihm. Aber, sagte Tu ungeduldig, ich bin<br />
nicht gekommen, sitzen zu lernen. Ich weiß, du willst kämpfen lernen, sagte Me-ti geduldig, aber<br />
dazu mußt du gut sitzen, da wir jetzt eben sitzen <strong>und</strong> sitzend lernen wollen. Tu sagte: Wenn man<br />
immer danach strebt, die bequemste Lage einzunehmen <strong>und</strong> aus dem Bestehenden das Beste<br />
herauszuholen, kurz, wenn man nach Genuß strebt, wie soll man da kämpfen? Me-ti sagte: Wenn<br />
man nicht nach Genuß strebt, nicht das Beste aus dem Bestehenden herausholen <strong>und</strong> nicht die<br />
beste Lage einnehmen will, warum sollte man da kämpfen?« (Brecht, Werke 12, S. 576).<br />
Die andere große Schwierigkeit beim Sichwehren stammt aus uns selber, aus den<br />
Verhaltensweisen, die wir anerzogen bekommen haben. Mit »wir« meine ich tatsächlich uns alle,<br />
die wir an der <strong>Uni</strong> sind. Als Intellektuelle sind wir zu einem Individualismus <strong>und</strong> meist auch<br />
intellektuellem Narzismus erzogen worden, so daß kollektives Arbeiten besonders schwierig ist.<br />
Voller Hoffnungen stürzen wir uns immer wieder in Gruppen. Ermutigende Erlebnisse werden<br />
aber permanent verhindert, weil es in den Gruppen nicht klappt, weil da Frust, Konkurrenz,
Ziellosigkeit, Aneinandervorbeireden vorherrschen. Aus guter theoretischer <strong>und</strong> politischer<br />
Einsicht nimmst du immer wieder einen Anlauf zur kollektiven Arbeit <strong>und</strong> prallst regelmäßig an<br />
denselben Schwierigkeiten ab: der <strong>Angst</strong>, dem Haß <strong>und</strong> der Unzuverlässigkeit in der Gruppe. Das<br />
kommt in seiner Zerrissenheit zwischen Erfahrung <strong>und</strong> Hoffnung in folgendem Text schlagend<br />
zum Ausdruck:<br />
»Ich könnte Seiten füllen mit Berichten über Zuspätkommen, Nichtkommen - ohne jegliche<br />
Entschuldigung oder Erklärung -, über haarsträubende Entschuldigungen beim nächsten<br />
Zusammentreffen, über lustlose Gruppensitzungen, die sich quälend hinzogen <strong>und</strong> mit müden<br />
Witzen gespickt waren. Am deprimierendsten war aber das Endergebnis: ein<br />
zusammengestoppeltes Referat, für das sich absolut keiner verantwortlich fühlte. Dieser oft<br />
vergebliche Zeitaufwand bei Gruppenarbeiten veranlaßte mich ab dem 2. Semester dazu, wenn<br />
möglich Gruppenarbeit zu vermeiden. Ich arbeitete fortan mit einem Fre<strong>und</strong> zusammen, den ich<br />
seit meiner Lehrzeit kenne <strong>und</strong> zu dem ich auch eine fre<strong>und</strong>schaftliche emotionale Beziehung<br />
habe. Dennoch halte ich Gruppenarbeit an der <strong>Uni</strong>versität für die einzige Möglichkeit, sinnvoll zu<br />
lernen. Nur in der Gruppenarbeit besteht die Chance, die nicht-intendierten, ungeplanten<br />
Lernprozesse zu thematisieren, die neben geplanten, intendierten immer auch stark das<br />
Geschehen beeinflussen« (Sienknecht, 1976, S. 13).<br />
Ich meine, diese Schwierigkeiten beim Versuch, den Gebrauchswert des Studiums zu<br />
verwirklichen, liegen vor allem in der<br />
67<br />
Illusion, man könne sich durch die gute Einsicht <strong>und</strong> den guten Willen gegen die<br />
tauschwertorientierten Verhaltensweisen <strong>und</strong> Erfolgskriterien entscheiden <strong>und</strong> das dann auch<br />
durchhalten, indem man sich eben solidarisch gegen diese äußeren Zwänge wehrt. Der Punkt ist:<br />
Im Prozeß unserer eigenen Sozialisation, also dem Erlernen gesellschaftlicher Verhaltensweisen,<br />
haben wir die für die kapitalistische Gesellschaft kennzeichnenden Verhaltensweisen <strong>und</strong><br />
Normen erlernt <strong>und</strong> zum Teil unserer eigenen Persönlichkeit gemacht. Es ist nun mal nicht so,<br />
daß sich Proletariat <strong>und</strong> Bourgeoisie in offener Feldschlacht gegenüberstehen, <strong>und</strong> man braucht<br />
sich nur zu entscheiden, auf welcher Seite man kämpft, auf der Seite der Befreiung oder auf<br />
derjenigen der Unterdrücker. Diese Gesellschaft ist ein völlig in sich verwobenes System von<br />
inneren Abhängigkeiten, aus dem man nicht so leicht heraus kann.<br />
Auch in unseren Köpfen <strong>und</strong> Verhaltensweisen gibt es nicht die sauber getrennte<br />
Schlachtordnung zwischen den Unterdrückern <strong>und</strong> den Unterdrückten. Gerade wir, die wir es in<br />
der bürgerlichen Sozialisation immerhin bis zur <strong>Uni</strong> geschafft haben, mußten dabei viel<br />
Unterdrückung hinnehmen <strong>und</strong> haben sie nur überlebt, weil wir gelernt haben, sie in uns<br />
aufzunehmen <strong>und</strong> sie weiterzugeben. Den Unterdrücker <strong>und</strong> das unterdrückerische Prinzip gibt<br />
es nicht nur draußen in der Gesellschaft, sondern auch in unseren Köpfen <strong>und</strong> in unseren<br />
Gruppen. Wir können es draußen nur bekämpfen, indem wir es auch in uns bekämpfen. Aber<br />
auch umgekehrt: Der Kampf gegen den verinnerlichten Unterdrücker ist nur als gleichzeitiger<br />
Kampf gegen äußere gesellschaftliche Unterdrückung möglich (vgl. Freire, 1974).<br />
Letzteres ist deshalb so wichtig, weil beim Aufarbeiten der eigenen Sozialisationsgeschichte <strong>und</strong><br />
bei Versuchen der Verhaltensveränderung in Gruppen der gesamtgesellschaftliche<br />
Unterdrückungszusammenhang oft aus dem Blick gerät.<br />
Die andere Seite aber, daß die äußere Unterdrückung nicht bekämpft werden kann, wenn nicht<br />
die Unterdrückung in uns selbst erkannt <strong>und</strong> bekämpft wird, ist Voraussetzung dafür, daß die<br />
eigene Existenz auch an der <strong>Uni</strong> gesellschaftlich <strong>und</strong> politisch sinnvoll <strong>und</strong> gleichzeitig persönlich
efriedigend werden kann. Die Entscheidung, fürs Proletariat <strong>und</strong> für die<br />
Gebrauchswertorientierung zu kämpfen <strong>und</strong> sich dafür zu organisieren, genügt eben nicht, denn<br />
sie kann nur gelingen, wenn wir uns dabei selbst verändern im Verhalten zu uns selbst <strong>und</strong> zu<br />
den anderen. »Die Gruppe kann ihren Weg erst finden <strong>und</strong> gehen, wenn sie über sich selbst <strong>und</strong><br />
ihre eigenen inneren Widerstände <strong>und</strong> einander widersprechenden Tendenzen Erfahrungen<br />
gesammelt hat« (Mahler, 1971, S. 48). Um diese Selbststeuerung im Gruppenverhalten erreichen<br />
zu können, sind gruppendynamische <strong>und</strong> selbstanalytische Mittel unverzichtbar. Dafür gibt es<br />
auch wieder keine Rezepte, doch will ich das dar<br />
68<br />
stellen, was ich aus der Literatur <strong>und</strong> aus meinen eigenen Erfahrungen mit Gruppen für machbar<br />
<strong>und</strong> vernünftig halte.<br />
Entscheidend ist der Anfang, denn da werden die meisten Fehler gemacht, schon indem zu<br />
weitgehende Ziele gesetzt werden <strong>und</strong> gemeint wird, es müßte schon am Anfang alles<br />
ausdiskutiert sein. Es ist deshalb wichtig, sich zu Anfang leicht erreichbare Zwischenziele zu<br />
setzen, z. B. zuerst einmal das Problem genau beschreiben oder Literatur heraussuchen <strong>und</strong> auf<br />
die Gruppenmitglieder verteilen, damit sie dann referiert werden kann. Kollektive Arbeit ist ja<br />
ohne individuelle Vorbereitung dieser kollektiven Phasen gar nicht möglich. Viele Schwierigkeiten<br />
in Gruppen entstehen aus dem unbewußten Vertrauen aller darauf, die Gruppe werde die<br />
gestellte Aufgäbe irgendwie von selbst als Gruppe lösen, ohne daß sich irgend jemand individuell<br />
dafür einsetzen muß. Alle warten darauf, daß etwas geschieht, <strong>und</strong> ärgern sich, daß nichts<br />
geschieht. Das kann leicht dadurch vermieden werden, daß von jeder Gruppensitzung zur<br />
nächsten Aufgaben verteilt werden. Dabei ist es wichtig, die in der Gruppe genau<br />
durchzudiskutieren, damit allen klar ist, was genau gefordert wird <strong>und</strong> wozu das notwendig ist.<br />
Wichtig ist auch: Keine großen Aufgaben vergeben, die erst-in wochenlanger Einzelarbeit<br />
erfüllbar sind. Solche Brocken sprengen das Kollektiv, weil es in ein Expertenteam zerfällt. Dazu<br />
kommt aber noch, daß die Gruppe in der Zeit der jeweiligen arbeitsteiligen Einzelarbeit stagniert.<br />
Also lieber die große Arbeit in kleine Einzelschritte zerlegen, die immer wieder kollektiviert<br />
werden können durch gegenseitige Berichte.<br />
Die andere Schwierigkeit entsteht daraus, daß niemand wagt, strukturierend einzugreifen, um<br />
sich nicht zu exponieren. Ich halte es deshalb für sehr sinnvoll, gerade am Anfang den<br />
gruppendynamischen Totalfrust dadurch zu vermindern, daß bestimmte Tätigkeiten einfach auf<br />
die einzelnen Mitglieder verteilt werden, wobei man sich immer wieder abwechseln kann, bis sie<br />
vielleicht überflüssig geworden sind (Clemens-Lodde, Sader, 1972, S. 43 f.). Eine solche<br />
Funktion ist die eines Diskussionsleiters. Das mag vielen absurd erscheinen, in einer Gruppe von<br />
5 oder 6 Leuten (größer sollte sie nicht sein). Aber gerade am Anfang wirkt eine solche formell<br />
festgelegte Funktion der Herausbildung eines »geheimen« Diskussionsleiters entgegen. Der ist<br />
dann in seiner hierarchischen Stellung nur noch schwer abzuschaffen. Wenn die Funktion<br />
jedesmal wechselt, lernen alle wie das gemacht wird.<br />
Eine weitere ständig wechselnde Funktion ist die des »Spiegels«. Das ist eine Person, die stärker<br />
als die anderen darauf achtet, was in der Gruppe läuft, <strong>und</strong> immer dann, wenn ihr etwas<br />
Besonderes auffällt, nicht etwa wertende Interpretationen gibt, sondern einfach erzählt,<br />
zurückspiegelt, was in ihrer Wahrnehmung passiert ist. Die Gruppe muß dann herausfinden, ob<br />
dies von allen so wahr<br />
69
genommen worden ist, <strong>und</strong> wenn es für die weitere Arbeit wichtig genug scheint, muß sie<br />
analysieren, woher »die Störung« kommt <strong>und</strong> wie sie abgestellt werden kann. Mit der Zeit lernen<br />
das alle, <strong>und</strong> man braucht die Funktion nicht mehr bewußt festzulegen.<br />
Was ist eine »Störung«? Die Gruppe diskutiert zuerst die Lebens<strong>und</strong> Lerngeschichte der<br />
einzelnen Mitglieder, um nach <strong>und</strong> nach das zu bestimmen, was für sie den Gebrauchswert des<br />
Studiums ausmacht. Dabei ist »Störung« all das, was die Atmosphäre des sich gegenseitig<br />
Akzeptierens <strong>und</strong> Zuhörens stören könnte. Denn die ist Voraussetzung dafür, daß alle so<br />
vorbehaltlos über sich erzählen wie möglich. Aggressive oder moralisch verurteilende Kritik,<br />
dominierendes Verhalten, Unterbuttern, ständiges Zwischenreden, all das sind hierbei Störungen,<br />
die auf ihre Ursachen untersucht werden müssen. Dazu gehört aber auch, wenn der »Spiegel«<br />
das Gefühl hat, daß sich ein Gruppenmitglied verkrampft oder aus der Diskussion zurückzieht.<br />
Das muß dann angesprochen werden, ohne daß aber jemand zum Mitdiskutieren gezwungen<br />
werden soll.<br />
Danach, wenn die Gruppe ein gemeinsames Projekt sucht, ist »Störung« wieder etwas anderes:<br />
Jetzt ist es wichtig, daß alle frei assoziieren, damit möglichst viele überschaubare <strong>und</strong><br />
einschätzbare Alternativen vorliegen, aus denen ausgewählt werden kann. Ungeduldiges<br />
Drängen oder wenn sich jemand schon vor der Phase für ein Projekt stark macht, bevor<br />
überhaupt an die Auswahl gegangen wird, das sind Beispiele dafür.<br />
Besonders schwierig wird es dann bei der Entscheidung, welches Projekt von der Gruppe<br />
bearbeitet wird, ob z. B. in der Antiatomkraftbewegung mitgearbeitet werden soll, ob ein<br />
theoretischwissenschaftliches Problem (<strong>und</strong> welches) oder ob z. B. eine berufspraktische<br />
Erk<strong>und</strong>ung angegangen werden soll. Hier ist es besonders wichtig, daß alle ihre Interessen<br />
aussprechen <strong>und</strong> daß es klar ist: Niemand wird überredet oder sonstwie untergebuttert. Es ist auf<br />
die Dauer besser, eine Gruppe aufzuteilen, als per Mehrheitsabstimmung eine Aufgabenstellung<br />
durchzusetzen, an der nicht alle Teilnehmer direkt interessiert sind. Gegen Ende dieser<br />
Entscheidungsphase müssen die gegensätzlichen Erwartungen <strong>und</strong> Bedürfnisse voll raus- <strong>und</strong><br />
klar gegeneinandergestellt werden. Hier ist also »Zurückhaltung« <strong>und</strong> Lavieren eine »Störung«,<br />
die ausgesprochen <strong>und</strong> auf ihre Ursachen hin diskutiert werden muß.<br />
Bei der Arbeit schließlich an dem gewählten Projekt schlage ich die Regeln der themenzentrierten<br />
Interaktion vor, die ich gleich darstellen werde. Allgemein gilt dabei als »Störung« alles, was es<br />
einem Gruppenmitglied schwierig macht, am Thema mitzuarbeiten. Es muß dann ausgesprochen<br />
<strong>und</strong> diskutiert werden bis klar ist, ob es abgestellt werden kann. Manchmal führt die erste<br />
Erfahrung mit gruppendynamischen Prozessen <strong>und</strong> das Ausprobieren angstfreier<br />
70<br />
Verhaltensweisen dazu, daß dicke Verdrängungsmauern plötzlich in sich zusammenbrechen <strong>und</strong><br />
die ganzen bisher dahinter aufgestauten Ängste hervorbrechen. So etwas läßt sich nicht auf die<br />
Schnelle lösen. Es kostet sehr viel Zeit <strong>und</strong> Energie, auf diese Situation geduldig <strong>und</strong> einfühlsam<br />
so lange immer wieder neben der Arbeit am Thema einzugehen, bis eine neue Sicherheit in der<br />
Gruppe gewonnen ist.<br />
Schließlich sollte jede Gruppe in jeder Sitzung eine Person bestimrnen, die so etwas wie ein<br />
Protokoll schreibt. Das ist für zwei Zwecke wichtig: einmal verhilft es der Gruppe zu einem<br />
Gedächtnis über den eigenen Lernprozeß, zum anderen trägt es dazu bei, die laufenden<br />
Sitzungen zu straffen, denn in dem Protokoll sollen immer nur die Probleme festgehalten werden<br />
<strong>und</strong> ihre Lösung. Das zwingt die protokollierende Person aber dazu, in der Diskussion immer
wieder nachzufragen: Was ist jetzt eigentlich das Problem? <strong>und</strong>: Haben wir eigentlich jetzt dieses<br />
Problem gelöst <strong>und</strong> wie? Nur so bleibt die Gruppe am Ball. Denn das Wohlfühlen in der Gruppe<br />
ist zwar eine der wichtigsten Voraussetzungen, daß die Arbeit an der gemeinsamen<br />
Problemstellung gelingen kann <strong>und</strong> daß die Gruppe über mehrere Semester zusammenhält, also<br />
ein Studienkollektiv wird. Aber entscheidendes Kriterium für Erfolg <strong>und</strong> Mißerfolg muß doch<br />
immer die inhaltliche Arbeit am Thema sein.<br />
Dazu gibt es eine recht gut bewährte Arbeitsmethode: die themenzentrierte Interaktion (Cohn,<br />
1974). Sie geht von der Erkenntnis aus, daß die Arbeit an einem Thema in einer Gruppe nur dann<br />
erfolgreich sein kann, wenn die emotionalen Schwierigkeiten ausgesprochen werden, wenn es zu<br />
einem Gleichgewicht zwischen Thema, dem Gruppenzusammenhang <strong>und</strong> dem persönlichen<br />
Wohlbefinden kommt. Dazu haben sich einige Gr<strong>und</strong>regeln bewährt: Beim Reden solltest du<br />
immer mit dazusagen, warum du das fragst oder sagst, was es für dich selbst bedeutet. Dadurch<br />
soll vermieden werden, sich hinter allgemeinen Formulierungen, Lavierereien <strong>und</strong> <strong>Bluff</strong>-Fassaden<br />
zu verstecken: also statt vom »man« oder »wir« zu reden, erzähle deine eigene Reaktion, <strong>und</strong><br />
statt zu interpretieren <strong>und</strong> zu verallgemeinern, erzähle, wie du die Situation erlebst <strong>und</strong> was dir<br />
zum Thema einfällt <strong>und</strong> warum es dir einfällt. Die Interpretation <strong>und</strong> ihre Verallgemeinerung kann<br />
erst dann kommen, wenn sich alle geäußert haben. Schweigen ist noch lange nicht als<br />
Zustimmung zu werten. Deshalb sollte an wichtigen Punkten ein »Blitzlicht« gemacht werden:<br />
Dabei sagen alle nacheinander r<strong>und</strong>um in höchstens ein, zwei kurzen Sätzen, wie sie zu der<br />
anstehenden Frage stehen. Diskutiert wird erst, wenn alle durch sind. Auf diese Weise können<br />
sich alle an solchen wichtigen Punkten über den Stand in der Meinungsbildung <strong>und</strong> über den<br />
Unterschied in der eigenen Wahrnehmung <strong>und</strong> derjenigen der anderen klar werden.<br />
Die wichtigste Regel der themenzentrierten Interaktion ist aber:<br />
71<br />
Störungen haben Vorrang. »Sieh unser Thema von deiner Warte, <strong>und</strong> wenn du nicht beim Thema<br />
bleiben kannst, <strong>und</strong> dir etwas anderes sehr viel wichtiger ist, sage es. Ich werde das gleiche tun«<br />
(Cohn, 1974, S. 151). Wenn der »Spiegel« also eine Störung bemerkt, oder wenn du selbst vom<br />
Thema abkommst oder wenn plötzlich jemand ausklinkt, dann muß die Diskussion zum Thema<br />
sofort unterbrochen werden. Die Gefühle <strong>und</strong> Assoziationen, die mit der »Störung« verb<strong>und</strong>en<br />
sind, sollen ausgesprochen <strong>und</strong> diskutiert werden, bis damit umgegangen werden kann. Auf diese<br />
Weise kommen Konflikte <strong>und</strong> Schwierigkeiten zu einem Zeitpunkt heraus, wo sie noch bearbeitet<br />
<strong>und</strong> bewältigt werden können. Sie werden nicht verdrängt, bis sie sich so aufgestaut haben, daß<br />
sie nur noch durch einen Ausbruch oder eine reinigende Katastrophe geäußert werden können.<br />
Wenn sich ein solcher Konflikt, eine solche »Störung« als besonders schwerwiegend erweist, sei<br />
es für ein einzelnes Gruppenmitglied, sei es für die Weiterarbeit am Thema insgesamt, dann muß<br />
dieser Konflikt gründlich aufgearbeitet werden, sowohl in bezug auf die Bedeutung für die Gruppe<br />
hier <strong>und</strong> jetzt, wie auch in seiner gesellschaftlich vermittelten Geschichte. Dazu gibt es eine<br />
Reihe sehr hilfreicher Instrumente, die über das rein verbale <strong>und</strong> kognitive Aufarbeiten<br />
hinausgehen <strong>und</strong> deshalb eher geeignet sind, die ganze beteiligte Emotionalität herauszubringen<br />
(sehr nützlich dafür ist das Buch von Lutz Schwäbisch <strong>und</strong> Martin Siems: Anleitung zum sozialen<br />
Lernen für Paare, Gruppen <strong>und</strong> Erzieher; rororo 6846, Reinbek 1974). Ich will hier nur die beiden<br />
wichtigsten Methoden nennen: die erste ist das Zurückspiegeln (feedback) des Konfliktes. Die<br />
Beteiligten stellen jeweils dar, wie sie die Situation erlebt <strong>und</strong> was sie dabei gefühlt <strong>und</strong> gedacht<br />
haben. Aus dem Unterschied zwischen Eigen<strong>und</strong> Fremdwahrnehmungen ergeben sich immer<br />
wichtige Anhaltspunkte über die möglichen individualgeschichtlichen Gründe für solch<br />
unterschiedliches Erleben. Die andere Methode ist das Psychodrama oder Rollenspiel: Die am
Konflikt Beteiligten spielen jeweils die Rolle des Gegners, dann spielen andere<br />
Gruppenmitglieder den Konflikt noch einmal aus ihrer Wahrnehmung vor, also z. B. typische <strong>und</strong><br />
eingefahrene Reaktionen auf eine bestimmte Situation, <strong>und</strong> erst dann wird darüber diskutiert.<br />
Solche Rollenspiele zwingen dazu, sich in die Verhaltensweisen des »Konfliktgegners«<br />
einzufühlen, sich selbst über die Relativität des eigenen Verhaltens klarer zu werden, <strong>und</strong> sind so<br />
besonders geeignet, eingefahrene Vorurteile abbauen zu helfen (Metzel-Göckel, 1975, S. 64 f.).<br />
In solchen Rollenspielen können auch Frustrationen mit dem aktuellen Geschehen positiv<br />
überw<strong>und</strong>en werden, wenn es gelingt, im Rollenspiel nicht nur die frustrierende Gegenwart,<br />
sondern auch ihr positives Gegenbild vorzuspielen. Wichtig ist dabei aber vor allem, daß die<br />
Spiele nicht nur<br />
72<br />
sprachlich, sondern mit der Emotionalität des ganzen Körpers <strong>und</strong> mit aller übertriebenen<br />
karikierenden Rachsucht ausgespielt werden, die sich in der Gruppensituation entwickelt hat<br />
(Lentz, 1975). Solche Methoden zur Bewältigung von Störungen <strong>und</strong> zur Sensibilisierung<br />
gegenüber der verinnerlichten Unterdrückerrolle wie auch der genauso verinnerlichten Rolle der<br />
erlittenen Unterdrückung, all das darf aber nie Selbstzweck werden, sondern muß sich daran<br />
messen lassen, ob es dazu beiträgt, den Gebrauchswert des Studiums zu finden <strong>und</strong> ihn gegen<br />
sich selbst <strong>und</strong> gegen die Institution <strong>Uni</strong>versität durchzusetzen.<br />
73<br />
Fünftes Kapitel<br />
Hochschuldidaktik auch für Lehrende<br />
Wenn ich zu Beginn des Semesters in meine erste Veranstaltung gehe, überfällt mich lähmende<br />
<strong>Angst</strong>. Da sitzen vierzig, sechzig oder vielleicht sogar noch mehr Leute <strong>und</strong> warten auf mich, den<br />
Dozenten. Ich weiß nicht, was sie tatsächlich von mir erwarten. Aber die Vorstellung von ihren<br />
kritischen <strong>und</strong> klugen Gesichtern stürzt mich in einen Taumel sich überschlagender<br />
Anforderungen: Alle Schwächen <strong>und</strong> Lücken in meinem Veranstaltungskonzept, alle möglichen<br />
Einwände, alle ungelesenen Titel, alles was an schlechtem Ge- wissen in mir drinsteckt, all das<br />
kommt in mir hoch <strong>und</strong> wird von mir auf die klugen Gesichter projiziert <strong>und</strong> als von ihnen<br />
ausgehende Erwartung an mich erlebt.<br />
Meine Reaktion darauf ist, Schotten dicht, keine Angriffsflächen bieten. Die Sache muß so<br />
überzeugend sein, daß niemand was dagegen sagen kann.<br />
Diese Reaktion ist aber dann das Lähmendste an meiner <strong>Angst</strong>. Denn es geht dabei immer<br />
weniger um Inhalte oder konkretes Verhalten auf gegebene Situationen, sondern um so etwas<br />
wie »Niveau.«, »Originalität«, um »den Stand der Diskussion«... lauter Formeln, die nichts<br />
anderes sagen als: Du mußt anders <strong>und</strong> besser sein als du jetzt bist! <strong>Wie</strong> anders <strong>und</strong> warum<br />
anders, das wird nicht gesagt - nur: streng dich an! <strong>und</strong>: so nicht! Die Folge ist: Verkrampfung<br />
<strong>und</strong> immer größere <strong>Angst</strong>. So kommt es dann, daß ich ein Einführungsreferat auf »höchstem<br />
Niveau« halte - ich erkläre nichts, setze all das voraus, was in der Veranstaltung erst erarbeitet<br />
werden soll, <strong>und</strong> verteidige mich gegen mögliche Gegenargumente schon bevor ich überhaupt<br />
das ausgeführt habe, worauf die Einwände kommen könnten. Selbstverständlich versteht dann<br />
niemand etwas. Die Studenten <strong>und</strong> Studentinnen können das aber nicht mehr zeigen, weil ich in<br />
so einer Situation vor lauter <strong>Angst</strong> so rede, als ob das alles einfach <strong>und</strong> sonnenklar wäre. Sie<br />
können nur mit gelangweilten oder resignierten Gesichtern reagieren, die ich vielleicht wieder als<br />
Kritik erlebe. So kann es nur zu leicht geschehen, daß wegen meiner <strong>Angst</strong> die Veranstaltung
schon nach wenigen Minuten gelaufen ist. Eine unerträgliche Arbeitsatmosphäre hat sich für das<br />
ganze Semester festgesetzt.<br />
Genausowenig wie die <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> ist der <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> allein das Problem der Studierenden. Die<br />
Lehrenden haben während ihres Studiums mit dem »heimlichen Lehrplan« die<br />
<strong>Angst</strong>abwehrfassade perfekt gelernt. Ihre Karriere an der Institution <strong>Uni</strong>versität zeigt auch -<br />
hoffentlich nicht nur -, daß sie sich dem Wissenschaftsbetrieb<br />
74<br />
besonders erfolgreich angepaßt haben. Aber das geschieht bei ihnen genauso unbewußt als<br />
Reaktion auf die eben beschriebene <strong>Angst</strong> wie bei den Studierenden. (Bei den Lehrenden kommt<br />
noch als wichtige <strong>Angst</strong>ebene die vor dem vernichtenden Urteil der Kolleginnen <strong>und</strong> Kollegen<br />
dazu. So kann es vorkommen, daß ein Dozent vor einer Prüfung, die er zusammen mit einem<br />
gefürchteten Professor abnehmen muß, manchmal mehr <strong>Angst</strong> hat als der Prüfling!) Jetzt, nach<br />
erfolgreichem Studium <strong>und</strong> gelungenem Sprung in die Hochschullehrerlaufbahn geben die<br />
Dozenten den »heimlichen Lehrplan« oft genug selbst dann weiter, wenn sie von ihren bewußt<br />
gewählten Zielen her das genaue Gegenteil erreichen wollen. Auch noch so emanzipatorisch<br />
gemeinte Inhalte werden nur zu leicht zum Lehrstoff für die Vermittlung von angsteinflößendem<br />
Herrschaftsverhalten.<br />
Dazu ein schlagendes Beispiel aus der Literatur zur Hochschuldidaktik, um die es hier ja geht.<br />
Die Passage, die ich gleich wörtlich zitieren werde, endet mit den Worten: »Eine Didaktik, die<br />
angstfrei genuine Freude am Lernen entwickeln <strong>und</strong> erhalten will..« Alles, was davor kommt,<br />
widerspricht dieser Forderung jedoch total:<br />
Wir können »hier aus lern- <strong>und</strong> motivationspsychologischer Sicht Hochschuldidaktik<br />
folgendermaßen charakterisieren: Didaktische Überlegungen transformieren über symbolische<br />
Mediatoren die Struktur einer Sache in die kognitiven Strukturen der Studierenden, die durch die<br />
Integration der Sache erweitert oder umstrukturiert werden, <strong>und</strong> wodurch auch die Sache<br />
gegebenenfalls einen neuen Aspekt erhält. Lernen führt wesentlich zu Redefinition <strong>und</strong><br />
Umstrukturierung von Erfahrungen durch kognitive Bewertungen. Optimale Strukturierung <strong>und</strong><br />
optimale Stimulation werden nach den Erkenntnissen der Anreizmotivation <strong>und</strong> unter<br />
Berücksichtigung spontan explorativer Verhaltensweisen <strong>und</strong> epistemischer Neugier zu zentralen<br />
Prozeßkategorien einer Didaktik, die angstfrei genuine Freude am Lernen entwickeln <strong>und</strong><br />
erhalten will« (Metz-Göckel, 1975, S. 113).<br />
Hochschuldidaktik ist ein ziemlich neuer Zweig der <strong>Uni</strong><br />
Wissenschaften. <strong>Wie</strong> alle anderen Fächer ist auch er Resultat einer<br />
politischen Machtfrage. In diesem ' Falle Resultat der Studentenbe<br />
wegung der sechziger Jahre. Damals wurde der Skandal zu offen<br />
sichtlich, daß von den an den Hochschulen Lehrenden niemand ge<br />
lernt hatte, wie man das Lehren eigentlich macht.. Statt aber nun<br />
damit anzufangen, den Dozentinnen <strong>und</strong> Dozenten das beizu<br />
bringen, besonders denen, die ganz neu anfangen, wurde ein neuer<br />
Wissenschaftsbereich eingerichtet, in dem solche klugen Bücher<br />
veröffentlicht werden. Von diesem Fach können also weder die<br />
Lehrenden noch die Studierenden gegenwärtig viel Hilfe erwarten.<br />
In den einzelnen Fächern bleibt es derweil beim alten. Für die Leh<br />
75
e völlig unausgebildete Leute werden einfach auf die Studierenden losgelassen, um - wie es im<br />
Hochschullehrergesetz so schön heißt -Erfahrungen in der Lehre zu sammeln. In aller Regel<br />
besteht das dann darin, daß sie eben denselben Stiefel abziehen wie sie ihn selbst als<br />
Studierende in den Seminaren erlebt haben. Es ist für sie auch nicht weiter schlimm, wenn eine<br />
Veranstaltung nach der anderen völlig schief geht <strong>und</strong> die Teilnehmer frustriert abhauen. Selbst<br />
wenn es sie psychisch belastet, für ihre Karriere hat es keinerlei Konsequenzen. Da entscheidet<br />
allein die Forschung in Form der Veröffentlichungsliste. Die Lehre spielt inhaltlich so gut wie<br />
keine Rolle dabei. Die Lehrerfahrung wird dadurch nachgewiesen, daß man einige Semester lang<br />
Lehrveranstaltungen angeboten hat. Das, was sich groteskerweise Hochschul»lehrer« nennt, hat<br />
mit der Lehre nichts im Sinn, sondern forscht. Die Lehre ist auch danach.<br />
Lehrveranstaltungen werden meist geplant wie ein wissenschaftlicher Aufsatz: Die einzelnen<br />
Sitzungen sind wie Kapitel, in denen die Elemente entwickelt werden, die dann im letzten Kapitel<br />
die große Lösung bringen. Diese Lösungsschritte hängen aber nur im Kopf der Lehrperson<br />
zusammen. Für die Studierenden zerfällt alles in einzelne Referate <strong>und</strong> unzusammenhängende<br />
Diskussionsbeiträge. Zwischen den einzelnen Plenumssitzungen liegen so viele andere Termine,<br />
daß schon von dort her kein Zusammenhang hergestellt werden kann. Gewöhnlich wird nur das<br />
Thema bewußt <strong>und</strong> mit einiger Kontinuität wahrgenommen, das in der eigenen Arbeitsgruppe<br />
oder in einem Referat bearbeitet wurde. Schlimmer aber noch ist: das Thema der Veranstaltung<br />
stammt entweder aus einem obligatorischen Studienplan, der in irgendwelchen<br />
Wissenschaftlergremien beschlossen worden ist, oder aus dem Kopf der Lehrperson. Dort kommt<br />
sie meist über das gerade vorherrschende Forschungsthema hinein: woran man gerade arbeitet,<br />
darüber wird gelehrt. Ob dieses Problem auch ein Problem der Studierenden ist, kümmert kaum<br />
jemanden. »Wen es nicht interessiert, soll wegbleiben« ist die verbreitete Einstellung. Der Frust<br />
<strong>und</strong> die Apathie, die bei solchen Lehrveranstaltungen notwendigerweise für alle Beteiligten<br />
entstehen, werden von den Lehrenden nur zu oft einfach dadurch verarbeitet, daß sie die<br />
Faulheit <strong>und</strong> Apathie der Studierenden dafür verantwortlich machen (Hagemann-White, 1976).<br />
Von den Lehrenden können sich die Studierenden also nur in Ausnahmefällen eine Verbesserung<br />
der Situation erhoffen. Folglich müssen sie selbst dafür sorgen, daß sich die Art <strong>und</strong> Weise zu<br />
lernen in den Übungen <strong>und</strong> Seminaren gründlich verändert: Die Lehre muß kommunikativ <strong>und</strong><br />
kooperativ werden <strong>und</strong> muß sich am Problemverständnis der Studierenden orientieren.<br />
Dafür halte ich ein pädagogisches Konzept für besonders geeignet, das aus der<br />
politisch-pädagogischen Arbeit mit südamerikanischen Landarbeitern <strong>und</strong> Slumbewohnern<br />
entwickelt worden ist. Paulo<br />
76<br />
Freire hatte die Erfahrung gemacht, daß die üblichen Konzepte nichts fruchteten, mit denen den<br />
Bauern <strong>und</strong> Arbeitern das Lesen beigebracht wurde, weil die Inhalte, die da gelesen werden<br />
sollen, nichts zu tun hatten mit dem, was das Leben dieser Menschen ausmacht, mit den<br />
Widersprüchen, in denen sie leben müssen. Diese üblichen Konzepte nennt er<br />
»Bankierskonzepte«, weil die Lehrenden, oft genug, auch wenn sie sich als links verstehen, sich<br />
dabei zu den Lernenden verhalten wie Bankiers: »So wird Erziehung zu einem Akt der<br />
>SpareinlageAnlage-Objekt( sind, der Lehrer aber der >AnlegerBankiersKonzept< der Erziehung, in dem der den Schülern zugestandene<br />
Aktionsradius nur so weit geht, die Einlagen entgegenzunehmen, zu ordnen <strong>und</strong> aufzustapeln«<br />
(Freire, 1973, S. 57 f.). Die Gegenkonzeption dazu nennt er »problemformulierend« (103). In ihr<br />
haben die Lehrenden die Aufgabe, bei der Formulierung der Probleme <strong>und</strong> Ziele behilflich zu<br />
sein, die sowohl für sie selbst wie für die Lernenden wichtig sind. Ihre Lösung kann nicht von den
Lernenden vorweg »gewußt« werden, weil es immer Lösungen für die beteiligten Personen selbst<br />
sein müssen <strong>und</strong> sie deshalb von diesen gemeinsam mit den Lehrenden erarbeitet werden<br />
müssen, die dabei selbst in die Rolle der Lernenden geraten. Entscheidend für eine Pädagogik<br />
als Praxis der Freiheit ist also genau das, was auch an der Hochschule Bedingung der<br />
Möglichkeit für kommunikativen <strong>und</strong> kooperativen Unterricht ist: Die Lernenden müssen<br />
zusammen mit den Lehrenden aus ihrem eigenen Lebenszusammenhang eine Fragestellung <strong>und</strong><br />
langfristige Zielperspektive entwickeln, in der ihnen das, was sie lernend bearbeiten, erfahrbar<br />
weiterhilft, sie müssen also selbst den Gebrauchswert dessen bestimmen, was sie lernen.<br />
Pädagogik <strong>und</strong> Hochschuldidaktik ist nach dieser Auffassung nicht mehr ein mehr oder weniger<br />
trickreiches <strong>und</strong> raffiniertes Mittel, mit dem die Lehrperson die Lernziele, die sie aus ihrem<br />
umfassenden Wissen oder aus den bürokratischen Vorschriften entwickelt hat, in die Lernenden<br />
hineinbringt. Didaktik ist nicht Manipulation auf noch so gut gemeinte <strong>und</strong> »emanzipatorische«<br />
Ziele hin, wie das nur allzu oft selbst in linken Lehrveranstaltungen verstanden wird <strong>und</strong> wie das<br />
auf jeden Fall das Selbstverständnis der bei uns herrschenden Erziehungswissenschaften ist.<br />
Statt dessen ist es nach dem problemformulierenden Konzept der Didaktik Aufgabe der<br />
Lehrpersonen, den Studierenden dabei zu helfen herauszufinden, was ein Thema, das der<br />
Dozent oder die Dozentin aus ihrem eigenen Lernprozeß heraus als wichtig erfahren hat, mit dem<br />
Lebenszusammenhang der Studierenden zu tun hat, welchen Gebrauchswert es für sie hat <strong>und</strong><br />
welches Problem es für sie lösen kann. Wenn die Rolle des Problems, sein Gebrauchswert<br />
einmal klar geworden ist, dann ist es die gemeinsame Aufgabe der Lehren<br />
77<br />
den, <strong>und</strong> Studierenden, einen für alle akzeptablen Weg zu seiner Lösung zu finden.<br />
Mit dieser Konzeption von Didaktik hört sie auch auf, Monopol der Lehrenden zu sein. Vielmehr<br />
wird Pädagogik zu einem Verhalten, das einem selbst <strong>und</strong> den anderen das Problem klar macht<br />
<strong>und</strong> mögliche Lösungsversuche verdeutlicht, zur gleichwertigen Aufgabe aller Beteiligten. Die<br />
folgenden Überlegungen, wie <strong>Uni</strong>Veranstaltungen besser gestaltet werden könnten, richten sich<br />
deshalb keineswegs vor allem an Dozenten <strong>und</strong> Dozentinnen, sondern sind im Gr<strong>und</strong>e<br />
genommen ein Teil des vorangegangenen Kapitels: <strong>Wie</strong> ist es für ein Studienkollektiv möglich,<br />
möglichst viel aus dem Studium herauszuholen. Es sind Vorschläge, die genauso von einer<br />
Gruppe Studierender kommen können, die darauf bestehen, die Bedingungen der Lehre so zu<br />
verändern, daß sie befriedigender werden. Wenn sie von den Lehrenden kommen, ist das<br />
einfacher, weil diese mit einem solchen Autoritäts- <strong>und</strong> Vertrauensvorsprung erlebt werden, daß<br />
ihnen solche Vorschläge nicht als eine besondere Form des <strong>Bluff</strong>s <strong>und</strong> der Profilisierungssucht<br />
übel genommen werden. Studienkollektive, die eine Veränderung des Lehrverhaltens<br />
durchsetzen wollen, müssen deshalb sehr viel vorsichtiger <strong>und</strong> offener in der Darstellung ihrer<br />
Ängste <strong>und</strong> Interessen auftreten als das für Lehrende notwendig ist. Für die ist lediglich wichtig<br />
zu verstehen, daß die Alternative in ihrem Lehrstil nicht die zwischen autoritär oder demokratisch<br />
ist - ganz zu schweigen von einem laisser-faire-Stil -, sondern die zwischen dozentenzentriert<br />
oder studentenzentriert (Metz-Göckel, 1975, S. 80 f.).<br />
Das Wichtigste ist, daß zu Anfang des Studiums, also wenigstens im ersten Semester, ganz<br />
gründlich <strong>und</strong> ausführlich diskutiert wird, weshalb jeder <strong>und</strong> jede einzelne gerade dieses Fach<br />
studieren. Dabei ist es gar nicht so wichtig, daß deshalb vielleicht im ersten Semester kaum Stoff<br />
behandelt werden kann. Die Überkonzentration auf die »Sache« oder den »Stoff« ist sowieso<br />
Kennzeichen der stoff- <strong>und</strong> nicht personenorientierten <strong>Uni</strong>-Situation, denn vor lauter Stoff geraten<br />
die sozialpsychologische Situation der Lehrveranstaltung <strong>und</strong> der Sinn des Stoffes für die<br />
Studierenden ganz aus dem Blick.
Aber auch zu Beginn einer jeden Lehrveranstaltung sollte festgestellt werden, was das Thema für<br />
die Teilnehmer bedeutet, <strong>und</strong> zwar nicht in der normativen Weise: was versprichst du dir von dem<br />
Thema, wie willst du, daß es angegangen wird, sondern in der erfahrungsbezogenen Frage: was<br />
hat das Thema mit dir zu tun, welche Erfahrungen hast du bisher mit dem Themenbereich<br />
gemacht, was hat dich dazu gebracht, dich näher damit zu beschäftigen? Ein sehr<br />
unkonventionelles, aber zugleich einleuchtendes Mittel zur Beantwortung dieser Frage ist es, vor<br />
der vertieften Beschäftigung mit der Literatur einfach mal zu sammeln, etwa durch Zei<br />
78<br />
tungsausschnitte, Fotos, kurze Papiere mit Interviews der anderen Studierenden, welche<br />
Eindrücke <strong>und</strong> Erfahrungen mit der Fragestellung des Themas schon vorhanden sind. Das ist<br />
selbst bei mathematischen Themen möglich (natürlich nicht mit Fotos!), weil alle Studierenden<br />
entweder schon in der Schule oder in vorangegangenen Semesterstufen schon einen Vorbegriff<br />
von dem haben, was sie in bestimmten Themenbereichen erwartet. Dabei ist es immer sinnvoller,<br />
die Veranstaltung in lauter Zweier- oder Vierergruppen aufzuteilen, die sich gegenseitig<br />
interviewen <strong>und</strong> dann gemeinsam darüber Bericht erstatten, als wenn die Teilnehmer unvermittelt<br />
aufgerufen werden, vor dem Plenum zu legitimieren, warum sie in die Veranstaltung gekommen<br />
sind. Eine andere Möglichkeit ist es, vor der eigentlichen Bildung von themenorientierten<br />
Arbeitsgruppen nur von einer Sitzung zur nächsten ad-hoc-Gruppen zu bilden, die gemeinsam<br />
vorklären, was sie von dem Seminar erwarten <strong>und</strong> was 'für Erfahrungen sie bisher mit dem<br />
Gegenstand gemacht haben.<br />
Wenn ich hier von Veranstaltungen rede, dann meine ich damit selbstverständlich nicht<br />
Vorlesungen. Die sind nach allgemeinem Urteil der Hochschuldidaktik bestenfalls am Ende des<br />
Hauptstudiums zur Informationsübermittlung als Buchersatz geeignet, <strong>und</strong> dann auch nur, wenn<br />
die monologische Vortragszeit des hier tatsächlich Dozierenden fünfzehn Minuten am Stück nicht<br />
überschreitet <strong>und</strong> zwischen diese Monologe jeweils Frage- <strong>und</strong> Diskussionsperioden geschaltet<br />
sind. Dann gilt für die Vorlesung: »Für bereits motivierte <strong>und</strong> an der Sache engagierte Lerner hat<br />
sie eine kognitive Verstärkerfunktion« (Metz-Göckel, 1975, S. 91). Für Studierende im<br />
Gr<strong>und</strong>studium ist die Vorlesung klassischen Stils meist ein Totschlaginstrument, wie es<br />
wirkungsvoller nicht ausgedacht werden könnte.<br />
Entscheidend ist also in der üblichen Diskussionsveranstaltung das solidarische Herausarbeiten<br />
dessen, was den Gebrauchswert der Veranstaltung für die Teilnehmer ausmacht. Die<br />
berühmtberüchtigte Semestervorbereitung der Lehrenden reduziert sich damit auf das Sammeln<br />
von Material <strong>und</strong> den Überblick über den Stoff. Das Durchplanen jeder einzelnen Sitzung bis zum<br />
Ende des Semesters erübrigt sich nicht nur, sondern wird unter solchen Voraussetzungen<br />
geradezu zum lernfeindlichen Akt: Die genaue Problemformulierung <strong>und</strong> die Schritte zu ihrer<br />
Lösung sind erst richtig möglich, wenn sich alle Teilnehmer klar geworden sind <strong>und</strong> sich geäußert<br />
haben, was für sie das relevante Problem der Veranstaltung ist, worauf sie neugierig sind<br />
(Metz-Göckel, 1975, S. 108 ff.).<br />
Vor einem Jahr habe ich eine solche studentenzentrierte Seminarveranstaltung versucht. Sie ist<br />
mir so mißlungen wie schon lange keine Veranstaltung mehr. Das ging so weit, daß ich einmal<br />
mehrere Minuten schweigend dasaß <strong>und</strong> voller Verzweiflung das ebenfalls schweigende Plenum<br />
anschaute. Heute glaube ich, daß dafür<br />
79<br />
zwei Gründe verantwortlich waren: am wichtigsten war, daß ich beim Auftauchen der ersten<br />
Schwierigkeiten nicht sofort darauf bestand, darüber ausführlich im Plenum zu reden, so lange,
is sich eine einverständige Lösung ergeben hätte. Statt dessen reagierte ich mit einem<br />
Verantwortungstaumel <strong>und</strong> entwickelte immer neue Aktivitätsschübe, schleppte immer neue<br />
theoretische Texte an <strong>und</strong> führte ein wahres Feuerwerk von Medieneinsätzen vor <strong>und</strong> was es<br />
sonst an pädagogischen Tricks gibt. Resultat: ich hatte den Rest an Initiative totagiert. Der<br />
andere Gr<strong>und</strong> war: die Studierenden sind in den konventionellen Veranstaltungen so überlastet,<br />
daß sie dort mit knapper Not ihre Referate durchziehen, sich sonst aber apathisch verhalten <strong>und</strong><br />
am Referat für eine andere Veranstaltung arbeiten. Veranstaltungskonzepte wie die hier<br />
vorgestellte Konzeption vom studentenzentrierten Lernen können da leicht zu einer<br />
Überforderung werden, auf die erst recht mit Apathie reagiert wird.<br />
In dieser Situation ist es für die Lehrenden wie für die Studierenden entscheidend, von der ersten<br />
Sitzung an darauf zu bestehen, daß in jeder Sitzung auch über das geredet wird, was an<br />
gruppendynamischen Prozessen <strong>und</strong> Lernschwierigkeiten auftritt. Das kann auch bei großen<br />
Veranstaltungen durch eine Methode geschehen, die ich »Großblitz« nenne: wenn ein<br />
inhaltliches oder gruppendynamisches Problem auftritt, das sich nicht so leicht lösen läßt, wird<br />
die Veranstaltung in lauter Sitzgruppen von vier bis sechs Leuten aufgeteilt. Die müssen dazu nur<br />
ihre Stühle ein wenig umstellen. In diesen Gruppen kann dann unter Beteiligung aller das<br />
Problem vorbesprochen werden. Nachdem die Ergebnisse von Berichterstattern ins Plenum<br />
gebracht worden sind, kann dann eine zusammenfassende Diskussion geführt werden. Das klingt<br />
zunächst etwas ungewöhnlich, ist aber kein Problem, denn die Situation in der Cafeteria mit den<br />
Gesprächsgruppen an den Tischen ist auch nicht anders (Diepold, 1975). Solche Phasen der<br />
Gruppenarbeit im Plenum entschärfen auch das Problem der Sprechschwelle im Plenum. Dem<br />
kommt man aber am besten bei, wenn schon in der ersten Sitzung ein richtiges »Blitzlicht«<br />
gemacht wird: alle sagen so kurz wie möglich, wer sie sind <strong>und</strong> was sie machen. Bei kleineren<br />
Seminaren kann man das auch vor der zusammenfassenden Diskussion statt der Sitzgruppen<br />
öfter machen. Die Beiträge sind so gleichmäßiger verteilt, <strong>und</strong> alle lernen die <strong>Angst</strong> vor dem<br />
Sprechen abzubauen. Eine weitere wichtige Hilfe dafür ist es auch, wenn die Person, die die<br />
Diskussion leitet, nicht stur nach Rednerliste vorgeht, sondern Studierende, die sich das erstemal<br />
melden oder sehr selten reden, sofort außerhalb der zeitlichen Reihenfolge drannimmt.<br />
Ein weiterer Hinweis für Lehrende: aus der Situation, die ich am Anfang dieses Kapitels<br />
beschrieben habe, ergaben sich für mich zwei Folgerungen. Die erste hat etwas mit meinem<br />
Körper zu tun.<br />
80<br />
jemand, der mich sonst nur außerhalb des Seminars kannte, sagte nach einer solchen Sitzung,<br />
daß er mich gar nicht wiedererkannt habe, so verkrampft <strong>und</strong> hart sei ich da aufgetreten, <strong>und</strong> er<br />
habe richtig gespürt, wie sich diese Verkrampfung sogar auf ihn übertragen habe, wo er doch gar<br />
kein eigentlicher Teilnehmer der Veranstaltung war. Danach habe ich probiert, mich selbst dazu<br />
zu zwingen, bewußt auch durch die Körpersprache zum Ausdruck zu bringen, also durch betont<br />
entspanntes Sitzen <strong>und</strong> Stehen (ich sitze z. B. auf dem Tisch <strong>und</strong> schlenkere mit den Beinen),<br />
daß ich in dieser Veranstaltung nicht gedenke, alle Verantwortung zu übernehrnen, sondern daß<br />
ich mich so einbringe, wie ich bin. Die zweite Folgerung ergab sich mit Notwendigkeit daraus: ich<br />
erzähle, was mit mir vorgeht, daß es mir gar nicht so leicht fällt, mich so locker zu geben. Ich<br />
zeige aber auch, daß ich auf eine Entwicklung in der Seminaratmosphäre hoffe, die es mir <strong>und</strong><br />
allen Teilnehmern ermöglicht, ohne Anstrengung entspannt zu sein.<br />
Dieses studentenzentrierte Lernen bringt aber eine ganze Menge Schwierigkeiten mit sich,<br />
besonders am Anfang. Die meisten Studierenden sind sich durchaus im unklaren darüber, warum<br />
sie ein bestimmtes Fach studieren oder warum sie eine bestimmte Lehrveranstaltung besuchen,
<strong>und</strong> reagieren ausweichend bis sauer, wenn sie durch den Veranstalter oder durch<br />
Mitstudierende genauer befragt werden (Oehler, 1974). Die Verdrängungen <strong>und</strong><br />
Versachlichungen, die während der Gymnasialzeit mühsam erlernt worden sind, funktionieren<br />
nun als Schutzwall gegen Betroffenheit durch ein wissenschaftliches Thema <strong>und</strong> gegen die<br />
verunsichernde Frage nach dem Gebrauchswert des Faches <strong>und</strong> des jeweiligen Themas. Sie<br />
kann anfangs zu Lernwiderständen <strong>und</strong> Spannungen führen, mit denen schwer umzugehen ist<br />
(Metz-Göckel, 1975, S. 140 f.). Denn durch die Schule <strong>und</strong> viele andere Sozialisierungsinstanzen<br />
ist gegenüber dem Lernen eine Haltung eingeübt worden wie gegenüber dem Fernsehprogramm:<br />
mal sehen, was interessant sein könnte, <strong>und</strong> hinterher drüber meckern! Die unmittelbare<br />
Identifikation mit einem Stoff, sogar die Frage, was dieser Stoff mit mir selbst zu tun hat, wird<br />
meist schon als ein unzulässiges Eindringen in die Intimsphäre empf<strong>und</strong>en. Dagegen hilft meiner<br />
Erfahrung nach nichts als das geduldige Insistieren auf der Berechtigung der eigenen<br />
Bedürfnisse <strong>und</strong> das Appellieren an die Toleranz der anderen. Tutoren, lange Zeit das<br />
Allheilmittel aller hochschuldidaktischen Diskussionen, sind unter den gegebenen Verhältnissen<br />
eher schädlich als nützlich. Es sei denn, es gibt die Möglichkeit, sie ausführlich in<br />
Intensivseminaren mit gruppendynamischen Übungen auf ihre Aufgabe vorzubereiten <strong>und</strong> sie<br />
permanent während der Veranstaltung unter der Kontrolle der anderen Teilnehmer zu<br />
beraten (so auch: Eckstein, 1972). Sonst ist nämlich die Gefahr zu groß, daß die Tutoren<br />
wahre Orgien der Selbstbestätigung feiern <strong>und</strong> sich als<br />
81<br />
allwissende Superdozenten ausgeben (Bull, Weber-Unger, 1976, S. 124 ff.). Ich meine, daß es<br />
stattdessen viel besser ist, in der Veranstaltung möglichst homogene (in bezug auf das inhaltliche<br />
Interesse <strong>und</strong> die Fächerkombination - das ist wichtig wegen der unterschiedlichen<br />
Zeitanforderungen) Gruppen von maximal acht ernsthaft interessierten Teilnehmern ohne Tutor<br />
oder sonstwie formal bestimmter Führungsperson zu bilden, die sich dann - nach einer langen<br />
<strong>und</strong> intensiven Diskussion über den Gebrauchswert ihres Studiums - vielleicht zu den<br />
Studienkollektiven entwickeln können, die ich im vorangegangenen Kapitel angesprochen habe.<br />
(Solche Gruppen kann man technisch am einfachsten dadurch bilden, daß jede Person, die eine<br />
Wohung hat, in der eine solche Gruppe tagen könnte, ihre Adresse <strong>und</strong> ihre Terminvorschläge<br />
mit den persönlichen Gebrauchswertinteressen an die Tafel schreibt <strong>und</strong> dann sechs bis sieben<br />
Interessenten/innen abgezählt werden, die sich nach Aufruf aus dem Plenum zu dieser Adresse<br />
melden!) Damit sich so etwas in einer Veranstaltung herausbilden kann, ist es für die<br />
Veranstaltung selbst unverzichtbar, daß ein Minimum an gruppendynamischen Kriterien in ihr<br />
angewandt wird, denn erst damit entsteht die Atmosphäre von Solidarität <strong>und</strong> Sensibilität, die<br />
eine solche Kollektivperspektive überhaupt erst glaubwürdig <strong>und</strong> möglich erscheinen läßt.<br />
Die Rückspiegelung des sozialen Geschehens kann sehr sinnvoll in einer regelmäßigen<br />
nachbereitenden Sitzung durchgeführt werden, wo Vertreter aus allen Gruppen, Interessierte, vor<br />
allem aber diejenigen, die in der Plenumssitzung durch Referate oder ähnliches besonders<br />
hervorgetreten sind, zusammenkommen <strong>und</strong> berichten, wie sie die Sitzung erlebt haben, welche<br />
Ängste sie dabei entwickelt haben,welche Erwartungen sie gehabt haben <strong>und</strong> welche<br />
Enttäuschungen sie erfahren haben. Daraus können dann gemeinsame Vorschläge für die<br />
nächste Sitzung entwickelt werden (Kisten, Mente, 1975). Solche nachbereitende Sitzungen<br />
werden dann besonders fruchtbar, wenn eine vorher bestimmte Gruppe dieselbe Funktion für das<br />
Plenum übernommen hat, die der »Spiegel« in der Kleingruppe hat. Eine solche<br />
»Feedbackgruppe« muß nach einem gemeinsam vorher ausgearbeiteten Fragenkatalog den<br />
Verlauf der Plenumssitzung beobachten <strong>und</strong> hinterher Bericht erstatten (Anregungen für solche<br />
Fragen bei: Doerry, 1972; zur Organisation: Tübinger Autorenkollektiv, 1976).
Solche Methoden müssen nicht erst vom Dozenten oder der Dozentin eingeführt werden, sie<br />
können auch von einer Teilnehmergruppe vorgeschlagen werden. Entscheidend bei solchen<br />
Metakommunikationen, also Kommunikation über die Kommunikation, ist aber meiner Meinung<br />
nach, daß Teilnehmer, die bluffen, nicht einfach denunziert werden. Das verstärkt nur die <strong>Angst</strong><br />
<strong>und</strong> macht die <strong>Angst</strong>abwehrfassade noch notwendiger <strong>und</strong> dichter. Statt dessen<br />
82<br />
sollten die anderen Teilnehmer, also die geblufften, zeigen, wie ihnen die <strong>Bluff</strong>sprache des<br />
Teilnehmers in der Sitzung <strong>Angst</strong> gemacht hat, wie sie selbst versucht waren zurückzubluffen.<br />
Dann kann man sich gemeinsam darüber unterhalten, welche unsinnigen Lern<strong>und</strong><br />
Kommunikationsschwierigkeiten dadurch aufgebaut werden. Eine noch bessere Möglichkeit, den<br />
<strong>Bluff</strong> ohne Diskriminierung einzelner zu problematisieren, ist die Methode »Schere <strong>und</strong> Leim«.<br />
Dabei wird ein typisch aufgeblasener <strong>Bluff</strong>text mit der Schere so bearbeitet, daß nur noch die<br />
verständlichen <strong>und</strong> aussagekräftigen Zeilen übrigbleiben, die dann zu einem neuen Text<br />
zusammengeklebt werden. Mit dieser Methode kann gleichzeitig die Aggression gegen den<br />
<strong>Bluff</strong>er gerichtet werden, die man sonst meist gegen sich selbst richtet, wenn man etwas nicht<br />
versteht.<br />
Auch die Ergebnisse von Arbeitsgruppen können ohne Schaden auf <strong>Bluff</strong>-Figuren hin<br />
durchleuchtet <strong>und</strong> in ihrer Lernfeindlichkeit kritisiert werden: Warum wird so getan, als sei alles<br />
gelöst, anstatt offengebliebene Fragen <strong>und</strong> Arbeitsprobleme mit zu benennen? Warum machen<br />
sich die Gruppen fast nie Gedanken über die Vermittlung ihres Papiers im Plenum? Warum<br />
schreiben sie meist nur für die Lehrenden?<br />
Auf diese Weise erleben alle, daß das <strong>Bluff</strong>en nicht Ausdruck eines persönlichen Versagens ist<br />
<strong>und</strong> gleichzeitig stellt sich mehr <strong>und</strong> mehr eine Situation her, in der es nicht mehr notwendig ist zu<br />
bluffen. Die pädagogische Haltung gegenüber den Teilnehmern darf also nicht auf den Dozenten<br />
oder die Dozentin beschränkt bleiben, sondern muß zur Haltung aller Teilnehmer einer<br />
Veranstaltung zueinander werden. Wenn jemand redet, dann muß das hauptsächliche<br />
Beurteilungskriterium sein, ob er oder sie sich dabei deutlich <strong>und</strong> verständlich macht <strong>und</strong> ob es<br />
auf die Redebeiträge anderer bezogen ist <strong>und</strong> nicht, ob es glänzend formuliert ist <strong>und</strong> von<br />
Wissen strotzt etc. Nur dann kann Hochschuldidaktik zu dem beitragen, was auch in den<br />
Veranstaltungen der Angelpunkt im Kampf gegen <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> <strong>und</strong> <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> ist: den Gebrauchswert<br />
des Studiums zu erkennen <strong>und</strong> gegen die eigenen Tauschwertstrukturen <strong>und</strong> gegen<br />
diejenigen der <strong>Uni</strong> durchzusetzen.<br />
83<br />
Sechstes Kapitel<br />
<strong>Wie</strong> wissenschaftliches Arbeiten<br />
Spaß machen kann<br />
Selbst wenn all das Wirklichkeit würde, was ich in den beiden vorangegangenen Kapiteln<br />
vorgeschlagen habe, so wäre damit immer noch nicht das Problem gelöst, wie du mit der<br />
Wissenschaft umgehen sollst. Auch wenn du durch lange Diskussionen zusammen mit anderen<br />
herumdiskutiert hast, was du vom Studium haben willst, was du später damit machen willst,<br />
welchen Sinn es also für dich hat, so bleibt doch noch das Problem, wie du aus dem sperrigen<br />
<strong>und</strong> unzugänglichen Wissenschaftskram das herausholen kannst, was dich interessiert. Und<br />
selbst dann, wenn du in einem funktionierenden Studienkollektiv gelandet bist, kommst du ohne
individuelle wissenschaftliche Arbeit nicht aus, nicht nur wegen der Prüfungen, sondern vor allem,<br />
weil auch du dich nützlich machen mußt für das Kollektiv.<br />
Normalerweise vermittelt der Hochschulunterricht keine Kenntnisse über selbständige, fürs<br />
Studium notwendige Arbeitstechniken, sondern setzt sie als vorhanden voraus. Oft genug kommt<br />
das erst im Hauptstudium oder gar vor der Prüfung zum Vorschein, weil es bis dahin gelungen ist,<br />
sich allen Situationen zu entziehen, wo sie ernstlich notwendig gewesen wären. Dann ist die<br />
Bedrohungssituation aber schon perfekt. Kommen da noch irgendwelche zusätzliche<br />
Schwierigkeiten, z. B. Probleme in der Zweierbeziehung, dann ist die Katastrophe da.<br />
In diesem Kapitel will ich deswegen versuchen, einige Hinweise zur Arbeitstechnik zu geben, die<br />
vielleicht die Chance verbessern können, Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten zu gewinnen.<br />
Dazu muß ich aber zwei wichtige Hinweise geben:<br />
1. Was ich hier beschreibe, ist meine individuelle Arbeitsweise, die sich bei mir in den<br />
vergangenen zehn Jahren entwickelt hat. Sie ist also noch geprägt durch die Studienorganisation<br />
der frühen sechziger Jahre. Damals liefen z. B. alle Studierenden mit Karteikarten herum. Ich<br />
halte diese Technik für die beste, sonst würde ich sie ja auch nicht selbst praktizieren. Es gibt<br />
aber auch viele andere Weisen, mit der Wissenschaft umzugehen. Ich kenne Hochschullehrer,<br />
die in ihrem ganzen wissenschaftlichen Leben noch nie eine Karteikarte beschriftet haben. Wenn<br />
du andere Techniken entwickelst, weil du dich zum Beispiel nicht so leicht selbst austricksen<br />
kannst wie ich, dann helfen dir diese Tips aber vielleicht dabei, dir klar darüber zu werden, was<br />
du anders machen willst <strong>und</strong> warum.<br />
2. Das Kapitel zerfällt in zwei Teile, einen für Studierende im Gr<strong>und</strong>studium <strong>und</strong> einen für das<br />
Hauptstudium (wobei Studieren<br />
84<br />
de in, Hauptstudium den ersten Teil unbedingt auch lesen müssen!) Der erste Teil reicht bis dort,<br />
wo es losgeht mit: »Die Arbeit an einein größeren Thema« auf S. 93. Studierende, die noch gar<br />
keine größeren selbständigen Arbeiten schreiben,. sollten nur bis dorthin lesen. Sobald du dich<br />
aber an eine solche Arbeit machst, sei es aus eigenem Interesse oder weil du sie für einen<br />
Schein oder eine Prüfung machen mußt, dann solltest du den Rest des Kapitels durcharbeiten.<br />
Dabei ist klar: Nicht die Technik des Arbeitens bringt die Befriedigung. Entscheidend ist, ob der<br />
Inhalt als Problem für dich spannend ist, ob dieser Inhalt für dich ein Problem lösen soll, das dir<br />
selbst wichtig ist. Die hier beschriebene Arbeit stechnik hilft nur unnötige Schwierigkeiten zu<br />
vermeiden.<br />
Bevor ich aber auf solche technischen Details komme, will ich anhand meiner häufigsten<br />
Arbeitsschwierigkeiten die drei Gr<strong>und</strong>prinzipien beim wissenschaftlichen Arbeiten darstellen, die<br />
mir bisher immer geholfen haben, schließlich doch Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten zu<br />
haben.<br />
Drei Gr<strong>und</strong>prinzipien:<br />
Erstens - den Respekt vor der Wissenschaft verlieren<br />
Meine erste Schwierigkeit: das ständige schlechte Gewissen, ich hätte nicht genug gelesen <strong>und</strong><br />
wisse über nichts richtig Bescheid, dieser Minderwertigkeitskomplex hängt direkt mit dem<br />
unsinnigen Respekt zusammen, den mir die Wissenschaft immer wieder aufs neue einflößt. Für<br />
mich ist es ungeheuer wichtig, mir diesen Respekt ebensooft aus dem Kopf herauszuwaschen.
Normalerweise reagiere ich auf ein Buch, das ich nicht verstehe, mit der üblichen<br />
eingeschüchterten Selbstaggression, mit dem Gefühl, ich sei zu dumm, das zu verstehen. Ich<br />
müsse mich eben hinsetzen <strong>und</strong> alle Bücher lesen, die in dem unverständlichen zitiert werden,<br />
mich also auf den Stand des Autors hinaufarbeiten. Dann würde ich schon verstehen. Meist fand<br />
ich nach unendlichen Mühen dann schließlich heraus, daß sich das alles viel einfacher hätte<br />
sagen lassen, wenn der Typ nicht vor allem für seine hochgestochenen Kollegen geschrieben<br />
hätte.<br />
Mit der Zeit habe ich also gelernt, immer öfter die Aggression von mir weg auf den Autor zu<br />
wenden, den ich nicht verstehe: nicht ich bin doof, sondern er, wenn er es bei all seiner Bildung<br />
nicht schafft, sich verständlich auszudrücken. Wenn ich mir das klarmache, dann schüchtert mich<br />
der Text auch schon nicht mehr so sehr ein, <strong>und</strong> ich überspringe einfach die unverständlichen,<br />
komplizierten <strong>und</strong> fremdwortgespickten Passagen <strong>und</strong> lese nur die halbwegs verständlichen<br />
Abschnitte, ich suche also nach dem inhaltlichen Kern unter der verhüllenden Sprachkruste.<br />
Bietet sich beim Ober85
fliegen kein solcher Kern an, dann lege ich das Buch weg, ordne es unter die unzähligen<br />
anderen, die nur aus Kruste bestehen <strong>und</strong> bloß der Karriere wegen geschrieben worden sind. Es<br />
kann durchaus sein, daß ich bei dieser respektlosen Manier, mit Büchern umzugehen, hin <strong>und</strong><br />
wieder ein geniales Werk mit auf den Misthaufen werfe. Wenn es aber so akademisch<br />
geschrieben ist, dann ist mir das auch egal. Ein solches souveränes Verhältnis zur Wissenschaft,<br />
das es ermöglicht, sie von den gängigen Akademismen zu unterscheiden, ist aber nur möglich,<br />
wenn du dich auf den Stoff voll einläßt, dich also nicht äußerlich zu ihm verhältst, sondern an der<br />
Sache dran bleibst, bis sie zu sprechen beginnt.<br />
Für mich bedeutet das zweierlei: einmal heißt es, daß ich alles erreichbare Material zu dem<br />
Thema oder der Fragestellung sammle, um einfach zuerst einmal herauszufinden, was los ist.<br />
Wenn ich beim Lesen das Gefühl kriege, es wiederholt sich alles nur noch, das kennst du alles<br />
schon, dann weiß ich, daß ich genug gesammelt habe. Dann heißt es, daß ich an diesem<br />
gesammelten Material so lange arbeite, bis es sich in einen stimmigen Zusammenhang bringen<br />
läßt, bis ich es mit seinen Widersprüchen <strong>und</strong> Verästelungen für mich einleuchtend <strong>und</strong><br />
befriedigend erklären kann. Meiner Erfahrung nach läßt sich das bei jedem Thema (außer den<br />
»Lebenswerken«, die man sowieso lieber bleiben lassen sollte) mit ein bis zwei Monaten<br />
regelmäßiger Arbeit erreichen.<br />
Wenn du in dieser Weise eine Fragestellung durcharbeiten kannst, dann hast du damit viel mehr<br />
von der Methodik <strong>und</strong> den Zusammenhängen deines Faches begriffen, als wenn du überall mal<br />
kurz hineinschnüffelst, um möglichst das ganze Fach abdecken zu können. Wenn du mit deiner<br />
Fragestellung in den Problemberg deines Faches hineingestochen hast, bis deine Frage für dich<br />
befriedigend beantwortet ist, dann hast du die meisten wichtigen methodischen <strong>und</strong><br />
gr<strong>und</strong>sätzlichen Probleme deines Faches drauf stecken wie auf einem Schaschlikspieß.<br />
Mit welcher Fragestellung aus welchem Themenbereich du dabei anfängst, ist meist ziemlich<br />
egal. Die Hauptsache ist, daß sie mit dem, was du für den Sinn des Faches hältst, <strong>und</strong> mit deinen<br />
eigenen Erfahrungen wenigstens ein bißchen was zu tun hat - <strong>und</strong> wenn es auch auf noch so<br />
verschlungenen Umwegen ist, wenn also dabei wenigstens mittelbar ein Problem gelöst wird, das<br />
du als dein eigenes betrachten kannst. Das Gefühl, das in der Regel entsteht, wenn du einen<br />
Stoff ganz erfaßt <strong>und</strong> ein für dich relevantes Problem für dich befriedigend gelöst hast, das ist<br />
dann das, was ich meine mit: wissenschaftliches Arbeiten kann Spaß machen!<br />
86<br />
Drei Gr<strong>und</strong>prinzipien:<br />
Zweitens - die geistige Arbeit in Handarbeit verwandeln<br />
Selbst wenn es gelungen ist, den Respekt vor der Wissenschaft abzubauen , bleibt das Problem<br />
des Anfangens. Ständig meine ich, ei<br />
gentlich etwas anderes, ein anderes Buch, ein anderes Gebiet bearbeiten zu müssen, weil es<br />
wichtiger oder Voraussetzung für das ist, was ich gerade mache. Gleichzeitig meine ich, mich<br />
ungeheuer anstrengen zu müssen, das was ich gerade lese, auch vollständig zu erfassen. Das<br />
Ganze wird dann mehr <strong>und</strong> mehr zu einem Knäuel von gleichzeitiger Anstrengung <strong>und</strong> Fahrigkeit,<br />
Konzentration <strong>und</strong> Abschweifen - die Arbeitsschwierigkeiten sind da.<br />
Dagegen hat sich bei mir mit der Zeit das Konzept herausgebildet, daß ich meine Arbeit mit<br />
anderen Maßstäben messen muß, als sich das normalerweise aus der geistigen Arbeit ergibt.
ich sage mir dabei: wissenschaftliche Arbeit ist zu einem großen Teil wie Detektivarbeit. Du hast<br />
einen »Fall«, sammelst Material, entwickelst daraus eine Theorie zur Lösung des »Falles« <strong>und</strong><br />
suchst nun Aussagen <strong>und</strong> Indizien, die deine Theorie stützen oder widerlegen oder ihm ein »ganz<br />
neues Gesicht« geben. Und wie es in englischen Krimis heißt, ist die Hauptsache bei der<br />
Detektivarbeit »legwork« - Fußarbeit -, das Suchen nach den Zeugen, das Abklappern von<br />
Adressen etc., oder wie es dann in deutschen Krimis bezeichnet wird »Routine«... - das<br />
systematisch gegliederte Nacheinander der einzelnen Untersuchungsschritte ohne geniale<br />
Sprünge. Dieselbe Art Routine versuche ich auch für die geistige Arbeit zu entwickeln-. Literatur<br />
suchen, beschaffen, auswerten, Material ordnen <strong>und</strong> schließlich schreiben. Das Prinzip liegt aber<br />
nicht so sehr in der Reihenfolge, entscheidend ist vielmehr das handwerkliche Herangehen: in<br />
der Lesephase, also beim Auswerten der Literatur gehe ich z. B. nicht nach der vermutlichen<br />
Wichtigkeit der Titel vor, sondern nach ihrer alphabetischen Reihenfolge oder nach ihrer<br />
Erreichbarkeit <strong>und</strong> lege zu jedem Titel in derselben handwerklichen Manier Karteikarten an, für<br />
jeden irgendwie für das Thema möglicherweise interessanten Gedanken bzw. jede Information<br />
jeweils eine eigene Karteikarte. Wenn ich mit dem Artikel oder dem Buch fertig bin, habe ich dann<br />
einen - je nachdem, wie gut es war - dünneren oder dickeren Stapel Karteikarten vor mir. Die<br />
kann ich zusammen mit der Titelkarte wegpacken: der Titel ist »untergepflügt«, ich kann ihn<br />
abhaken <strong>und</strong> beruhigt bis später vergessen. Das schlechte Gewissen, das ich früher beim<br />
wissenschaftlichen Arbeiten ständig hatte, egal wieviel ich tatsächlich an einem Tag gearbeitet<br />
hatte, hängt eng damit zusammen, daß ich die geistige Arbeit nicht wie eine »normale« Arbeit<br />
behandelte. Ich richtete mir damals daheim in meinem Zimmer einen Arbeitsplatz zwischen<br />
Büchern, Bett <strong>und</strong> Küche ein mit dem Ergebnis, daß ich<br />
87<br />
auch dann an meinem Arbeitsplatz war, wenn ich im Bett lag - die unerledigte Arbeit schaute mich<br />
an. Und umgekehrt lockte mich das Bett (<strong>und</strong> meist auch der Kühlschrank in der Küche), wenn die<br />
Arbeit nicht so richtig lief <strong>und</strong> ich deshalb müde wurde. Ich legte mich hin <strong>und</strong> wachte nach zwei<br />
St<strong>und</strong>en mit entsprechend schlechtem Gewissen auf. Weiter wurde mein schlechtes Gewissen<br />
dadurch angestachelt, daß ich mir immer zum Ausgleich des schlechten Gewissens viel zuviel<br />
vorgenommen hatte <strong>und</strong> dazu noch in der Form: heute werde ich so <strong>und</strong> so viele Seiten oder das<br />
Buch vollends fertig lesen. Wenn es dann schwierig wurde <strong>und</strong> es ganz offensichtlich war, daß<br />
ich auch nicht einmal in die Nähe meiner guten Vorsätze kommen würde, wurde ich fahrig <strong>und</strong><br />
nervös, verlor immer mehr die Lust, wurde müd <strong>und</strong> müder <strong>und</strong> verfiel wieder in das<br />
Verdrängungsverhalten, das wiederum mein schlechtes Gewissen anstachelte. So saß ich<br />
eigentlich mit dem Kopf immer bei der Arbeit, Tag <strong>und</strong> Nacht, wochentags <strong>und</strong> am Wochenende,<br />
selbst wenn ich nicht am Schreibtisch saß. Ich konnte weder arbeiten noch faulenzen. Daraus<br />
habe ich gelernt: Ich muß die geistige Arbeit nicht nur in konkrete, machbare Arbeitsschritte<br />
aufgliedern, sondern muß darüber hinaus zu ihr ein Verhältnis wie zu einer bezahlten Büroarbeit<br />
herstellen. Ich muß sie nicht nur zu Handarbeit, sondern auch zu einer richtigen, »normalen«<br />
Arbeit machen: ich habe aufgehört, bei längeren Arbeiten zu Hause zu arbeiten. Ich suchte mir<br />
von den vielen <strong>Uni</strong>-Bibliotheken diejenige heraus, in der es mir am besten gefiel, mit der besten<br />
Arbeitsatmosphäre, mit Mensa- <strong>und</strong> KaffeeStube in der Nähe.<br />
Ich orientiere mich also seither an den Bürozeiten, mache meine Mittagspause <strong>und</strong> höre pünktlich<br />
mit der Arbeit auf. Dazwischen mache ich auch immer wieder meine Pausen, schaue zum Fenster<br />
hinaus <strong>und</strong>, weil ich beim Lesen sehr leicht ermüde, schlafe immer wieder den berühmten<br />
Büroschlaf: vor dem Buch sitzend nicke ich ein <strong>und</strong> werde nach wenigen Minuten durch irgendein<br />
Geräusch aufgeschreckt. Ohne schlechtes Gewissen <strong>und</strong> durchaus wieder hellwach arbeite ich<br />
dann weiter bis zu meinem »Feierabend«. Den halte ich sehr strikt ein: die Bücher <strong>und</strong><br />
Karteikarten bleiben in der Bibliothek. Dasselbegilt fürdasWochenende: Samstag<strong>und</strong>Sonntag
mache ich wie alle anderen, die »normal« arbeiten, nichts was mit meiner wissenschaftlichen<br />
Arbeit zusammenhängt. Das habe ich auch bei Prüfungsarbeiten durchgehalten - bis auf die<br />
hektische Schlußphase.<br />
88<br />
Drei Gr<strong>und</strong>prinzipien:<br />
Drittens - sich Erfolgserlebnisse verschaffen<br />
Für mich ist das größte Problem beim wissenschaftlichen Arbeiten, daß es so schwer<br />
abzuschätzen ist, was ich gemacht habe <strong>und</strong> was noch vor mir liegt. Beim Arbeiten im Garten z.<br />
B. ist das ganz anders: wenn man ein Stück Land umzugraben hatte, da sah man jeden<br />
Spatenstich, wie es voranging, <strong>und</strong> konnte in den Pausen stolz auf das bereits Geleistete<br />
zurückblicken <strong>und</strong> etwa abschätzen, wie lange man noch für den Rest brauchen würde. Bei<br />
wissenschaftlicher Arbeit ist das alles anders: was zurückliegt, erscheint ungewiß <strong>und</strong> kaum<br />
bemerkenswert, was vor einem liegt, scheint unendlich <strong>und</strong> kaum zu übersehen. Dagegen hat<br />
sich bei mir die Strategie herausgebildet, nicht immer an die insgesamt zu leistende Arbeit zu<br />
denken, sondern nur an das, was ich an dem jeweiligen Tag machen will. Wichtiger aber noch:<br />
ich nehme mir ganz bewußt für den Tag deutlich weniger vor als dasjenige Arbeitsquantum, von<br />
dem ich ganz sicher bin, daß ich es ohne große Anstrengung schaffe. Dadurch schaffe ich immer<br />
das, was ich mir vorgenommen habe <strong>und</strong> oft sogar noch mehr. Dafür belohne ich mich dann: ich<br />
gehe in der Mittagspause in einen Buchladen <strong>und</strong> schau mir Kunstbände an oder lese Comics.<br />
Nachmittags belohne ich mich mit einem ausführlichen Kaffee <strong>und</strong> abends schwelge ich in den<br />
Belohnungsmöglichkeiten. Die Leistungsmaßstäbe, in denen ich meine Vorsätze <strong>und</strong> Erfolge<br />
ausdrücke, sind immer solche, die aus der Verwandlung geistiger Arbeit in Hand-Arbeit<br />
entstanden sind, also nicht »ein wichtiges Problem lösen«, sondern »20 Karteikarten<br />
produzieren« oder »3 Titel unterpflügen« oder »5 St<strong>und</strong>en an der Arbeit bleiben« oder »3 Seiten<br />
des ersten Textentwurfes schreiben«. Das sind alles Arbeitskriterien, die ein wenig so sind wie<br />
die beim Umgraben im Garten: ich sehe, was ich geleistet habe <strong>und</strong> weiß genau, was ich noch<br />
vor mir habe.<br />
Vieles von diesen drei Gr<strong>und</strong>prinzipien ist vielleicht wirklich meine besondere Marotte. Probier sie<br />
jedenfalls mal aus, wenn du kannst. Wer weiß, vielleicht klappen sie bei dir auch <strong>und</strong> helfen dir<br />
tatsächlich, Spaß am wissenschaftlichen Arbeiten zu haben.<br />
Jetzt will ich auf einige unterschiedliche Techniken wissenschaftlichen Arbeitens eingehen <strong>und</strong><br />
fange mit der Haupttätigkeit von Intellektuellen an:<br />
<strong>Wie</strong> lesen?<br />
Wenn du mit einem ganz neuen Gebiet anfängst, von dem du noch überhaupt keine Ahnung hast,<br />
dann mußt du zuerst einmal einige Bücher ganz gründlich dazu durcharbeiten. Am besten nimmst<br />
du<br />
89<br />
dafür etwas Einführendes. Erk<strong>und</strong>ige dich aber bei unterschiedlichen Leuten, ob es wirklich auch<br />
etwas taugt, ob es einigermaßen leicht lesbar ist.<br />
Für diese Art lesen, also das Durcharbeiten von Lehrbüchern, hat sich eine Lesemethode<br />
bewährt, die von einem amerikanischen Pädagogen entwickelt worden ist (Robinson, 1961). Ich
finde sie ganz toll, weil sie einem dazu verhilft, sehr schnell zu arbeiten, <strong>und</strong> das Gelesene doch<br />
im Gedächtnis bleibt.<br />
Im Englischen heißt sie SQ3R-Methode nach den Anfangsbuchstaben ihrer fünf Arbeitsschritte.<br />
Ich habe sie übersetzt <strong>und</strong> um des Gags willen in die »Fünf-S-Methode« verwandelt, was sich<br />
sowohl auf die Anfangsbuchstaben wie auf die fünf Schritte beziehen kann. Die Schritte sind:<br />
sichten, sich fragen, suchen, schreiben, sichern. Ich werde sie jetzt nacheinander einzeln<br />
beschreiben:<br />
- Bevor du ein Buch, einen Aufsatz oder auch nur ein Kapitel anfängst zu lesen, solltest du es<br />
sichten, d. h. du solltest es durchblättern, das Inhaltsverzeichnis <strong>und</strong> die Überschriften, den<br />
Klappentext angucken, <strong>und</strong> wenn es Zusammenfassungen oder Schlußbemerkungen gibt, die<br />
zuerst lesen. Dadurch kannst du dir einen Überblick verschaffen, worüber das Buch geht, was die<br />
zentralen Thesen sind <strong>und</strong> auf was der Autor oder die Autorin letztlich hinauswill.<br />
- Aber auch danach sollte noch nicht gleich mit dem Lesen angefangen werden. Vielmehr sollte<br />
man sich fragen: worauf will der Abschnitt, den ich jetzt lesen will, eine Antwort geben? Mit Hilfe<br />
der vorher gesichteten Elemente (also Kapitalüberschriften oder Zwischentitel,<br />
Zusammenfassungen, Einleitungen) läßt sich so die Fragestellung des betreffenden Abschnitts<br />
oder Kapitels formulieren.<br />
- Den nächsten Schritt könnte man nun einfach »lesen« nennen. Zusammen mit den beiden<br />
vorangegangenen Schritten ist es aber mehr, es ist ein Suchen nach der Antwort auf die<br />
Fragestellung des Abschnitts, ist also aufmerksames, aktives <strong>und</strong> kritisches Lesen <strong>und</strong> nicht bloß<br />
passives Aufnehmen.<br />
- Mit schreiben ist gemeint, daß du dir diese Antwort dann in eigenen Worten aufschreibst. Dabei<br />
ist dieses »in eigenen Worten« zentral wichtig, denn erst wenn du sie selbst formulieren kannst,<br />
also nicht einfach Kernsätze des Titels abschreibst, zeigt sich, ob du den Text verstanden hast.<br />
Schon oft habe ich beim Lesen eines Textes im Bauch so ein warmes Gefühl des Verstehens<br />
entwickelt, war mir sicher, daß alles klar ist <strong>und</strong> daß der Text <strong>und</strong> ich in vollem Einverständnis<br />
sind. Als ich dann aber gezwungen war, anderen zu erzählen, was ich gelesen hatte, stellte sich<br />
heraus, daß es nur ein warmes Gefühl war, ich in Wirklichkeit aber nichts verstanden hatte, denn<br />
ich mußte immer wieder zum Text greifen <strong>und</strong> noch ein<br />
90<br />
mal nachlesen mit den Worten: »Hier steht es doch, ich lese mal vor!« Daran zeigt sich: kapieren<br />
heißt nachkonstruieren! Dieses Nachkonstruieren soll im Aufschreiben der Antwort auf die<br />
Fragestellung geschehen. Wichtig ist dabei nicht die Ausführlichkeit (im Gegenteil, sie sollte so<br />
knapp wie möglich sein), sondern daß du selbst den Eindruck hast, es ist die vom Text gegebene<br />
Antwort. Um das zu überprüfen, ist es sinnvoll, die Antwort an einem Beispiel durchzuspielen.<br />
Wenn sich dabei Schwierigkeiten ergeben, ist es notwendig, noch einmal nachzuprüfen, ob du<br />
den Text richtig verstanden hast <strong>und</strong> wie der Autor oder die Autorin zu der Antwort kommt, die dir<br />
so problematisch geworden ist. Damit hast du dann bereits ein wichtiges Stück Kritik an dem Text<br />
geleistet.<br />
- Der letzte Schritt ist das Sichern des Textes: Dazu liest du dir die gesammelten Antworten durch<br />
<strong>und</strong> versuchst, mit ihnen den Gang der Gesamtargumentation zu rekonstruieren <strong>und</strong> die zentrale<br />
These in ihrer Entwicklung <strong>und</strong> Begründung herauszuarbeiten. Das Ganze kommt dann in einen<br />
Aktenordner oder in den Karteikasten unter dem entsprechenden Stichwort. So kannst du dir den
Inhalt des Buches, seine Argumentation <strong>und</strong> seine kritischen Punkte selbst dann sehr schnell für<br />
andere Referate oder Prüfungen wieder vergegenwärtigen, falls du es im Laufe der Zeit<br />
vergessen solltest. Ein Text, der nach der »Fünf-S-Methode« (oder »Fünf-SchritteMethode
Oft genug passiert es mir beim Lesen eines solchen Titels, daß mir selbst Gedanken zum Thema<br />
kommen, die ich für die Arbeit festhalten will. Ich lege dazu dann einfach auch eine Karteikarte an<br />
<strong>und</strong> packe sie zu den anderen.<br />
In jedem Fach gibt es einige wenige gr<strong>und</strong>sätzliche Werke, um die sich die meisten theoretischen<br />
Kontroversen, methodischen Überlegungen <strong>und</strong> Publikationen herumstreiten. Sie kommen in<br />
nahezu allen Titeln vor, <strong>und</strong> zwar immer so in einem Nebensatz, als ob es selbstverständlich<br />
wäre, sie zu kennen.<br />
Wenn du nicht dauerhaft gezwungen sein willst, in theoretischen <strong>und</strong> methodischen Fragen<br />
deines Faches voller Unsicherheit zu<br />
92<br />
bluffen, dann mußt du dich dran machen <strong>und</strong> diese gr<strong>und</strong>sätzlichen Werke deines Faches<br />
durcharbeiten.. Oft sind diese Bücher aber so schwierig, daß du sie alleine gar nicht schafftst,<br />
sondern nur zusammen mit anderen in einer Diskussionsgruppe.<br />
Diese Bücher mußt du dir auf jeden Fall anschaffen, denn mit denen wirst du immer arbeiten<br />
müssen, wenn du mit deinem Fach zu tun hast. Sie müssen auch anders bearbeitet werden als<br />
alle anderen Bücher: nach der Lektüre sehen sie bei mir im Unterschied zu den anderen Büchern<br />
durch <strong>und</strong> durch bunt aus. Ich streiche die zentralen Passagen nämlich je nach ihrer Wichtigkeit<br />
in unterschiedlichen Farben an. Das hilft mir, mich beim Lesen zu konzentrieren, <strong>und</strong> später finde<br />
ich bestimmte Stellen leicht wieder, weil jede Seite anders aussieht. Wichtiger aber: das, was in<br />
der Fünf-S-Methode für ganze Abschnitte oder Kapitel gemacht wird, wende ich hier auf jeden<br />
Absatz an <strong>und</strong> schreibe die zentralen Argumentationspunkte in eigenen Worten auf den Rand<br />
des Buches neben den entsprechenden Absatz. Wenn sich beim »sichern« der Absätze neue<br />
Gesichtspunkte ergeben, schreibe ich diese unten an den Rand der Seite oder an das Ende des<br />
Kapitels. Auch das hat einen Vorteil für sofort <strong>und</strong> einen für später: beim Lesen selbst zwingt es<br />
mich zu überprüfen, ob ich wirklich verstanden habe, worum es geht; später brauche ich, wenn<br />
ich eine Argumentation aus einem solchen Buch verwenden will, nur die entsprechenden<br />
Passagen aufzuschlagen <strong>und</strong> meine Randbemerkungen zu lesen <strong>und</strong> habe dann schon wieder<br />
den Zusammenhang im Kopf.<br />
Die Arbeit an einem größeren Thema<br />
Auf den folgenden Seiten will ich meine Arbeitstechnik beim Arbeiten an einem größeren Thema<br />
darstellen. Ich habe sie zum Beispiel auch für dieses Buch angewandt. Das Allerwichtigste an der<br />
ganzen Technik ist aber, daß du nicht nur einfach einen Themenbereich hast, sondern eine<br />
Fragestellung. <strong>Wie</strong> die für Arbeiten gef<strong>und</strong>en wird, die mit dir selbst etwas zu tun haben, die also<br />
direkt einen Gebrauchswert darstellen <strong>und</strong> nicht vor allem für die Prüfung geschrieben sind, das<br />
habe ich im vierten Kapitel versucht klar zu machen. Aber auch bei Arbeiten für Prüfungen ist<br />
eine Fragestellung entscheidend wichtig, weil du sonst nur zu leicht in eine unkontrollierbare<br />
Breite gerätst.<br />
Eine Möglichkeit dazu habe ich bei der Fünf-S-Methode schon genannt: das Thema in eine Frage<br />
umformulieren. Eine andere Möglichkeit ist es, wenn du aus der einführenden Literatur eine<br />
Hypothese bildest. Daraus kannst du dann die Frage bilden: stimmt das so?<br />
93
Die Fragestellung muß jedenfalls zum gliedernden Prinzip deiner Arbeit werden: Alle Literatur, die<br />
du heraussuchst <strong>und</strong> durcharbeitest, <strong>und</strong> jeden Satz, den du schreibst, mußt du dann einzig <strong>und</strong><br />
allein darauf prüfen, ob die Fragestellung dadurch beantwortet wird. Meiner Meinung nach ist das<br />
das Allerwichtigste beim Arbeiten an einem wissenschaftlichen Thema! Aus dieser Frage <strong>und</strong><br />
ihrer Beantwortung ergibt sich auch nachher meist ganz logisch <strong>und</strong> einfach die Gliederung beim<br />
Schreiben. Ohne eine solche Frage wird jedes Fitzelchen <strong>und</strong> jeder Nebenweg des<br />
Themenbereiches irgendwie <strong>und</strong> möglicherweise wichtig <strong>und</strong> du hängst unweigerlich völlig<br />
kriterienlos durch.<br />
Die Literatursuche<br />
Es ist klar: für eine Examensarbeit brauche ich eine ganz andere Literatur<strong>und</strong> Materialbasis als<br />
für eine Erstsemesterarbeit. Während der ersten Semester genügt es immer, die von den<br />
Lehrenden angegebene <strong>und</strong> empfohlene Literatur durchzuschauen - <strong>und</strong> die ist oft zu viel <strong>und</strong> zu<br />
schwierig, so daß man sich von höheren Seinestern beraten lassen muß.<br />
Sobald du aber an eine Fragestellung herangehst, die dich wirklich interessiert <strong>und</strong> aus der du<br />
etwas für dich herausholen willst, dann ist es wichtig, möglichst viel von der Literatur<br />
durchzugucken. (<strong>Wie</strong> das ohne viel Aufwand gemacht werden kann, dazu komme ich gleich.)<br />
Denn wenn du das befriedigende Gefühl haben willst, die Sache wirklich im Griff zu haben, dann<br />
mußt du sozusagen mit einem Schleppnetz durch den Teil des Literaturmeeres durchgehen, der<br />
zu deinem Thema gehört, <strong>und</strong> die wenigen wertvollen Informationen, die darin verborgen sind,<br />
herausfischen <strong>und</strong> anlanden.<br />
Das klingt zuerst wieder einmal wie eine Selbstüberforderung. Da gibt es aber einige ganz<br />
einfache Tricks, wie diese unüberschaubar klingende Aufgabe leicht handhabbar gemacht<br />
werden kann. Der erste ist: du nimmst nur die Titel der letzten Zeit auf. Wenn es sehr viel<br />
Literatur zu deiner Fragestellung gibt, dann vielleicht nur die aus dem letzten bereits in den<br />
Bibliographien <strong>und</strong> Katalogen erfaßten Jahr. Gibt es wenig dazu, ist es sinnvoll, ein wenig weiter<br />
zurückzugreifen. Dabei gehe ich davon aus, daß es immer wenigstens einen oder zwei Titel gibt,<br />
deren Autor oder Autorin sich ebenfalls ernsthaft mit dem Thema beschäftigt hat, also auch die<br />
vorher erschienene Literatur gesichtet hat. Aus diesem Titel erfährst du dann zum einen die<br />
wichtigsten Informationen aus der davor erschienenen Literatur <strong>und</strong> zum anderen merkst du an<br />
der Häufigkeit der Zitate, welche Titel so gr<strong>und</strong>legend <strong>und</strong> umfassend sind, daß du sie dir doch<br />
selbst vornehmen mußt. Der zweite Trick ist: sammle vor allem Zeitschriftenaufsätze. Der<br />
Wissenschaftsbetrieb<br />
94<br />
zwingt nämlich die Leute dazu, aus einer Sache, die sie sich einmal mühsam erarbeitet haben,<br />
möglichst viele Titel für ihre Liste der Veröffentlichungen herauszuschlagen, denn damit<br />
bewerben sie sich um Stellen, <strong>und</strong> oft wird die Länge der Literaturliste mit dem Grad der<br />
Qualifikation gleichgesetzt. Also müssen sie das, was sie in ihrer Doktorarbeit oder in einem Buch<br />
gesagt haben, mindestens noch einmal in einem Artikel verbraten. Und das ist deine Chance,<br />
zuerst die Zeitschriftenaufsätze anzugucken <strong>und</strong> aus diesen Kurzfassungen dann darauf zu<br />
schließen, ob es sich lohnt, auch das Buch durchzuschauen.<br />
Welches ist der beste Weg, die Literatur zu finden? Ich meine, es ist am sinnvollsten, mit den<br />
Schlagwortkatalogen anzufangen. Die haben nämlich den Vorteil, daß auf den Katalogkarten oft<br />
die Signaturen draufstehen, unter denen die Titel in der betreffenden Bibliothek ausgeliehen oder<br />
(bei Präsenzbibliotheken) gef<strong>und</strong>en werden können, du mußt also nicht erst mühsam alle
alphabetischen Kataloge durchsuchen oder die Fernleihe beanspruchen. Dabei ist der einzige<br />
Nachteil der Fernleihe, daß sie so lange dauert. Sie hat allerdings den großen Vorteil, daß du<br />
Zeitschriftenaufsätze oft gegen eine kleine Schutzgebühr als Fotokopien erhältst.<br />
Schlagwortkataloge mußt du übrigens benützen wie ein Lexikon: wenn du unter dem<br />
naheliegendsten Schlagwort nichts findest, dann mußt du unter verwandten suchen (gute<br />
Kataloge haben übrigens ein Verzeichnis der Schlagworte <strong>und</strong> verweisen auf der ersten oder<br />
letzten Karte auf andere Schlagworte, wo zum selben Thema etwas gef<strong>und</strong>en werden kann).<br />
Nun gibt es aber die Schwierigkeit, daß die meisten Schlagwortkataloge nur Monographien<br />
erfassen, das sind selbständige Bücher, also keine Zeitschriften oder Reihen. Mein Rat, zuerst<br />
mit den Zeitschriftenaufsätzen anzufangen, stößt also auf Hindernisse. Es gibt zwei Wege, dieses<br />
Hindernis zu überwinden. Der erste heißt »Dokumentation«: in den meisten Fächern gibt es<br />
Stellen, die alle wichtigen Zeitschriften des Faches auswerten <strong>und</strong> nach Themengebieten<br />
aufschlüsseln, die aber leider meist sehr viel gröber eingeteilt sind als die der<br />
Schlagwortkataloge. Dafür haben sie einen großen Vorteil: sie enthalten kurze<br />
Zusammenfassungen der Hauptaussagen des erwähnten Aufsatzes, mindestens aber<br />
Präzisierungen des behandelten Gebietes. Auf diese Weise kann schon von vornherein eine<br />
große Zahl vielversprechend klingender Titel ausgeschieden werden. Der andere Weg heißt<br />
»Dietrich«, so wie das bekannte Einbrecherwerkzeug: es ist ein vielbändiges Werk, das in den<br />
Bibliographieräumen aller Bibliotheken steht <strong>und</strong> einstmals von einem Menschen namens Dietrich<br />
angefangen worden ist. (Inzwischen heißt es offiziell »BIZ« - Bibliographie der Internationalen<br />
Zeitschriftenliteratur - die meisten Leute sagen aber immer noch »Dietrich« dazu.) Heute werden<br />
über 60000 Zeitschriften, Zeitun<br />
95<br />
gen <strong>und</strong> Schriftenreihen aus aller Welt <strong>und</strong> aus allen Fachgebieten unter einer Unzahl von<br />
detailliert aufgeschlüsselten Schlagwörtern ausgewertet <strong>und</strong> in mehreren Jahresbänden<br />
gesammelt hera usgegeben. Unter jedem Schlagwort sind die Autoren mit dem Titel des<br />
Aufsatzes alphabetisch aufgeführt <strong>und</strong> den Angaben über Jahrgang, Erscheinungsjahr, Heft <strong>und</strong><br />
Seitenzahlen. Nur der Titel der Zeitschrift fehlt. Der ist in einer Nummer, einer Sigel verschlüsselt,<br />
unter der du im jeweils ersten Band die ausführlichen Titelangaben finden kannst.<br />
Da es für ganz viele Gebiete auch noch Spezialbibliographien gibt, die auch die<br />
Zeitschriftenliteratur auswerten, empfiehlt es sich in allen Fällen, die Fachkräfte in den<br />
Bibliotheken um Rat zu fragen. Meist macht es denen sogar Spaß, dich in die Geheimnisse der<br />
Bibliothekskunst einzuweihen.<br />
Schreib die Titel aber um Himmels willen nicht in irgendein Heft oder auf Blätter. Da gerätst du<br />
völlig durcheinander <strong>und</strong> notierst dir denselben Titel immer wieder. Statt dessen kauf dir oder<br />
mach dir kleine Karteikarten, die du alphabetisch nach den Autoren ordnest <strong>und</strong> mit allen<br />
Angaben versiehst, die f ür das spätere Literaturverzeichnis notwendig sind. Auf dieselbe Karte<br />
schreibe ich mir soweit möglich - auch noch den Verlag, falls ich das Buch vielleicht doch einmal<br />
kaufen will. Da braucht man das nämlich! Auch sagt der Verlag oft schon einiges über das Buch<br />
aus.<br />
Alle weiteren Arbeitsschritte, die ich danach mit dem Titel mache, werden ebenfalls auf der<br />
Karteikarte vermerkt: die Signatur <strong>und</strong> Bibliothek, die Anzahl Karteikarten <strong>und</strong> Photokopien, die<br />
ich über den Titel angefertigt habe, <strong>und</strong> eine kurze, deftig subjektive Charakterisierung des<br />
Inhaltes.
<strong>Wie</strong> lesen, ohne zu lesen<br />
Vielleicht ist aufgefallen, daß ich nie davon gesprochen habe, daß die Literatur zu lesen sei,<br />
sondern daß ich sie »angucke«, »durchgehe« oder »sichte«. Sobald du anfängst die ganzen Titel<br />
lesen zu wollen, in dem Sinne, daß du mit der ersten Seite anfängst <strong>und</strong> mit der letzten Seite<br />
aufhörst, bist du verloren. Du mußt statt dessen lernen, mit wissenschaftlicher Literatur<br />
umzugehen wie mit einer Illustrierten. Die blätterst du auch durch <strong>und</strong> holst dir nur das heraus<br />
zum Lesen, was dich interessiert.<br />
Ich lese wissenschaftliche Literatur immer von hinten nach vorn. Am Schluß wird immer gesagt,<br />
was herausgekommen ist <strong>und</strong> worum es eigentlich ging. Daraus kann ich dann ersehen, ob mich<br />
das überhaupt interessiert, ob es mit meiner Fragestellung etwas zu tun hat. Wenn ja, kann ich<br />
mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses gezielt die Kapitel heraussuchen, die für mich besonders<br />
relevant sein<br />
96<br />
könnten. Auch die lese ich wieder von hinten nach vorn, <strong>und</strong> zwar so, daß ich jeweils den Anfang<br />
<strong>und</strong> Schluß der Absätze überfliege. Dabei gehe ich von der Annahme aus, daß am Anfang eines<br />
Absatzes der Gedanke benannt wird, um den es dabei geht <strong>und</strong> am Schluß das zugespitzte<br />
Ergebnis der Überlegungen steht. Nahezu alle wissenschaftliche Literatur ist tatsächlich so<br />
aufgebaut, daß es ohne weiteres möglich ist, jedes einzelne Kapitel wie das ganze Buch von<br />
hinten nach vorn zu lesen: man kann vom Ergebnis her durch Überfliegen den Gang der<br />
Argumentation sehr schnell herausfinden <strong>und</strong> die zentralen Passagen lokalisieren, in denen. der<br />
Kern der Überlegungen steckt. Die muß man dann sehr sorgfältig lesen. Das sind dann auch die<br />
zitierfähigen Stellen, die fotokopiert werden müssen <strong>und</strong> über die ich Karteikarten anlege.<br />
Auf diese Weise ist es mit einiger Übung möglich, jedes durchschnittliche Buch in wenigen<br />
St<strong>und</strong>en »unterzupflügen«. Bei Aufsätzen geht das sogar noch viel schneller. Da genügt es meist,<br />
den Schluß <strong>und</strong> den Anfang zu lesen, denn meist stecken da alle Informationen drin. Nur bei<br />
ganz wenigen lohnt es sich auch, die Mitte in derselben Weise durchzugehen, wie ich das eben<br />
für Bücher beschrieben habe. So ist es möglich, in relativ kurzer Zeit große Mengen von Literatur<br />
zu sichten, mit dem Schleppnetz die für die eigene Fragestellung wichtigen Informationen aus<br />
dem Literaturmeer anzulanden.<br />
All das bringt aber überhaupt nur dann etwas, wenn du dabei mit Karteikarten arbeitest. Mit ihnen<br />
müssen nämlich die Gedanken <strong>und</strong> Informationen festgehalten werden, die du aus dem ganzen<br />
Wust von Literatur herausgef<strong>und</strong>en hast.<br />
Ich mache das so: wenn ich ein Buch durcharbeite, habe ich vor mir außer der kleinen Titelkarte<br />
zum Buch immer auch einen Stapel Karteikarten in Postkartengröße vor mir liegen (in einer<br />
Buchbinderei kann man die sich aus normalem Papier zurechtschneiden lassen). Wenn ich<br />
beispielsweise über Arbeitsbelastung arbeite, finde ich auf Seite 68 einige Zahlen über die<br />
Zunahme von Schichtarbeit in der B<strong>und</strong>esrepublik. Ich nehme eine Karteikarte <strong>und</strong> schreibe<br />
zuerst eine Kurzfassung des Titels oben links in derselben Weise wie hier die Titel kurz zitiert<br />
werden (also: Schmiede, Schudlich, 1976). Darunter schreibe ich noch ein Stichwort, damit ich<br />
die Karteikarte <strong>und</strong> die kleine Titelkarte immer als zusammengehörig wiedererkenne (z. B. aus<br />
dem Titel: »Die Entwicklung der Leistungsentlohnung in Deutschland« nur das Stichwort<br />
»Leistungsentlohnung«). Damit habe ich die Quelle identifiziert. Jetzt schreibe ich rechts oben<br />
das hin, über das der Gedanke oder die Information geht (hier: »Schichtarbeit«). Dabei mache ich
mir keine großen Überlegungen zu einer Systematik. Die verändert sich sowieso ständig. Ich<br />
versuche nur die Information auszudrücken, wie sie mir vorliegt. In die Mitte der Karte schreibe<br />
ich die Seitenzahl (also 68) <strong>und</strong> setze ein »K« dahinter,<br />
97<br />
wenn ich vorhabe, die Seite zu kopieren (nur wenn es zu lange dauern würde, den Text auf die<br />
Karte zu übertragen). Darunter schreibe ich dann so kurz wie möglich, was da steht: In diesem<br />
Fall nur: »Gute Zahlen zur neueren Entwicklung der Schichtarbeit.« Wenn auf derselben Seite<br />
ein neues Thema kommt, das für mich wichtig ist (z. B. Verbreitung von Akkordlöhnen), dann<br />
nehme ich eine neue Karteikarte, die ich nun unter dem Stichwort »Akkordlöhne« anlege.<br />
Beim weiteren Lesen des Buches nehme ich jedesmal, wenn eine interessante Stelle zu<br />
Schichtarbeit auftaucht, die Karte »Schichtarbeit« <strong>und</strong> trage dort unter der jeweiligen Seitenzahl<br />
den möglichst kurzgefaßten Inhalt dieser Stelle ein (genauso bei »Akkordarbeit«, »Akkordlohn«<br />
etc.). So habe ich dann am Schluß des Buches alle Informationen zur »Schichtarbeit«, die darin<br />
interessant waren, auf Karteikarten unter diesem Stichwort beieinander. (Für die anderen<br />
Informationen habe ich entsprechende Karten zu »Akkordlöhnen«, »Leistungslohn« etc.) Danach<br />
trage ich diese Stichworte auf der Rückseite der Titelkarte ein, damit ich weiß, welche<br />
StichwortKarten ich zu dem Buch angelegt habe. Wichtig: beim Fotokopieren nicht vergessen,<br />
den Titel gleich auf die Kopie zu schreiben, sonst ist die Information verloren. (Die Kopien hefte<br />
ich dann alphabetisch nach den Autorennamen ab.) Jetzt kann ich den Stapel Karteikarten<br />
wegpacken, an dessen Dicke ich sehe, wieviel mir das Buch gebracht hat, <strong>und</strong> mache auf der<br />
kleinen Titelkarte befriedigt das Kreuzchen, das mir zeigt: das Buch ist »untergepflügt«.<br />
Das Schreiben<br />
Wenn ich alle Bücher <strong>und</strong> Aufsätze zu meinem Thema so durchgearbeitet habe, dann ist das<br />
Schreiben kein großes Problem mehr. Alle Informationen <strong>und</strong> Gedanken etwa zur »Schichtarbeit«<br />
sind jetzt auf Karteikarten, die ich nur noch aus den zu den einzelnen Büchern gehörigen Stapeln<br />
heraussortieren muß. Ich brauche also nur eine erste grobe Gliederung schreiben, wie ich die<br />
Fragestellung meines Themas schrittweise beantworten will - sozusagen in Kapitelüberschriften,<br />
nach denen ich die Karten sortieren kann. Ich habe dann alle Karten zur Schichtarbeit beeinander<br />
<strong>und</strong> damit auch alle interessanten Informationen zu diesem Punkt aus der gesamten Literatur, die<br />
ich durchgearbeitet habe. Bei Karten, bei denen ich mich nicht mehr so richtig erinnern kann, was<br />
ich mir dabei gedacht habe, kann ich die entsprechenden Stellen in den Fotokopien nachlesen.<br />
Karten, die in mehreren Kapiteln Verwendung finden könnten, ordne ich in das frühste ein <strong>und</strong><br />
stecke sie dann um. Dieses erste Ordnen macht mir das ganze Material wieder gegenwärtig <strong>und</strong><br />
führt vielleicht schon zu Umstellungen in der Gliederung. Danach ordne ich die Karten innerhalb<br />
eines jeden einzelnen Kapitels solange, bis alle Karten<br />
98<br />
gleichen Gedanken beieinander sind <strong>und</strong> in einer sinnvollen Reihenfolge liegen. Für die<br />
Hauptpunkte der Gliederung <strong>und</strong> eigene Überlegungen lege ich extra Karteikarten dazwischen.<br />
Am Schluß habe ich die gesamte Arbeit in ihrer Feingliederung vor mir liegen als einen Stapel<br />
Karteikarten. Danach fange ich einfach mit der ersten Karteikarte an <strong>und</strong> schreibe den<br />
dazugehörigen Gedanken auf. In der Karteikarte habe ich den Beleg dazu, brauche also nicht<br />
lange herumzusuchen.
Wenn ich einmal ein Zitat bringen will, dann habe ich den Text auch gleich in der Fotokopie zur<br />
Hand. Ich schreibe also von einer Karteikarte zur nächsten, bis ich bei der letzten Karte<br />
angekommen bin. Dann ist die Arbeit fertig! Jetzt muß ich nur noch die kleinen Titelkarteikarten<br />
nehmen <strong>und</strong> sie abschreiben, dann ist auch das alphabetische Literaturverzeichnis fertig, das<br />
sonst so ungeheuer viel Mühe macht, gerade dann, wenn man am wenigsten Lust hat, noch groß<br />
herumzusuchen, weil man eigentlich das Gefühl hat, fertig zu sein.<br />
Bei dieser Arbeitsweise stecken die einzigen Schwierigkeiten, die beim Schreiben übrigbleiben, in<br />
den Ansprüchen an die eigenen Formulierungen, in der Anstrengung um einen verständlichen<br />
<strong>und</strong> zugleich präzisen Stil. Die lassen sich aber dadurch reduzieren, daß ich mir sage: ich<br />
schreibe jetzt einen ersten Entwurf, den ich hinterher noch mehrfach überarbeiten <strong>und</strong> vielleicht<br />
ganz umschreiben werde. Das reduziert die Anspannung <strong>und</strong> macht das Umarbeiten oft genug<br />
unnötig. (Ich habe mir übrigens angewöhnt, alles gleich mit Durchschlag in die Schreibmaschine<br />
zu schreiben.)<br />
Das ist anfangs schwierig, hat aber eine Menge Vorteile: 1. Lesbarkeit <strong>und</strong> Übersichtlichkeit des<br />
Manuskriptes, 2. der Durchschlag kann an einem sicheren Ort aufbewahrt werden <strong>und</strong> das<br />
Manuskript geht weniger leicht verloren - was ein übler Frust ist! 3. das Umarbeiten wird eine<br />
Arbeit mit Schere <strong>und</strong> Klebstoff, <strong>und</strong> man erspart sich, ganze Teile noch einmal abschreiben zu<br />
müssen.<br />
Nachdem ich diese Arbeitsweise entwickelt hatte, fing das wissenschaftliche Arbeiten an, mir<br />
Spaß zu machen. Ich empfand die Arbeit am Schreibtisch oder in der Bibliothek auch nicht mehr<br />
wie zuvor als isoliert <strong>und</strong> vereinsamend. Weil ich ja nur tagsüber <strong>und</strong> wochentags arbeite, kann<br />
ich die politischen <strong>und</strong> sonstigen Kontakte <strong>und</strong> Termine weiterhin wahrnehmen (früher hatte ich<br />
mich in solchen Arbeitsperioden von allem zurückgezogen). Darüber hinaus<br />
abe ich aber durch diese Arbeitsweise ein sehr entspanntes Verhältnis zur Literatur entwickelt<br />
<strong>und</strong> kommuniziere oft regelrecht beim Lesen mit den Büchern, stelle mir vor, wie die Autoren <strong>und</strong><br />
Autorinnen aussehen, was sie so in ihrer Freizeit machen etc.: wenn ich auf eine besonders<br />
aufschlußreiche Stelle stoße, juble ich, <strong>und</strong> wenn einer das Wissenschaftsritual <strong>und</strong> den <strong>Bluff</strong> so<br />
richtig durchzieht <strong>und</strong> dabei letztlich nichts sagt, dann stöhne <strong>und</strong> schimpfe ich<br />
99<br />
in mich rein, oder schreibe bissige Kommentare auf die Karteikarte. Und mit der fortschreitenden<br />
Durchdringung des Themas fühle ich mich immer mehr verb<strong>und</strong>en mit den wenigen Leuten, deren<br />
Schriften mich dabei weitergebracht haben.<br />
(Als weiterführende Literatur zur Arbeitsmethode empfehle ich Gerd Junne, Kritisches Studium<br />
der Sozialwissenschaften, UrbanTaschenbücher 244, Kohlhammer, 1976; es ist nicht nur für<br />
Sozialwissenschaftler, sondern bringt sehr gute Tips für alle Wissenschaftsbereiche.)<br />
<strong>Wie</strong> Prüfungen überstehen<br />
»Spaß an der wissenschaftlichen Arbeit haben«, das ist leicht gesagt <strong>und</strong> wäre vielleicht auch<br />
möglich, wenn man es nicht für Prüfungen machen müßte. Das ist ein naheliegender Einwand<br />
gegen all das, was ich hier geschrieben habe.<br />
Entscheidend bei der ganzen Prüfung ist es, sich klar zu machen, daß es sich dabei um eine<br />
irrationale <strong>und</strong> theaterhafte Situation handelt, die vorbereitet werden muß wie eine einmalige
Theateraufführung: die Rolle muß auswendig gelernt <strong>und</strong> eingeübt werden. Aber es ist eben nur<br />
eine Rolle, die du da zu spielen hast. In der Prüfung geht es nicht um deine Person oder dein<br />
wirkliches Denken, Handeln <strong>und</strong> Wissen, sondern um die Erfüllung einer durch <strong>und</strong> durch<br />
ritualisierten Rollenerwartung: du mußt die »gute Studentin« oder den »guten Studenten«<br />
spielen. Die <strong>Angst</strong> vor dieser Premiere ist verständlich - alle Theatermenschen haben sie. Aber<br />
danach kannst du wieder du selbst sein. Die <strong>Angst</strong> verliert jedoch jeglichen Zusammenhang zur<br />
Wirklichkeit <strong>und</strong> entwickelt sich zur blockierenden Panik, wenn du das vergißt, daß es hier um ein<br />
Theaterstück geht <strong>und</strong> du statt dessen das Gefühl entwickelst, du als Person würdest daraufhin<br />
geprüft, was du bisher geleistet hast. Dann kommen nämlich alle in dir verborgenen Ängste hoch,<br />
verbinden sich mit dem Prüfungsgeschehen <strong>und</strong> summieren sich zur neurotischen Prüfungsangst.<br />
In einer umfangreichen Untersuchung über, mündliche Prüfungen in einer Reihe von Fächern an<br />
der <strong>Uni</strong>versität zeigte sich, daß nicht so sehr das Wissen über Verlauf <strong>und</strong> Ergebnis der Prüfung<br />
entscheidet, sondern das Auftreten der geprüften Person, also wie sie ihre Rolle in der Premiere<br />
spielt. Aus dieser Erkenntnis entwickelten die Autoren der Untersuchung folgende<br />
Regieanweisungen: »Es ist ratsam, auch dann in der Prüfung die Rolle eines zukünftigen<br />
Angehörigen einer entscheidungsbefugten Gruppe einzunehmen, wenn man sich mit der Rolle<br />
eines Führungskaders nicht identifizieren kann oder will. Dazu gehört, daß man in mündlichen<br />
Prüfungen durchaus viel redet, zugleich aber vermeidet, ei<br />
100<br />
gene subjektive Aspekte ins Spiel zu bringen, zumal wenn sie unvorteilhaft erscheinen könnten.<br />
So sollte ein Prüfungskandidat an dem Zeitpunkt, zu dem die Prüfungen beginnen, ob zu Recht<br />
oder zu Unrecht, die Oberzeugung <strong>und</strong> Zuversicht in sich gefestigt haben, daß er vorbereitet ist,<br />
zufriedenstellende Arbeit geleistet <strong>und</strong> hinreichende Mühe aufgebracht hat. Eventuell<br />
aufkommende Unsicherheit während der Prüfung hinsichtlich dieses Komplexes sollte unterdrückt<br />
werden, erst recht, wenn es dem Prüfer seinerseits einfallen sollte, die vorausgegangenen<br />
Vorbereitungen als unzureichend in Zweifel zu ziehen. Jedes Eingeständnis dem Prüfer<br />
gegenüber, wenn dieser Komplex berührt wird, vergrößert die Wahrscheinlichkeit einer negativen<br />
Beurteilung. Falsch wäre es schließlich, davon auszugehen, daß normalerweise jeder Prüfer vom<br />
Prüfling die Aufgabe seines eigenen Willens erwartet. ( . ) Je deutlicher vielmehr der<br />
Prüfungskandidat seine Fähigkeit beweist, seine Interessen durchsetzen zu können, um so mehr<br />
wird dieses eben auch zur Prüfung anstehende Verhalten honoriert.« (Scheer, Zenz,1973, S. 79<br />
f.)<br />
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen also eines sehr deutlich: Die Rolle, die da gespielt<br />
werden soll, macht keine Unterwerfung oder politische Maskerade als Anpassung erforderlich. Es<br />
geht vielmehr darum, Selbstbewußtsein <strong>und</strong> Sicherheit züi demonstrieren - eben auch bei eigener<br />
Einschätzung eines Problembereichs. Dabei ist aber wichtig, daß du die Begriffe, die du<br />
verwendest, erklären <strong>und</strong> verteidigen kannst. Entscheidender aber ist: man muß unterscheiden<br />
zwischen dem schriftlichen <strong>und</strong> dem mündlichen Teil der Prüfung. Im schriftlichen Teil, vor allem<br />
aber in der Hausarbeit, ist es möglich, tatsächlich ein Problem so anzugehen, daß du selbst noch<br />
lange etwas davon hast. Insbesondere dann, wenn du in irgendeiner Form auf die<br />
Themenstellung Einfluß nehmen kannst <strong>und</strong> es so vielleicht schaffst, ein Thema zu bearbeiten,<br />
das mit dem etwas zu tun hat, was du als den Sinn deines Studiums bestimmt hast. Der<br />
mündliche Teil ist so sehr Schauspiel, daß es manchmal auc in ein sadistisches Tribunal gegen<br />
den Prüfling auszuarten droht, daß es tatsächlich nur noch zynisch behandelt werden kann.<br />
Viel wichtiger aber ist die Konsequenz dieser Prüfungskritik für die N twendigkeit kollektiver<br />
Absprachen: das Prüfungssystem hat keine absoluten Maßstäbe, sondern vergleicht nur
zwischen den auftretenden Prüflingen. Der Durchschnitt bekommt die Durchschnittsnote, egal, ob<br />
er in diesem Jahr objektiv gesehen den Einserleuten der vorangegangenen Prüfung entspricht.<br />
Deshalb ändert es an der Notenverteilung nicht das geringste, wenn sich alle in Konkurrenz<br />
zueinander ausstechen. Sie machen sich nur selbst kaputt. Folglich muß es der entscheidende<br />
Punkt der Gegenwehr gegen das Prüfungssystem sein, möglichst alle Prüfungskandidaten <strong>und</strong><br />
Kandidatinnen zu erfassen <strong>und</strong> gemeinsam auf Konkurrenzbe<br />
101<br />
schränkungen festzulegen: »Niemand schreibt mehr als 15 Seiten de nach Schrift) in den<br />
Klausuren <strong>und</strong> niemand mehr als 120 Seiten in der Diplomarbeit!« Ohne einen solchen<br />
Zusammenschluß gegen die Konkurrenz ist die Gefahr wirklich sehr groß, daß alle positiven<br />
Ansätze der Gegenwehr auf dem Umweg über die Prüfung wieder kaputt gemacht werden!<br />
102<br />
(Nachtrag zur 8. Auflage.,)<br />
Siebtes Kapitel<br />
Chaos als Prinzip<br />
In den vorangegangenen Kapiteln habe ich immer wieder gezeigt, daß <strong>Uni</strong>-<strong>Angst</strong> <strong>und</strong> <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong><br />
vor allem durch das Chaos an den Hochschulen produziert werden. Niemand weiß, was wirklich<br />
gewußt werden muß, um ein Fach zu beherrschen. So erscheinen die Anforderungen unendlich<br />
<strong>und</strong> können nur noch dem Schein nach durch das gravitätische Niveaugehabe des <strong>Bluff</strong>s erfüllt<br />
werden. Wenn es klar aufgebaute Studiengänge gäbe, in denen die Studierenden Schritt für<br />
Schritt in die Methoden <strong>und</strong> Gr<strong>und</strong>probleme ihres Faches eingeführt würden, <strong>und</strong> sie deutlich<br />
erkennen könnten, welche Bereiche unverzichtbar <strong>und</strong> welche eher exotisch sind, dann wäre<br />
vieles leichter,<br />
Es hat unzählige Versuche gegeben, solche Studiengänge einzurichten. Zuerst kämpften die<br />
hochschulpolitischen Gruppen der Studenten <strong>und</strong> Assistenten darum <strong>und</strong> scheiterten an der<br />
Professorenschaft. Mit ganz anderen Motiven setzte sich dann das Hochschulrahmengesetz das<br />
gleiche Ziel: Das chaotische Studium dauerte zu lange <strong>und</strong> bereitete die Abgänger nicht<br />
genügend auf die Berufsanforderungen vor. Deshalb sollten die <strong>Uni</strong>versitäten mit<br />
Regelstudienzeit <strong>und</strong> Zwangsexmatrikulation dazu gezwungen werden, das Studium zu<br />
»entrümpeln« <strong>und</strong> »auf das Wesentliche« zu beschränken.<br />
Außer an einigen neugegründeten Hochschulen, die samt Studiengängen auf dem Reißbrett<br />
geplant worden sind, bevor es die dazugehörigen Studierenden <strong>und</strong> Lehrenden gab, sind auch<br />
die technokratischen Reformversuche des Hochschulrahmengesetzes sämtlich gescheitert. Zwar<br />
gibt es allenthalben neue Studiengänge <strong>und</strong> große Reformen. Bei ihnen ist aber kaum etwas von<br />
Entrümpelung oder Beschränkung auf das Wesentliche zu merken. Statt dessen lief es überall<br />
dort, wo die bereits vorhandenen Professoren die Reform selbst durchführen <strong>und</strong> in den Gremien<br />
absegnen mußten, so: Jeder Vertreter eines Teilgebietes wehrte sich mit Händen <strong>und</strong> Füßen<br />
dagegen, daß sein Spezialgebiet als »unwesentlich« <strong>und</strong> »entrümpelungswürdig« aus dem<br />
neuen Studiengang herausgeworfen werden könnte, denn damit wären seine Anträge auf<br />
Hilfskräfte, Sekretärinnen <strong>und</strong> Sachmittel für alle Zukunft schwer bedroht. Deshalb sehen die<br />
»reformierten« Studiengänge nahezu überall gleich aus: Zu dem ganzen alten Stoff kamen neue<br />
Sachgebiete hinzu; das alles wurde mit mehr Leistungsdruck <strong>und</strong> schärferen Kontrollen in den<br />
neu vorgeschriebenen Zeitrahmen hineingestopft - wie in einen zu knappen Sack.
103<br />
Es kam, wie es kommen mußte: Der Sack platzte, kaum jemand konnte die Regelstudienzeit<br />
einhalten. Die Zwangsexmatrikulation, die als Schnur zum Zubinden des Sacks gedacht war,<br />
mußte deshalb schon 1980 wieder abgeschafft werden. Gleich einem zu vollen Sack, aus dem<br />
alles herausquillt, wenn man ihn nicht zubindet, so zerfloß auch das Studium wieder in seine alte<br />
chaotische Länge <strong>und</strong> Breite. Die »technokratische Hochschulreform« des<br />
Hochschulrahmengesetzes war an den Professoren gescheitert. Das Chaos herrscht weiter.<br />
Die Schuld daran hat das B<strong>und</strong>esverfassungsgericht. Es hat in seinem Urteil gegen das<br />
Niedersächsische Landeshochschulgesetz mit einer recht seltsamen Argumentation die<br />
Hochschulen, die rechtlich <strong>und</strong> haushaltstechnisch öffentliches Eigentum sind, der<br />
Professorenschaft zur privaten Nutzung übereignet. An den Hochschulen gehe es in der Lehre<br />
<strong>und</strong> Forschung um die Wahrheit, <strong>und</strong> die sei kein Gegenstand für Abstimmungen. So weit, so gut.<br />
Anstatt nun aber die Freiheit von Lehre <strong>und</strong> Forschung jedes einzelnen Hochschulmitglieds<br />
gegen Eingriffe der Verwaltung zu sichern, erklärte das Gericht die Professorenschaft insgesamt<br />
(sozusagen als Stand) zu Trägern der Wahrheit - <strong>und</strong> das nicht nur in fachlichen Fragen, sondern<br />
auch in allen Personal- <strong>und</strong> Verwaltungsfragen, die irgend etwas mit Forschung <strong>und</strong> Lehre zu tun<br />
haben. Bei der Studienreform, bei Berufungen <strong>und</strong> in Entscheidungen über Forschung läuft<br />
seither nichts mehr gegen die Prof essorenschaft.<br />
Da die Professoren als Stand solche allentscheidende Macht an den Hochschulen innehaben, ist<br />
es für das Verständnis dessen, was an den Hochschulen läuft, von möglicherweise zentraler<br />
Bedeutung, zu überlegen, wie eigentlich jemand Professor wird. Dabei geht es nicht so sehr um<br />
die ehrwürdigen Großen der Wissenschaft, die immer wieder Rufe erhalten <strong>und</strong> sie benützen<br />
können, um an ihrer Heimatuniversität zusätzliche Vergünstigungen auszuhandeln. Die Masse<br />
der Professorenschaft als Stand sind Männer <strong>und</strong> ganz wenige Frauen, die irgendwann einmal in<br />
eine Professorenstelle hineingekommen sind <strong>und</strong> dort auch sehr lange bleiben. Es sind also nicht<br />
die großen wissenschaftlichen Leuchten wie Max Weber, Einstein, Heisenberg, die diesen Stand<br />
kennzeichnen, sondern die Laufbahnbeamten wie in anderen Bereichen des öffentlichen<br />
Dienstes auch. Um die heutige Hochschule zu verstehen, ist es also wichtig, zu untersuchen, wie<br />
jemand in die professorale Beamtenlaufbahn eintreten kann, denn das »<strong>Wie</strong>« gibt auch Auskunft<br />
über das »Wer«.<br />
Die Aufnahmeprüfung der Professoren ist nicht etwa die Habilitation, die formale Prüfung der<br />
Befähigung zum Professorenstand, die inzwischen wieder zur unverzichtbaren Vorbedingung für<br />
einigermaßen erfolgversprechende Bewerbungen auf Professo<br />
104<br />
renstellen geworden ist. Sie ist wie die Promotion zur notwendigen, aber keinesfalls<br />
hinreichenden Bedingung geworden.<br />
Die eigentlichen Aufnahmebedingungen setzt die Berufungskommission für die erste<br />
Professorenstelle. In dieser Kommission spielen aber zwei recht seltsame Kriterien die<br />
entscheidende Rolle, die mit fachlicher Qualifikation recht wenig zu tun haben. Das erste<br />
Kriterium ist, daß man sich in seinem Fach einen »Namen« gemacht hat über die<br />
Habilitationsprüfung hinaus. In der Wissenschaft macht man sich solch einen »Namen«, indem<br />
man zu seinem normalen bürgerlichen Meier, Schulze oder Müller ein Fachwort des<br />
Wissenschaftszweiges hinzugewinnt, in dem man Karriere machen will. Man wird dann zum<br />
»Krisen-Meier«, »Sozialstaats-Schulze« oder »Dingsbumsda-Müller«. Dieses wissenschaftliche
Vorwort zum normalen Namen erwirbt man sich, indem man sich eine relativ unbearbeitete<br />
Nische in seinem Fachgebiet heraussucht <strong>und</strong> sie dann in einer möglichst langen Serie von<br />
Kongreßbeiträgen <strong>und</strong> Aufsätzen solange beackert, bis alle Kollegen den eigenen Namen mit<br />
dieser Nische verbinden. Hilfreich sind auch komplizierte Fragen auf Fachkongressen, mit denen<br />
man alle möglichen Referenten darauf stößt, daß sie den Aspekt dieser Nische bisher<br />
unverantwortlicherweise vernachlässigt haben. Hilfreicher noch ist eine griffige These, die<br />
unermüdlich wiederholt, wenn auch leicht variiert - sich tief in das Gedächtnis jedes Zuhörers<br />
einprägt. So wird man selbst bei denjenigen, die sich nie die Mühe gemacht haben, die Texte zu<br />
lesen, allgemein als der Schöpfer dieser zitierfähigen These bekannt. Da es in der Wissenschaft<br />
üblich ist, alle unterschiedlichen »Ansätze« zu einem Gegenstand zu referieren, kann man so<br />
selbst mit einer ziemlich unsinnigenThese zu beachtlichem Ruhm gelangen.<br />
Für eine Berufungskommission um eine Eingangsstelle in die Professorenlaufbahn genügt aber<br />
diese Art Bekanntheit keineswegs. Sie ist zwar eine gute Voraussetzung, mit der sich ein<br />
Kandidat von der Masse der habilitierten Mitbewerber abheben kann, doch das professorale<br />
Kollegium hat noch andere Gesichtspunkte zu bedenken. Denn der jetzige Bewerber wird im Falle<br />
seiner Berufung zum wahrscheinlich langjährigen Kollegen. Außer in den Fällen eindeutiger <strong>und</strong><br />
öffentlich bekanntgewordener Genialität müssen die Professoren unter den Bewerbern, die sich<br />
einen »Namen« erworben haben, denjenigen aussuchen, den sie auch als Kollegen erträglich<br />
finden. Dabei machen sich nach meiner über zehnjährigen Erfahrung nur selten irgendwelche<br />
Mitglieder der Kommissionen die Mühe, wenigstens die zentralen Schriften der Bewerber zu<br />
lesen. Die meisten gehen nach dem Eindruck bei der mündlichen Anhörung; sie haben bei all<br />
ihren Belastungen auch gar nicht die Zeit, die wissenschaftlichen Werke<br />
105<br />
all der Bewerber in all den Kommissionen zu lesen, in die sie hineingewählt werden. Unter diesen<br />
Umständen setzt sich nur zu leicht eine Tendenz durch, die in allen Gremien vorherrscht, in<br />
denen eine etablierte Elite sich selbst die neuen Mitglieder aussuchen muß, die zugleich die<br />
neuen Konkurrenten sein werden: Es werden diejenigen bevorzugt, von denen sich die meisten<br />
Mitglieder die geringsten Schwierigkeiten versprechen.<br />
Bei solch einem Kriterium fallen die profilierten, mutigen <strong>und</strong> eigenständigen Bewerber tendentiell<br />
durch <strong>und</strong> die grauen Mäuse, die sich in einer geschützten Nische zu einem »Namen«<br />
hochgearbeitet haben, werden bevorzugt. Solche grauen Mäuse in ihren Nischen sind die<br />
geringste Gefahr - hochschulpolitisch in den Kämpfen der Fraktionen, stellenpolitisch im Kampf<br />
um die Haushaltspositionen <strong>und</strong> auch im normalen Kampf der Eitelkeiten. Dieser<br />
Auswahlmechanismus sorgt dafür, daß unkonventionelle Wissenschaftler, politisch unangepaßte<br />
Stimmen <strong>und</strong> selbstbewußte Persönlichkeiten unter den Bewerbern kaum jemals zum Zuge<br />
kommen <strong>und</strong> eher die profilose Normalität, das handwerkliche Können <strong>und</strong> die aufstiegsbewußte<br />
Anpassungsfähigkeit den Zugang zur Professorenlaufbahn findet. Von wenigen Ausnahmen<br />
abgesehen, etabliert sich so im Professorenstand eine Ansammlung <strong>und</strong> damit auch eine<br />
Herrschaft der »grauen Mäuse«, die sich in irgendwelchen mehr oder weniger exotischen<br />
Nischen des Wissenschaftsbetriebes hochgearbeitet haben <strong>und</strong> ihre Studenten <strong>und</strong> Assistenten<br />
immer wieder neu auf diese Nischen ansetzen werden.<br />
Das ist mit ein Gr<strong>und</strong> dafür, daß sich beinahe alle Fächer immer weiter ausdehnen <strong>und</strong> in immer<br />
neuen Spezialgebieten verzetteln. Vermutlich sind ganze Wissenschaftsgebiete auf diese Weise<br />
entstanden - weniger aus inhaltlich-sachlichen Gründen als aufgr<strong>und</strong> der inneren Gesetze einer<br />
Bürokratie beamteter Stelleninhaber, die keinen Konkurrenten neben sich dulden, es sei denn, er<br />
steigt in einer neuen, ungefährlichen Nische neben ihnen auf.
Wichtiger aber <strong>und</strong> folgenreicher noch: Die Inhaber der unterschiedlichen Nischen nehmen sich<br />
gegenseitig fachlich kaum noch zur Kenntnis. Die Zeiten sind längst vorbei, als die Professoren<br />
eines großen Sachgebietes alle Publikationen ihrer Kollegen begierig lasen <strong>und</strong> kritisch<br />
kommentierten. Heute sind die Professoren so überlastet, daß sie gerade noch die Entwicklungen<br />
in ihrer Nische verfolgen können, aber kaum eine Ahnung haben von dem, was ihre Kollgen<br />
fachlich leisten, mit denen sie in Verwaltung, Forschung <strong>und</strong> Lehre in den Gremien kooperieren<br />
müssen - sie kennen nur das bekannte Präfix zu deren »Namen«. Das Ergebnis ist, daß es<br />
keinen einheitlichen Begriff von »Fach« mehr gibt <strong>und</strong> daß sich die professoralen Kollegen<br />
untereinander über ihre Nische hinaus kaum mehr fachlich auseinandersetzen können,<br />
106<br />
ohne <strong>Angst</strong> davor zu haben, als »unfähig« entlarvt zu werden. Das ist aber im Kern die gleiche<br />
<strong>Angst</strong>, die der Student oder die Studentin im ersten Semester hat: sich in Gegenwart von anderen<br />
Studierenden über irgend ein Thema zu äußern, über das sie oder er nicht genau Bescheid weiß.<br />
Für Professoren ist die Situation aber einfacher, weil in den Gremien kaum jemals fachliche<br />
Details zur Sprache kommen. Es geht um Allgemeines. Und in der Kommunikation zwischen<br />
diesen Kollegen, die fachlich kaum etwas übereinander wissen, aber alles befürchten müssen,<br />
entsteht dann ein inhaltsleerer Jargon, der allgemeine Kompetenz <strong>und</strong> hohes Niveau signalisiert.<br />
Solches Niveau wird zum gravitätischen Habitus des Professorenstandes. Es wird zur zweiten<br />
Natur, da allen Menschen, die in der Nische nicht zu Hause sind, die Wissenschaftlichkeit <strong>und</strong> die<br />
fachliche Qualifikation nicht durch inhaltliche Stellungnahmen bewiesen werden kann, sondern<br />
eben nur durch das gravitätisch niveauvolle Gehabe. Ohne dieses Gehabe wäre im Kampf um<br />
Stellen, Aufstieg <strong>und</strong> Gelder bei den Kollegen kein Blumentopf zu gewinnen, denn über die<br />
wirkliche Qualifikation weiß kaum einer Bescheid. So wird der <strong>Bluff</strong>, das inhaltsleere Geklingel mit<br />
Niveau <strong>und</strong> Qualifikation, schon bevor er zwischen den Studierenden in ihrer besonderen<br />
Konkurrenz entsteht, von den Professoren als den Spitzen der Institution Hochschule modellhaft<br />
vorgelebt.<br />
<strong>Wie</strong> weit das geht, kann ich an einem Beispiel deutlich machen, das mich 1971 überhaupt erst<br />
auf die ganzen Überlegungen zum <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong> gebracht hat. Damals saß ich als<br />
Assistentenvertreter in einer Kommission zur Ausbildungsreform. Auf dem Weg zu einer der<br />
unendlich langweiligen Wochenend-Marathonsitzungen mit hohem wissenschaftlichem Niveau<br />
<strong>und</strong> tiefschürfenden Ausführungen meiner Kollegen kam ich mit einer befre<strong>und</strong>eten<br />
Studentenvertreterin an einem Schaufenster einer naturwissenschaftlichen Buchhandlung vorbei.<br />
Da war eine ganze Ecke der Holographie gewidmet. Damals war für diese räumliche<br />
Darstellungsweise mit Laserstrahlen noch kein Nobelpreis vergeben worden, <strong>und</strong> ich wußte nicht,<br />
was das Wort bedeutete. Durch die vorherigen Sitzungen der Kommission war ich bereits so<br />
aufgebracht, daß ich mit der Studentin eine Wette abschloß: Ich würde in der Sitzung des Wort<br />
Holographie dreimal einbringen, <strong>und</strong> alle Professoren würden mir zustimmend zunicken oder<br />
schweigen, ohne mir eine Erklärung abzuverlangen. Ich habe die Wette nicht gewonnen, weil ich<br />
beim drittenmal so sehr lachen mußte, daß doch jemand nachfragte. Davor aber war es mir<br />
zweimal gelungen, mit diesem Begriff allgemeines Kopfnicken oder zustimmendes Schweigen zu<br />
ernten. Als jemand sagte, man müsse den kybernetischen Aspekt (oder ähnliches)<br />
berücksichtigen, hatte ich mit klopfendem Herzen hinzugefügt, daß man dabei aber den<br />
holographischen Ansatz<br />
107
nicht vernachlässigen dürfe. Ich hatte mit etwas, von dem ich selbst nicht wußte, was es war, in<br />
einem überwiegend professoralen Fachbereichsgremium vollen Erfolg gehabt, nur weil es aus<br />
einer Nische stammte die keiner der anwesenden Kollegen kannte.<br />
Diese niveauvoll gravitätische Toleranz aus <strong>Angst</strong> vor der Entlarvung ist letztlich der Gr<strong>und</strong> für<br />
das Scheitern aller Studienreformversuche an Hochschulen, an denen es bereits einen Stamm<br />
von Professoren gibt. Jeder Kollege kann seine Forderungen unterbringen, weil kein anderer sie<br />
als unwesentlich oder als nicht zum Kern gehörig angreifen kann <strong>und</strong> will. Es fehlt die fachliche<br />
Kompetenz. Es fehlt aber auch das Interesse. Das Hauptinteresse liegt nämlich darin, durch<br />
Forschungsaufträge <strong>und</strong> Stellenerweiterungen die eigene Nische auszubauen. Die Lehre ist dazu<br />
eine notwendige, aber eher störende Voraussetzung. Denn würde der Nische die Berechtigung<br />
zur Lehre im Kernbereich des Studiums abgesprochen, wäre sie gleichzeitig zur<br />
Bedeutungslosigkeit auch in allen anderen Anträgen auf Sach<strong>und</strong> Personalmittel verdammt.<br />
Dennoch bleibt die Lehre auch für den fertigen Professor so uninteressant für die weitere<br />
Karriere, wie sie vorher für den promovierenden oder habilitierenden Assistenten war. Wer eine<br />
weitere Karriere machen will, schafft sie auch jetzt nur durch Veröffentlichungen <strong>und</strong><br />
Kongreßbesuche, ob sie aus eigener Feder stammen oder nur über seine Assistenten von ihm<br />
gemanagt werden. Ob er sich mit dem Professorentitel seinen weiteren Aufstieg in Forschung,<br />
Wirtschaft oder Politik erkämpfen will, die Lehre bleibt dafür eher hinderliche Belastung. Und<br />
doch muß er in ihr vertreten sein: denn kein Lehrstuhl ohne Lehre.<br />
Das sind die Gründe, weshalb die meisten Professoren zwar darauf drängen, daß ihre spezielle<br />
Nische gleichwertig mit den anderen als unverzichtbar in den Pflichtteil des Studiums<br />
aufgenommen wird, aber sich in der Lehre doch nie so weit engagieren, daß sie zu zuverlässigen<br />
Trägern einer rationalen Reform <strong>und</strong> zum Organ einer sinnvollen Ausbildung werden könnten. An<br />
allen Hochschulen, wo es schon vor der Reform Professoren gab <strong>und</strong> sie nicht wie an den<br />
Neugründungen erst hinterher in vorgegebene Lehrpläne hineinberufen wurden, ist das Ergebnis<br />
entsprechend: erhöhter Leistungsdruck bei Fortbestehen des Chaos. Denn die bloße Addition<br />
von Nischen kann nichts anderes ergeben.<br />
So bleibt Chaos das Prinzip, das die Hochschulen regiert. Der Witz daran ist aber, daß dieses<br />
herrschende Prinzip die Ziele, die einstmals mit der technokratischen Hochschulreform des<br />
Hochschulrahmengesetzes angestrebt worden waren, überhaupt nicht gefährdet, wie eigentlich<br />
anzunehmen wäre. Im Gegenteil: Ich glaube, daß durch das Chaos diese Ziele sogar besser<br />
erreicht werden, als es die aufwendigen Maßnahmen der Bildungsplaner je ermöglicht hätten.<br />
Diese Ziele waren:<br />
108<br />
- ökonomisierung der Ausbildung, d. h., möglichst großen<br />
Ausstoß bei geringsten Kosten;<br />
- Flexibilität <strong>und</strong> Multifunktionalität als Ausbildungsziele, da nicht mehr bestimmte Inhalte <strong>und</strong><br />
Berufsbilder über ein ganzes Berufsleben gültig bleiben <strong>und</strong> deshalb Anpassungsfähigkeit die<br />
wichtigste Qualifikation ist;<br />
- differenzierte Elitenbildung, d. h., die frühere Akademikerschicht mit garantiertem Zugang zu<br />
den höchsten Berufsmöglichkeiten muß sich differenzieren nach den Möglichkeiten des<br />
Arbeitsmarktes, von den mittleren Verwaltungstätigkeiten bis zur führenden Spitzenstellung.
Das Chaos als herrschendes Prinzip scheint auf den ersten Blick das genaue Gegenteil vom<br />
ersten Ziel, der Ökonomisierung, zu bewirken. Die Kultusministerien haben sich aber inzwischen<br />
darauf eingestellt <strong>und</strong> regieren selbst mit dem Mittel des Chaos, indem sie einfach in den<br />
Bereichen, in denen zuviele Absolventen produziert werden oder die Kosten unvertretbar steigen,<br />
die Sachmittel streichen <strong>und</strong> die Stellen blockieren. Die betroffenen Bereiche protestieren zwar<br />
heftig, müssen dann aber doch lernen, mit den geringeren Mitteln <strong>und</strong> Stellen auszukommen. Das<br />
Chaos wird dadurch immer größer, doch das fällt nach außen kaum noch auf.<br />
Es ist sogar das ideale Mittel, um das zweite Ziel zu erreichen, das Ausbildungsziel Flexibilität<br />
<strong>und</strong> Multifunktionalität. Denn die Ökonomisierung, die so auf die Lehrkräfte <strong>und</strong> von denen auf<br />
die Studierenden abgewälzt wird, erzeugt an den Fachbereichen die Bedingungen eines<br />
sozialdarwinistischen Dschungels, in dem nur die Anpassungsfähigsten <strong>und</strong> Stärksten überleben,<br />
die sich dann auch allen Berufsbedingungen stellen könne, ob sie mit dem bisherigen Studium<br />
etwas zu tun haben oder nicht.<br />
Das Prinzip Chaos sorgt in der gleichen Weise dafür, daß das dritte Ziel, die differenzierte<br />
Elitenbildung, erreicht wird. Da nur die Anpassungsfähigsten <strong>und</strong> Selbständigsten das Studium<br />
schaffen <strong>und</strong> sogar noch ein weiterführendes Studium bis zum Doktortitel durchstehen, kann die<br />
weitere Elitenauswahl beruhigt dem Arbeitsmarkt überlassen werden. Wenn die Absolventen<br />
lange genug arbeitslos <strong>und</strong> ohne Unterstützung durchgehangen haben, werden sie sich schon<br />
dazu bequemen, auch weniger gut bezahlte <strong>und</strong> renommierte Jobs anzunehmen.<br />
Da das Prinzip Chaos also die Ziele des Hochschulrahmengesetzes mit weniger<br />
Verwaltungsaufwand <strong>und</strong> für den Staat letztlich sogar billiger durchsetzt, gibt es für die<br />
staatlichen Stellen immer weniger Anlaß, direkt in die Entwicklung der Fächer <strong>und</strong> in ihren<br />
Studienaufbau einzugreifen. Es genügt, die Gesamtentwicklung der Fächer finanziell zu steuern,<br />
sie auszudehnen oder einzu<br />
109<br />
schränken. Alles andere regelt sich von selbst in seinem gewohnten chaotischen Gang - auf<br />
Kosten der Studierenden.<br />
Genau betrachtet, ist diese Art Reform auch viel kapitalismuskonformer als die »große<br />
Planifikation«, »die Unterwerfung unter das Kapital« oder die »technokratische Reform«, wie sie<br />
jahrelang in den Flugblättern prophezeit worden ist, denn nichts entspricht dieser<br />
Gesellschaftsform so sehr wie das Chaos des Warenmarkts mit seinem »jeder für sich selbst <strong>und</strong><br />
gegen alle anderen«.<br />
Das Chaos als herrschendes Prinzip der Hochschulpolitik steigert aber die Probleme für die<br />
Studierenden ins schier Unerträgliche. Trotz aller Studienordnungen <strong>und</strong> Vorschriften ist es allein<br />
ihre Erfingungsgabe, ihr Kraftaufwand, ihr Einsatz von Zeit <strong>und</strong> Geld, wodurch die Hochschulen<br />
überhaupt noch weiterfunktionieren. Sie werden sozusagen von der Institution <strong>Uni</strong>versität selbst<br />
gegen alle offiziellen Pläne <strong>und</strong> Vorschriften zum subversiven Studium verpflichtet. Denn die<br />
Pläne <strong>und</strong> Vorschriften spiegeln nur vor, sinnvolles Studieren zu ermöglichen. Dieser Anspruch<br />
selbst ist <strong>Bluff</strong>, da sie nur die weniger oder besser arrangierte Addition der vorhandenen Nischen<br />
sind. Die Herrschaft des <strong>Uni</strong>-<strong>Bluff</strong>s wird aber auch ansonsten durch die grauen Mäuse in ihren<br />
Nischen stetig befestigt. Da sie kaum etwas übereinander fachlich wissen <strong>und</strong> auch kaum jemals<br />
fachlich miteinander kommunizieren, gibt es statt inhaltlicher Auseinandersetzungen nur noch das<br />
inhaltsleere, gravitätische Gehabe vom hohen Niveau, das der bloßen Verwaltung des Chaos den<br />
schönen Schein von Sinn <strong>und</strong> Wissenschaftlichkeit gibt. Tatsächlich nützliche Wissenschaft <strong>und</strong>
sinnvolles Studium kann in den Hochschulen, wie sie gegenwärtig konstruiert sind, nur gegen die<br />
Institution verwirklicht werden, gegen ihre Vorschriften <strong>und</strong> Pläne, gegen ihre Ansprüche <strong>und</strong> vor<br />
allem gegen ihr »Niveau«.<br />
(Januar 1982)<br />
110<br />
Verzeichnis der angeführten Literatur<br />
Achterberg, 1974; Bernhard: »<strong>Angst</strong> - Erfahrung« in: <strong>Angst</strong>, Erfahrungsberichte, Analysen <strong>und</strong><br />
Kritik zu »<strong>Angst</strong> im Kapitalismus«; Lampertheim, S. 9-47.<br />
Anger, 1960; Hans: Probleme der deutschen <strong>Uni</strong>versität. Bericht über eine Erhebung unter<br />
Professoren <strong>und</strong> Dozenten; Tübingen.<br />
Appel, Groebel, 1975: »Sozialisationseffekte in Ingenieurstudiengängen. Ausbildung <strong>und</strong><br />
Ausprägung von Haltungen <strong>und</strong> Einstellungen mit Bedeutung für spätere Berufsausübung« in:<br />
Sozialisation in der Hochschule, Blickpunkt Hochschuldidaktik 37; Hamburg, S. 230-238.<br />
Archer, 1972; Margaret S.: Students, <strong>Uni</strong>versity and Society; London.<br />
Baumeyer, 1968; Franz: »Arbeitsstörungen bei Studenten« in: Zeitschrift für psycho-somatische<br />
Medizin 14.<br />
Beckmann u. a., 1972; Beckmann, Möller, Richter, Scheer: Studenten; Stuttgart.<br />
Böker, 1969; W.: »Psychische Probleme bei Studierenden - Symptomatik, Ursachen <strong>und</strong><br />
Behandlungsmöglichkeiten« in: Zeitschrift für Psychotherapie <strong>und</strong> medizinische Psychologie, J.<br />
19, H. 4, S. 137-153.<br />
Bourdieu, Passeron, 1971; Pierre <strong>und</strong> Jean-Claude: Die Illusion der Chancengleichheit -<br />
Untersuchungen zur Soziologie des Bildungswesens am Beispiel Frankreichs; Stuttgart.<br />
Branahl, Francke, 1975; Udo <strong>und</strong> Robert: »Hochschulsozialisation <strong>und</strong> Berufspraxis von Juristen«<br />
in: Sozialisation in der Hochschule; Blickpunkt Hochschuldidaktik 37; Hamburg, S. 260-274.<br />
Bürmann, 1975; Jörg: »Kritische Anmerkungen zum gegenwärtigen Interesse der<br />
Hochschuldidaktik an Problemen der Hochschulsozialisation« in: Sozialisation in der Hochschule,<br />
Blickpunkt Hochschuldidaktik 37; Hamburg, S. 48-69.<br />
Bull, Weber-Unger, 1976; Monika <strong>und</strong> Steffi: Übergangsprobleme von Schule zu Hochschule bei<br />
Studienanfängern; Diplomarbeit am FB Erziehungswissenschaften der <strong>Uni</strong> Marburg.<br />
Clemens-Lodde, Sader, 1972; B. <strong>und</strong> M.: »Motivation, Zufriedenheit <strong>und</strong> Lernerfolg in kleinen<br />
Gruppen« in: Lernen in der Hochschule, Blickpunkt Hochschuldidaktik 22; Hamburg, S. 31-57.<br />
Cohn, 1974; Ruth C.: »Zur Gr<strong>und</strong>lage des themenzentrierten interaktionellen Systems« in:<br />
Gruppendynamik, Jg. 5, H. 3, S. 150-159.
Diepold, 1975; Peter: »Gruppendynamik in wirtschaftswissenschaftlichen<br />
Massenveranstaltungen« in: Gruppenarbeit <strong>und</strong> Tutorenausbildung, Blickpunkt Hochschuldidaktik<br />
38; Hamburg, S. 60-64.<br />
Doerry, 1972; Gerd: »Gruppendynamische Prozeßanalyse in Seminaren« in:<br />
Gruppendynamische Experimente im Hochschulbereich, Blickpunkt Hochschuldidaktik 24;<br />
Hamburg, S. 12-28.<br />
Duhm, 1974; Dieter: Warenstruktur <strong>und</strong> zerstörte Zwischenmenschlichkeit; Köln.<br />
Eckstein, 1972; Brigitte: »Gruppendynamische Arbeit mit Tutoren an der Hochschule« in:<br />
Gruppendynamische Experimente im Hochschulbereich, Blickpunkt Hochschuldidaktik 24;<br />
Hamburg, S, 29-34.<br />
Eckstein, 1975; Brigitte: »Zur Sozialisation der Hochschullehrer« in: Sozialisation in der<br />
Hochschule, Blickpunkt Hochschuldidaktik 37; Hamburg, S. 167-174.<br />
Eisenberg, Thiel, 1973; Götz <strong>und</strong> <strong>Wolf</strong>gang: Fluchtversuche - Über Genesis, Verlauf <strong>und</strong><br />
schlechte Aufhebung der antiautoritären Bewegung; Gießen.<br />
Framhein, 1975; Gerhild: »Außerfachliche Bildungsziele der <strong>Uni</strong>versität als Gegenstand der<br />
Sozialisationsforschung« in: Sozialisation in der Hochschule, Blickpunkt Hochschuldidaktik 37;<br />
Hamburg, S. 154-166.<br />
Freire, 1973; Paulo: Pädagogik der Unterdrückten - Bildung als Praxis der Freiheit; Reinbek.<br />
Friedrich, 1974; Volker: »Selbstmord <strong>und</strong> Selbstmordversuch unter Göttinger Studenten« in: Bd. 2<br />
von: Zwischen Apathie <strong>und</strong> Protest, Hrsg. Sperlin, Jahnke; Bern, S. 111-232.<br />
Gärtner-Harnach, 1972; Viola: <strong>Angst</strong> <strong>und</strong> Leistung; Weinheim.<br />
Goldschmidt, 1969; D.: »Die objektive Studiensituation der Studierenden in der B<strong>und</strong>esrepublik<br />
Deutschland als eine Streß-Situation« in: Psychische Störungen bei Studenten, hrsg. H.-U.<br />
Ziolko; Stuttgart.<br />
Goldschmidt, 1972; Dietrich: »West Germany« in: Students, <strong>Uni</strong>versity and Society, hrsg. M. S.<br />
Archer; London, S. 154-166.<br />
Gorz, 1975; Andrè: »Zerschlägt die <strong>Uni</strong>versität!« in: Sozialistisches Jahrbuch 3; Berlin.<br />
Greiff, 1976; Bodo von: Gesellschaftsform <strong>und</strong> Erkenntnisform - Zum Zusammenhang von<br />
wissenschaftlicher Erfahrung <strong>und</strong> gesellschaftlicher Entwicklung; Frankfurt a. M.<br />
Hagemann-White, 1976; Carol: »Einige Erfahrungen <strong>und</strong> Gedanken über Hochschuldidaktik an<br />
der Massenuniversität« in: Zeitschrift für Soziologie, Jg. 5, H. 1, S. 80-98.<br />
Heckhausen, 1965; Heinz: »Leistungsmotivation« in: Handbuch der Psychologie, Band II:<br />
Motivation; Göttingen, S. 602-702.<br />
Hervè, 1973; Florence: Studentinnen in der BRD - Eine soziologische Untersuchung; Köln.
Infratest, 1974; Befragung von Studierenden, Wintersemester 1973/74 Zusammenfassung<br />
wichtiger Ergebnisse; Broschüre, München.<br />
Jahnke, Ziolko, 1969; S. <strong>und</strong> H.-U.: »Untersuchungen an ausländischen Studenten bei<br />
neurotischen Störungen« in: Psychische Störungen bei Studenten; Stuttgart, S. 245-256.<br />
Jenne, u. a., 1969; Michael; Krüger, Marlis; Müller-Plantenberg, Urs: Student im Studium -<br />
Untersuchungen über Germanistik, Klassische Philologie <strong>und</strong> Physik an drei <strong>Uni</strong>versitäten;<br />
Stuttgart.<br />
Keil, 1973; <strong>Wolf</strong>gang: »Vorn Umgang mit Hochschullehrern« in: Der andere Studienführer, hrsg.<br />
Lothar Schweim; Weinheim, S. 56-77 .<br />
Keil, 1975; <strong>Wolf</strong>gang: »Fachumgebung <strong>und</strong> affektive Lernvoraussetzungen im Studium« in:<br />
Sozialisation in der Hochschule, Blickpunkt Hochschuldidaktik 37; Hamburg, S. 149-153.<br />
Kirsten, Mente, 1975; Herbert <strong>und</strong> Arnold: »Ein Modell für partnerzen<br />
112<br />
trierte Gruppenarbeit als Beitrag zur Hochschuldidaktik« in: Gruppendynamik, Jg. 6, H. 4, S.<br />
256-260.<br />
Klöckner, 1977; Beate: »Unter lauter Männern« in: Frauen, Kursbuch 47-1 Berlin, Seite 27-42.<br />
Krohne, 1976; Heinz W.: Theorien zur <strong>Angst</strong>; Stuttgart.<br />
Kudera, Graeßner, 1974; Werner <strong>und</strong> Dietrich-Eckart: Projekt-. Hochschuldidaktik; Hannover.<br />
Leutz, 1975; Grete A.: »Imagination <strong>und</strong> Psychodrama« in: Gruppendynamik, Jg. 6, S. 97-104.<br />
Lungershausen, 1968; E.: Selbstmorde <strong>und</strong> Selbstmordversuche bei Studenten; Heidelberg.<br />
Lungershausen, 1969; E.: »Zum Problem der Suizidhandlungen an <strong>Uni</strong>versitäten« in: Psychische<br />
Störungen bei Studenten, hrsg. K.-U. Ziolko; Stuttgart.<br />
Mahler, 1971; Eugen: Psychische Konflikte <strong>und</strong> Hochschulstruktur Gruppenprotokolle; Frankfurt<br />
a. M.<br />
Metzger, 1975; <strong>Wolf</strong>gang: »Gestalttheorie <strong>und</strong> Gruppendynamik« in: Gruppendynamik, Jg. 6, H.<br />
5, S. 319-329.<br />
Metz-Göckel, 1975; Sigrid: Theorie <strong>und</strong> Praxis der Hochschuldidaktik Modelle der Lehr- <strong>und</strong><br />
Lernorganisation; Frankfurt a. M.<br />
Möller, 1974-, B.: Widersprüche überleben!, hektographiertes Manuskript; Tübingen.<br />
Möller, Korte, 1972: Elke <strong>und</strong> Hermann: Sozialer Numerus clausus: studentisches Wohnen;<br />
Hannover - HIS-Brief 25.
Moeller, 1971; M. L.: »Die Prüfung als Kernmodell psychosozialer Konflikte« in.<br />
Hochschulprüfungen - Rückmeldung oder Repression, Blickpunkt Hochschuldidaktik 13;<br />
Hamburg, S. 28-34.<br />
Moeller, Scheer, 1974; Michael L. <strong>und</strong> Jörn W.: Psychotherapeutische Studentenberatung -<br />
Probleme der Klienten, Problematik der Institution; Stuttgart.<br />
Morgenstern, 1972; W. X.: »Botschaft - Appell - Flucht, Selbstmord <strong>und</strong> Selbstmordversuch bei<br />
Studenten« in: Analysen - Zeitschrift für Wissenschafts<strong>und</strong> Berufspraxis, Jg. 2, Nr. 1, S. 28.<br />
Müller, 1976; Ludmilla: »Kinderaufzucht im Kapitalismus - wertlose Arbeit; über die Folgen der<br />
Nichtbewertung der Arbeit der Mütter für das Bewußtsein der Frauen als Lohnarbeiterinnen« in:<br />
Prokla 22, S. 13-65.<br />
Neef u. a., 1975; <strong>Wolf</strong>gang; Schoembs, Harald; Wagemann, Carl-Hellmuth: »Fünf Thesen zum<br />
Thema >Sozialisation in der Hochschule in: Sozialisation in der Hochschule, Blickpunkt<br />
Hochschuldialektik 37, Hamburg.<br />
Oehler, 1974; Christoph: Student <strong>und</strong> Studienberatung - Bericht über die Befragung von<br />
Studienanfängern <strong>und</strong> Vorschläge zum Aufbau eines Studienberatungssystems an einer<br />
Großstadtuniversität; Frankfurt a. M,<br />
Oelschläger, Müller, 1973; Dieter <strong>und</strong> C. <strong>Wolf</strong>gang: »<strong>Wie</strong> man sein Studium organisieren kann«<br />
in: Der andere Studienführer hrsg. Lothar Schweim; Weinheim.<br />
Ottwaska, 1971; Gertrud: Studienbedingungen - Prüfungsleistungen Berufserfolg, Eine<br />
Untersuchung zur Effektivität des Studiums der<br />
113<br />
Wiftschaftswissenschaften an der <strong>Uni</strong>versität Mannheim in den Jahren 1958 <strong>und</strong> 1966; Blickpunkt<br />
Hochschuldidaktik 15, Hamburg.<br />
Pätzold, 1972; Bjorn: Ausländerstudium in der BRD - Ein Beitrag zur Imperialismuskritik; Köln.<br />
Piontkowski, 1973; Ursula: Interaktion <strong>und</strong> Wahrnehmung in Unterrichtsgruppen; Münster.<br />
Prior; 1972; Harm: »Gruppendynamik <strong>und</strong> politisches Lernen« in: Gruppendynamische<br />
Experimente im Hochschulbereich, Blickpunkt Hochschuldidaktik 24; Hamburg, S. 92-98.<br />
Reiss, 1975; Veronika: »Die theoretischen Naturwissenschaften als Sozialisationsumwelt für<br />
Studenten« in: Sozialisation in der Hochschule, Blickpunkt Hochschuldidaktik 37; Hamburg, S.<br />
214-229.<br />
Robinson, 1961; F. P.: Effective Study; New York, Evanston, London.<br />
Saterdag, Apenburg, 1972; Hermann <strong>und</strong> Eckhard: 0-ientierungsprobleme <strong>und</strong><br />
Erfolgsbeeinträchtigungen bei Studierenden - Saarbrükker Studien zur Hochschulentwicklung 14;<br />
Saarbrücken, hektographiertes Manuskript.
Scheer, Zenz, 1973; Jörn W. <strong>und</strong> Helmuth: Studenten in der Prüfung Eine Untersuchung zur<br />
akademischen Initiationskultur; Stuttgart.<br />
Scholz, 1975; Gudrun: Selbsterfahrungsgruppen in pädagogischen Studiengängen; Blickpunkt<br />
Hochschuldidaktik 36; Hamburg.<br />
Sienknecht, 1976; Jens: Selbsterfahrung im Lehrerstudium; München, Berlin <strong>und</strong> <strong>Wie</strong>n.<br />
Sperlin, Jahnke, 1974; Eckhard <strong>und</strong> Jürgen: Zwischen Apathie <strong>und</strong> Protest, 2 Bände. Band 1:<br />
Studentenprobleme <strong>und</strong> Behandlungskonzepte einer ärztlich-psychologischen Beratungsstelle;<br />
Bern, Stuttgart, <strong>Wie</strong>n.<br />
Student, 1966; Der Spiegel legt vor: Der deutsche Student - Situation, Einstellungen <strong>und</strong><br />
Verhaltensweisen. Ergebnisse einer Repräsentativerhebung an 26 deutschen <strong>Uni</strong>versitäten <strong>und</strong><br />
Hochschulen, durchgeführt im Auftrag des Spiegel vom Institut für Demoskopie Allensbach<br />
1966/67. Broschüre.<br />
Teuwsen, 1975; E.: »Klientenzentrierte Selbsterfahrungsgruppen in der Studentenberatung« in:<br />
Gruppendynamik, Jg. 6, H. 4, S. 250-255.<br />
Tübinger Autorenkollektiv, 1976; Selbstorganisation <strong>und</strong> Politisches Lernen, Versuche zur<br />
Initiierung selbstgesteuerter Lernprozesse in der Lehrerbildung; Blickpunkt Hochschuldidaktik 41;<br />
Hamburg.<br />
<strong>Wagner</strong>, 1., 1969; »Über den Einfluß von Situationsfaktoren in Leistungsprüfungen« in:<br />
Psychische Störungen bei Studenten, Stuttgart, S. 170-182.<br />
Weber, 1973; Norbert: Privilegien durch Bildung. Über die Ungleichheit der Bildungschancen in<br />
der B<strong>und</strong>esrepublik Deutschland; Frankfurt a. M.<br />
Wilcke, 1976; Bernd-Achim: Studienmotivation <strong>und</strong> Studienverhalten; Göttingen, Toronto, Zürich.<br />
114<br />
Nachtrag<br />
Hier will ich mit Auszügen aus den Studienberichten von drei Studentinnen, denen es gelungen<br />
ist, sich trotz großer Schwierigkeiten an der <strong>Uni</strong> zurechtzufinden, zeigen, wie so etwas im<br />
wirklichen Studienverlauf aussehen kann. Die Studienberichte sind so zusammengestrichen, daß<br />
sich keine Rückschlüsse auf die Personen ziehen lassen.<br />
»Der Sprung von der Schule, aus einem relativ sicheren sozialen Umfeld, an die <strong>Uni</strong> <strong>und</strong> in eine<br />
Stadt, in der ich, außer einigen Verwandten, niemand kannte, war nicht einfach, <strong>und</strong> das erste<br />
Semester war beansprucht durch die Suche nach einer Wohnung <strong>und</strong> den Versuch, die (auch<br />
durch die <strong>Uni</strong>-Atmosphäre verursachte) Verunsicherung loszuwerden. Ich konnte mit den beiden<br />
Gr<strong>und</strong>kursen nicht viel anfangen, wohl auch deshalb, weil ich viel zu sehr mit mir selbst<br />
beschäftigt war, als daß ich für irgend etwas anderes hätte Interesse aufbringen können.<br />
Der Streik gegen die Berufsverbote hat die Unbetroffenheit <strong>und</strong> das Abgehobene der <strong>Uni</strong>versität<br />
(es fällt mir schwer, diesen Zustand, in dem ich mich der <strong>Uni</strong> gegenüber befand, näher zu
eschreiben) aufgebrochen, gerade auch durch Diskussionen über Anonymität im Studium <strong>und</strong><br />
Organisationsstrukturen desselben.<br />
Die Schwierigkeit, mich bei Diskussionen in den Massenveranstaltungen zu beteiligen, hatte ich<br />
verloren, als es um den Streik ging, wohl auch deshalb, weil es mir leichter fällt, Hemmungen zu<br />
überwinden, wenn es um Dinge geht, die mich betroffen machen. ( ... ) Die<br />
Arbeitsgruppenerfahrung im 2. Semester war die, daß wir uns zwar persönlich näherkamen,<br />
unsere gemeinsamen Aktivitäten sich aber auch darauf beschränkten, einige dufte Erfahrungen<br />
miteinander zu machen - immerhin, wir dem Anspruch aber, unsere Gruppenarbeit gemeinsam zu<br />
erstellen <strong>und</strong> zu diskutieren, nicht gerecht werden konnten <strong>und</strong> jeder seinen Teil individuell<br />
erstellte. ( ... )<br />
Das dritte Semester brachte insofern einen entscheidenden Einschnitt, als sich hier Kontakte an<br />
der <strong>Uni</strong> verfestigten, die in ihrer Entwicklung zu einem Studienkollektiv führen sollten.<br />
Das Gefühl, daß sich mein Leben tatsächlich immer mehr in Berlin abspielte, <strong>und</strong> auch<br />
entscheidende Veränderungen meiner selbst veranlaßten mich, den ehemals sehr verlockenden<br />
Plan aufzugeben, mit Fre<strong>und</strong>en, die ich noch aus der Schulzeit kannte, eine Wohngemeinschaft<br />
in Tübingen aufzubauen. Gespräche über Studieninhalte, politische Arbeit, Alltagssituationen<br />
ließen mich Erfahrungen viel bewußter erleben, brachten Auseinandersetzungen über unsere<br />
eigene Geschichte, unsere Berufswünsche <strong>und</strong> unser durch gesellschaftliche Normen geprägtes<br />
Sein mit sich. Daraus resultierte die Fähigkeit, vieles in Frage zu stellen oder einfach bewußt zu<br />
leben.«<br />
115
»Zwischen Bergen von Literatur, mehr oder weniger chaotischen Arbeitsgruppensitzungen <strong>und</strong><br />
trockenen Seminaren konnte ich im 1. Semester weder die Seminare in Zusammenhang bringen,<br />
geschweige denn mich mit eben diesen.<br />
Dermaßen desorientiert, war ich nicht nur an der <strong>Uni</strong>, sondern auch bezüglich der Stadt Berlin,<br />
denn ich hatte bis zu meinem Eintreffen hier keinerlei soziale Kontakte.<br />
Viel mehr als die Seminare (Inhalt <strong>und</strong> Form) berührte mich der Streik gegen die Berufsverbote.<br />
Im Streikrat, als Streikposten <strong>und</strong> als eifriger VV-Besucher gewann ich Einblick in die<br />
Hochschulpolitik - lernte z. B. die diversen politischen Hochschulgruppen kennen <strong>und</strong><br />
unterscheiden. Nicht zuletzt schloß ich auch in der StreikCafeteria die ersten Fre<strong>und</strong>schaften.<br />
Angesichts der Auseinandersetzung mit den Berufsverboten, den direkten Erfahrungen mit den<br />
parteilichen Medien <strong>und</strong> schlagkräftigen Polizeiknüppeln, änderte oder präzisierte sich mein<br />
politisches Selbstverständnis. Das hatte vor allem Auswirkungen auf das Verhältnis zu meinen<br />
Eltern <strong>und</strong> Fre<strong>und</strong>en aus Westdeutschland (Bayern!) ( ... )<br />
Eigentlich hat mein Studium erst mit dem 3. Semester begonnen, d. h. es hat sich soweit entfaltet,<br />
daß es mir zur Befriedigung gereicht. Es lassen sich inhaltliche Bezüge zwischen den Seminaren<br />
herstellen, <strong>und</strong> vor allem bietet sich mir die Möglichkeit der Identifikation. Die Kombination von<br />
theoretisch-philosophischen Aspekten, theoretisch-ökonomischen <strong>und</strong> praktisch anschaulichen<br />
vermittelt mir das Gefühl, in einen Themenbereich in seiner ganzen Komplexität vorzudringen.<br />
Neben dieser >thematischen Geborgenheit< spielt auch die persönliche eine große Rolle, die,<br />
obgleich schon in den ersten Semestern aufgebaut, jetzt erst zum Tragen kommt. Gruppenarbeit<br />
ist nicht mehr nur Postulat, sondern läßt sich realisieren.«<br />
»Recht zuversichtlich trat ich meinen Weg ins erste Semester an. Dieses Seminar entsprach vom<br />
Thema her voll meinem Interesse. Da ich mich zusammen mit einem Kommilitonen gleich für das<br />
erste Referat gemeldet hatte, mußte ich mich sofort in die Arbeit stürzen. Auf diesem Weg lernte<br />
ich in kürzester Zeit Gruppenarbeit, die gut funktionierte, die <strong>Uni</strong>versitätsbibliothek, richtiges<br />
Zitieren <strong>und</strong> >den M<strong>und</strong> aufmachen müssen< kennen. Mit meinem Einstieg war ich zufrieden,<br />
bald jedoch kam ich mit den weiteren Sitzungen, mit der oft abgehobenen Diskussionsweise nicht<br />
mehr zurecht. Ober meine eigenen Papiere hinaus glaube ich nichts hinzugelernt zu haben;<br />
Zusammenhänge gingen verloren, <strong>und</strong> z. T. wußte ich gar nicht mehr, was das eine Thema mit<br />
dem anderen zu tun hatte.<br />
116<br />
Auch wenn durch die langen Semesterferien Kontinuität oft schwer gemacht wird, trafen wir uns<br />
zu Beginn des Wintersemesters, um im Vorlesungsverzeichnis ein Seminar zu finden, das<br />
unseren gemeinsamen Interessen entsprach.<br />
Uns als Studienkollektiv zu bezeichnen, obwohl wir ein solches werden wollten, wäre übertrieben.<br />
Teile unsererdamaligen Arbeitsgruppe sowie der >harte Kern< sindjedoch nach wie vor der<br />
Meinung, daß es unbedingt notwendig ist, über mehrere Semester hinweg mit denselben Leuten<br />
zusammenzuarbeiten. Persönlich kamen wir uns zwar in den Gruppensitzungen näher,<br />
andererseits haben wir allzu oft die einfachsten Entschuldigungen für Nichtstun akzeptiert, so daß<br />
wir inhaltlich zu unserem Arbeitsthema kaum vorwärts kamen. Ferner unterbrachen der Streik<br />
gegen das HRG -jeder von uns wollte aktiv daran teilnehmen - <strong>und</strong> die Weihnachtsferien unsere<br />
Gruppensitzungen. In der anstehenden konkreten Arbeitsphase waren,dann nur noch drei Leute
auf sich zurückgeworfen. Für mich war diese Situation sehr unbefriedigend, weil der Reflexions-<br />
<strong>und</strong> Diskussionsprozeß Überhaupt nicht stattfand. Wir restlichen drei hatten das Gefühl, ein total<br />
oberflächliches Papier abgeliefert zu haben, obwohl wir gerade dies verhindern wollten. Nach<br />
einigen selbstkritischen Gesprächen ist uns klar geworden, daß wir persönliches Interesse <strong>und</strong><br />
intensive inhaltliche Arbeit mit ein wenig Selbstdisziplin verbin<br />
den müssen, um ein gutes Gruppengesarntgefühl zu erreichen. ( ... ) Innerhalb des Kapitalkurses,<br />
den ich in diesem Semester begonnen hatte, <strong>und</strong> während des Streiks habe ich an vielen<br />
Gesprächen über Kommunikationsschwierigkeiten <strong>und</strong> den vielzitierten <strong>Uni</strong>-Frust teilgenommen.<br />
So wichtig ich diese Diskussionen für das Aufknacken von verkrampften<br />
Seminarzusammenhängen finde <strong>und</strong> sie auch für mich zuweilen sind, entstand bei mirjedoch<br />
mehr <strong>und</strong> mehr der Eindruck, daß viele Leute sich in diesen Frust hineinreden, ohne<br />
daß dabei deutlich wird, ob alle Möglichkeiten zu einer Änderung der Situation ausgeschöpft<br />
worden sind. Im Streik hatte ich an der Arbeitsgruppe für OSI-interne Informationen, die die<br />
Arbeitsberichte der Streikarbeitsgruppen sammelte <strong>und</strong> mit einer riesigen Wandzeitung die<br />
verschiedensten Aktivitäten transparent machen wollte, teilgenommen. Dort habe ich gespürt, wie<br />
wenig solche Angebote überhaupt wahrgenommen werden, <strong>und</strong> wie selten die Leute vor ihren<br />
eigenen Füßen mit einer Veränderung beginnen. Solange Privatsphäre <strong>und</strong> <strong>Uni</strong>sphäre bei den<br />
meisten von uns so getrennt nebeneinander existieren, wird es schwer sein - neben den anderen<br />
schlechten <strong>Uni</strong>bedingungen - diesen Gegensatz zu durchbrechen. Für mich meine ich ihn schon<br />
einigermaßen aufgehoben zu haben. Unser Institut ist für mich nicht der Hort des notwendigen<br />
Übels, sondern ein Ort, an dem ich auch Fre<strong>und</strong>e treffen kann.«