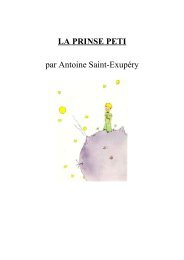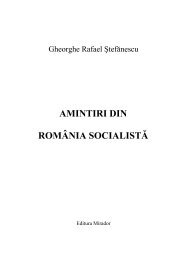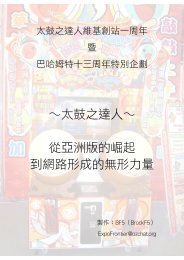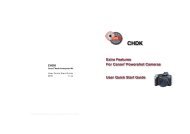IKK Verbessert - wikia.nocookie.net
IKK Verbessert - wikia.nocookie.net
IKK Verbessert - wikia.nocookie.net
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Interkulturelle Kommunikation<br />
Dozentin: Dr. des. Halyna Leontiy<br />
Yves Steinebach, Maximilian Weiß, Thomas Rückert 24.03.2009<br />
1. Ausgangspunkt des Gegenstandsbereichs<br />
Interkulturelle Kommunikation<br />
Karlfried Knapp, Universität Düsseldorf<br />
Annelie Knapp-Potthoff, Achen<br />
Die heutige Welt ist aufgrund zahlreicher Gründe kleiner geworden. Die Ursachen hier für sind unter<br />
anderem Medien, durchlässige Grenzen und moderne Verkehrsmitteln. Die Internationalisierung der<br />
Welt hat nicht nur den Austausch gefördert, sondern auch aufgrund der Begegnungen verschiedener<br />
Denk- und Verhaltensmuster Kommunikationsprobleme hervorgebracht. Diese Paradoxie der Begegnung<br />
findet nicht nur im Kontakt zwischen verschiedenen Nationen statt, sondern auch zwischen Mitglieder<br />
unterschiedlicher Kulturen einer Nation.<br />
Es ist heute aufgrund zunehmender Vielfalt internationaler Kontakte nicht möglich alle Sprachen zu<br />
lernen, deshalb weitet sich der Gebrauch von linguae francae 1 aus. Unter linguae francae versteht man<br />
im erweiterten Sinne jede andere Sprache, die zwischen den Sprechern verschiedener sprachlicher<br />
Gruppierungen als Verkehrssprache dient, so wie heute z.B. Englisch in der Wirtschaft und Latein in<br />
der Medizin.<br />
!<br />
Ein interdisziplinärer Zugang ist vonnöten, da es den einzelnen Disziplinen nicht möglich ist die Komplexität<br />
der interkulturellen Kommunikation (<strong>IKK</strong>) zur artikulieren. Um diesen zu ermöglichen muss<br />
der Begriff der <strong>IKK</strong> klar definiert sein.<br />
2. Definition von „interkulturelle Kommunikation“<br />
Um <strong>IKK</strong> definierten zu können muss zunächst eine Abgrenzung der Begriffe Kultur und Kommuni-kation<br />
stattfinden.<br />
!<br />
1.1. Kultur<br />
In Anlehnung an die Kulturantropologen Keesing und Goodenough verstehen die Autoren, Kultur<br />
als „ … ein ideationales System, als ein zwischen Gesellschaftsmitgliedern geteiltes Wissen<br />
an Standards des Wahrnehmens , Glaubens, Bewertens und Handelns, dass sich im öffentlichen<br />
Verzug vom symbolischem Handeln manifestiert“ 2 . Dieses ist in einer Gesellschaft „nicht homogen“<br />
verteilt, sondern in vielseitigen Abhandlungen vorhanden. Dabei sind Kultur und Gesellschaft<br />
nicht identisch, sondern interpendent.<br />
1.2. Kommunikation<br />
Unter Kommunikation verstehen die Autoren „ … interpersonale Interaktion, vollzogen mit<br />
Hilfe eines sprachlichen Kodes“ 3 . Dieser Kode setzt sich hierbei aus verbalen, paraverbalen<br />
und non-verbalen Dimensionen der Kommunikation zusammen.<br />
1 Vgl. hierzu auch Foltys (2006), S. 1-37.<br />
2 Knapp K., Knapp-Potthoff A. (1990), S. 65.<br />
3 Knapp K., Knapp-Potthoff A. (1990), S. 66.
Interkulturelle Kommunikation<br />
Dozentin: Dr. des. Halyna Leontiy<br />
Yves Steinebach, Maximilian Weiß, Thomas Rückert 24.03.2009<br />
Somit wird die <strong>IKK</strong> „ … als interpersonale Interaktion zwischen Angehörigen verschiedener<br />
Gruppen, die sich mit Blick auf die ihren Mitglieder jeweils gemeinsamen Wissensbeständen und<br />
sprachlichen Formen, symbolischen Handelns unterscheiden“ 4 . Infolgedessen ist der wesentliche Unterschied<br />
zur intrakulturellen Kommunikation, dass sich mindestens „ ... einer der an ihr beteiligten<br />
Kommunikationspartnern sich einer zweiten oder fremden Sprache bedienen muss“ 5 .<br />
3. Zur Beschreibung interkultureller Kommunikation<br />
Die <strong>IKK</strong> ist mehr als die konventionelle Kommunikation, aufgrund von Kulturunterschieden, dem „ …<br />
Risiko des Nichtverstehens, Missverstehens und völligen Scheiterns ausgesetzt“ 6 . Diese Probleme sind<br />
Gegenstand vielseitiger Erklärungsansätze.<br />
!<br />
3.1. Kontrastive Ansätze<br />
Verbale Dimension der Kommunikation<br />
a) Semantik: Problematik scheinbar gleichbedeutender Begrifflichkeiten, die sich allerdings in<br />
ihrer inhaltlichen Essenz unterscheiden und deshalb zur Missverständnissen führen.<br />
b) Sprechakte: „ ... können sich interkulturell hinsichtlich der Vorkommensbedingungen und<br />
der bevorzugten Realisierungsformen unterscheiden“ 7 . Damit ist die unterschiedliche Ritualisierung<br />
der Sprechakte gemeint, so folgt z.B. der Erfüllung einer Gefälligkeit im Deutschen<br />
an „Sich-Bedanken“ im japanischen „Sich-Entschuldigen“.<br />
c) Handlungssequenzen: Die oben genannte differenzierte Ritualisierung der Sprechakte findet<br />
nicht nur im gesprochen Wort, sondern auch in Handlungen Ausdruck.<br />
d) Diskurskonventionen: Verschiedene kulturspezifische Einstellungen und Werte spiegeln<br />
sich in Art und Weise der Interaktionszüge der Gesprächspartner und in deren gewählten<br />
Themen wider.<br />
Paraverbale Dimension der Kommunikation – Prosodie<br />
a) Durch kulturspezifische Eigenschaften der paraverbalen Dimension wie Intonation, Rhythmus,<br />
Lautstärke und temporale Gliederung können unterschiedliche Auffassungen über die<br />
Intention des Gesprochenen entstehen.!<br />
4 Knapp, K., Knapp-Potthoff, A. (1990), S. 66.<br />
5 Knapp, K., Knapp-Potthoff, A. (1990), S. 66.<br />
6 Knapp, K., Knapp-Potthoff, A. (1990), S. 68.<br />
7 Knapp, K., Knapp-Potthoff, A. (1990), S. 70.
Interkulturelle Kommunikation<br />
Dozentin: Dr. des. Halyna Leontiy<br />
Yves Steinebach, Maximilian Weiß, Thomas Rückert 24.03.2009<br />
Nonverbale Dimension der Kommunikation<br />
a) Ebenfalls kann es in der nonverbalen Dimension zu Missverständnissen durch falsches Interpretieren<br />
von Mimik, Gestik, Körperhaltung und Proxemik kommen. Unter Proxemik versteht<br />
man die „ … räumliche Distanz von Interaktionspartnern zueinander, […] des zu suchenden<br />
oder zu vermeidenden Blickkontaktes in der Interaktion oder Situierung und Abwicklung<br />
einer Handlung in der Dimension der Zeit“ 8 .<br />
Diese Dimensionen treten aber nie isoliert, sondern in Kombinationen auf. Des Weiteren bedingen diese<br />
sich gegenseitig, da das Fehlen oder Anderssein eines der Elemente bereits als eine Abweichung<br />
vom konventionellen Verhalten wahrgenommen wird. Die Präferenzen der einzelnen Kulturen „ …<br />
nach denen jeweils bestimmte der verschiedenen Handlungsmöglichkeiten auf den einzelnen Dimensionen<br />
bevorzugt realisiert werden“ 9 , nennt man kommunikative Stile.<br />
3.2. Interaktionistische Ansätze<br />
Im Unterschied zu dem zuletzt beschriebenen Ansatz haben interaktionistische Ansätze die Interaktion<br />
zwischen Mitgliedern verschiedener Kulturen selbst zum Gegenstand. Diese bauen bestenfalls auf die<br />
kontrastiven Untersuchungen auf. Auch versuchen die interaktionistische Ansätze in vielfacher Weise<br />
über die Beschränkungen der kontrastiven Ansätze hinauszugehen:<br />
a) Kulturelle Unterschiede müssen nicht zwangsläufig zu „… Problemen und Kommunikationskonflikten<br />
führen“ 10 , da sich diese im Zusammenhang und durch gemeinsame Ziele<br />
neutralisieren können. Hinzukommend können kulturelle Unterschiede im bestimmten Situationen<br />
und Kontexten konfliktfrei koexistieren. Dies wird durch eine höhere Sensibilität<br />
und Toleranz in Erwartung einer nicht herkömmlichen Kommunikation verstärkt.<br />
b) In der Interaktion mit Mitgliedern einer andern Kultur, finden so genannte Akkommodationsprozesse<br />
statt. Bekannte Phänomene sind Komplexitätsreduktion, Verlangsamung der<br />
Sprechgeschwindigkeit oder „foreigner talk“. Hinzu kommt, dass auch auf die spezifische<br />
Andersartigkeit des Gegenübers eingegangen wird. So kann es auch zur Assimilation stereotypischer<br />
Eigenschaften des Interaktionspartners kommen und durch wechselseitige Anpassung<br />
zur paradoxen Situationen führen.<br />
c) In Abgrenzung zur kontrastiven Ansätzen gibt es auch Phänomene interkulturellen Kontaktes,<br />
die nur interaktionistisch angegangen werden können. So z.B. die Frage was die<br />
Sprachwahl (Muttersprache, Lernsprache, linguae francae) in der Kommunikation determiniert<br />
und was für Auswirkungen ein nichtprofessioneller Dolmetscher auf die Kommunikation<br />
hat. Mangels empirischer Basis wird hier oft mit simulierten oder quasi-authentischen<br />
Daten gearbeitet.<br />
8 Knapp, K., Knapp-Potthoff, A. (1990), S. 72.<br />
9 Knapp, K., Knapp-Potthoff, A. (1990), S. 73.<br />
10 Knapp, K., Knapp-Potthoff, A. (1990), S. 75.
Interkulturelle Kommunikation<br />
Dozentin: Dr. des. Halyna Leontiy<br />
Yves Steinebach, Maximilian Weiß, Thomas Rückert 24.03.2009<br />
4. Verbesserung interkultureller Kommunikationsfähigkeit<br />
Zur Verbesserung von interkultureller Kommunikationsfähigkeit identifizieren die Autoren zwei Ansätze:<br />
4.1. Kulturspezifischer Ansatz<br />
!<br />
5. Fazit<br />
Dieser Ansatz ist weniger abstrakt und zielt auf die Vermittlung wesentlicher Kultureigenschaften<br />
und Verhaltensregeln ab. Durch die Möglichkeit einer faktischen Vermittlung ist dieser<br />
Ansatz daher leichter in das bestehende Fächerkanon einzuordnen. Dabei besteht die Gefahr<br />
von unzulässigen Generalisierungen, Vorurteilen und Stereotypisierungen sowie die<br />
Nichtberücksichtigung des historischen Wandels.<br />
4.2. Allgemein-kultureller Ansatz<br />
Der allgemein-kultureller Ansatz behandelt die abstrakt analytisch-strategischen Fähigkeiten.<br />
Diese beinhalten beispielsweise die Erklärungen kommunikativen Verhaltens aufgrund tieferliegender<br />
Kulturdeterminanten sowie die Beherrschung von Strategien zur Identifikation von<br />
Missverständnissen in der Interaktion mit Mitgliedern einer anderen Kultur. Zum erreichen<br />
dieser Ziele bedarf es fächerübergreifenden Kooperationen.<br />
Den Autoren geht es nicht um eine Assimilation anderer Denk- und Verhaltensformen, sondern um die<br />
Reduktion der Distanz zwischen verschiedenen Kulturen. Dazu müssen in ihren Augen didaktische<br />
Verfahren entwickelt werden, um die dargelegten interkulturellen Kommunikationsprobleme und -paradoxien<br />
ausräumen.<br />
6. Eigene Meinung<br />
Unserer Meinung nach kann man nicht vollständig zu dem einen oder anderen Lösungsansatz polarisieren.<br />
Der allgemein-kulturelle Ansatz sollte in jedem Fall die Basis stellen auf dem dann ein kulturspezifischer<br />
Ansatz aufbaut. Eine Kultur ist ein hochkomplexes System, daher kann ein universeller<br />
Ansatz nicht ausreichen um dieses vollständig zu verstehen. Deshalb ist zusätzlich immer noch ein tieferes<br />
Wissen über die Kultur mit der man „interagiert“ vonnöten. Die Zusammensetzung aus allgemein-kulturellem<br />
und kulturspezifischem Ansatz ist jedoch abhängig vom individuellen kulturellen<br />
Standpunkt. So ist es einfacher einen Zugang (Tendenz in Richtung allgemein-kultureller Ansatz) zu<br />
einer Kultur zu finden, die der eigenen Kultur ähnlicher ist als zu einer weiter entfernteren Kultur. Bei<br />
komplexeren kulturellen Unterschieden bedarf es daher der Hinzunahme von kulturspezifischem Wissen.<br />
Literaturverzeichnis:<br />
Foltys, C. (2006): Die Belege der Lingua Franca. in: Neue Romania, S. 1-37.<br />
Knapp, K., Knapp-Potthoff, A. (1990), Interkulturelle Kommunikation, in: Zeitschrift für Fremdsprachenforschung,<br />
S. 62-93.