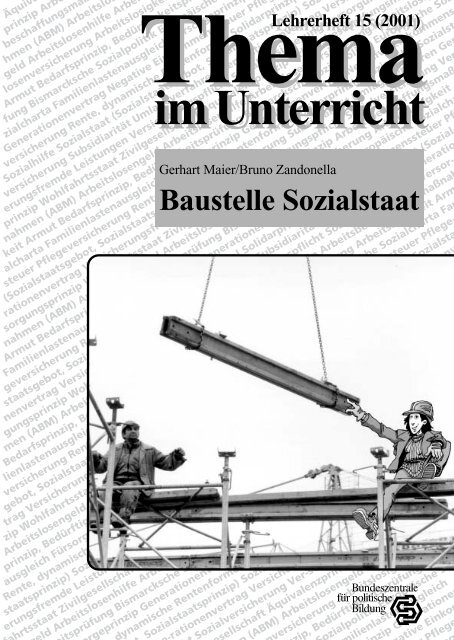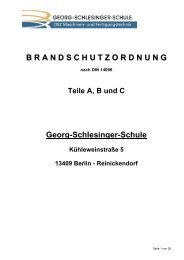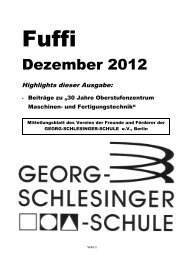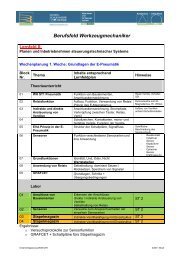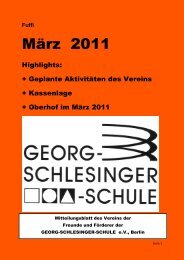Baustelle Sozialstaa.. - Georg-Schlesinger-Schule
Baustelle Sozialstaa.. - Georg-Schlesinger-Schule
Baustelle Sozialstaa.. - Georg-Schlesinger-Schule
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Thema<br />
Lehrerheft 15 15 (2001)<br />
im Unterricht<br />
Gerhart Maier/Bruno Zandonella<br />
Äquiva<br />
prinzip Arbe<br />
beschaffungsmaß<br />
hmen (ABM) Arbeitslos<br />
geld Arbeitslosenhilfe Arbeit<br />
losenversicherung Arbeitslosigkei<br />
Armut Bedarfsprinzip, Bedürftigkeitspr<br />
fung Bismarcksche Sozialpolitik Europäische<br />
zialcharta Familienlastenausgleich Fürsorgeprinzip<br />
Generationenvertrag Negative Einkommenssteuer Pfleg<br />
versicherung Rente, dynamische Rentenformel Solidarprinzip<br />
Sozialhilfe <strong>Sozialstaa</strong>t (<strong>Sozialstaa</strong>tsgebot, <strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip) Sozi<br />
versicherung Subsidiarität Umlageverfahren Generationenvertrag Versi<br />
erungsfremde Leistungen Versicherungspflicht Sozialversicherung Versorgun<br />
prinzip Wohlfahrtsstaat Zivilgesellschaft Äquivalenzprinzip Arbeitsbeschaffungsm<br />
nahmen (ABM) Arbeitslosengeld Arbeitslosenhilfe Arbeitslosenversicherung Arbeitslosi<br />
keit Armut Bedarfsprinzip, Bedürftigkeitsprüfung Bismarcksche Sozialpolitik Europäische Soz<br />
alcharta Familienlastenausgleich Fürsorgeprinzip Generationenvertrag Negative Einkommens<br />
steuer Pflegeversicherung Rente, dynamische Rentenformel Solidarprinzip Sozialhilfe Sozialst<br />
(<strong>Sozialstaa</strong>tsgebot, <strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip) Sozialversicherung Subsidiarität Umlageverfahren Gen<br />
rationenvertrag Versicherungsfremde Leistungen Versicherungspflicht Sozialversicherung Ver<br />
sorgungsprinzip Wohlfahrtsstaat Zivilgesellschaft Äquivalenzprinzip Arbeitsbeschaffungsmaß<br />
nahmen (ABM) Arbeitslosengeld Arbeitslosenhilfe Arbeitslosenversicherung Arbeitslosigkeit<br />
Armut Bedarfsprinzip, Bedürftigkeitsprüfung Bismarcksche Sozialpolitik Europäische Sozialch<br />
Familienlastenausgleich Fürsorgeprinzip Generationenvertrag Negative Einkommenssteuer Pf<br />
geversicherung Rente, dynamische Rentenformel Solidarprinzip Sozialhilfe <strong>Sozialstaa</strong>t (Sozial<br />
staatsgebot, <strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip) Sozialversicherung Subsidiarität Umlageverfahren Generatio<br />
nenvertrag Versich-erungsfremde Leistungen Versicherungspflicht Sozialversicherung Versorgungsprinzip<br />
Wohlfahrtsstaat Zivilgesellschaft Äquivalenzprinzip Arbeitsbeschaffungsmaßnah<br />
men (ABM) Arbeitslosengeld Arbeitslosenhilfe Arbeitslosenversicherung Arbeitslosigkeit Arm<br />
Bedarfsprinzip, Bedürftigkeitsprüfung Bismarcksche Sozialpolitik Europäische Sozialcharta Fam<br />
lienlastenausgleich Fürsorgeprinzip Generationenvertrag Negative Einkommenssteuer Pflegeversicherung<br />
Rente, dynamische Rentenformel Solidarprinzip Sozialhilfe <strong>Sozialstaa</strong>t (Sozialsta<br />
gebot, <strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip) Sozial-versicherung Subsidiarität Umlageverfahren Genera-tionenv<br />
trag Versicherungsfremde Leistungen Versicherungspflicht Sozialversicherung Ver-sorgungsp<br />
zip Wohlfahrtsstaat Zivilgesellschaft Äquivalenzprinzip Arbeits-beschaffungsmaßnahmen (AB<br />
Arbeitslosengeld Arbeitslosenhilfe Arbeits-losenversicherung Arbeitslosigkeit Armut Bedarfsprinzip,<br />
Bedürftigkeitsprüfung Bismarcksche Sozialpolitik Europäische Sozialcharta Familienla<br />
ausgleich Fürsorgeprinzip Generationenvertrag Negative Einkommenssteuer Pflege-versicheru<br />
Rente, dynamische Rentenformel Solidarprinzip Sozialhilfe <strong>Sozialstaa</strong>t (<strong>Sozialstaa</strong>tsgebot, Soz<br />
staatsprinzip) Sozial-versicherung Subsidiarität Umlageverfahren Gene-rationenvertrag Versic<br />
erungsfremde Leistungen Versicherungspflicht Sozialversicherung Versorgungsprinzip Wohlrtsstaat<br />
Zivilgesellschaft Äquivalenzprinzip Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) Arbeit<br />
ld Arbeitslosenhilfe Arbeitslosenversicherung Arbeitslosigkeit Armut Bedarfsprinzip,<br />
sprüfung Bismarcksche Sozialpolitik Europäische Sozi-alcharta Familienlastenaus<br />
geprinzip Generationenvertrag Negative Einkommenssteuer Pflege-versiche<br />
ynamische Rentenformel Solidarprinzip Sozialhilfe <strong>Sozialstaa</strong>t (Sozial<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip) Sozialversicherung Subsidiarität Umlageverrationenvertrag<br />
Versicherungsfremde Leistungen Versiche-<br />
Sozialversicherung Ver-sorgungsprinzip Wohlfahrtsellschaft<br />
Äquivalenzprinzip Arbeitsbeschaffungs<br />
(ABM) Arbeitslosengeld Arbeitslosenhilfe<br />
ersicherung Arbeitslosigkeit Armut<br />
p, Bedürftigkeitsprüfung Biszialpolitik<br />
Europäische Soz<br />
ilienlastenausgleich<br />
zip Generatione<br />
tive Einkom<br />
flege<br />
<strong>Baustelle</strong> <strong>Sozialstaa</strong>t
Inhalt<br />
Einführung: <strong>Sozialstaa</strong>t in der Krise _____________________________________ 3<br />
Baustein A:<br />
Ohne <strong>Sozialstaa</strong>t geht es nicht ___________________________________________ 7<br />
Baustein B:<br />
Arbeitslosigkeit - eine Herausforderung für den <strong>Sozialstaa</strong>t ____________________ 11<br />
Baustein C:<br />
Zur Zukunft der Rente - Hält der Gernerationsvertrag? _______________________ 16<br />
Baustein D:<br />
Trotz Sozialhilfe: Armut in Deutschland ___________________________________ 21<br />
Baustein E:<br />
Die Zukunft des <strong>Sozialstaa</strong>tes ___________________________________________ 27<br />
Literaturhinweise ____________________________________________________ 31<br />
Zu diesem Lehrerheft gibt es ein Arbeitsheft für Schülerinnen und Schüler. Das können Sie<br />
(auch im Klassensatz) kostenlos und portofrei bei unserer Versandstelle beziehen unter der Bestell-Nr.<br />
5.331.<br />
Franzis print & media, Postfach 150740, 80045 München<br />
infoservice@franzis-online.de, Fax: 0 89 / 5172 92<br />
Selbstverständlich können Sie kostenlos für jeden Schüler ein eigenes Exemplar des Arbeitsheftes<br />
zugeschickt bekommen. Um Portokosten zu sparen, bitten wir jedoch um Sammelbestellungen<br />
auf einer Postkarte oder per Bestellzettel. Vielen Dank!<br />
„Thema im Unterricht“ (Lieferbar, solange der Vorrat reicht)<br />
2: Parteien, Bürger und Wahlen (Neudruck 2000)<br />
Lehrerheft im Internet: www.bpb.de 5.303 (Arbeitsheft)<br />
(➟ Online-Publikationen)<br />
5: Europa für Einsteiger (Neudruck 1998)<br />
Lehrerheft vergriffen 5.307 (Arbeitsheft)<br />
10: Die öffentliche Meinung (1996)<br />
Bestell-Nr.: 5.318 (Lehrerheft) und 5.319 (Arbeitsheft)<br />
11: Menschenwürde, Menschenrechte (1997)<br />
Bestell-Nr.: 5.320 (Lehrerheft) und 5.321 (Arbeitsheft)<br />
12: Nahaufnahme Bundestag (Neudruck 2000)<br />
Lehrerheft im Internet: www.bpb.de 5.323 (Arbeitsheft)<br />
(➟ Online-Publikationen)<br />
13: Was ist Politik? (1998)<br />
Bestell-Nr.: 5.326 (Lehrerheft) und 5.327 (Arbeitsheft)<br />
14: Nord und Süd – Eine Welt? (1998)<br />
Bestell-Nr.: 5.328 (Lehrerheft) und 5.329 (Arbeitsheft)<br />
15: <strong>Baustelle</strong> <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
Bestell-Nr.: 5.330 (Lehrerheft) und 5.331 (Arbeitsheft)<br />
Thema im Unterricht EXTRA<br />
Grundgesetz für Einsteiger<br />
Bestell-Nr.: 5.317 (Arbeitsmappe)<br />
Methoden-Kiste<br />
Bestell-Nr.: 5.350 (24 Karteikarten)<br />
2<br />
Bei Franzis gibt es auch eine aktuelle Liste der lieferbaren Unterrichtsmaterialien.<br />
an: Franzis-Druck, Postfach 150740, 80045 München.<br />
✂ --------------------------------------------------------------------<br />
Name:<br />
Straße:<br />
PLZ und Ort:<br />
Impressum<br />
Herausgegeben von der Bundeszentrale<br />
für politische Bildung, 53111 Bonn,<br />
Berliner Freiheit 7<br />
www.bpb.de<br />
Manuskript:<br />
Prof. i.R. Gerhart Maier, Esslingen und<br />
Bruno Zandonella, Stuttgart<br />
Redaktion:<br />
Iris Möckel (verantw.)<br />
Titelbild:<br />
Foto: Photopool, Lisa: ZAMAS.<br />
Graphische Gestaltung:<br />
Werbeagentur Rechl, Wanfried-Aue.<br />
Druck:<br />
Mitteldeutsche Druckanstalt, Heidenau.<br />
Zu diesem Lehrerheft gehört ein<br />
Arbeitsheft, das Sie bestellen können bei:<br />
infoservice@franzis-online.de<br />
Fax: 0 89 / 51 52 92 (siehe Kasten links)<br />
Der Text kann in <strong>Schule</strong>n zu<br />
Unterrichtszwecken vergütungsfrei<br />
vervielfältigt werden.<br />
Auflage des Arbeitsheftes:<br />
100.000 Exemplare<br />
Auflage des Lehrerheftes:<br />
30.000 Exemplare<br />
Redaktionsschluss: Januar 2001<br />
ISSN 0944-8349<br />
Hinweise der Redaktion<br />
Querverweise im folgenden Text:<br />
Die fettgedruckten Angaben in Klammern<br />
(z. B. C4) beziehen sich auf die<br />
Materialien im Arbeitsheft. Bestellmöglichkeit<br />
siehe links.<br />
Rechtschreibung:<br />
Wir haben bei Zitaten und Quellen<br />
Dritter die jeweilige Originalversion<br />
beibehalten. Das bedeutet, je nach Erscheinungsdatum<br />
finden Sie alte oder<br />
neue Rechtschreibung vor.<br />
Neu ab Dezember 2000<br />
Methoden-Kiste Bestell-Nr. 5.350<br />
Karteikarten mit Beschreibungen verschiedener<br />
methodischer Vorschläge<br />
für einen lebendigen (Politik-)Unterricht.<br />
Themenblätter im Unterricht<br />
Nr. 1: Menschliche Embryonen als Ersatzteillager?<br />
Bestell-Nr. 5.351<br />
Nr. 2: Die Öko-Steuer in der<br />
Diskussion. Bestell-Nr. 5.352<br />
Nr. 3: Was wissen Sie eigentlich vom<br />
Bundestag?/Was aus unserem<br />
Bundesstaat werden könnte und<br />
was nicht. Bestell-Nr. 5.353<br />
Zu bestellen bei Franzis (siehe links)
Einführung<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t in der Krise<br />
1. Der <strong>Sozialstaa</strong>t ist unbestreitbar ins Gerede<br />
gekommen. Wissenschaftler, Politiker<br />
und Verbandsvertreter betonen,<br />
dass der deutsche <strong>Sozialstaa</strong>t reformbedürftig<br />
sei. Freilich ist die Kritik<br />
nicht neu: „Seit es ihn gibt, ist der <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
umstritten, und zwar paradoxerweise<br />
nicht nur bei denjenigen, die<br />
zu seiner Finanzierung beitragen, ohne<br />
von den Leistungen zu profitieren, sondern<br />
auch bei vielen seiner Nutznießer“.<br />
(Butterwegge, Christoph: Wohlfahrtsstaat im<br />
Wandel, Opladen (Leske + Budrich) 1999,<br />
S.9).<br />
2. Zahlreiche Länder, deren Sozialwesen<br />
früher als beispielhaft galt, haben inzwischen<br />
ihre Sozialleistungen eingeschränkt<br />
oder befinden sich mitten im<br />
Umbau ihres sozialstaatlichen Systems.<br />
Das Ziel solcher Reformen ist<br />
es, den <strong>Sozialstaa</strong>t an die neuen ökonomischen<br />
Bedingungen anzupassen, ohne<br />
dessen bewährte Schutzfunktion für<br />
die sozial schwächeren Gruppen der<br />
Bevölkerung aufzugeben.<br />
3. Spätestens seit den achtziger Jahren hat<br />
die Diskussion über die Krise des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
auch Deutschland erfasst -<br />
verstärkt seit 1990, als hohe Belastungen<br />
der Sozialversicherungen und des<br />
Staatshaushaltes durch die Wiedervereinigung<br />
hinzugekommen sind. (vgl.<br />
Baustein E) Erweist sich also der<br />
deutsche <strong>Sozialstaa</strong>t als eine „Schönwettereinrichtung“,<br />
die in Krisen nicht<br />
funktionsfähig ist? „Deutschland wird<br />
um eine grundsätzliche Debatte über<br />
die zukünftige Ordnung des <strong>Sozialstaa</strong>ts<br />
nicht herumkommen. Jeder Versuch,<br />
diese Debatte zu verhindern [...]<br />
wird die externen Schocks, die auf die<br />
Bundesrepublik durchschlagen, verstärken<br />
und uns immer weniger in den<br />
Stand versetzen, eine zukunftsfähige<br />
Antwort auf die Veränderungen in der<br />
Welt um uns herum zu formulieren.“<br />
(Rüdiger von Voss; in: Bundesverband deutscher<br />
Banken (Hg.): Dem Land Richtung geben,<br />
Köln 1999, S. 39).<br />
4. Die Kritik am traditionellen <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
hat vier Stoßrichtungen:<br />
a) Der <strong>Sozialstaa</strong>t sei nicht länger finanzierbar:<br />
„Der <strong>Sozialstaa</strong>t ist zum<br />
Kostentreiber geworden [...] Das<br />
verteuert die Arbeit durch dauernd<br />
steigende Sozialbeiträge. Die daraus<br />
folgende Arbeitslosigkeit belastet<br />
und entwertet die sozialen Sicherungseinrichtungen“<br />
(Hans D. Barbier; in: Frankfurter Allgemeine<br />
Zeitung vom 8. August 1996, S. 1). (vgl. E 3).<br />
b) Der <strong>Sozialstaa</strong>t helfe nicht hinreichend<br />
den tatsächlich Bedürftigen<br />
(Stichwort: „neue Armut“). „Der<br />
Staat ist ein einziger Verschiebebahnhof,<br />
aber von Jahr zu Jahr ist<br />
das Vermögen ungleichmäßiger verteilt“.<br />
(Roger de Weck; in: DIE ZEIT vom 17. Oktober<br />
1997, S. 1).<br />
c) Der <strong>Sozialstaa</strong>t ersticke Eigenverantwortung,<br />
Eigenvorsorge und eigene<br />
Initiativen. Kritisiert wird, dass<br />
sich durch staatliche Bevormundung<br />
und „Rundumversicherung“ eine<br />
„Vollkaskomentalität“ herausgebildet<br />
habe.<br />
d) Schließlich wird auf die Gefahr hingewiesen,<br />
dass durch überzogene<br />
Eingriffe in das Marktgeschehen<br />
und eine Überbetonung des Faktors<br />
„sozial“ die „Soziale Marktwirtschaft“<br />
beschädigt werden könne.<br />
5. Die Gründe der Krise sind vielfältig:<br />
a) Interne Mängel des <strong>Sozialstaa</strong>tes:<br />
- permanente Kostensteigerung<br />
- Überforderung der sozialen Sicherungssysteme<br />
und des Staatshaushaltes<br />
- Lebensstandardwahrung<br />
- Versorgungsmentalität<br />
- Mitnahmeeffekte (Korrumpierung)<br />
- Verschärfung des Gefälles zwischen<br />
Reich und Arm<br />
- Entstehung eines neuen Subproletariats<br />
(Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende<br />
und andere Marginalisierte)<br />
- Umverteilung von unten nach oben<br />
- aufgeblähter Apparat (Bürokratie)<br />
b) Externe Einflüsse:<br />
-Wertewandel in der Gesellschaft<br />
- Individualisierung und Entsolidarisierung<br />
- Globalisierung<br />
- Wandel der Arbeitswelt<br />
- demografische Veränderungen<br />
- größere Nachfrage nach Arbeitsplätzen<br />
(höhere Beschäftigungsquote)<br />
- hohe Staatsverschuldung)<br />
- Produktivitätszuwächse<br />
- Marktsättigung<br />
- Vereinigungsfolgen („Erblast“ und<br />
Transformationsprozess).<br />
6. Im Unterricht ist die Darstellung aller<br />
Bereiche und Probleme des <strong>Sozialstaa</strong>ts<br />
unzweckmäßig und aus Zeitgründen<br />
auch nicht realisierbar. Sinnvoll<br />
ist vielmehr ein exemplarisches<br />
Vorgehen; für das Schülerheft wurden<br />
deshalb die zentralen Problembereiche<br />
Arbeitsmarktpolitik, Sozialhilfe und<br />
Rentenreform (Baustein B, C und D)<br />
ausgewählt. An diesen Beispielen können<br />
sowohl die Funktionen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
als auch die wachsenden Probleme<br />
und Herausforderrungen hinreichend<br />
dargestellt werden. Die thematisierten<br />
Bereiche sind auch im Hinblick<br />
auf die Prinzipien des <strong>Sozialstaa</strong>ts -<br />
Sozialversicherung, staatliche Fürsorge<br />
und gesellschaftliche Solidarität - exemplarisch.<br />
Bei den Lösungsvorschlägen und den<br />
Reformansätzen haben sich Redaktion<br />
und Autoren ebenfalls auf eine Auswahl<br />
beschränkt; der gründlichen Analyse<br />
einiger ausgewählter Vorschläge<br />
und ihrer möglichen Folgen für die<br />
Gesellschaft ist zweifellos der Vorzug<br />
gegenüber einer bloß oberflächlichen<br />
Diskussion möglichst vieler Ansätze<br />
zu geben.<br />
7. Andererseits erschien es unumgänglich,<br />
wenigstens Grundinformationen in einigen<br />
Bereichen der Sozialpolitik auch<br />
in einem Heft, das sich schwerpunktmäßig<br />
mit der Krise des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
und den Vorschlägen zu seiner Reform<br />
auseinandersetzt, anzubieten. Nur aus<br />
der Kenntnis des bestehenden sozialen<br />
Sicherungssystems und aus der Auseinandersetzung<br />
mit diesem können<br />
Probleme des <strong>Sozialstaa</strong>tes erkannt<br />
und Reformvorschläge kritisch analysiert<br />
und bewertet werden.<br />
8. Auf folgende Aspekte und Themenkreise<br />
musste aus Platzgründen und wegen<br />
der erforderlichen Reduktion des umfangreichen<br />
Themas für die Belange<br />
des Unterrichts verzichtet werden:<br />
- Europäische Sozialpolitik<br />
- Sozialpolitik im weiteren Sinne (Bildung,<br />
Familie, Jugend)<br />
- unterschiedliche Positionen der politischen<br />
Parteien zum Umbau des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
- Zielsetzungen und Einfluss der Verbände<br />
- Steuerpolitik („Umverteilung“) u.a.<br />
„Umbau“, nicht „Abbau“<br />
1. Die Leistungen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
sind unbestritten; seine Erfolgsgeschichte<br />
währt inzwischen über 100 Jahre; er hat<br />
die beiden Weltkriege und mehrere Regimewechsel<br />
relativ unbeschädigt überdauert<br />
und wurde nach 1945 sogar in bemerkenswertem<br />
Umfang ausgebaut und zum<br />
Kernelement der Sozialen Marktwirtschaft.<br />
Der Weg des deutschen <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
von der Armenfürsorge zum Garanten<br />
der sozialen Sicherheit ist beispiellos.<br />
Deutschland wurde für viele andere Staaten<br />
wegen seines Sozialsystems zum<br />
Vorbild. „Der Wohlfahrtsstaat ist die bisher<br />
letzte große kulturelle Leistung der<br />
(West-)Europäer. Wer ihn untergehen<br />
ließe, der würde massenpsychologisch die<br />
politischen Grundlagen der Demokratie<br />
gefährden“.<br />
(Helmut Schmidt; in: DIE ZEIT vom 30. März<br />
2000, S.8).<br />
3
2. Folgende Wesensmerkmale des deutschen<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tes verdienen eine besondere<br />
Hervorhebung<br />
- Konsensgesellschaft („innerer Frieden“);<br />
Stabilitäts-Anker <strong>Sozialstaa</strong>t;<br />
Solidargemeinschaft<br />
- Korrelation zwischen Demokratie<br />
und <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
- soziale Teilhabe: Anspruch des Einzelnen<br />
auf soziale Leistungen<br />
- Sicherung eines Existenzminimums:<br />
Verhinderung unerträglicher Armut<br />
- Verhinderung von „Armutskriminalität“<br />
(anders: USA, Russland).<br />
3. Deshalb dürfen ökonomische „Sachzwänge“<br />
nicht als alleinige Richtschnur<br />
für den Umbau des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
herausgestellt werden. Vielmehr<br />
sind sozialer Frieden und gesellschaftliche<br />
Stabilität als wichtige Faktoren in<br />
der Standortdiskussion - und als Leistungen<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes - im Unterricht<br />
zu betonen. „Es geht nicht um einen<br />
schlanken Staat generell, sondern<br />
um einen besseren Staat, der zudem eine<br />
soziale Grundsicherung und soziale<br />
Teilhabe sichert“<br />
(Heinze, Rolf G. u.a.: Vom Wohlfahrtsstaat<br />
zum Wettbewerbsstaat, Opladen (Leske + Budrich)<br />
1999, S.215).<br />
„Ohne Sicherheit ist Flexibilisierung<br />
eine Strategie, die ihre eigenen Potenzen<br />
nicht ausschöpft und die Gesellschaft<br />
weiter spaltet. Viele Neoliberale<br />
haben immer noch nicht begriffen,<br />
dass vor allem der Wohlfahrtsstaat das<br />
Fundament für intelligente Deregulierung<br />
schafft. Gerade dort liegen im<br />
übrigen auch die Chancen europäischer<br />
Länder, einen erfolgreicheren<br />
Politik und Unterricht 1991/4, S.24.<br />
4<br />
und stabileren Modernisierungspfad<br />
einzuschlagen als die USA“<br />
(Heinze, Rolf G. u.a.: Vom Wohlfahrtsstaat<br />
zum Wettbewerbsstaat, Opladen (Leske + Budrich)<br />
1999, S.217).<br />
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik<br />
haben also den Strukturwandel so zu<br />
gestalten, dass die zukünftige Gesellschaft<br />
nicht in Arm und Reich gespalten<br />
wird; ihr Leitbild muss vielmehr<br />
im Sinne der sozialen Marktwirtschaft<br />
eine Gesellschaft des „Wohlstands für<br />
alle“ sein.<br />
4. Andererseits gilt: Mannigfaltige Herausforderungen<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>ts und<br />
seiner Sicherungssysteme, die offensichtliche<br />
Krise des <strong>Sozialstaa</strong>ts zeigen,<br />
dass Handlungsbedarf besteht; die<br />
bloße Fortsetzung der tradierten Sozialpolitik<br />
führt in die Sackgasse. Die<br />
Reform des <strong>Sozialstaa</strong>tes muss alle seine<br />
Aspekte auf den Prüfstand stellen,<br />
und der Umbau erfordert auch den<br />
Verzicht auf viele Besitzstände.<br />
5. Es kann nicht die Aufgabe des Politikunterrichts<br />
im besonderen und der<br />
<strong>Schule</strong> im allgemeinen sein, einer Aufkündigung<br />
des Solidarpakts in unserem<br />
Gemeinwesen das Wort zu reden<br />
und einseitig für einen radikalen Neoliberalismus<br />
die Werbetrommel zu<br />
rühren. Es ist vielmehr notwendig,<br />
dass im Unterricht die Gefahren einer<br />
entsolidarisierten Gesellschaft und des<br />
Verzichts auf soziale Gerechtigkeit<br />
aufgezeigt werden.<br />
„In wohlhabenden und immer noch<br />
reicher werdenden Volkswirtschaften ist<br />
es eine Frage der Menschenwürde und<br />
Menschenrechte, also auch ein verfas-<br />
sungsrechtliches Problem, ob der arbeitsteilig<br />
produzierte Reichtum nicht immer<br />
ungleicher verteilt wird, sondern Teile der<br />
Gesellschaft auf ein menschenunwürdiges<br />
sozialökonomisches Niveau heruntergestoßen<br />
werden ..... Wenn in einer wohlhabenden<br />
Volkswirtschaft aufgrund unzulänglicher<br />
Arbeitseinkommen soziale<br />
Armut entsteht, gar noch parallel zum gesamtwirtschaftlichen<br />
Wachstum zunimmt...,<br />
so mag das zwar als beschäftigungspolitischer<br />
„Erfolg“ gelobt werden,<br />
signalisiert aber zugleich den Rückfall in<br />
vorsozialstaatliche Konstellationen“.<br />
(Karl <strong>Georg</strong> Zinn; in: Aus Politik und Zeitgeschichte<br />
B 14-15/99 vom 2. April 1999, S.6 und<br />
S.11).<br />
Freilich darf dabei die Realität einer<br />
fortschreitenden Individualisierung und<br />
eines zunehmenden Verlusts an Solidarität<br />
nicht vertuscht werden; diese Entwicklungen<br />
müssen vielmehr Gegenstand<br />
des Unterrichts sein und auf ihre möglichen<br />
Konsequenzen hin befragt werden.<br />
Die Aufgabe der <strong>Schule</strong><br />
1. Theoretische und abstrakte Wissensvermittlung<br />
über die Errungenschaften<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes sind zu vermeiden.<br />
Der Unterricht muss vielmehr von den<br />
Schülerinnen und Schülern ausgehen.<br />
Die Jugendlichen sind in mehrfacher<br />
Hinsicht von dem Wandlungsprozess,<br />
in welchem sich die soziale Ordnung<br />
in Deutschland befindet, betroffen:<br />
● Sie und ihre Familien sind in das bestehende<br />
soziale Netz eingebettet; sie<br />
nehmen - ohne dass ihnen das in jedem<br />
Fall bewusst wird - ständig Leistungen<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes entgegen (Kindergeld,<br />
Fahrpreisermäßigungen, Lehrmittelfreiheit,<br />
Regelungen des Jugendschutzes<br />
usw.; vgl. Baustein A)<br />
● Auch Jugendliche haben Erfahrungen<br />
mit der Beschäftigungskrise und dem<br />
Wandel der Arbeitswelt sowie mit der<br />
Aushöhlung von Normalarbeitsverhältnissen<br />
und den Auswirkungen der Globalisierung.<br />
Bei Befragungen wird der<br />
hohe Stellenwert, den ein hinreichendes<br />
Lehrstellenangebot und ein gesicherter<br />
Arbeitsplatz in ihrer Werteskala<br />
einnehmen, immer wieder deutlich.<br />
● Sozialpolitische Reformen, welche<br />
darauf abzielen, die Funktionsfähigkeit<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes zu erhalten und auszubauen,<br />
haben unmittelbare Auswirkungen<br />
auf die zukünftige Lebenswelt<br />
der Schülerinnen und Schüler. Deshalb<br />
müssen bei der unterrichtlichen Beschäftigung<br />
mit dem <strong>Sozialstaa</strong>t vor allem<br />
Themen wie das Generationenproblem<br />
bei der Rentenversicherung, die<br />
Finanzierung des Gesundheitswesens
und Maßnahmen zu einer aktiven und<br />
aktivierenden Arbeitsmarktpolitik<br />
erörtert werden.<br />
● Schließlich dürfen auch die Forderung<br />
der Jugendlichen nach sozialer Gerechtigkeit<br />
und ihre Bereitschaft zum<br />
sozialen Engagement nicht unterschätzt<br />
werden, wenn es um den Umbau<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes geht. Erfahrungsgemäß<br />
interessieren sie sich sehr für<br />
die Gestaltung einer „Bürgergesellschaft“<br />
und Tätigkeiten, bei welchen<br />
sie soziale Kompetenz erwerben können.<br />
(vgl. Baustein E)<br />
2. Der Unterricht soll zunächst und vor allem<br />
Kenntnisse hinsichtlich der Bedeutung<br />
und der Funktionen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
vermitteln. „Unter funktionalen<br />
Gesichtspunkten lassen sich vier<br />
grundlegende Aufgaben des modernen<br />
Wohlfahrtsstaates identifizieren:<br />
● die Schutzfunktion (durch kollektive<br />
Sicherung gegen die Risiken der Industriegesellschaft),<br />
● die Verteilungs- und Umverteilungsfunktion<br />
(durch Eingriffe etwa in die<br />
Primäreinkommen),<br />
● die Produktivitätsfunktion (durch Erhaltung<br />
und Förderung des Faktors Arbeit)<br />
sowie<br />
● die gesellschaftspolitische Funktion<br />
(durch Integration und Legitimation).“<br />
(Heinze, Rolf G. u.a.: Vom Wohlfahrtsstaat<br />
zum Wettbewerbsstaat, Opladen (Leske + Budrich)<br />
1999, S. 15.)<br />
Christoph Butterwegge nennt drei wesentliche<br />
Aspekte von <strong>Sozialstaa</strong>tlichkeit:<br />
„1.ein Höchstmaß an sozialer Sicherheit<br />
für alle Gesellschaftsmitglieder ...;<br />
2. ein Mindestmaß an sozialer Gerechtigkeit<br />
(im Sinne von Bedarfs- und Leistungsgerechtigkeit),<br />
3. das Streben nach sozialer Gleichheit<br />
(Ausgleich der Einkommens- und Vermögensunterschiede).<br />
Die geforderte Nivellierung bestehender<br />
Unterschiede bedeutet nicht Überkompensation,<br />
sondern die Vermeidung einer<br />
Spaltung der Gesellschaft in Arm und<br />
Reich mit den daraus fast zwangsläufig erwachsenden<br />
Problemen wie zunehmende<br />
Perspektivlosigkeit der Jugend, (Gewalt)<br />
Kriminalität, Verwahrlosung, Sittenverfall,<br />
Steigen der Suizidquote, weiter um sich<br />
greifender Drogensucht usw.“<br />
(Butterwegge, Christoph: Wohlfahrtsstaat im<br />
Wandel, Opladen (Leske + Budrich) 1999,<br />
S.15.)<br />
4. Die Schülerinnen und Schüler müssen<br />
die aktuellen Herausforderungen des<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tes beschreiben und gewichten<br />
können und den Reformbedarf<br />
erkennen. Im Vordergrund stehen<br />
dabei der Wandel der Bevölkerungs-<br />
struktur, das veränderte Wertesystem<br />
(Tendenz zur Entsolidarisierung, Auflösung<br />
traditioneller Bindungen,<br />
Emanzipationsprozesse) und die durch<br />
die Europäisierung und die Globalisierung<br />
bedingte Veränderungen ökonomischer<br />
und gesellschaftlicher Strukturen.<br />
5. Schließlich müssen Reformvorschläge<br />
im Unterricht kritisch analysiert werden;<br />
das Pro und Contra zu einzelnen<br />
Vorschlägen ist zu erarbeiten. Dabei<br />
sollen die Schülerinnen und Schüler<br />
die Standortgebundenheit der Reformansätze<br />
identifizieren. „Häufig bleiben<br />
die hinter (...) Vorschlägen zum reformerischen<br />
Um- bzw. Abbau des Wohlfahrtsstaates<br />
verborgenen Interessen<br />
sehr (einfluss)reicher Gesellschaftsgruppen<br />
unerwähnt, obwohl sie erklären<br />
könnten, warum das Soziale<br />
verstärkt unter Druck gerät“.<br />
(Butterwegge, Christoph: Wohlfahrtsstaat im<br />
Wandel, Opladen (Leske + Budrich) 1999, S.9)<br />
6. Die Schülerinnen und Schüler müssen<br />
befähigt werden, einseitige und monokausale<br />
Erklärungen für die Krise des<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tes und allzu einfache oder<br />
realitätsferne Konzepte für die Lösung<br />
dieser Krise zu durchschauen und<br />
zurück zu weisen. Eindimensionale<br />
Ursachenbeschreibungen und Lösungsansätze<br />
taugen nicht für das Verständnis<br />
der aktuellen Herausforderungen<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>ts und seiner Sicherungssysteme;<br />
sie verstellen vielmehr<br />
die Möglichkeit einer angemessenen<br />
Beurteilung durch die Schülerinnen<br />
und Schüler. „Holzschnittartige Abbilder<br />
dieser Welt geben die Realität<br />
nicht wieder“.<br />
(Wolfgang Roth; in Süddeutsche Zeitung vom<br />
24. Dezember 1999, S.4)<br />
Insbesondere ist davor zu warnen, die<br />
Höhe der Lohn- und Lohnnebenkosten<br />
vorrangig für die aktuellen Probleme des<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tes verantwortlich zu machen.<br />
Zahlreiche Autoren weisen darauf hin,<br />
dass gerade die Personalkosten eher<br />
zweitrangig seien und andere Ursachen<br />
stärker zu gewichten seien; hier sind<br />
zunächst die Folgen der Globalisierung,<br />
die fortschreitende Rationalisierung im<br />
Produktions- und Dienstleistungsbereich<br />
mit ihren Auswirkungen auf die Beschäftigungssituation<br />
sowie der gesellschaftliche<br />
Desintegrationsprozess und der Wertewandel<br />
in der Gesellschaft - Individualisierung,<br />
Funktionsverlust der Familie und<br />
Entsolidarisierungsprozesse - zu nennen.<br />
Der deutsche <strong>Sozialstaa</strong>t leidet zudem unter<br />
den Auswirkungen der Wiedervereinigung,<br />
dem von Politik und Wirtschaftsverbänden<br />
zu verantwortendem Reformstau<br />
in den vergangen Jahren und einem<br />
hohen Maß an Reglementierung und<br />
Bürokratisierung.<br />
Für die Sozial- und Arbeitsmarktpolitik<br />
ist besonders die Bedeutung der Globalisierung<br />
hervorzuheben. Im Wettlauf<br />
um die günstigsten Standortbedingungen<br />
für multinationale Konzerne verlieren die<br />
Nationalstaaten ihre sozialpolitische Souveränität,<br />
weil die Sozialpolitik zu einer<br />
Typen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
Der liberale oder angelsächsische <strong>Sozialstaa</strong>tstypus beinhaltet einen vergleichsweise<br />
geringen Grad an arbeitsmarktpolitischen Regulierungen. Zugleich kombiniert<br />
er vergleichsweise niedrige Leistungsniveaus in den staatlichen Sicherungssystemen<br />
mit umfangreichen Fürsorgeleistungen und großer Verarbeitung individueller Bedürftigkeitsprüfungen.<br />
Soziale Sicherung ist damit nahezu ausschließlich auf den<br />
Schutz vor Armut beschränkt, während weitergehende Sicherungsbedürfnisse an den<br />
freien Markt verwiesen sind. Der sozialdemokratische oder skandinavische <strong>Sozialstaa</strong>ttypus<br />
umfasst universalistisch ausgerichtete, primär steuerfinanzierte Sicherungssysteme<br />
mit hohem Sicherungsniveau, bei denen das Ziel der Armutsbekämpfung<br />
mit dem der Lebensstandardsicherung verknüpft ist. Der hohe Stellenwert des<br />
Ziels einer Integration in den Arbeitsmarkt verbindet weitgehende Sicherungsrechte<br />
mit entsprechenden Pflichten zur Teilnahme am Beschäftigungssystem.<br />
Der konservative oder kontinentaleuropäische Sozial- bzw. Wohlfahrtsstaat, dem<br />
auch die Bundesrepublik zuzurechnen ist, weist ebenfalls ein hohes Leistungsniveau<br />
sozialer Sicherung auf und verbindet das Ziel der Lebensstandardsicherung gleichermaßen<br />
mit dem der Armutsverhinderung. Dabei bilden lohnarbeitszentrierte und beitragsfinanzierte<br />
Sozialversicherungssysteme den Kernbereich sozialer Sicherung.<br />
Diese werden ergänzt durch weitgehende Regulierungen des Arbeitsmarkts durch<br />
den Staat und die Sozialpartner. Wenn heute [...] über die Zukunft des <strong>Sozialstaa</strong>ts<br />
im Zeitalter der Globalisierung diskutiert wird, so steht zumeist die Frage im Vordergrund,<br />
ob und inwieweit die kontinentaleuropäische und/oder die skandinavische Variante<br />
von <strong>Sozialstaa</strong>tlichkeit unter den veränderten weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen<br />
noch eine Zukunft hat; demgegenüber steht die Vereinbarkeit des angelsächsischen<br />
Modells mit einer globalisierten Wirtschaft in der Regel außer Frage.<br />
Hanesch, Walter: Der <strong>Sozialstaa</strong>t in der Globalisierung; in: Aus Politik und Zeitgeschichte,<br />
B 49/99 vom 3. Dezember 1999, S.3f.<br />
5
Funktion der dem globalen Wettbewerb<br />
ausgesetzten Kostenkalkulation wird.<br />
(vgl. Heinze, Rolf G.u.a. (1999), S.42)<br />
Den Schülerinnen und Schülern ist die<br />
Einsicht in die Notwendigkeit des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
zu vermitteln. <strong>Sozialstaa</strong>t und Sozialpolitik<br />
dürfen nicht zu einer Funktion,<br />
einem störenden Anhängsel der Standortfrage<br />
und der wirtschaftlichen Effizienz<br />
degenerieren. Vielmehr muss die Eigenständigkeit<br />
des Sozialen im politischen<br />
Entscheidungsprozess herausgestellt werden:<br />
Der Unterricht muss zeigen, dass <strong>Sozialstaa</strong>tlichkeit<br />
das unverzichtbare Fundament<br />
einer humanen, demokratischen<br />
und stabilen Gesellschaft bildet.<br />
Hinweise zum Einsatz des<br />
Heftes<br />
1. Dem Aufbau des Schülerheftes liegt<br />
folgende Konzeption zugrunde:<br />
Im Baustein A gewinnen die Schülerinnen<br />
und Schüler einen einführenden<br />
Überblick über den Unterrichtsgegenstand:<br />
Sie können sich anhand der angebotenen<br />
Materialien über Funktion,<br />
Wirkungsweise und Geschichte des<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tes informieren. Bereits hier<br />
finden sie aber auch Hinweise auf aktuelle<br />
Herausforderungen des <strong>Sozialstaa</strong>tes,<br />
weil auf diese Weise am ehesten<br />
das Interesse am Thema des Heftes<br />
geweckt werden kann. Die abschließende<br />
Analyse und Diskussion<br />
der Lösungsansätze bleibt jedoch dem<br />
letzten Baustein vorbehalten, weil dazu<br />
die ausführliche Beschäftigung mit den<br />
in den mittleren Bausteinen dargestellten<br />
Teilaspekten der sozialen Ordnung<br />
vorausgesetzt werden muss.<br />
Die Bausteine B-D vertiefen exemplarisch<br />
einzelne Teilbereiche der Sozialpolitik,<br />
und zwar Arbeitsmarktpolitik,<br />
Rentenproblematik und Sozialhilfe. Jeder<br />
dieser Bausteine enthält Grundinformationen,<br />
eine Beschreibung der<br />
Krise und deren Ursachen sowie Lö-<br />
6<br />
sungsvorschläge für den jeweils gewählten<br />
Aspekt.<br />
Im abschließenden Baustein E werden<br />
die allgemeinen Strukturprobleme zusammengefasst<br />
und Wege aus der Krise<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes zur Diskussion gestellt.<br />
Hier ist wie in allen Teilen<br />
des Heftes die Beschränkung auf das<br />
„Exemplarische“ leitendes Prinzip.<br />
(s.S. 3)<br />
Überschneidungen waren bei dieser<br />
Konzeption nicht gänzlich zu vermeiden;<br />
sie lassen sich jedoch produktiv<br />
verwerten, indem man die bereits zuvor<br />
erarbeiteten Informationen vertieft<br />
und das Problembewusstsein fortschreitend<br />
intensiviert.<br />
2. Die Bausteine sind in sich geschlossen.<br />
Falls keine Unterrichtseinheit vorgesehen<br />
ist, in welcher man den <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
in der hier vorgeschlagenen Ausführlichkeit<br />
thematisiert und die fünf Bausteine<br />
in der vorgeschlagenen Reihenfolge<br />
behandelt werden, ist es möglich,<br />
einzelne Bausteine in anderem Unterrichtszusammenhang<br />
aufzugreifen.<br />
3. Jeder Baustein beginnt mit einer Auftaktseite;<br />
hier setzt sich die fiktive Familie<br />
Schulze mit Fragen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
auseinander; dadurch soll eine<br />
altersgemäße Einführung und Präsentation<br />
der Problematik gewährleistet<br />
werden. Die unterrichtliche Beschäftigung<br />
mit den Aussagen und der Situation<br />
der fünf Familienmitglieder kann<br />
die Schülerinen und Schüler zur Diskussion<br />
und zum Sammeln weiterführender<br />
Fragen anregen.<br />
4. Aktivmedien werden von Schülerinnen<br />
und Schülern erfahrungsgemäß gern<br />
bearbeitet. Sie eignen sich zur Bildung<br />
einer eigenen Stellungnahme; der Vergleich<br />
der Ergebnisse der individuellen<br />
Eintragungen führt in der Regel zu einem<br />
lebhaften Unterrichtsgespräch.<br />
(vgl. A3, B9, S. 24, C6, S. 32, C23,<br />
D9, S.49, E1)<br />
5. Am Schluss eines jeden Bausteins findet<br />
man im Schülerheft eine Übung,<br />
welche zur Ergebnissicherung und zur<br />
Auseinandersetzung mit dem jeweiligen<br />
Inhalt anregen soll. (s.S. 5)<br />
6. Um die Aktualität zu verstärken, wird<br />
empfohlen, während der Behandlung<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes die Schülerinnen und<br />
Schüler Zeitungsmeldungen, Bilder<br />
und Karikaturen zum Thema sammeln<br />
zu lassen und damit eine Wandzeitung<br />
oder eine Dokumentationsmappe zu<br />
gestalten. Vor allem jedoch das Internet<br />
bietet Aktuelles an (siehe unten).<br />
7. Die Bausteine B, C und D kann man jeweils<br />
durch eine Schülergruppe bearbeiten<br />
lassen. Zur Integration der Ergebnisse<br />
der drei Gruppen empfiehlt<br />
sich folgende Systematik:<br />
- Leistungen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
- Instrumente der Sozialpolitik<br />
- Probleme/Herausforderungen<br />
- Reformvorschläge<br />
- Stellungnahme der jeweiligen Gruppe.<br />
Baustein A und Baustein E wird man<br />
dagegen in jedem Fall gemeinsam bearbeiten.<br />
8. Dringend empfohlen wird die Einladung<br />
von Fachleuten und Politikern in<br />
den Unterricht. Sinnvoll ist auch die<br />
Begegnung mit Betroffenen: Arbeitslosen,<br />
Rentnern, Sozialhilfeempfängern<br />
und Unternehmern sowie der Besuch<br />
von Einrichtungen: Arbeitslosenorganisationen,<br />
Sozialamt, „Armentafel“,<br />
soziale Dienste.<br />
Aktuelle Informationen und Antworten<br />
auf Detailfragen liefert auch<br />
die Recherche im Internet. Hier nur einige,<br />
für das Thema <strong>Sozialstaa</strong>t wichtige<br />
Adressen:<br />
Bundesanstalt für Arbeit:<br />
www.arbeitsamt.de<br />
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung:<br />
www.bma.de<br />
Bundesministerium für Familien, Senioren,<br />
Frauen und Jugend:<br />
www.bmfsfj.de<br />
Bundesministerium für Gesundheit:<br />
www.bmgesundheit.de<br />
Statistisches Bundesamt:<br />
www.statistik-bund.de<br />
(Über das Internetangebot von Wirtschaftsforschungsinstituten,<br />
Verbänden oder Parteien<br />
informiert Christiane Toyka-Seid, Martin<br />
Bründing: Internet-Wegweiser für die politische<br />
Bildung; hrsg. v. der BpB, Bonn 1999)
Baustein A<br />
Ohne <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
geht es nicht<br />
Was heißt „<strong>Sozialstaa</strong>t“?<br />
„Daran, was Sozialpolitik eigentlich<br />
ist, scheiden sich seit jeher die<br />
Geister. Zwar sind die Versuche einer<br />
Definition längst Legion, aber nie so<br />
weit gediehen, dass die Wissenschaft<br />
hierüber einen Konsens hätte herbeiführen<br />
können.“<br />
Butterwegge, Christoph: Wohlfahrtsstaat<br />
im Wandel, Opladen 1999, S. 11f.<br />
„Mehr als zehn Jahre habe ich mich<br />
intensiv damit befasst, den Sinn des<br />
Begriffs „soziale Gerechtigkeit“ herauszufinden.<br />
Der Versuch ist gescheitert.“<br />
Friedrich August von Hayek<br />
(Nobelpreisträger für Wirtschaftswissenschaften);<br />
nach: DER SPIEGEL vom 5. Juli<br />
1999, S.72.<br />
„Welcher gesellschaftliche Sachverhalt<br />
als sozial unerwünscht gilt und<br />
sozialpolitisches Handeln notwendig<br />
macht, ist eine Frage, die je nach Gesellschaftssystem<br />
und Gruppenzugehörigkeit<br />
eine andere Antwort erfährt.“<br />
Dietmar Kath; in: Vahlens Kompendium<br />
der Wirtschaftstheorie und Wirtschaftspolitik.<br />
Band 2, München 1992, S.407.<br />
„Als System des sozialen Ausgleichs<br />
zwischen den Starken und den<br />
Schwachen ist der <strong>Sozialstaa</strong>t per se<br />
Umverteilung. Nur in welchem Umfang,<br />
wer die Nutznießer und die Erbringer<br />
der Leistungen sind, das muss<br />
immer neu definiert werden.“<br />
Wolfgang Thierse (Bundestagspräsident;<br />
SPD); in: Vorwärts 1999/8, S.55.<br />
Eine verbindliche Definition für den<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t gibt es nicht. Auch die Grenzziehung<br />
zwischen „<strong>Sozialstaa</strong>t“ und<br />
„Wohlfahrtsstaat“ ist fließend. Manche<br />
Autoren verwenden die Begriffe synonym,<br />
andere bezeichnen die Bundesrepublik<br />
Deutschland als einen Wohlfahrtsstaat und<br />
wollen damit zum Ausdruck bringen, dass<br />
die soziale Rundumversicherung längst<br />
über die eigentlichen Funktionen eines <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
hinausgewachsen sei.<br />
Definition für den <strong>Sozialstaa</strong>t sind<br />
standort- und interessengebunden; sie sind<br />
abhängig davon, wo man den <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
Was heißt „<strong>Sozialstaa</strong>t“?<br />
- ein Definitionsversuch (vgl. A 1-4)<br />
Verfassungsauftrag „<strong>Sozialstaa</strong>tprinzip“<br />
Aufgaben des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
}<br />
Exkurs: Geschichte des deutschen<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tes (vgl. A12-14)<br />
Der <strong>Sozialstaa</strong>t muss erhalten bleiben<br />
Umbau: Ja; Abbau: Nein (vgl. A15-19)<br />
im Spannungsverhältnis von individueller<br />
Freiheit und Eigenverantwortung einerseits<br />
und sozialer Absicherung eines jeden<br />
gegen soziale Risiken in allen Lebenslagen<br />
andererseits ansiedelt.“ Die beiden in<br />
der aktuellen Debatte um den <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
dominierenden Grundsatzpositionen lassen<br />
sich letztlich auf die Alternative <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
versus Markt oder persönliche<br />
Freiheit und Eigenverantwortung versus<br />
kollektive Sicherung und Solidarität<br />
zurückführen“.<br />
(Klaus Schroeder; in: Breit, Gotthard (Hrsg.):<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip und Demokratie, Schwalbach/Ts.<br />
1996, S.15f.)<br />
Die Behandlung des <strong>Sozialstaa</strong>ts in der<br />
<strong>Schule</strong> darf diesen Deutungsproblemen<br />
nicht ausweichen; die vorschnelle Festlegung<br />
auf ein bestimmtes Definitionsangebot<br />
widerspricht dem Stand der wissenschaftlichen<br />
Diskussion. Die Offenheit<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tsbegriffs ist nicht nur eine<br />
Herausforderung für den Unterricht, sondern<br />
auch eine große Chance: Die Schüle-<br />
Kosten + Leistungen<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
(vgl. A5-A11)<br />
rinnen und Schüler versuchen, ihren eigenen<br />
Standort zum Wesen des <strong>Sozialstaa</strong>ts<br />
zu formulieren.<br />
Eine engere Betrachtung des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
betont vorrangig die sozialen Sicherungssysteme,<br />
welche den Betroffenen<br />
in Notlagen, die aus Krankheit, Arbeitslosigkeit,<br />
Alter und Pflegebedürftigkeit entstanden<br />
sind, die erforderliche Hilfe gewähren;<br />
im weiteren Sinne gehören zum<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t auch ordnungspolitische Elemente<br />
wie das Tarifsystem und die gesetzlichen<br />
Regelungen der Arbeitszeit sowie<br />
der Jugendschutz, Bildungsangebote<br />
und die Gleichstellung von Mann und<br />
Frau.<br />
Aus diesen Überlegungen ergibt sich<br />
die im ersten Baustein des Schülerheftes<br />
gewählte additive Charakterisierung des<br />
<strong>Sozialstaa</strong>ts; dieser wird als ein aus zahlreichen<br />
Elementen zusammengesetztes<br />
Gebilde vorgestellt und dadurch für die<br />
Adressaten transparent. (vgl. A1 - A5 und<br />
A19)<br />
7
8<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t als Auftrag<br />
Freiheit und soziale Sicherheit sind ein Geschwisterpaar. Denn menschliche Geborgenheit<br />
ist ohne soziale Sicherheit ebensowenig denkbar wie ohne persönliche<br />
Freiheit. Der Mensch braucht beides... Soziale Sicherheit bedeutet frei sein von Not<br />
und gewährt damit ein großes Stück Freiheit. Freie Entfaltungsmöglichkeiten wiederum<br />
sind die Voraussetzung für soziale Sicherheit durch leistungsfähige Sozialsysteme.<br />
Beide bedingen einander. Das gilt auch für das Verhältnis von Wirtschafts- und<br />
Sozialpolitik: Eine gute Wirtschaftspolitik ist Grundlage aller Sozialleistungen. Eine<br />
gute Sozialpolitik ist Fundament wirtschaftlicher Stabilität durch sozialen Frieden ...<br />
Einerseits schuldet der <strong>Sozialstaa</strong>t jedem Bürger die Sicherung existentieller Lebensbedingungen.<br />
Diese Schuld ist andererseits immer mit dem Gebot verbunden,<br />
Voraussetzungen für die Entfaltung von Freiheit zu sichern. Ziel des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
kann folglich nicht der allumfassend versorgte und betreute Mensch sein. Im Gegenteil:<br />
Der Einzelne muss die Verantwortung für sich selbst und seine Freiheit zu eigenen<br />
Lebensentscheidungen behalten.<br />
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung (Hrsg.): Sozialrecht, Bonn 1998, S.27f.<br />
Zur Geschichte<br />
„Deutschland ist ein Pionier staatlicher<br />
Sozialpolitik“<br />
(Schmidt, Manfred u.a.: Sozialpolitik in<br />
Deutschland, Opladen 1998, S.23).<br />
Der heutige deutsche <strong>Sozialstaa</strong>t ist<br />
das Ergebnis einer langen Entwicklungsgeschichte.<br />
Mit Recht wird dabei die Bismarcksche<br />
Sozialgesetzgebung als ein<br />
richtungweisender Meilenstein angesehen.<br />
Sie enthielt bereits wichtige Prinzipien<br />
unseres heutigen staatlichen Sicherungssystems,<br />
insbesondere die Pflichtversicherung,<br />
die Beteiligung von Arbeitgebern<br />
und Arbeitnehmern an den Beiträgen,<br />
den Rechtsanspruch der Versicherten<br />
auf soziale Leistungen und die Selbstverwaltung.<br />
Die Geschichte der deutschen Sozialpolitik<br />
ist nicht nur durch die Expansion<br />
der sozialen Sicherung, sondern auch<br />
durch Einschränkungen und Einschnitte in<br />
das „soziale Netz“ gekennzeichnet: Am<br />
Ende der Weimarer Republik kam es zu<br />
weitreichenden Leistungsverkürzungen,<br />
und im Dritten Reich entzogen zahlreiche<br />
Ausnahmebestimmungen ganzen Bevölkerungsgruppen<br />
den sozialen Schutz<br />
durch die Gemeinschaft. Auch in jüngster<br />
Zeit blieben Eingriffe in die sozialen Sicherungssysteme<br />
nicht aus. „Während der<br />
beiden Wirtschaftskrisen 1974/96 bzw.<br />
1980/82 brach der Grundwiderspruch des<br />
bürgerlichen Wohlfahrtsstaates erstmals<br />
in aller Schärfe auf (...) In der politischen<br />
und Fachöffentlichkeit mehrten sich zur<br />
selben Zeit bereits die Kassandrarufe mit<br />
Blick auf angeblich erreichte oder überschrittene<br />
Grenzen des <strong>Sozialstaa</strong>tes (...)<br />
Folgerichtig führte die damalige Wirtschaftskrise<br />
zu einem Kurswechsel in der<br />
Sozialpolitik (...) Das Haushaltsstrukturgesetz<br />
1975 markiert eine historische Zäsur<br />
(...) Es begann eine Phase der Stagnation<br />
und Regression“.<br />
(Butterwegge; Christoph: Wohlfahrtsstaat im<br />
Wandel, Opladen 1999, S.39)<br />
Die unterrichtliche Auseinandersetzung<br />
mit dem <strong>Sozialstaa</strong>t und seinen Problemen<br />
darf dessen Geschichte nicht aussparen,<br />
weil die lange Tradition staatlicher<br />
Sozialpolitik im heutigen Sozialsystem<br />
relevant ist und das sozialstaatliche<br />
Denken und Handeln in Deutschland in<br />
einem solchen Maße geprägt hat, dass das<br />
Sozialwesen zu einem unverzichtbaren<br />
Bestandteil unserer politischen Kultur geworden<br />
ist. Jede Reformdiskussion muss<br />
diesem hohen Stellenwert des Sozialen in<br />
unserer Gesellschaft Rechnung tragen.<br />
Eingriffe in soziale Besitzstände und soziale<br />
Sicherungen sind nur in kleinen<br />
Schritten gerechtfertigt und bedürfen einer<br />
überzeugenden Begründung.<br />
„Tatsächlich ist es eine deutsche Besonderheit,<br />
gegenüber sozialen Ungleichheiten<br />
tendenziell skeptisch eingestellt zu<br />
sein und vom Staat ausgleichende Maßnahmen<br />
zu erwarten“.<br />
(Holger Lengfeld; in: Die Neue<br />
Gesellschaft/Frankfurter Hefte 1999/3, S.202).<br />
Auch wenn aus Platzgründen im<br />
Schülerheft nur ein Überblick über die<br />
Geschichte des <strong>Sozialstaa</strong>tes angeboten<br />
werden kann (A14; vgl. C2), ist doch eine<br />
vertiefte Auseinandersetzung mit seiner<br />
über hundertjährigen Tradition dringend<br />
zu empfehlen. Wo sich die Gelegenheit<br />
dazu anbietet, ist ein fächerverbindendes<br />
Unterrichtsprojekt mit dem Fach Geschichte<br />
zweckmäßig.<br />
Unverzichtbare Werte<br />
Der soziale Rechtsstaat deutscher Ausprägung<br />
verwirklicht in bester Weise die<br />
drei Werte Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität.<br />
Diese sind der Kernbestand der<br />
unabänderlichen Wertordnung unseres<br />
Grundgesetzes. Sie verpflichten alle staatliche<br />
Gewalt und verschafften dem Einzelnen<br />
des Freiraum, den er zur Verwirklichung<br />
dieser Werte in seinem persönlichen<br />
Bereich benötigt. Diese Werte ste-<br />
hen zueinander in einem Spannungsverhältnis.<br />
Die Politik muss ausfechten, wie<br />
das Spannungsverhältnis zwischen diesen<br />
Werten zu lösen ist. Der Ausgleich ist oft<br />
schwierig. Denn ein Kennzeichen der gesellschaftlichen<br />
Situation in modernen Industriestaaten<br />
ist das Auseinanderfallen<br />
der Bevölkerung in Interessengruppen.<br />
Hier bildet die <strong>Sozialstaa</strong>tsverpflichtung<br />
einen Schutzwall für die Schwächeren<br />
und lässt den sozialen Rechtsstaat zu ihrer<br />
Interessenvertretung werden.<br />
Nach: Stützle, Hans: Das soziale Netz in<br />
Deutschland, München (Olzog Verlag) 1994,<br />
S.17.<br />
Didaktische und<br />
methodische Hinweise<br />
Bei der Auseinandersetzung mit den<br />
Materialien des Bausteins A sollen sich<br />
die Schülerinnen und Schüler die vielfältigen<br />
Aktivitäten des <strong>Sozialstaa</strong>tes bewusst<br />
machen und gleichzeitig die Notwendigkeit<br />
des Gleichgewichts zwischen individueller<br />
Entfaltungsfreiheit und sozialer<br />
Sicherheit verstehen. In einem auf Solidarität<br />
begründeten Gemeinwesen muss jeder<br />
den Anspruch auf soziale Sicherheit<br />
und wirkungsvolle Hilfe in persönlichen<br />
Notlagen haben; andererseits darf es in einer<br />
offenen Gesellschaft nicht Ziel und<br />
Aufgabe des <strong>Sozialstaa</strong>tes sein, die Menschen<br />
umfassend zu versorgen, zu betreuen<br />
und zu bevormunden. Denn „in dem<br />
Maße, in dem versucht wird, einen perfekten<br />
Wohlfahrtsstaat zu organisieren,<br />
werden die Bürger in eine Vollkasko-<br />
Mentalität entführt“.<br />
(Werner Müller, SPD, (Bundeswirtschaftsminister);<br />
in: DER SPIEGEL vom 11. Oktober<br />
1999, S.29).<br />
Es hat sich bewährt, die Schülerinnen<br />
und Schüler selbstständig eine - vorläufige<br />
- Definition für den <strong>Sozialstaa</strong>t finden<br />
zu lassen, die im weiteren Unterrichtsverlauf<br />
überprüft und gegebenenfalls modifiziert<br />
werden kann. Um hochgradig abstrakte<br />
Definitionsmodelle zu vermeiden,<br />
ist einer additiven Erklärung für den <strong>Sozialstaa</strong>tsbegriff<br />
der Vorrang zu geben. Als<br />
Ausgangspunkt für eine solche Definition<br />
eignen sich die Ergebnisblätter des Spiels<br />
der Familie Schulze (Schülerheft S. 4f.)<br />
sowie die Materialien A1 - A4. Indem<br />
man die gefundenen Elemente der sozialstaatlichen<br />
Ordnung geeigneten Überbegriffen<br />
zuordnen lässt, machen sich die<br />
Jugendlichen die jeweilige Bedeutung und<br />
Funktion dieser Maßnahmen klar.<br />
Soziale Sicherheit gibt es nicht umsonst!<br />
Der leistungsfähige <strong>Sozialstaa</strong>t ist<br />
eine teure Angelegenheit: Etwa ein Drittel<br />
des Bruttoinlandsprodukts der Bundesrepublik<br />
Deutschland wird jährlich für die<br />
verschiedenen sozialen Sicherungssyste-
me aufgewendet (E6; vgl. A8). Freilich<br />
wird der größte Teil davon durch die<br />
Leistungsempfänger selbst aufgebracht,<br />
indem diese Beiträge für die gesetzliche<br />
Kranken-, Arbeitslosen-, Renten- und<br />
Pflegeversicherung entrichten bzw. als<br />
Beamte Anwartschaften erwerben. Sozialhilfe<br />
oder Kinder- und Wohngeld sind daneben<br />
- verhältnismäßig (!) - kleine Ausgabenposten.<br />
Für eine effiziente Bearbeitung dieser<br />
Zahlen werden drei Arbeitsschritte empfohlen:<br />
1) eine Aufstellung der Ausgabenbereiche<br />
nach ihrer absoluten Größe,<br />
2) eine Zuordnung der Ausgabenblöcke<br />
zu den Bereichen „soziale Fürsorge“,<br />
„soziale Vorsorge“ und „Sozialversicherungen,<br />
3) die Berechnung der Beiträge, welche<br />
ein durchschnittlicher Arbeitnehmer in<br />
die gesetzlichen Versicherungen entrichten<br />
muss.<br />
Diese Arbeitsschritte eröffnen den Zugang<br />
zu wichtigen und aktuellen Problemen<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes. Aus didaktischen<br />
Gründen ist es zweckmäßig, bereits in den<br />
Einführungsstunden auch diese Probleme<br />
unserer sozialen Ordnung zu thematisieren,<br />
weil die Schülerinnen und Schüler<br />
ohnehin in ihrem Alltag mit den Herausforderungen<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes konfrontiert<br />
werden und weil die Reformdiskussion in<br />
der Regel einen nachhaltigen Motivationsschub<br />
bewirkt (vgl. A15-A18). Dabei<br />
muss freilich stets die enge Verflechtung<br />
zwischen dem <strong>Sozialstaa</strong>t und einer funktionsfähigen<br />
Wirtschaft betont werden<br />
(vgl. auch Baustein B), denn „die soziale<br />
Sicherheit darf nicht zerstört werden,<br />
Das Hauptbuch der Nation<br />
Bundeshaushalt 2001 (Soll)<br />
*Bundesanteil<br />
ebenso dürfen aber auch die Belastungen<br />
nicht die Chancen der Wirtschaft beschädigen“<br />
(Wilfried Herz; in: DIE ZEIT vom 28. Oktober<br />
1994, S.40).<br />
Schon jetzt kann ein Fragenkatalog erstellt<br />
werden, der die weitere Beschäftigung<br />
mit ausgewählten Aspekten des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
strukturiert:<br />
● Warum ist die Charakterisierung der<br />
Bundesrepublik Deutschland als „sozialer<br />
Bundesstaat“ in das Grundgesetz<br />
aufgenommen worden?<br />
● Welche Elemente des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
sind unverzichtbar?<br />
● Wo kann im Sozialwesen gespart werden?<br />
● Warum wird die Forderung nach einer<br />
Reform des <strong>Sozialstaa</strong>tes immer lauter<br />
und dringender?<br />
● Wie kann der <strong>Sozialstaa</strong>t ohne Nachteile<br />
für das gesellschaftliche Zusammenleben<br />
reformiert werden?<br />
usw.<br />
Beispiel eines „Lohnzettels“:<br />
Bei der Berechnung des Nettolohnes<br />
sollten die Schülerinnen und Schüler die<br />
signifikant hohen Kosten des deutschen<br />
Sozialverischerungssystems kennenlernen.<br />
Da die Prozentsätze für die Beiträge<br />
jährlich neu festgesetzt werden und etwaige<br />
zusätzliche Leistungen der Unternehmen<br />
in dieser Modellrechnung unberücksichtigt<br />
bleiben, handelt es sich lediglich<br />
um Annäherungswerte. Man wird nach<br />
der Berechnung der Abzüge vom Bruttolohn<br />
darauf hinweisen, dass die Arbeitgeber<br />
ebenfalls an den Beiträgen zu den gesetzlichen<br />
Sozialversicherungen beteiligt<br />
Einnahmen 477,0 Mrd. DM 477,0 Mrd. DM Ausgaben<br />
135,4 135,4 135,4<br />
169,6 169,6 169,6<br />
Lohn- und<br />
Einkommensteuer*<br />
Stromsteuer<br />
Umsatzsteuer*<br />
Körperschaftsteuer*<br />
Mineralölsteuer<br />
8,2 8,2 8,2<br />
135,4 135,4 135,4<br />
12,0 12,0 12,0<br />
Tabaksteuer<br />
Solidaritätszuschlag<br />
Versicherungsteuer<br />
Bundesbankgewinn<br />
Nettokreditaufnahme<br />
sonstiges sonstiges sonstiges<br />
(Zuweisungen (Zuweisungen (Zuweisungen abgerechnet)<br />
abgerechnet)<br />
abgerechnet)<br />
68,7 68,7 68,7<br />
23,4 23,4 23,4<br />
21,4 21,4 21,4<br />
14,3 14,3 14,3<br />
7,0 7,0 7,0<br />
43,7 43,7 43,7<br />
7,5 7,5 7,5<br />
17,4 17,4 17,4<br />
81,9 81,9 81,9<br />
16,0 16,0 16,0<br />
Arbeit u. Soziales<br />
48,6 48,6 48,6<br />
46,9 46,9 46,9<br />
27,2 27,2 27,2<br />
Versorgung<br />
Bundesschuld<br />
14,3 14,3 14,3<br />
11,0 11,0 11,0<br />
10,8 10,8 10,8<br />
33,3 33,3 33,3<br />
Bildung, Forschung<br />
Verkehr, Bau,<br />
Wohnungswesen<br />
Verteidigung<br />
Allg. Finanzverwaltung<br />
Wirtschaft, Technologie<br />
Ernährung, Landwirtschaft<br />
Familie, Senioren, Frauen,<br />
Jugend<br />
sonstiges<br />
werden, und zwar jeweils in der gleichen<br />
Höhe wie die Arbeitnehmer (Sonderfall:<br />
Pflegeversicherung *) ); Die Unfallversicherung<br />
wird gänzlich von den Unternehmen<br />
bestritten.<br />
Angenommener Bruttolohn 5.000,-<br />
./. Lohnsteuer (15%) 750,-<br />
./. Solidaritätsabgabe<br />
(5% von der Lohnsteuer) 37,50<br />
./. Rentenversicherung (9,65 %) 482,50<br />
./. Krankenversicherung (6,2 %) 337,50<br />
./. Arbeitslosenvers. (3,25 %) 162,50<br />
./. Pflegeversicherung (0,85 %) 1) 42,50<br />
Summe der Abzüge 1.812,50<br />
davon Sozialversicherung 1.025,-<br />
Nettolohn 3.177,50<br />
(alle Angaben in DM)<br />
*) Der Arbeitgeberanteil an der Pflegeversicherung<br />
(0,85 % des Bruttolohnes) wurde durch<br />
die Streichung eines Feiertages kompensiert.<br />
Wiederholen und Stellung<br />
nehmen:<br />
Die vorgeschlagene Übung soll nicht<br />
nur der eigenständigen Überprüfung des<br />
erworbenen Wissens dienen, sondern zu<br />
einer erneuten Reflexion über das Wesen<br />
und die Herausforderungen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
anregen.<br />
Zum Arbeitsblatt: Folgende<br />
Kästchen sind anzukreuzen:<br />
1: b,c,d<br />
2: a<br />
3: b,c<br />
4: a, d<br />
5: b<br />
6: a,b,c.<br />
© Globus<br />
6804<br />
9
10<br />
Vorschlag für ein Tafelbild zu Baustein A<br />
Aufgaben des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
1. Herstellung der „sozialen Gerechtigkeit“<br />
Verteilungs- und Umverteilungsfunktion<br />
d. h. Eingriffe in das Einkommen und das Vermögen zugunsten<br />
sozial Benachteiligter<br />
Sicherung des Existenzminimums<br />
Chancengleichheit<br />
Ausgleich krasser sozialer Gegensätze<br />
z. B. Sozialhilfe<br />
Mietzuschüsse<br />
2. Absicherung gegen die Risiken<br />
der Industriegesellschaft<br />
Schutzfunktion<br />
z. B. Krankenversicherung<br />
Rentenversicherung<br />
Arbeitslosenversicherung<br />
Pflegeversicherung<br />
Unfallversicherung<br />
Probleme:<br />
● Erzeugung einer<br />
Anspruchs- und<br />
„Vollkasko“-Mentalität<br />
● Rundumversorgung<br />
statt Eigeninitiative<br />
4. Stabilisierung des demokratischen<br />
Gemeinwesens und Sicherung des<br />
sozialen Friedens<br />
Gesellschaftspolitische Funktion<br />
3. Förderung der Beschäftigung<br />
Produktivitätsfunktion<br />
z. B. Umschulung und Fortbildung<br />
Lohnzuschüsse („Kombilohn“)<br />
Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen<br />
BAFÖG<br />
Probleme:<br />
● hohe und ständig<br />
wachsende Kosten<br />
● Grenzen der<br />
Finanzierbarkeit
Baustein B<br />
Arbeitslosigkeit bedroht den<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t<br />
„Massenarbeitslosigkeit ist eine Gefahr<br />
für den gesellschaftlichen Frieden.“<br />
Wilfried Herz; in: DIE ZEIT vom 4. Februar<br />
1994, S.1,<br />
„Die eigentliche Krise des westeuropäischen<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tes liegt in einer<br />
Beschäftigungskrise, zu deren Lösung<br />
es bis heute keine überzeugende ökonomische<br />
und zugleich soziale Antwort<br />
gibt.“<br />
Joschka Fischer; zitiert nach: Heinze, Rolf<br />
G.u.a.: Vom Wohlfahrtsstaat zum Wettbewerbsstaat,<br />
Opladen 1999, S. 85.<br />
„Den Königsweg zu mehr Beschäftigung<br />
gibt es nicht. Man sollte ihn daher<br />
weder von Politikern noch von<br />
Verbandsfürsten einfordern.“<br />
Nikolaus Piper; in: DIE ZEIT vom 21. Februar<br />
1994, S.1.<br />
„Die gewohnten Bahnen der bisherigen<br />
Lohn- und Arbeitsmarktpolitik<br />
müssen verlassen werden, auch sind<br />
radikal andere Ansätze zu diskutieren.“<br />
Siebert, Horst: Geht den Deutschen die Arbeit<br />
aus?, München 1994, S.23.<br />
Der deutsche <strong>Sozialstaa</strong>t wird durch<br />
die Arbeitslosigkeit in doppelter Weise<br />
herausgefordert und bedroht - trotz des<br />
Rückgangs der Arbeitslosenquote in jünster<br />
Zeit:<br />
1. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten<br />
vom <strong>Sozialstaa</strong>t, dass er für Vollbeschäftigung<br />
eintritt und das kostbare<br />
Gut Arbeit gerecht verteilt. Die Höhe<br />
der Beschäftigung und die Beschäftigungsstruktur<br />
haben daher einen<br />
großen Einfluss auf die Stabilität unserer<br />
Gesellschaft. Die Legitimation von<br />
Demokratie und Marktwirtschaft gründet<br />
zu einem guten Teil auf der Bereitstellung<br />
und Sicherung von Arbeitsplätzen<br />
für möglichst viele.<br />
2. Bei hoher Arbeitslosigkeit steigt die<br />
Beanspruchung der sozialen Sicherungssysteme<br />
in einem Maße, welches<br />
deren Funktionsfähigkeit in Frage stellen<br />
kann, während gleichzeitig die diesen<br />
Sicherungssystemen zur Verfügung<br />
stehenden Mittel schrumpfen,<br />
weil Arbeitslose keine Beiträge entrichten.<br />
Die verbliebenen Arbeitsplatzbesitzer<br />
und ihre Arbeitgeber müssen<br />
infolgedessen immer mehr Arbeitslose<br />
durch ihre Beiträge zu den Sozialversicherungen<br />
und durch ihre Steuern ali-<br />
Arbeitslosigkeit – eine Herausforderung<br />
für den <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
Ausmaß und Folgen der Arbeitslosigkeit<br />
passive<br />
Arbeitsmarktpolitik<br />
(vgl. B 10– 13)<br />
mentieren - dies verteuert die Arbeit<br />
und verstärkt die Neigung der Unternehmen,<br />
zu rationalisieren und Arbeitsplätze<br />
einzusparen. Der Verlust an<br />
Wohlstand, der in Deutschland durch<br />
die Arbeitslosigkeit derzeitig entsteht,<br />
wird auf 15 Prozent des Bruttoinlandsprodukts<br />
geschätzt. Die Ausgaben,<br />
welche durch Arbeitslosigkeit entstehen,<br />
weisen die höchste Zuwachsraten<br />
innerhalb des gesamten Sozialbudgets<br />
auf.<br />
(vgl. B1 – 3)<br />
Ursachen und Voraussetzungen<br />
von Arbeitslosigkeit<br />
– Phänomene<br />
– Qualifikationsdefizite<br />
– Veränderung der Beschäftigungsquote<br />
– Sockelarbeitslosigkeit<br />
– jobless growth<br />
(vgl. B 4– 9)<br />
Arbeitsmarktpolitik<br />
Kosten der<br />
Arbeitsmarktpolitik<br />
(vgl. B 14– 15)<br />
aktive<br />
Arbeitsmarktpolitik<br />
(vgl. B 16– 20)<br />
Arbeitsmarktpolitische Grundpositionen<br />
(vgl. B21)<br />
Ergebnisse einer Umfrage des Mannheimer Ipos-Instituts<br />
In der Werteskala der deutschen Bevölkerung<br />
nehmen ein gesicherter Arbeitsplatz<br />
und die Vollbeschäftigung den<br />
vordersten Rang ein. Arbeit ist zunächst<br />
die unverzichtbare Quelle von Einkommen<br />
und Wohlstand; ein gesicherter Arbeitsplatz<br />
trägt dann in unserer Gesellschaft<br />
entscheidend zum Selbstwertgefühl<br />
eines jeden Einzelnen bei und stellt einen<br />
wichtigen Prestigefaktor dar. Arbeit ist<br />
aber vor allem dazu geeignet, für menschliches<br />
Leben Sinn zu stiften; andere Werte<br />
Das Vertrauen der Deutschen in die Leistungsfähigkeit der Demokratie nimmt ab.<br />
Besonders in den neuen Ländern glauben immer weniger Menschen, dass die politische<br />
Ordnung der Bundesrepublik in der Lage sei, die aktuellen Probleme zu lösen<br />
(...) Als besondere Bedrohung für die Demokratie sehen die Befragten die Massenarbeitslosigkeit.<br />
Jeder Zweite ist der Ansicht, die hohe Zahl der Beschäftigungslosen<br />
gefährde die politische Stabilität derart, dass es zu politischen Unruhen kommen<br />
könne. Diese Sorge ist mt 63 Prozent im Osten stärker ausgeprägt als im Westen, wo<br />
nur 47 Prozent mit einer solchen Möglichkeit rechnen.<br />
Berliner Zeitung vom 18. November 1999, S.7.<br />
11
- wie Freizeit, Hobbys und Urlaub - treten<br />
dahinter zurück. Nicht nur in den neuen<br />
Bundesländern, sondern auch in Westdeutschland,<br />
wo die Arbeitslosigkeit nur<br />
halb so hoch ist, hat sich deshalb die Beschäftigungskrise<br />
zum beherrschenden<br />
Thema entwickelt.<br />
Diese Beobachtungen sind bei der unterrichtlichen<br />
Auseinandersetzung mit der<br />
Arbeitsmarktpolitik von großer Bedeutung,<br />
weil die Schülerinnen und Schüler<br />
daraus ableiten können, wie groß die Gefahr<br />
für den <strong>Sozialstaa</strong>t ist, die diesem aus<br />
wachsender und andauernder Arbeitslosigkeit<br />
entsteht. In einem Unterrichtsprojekt,<br />
in welchem Reformen des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
diskutiert werden sollen, kann deshalb die<br />
Arbeitsmarktpolitik nicht ausgespart werden.<br />
Ob und wie der <strong>Sozialstaa</strong>t mit der<br />
Arbeitslosigkeit zu Rande kommt, davon<br />
hängt ganz wesentlich seine zukünftige<br />
Akzeptanz in der Bevölkerung ab.<br />
Zukunftsperspektiven<br />
· Weltwirtschaftliche Trends<br />
· Fortschreitende Globalisierung und<br />
weltwirtschaftliche Verflechtung;<br />
· Wachstum neuer Märkte und Auftreten<br />
neuer Wettbewerber;<br />
· mobiler und älter werdende Weltbevölkerung;<br />
· Zunahme von Wanderungen.<br />
12<br />
Technologische Trends<br />
· Zunehmende Bedeutung der Innovationen<br />
im Technologiewettbewerb;<br />
· wissensbasierte Technologien und<br />
standortunabhängige geistige<br />
Leistungen werden zum strategischen<br />
Produktionsfaktor;<br />
· Entwicklung zur medial vernetzten<br />
Informations-/Wissensgesellschaft.<br />
Gesellschaftliche Trends<br />
· Weiter steigende Erwerbsquote der<br />
Frauen;<br />
· „alternde“ Bevölkerung;<br />
· weitergehende Arbeitszeitverkürzung<br />
und -flexibilisierung;<br />
· Wandel der Wertorientierungen und<br />
der Arbeitsethik;<br />
· Konsolidierung des <strong>Sozialstaa</strong>ts; Ausbau<br />
der ehrenamtlichen Tätigkeiten.<br />
Trends der Arbeitswelt<br />
· Der Trend zur Dienstleistungsorientierung und zu den Dienstleistungstätigkeiten wird anhalten.<br />
· Die Arbeitsinhalte werden sich weiter wandeln: von materialorientiert zu informationsorientiert, von Gegenständen/Werkstücken<br />
zu Prozessen und Zusammenhängen (zur „virtuellen“ Arbeit).<br />
· Das Angebot an „Normalarbeitsverhältnissen“ wird weiter abnehmen, atypische Arbeitsverhältnisse (befristet, Teilzeit-, Projektarbeit,<br />
geringfügige Beschäftigung etc.) werden zunehmen; ebenso „duale Arbeitsverhältnisse“: Erwerbsarbeit im marktwirtschaftlichen<br />
Sektor und Zweittätigkeiten im gemeinwirtschaftlichen Sektor (Fürstenberg; Rifkin).<br />
· Der Trend zur weiteren Flexibilisierung der Arbeitszeit und der Arbeitsorganisation geht weiter; die Teilzeitbeschäftigung wird<br />
zunehmen, verbunden mit häufigerem Wechsel zwischen Phasen der Beschäftigung, Weiterbildung, Arbeitslosigkeit, Eigenarbeit<br />
etc. Dies führt zu „fragmentierten“ Erwerbsbiographien.<br />
· Der Trend zur Bildung kleiner, selbstverantwortlicher und flexibler Gruppen in Produktion und Dienstleistung wird sich verstärken;<br />
Herstellen und zugehörige Dienste werden stärker integriert.<br />
· Unterstützt durch moderne Informations- und Kommunikationstechnologien wird ein wachsender Teil der Berufsarbeit flexibel<br />
zuhause und/oder unterwegs geleistet werden können.<br />
· Die Nachfrage nach einfachen, wenig qualifizierten Arbeitsleistungen wird weiter abnehmen.<br />
· Der Bedarf an Fachqualifikationen und technischem Wissen wird weiter zunehmen, aber auch die Anforderungen bezüglich sozialer<br />
Kompetenzen und „Schlüsselqualifikationen“.<br />
· Die Erwerbsquote der Frauen wird weiter steigen, die Bedeutung der Frauenerwerbstätigkeit zunehmen, der Anteil von Frauen in<br />
Führungsprositionen (langsam) steigen.<br />
· Arbeitnehmer werden zunehmend unternehmerische Funktionen im Betrieb übernehmen müssen, d.h. selbstverantwortlich, kreativ<br />
und qualitäts- und ergebnisorientiert arbeiten ( Trend zu „Intrapreneurs“).<br />
· Information, Wissen und Kreativität sind künftig der Motor der Wertschöpfung; der Anteil „wissensbasierten“ Lernens wird immer<br />
wichtiger.<br />
· In den Gruppen/Teams geht der Trend in Richtung Integration von Facharbeiterqualifikationen, Ingenieurwissen und Servicequalifikationen;<br />
es entsteht ein „neuer Typus industrieller Arbeitskraft“ - der „Facharbeiter-Ingenieur“ (B. Lutz).<br />
Gerhard Willke: Die Zukunft unserer Arbeit, Hannover 1998, S. 36<br />
Arbeitslosigkeit im Wohlfahrtsstaat<br />
Heute hat die registrierte Arbeitslosigkeit ... wieder das Niveau erreicht, das sie<br />
1950, d.h. vor dem eigentlichen Beginn des ... sogenannten „deutschen Wirtschafswunders“<br />
hatte. Nur muss man sich einmal klar machen, wie sehr sich die wirtschaftliche<br />
Situation verändert hat. Damals ein kriegsverwüstetes Land, zu wenig Produktionskapazität,<br />
zerstörte Infrastrukturen, zu wenig Kapital, heute ein hochmodernes<br />
Land mit hochgetriebener Produktion und modernen, z.T. hochmodernen Kapazitäten<br />
und Infrastrukturen, mit einem riesigen Überschuss an Kapital, der sich zunehmend<br />
einen Weg über die Grenzen sucht ... Und doch in beiden so unterschiedlichen<br />
Zeiten eine riesige Massenarbeitslosigkeit ...<br />
Die katastrophale Entwicklung am Arbeitsmarkt ist nicht verursacht ... durch die<br />
Wiedervereinigung. Die Massenarbeitslosigkeit ist im modernen Westen einstanden.<br />
Dort hat sie sich verstetigt und ist - lange vor der Wiedervereinigung - weiter eskaliert<br />
und offensichtlich der politischen Gegensteuerung entglitten ... Weder die ökonomische<br />
Katastrophe der früheren DDR noch die deutsch-deutschen Veränderungen<br />
nach 1989 haben ursächlich etwas mit dem Entstehen der Massenarbeitslosigkeit zu<br />
tun.<br />
Briefs, Ulrich: High-Tech und sozialer Verfall? Bonn (Pahl-Rugenstein Verlag) 1997, S.25f.
Didaktische und<br />
methodische Hinweise<br />
Auch Schülerinnen und Schüler sind<br />
von den Problemen, welche aus der Arbeitslosigkeit<br />
entstehen, betroffen. Viele<br />
von ihnen erfahren Auswirkungen der Arbeitslosigkeit<br />
in ihrem sozialen Umfeld,<br />
viele wissen um die Schwierigkeit, den<br />
gewünschten Ausbildungsplatz auch<br />
tatsächlich zu erhalten. Es ist deshalb<br />
sinnvoll, bei der Auseinandersetzung mit<br />
dem <strong>Sozialstaa</strong>t die Arbeitsmarktpolitik<br />
schwerpunktmäßig zu thematisieren. Dabei<br />
muss die Beschäftigungskrise sachlich<br />
bilanziert werden, freilich nicht ohne Auswege<br />
aus der Arbeitslosigkeit aufzuzeigen.<br />
Auch wenn es keinen Königsweg zur<br />
Vollbeschäftigung gibt, verfügen Gesellschaft<br />
und Politik doch über zahlreiche<br />
und sehr unterschiedliche Instrumente zur<br />
Eindämmung der Arbeitslosigkeit. In einem<br />
Unterrichtsprojekt über die Zukunft<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes sollten diese Möglichkeiten<br />
kontrovers erörtert werden. Dabei<br />
kann auf einer insgesamt positiven<br />
Grundeinstellung der Jugendlichen aufgebaut<br />
werden: „Wenig (spricht) für die<br />
manchmal zu hörende Unterstellung, die<br />
Jugendlichen wüssten angesichts von fortdauernder<br />
Arbeitslosigkeit, von Flexibilisierung<br />
und Globalisierung ... nicht mehr<br />
aus noch ein. Eher im Gegenteil: Relativ<br />
zuversichtlich und überzeugt von der eigenen<br />
Leistungsfähigkeit versuchen sie<br />
mehrheitlich, aktiv ihre Lebensperspektive<br />
vorzubereiten. Sie sind ... entschlossen,<br />
die Herausforderungen, die sie realistisch<br />
vor sich sehen, zu meistern.“<br />
Deutsche Shell (Hg.): Jugend 2000. Band 1,<br />
Opladen 2000, S. 13<br />
Allerdings können tradierte Vorstellungen<br />
von lebenslanger Vollbeschäftigung<br />
mit anschließendem Rentenanspruch<br />
für die Mehrzahl der Schülerinnen und<br />
Schüler nicht mehr länger als Leitbild dienen.<br />
„Arbeitslosigkeit kann jeden Beschäftigten<br />
treffen. Faktisch sind alle Arbeitnehmer<br />
potentielle Arbeitslose“.<br />
ÖTV-Hauptverwaltung (Hg.): Arbeitslos, Stuttgart<br />
1990, S. 19<br />
Deshalb müssen temporäre Arbeitslosigkeit<br />
und Patchwork-Biografien ebenso<br />
thematisiert werden wie Zeitarbeit, Jobsharing<br />
und neue Formen von Arbeit (vgl.<br />
E 26 - E 32: Zivilgesellschaft).<br />
Nachdrücklich ist vor der verbreiteten<br />
Meinung zu warnen, die auch Schülerinnen<br />
und Schüler häufig vortragen, dass<br />
Arbeitslosigkeit selbstverschuldet sei und<br />
dass jeder, der arbeiten wolle, auch Arbeit<br />
finde. Die Massenarbeitslosigkeit in den<br />
neuen Bundesländern und die bei Betreibsstilllegungen<br />
in die Höhe schießenden<br />
regionalen Arbeitslosenquoten beweisen<br />
das Gegenteil. Die Schülerinnen und<br />
Schüler sollen sich vielmehr mit dem<br />
Schicksal von Arbeitslosen und deren<br />
häufig verzweifelten Versuchen, eine<br />
neue Beschäftigung zu finden, vertraut<br />
machen und dabei die Notwendigkeit einer<br />
Neueinsteuerung der Arbeitsmarktpolitik<br />
im modernen <strong>Sozialstaa</strong>t erkennen.<br />
(B1 - B3)<br />
Das Materialangebot im Baustein B<br />
ermöglicht eine umfassende Beschäftigung<br />
mit den Ursachen und Folgen der<br />
Arbeitslosigkeit sowie den arbeitsmarktpolitischen<br />
Möglichkeiten zu deren Linderung.<br />
Im Vordergrund steht jedoch die<br />
Herausforderung des <strong>Sozialstaa</strong>tes durch<br />
eine lang andauernde Beschäftigungskrise.<br />
Wichtig erscheint es, dass die Adressaten<br />
dazu angeregt und ermutigt werden,<br />
eine eigenständige Meinung zu formulieren<br />
und eine fundierte Position in der Diskussion<br />
über arbeitsmarktpolitische Maßnahmen<br />
zu beziehen. Dazu dient zunächst<br />
das fiktive Gespräch in der Familie Schulze<br />
(s. Einleitung in den Baustein B); die<br />
Jugendlichen werden aufgefordert, die<br />
dort geäußerten Meinungen zu charakterisieren<br />
und sich gegebenenfalls einer der<br />
Positionen anzuschließen. Auch das<br />
Aktivmedium (B9) kann bei der Standortfindung<br />
nützlich sein.<br />
Fast alle entwickelten Industriestaaten<br />
und auch die Reformstaaten Mittel- und<br />
Osteuropas leiden unter einer mehr oder<br />
weniger bedrückenden Arbeitslosigkeit.<br />
Die Ursachen dafür sind vielfältig und unterscheiden<br />
sich von Land zu Land. eine<br />
monokausale Erklärung für die Arbeitslosigkeit<br />
ist deshalb nicht zulässig; die verschiedenen<br />
Gründe müssen für jede Region<br />
unterschiedlich gewichtet werden. Es<br />
ist notwendig, dass man den Schülerinnen<br />
und Schülern eine breite Palette von Ursachen<br />
vorstellt; dabei hat es sich bewährt,<br />
diese Ursachen durch die Klasse geeigneten<br />
Oberbegriffen zuordnen zu lassen,<br />
z.B.<br />
● Rationalisierung und Automatisierung<br />
● Globalisierung und Veränderung der<br />
Nachfragestruktur<br />
● gesellschaftlicher Wandel/Wertewandel<br />
● „Reformstau“<br />
● Produktions- und Lohnkosten<br />
für Deutschland zusätzlich:<br />
● Vereinigungsfolgen.<br />
(vgl. B5-B8)<br />
Reichlich provokant und für eine Diskussion<br />
in einer leistungsfähigen Klasse<br />
geeignet sind die Forderungen des Präsidenten<br />
des Kieler Instituts für Weltwirtschaft<br />
Horst Siebert. Er schlägt folgende<br />
Maßnahmen zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
vor:<br />
● Abschaffung der Arbeitslosenhilfe<br />
● Begrenzung des Arbeitslosengeldes<br />
auf 12 Monate (statt bisher 36)<br />
● Kürzung der Sozialhilfe für Arbeitsfähige<br />
und junge Arbeitslose<br />
● Niedriglöhne, um Arbeitslosen den<br />
Schritt in die Erwerbstätigkeit zu erleichtern<br />
● Einstiegslöhne unterhalb der tariflichen<br />
Grenzen (Abschläge vom Tariflohn<br />
von etwa 20 Prozent).<br />
(nach: Esslinger Zeitung vom 20./21. April<br />
2000, S.1f.)<br />
„Recht auf Arbeit“<br />
Mit besonders interessierten und qualifizierten<br />
Lerngruppen kann man zusätzlich<br />
erörtern, ob das „Recht auf Arbeit“ in<br />
der Verfassung verankert werden sollte.<br />
Plädoyer für das verfassungsmäßige<br />
Recht auf Arbeit<br />
Die anhaltende Massenarbeitslosigkeit<br />
ist eine Gefahr für den Bestand der demokratischen<br />
Industriegesellschaft.<br />
Wir brauchen deshalb ein Recht auf<br />
Arbeit in der Verfassung ...<br />
Über den Inhalt eines Rechts auf Arbeit<br />
muss .. noch einmal neu nachgedacht<br />
werden. Ein Recht auf Arbeit<br />
kann niemals als individuelles, subjektives<br />
Recht des Einzelnen verstanden<br />
werden, vom Staat einen bestimmten<br />
Arbeitsplatz zugewiesen zu bekommen.<br />
Die Aufnahme des besonderen<br />
Staatszieles „Recht auf Arbeit“ hat ...<br />
nur Sinn, wenn es gegenüber den übrigen<br />
Elementen des gesamtwirtschaftlichen<br />
Gleichgewichts (Preisstabilität,<br />
Wirtschaftswachstum und aktive<br />
Außenhandelsbilanz) einen hervorgehobenen<br />
Rang erhält ...<br />
Das Recht auf Arbeit müsste, wenn es<br />
tatsächlich etwas bewirken sollte, die<br />
Verpflichtung des Staates zu einer aktiven<br />
Arbeitsmarktpolitik aussprechen -<br />
bis hin zu einem offenen Bekenntnis<br />
zur öffentlichen Subvention von Arbeitsplätzen.<br />
Die besondere Betonung<br />
eines Rechts auf Arbeit in der Werteordnung<br />
der Verfassung ist freilich mit<br />
umfangreichen staatlichen Eingriffen<br />
in die Wirtschaft ... verbunden.<br />
Gerhard Hofe; in: DIE ZEIT vom 11. März<br />
1994, S.26.<br />
Folgende Gesichtspunkte sind dabei zu<br />
erörtern:<br />
● Im Grundgesetz der Bundesrepublik<br />
Deutschland ist das Recht auf Arbeit<br />
nicht ausdrücklich garantiert.<br />
13
● Ein gesetzlicher und einklagbarer Anspruch<br />
auf einen Arbeitsplatz setzt die<br />
staatliche Bewirtschaftung der Arbeitsplätze<br />
voraus.<br />
● Ein Recht auf Arbeit ist ohne eine<br />
staatliche Berufslenkung nicht realisierbar.<br />
(So wurden Schulabgänger in<br />
der DDR über ihre Lehrerinnen und<br />
Lehrer in Lehrstellen vermittelt je nach<br />
Bedarf der Produktionspläne und ohne<br />
Berücksichtigung der individuellen<br />
Wünsche der Jugendlichen.)<br />
● Das Recht auf Arbeit beinhaltet in der<br />
Regel eine „Pflicht zur Arbeit“.<br />
● Die erforderlichen Eingriffe des Staates<br />
in den Wirtschaftsprozess und die<br />
individuelle Lebensgestaltung widersprechen<br />
der marktwirtschaftlichen<br />
Ordnung der Bundesrepublik Deutschland.<br />
(1)<br />
Mögliche Aufgaben:<br />
a) Soll das „Recht auf Arbeit“ durch die<br />
Verfassung garantiert werden? Begründen<br />
Sie Ihre Meinung.<br />
b) Warum ist das „Recht auf Arbeit“ ohne<br />
die „Verpflichtung zur Arbeit“ nicht<br />
realisierbar?<br />
c) Zeigen Sie das Spannungsverhältnis<br />
zwischen einem garantierten Recht auf<br />
Arbeit und der sozialen Marktwirtschaft<br />
auf.<br />
Anmerkungen zu einzelnen<br />
Materialien<br />
Streitgespräch bei Familie Schulze:<br />
Die thesenartige Zusammenfassung der<br />
fünf Stellungnahmen kann folgendermaßen<br />
lauten:<br />
Großmutter: Das Arbeitsleben in den<br />
fünfziger Jahren war gegenüber heute<br />
zwar anstrengender, aber alle hatten Arbeit<br />
und ein (bescheidenes) Auskommen;<br />
dies sollte uns heute als Beispiel dienen.<br />
14<br />
Timo: Wer keine Arbeit hat, ist einfach zu<br />
anspruchsvoll und bemüht sich zu wenig<br />
um einen Arbeitplatz.<br />
Sabine: Die Verantwortung liegt bei den<br />
Unternehmen; sie müssen - auch unter<br />
Verzicht auf hohen Gewinn - mehr Arbeitsplätze<br />
und Lehrstellen anbieten.<br />
Vater: Bei niedrigen Lohn- und Lohnnebenkosten<br />
gibt es keine Arbeitslosigkeit.<br />
Mutter: Durch steuerfinanzierte Staatsaufträge<br />
kann Nachfrage geschaffen und die<br />
Arbeitslosigkeit behoben werden.<br />
Arbeitszeitverkürzung<br />
Unterschied zwischen Arbeitslosengeld und Arbeitslosenhilfe<br />
Aus der Verfassung der ehemaligen DDR<br />
In der Diskussion über die Wege aus<br />
der Arbeitslosigkeit spielt die Arbeitszeitverkürzung<br />
eine wichtige Rolle; insbeson-<br />
Arbeitslosengeld<br />
Leistung der gesetzlichen Arbeitslosenversicherung<br />
Anspruchberechtigung des Arbeitslosen (unter bestimmten Voraussetzungen)<br />
Höhe abhängig von dem früheren Lohn und von der Dauer der Arbeitslosigkeit<br />
Finanzierung durch die Bundesanstalt für Arbeit (Arbeitslosenversicherung)<br />
Arbeitslosenhilfe<br />
Fürsorgeleistung<br />
nur bei Bedürftigkeit<br />
anhängig vom Vermögen und anderen Einnahmen (auch der Familienangehörigen)<br />
steuerfinanziert durch den Bund<br />
(vgl. Baustein A)<br />
Artikel 24<br />
(1) Jeder Bürger der Deutschen Demokratischen Republik hat das Recht auf Arbeit.<br />
Er hat das Recht auf einen Arbeitsplatz und dessen freie Wahl entsprechend den gesellschaftlichen<br />
Erfordernissen und der persönlichen Qualifikation ...<br />
(2) Gesellschaftlich nützliche Tätigkeit ist eine ehrenvolle Pflicht für jeden arbeitsfähigen<br />
Bürger. Das Recht auf Arbeit und die Pflicht zur Arbeit bilden eine Einheit.<br />
(....)<br />
Aus dem Kommentar zur Verfassung (Artikel 24)<br />
Wie im Absatz 2 festgelegt wird, ist gesellschaftlich nützliche Tätigkeit eine ehrenvolle<br />
Pflicht für jeden arbeitsfähigen Bürger, bilden das Recht auf Arbeit und die<br />
Pflicht zur Arbeit eine Einheit (...)<br />
Die Fälle, in denen die sozialistische Gesellschaft als letztes Mittel staatlichen<br />
Zwang anwendet, um einen Bürger an geregelte nützliche Arbeit heranzuführen und<br />
die Pflicht zur Arbeit durchzusetzen, sind im Strafgesetzbuch der Deutschen Demokratischen<br />
Republik geregelt. (...) Nach § 249 des Strafgesetzbuches macht sich<br />
strafbar, „wer das gesellschaftliche Zusammenleben der Bürger oder die öffentliche<br />
Ordnung dadurch gefährdet, dass er sich aus Arbeitsscheu einer geregelten Arbeit<br />
hartnäckig entzieht, obwohl er arbeitsfähig ist (...)“ Die Mittel des Strafrechts kommen<br />
zur Anwendung, wenn alle anderen Bemühungen der Gesellschaft zur Erziehung<br />
arbeitsscheuer Personen keinen Erfolg haben.<br />
Sorgenicht, Klaus u.a. (Hg.): Verfassung der Deutschen Demokratischen Republik. Dokumente-<br />
Kommentar, Band II, Berlin (Staatsverlag der Deutschen Demokratischen Republik) 1969, S.<br />
64 f., S. 76 und S. 78.<br />
dere die Gewerkschaften erwarten davon<br />
einen regelrechten Beschäftigungsboom.<br />
„Ohne intelligente Modelle der Arbeitszeitverkürzung<br />
werden die Massenarbeitslosigkeit<br />
und die mit ihr wachsende Armut<br />
nicht zu überwinden sein. Denn<br />
selbst bei optimaler Ausnützung der<br />
Wachstumschancen führt die hohe Produktivitätsentwicklung<br />
nicht zu ausreichendem<br />
Jobwachstum<br />
(Rudolf Hickel; zitiert nach Butterwegge, Christoph:<br />
Wohlfahrtsstaat im Wandel, Opladen<br />
1999, S. 163).<br />
Freilich ist auch dieser Vorschlag nicht<br />
frei von Problemen. Die Schülerinnen und<br />
Schüler können selbstständig die Auswirkung<br />
unterschiedlicher Formen der Arbeitszeitverkürzung<br />
- aufgeschlüsselt nach<br />
den Betroffenen - zusammenstellen. Das<br />
Schema auf S. 15, das man gegebenenfalls<br />
auch als Vorschlag für ein Tafelbild<br />
verwenden kann, strukturiert die Ergebnisse.<br />
(Die kursiv gesetzten Eintragungen<br />
geben die erwarteten Antworten der Schülerinnen<br />
und Schüler wieder.)<br />
Wiederholen – Stellung<br />
nehmen<br />
Die von den Schülerinnen und<br />
Schülern vorgeschlagenen Überschriften<br />
für die zwei Karikaturen sollen das gewonnene<br />
Problembewusstsein nachweisen;<br />
den Originalen waren folgende Texte<br />
beigegeben:<br />
(1) Vgl. Friedrich, Horst/Wiedemeyer, Michael: Arbeitslosigkeit ein Dauerproblem im vereinten Deutschland, Opladen 1994, S. 51 - 53.
a) „Es geht zu Ende. Schon ein Zentimeter<br />
geschrumpft“ (S. 23)<br />
b) „Das Experiment“ (S. 24)<br />
Bei der Übung sollten folgende Spalten<br />
angekreuzt werden:<br />
Richtig: 3, 7, 8, 11, 13, 14<br />
Falsch: 1, 2, 4, 5, 6, 9, 10, 12.<br />
Die Situation auf dem ostdeutschen<br />
Arbeitsmarkt<br />
Ab 1996 verschlechterte sich der<br />
(ostdeutsche) Arbeitsmarkt erneut, und<br />
seitdem ist keine entscheidende Wende<br />
eingetreten ... Die wesentlichen Gründe<br />
für die anhaltenden Schwierigkeiten<br />
sind: Die überdimensionale Bauwirtschaft,<br />
die zwischendurch die Lokomotive<br />
des Aufholprozesses war,<br />
schrumpft nach Einschränkungen der<br />
Subventionen entsprechend stark.<br />
Auch der öffentliche Dienst baut weiter<br />
Personal ab. Dass sich das verarbeitende<br />
Gewerbe inzwischen kräftig belebt<br />
und zuletzt auch bei der Beschäftigung<br />
zugelegt hat, stellt - wegen seiner<br />
geringen gesamtwirtschaflichen Bedeutung<br />
- kein ausreichendes Gegengewicht<br />
dar. Der Dienstleistungsbereich<br />
expandiert ebenfalls, aber auch<br />
nicht stark genug ...<br />
Zehn Jahre nach der Wiedervereinigung<br />
krankt der Arbeitsmarkt in den<br />
neuen Ländern immer noch. Weitere<br />
Hilfen sind also von Nöten, insbesondere<br />
zur Schaffung von Arbeitsplätzen<br />
am ersten Arbeitsmarkt ... Erforderlich<br />
ist aber auch der Abbau von Kostennachteilen<br />
sowie von Wettbewerbsund<br />
Produktivitätsrückständen aus eigener<br />
Kraft. So lange z.B. die ostdeutschen<br />
Lohnstückkosten durchschnittlich<br />
gut 10 Prozent über denen des<br />
Westens liegen, kann ein breiter selbsttragender<br />
Aufschwung nicht erwartet<br />
werden.<br />
Bundesanstalt für Arbeit (Hg.): Presseinformation<br />
vom 5. Oktober 2000, S. 20f.<br />
Möglichkeit<br />
Arbeitszeitverkürzung<br />
Folgen und Probleme für<br />
Arbeitnehmer Unternehmen Gesellschaft<br />
Teilzeitbeschäftigung/ unzureichende höhere Investitions- Verringerung<br />
Jobsharing soziale Absicherung kosten der Arbeitslosigkeit<br />
weniger Lohn Störung des Einsparung von<br />
Produktionsprozesses für die Arbeitslosen<br />
freiere Zeitgestaltung höhere Produktivität<br />
(belastbarere Mitarbeiter)<br />
Senkung der Wochen- weniger Lohn Zwang zur ungewisser Bearbeitszeit<br />
Rationalisierung schäftigungseffekt<br />
Verlängerung der mehr Freizeit höhere Kosten höhere Belastung<br />
Jahresurlaubszeit<br />
Probleme bei der<br />
Anpassung der Arbeitsorganisation<br />
Nachteile für Kleinbetriebe<br />
der gesetzlichen Versicherungssysteme<br />
Verkürzung der Einbußen bei den Missverhältnis zwischen Verringerung der<br />
Lebensarbeitszeit Löhnen und bei der Ausbildungsaufwen- Arbeitslosigkeit<br />
Altersversicherung dungen und Lebensleistung<br />
der Arbeitnehmer<br />
längerer „Lebens- jüngere und leistungs- vermehrte Freizeitabend“<br />
fähigere Mitarbeiter angebote für ältere<br />
Menschen<br />
Die Kluft zwischen West und Ost<br />
im Jahr 2000<br />
West<br />
Ost<br />
West<br />
Ost<br />
Wochenarbeitszeit<br />
37,4 Stunden<br />
39,1<br />
Stunden<br />
Arbeitslosenquote<br />
7,8 %<br />
17,4 %<br />
Wirtschafts-<br />
Wirtschafts-<br />
leistung*<br />
je Einwohner<br />
100<br />
= West- West-<br />
deutschland<br />
73<br />
West Ost<br />
Tarif- Tarif-<br />
verdienste<br />
91<br />
Rente<br />
© Globus<br />
87<br />
*Bruttoinlandsprodukt<br />
6896<br />
15
Baustein C<br />
Zur Zukunft der<br />
Rente - Hält der Generationenvertrag?<br />
Die Ziele des Bausteins<br />
Wer als Politiklehrer versucht, die aktuelle<br />
Rentendiskussion mit ihren schwer<br />
durchschaubaren Begriffen wie „Rentenniveau“<br />
, „Eckrentner“ oder „demografischer<br />
Faktor“ für Schüler anschaulich aufzubereiten,<br />
fragt sich sehr schnell, ob das<br />
„schwierigste sozialpolitische Thema“ 1<br />
überhaupt für die <strong>Schule</strong> geeignet ist. Und<br />
bringen Jugendliche, die vielleicht gerade<br />
beginnen, sich über Studium oder Berufsausbildung<br />
Gedanken zu machen, dem<br />
Thema Altersvorsorge genügend Interesse<br />
entgegen?<br />
Eine Flut von teilweise dramatisierenden<br />
Berichten und Büchern zum Thema<br />
Rente (vgl. C 1) hat inzwischen die Aufmerksamkeit<br />
auch vieler junger Menschen<br />
geweckt: Nach allgemein verbreiteter Ansicht<br />
braucht sich zwar die heutige Rentnergeneration<br />
um ihre Rente keine gravierenden<br />
Sorgen zu machen, aber viele junge<br />
Menschen fragen sich mittlerweile, ob<br />
sie zur Finanzierung der steigenden Rentenlast<br />
nicht über Gebühr zur Kasse gebeten<br />
werden, ob die Rente auch in ferner<br />
Zukunft sicher und ausreichend sein wird.<br />
Die demografische Entwicklung und der<br />
„Generationenvertrag“ bewirken, dass die<br />
Menschen in Deutschland bereits in jungen<br />
Jahren von diesem Thema betroffen<br />
sind; und zunehmend macht es sie auch<br />
betroffen.<br />
• Der Baustein C möchte diese Betroffenheit<br />
aufgreifen; die Frage nach dem<br />
Generationenverhältnis steht deshalb<br />
am Anfang (vgl. C 1-6).<br />
• Um der Problemtiefe einigermaßen gerecht<br />
zu werden, muss in einem zweiten<br />
Schritt über die Gesetzliche Rentenversicherung<br />
in Deutschland (als<br />
Teil des gesamten Sozialversicherungssystems)<br />
informiert werden (vgl.<br />
C 7-11).<br />
• Ausmaß und Ursachen der Finanzierungsprobleme<br />
der Rentenkasse können<br />
die Schüler anschließend anhand<br />
von Statistiken selbst erarbeiten (vgl.<br />
C 12-16).<br />
• Sie sollen sich aber auch Gedanken<br />
über die Gerechtigkeit unseres Rentensystems<br />
machen. Sind die Lasten zwischen<br />
Jung und Alt, zwischen Mann<br />
und Frau gerecht verteilt? (vgl. C 17-<br />
21)<br />
16<br />
Struktur des Bausteins -<br />
Möglicher Unterrichtsverlauf<br />
Einstiegsmöglichkeiten<br />
Basiswissen aneignen<br />
Die sozialpolitische<br />
Problematik erarbeiten<br />
und beschreiben<br />
Die Notwendigkeit<br />
einer<br />
Veränderung erkennen<br />
Reformalternativen<br />
kennenlernen<br />
und vergleichen<br />
Reformmodelle bewerten;<br />
den eigenen<br />
Standpunkt begründen<br />
• Schließlich sollen die Schüler Lösungsansätze<br />
kennenlernen und diskutieren.<br />
In Baustein C werden Reformmöglichkeiten<br />
innerhalb des gesetzlichen<br />
Rentensystems (z.B. Rentenalter)<br />
als auch systemsprengende Alternativen<br />
(z. B. Grundrente) vorgestellt (vgl.<br />
C 22-28).<br />
• Am Ende sollten die Schüler eine eigene<br />
begründete Position zur Zukunft der<br />
Altersvorsorge in Deutschland formulieren<br />
und verteidigen können.<br />
„Krise“ der Rentenversicherung?<br />
Wie sicher sind die Renten? Hält der<br />
Generationenvertrag? Befindet sich unser<br />
Rentensystem in einer Krise? Um diese<br />
Fragen beantworten zu können, muss man<br />
sich zunächst die Struktur und Funktionsweise<br />
der Alterssicherung in Deutschland<br />
vergegenwärtigen.<br />
Familie Schulze diskutiert:<br />
Generationenverhältnis (C1,2)<br />
Rente früher und heute (C3-5);<br />
Meinungen der Schüler (C6)<br />
Die Prinzipien der Gesetzlichen<br />
Rentenversicherung: leistungsbezogene<br />
und dynamische Rente;<br />
Generationenvertrag (C7-11)<br />
Ist die GRV<br />
zukünftig<br />
noch<br />
finanzierbar?<br />
(C12-17)<br />
Reformbedarf in der<br />
Altersvorsorge (C22)<br />
- Grundrente<br />
- Kapitaldeckung<br />
- Änderungen im<br />
Umlageverfahren<br />
(C23-29)<br />
Ist die<br />
GRV gerecht?<br />
(C18-21)<br />
Beurteilen anhand der Kriterien:<br />
(1) Effizienz, Rendite<br />
(2) intergenerative Gerechtigkeit<br />
(3) innergenerative Gerechtigkeit<br />
Die Altersvorsorge erfolgt in Deutschland<br />
durch die Gesetzliche Rentenversicherung,<br />
durch Betriebsrenten und ergänzende<br />
Privatvorsorge, was oftmals als<br />
„Drei-Säulen-System“ bezeichnet wird.<br />
Der Begriff verdeckt allerdings die Tatsache,<br />
dass diese drei Säulen sehr unterschiedlich<br />
ausgeprägt sind. Rund 70 Prozent<br />
aller Aufwendungen für die Alterssicherung<br />
entfallen auf die Gesetzliche<br />
Rentenversicherung. Dies entspricht etwa<br />
einem Drittel der gesamten Sozialausgaben.<br />
(siehe Seite 17)<br />
1 Schmähl, Winfried: Auf dem Weg zur nächsten<br />
Rentenreform in Deutschland; in: Aus Politik<br />
und Zeitgeschichte, B35–36/2000, S. 2
Die Zeit Nr. 26, vom 21. Juni 2000, S. 22<br />
(in Prozent; bezogen auf alle, die Privatvorsorge<br />
getroffen haben)<br />
Die mit Abstand wichtigste „Säule“<br />
der Alterssicherung ist 1889 im Rahmen<br />
der Bismarckschen Sozialgesetzgebung<br />
eingeführt worden und bis heute am Modell<br />
der Sozialversicherung ausgerichtet:<br />
Pflichtversichert sind alle abhängig Beschäftigten<br />
mit einem Einkommen bis zu<br />
einer gesetzlich festgelegten Bemessungsgrenze<br />
(vgl. A8). Finanziert wird die Rente<br />
durch gleiche Beiträge der Arbeitgeber<br />
und Arbeitnehmer (19,3 Prozent im Jahr<br />
2000; vgl. A8) nach dem Umlageverfahren;<br />
das heißt, die Rentenbeiträge der Erwerbstätigen<br />
werden unmittelbar an die<br />
Ruheständler weitergereicht. Darüber hinaus<br />
leistet der Bund Zuschüsse aus Steuermitteln.<br />
Es handelt sich um eine leistungsbezogene<br />
Rente, da die Höhe des<br />
monatlichen Ruhegeldes sich im Wesentlichen<br />
nach den geleisteten Beiträgen und<br />
damit dem jeweiligen Bruttolohn des Versicherten<br />
richtet. Ziel der gesetzlichen<br />
Rentenversicherung ist es, den Lebensstandard<br />
der Erwerbstätigen auch im Alter<br />
und bei Invalidität zu sichern.<br />
Die Rentenversicherung wurde zwar<br />
häufig reformiert (vgl. C2), blieb aber im<br />
Kern über ein Jahrhundert erhalten. Heute<br />
sind ihre (Finanzierungs-)Probleme aber<br />
derart gewachsen, dass manche Kommentatoren<br />
bereits das Ende der gesetzlichen<br />
Rentenversicherung prophezeien: So<br />
mahnte der Rentenexperte Wolfgang Borchert<br />
mit dem bewusst provokativen Titel<br />
„Rente vor dem Absturz. Ist der <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
am Ende?“ bereits vor Jahren eine<br />
grundlegende Reform der Alterssicherung<br />
in Deutschland an. 2 Auch die von der<br />
Bundesregierung eingesetzte Rentenreformkommisssion<br />
spricht in ihrem Gutachten<br />
von einer dramatischen Lage: „Die<br />
gesetzliche Rentenversicherung, ein Kernstück<br />
des deutschen <strong>Sozialstaa</strong>tes, treibt in<br />
die Krise, wenn nicht eine grundlegende<br />
Reform vorgenommen wird. Demographische<br />
und wirtschaftliche Veränderungen<br />
setzen das überkommene System der Umlagefinanzierung<br />
hohen Gefahren aus, die<br />
es nicht unbeschadet überstehen kann.“ 3<br />
Weshalb ist die Rentenversicherung in<br />
eine Krise geraten? Während die Politik<br />
am Generationenvertrag festgehalten hat,<br />
haben sich seit Einführung der Gesetzlichen<br />
Rentenversicherung (am Ende des<br />
vorletzten Jahrhunderts!) die Rahmenbedingungen<br />
für die Alterssicherung tiefgreifend<br />
verändert:<br />
Zeichnung: Mester Stuttgarter Zeitung vom 24.5.2000<br />
● Aufgrund der demografischen Entwicklung<br />
in Deutschland stehen immer<br />
mehr Rentner immer weniger Beitragszahlern<br />
gegenüber. Seit Mitte der 60er<br />
Jahre sinken die Geburtenzahlen,<br />
während die steigende Lebenserwartung<br />
zu einer Alterung der Bevölkerung<br />
beiträgt. Die Deutschen gehören<br />
mit einem durchschnittlichen Alter von<br />
39,7 Jahren zu den ältesten Bevölkerungen<br />
auf der Welt (Weltbevölkerung<br />
im Durchschnitt: 26,4 Jahre). Auf hundert<br />
Einwohner zwischen 20 und 60<br />
Jahren kommen in Deutschland heute<br />
40 Menschen, die über 60 Jahre alt<br />
sind. Im Jahr 2050 werden es doppelt<br />
so viele alte Menschen sein.<br />
● Die jüngere und mittlere Generation<br />
sieht sich durch diese Entwicklung<br />
steigenden Belastungen ausgesetzt und<br />
muss gleichzeitig damit rechnen, dass<br />
sie mit dem Eintritt ins Rentenalter<br />
nicht annähernd so viel ausbezahlt bekommt,<br />
wie sie an Beiträgen einbezahlt<br />
hat. Die Forderung nach intergenerativer<br />
Gerechtigkeit, einer gleichmäßigen<br />
Belastung aller Generationen<br />
bei der Alterssicherung, wird deshalb<br />
immer lauter.<br />
● Zu den aktuellen Herausforderungen<br />
zählt auch die anhaltend hohe Arbeitslosigkeit<br />
(vgl. Baustein B), die für die<br />
Rentenversicherung nicht nur geringere<br />
Einnahmen bedeuten, sondern auch<br />
größere Ausgaben infolge der „Frühverrentung“<br />
(vgl. C 14).<br />
● Vor dem Hintergrund der Globalisierung<br />
wird die Senkung der Lohnnebenkosten<br />
und damit auch der Rentenbeiträge<br />
angemahnt. International<br />
wettbewerbsfähig bleibe Deutschland<br />
nur, wenn die Sozialabgaben spürbar<br />
gesenkt würden.<br />
● Der Wandel der Arbeitswelt hat zu einer<br />
deutlichen Zunahme der Frauenerwerbstätigkeit,<br />
der Teilzeitarbeit und<br />
der flexiblen Beschäftigungsformen<br />
(z.B. zeitweilige Selbstständigkeit) geführt.<br />
● Daneben sind soziale Veränderungen<br />
(z.B. die Zunahme alleinerziehender<br />
Frauen) Grund für die Forderung nach<br />
einer eigenständigen und gerechten Alterssicherung<br />
der Frauen und einer individuell<br />
zu gestaltenden Altersvorsorge.<br />
17
Welche Alternativen gibt es?<br />
Wenn heute auch von allen Seiten die<br />
Notwendigkeit einer Rentenreform betont<br />
wird, so gehen die Vorstellungen, wie die<br />
Altersvorsorge zukünftig zu gestalten sei,<br />
doch erheblich auseinander. Neben vielen<br />
Vorschlägen, die einen „Kurswechsel von<br />
fünf Prozent“ (vgl. E23), also eine schrittweise<br />
und behutsame Anpassung befürworten,<br />
gibt es auch Stimmen, die eine<br />
grundsätzliche Kehrtwende bei der Altersvorsorge<br />
fordern. Die am häufigsten genannten<br />
Alternativen sind das Kapitaldeckungsverfahren<br />
und die Grundrente.<br />
Auch wenn eine radikale Abkehr vom<br />
Umlageverfahren politisch derzeit nicht<br />
mehrheitsfähig ist, so scheint die Behandlung<br />
klarer Alternativen zum hergebrachten<br />
System der Alterssicherung aus didaktischen<br />
Gründen durchaus sinnvoll. Durch<br />
den Vergleich von deutlich unterschiedlichen<br />
Reformmodellen können Vor- und<br />
Nachteile - auch des bisherigen Rentensystems<br />
- am besten erfasst werden.<br />
Im folgenden sind die wichtigsten Argumente<br />
für und gegen die beiden Alternativmodelle<br />
aufgelistet (vgl. auch C25-<br />
27; E 22):<br />
1) Der erste Vorschlag sieht vor, die gesetzliche<br />
Rentenversicherung in ein<br />
System der steuerfinanzierten Grundrente<br />
umzuwandeln, bei dem alle Bürger<br />
- ungeachtet ihres Einkommens -<br />
den gleichen Rentenanspruch haben.<br />
Die staatliche Altersvorsorge soll nach<br />
diesem Modell ausschließlich Altersarmut<br />
vermeiden (Mindestsicherung),<br />
nicht aber den im Berufsleben erworbenen<br />
Lebensstandard sichern.<br />
Für die Grundrente spricht:<br />
● Die Grundrente bewahrt alle Bürger<br />
vor existentieller Not im Alter, und<br />
zwar unabhängig von den demografischen<br />
und wirtschaftlichen Entwicklungen.<br />
● Die Beschränkung auf eine Grundsicherung<br />
im Alter ermöglicht eine individuell<br />
unterschiedliche, frei gewählte<br />
Privatvorsorge.<br />
● Dadurch wird die Eigenverantwortlichkeit<br />
gestärkt.<br />
● Die Senkung der Lohnnebenkosten<br />
stärkt den Wirtschaftsstandort<br />
Deutschland.<br />
● Männer und Frauen, Erwerbstätige und<br />
Nichterwerbstätige, Beschäftigte in der<br />
Privatwirtschaft und im öffentlichen<br />
Dienst, Selbständige und abhängig Beschäftige<br />
werden gleichbehandelt.<br />
Einwände gegen die Einführung einer<br />
Grundrente:<br />
● Steigende Lebenserwartung und hohe<br />
Arbeitslosigkeit erhöhen auch bei der<br />
18<br />
Grundrente die Finanzierungskosten.<br />
Sie löst keines der beiden wichtigsten<br />
Probleme der gesetzlichen Rentenversicherung.<br />
● Eine Übergangsphase würde erhebliche<br />
Mehrbelastungen mit sich bringen:<br />
Niedrige Renten müssten angehoben<br />
werden, höhere müssten wegen des<br />
Besitzschutzes weiterbezahlt werden.<br />
Außerdem würden auch bislang nicht<br />
versicherte Personen eine Grundrente<br />
erhalten.<br />
● Eine zusätzliche private Vorsorge wäre<br />
in der Übergangsphase wegen dieser<br />
erhöhten Abgabenbelastung kaum finanzierbar.<br />
● Vielfach fehlen auch die Bereitschaft<br />
und die Möglichkeit, freiwillig einen<br />
Teil des Einkommens für die Altervorsorge<br />
aufzuwenden.<br />
● Ausstieg aus dem Erwerbsleben und<br />
Schwarzarbeit, nicht aber Leistung<br />
würden durch die Grundrente belohnt.<br />
● Die Grundrente wird auch an die (Reichen)<br />
bezahlt, die sie nicht benötigen.<br />
2) Im Unterschied zum Umlageverfahren<br />
der gesetzlichen Rentenversicherung<br />
werden beim Kapitaldeckungsverfahren<br />
die Beiträge der Erwerbstätigen<br />
nicht für die Finanzierung der laufenden<br />
Renten verwendet, sondern zu einem<br />
Kapitalvermögen angespart; aus<br />
diesem Vermögen und den Kapitalerträgen<br />
(z.B. Zinsen) werden dann die<br />
laufenden Renten finanziert.<br />
Für das Kapitaldeckungsverfahren sprechen<br />
folgende Argumente:<br />
● Bei einer Umstellung der Alterssicherung<br />
auf das Kapitaldeckungsverfahren<br />
muss das Sparaufkommen erhöht werden.<br />
Dies stärkt die Investitionskraft<br />
der Unternehmen und trägt zum<br />
Wirtschaftswachstum bei.<br />
● Die Rendite einer kapitalgedeckten<br />
Rente ist höher (als beim Umlageverfahren).<br />
● Das Kapitalstockverfahren vermeidet<br />
intergenerative Ungerechtigkeiten,<br />
weil man nur für seine eigene Rente<br />
aufkommt.<br />
Gegen das Kapitaldeckungsverfahren<br />
spricht:<br />
● Die Generation, die den Kapitalstock<br />
für ihre eigene Altersvorsorge aufbaut,<br />
müsste gleichzeitig nach dem Umlageverfahren<br />
die Ansprüche der Rentner<br />
finanzieren und wäre doppelt belastet.<br />
● Eine vollständige Umstellung auf das<br />
Kapitaldeckungsverfahren würde einen<br />
Kapitalstock von ca. 10 bis 15 Billionen<br />
DM(!) erfordern. Das entspricht<br />
dem zwei- bis dreifachen des gesamten<br />
gesparten Geldvermögens aller priva-<br />
ten Haushalte in Deutschland. Eine so<br />
große Kapitalmenge könnte zusätzlich<br />
weder angespart, noch sinnvoll angelegt<br />
oder bei Bedarf wieder „entspart“ ,<br />
werden.<br />
● Anlagemöglichkeiten in diesem Umfang<br />
sind im Inland nicht ausreichend<br />
vorhanden und im Ausland mit (Wechselkurs-)Risiken<br />
behaftet.<br />
● Kapitalanlagen sind langfristig inflationsanfällig<br />
und unterliegen Wertschwankungen.<br />
● Auch beim Kapitaldeckungsverfahren<br />
muss bei steigender Lebenserwartung<br />
mit höheren Beiträgen und geringeren<br />
Leistungen gerechnet werden.<br />
● Bei einer schrumpfenden Bevölkerung<br />
muss mehr Kapital „entspart“ werden,<br />
was zu einem Wertverfall des Kapitals<br />
führen kann.<br />
● Wenn die Wirtschaft nicht zu einer<br />
ständigen Wohlstandsvermehrung<br />
führt (Grenzen des Wachstums) halten<br />
sich Beitragszahlungen und Rentenauszahlungen<br />
letztlich die Waage; d.h.<br />
es besteht kein Vorteil gegenüber dem<br />
Umlageverfahren.<br />
Rentenreform 2000/2001<br />
Unter dem Begriff „Rentenreform<br />
2000“ hat die Bundesregierung ein<br />
Mischsystem aus gesetzlicher Rentenversicherung<br />
und kapitalgedeckter privater<br />
Eigenvorsorge zur Diskussion gestellt und<br />
ein entsprechendes Gesetz auf den Weg<br />
gebracht (Stand: Januar 2001). Geplant ist<br />
eine schrittweise Senkung des Rentenniveaus,<br />
verbunden mit dem Aufbau einer<br />
privaten, freiwilligen Altersvorsorge, die<br />
aus Steuermitteln gefördert wird (vgl.<br />
C28). Mit dem Einstieg in die private<br />
Vorsorge als Ergänzung zur gesetzlichen<br />
Rente nähert sich die Altersvorsorge in<br />
Deutschland dem niederländischen System,<br />
das mit einem „Renten-Mix“ aus<br />
gesetzlicher Rente, obligatorischer Betriebsrente<br />
und privater Zusatzvorsorge<br />
gute Erfahrung gemacht hat.<br />
Eine Unterrichtseinheit zum Thema<br />
Altervorsorge sollte am Ende in eine fundierte<br />
Diskussion der aktuellen Rentenreform<br />
münden. Die Erörterung der oben<br />
beschriebenen Alternativen ist dafür eine<br />
gute Grundlage und Vorbereitung.<br />
Aktuelle und ausführliche Informationen<br />
zur Rentenreform enthält die<br />
Internet-Seite des Bundensministeriums<br />
für Arbeit und Sozialordnung:<br />
www.bma.bund.de)
Unterrichtspraktische Hinweise (Anmerkungen zu einzelnen Materialien)<br />
1) Die Rentenformel (C 10)<br />
Sollte für eine eingehende Behandlung der Rentenformel, wie in C 10 vorgesehen, keine Zeit zur Verfügung stehen, so kann das<br />
folgende Tafelbild* eine schnelle Orientierung über die Faktoren bieten, welche die Rentenhöhe bestimmen.<br />
Zahl der Arbeitsjahre<br />
Bruttolohn<br />
Kindererziehung<br />
Zeiten der Ausbildung,<br />
des Wehr- oder<br />
Ersatzdienstes u.a.<br />
Persönliche Entgeltpunkte<br />
Altersrente<br />
(= 100 %)<br />
oder<br />
* vgl. Frankfurter Rundschau v. 14.4.2000, S. 13<br />
2) Die „Rentenkasse“ (H15)<br />
Das Arbeitsblatt auf S. 32 kann den<br />
Schülern die Konsequenzen des Generationenvertrags<br />
verdeutlichen. Die Renten<br />
werden nach dem Umlageverfahren laufend<br />
durch die Beiträge der Versicherten<br />
(ergänzt durch einen Staatszuschuss) finanziert.<br />
Die Aufstellung soll der<br />
falschen, aber verbreiteten Ansicht entgegenzutreten,<br />
die Beiträge der Erwerbstätigen<br />
würden in einer „Rentenkasse“ angespart<br />
und bei Eintritt ins Rentenalter mit<br />
entsprechenden Erträgen ausbezahlt. Die<br />
gesetzlich vorgeschriebene Reserve der<br />
Rentenversicherer beträgt lediglich die<br />
Rentenzahlung eines Monats; weitere<br />
Rücklagen sind nicht vorhanden.<br />
Die Schüler können mittels C 15 die<br />
verschiedenen Ursachen für die „Krise<br />
der Rente“ (z.B. Bevölkerungsentwicklung,<br />
Renteneintrittsalter, Arbeitslosigkeit)<br />
selbstständig zusammentragen. Sie<br />
erkennen in der Aufstellung leicht, dass es<br />
ganz unterschiedliche Ursachen für die<br />
Finanzierungsprobleme in der Rentenversicherung<br />
gibt.<br />
Schließlich können die Schüler mit<br />
Hilfe des Arbeitsblatts auch gezielt Maßnahmen<br />
zur Reform der Rentenversicherung<br />
entwickeln, die jeweils bei einer der<br />
genannten Ursachen ansetzen. Dabei werden<br />
auch „Verteilungskämpfe“ zwischen<br />
Jung und Alt, zwischen Rentnern und<br />
Beitragszahlern deutlich.<br />
Berufsunfähig-keitsrente<br />
(=66 %)<br />
Mit diesem Betrag wird<br />
die Rente jährlich an die<br />
Nettolöhne angepasst.<br />
x Rentenart<br />
x aktueller Rentenwert = monatliche Rente<br />
3) Berechnung der Entgeltpunkte<br />
Lösungen zu Aufgabe 2, Schülerheft Seite 38<br />
Herr Müller Frau Niedermayer<br />
1955 - 1964 10 Jahre x 1,0 EP = 10 1960 - 1969 10 Jahre x 0,75 EP = 7,5 EP<br />
1965 -1969 – 1970 - 1984 2 Kinder x 3 Jahre x 1 EP = 6 EP<br />
Studium (Kindererziehungszeiten)<br />
1970 - 1984 15 Jahre x 1,3 EP = 19,5 1985 - 1989 5 Jahre x 0,5 EP = 2,5 EP<br />
15 Jahre x 1,75 EP = 26,25 1990 - 1999 10 Jahre x 1,2 EP = 12 EP<br />
insg. 55,75 EP insg. 28 EP<br />
Monatsrente Herr Müller:<br />
55,75 EP X 0,892 Zf x 1 (RAF) x 48,29 (aRW 99/00) = 2401,41 DM (Bruttorente West)<br />
Monatsrente Frau Niedermayer:<br />
28 EP x 0,892 Zf x 1 (RAF) x 48,29 (aRW 99/00) = 1206,09 DM (Bruttorente West)<br />
Die Rechenaufgaben sind aufgrund der Komplexität des Themas stark vereinfacht, aber dennoch<br />
eine Möglichkeit, die Prinzipien der gesetzlichen Rentenversicherung an Beispielen zu<br />
konkretisieren und zu prüfen, ob der Schüler die Rentenformel verstanden hat. Im Anschluss an<br />
den Vergleich der beiden ausgewählten Beispiele kann auch die Frage nach Benachteiligung<br />
von Frauen (Familien) in der Gesetzlichen Rentenversicherung diskutiert werden.<br />
19
Die Rentenkasse<br />
zu C 15<br />
20<br />
Einnahmen = Ausgabe<br />
durchschnittliche<br />
Rentenhöhe<br />
Beiträger zu Staatszuschuss Zahl der<br />
x<br />
Rentenversicherung<br />
+ =<br />
Rentenempfänger/innen<br />
x<br />
Zahl der<br />
Beitragszahler<br />
Finanzierungsprobleme und ihre Ursachen:<br />
höhere Renten wegen<br />
a. dynamischer<br />
Rentenanpassung<br />
b. versicherungsfremden<br />
Leistungen<br />
mehr Rentner durch<br />
3. Frühverrentung<br />
Belastung des<br />
Bundeshaushaltes<br />
bei hoher Staatsverschuldung<br />
4. steigende Lebenserwartung<br />
hohe Rentenbeiträge<br />
belasten deutsche<br />
Unternehmen<br />
im internationalen<br />
Wettbewerb<br />
1. weniger Erwerbstätige<br />
infolge hoher<br />
Arbeitslosigkeit<br />
2. weniger Erwerbsfähige<br />
infolge des<br />
Geburtenrückgangs<br />
Mögliche Gegenmaßnahmen:<br />
– Rentenkürzungen bzw.<br />
verlangsamte Erhöhung<br />
– keine Frühverrentung mehr<br />
– Erhöhung des Staatszuschusses<br />
– Steuererhöhung<br />
– Erhöhung des Rentenbeitrages<br />
– allgemeine Leistungskürzungen<br />
bei Renten (z. B. bei der<br />
Krankenversorgung)<br />
– Verlängerung der Lebensarbeitszeit<br />
mehr Erwerbstätige<br />
– Bekämpfung der Arbeitslosigkeit<br />
– Gebrutenzunahme<br />
durch Familienförderung<br />
– Einwanderung
Baustein D<br />
Trotz Sozialhilfe:<br />
Armut in<br />
Deutschland<br />
Ziele des Bausteins<br />
Armut und ihre Folgen sind Schülern<br />
durchaus geläufig und auch im Schulalltag<br />
sichtbar, wenn z.B. Eltern ihren Kindern<br />
die „angesagte“ Markenkleidung, eine<br />
aufwendige Freizeitkultur oder die<br />
Klassenfahrt ins Ausland nicht bezahlen<br />
können. Betroffene Schüler werden im<br />
Unterricht aber kaum ihre eigene Situation<br />
thematisieren wollen und dürfen dazu<br />
vom Lehrer auch nicht gezwungen werden.<br />
Um Armut aber nicht nur als statistische<br />
Größe zu behandeln, sind konkrete<br />
Fallbeispiele an den Anfang des Baustein<br />
gestellt. Die Beschreibung dreier „Armutskarrieren“<br />
soll zeigen, dass sich hinter<br />
den Zahlen sehr unterschiedliche<br />
menschliche Schicksale verbergen(vgl. D<br />
1a-c).<br />
Bevor die Schülerinnen und Schüler<br />
sozialstaatliche Maßnahmen zur Bekämpfung<br />
von Armut erörtern, ist es sinnvoll,<br />
das Ausmaß, die Ursachen und die Folgen<br />
der Armut wenigstens in Grundzügen exemplarisch<br />
kennenzulernen (vgl. D 2-8).<br />
Dabei stößt man unwillkürlich auf das<br />
Problem, dass der Begriff „Armut“ in der<br />
wissenschaftlichen wie öffentlichen Diskussion<br />
sehr unterschiedlich gebraucht<br />
wird. Die Schülerinnen und Schüler können<br />
anhand der Materialien D11 und D12<br />
die wichtigsten Armutsdefinitionen erarbeiten<br />
und ihre Berechtigung und<br />
Brauchbarkeit einschätzen lernen.<br />
In einem weiteren Schritt werden die<br />
Prinzipien und konkrete Ausgestaltung<br />
der Sozialhilfe in Deutschland vorgestellt.<br />
Die Schüler sollen erkennen, dass Sozialhilfe<br />
kein Almosen ist, sondern einen<br />
Rechtsanspruch darstellt, der aus dem Art.<br />
1 des Grundgesetzes abgeleitet wird.<br />
Mit diesen Unterrichtsschritten ist eine<br />
sachliche Diskussion über die Reform der<br />
Sozialhilfe (vgl. D 22-26) solide vorbereitet.<br />
Die Jugendlichen sollten Reformvorschläge<br />
aus der Sicht der Betroffenen,<br />
aber auch aus gesamtgesellschaftlicher<br />
Perspektive beurteilen können.<br />
Armut im <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
Was ist überhaupt Armut?<br />
Die Forschung verwendet verschiedene<br />
Armutsdefinitionen, je nachdem was<br />
Struktur des Bausteins -<br />
Möglicher Unterrichtsverlauf<br />
Möglicher Einstieg (I):<br />
Häufig geäußerte<br />
(Vor-)Urteile über Arme<br />
Möglicher Einstieg (II):<br />
Beschreibungen<br />
von Armut/erste<br />
Überprüfung der<br />
(Vor-)Urteile<br />
Basiswissen und<br />
Kontroverse (I)<br />
Basiswissen und<br />
Kontroverse (II)<br />
Diskussion<br />
mit einer wissenschaftlichen Untersuchung<br />
bezweckt werden soll:<br />
1. Wenn man wissen möchte, wieviel<br />
Geld jemand braucht, um zu überleben,<br />
dann benötigt man ein absolutes Armutsmaß.<br />
Es gibt an, was jemand braucht, um<br />
ausreichend Nahrung und Kleidung einkaufen<br />
und sich eine Wohnung leisten zu<br />
können. Wenn von Armut in Entwicklungsländern<br />
die Rede ist, so ist meist die<br />
absolute Armut gemeint, also ein Mangelzustand,<br />
der es nicht erlaubt, die physische<br />
Existenz dauerhaft zu sichern. Auch<br />
die Sozialhilfe in der Bundesrepublik beruht<br />
letztlich auf einem absoluten Armutsbegriff.<br />
Allerdings legt man bei ihrer Berechnung<br />
nicht nur das physische Existenzminimum<br />
zugrunde. Auch soziale<br />
und kulturelle Bedürfnisse, die Vereinsmitgliedschaft<br />
oder der Kinobesuch, werden<br />
berücksichtigt. Sozialhilfe muss auch<br />
die „Beziehungen zur Umwelt und eine<br />
Teilnahme am kulturellen Leben“ (§ 12,1<br />
Bundessozialhilfegesetz) ermöglichen,<br />
Ausmaß und Ursachen<br />
der Armut (D2,7)<br />
Familie Schulze:<br />
Ein Gespräch über Armut<br />
Fallbeispiele:<br />
Drei Armutskarieren<br />
(D1a –c)<br />
Von Armut besonders<br />
betroffene Gruppen<br />
(Beispiel: Kinder; D2, 6)<br />
Was ist Armut?<br />
Der Streit um die<br />
Definition (D 9 – 14)<br />
Sozialhilfe: Regelungen<br />
und Auseinandersetzung<br />
(D15 – 21)<br />
Müssen wir mit Armut<br />
leben? Vorschläge zur<br />
Bekämpfung der Armut<br />
(Beispiele, D22–26)<br />
Folgen der Armut<br />
(Beispiel: Krank durch<br />
Armut, D5)<br />
denn nur so ist die Führung eines Lebens<br />
möglich, das der Würde des Menschen<br />
entspricht.<br />
2. Anders verhält es sich, wenn man<br />
Armut unter dem Aspekt der Ungleichheit<br />
untersuchen möchte. Dann muss man die<br />
Armen mit der Mittelschicht und den<br />
Wohlhabenden einer bestimmten Gesellschaft<br />
vergleichen. Armut ist in dieser<br />
Sichtweise eine relative Größe, in der<br />
Schweiz anders zu definieren als in Portugal<br />
oder Rumänien. Um Armut überhaupt<br />
international vergleichen zu können, setzt<br />
die Europäische Union die Armutsgrenze<br />
bei 50 Prozent des Durchschnittseinkommens<br />
im jeweiligen Land fest. Jeder, der<br />
im Rahmen des Familieneinkommens weniger<br />
als die Hälfte eines Durchschnittsbürgers<br />
seines Landes zur Verfügung hat,<br />
gilt als arm. Nach dieser Definition gibt es<br />
in Westdeutschland 9,1 Prozent Arme. In<br />
Ostdeutschland sind es 6,2 Prozent - bezogen<br />
auf das ostdeutsche Einkommen.<br />
Angaben für 1997; Statistisches Bundes-<br />
21
amt (Hrsg.): Datenreport 1999, Schriftenreihe<br />
der Bundeszentrale für politische<br />
Bildung Nr. 365, S. 589 f. Vgl. D 13<br />
Würde sich diese Berechnung auf das<br />
westdeutsche Durchschnittseinkommen<br />
beziehen, so wären dagegen 10,1 Prozent<br />
der Ostdeutschen arm.<br />
vgl. Statistisches Bundesamt (Hrsg.): Datenreport<br />
1999. Schriftenreihe der Bundeszentrale<br />
für politische Bildung Band 365, S.589 f.<br />
3. Wenn man Armut empirisch erfassen<br />
und den Anteil der Armen an der Gesamtbevölkerung<br />
feststellen möchte, so<br />
muss man eine - absolute oder relative -<br />
Armutsgrenze festlegen. Zumeist geht<br />
man dabei vom Einkommen und Vermögen<br />
aus. Nach dem Ressourcen-Ansatz<br />
gelten alle Personen als arm, die über kein<br />
ausreichendes Einkommen verfügen, um<br />
das soziokulturelle Existenzminimum zu<br />
sichern. Wo die Schwelle des ausreichenden<br />
Einkommens liegt, ist zwar umstritten,<br />
aber wenn sie einmal politisch festgelegt<br />
wurde, folgt daraus eine einfache und<br />
klare Richtlinie für die Armutsbekämpfung:<br />
Der <strong>Sozialstaa</strong>t muss das zu niedri-<br />
Die Zeit v. 5. 10. 2000, Seite 6<br />
22<br />
Zeichnung:<br />
G. Mester, in:<br />
EU-Magazin<br />
Nr. 5/ 1996, S.<br />
23<br />
ge oder fehlende Einkommen auf die<br />
Höhe des Existenzminimums aufstocken.<br />
4. Schwieriger ist diese Aufgabe, wenn<br />
man nicht nur vom Einkommen ausgeht,<br />
sondern seine Aufmerksamkeit auf die<br />
tatsächliche Lebenslage von Armen richtet.<br />
Die Lebenslage eines Menschen ist<br />
nicht nur vom Einkommen, sondern auch<br />
von der Wohnsituation, den Bildungsmöglichkeiten,<br />
dem Gesundheitszustand,<br />
den Kontaktmöglichkeiten u.a.m. abhängig.<br />
Nach dem Lebenslagen-Konzept gelten<br />
alle jene als arm, die in einer oder<br />
mehrerer Hinsicht an Unterversorgung<br />
leiden, z.B. in unzumutbaren Wohnverhältnissen<br />
leben, unter gesundheitlichen<br />
Beeinträchtigungen leiden oder nur unzureichend<br />
an Lernangeboten oder gesellschaftlichen<br />
Aktivitäten teilnehmen können.<br />
Was Arme in ihrem Alltag an Diskriminierung<br />
und Benachteiligung erleben<br />
und erfahren müssen, ist mit dem Begriff<br />
der „sozialen Ausgrenzung“ sicher angemessener<br />
beschrieben als nur mit dem Begriff<br />
der „Verarmung“. Aber „so richtig<br />
es ist, den Armutsbegriff...auf die verschiedenen<br />
Dimensionen einer Lebensla-<br />
ge auszudehnen und die Multidimensionalität<br />
von Armut zu unterstreichen, so richtig<br />
ist auch: Je stärker der Armutsbegriff<br />
ausgeweitet wird, desto mehr entzieht sich<br />
die Bekämpfung der Armut staatlicher<br />
Sozialpolitik.“<br />
Huster, Ernst-Ulrich, Armut in Europa. Opladen<br />
(Leske+Budrich) 1996, S. 28 f.<br />
Armut in Deutschland<br />
Am Jahresende 1998 erhielten in der<br />
Bundesrepublik 2,91 Millionen Menschen<br />
in 1,51 Millionen Haushalten Sozialhilfe<br />
in Form der „laufenden Hilfe zum Lebensunterhalt“<br />
zur Deckung ihres Grundbedarfs.<br />
Das waren rund 3,5 Prozent der<br />
Bevölkerung.<br />
Alle Zahlenangaben vgl. Statistisches Bundesamt<br />
(www.statistik-bund.de)<br />
Die Sozialhilfequote, das ist der Anteil<br />
der Hilfebezieher an der Bevölkerung, ist<br />
in den alten Bundesländern mit 3,7 Prozent<br />
nach wie vor höher als in den neuen<br />
Ländern und Ostberlin (2,7 %). Die<br />
höchsten Sozialhilfequoten wurden in den<br />
drei Stadtstaaten Bremen (10,0 %), Berlin<br />
(8,3%) und Hamburg (8,3 %) festgestellt.<br />
Die niedrigsten Sozialhilfequoten hatten<br />
Bayern (2,0 %) und Thüringen (2,1,%).<br />
Die Zahl der Sozialhilfeemfpänger ist<br />
über fast zwei Jahrzehnte hinweg gestiegen<br />
und 1998 erstmals wieder geringfügig<br />
rückläufig (0,4 % weniger Hilfeempfänger<br />
als 1997). Der Rückgang 1994 ist ausschließlich<br />
auf eine Änderung im Asylbewerberleistungsgesetz<br />
zurückzuführen,<br />
wonach Asylbewerber, Kriegsflüchtlinge<br />
und ausreisepflichtige Ausländer anstelle<br />
von Sozialhilfe Leistungen nach dem<br />
Asylbewebergesetz erhalten und damit in<br />
der Sozialhilfestatistik nicht mehr geführt<br />
werden.<br />
Ende 1998 gab es in Deutschland 2,23<br />
Millionen deutsche und 676 000 ausländi-
sche Emfpänger von laufender Hilfe zum<br />
Lebensunterhalt. Der Ausländeranteil an<br />
den Sozialhilfeempfängern lag damit bei<br />
23,3 Prozent.<br />
56,2 Prozent aller Sozialhilfeempfänger<br />
sind Frauen. Über eine Million Kinder<br />
und Jugendliche leben in der Bundesrepublik<br />
von Sozialhilfe (vgl. D 4, D 5).<br />
Sozialhilfe = „bekämpfte Armut“?<br />
Besonders umstritten ist die Frage, ob<br />
die Empfänger von laufender Hilfe zum<br />
Lebensunterhalt im Rahmen der Sozialhilfe<br />
noch als „arm“ einzustufen oder als bereits<br />
der Armutslage enthoben und damit<br />
als „nicht-arm“ zu bezeichnen sind. Dies<br />
hängt offensichtlich von dem persönlichen<br />
Werturteil ab, ob man die Höhe der<br />
Sozialhilfe als ausreichend zur Sicherung<br />
eines sozio-kulturellen Existenzminimums<br />
ansieht und ob man die Umstände<br />
der Antragsstellung und des Bezugs<br />
(scharfe Einkommensüberprüfung, Pflicht<br />
zum fast völligen vorhergehenden Vermögensverbrauch,<br />
Erstattungsanspruch des<br />
Sozialamts gegenüber Verwandten ersten<br />
Grades in gerader Linie, Stigmatisierung<br />
in der öffentlichen Meinung) mit der<br />
grundgesetzlich geschützten Würde des<br />
Menschen für vereinbar hält.<br />
Hauser, Richard: Das empirische Bild der Armut<br />
in der Bundesrepublik Deutschland - ein<br />
Überblick. Aus Politik und Zeitgeschichte B 31-<br />
32/95 , S. 5<br />
Hat der <strong>Sozialstaa</strong>t versagt?<br />
Das soziale Netz soll vor Lebensrisiken<br />
schützen und Armut verhindern. Ein<br />
Blick auf die Sozialhilfestatistik (vgl. D3,<br />
D7) offenbart aber Missstände im Sozialsystem:<br />
● Arbeitslosigkeit ist inzwischen die<br />
wichtigste Ursache für Armut. Jeder<br />
Dritte Empfänger von laufender Hilfe<br />
zum Lebensunterhalt bekommt diese<br />
Hilfe, weil er arbeitslos ist. Ein besonders<br />
großes Problem ist die Langzeitarbeitslosigkeit.<br />
Wenn das Arbeitslosengeld<br />
und die Arbeitslosenhilfe endet,<br />
werden diese Menschen in die Sozialhilfe<br />
abgedrängt. Aber schon wer Arbeitslosengeld<br />
bezieht und kinderreich<br />
ist, braucht zusätzlich Sozialhilfe. Hier<br />
versagt die Arbeitslosenversicherung<br />
(vgl. B 10 - B 14).<br />
● Auch die Altersvorsorge reicht in vielen<br />
Fällen nicht aus: Jeder Zehnte<br />
Empfänger von Sozialhilfe hat eine zu<br />
geringe Rente (vgl. D 3).<br />
● Ein weiterer Grund für den Sozialhilfe<br />
bezug ist ein unzureichender Familien-<br />
lastenausgleich besonders bei großen<br />
Familien. 37 Prozent aller Bezieher<br />
von laufender Hilfe zum Lebensunterhalt<br />
sind inzwischen Kinder. Hier ist<br />
der Familienlastenausgleich gefragt.<br />
Um Armut zu bekämpfen müssten also<br />
zunächst einmal die sozialen Sicherungssysteme<br />
„armutsfest“ gemacht werden,<br />
die der Sozialhilfe als „letztem Auffangnetz“<br />
vorgeschaltet sind. So könnte beispielsweise<br />
eine ausreichende Mindestsicherung<br />
innerhalb der Rentenversicherung<br />
Armut im Alter zumindest soweit<br />
bekämpfen, dass den Rentnern der Gang<br />
zum Sozialamt erspart bliebe. Die Arbeitslosigkeit<br />
als wichtigste Ursache für<br />
den Bezug von Sozialhilfe wird sich aber<br />
mit sozialstaatlichen Maßnahmen nur<br />
schwer bekämpfen lassen (vgl. Baustein<br />
B). In diesem Zusammenhang wird häufig<br />
der Vorwurf erhoben, dass Arbeit sich<br />
wegen zu hoher Sozialhilfeleistungen<br />
nicht lohne. Fehle aber ein starker Anreiz,<br />
sich Arbeit zu suchen, weil sich mit Sozialhilfe<br />
vermeintlich „besser“ leben<br />
ließe, so schaffe der <strong>Sozialstaa</strong>t erst jene<br />
Probleme, zu deren Linderung er angetreten<br />
sei. Deshalb wird häufig eine reale<br />
Absenkung der materiellen Hilfsleistungen<br />
gefordert. Zusätzlich solle die Verpflichtung<br />
zur Annahme „zumutbarer“<br />
Arbeit verschärft werden. Nur wenn ein<br />
ausreichender „Lohnabstand“ zwischen<br />
den unteren Lohngruppen und der Sozialhilfe<br />
gewährleistet sei, würde die Arbeitssuche<br />
ernsthaft genug betrieben. Hinter<br />
dieser Forderung steht allerdings die Vorstellung,<br />
dass auch in Zeiten der Massenarbeitslosigkeit<br />
die Beschäftigungslosigkeit<br />
letztlich individuell verschuldet sei.<br />
Wer arbeiten wolle, finde auch Arbeit,<br />
werde aber durch zu „üppig“ ausgestaltete<br />
Sozialleistungen daran „gehindert“. Bei<br />
dieser Frage muss allerdings berücksichtigt<br />
werden, dass die Sozialhilfe nur eine<br />
solche Hilfe zum Lebensunterhalt leistet,<br />
die nötig ist, um ein menschenwürdiges<br />
Leben zu führen (§ 1 Bundessozialhilfegesetz).<br />
Damit ist eine Untergrenze definiert,<br />
die nicht ohne weiteres unterschritten<br />
werden kann.<br />
Eine neue Sozialhilfe?<br />
„In Deutschland liegt der niedrigste<br />
Lohn bei 70 % des Durchschnittslohns, in<br />
den USA bei 30 %. Dies ist der eigentliche<br />
Grund dafür, dass die Unterbeschäftigung<br />
im Bereich der einfachen Arbeit in<br />
Deutschland so groß und in den USA so<br />
klein ist. Einfache Arbeit kostet mehr, als<br />
sie an Werten schaffen kann, und genau<br />
deshalb gibt es von ihr nicht genug.<br />
Der hohe Lohn für die einfache Arbeit<br />
kann auf die Konstruktion der deutschen<br />
Sozialhilfe zurückgeführt werden. Da<br />
man die Sozialhilfe nur dann in voller<br />
Höhe zugesprochen bekommt, wenn man<br />
kein Arbeitseinkommen erhält und da sie<br />
in weiten Bereichen eins zu eins gekürzt<br />
wird, kann der niedrigste Lohn nicht unter<br />
dem Satz der Sozialhilfe liegen.<br />
Eine Sozialhilfe, die nur bezahlt wird,<br />
wenn man eine Arbeit aufnimmt, und die<br />
zudem bis zu einer gewissen Einkommensgrenze<br />
mit dem selbstverdienten<br />
Einkommen steigt, schafft den Anreiz,<br />
auch niedrigbezahlte Jobs anzunehmen.<br />
Der Tariflohn im Bereich der einfachen<br />
Arbeit fällt, und neue Arbeitsplätze werden<br />
geschaffen.<br />
Sinn, Hans-Werner: Institut für Wirtschaftsforschung<br />
e.V., München 15.11.1999<br />
(www.ifo.de)<br />
Die Forschung hat Tendenzen in der<br />
Armutsentwicklung* ausgemacht, die unabhängig<br />
von der Auseinandersetzung<br />
über eine angemessene Höhe der Sozialhilfe<br />
jeden Bürger und politisch Verantwortlichen<br />
in der Bundesrepublik aufrütteln<br />
müssten:<br />
1. die hohen Armutsquoten von Kindern,<br />
die zu sehr ungleichen Startchancen<br />
führen;<br />
2. das hohe Armutsrisiko von Ausländern,<br />
die deren Integrationschancen<br />
verschlechtern;<br />
3. die Konzentration von armen Haushalten<br />
in einzelnen Stadtvierteln, die eine<br />
Herausforderung für den sozialen<br />
Wohnungsbau und die Stadtplanung<br />
darstellt;<br />
4. ein hoher Anteil von „verdeckter Armut“,<br />
d.h. von Personen, die zwar Anspruch<br />
auf Sozialhilfe haben, ihn aber<br />
nicht wahrnehmen (nach Schätzungen<br />
20 bis 50 Prozent!);<br />
5. die zunehmende Anzahl von Wohnungslosen<br />
bzw. Nichtsesshaften (ca.<br />
690 000 Menschen) in der Bundesrepublik<br />
Deutschland.<br />
* In Anlehung an Hauser, Richard: Das empirische<br />
Bild der Armut in der Bundesrepublik<br />
Deutschland - ein Überblick. Aus Politik und<br />
Zeitgeschichte B 31-32/95, S. 3 - 13.<br />
23
Quelle: Allensbacher Archiv, IfD-Umfrage 6046, Juli/August 1997.<br />
Institut für Demoskopie Allensbach. FAZ vom 13. August 1997, Seite 5 (vgl. Arbeitsheft Seite 49).<br />
Unterrichtspraktische<br />
Hinweise - Anmerkung zu<br />
einzelnen Materialien<br />
Populäre Ansichten über Arme<br />
Arme haben infolge fehlender finanzieller<br />
Mittel nicht nur mit Benachteiligungen<br />
zu kämpfen, sie stoßen nicht selten<br />
auch auf Vorbehalte und Vorurteile im<br />
persönlichen Umfeld und in der Gesellschaft.<br />
Zu Beginn der Unterrichtseinheit<br />
ist es sinnvoll, sich die häufig geäußerten<br />
(Vor-) Urteile über Arme bewußt zu machen.<br />
Im Gespräch der Familie Schulze (<br />
vgl. Schülerheft, Seite 39) werden folgende<br />
populäre Ansichten über Arme genannt:<br />
● „Sie sind arm, weil sie faul sind.“<br />
● „Sie sollten dazu gebracht werden,<br />
sich eine Arbeit zu suchen.“<br />
● „Wenn sie nur ihr Geld gespart hätten,<br />
statt es zum Trinken und Spielen zu<br />
verschwenden, wären sie nicht arm.“<br />
24<br />
● „Warum reden sie von der Armut bei<br />
uns? Die wirklichen Probleme gibt es<br />
doch in der Dritten Welt.“<br />
● „Jeder ist seines Glückes Schmied.<br />
Wenn ich es geschafft habe, warum sie<br />
denn nicht auch?“<br />
● „Einmal arm, immer arm. Die Gesellschaft<br />
läßt den Armen keine Chance.“<br />
● „Die Armen sind selbst schuld an ihrer<br />
Lage, weil sie zu passiv und unselbstständig<br />
sind.“<br />
Es empfiehlt sich, dass die Schülerinnen<br />
und Schüler diese (Vor-)Urteile herausarbeiten<br />
und thesenartig zusammenfassen.<br />
Das Familiengespräch motiviert sie,<br />
ihre eigene Meinung frei zu äußern und<br />
die Liste der (Vor-)Urteile zu ergänzen.<br />
In einem weiteren Unterrichtsschritt<br />
sollten dann die aufgeführten Ansichten<br />
mit den biografischen Schilderungen der<br />
Sozialhilfe-Empfänger (D 1a-c) verglichen<br />
werden. Dies könnte ebenso eine Korrektur<br />
der eigenen Einstellung bewirken wie die<br />
Überprüfung der getroffenen Urteile mit<br />
den Statistiken D3, D4 und D7.<br />
Wird das Meinungsbild der Klasse<br />
schriftlich festgehalten, kann am Ende der<br />
gesamten Unterrichtseinheit festgestellt<br />
werden, inwieweit die Beschäftigung mit<br />
dem Thema Armut bei den Schülerinnen<br />
und Schülern eine Einstellungsänderung<br />
bewirkt hat.
Zu D9: Was gehört zu einem menschenwürdigen Leben?<br />
Diese Frage stellte eine Forschungsgruppe 1204 Bürgern in West- und Ostdeutschland. Siehe: Andreß Hans-Jürgen / Lipsmeier, Gero: Was gehört<br />
zum notwendigen Lebensstandard und wer kann ihn sich leisten? Ein neues Konzept zur Armutsmessung. In: Aus Politik und Zeitgeschichte B 31-<br />
32/95, S. 35-49.<br />
Sie sollten die aufgelisteten Güter als „notwendig zum Leben“ oder als „zwar wünschenswert, aber entbehrlich“ charakterisieren (vgl. D 9).<br />
Ausgewählte Ergebnisse der Umfrage: Anteil der Befragten, Anteil der Befragten. Anteil der Sozialhilfeempfänger,<br />
die das Gut für die das Gut für die sich das Gut nicht leisten<br />
unbedingt notwendig halten entbehrlich halten können<br />
(in Prozent) (in Prozent) (in Prozent)<br />
Notwendige Dinge:<br />
11) keine feuchten Wände 87,5 12,3 6,5<br />
12) WC in der eigenen Wohnung 87,2 12,3 2,8<br />
13) Bad oder Dusche in der Wohnung 85,4 14,2 4,7<br />
14) Gas, Wasser, Strom bezahlen können 85,0 14,9 14,4<br />
15) ausreichende Heizung 83,2 16,6 8,3<br />
16) ein Berufsabschluss 81,7 17,5 2,2<br />
17) Mieten/Zinsen zahlen können 79,7 20,1 16,9<br />
18) eine Waschmaschine 79,0 19,5 11,9<br />
19) ein Radio 74,8 22,2 4,9<br />
10) gesunder Arbeitsplatz 68,2 31,8 40,3<br />
11) sicherer Arbeitsplatz 65,6 33,9 60,4<br />
12) gesund leben 65,3 34,4 12,6<br />
13) Altersversorgung (Arbeit) 58,8 40,2 50,7<br />
14) warme Mahlzeit 51,3 42,7 6,0<br />
15) ein Telefon 50,4 39,0 16,5<br />
Entbehrliche Dinge:<br />
16) Spielzeug 49,6 48,6 13,1<br />
17) Kindergarten/Kindergrippe 44,1 54,2 7,5<br />
18) einwöchiger Jahresurlaub 40,8 47,1 48,9<br />
19) Kontakt mit der Nachbarschaft 39,1 55,5 3,4<br />
20) ein Auto 33,8 42,8 44,8<br />
21) auf die Qualität achten 31,5 62,5 44,9<br />
22) guter baulicher Zustand 30,8 65,4 33,9<br />
23) Kinderzimmer 30,4 63,9 29,2<br />
24) alle zwei Tage Fleisch 22,0 53,7 21,7<br />
25) Garten, Balkon, Terrasse 21,5 66,3 13,3<br />
26) gute Wohngegend 20,1 73,2 24,2<br />
27) abends ausgehen 8,1 50,0 40,4<br />
28) neue Möbel 7,6 70,0 56,2<br />
29) neue Kleider kaufen 7,2 60,8 59,1<br />
Die Ergebnisse der repräsentativen Umfrage<br />
können im Unterrichtsgespräch zu<br />
verschiedenen Zwecken genutzt werden:<br />
● Interessant ist sicherlich ein Vergleich<br />
der Umfrage-Ergebnisse mit den Entscheidungen<br />
der Schülerinnen und<br />
Schüler.<br />
● Dieser Vergleich dürfte zwangsläufig<br />
zu einer Diskussion über die Rangfolge<br />
der einzelnen Positionen führen<br />
(Beispiel: Ist ein Radio (Nr. 9) wichtiger<br />
als ein Kindergartenplatz (Nr. 17)<br />
oder ein Kinderzimmer (Nr. 23)?)<br />
● Aufschlussreich ist in diesem Zusammenhang<br />
auch, welche Güter bzw. Lebensbereiche<br />
für die Menschen besonders<br />
wichtig sind (Beispiel: Wohnung<br />
Nr. 1-5,7; Beruf und Arbeit Nr. 6, 10,<br />
11, 13).<br />
● Entscheidend für den Fortgang unserer<br />
Unterrichtseinheit ist aber die Frage:<br />
Was leistet dieser Ansatz für die<br />
schwierige Definition von Armut? Als<br />
arm gilt hier, wer mindestens drei der<br />
genannten „Güter“ nicht hat bzw. sich<br />
nicht leisten kann*. Armut wird somit<br />
als Deprivation, d.h. als Ausschluss eines<br />
Menschen von mehr oder minder<br />
großen Teilen eines allgemein akzeptierten<br />
Lebensstandard definiert. Für<br />
die Beurteilung der Sozialhilfe (vgl. D<br />
15 - 21) ist dieser Gedanke interessant,<br />
weil Lebensstil bzw. Lebenschancen<br />
auch vieler Sozialhilfe-Empfänger erheblich<br />
beeinträchtigt sind (vgl. Umfrage-Ergebnis<br />
Spalte 3). Die amtliche<br />
Auffassung, dass mit der rechtlich garantierten<br />
Zahlung von Sozialhilfe die<br />
*Ebd., S. 47<br />
Armut in Deutschland „bekämpft“ sei,<br />
wird durch diese Untersuchung in Frage<br />
gestellt. Das umfangreiche Zahlenmaterial<br />
kann aus Zeitgründen im Unterricht<br />
natürlich nicht detailliert ausgewertet<br />
werden. Es lohnt sich aber,<br />
mit Hilfe der konkreten Angaben die<br />
Frage zu erörtern, ob auch ohne die als<br />
notwendig eingestuften Güter ein Leben<br />
geführt werden kann, das der Würde<br />
des Menschen entspricht (Art 1 GG;<br />
§ 1 Bundessozialhilfegesetz).<br />
Was ist eigentlich Armut?<br />
Die widerstreitenden Armutsdefinitionen<br />
können in einem Tafelanschrieb zuammengefasst<br />
werden (vgl. D11, D12):<br />
25
Wie Sozialhilfe-Empfänger ihre Situation bewältigen:<br />
(Ergebnis der Aufgaben 3 und 4 auf Seite = Aufgaben nach D21, Seite 48).<br />
Drei Beispiele / Bewältigungsmuster Herr Sylvester (D 1a) Herr Wedemayer (D 1b) Frau Haferkamp (D 1c)<br />
Wie bewältigen die Sozialhilfe- Ein dauerhafter Bezug von Das Leben mit Sozialhilfe Der Wille, den Bezug von<br />
Empfänger ihre Situation? Sozialhilfe scheint unum- wird auf Dauer aktiv Sozialhilfe zu überwinden,<br />
gänglich Die Situation wird bewältigt, weil Lebensinhalt führt früher oder später zum<br />
als hoffnungslos empfunden. und Bestätigung auch Erfolg. Der Lebensunterhalt<br />
(vgl. D19/1). außerhalb der Arbeitswelt wird meist sogar nach kurzer<br />
gefunden werden Zeit wieder aus eigenen<br />
(vgl. D19/2). Kräften bestritten<br />
(vgl. D19/3)<br />
Wie müsste der Staat helfen? Eine intensive psycho-soziale Eine finanzielle Unterstützung Vorübergehende, oft nur<br />
Betreuung wäre nötig, um reicht aus. kurzfristige, finanzielle<br />
eine Integration in die Unterstützung ist wichtig.<br />
Arbeitswelt und Gesellschaft Umschulungs- und Fortzu<br />
ermöglichen. bildungsmaßnahmen sind<br />
in diesen Fällen besonders<br />
gefragt.<br />
Die biographischen Berichte (D1) und<br />
die Beschreibung typischer Bewältigungsmuster<br />
von Sozialhilfe-Empfängern (D19)<br />
kann zwar die vorhandene Problemvielfalt<br />
nicht einfangen, schärft aber immerhin<br />
den Blick dafür, dass die finanzielle Unterstützung<br />
nicht in jedem Falle ausreicht,<br />
26<br />
Der absolute Armutsbegriff orientiert sich am<br />
Existenzminimum. Arm ist, wer die Grundbedürfnisse<br />
wie Nahrung, Wohnung, Kleidung nicht ausreichend<br />
befriedigen kann.<br />
... ein absolutes Maß oder … relativ?<br />
Ist Armut …<br />
… ein zu geringes Einkommen oder eine Lebenslage?<br />
Der Ressourcenansatz orientiert sich am<br />
(Haushalts-)Einkommen. Arm ist, wer nicht über ein<br />
ausreichendes Einkommen bzw. Vermögen verfügt<br />
um die Betroffenen zu befähigen, ein Leben<br />
unabhängig von der Sozialhilfe zu<br />
führen (vgl. § 1 Bundessozialhilfegesetz,<br />
D15). Dabei sollte die „Erkenntnis, dass<br />
die Sozialhilfe in den meisten Sozialämtern<br />
nur verwaltet wird und somit erheblich<br />
mehr Ressourcen kostet als intensive<br />
Der relative Armutsbegriff orientiert sich am durchschnittlichen<br />
Wohlstandsniveau einer Gesellschaft.<br />
Arm ist, wer weniger als 50 Prozent eines Durchschnittsbürgers<br />
zur Verfügung hat.<br />
Nach dem Lebenslagenansatz gilt als arm, wer in zentralen<br />
Lebensbereichen nicht ausreichend versorgt ist,<br />
d. h. nur unzureichend gekleidet ist, in unzumutbaren<br />
Wohnverhältnissen lebt oder nicht genug am gesellschaftlichen<br />
Leben teilnehmen kann.<br />
Beratung und Betreuung“ (Schiewer,<br />
Günter: Sozialhilfe. Leitfaden für die Praxis.<br />
Freiburg (Lambertus-Verlag): 1999,<br />
S. 16) die politisch Verantwortlichen (in<br />
Städten und Gemeinden) nachdenklich<br />
stimmen.
Baustein E<br />
Die Zukunft des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
Thesen: Ursachen für die Krise des <strong>Sozialstaa</strong>tes (vgl. E1 – 12):<br />
Die „Rundumversorgung“ des<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tes hat den<br />
Menschen die Selbsthilfefähigkeit<br />
genommen.<br />
Die Wiedervereinigung<br />
belastet den <strong>Sozialstaa</strong>t in<br />
Deutschland.<br />
Die Globalisierung drängt<br />
auf günstige Standortfaktoren<br />
(geringe Sozialkosten).<br />
Der Faktor Arbeit wird übermäßig<br />
belastet (Lohnnebenkosten).<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t<br />
in der Krise<br />
Reform des bundesdeutschen <strong>Sozialstaa</strong>ts:<br />
Abbau des <strong>Sozialstaa</strong>tes nach<br />
amerikanischen Vorbild (vgl. E13 –17)<br />
Zuwanderung<br />
verstärken (E25)<br />
Der <strong>Sozialstaa</strong>t ist nicht mehr<br />
finanzierbar (z.B. „Kostenexplosion“)<br />
im Gesundheitswesen.<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t unterstützt die<br />
Bedürftigen zu wenig, weil er<br />
an alle umverteilt.<br />
Reformdiskussion<br />
Ehrenamtliches Engagement<br />
verstärken (vgl. E26 – 32)<br />
Die Belastung durch die<br />
Massenarbeitslosigkeit<br />
ist zu groß.<br />
Die demografische Entwicklung<br />
(Alterung der Bevölkerung)<br />
steigert langfristig die Sozialausgaben.<br />
Umbau des <strong>Sozialstaa</strong>tes:<br />
Staat garantiert nur Grundsicherung<br />
(vgl. C22, E26)<br />
Private Vorsorge<br />
ausweiten (vgl. E19)<br />
27
Der deutsche <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
muss reformiert werden<br />
„Wenn der angeblich so vorbildliche<br />
und gut ausgebaute deutsche Wohlfahrtsstaat<br />
nicht in der Lage ist, das Entstehen<br />
von Armut in massenhaftem Umfang zu<br />
verhindern, so liegt das nicht an seinem<br />
zu geringen Ausgabevolumen, sondern an<br />
seiner politisch falschen, anachronistisch<br />
gewordenen Konstruktion.“<br />
Christoph Deutschmann; in: Müller,<br />
Siegfried/Otto, Ulrich (Hg.): Armut im <strong>Sozialstaa</strong>t,<br />
Neuwied 1997, S. 48f.<br />
„Wir müssen klären, wie wir angesichts<br />
der veränderten Demographie und<br />
Erwerbsbiografien überhaupt noch soziale<br />
Sicherheit erhalten können ... Ich sehe<br />
keine Chance für einen völligen Systemwechsel.<br />
Wir werden umlagefinanziert eine<br />
Grundsicherung organisieren und alles<br />
andere in die Eigenverantwortung entlassen.<br />
Es gibt jedoch Leute, die das nicht<br />
leisten können ...<br />
Da muss dann der Staat mit Sozialhilfe<br />
einspringen.“<br />
Peter Müller (saarländischer Ministerpräsident,<br />
CDU); in: DIE WOCHE vom 7. April<br />
2000, S. 8.<br />
„Werden die Kosten den Unternehmen<br />
aufgeladen, können diese sie unter dem<br />
Druck ausländischer Konkurrenten nun<br />
nicht mehr auf die Verbraucher abwälzen.<br />
Wird die Belastung nicht durch Produktivitätssteigerung,<br />
Lohnverzicht oder Abwertung<br />
ausgeglichen, so sinken die Unernehmergewinne,<br />
und das international<br />
mobile Kapital sucht sich andere Anlagemöglichkeiten<br />
... Der Staatenwettbewerb<br />
verliert jedoch an Schärfe, wenn die<br />
Kosten des <strong>Sozialstaa</strong>ts ... über Steuern<br />
auf Einkommen und Konsum finanziert<br />
werden.“<br />
Fritz Schrapf; in: Jachtenfuchs,<br />
Markus/Kohler-Koch, Beate (Hg.): Europäische<br />
Integration, Opladen 1996, S. 135.<br />
„ Der <strong>Sozialstaa</strong>t befindet sich gegenwärtig<br />
in einer Umbruchphase, und niemand<br />
kann vorhersehen, in welche Richtung<br />
er sich entwickeln wird. Wer allerdings<br />
meint, von einigen kleinen Korrekturen<br />
abgesehen werde alles so weitergehen<br />
wie bisher, verkennt die Dramatik der<br />
Situation“.<br />
Breit, Gotthard (Hg.): <strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip und<br />
Demokratie, Schwalbach/Ts. 1996, S. 5.<br />
Im Baustein E werden die Notwendigkeit<br />
eines tiefgreifenden Umbaus des <strong>Sozialstaa</strong>ts<br />
und wichtige Ansätze für diesen<br />
Umbau thematisiert. In der wissenschaftlichen<br />
und politischen Diskussion spielen<br />
folgende Vorschläge eine wesentliche<br />
Rolle:<br />
28<br />
● Die wirkungsvolle Entlastung der Unternehmen<br />
von Steuern und Lohnnebenkosten,<br />
● die Herstellung einer größeren Eigenverantwortung<br />
der Versicherten durch<br />
private Vorsorge,<br />
● die Umlenkung von Transferleistungen<br />
zu den wirklich Bedürftigen, bei<br />
gleichzeitiger Begrenzung von Umverteilungsprozessen,<br />
● die verstärkte Bekämpfung von Armut<br />
in der Bundesrepublik (insbesondere<br />
die Behebung der Kinderarmut),<br />
● die Verbreiterung der Zahl der Sozialversicherungspflichtigen<br />
durch die<br />
Einbeziehung von Selbständigen und<br />
Beamten in die sozialen Sicherungssysteme,<br />
● der Abbau von Subventionen und Abschreibungsmöglichkeiten<br />
bei gleichzeitiger<br />
Senkung der Steuersätze,<br />
● die Absenkung von Versicherungsleistungen<br />
und Sozialhilfe,<br />
aber auch<br />
● die Schaffung von mehr „sozialer Gerechtigkeit“<br />
durch eine höhere steuerliche<br />
Belastung der hohen Einkommen<br />
und Vermögen: „Wer den <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
retten will, darf die hohen Einkommen<br />
und Kapitalvermögen nicht unangetastet<br />
lassen. Verbunden mit einer tiefgreifenden<br />
Erbschaftssteuerreform<br />
könnte eine zeitlich befristete Abgabe<br />
auf Millionenvermögen den Staat in<br />
die Lage versetzen, eine aktive Sozialund<br />
Beschäftigungspolitik zu betreiben“<br />
(Butterwegge, Christoph: Wohlfahrtsstaat im<br />
Wandel, Opladen 1999, S. 162).<br />
(Vgl. E 18 - E23)<br />
Im Vergleich mit anderen westlichen<br />
Industriestaaten ergibt sich, dass der deutsche<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t sehr teuer geworden ist -<br />
und dies bei einer unbefriedigenden Effizienz.<br />
Auch im Jahr 1999 sind die Sozialleistungen<br />
weiter gestiegen - sie gingen<br />
nur im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt<br />
zurück; dieser Trend droht sich fortzusetzen.<br />
Deshalb muss nach Möglichkeiten<br />
gesucht werden, das Sozialbudget abzusenken<br />
(E3-E5; vgl. A7).<br />
Bedingungsfaktoren der<br />
Sozialleistungsquote<br />
Die Sozialleistungsquote ist um so höher,<br />
1. je höher die Seniorenquote ist...,<br />
2. je höher die Arbeitslosenquote ist...,<br />
3. je älter die Demokratie ... ist...,<br />
4. je stärker die Regierungsbeteiligung<br />
von Linksparteien,<br />
5. (je stärker die Regierungsbeteiligung)<br />
von Mittelparteien...l<br />
6. (je stärker die Regierungsbeteiligung)<br />
von liberalen Parteien ist ...;<br />
7. je größer die Zahl der Regierungsparteien<br />
und die hierdurch erforderlichen<br />
Kompromissbildungskosten sind...,<br />
8. je schwächer die gegen die Mehrheit<br />
gerichteten Institutionen sind...,<br />
9. je stärker die Einbindung in den Weltmarkt<br />
und der dies ausgleichende innenpolitische<br />
Steuerungsbedarf sind...<br />
Die Sozialleistungsquote nimmt umso<br />
mehr zu,<br />
1. je niedriger die Sozialleistungsquote im<br />
Vorjahr ist,<br />
2. je schwächer die Wirtschaft gegenüber<br />
dem Vorjahr wächst ...,<br />
3. je stärker die Arbeitslosenquote ... ansteigt,<br />
4. je höher die Seniorenquote ist,<br />
5. je weniger die Regierungsgeschäfte von<br />
konservativen Parteien geführt ... werden<br />
...<br />
Die Sozialleistungsquote wächst nur langsam,<br />
stagniert oder schrumpft,<br />
1. je höher ihr Niveau in der Vorperiode<br />
ist,<br />
2. je stärker die Wirtschaft wächst,<br />
3. je mehr die Arbeitslosenquote abnimmt,<br />
4. je kleiner die Seniorenquote ist,<br />
5. je stärker konservative Parteien an der<br />
Regierung beteiligt sind,<br />
6. je mächtiger die gegen die Mehrheit gerichteten<br />
Institutionen sind.<br />
Schmidt, Manfred G.: Sozialpolitik in Deutschland,<br />
Opladen (Leske + Budrich Verlag) 1998,<br />
S.208f.<br />
Der Vergleich mit den USA<br />
Häufig wird das „Modell USA“ mit<br />
anscheinend geringen Sozialausgaben, einem<br />
größeren Wirtschaftswachstum und<br />
niedrigerer Arbeitslosigkeit als nachahmenswertes<br />
Vorbild für Deutschland genannt.<br />
Diese Diskussion sollte auch im<br />
Unterricht aufgegriffen und der deutsche<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t mit dem US-amerikanischen<br />
verglichen werden (E13-E17). Vor einer<br />
vorschnellen Ablehnung des amerikanischen<br />
Modells ist genau so zu warnen wie<br />
vor der Meinung, man könne dieses Modell<br />
ohne weiteres auf Deutschland übertragen.<br />
Die demografischen und historischen<br />
Voraussetzungen des amerikanischen<br />
Sozialwesens unterscheiden sich<br />
grundsätzlich von denen in Deutschland;<br />
während die Bevölkerung der USA in den<br />
vergangenen 30 Jahren von rund 2,3 Millionen<br />
pro Jahr gewachsen sind, je zur<br />
Hälfte verursacht durch Zuwanderung und<br />
Geburten, verläuft die Entwicklung in<br />
Deutschland gerade umgekehrt: Die Bevölkerungszahlen<br />
schrumpfen, und der<br />
Alterungsprozess schreitet voran;<br />
während in den USA das soziale Siche-
ungssystem verhältnismäßig gering ausgebaut<br />
ist und die Eigeninitiative bei der<br />
Vorsorge für den Krankheitsfall und das<br />
Alter einen sehr hohen Stellenwert besitzt,<br />
erwarten die Deutschen traditionell viel<br />
vom <strong>Sozialstaa</strong>t und vertrauen ganz auf<br />
die vom Staat garantierte Absicherung gegen<br />
Krankheit, Not und Altersarmut. Es<br />
gibt heute kaum mehr eine Gruppe von<br />
Bevölkerung, die nicht direkt oder indirekt<br />
Empfänger staatlicher Sozialleistungen<br />
ist.<br />
Der Vergleich führt zu einem ambivalenten<br />
Ergebnis: In den USA ist die freiwillige<br />
private Vorsorge viel weiter ausgebaut<br />
als in Deutschland (7,8 Prozent<br />
des Bruttoinlandsprodukt gegenüber 0,8<br />
in Deutschland), und „die USA (können)<br />
mit weit niedrigeren Einkommenssteuern<br />
und wirksamer Förderung der freiwilligen<br />
Risikoversicherung (z.B. bei der Krankenversicherung)<br />
fast gleich große Mittel für<br />
soziale Zwecke mobilisieren wie die <strong>Sozialstaa</strong>ten<br />
Europas“ (Alfred Zanker; in:<br />
DIE WELT vom 7. Februar 2000, S.11).<br />
Andererseits „ist der amerikanische<br />
Wohlfahrtsstaat hochgradig zerspalten: Er<br />
trennt die Alten von den Jungen und die<br />
(weiße) Mittelschicht von der (schwarzen)<br />
Unterschicht. Das nationale Sozialsversicherungssystem<br />
ist nur unzureichend ausgebaut.<br />
Jeder dritte Amerikaner ist nicht krankenversichert.<br />
Jeder dritte amerikanische<br />
Arbeiter hat keinen Anspruch auf Arbeitslosengeld.<br />
Ein Drittel des Sozialbudgets<br />
ist ... Sozialfürsorge“.<br />
(Elmar Rieger; zitiert nach: Heinze, Rolf G.<br />
u.a.: Vom Wohlfahrtsstaat zum Wettbewerbsstaat,<br />
Opladen 1999, S. 46).<br />
Die Bedeutung staatlicher<br />
Sozialpolitik in der Bundesrepublik<br />
Deutschland<br />
„Sozialpolitik zielt auf Schutz vor Not,<br />
auf Sicherung gegen die Wechselfälle des<br />
Lebens und - im fortgeschrittenen Stadium<br />
- darauf, soziale Ungleichheit zu kontrollieren<br />
und einzudämmen ...<br />
● Mit dem Auf- und Ausbau der Sozialpolitik<br />
wurde ein zuvor noch nie errichtes<br />
Maß an sozialer Sicherheit für<br />
viele geschaffen. Wer hierin einen<br />
Vorgang epochaler Bedeutung sieht,<br />
irrt nicht ...<br />
● Ein beträchtlicher Teil des Sozialprodukts<br />
... (wird) für Sozialleistungen<br />
verwendet ...<br />
● Aus der Sozialpolitik für Wenige ist -<br />
vor allem im 20. Jahrhundert - die Sozialpolitik<br />
für die Vielen geworden ...<br />
● Mindestens ein Drittel aller Wähler (in<br />
der Bundesrepublik Deutschland) ist<br />
zur Sicherung seines Lebensunterhal-<br />
tes existentiell auf die Sozialpolitik angewiesen<br />
...<br />
● Heutzutage gilt als selbstverständlich,<br />
dass die große Mehrheit der Erwerbspersonen<br />
gegen Risiken des Einkommensausfalls<br />
infolge von Alter, Invalidität,<br />
Krankheit, Arbeitslosigkeit, Pflege<br />
oder Mutterschaft zwangsversichert<br />
sind und der Versicherungsschutz<br />
meist auch den Familienangehörigen<br />
zugute kommt ...<br />
● Der hohe Sozialschutz ist keineswegs<br />
selbstverständlich, sondern im weltweiten<br />
und im historischen Vergleich<br />
die Ausnahme.“<br />
Schmidt, Manfred G.: Sozialpolitik in Deutschland,<br />
Opladen (Leske + Budrich 1998, S. 13f.<br />
Didaktische und<br />
methodische Überlegungen<br />
Der Baustein E setzt die in den vorangehenden<br />
Bausteinen vermittelten Kenntnisse<br />
und Einsichten voraus. Die hier vorgeschlagenen<br />
Erörterungen zum Umbau<br />
des deutschen <strong>Sozialstaa</strong>tes bedürfen einer<br />
- wenigsten exemplarischen - Einsicht<br />
in das Wesen und die Funktionsweise der<br />
sozialen Sicherungssysteme in ihrer derzeitigen<br />
Ausprägung.<br />
Die Diskussion um die Zukunft des<br />
modernen <strong>Sozialstaa</strong>tes ist nicht auf<br />
Deutschland beschränkt. „Überall sind die<br />
Dinge aus den Fugen geraten, werden<br />
Um- und Abbaupläne geschmiedet, um<br />
den neuen Herausforderungen und Problemen<br />
gerecht zu werden“ (Heinze, Rolf G.<br />
u.a.: Vom Wohlfahrtsstaat zum Wettbewerbsstaat,<br />
Opladen 1999, S. 97).<br />
Angesichts der vielfältigen Vorschläge<br />
zur Reform des <strong>Sozialstaa</strong>tes und der<br />
Schwierigkeit, diese Vorschläge politisch<br />
umzusetzen, verbietet sich die Festlegung<br />
auf einen bestimmten Reformansatz. Die<br />
<strong>Schule</strong> kann keinen „Königsweg“ verordnen.<br />
Es geht im Unterricht darum, den<br />
Schülerinnen und Schülern die Notwendigkeit<br />
und die Möglichkeit eines wirkungsvollen<br />
Umbaus des <strong>Sozialstaa</strong>tes -<br />
Solidarität, soziale Gerechtigkeit, Freiheit<br />
der persönlichen Entfaltung und Orientierung<br />
auf das Gemeinwesen - zu vermitteln<br />
(vgl. S. 58). Martin und Sylvia Greiffenhagen<br />
hatten bereits 1993 auf die Gefahr<br />
der aktuellen Debatte hingewiesen: „Was<br />
heute unter dem Stichwort Umbau des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
diskutiert wird, ist kein Umbau,<br />
sondern ein Rückbau des sozialen Sicherungssystems,<br />
der in nie dagewesener<br />
Weise eindeutig die sozial Schwachen belastet“.<br />
(Greiffenhagen, Martin und Sylvia: Ein schwieriges<br />
Vaterland, München/Leipzig 1993, S. 322).<br />
Die Erarbeitung der Ursachen für die Krise<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes kann arbeitsteilig erfolgen:<br />
Gruppe A: Kostenexplosion (E2-E3)<br />
Gruppe B: Folgen der Wiedervereinigung<br />
(E4 - E6)<br />
Gruppe C: „Konstruktionsfehler“<br />
(E7-E10)<br />
Gruppe D: Globalisierungsfolgen<br />
(E11 und E12).<br />
Man fordert die Gruppen auf, ihre Befunde<br />
auf einem Plakat zusammenzufassen<br />
und den übrigen Mitgliedern der Klasse<br />
vorzustellen; die vier Plakate ermöglichen<br />
einen hinreichenden Einblick in die<br />
aktuellen Herausforderungen des <strong>Sozialstaa</strong>tes.<br />
In gleicher Weise kann man bei den<br />
Reformansätzen verfahren: vgl. Aufgabe<br />
4, S. 56.<br />
Vorschlag für eine<br />
„Sozialkonferenz“<br />
Soll ein soziales Pflichtjahr für alle<br />
eingeführt werden?<br />
Der <strong>Sozialstaa</strong>t gewährt dem einzelnen<br />
eine beachtliche soziale Sicherheit. Dafür<br />
müssen Sozialabgaben, Versicherungen<br />
bezahlt, Steuern und Gebühren entrichtet<br />
werden. Im Alltag werden aber dann beim<br />
Arzt und in der Apotheke nicht die Kosten<br />
gefordert, die tatsächlich anfallen.<br />
Die tatsächlichen Krankheitskosten werden<br />
nach dem Solidarprinzip in der Krankenkasse<br />
umgelegt oder durch staatliche<br />
Subventionen abgedeckt. Zum Teil erwächst<br />
aus diesem System eine „Vollkasko-“<br />
und „Versorgungsmentalität“. Man<br />
stellt Ansprüche an andere, vor allem an<br />
den Staat, ist aber selbst kaum zu irgendwelchen<br />
sozialen Dienstleistungen bereit.<br />
Um den zu teuer gewordenen <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
finanziell zu entlasten, sollen die Bürger<br />
zur kostenlose Mithilfe im sozialen Bereich<br />
herangezogen werden. In diesem<br />
Zusammenhang taucht immer wieder die<br />
Forschung auf, ein soziales Pflichtjahr für<br />
junge Frauen und Männer einzuführen,<br />
die keinen Wehrdienst ableisten. Mögliche<br />
Arbeitsaufträge an die Schülerinnen<br />
und Schüler: Diskutieren sie über diesen<br />
Vorschlag. Erarbeiten Sie dazu zunächst<br />
die (vermuteten) Haltungen der unten angegebenen<br />
Personengruppen und vertreten<br />
Sie deren Haltung in der Diskussion.<br />
Gruppe A: Als junge Frauen wären<br />
Sie von der Einführung eines sozialen<br />
Pflichtjahrs direkt betroffen. Erstellen Sie<br />
in der Gruppe ein Meinungsbild, wie Sie<br />
zu dieser Frage grundsätzlich stehen und<br />
welche Anforderungen an eine solche<br />
Dienstpflicht gegebenenfalls zu stellen<br />
wären.<br />
Gruppe B: Als junge Männer sind Sie<br />
ohnehin wehr- bzw. zivildienstpflicht. Die<br />
29
Frage der sozialen Dienstpflicht für alle<br />
interessiert Sie vor dem Hintergrund der<br />
Gleichberechtigung und der Chancengleichheit.<br />
Gruppe C: Als Vertreter sozialer Einrichtungen<br />
und ihrer Trägerorganisationen<br />
(Caritas, Diakonisches Werk, Arbeiterwohlfahrt,<br />
Paritätischer Wohlfahrtsverband)<br />
machen Sie sich für die Belange der<br />
30<br />
politischer<br />
und<br />
gesellschaftlicher<br />
„Mehrwert“<br />
Wirtschaftlicher<br />
„Mehrwert“<br />
Kosten des<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
Hinweis zu „Wiederholen und Zusammenfassen“<br />
(Arbeitsheft S.63)<br />
Man kann das Aufbauschema für den<br />
Baustein E (siehe vorne, S. 27) den Schülerinnen<br />
und Schülern als Zusammenfas-<br />
Krankenhäuser, Sozialstationen, Altenund<br />
Behindertenheime stark.<br />
Gruppe D: Als Beschäftigte im sozialen<br />
Bereich (Sozialarbeiter, Krankenschwester,<br />
Altenpfleger, Heimleiter usw.)<br />
können Sie zum praktischen Nutzen einer<br />
sozialen Dienstpflicht kompetent Auskunft<br />
geben. Auf der anderen Seite sind<br />
sie auch der Meinung, dass soziale Arbeit<br />
Vorschlag für ein Tafelbild<br />
Kosten - und Nutzenanalyse für den <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
Legitimation des<br />
demokratischen Systems<br />
Möglichkeit zur politischen<br />
und gesellschaftlichen<br />
Partizipation<br />
leistungswillige und<br />
bereite Arbeitnehmer<br />
weniger Streiktage<br />
Sozialleistungen<br />
(Ausgaben der<br />
Sicherungssysteme)<br />
sung der Beschäftigung mit der Krise des<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tes und den Umbauplänen aushändigen.<br />
Es hilft ihnen bei der Strukturierung<br />
und Zusammenfassung der erarbeiteten<br />
Erkenntnisse. Wir schlagen vor,<br />
professionell ausgeübt und gut bezahlt<br />
werden sollte.<br />
Gruppe E: Als Staatsbürger vertreten<br />
Sie die Interessen der Allgemeinheit und<br />
sehen in der Sozialpflicht ein Lernprogramm<br />
für mehr Mitgefühl, Verantwortungsbereitschaft<br />
und Gemeinsinn bei jungen<br />
Leuten. Außerdem würde der <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
finanziell entlastet.<br />
Gefahren:<br />
Individualisierung<br />
Wertewandel<br />
Unzufriedenheit wegen<br />
hoher Sozialabgaben<br />
(Schwarzarbeit, Arbeitsverweigerung,<br />
unberechtigte<br />
Inanspruchnahme<br />
von Sozialleistungen)<br />
Überforderung des<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tes:<br />
Kostenexplosion<br />
Abwanderung des<br />
(mobilen) Kapitals<br />
Konkurrenzdruck<br />
Globalisierung<br />
dass die Jugendlichen die Eintragungen<br />
während einer Selbsttätigkeitsphase vornehmen.<br />
Die Eintragungen werden anschließend<br />
mit dem Aufbauschema verglichen,<br />
diskutiert und gegebenenfalls abgeändert.
Weiterführende<br />
Literatur<br />
Buchhandel/Bibliotheken<br />
Aus der Fülle von Publikationen zum <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
und zur Sozialpolitik kann hier nur<br />
eine knappe Auswahl vorgestellt werden.<br />
Auf die Aufnahme von Aufsätzen in Zeitschriften<br />
musste gänzlich verzichtet werden.<br />
Adamy, Wilhelm/Steffen, Johannes:<br />
Abseits des Wohlstands. Arbeitslosigkeit<br />
und neue Armut.<br />
Verlag Primus, Darmstadt 1998<br />
– engagierte Analyse der Ursachen und Folgen<br />
zunehmender Armut in Deutschland<br />
Bäcker, Gerhard u.a.:<br />
Sozialpolitik und soziale Lage in der Bundesrepublik<br />
Deutschland, 2. Bände.<br />
Westdeutscher Verlag, Opladen 1999<br />
– lesenswerte, übersichtlich gegliederte Einführung<br />
Berger, Rainer:<br />
Der Umbau des <strong>Sozialstaa</strong>ts.<br />
Westdeutscher Verlag, Opladen/Wiesbaden<br />
1999<br />
– umfassende Zusammenstellung der Reformvorschläge<br />
der Verbände und der politischen<br />
Parteien<br />
Berthold, Norbert:<br />
Der <strong>Sozialstaa</strong>t im Zeitalter der Globalisierung.<br />
Verlag J.L.B. Mohr, Tübingen 1997<br />
– nützliche Darstellung der aktuellen Herausforderungen<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>ts<br />
Born, Karl Erich u.a. (Hg.):<br />
Quellensammlung zur Geschichte der deutschen<br />
Sozialpolitik 1867 - 1914. 3 Bände.<br />
Verlag Wissenschaftliche Buchgesellschaft,<br />
Darmstadt 1999<br />
– umfangreiche und wichtige Materialsammlung<br />
Breit, Gotthard (Hg.):<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip und Demokratie<br />
Verlag Wochenschau, Schwalbach/Ts. 1996<br />
– nützliche Aufsatzsammlung mit unterschiedlichen<br />
Ansätzen zum Umbau des <strong>Sozialstaa</strong>ts<br />
Briefs, Ulrich:<br />
High Tech und sozialer Verfall<br />
Verlag Pahl-Rugenstein, Bonn 1997<br />
- überaus kritische Auseinandersetzung mit den<br />
Ursachen der Krise des deutschen <strong>Sozialstaa</strong>ts<br />
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung<br />
(Hg.):<br />
Übersicht über das Sozialrecht<br />
Bonn 198<br />
– unentbehrliches Handbuch (Neuauflage angekündigt)<br />
Butterwegge, Christoph:<br />
Wohlfahrtsstaat im Wandel.<br />
Verlage Leske + Budrich, Opladen 1999<br />
– kenntnisreiche Beschreibung der Probleme des<br />
<strong>Sozialstaa</strong>ts mit bedenkenswerten Anregungen<br />
für eine moderne deutsche Sozialpolitik<br />
Döring, Diether:<br />
Soziale Sicherheit im Alter?<br />
Verlag Aufbau, Berlin 1997<br />
– knappe einführende Beschreibung des Rentenversicherungssystems<br />
in Deutschland und<br />
der Ansätze zu seiner Reform<br />
Frankfurter Institut-Stiftung Marktwirtschaft<br />
(Hg.):<br />
Rentenkrise. Und wie wir sie meistern können.<br />
Verlag Frankfurter Institut, Bad Homburg 1997<br />
– lesenswerte Aufsätze für die Umstellung der<br />
Rentenversicherung auf das<br />
Kapitaldeckungsverfahren<br />
Friedrich, Horst/Wiedemeyer, Michael:<br />
Arbeitslosigkeit ein Dauerproblem.<br />
Verlag Leske + Budrich, Opladen 2000<br />
– nützliche Einführung in die Hintergründe der<br />
Beschäftigungskrise mit wichtigen Vorschlägen<br />
zu ihrer Bekämpfung<br />
Gerster, Florian:<br />
Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Gewinner<br />
und Verlierer im <strong>Sozialstaa</strong>t.<br />
Verlag Nomos, Baden-Baden 1997<br />
– kritische Auseinandersetzung mit den Ergebnissen<br />
der deutschen Sozialpolitik in den<br />
neunziger Jahren<br />
Heinze, Rolf G. u.a.:<br />
Vom Wohlfahrtsstaat zum<br />
Wettbewerbsstaat.<br />
Verlag Leske + Budrich, Opladen 1999<br />
– unentbehrlicher Überblick über die sozialpolitische<br />
Reformdiskussion<br />
Hengsbach, Friedhelm/Möhring-Hesse, Matthias:<br />
Aus der Schieflage heraus.<br />
Verlag Dietz, Bonn 1999<br />
– engagiertes Plädoyer für die Wiedergewinnung<br />
des Sozialen im <strong>Sozialstaa</strong>t<br />
Huf, Stefan:<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t und Moderne. Modernisierungseffekt<br />
staatlicher Sozialpolitik.<br />
Verlag Duncker & Humblot, Berlin 1998<br />
– empfehlenswerte Analyse der Konsequenzen<br />
moderner Sozialpolitik<br />
Hunfeld, Frauke:<br />
„Und plötzlich bist zu arm“.<br />
Verlag Rowohlt, Reinbek 1998<br />
– lesenswerte, auch für die Unterrichtsvorbereitung<br />
nützliches Taschenbuch<br />
Klocke, Andreas/Hurrelmann, Klaus (Hg.):<br />
Kinder und Jugendliche in Armut.<br />
Westdeutscher Verlag, Wiesbaden 1998<br />
– brauchbarer Reader zu Umfang und Auswirkungen<br />
der Jugendarmut<br />
Knappe, Eckhard/Winkler, Albritt (Hg.):<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t im Umbruch.<br />
Verlag Campus, Frankfurt/M.-New York 1997<br />
– empfehlenswertes Sammelwerk zu Herausforderungen<br />
und Chancen einer zukunftsorientierten<br />
deutschen Sozialpolitk<br />
Lampert, Heinz:<br />
Krise und Reform des <strong>Sozialstaa</strong>tes.<br />
Verlag P. Lang, Frankfurt/M. 1997<br />
– unentbehrliche, leicht lesbare Publikation zu<br />
aktuellen Problemen des Sozialwesens<br />
Manuel, Jürgen/Neubauer, <strong>Georg</strong> (Hg.):<br />
Armut und soziale Ungleichheit bei Kindern.<br />
Verlag Leske + Budrich, Opladen 1998<br />
– wichtige, auch für Unterrichtszwecke geeignete<br />
Beiträge zu einem brisanten Problem<br />
Müller, Siegfied/Otto, Ulrich (Hg.):<br />
Armut im <strong>Sozialstaa</strong>t.<br />
Verlag Luchterhand, Neuwied 1997<br />
– leicht lesbarer Sammelband; auch für Schülerinnen<br />
und Schüler geeignet<br />
Murswieck, Axel:<br />
Sozialpolitik.<br />
Verlag Leske + Budrich, Opladen 1998<br />
-– übersichtliche Einführung in den Aufbau<br />
und die Funktion des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
Otto, Ulrich (Hg.):<br />
Aufwachsen in Armut.<br />
Verlag Leske + Budrich, Opladen 1997<br />
– kenntnisreicher Überblick über die Betroffenheit<br />
von Familien und Jugendlichen durch<br />
Arbeitslosigkeit und Armut<br />
Schmid, Josef/Niketta, Rainer (Hg.):<br />
Wohlfahrtsstaat: Krise und Reform im Vergleich.<br />
Verlag Metropolis, Marburg 1998<br />
– Sammlung nützlicher und problemorientierter<br />
Aufsätze zu aktuellen Herausforderungen des<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tes im internationalen Vergleich<br />
Schmidt, Manfred G.:<br />
Sozialpolitik. Historische Entwicklung im<br />
internationalen Vergleich.<br />
Verlag Leske + Budrich, Opladen 1998<br />
– unentbehrliche und übersichtlich gegliederte<br />
Übersicht über die Entwicklung und die Ausprägungen<br />
des <strong>Sozialstaa</strong>tes<br />
Schönigh, Werner/L’Hoest, Raphael (Hg.):<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t wohin?<br />
Verlag Wissenschaftliche Buchgesellschaft,<br />
Darmstadt 1996<br />
– lesenswerte Aufsatzsammlung zu wichtigen<br />
Aspekten des <strong>Sozialstaa</strong>tes und der Reformkonzepte<br />
Thuy, Peter:<br />
<strong>Sozialstaa</strong>tsprinzip und Marktwirtschaft.<br />
Verlag Paul Haupt, Berlin u.a. 1999<br />
– kenntnisreiche Darstellung der Grundlagen<br />
des deutschen <strong>Sozialstaa</strong>ts aus<br />
marktwirtschaftlicher Sicht<br />
Zinn, Karl <strong>Georg</strong>:<br />
<strong>Sozialstaa</strong>t in der Krise.<br />
Verlag Aufbau, Berlin 1999<br />
– brauchbare und angemessene Vorschläge zur<br />
Sanierung des deutschen <strong>Sozialstaa</strong>tes.<br />
31
Internet-Adressen<br />
Statistik<br />
Statistisches Bundesamt (mit Links zu allen Statistischen<br />
Landesämtern)<br />
http://www.statistik-bund.de/<br />
Eurostat (das statistische Amt der Europäischen Union)<br />
http://europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datashop/<br />
print-catalogue/DE?catalogue=Eurostat<br />
Bundesanstalt für Arbeit<br />
http://www.arbeitsamt.de/hst/index.html<br />
Staatliche Institutionen<br />
Deutscher Bundestag (Ständige Ausschüsse für “Arbeit und<br />
Sozialordnung”, “Familie, Senioren, Frauen und Jugend” und<br />
“Gesundheit”)<br />
http://bundestag.de<br />
Bundesregierung<br />
http://bundesregierung.de<br />
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung<br />
http://www.bma.de/<br />
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend<br />
http://www.bmfsfj.de/frameset/index.jsp<br />
Bundesministerium für Gesundheit<br />
http://www.bmgesundheit.de/<br />
Parteien<br />
Christlich Demokratische Union Deutschlands<br />
http://www.cdu.de<br />
Christlich-Soziale Union in Bayern<br />
http://www.csu.de<br />
Bündnis 90/Die Grünen<br />
http://www.gruene.de<br />
Freie Demokratische Partei<br />
http://www.fdp.de<br />
Partei des Demokratischen Sozialismus<br />
http://www.pds-online.de<br />
Sozialdemokratische Partei Deutschlands<br />
http://www.spd.de<br />
32<br />
Verbände<br />
Deutscher Industrie- und Handelstag<br />
http://www.diht.de<br />
Bundesverband der deutschen Arbeitgeberverbände<br />
http://www.bda-online.de<br />
Bundesverband der deutschen Industrie<br />
http://www.bdi-online.de<br />
Deutscher Gewerkschaftsbund<br />
http://www.dgb.de<br />
Arbeiterwohlfahrt (Verband der freien Wohlfahrtspflege)<br />
http://www.awo.de<br />
Deutscher Caritas-Verband e.V.<br />
http://www.caritas.de/<br />
Diakonie<br />
http://www.diakonie.de<br />
Paritätischer Wohlfahrtsverband<br />
http://www.paritaet.org/<br />
Verband der Rentenversicherungsträger<br />
http://www.vdr.de/<br />
Internet-Plattformen<br />
(mit zahlreichen Links und Informationen u.a. über Ansprechpartner,<br />
Diskussionsforen und Literatur zu sozialen Themen)<br />
Forum Sozialhilfe<br />
http://www.forum-sozialhilfe.de<br />
Soziales Netz- Soziale Arbeit im Netz<br />
http://www.soziales-netz.de<br />
Das Soziale Internet-Portal - Informationsplattform für das Sozial-<br />
und Gesundheitswesen<br />
http://www.sozialwesen.de<br />
Stiftung Bürger für Bürger - Deutsches Forum für freiwilliges<br />
Engagement und Ehrenamt<br />
http://www.buerger-fuer-buerger.de<br />
Das Verzeichnis lieferbarer Publikationen der Bundeszentrale<br />
für politische Bildung finden Sie auch im Internet unter:<br />
www.bpb.de.<br />
Unsere Website enthält außerdem viele aktuelle Informationen<br />
und eine Reihe von Online-Publikationen bereit (auch<br />
z.B: die “Beilage aus Politik und Zeitgeschichte” und die “Informationen<br />
zur politischen Bildung”.