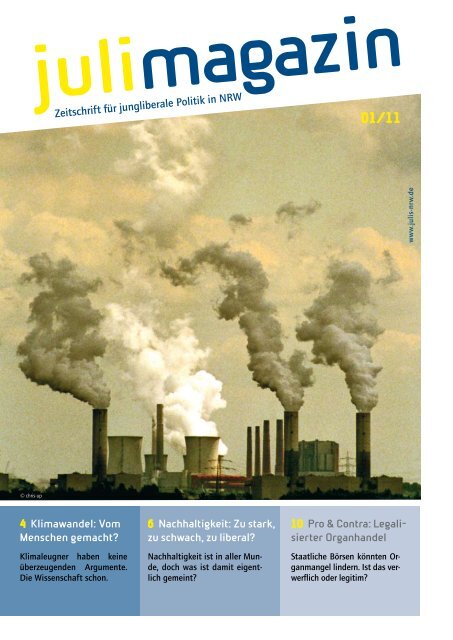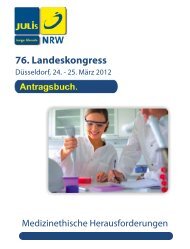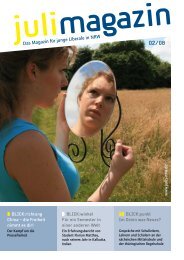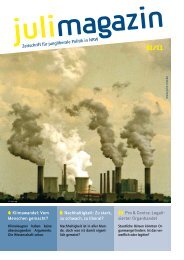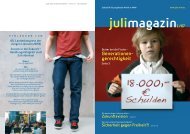10 Pro & Contra: Legali- sierter Organhandel 4 Klimawandel: Vom ...
10 Pro & Contra: Legali- sierter Organhandel 4 Klimawandel: Vom ...
10 Pro & Contra: Legali- sierter Organhandel 4 Klimawandel: Vom ...
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
© chris-up<br />
4 <strong>Klimawandel</strong>: <strong>Vom</strong><br />
Menschen gemacht?<br />
Klimaleugner haben keine<br />
überzeugenden Argumente.<br />
Die Wissenschaft schon.<br />
6 Nachhaltigkeit: Zu stark,<br />
zu schwach, zu liberal?<br />
Nachhaltigkeit ist in aller Munde,<br />
doch was ist damit eigentlich<br />
gemeint?<br />
01/11<br />
<strong>10</strong> <strong>Pro</strong> & <strong>Contra</strong>: <strong>Legali</strong><strong>sierter</strong><br />
<strong>Organhandel</strong><br />
Staatliche Börsen könnten Organmangel<br />
lindern. Ist das verwerflich<br />
oder legitim?<br />
www.julis-nrw.de
2|<br />
Neujahrsempfang<br />
der Jungen Liberalen NRW<br />
15. Januar 2011 in der Jazzschmiede Düsseldorf<br />
Liberaler Mund<br />
Landesvorstandssitzung. Es wird entschieden, wo der<br />
nächste Landeskongress stattfindet.<br />
Joana Horch: „Wir haben leider nur eine einzige Bewerbung vorliegen,<br />
die wir ernstnehmen können. Sie kommt aus dem Kreisverband<br />
Gütersloh in OWL …“<br />
Umut Icten: „Oh nein! Gütersloh? Das ist ja fast Berlin!“<br />
Landesvorstandssitzung. Diskussion um eine mögliche<br />
Referentin für den Landespolitischen Tag.<br />
Henning Höne: „Niko, hast du deine Kommilitonin denn schon<br />
gefragt ob sie das machen würde?“<br />
Niko Böckly: „Nein. Ich wollte sie erst fragen, wenn wir uns hier für<br />
sie entschieden haben.“<br />
Umut Icten: „Warum das denn?“<br />
Niko Böckly: „Na das ist doch scheiße sie erst heiß zu machen und<br />
dann darf sie gar nicht kommen.“<br />
Landesvorstandssitzung. Marc Urmetzer fallen während<br />
eines Redebeitrags die Augen zu.<br />
Sebastian Stachelhaus: „Der Marc muss ins Bett.“<br />
Joana Horch: „Woher weißt du das? Kannst du ihm das von den<br />
Augen ablesen?“<br />
Sebastian Stachelhaus: „Wohl eher von den Augenlidern …“<br />
Marc Urmetzer: „Wow. Kannst du noch mehr so coole Sachen,<br />
Stachel?“<br />
Kreiskongress Bonn. Marc Urmetzer hält sein Grußwort.<br />
Marc Urmetzer: „Bonn ist doch wahrlich eine Perle im Zacken der<br />
Krone der Jungen Liberalen.“<br />
(fünf Minuten später)<br />
Marc Urmetzer: „Ne, da denkt man, man kommt aus Köln zu den<br />
netten Nachbarn nach Bonn und dann erlebt man sowas hier …“
Vorwort<br />
Liebe JuLis,<br />
in unserem Grundsatzpro-<br />
gramm, dem Humanistischen<br />
Liberalismus 2.0, machten<br />
wir es zur Verpflichtung<br />
unseres politischen Handelns,<br />
die Natur in ihrer Vielfalt<br />
und Einzigartigkeit für die<br />
derzeitigen und die nachfolgenden<br />
Generationen zu<br />
bewahren. Ziel dieser Bemühungen<br />
sollte die Fortentwicklung unserer sozialen, hin zu einer<br />
sozialen und ökologischen Marktwirtschaft sein. Bereits 2007 sprachen<br />
wir deshalb in diesem Zusammenhang vom Begriff der Nachhaltigkeit als<br />
Richtschnur liberaler Umwelt- und Klimapolitik. Was wir darunter jedoch<br />
konkret verstehen, definierten wir damals nicht.<br />
Heute ist der Nachhaltigkeitsbegriff in aller Munde. Kaum ein Bereich<br />
unseres Alltags – egal ob in Ökonomie, Ökologie oder Gesellschaft –<br />
bleibt davon verschont. Jeder und alles möchte immer und zu jeder Zeit<br />
nachhaltig sein, bleiben oder werden. Für uns Liberale scheint daher die<br />
Zeit gekommen, an der wir konkretisieren müssen, welche Bedeutung<br />
wir diesem schillernden Begriff eigentlich beimessen und wie wir<br />
unsere Umweltpolitik an ihm ausrichten möchten. Schließlich laufen wir<br />
ansonsten Gefahr, dass andere die Deutungshoheit über ihn gewinnen<br />
und ihn sich durch inflationäre Nutzung zu Eigen machen.<br />
Damit es gar nicht erst soweit kommt, werden wir uns auf dem nächsten<br />
Landeskongress intensiv mit den Themen Klima- und Umweltpolitik<br />
beschäftigen. Vorbereitend auf diese Debatte, stellt dieses Heft daher<br />
die Ursachen und Folgen des <strong>Klimawandel</strong>s dar, gibt Denkanstöße<br />
für liberale Ansätze in der Umweltpolitik und widmet sich außerdem<br />
der Diskussion um den Einbezug von Faktoren der Nachhaltigkeit in<br />
wirtschaftliche Indizes, wie beispielsweise das Bruttosozialprodukt.<br />
Nachhaltig geplant sollten nicht nur politische Maßnahmen, sondern<br />
auch personelle Wechsel sein. Daher möchte ich schon an dieser Stelle<br />
darauf hinweisen, dass ich in diesem Sommer die Chefredaktion des<br />
julimagazins niederlegen werde. Nach drei Jahren mache ich damit den<br />
Platz frei, für neue Köpfe mit neuen Ideen und neuen Konzepten. Alle, die<br />
Interesse an meiner Nachfolge haben, sind daher an dieser Stelle auf die<br />
Ausschreibung der Chefredaktion in der Rubrik „Personalien & Notizen“<br />
hingewiesen. Wir freuen uns auf eure Bewerbungen.<br />
Nun aber viel Spaß beim Lesen und bis zum nächsten Mal.<br />
Euer<br />
Inhalt<br />
Seite<br />
03<br />
04 – 05<br />
06<br />
07<br />
08<br />
09<br />
<strong>10</strong> – 11<br />
12<br />
13<br />
14 – 15<br />
16<br />
Vorwort, Inhalt, Impressum<br />
Impressum<br />
|3<br />
<strong>Klimawandel</strong>: <strong>Vom</strong> Menschen gemacht?<br />
Zu stark, zu schwach, zu liberal …<br />
Wohlstand ist mehr als das BIP<br />
Wer hat Angst vorm bösen Wolf?<br />
Don‘t touch my junk!<br />
<strong>Pro</strong> & <strong>Contra</strong>:<br />
Legaler <strong>Organhandel</strong>: Ist das vertretbar?<br />
20<strong>10</strong>: Das Ende der Wehrpflicht<br />
Fünf Fragen an Henning Höne<br />
Personalien & Notizen<br />
Termine<br />
Herausgeber und Verlag<br />
Junge Liberale Landesverband NRW e.V.<br />
Sternstraße 44<br />
40479 Düsseldorf<br />
Telefon (0211) 4925185<br />
Fax (0211) 490028<br />
julimagazin@julis-nrw.de<br />
Chefredaktion / V.i.S.d.P.:<br />
Florian Philipp Ott (florian.ott@julis-nrw.de)<br />
Lektorat<br />
Petra Pabst<br />
Redaktion<br />
Henning Höne, Martina Sitko, Niko Böckly, Jan Mickel, Florian<br />
Scheuer, Nico Weber, Jörg Wischinski, Jonathan Dannemann,<br />
<strong>Pro</strong>f. Dr. Dr. Peter Oberender u.a.<br />
Fotos<br />
Florian Philipp Ott, Kai Oliver Mosel, photocase.de u.a.<br />
Gestaltung<br />
plakart GmbH & Co. KG, Neuenrade<br />
Druck<br />
mc3 Marketing Contacts, Castrop-Rauxel<br />
Das julimagazin ist die Zeitschrift des Landesverbandes NRW der<br />
Jungen Liberalen. Es erscheint viermal jährlich. Für Mitglieder der<br />
Jungen Liberalen ist der Bezugspreis mit dem Mitgliedsbeitrag<br />
abgegolten. Die im julimagazin abgedruckten Beiträge und<br />
Artikel geben alleine die Meinung des jeweiligen Verfassers<br />
und nicht unbedingt die der Redaktion oder der Herausgeber<br />
wieder.<br />
www.julimagazin.de
4|<br />
<strong>Klimawandel</strong>:<br />
<strong>Vom</strong> Menschen gemacht?<br />
Der <strong>Klimawandel</strong> ist wissenschaftlich eindeutig zu belegen. Dennoch leugnet eine ganze Lobby<br />
den menschlichen Einfluss auf die Erderwärmung. Was ist dran, am Mythos der Klimaleugner?<br />
Von Florian Scheuer<br />
Kaum eine umweltpolitische Debatte vergeht, in der<br />
nicht irgendein – meist selbsternannter – Experte<br />
den gesamten <strong>Klimawandel</strong> oder den menschlichen<br />
Beitrag dazu abstreitet. Wer kennt diese Leugner also nicht,<br />
die tatsächlich glauben, dass die wohlstandsorientierte Lebensweise<br />
unserer industriellen Gesellschaft keinen Einfluss<br />
auf die Erdatmosphäre hat, da es Temperaturschwankungen<br />
ja immer schon gegeben habe. In der Tat kann man erdgeschichtlich<br />
nachweisen, dass sich die Durchschnittstemperatur<br />
von Warm- und Kaltzeiten immer wieder verändert hat. Ausnahmen<br />
und kurzfristige Abweichungen der Temperatur gab<br />
es ebenfalls immer wieder. Dennoch hat die Amplitude der<br />
bekannten Hockeystick-Kurve, einer Rekonstruktion des Verlaufes<br />
der Erdtemperatur im letzten Jahrtausend, noch nie so<br />
weit nach oben ausgeschlagen, wie in den vergangenen 20<br />
Jahren. Seit der industriellen Revolution hat sich die Atmosphäre<br />
um durchschnittlich 2,4 Grad aufgeheizt. Alleine seit<br />
1980 stieg der CO 2 -Ausstoß um fast 20 <strong>Pro</strong>zent. Der Zusammenhang<br />
zwischen dem Anstieg der globalen Temperaturen<br />
in Abhängigkeit vom CO 2 –Ausstoß wird von keinem seriösen<br />
Wissenschaftler geleugnet. Mehr noch: Mittlerweile ist der<br />
Temperaturanstieg anhand der CO 2 -Emissionen ziemlich genau<br />
berechenbar. Hätten wir keine Biosphären wie Ozeane<br />
oder Regenwälder, die einen Teil dieses Ausstoßes absorbieren,<br />
läge die Konzentration heute bereits bei über 500 ppm.<br />
Das entspricht einer Menge, die beinahe doppelt so hoch ist<br />
wie in vorindustriellen Zeiten. In den letzten 650 000 Jahren<br />
wurde nie ein höherer Wert als 300 ppm erreicht. Dennoch<br />
produzieren wir schädliche Treibhausgase weiterhin schneller<br />
als sie von alle Regenwäldern zusammen aufgenommen<br />
werden können. Der von ihnen ausgelöste Treibhauseffekt gilt<br />
dabei als Motor des <strong>Klimawandel</strong>s: Weil zu viele Treibhausgase<br />
in der Atmosphäre sind, gelangt die von der Erdoberfläche reflektierte<br />
Sonnenstrahlung schlechter zurück ins All und heizt<br />
dadurch die Erde weiter auf.<br />
Zurück zum historischen Verlauf der Temperaturen und der<br />
CO 2 -Konzentration: In der Tat ist es schwer wissenschaftlich zu<br />
belegen, welche Temperaturen vor 1.000, <strong>10</strong>.000 oder 50.000<br />
Jahren geherrscht haben. Helfen können heute vor allem Eisbohrungen<br />
oder Untersuchungen an Fossilien. Die Genauigkeit<br />
dieser Methoden war bei den Wissenschaftlern zunächst<br />
umstritten. Nach einer Ergebnisbereinigung konnten neueste<br />
Forschungen den Zusammenhang von CO 2 -Emissionen und<br />
Klimaerwärmung jedoch erneut bestätigen. Unabhängig davon<br />
gab es natürlich die berühmten Schwankungen zwischen<br />
Warm- und Kaltzeiten. In Deutschland war die letzte Kaltzeit<br />
vor rund <strong>10</strong>.000 Jahren. Alleine in Mitteleuropa gab es seither<br />
weitere Kaltzeiten in unterschiedlichen Abständen. Eine Rückkehr<br />
zu einer eigentlich normalen Kaltzeit ist heute allerdings<br />
so gut wie unmöglich, da der anthropogene – also vom Menschen<br />
verursachte – Treibhauseffekt eine solche Entwicklung<br />
verhindert.<br />
Unabhängig von theoretischen Erkenntnissen sind die Auswirkungen<br />
des <strong>Klimawandel</strong>s ohnehin für die meisten Menschen<br />
spürbar. Paradox ist dabei jedoch, dass die Industrienationen<br />
als Hauptverursacher dieser Entwicklung zumeist als letzte von<br />
negativen Effekten betroffen sind. Das Schmelzen der Pole, die<br />
Ausbreitung der Wüsten, der Anstieg des Meeresspiegels und<br />
die Zunahme von Naturkatastrophen sind sichtbare Folgen,<br />
die häufig in Entwicklungs- oder Schwellenländern zu spüren<br />
sind. So kommt es in Bangladesch, einem sehr armen und<br />
© suze
nur knapp über dem Meeresspiegel gelegenen Land, regelmäßig zu<br />
Überflutungen. Betroffen sind in Zukunft bis zu 15 Millionen Menschen,<br />
die mit ihren Anbau- und Siedlungsflächen auch ihre Existenz<br />
verlieren. Betrachtet man parallel dazu die Niederlande, ein niedrig<br />
gelegenes, aber hoch entwickeltes Industrieland, ist der steigende<br />
Meeresspiegel ebenfalls messbar. Allerdings sorgen Infrastruktur, finanzielle<br />
Ressourcen und technisches Know-How dafür, dass keine<br />
Gefahr für Mensch und Landschaft besteht. Der Anstieg des Meeresspiegels<br />
selbst ist dabei vor allem auf die Erwärmung des Wassers<br />
und dessen damit verbundener Ausdehnung zurückzuführen. Auch<br />
hier besteht ein signifikanter Zusammenhang mit der Erwärmung<br />
des Klimas.<br />
Langsam aber sicher werden die Auswirkungen des <strong>Klimawandel</strong>s<br />
auch in Europa spürbar: Überschwemmungen wie in Deutschland<br />
und Polen stehen Wassermangel etwa in Andalusien gegenüber.<br />
Hinzu kommen die <strong>Pro</strong>bleme der schrumpfenden Anbauflächen und<br />
der Unbewohnbarkeit ganzer Regionen. In beiden Fällen werden<br />
langfristig auch die Industrieländer betroffen sein, die aufgrund von<br />
weltweiter Nahrungsmittelknappheit mit höheren Lebensmittelpreisen<br />
und steigenden Migrationsströmen rechnen müssen.<br />
Diese Entwicklung ist insbesondere für die nachfolgenden Generationen<br />
besorgniserregend, deren Schutz für die Politik daher<br />
unabdingbar ist. Sie bietet gleichwohl auch neue Chancen durch<br />
umweltfreundliche Technologien und außenpolitische Kooperationen<br />
im Sinne von Global Governance. Da Umweltprobleme nicht<br />
an politischen Grenzen halt machen, ist die gesamte Weltgemeinschaft<br />
gefragt, zusammenzuarbeiten. Die politische Aufgabe beim<br />
Kollektivgut Umwelt kann daher nur eine Förderung nachhaltiger<br />
Entwicklung sein. Dabei kann sich Politik der bekannten Instrumente<br />
wie Ge- und Verbote, Auflagen, Steuern oder ökonomischer Anreize<br />
bedienen. Ein positiver und liberaler Ansatz wäre hier beispielsweise<br />
der weltweite Emissionshandel in Form von Zertifikaten. Das gesellschaftliche<br />
Konfliktpotential liegt in der Nutzung der Umwelt durch<br />
einzelne Personen, Unternehmen oder Staaten, die damit ihre eigene<br />
Existenz sichern und ihre Wohlfahrt steigern wollen. Langfristig sorgt<br />
dieses individuelle Verhalten jedoch dafür, dass die Lebensgrundlage<br />
für alle Menschen verschlechtert wird.<br />
Vor diesem Hintergrund wird klar: Der <strong>Klimawandel</strong> ist nicht zu leugnen<br />
und der menschliche Einfluss darauf ist deutlich messbar. Auch<br />
wenn diese wissenschaftlichen Argumente nicht alle überzeugen und<br />
die Angebote der Leugner-Lobby verlockender sind als rationale Fakten,<br />
sollte bedacht werden, dass menschliches Handeln zu häufig negative<br />
Auswirkungen auf unsere Erde hat. Aus Subsistenzwirtschaft<br />
im Regenwald wurde industrieller Rohstoffabbau, der mittlerweile<br />
50 <strong>Pro</strong>zent der Fläche zerstört und somit die Absorbtionsmöglichkeit<br />
für CO 2 massiv verringert hat. Selbst wenn die Folgen nicht hundertprozentig<br />
absehbar sind, ist es durchaus möglich und sinnvoll, sich<br />
umweltfreundlicher zu verhalten. Zugegeben, es mag mühsam sein<br />
und jeden Einzelnen fordern. Dennoch liegt in nachhaltigem Verhal-<br />
© Fotoline<br />
ten nicht nur eine Sicherung für nachfolgende Generationen, sondern<br />
auch Potential für Wettbewerb, Innovation und Partizipation<br />
aller Nationen.<br />
Florian Scheuer (30) ist Gymnasiallehrer für<br />
Politik/Wirtschaft und Erdkunde. Er studierte<br />
in Münster und Groningen. Von 2007<br />
bis 2009 war er Mitglied im JuLi-Bundesvorstand<br />
und wohnt derzeit in Hameln. Ihr<br />
erreicht ihn unter scheuer@julis.de.<br />
Dieser Artikel sowie die in ihm enthaltenen Daten und Fakten beruhen auf<br />
folgenden Forschungsergebnissen:<br />
Bahr, Matthias: Klima unterrichten. In: Westermann (Hrsg.): Praxis Geographie. Heft<br />
3/09<br />
Börner, Andrea: Wasserengpass in Spanien. In: Westermann (Hrsg.): Praxis Geographie.<br />
Heft 9/07<br />
Breuer, Reinhard et. al: Spektrum der Wissenschaft. Dossier 2/2005<br />
Butzengeiger, Sonja/Horstmann, Britta: <strong>Klimawandel</strong>. Ein Phänomen, verschiedene<br />
Konsequenzen. In: Westermann (Hrsg.): Praxis Geographie. Heft 1/05<br />
Gore, Al (2006): Eine unbequeme Wahrheit<br />
Hassol, Susan (2005): Der Arktis-Klima-Report<br />
Nordmeier, Günter: Klimaänderung in Mitteleuropa. In: Westermann (Hrsg.): Praxis<br />
Geographie. Heft 1/04<br />
Westermann (Hrsg.): Praxis Geographie. Heft 5/05<br />
Westermann (Hrsg.): Praxis Geographie. Heft <strong>10</strong>/07<br />
Westermann (Hrsg.): Praxis Geographie. Heft 3/09<br />
|5
6|<br />
Zu stark, zu schwach, zu liberal…<br />
Nachhaltigkeit ist in aller Munde. Dennoch sind klare Definitionen rar. Zwar unterscheidet die Wissenschaft<br />
zwischen starker und schwacher Nachhaltigkeit, doch beide Konzepte haben Schwächen.<br />
Von Jan Mickel<br />
Der Begriff der Nachhaltigkeit wurde in den vergangenen Jahren<br />
zur absoluten Pflichtvokabel hochstilisiert. Es gibt kaum<br />
eine Werbung, Rede oder Argumentation, die ohne ihn auskommt.<br />
Daran ist nicht zuletzt auch seine schwammige Definition<br />
schuld: Einerseits führt sie immer öfter dazu, dass sich selbst diejenigen<br />
mit Nachhaltigkeit schmücken, die vorgeben, mehr als drei Tage<br />
in die Zukunft zu denken. Andererseits wehren sich immer mehr Menschen,<br />
unter dem Deckmantel der Nachhaltigkeit, gegen jeglichen<br />
Eingriff in die Umwelt und beschränken den Begriff dadurch auf eine<br />
ökologische Bedeutung.<br />
Doch Nachhaltigkeit ist mehr als das. In der Wissenschaft wird das<br />
Konzept als ein Drei-Säulen-Modell beschrieben, einem Dreiklang<br />
aus ökologischer, ökonomischer und gesellschaftlicher Nachhaltigkeit.<br />
Nachhaltigkeit bedeutet demnach die Sicherung des dauerhaften<br />
Fortbestands von Natur und Umwelt, aber auch von Wohlstand,<br />
Kultur und gesellschaftlicher Weiterentwicklung. Sie ist somit eine<br />
allumfassende Zielvorgabe, die viele Politikbereiche berührt und der<br />
nächsten Generation das gleiche oder ein besseres Umfeld garantieren<br />
soll. Damit wird klar, dass Nachhaltigkeit vor allem eine Frage der<br />
Generationengerechtigkeit ist. Darunter verstehen wir Liberale bis-<br />
© kallejipp<br />
lang jedoch vor allem das Prinzip schuldenfreier und ausgeglichener<br />
Staatshaushalte. Diesen Begriff von Generationengerechtigkeit um<br />
Aspekte der Nachhaltigkeit zu erweitern, würde ihn sinnvoll ergänzen<br />
und auf eine deutlich breitere Basis stellen. Zu achten ist dabei natürlich<br />
auf eine klare Definition.<br />
In der Wissenschaft wird heute zwischen schwacher und starker<br />
Nachhaltigkeit unterschieden. Schwache Nachhaltigkeit geht davon<br />
aus, dass Naturkapital durch Sach- oder Humankapital grundsätzlich<br />
aufgewogen werden kann. Starke Nachhaltigkeit hingegen besagt,<br />
dass dies unter keinen Umständen möglich ist. Realpolitisch könnte –<br />
bei schwacher Nachhaltigkeit – der gesamte Regenwald abgeholzt<br />
werden, sofern im Gegenzug ausreichend viele Billy Regale gebaut<br />
und das Naturkapital gänzlich in Sachkapital umgewandelt würde.<br />
Bei einem starken Nachhaltigkeitsbegriff wäre dieses Vorgehen ausgeschlossen<br />
und das Naturkapital in seiner Größe gesichert. Entsprechend<br />
ginge damit ein völliger Verzicht auf den Verbrauch natürlicher<br />
Ressourcen einher.<br />
Als Liberale können uns daher weder der schwache noch der starke<br />
Nachhaltigkeitsbegriff überzeugen. Schließlich könnte mit schwacher<br />
Nachhaltigkeit der Erhalt des Naturkapitals langfristig nicht sichergestellt<br />
werden. Währenddessen führt starke Nachhaltigkeit zu einer reinen<br />
Fokussierung auf den Erhalt des ökologischen Kapitals auf Kosten<br />
der ökonomischen und gesellschaftlichen Aspekte. Daher müssen<br />
wir uns für einen pragmatischen Ansatz aussprechen. Dieser muss<br />
auf dem starken Nachhaltigkeitsbegriff, also dem Ziel, das Naturkapital<br />
langfristig nicht kleiner werden zu lassen, basieren. Er muss aber<br />
auch mit der Einsicht in die Notwendigkeit verbunden werden, dass<br />
Eingriffe an gewisser Stelle zu tolerieren sind, um an anderer Stelle einen<br />
weitaus größeren Schaden zu vermeiden. Ein passendes Beispiel<br />
hierfür stellen Wasser- und Pumpspeicherkraftwerke dar, durch deren<br />
Errichtung im Gegenzug Kohlekraftwerke stillgelegt werden können.<br />
Andererseits sind Eingriffe, welche zu irreparablen Schäden führen,<br />
unter allen Umständen zu verhindern. Irreparabel sind zum Beispiel<br />
Eingriffe, welche zur Ausrottung von Arten und einer damit einhergehenden<br />
Verringerung der Artenvielfalt führen.<br />
Jan Mickel (23) ist als Co-<strong>Pro</strong>grammatiker<br />
Mitglied im Landesvorstand. Er kommt aus<br />
dem Kreisverband Bochum und studiert<br />
Wirtschaftswissenschaften an der dortigen<br />
Ruhr-Universität. Ihr erreicht ihn unter<br />
jan.mickel@julis-nrw.de.
Wohlstand ist mehr als das<br />
Bruttoinlandsprodukt<br />
Wirtschaft, Wohlstand und Umwelt sind stets eng miteinander verwoben. Das muss endlich seinen Ausdruck in<br />
Indikatoren der Nachhaltigkeit finden. Nur so sind Wohlfahrtsdebatten zielführend.<br />
Von Nico Weber<br />
Wirtschaftswachstum ist nicht alles! Dieser Wahlspruch kam<br />
im Zuge der internationalen Wirtschafts- und Finanzkrise<br />
wieder in Mode. Begleitet wird er von der Weisheit, dass<br />
Wachstum Grenzen hat und von der Forderung nach einem Glücks-<br />
indikator. All dies mag man der Esoterik oder gar dem Fatalismus<br />
zuschreiben. Denn Stagnation mündet zweifelsohne in stärkeren Verteilungskämpfen<br />
und einem deutlich geringeren Spielraum für die<br />
Bewältigung kommender Herausforderungen. Der Begriff des Wachstums<br />
darf sich dennoch nicht zu weit von der Realität entfernen.<br />
Schließlich sind Faktoren wie Umweltverschmutzung nicht nur von<br />
ideologischem Interesse, sondern haben messbare Folgen.<br />
Der wichtigste ökonomische Index, das Bruttoinlandsprodukt (BIP),<br />
ist im Wesentlichen jedoch nur ein Indikator für die Veränderung des<br />
Wohlstands. Was an bisherigen Vermögen angehäuft wurde kann nur<br />
unzureichend dargestellt werden – von den ökologischen Reichtümern<br />
eines Landes ganz zu schweigen. So steigert<br />
es paradoxerweise das BIP, wenn zwei Autofahrer<br />
nach einem Verkehrsunfall im Krankenhaus liegen<br />
und ihren Unfallwagen anschließend reparieren<br />
lassen müssen. Dabei wurde der Gesamtwohlstand<br />
gar nicht erhöht.<br />
© Knipsermann<br />
Ein Ansatzpunkt, ökologische Faktoren ins BIP zu integrieren, könnte<br />
daher eine Ausweitung der Abschreibungen um Schäden an unserer<br />
Umwelt sein. In diesem Zusammenhang wurden bereits einige <strong>Pro</strong>gnosen<br />
im Rahmen der Klimadebatte erstellt, die jedoch hauptsächlich<br />
auf ökonomischen Schätzungen beruhen. Im Gegensatz zu weiteren<br />
Ansätzen sind diese Schätzungen jedoch noch relativ exakt. Einer<br />
dieser weiteren Ansatzpunkte ist die Kontingente Bewertungsmethode.<br />
Mittels Umfragen soll dabei ermittelt werden, wie viel die Bürger<br />
für den Erhalt oder den Erwerb eines immateriellen ökologischen<br />
Wertes zu zahlen bereit wären. Die Makel dieser Herangehensweise<br />
sind offensichtlich: Die Befragungssituation ist völlig marktfern und<br />
den Befragten fehlt oft der Bezug zum Gegenstand und die nötige<br />
Kompetenz. Ähnlich schwer berechenbar sind Ansätze, die den wünschenswerten<br />
Grad an Ressourceneffizienz oder die Opportunitätskosten,<br />
die durch eine zu starke Umweltausbeutung entstehen, in den<br />
Mittelpunkt stellen. Hier müssen notwendigerweise auf politischer<br />
Ebene teils willkürliche Zielsetzungen erfolgen.<br />
Im Endeffekt ist die Integration von Nachhaltigkeitsindikatoren in<br />
das BIP daher kaum zielführend. Zu sehr verwischen sie den mathematischen<br />
Charakter dieses wichtigen volkswirtschaftlichen Index.<br />
Statt den ökologischen Gedanken aufzuwerten, verlöre das BIP durch<br />
eine zu starke Verwässerung zwangsläufig an Bedeutung. Für eine<br />
stärkere Fokussierung auf Nebenindikatoren zum BIP, als Teil einer<br />
universellen Wohlstandsrechnung, plädiert daher auch der Sachverständigenrat<br />
für Wirtschaft. Gemeinsam mit dem französischen Conseil<br />
d‘Analyse Économique erarbeitete er einen Vorschlag, der neben<br />
dem BIP noch sechs weitere Indikatoren einfordert. Auch wenn das<br />
weder elegant noch einfach ist, scheint es der einzige Weg zu sein,<br />
um der komplexen <strong>Pro</strong>blemstellung Herr zu werden. Wie das BIP, die<br />
Beschäftigungsquote oder inzwischen auch die Treibhausgasemissionsbilanz,<br />
müssen nun weitere Indikatoren zu einem steten Begleiter<br />
im öffentlichen Diskurs werden.<br />
Nico Weber (19) ist Abiturient und lebt in<br />
Duisburg. Dort ist er stellvertretender<br />
Kreisvorsitzender der JuLis. Außerdem ist<br />
er Leiter des Landesarbeitskreises Umwelt<br />
und Infrastruktur. Ihr erreicht ihn unter<br />
nico.weber@julis-nrw.de.<br />
|7
8|<br />
Wer hat Angst vorm<br />
bösen Wolf?<br />
Umweltpolitik ist mehr als Klimaschutz. Auch bedrohte Tierarten bedürfen des politischen Schutzes damit sie<br />
nicht gänzlich verschwinden. Die Rückkehr des Wolfes ist dafür ein Erfolgsbeispiel.<br />
Von Niko Böckly<br />
Ausgangspunkt liberaler Politik ist das Bestreben, die Freiheit<br />
des Einzelnen zu schützen. Sie findet ihre Grenzen in der<br />
Freiheit des jeweils Nächsten. Diese Prämisse gilt auch für<br />
liberale Umweltpolitik, ja gar für die Umwelt an sich. Sie in ihrer<br />
Mannigfaltigkeit zu schützen ist dabei das Ziel. Einer von vielen Aspekten<br />
ist der Artenschutz, also der Schutz vom Aussterben bedrohter<br />
Tiere. Leider werden das immer mehr, worunter die biologische<br />
Vielfalt leidet.<br />
Eine dieser Tierarten ist der Wolf: Er wurde vor circa 150 Jahren in<br />
Deutschland ausgerottet. Vor rund zehn Jahren wurden in Deutschland<br />
wieder die ersten Wölfe gesichtet. International ist der Wolf<br />
eine streng geschützte Art. Auch hierzulande ist der Bestand sehr<br />
klein und konzentriert sich auf wenige Rudel in Ostdeutschland.<br />
Auch einzelne Wölfe werden mancherorts gesichtet. So ist ein Tier<br />
zum Beispiel im hessischen Reinhardswald sesshaft geworden und<br />
macht gelegentliche Ausflüge nach NRW. Es kehrt jedoch immer<br />
wieder nach Hessen zurück.<br />
Der Wolf ist das seltenste Säugetier der Bundesrepublik. Seine<br />
Bejagung ist streng verboten. Nur wenn für ein konkretes Tier ein<br />
dringender Verdacht auf eine Tollwutinfektion besteht, wenn durch<br />
den Angriff eines Tieres unmittelbare Gefahr droht oder wenn Wölfe<br />
erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten, sind Gegenmaßnahmen<br />
gestattet. Die Rückkehr von Beutegreifern wie dem Wolf,<br />
neben dem auch Bär und Luchs wieder heimisch werden, ist nicht<br />
unproblematisch. Schnell entwickeln sich Ängste in der Bevölkerung.<br />
Deswegen ist eine breit angelegte Aufklärung<br />
notwendig. Klare Aussagen, Entmystifizierung<br />
und Versachlichung sind<br />
gefragt. Denn: Das Zusammenleben von<br />
Wolf und Mensch ist möglich.<br />
Dass das Märchen vom „bösen Wolf“ tatsächlich<br />
nur eine Mär ist und vom Wolf<br />
keine Gefahr ausgeht, zeigen dicht besiedelte<br />
Gebiete, in denen Mensch und Tier<br />
eng beieinander leben. Dass die Wölfe<br />
dort nicht angreifen liegt daran, dass sie<br />
im Gegensatz zu Hunden eine natürliche<br />
Scheu gegenüber dem Menschen haben.<br />
Sie können sogar helfen das ökologische<br />
Gleichgewicht zu erhalten. Schließlich<br />
ernähren sie sich von alten und kranken<br />
Rehen, Rothirschen und Wildschweinen.<br />
So halten sie deren Populationen gesund. Natürlich reißen sie auch<br />
Schafe und werden in Notzeiten zu Allesfressern. Trotzdem kann keine<br />
Rede davon sein, dass Wölfe oder andere Wildtiere im Lebensraum<br />
der Menschen überhand nehmen. Vielmehr wird ihr eigener<br />
Lebensraum eingeengt und zerstört. Diese Entwicklung gilt es durch<br />
gezielte Maßnahmen aktiv aufzuhalten. So müssen Flüsse wieder<br />
zum Lebensraum für Fische werden und geschützte Rückzugsräume<br />
geschaffen bzw. erhalten werden. Auch müssen Querungshilfen für<br />
Wildtiere und nächtliche Tempolimits auf Straßen in deren Lebensraum<br />
geprüft werden. Da – mit Blick auf den Wolf – Interessenkonflikte<br />
vor allem mit Jägern und Schäfern auf der Tagesordnung<br />
stehen, sind außerdem Maßnahmen zum Herdenschutz notwendig.<br />
Solche Vorkehrungen sollten in Managementplänen zusammengefasst<br />
werden, die auf die spezifischen Vorkommen zugeschnittenen<br />
sind. Zudem können auch Nistkästen im heimischen Garten helfen.<br />
Ansonsten kann man seltene Arten bald nur noch im Zoo betrachten.<br />
Das wäre eine unschöne Vorstellung.<br />
Niko Böckly (29) ist stellv. Landesvorsitzender<br />
für <strong>Pro</strong>grammatik. Der Industriekaufmann<br />
und Politikwissenschaftler beendet derzeit<br />
den Master Politikmanagement an der NRW<br />
School of Governance in Duisburg. Ihr erreicht<br />
ihn unter niko.boeckly@julisnrw.de.<br />
© MBCH
© ?qwertzui<br />
Don´t touch my junk!<br />
Statt alle Sicherheitsmaßnahmen reflexartig abzulehnen, sollten auch Liberale über die Chancen<br />
neuer Technologien nachdenken. Nur so können sie intelligente Terrorismusprävention mitgestalten.<br />
Von Jon Dannemann<br />
Als der Bundesinnenminister am 17. November 20<strong>10</strong> konkrete Hinweise<br />
auf einen bevorstehenden Terroranschlag auf deutsche Ziele<br />
publik machte, waren die parteipolitischen Reaktionen auf diese<br />
Ankündigung vorhersehbar: Die CDU befürwortete eine Verschärfung<br />
von Gesetzen und Sicherheitsmaßnahmen, während die FDP<br />
dagegen war und zu Besonnenheit mahnte.<br />
Einige Tage später erschwerte sich der Kalifornier John Tyner sein<br />
Thanksgiving. Tyner hatte sich dem „Nacktscan“ verweigert und<br />
drohte einem Mitarbeiter der Flughafensicherheit mit Verhaftung,<br />
falls die dadurch verpflichtende Abtastung zu intim werde („Don’t<br />
touch my junk!“). Dankbar griff der sonst so auf Sicherheit bedachte<br />
Sender Fox News das von Tyner gefilmte Ereignis lautstark und<br />
kritisch auf.<br />
Aus rechtsstaatlicher Sicht können sowohl Prävention als auch Strafverfolgung<br />
nur im Rahmen gesicherter Erkenntnisse und Beweise<br />
stattfinden. Dieser Ansatz ist im Hinblick auf Art. 1 des Grundgesetzes<br />
unstrittig und muss es auch bleiben. Terrorismus hingegen –<br />
obwohl sonst unzureichend definiert – ist, ähnlich wie Krieg, vor allem<br />
eine Erscheinungsform politisch motivierter Gewalt. Weil solche<br />
Gewalt letztlich den Rechtsstaat untergraben will, sollten auch wir<br />
JuLis bereit sein, seine Wehrhaftigkeit mit Augenmaß zu stärken.<br />
Ob der Bürger langfristig bereit ist, den antistaatlichen Affekt des<br />
Liberalismus zu akzeptieren, ist zweifelhaft.<br />
Der von Liberalen mitgetragene Globalisierungsschub der letzten 20<br />
Jahre hat die Ausbreitung klassisch-staatlicher Machtmittel – Geld,<br />
Waffen, Kommunikation und Infrastruktur – auf nichtstaatliche Akteure<br />
begünstigt. Kritik an staatlichem Handeln bleibt notwendig,<br />
darf die von der Globalisierung begleitete Machtkonzentration in<br />
anderen Gesellschaftsteilen aber nicht vernachlässigen. Durch die<br />
zunehmend rein wirtschaftliche Legitimation westlicher Staaten sind<br />
nichtstaatlichen Akteuren wie Terrororganisationen jene Machtmittel<br />
leichter zugänglich gemacht worden, die zuvor staatliche Privilegien<br />
waren. Letztendlich entsteht dadurch auch international ein unlieb-<br />
samer Wettbewerb zwischen verschiedenen Gesellschaftsbereichen.<br />
Kann der Staat die körperliche Unversehrtheit seiner Bürger oder<br />
ihr Vertrauen in ein geregeltes Zusammenleben nicht garantieren,<br />
so erodiert dadurch letztendlich seine Legitimität und sein Schutz.<br />
Durch verschärfte Sicherheitsmaßnahmen schützt der Staat also<br />
nicht nur den Bürger, sondern vor allem auch sich selbst.<br />
In der Terrorbekämpfung gebietet diese Entwicklung, sich eröffnende<br />
technische und organisatorische Möglichkeiten zu nutzen und<br />
ihre Erprobung zu unterstützen. Konstruktiver als eine Blockade neuer<br />
Maßnahmen, deren Anwendung oft unumkehrbar ist, wäre es,<br />
verstärkte Kontrollmöglichkeiten und Transparenz einzufordern sowie<br />
empirische Erkenntnisse abzuwarten. So hat sich Videoüberwachung<br />
an vielen Orten als ineffektiv herausgestellt und Flughafensicherheit<br />
bedarf weltweit einer Reform. Im Entwurf von „smarten“<br />
Lösungen steckt nicht allein politisches Kapital für den Liberalismus,<br />
sondern auch eine wirkliche Lebenserleichterung für den Bürger.<br />
Jon Dannemann (22) lebt in Großbritannien.<br />
Er ist Mitglied der JuLis Mönchengladbach<br />
und studiert War, Peace<br />
and International Relations an der University<br />
of Reading. Ihr erreicht ihn unter<br />
jon.dannemann@gmx.net.<br />
|9
<strong>10</strong>|<br />
<strong>Pro</strong> & <strong>Contra</strong><br />
Ist legaler <strong>Organhandel</strong><br />
ethisch vertretbar?<br />
Um möglichst viele Menschenleben zu retten, muss der <strong>Organhandel</strong> in Deutschland endlich legalisiert werden –<br />
auch aus ethischen Gründen. Ein Weltmarkt für Organe besteht ohnehin bereits.<br />
Von <strong>Pro</strong>f. Dr. Dr. h.c. Peter Oberender<br />
Fünf bis sechs Jahre muss ein nierenkranker Mensch in Deutschland<br />
im Durchschnitt warten, bis er eine Spenderniere bekommt.<br />
Laut der Deutschen Stiftung Organtransplantation<br />
(DSO) warten hierzulande derzeit circa 12.000 Menschen auf eine<br />
Organspende. Für 1.000 Patienten pro Jahr kommt diese Organspende<br />
allerdings zu spät – sie sterben innerhalb der Wartezeit. Angesichts<br />
der demografischen Entwicklung und der Zunahme von Zivilisationskrankheiten<br />
wird der Bedarf an menschlichen Organen weiter<br />
zunehmen. Es ist davon auszugehen, dass die in Deutschland vorgesehenen<br />
Möglichkeiten der Transplantation postmortaler Spenderorgane<br />
sowie die Lebendspenden auch in Zukunft nicht ausreichen<br />
werden, um diesen Mangel an Organen zu beseitigen. Es muss auch<br />
weiterhin alles versucht werden, um die freiwillige Organspende zu<br />
erhöhen. Falschen Hoffnungen sollte man sich dabei jedoch nicht<br />
hingeben.<br />
Aufgrund der vorhandenen Mangelsituation existiert weltweit<br />
bereits ein grauer Markt für Organe. Diese Märkte befinden sich<br />
hauptsächlich im Iran und in Indien. Die Organe werden dort zu<br />
Dumpingpreisen gehandelt und wegen der schlechten Nachsorge<br />
ist die Sterblichkeitsrate der Organspender hoch: Man spricht von<br />
etwa 30 bis 80 <strong>Pro</strong>zent. Angesichts dieser Situation ist es – auch aus<br />
ethischen Gründen – erforderlich, diese Mangelsituation soweit wie<br />
möglich zu lindern. Ein möglicher Ausweg besteht darin, einen regulierten<br />
Markt für Organe zu installieren. Dies hätte den Vorteil, dass<br />
zum einen weniger Menschen wegen des Organmangels sterben und<br />
zum anderen weniger Menschen, die Organe spenden, ausgebeutet<br />
werden und wegen fehlender Nachsorge den Tod finden.<br />
Ein derartiger Markt kann analog zu einer Wertpapierbörse ausgestaltet<br />
werden. Die Nachfrager und die Anbieter müssen sich hierbei<br />
eines Maklers bedienen, der spezifische Qualifikationen nachweisen<br />
muss. Weiterhin müssen die Organspender sich einer eingehenden<br />
Beratung unterziehen. Über diese Börse werden verfügbare Organe<br />
gehandelt – unter staatlicher Kontrolle. Auch Krankenkassen müssen<br />
dabei die Gelegenheit haben, auf diesem Markt mitzubieten.<br />
Unter ökonomischen Aspekten (Opportunitätskosten) kann dies für<br />
Krankenkassen interessant sein. Eine Dialyse kostet jährlich etwa<br />
60.000 bis 70.000 Euro, während sich bei einer Transplantation<br />
die Operationskosten einschließlich Organ auf etwa 50.000 Euro<br />
belaufen dürften und die laufende Medikation nach der Operation<br />
(Immunsuppressiva) etwa 15.000 Euro pro Jahr kosten würde.<br />
Es muss allerdings auch sichergestellt werden, dass niemand der<br />
Zugang zu diesem Handel verwehrt wird, weil er den Preis für das<br />
Organ nicht bezahlen kann. Die Krankenkasse muss hier als Agent<br />
des Betroffenen tätig werden. Bezüglich der Organspende muss eine<br />
lückenlose Nachsorge sichergestellt werden. Außerdem muss für<br />
den Organspender auch eine Beratung bezüglich der Verwendung<br />
des durch den Verkauf seines Organs erzielten Erlöses stattfinden<br />
und eine Verpflichtung bestehen, für ihn eine Risikoversicherung<br />
abzuschließen, für den Fall, dass er selbst ein Organ benötigt. Durch<br />
diesen geregelten Markt wird sichergestellt, dass die vielfältigen Defizite,<br />
die gegenwärtig im Bereich der Organtransplantation bestehen,<br />
einigermaßen gelindert werden können. Wünschenswert wäre<br />
es selbstverständlich, wenn aufgrund einer ausreichenden Spende<br />
auf einen <strong>Organhandel</strong> verzichtet werden könnte, indem für Krankenhäuser<br />
ein finanzieller Anreiz zur Entnahme von Organen geschaffen<br />
wird. Die Erfahrung zeigt jedoch, dass es utopisch ist zu<br />
glauben, dass dies ausreicht. Vielmehr müssen neue Lösungswege<br />
eingeschlagen werden.<br />
<strong>Pro</strong>f. Dr. Dr. h.c. Peter Oberender (69) ist<br />
emeritierter <strong>Pro</strong>fessor für Wirtschaftstheo-<br />
rie an der Universität Bayreuth. Der Gesundheitsökonom<br />
gehörte der bayrischen<br />
Bioethik-Kommission an. Ihr erreicht ihn<br />
unter peter.oberender@uni-bayreuth.de.
<strong>Contra</strong><br />
<strong>Organhandel</strong> macht den Wert<br />
des menschlichen Lebens quantifizier-<br />
und berechenbar. Um die<br />
Würde des Menschen zu schützen,<br />
muss er daher auch weiterhin und<br />
dauerhaft verboten bleiben.<br />
Von Florian Philipp Ott<br />
Die Idee klingt verlockend: Man legalisiert den <strong>Organhandel</strong><br />
und erschafft im gleichen Augenblick<br />
eine dreifach gerechtere Welt. Dem Organmangel<br />
moderner Gesellschaften setzt man erstens ein Angebot von<br />
gesunden Spenderorganen gegenüber. Schwarzmärkten, in denen<br />
mit illegal entnommenen Organen gehandelt wird, entzieht man<br />
zweitens ihr Gut und trocknet sie aus. Zu guter Letzt profitieren drittens<br />
auch all jene Menschen, die ihre Organe heute zu Dumpingpreisen<br />
und unter mangelhafter medizinischer Betreuung verkaufen<br />
müssen. Durch eine <strong>Legali</strong>sierung erzielen sie am Markt höhere<br />
Preise, sind abgesichert und ihre Überlebenschancen steigen. Eine<br />
einzige politische Entscheidung sorgt also für weniger Tod, weniger<br />
Kriminalität und verbesserte Lebenschancen. Eine lehrbuchartige<br />
Win-Win-Situation, so könnte man denken.<br />
Doch eine derartige Argumentation kratzt nur an der Oberfläche<br />
tiefgreifender Fragen, die jede Gesellschaft mit ihren kollektiven Vorstellungen<br />
von Moral und Ethik beantworten muss. Richtschnur für<br />
Deutschland bleibt dabei die Würde des Menschen, deren Schutz<br />
und Achtung laut Grundgesetz stets Verpflichtung aller staatlichen<br />
Gewalt sein muss. Vor diesem Hintergrund hat sich die Politik dem<br />
Dilemma zu stellen, ob es der Würde des Menschen gerecht wird,<br />
wenn dieser Teile seiner selbst verkauft, um das Leben anderer damit<br />
zu verlängern. Die Antwort lautet hier ganz eindeutig: Nein.<br />
Durch die <strong>Legali</strong>sierung des <strong>Organhandel</strong>s deklassiert man den<br />
menschlichen Körper zur Ware. Da selbst Organe von toten Spendern<br />
gehandelt werden sollen, um das so erwirtschaftete Geld an die Erben<br />
auszuzahlen, bilden sich am Markt die Preise für menschliche Ersatzteile.<br />
Nicht mehr die Schwere einer Krankheit und die gesundheitliche<br />
Notwendigkeit entscheiden dann, ob jemand ein Spenderorgan<br />
erhält. Vielmehr wird die finanzielle Leistungsfähigkeit des Bedürftigen<br />
oder seiner Krankenkasse zum Vergabemaßstab. Der Wert des<br />
Lebens wird quantifizierbar und ermöglicht dadurch wirtschaftliche<br />
Berechnungen aller Art. Die Würde des Menschen wird zum Objekt<br />
von Kalkulation und Spekulation degradiert.<br />
Leben kann unter finanziellen<br />
Gesichtspunkten – scheinbar objektiv –<br />
gegen Leben abgewogen werden. Der<br />
Mensch wäre dann nicht mehr Wert an sich,<br />
sondern die Summe der Preise seiner Einzelteile. Sicher<br />
dauert es nicht lange, bis kluge Wissenschaftler berechnen, ab<br />
welchem Grenznutzen sich das Opfer eines Menschenlebens lohnt,<br />
um mehrere andere zu retten. Ein Horrorszenario.<br />
Auch das Argument von Freiheit und Selbstbestimmung, das Befürworter<br />
legalen <strong>Organhandel</strong>s vorbringen, überzeugt nicht. Kein<br />
gesunder Mensch wird freiwillig seine Organe verkaufen, wenn er<br />
wirtschaftlich nicht dazu gezwungen ist. Zudem bleibt der Gewinn<br />
des Verkaufes auch bei Marktpreisen flüchtig und ist schnell ausgegeben.<br />
Die gesundheitlichen Folgen belasten den Spender jedoch<br />
sein Leben lang. Die Wurzeln illegalen <strong>Organhandel</strong>s liegen in der<br />
Armut weiter Teile der Weltbevölkerung. Die Notsituation und der<br />
ökonomische Druck zwingen die Menschen dazu, sich den Risiken<br />
einer Entnahme auszusetzen. Statt Entscheidungsfreiheit zu ermöglichen,<br />
würde die <strong>Legali</strong>sierung nur eine zusätzliche Druckdimension<br />
schaffen, die von einer Gesellschaft ausgeht, in der der Verkauf von<br />
Organen alltäglich ist. Das Zahlen von Schulden mit der eigenen<br />
Niere würde als legitim anerkannt. Statt den Schwarzmarkt wirksam<br />
zu bekämpfen, würde der Rechtsstaat lediglich seine Logik übernehmen.<br />
Das käme einer Kapitulation vor den Machenschaften krimineller<br />
Organhändler gleich. So weit darf es nicht kommen. Um die<br />
Menschenwürde zu sichern, muss <strong>Organhandel</strong> verboten bleiben.<br />
Florian Philipp Ott (22) studiert Politikwissenschaft<br />
an der Universität Duisburg-<br />
Essen und Soziologie in Hagen. Der Krefelder<br />
ist Chefredakteur des julimagazins<br />
und Pressesprecher der Krefelder FDP. Ihr<br />
erreicht ihn unter florian.ott@julis-nrw.de.<br />
|11<br />
© Jenzig71
12|<br />
20<strong>10</strong>: Das Ende der Wehrpflicht<br />
Im April wählte der JuLi-Bundeskongress einen neuen Bundesvorstand. Gleich vier Mitglieder kommen seitdem aus<br />
NRW. Nach fast einem Jahr ist es Zeit für eine erste Bilanz.<br />
Von Jörg Wischinski<br />
Das Jahr im Bundesvorstand begann mit einer der spannendsten<br />
Wahlen in der Geschichte der JuLis: Nachdem<br />
Johannes Vogel aus NRW nach fünf Jahren nicht erneut für<br />
den Bundesvorsitz kandidierte, hieß es Leif gegen Lasse. Im ersten<br />
Wahlgang lag Leif Schubert aus Baden-Württemberg noch hauchdünn<br />
vorne, ihm fehlte lediglich eine Stimme für die absolute Mehrheit.<br />
Im zweiten Wahlgang konnte sich dann aber Lasse Becker aus<br />
Hessen mit <strong>10</strong>1 Stimmen durchsetzen.<br />
Aus NRW sind seit April 20<strong>10</strong> Jan Krawitz als stellvertretender Bundesvorsitzender<br />
und Jörg Wischinski, Beret Roots sowie Julian Kirchherr<br />
als Beisitzer im Bundesvorstand. Natürlich haben wir uns im<br />
Amtsjahr viel mit unserer Seniorenorganisation FDP beschäftigen<br />
müssen. Die ständige Talfahrt und der Verlust des Ansehens wurden<br />
von uns kritisch hinterfragt. Im Sommer haben wir in einem Strategiepapier<br />
daher Partei und Fraktion aufgefordert, einen mittelfristigen<br />
Fahrplan für die weitere Regierungszeit zu erarbeiten. Außerdem<br />
forderten wir ein klares Konzept zur Abschaffung des verminderten<br />
Mehrwertsteuersatzes und zur Abschaffung der Wehrpflicht.<br />
Zumindest bei der Wehrpflicht konnte die FDP Erfolge in der Bundesregierung<br />
liefern: Zehn Jahre nachdem wir JuLis ihre Abschaffung<br />
als programmatische Forderung in der FDP durchgesetzt haben,<br />
wurde die Aussetzung im Herbst politisch beschlossen. Ein großer<br />
Erfolg der JuLis, schließlich ist dieses Beispiel der beste Beweis dafür,<br />
dass es sich für junge Menschen lohnt in einer politischen Jugendorganisation<br />
aktiv zu werden.<br />
Neben den <strong>Pro</strong>blemen der Berliner Regierungskoalition war das<br />
Jubiläum der JuLis das bestimmende und arbeitsintensivste Themenfeld<br />
im Bundesvorstand. Im November haben wir mit etwa 600<br />
Gästen den größten Bundeskongress in unserer Geschichte und<br />
gleichzeitig unseren 30. Geburtstag gefeiert. Der Kongress beschäftigte<br />
sich ausführlich mit der Regulierung der europäischen Finanzmärkte.<br />
Auf der anschließenden Party am Samstagabend hatten wir<br />
Gelegenheit, mit den Abgeordneten des Deutschen Bundestags zu<br />
diskutieren. Am Sonntagmorgen ließen wir 30 Jahre jungliberale<br />
Politik im Allianz Forum am Brandenburger Tor Revue passieren.<br />
Neben diesem Event haben wir im Bundesvorstand vor allem kommunikative<br />
Akzente gesetzt. Du hast darüber in den vergangenen<br />
Monaten zahlreiche Emails von uns erhalten, in denen du über<br />
einzelne <strong>Pro</strong>jekte und Vorhaben informiert wurdest. Außerdem<br />
hast du nun regelmäßig die Möglichkeit, mit Lasse und anderen<br />
Vorstandsmitgliedern über unseren BuVo-Chat direkt in Kontakt zu<br />
treten. Zum Ende unserer Amtszeit haben wir zudem noch etwas<br />
ganz besonderes vor: Jahrelang hat der Verband über einheitliche<br />
Mitgliedsausweise diskutiert. Im Sommer hat der erweiterte Bundesvorstand<br />
endlich deren Einführung beschlossen. Noch vor dem<br />
nächsten Bundeskongress am 15. April 2011 wirst du deinen neuen<br />
Ausweis in den Händen halten.<br />
Insgesamt war 20<strong>10</strong> ein ereignisreiches und arbeitsintensives Jahr.<br />
Die JuLis können aber sehr zufrieden sein. Auch in 2011 werden<br />
wir die Arbeit der FDP kritisch und konstruktiv begleiten müssen.<br />
Der Zustand der Partei ist besorgniserregend. Hinzu kommen sieben<br />
Landtagswahlen. Die dort wahlkämpfenden Landesverbände werden<br />
wir selbstverständlich nach Kräften unterstützen.<br />
Jörg Wischinski (31) kommt aus Münster.<br />
Der Politikwissenschaftler arbeitet im<br />
Büro von Daniel Bahr. Er ist Beisitzer im<br />
Bundesvorstand und Bezirksvorsitzender<br />
der JuLis im Münsterland. Ihr erreicht ihn<br />
unter wischinski@julis.de.
Fünf Fragen an…<br />
Henning Höne<br />
Henning Höne ist seit fast einem Jahr Landesvorsitzender der Jungen Liberalen in NRW. In jeder<br />
Ausgabe stellt er sich den Fragen des julimagazins zum aktuellen Geschehen in der Politik.<br />
Henning, seit November ist Daniel Bahr neuer Vorsitzender<br />
der FDP in NRW. Wie hast du den Wechsel empfunden?<br />
Der Wechsel kam schnell und der Zeitpunkt war überraschend. Für<br />
die JuLis bedeutete dies, dass wir uns nach den Diskussionen um<br />
mögliche Koalitionen mal wieder mit der FDP beschäftigen mussten.<br />
Das ist sicher notwendig, aber die wahlkampffreie Zeit hätte ich<br />
lieber für inhaltliche Arbeit genutzt. Die Zusammenarbeit der JuLis<br />
mit <strong>Pro</strong>fessor Pinkwart war immer gut. Mit Daniel Bahr ist nun aber<br />
natürlich jemand FDP-Landesvorsitzender, der die JuLis wie seine<br />
Westentasche kennt. Die Zusammenarbeit zwischen den JuLis und<br />
der FDP wird deshalb sehr gut bleiben.<br />
Die JuLis verstehen sich als programmatischer Motor der<br />
FDP. Werden sie jetzt nicht überflüssig, wo Daniel Bahr<br />
doch selbst noch JuLi ist?<br />
Auf keinen Fall! Es hat immer JuLis gegeben, die in der FDP Verantwortung<br />
übernommen haben. Das wollen wir und darauf können<br />
wir stolz sein. Trotzdem werden wir immer JuLis brauchen, die nicht<br />
in Koalitionen oder Fraktionen eingebunden sind. Als Jugendorganisation<br />
haben wir das Recht und die Pflicht unabhängiger, mutiger<br />
und frecher zu sein als die Partei. Das gilt strategisch und inhaltlich.<br />
Bestes Beispiel ist die Wehrpflicht: Was heute ganz selbstverständlich<br />
FDP-<strong>Pro</strong>gramm ist, musste von uns JuLis hart erkämpft werden.<br />
Verstehe. Wichtiger ist eigentlich auch die Frage, ob<br />
NRW die Liberalen an sich noch braucht. In Umfragen<br />
sackt die FDP immer weiter ab. Was ist geplant, um diesen<br />
Trend zu stoppen?<br />
Wir bleiben bei unserem Dreiklang: Inhaltliche Verbreiterung. Personelle<br />
Verbreiterung. Strategische Öffnung. Wir müssen erklären,<br />
warum Leistungsgerechtigkeit in Verbindung mit Chancengerechtigkeit<br />
fairer ist als Gleichmacherei. Wir müssen Freiheit als Wert in den<br />
Vordergrund stellen und mit eigenen Themen in die Offensive gehen.<br />
Da gibt es bei der Innen- und Rechtspolitik, der Bildungspolitik<br />
und der Integrationspolitik Möglichkeiten. Wir werden im Landesvorstand<br />
noch vor dem Landeskongress an ein paar Ideen arbeiten,<br />
wie wir diese Ansätze in einer kleinen Kampagne umsetzen können.<br />
Im Landtag kann die FDP durch eigene Initiativen und durch die<br />
Zusammenarbeit mit Rot-Grün bei inhaltlicher Übereinstimmung<br />
punkten. Außerdem sind Umfragen nur Umfragen. Vor einem Fuß-<br />
ballspiel macht sich auch niemand wegen der Wettquoten verrückt<br />
– man kämpft auf dem Platz für ein gutes Ergebnis.<br />
Wann glaubst du, wird die Landesregierung anfangen<br />
ihre Wahlversprechen einzulösen? Hat sie dafür überhaupt<br />
die Mehrheit?<br />
Die Abschaffung der Studienbeiträge soll im Frühjahr beschlossen<br />
werden. Die Studenten in ganz NRW werden dann schnell merken,<br />
dass die versprochene Kompensation der Gelder aus Steuermitteln<br />
ungerecht und kurzfristig gedacht ist. Ansonsten sehe ich im<br />
Moment wenig vom angekündigten Politikwechsel. Bisher macht<br />
er sich vor allem durch zusätzliche Schulden bemerkbar. Dank der<br />
Linkspartei fürchte ich aber, wird es immer eine Mehrheit für Rot-<br />
Grün geben.<br />
Wie du sagst: Rot-Rot-Grün finanziert fast alles über<br />
neue Schulden. Wie stehen eigentlich die Jugendorganisationen<br />
der Regierungsparteien dazu?<br />
Jungsozialisten und Grüne Jugend stören sich an der Verschuldung<br />
nicht. Sie machen es sich einfach, indem sie Schulden als alternativlos<br />
voraussetzen. Gerade für eine Jugendorganisation ist das ein<br />
Armutszeugnis. Die Verfügung des Verfassungsgerichtshofes lässt<br />
mich allerdings hoffen. Spätestens mit juristischen Mitteln wird es<br />
möglich sein, Generationengerechtigkeit über Rekordverschuldung<br />
siegen zu lassen.<br />
|13
14|<br />
Personalien & Notizen<br />
Daniel Bahr auf Neujahrsempfang<br />
Über <strong>10</strong>0 junge Liberale folgten Mitte Januar der Einladung des<br />
Landesverbandes zu dessen traditionellen Neujahrsempfang in der<br />
Düsseldorfer Jazzschmiede. Bei Orangensaft, Sekt und Schnittchen<br />
begrüßten mit Henning Höne und Daniel Bahr die jeweiligen<br />
Landesvorsitzenden von JuLis und FDP das politische Jahr 2011.<br />
Außerdem war der jungliberale Landtagsabgeordnete Marcel Hafke<br />
zu Gast, der erstmals auf einem JuLi-Neujahrsempfang sprechen<br />
konnte, den er nicht selbst als Landesvorsitzender organisiert hatte.<br />
Alle Redner kritisierten die rot-grüne Landesregierung heftig für ihre<br />
maßlose Verschuldungspolitik und riefen dazu auf, die liberale Sache<br />
auch in Zeiten schwieriger Umfrageergebnisse geradlinig zu vertreten.<br />
Im Anschluss an den Neujahrsempfang<br />
tagte die Kreisverbandskonferenz und<br />
beschäftigte sich mit den verwiesenen<br />
Anträgen der letzten Landeskongresse. Zu<br />
Gast war dabei der FDP-Generalsekretär<br />
Joachim Stamp, der sich ebenfalls mit<br />
einem kurzen Grußwort an das interessierte<br />
Daniel Bahr<br />
Publikum richtete.<br />
Jugendpolitischer Dialog im Landtag<br />
Ende Januar lud die FDP-<br />
Landtagsfraktion politisch inte-<br />
ressierte Jugendliche aus ganz<br />
NRW in den Düsseldorfer<br />
Landtag ein. Unter dem Motto<br />
„Jugend in der Politik“ stellten<br />
sich die Abgeordneten dem Dialog mit den zahlreichen Teilnehmern.<br />
Dabei waren natürlich auch viele Jungliberale, die den Weg in die<br />
Landeshauptstadt auf sich genommen hatten. Mit Marcel Hafke<br />
und Ralf Witzel konnten die Politikinteressierten gleich zwei<br />
ehemalige Landesvorsitzende der Jungen Liberalen an ihrem<br />
Arbeitsplatz treffen, denn die gesamte Diskussion fand im Plenarsaal<br />
des Parlaments statt. Im Anschluss daran traf man sich zu<br />
einem Imbiss und weiteren Gesprächen im Foyer des Landtags.<br />
Sattler sitzt fest im Sattel<br />
Auf ihrem Kreiskongress Anfang Dezember wählten die Jungen<br />
Liberalen im Märkischen Kreis Saskia Stattler erneut zu ihrer<br />
Vorsitzenden. Die 18-jährige Studentin ist damit zum dritten Mal<br />
in Folge die führende Liberale vor Ort. Nina-Carolin Krumnau aus<br />
Iserlohn steht ihr als Stellvertreterin zur Seite und Ahmet Günaydin<br />
aus Halver übernimmt die Position des Schatzmeisters. Den<br />
Vorstand vervollständigen die drei Beisitzer Mark Haiden aus Altena,<br />
Alexander Lilienbeck aus Werdohl und Alexander Romanowicz aus<br />
Hemer.<br />
(v.l.n.r.) Ahmet Günaydin,<br />
Mark Heiden, Saskia Sattler,<br />
Alexander Romanowicz,<br />
Nina-Carolin Krumnau,<br />
Alexander Lilienbeck<br />
Landesvorstand besucht LVR-Museum<br />
Im Rahmen seiner letzten Sitzung in 20<strong>10</strong> besuchte der JuLi-<br />
Landesvorstand das Rheinische Landesmuseum in Bonn. Die<br />
Einrichtung wird vom Landschaftsverband Rheinland getragen,<br />
dessen Versammlung seit 2009 mit Sebastian T. Stachelhaus auch<br />
ein JuLi angehört. Nach einem Gespräch mit dem Geschäftsführer der<br />
FDP-Fraktion in der Landschaftsversammlung, Hans-Otto Runkler,<br />
nahm der Landesvorstand an einer Führung durch das Museum teil.<br />
Neben kulturellen Einrichtungen übernimmt der LVR Aufgaben in<br />
der kommunalen Daseinsvorsorge. So betreibt er Lernförderschulen,<br />
Behindertenwerkstätten und andere<br />
soziale Einrichtungen. Dadurch<br />
sorgt er für Synergieeffekte und<br />
entlastet die Haushalte von<br />
Städten und Gemeinden.<br />
Der JuLi-Landesvorstand im<br />
Rheinischen Landesmuseum<br />
Bezirk Köln/Bonn ändert Satzung<br />
Auf ihrem programmatischen Bezirkskongress sprachen sich die<br />
JuLis Köln/Bonn Anfang Dezember für die Änderung ihrer Satzung<br />
aus. Statt des bisher üblichen Bezirkssprechers, wählen die Mitglieder<br />
nun einen wirklichen Bezirksvorsitzenden und einen Stellvertreter.<br />
Außerdem etablierten sie neben der Runde der Kreisvorsitzenden<br />
eine Runde für <strong>Pro</strong>grammatik. Damit möchten sie die inhaltliche<br />
Zusammenarbeit der Kreisverbände in Köln/Bonn verbessern.<br />
Dieses Ziel haben auch die neu in der Satzung etablierten Regio-<br />
Treffs, die mindestens zwei Mal im Jahr stattfinden sollen. Neben<br />
der Satzungsänderung stand noch<br />
ein Vortrag von Werner Hoyer,<br />
Staatssekretär im Auswärtigen Amt, auf<br />
der Tagesordnung. Er referierte über das<br />
deutsche Verhältnis zur Europäischen<br />
Union und den Vereinten Nationen.<br />
(v.l.n.r.) Max Zöller, Daniel Nott,<br />
Mike Pöhler, Willi Bartz, Lucas<br />
Zurheide, Christina Trück<br />
Wünsch macht in Steinfurt weiter<br />
Bereits Ende November wählten die JuLis Steinfurt einen neuen<br />
Vorstand. Neuer und alter Vorsitzender ist Stefan Wünsch aus<br />
Mettingen. Ihm stehen gleich drei Stellvertreter zur Seite: Die<br />
Aufgabe des <strong>Pro</strong>grammatikers übernimmt in Zukunft Florian<br />
Wittrock aus Tecklenburg, die Pressearbeit macht Alexander<br />
Brockmeier aus Rheine und um die Organisation kümmert sich<br />
Albert Kilarski, ebenfalls aus Rheine. Neuer Schatzmeister ist Daniel<br />
Afting-Bühmann, der<br />
auch aus Rheine kommt.<br />
Ihnen allen stehen mit<br />
Nathalie Bockelmann<br />
aus Greven und Tobias<br />
Meirig aus Emsdetten<br />
zwei Beisitzer zur Seite.<br />
Der frisch gewählte Kreisvorstand in Steinfurt.
JuLis Bonn feiern 30. Geburtstag<br />
Anfang Januar wählten die<br />
Jungen Liberalen in Bonn zum<br />
30. Mal einen neuen Vorstand.<br />
Alter und neuer Vorsitzender<br />
ist der Jurastudent Lucas<br />
Zurheide. Als Stellvertreter<br />
(v.l.n.r.) Axel Stammberger, Alexander<br />
Magel, Franziska Müller-Rech,<br />
Hendrik Born, Lucas Zurheide, Florian<br />
Bräuer, Michelle Schneider, Christóbal<br />
Marrero-Winkens<br />
wählten die Mitglieder Orga-<br />
nisatorin Franziska Müller-<br />
Rech, Pressesprecher Axel<br />
Stammberger und <strong>Pro</strong>gram-<br />
matiker Hendrik Born. Das<br />
Amt der Schatzmeisterin übernimmt auch weiterhin Michelle<br />
Schneider. Als Beisitzer gehören Florian Bräuer, Alexander Magel<br />
und Christóbal Marrero-Winkens dem neuen Vorstand an. Im<br />
Anschluss an den Kongress feierten die JuLis Bonn ihr 30-jähriges<br />
Jubiläum mit einer großen Party. Dabei gaben sich die bekannten<br />
Gesichter aus JuLis und FDP ein regelrechtes Stelldichein.<br />
Ordentliche Amtsübergabe in Hagen<br />
Katrin Helling ist nicht länger Kreisvorsitzende in Hagen. Auf dem<br />
ordentlichen Kongress Ende Dezember kandidierte die 24-jährige<br />
Studentin nicht erneut als Vorsitzende, nachdem sie den Verband<br />
seit 2006 angeführt hatte. Zur Nachfolgerin wählten die Hagener<br />
JuLis die 19-jährige Lehramtsstudentin Anna Bergenthal. Sie<br />
unterstützen mit Organisator Alessandro Cordi, Finanzer Christoph<br />
von der Heyden, Mitgliederbetreuer Philipp Alda und Presse-<br />
sprecher Stephan Schmidt gleich vier Stellvertreter. Die Beisitzer<br />
Mareike Neuenfeld, Sven<br />
Reinecke und Matthias<br />
Scholz komplettieren den<br />
neuen Vorstand.<br />
Der neue Vorstand der JuLis<br />
im Kreisverband Hagen.<br />
Werde Mitgliederbetreuer in der LGST<br />
Zum 1. August suchen wir einen neuen Mitgliederbetreuer oder<br />
eine neue Mitgliederbetreuerin für unsere Landesgeschäftsstelle<br />
in Düsseldorf. Neben dem Kontakt zu unseren Mitgliedern<br />
gehören insbesondere die Pflege der Mitgliederdaten, die<br />
Aufnahme von Neumitgliedern und die Verschickung von<br />
Interessentenpaketen zu deinen Aufgaben. Außerdem unterstützt<br />
du das Team der Landesgeschäftsstelle bei der Organisation von<br />
Großveranstaltungen wie unseren Landeskongressen. Die Stelle<br />
umfasst <strong>10</strong> Wochenarbeitsstunden, die regelmäßig an zwei Tagen<br />
abgeleistet werden sollten. Bewirb dich mit Motivationsschreiben<br />
und Lebenslauf unter henning.hoene@julis-nrw.de.<br />
Kennst du schon die JuLi-Angebote im Web 2.0?<br />
Immer aktuelle Podcasts, Reden, Fotos, Infos, Interviews<br />
und Eindrücke unter:<br />
www.youtube.com/julis<br />
www.flickr.com/photos/julisnrw<br />
www.twitter.com/julisnrw<br />
© john krempl<br />
Remscheid: Benjamin Becker hört auf<br />
Anfang Januar machten die JuLis Remscheid Torben Clever zum<br />
neuen Kreisvorsitzenden. Er folgt damit Benjamin Becker nach,<br />
der sechs Jahre die Geschicke des Verbandes geführt hatte. Zum<br />
Stellvertreter für Öffentlichkeitsarbeit wurde Jan-Frederik Kremer<br />
gewählt. Marco Sinani wurde als Stellvertreter für Verbandsarbeit<br />
und -kommunikation bestätigt und Florian Steinbach ist neuer<br />
Stellvertreter für Finanzen. Den Vorstand komplettieren die vier<br />
Beisitzer Matthias Meier, Gabriel Gerlich, Maximilian Loosen und<br />
Benjamin Becker.<br />
(v.l.n.r.) Maximilian<br />
Loosen, Mirco Sinani,<br />
Benjamin Becker,<br />
Gabriel Gerich, Torben<br />
Clever, Hans-Lothar<br />
Schiffer, Jan-Frederik<br />
Kremer, Florian Steinbach,<br />
Matthias Meier<br />
Preisverleihung der Liberalen Gesellschaft<br />
Bereits im vorletzten Heft hatten wir auf den Fotowettbewerb<br />
der Gesellschaft für die Freiheit hingewiesen, der im Rahmen der<br />
Kulturhauptstadt 20<strong>10</strong> stattfand und mit 1.500 Euro dotiert war.<br />
Gefragt waren Fotografien, die dem Wandel des Ruhrgebiets von der<br />
Industrie- zur Kulturlandschaft Rechnung tragen. Am Samstag, den<br />
12. März um 14 Uhr findet nun die Preisverleihung im Gelsenkirchener<br />
InterCity-Hotel statt. Alle JuLis sind hier herzlich willkommen.<br />
Eine vorherige Anmeldung ist unter susanne.schimanski@yahoo.de<br />
möglich.<br />
Werde Chef des<br />
julimagazins<br />
Ab April suchen wir einen neuen Chef-<br />
redakteur oder eine neue Chefredakteurin<br />
für unser julimagazin. Wenn du<br />
Spaß am Schreiben hast, dich der liberalen<br />
Sache verbunden fühlst und schon<br />
Erfahrungen im journalistischen Bereich<br />
machen konntest, be-<br />
3 Landtag: So viel 8 Ist Verstümmelung<br />
Gelb steckt in Rot-Grün immer illegal?<br />
Liberale verbindet mehr mit<br />
SPD und Grünen als sie gemeinhin<br />
denken.<br />
<strong>Pro</strong> & <strong>Contra</strong> zur medizinisch<br />
unnötigen Beschneidung von<br />
Kindern in Deutschland.<br />
03/<strong>10</strong><br />
www.julis-nrw.de<br />
11 Afghanistan: Eine<br />
Frage der Verantwortung<br />
Der Bundestagsabgeordnete<br />
Dr. Bijan Djir-Sarai war zu Besuch<br />
in Afghanistan.<br />
© Landtag NRW / B. Schälte<br />
4 Marcel Hafke: Neuling<br />
auf Sitzplatz 181<br />
Zu Besuch beim frisch gebackenen<br />
JuLi-Landtagsabge-<br />
ordneten Marcel Hafke.<br />
6 Für Johannes eine<br />
Frage der Ehre<br />
Johannes Vogel trägt seit dem<br />
Sommer Verantwortung im<br />
Deutschen Bundestag.<br />
wirb dich bei uns. Wir suchen engagierte<br />
Köpfe mit neuen Ideen und Konzepten für das<br />
Heft. Freude am Umgang mit Sprache, Team-<br />
und Organisationsfähigkeit sowie politisches<br />
Interesse sind Voraussetzungen für den Job.<br />
Schick uns ein kurzes Motivationsschreiben mit<br />
deinen Ideen, deinem Lebenslauf und einigen<br />
Arbeitsproben an henning.hoene@julis-nrw.de.<br />
Bewerbungsschluss ist der 30. März 2011.<br />
|15<br />
9 Zwischen Haushalt<br />
und Datenschutz<br />
02/<strong>10</strong><br />
Alexander Alvaro sitzt zum<br />
zweiten Mal für die JuLis im<br />
Europäischen Parlament.<br />
www.julis-nrw.de
Einladung<br />
zum 74. Landeskongress<br />
Wir freuen uns auf interessante Gäste, eine ergiebige Antragsberatung und spannende Wahlen<br />
zum Landesvorstand. Im Zentrum des Kongresses werden dabei insbesondere jungliberale<br />
Ansätze in der Umwelt- und Klimapolitik stehen, denen wir uns im Leitantrag widmen.<br />
2. bis 3. April 2011<br />
A2 Forum in Rheda-Wiedenbrück<br />
Gütersloher Straße <strong>10</strong>0<br />
33378 Rheda-Wiedenbrück<br />
Herzlich willkommen sind alle Mitglieder, Interessenten,<br />
Freunde und Förderer der Jungen<br />
Liberalen NRW. Weitere Infos zum Tagungsort,<br />
zu Hotelangeboten und zur Anfahrt gibt<br />
es auf www.julis-nrw.de.<br />
Wir freuen uns auf Euch!<br />
Termine 2011<br />
27. Februar 2011 Landespolitischer Tag in Düsseldorf (LpT)<br />
11. bis 13. März 2011 Politisch-<strong>Pro</strong>grammatisches Wochenende (PPW)<br />
26. März 2011 Jubiläumsempfang „<strong>10</strong> Jahre Liberale Senioren“<br />
02. bis 03. April 2011 Landeskongress in Rheda-Wiedenbrück (LaKo)<br />
15. bis 17. April 2011 Bundeskongress (BuKo) in Gütersloh<br />
07. Mai 2011 Landesparteitag der FDP NRW (LPT) in Duisburg<br />
13. bis 15. Mai 2011 Bundesparteitag der FDP (BPT) in Rostock<br />
16. bis 18. September 2011 Landespolitisch-<strong>Pro</strong>grammatisches Wochenende (LPPW)