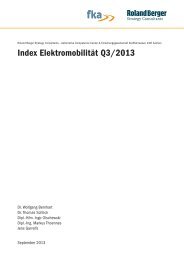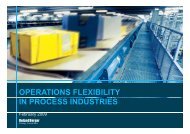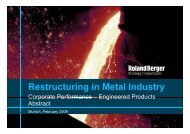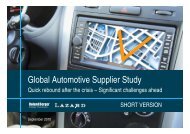Die Kunst der Corporate Recovery - Roland Berger
Die Kunst der Corporate Recovery - Roland Berger
Die Kunst der Corporate Recovery - Roland Berger
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
Das globale Entschei<strong>der</strong>-Magazin von <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants DOSSIER: <strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong> Ausgabe 12<br />
think:act<br />
ROLAND BERGER STRATEGY CONSULTANTS<br />
Michel Platini<br />
setzt auf den<br />
Zukunftsmarkt<br />
Osteuropa<br />
Mo Ibrahim<br />
arbeitet an einem<br />
Wirtschaftswun<strong>der</strong><br />
für Afrika<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong><br />
So kommt Ihr Unternehmen<br />
gestärkt aus <strong>der</strong> Krise<br />
Das globale Entschei<strong>der</strong>-Magazin Ausgabe 12<br />
Pakistan rockt. Norwegens Frauen übernehmen<br />
die Vorstandsetagen. Junge Entrepreneure entdecken das Soziale. Japans<br />
Marketer verschenken Produkte. Lufttaxis verbinden Metropolen.
D A S W I C H T I G S T E B O O K M A R K<br />
D E R P R I N T W E<br />
L T<br />
INTERNATIONAL<br />
MANAGEMENT<br />
KNOWLEDGE<br />
<strong>Die</strong> globale Buchreihe:<br />
Managementwissen<br />
aus den Denkfabriken von<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>.<br />
In Kooperation mit<br />
dem Palgrave-Verlag.<br />
1. AUSGABE<br />
Operations Excellence<br />
Smart Solutions for Business Success<br />
von Axel Schmidt und <strong>Roland</strong> Schwientek<br />
Mehr Informationen unter<br />
www.palgrave.com
Liebe Leser, im aktuellen Standard&Poor’s-500-Index<br />
finden sich nur noch 86 <strong>der</strong> 500 Firmen aus <strong>der</strong> Liste von vor<br />
50 Jahren. Und mehr noch: Als <strong>der</strong> Aktienindex ins Leben gerufen<br />
wurde, konnte ein neu aufgenommenes Unternehmen<br />
damit rechnen, statistisch etwa 65 Jahre auf <strong>der</strong> Liste zu bleiben.<br />
Heute sind es nur noch zehn Jahre! Verän<strong>der</strong>ung ist also nicht<br />
nur ein Berater-Buzzword; sie findet ganz konkret statt, und<br />
wer sich nicht rechtzeitig wandelt, läuft Gefahr unterzugehen.<br />
Wie man ein Unternehmen auf einen schnellen Wandel vorbereitet<br />
und Krisen gestärkt überlebt, erläutern wir in unserem<br />
Dossier zum Thema „<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong>“.<br />
Dr. Burkhard Schwenker<br />
CEO <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants<br />
first views f<br />
Verän<strong>der</strong>ung bedeutet in erster Linie aber eine Chance. Deswegen<br />
stellen wir Ihnen in diesem Heft einige Beispiele von Unternehmern<br />
und Topmanagern vor, die solche neuen Möglichkeiten<br />
in Geschäft verwandeln: André Bergen und Rafal Juszczak zum<br />
Beispiel haben mit ihren Banken sehr früh auf das Osteuropa-<br />
Geschäft gesetzt, Vern Raburn kreiert mit seinen Ultraleichtfliegern<br />
einen neuen Markt für Businessreisende, und Ghazanfar<br />
Ali und Wiqar Ali Khan etablieren <strong>der</strong>zeit das westliche Musikfernsehen MTV in Pakistan.<br />
Exzellente Beispiele für die erfolgreiche und dauerhafte Bewältigung von Verän<strong>der</strong>ung liefern<br />
auch die Gewinner unseres „Best of European Business“-Wettbewerbs, die wir Ihnen in diesem<br />
Heft noch einmal im Überblick vorstellen und die eindrucksvoll unterstreichen, wie wettbewerbsfähig<br />
und stark europäische Unternehmen heute sind. Nicht ohne Grund haben gegenwärtig<br />
23 <strong>der</strong> 50 größten Unternehmen <strong>der</strong> Welt ihren Sitz in Europa.<br />
Seit Kurzem können Sie think:act nicht nur lesen, son<strong>der</strong>n auch hören – und diesmal sogar<br />
ansehen: Auf unserer CD finden Sie einen kurzen Film mit Impressionen vom Wettbewerb<br />
„Best of European Business“. Ich wünsche Ihnen also viel Freude beim Lesen, Hören und Sehen!<br />
3
p inhalt<br />
4<br />
think:act erscheint in fünf Sprachen (auf Deutsch, Englisch, Chinesisch, Russisch und Polnisch)<br />
Per Quote nach oben: Norwegen ebnet seinen Frauen per Gesetz<br />
den Weg in die Topetagen. Aber nutzt dies <strong>der</strong> Gleichberechtigung<br />
wirklich – und kommen so auch die Besten an die Spitze? Seite 46<br />
Neue Flieger grüßen die Sonne: Kleine, flexible Lufttaxis erleben<br />
momentan einen Aufschwung. Doch viele <strong>der</strong> jungen Unternehmer<br />
haben mit Startschwierigkeiten zu kämpfen. Seite 42<br />
Mekka des Pop? In Pakistan erlebt die Musikindustrie einen überraschenden<br />
Aufschwung. Ein massiver Vorteil des Landes: Musiker<br />
sind sehr offen für Co-Branding mit Konsumanbietern. Seite 28<br />
Zweifeln<strong>der</strong> Fußballgott: Als Uefa-Boss ist Michel Platini Teil<br />
<strong>der</strong> Kommerzialisierung des Fußballs. Doch eigentlich wi<strong>der</strong>spricht<br />
diese Tendenz seinem Wertesystem. Seite 32
food for thought<br />
6 Auf dem Weg zur Marktwirtschaft<br />
Wo entwickeln sich für Unternehmen<br />
neue Wachstumschancen?<br />
8 Wi<strong>der</strong> die Armut <strong>der</strong> Eliten<br />
CEOs entdecken die Langsamkeit.<br />
Dabei entsteht ein neues<br />
Verständnis von Management.<br />
dossier<br />
12 <strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong><br />
gesehen von James Dawe<br />
14 Rezession <strong>der</strong> CFOs<br />
Liquidität wird selten, Banken sind<br />
nervös: Immer mehr Unternehmen<br />
müssen ihr Geschäft umbauen.<br />
16 Im Sturm neue Stärke finden<br />
In Krisenzeiten gilt: Wer sich dem<br />
Wandel konsequent stellt, kann von<br />
ihm profitieren.<br />
�<br />
Dossier<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong><br />
Ab Seite 11<br />
20 Rechtzeitig gegensteuern<br />
Gewinnen in hartem Umfeld?<br />
Stahl- und Food-Unternehmen<br />
zeigen, wie es geht.<br />
22 Keine Schnellreparatur<br />
Change-Management ist nicht die<br />
Lösung aller Probleme – und auch<br />
mehr als nur Kommunikation.<br />
24 <strong>Die</strong> neuen Magier?<br />
Essay: Wie sinnvoll sind Chief<br />
Restructuring Officers?<br />
26 Krise als Chance<br />
CEOs können gestärkt aus Krisen<br />
hervorgehen – wenn sie nicht in<br />
die Selbstmitleidsfalle tappen.<br />
industry-report<br />
28 „Pakistan ist cool“<br />
Ein Land entdeckt den Pop – und<br />
<strong>der</strong> Pop einen spannenden Markt.<br />
32 Zwei Seelen und ein Spiel<br />
Uefa-Chef Michel Platini treibt die<br />
Kommerzialisierung des Fußballs<br />
voran – wi<strong>der</strong> Willen.<br />
34 Lissabon im Blick<br />
Der Wettbewerb „Best of European<br />
Business“ zeigt, wo <strong>der</strong> Kontinent<br />
wirklich stark ist.<br />
38 Im Osten viel Neues<br />
Zwei Banken machen vor, wie man<br />
in Osteuropa wächst.<br />
42 <strong>Die</strong> Jetchauffeure<br />
Wie Lufttaxis eine Branche von<br />
Grund auf verän<strong>der</strong>n<br />
44 Zukunftsmärkte<br />
Beton repariert unter Wasser,<br />
Bakterien erzeugen Benzin.<br />
business-culture<br />
inhalt f<br />
46 Aufwärts dank Gesetz<br />
Norwegen hievt Frauen per Quote<br />
auf Chefsessel – eine brillante Idee?<br />
48 Was treibt die guten Unternehmer?<br />
Wie junge „Social Entrepreneurs“<br />
die drängenden Probleme <strong>der</strong> Welt<br />
bekämpfen<br />
56 <strong>Die</strong>bstahl am helllichten Tag<br />
In Japan verschenken Marketer<br />
Produkte – zum Wohle <strong>der</strong><br />
Unternehmen.<br />
58 Work in Progress<br />
Viele aktuelle <strong>Roland</strong>-<strong>Berger</strong>-<br />
Projekte stehen im Zeichen neuer<br />
Wachstumsmärkte.<br />
60 Keine Angst vor Afrika<br />
Unternehmer Mohamed Ibrahim ist<br />
<strong>der</strong> größte Spen<strong>der</strong> des Kontinents.<br />
regulars<br />
3 First Views<br />
62 Service | Impressum<br />
Mit diesem Symbol versehene<br />
Beiträge können Sie auf unserer<br />
Audio-CD (Seite 63) auch hören.<br />
5
p food for thought<br />
ZAHLENWELT<br />
Auf dem Weg zur Marktwirtschaft<br />
60 Prozent <strong>der</strong> untersuchten Län<strong>der</strong><br />
können grundsätzlich als<br />
Demokratie bezeichnet werden,<br />
mit freien Wahlen, Gewaltenteilung und Bürgerrechten. Gut<br />
für die Marktwirtschaft, die dadurch Stabilität erhält. Doch<br />
auch sie haben oft noch Schwächen. Wirklich keine wesentlichen<br />
Defizite weisen nämlich nur 23 <strong>der</strong> untersuchten Demokratien<br />
auf. 42 Staaten gelten als „defekte Demokratien“, zehn<br />
zählen zu den „stark defekten“. Prominentestes Beispiel ist<br />
Russland. Offiziell erfüllt das Land zwar demokratische Mindeststandards.<br />
In <strong>der</strong> Praxis weist es aber noch erhebliche<br />
Rechtsstaatsmängel auf.<br />
Gute Bedingungen für Investitionen<br />
14 Staaten bieten Unternehmen<br />
gute Bedingungen für Investitionen.<br />
Sie sind laut BTI konsolidierte<br />
o<strong>der</strong> weit fortgeschrittene marktwirtschaftliche<br />
Demokratien.<br />
Angeführt wird diese Liste von<br />
Tschechien. Im Vergleich zur Vorgängerstudie<br />
von 2006 stieg nur<br />
ein Land komplett neu in die Spitzengruppe<br />
auf: Lettland. <strong>Die</strong> EU-<br />
Neulinge Bulgarien und Rumänien<br />
schafften es im Index auf<br />
Rang 15 und 17. Relativ stark<br />
abgefallen ist Polen. Gründe da-für<br />
sind laut Bertelsmann Stiftung<br />
unter an<strong>der</strong>em nachlassende<br />
Reformbestrebungen nach dem<br />
EU-Beitritt.<br />
MEDIEN-<br />
KOOPERATION<br />
Welche Marktchancen bieten sich Unternehmen jenseits <strong>der</strong> klassischen Industrielän<strong>der</strong>? Das<br />
verrät <strong>der</strong> Bertelsmann Transformation Index 2008 (BTI). In einer MEDIENKOOPERATION MIT DER<br />
BERTELSMANN STIFTUNG stellt think:act die zentralen Ergebnisse <strong>der</strong> Untersuchung vor, die Erfolge<br />
und Rückschläge auf dem Weg zu rechtsstaatlicher Demokratie und sozialpolitisch flankierter<br />
Marktwirtschaft in 125 Volkswirtschaften misst – und einige Überraschungen parat hat.<br />
1<br />
800 000 000<br />
Menschen in 54 verschiedenen Staaten sind Teil des Wirtschaftsraums<br />
Afrika. Dort entwickelten sich 13 Län<strong>der</strong><br />
zuletzt positiv. <strong>Die</strong> Mehrheit <strong>der</strong> Afrikaner lebt mittlerweile<br />
in Demokratien; <strong>der</strong> Kampf gegen Unterentwicklung und<br />
Armut macht Fortschritte. Neben Mauritius und Botswana<br />
weisen auch Ghana, Senegal und Tansania relativ hohe<br />
Wachstumsraten auf. Immer mehr ausländische Unternehmen<br />
investieren in rohstoffexportierenden Sektoren etwa in<br />
Nigeria und Südafrika.<br />
Obwohl <strong>der</strong> Anteil Afrikas an <strong>der</strong> Weltwirtschaft noch<br />
immer gering ist, gibt es Anzeichen einer stärkeren Einbindung.<br />
So hat sich <strong>der</strong> Handel Asiens mit dem Kontinent in<br />
den letzten 13 Jahren fast verdoppelt. Der Agrarmarkt<br />
wächst, die Nachfrage nach Unterhaltungselektronik steigt.<br />
Note 1 für das politische Management ihres Transformationsprozesses<br />
bekamen Chile, Estland, Botswana, Mauritius und die<br />
Slowakei. Der Inselstaat Mauritius gilt als konkurrenzfähigste<br />
Wirtschaft und stabilste Demokratie Afrikas. <strong>Die</strong> Reformregierung<br />
von Botswana nutzt den Ressourcenreichtum für Investitionen<br />
in Bildung, Infrastruktur und Gesundheit. In Chile konnten<br />
Infrastruktur und Exporte ausgebaut werden. Der in Chile tätige<br />
Deutsche Christian Falkenstein berichtet: „<strong>Die</strong> Mentalität <strong>der</strong><br />
Chilenen ist uns vertraut – sie sind relativ pünktlich und exakt.“<br />
Nachhaltiges Wachstum<br />
1. Tschechien<br />
2. Slowenien<br />
3. Estland<br />
4. Taiwan<br />
5. Ungarn<br />
6. Litauen<br />
7. Slowakei<br />
8. Chile<br />
9. Uruguay<br />
10. Südkorea<br />
11. Polen<br />
12. Costa Rica<br />
13. Lettland<br />
14. Kroatien<br />
0 10 20 30 40 50 60<br />
Einen enttäuschenden Platz 85 unter 125 untersuchten Staaten im BTI-Statusindex belegt überraschen<strong>der</strong>weise China. Wie auch Vietnam vermeide das<br />
Land bisher eine politische Öffnung und ziele „ausschließlich auf eine marktwirtschaftliche Transformation ab“, so die Bertelsmann-Stiftung. <strong>Die</strong> ökonomischen<br />
Erfolge dieser politischen Steuerung „haben durchaus Einfluss auf an<strong>der</strong>e Län<strong>der</strong>“ Asiens, so die Stiftung.<br />
§
10 <strong>der</strong> 49<br />
leistungsfähigsten Volkswirtschaften nutzen die günstige Wirtschaftsentwicklung<br />
für eine Stärkung ihrer sozialen Netze – insbeson<strong>der</strong>e Bulgarien, Lettland,<br />
Mauritius, Polen, Rumänien, Tschechien, Taiwan sowie Südkorea.<br />
Gerade beim sozioökonomischen Entwicklungsniveau und dem sozialen<br />
Ausgleich klafft zwischen den stärksten Performern China, Indien und Singapur<br />
eine große Lücke. Während Singapur sein soziales Netz weiter ausbaute,<br />
müssen China und Indien die wachsende Kluft zwischen Arm und Reich und<br />
die größer werdenden Unterschiede zwischen Regionen überbrücken.<br />
20<br />
Viele leistungsstarke Volkswirtschaften, wenige wirklich gut<br />
funktionierende Sozialsysteme<br />
Überblick über die<br />
Verteilung aller<br />
125 Län<strong>der</strong> nach<br />
den einzelnen Kriterien<br />
für wirtschaftliche<br />
Transformation<br />
Markt- und<br />
Wettbewerbsordnung<br />
Sozialordnung Leistungsstärke <strong>der</strong><br />
Volkswirtschaft<br />
Währungs- und<br />
Preisstabilität<br />
Nachhaltigkeit<br />
Privateigentum<br />
Sozioökonomisches<br />
Entwicklungsniveau<br />
10–9 Punkte (sehr gut) 8–6 Punkte (gut) 5–3 Punkte (schwach) 2–1 Punkte (sehr schwach)<br />
Plätze machte Georgien<br />
in puncto<br />
ökonomische Entwicklung<br />
in zwei Jahren gut. Der Topaufsteiger<br />
reduzierte die Korruption, reformierte<br />
Steuer- und Privatisierungsgesetze,<br />
baute Zoll- und Handelsschranken ab<br />
und erleichterte Betriebsansiedlungen.<br />
Folgen: günstiges Geschäftsklima und Zunahme<br />
ausländischer Direktinvestitionen.<br />
Nur 4 Staaten<br />
erhalten gute Bewertungen für die Nachhaltigkeit<br />
ihrer Wirtschaftssysteme. Singapur,<br />
Slowenien, Südkorea und Taiwan<br />
investieren in beson<strong>der</strong>em Maße in<br />
Bildung, Forschung und Entwicklung.<br />
Gleichzeitig ist Umweltschutz ein wichtiger<br />
Punkt auf <strong>der</strong> Entwicklungsagenda.<br />
70 80 90 100 110 120 125<br />
Platz 85: China<br />
7
p food for thought<br />
8<br />
Wi<strong>der</strong> die Armut <strong>der</strong> Eliten<br />
Sie haben viel, nur eines nicht – Zeit. <strong>Die</strong> globalen Entschei<strong>der</strong> leiden unter<br />
ständigem Termindruck. Doch es formiert sich ein Gegentrend. Immer mehr Menschen<br />
entdecken bewusst die Langsamkeit.<br />
:<br />
<strong>Die</strong> Gleichung scheint einfach: Mit dem<br />
Erfolg steigt <strong>der</strong> Wohlstand. Und mit<br />
dem Wohlstand steigt die Menge <strong>der</strong> Luxusgüter,<br />
die ein Mensch sich leisten kann.<br />
Doch Erfolg hat auch einen Preis: Es kostet<br />
Zeit, ihn zu erringen. Und genau die fehlt<br />
am Ende dieser Gleichung, um den Luxus<br />
lebenswert zu machen. Denn <strong>der</strong> Wert<br />
des Luxus entsteht erst dadurch, dass <strong>der</strong><br />
Mensch die Zeit hat, ihn zu genießen – und<br />
für den künftigen Erfolg zu nutzen, daraus<br />
also eine Investition zu machen. In <strong>der</strong> fernöstlichen<br />
Lebenskunst des Zen gibt es ein<br />
Gleichnis für die Gleichung: Demnach sind<br />
Luxusgüter nichts an<strong>der</strong>es als Nullen.<br />
Einen Wert bekommen sie erst durch<br />
die Eins davor. Und die Eins ist alles, wozu<br />
<strong>der</strong> Luxus dienen kann: Ruhe, Entspannung,<br />
Freude, Erholung und neue Kraft<br />
durch den Genuss, um in <strong>der</strong> Folge wie<strong>der</strong><br />
Spitzenleistungen zu bringen.
Sowohl für den Erfolg als auch für den Wert<br />
des Luxus ist die kritische Variable Zeit. Und<br />
genau die wird heute für Leistungsträger<br />
immer knapper. „Bizarrerweise sind es gerade<br />
die Funktions- und Geldeliten, die über<br />
ihre eigene Lebenszeit am wenigsten frei<br />
verfügen können“, bestätigt <strong>der</strong> Wirtschaftsnobelpreisträger<br />
Daniel Kahnemann, <strong>der</strong><br />
die Irrationalitäten des Homo oeconomicus<br />
erforscht. „Es sind ihre vielfältigen Abhängigkeiten,<br />
die sie versklaven.“<br />
Um mit <strong>der</strong> Zeitnot klarzukommen, wird oftmals<br />
nur dazu geraten, den Mangel besser<br />
zu verwalten. Doch letztlich ist Zeitmanagement<br />
nichts an<strong>der</strong>es als <strong>der</strong> verzweifelte<br />
Versuch, die Planwirtschaft zu retten, indem<br />
man neue Pläne macht.<br />
Was würden Sie als Unternehmer tun? Doch<br />
wohl nur eines: gezielt und großzügig in<br />
Zeit investieren. Dazu rät auch <strong>der</strong> Nobelpreisträger.<br />
Um leistungsfähiger zu werden,<br />
so Kahnemann, gilt es, Zeit möglichst intelligent<br />
zu nutzen und Geld nicht in noch mehr<br />
Besitz und Luxusgüter, son<strong>der</strong>n in Lebensqualität<br />
zu investieren. Gerade wenn man<br />
unter Maximalbelastung steht.<br />
<strong>Die</strong> Leistungselite muss das Verhältnis von<br />
Zeit und Wert neu definieren. Am Anfang<br />
steht dabei nur eine Frage: Was ist es Ihnen<br />
wert, mehr Zeit zu haben? Im Anschluss<br />
eröffnen sich zwei Strategien: erstens mehr<br />
Geld in Zeit und zweitens Zeit in mehr Zeit<br />
zu investieren. Gelegenheiten für beides<br />
gibt es. Denn den neuen Trend haben Unternehmen<br />
und Institutionen bereits als<br />
Zukunftsmarkt entdeckt. Hier die Ergebnisse<br />
einer zeitorientierten Spurensuche:<br />
CASE 1: PROBLEMLÖSER FÜR 40 000 EURO<br />
Der Schweizer Luxusuhrenhersteller Bedat<br />
& Co, die Karosseriemanufaktur Jaguar und<br />
<strong>der</strong> Prêt-à-porter-Handyproduzent Vertu<br />
verschenken Zeit. Denn wer sich die Edelware<br />
leistet, bekommt vom Hersteller gratis<br />
und lebenslang den Zugang zu den <strong>Die</strong>nst-<br />
CARLO PETRINI, Grün<strong>der</strong> <strong>der</strong> Slowfood-Bewegung.<br />
Was im Städtchen Bra begann, gilt heute<br />
mit über 85 000 Mitglie<strong>der</strong>n als eines <strong>der</strong> einflussreichsten<br />
gastronomischen Netzwerke <strong>der</strong> Welt.<br />
leistungen des Conciergeservice Quintessentially<br />
dazu. <strong>Die</strong> Agentur ist ein Pionier<br />
im Bereich des Zeitbudgetservice. Im Jahr<br />
2000 gegründet, hat sich Quintessentially<br />
mit bemerkenswerter Geschwindigkeit von<br />
einem Londoner Klub in ein globales Unternehmen<br />
verwandelt. Dahinter steht das<br />
Wissen, dass „High-net-worth-individuals“<br />
und „Time-stretched-executives“ oft umfassende<br />
Hilfe brauchen, um ihr anspruchsvolles<br />
Berufs- und Privatleben aufrechtzuerhalten<br />
– auch jene, die bereits persönliche<br />
Assistenten haben.<br />
1500 Euro jährlich kostet <strong>der</strong> Eintritt regulär.<br />
Für bis zu 40 000 Euro hat ihr persönlicher<br />
Concierge dann nur noch einen Job: ihnen<br />
jedes Problem vom Hals zu schaffen, zu<br />
besorgen, was sie brauchen, sich zu merken,<br />
was sie mögen, und sogar dann, wenn es<br />
unmöglich ist, noch zu bekommen, was sie<br />
wollen. Dafür arbeiten die Londoner mit<br />
einem weltweiten Netzwerk hoch spezialisierter<br />
Serviceprovi<strong>der</strong> zusammen.<br />
CASE 2: DIE NEUE REISEKULTUR<br />
Was einst mit dem legendären Orientexpress<br />
begann, entdecken europäische Bahngesellschaften<br />
<strong>der</strong>zeit neu: den hochkomfortablen<br />
Schlafwagen. <strong>Die</strong> französische SNCF tut sich<br />
hier beson<strong>der</strong>s hervor, vor allem im schnellsten<br />
Zug <strong>der</strong> Welt, dem TGV. Der lässt mit<br />
einer Reisegeschwindigkeit von 300 Stundenkilometern<br />
transeuropäische Entfernungen<br />
food for thought f<br />
über Nacht zusammenschmelzen. Was zeigt:<br />
Neues Zeitgefühl und Hochgeschwindigkeit<br />
schließen sich nicht aus.<br />
<strong>Die</strong> europäischen Bahngesellschaften bilden<br />
momentan Allianzen, um das Hochgeschwindigkeitsschienennetz<br />
für nächtliche<br />
Reisende enger zu knüpfen. Mireille<br />
Faugère, als Direktorin bei <strong>der</strong> französischen<br />
Staatsbahn SNCF für den grenzüberschreitenden<br />
Personenfernverkehr zuständig:<br />
„Wir müssen diesen Verkehr nun weiterentwickeln.<br />
<strong>Die</strong> Leute wünschen Züge,<br />
die sehr schnell sind und komfortabel und<br />
für die attraktive Preise gelten.“<br />
Über 50 000 Städteverbindungen per Schlafund<br />
Liegewagen werden bereits heute von<br />
mehr als 16 Millionen Fahrgästen pro Jahr<br />
genutzt. Von den Maßstäben des historischen<br />
Orientexpress sind die De-luxe-Abteile<br />
noch ein Stück entfernt. Doch bieten sie<br />
den Luxus einer neuen Zeit: Der Nachttransfer<br />
spart Reisetage, bietet mehr Ruhe, mehr<br />
Raum – auch für Kreativität.<br />
CASE 3: LUNCH IS BACK<br />
Ende <strong>der</strong> Achtzigerjahre definierte Michael<br />
Douglas als Börsenhai Gordon Gekko im<br />
Film „Wall Street“ mit dem Leitsatz „Lunch<br />
is for wimps!“ die Relation von Zeit und<br />
Nahrungsaufnahme für die Topmanagementetagen.<br />
Zeitgleich formierte sich im piemontesischen<br />
Städtchen Bra die Keimzelle einer<br />
weltweiten Wi<strong>der</strong>standsbewegung gegen<br />
jede Form des Fastlife: Slowfood.<br />
„Ich wollte eine Revolution von meinem<br />
Esstisch aus starten – ganz langsam“, sagt<br />
<strong>der</strong> 59-jährige Slowfood-Grün<strong>der</strong> Carlo<br />
Petrini, <strong>der</strong> gerade vom britischen „Guardian“<br />
zu einer <strong>der</strong> 50 Personen gewählt<br />
wurde, die die Welt retten könnten. Er<br />
erkannte die Absurdität eines Zeitverhaltens,<br />
in dem Topmanager, die Umsätze in<br />
Milliardenhöhe verantworten, es nicht<br />
schaffen, regelmäßig und gut zu essen. Sein<br />
Ziel: mehr Lebensqualität – durch mehr Zeit<br />
9
10<br />
für Genuss. Aus <strong>der</strong> Grassroot-Bewegung ist<br />
mit über 85 000 Mitglie<strong>der</strong>n das einflussreichste<br />
öko-gastronomische Netzwerk <strong>der</strong><br />
Welt geworden.<br />
Genuss hat für Slowfoodianer nichts mit<br />
dem Preis zu tun, son<strong>der</strong>n mit <strong>der</strong> Einstellung<br />
zum Leben. Für die Mitglie<strong>der</strong>, die sich<br />
in den regionalen Convivien organisieren,<br />
geht es darum, nicht nur die eigenen Essgewohnheiten,<br />
son<strong>der</strong>n auch sich selbst im<br />
Umgang mit <strong>der</strong> Zeit zu kultivieren.<br />
CASE 4: SUCHE NACH DEM INNEREN RUHEPUNKT<br />
Einen an<strong>der</strong>en Ansatz bietet <strong>der</strong> Managementcoach<br />
Christo Quiske. Mit seinen Kunden<br />
geht er in persönlichen Retreats nicht<br />
den Symptomen ihrer Zeitnot, son<strong>der</strong>n den<br />
mentalen Ursachen auf den Grund – auf Bergen,<br />
in <strong>der</strong> Wüste o<strong>der</strong> einfach bei Spaziergängen<br />
um den nächstgelegenen See. „Wir<br />
sind“, sagt Quiske, „mit unseren Gedanken<br />
ständig in Konzepten über Zukunft o<strong>der</strong><br />
Vergangenheit verstrickt – und leben nie im<br />
Jetzt. Das Gefühl <strong>der</strong> Zeitnot entsteht, wenn<br />
wir uns mit Dingen beschäftigen müssen,<br />
die unseren Konzepten, wie die Dinge sein<br />
sollten, wi<strong>der</strong>sprechen.“<br />
<strong>Die</strong> Lösung besteht für Quiske darin, sich<br />
immer wie<strong>der</strong> klarzumachen, dass Leben<br />
nur im Jetzt stattfindet. Wenn wir wie<strong>der</strong><br />
lernen, uns dem Augenblick wach und präsent<br />
mit allen Sinnen hinzugeben, gebe es<br />
keine Zeitverschwendung mehr.<br />
<strong>Die</strong> absolute Zeitsouveränität entsteht für<br />
den Coach jedoch, wenn es gelingt, in einer<br />
Welt, die sich mehr und mehr beschleunigt,<br />
in sich selbst den Punkt <strong>der</strong> Ruhe und Stille<br />
zu entdecken, einen Ruhepol, <strong>der</strong> selbst in<br />
Momenten größter Hektik nicht verloren<br />
gehe. Hier, so Quiske, liegt die Quelle von<br />
Intuition, innerer Klarheit und Kreativität.<br />
Ruhe und Gelassenheit sind immer ein Prozess<br />
<strong>der</strong> Selbsterkenntnis und Reflexion.<br />
Das verlangt gerade von Menschen mit Führungsverantwortung<br />
immer wie<strong>der</strong> Zeiten<br />
des reflexiven Rückzugs. Quiske empfiehlt,<br />
sich zwei o<strong>der</strong> drei Tage Zeit für ein solches<br />
Retreat zu nehmen – allein o<strong>der</strong> mit an<strong>der</strong>en<br />
Menschen in Führungspositionen.<br />
„Erfolg und Nie<strong>der</strong>lage haben ihre eigene<br />
Dynamik“, sagt Quiske, „aber wer einmal<br />
diesen inneren Punkt auf einem Retreat entdeckt<br />
hat, kann immer wie<strong>der</strong> auf diese<br />
Quelle zurückgreifen. Das ist das eigentliche<br />
Kapital und auch das Lohnende dieses<br />
Investments.“<br />
CASE 5: LERNEN, EIN LEBEN LANG<br />
Während Heerscharen von Akademikern<br />
und MBAs durch immer kürzere Studiengänge<br />
geschleust werden, rät Birger Priddat,<br />
Präsident <strong>der</strong> privaten Eliteuniversität Witten/Herdecke,<br />
zum Luxus einer entschleunigten<br />
Bildung. „Wir müssen in hochdynamischen<br />
Wissensgesellschaften von dem<br />
Wahnsinn wegkommen, nur einmal, in <strong>der</strong><br />
Jugend, auf Universitätsniveau ausgebildet<br />
zu werden – und dann mit diesem Wissen<br />
ein Leben lang auskommen zu müssen. Bei<br />
<strong>der</strong> Verän<strong>der</strong>ungsgeschwindigkeit unserer<br />
Gesellschaft wäre es doch viel intelligenter,<br />
Zeitnischen: Das vom italienischen Designer selbst<br />
geplante Armani/Spa will den entspannten Weg nach<br />
innen verkaufen. Passagiere <strong>der</strong> Singapore Airlines<br />
können in fliegenden Entspannungskapseln ihre<br />
Privatsphäre genießen. <strong>Die</strong> Privatuniversität Witten/<br />
Herdecke setzt auf den Luxus einer entschleunigten<br />
Bildung und auf lebenslanges Lernen.<br />
zwei- o<strong>der</strong> dreimal im Leben Bildung aufzutanken.“<br />
Denn: Bildung braucht Zeit.<br />
Priddats Plan: ein Bildungs-Sabbatical. <strong>Die</strong>se<br />
Idee erschließt <strong>der</strong> Universität neue Bildungsmärkte.<br />
Und sie bricht mit herkömmlichen<br />
akademischen Gewohnheiten und<br />
engem Disziplinendenken. Es geht um<br />
lebenslanges Lernen in einer neuen Dimension,<br />
die weit über die Grenzen <strong>der</strong> MBA-<br />
Ausbildung hinausweisen soll.<br />
Mit dem exklusiven Bildungs-Sabbatical<br />
will man in Witten/Herdecke einen neuen<br />
Trend setzen. Das Angebot richtet sich an<br />
Menschen jeden Alters mit Wunsch nach<br />
einem Bildungsupdate. Das Motto: Studier,<br />
was du willst! Den Studierenden stehen alle<br />
Seminare offen: Medizin, <strong>Kunst</strong>, Naturwissenschaft,<br />
Wirtschaft, Philosophie. Fehlt ein<br />
gewünschtes Studienfach, wird eine Kooperation<br />
mit einer an<strong>der</strong>en Spitzenuniversität<br />
geschlossen. Einzeltutorien mit Professoren<br />
sowie individuelles Coaching in einem weltweiten<br />
Netzwerk von Wissenschaftlern, Experten<br />
und Alumni helfen dabei, den individuellen<br />
Forschungs- und Bildungsinteressen<br />
bis in die Tiefe nachzugehen.<br />
Bildungsluxus jenseits aller Disziplinengrenzen<br />
für Menschen, die wissen, dass sie<br />
die Freiheit wollen, selbst zu entscheiden,<br />
womit sie sich beschäftigen. „<strong>Die</strong>se Menschen<br />
wählen wir sehr genau aus – denn sie<br />
müssen die Freiheit zum geruhsamen Wissenserwerb<br />
aushalten können“, sagt Priddat.<br />
„Nur eine Idee, ein Projekt o<strong>der</strong> ein Thema,<br />
dass für beide Seiten ein herausragendes<br />
Erkenntnispotenzial besitzt, öffnet die<br />
Türen bis in den letzten Winkel unserer<br />
Universität.“ Zum Wintersemester 2008 will<br />
man den ersten Wagemutigen die Tore öffnen.<br />
Das Einzige, was noch entschieden<br />
werden muss, ist <strong>der</strong> Preis für diesen Bildungsluxus..
DIE KUNST<br />
DER<br />
CORPORATE<br />
RECOVERY<br />
DOSSIER #12<br />
In harten Zeiten überdenken viele Unternehmen<br />
ihr Geschäft – und erfinden sich neu. Aber wie<br />
sieht eine kluge Restrukturierung aus, wann<br />
beginnt man damit am besten? Und wie mündet<br />
ein Restrukturierungsprozess in eine Strategie<br />
<strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong>? <strong>Die</strong>ses Dossier liefert<br />
Lösungsansätze – und zeigt, dass Change-<br />
Management heute eine strategische Kernaufgabe<br />
<strong>der</strong> Topmanager ist.<br />
Jede <strong>Recovery</strong> beginnt dabei mit Zahlenwälzen.<br />
Nach soli<strong>der</strong> Analyse müssen Unternehmen dann<br />
ihren eigenen Weg aus <strong>der</strong> Krise definieren –<br />
finanziell, organisatorisch, strategisch. Ein Muss<br />
dabei: Vertrauen bei Partnern schaffen!<br />
„Then you better start swimming<br />
„People don’t resist change,<br />
or you’ll sink like a stone, for the<br />
they resist being changed.“<br />
times, they are a-changin’.“<br />
BOB DYLAN<br />
PETER SENGE
DOSSIER #12<br />
12<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong><br />
<strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong><br />
gesehen von James Dawe<br />
Es ist eine chaotische Wirtschaftswelt, die uns <strong>der</strong> Künstler James Dawe hier präsentiert; eine<br />
Welt, in <strong>der</strong> ständiger Wandel Normalzustand ist. Dawe selbst sagt zu seinem Werk, das er<br />
exklusiv für think:act geschaffen hat: „Ich habe mich auf die Bedeutung von Evolution und<br />
Wandel konzentriert. <strong>Die</strong>se Faktoren sind für das Überleben eines Unternehmens sehr wichtig.<br />
Ich wollte deshalb eine futuristische Hybridstruktur schaffen, die sich zum Himmel streckt –<br />
o<strong>der</strong> einer neuen Utopie entgegen.“ Dawe nimmt mit seiner Collage auch auf die einzelnen Elemente<br />
<strong>der</strong> Beiträge in diesem Dossier Bezug. So tauchen <strong>der</strong> Fiat 500 und ein Flugzeug auf.
<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong> DOSSIER #12<br />
13
DOSSIER #12 <strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong><br />
14<br />
NORTHERN ROCK<br />
NORTHERN ROCK WURDE VER-<br />
STAATLICHT, ALS DIE MASSEN-<br />
KREDITMÄRKTE ABSTÜRZTEN.<br />
DIE BANK REDUZIERT NUN DIE<br />
BILANZSUMME, INDEM SIE<br />
HYPOTHEKEN SCHNELLER<br />
ZURÜCKZAHLT ALS BISHER.<br />
4,1Milliarden<br />
Pfund schuldet das<br />
Unternehmen <strong>der</strong><br />
Bank of England.<br />
»Wir konzentrieren uns<br />
weiterhin auf unsere<br />
wichtigsten Geschäftsziele,<br />
die Rückzahlung<br />
<strong>der</strong> Schulden an die<br />
Regierung, die Freigabe<br />
<strong>der</strong> Bürgschaften<br />
und, zu gegebener Zeit,<br />
die Rückführung <strong>der</strong><br />
Northern Rock in<br />
Privateigentum.«<br />
RON SANDLER, EXECUTIVE CHAIRMAN<br />
AKTIENKURS: STABILISIERT<br />
NACH FREIEM FALL<br />
1000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
Jul. 07 Sep. 07 Nov. 07 Jan. 08 Mär. 08<br />
Quelle: Yahoo<br />
Rezession <strong>der</strong> CFOs<br />
<strong>Die</strong> Zeiten sind härter geworden. Der Liquiditätsengpass entwickelt sich für viele<br />
Unternehmen zu einem echten Problem – auch für die mit einem gesunden Geschäftskonzept.<br />
Oft hilft nur noch eine Restrukturierung, um das Unternehmen zu retten.<br />
s<br />
DIE ANZEICHEN für eine stotternde Wirtschaft<br />
mehren sich. <strong>Die</strong> Kündigung von Hypotheken erreicht<br />
Rekordniveau, Konsumenten schnallen ihre Gürtel<br />
enger. Erst kürzlich gab die Kaffeehauskette Starbucks<br />
eine Gewinnwarnung heraus. Während im Einzelhandel<br />
Umsätze fallen, steigen sie bei den Discountern.<br />
Harte Zeiten für Unternehmenslenker. Denn<br />
nicht nur zügeln Kunden ihre Ausgaben. Firmenchefs<br />
plagen auch unbezahlte Rechnungen, und Banken<br />
sind bei <strong>der</strong> Kreditvergabe immer restriktiver. Dabei<br />
ist flüssiges Kapital bitter nötig, um die schwierigen<br />
Zeiten zu überbrücken o<strong>der</strong> in Innovationen zu investieren.<br />
Gleichzeitig steigen Öl- und Rohstoffpreise,<br />
europäische und asiatische Firmen drücken zudem<br />
die hohen Wechselkursrisiken.<br />
So überrascht es nicht, dass Unternehmen an<br />
ihrem Geld festhalten, wie die Banken nach <strong>der</strong> Subprime-Krise.<br />
Das Ergebnis: <strong>Die</strong> Wirtschaft ist nicht<br />
flüssig. Ein Nachteil für alle, die auf Kapital angewiesen<br />
sind. Während Unternehmen also nach Finanzierungen<br />
suchen, ziehen Banken die Notbremse und<br />
sorgen dafür, dass die eigenen Verluste nicht noch<br />
weiter wachsen.<br />
DIE SUBPRIME-KRISE und Liquiditätsengpässe<br />
belasten die Wirtschaft. In <strong>der</strong> Politik fällt immer<br />
häufiger das bisherige No-no-Wort Inflation. Aber was<br />
bedeutet das für die Chefs? „Wer dachte, sein Unternehmen<br />
sei gegen solche Turbulenzen immun, sollte<br />
lieber noch einmal nachdenken“, sagt Steve Francis,<br />
Partner in <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>s Turnaround and Restructuring<br />
Practice. <strong>Die</strong>ses Überdenken „findet nicht überall<br />
schnell genug statt. Unternehmen aus allen Branchen<br />
werden erst langsam und zögerlich einsehen, dass<br />
Restrukturierungen angebracht sind“.<br />
Das kann tödlich sein. Sind Unternehmen<br />
schlecht auf Krisen vorbereitet, können diese ihnen<br />
das Genick brechen. Und heute ist die Situation be-<br />
<strong>Die</strong>sen Beitrag können Sie auch<br />
auf unserer Audio-CD (Seite 63) hören.<br />
son<strong>der</strong>s gefährlich. In den Bilanzen sind die Fremdkapitalquoten<br />
tendenziell höher und ihre Strukturen<br />
auch komplizierter als bisher. „Ging es bislang bergab,<br />
haben sich die Banken gegenseitig vertraut. Das<br />
ist jetzt selbst bei Routinetransaktionen nicht mehr<br />
<strong>der</strong> Fall“, sagt Francis. Unternehmen, die sich nach <strong>der</strong><br />
Erholung von <strong>der</strong> geplatzten New-Economy-Blase auf<br />
Wachstum konzentrierten, wurden vom Abschwung<br />
durch die Finanzmärkte überrascht. Viele hatten<br />
Schulden angehäuft, weil Kapital so einfach zu haben<br />
war. An<strong>der</strong>e hatten an Private-Equity-Firmen verkauft,<br />
die in den Bilanzen <strong>der</strong> Unternehmen die Schulden in<br />
bis dahin ungeahnte Höhen trieben. Schätzungen<br />
zufolge sind satte 30 Prozent <strong>der</strong> „echten“ Wirtschaft<br />
im Besitz von Private-Equity-Unternehmen. Es ist fast<br />
so, als gerate man mit vollen Segeln in einen Sturm:<br />
Wer auf Kurs bleibt, erleidet Schiffbruch. Aber eine<br />
alternative Route auf <strong>der</strong> Suche nach Liquidität einzuschlagen<br />
ist alles an<strong>der</strong>e als einfach.<br />
<strong>Die</strong>smal sollte nicht <strong>der</strong> CEO allein den Kurs<br />
bestimmen. Ein Umdenken in Bezug auf Schuldenhöhe<br />
und -strukturen ist notwendig. Bei dem gegebenen<br />
Liquiditätsengpass sieht <strong>der</strong> CFO den Tsunami eher<br />
auf das Unternehmen zukommen als <strong>der</strong> CEO. Der CFO<br />
sitzt an <strong>der</strong> Schnittstelle von Firmenaktivität und<br />
Liquidität. Er kann daher die Gefahren <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen<br />
Marktbedingungen am besten einschätzen. „<strong>Die</strong> normale<br />
Rezession ist Sache des CEO. Mit dem Schwerpunkt<br />
auf Liquidität ist dies die Rezession <strong>der</strong> CFOs“,<br />
sagt Francis und fügt hinzu: „CFOs leben und sterben<br />
mit <strong>der</strong> Liquidität. Während CEOs in <strong>der</strong> Lage sind, sich<br />
aus strategischen Fehlern herauszureden und später<br />
beim Lebenslauf ein wenig zu schummeln, wird ein<br />
CFO den Verlust <strong>der</strong> Liquidität eines Unternehmens<br />
nicht überleben. Hier gibt es nur Schwarz o<strong>der</strong> Weiß.“<br />
Unternehmen geraten meist in eine existenzielle<br />
Krise, nachdem sie drei Phasen durchlaufen haben.<br />
Strategische Fehler, durch die das Unternehmen sei-
nen Wettbewerbsvorteil verliert, stehen am Anfang.<br />
<strong>Die</strong>se Fehltritte werden über kurz o<strong>der</strong> lang intern<br />
bekannt. Bald darauf erfahren Stakehol<strong>der</strong> und die<br />
Medien über die sich verschlechternden Zahlen von<br />
dem Dilemma. Auch wenn das Management dann reagiert,<br />
wird dies erst zu spät zu Ergebnissen führen.<br />
<strong>Die</strong> Banken fangen an, bei Kreditvereinbarungen hart<br />
durchzugreifen, und verursachen so eine Krise o<strong>der</strong><br />
gar eine Insolvenz. Ein Beispiel: die US-Autoindustrie.<br />
Vor Jahrzehnten verschliefen die großen Player zentrale<br />
Entwicklungen. Während sie sich auf große Autos<br />
und den Heimatmarkt konzentrierten, setzten die<br />
japanischen und deutschen Hersteller auf internationale<br />
Märkte und energiesparende Technologien. Aber<br />
auch sie bekommen die abnehmende Nachfrage,<br />
strengere Umweltauflagen und angespanntere Lage<br />
an den Finanzmärkten zu spüren. Genau das ist das<br />
Markenzeichen <strong>der</strong> CFO-Rezession: Der Liquiditätsengpass<br />
und die Verunsicherung <strong>der</strong> Finanzmärkte<br />
können auch bei gesunden Unternehmen zu Problemen<br />
führen. Plötzlich kann da ein Unternehmen<br />
we<strong>der</strong> seine Rechnungen bezahlen noch Geld für neue<br />
Technologien o<strong>der</strong> F&E aufbringen. „Ein gutes Unternehmen<br />
mit einer schlechten Bilanz wird so ein<br />
schlechtes Unternehmen“, sagt Francis.<br />
Eine Restrukturierung ist für viele Unternehmen<br />
die einzige Möglichkeit, ihre Geschäfte inmitten <strong>der</strong><br />
Gefahren des Markts weiterzuführen. Kandidaten für<br />
finanzielle Restrukturierungen sind die Unternehmen,<br />
die in ihrem Marktsegment führend sind, aber finanzielle<br />
Engpässe haben. Unternehmen, die aber nicht<br />
nur überschuldet sind, son<strong>der</strong>n auch auf ihrem Markt<br />
zu kämpfen haben, sollten jedoch eine ganzheitliche<br />
Restrukturierung in Betracht ziehen, also eine strategische,<br />
finanzielle und operative Reorganisation.<br />
Als Folge <strong>der</strong> Subprime-Krise geriet in Großbritannien<br />
Northern Rock als erstes Unternehmen ins<br />
Schlingern. Hier wird jetzt in allen drei Bereichen<br />
restrukturiert. Nachdem die Massenkreditmärkte<br />
abstürzten und so das Geschäftsmodell <strong>der</strong> Bank<br />
zusammenbrach, wurde <strong>der</strong> angeschlagene Hypothekengeber<br />
im Februar dieses Jahres verstaatlicht. Ein<br />
neuer CEO leitet nun die Restrukturierung. <strong>Die</strong> Bank<br />
muss jetzt ihre Schulden – Ende März waren es<br />
4,1 Milliarden britische Pfund – <strong>der</strong> Bank of England<br />
bis 2010 zurückzahlen. Teil <strong>der</strong> Restrukturierung ist<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong> DOSSIER #12<br />
auch, dass Northern Rock seine Bilanzsumme reduziert,<br />
indem das Unternehmen Hypotheken schneller<br />
zurückzahlt. Zudem wird die Mitarbeiterzahl um rund<br />
2000 reduziert. Im Mai sagte Ron Sandler, <strong>der</strong> neue<br />
CEO: „<strong>Die</strong> Schulden bei <strong>der</strong> Bank of England werden<br />
geringer, und dank <strong>der</strong> geplanten Hypothekenablösungen<br />
schrumpft unsere Bilanzsumme. Zwar sind<br />
die Rückstände gewachsen, aber die Qualität <strong>der</strong> Kredite<br />
im Kreditbuch ist weiterhin zufriedenstellend und<br />
auf dem im Businessplan verzeichneten Level.“<br />
Natürlich sei <strong>der</strong> Ausblick auf den UK-Hypothekenmarkt<br />
unsicher. Aber „unser bisheriger Fortschritt ist<br />
ermutigend. Wir konzentrieren uns weiterhin auf<br />
unsere wichtigsten Geschäftsziele, die Rückzahlung<br />
<strong>der</strong> Schulden an die Regierung, die Freigabe <strong>der</strong> Bürgschaften<br />
und, zu gegebener Zeit, die Rückführung <strong>der</strong><br />
Northern Rock in Privateigentum“.<br />
<strong>Die</strong> meisten Manager wissen, dass Restrukturierung,<br />
insbeson<strong>der</strong>e die operative Restrukturierung,<br />
ein langfristiger Prozess ist. Sie wissen auch, dass<br />
dieser schnell beginnen muss und möglichst wenig<br />
Unruhe bei Kunden stiften sollte. Hält man sich nicht<br />
an diese Regeln, übernimmt die Bank. „Oft läuft es auf<br />
ein Kräftemessen mit den Banken hinaus, nach dem<br />
Motto: Wer gibt zuerst auf? Insbeson<strong>der</strong>e dann, wenn<br />
man von „Covenant Lite“-Finanzierungskonditionen<br />
profitiert. Wenn man verliert, übernimmt die Bank die<br />
Geschäfte“, sagt Francis.<br />
Richard Tett, Restrukturierungsspezialist von<br />
Freshfield Bruckhaus Deringer, erkennt bereits einen<br />
Trend zur Restrukturierung. „Während die Kreditkrise<br />
immer deutlicher zu spüren ist und die Liquidität austrocknet,<br />
bewegen wir uns auf eine Phase <strong>der</strong> aktiven<br />
Restrukturierung zu.“ In <strong>der</strong> Vergangenheit haben<br />
viele Unternehmen nur durch großzügige Banken<br />
überlebt. „Es hat sich jedoch gezeigt, dass Überbrückungsfinanzierungen<br />
häufig lediglich die Restrukturierung<br />
hinauszögern. Auf dem <strong>der</strong>zeit weit angespannteren<br />
Markt würden einige Firmen, denen in den<br />
vergangenen paar Jahren noch mit Überbrückungskrediten<br />
ausgeholfen wurde, heute sicher keine<br />
Finanzierung mehr bekommen.“<br />
Das ist das Bild früherer Zeiten: Liquidität ohne<br />
Ende und gebührenfreie Kreditvereinbarungen. Jetzt<br />
aber hat sich <strong>der</strong> Wind gedreht. Und die Frage ist: Wer<br />
kann dem Sturm trotzen?<br />
ZEICHEN DES<br />
ABSCHWUNGS<br />
�Der Wert von Gewerbeimmobilien<br />
sinkt.<br />
�Der Konsum im Einzelhandel<br />
lässt nach.<br />
�Gerüchte über Probleme<br />
von hoch verschuldetenUnternehmen<br />
mehren sich.<br />
�Große Unternehmen<br />
zahlen ihre Rechnungen<br />
an kleinere<br />
Unternehmen mit<br />
Verspätung.<br />
15
DOSSIER #12 <strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong><br />
FIAT<br />
DER ITALIENISCHE AUTO-<br />
BAUER WURDE KOMPLETT<br />
UMGEKREMPELT. CEO SERGIO<br />
MARCHIONNE VERRINGERTE<br />
DIE SCHULDEN, ERHÖHTE<br />
DIE LIQUIDITÄT UND SETZTE<br />
AUF KLEINERE AUTOS.<br />
766 Millionen<br />
Euro betrug Fiats<br />
Gewinn im ersten<br />
Quartal 2008.<br />
16<br />
»Am wichtigsten<br />
war es, die organisatorische<br />
Struktur zu<br />
erneuern. Innerhalb<br />
von 60 Tagen haben<br />
wir die alten Strukturen<br />
nie<strong>der</strong>gerissen.<br />
Viele Führungskräfte<br />
mussten gehen.«<br />
CEO SERGIO MARCHIONNE<br />
DER MARCHIONNE-EFFEKT<br />
Kursindex vom 1. Juni 2004 = 100<br />
Fiat<br />
Renault<br />
PSA Peugeot Citroën<br />
2004 2005 2006 2007 2008<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
Quelle: Thomson Datastream<br />
Ab 2004 entwickelte sich die Fiat-Aktie<br />
deutlich besser als die Wertpapiere <strong>der</strong><br />
französischen Konkurrenz.<br />
0<br />
Im Sturm neue Stärke finden<br />
Wenn Firmen ihr Geschäft umbauen, kann viel schiefgehen. Unternehmen wie Fiat<br />
zeigen aber, wie man auf Krisen sinnvoll reagiert. <strong>Die</strong> wichtigsten Regeln: scharfe Analyse,<br />
Ausgabendisziplin und die Bereitschaft zur langfristigen Kooperation mit <strong>der</strong> Bank.<br />
s<br />
UNTERNEHMEN ZU RESTRUKTURIEREN wird<br />
zusehends komplexer: Ihr Verschuldungsgrad steigt,<br />
was eine unübersichtliche Gläubigerhierarchie erzeugt.<br />
Immer ausgefeilter werden folglich auch die<br />
Lösungsvorschläge <strong>der</strong> Restrukturierungsbranche.<br />
Experten haben dabei Best Practices ausgemacht, die<br />
in jedem Verän<strong>der</strong>ungsprozess eine wertvolle Orientierung<br />
bieten.<br />
„Wir glauben, dass eine rein finanzielle Neuorganisation<br />
ohne eine gleichzeitige operationelle<br />
Neuglie<strong>der</strong>ung nicht funktionieren kann“, sagt Max<br />
Falckenberg, Partner bei <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants.<br />
„<strong>Die</strong> meisten Versuche laufen darauf hinaus,<br />
dass man am Ende so o<strong>der</strong> so auch die Strukturen neu<br />
ordnet.“ <strong>Die</strong> Best Practices sollen helfen, die sechs<br />
beson<strong>der</strong>s gängigen Fehlerquellen zu vermeiden.<br />
Fehler Nummer eins: unrealistische Planung.<br />
<strong>Die</strong> Bedürfnisse <strong>der</strong> Kunden werden ignoriert, Marktentwicklungen<br />
verschlafen. Zweiter typischer Fehler:<br />
unpräzise Sanierungspläne. Verantwortlichkeiten<br />
müssen eindeutig geklärt und Ziele klar definiert sein.<br />
Drittens rücken interne Angelegenheiten häufig zu<br />
sehr in den Vor<strong>der</strong>grund, sodass kein Raum bleibt,<br />
sich auf die Wettbewerber zu konzentrieren. Das vierte<br />
Problem besteht im fehlenden Vertrauen <strong>der</strong> Belegschaft<br />
in die Führungsmannschaft – irgendetwas<br />
muss diese ja falsch gemacht haben, wenn jetzt<br />
restrukturiert werden muss, so <strong>der</strong> Gedanke. Punkt<br />
fünf: Viele Unternehmen haben eine zu vage Vorstellung<br />
davon, welche Produkte wirklich Gewinn bringen.<br />
Einige haben ihr Produktportfolio nie gründlich analysiert<br />
und sich zu sehr auf bloße Umsatzsteigerung<br />
konzentriert – statt auf profitables Wachstum.<br />
Schließlich sind sechstens immer noch viele Unternehmen<br />
nur wi<strong>der</strong>willig bereit, etwas zu än<strong>der</strong>n. „Wer<br />
langsam in die Krise driftet, spürt keinen unmittelbaren<br />
Druck“, sagt Falckenberg. Trotzdem schaffen<br />
es einige Firmen, sich zugleich operationell, stra-<br />
<strong>Die</strong>sen Beitrag können Sie auch<br />
auf unserer Audio-CD (Seite 63) hören.<br />
tegisch und finanziell neu aufzustellen – rechtzeitig<br />
vor <strong>der</strong> Liquiditätskrise. Zum Beispiel Fiat. 2004 brachten<br />
die Agnellis als Haupteigner Sergio Marchionne<br />
als neuen Chef an die Spitze, um den Negativtrend zu<br />
stoppen. Der setzte mit <strong>der</strong> Reorganisation an diversen<br />
Fronten gleichzeitig an. Und das schnell.<br />
„Am wichtigsten war es, die organisatorische<br />
Struktur des Unternehmens radikal zu erneuern“, sagt<br />
Marchionne. „Innerhalb von nur 60 Tagen haben wir die<br />
alten Strukturen komplett nie<strong>der</strong>gerissen. Viele Führungskräfte,<br />
die lange dabei waren, aber jegliche<br />
Marktmechanismen zu ignorieren schienen, mussten<br />
gehen. Wir haben die Strukturen flacher gestaltet und<br />
jungen Leuten viel Raum gegeben.“<br />
Inzwischen hat das Unternehmen hervorragende<br />
Perspektiven. Marchionne reduzierte die Schulden<br />
und sorgte für mehr Liquidität. Unter ihm besann sich<br />
Fiat auf die Wurzeln im italienischen Design und konzentrierte<br />
sich wie<strong>der</strong> auf Kleinwagenmodelle. Der<br />
Kultwagen Fiat 500 avancierte zum Liebling <strong>der</strong> Autokenner.<br />
Das Ergebnis: 3,2 Milliarden Euro Gewinn im<br />
Jahr 2007, 66 Prozent mehr als 2006.<br />
ÄHNLICH SIEHT ES BEIM Konsumgüterhersteller<br />
Unilever aus: CEO Patrick Cescau rechnet als Folge <strong>der</strong><br />
Umstrukturierung für 2008 mit einem Gewinnzu–<br />
wachs von rund fünf Prozent – und diese liegen am<br />
oberen Ende des zuvor prognostizierten Rahmens.<br />
Auch Japan Airlines (JAL) kündigte 2006 an, seine Ertragskraft<br />
durch Umbaumaßnahmen steigern zu wollen:<br />
<strong>Die</strong> Passagierabfertigung sollte international neu<br />
organisiert, die Anzahl <strong>der</strong> Maschinen reduziert und die<br />
Kostenstrukturen effizienter gestaltet werden. In den<br />
sechs Monaten bis zum 30. September betrug <strong>der</strong><br />
Gewinn 56,6 Milliarden Yen – im Vorjahr ergab sich im<br />
gleichen Zeitraum ein Gewinn von 8,1 Milliarden Yen.<br />
Immerhin die Verluste senken konnte <strong>der</strong> Autohersteller<br />
Ford – mitten in einem schmerzhaften
Umstrukturierungsprozess. Zwar soll sich die Restrukturierung<br />
noch über mehrere Jahre hinziehen,<br />
doch das erklärte Ziel ist ein positives Ergebnis für<br />
den US-Markt bereits im Jahr 2009. „Wir werden zur<br />
Stelle sein, wenn es auf dem Markt wie<strong>der</strong> bergauf<br />
geht“, so CEO Alan Mulally. „Und zwar mit genau den<br />
Produkten, die die Kunden wollen, und einer Kostenstruktur,<br />
die ihnen die besten Preise bietet.“<br />
Aber: In allen vier Fällen musste erst die Krise<br />
kommen, bevor <strong>der</strong> Wandel einsetzen konnte. Nicht<br />
untypisch, wie eine neue Studie von <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong><br />
zeigt: 71 Prozent <strong>der</strong> Unternehmen reagieren erst,<br />
wenn aus <strong>der</strong> strategischen zusätzlich eine Ertragso<strong>der</strong><br />
Liquiditätskrise geworden ist. Doch die vier<br />
genannten Fälle verbindet noch mehr: <strong>Die</strong> Restrukturierungsmaßnahmen<br />
wurden von <strong>der</strong> Führungsetage<br />
voll unterstützt, <strong>der</strong> Ansatz war ganzheitlich, und die<br />
Maßnahmen wurden rasch umgesetzt.<br />
Was aber sind die Instrumente erfolgreicher<br />
Restrukturierungsprozesse?<br />
INSTRUMENT NR. 1: VERTRAUEN SCHAFFEN DANK<br />
SOLIDER ANALYSE UND PARTNERN VON AUSSEN<br />
Der Markt für Unternehmen ist illiquide. Ein guter CFO<br />
muss den Kreditgebern deshalb korrekte und glaubhafte<br />
Zahlen liefern. „<strong>Die</strong> Geldgeber müssen das<br />
Gefühl haben, dass sie <strong>der</strong> Firma vertrauen können“,<br />
sagt Richard Tett, Restrukturierungsspezialist bei<br />
Freshfields Bruckhaus Deringer. „Allein die Tatsache,<br />
dass überhaupt eine Sanierung ansteht, zeigt, dass<br />
etwas falsch gelaufen ist. Das Unternehmen muss<br />
noch nicht einmal schuld daran sein. Klar ist aber,<br />
etwas lief an<strong>der</strong>s als geplant. So etwas beunruhigt die<br />
Leute – und lässt sie gegenüber Zahlen misstrauisch<br />
werden.“ Experten sind sich einig, dass <strong>der</strong> Blick von<br />
außen hier von großem Nutzen ist.<br />
Unilever hat sich für sein Restrukturierungsprogramm<br />
„One Unilever“ externe Hilfe geholt. Eine<br />
zentrale Maßnahme: Verschiedene Personalfunktionen<br />
wurden zusammengelegt. Das Programm trägt<br />
Früchte. „Dass wir unser Geschäftsmodell optimieren<br />
und den Wandel dabei sehr schnell vorantreiben, hat<br />
uns jetzt schon spürbare Vorteile gebracht“, sagt<br />
Cescau. „<strong>Die</strong> Restrukturierung hat Unilever zu einem<br />
flexibleren und wi<strong>der</strong>standsfähigeren Unternehmen<br />
gemacht, das sich in schwierigen Zeiten und in engen<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong> DOSSIER #12<br />
ZENTRALE BEFUNDE EINER AKTUELLEN ROLAND-<br />
BERGER-STUDIE ZUM THEMA RESTRUKTURIERUNG<br />
�Der wichtigste Erfolgsfaktor für Restrukturierungen<br />
ist das Commitment des Managements.<br />
�Unternehmen reagieren langsam auf Krisen: Nur<br />
50 Prozent werden binnen zwölf Monaten aktiv.<br />
�Frühwarnsysteme sind wichtig, werden aber<br />
selten implementiert.<br />
�Rund zwei Drittel aller Unternehmen benötigen für<br />
die Restrukturierung zusätzliche Mittel.<br />
�<strong>Die</strong> Personalkosten spielen bei <strong>der</strong> Kostenreduzierung<br />
die zentrale Rolle.<br />
�Restrukturierung ist eine immer neu zu bewältigende<br />
Aufgabe.<br />
Kostenstrukturen behaupten kann.“ Tett macht Führungskräften<br />
immer wie<strong>der</strong> deutlich, dass die wirtschaftliche<br />
Krise eines Unternehmens das Verhältnis<br />
zu den Banken einschneidend verän<strong>der</strong>t. Sobald es<br />
um die Restrukturierung eines Unternehmens geht,<br />
übernehmen bei <strong>der</strong> Bank statt <strong>der</strong> gewohnten Ansprechpartner<br />
in <strong>der</strong> Regel Spezialisten für die Schuldumwandlung<br />
das Steuer. Tett hat einiges an Erfahrung<br />
mit auf Krisen spezialisierten Bankern. „<strong>Die</strong>se Leute<br />
gehen völlig an<strong>der</strong>s an die ganze Sache heran“, sagt<br />
er. „Sie haben in <strong>der</strong> Regel viel Erfahrung, was Restrukturierungsprogramme<br />
betrifft. Ihnen sind ganz<br />
an<strong>der</strong>e Dinge wichtig als den Kollegen, die das Unternehmen<br />
bisher betreut haben.“<br />
INSTRUMENT NR. 2: LIQUIDITÄT SCHONEN<br />
Eine Möglichkeit, kurzfristig Liquidität zu erreichen,<br />
besteht darin, Aktiva zu verkaufen, Firmeneigentum<br />
an die Bank zu übergeben, um so die Restrukturierung<br />
zu finanzieren und all das Firmeneigentum zu<br />
veräußern, das nicht <strong>der</strong> Produktion dient. Eine an<strong>der</strong>e<br />
Option: die Lagerhaltung reduzieren. „Wir konnten<br />
die Liquidität eines Maschinenherstellers um zehn<br />
17
DOSSIER #12 <strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong><br />
18<br />
UNILEVER<br />
UNILEVER SETZT AUF KONTI-<br />
NUIERLICHE RESTRUKTURIE-<br />
RUNGSMASSNAHMEN UND<br />
HAT SICH FÜR SEIN ONE-UNI-<br />
LEVER-RESTRUKTURIERUNGS-<br />
PROGRAMM AUCH HILFE VON<br />
AUSSEN GEHOLT.<br />
Um bis zu5 Prozent<br />
könnte <strong>der</strong> Umsatz<br />
2008 steigen,<br />
auch dank <strong>der</strong><br />
Restrukturierung.<br />
»Wir sind zuversichtlich,<br />
2008 ein<br />
Wachstum am oberen<br />
Ende <strong>der</strong> Spanne<br />
von drei bis fünf<br />
Prozent zu erzielen,<br />
in einem zunehmend<br />
herausfor<strong>der</strong>nden<br />
Umfeld. Wir sind<br />
heute fitter, schlanker,<br />
aggressiver.«<br />
CEO PATRICK CESCAU<br />
DER OPERATIVE GEWINN<br />
STIEG UM FAST 40 PROZENT.<br />
Q1/2008<br />
(Millionen €) Anstieg<br />
Operating Profit 1,815 39 %<br />
Pre-tax Profit 1,782 34 %<br />
Net Profit 1,407 34 %<br />
EPS (in €) 0,47 35 %<br />
Quelle: Unilever<br />
Millionen Euro steigern, indem wir einfach die<br />
Rohstofflagerhaltung heruntergefahren haben“, sagt<br />
Falckenberg. An<strong>der</strong>e Tricks: die Außenstände reduzieren,<br />
indem man nicht mehr gegen Rechnung einkauft.<br />
O<strong>der</strong> die Zahlungskonditionen von 45 auf 30 Tage<br />
neu verhandeln.<br />
INSTRUMENT NR. 3: ROLLIERENDE LIQUIDITÄTS-<br />
PROGNOSEN EINFÜHREN<br />
Wenn es bei <strong>der</strong> Restrukturierung eines Unternehmens<br />
um die Finanzen geht, sind rollierende Liquiditätsprognosen<br />
unabdingbar. Laut einer aktuellen<br />
<strong>Roland</strong>-<strong>Berger</strong>-Studie werden diese aber gerade mal<br />
von 30 Prozent aller Unternehmen in einer Liquiditätskrise<br />
implementiert. Steve Francis, Partner bei <strong>der</strong><br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Turnaround and Restructuring Practice<br />
in London, beobachtet Umstrukturierungsprozesse<br />
seit Jahren. Unternehmen verfügten in <strong>der</strong> Regel über<br />
riesige Mengen Cash, die ungenutzt im Unternehmen<br />
herumschwirren, so seine Erfahrung. „Man muss nur<br />
wissen, wo es ist und wer dafür verantwortlich ist“,<br />
sagt Francis. In einem Unternehmen, in dem er den<br />
Job des CRO, also des Chief Restructuring Officer,<br />
übernahm, führte er einen täglichen Bericht für<br />
jedes Unternehmenskonto ein, um aufzuzeigen, was<br />
an Zahlungen ein- und ausging. Außerdem stellte er<br />
sicher, dass keine Unit über mehr Cash verfügte<br />
als nötig. Das Ausgabeverhalten wurde deutlich<br />
restriktiver. „Wenn Manager Geld ausgeben wollten,<br />
mussten sie erst formal anfragen“, erklärt Francis.<br />
„Ohne das Ausgabeverhalten <strong>der</strong>art harsch zu kontrollieren,<br />
ist mehr Disziplin kaum zu erreichen.“<br />
INSTRUMENT NR. 4: SICH DAS BESTE INSOLVENZ-<br />
RECHT AUSSUCHEN<br />
Experten empfehlen Unternehmen, sich für die<br />
Restrukturierung die rechtlichen Rahmenbedingungen<br />
auszusuchen, die einem am meisten entgegenkommen.<br />
Als <strong>der</strong> deutsche Autoteilehersteller<br />
Schefenacker ankündigte, seinen Sitz nach London<br />
zu verlagern, um dort Konkurs anzumelden, wachten<br />
deutsche Politiker plötzlich auf und machten<br />
sich Gedanken über das hiesige Insolvenzrecht.<br />
2007 meldete Schefenacker in London Konkurs<br />
an – und überlebte. Dank des flexibleren britischen<br />
Insolvenzrechts.<br />
INSTRUMENT NR. 5: LANGFRISTIG MIT DER BANK<br />
ZUSAMMENARBEITEN<br />
Gerade bei illiquiden Märkten müssen finanziell angeschlagene<br />
Unternehmen oft langfristig mit dem gleichen<br />
Team von Bankern zusammenarbeiten. Welche<br />
Banker das sind, mag am Anfang <strong>der</strong> Unternehmenssanierung<br />
unklar sein, denn die Hausbank kann Kredite<br />
weiterverkauft haben. Richard Millward, bei NM<br />
Rothschild in London zuständig für den Bereich<br />
Restrukturierung, warnt Manager deshalb: „Man muss<br />
den Kreditvertrag im Detail durchschauen, um genau<br />
zu wissen, ob die Banken einen Kredit ohne Absprache<br />
weiterverkaufen dürfen o<strong>der</strong> ob es dazu <strong>der</strong><br />
Zustimmung des Unternehmens bedarf.“ Millward rät,<br />
sich um gute und stabile Beziehungen zu seinen Kreditgebern<br />
zu bemühen – schließlich befinden sich die<br />
Banken in <strong>der</strong> schwierigen Situation, dass sie ihr Verlustrisiko<br />
minimieren müssen, aber auch dem Unternehmen<br />
helfen möchten, zu überleben. „<strong>Die</strong> Zusammenarbeit<br />
mit den Banken ist immer langfristiger als<br />
zuerst gedacht“, sagt Millward.<br />
INSTRUMENT NR. 6: DIE RICHTIGE KOMMUNIKATIONS-<br />
STRATEGIE WÄHLEN<br />
Gerade wenn die Banken Kredite untereinan<strong>der</strong><br />
weiterverkaufen, können Informationen nach außen<br />
dringen – das sollte man als CFO berücksichtigen.<br />
Sobald Berichte und Zahlen an eine Bank gehen, können<br />
sie dem Unternehmen schaden. „Man muss sich<br />
überlegen, was die Banken mit den Daten anfangen<br />
könnten“, so Millward. „Solange die Banken Geheimhaltungsabkommen<br />
unterzeichnen, können sie die<br />
Informationen nur weitergeben, wenn sie die Erlaubnis<br />
dazu haben.“ Ein Hedgefonds etwa kann in Verhandlungen<br />
mit Banken vertrauliche Informationen<br />
über ein Unternehmen und seine Kredite zur Verfügung<br />
gestellt bekommen. Wenn <strong>der</strong> Fonds die Kredite<br />
dann doch nicht übernimmt, haben seine Manager<br />
trotzdem Interessantes über das Unternehmen erfahren.<br />
<strong>Die</strong>ses Problem kann man kaum umgehen: Unternehmen<br />
sind in vielen Fällen sogar verpflichtet, <strong>der</strong><br />
Bank vertrauliche Daten weiterzugeben. Bevor kritische<br />
Informationen über operationelle Probleme o<strong>der</strong><br />
schlechte Renditeaussichten das Unternehmen verlassen,<br />
muss das Management deshalb zwingend<br />
eine Kommunikationsstrategie entwickelt haben.
INSTRUMENT NR. 7: SICH AUF DAS NEUE RESTRUK-<br />
TURIERUNGS-UMFELD EINSTELLEN<br />
Vor 10 bis 15 Jahren gingen Insolvenzverfahren nur<br />
Banken und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften etwas<br />
an. Banken schrieben Kredite zu 20 bis 80 Prozent ab,<br />
erließen für mehrere Jahre die Zinsen und wandelten<br />
die Kredite schließlich in Unternehmensbeteiligungen<br />
um. Mit etwas Glück konnten die Banken mit dieser<br />
Strategie den ursprünglichen Kredit größtenteils wie<strong>der</strong>erlangen<br />
o<strong>der</strong> sogar Gewinn machen. <strong>Die</strong> Frage war<br />
nur: abwarten o<strong>der</strong> gleich abschreiben?<br />
Inzwischen hat sich ein ganzer Markt für in<br />
Not geratene Kredite entwickelt, und die Kreditgeberstrukturen<br />
werden immer komplexer. „Jetzt, wo Kredite<br />
gehandelt werden, sind Leute bereit, die Kredite<br />
für 60 Cent pro Euro o<strong>der</strong> sogar 20 Cent pro Euro zu<br />
übernehmen“, sagt Francis, „und zwar mit <strong>der</strong> Überlegung,<br />
dass, egal, wie schlecht es aussehen mag,<br />
die Situation nur besser werden kann.“ Jüngste Auktionen<br />
gefährdeter Kredite <strong>der</strong> Deutschen Bank und<br />
<strong>der</strong> Citigroup zeugen davon.<br />
Seit die Verschuldung <strong>der</strong> Unternehmen<br />
zunimmt und <strong>der</strong> Markt für Kredite floriert, sind<br />
immer mehr Parteien am Erfolg jedes einzelnen Unternehmens<br />
interessiert. Dadurch entsteht ein stärkerer<br />
Wille, dieses am Leben zu erhalten – gerade in<br />
Europa, wo nur die wenigsten Unternehmen eine<br />
Insolvenz überleben. In den USA, wo das Insolvenzrecht<br />
großzügiger gestaltet ist, stehen die Chancen,<br />
sich wie<strong>der</strong> am Markt zu etablieren, erheblich besser.<br />
Das heißt aber nicht, dass alle Parteien einmütig<br />
an Lösungsstrategien arbeiten. „Wenn die Vertreter<br />
<strong>der</strong> verschiedenen Parteien gegen den Restrukturierungskurs<br />
und neue Kreditrahmen stimmen, kann<br />
es daran liegen, dass sie die vorgelegten Pläne tatsächlich<br />
für die falsche Unternehmensstrategie halten“,<br />
so Tett. „An<strong>der</strong>e haben die Kreditanteile aber<br />
womöglich aus ganz an<strong>der</strong>en Gründen überhaupt erst<br />
aufgekauft: nämlich, um aus dieser Position Einfluss<br />
geltend zu machen.“ Ein Hedgefonds kann zum Beispiel<br />
versuchen, den Verkauf von Betriebsvermögen<br />
zu erzwingen, um mithilfe von Leerverkäufen Gewinne<br />
zu erzielen, sagt Henry Hu, Juraprofessor an <strong>der</strong><br />
University of Texas. „Je mehr Restrukturierungen und<br />
Insolvenzen es gibt, desto mehr Potenzial gibt es<br />
auch, Unheil anzurichten“, so Hu im „Economist“. In<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong> DOSSIER #12<br />
jedem Fall hat <strong>der</strong> Einfluss von neuen Spielern wie<br />
Hedgefonds Restrukturierungen zu einer sprunghaften<br />
Angelegenheit gemacht. Früher, sagt Millward,<br />
konnten Unternehmen um bis zu 30 Prozent von<br />
ihrem Geschäftsplan abweichen, bevor das die Bank<br />
in Alarmbereitschaft versetzte. „Jetzt sind es vielleicht<br />
20 bis 25 Prozent.“ Außerdem: Noch vor einem<br />
Jahr konnten Unternehmen Wettbewerbe zwischen<br />
Kreditgebern veranstalten, um den besten Deal zu<br />
bekommen. „Heute erhält eine starke Firma, die<br />
nur bis zu einem vernünftigen Maß verschuldet ist,<br />
bedeutend weniger Angebote und hat deshalb eingeschränktere<br />
Handlungsmöglichkeiten“, erklärt<br />
Millward. „Unternehmen, die sich in <strong>der</strong> Vergangenheit<br />
am Aktienmarkt kurzfristig Geld beschaffen konnten,<br />
verfügen heute nicht mehr über diese Option.“<br />
Im Prinzip lässt sich die Situation so zusammenfassen:<br />
In Zeiten des Abschwungs geht <strong>der</strong><br />
Cashflow zurück, und die Führungskräfte haben weniger<br />
Zeit, um schwierige Entscheidungen zu treffen.<br />
Doch Chefs können sich darauf einstellen und – gerade<br />
mit Blick auf künftige Turbulenzen – ihr Unternehmen<br />
immer wie<strong>der</strong> restrukturieren, auch in guten<br />
Zeiten. Wie schon John F. Kennedy sagte: „Man soll<br />
das Dach reparieren, wenn die Sonne scheint.“<br />
BEST PRACTICES: ROLLE DER BANKEN BEI DER<br />
RESTRUKTURIERUNG<br />
�Wählen Sie den besten Partner für die langfristige<br />
Zusammenarbeit aus.<br />
�Versuchen Sie, sich auch die Sicht <strong>der</strong> Bank auf Ihr<br />
Unternehmen vor Augen zu führen.<br />
�Ermitteln Sie, wie stark die Bank in Ihrem Unternehmen<br />
finanziell engagiert ist, und prüfen Sie, ob<br />
die Bank nicht mit zu vielen Risiken belastet ist.<br />
�Machen Sie sich klar, wie Entscheidungsprozesse<br />
in <strong>der</strong> Bank ablaufen und wie <strong>der</strong> Kontakt zur Bank<br />
aussieht: Haben Sie es mit <strong>der</strong> Zentrale zu tun? Ist<br />
Ihr Ansprechpartner entscheidungsbefugt?<br />
19
DOSSIER #12 <strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong><br />
20<br />
MORGEN WITZEL ist Honorary<br />
Senior Fellow an <strong>der</strong> School of<br />
Business and Economics <strong>der</strong> University<br />
of Exeter. Er schreibt für Zeitungen<br />
und Magazine, unter an<strong>der</strong>em<br />
für Financial Times, Financial<br />
World, Finance and Management,<br />
<strong>Corporate</strong> Finance Review und The<br />
Smart Manager, Indiens führendes<br />
Managementmagazin. Er lehrt Geschichte<br />
<strong>der</strong> Managementmethoden<br />
und -praktiken sowie Business<br />
in Asien und Businessstrategien.<br />
Zu seinen Büchern gehören „Doing<br />
Business in China“, „Managing in<br />
Virtual Organizations“, „Management:<br />
The Basics“ und sein aktuelles<br />
Werk „John Adair: Fundamentals<br />
of Lea<strong>der</strong>ship“.<br />
Rechtzeitig gegensteuern<br />
Krisen gelten als Übel. Doch clevere Unternehmen nutzen sie zu ihrem Vorteil, sagt<br />
Managementexperte Morgen Witzel. Wie man in turbulenten Zeiten reagiert, haben<br />
Schwergewichte <strong>der</strong> Stahl- und Lebensmittelbranche wie Mittal und Nestlé gezeigt.<br />
s<br />
„Wandel ist die einzige Konstante einer zivilisierten<br />
Gesellschaft.“ Das Zitat des ehemaligen britischen<br />
Premiers Benjamin Disraeli gilt auch heute<br />
noch, 130 Jahre später. Unternehmen, die sich nicht<br />
weiterentwickeln und anpassen, finden sich schnell<br />
im Überlebenskampf wie<strong>der</strong>. Es gibt aber auch Markt-<br />
Player, die Wandel und auch Krisen als Chance verstehen.<br />
Manager, die den Charakter von Change und<br />
auch die Zyklen des Wandels kennen, setzen dieses<br />
Wissen strategisch ein. Sie nutzen den Druck, um<br />
die Wettbewerbsposition ihres Unternehmens auszubauen,<br />
neue Produkte sowie <strong>Die</strong>nstleistungen einzuführen<br />
und die Organisationsstruktur durch Allianzen<br />
o<strong>der</strong> Akquisitionen zu verän<strong>der</strong>n. Damit wird<br />
ein Unternehmen fit für die Zukunft und zum Gewinner<br />
durch Verän<strong>der</strong>ung.<br />
In <strong>der</strong> Stahl- und Lebensmittelbranche ist ständiger<br />
Wandel schon seit Jahren eine Konstante. So<br />
schwankt die Nachfrage im Stahlbusiness teilweise<br />
drastisch, und die Schmelzhütten suchen immer<br />
nach dem goldenen Mittelweg zwischen Über- und Unterproduktion.<br />
Bei <strong>der</strong> Lebensmittelindustrie erschüttert<br />
dagegen die Produktionsseite regelmäßig<br />
den Markt. Rohstoffpreise können wetterbedingt<br />
plötzlich fallen o<strong>der</strong> steigen.<br />
DIE HISTORIE DIESER BRANCHEN beweist, dass<br />
die Unternehmen verlieren, die sich nicht anpassen.<br />
Vom Altertum bis zum 19. Jahrhun<strong>der</strong>t war Stahlproduktion<br />
fast Heimarbeit. Mit dem Aufkommen neuer<br />
Produktionsprozesse entstanden große Stahlhütten<br />
wie Krupp und Carnegie. <strong>Die</strong> Industrialisierung in<br />
Europa und Nordamerika steigerte die Nachfrage nach<br />
dem Metall so enorm, dass Unternehmer weltweit in<br />
das Schmelzgeschäft einstiegen. Im Jahr 1900 war<br />
die Industrie nicht nur zersplittert, son<strong>der</strong>n auch<br />
anfällig für jede Erschütterung <strong>der</strong> Volkswirtschaft.<br />
Ein zyklischer Abschwung brachte immer auch einen<br />
Rückgang <strong>der</strong> Stahlnachfrage mit sich, beispielsweise<br />
im Schiffsbau und in <strong>der</strong> Bauindustrie. Fielen hohe<br />
Lagerbestände und stornierte Aufträge zusammen,<br />
schraubten viele Unternehmen die Produktion herunter.<br />
Schoss die Nachfrage nach Stahl plötzlich wie<strong>der</strong><br />
in die Höhe, konnten die Stahlanbieter diese nicht<br />
schnell genug bedienen. In den USA suchte die Branche<br />
den Ausweg durch Fusionen – die Grün<strong>der</strong>zeit<br />
<strong>der</strong> Stahlgiganten. Aus Carnegie wurde beispielsweise<br />
die United States Steel.<br />
HEUTE WIEDERHOLT SICH dieser Prozess. In den<br />
Neunzigerjahren war Stahl auf den Weltmärkten nicht<br />
gefragt, jetzt ist er wie<strong>der</strong> ein geschätztes Gut. Aber<br />
wie lange? Umsichtige Stahlunternehmen haben ihre<br />
Lektion aus <strong>der</strong> Geschichte gelernt und denken voraus.<br />
Sie bereiten sich auf Verän<strong>der</strong>ungen vor. „In den<br />
kommenden Jahren und Jahrzehnten bestimmen die<br />
Megatrends die Innovationen und zukunftsträchtigen<br />
Produkte“, sagt Ekkehard Schulz, Vorsitzen<strong>der</strong> des<br />
Aufsichtsrats von ThyssenKrupp. „<strong>Die</strong> Auswirkungen<br />
des Klimawandels, Ressourcenknappheit, Bevölkerungswachstum<br />
und die fortschreitende Urbanisierung,<br />
um nur einige <strong>der</strong> Megatrends zu nennen, stehen<br />
ständig auf <strong>der</strong> Agenda.“<br />
ThyssenKrupp setzt deshalb auf organisches<br />
Wachstum. <strong>Die</strong> Düsseldorfer investieren in neue Produktionsstätten<br />
und sichern die Stahlgel<strong>der</strong> durch<br />
Geschäft in an<strong>der</strong>en Segmenten wie Industriegüter<br />
und <strong>Die</strong>nstleistungen – darunter Aufzüge sowie Komponenten<br />
für den Flugzeugbau und die Autoindustrie.<br />
Das Ziel: von zyklischen Nachfrageflauten unabhängig<br />
werden.<br />
Einige Mitbewerber dagegen schlagen den Weg<br />
von United States Steel ein. Sie hoffen, durch Zukäufe<br />
zukunftsfähiger zu sein. Deshalb übernahm Mittal<br />
seinen Konkurrenten Arcelor und Tata Steel die Aluminium-<br />
und Stahlschmelze Corus. Auch strategische
Allianzen gehören zu dieser Überlebensstrategie. So<br />
kuschelt Boasteel aus Shanghai mit chinesischen<br />
Stahlproduzenten und Japans Nippon Steel. <strong>Die</strong>se<br />
„asiatischen Tigerfirmen“ restrukturieren damit nicht<br />
nur sich selbst. Sie zwingen die Konkurrenz ebenfalls<br />
zu Wachstum, will sie überleben.<br />
Was cleveres Wachstum heutzutage heißt,<br />
exerzieren Mittal und Tata elegant vor. Beide Stahlkocher<br />
sind Teile großer, diversifizierter Konglomerate.<br />
Und <strong>der</strong>en Nachfrage nach Industriemetallen<br />
ist ein nicht unerheblicher Grund für die Arcelor- und<br />
Corus-Deals. Es war also weniger eine Expansion in<br />
einem Marktsegment als vielmehr eine Bewegung<br />
entlang <strong>der</strong> Wertschöpfungskette. „Das Geschäft<br />
än<strong>der</strong>t sich fast jeden Tag“, sagt Sunil Mittal, <strong>der</strong> bei<br />
<strong>der</strong> Mittal Group den Geschäftsbereich Telecom Venture<br />
in Indien leitet. „Du wachst am Morgen auf, und<br />
<strong>der</strong> Boden hat sich einige Zentimeter bewegt. An manchen<br />
Tagen sind es sogar Meter. Wer nicht beständig<br />
dazulernt, verliert.“<br />
INTERESSANTE GEMEINSAMKEITEN mit <strong>der</strong> Stahlindustrie<br />
in Sachen Wandel zeigt die Lebensmittelbranche.<br />
<strong>Die</strong> Rohstoffpreise sind hier oft <strong>der</strong> Grund<br />
für zyklische Schwankungen. Schlechtes Wetter kann<br />
ganze Ernten vernichten, in ertragreichen Jahren gibt<br />
es dagegen ein Überangebot, und die Preise fallen in<br />
den Keller. <strong>Die</strong> Folge: Preisschwankungen. Von diesen<br />
unabhängig macht sich <strong>der</strong> US-Lebensmittelriese<br />
Heinz. Schon 1890 setzte sich Heinz mit haltbaren<br />
hochwertigen Produkten in Dosen und Flaschen an<br />
die Spitze des Markts. Sie waren teuer, aber qualitätsbewusste<br />
Abnehmer waren durchaus bereit, den<br />
Preis zu bezahlen.<br />
Derzeit steckt die Lebensmittelbranche wie<strong>der</strong><br />
in <strong>der</strong> Krise. Beispiel Kaffee: Vor einigen Jahren standen<br />
die Kaffeebauern in Indien vor dem Ruin. <strong>Die</strong> Ernten<br />
waren gut, das Angebot reichlich, die Preise fielen.<br />
In diesem Jahr dagegen lassen heftige Regenfälle im<br />
Süden des Subkontinents die Ernte verfaulen. <strong>Die</strong> Ausfälle<br />
sind dramatisch, die Preise ziehen an. Auf solche<br />
Krisen müssen Lebensmittelhersteller vorbereitet sein.<br />
Und das rechtzeitig. Nestlé, einer <strong>der</strong> führenden Anbieter<br />
von Kaffeeprodukten, versucht daher, zyklische<br />
Preisschwankungen lange im Voraus vorherzusagen<br />
und so seine Geschäfte abzusichern. Als das aktuelle<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong> DOSSIER #12<br />
Bohnendesaster absehbar war, kauften die Schweizer<br />
rechtzeitig Aktien und fe<strong>der</strong>n so die Folgen ab.<br />
QUALITÄT IST NEBEN dieser Absicherungsstrategie<br />
für Nestlé wichtiger Wachstumstreiber. Von höherwertigen<br />
Produkten erwarten sich die Unternehmensstrategen<br />
größere Margen. Ebenso denkt die US-Konkurrenz<br />
von Kraft. Mit den Gourmet-Tiefkühlpizzen<br />
DiGiorno Ultimate will Kraft nicht nur mehr verdienen.<br />
Der Anbieter for<strong>der</strong>t mit seinen belegten Teigfladen<br />
aus <strong>der</strong> Kühltruhe Pizzaketten wie Domino’s mit ihren<br />
Frischwaren heraus. Denn in den von Finanz- und<br />
Immobilienkrisen geschüttelten USA geben die Konsumenten<br />
weniger Geld in Restaurants aus. Eine Krise<br />
und Chance für Kraft. Mit DiGiorno Ultimate will man<br />
sich einen größeren Anteil am nordamerikanischen<br />
Pizzamarkt sichern. Auch die britische Supermarktkette<br />
Waitrose verzeichnete gegenüber ihren preisgünstigeren<br />
Rivalen mehr als das doppelte Wachstum,<br />
indem sie auf Produkte beson<strong>der</strong>er Güte setzte.<br />
Speziell mit Biolebensmitteln ist Waitrose erfolgreich.<br />
Während Nestlé & Co. Qualität anbieten, die<br />
ihren Preis hat, zielen die Strategien an<strong>der</strong>er Lebensmittelanbieter<br />
auf Günstigware. Der One-Dollar-Burger<br />
von McDonald’s o<strong>der</strong> <strong>der</strong> One-Dollar-Kaffee von Starbucks<br />
ist für den US-Konsumenten am Ende <strong>der</strong> Ausgabenkette<br />
gedacht, <strong>der</strong> aufgrund <strong>der</strong> Immobilienund<br />
Finanzkrise stark sparen muss.<br />
Ob sie nun ihr Heil auf den Massenmärkten<br />
o<strong>der</strong> in <strong>der</strong> Nische suchen, im Wachstum durch Fusionen<br />
o<strong>der</strong> durch Allianzen: Erfolgreiche Unternehmen<br />
verstehen schlechte Zeiten als Chance, ihr Geschäftsmodell<br />
zu überdenken – und nicht als Last. Sie nutzen<br />
die Strukturverän<strong>der</strong>ungen des Markts zu ihren<br />
Gunsten, indem sie individuelle Stärken und Marktbedingungen<br />
analysieren. Damit können sie nicht nur<br />
entsprechend, son<strong>der</strong>n vor allem auch rechtzeitig reagieren.<br />
Dabei ist es wichtig, die Kontinuität des<br />
Geschäfts nicht zu vergessen. Etablierte Marken können<br />
dabei helfen. Entscheidend ist aber, die Dynamik<br />
sowie die Gefahren und Chancen des Wandels zu kennen<br />
und zu wissen, wie man darauf reagiert. Das ist<br />
häufig auch eine Frage des Timings. Manager müssen<br />
nicht nur wissen, was zu tun ist und wie es zu tun ist.<br />
Sie müssen unbedingt auch wissen, wann es zu tun<br />
ist. Das ist womöglich die wichtigste Entscheidung.<br />
21
DOSSIER #12 <strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong><br />
22<br />
Keine Schnellreparatur<br />
Restrukturierung ist oft ein langer Prozess, sagt Stuart Crainer in diesem Beitrag. Um<br />
wie<strong>der</strong> spitze zu werden, muss ein Unternehmen bereit für Verän<strong>der</strong>ungen sein. Beson<strong>der</strong>s<br />
wichtig: Wandel ist nicht nur eine Sache <strong>der</strong> Kommunikation; Change braucht Strategie.<br />
s<br />
ORGANISATIONEN KOMMEN und gehen. Manche<br />
legen einen kometenhaften Aufstieg hin und sind<br />
ebenso schnell wie<strong>der</strong> verglüht. An<strong>der</strong>e wachsen stetig<br />
und verän<strong>der</strong>n sich langsam, ihre Mitarbeiter,<br />
Arbeitsweisen, Unternehmenskultur und -ziele. Eine<br />
Firma, die mit den gleichen Mitarbeitern auf die gleiche<br />
Art das gleiche Ziel verfolgt wie ein Jahr zuvor, wird es<br />
vielleicht bald nicht mehr geben. Wandel ist Teil des<br />
Wirtschaftslebens. Da erstaunt es, dass <strong>der</strong> Begriff<br />
Change-Management erst in den Neunzigern Einzug in<br />
die einschlägigen Lexika gehalten hat.<br />
<strong>Die</strong> Zurückhaltung gegenüber Verän<strong>der</strong>ungen<br />
ist verständlich. Organisationen und Individuen klammern<br />
sich gerne an den Status quo. Denn Wandel, das<br />
legt jede Studie zu dem Thema nahe, ist mit Schwierigkeiten<br />
verbunden. Wandel ist gefährlich, ganz gleich,<br />
ob man Produktlinie und Organisationsstruktur leicht<br />
verän<strong>der</strong>t, ein Unternehmen vollkommen restrukturiert<br />
o<strong>der</strong> es mit einem an<strong>der</strong>en fusioniert.<br />
Aber Wandel ist machbar. Davon zeugen <strong>der</strong><br />
erneute Aufstieg von IBM unter Lou Gerstner, die<br />
Wie<strong>der</strong>belebung <strong>der</strong> Kaufhauskette Marks & Spencer<br />
unter Stuart Rose o<strong>der</strong> die Wandlung <strong>der</strong> Olympischen<br />
Spiele nach <strong>der</strong> Beinahe-Pleite Anfang <strong>der</strong> Achtzigerjahre<br />
zur Goldgrube von heute. Wie aber soll man <strong>der</strong><br />
Realität des Wandels begegnen? Wie initiiert man ihn?<br />
Sich zu vergegenwärtigen, dass Verän<strong>der</strong>ung kontinuierlich<br />
geschieht, ist dabei <strong>der</strong> erste Schritt. Wandel<br />
ist ein Dauerzustand – das wurde mir beson<strong>der</strong>s durch<br />
ein Gespräch mit dem jetzigen CEO von Pitney Bowes<br />
und seinem Vorgänger klar. Der Konzern gilt in diesem<br />
Punkt als Vorreiter in <strong>der</strong> US-Unternehmenswelt. Dabei<br />
gab es für diesen Giganten, <strong>der</strong> über einen Marktanteil<br />
von 80 Prozent verfügt, äußerlich kaum einen Grund,<br />
sich neu zu erfinden. Autor Jim Collins pries Pitney<br />
Bowes mit seinen mehr als zwei Millionen Kunden,<br />
über 3500 aktiven Patenten und seinem Umsatz von<br />
über 5,5 Milliarden Dollar in „Good to Great“ als Vor-<br />
bild. Trotzdem hat sich <strong>der</strong> Konzern im letzten Jahr<br />
einer sorgfältig kalibrierten Verwandlung unterzogen.<br />
Spricht man mit CEO Murray Martin und seinem Vorgänger<br />
Michael Critelli, ist Wandel immer wie<strong>der</strong> ein<br />
wichtiges Thema. „Ich nenne es: ‚Wachs o<strong>der</strong> stirb‘“,<br />
so Martin. „Wir haben uns deshalb gesagt: Wenn wir<br />
auf einem Markt 80 Prozent haben, wo sind dann die<br />
Möglichkeiten, um auf den angrenzenden Märkten<br />
unsere Kapazitäten, unser Wissen und unsere Mitarbeiterzahl<br />
zu vergrößern?“ Das Unternehmen definiert<br />
sich also permanent neu. Wandel wird bei Pitney<br />
Bowes als konstante Neubestimmung <strong>der</strong> Wettbewerbsposition<br />
verstanden.<br />
UND DAS IST SICHER NICHT einfach. Ein Nebeneffekt:<br />
Der nominelle Marktanteil schrumpfte über<br />
Nacht; <strong>der</strong> Anteil auf dem neuen, größeren Markt wurde<br />
auf eine kleine einstellige Prozentzahl geschätzt.<br />
„Wenn etwas gut läuft, dann setzt man nicht gern<br />
auf radikale Verän<strong>der</strong>ungen. Doch um zu sein, wer wir<br />
sind, mussten wir diesen Weg gehen“, resümiert Martin<br />
und fügt hinzu: „Evolution ist nicht gut, wenn man<br />
sich aus einer schlechten Position heraus entwickelt.“<br />
Martin ist energiegeladen und beschränkt sich<br />
aufs Wesentliche – so sehr, dass er bei seinem Antritt<br />
seine ursprünglich fünf Kernbotschaften auf drei reduzierte.<br />
Management und Managementabfolge orientieren<br />
sich am Wandel. Für Michael Critelli, bis 2007 CEO<br />
des Unternehmens, benötigt man als CEO drei Jahre,<br />
um sich zu akklimatisieren. In den folgenden fünf o<strong>der</strong><br />
sechs Jahren nimmt man die Rolle des Change-Agent<br />
ein und setzt seine eigenen Programme und Visionen<br />
für das Unternehmen um. Eine solide Nachfolgeplanung<br />
schließlich dauert vier Jahre, während <strong>der</strong> man<br />
Talente für die kommende Generation aufbaut.<br />
So etwas funktioniert aber nur in einer Organisation,<br />
in <strong>der</strong> Wandel als notwendiger Teil <strong>der</strong> Unternehmenskultur<br />
betrachtet wird. Wandel, so Critelli und
Martin, braucht deshalb ein gutes Management. „Wo<br />
beginnt Führung? Dort, wo Wandel beginnt“, betont<br />
<strong>der</strong> Politikwissenschaftler James McGregor Burns. Für<br />
ihn ist die Führungskraft nicht <strong>der</strong> Vollen<strong>der</strong> des Wandels,<br />
son<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Katalysator. Das verlangt von Führungskräften,<br />
dass sie den Anstoß dazu geben und die<br />
Agenda neu schreiben.<br />
Das Wissen, wie man Verän<strong>der</strong>ungsprozesse<br />
managt, ist heute gefragter denn je. Ein Drittel <strong>der</strong> europäischen<br />
Unternehmen hat bereits Change-Projekte<br />
budgetiert; <strong>der</strong> systematische Wandel bestehen<strong>der</strong><br />
Geschäftsmodelle und Organisationen wird von 85 Prozent<br />
als wichtig o<strong>der</strong> sehr wichtig betrachtet. Doch es<br />
ist verblüffend, wie erfolglos die meisten dieser Projekte<br />
sind. <strong>Die</strong> Hälfte aller verantwortlichen Manager<br />
gibt zu, dass sie ihre Verän<strong>der</strong>ungsziele in <strong>der</strong> Vergangenheit<br />
klar verfehlt haben, 80 Prozent sämtlicher<br />
Change-Management-Projekte gelten für die Unternehmensleitungen<br />
als ganz o<strong>der</strong> teilweise gescheitert.<br />
Woran das liegt? „Europäische Unternehmen<br />
wollen dieses Jahr rund 15 Prozent mehr Geld für<br />
Change-Management bezahlen, <strong>der</strong> Löwenanteil davon<br />
fließt in die Kommunikation mit den Mitarbeitern – und<br />
das ist falsch“, sagt Torsten Oltmanns von <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong><br />
Strategy Consultants. Sein Team hat die Regeln für<br />
erfolgreiches Change-Management untersucht und<br />
festgestellt: „<strong>Die</strong> meisten Projekte scheitern daran,<br />
dass das Management die Konflikte in den eigenen<br />
Reihen nicht systematisch löst. <strong>Die</strong> Folge: Es gibt keine<br />
tragfähige, realistische Strategie.“ Trotzdem werden<br />
kostspielige Programme für die Verhaltensän<strong>der</strong>ungen<br />
<strong>der</strong> Mitarbeiter aufgesetzt. Aber: „Wenn die Führungsfragen<br />
nicht gelöst sind, ist das rausgeworfenes<br />
Geld“, so Oltmanns, „Change-Management ist eine Topmanagementaufgabe.“<br />
Für erfolgreichen Wandel ist <strong>der</strong> Einsatz einer<br />
kritischen Masse an Personen notwendig – nach<br />
Ansicht von Harvard-Change-Guru John Kotter „eine<br />
Gruppe von 2 bis 50 Personen, je nach Größe des<br />
Unternehmens –, um die Organisation in eine neue<br />
Richtung zu bewegen“. Ohne diese kritische Masse<br />
passiert nichts, meint Kotter. <strong>Die</strong> Einsicht, dass Verän<strong>der</strong>ung<br />
<strong>der</strong> Führung bedarf, sollte aber nicht dazu<br />
verleiten, Wandel lediglich als Initiative o<strong>der</strong> Programm<br />
zu begreifen. Er ist vielmehr eine Mentalitätssache –<br />
und eine, die langfristiges Commitment erfor<strong>der</strong>t.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong> DOSSIER #12<br />
Wandel ist aber auch eine Frage <strong>der</strong> richtigen<br />
IT-Infrastruktur. Oswaldo Lorenzo von <strong>der</strong> spanischen<br />
IE Business School hat untersucht, wie Unternehmen<br />
Milliarden Dollar für IT-Systeme ausgeben, während<br />
Senior Manager offen zugeben, dass ihre Investitionen<br />
den jeweiligen Anfor<strong>der</strong>ungen nicht entsprechen. „Großen<br />
Investitionen folgen hohe Erwartungen“, warnt er.<br />
Enterprise-Systeme (ES) versprechen viel, „aber die<br />
Wirklichkeit zeigt, dass sie häufig nicht nur hochkomplex<br />
sind, son<strong>der</strong>n auch den Status quo des Beziehungsgeflechts<br />
innerhalb <strong>der</strong> Organisation bedrohen.“<br />
Folglich ist die Implementierung problemüberladen.<br />
„<strong>Die</strong> Kosten für Change-Management steigen, sobald<br />
alte Systeme verworfen o<strong>der</strong> verän<strong>der</strong>t, Mitarbeiter<br />
trainiert, alte Prozesse ausgesetzt und neue Produkte<br />
eingeführt werden.“ Anschließend erwarten die Organisationen,<br />
dass sich ihre Investitionen schnellstmöglich<br />
auszahlen, und entwickeln einen Projektplan, <strong>der</strong><br />
das Risiko auf ein Minimum begrenzt. „<strong>Die</strong> Organisationen<br />
rackern sich ab, um Ergebnisse zu erzielen, die<br />
ihren ursprünglichen Erwartungen entsprechen.“<br />
Lorenzo kommt in seinen Studien zu dem<br />
Schluss, dass Enterprise-Systeme dann von größtem<br />
Nutzen sind, wenn sie nicht als schneller Gewinn<br />
o<strong>der</strong> Wahnsinnsverbesserung gesehen werden, son<strong>der</strong>n<br />
als <strong>der</strong> Kern eines sorgfältigen Lernprozesses.<br />
Sie ermöglichen es Mitarbeitern, Aufgaben, die vermeintlich<br />
Routine waren, in neuem Licht zu sehen,<br />
ihr Beziehungsnetz auszubauen und Erkenntnisse<br />
dieses Prozesses mit an<strong>der</strong>en zu teilen. „Vom Anfang<br />
eines ES-Projekts bis zum Punkt, an dem Organisationen<br />
berichten, dass sie die Technologie und den<br />
Prozess voll verstanden haben, können bis zu sechs<br />
Jahre vergehen.“ Das ist <strong>der</strong> Kern des Wandels: Er<br />
ist keine kurzzeitige Übung, son<strong>der</strong>n Ausdruck einer<br />
Geisteshaltung. Keine Schnellreparatur, son<strong>der</strong>n ein<br />
langsamer Prozess.<br />
STUART CRAINER ist Redakteur <strong>der</strong><br />
Business Strategy Review und <strong>der</strong> erste „Editorial<br />
Fellow“ <strong>der</strong> London Business School. Er fungiert<br />
außerdem als stellvertreten<strong>der</strong> Direktor des<br />
Management Innovation Lab, ist Erfin<strong>der</strong> des Thinkers<br />
50 Ranking und Herausgeber des Bestsellers<br />
„Financial Times Handbook of Management“.<br />
Für Murray Martin, CEO von Pitney Bowes,<br />
ist permanente Neuerfindung <strong>der</strong> Schlüssel<br />
zum Geschäftserfolg<br />
23
DOSSIER #12 <strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong><br />
24<br />
<strong>Die</strong> neuen Magier?<br />
Harte Zeiten brauchen toughe Manager – diese Idee steckt hinter dem Trend zum Chief<br />
Restructuring Officer (CRO). Er, und nicht <strong>der</strong> CEO, soll als „Master of Disaster“<br />
Verän<strong>der</strong>ungsprozesse leiten. Das soll funktionieren. Doch Michael Jarrett ist skeptisch.<br />
MICHAEL JARRETT ist<br />
Lehrbeauftragter an <strong>der</strong> London<br />
Business School. Sein neues Buch<br />
„Ready for Change. Unlocking the<br />
Secrets of Successful Change“ soll<br />
im Herbst 2008 erscheinen.<br />
s<br />
WIR ALLE WOLLEN AM LIEBSTEN Helden sein. O<strong>der</strong><br />
zumindest für sie schwärmen. Heroen wagen<br />
Unglaubliches, besiegen bösartige Feinde und riesenhafte<br />
Drachen und bringen schließlich den Goldschatz<br />
nach Hause – beziehungsweise gute Zahlen für die<br />
Analysten. <strong>Die</strong> Sehnsucht nach dem Superman gibt<br />
es in allen Zeiten und Kulturen, und unsere heutige<br />
Businesswelt macht keine Ausnahme. Der neueste<br />
Mythos in <strong>der</strong> langen Reihe <strong>der</strong> Unternehmer-Helden<br />
ist <strong>der</strong> CRO, ein Zauberer des Change-Managements,<br />
jemand, dem sein Titel übermenschliche Kräfte verleiht<br />
und <strong>der</strong> in mindestens 70 Prozent <strong>der</strong> Fälle Fehlleistungen<br />
von Unternehmen in glänzende Erfolge<br />
verwandelt – die Inkarnation aller Heldenfantasien.<br />
Man merkt schon: Mich stimmt das Bild vom<br />
neuen Zauberer skeptisch. Ich glaube, dass CROs an<br />
diesem Ideal scheitern müssen, denn so schön die<br />
Geschichte vom starken Drachentöter klingt: Wer den<br />
Heldenmythos auf Verän<strong>der</strong>ungsprozesse anwenden<br />
will, hat nicht verstanden, wie Change wirklich funktioniert.<br />
Alle Studienergebnisse zeigen: Verän<strong>der</strong>ungen<br />
müssen im System angelegt sein. Wer ein einzelnes<br />
Individuum mit <strong>der</strong> Aufgabe betraut, und sei es einen<br />
Topmanager, wird kaum weit kommen.<br />
IM RAHMEN MEINER FORSCHUNG fand ich in den<br />
letzten zehn Jahren vier Faktoren, die nachhaltige<br />
Verän<strong>der</strong>ungen bestimmen. Erstens braucht ein<br />
Unternehmen tatsächlich eine Art Märchenprinz o<strong>der</strong><br />
-prinzessin: jemanden mit einer klaren Vision, <strong>der</strong> sein<br />
Team begeistert, die Dinge anpackt und mit seiner ganzen<br />
Persönlichkeit für diese Vision einsteht. <strong>Die</strong> Frage<br />
ist nur, ob dieser Mensch nicht im Idealfall <strong>der</strong> CEO des<br />
Unternehmens sein sollte. So wie Indra Nooyi. Als sie<br />
bei Pepsi das Ru<strong>der</strong> übernahm, steuerte sie das Unternehmen<br />
in eine völlig neue Richtung: Statt nur Softdrinks<br />
zu verkaufen, sollte <strong>der</strong> Getränkehersteller sich<br />
zusätzlich auf verschiedene gesunde Snacks verle-
gen. Nooyi brachte ihr Team und ihre Mitarbeiter hinter<br />
sich und begeisterte sie. „Sie bringt ihre ganze Persönlichkeit<br />
ein“, sagen ihre Kollegen. <strong>Die</strong> Frau hat genau<br />
die richtigen Qualitäten, um Verän<strong>der</strong>ungen anzugehen<br />
– und kommt ohne das Etikett „CRO“ aus.<br />
DER ZWEITE ZENTRALE FAKTOR ist das Team. Egal,<br />
wie brillant <strong>der</strong> Chef ist – bei internen Unstimmigkeiten<br />
wird jede Mannschaft schnell handlungsunfähig.<br />
Wenn dagegen alle an einem Strang ziehen, erhöht<br />
das die Chancen auf dauerhafte, nachhaltige Neuerungen<br />
um ein Vielfaches. Zum Beispiel Xerox: Das Unternehmen<br />
stand kurz vor dem Zusammenbruch, machte<br />
jährliche Verluste von einer Drittelmilliarde US-Dollar<br />
und hatte 17,1 Milliarden Dollar Schulden. <strong>Die</strong> Ratings<br />
fielen zusehends schlechter aus, <strong>der</strong> Aktienkurs stand<br />
beim Rekordtief von 4,43 Dollar. Dann kam als CEO<br />
Anne Mulcahy. Ihr Mandat: Verän<strong>der</strong>ung. Mulcahy<br />
schaffte einen Topmanagementzirkel, <strong>der</strong> Kopf, Herz<br />
und rechte Hand des Unternehmens zugleich war:<br />
CFO Larry Zimmerman nahm sich <strong>der</strong> finanziellen Seite<br />
an, gemeinsam mit Jim Firestone, zuständig für Nordamerika.<br />
Ursula Burns setzte Neuerungen um und<br />
baute das Gerüst des Unternehmens neu auf. Das Herz<br />
aber schlug bei <strong>der</strong> Chefin. Mulcahy war es vor allem<br />
wichtig, den Werten <strong>der</strong> Firma treu zu bleiben. „Ich war<br />
30 Jahre bei dem Unternehmen“, erklärt Mulcahy,<br />
„und ich bin geblieben, weil mich die Kultur hier fasziniert<br />
und begeistert – ein breit ausgelegter Begriff von<br />
Unternehmenskultur, <strong>der</strong> den richtigen Umgang mit<br />
den eigenen Leuten definiert, aber auch den mit Kunden,<br />
Lieferanten und mit allen gesellschaftlichen Gruppen<br />
und Belangen. Jede meiner Entscheidungen war<br />
von dieser Kultur geprägt.“<br />
Unsere Forschungsergebnisse deuten in die<br />
gleiche Richtung wie diese Beispiele. Wir haben unter<br />
an<strong>der</strong>em 5000 Führungskräfte aus verschiedenen<br />
Län<strong>der</strong>n, von Österreich bis Sambia, befragt. Dabei hat<br />
sich auch gezeigt: Neben <strong>der</strong> Qualität des Führungsteams<br />
spielen die strategischen Ressourcen eines<br />
Unternehmens bei Verän<strong>der</strong>ungsprozessen eine wichtige<br />
Rolle. Deshalb kommt es drittens auf die richtige<br />
Unternehmenskultur an. Wir haben drei Verän<strong>der</strong>ungstypen<br />
gefunden: die „Vermei<strong>der</strong>“, die sich gegen<br />
jede Verän<strong>der</strong>ung stemmen, die „Analysierer“, die<br />
zwar viel reflektieren, aber wenig umsetzen, und die<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong> DOSSIER #12<br />
erfolgreichen „Verän<strong>der</strong>er“, die über die nötigen strategischen<br />
Ressourcen verfügen, um sich zu än<strong>der</strong>n –<br />
nicht nur einmal, son<strong>der</strong>n immer wie<strong>der</strong>. Zu den<br />
erfolgreichsten „Verän<strong>der</strong>ern“ zählt Google mit seiner<br />
innovativen Kultur und seinen kooperativen und<br />
zugleich effizienten Strukturen. Dabei sind Innovation,<br />
Kooperation und Effizienz die zentralen Punkte.<br />
Durch sie wird ein Unternehmen fit für den Wandel.<br />
Und noch ein letzter Faktor ist wichtig: Change-<br />
Strategien müssen sich an Umweltbedingungen anpassen.<br />
Wer die Welt verän<strong>der</strong>n will, muss sich auf sie<br />
einlassen. CROs sind zwar nicht die Bösewichte in dieser<br />
Geschichte, aber sie sind auch nicht die neuen Helden.<br />
Sie handeln im Auftrag des Topmanagements und<br />
sind in ihrer Handlungsfähigkeit doch begrenzt durch<br />
die spezifische Unternehmenskultur. Sie können<br />
Teil eines Lösungsansatzes sein – die magische<br />
Patentlösung für Verän<strong>der</strong>ungsprozesse sind sie<br />
jedenfalls garantiert nicht.<br />
Kontrapunkt: Sushil Khanna<br />
SUSHIL KHANNA LEHRT STRATEGISCHES MANAGEMENT AM INDIAN<br />
INSTITUTE OF MANAGEMENT, KALKUTTA. ER GLAUBT, DASS EIN CRO<br />
EINEN WICHTIGEN BEITRAG BEI FUSIONEN LEISTEN KANN.<br />
„ÜBLICHERWEISE zahlt die übernehmende Firma bei einer Fusion<br />
einen Aufschlag auf den regulären Börsenwert. <strong>Die</strong> Hoffnung auf eine<br />
Gewinnsteigerung nach <strong>der</strong> Verschmelzung rechtfertigt den Aufschlag.<br />
Das Mehr im Ergebnis hängt von Synergieeffekten und Einsparungen<br />
nach einer Umstrukturierung ab. <strong>Die</strong> Kernaufgabe ist also, Verän<strong>der</strong>ungen<br />
im neuen gemeinsamen Unternehmen umzusetzen. Forschungen<br />
zeigen, dass das längst nicht immer gelingt: Darum enden viele Übernahmen<br />
in <strong>der</strong> Zerstörung von Anlegerkapital.<br />
NUR IN DEN WENIGSTEN Fällen wird <strong>der</strong> CEO Zeit finden, die nötigen<br />
Umwälzungen im Detail umzusetzen, wobei es an<strong>der</strong>erseits natürlich<br />
auch nicht ohne seine Unterstützung geht. <strong>Die</strong> Kernaufgabe eines<br />
CEO aber ist die Unternehmensstrategie. Für eine fusionierte Firma ist<br />
es deswegen sinnvoll, einen CRO zu benennen, <strong>der</strong> sich um die notwendigen<br />
Verän<strong>der</strong>ungen kümmert und sich mit dem – bei Change-Prozessen<br />
unvermeidbaren – Wi<strong>der</strong>stand im Unternehmen auseinan<strong>der</strong>setzt.<br />
25
DOSSIER #12 <strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong><br />
26<br />
DAVID CHAN machte seinen<br />
PhD in Industrial and Organizational<br />
Psychology an <strong>der</strong> Michigan<br />
State University. Derzeit ist er Professor<br />
für Psychologie an <strong>der</strong> Singapore<br />
Management University<br />
und leitet übergangsweise <strong>der</strong>en<br />
School of Social Sciences. Chan<br />
hat diverse Artikel in Fachzeitschriften<br />
veröffentlicht und Nachschlagewerke<br />
verfasst. Er ist Herausgeber<br />
des Asia Pacific Journal<br />
of Management. Gemeinsam mit<br />
dem Nobelpreisträger Daniel Kahneman<br />
befasst er sich im Rahmen<br />
eines internationalen Komitees<br />
damit, wie man das Wohlergehen<br />
<strong>der</strong> Bevölkerung in verschiedenen<br />
Län<strong>der</strong>n messen kann.<br />
Krise als Chance<br />
Firmenturbulenzen sind für CEOs Stress pur. Da hilft nur eins, sagt Managementprofessor<br />
David Chan: sich aktiv mit <strong>der</strong> Psychologie von Krisensituationen auseinan<strong>der</strong>setzen.<br />
Eine wichtige Grundregel ist, nicht in die Selbstmitleidsfalle zu tappen.<br />
THINK:ACT Professor Chan, was geht in einem CEO<br />
vor, wenn sein Unternehmen in eine Krise gerät?<br />
DAVID CHAN Eine Krise führt zu Stress, schließlich<br />
bedroht sie das Überleben <strong>der</strong> Firma. Der Adrenalinspiegel<br />
steigt, und auch an<strong>der</strong>e Stresshormone melden<br />
sich – ein Überlebensmechanismus, <strong>der</strong> jedem<br />
Menschen angeboren ist. Außerdem werden die Teile<br />
des Gehirns aktiviert, die entwe<strong>der</strong> den Kampf- o<strong>der</strong><br />
den Fluchtreflex auslösen können. Emotionen wie<br />
Angst und Wut kommen hinzu.<br />
Kämpfen o<strong>der</strong> fliehen – passt das in unsere Zeit?<br />
Das Reaktionsmuster, das durch bedrohliche Situationen<br />
ausgelöst wird, kann in Krisen nützlich, aber<br />
auch hin<strong>der</strong>lich sein. Anregend sind Adrenalin und<br />
Stresshormone, weil sie einen aufmerksamer und<br />
wachsamer machen. Außerdem können sie uns<br />
dazu bringen, schnell und konsequent Entscheidungen<br />
zu treffen, wenn es darauf ankommt.<br />
Wann sind natürliche Reaktionsmuster schädlich?<br />
In <strong>der</strong> Vergangenheit, als Krisen das eigene Überleben<br />
bedrohten, war solch ein Verhalten angebracht.<br />
Heute ist das an<strong>der</strong>s: Vor schwierigen Situationen zu<br />
fliehen ist kaum sinnvoll, wenn es um das Überleben<br />
des Unternehmens geht. Auch übertriebenes Kampfverhalten<br />
– Aggressivität, extreme Wachsamkeit –<br />
ist eher kontraproduktiv. Gefragt sind dagegen<br />
Besonnenheit und Selbstbeherrschung.<br />
Können sich CEOs auf solche schwierigen Situationen<br />
vorbereiten?<br />
Ja. CEOs sollten die Mechanismen kennen, mit<br />
denen Menschen auf Krisen reagieren, und sich die<br />
daraus resultierenden Fallstricke bewusst machen.<br />
Sie sollten wissen, mit welchen Techniken man<br />
Stress bewältigt und wie man Ängste in den Griff<br />
bekommt. Generell sind natürlich Führungsqualitä-<br />
ten in Krisensituationen beson<strong>der</strong>s von Nutzen –<br />
und auch die kann man trainieren, zum Beispiel das<br />
Denken in Systemen und Szenarien, das Setzen von<br />
Prioritäten, das Treffen von Entscheidungen bei<br />
unvollständiger Information, Überzeugungs- und<br />
Motivationskraft, ein Gefühl für Menschen und Situationen<br />
und praktische Intelligenz. Zu den größten<br />
Schwachpunkten <strong>der</strong> meisten CEOs gehört die Überzeugung,<br />
dass man das nötige Instrumentarium für<br />
das Krisenmanagement längst in <strong>der</strong> Tasche hat.<br />
Warum ist diese Überzeugung schlecht?<br />
Viele Topmanager glauben, dass ihre legitime Autorität<br />
als Führungskraft ihnen qua Amt gleich auch die<br />
nötigen Führungsqualitäten verleiht. Sie stellen sich<br />
nur selten infrage. Dabei gibt es unumstrittene und<br />
höchst relevante Fakten zum Thema Psychologie<br />
und Krisen – die meisten CEOs interessieren sich<br />
dafür aber erst gar nicht.<br />
Zum Beispiel?<br />
Zum Beispiel das sogenannte Negativity-Bias: Alle<br />
Forschungsergebnisse zeigen, dass die menschliche<br />
Wahrnehmung gewissermaßen negativ verzerrt<br />
ist: Ein Verlust von 100 Euro wird stärker negativ<br />
wahrgenommen als ein Gewinn von 100 Euro positiv.<br />
Ein Vorwurf wirkt länger nach als ein Lob. Viele Führungskräfte<br />
scheitern, weil sie diese ganz simplen<br />
psychologischen Tatsachen ignorieren.<br />
Als CEO trägt man in <strong>der</strong> Krise enorme Verantwortung.<br />
Was lässt sich hier aus <strong>der</strong> Psychologie lernen?<br />
Es gibt im Krisenmanagement einige ganz klare Dos<br />
and Don’ts. Man darf Krisen nicht ignorieren o<strong>der</strong><br />
leugnen. Wenn Entscheidungen auf die lange Bank<br />
geschoben werden, verschlimmert das tendenziell<br />
die Situation. Und – obwohl es natürlich wichtig ist,<br />
die eigenen Fehler zu analysieren – bloß nicht vor
lauter Schuldeingeständnissen und Selbstbezichtigungen<br />
im Selbstmitleid versinken.<br />
Was bedeutet das konkret?<br />
Problemzentrierte Strategien können helfen, mit<br />
dem mentalen Druck einer Krise fertig zu werden.<br />
Wenn man versucht, eine Situation rein kognitiv neu<br />
zu bewerten, lässt man negative Emotionen wie<br />
Angst, Wut o<strong>der</strong> Schuldgefühle leichter hinter sich,<br />
und <strong>der</strong> Blick öffnet sich für Problemlösungsstrategien.<br />
Wichtig ist auch, ein starkes Selbstwertgefühl<br />
aufrechtzuerhalten. Als CEO ist man in <strong>der</strong> Krise <strong>der</strong><br />
Oberbefehlshaber und braucht deshalb auch die<br />
Überzeugung, durch eigene Fähigkeiten Probleme zu<br />
lösen. Schließlich spielt gerade in Krisensituationen<br />
natürlich auch die Unterstützung durch Familie und<br />
Freunde eine wichtige Rolle.<br />
Wie gut sind CEOs zurzeit auf Krisen vorbereitet?<br />
Viele CEOs, gerade die jüngeren und solche ohne Krisenerfahrung,<br />
sind kaum o<strong>der</strong> unzureichend auf die<br />
für Krisensituationen typischen, meist nur vage definierten<br />
Probleme und die völlig neuen Anfor<strong>der</strong>ungen<br />
vorbereitet.<br />
<strong>Die</strong> Situation wird noch komplexer, wenn die Krise<br />
sich vor einem kulturellen, politischen o<strong>der</strong> wirtschaftlichen<br />
Hintergrund abspielt, <strong>der</strong> dem CEO nicht<br />
vertraut ist. Schließlich sind solche Krisensituationen<br />
beson<strong>der</strong>s schwierig, in denen es um ethische<br />
Themen und den Ruf des Unternehmens geht, und<br />
solche, die in einem bereits bestehenden schwierigen<br />
Arbeitsklima entstehen o<strong>der</strong> in Zeiten <strong>der</strong> Unsicherheit,<br />
wenn beispielsweise das Führungsteam<br />
vor Kurzem ausgetauscht o<strong>der</strong> gerade eine Fusion<br />
bewältigt wurde.<br />
Sollten Führungskräfte psychologische Hilfe in Anspruch<br />
nehmen?<br />
Wenn die Krise sich über eine längere Zeit hinzieht<br />
o<strong>der</strong> beson<strong>der</strong>s schwer zu verkraften ist, kann eine<br />
professionelle psychologische Behandlung helfen.<br />
In vielen Krisensituationen ist allerdings Präsenz<br />
gefragt, sodass für regelmäßige professionelle Hilfe<br />
keine Zeit bleibt. In solchen Situationen ist es unabdingbar,<br />
die Basistechniken des Stressmanagements<br />
zu beherrschen.<br />
<strong>Die</strong> <strong>Kunst</strong> <strong>der</strong> <strong>Corporate</strong> <strong>Recovery</strong> DOSSIER #12<br />
In einer Krise muss ein CEO auch das Vertrauen <strong>der</strong><br />
Mitarbeiter stärken. Wie tut er das am besten?<br />
Indem er zeigt, dass er die Situation unter Kontrolle<br />
hat, ohne aber Probleme kleinzureden. Das gesamte<br />
Führungsteam muss signalisieren, dass es die<br />
Anliegen <strong>der</strong> Mitarbeiter ernst nimmt. Gleichzeitig<br />
müssen die Mitarbeiter verstehen, wo die Probleme<br />
liegen und wie sie mithelfen können, die Krise zu<br />
überwinden. Gefragt sind dabei nicht nur gute Argumente,<br />
son<strong>der</strong>n vor allem Überzeugungskraft und<br />
die Fähigkeit, Optimismus und Hoffnung zu verbreiten,<br />
damit die Mitarbeiter aktiv am Wandel mitwirken.<br />
Als CEO braucht man dazu Führungsqualitäten<br />
wie Gelassenheit und Durchsetzungsvermögen, soziale<br />
Kompetenz, ein Gespür für Situationen und die<br />
Fähigkeit, die Mitarbeiter zu motivieren.<br />
Sollte man den Mitarbeitern als CEO offen zeigen,<br />
dass man sich auch persönlich in einer schwierigen<br />
Situation befindet?<br />
Davon rate ich eher ab. <strong>Die</strong> Mitarbeiter werden darauf<br />
nicht gerade mit Mitgefühl und Verständnis reagieren;<br />
sie wollen jemanden an <strong>der</strong> Spitze sehen, <strong>der</strong><br />
die Fäden in <strong>der</strong> Hand hält und die bestehenden Probleme<br />
entschlossen angeht. In Krisenzeiten haben<br />
viele Mitarbeiter eine kritische Grundeinstellung<br />
gegenüber <strong>der</strong> Führungsspitze. Deshalb ist es umso<br />
wichtiger für einen CEO, sich in seine Mitarbeiter hineinversetzen<br />
und auf sie eingehen zu können.<br />
Kann man als CEO an einer Krise eigentlich persönlich<br />
wachsen?<br />
Sicherlich. Eine Krise zu durchleben, beson<strong>der</strong>s<br />
wenn man sie schließlich überwinden kann, bringt<br />
einem einen ganzen Schatz von Erfahrungen, aus<br />
dem man sein ganzes Leben schöpfen kann, beruflich<br />
und auch privat. <strong>Die</strong> Krisenerfahrung ist wie ein<br />
Überlebenstraining, es macht einen wi<strong>der</strong>standsfähiger.<br />
Bei vielen Managern folgt auf die Krise eine<br />
reflexive Phase, in <strong>der</strong> sie sich kritisch mit ihren<br />
Werten, Überzeugungen, Handlungsmustern, Rollen<br />
und sozialen Beziehungen auseinan<strong>der</strong>setzen. Oft<br />
werden im Anschluss an diese Periode Prioritäten<br />
neu gesetzt: Man legt zum Beispiel mehr Wert auf<br />
gutes Teamwork, Mitarbeiterzufriedenheit o<strong>der</strong><br />
Talentmanagement.<br />
DOSSIER<br />
#12<br />
DIE KUNST DER<br />
CORPORATE<br />
RECOVERY<br />
Key-Learnings<br />
Was tun, wenn die Krise zuschlägt?<br />
<strong>Die</strong>ses Dossier beschäftigt<br />
sich mit <strong>der</strong> Frage,<br />
worauf es in schwierigen<br />
Zeiten für Unternehmen<br />
ankommt. <strong>Die</strong> wichtigsten<br />
Ergebnisse:<br />
� Nicht nur auf die finanzielle<br />
Restrukturierung<br />
konzentrieren: Auch auf<br />
Organisationsstrukturen<br />
kommt es an!<br />
� Den Markt im Auge behalten<br />
– wer nur intern umstrukturiert<br />
und dabei die<br />
Marktposition vernachlässigt,<br />
hat schon verloren.<br />
� <strong>Die</strong> Zahlen geben den<br />
Ausschlag: Eine solide<br />
Finanzanalyse hilft beim<br />
Unternehmensumbau<br />
und schafft Vertrauen bei<br />
den Geldgebern.<br />
� Miteinan<strong>der</strong> reden – aber<br />
richtig! Kreditgeber und<br />
Investoren geben Informationen<br />
gern mal weiter.<br />
27
Das Studioteam von MTV Pakistan: Erfolgszahlen kann <strong>der</strong> Sen<strong>der</strong> nicht vermelden<br />
– Quotenmessungen für das Fernsehen in Pakistan gibt es noch nicht.<br />
Ghazanfar Ali (l.) und Wiqar Ali Khan von MTV Pakistan. Ali steuert die Geschäfte<br />
des Musik-TV-Franchisenehmers, Ali Khan ist <strong>der</strong> Starmo<strong>der</strong>ator.
REPORTAGE<br />
„Pakistan ist cool“<br />
: Karatschi-Zentrum, Mereweather Road.<br />
Der Weg in die Zukunft <strong>der</strong> Popkultur <strong>der</strong><br />
islamischen Republik Pakistan führt durch<br />
eine staubige Seitenstraße. Hier, in den Studios<br />
von MTV, befindet sich die Schnittstelle,<br />
die das Dritte-Welt-Land mit dem Pulsschlag<br />
<strong>der</strong> globalen Musikindustrie verbindet. Während<br />
politische Unruhen das Land erschüttern,<br />
gedeiht 16 Monate nach Ankunft <strong>der</strong><br />
weltweit bekannten Musikmarke ein popkultureller<br />
Zukunftsmarkt.<br />
<strong>Die</strong> wirtschaftlichen Grundlagen für eine<br />
wachsende Freizeitindustrie sind so gut wie<br />
nie zuvor. Das Pro-Kopf-Einkommen im<br />
Land verdoppelte sich seit 2000, in den letzten<br />
sechs Jahren stieg das Bruttosozialprodukt<br />
um circa 50 Prozent. Goldman Sachs<br />
bewertet Pakistan als eines <strong>der</strong> „Next 11“-<br />
Län<strong>der</strong>, mit dem Potenzial, zukünftig zu den<br />
BRIC-Län<strong>der</strong>n Brasilien, Russland, Indien<br />
und China aufzuschließen.<br />
<strong>Die</strong>sen Wachstumsmarkt hat nun <strong>der</strong> Musiksen<strong>der</strong><br />
aus den USA im Visier. „MTV Pakistan<br />
ist <strong>der</strong> erste lokal produzierte internationale<br />
Sen<strong>der</strong> <strong>der</strong> Nation“, sagt Ghazanfar<br />
Ali, Chairman von Indus Network, über das<br />
Franchise zwischen MTV International und<br />
seiner TV-Company. Nach <strong>der</strong> Öffnung des<br />
Landes für das Satellitenfernsehen im Jahr<br />
2000 erkannte <strong>der</strong> 70-Jährige als Erster das<br />
Potenzial des Markts von 160 Millionen Menschen.<br />
Und gründete den ersten unabhängigen<br />
Satellitensen<strong>der</strong>. Heute ist Ali einer <strong>der</strong><br />
einflussreichsten Männer im TV-Business<br />
des Landes. Ali und MTV sind aber auch<br />
für einen weiteren Zweig <strong>der</strong> Medien- und<br />
Musikwirtschaft von größter Bedeutung: die<br />
Tonträgerindustrie. Sie prosperiert seit <strong>der</strong><br />
Fernsehliberalisierung. Und MTV Pakistan<br />
ist weit vor Radio, Internet, Presse, Konzerten<br />
und Tourneen das wichtigste Marketingwerkzeug<br />
<strong>der</strong> Musik-CD-Produzenten.<br />
<strong>Die</strong> Musikbranche des südasiatischen Landes<br />
ist ein Markt mit ganz beson<strong>der</strong>en Gesetzen –<br />
und unglaublichen Wi<strong>der</strong>sprüchen. Während<br />
in den Nord-West-Provinzen Pakistans<br />
radikale Islamisten CD-Händler ermorden,<br />
zelebriert von <strong>der</strong> Hafenstadt Karatschi aus<br />
MTV-Starmo<strong>der</strong>ator Wiqar Ali Khan in seiner<br />
Mode-und-Musik-Show „Style Guru“ hedonistische<br />
Werte. „Der Bedarf an Popkultur ist<br />
riesig“, weiß Khan. „Und obwohl zum Beispiel<br />
Musik im Islam keine Rolle spielt, ist<br />
Pakistan weltweit das Land mit <strong>der</strong> höchsten<br />
Quote nationaler Künstler in den Charts.“<br />
WÄHREND KONSUMENTEN NACH POP VERLANGEN,<br />
BRENNEN ISLAMISTEN CD-SHOPS NIEDER<br />
Starmo<strong>der</strong>ator Ali Khan, aufgewachsen in<br />
London, kennt die Unterschiede zwischen<br />
westlichem und pakistanischem Musikgeschäft:<br />
„<strong>Die</strong> Verwertungskette hier besteht<br />
nur aus Fragmenten: Es gibt keine nennenswerten<br />
Labelstrukturen, lediglich Distributeure,<br />
die den Künstlern ihre Alben und alle<br />
Rechte zu einer erfolgsunabhängigen Festsumme<br />
abkaufen.“ Dazu kommt: Ist ein Song<br />
einmal veröffentlicht, wird er sofort illegal<br />
auf CD gebrannt. Laut IFPI, dem Weltverband<br />
<strong>der</strong> Phonoindustrie, entstehen in Pakistan<br />
jährlich 230 Millionen Raubkopien – das<br />
sind dreimal so viele Scheiben, wie im Jahr<br />
2007 in den USA regulär verkauft wurden.<br />
industry-report f<br />
<strong>Die</strong>sen Beitrag können Sie auch<br />
auf unserer Audio-CD (Seite 63) hören.<br />
Pakistan goes Pop: Junge Unternehmer wollen die Marke MTV in dem Land etablieren. Ihr Ziel:<br />
regionale Künstler in das internationale Konzept integrieren. Ein Wagnis in einem Land, das von<br />
radikalen Muslimen bedroht wird. Eine Reportage aus dem Grenzgebiet <strong>der</strong> Popkultur.<br />
MTV Pakistan ist <strong>der</strong> erste lokal produzierte<br />
internationale Sen<strong>der</strong> <strong>der</strong> Nation<br />
29
p industry-report<br />
30<br />
Ali Khan und Wachleute. Sicherheit ist wichtig – längst<br />
nicht allen Pakistanis schmecken die popkulturellen<br />
Aktivitäten des Medienmachers.<br />
„Wir versuchen, so massenorientiert<br />
wie möglich zu sein.“<br />
Ghazanfar Ali<br />
<strong>Die</strong> Flut an Raubkopien war auch <strong>der</strong> Grund,<br />
warum sich 1994 die damals einzigen Major<br />
Labels EMI und HMV aus Pakistan verabschiedeten.<br />
Erst als die Regierung 2006<br />
begann, wenn auch zaghaft, den Schwarzmarkt<br />
einzudämmen, kehrte EMI zurück.<br />
Den von <strong>der</strong> britischen Zentrale empfohlenen<br />
Verkaufspreis von 2,50 Euro pro CD hält<br />
Ameed Riaz, Head of EMI Pakistan, trotzdem<br />
für unrealistisch: „Wir wissen, dass hier niemand<br />
so viel für eine CD ausgeben würde.“<br />
Denn schon für 80 Cent gibt es die schwarzkopierten<br />
CDs von Madonna, dem musikalischen<br />
Nationalhelden Nusrat Fateh Ali Khan<br />
o<strong>der</strong> sonstigen Hitparadenstürmern.<br />
Trotz aller Probleme: Das Popgeschäft in<br />
Pakistan funktioniert. Denn große Konsumgütermarken<br />
sponsern die Publikumslieblinge<br />
mit teilweise zweistelligen Millionenbeträgen.<br />
So kreierten Coca-Cola und Unilever<br />
mit Pakistans Toprockband Junoon – das<br />
Q Magazine nannte sie aufgrund ihres<br />
grenzübergreifenden Erfolgs im südlichen<br />
Asien „eine <strong>der</strong> größten Rockbands <strong>der</strong><br />
Welt“ – ihre eigenen Musikbotschafter. In<br />
ihren Videoclips tranken die Rocker Coke,<br />
in den Werbepausen waren sie als Testimonials<br />
für eine Zahnpasta zu sehen. „Je<strong>der</strong><br />
Topkünstler hat ein von <strong>der</strong> Konsumgüterindustrie<br />
mitgestaltetes Image“, beschreibt<br />
Musikjournalist Ziad Zafar den Einfluss<br />
des Künstlersponsorings. Für westliche Pop-<br />
Puristen ist das natürlich ein Grauen. Fernsehmacher<br />
Ghazanfar Ali denkt über den<br />
künstlerischen Glaubwürdigkeitsverlust<br />
weniger nach. „Wir versuchen, so massenorientiert<br />
wie möglich zu sein“, erklärt er<br />
die Strategie von MTV Pakistan.<br />
Eine Win-win-Situation: Während MTV<br />
Pakistan von <strong>der</strong> Strahlkraft <strong>der</strong> internationalen<br />
Marke profitiert, glaubt <strong>der</strong> amerikanische<br />
Franchisegeber an das Marktpotenzial<br />
pakistanischer Künstler auch außerhalb des<br />
Landes. „MTV Pakistan ist die perfekte Plattform,<br />
um die wun<strong>der</strong>bare Kultur dieses Landes<br />
dem Rest <strong>der</strong> Welt vorzustellen. Pakistan<br />
ist cool“, sagte Bill Roedy, Chairman von<br />
MTV International, beim Launch des Kanals<br />
in Karatschi im Dezember 2006.<br />
Heute, gut eineinhalb Jahre später, sind<br />
die Pop-Produkte aus Pakistan in den MTV-<br />
Ablegern Indien und Arabien zu „Heavy<br />
Rotaters“ geworden. Wie erfolgreich MTV<br />
Pakistan im Inland ist, kann nur geschätzt<br />
werden. „Wir erreichen rund vier Millionen<br />
Haushalte per Kabel und Satellit“, sagt<br />
Ho Yan Mok, MTV-Direktor für Asien. Marktforschungsverfahren<br />
zur Quotenmessung<br />
stehen in Pakistan erst am Anfang. Deshalb<br />
evaluiert Ghazanfar Ali den Erfolg seiner<br />
Kooperation anhand des Verkehrs auf <strong>der</strong><br />
Website. Und <strong>der</strong> nahm drastisch zu. „Am<br />
Anfang waren es 10 000 Hits pro Tag, jetzt<br />
sind es 30 000“, sagt er. Zum Vergleich: <strong>Die</strong><br />
Website von MTV Großbritannien verzeichnet<br />
neun Millionen Hits am Tag, bei einer<br />
24-mal höheren Vernetzung <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
mit privaten Internetzugängen.<br />
RUND DIE HÄLFTE DER PAKISTANIS IST UNTER<br />
20 JAHREN – EIN RIESIGES KUNDENPOTENZIAL<br />
Damit MTV Pakistan und damit auch die<br />
pakistanische Popbranche weiterhin wächst,<br />
wünscht sich Ali mehr Engagement aus dem<br />
Ausland. „Tief im Innern ist dieses Land ein<br />
Markt wie je<strong>der</strong> an<strong>der</strong>e. Der Westen überlässt<br />
die Geschäfte aber <strong>der</strong>zeit den Arabern,<br />
weil die westlichen Medien nur die Gefahren<br />
und nicht die Chancen in Pakistan transportieren.“<br />
Dabei bietet <strong>der</strong> Markt ein gigantisches<br />
Potenzial: <strong>Die</strong> Hälfte <strong>der</strong> Bevölkerung<br />
Pakistans ist noch keine 20 Jahre alt.<br />
Offen ist, ob das <strong>der</strong>zeitige Wachstum von<br />
MTV Pakistan in einen konsolidierten pakistanischen<br />
Popmarkt mündet. Denn je<strong>der</strong>zeit<br />
kann eine konservativere Regierung die<br />
Knospen des Aufbruchs jäh beschneiden.<br />
Ali aber bleibt Optimist: „Wir werden auch<br />
mit einem erneuten Wechsel zurechtkommen<br />
– so, wie wir mit den bisherigen Verän<strong>der</strong>ungen<br />
zurechtgekommen sind.“.
Wiqar Ali Khan ist <strong>der</strong> Star von MTV Pakistan. Seine Show „Style Guru“<br />
propagiert offen hedonistische – und damit eigentlich westliche – Werte.<br />
Pakistan, ein Land zwischen Tradition und Mo<strong>der</strong>ne. Der Bedarf <strong>der</strong><br />
Menschen an Popkultur „ist riesig“, sagt Wiqar Ali Khan.<br />
31
p industry-report<br />
32<br />
Zwei Seelen und ein Spiel<br />
: An Genies scheiden sich die Geister –<br />
gerade im Fußball. Als Michel Platini in<br />
den Achtzigerjahren am Ball zauberte,<br />
schnalzten dessen Fans mit <strong>der</strong> Zunge, seine<br />
Gegner aber brachte das große Selbstbewusstsein<br />
des Franzosen auf die Palme. Als<br />
Chef <strong>der</strong> UEFA polarisiert Platini heute weiter<br />
die Fußballwelt. Er betreibt nämlich<br />
einen Kuschelkurs in Richtung Osten. Einige<br />
große Verbände sehen das kritisch.<br />
PLATINI WILL DIE NÄCHSTE EM AUFSTOCKEN –<br />
ZUR FREUDE ÖSTLICHER FUSSBALLNATIONEN<br />
Schon bei seiner Wahl zum UEFA-Präsidenten<br />
im Jahr 2007 hatte er auf die Stimmen<br />
<strong>der</strong> „Kleinen“, vor allem auf die aus Osteuropa,<br />
gesetzt. Als <strong>der</strong>en Freund erweist sich<br />
Platini nun auch. Beobachter gehen davon<br />
aus, dass er den Zuschlag für die EM 2012 an<br />
Polen und die Ukraine unterstützte. Außerdem<br />
verabschiedete die UEFA gerade eine<br />
Reform <strong>der</strong> Champions League, die kleineren<br />
Ligen bessere Chancen auf Startplätze<br />
einräumt. Aus einer ähnlichen Motivation<br />
heraus will Platini auch die nächste Europameisterschaft<br />
aufstocken.<br />
Mit Blick in die Zukunft sucht Platini konsequent<br />
nach „Emerging Markets“. <strong>Die</strong> liegen,<br />
auch im Fußball, im Osten. So durfte <strong>der</strong><br />
russische Verband in diesem Jahr das Finale<br />
<strong>der</strong> Champions League ausrichten. Dabei<br />
demonstrierten die Moskauer, dass sie in<br />
<strong>der</strong> Lage sind, ein Cupfinale mit weltweiter<br />
medialer Strahlkraft auszurichten.<br />
Der Fußball im Osten boomt. Sponsormillionen<br />
aus dem Öl-, Gas- und Bergwerksge-<br />
„Er verstand es, das Spiel auf dem Platz in die richtige Bahn<br />
zu lenken. Er war ein Kopfspieler im weitesten Sinne,<br />
<strong>der</strong> überragende europäische Spieler <strong>der</strong> Achtzigerjahre.“<br />
Am Ball konnte er alles. Jetzt mischt Michel Platini als UEFA-Chef die Karten im globalen<br />
Fußballbusiness neu. Dabei erschließt er auch die Märkte Osteuropas – und das, obwohl er<br />
die Kommerzialisierung des Fußballs eigentlich skeptisch sieht.<br />
schäft finanzieren Arena-Neubauten und<br />
Spielereinkäufe. Auch für internationale<br />
Sponsoren sind die Spielfel<strong>der</strong> im Osten<br />
lukrativ. Der dortige Konsumentenmarkt<br />
wächst stark. Markenartikelhersteller aus<br />
Westeuropa o<strong>der</strong> den USA sehen daher die<br />
Ostöffnung gern.<br />
Leicht wird Platini die EM-Entscheidung<br />
nicht gefallen sein. Italien sei emotional sein<br />
Favorit gewesen, hieß es hinter den Kulissen.<br />
Schließlich hat er seine größten Erfolge<br />
als Sportler bei Juventus Turin gefeiert.<br />
Das Land hätte dringend eines Investitionsschubs<br />
bedurft, um Stadien und Infrastruktur<br />
zu mo<strong>der</strong>nisieren. Doch die Doppelbewerbung<br />
aus Polen und <strong>der</strong> Ukraine siegte.<br />
„Verrat!“, schimpfte die Gazzetta dello Sport.<br />
<strong>Die</strong> Nie<strong>der</strong>lage soll für die italienische Wirtschaft<br />
bis zu 15 Milliarden Euro Verlust<br />
bedeuten.<br />
EINE MILLIARDE EURO MUSS POLEN WEGEN<br />
DER EUROPAMEISTERSCHAFT INVESTIEREN<br />
In Polen hingegen jubiliert man. „<strong>Die</strong>ses<br />
Turnier wird ein Meilenstein für uns sein“,<br />
UEFA<br />
<strong>Die</strong> Union Européenne de Football-Association,<br />
kurz UEFA, vertritt als eine <strong>der</strong> sechs<br />
Konfö<strong>der</strong>ationen des Weltfußballverbandes<br />
FIFA 53 nationale Verbände. Gerade brachte<br />
die UEFA die EM in Österreich und <strong>der</strong><br />
Schweiz über die Bühne. Auch die Vermarktung<br />
von Champions League und UEFA-Cup<br />
liegt bei dem Verband.<br />
Pelé über Michel Platini<br />
so <strong>der</strong> Präsident des polnischen Fußballverbandes,<br />
Michal Listkiewicz. „Wir haben es<br />
in Osteuropa verdient, dass so ein Ereignis<br />
mal zu uns kommt.“ Sein ukrainischer Kollege,<br />
<strong>der</strong> Öl-Oligarch Grigoriy Surkis, <strong>der</strong><br />
geholfen hatte, Platini ins Amt zu hieven,<br />
erklärt stolz: „Wir werden das Vertrauen,<br />
das in uns gesetzt wird, rechtfertigen. <strong>Die</strong><br />
Ukraine ist erst seit 15 Jahren unabhängig.<br />
Das ist eine große Chance und eine große<br />
Herausfor<strong>der</strong>ung für uns.“<br />
Allein in Polen werden die notwendigen<br />
Investitionen in die Sportinfrastruktur mit<br />
rund einer Milliarde Euro beziffert. Dazu<br />
kommen Ausgaben für die Verbesserung <strong>der</strong><br />
Verkehrs- und Transportinfrastruktur sowie<br />
<strong>der</strong> Ausbau <strong>der</strong> Teleinformatik, Verkehrsleit-<br />
und Sicherheitssysteme. <strong>Die</strong> Ratingagentur<br />
Fitch schätzt die Gesamtkosten<br />
Polens für die Organisation <strong>der</strong> EM auf<br />
27 Milliarden Euro.<br />
Viel Rechnerei im Vorfeld – zu viel vielleicht<br />
für Monsieur Platini. Denn die allumfassende<br />
Kommerzialisierung des Fußballs ist ihm<br />
eigentlich ein Dorn im Auge. „Fußball ist<br />
zuerst ein Spiel und dann ein Produkt, ist<br />
Sport und kein Markt, ist ein Spektakel und<br />
dann erst ein Geschäft!“ Gerade dieser Geist<br />
nährt bei den kleineren Fußballnationen die<br />
Hoffnung, dass auch sie im Konzert <strong>der</strong> Großen<br />
mitverdienen können. So treibt Platini,<br />
ob er will o<strong>der</strong> nicht, die Kommerzialisierung<br />
im Fußballosten voran.<br />
Einen entscheidenden Schachzug machte er<br />
dazu im Januar dieses Jahres. <strong>Die</strong> G14, die<br />
mächtige Interessenvereinigung <strong>der</strong> 18<br />
(west-)europäischen Topklubs, hatte den
Michel Platini: Als Spieler war<br />
er ein Genie. In seiner neuen<br />
Rolle als UEFA-Chef stärkt er<br />
die kleinen Fußballnationen.<br />
industry-report f<br />
Fußballdachverbänden eine ganze Reihe<br />
von Klagen beschert. <strong>Die</strong> UEFA kam den<br />
Vereinen entgegen. „<strong>Die</strong> Klubs sind nun an<br />
den Gewinnen <strong>der</strong> UEFA beteiligt“, so Platini.<br />
Doch er wurde für die Zugeständnisse<br />
reichlich entlohnt. Im Gegenzug erreichte er<br />
nämlich, dass die dem Verband gefährlich<br />
gewordene G14 aufgelöst wurde. An <strong>der</strong>en<br />
Stelle trat die ECA, die sich deutlich heterogener<br />
als ihre Vorgängerin aus 103 Vereinen<br />
<strong>der</strong> 53 Mitgliedslän<strong>der</strong> <strong>der</strong> UEFA zusammensetzt.<br />
Den kleinen Verbänden eröffnet<br />
sich über mehr Startplätze die Teilhabe am<br />
großen Geschäft.<br />
Das könnte auch Investoren auf den Plan<br />
rufen. Doch gerade die sieht Platini skeptisch.<br />
Ausgewogen legt er sich mal mit russischen,<br />
mal mit amerikanischen Financiers<br />
an, die zunehmend auf den lukrativen Fußballmarkt<br />
drängen und eine Preisspirale auf<br />
dem Spielertransfer- und Rechtemarkt in<br />
Gang gebracht haben. In einem Brandbrief<br />
hatte <strong>der</strong> UEFA-Präsident unlängst die EU-<br />
Regierungschefs aufgefor<strong>der</strong>t, Europas Fußball<br />
vor „einer Schieflage“ zu bewahren. <strong>Die</strong><br />
Russen und Amerikaner kämen nicht aus<br />
Liebe zum Fußball, son<strong>der</strong>n um damit Geld<br />
zu scheffeln. „Ich glaube, dass Gesetze nötig<br />
sind, um so etwas zu verhin<strong>der</strong>n.“<br />
Damit zielte Platini beson<strong>der</strong>s auf die US-<br />
Investoren beim FC Liverpool, George Gillett<br />
und Tom Hicks, sowie auf Malcolm Glazer<br />
bei Manchester United. Ihnen unterstellte<br />
er, seine Reformbestrebungen in <strong>der</strong><br />
Champions League aktiv zu hintertreiben.<br />
Interessant: Den russischen Oligarchen<br />
Roman Abramowitsch und den italienischen<br />
Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi,<br />
Geldgeber beim FC Chelsea und dem<br />
AC Mailand, nahm Platini ausdrücklich von<br />
den Vorwürfen aus. „<strong>Die</strong> beiden lieben den<br />
Fußball und haben ihr Geld nicht investiert,<br />
um Rendite zu erwirtschaften.“.<br />
33
p industry-report<br />
34<br />
Lissabon im Blick<br />
Europas Wirtschaft wächst immer enger zusammen. Seine leistungsfähigsten Unternehmen<br />
sind auch global Vorbil<strong>der</strong> in Management und Strategie. Der Wettbewerb „Best of European<br />
Business“ zeigt, wo <strong>der</strong> Kontinent stark ist – und för<strong>der</strong>t damit das Europagefühl.<br />
: Europa festigt seine Position im globalen<br />
Konkurrenzkampf. Das Wachstum in den<br />
vergangenen Jahren hat sich deutlich gesteigert<br />
und verstetigt. 23 <strong>der</strong> 50 größten Unternehmen<br />
haben heute ihren Sitz in Europa.<br />
2007 haben europäische Unternehmen 400<br />
Milliarden Euro in grenzüberschreitende<br />
Übernahmen und Fusionen investiert. Das<br />
ist Rekord, Europas Wirtschaft wächst offensichtlich<br />
immer enger zusammen. Und vor<br />
allem: Der europäische Heimatmarkt mit<br />
rund 500 Millionen Konsumenten wird Wirk-<br />
lichkeit und zu einer Stütze im immer schärferen<br />
Wettbewerb <strong>der</strong> Globalisierung. Folgerichtig<br />
war die diesjährige Abschlussveranstaltung<br />
des Wettbewerbs Best of European<br />
Business (BEB) von Optimismus geprägt.<br />
„Wir können an Europa glauben, weil wir an<br />
Europas Unternehmen glauben“, formuliert<br />
es Burkhard Schwenker, Vorstandschef von<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants.<br />
Gewonnen haben in diesem Jahr vier Unternehmen:<br />
<strong>der</strong> französische Versicherungsriese<br />
AXA, Portugals Energieanbieter Galp-<br />
Burkhard Schwenker, CEO von<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants,<br />
lobte bei <strong>der</strong> Preisverleihung<br />
in Deutschland die Innovationsstärke<br />
<strong>der</strong> europäischen<br />
Wirtschaft<br />
Energia, <strong>der</strong> polnische Ölkonzern PKN Orlen<br />
und das deutsche Chemieunternehmen<br />
BASF. AXA und PKN Orlen wurden für<br />
grenzüberschreitende M&A-Aktivitäten<br />
belohnt, GalpEnergia für sein beeindruckendes<br />
Wachstum. BASF räumte den Son<strong>der</strong>preis<br />
„Green Business“ ab.<br />
Mit dem Preis für das Energieunternehmen<br />
GalpEnergia prämierten die Juroren ein<br />
jährliches Wachstum von gut 15 Prozent zwischen<br />
den Jahren 2002 und 2006. Neue Produktionsanlagen<br />
in Angola und Spanien
Bild rechts, v. l.: die Gewinner Thomas En<strong>der</strong>s (CEO, Airbus),<br />
Kurt Bock (CFO, BASF, verantwortlich für Nordamerika),<br />
Mathias Hüttenrauch (Managing Director,<br />
Benteler Automobiltechnik), Ulf M. Schnei<strong>der</strong> (Vorsitzen<strong>der</strong><br />
des Vorstands, Fresenius), Bernd G. Hoffmann<br />
(CEO, Schmitz Cargobull)<br />
Unten: Jürgen Großmann (CEO, RWE)<br />
DEUTSCHLAND: OHNE DIE USA GEHT ES NICHT<br />
Der deutsche Teil des Best-of-European-Business-<br />
Wettbewerbs hinterfragte die transatlantische<br />
Wirtschaftspartnerschaft. Der provokante Titel <strong>der</strong><br />
Podiumsdiskussion: „Who needs America?“. Europa<br />
auf jeden Fall, war die einstimmige Antwort <strong>der</strong><br />
prominenten Teilnehmer. Allerdings, auch darin<br />
waren sich die Experten einig, gehört dazu eine<br />
FRANKREICH: GISCARD D’ESTAING SPRICHT ÜBER EUROPA<br />
<strong>Die</strong> französischen Awards glänzten auch mit Politprominenz:<br />
Über die politische Zukunft <strong>der</strong> Europäischen<br />
Union sprach <strong>der</strong> frühere französische<br />
Staatspräsident Valéry Giscard d’Estaing, über die<br />
europäische Integration <strong>der</strong> frühere Außenminister<br />
Hubert Védrine. Vor über 1000 Gästen mo<strong>der</strong>ierte<br />
François Lenglet, Chefredakteur des Medienpartners<br />
Enjeux Les Echos, eine hochkarätige CEO-<br />
Runde, die Strategien für europäische Unternehmen<br />
diskutierte. Mit dabei: Pierre-André de Chalendar<br />
(General Manager, Saint-Gobain), José Luis Duran<br />
(CEO, Carrefour), Charles Milhaud (CEO, Caisse<br />
Nationale des Caisses d’Epargne) und Gilles Pélisson<br />
(Administrator und General Manager, Accor).<br />
In <strong>der</strong> Kategorie Wachstum gewannen das Recyclingunternehmen<br />
CFF Derichebourg und <strong>der</strong> Maschinenproduzent<br />
Haulotte. Preise für ihre Europastrategien<br />
bekamen <strong>der</strong> Food-Hersteller Sodexo<br />
und <strong>der</strong> Anbieter von Zahlungslösungen Ingenico,<br />
für grenzüberschreitende M&A AXA und Softwarehersteller<br />
Avanquest. Den Großen Preis <strong>der</strong> Jury<br />
sicherte sich <strong>der</strong> Baustoffhersteller Lafarge.<br />
offene Diskussion. Prämiert wurden in Deutschland<br />
fünf Unternehmen: In <strong>der</strong> Kategorie Wachstum<br />
gewannen Benteler und Schmitz Cargobull. Für ihre<br />
grenzüberschreitenden M&A-Aktivitäten wurden<br />
Fresenius und BASF ausgezeichnet. Der Spezialpreis<br />
„Transatlantic Relations“ ging an Tom En<strong>der</strong>s,<br />
CEO von Airbus.<br />
Bild links, v. l.: Bernard Regis (Deputy General Manager,<br />
Daniel Derichebourg), Alexandre Saubot (CEO, Haulotte<br />
Group), Michel Landel (CEO, Sodexo), Bruno Lafont<br />
(CEO, Lafarge), François Lenglet (Chefredakteur,<br />
Enjeux Les Echos), Jacques Stern (CEO, Ingenico),<br />
Gérard Harlin (Deputy General Manager, verantwortlich<br />
für Finance and Control, AXA), Bruno Vanryb (Mitbegrün<strong>der</strong><br />
und CEO, Avanquest Software)<br />
Oben: Valéry Giscard d’Estaing (l.), Vincent Mercier<br />
(Mitglied Exekutivkomitee, <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>)<br />
35
p industry-report<br />
36<br />
Bild rechts, v. l.: Europakenner im Gespräch: Vasco<br />
de Mello (Board President, Brisa Auto-Estradas de<br />
Portugal), António Bernardo (Deputy CEO, <strong>Roland</strong><br />
<strong>Berger</strong>), <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong><br />
Unten: Portugalexperte mit Gewinner: Josep Ros<br />
(l., Partner, <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>), António Mexia (Executive<br />
Board President, Grupo EDP)<br />
nutzten die Portugiesen für weiteres Wachstum.<br />
Außerdem integrierten sie das spanische<br />
Unternehmen AGIP erfolgreich.<br />
Wie man durch Zukäufe die eigene Wettbewerbsposition<br />
stärkt, das führt <strong>der</strong> französische<br />
Versicherungskonzern AXA vor. Mit <strong>der</strong><br />
Übernahme des Schweizer Konkurrenten<br />
Winterthur im Jahr 2006 stieß AXA nicht nur<br />
das Tor zum Schweizer Markt auf. <strong>Die</strong> Franzosen<br />
erweiterten damit auch maßgeblich<br />
die eigene Produktpalette. Außerdem generierte<br />
die Übernahme ein Synergiepotenzial<br />
von 350 Millionen Euro.<br />
Große Übernahmen erfor<strong>der</strong>n Mut. <strong>Die</strong>sen<br />
bewies auch <strong>der</strong> polnische Ölkonzern PKN<br />
Orlen. Für 2,78 Milliarden US-Dollar übernahm<br />
PKN die Mehrheit des größten Unternehmens<br />
<strong>der</strong> baltischen Staaten: Litauens<br />
Mazeikiu Nafta. Es war das bisher größte<br />
Auslandsinvestment eines polnischen Unternehmens.<br />
Der Deal demonstriert nach<br />
Ansicht <strong>der</strong> Jury die Fähigkeit PKN Orlens,<br />
übernommene Unternehmen ohne große<br />
Reibungsverluste zu integrieren.<br />
Mut zu einer aktiven M&A-Politik bewies<br />
auch BASF beim Kauf des US-Chemieunternehmens<br />
Engelhard. In Brüssel wurden die<br />
PORTUGAL: JERÓNIMO-MARTINS-CEO IST MANAGER DES JAHRES<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>, Grün<strong>der</strong> des Beratungsunternehmens,<br />
plädierte in seiner Eröffnungsrede <strong>der</strong> portugiesischen<br />
Award-Feier dafür, die Emerging Markets<br />
nicht als Bedrohung, son<strong>der</strong>n als Chance für<br />
Europas Wirtschaft zu sehen. Aufstrebende Volkswirtschaften<br />
seien auf den Import europäischen<br />
Wissens angewiesen, so <strong>Berger</strong>.<br />
Manager des Jahres wurde <strong>der</strong> CEO des Food-Unternehmens<br />
Jerónimo Martins, Luís Palha da Silva.<br />
Ludwigshafener aber für etwas an<strong>der</strong>es ausgezeichnet:<br />
für ihre umweltfreundliche Produktionspolitik.<br />
30 Prozent des F&E-Budgets<br />
lässt BASF in eine ressourceneffizientere<br />
Produktion fließen. Als erstes deutsches<br />
Unternehmen traten die Ludwigshafener<br />
dem „Community Development Carbon<br />
Fund“ <strong>der</strong> Weltbank bei. <strong>Die</strong> Initiative för<strong>der</strong>t<br />
Projekte, die CO 2-Reduktion mit Entwicklungshilfe<br />
kombinieren.<br />
ES GIBT IHN, DEN EUROPÄISCHEN WEG<br />
GUTER UNTERNEHMENSFÜHRUNG<br />
<strong>Die</strong> Preisträger zeigen: „Best of European<br />
Business“ prämiert Unternehmen, die von<br />
Europa aus Standards für die Welt setzen.<br />
Was aber macht Europa einzigartig? Wo<br />
sind seine originären Wettbewerbsvorteile?<br />
Das will eine Umfrage unter europäischen<br />
Topentschei<strong>der</strong>n klären, die <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong><br />
anlässlich des Wettbewerbs vorstellte. Über<br />
80 Prozent sehen demnach Europas Rolle im<br />
Wettbewerb <strong>der</strong> Standorte als stabil o<strong>der</strong><br />
wachsend an, außer in den Bereichen Einkauf<br />
und Produktion. In Forschung, Finanzwesen<br />
und Management wird Europa wich-<br />
Leser des Medienpartners Jornal de Negócios prämierten<br />
zudem António Mexia, Chef des Energieriesen<br />
EDP. Sein Konzern wurde auch für grenzüberschreitende<br />
M&A belohnt. Im Bereich Wachstum<br />
gewannen das Energieunternehmen GalpEnergia<br />
und <strong>der</strong> Baudienstleister Martifer. Sonae Indústria<br />
wurde für seine Stärke in Zentraleuropa ausgezeichnet.<br />
<strong>Die</strong> Aktivitäten in den BRIC-Staaten verhalfen<br />
dem Autobahnbetreiber Brisa zum Sieg.<br />
tiger. Vier von fünf Unternehmen wollen<br />
vermehrt auf europäisches Nearshoring setzen,<br />
anstatt in Offshorelän<strong>der</strong> wie Indien<br />
auszulagern.<br />
Der europäische Weg erfolgreicher Unternehmensführung<br />
– es gibt ihn tatsächlich,<br />
wenn man die Teilnehmer des Wettbewerbs<br />
betrachtet. Das betonte auch Burkhard<br />
Schwenker in seiner Rede auf dem deutschen<br />
BEB-Abschlussevent. Vier Dinge<br />
zeichnen demnach erfolgreiche europäische<br />
Unternehmen aus. Sie verfolgen eine Doppelstrategie<br />
– ergreifen also parallel Maßnahmen<br />
zur Steigerung <strong>der</strong> Produktivität<br />
und für mehr Wachstum. Sie setzen auf eine<br />
Systemkopfstrategie, stärken also konsequent<br />
jene Funktionen, die einen echten<br />
Wettbewerbsvorteil darstellen: F&E, Fertigungssteuerung,<br />
Marketing und Branding,<br />
Design, aber auch hochwertige Produktion.<br />
Außerdem nutzen Erfolgsfirmen die kulturelle<br />
Vielfalt Europas für die Kreativität und<br />
damit als Vorteil im globalen Wettbewerb.<br />
Und schließlich kombinieren sie Wachstumsfähigkeit<br />
mit Wachstumsbereitschaft –<br />
dem, wie es Schwenker formuliert, „richtigen<br />
Mindset bei den weichen Faktoren“..
Bild rechts, v. l.: José Luis del Valle (Director, Strategy<br />
and Development, Iberdrola), Luis Abril (Dirección<br />
General, Secretaría General Técnica de Presidencia,<br />
Telefónica), Fernando Merry del Val (Consejero de Economía,<br />
Comunidad de Madrid), Josep Ros (Partner,<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>), Jorge Sendagorta (President, Sener<br />
Ingeniería y Sistemas, Grupo Sener), Guillermo de la<br />
Dehesa (Member, Banco Santan<strong>der</strong> Board of Directors,<br />
Vice President, Goldman Sachs Europe, President, Aviva<br />
Spain, President, Instituto de Empresa Advising Committee,<br />
Jurymitglied), Juan Ramón Quintás (President,<br />
Spanish Confe<strong>der</strong>ation of Saving Banks, Jurymitglied),<br />
Amparo Moraleda (President, IBM Spain, Portugal,<br />
Greece, Israel, Turkey, Jurymitglied)<br />
Unten: Josep Ros (l., Partner, <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>), Ángel Corcóstegui<br />
(ehemals CEO, Banco Santan<strong>der</strong>, President,<br />
Magnum Capital Industrial Partners, Jurymitglied)<br />
Über 100 Gäste und Jurymitglie<strong>der</strong> kamen in <strong>der</strong><br />
Madri<strong>der</strong> Börse zusammen, um an <strong>der</strong> Feier des<br />
spanischen Best of European Business Award teilzunehmen.<br />
Der Jury gehörten unter an<strong>der</strong>em <strong>der</strong><br />
Dean <strong>der</strong> IESE Business School, Jordi Canals, und<br />
<strong>der</strong> Chef von IBM Spanien, Portugal, Griechenland,<br />
Israel und Türkei, Amparo Moraleda, an.<br />
POLEN: GLOBALE WETTBEWERBSFÄHIGKEIT STEIGT<br />
<strong>Die</strong> Veranstaltung im Warschauer Königspalast<br />
stand ganz im Zeichen <strong>der</strong> zunehmenden globalen<br />
Marktpräsenz polnischer Unternehmen. Spezialpreise<br />
wurden daher auch für Unternehmen mit<br />
beson<strong>der</strong>er internationaler Wettbewerbsfähigkeit<br />
ausgelobt. <strong>Die</strong> Danziger Schiffsreparaturwerft<br />
Stocznia Remontowa und <strong>der</strong> Autozulieferer Inter<br />
SPANIEN: TELEFÓNICA HOLT GROSSEN PREIS<br />
Groclin wurden mit diesen Preisen ausgezeichnet.<br />
Das Modehaus LPP, <strong>der</strong> Hersteller von Bergbauequipment<br />
Fabryka Maszyn Famur und <strong>der</strong> Bauzulieferer<br />
Koelner gewannen aufgrund ihres profitablen<br />
Wachstums. Für seine M&A-Aktivitäten über<br />
die Landesgrenzen hinweg prämierten die Juroren<br />
den Tankstellenbetreiber und Ölkonzern PKN Orlen.<br />
Das profitable Wachstum verhalf dem Food-Hersteller<br />
SOS und den Ingenieurdienstleistern von Sener<br />
zum Sieg. Das Energieunternehmen Iberdrola und<br />
<strong>der</strong> Anbieter von Umweltservices Befesa gewannen<br />
bei den grenzüberschreitenden Übernahmen und<br />
Zusammenschlüssen. Den Großen Preis holte sich<br />
<strong>der</strong> Telekommunikationsriese Telefónica.<br />
Bild links, v. l.: Czesław Kisiel (CEO, TDJ Investments,<br />
Hauptanteilseigner von Famur), Piotr Soyka<br />
(CEO, Gdańska Stocznia Remontowa), Joanna<br />
Drzymała (Mitglied Supervisory Board, Inter Groclin<br />
Auto), Waldemar Maj (Vice President, PKN<br />
Orlen), Dariusz Pachla (Vice President, LPP),<br />
Tomasz Mogilski (Vice President, Koelner)<br />
Unten: Maciej Orłoś (l., TVP 1), Artur Pielech (Partner,<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>)<br />
37
<strong>Die</strong>sen Beitrag können Sie auch<br />
auf unserer Audio-CD (Seite 63) hören.<br />
Im Osten viel Neues<br />
: Vor sechs Jahren investierte die belgische<br />
Bank KBC 425 Millionen Euro in ihren<br />
ersten Anteil an <strong>der</strong> slowenischen Nova<br />
Ljubljanska Banka (NLB). In den folgenden<br />
Jahren stockte KBC diesen Anteil kontinuierlich<br />
auf und wurde schließlich Mehrheitseigner.<br />
Obwohl sich die NLB außerordentlich<br />
gut entwickelte und dank zahlreicher Expansionen<br />
heute zu den größten Playern auf<br />
dem südosteuropäischen Markt zählt, hat<br />
KBC die NLB nie ganz übernommen. Als die<br />
slowenische Regierung den ersten Anteil <strong>der</strong><br />
NLB von 34 Prozent verkaufte, räumte sie<br />
zwar <strong>der</strong> KBC das Vorkaufsrecht für weitere<br />
Anteile ein – brachte diese dann aber nie auf<br />
den Markt. <strong>Die</strong> KBC beschloss schließlich,<br />
ihre Anteile wie<strong>der</strong> zu verkaufen. CEO<br />
André Bergen sagt: „Finanziell hat sich unser<br />
Engagement gelohnt.“<br />
Ursprünglich ging es um mehr als um ein<br />
gutes Geschäft, noch 2002 sprach man von<br />
einer strategischen Investition. Bergen kennt<br />
die Hintergründe des Kurswechsels: „Für<br />
die slowenische Regierung, indirekt und<br />
direkt <strong>der</strong> größte Sharehol<strong>der</strong> <strong>der</strong> Bank,<br />
überwogen politische Aspekte. <strong>Die</strong> politische<br />
Logik unterscheidet sich eben von <strong>der</strong><br />
Logik <strong>der</strong> Banken.“ Der Ertrag kann sich<br />
dennoch sehen lassen. Als KBC wie<strong>der</strong> verkauft,<br />
wird <strong>der</strong> Unternehmenswert von NLB<br />
auf rund drei Milliarden Euro geschätzt,<br />
die KBC-Anteile sind deshalb geschätzt doppelt<br />
so teuer wie <strong>der</strong> ursprüngliche Kaufpreis.<br />
Das Beispiel zeigt: Ein Engagement in<br />
Osteuropa kann sich lohnen; <strong>der</strong> schnell<br />
wachsende Markt lockt mit guten Erträgen.<br />
Gleichzeitig müssen sich Investoren aber<br />
auf unvorhersehbare Risiken einstellen.<br />
industry-report f<br />
Bankenkrise hin o<strong>der</strong> her: Der osteuropäische Bankenmarkt bietet nach wie vor substanzielle<br />
Wachstumschancen. KBC aus Brüssel und PKO BP aus Warschau nutzen das zu ihrem Vorteil.<br />
Ihre Strategien unterscheiden sich allerdings, wie FT-Korrespondent Thomas Escritt berichtet.<br />
Das Muster wie<strong>der</strong>holt sich: Lange bevor<br />
Rumänien auf dem Schirm <strong>der</strong> Investoren<br />
auftauchte, wagte sich die griechische Alpha<br />
Bank Anfang <strong>der</strong> Neunzigerjahre auf den<br />
rumänischen Markt. <strong>Die</strong> Bank zahlte für<br />
ihren Markteintritt weniger als zehn Millionen<br />
Euro und besitzt heute Kapitalreserven<br />
von mehr als drei Milliarden. Der Weg dorthin<br />
war oft schwierig. „Wir waren Teil des<br />
Bankenkonsortiums, das Rumäniens Zentralbank<br />
kurz vor <strong>der</strong> Jahrtausendwende finanziell<br />
aus <strong>der</strong> Krise rettete“, sagt CEO Sergiu<br />
Oprescu. „Wir wissen, wie <strong>der</strong> Hase läuft.“<br />
Nachzügler zahlen mehr, wie Österreichs<br />
Erste Bank zeigt: Sie investierte bei <strong>der</strong> letzten<br />
großen Bankprivatisierung fast vier Milliarden<br />
Euro für die rumänische BCR.<br />
Mit einer an<strong>der</strong>en Ausgangslage ist als staatlich<br />
kontrollierte Bank Polens PKO BP konfrontiert.<br />
Zwar ist sie in ihrer Heimat Marktführer,<br />
aber während KBC bereits seit den<br />
späten Achtzigern international expandiert,<br />
verfolgt PKO BP erst jetzt diese Strategie.<br />
Wie KBC kennt aber auch sie die Launen <strong>der</strong><br />
Politik. PKO BP, zu 51 Prozent im Besitz des<br />
polnischen Staats, darf ihren Vorständen<br />
per Gesetz nicht mehr als 4000 Euro monatlich<br />
zahlen. Auf einem umkämpften Markt,<br />
auf dem je<strong>der</strong> die besten Talente für sich<br />
gewinnen will, ist das eine große Herausfor<strong>der</strong>ung.<br />
Dennoch: Für wirklich existenziell<br />
hält Rafal Juszczak, bis vor Kurzem PKOs<br />
Vorstandschef, dieses Problem nicht. Denn<br />
für ihn war die Herausfor<strong>der</strong>ung, ein solches<br />
Schwergewicht auf dem Finanzmarkt zu<br />
führen und zu restrukturieren, eine Belohnung.<br />
Außerdem könne man Mitarbeiter<br />
unterhalb des Vorstands durchaus marktüb-<br />
lich entlohnen. <strong>Die</strong> Institution, die Juszczak<br />
restrukturieren sollte, glich eher einem<br />
Staatsbetrieb: „<strong>Die</strong> Angestellten schoben<br />
sich gegenseitig die Papiere über den Tisch<br />
und machten um vier Uhr nachmittags Feierabend.<br />
An die Aufgabe, die Bank wettbewerbsfähig<br />
zu machen, um mit den Besten<br />
am Markt zu konkurrieren, hatte sich niemand<br />
gewagt.“ Jetzt aber wandelt sich die<br />
Unternehmenskultur. Das ehrgeizige Ziel:<br />
„mindestens mit dem Marktwachstum<br />
Schritt halten, sich auf die Kernproduktgruppen<br />
Kundenkredite, Investmentfonds und<br />
Pfandbriefe konzentrieren und das Firmengeschäft<br />
auf das Niveau unseres Privatkundengeschäfts<br />
ausbauen.“ Das Tempo gibt die<br />
italienische UniCredit vor. Seit <strong>der</strong> Übernahme<br />
<strong>der</strong> deutschen HypoVereinsbank und <strong>der</strong><br />
darauf folgenden Fusionierung <strong>der</strong> Aktivitäten<br />
bei<strong>der</strong> Banken ist UniCredit <strong>der</strong> größte<br />
Akteur auf dem polnischen Markt.<br />
WIE VERANKERT MAN UNTERNEHMERISCHES<br />
DENKEN IN DEN KÖPFEN DER MITARBEITER?<br />
<strong>Die</strong> zunächst größte Herausfor<strong>der</strong>ung für<br />
PKO BP war es, unternehmerisches Denken<br />
in den Köpfen <strong>der</strong> Mitarbeiter zu verankern.<br />
„Es lässt sich leicht vom Empowerment <strong>der</strong><br />
Mitarbeiter reden. Unser Problem war aber,<br />
dass die Leute gar keine Verantwortung<br />
übernehmen wollten“, sagt Juszczak. Als<br />
Lösung wählte man anfangs ein Anreizsystem,<br />
das den Mitarbeitern Erwartungen und<br />
entsprechende Belohnungen klar vorgab.<br />
„Zuerst war es ein Anreizsystem zur<br />
Gewinnumverteilung, heute arbeiten wir<br />
mit Zielvorgaben.“ <strong>Die</strong> Strategie hat sich<br />
39
40<br />
André Bergen, CEO von KBC (links) will mit <strong>der</strong> Bank in Län<strong>der</strong>n wachsen, in <strong>der</strong> das Institut<br />
schon vertreten ist. Rafal Juszczak (rechts), <strong>der</strong> ehemalige CEO von PKO BP, restrukturierte<br />
die Ex-Staatsbank und hält auch einen Merger für möglich, um international zu wachsen.<br />
bezahlt gemacht: <strong>Die</strong> Gewinne <strong>der</strong> Bank stiegen<br />
im vergangenen Jahr auf zwei Milliarden<br />
Zloty (rund 596 Millionen Euro), die<br />
Hälfte davon wurde in diesem Jahr bereits<br />
im ersten Quartal erreicht.<br />
Auch die mangelhafte Kommunikation gehört<br />
<strong>der</strong> Vergangenheit an. „Vor zwei Jahren<br />
schickte <strong>der</strong> Vorstand einmal im Jahr einen<br />
Brief an die Mitarbeiter“ – heute sieht das<br />
ganz an<strong>der</strong>s aus. Es gibt regelmäßige Versammlungen,<br />
an denen „mehr als 7000 <strong>der</strong><br />
insgesamt 30 000 Beschäftigten teilnehmen.“<br />
Und PKO BP hat sogar mit Live-Onlinechats<br />
experimentiert, in denen Angestellte ihre<br />
Fragen direkt an den Vorstand richten konnten.<br />
Mehr als die Hälfte <strong>der</strong> Mitarbeiter<br />
nutzte dieses Angebot.<br />
Ebenfalls zur Restrukturierung <strong>der</strong> Bank<br />
gehören große Investitionen: <strong>Die</strong> Bank<br />
gibt mehr als 300 Millionen Euro für ein<br />
neues IT-System aus. Allerdings führen die<br />
Einsparungen auch zum Verlust von rund<br />
1500 Arbeitsplätzen. Juszczak ist sich dennoch<br />
sicher, dass das Ergebnis die schmerzhaften<br />
Eingriffe rechtfertigen wird.<br />
Wie KBC hält auch PKO BP die weniger entwickelten,<br />
aber dynamischeren Märkte für<br />
vielversprechend. Vor vier Jahren kaufte die<br />
Bank daher „für wenig Geld“, wie Juszczak<br />
sagt, ein kleines Unternehmen in <strong>der</strong> Ukraine.<br />
Juszczak sieht seine Bank zwar als die<br />
„beste Marke in <strong>der</strong> polnischen Finanzwelt“.<br />
Aber wenn das Unternehmen die erste Liga<br />
in Europa erreichen will, müsse es „einen<br />
großen Schritt wagen“ – dabei schließt er<br />
eine Fusion nicht aus.<br />
Während PKO BP international expandieren<br />
will, konzentriert sich KBC darauf, die starke<br />
Marktposition in den neun Län<strong>der</strong>n in Zentral-<br />
und Osteuropa auszubauen, in denen<br />
die Bank bereits Fuß gefasst hat. „Wir wollen<br />
mindestens einen Marktanteil von zehn Prozent<br />
erreichen. Das ist kein Fetisch, son<strong>der</strong>n<br />
unsere Art zu sagen: Wir wollen keine Nebenrolle<br />
spielen.“ Auch wenn sich KBC auf<br />
Län<strong>der</strong> konzentriert, in denen die Bank<br />
bereits präsent ist, gibt es genügend Spielraum<br />
für weiteres Wachstum. Das zeigt auch<br />
<strong>der</strong> Intermediationsgrad des Finanzsystems,<br />
<strong>der</strong> die Summe aller Bankenvermögen in<br />
THOMAS ESCRITT, geboren in London,<br />
ist seit 2007 Bukarest-Korrespondent <strong>der</strong><br />
Financial Times (FT) und widmet sich Rumänien,<br />
Ungarn und Slowenien. Davor schrieb<br />
er in einer Reihe von Publikationen <strong>der</strong> FT<br />
über Assetmanagement.<br />
Prozent vom BIP bezeichnet. In Rumänien<br />
etwa liegt dieser Wert bei unter 40 Prozent,<br />
in Polen bei 70 Prozent, an den entwickelten<br />
Finanzmärkten in Westeuropa bei 120 Prozent.<br />
„Wir investieren unser Kapital in organisches<br />
Wachstum“, sagt Bergen. „Zwei neue<br />
Filialen pro Woche sprechen für sich.“<br />
TROTZ HETEROGENEM AUSSEN-<br />
BILD: KBC STREBT EIN EINHEITLICHES<br />
GESCHÄFTSMODELL AN<br />
Sobald sich KBC in einem Land etabliert hat,<br />
verhält sich die Bank wie ein lokaler Finanzdienstleister.<br />
Bergen erklärt: „SOB wird als<br />
tschechische Bank wahrgenommen. In Russland<br />
haben wir den Namen und das Logo <strong>der</strong><br />
Absolut Bank beibehalten, auch wenn je<strong>der</strong><br />
weiß, dass diese Bank Teil <strong>der</strong> KBC-Gruppe<br />
ist.“ Trotz unterschiedlicher Außenwahrnehmung<br />
strebt KBC bei allen Banken ein einheitliches<br />
Geschäftsmodell an: „Bei Instituten<br />
mit einem starken Fokus auf Geschäftskunden<br />
haben wir uns nach dem Kauf sofort<br />
bemüht, auch das Privatkundengeschäft auszubauen“,<br />
blickt <strong>der</strong> CEO zurück.<br />
KBCs Alleinstellungsmerkmal heißt nach<br />
Bergen „integrierter Bankversicherer“:<br />
„Unsere Wettbewerber können ihren Kun-
den zwar Versicherungsprodukte weiterer<br />
<strong>Die</strong>nstleister anbieten, aber wir liefern das<br />
komplette Paket aus einer Hand.“<br />
Von den insgesamt 57 000 Beschäftigten <strong>der</strong><br />
KBC-Gruppe arbeiten momentan 33 000 in<br />
Zentral- und Osteuropa. 22 Prozent des Nettogewinns<br />
werden dort erwirtschaftet. Auch<br />
ohne weitere Expansionen verän<strong>der</strong>t dies<br />
das Gesicht des Unternehmens. „Momentan<br />
arbeiten in Brüssel 30 Mann aus dieser Region.<br />
Ich kann mir auch gut vorstellen, dass<br />
irgendwann einer meiner Nachfolger nicht<br />
aus Belgien, son<strong>der</strong>n aus Osteuropa stammen<br />
wird“, sagt Bergen.<br />
Das Interesse am Bankenboom im Osten<br />
wächst. Aber ein Stück vom Kuchen ist<br />
längst nicht mehr billig zu haben. „Betrachtet<br />
man das Wachstum in Län<strong>der</strong>n wie Russland,<br />
wird klar, dass weitere Expansionen<br />
viel Geld kosten. Ich möchte mich aber lieber<br />
darauf konzentrieren, unsere bestehenden<br />
Unternehmen weiter auszubauen, anstatt<br />
Geld und Ressourcen über viele Län<strong>der</strong><br />
zu streuen“, sagt daher Bergen.<br />
Und die weltweite Bankenkrise? Seit liquide<br />
Mittel nicht mehr im Überfluss vorhanden<br />
sind, ist es für viele Institute schwierig<br />
geworden. Aber we<strong>der</strong> bei KBC noch bei<br />
PKO BP ist man übermäßig besorgt. Bergen<br />
räumt Verluste ein, die sich aber, da ist er<br />
sich sicher, auf maximal 500 Millionen Euro<br />
belaufen werden. Außerdem, so sagt er, sei<br />
eine Bank mit Schwerpunkt auf dem Privatkundengeschäft<br />
weit weniger von den<br />
Finanzmärkten abhängig, wenn es darum<br />
gehe, Mittel zu beschaffen.<br />
Deutliche Vorteile bietet es in Osteuropa,<br />
als Tochtergesellschaft in ausländischer<br />
Hand zu sein. <strong>Die</strong> Dependancen nämlich<br />
können sich bei Kapitalbedarf an ihre Muttergesellschaften<br />
wenden. Unabhängige<br />
Banken sind auf die Kapitalmärkte angewiesen,<br />
was sich in jüngster Zeit als problematisch<br />
erwiesen hat. Auch PKO BP musste die<br />
geplante Emission eines Eurobonds um<br />
sechs Monate verschieben..<br />
Alles ist an<strong>der</strong>s<br />
industry-report f<br />
Eine Bankenstudie zeigt: Zwischen Ost und West existieren große<br />
Unterschiede. Während sich westliche Banken auf den Gewinn pro<br />
Kunden konzentrieren, herrscht im Osten ein Akquisitionskampf.<br />
Europas Bankenwelt teilt sich in einen<br />
ruhigen Westen und Norden sowie einen<br />
dynamischen Osten. Zwischen 2002 und<br />
2006 wuchs die Rentabilität nordeuropäischer<br />
Banken um drei Prozent, während die<br />
Banken in Russland und <strong>der</strong> Ukraine ein<br />
Wachstum von 62 Prozent verzeichneten.<br />
Mittel- und osteuropäische Län<strong>der</strong> wuchsen<br />
im Schnitt um 14 Prozent pro Jahr.<br />
Gleichzeitig erwirtschafteten Banken auf<br />
den reifen Märkten Nord- und Westeuropas<br />
siebenmal mehr Ertrag pro Kunden als Banken<br />
in Russland und <strong>der</strong> Ukraine.<br />
<strong>Die</strong> Zahlen aus <strong>der</strong> aktuellen Studie „Retail<br />
Banking in Europe“ von <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>,<br />
Nordea und EFMA zeigen, dass es im Banking<br />
in Europa immer noch große Unterschiede<br />
gibt. Einer <strong>der</strong> wichtigsten: die<br />
Art des Wachstums. Westliche Banken<br />
CIS-LÄNDER HOLEN AUF<br />
Jährliches Wachstum nach Umsatzsektor<br />
(2002–2006)<br />
61,9 %<br />
Durchschnittswachstum<br />
14 %<br />
2,9 % 4,7 %<br />
Zinsen<br />
Gebühren,<br />
Provisionen<br />
41 %<br />
59 %<br />
Nordeuropa<br />
51 %<br />
49 %<br />
Westeuropa<br />
think:act-Chart, Quelle: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong><br />
66 %<br />
34 %<br />
82 %<br />
18 %<br />
West- und Osteuropa<br />
Russland und<br />
Ukraine<br />
wachsen vor allem durch die Ertragssteigerungen<br />
pro Kunden, im Osten dagegen<br />
herrscht zwischen den Banken ein Krieg<br />
um Neukunden.<br />
Wenn es um die Erträge pro Kunden geht,<br />
haben westliche Banken klar die Nase vorn.<br />
Ihre Kunden nutzen im Schnitt 5,4 Produkte<br />
und generieren so durchschnittlich einen<br />
Ertrag von 750 Euro pro Person und Jahr.<br />
Bei nordeuropäischen Banken liegt dieser<br />
Ertrag bei 630 Euro pro Kunden, in den<br />
GUS-Staaten lediglich bei 110 Euro.<br />
<strong>Die</strong> Marktdurchdringung schreitet im<br />
Osten weiter fort. Größte Herausfor<strong>der</strong>ung<br />
ist dabei die Neukundengewinnung. Insbeson<strong>der</strong>e<br />
die Vielfalt <strong>der</strong> innovativen Distributionskanäle<br />
in Mittel- und Osteuropa fällt<br />
dabei ins Auge. Auch in den GUS-Staaten<br />
nutzten Banken solche „innovativen Treiber“,<br />
um ihren Marktanteil auszubauen.<br />
Viele Unternehmen passten etwa die Öffnungszeiten<br />
<strong>der</strong> Filialen je nach Lage an<br />
und führten multifunktionale Geldautomaten<br />
ein. Für Mitarbeiter in Osteuropa und<br />
den GUS-Staaten existieren zudem starke<br />
Anreizsysteme mit Boni, die in Mittel- und<br />
Osteuropa bis zu 27 Prozent und in den<br />
GUS-Staaten bis zu 17 Prozent des Einkommens<br />
betragen. Im Vergleich dazu machen<br />
Boni in Nordeuropa im Schnitt ein Prozent<br />
des Einkommens aus.<br />
Während westeuropäische Banken vor<br />
allem die Erträge zu steigern versuchen,<br />
konzentrieren sich die nordeuropäischen<br />
darauf, die Kosten zu senken. Sie haben<br />
folglich das beste durchschnittliche Kosten-<br />
Einkommen-Verhältnis und die niedrigsten<br />
Personalkosten. Hier spielen vor allem neue<br />
Technologien eine wichtige Rolle. So hat<br />
das Internet dort maßgeblich dazu beigetragen,<br />
die Filialdichte zu verringern.<br />
41
42<br />
<strong>Die</strong> Jetchauffeure<br />
: <strong>Die</strong> Idee soll den Luftverkehr revolutionieren:<br />
Kleine und leichte Flugzeuge,<br />
die Very Light Jets (VLJs), beför<strong>der</strong>n Passagiere<br />
als Lufttaxis ans Ziel – in Airliner-<br />
Geschwindigkeit. <strong>Die</strong> kleinen Businessjets<br />
bieten Platz für höchstens sechs Fluggäste,<br />
sind dabei rund 4500 Kilogramm leicht und<br />
sollen, so die Hersteller, die Kosten eines<br />
normalen Businessjets pro Passagier halbieren.<br />
Günstig für Geschäftsreisende, die per<br />
VLJ da hinkommen, wo herkömmliche<br />
Businessjets wegen ihrer Größe nicht landen<br />
dürfen. Rund 1200 Flughäfen in Europa<br />
sind VLJ-geeignet.<br />
Lufttaxi, das kann man auch wörtlich nehmen,<br />
was das Flugerlebnis angeht. <strong>Die</strong> Kabinen<br />
sind zwar meist in edlem Le<strong>der</strong> gehalten.<br />
Das Raumgefühl erinnert aber eher<br />
an das Interieur eines Minivans als an einen<br />
luxuriösen Businessjet. Eine Küche gibt es<br />
nicht, oft auch keine Toilette. Becherhalter<br />
für den Kaffee und ein paar Ablagen für<br />
die Zeitung müssen reichen. Dafür bieten<br />
die meisten Taxiunternehmen Telefon und<br />
E-Mail-<strong>Die</strong>nste, für Laptops gibt es Steck-<br />
dosen. Ist das Flugzeug voll, so sitzt man<br />
sich gegenüber wie in <strong>der</strong> S-Bahn und muss<br />
sich mit den Beinen arrangieren. Standhöhe<br />
hat keine <strong>der</strong> kleinen Kabinen. Bei <strong>der</strong><br />
Eclipse 500 fallen die großen Fenster auf,<br />
die Enge des Rumpfs wird dadurch optisch<br />
etwas aufgelöst.<br />
Obwohl sich bisher we<strong>der</strong> die neuen Flugzeuge<br />
noch das neue Geschäftsmodell <strong>der</strong><br />
Betreiber beweisen konnten, marschieren<br />
Chefveteranen und Branchengurus an <strong>der</strong><br />
Spitze des Trends: Beim nie<strong>der</strong>ländischen<br />
Start-up Bikkair sitzt Pieter Bouw, <strong>der</strong> ehemalige<br />
Chef von KLM und Swiss, im Aufsichtsrat.<br />
<strong>Die</strong> Kollegen von POGO Jet haben<br />
sich Bob Crandall geangelt, den legendären<br />
Ex-Chef von American Airlines, Erfin<strong>der</strong><br />
von Computerreservierungssystem und<br />
Vielfliegerprogramm. Und <strong>der</strong> VLJ-Flugzeugbauer<br />
Eclipse Aviation wurde von Vern<br />
Raburn gegründet, einst 18. Mitarbeiter des<br />
Softwaregiganten Microsoft.<br />
<strong>Die</strong> Branchenleitwölfe scheinen den richtigen<br />
Riecher zu haben. Knapp 500 VLJs<br />
haben Kunden allein in Europa bislang<br />
Light Jet <strong>der</strong> Firma Grob.<br />
Topmanagern bieten die Lufttaxis<br />
eine ganz neue Flexibilität.<br />
Mit beson<strong>der</strong>s leichten Flugzeugen sorgen Flugunternehmer in <strong>der</strong> Luftfahrtbranche für Aufregung.<br />
Sie bieten mit Very Light Jets einen günstigen Taxiservice für die Lüfte an. In den Weiten <strong>der</strong> USA<br />
und Asiens eine Erfolgsidee, in Europa könnte <strong>der</strong> enge Luftraum zum Problem werden.<br />
bestellt. Rund die Hälfte wird binnen <strong>der</strong><br />
nächsten drei Jahre ausgeliefert.<br />
Für 2015 rechnet die europäische Flugsicherungsbehörde<br />
Eurocontrol mit 700 VLJs.<br />
Goldgräberstimmung hat die Hersteller<br />
erfasst. Insgesamt sieben Flugzeugbauer<br />
basteln an VLJs. Auch die erste Pleite<br />
scheint den Hype nicht zu bremsen. Adam<br />
Aircraft musste als Branchenneuling Lehrgeld<br />
bezahlen. Denn kleine Flugzeuge<br />
bedeuten noch lange nicht kleine Probleme.<br />
Zumal in den Maschinen viel Hightech<br />
steckt. <strong>Die</strong>ses soll den Piloten das Fliegen<br />
vereinfachen: einsteigen, Route programmieren,<br />
Motor anmachen, losfliegen. <strong>Die</strong><br />
einfache Idee erfor<strong>der</strong>t komplexe Systeme<br />
im Hintergrund.<br />
Auch Vern Raburns Eclipse Aviation musste<br />
erfahren, wie weit Wirklichkeit und Traum<br />
manchmal auseinan<strong>der</strong>liegen. „Wir sind<br />
lange nicht da, wo wir eigentlich sein wollen“,<br />
so Raburn. Zwar fliegen mittlerweile<br />
die ersten Eclipse 500. Aber <strong>der</strong> Produktionshochlauf<br />
hat länger gedauert als erhofft.<br />
Und die ersten ausgelieferten Maschinen
müssen aufwendig mit Navigationstechnik<br />
nachgerüstet werden. Eclipse überlebte bislang<br />
vor allem durch eine Kapitalspritze von<br />
mehr als 100 Millionen Dollar des nie<strong>der</strong>ländischen<br />
Finanzinvestors ETIRC.<br />
In den USA gibt es schätzungsweise 3000<br />
Flugplätze, die für VLJs infrage kommen.<br />
<strong>Die</strong> großen Distanzen, <strong>der</strong> auf dem Land<br />
nicht überfüllte Luftraum und die Aufgeschlossenheit<br />
gegenüber <strong>der</strong> Geschäftsfliegerei<br />
machen die USA zum Idealmarkt.<br />
POGO Jet, DayJet, MagnumJet und an<strong>der</strong>e<br />
versuchen sich daher zu etablieren. Rund<br />
800 Dollar pro Sitz und Strecke müssen sie<br />
nach Ansicht von Vaughn Cordle, Analyst<br />
bei AirlineForecasts, verlangen, damit sich<br />
das Geschäft lohnt.<br />
IDEALMARKT USA, POTENZIAL IN ASIEN – NUR IN<br />
EUROPA IST DER LUFTRAUM EIN PROBLEM<br />
Auch in Asien sehen Experten viel Potenzial.<br />
Bereits 2007 bestellte Hainan Zhong Hang<br />
Tai General Aviation Airlines aus China<br />
50 VLJs. Und jüngst kaufte Club One Air, ein<br />
Fractional-Ownership-Anbieter aus Delhi,<br />
zehn Eclipse 500. Bislang fliegen in Asien<br />
zwar nur 2,6 Prozent aller Geschäftsreisejets.<br />
Doch „Indien wird für die Very Light Jets ein<br />
sehr guter Markt“, glaubt Embraer-Phenom-<br />
Programmchef Luís Carlos Affonso.<br />
Ob VLRs in Europa Erfolg haben, hängt auch<br />
von <strong>der</strong> Entwicklung im Luftverkehr ab.<br />
Schon jetzt gilt <strong>der</strong> europäische Luftraum als<br />
verstopft und ineffizient organisiert. Was<br />
hilft <strong>der</strong> Kleinflughafen, wenn <strong>der</strong> Luftraum<br />
darüber dicht ist? Doch damit nicht genug:<br />
„Das Wachstum bei den Very Light Jets<br />
bedeutet zusätzliche Komplexität für den<br />
Luftverkehr in Europa“, so Alex Hendriks,<br />
Strategiechef bei <strong>der</strong> Flugsicherungsbehörde<br />
Eurocontrol. Das Problem ist: <strong>Die</strong> kleinen<br />
Jets werden in <strong>der</strong> Regel zwischen 33 000 und<br />
35 000 Fuß fliegen. Das aber ist schon <strong>der</strong><br />
Bereich, in dem viele große Flugzeuge unterwegs<br />
sind, wenn sie dürfen. Dazu kommt,<br />
dass die VLJs mit 240 bis 380 Knoten etwa<br />
AIRTAXI-UNTERNEHMER<br />
Insgesamt 25 Linien organisieren sich<br />
im Weltverband Airtaxi Association<br />
(www.ataxa.com). Wichtige Player:<br />
DAYJET<br />
Das amerikanische Airtaxi-Unternehmen<br />
wurde 2002 gegründet. Im Südosten <strong>der</strong> USA<br />
können seit 2007 Passagiere mit DayJet reisen.<br />
Der Preis wird pro Sitzplatz berechnet.<br />
POGO JET<br />
Den Nordosten <strong>der</strong> USA wird ab 2009 das<br />
Unternehmen von Ex-American-Airlines-Chef<br />
Bob Crandall bedienen – ausgenommen sind<br />
die großen Flughäfen wie JFK in New York.<br />
BIKKAIR<br />
Mit <strong>der</strong> Basis in Rotterdam will das nie<strong>der</strong>ländische<br />
Airtaxi-Unternehmen Bikkair rund<br />
1200 Ziele in ganz Europa anfliegen. Wer<br />
dabei sein will, muss Mitglied werden.<br />
CLUB ONE AIR<br />
Das Geschäftsmodell des indischen Unternehmens<br />
heißt Fractional Ownership: Wer<br />
beispielsweise ein Sechstel eines Flugzeugs<br />
kauft, kann 120 Stunden im Jahr fliegen.<br />
Eclipse-CEO Vern Raburn glaubt an die Leichtflieger –<br />
auch wenn er Hilfe eines Finanzinvestors brauchte<br />
20 Prozent langsamer sind als ein Airbus A320<br />
o<strong>der</strong> eine Boeing 737. Sie drohen also zum<br />
Verkehrshin<strong>der</strong>nis zu werden o<strong>der</strong> bekommen<br />
die gewünschte Flughöhe gar nicht erst<br />
zugeteilt. Müssen die Maschinen aber niedriger<br />
fliegen, steigen die Betriebskosten.<br />
Auch für Bernhard Fragner von GlobeAir<br />
in Linz ist die Flugsicherung „ein großes<br />
industry-report f<br />
<strong>Die</strong>sen Beitrag können Sie auch<br />
auf unserer Audio-CD (Seite 63) hören.<br />
Thema“. Aber er bleibt optimistisch: „Der<br />
Geschäftsflugverkehr ist auch in Wirtschaftskrisen<br />
in Europa zuletzt immer weiter<br />
gewachsen. Es besteht Bedarf.“<br />
<strong>Die</strong> meisten VLJs werden von Airtaxi- und<br />
Charteranbietern wie Fragners GlobeAir<br />
o<strong>der</strong> Pieter Bouws Bikkair übernommen.<br />
Bikkair hat seine erste Citation Mustang in<br />
<strong>Die</strong>nst gestellt. Bis Ende 2008 sollen es zehn<br />
Maschinen sein, bis zu 100 im Jahr 2012.<br />
Bikkair-Grün<strong>der</strong> Leen<strong>der</strong>t Bikker glaubt:<br />
„80 Prozent unserer Kunden sind vorher<br />
noch nie mit einem Businessjet geflogen.“<br />
Um Bikkair-Flüge zu buchen, müssen sich<br />
Kunden für das sogenannte Amulet-Programm<br />
registrieren. Dabei kaufen sie Kontingente<br />
von 15, 40 o<strong>der</strong> 100 Stunden Flugzeit<br />
im Voraus und bestellen ihre Flüge dann<br />
mit einigen Tagen Vorlauf. <strong>Die</strong> Anlaufkosten<br />
sind für Airtaxi-Unternehmen enorm. Denn<br />
solange sie nur über wenige Flugzeuge verfügen,<br />
müssen die Maschinen oft leer dorthin<br />
fliegen, wo die Kunden warten. Gewinne<br />
sind so kaum möglich, deswegen ist schnelles<br />
Wachstum so wichtig.<br />
TROTZ HOHER STARTKOSTEN: DIE UNTERNEHMER<br />
GLAUBEN AN DIE ZUKUNFT DES MODELLS<br />
Bernhard Fragner vermeidet dieses Problem<br />
komplett. Im April bekommt GlobeAir die<br />
erste Cessna Citation Mustang und will bald<br />
darauf den Betrieb starten. „Es wird keine<br />
Positionierungsflüge geben“, so Fragner.<br />
GlobeAir wird die Maschinen zunächst in<br />
Linz, Wien, Graz und St. Gallen stationieren<br />
und Tagesflüge anbieten. Mit seinem Angebot<br />
will er die zweite Führungsebene o<strong>der</strong><br />
hoch bezahlte Ingenieure exportorientierter<br />
Unternehmen erreichen. 2009 wird<br />
GlobeAir weitere zehn Mustangs übernehmen<br />
und will mittelfristig auf 30 Maschinen<br />
und weitere Standorte expandieren. In einigen<br />
Jahren, so glaubt <strong>der</strong> Unternehmer,<br />
„werden Airtaxi-<strong>Die</strong>nste basierend auf VLJs<br />
eine gut akzeptierte Methode des Reisens<br />
für Geschäftsleute in ganz Europa sein“..<br />
43
p industry-report<br />
44<br />
ZUKUNFTSMÄRKTE<br />
In Kalifornien lassen sich Wirbelwinde einfangen. In Russland repariert Beton Bauwerke unter<br />
Wasser. Festplatten werden bald schneller – und Bakterien erzeugen künftig Benzin.<br />
lernen von den fischen<br />
Wind- und Wasserkraftwerke sind sauber. Sie verbrennen<br />
keine fossilen Energieträger und erzeugen trotzdem<br />
Strom. Allerdings nur dort, wo <strong>der</strong> Wind o<strong>der</strong> das Wasser<br />
geradlinig, laminar von vorne anströmen kann. <strong>Die</strong> Kraft<br />
verwirbelter Luftmassen dagegen können sie nicht nutzen.<br />
John Dabiri will das än<strong>der</strong>n. Normalerweise beschäftigt<br />
sich <strong>der</strong> Professor am California Institute of Technology<br />
mit <strong>der</strong> Fortbewegung von Fischen. Genau diese Beobachtungen<br />
brachten ihn nun auf eine vielleicht bahnbrechende<br />
Idee. „Bei den Fischen finden wir die lebenden<br />
Beispiele dafür, dass man Energie aus Verwirbelungen<br />
ziehen kann“, sagt <strong>der</strong> Wissenschaftler.<br />
Fische nutzen die Druckverhältnisse, die durch Wasserwirbel<br />
an ihrem Körperende entstehen, um sich nach<br />
vorne zu saugen. Weil sich die Drehrichtung <strong>der</strong> Wirbel<br />
aber ständig än<strong>der</strong>t, wedeln sie mit ihren Schwanzflossen<br />
hin und her. Auf <strong>der</strong> Grundlage dieser Erkenntnis will<br />
Dabiri nun mechanische Systeme entwickeln, die ihre<br />
Stellung zu vorbeiströmen<strong>der</strong> Luft genauso variieren können,<br />
um Energie zu gewinnen. „Wir benötigen ein Gerät,<br />
das die anfliegenden Wirbel vorausberechnen kann und<br />
sich entsprechend dazu ausrichtet.“ Eine Bauanleitung<br />
für die Steuerung will er ebenfalls liefern. Seinen Angaben<br />
zufolge genügen bereits drei Parameter, um verwirbelte<br />
Strömungen mathematisch hinreichend genau zu<br />
beschreiben.<br />
Als ideale Standorte für diese Wirbelmaschinen bieten<br />
sich vor allem Großstädte an. Normale Windrä<strong>der</strong> rotieren<br />
dort nicht, weil keine steifen Brisen wehen. An<strong>der</strong>s dagegen<br />
die Wirbelgeneratoren, die die Luftturbulenzen in<br />
den Häuserschluchten in nutzbaren Strom verwandeln<br />
sollen. Über das Jahr gesehen, würden beide Generatorentypen<br />
übrigens gleich viel Energie erzeugen, betont<br />
Dabiri. Mit einem Unterschied: „Windturbinen benötigen<br />
Windstärken von mindestens zehn Metern pro Sekunde,<br />
damit sie sich drehen. Unsere Maschinen dagegen würden<br />
<strong>der</strong> Strömung konstant Energie entziehen.“<br />
Transportschiffe auf <strong>der</strong> Wolga<br />
zauberbeton<br />
Mit 3500 Kilometern ist die Wolga <strong>der</strong> längste Fluss<br />
Europas – und ein riesiger Energieträger dazu. Schon<br />
Stalin setzte zahlreiche Wasserkraftwerke in den Fluss, die<br />
bis heute eine elektrische Leistung von zusammen rund<br />
zwölf Gigawatt liefern. Allerdings weisen die fast 60 Jahre<br />
alten Anlagen inzwischen erhebliche Schäden auf. Das<br />
Problem: Zu reparieren waren diese Schäden bislang nur<br />
im Trockenen, sodass dafür jeweils <strong>der</strong> Wasserspiegel<br />
gesenkt werden musste. Schifffahrt und <strong>der</strong> Betrieb des<br />
Kraftwerks wurden dadurch erheblich eingeschränkt.<br />
Forscher haben jetzt gemeinsam mit dem Baustoffhersteller<br />
MC Bauchemie eine neuartige Betonmixtur entwickelt,<br />
mit <strong>der</strong> sich schadhafte Stellen unter Wasser automatisiert<br />
ausbessern lassen. Sie zeichnet sich durch drei<br />
Eigenschaften aus: Sie ist selbstverdichtend, muss also<br />
nicht gerüttelt werden, um Lufteinschlüsse zu vermeiden.<br />
Sie bleibt lange fließfähig. Und sie verbindet sich nachhaltig<br />
mit dem Untergrund des Altbetons.<br />
Auch das Reparaturverfahren stimmten die Forscher<br />
auf die beson<strong>der</strong>e Umgebung ab. So entwickelten sie eine<br />
ganz spezielle Schalung, die von unten befüllt und nach<br />
oben sowohl entwässert als auch entlüftet wird. <strong>Die</strong> Laborphase<br />
hat das Verfahren bereits erfolgreich überstanden.<br />
Im Sommer soll es daher erstmals an <strong>der</strong> Wolga<br />
zum Einsatz kommen.
optische festplatte<br />
Computerfestplatten gewinnen zwar ständig an<br />
Speicherplatz. <strong>Die</strong> Geschwindigkeit aber, mit <strong>der</strong> die Daten<br />
auf die rotierenden Magnetscheiben geschrieben werden,<br />
konnte in <strong>der</strong> Vergangenheit nur langsam gesteigert werden.<br />
Forscher um Professor Theo Rasing von <strong>der</strong> Universität<br />
Nijmegen entwickelten jetzt eine Methode, mit <strong>der</strong> sich die<br />
Daten optisch und so wesentlich schneller schreiben lassen.<br />
<strong>Die</strong> Schreib-Lese-Köpfe für konventionelle Festplatten<br />
bestehen aus winzigen Elektromagneten, die so angesteuert<br />
werden, dass ihr eigenes Magnetfeld die Magnetisierung des<br />
Speichermediums lokal verän<strong>der</strong>t. Ein Strompuls genügt, um<br />
ein magnetisches Bit von Null auf Eins umzuschalten und<br />
umgekehrt. Allerdings dauert dieser Vorgang typischerweise<br />
eine milliardstel Sekunde. Zu lange, um die wachsende<br />
Datenflut schnell zu archivieren. Aus diesem Grund setzen<br />
die Forscher auf Laserlicht. „Mit Lichtpulsen können wir den<br />
Fermentor<br />
Zuckerhaltige<br />
Abfälle<br />
in Wasser<br />
gelöst<br />
Motor<br />
Beschleuniger <strong>der</strong> IT-Gesellschaft:<br />
die optische Festplatte<br />
Bakterien Kohlenwasserstoffe<br />
CxHx Öl schwimmt<br />
auf <strong>der</strong><br />
Oberfläche<br />
Rotor<br />
Schreibvorgang drastisch beschleunigen“,<br />
sagt Rasing. „Wir benutzen<br />
infrarote Laserpulse, die 40 Femtosekunden<br />
dauern, um ein magnetisches Bit<br />
umzuschalten.“ Der Speicherprozess läuft damit<br />
rund eine Million Mal schneller ab als bei elektromagnetischen<br />
Schreib-Lese-Geräten üblich.<br />
Welcher physikalische Effekt das Tempo ermöglicht,<br />
wissen die Forscher noch nicht. Normalerweise reagieren<br />
Magnete nicht auf optische Reize; vermutlich spielen deshalb<br />
Streuprozesse eine wichtige Rolle. Auch in puncto Platz<br />
bleibt Forschungsbedarf. Denn um Speicherdichten wie bei<br />
heutigen Festplatten zu erzielen, müssten die Forscher kleinere<br />
Sektoren im Speichermedium ansteuern können als<br />
heute möglich. Frühestens in fünf Jahren, so Rasing, werden<br />
daher die ersten Optikfestplatten auf den Markt kommen.<br />
benzin aus bakterien<br />
Erneuerbare Biokraftstoffe sind die Hoffnungsträger <strong>der</strong> Industriegesellschaft.<br />
Neuland betritt hier momentan das kalifornische Start-up<br />
LS9. Das Unternehmen will Benzin, <strong>Die</strong>sel o<strong>der</strong> Kerosin mithilfe von<br />
genetisch verän<strong>der</strong>ten Bakterien aus Biomasse herstellen. Im Jahr 2005<br />
gründeten die Wissenschaftler Chris Somerville und George Church ihr<br />
Unternehmen, mit <strong>der</strong> Idee, das Erbgut von Bakterien so zu ergänzen,<br />
dass sie zuckerhaltige Abfälle zu Kraftstoffen verarbeiten. Sie pflanzten<br />
den Mikroorganismen Gene an<strong>der</strong>er Pflanzen und Kleinsttiere ein,<br />
aber auch künstlich erzeugte DNA-Stränge – mit Erfolg: <strong>Die</strong> Kohlenwasserstoffe,<br />
die die Bakterien produzieren, sind energiereicher als<br />
Ethanol o<strong>der</strong> Butanol und in ihren physikalisch-chemischen Eigenschaften<br />
von den Ölprodukten, die sie ersetzen sollen, nicht zu unterscheiden.<br />
Noch steht LS9 allerdings ebenso am Anfang wie die Wissenschaftsdisziplin<br />
<strong>der</strong> „synthetischen Biologie“, die dem Verfahren zugrunde<br />
liegt. Einen weltweit beachteten Auftritt hatten die LS9-Macher allerdings<br />
schon, Ende Januar im schweizerischen Davos. Dort durften sie<br />
sich im Rahmen des Weltwirtschaftsforums präsentieren – als offizieller<br />
„Technologie-Pionier des Jahres 2008“.<br />
45
p business-culture<br />
46<br />
Aufwärts dank Gesetz<br />
Es ist eine Revolution von oben: Zu 40 Prozent muss ein Board of Directors in Norwegen künftig weiblich<br />
sein. Doch führen Quoten wirklich zu mehr Gerechtigkeit – und sind sie gut für die Unternehmen?<br />
: Post von <strong>der</strong> Regierung erhielten zwölf<br />
norwegische Firmen im Februar. Sie wurden<br />
abgemahnt – weil in ihrem Board of<br />
Directors kaum Frauen saßen. Denn seit<br />
2008 ist in Norwegen eine Frauenquote von<br />
40 Prozent im Leitungsgremium von Aktiengesellschaften<br />
(ASA) verbindlich. In diesem<br />
sind Funktionen von Vorstand und Aufsichtsrat<br />
vereint. Können die AGs die Auflagen<br />
nicht erfüllen, drohen Strafen bis hin zur<br />
Auflösung. Nachdem freiwillige Initiativen<br />
<strong>der</strong> Wirtschaft die gewünschte Geschlechterbalance<br />
nicht erreichten, wurde das Gesetz<br />
im Januar 2006 eingeführt. Zur Umsetzung<br />
hatten Unternehmen dann zwei Jahre Zeit.<br />
<strong>Die</strong> meisten <strong>der</strong> rund 500 vom Gesetz betroffenen<br />
Aktiengesellschaften realisierten die<br />
Bestimmungen fristgerecht.<br />
Gleichberechtigung zählt viel in Norwegen.<br />
Dennoch wäre dem Unternehmensverband<br />
NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon)<br />
ein Gesetzesverzicht lieber gewesen. „Wir<br />
hätten eine freiwillige Lösung bevorzugt“,<br />
sagt Kari Mæland, die beim NHO das<br />
Projekt „Female Future“ leitet. Mit <strong>der</strong> Initiative<br />
möchte <strong>der</strong> Verband mehr Frauen in<br />
Spitzenpositionen bringen. Resonanz ist<br />
durchaus da. Allein seit 2006 haben nahezu<br />
500 Frauen die Managementkurse von<br />
Female Future besucht, die Hälfte von ihnen<br />
erhielt daraufhin einen Sitz im Führungsorgan.<br />
Innerhalb von zwei Jahren stieg <strong>der</strong><br />
Frauenanteil in norwegischen Boards von<br />
19 auf 34 Prozent. Das Gesetz, so gesteht<br />
Mæland ein, hat den Aufstieg <strong>der</strong> Frauen ins<br />
Topmanagement sehr beschleunigt.<br />
Auch Hege Gunnerud, eine <strong>der</strong> Absolventinnen<br />
<strong>der</strong> NHO-Kurse, sieht das Gesetz ambivalent.<br />
„Ich bin gegen Quoten, aber manchmal<br />
sind sie nötig, um Dinge zu beschleunigen“,<br />
sagt sie. Sie verantwortet bei dem Planenhersteller<br />
Protan den Bereich Technical<br />
Services. Neben ihrer Position in <strong>der</strong> Protan-<br />
Führung erhielt sie nach dem Karriereprogramm<br />
auch einen Sitz im Board <strong>der</strong> Hafenverwaltung<br />
von Drammen. „Freiwillige<br />
Lösungen benötigen viel mehr Zeit, und ich<br />
persönlich hätte das einer Quotenregelung<br />
vorgezogen“, erklärt Gunnerud. „Kluge<br />
Frauen und Netzwerke hätten mit <strong>der</strong> Zeit<br />
selbst bewiesen, dass Frauen auch in Spitzenjobs<br />
eine starke Leistung bringen.“<br />
Und die Frauen in Norwegen greifen an.<br />
Nicht nur im Manageralltag. „An den Uni
GUY CRAWFORD,<br />
CEO Jumeirah Group, Dubai:<br />
„Ich glaube nicht an einen spezifisch weiblichen<br />
Managementansatz. Was zählt, ist Talent<br />
und Einsatz. Der bestqualifizierte Bewerber<br />
bekommt den Job – ganz gleich, ob Frau o<strong>der</strong><br />
Mann. Unser Mitarbeiterstamm setzt sich aus<br />
über 100 verschiedenen Nationalitäten zusammen<br />
– da hat ohnehin je<strong>der</strong> eine etwas an<strong>der</strong>e<br />
Vorstellung von gutem Management. <strong>Die</strong>ser<br />
kulturelle Reichtum trägt zu unserer Stärke als<br />
<strong>Die</strong>nstleistungsunternehmen bei. Unser Ziel ist<br />
es, in allen Bereichen und auf allen Hierarchieebenen<br />
ein ausgewogenes Verhältnis <strong>der</strong><br />
Geschlechter und <strong>der</strong> Nationalitäten zu schaffen.<br />
Derzeit liegt <strong>der</strong> Frauenanteil im Management<br />
<strong>der</strong> Jumeirah Group bei 33 Prozent. Im<br />
Jahr 2006 haben wir die Position eines Director<br />
of Talent geschaffen, um gezielt Nachwuchs<br />
bei<strong>der</strong>lei Geschlechts aus den eigenen Reihen<br />
zu för<strong>der</strong>n. Unser Fast Track Career Management<br />
Program ASPIRO steht beson<strong>der</strong>s talentiertem<br />
Nachwuchs offen. Derzeit sind unter<br />
den sieben <strong>Corporate</strong> Trainees zwei Frauen.<br />
<strong>Die</strong>se jungen Talente sind unsere Führungskräfte<br />
von morgen.“<br />
versitäten im Land sind die Frauen heute<br />
deutlich in <strong>der</strong> Mehrheit“, sagt Mæland, „es<br />
wäre eine Verschwendung von Talent, wenn<br />
wir dieses Potenzial nicht nutzen würden.“<br />
So argumentiert auch die Regierung – und<br />
steht damit nicht alleine da. Laut einer<br />
Untersuchung von Catalyst, einer internationalen<br />
Non-Profit-Organisation, die sich für<br />
Frauen im Wirtschaftsleben einsetzt, erreichen<br />
Unternehmen mit mehr als drei Frauen<br />
in einem Top-Leitungskomitee deutlich<br />
höhere Gewinne als Firmen mit C-Level-<br />
Gremien, die nur von Männern besetzt sind.<br />
<strong>Die</strong> Studie verglich dazu Eigenkapitalrendite,<br />
Gewinnspanne und den Ertrag des investierten<br />
Kapitals von Unternehmen mit<br />
hohem und niedrigem Frauenanteil im<br />
Management. Dabei erreichten die Wettbe-<br />
YU SHUMIN,<br />
CEO Hisense Group, China:<br />
„Der Weg auf <strong>der</strong> Karriereleiter ist für Frauen in<br />
China beson<strong>der</strong>s weit. Aber ich glaube, dass<br />
<strong>der</strong> Aufstieg in Zukunft einfacher wird.<br />
In <strong>der</strong> obersten Führungsebene, die überwiegend<br />
aus Männern besteht, sind Frauen in <strong>der</strong><br />
Regel beständiger und beharrlicher. Sie sind<br />
aufmerksam und an<strong>der</strong>en gegenüber aufgeschlossen,<br />
sie achten mehr auf Details und<br />
sind oft perfektionistisch. <strong>Die</strong> Koexistenz von<br />
Entschlossenheit und Einfühlsamkeit ist<br />
charakteristisch für weibliche Führung. Selbstvertrauen<br />
und Selbstermutigung sind die<br />
Schlüssel zu ihrem Erfolg.<br />
Immer mehr Frauen übernehmen die Funktion<br />
von Stellvertretern, während die Leitungspositionen<br />
weiter von Männern bekleidet werden. In<br />
<strong>der</strong> Politik haben Frauen 1,7 Prozent <strong>der</strong> leitenden<br />
Funktionen in Ministerien o<strong>der</strong> Provinzen<br />
inne, bei Hisense sind 40 Prozent <strong>der</strong> Angestellten<br />
und 20 Prozent <strong>der</strong> Manager Frauen.<br />
Um Frauen das Arbeiten zu erleichtern, haben<br />
wir Konzepte für eine bessere Vereinbarkeit<br />
von Beruf und Familie eingeführt, dazu gehören<br />
auch bezahlte Urlaubszeiten.”<br />
werber mit dem höchsten Frauenanteil eine<br />
um bis zu 53 Prozent höhere Rendite als<br />
diejenigen mit den niedrigsten Quoten an<br />
weiblichen Führungskräften. Zahlreiche<br />
an<strong>der</strong>e Erhebungen kommen zu ähnlichen<br />
Ergebnissen.<br />
VIELE SETZTEN AUF FREIWILLIGKEIT – ABER<br />
ERST DAS GESETZ BRACHTE FORTSCHRITTE<br />
Resultate in dieser Deutlichkeit kann Professor<br />
Morten Huse, Leiter des Center for<br />
Boards and Governance <strong>der</strong> Norwegian<br />
School of Management, mit seiner eigenen<br />
Forschung zwar nicht vorweisen. Aber auch<br />
er bestätigt die positiven Auswirkungen von<br />
Frauen an <strong>der</strong> Spitze. „Sie tragen entscheidend<br />
zur Vielfalt in Führungsgremien bei.“<br />
HANS STRÅBERG,<br />
CEO Electrolux, Schweden:<br />
„Bei uns sind Frauen immer in den Auswahlverfahren<br />
für alle Führungspositionen vertreten.<br />
Allein in unserer Geschäftsführungsebene sind<br />
drei von elf Mitglie<strong>der</strong>n Frauen. Im Jahre 2007<br />
waren ungefähr 29 Prozent <strong>der</strong> Teilnehmer<br />
unserer Management-Ausbildungsprogramme<br />
Frauen. Der Vorstand von Electrolux setzt sich<br />
zu einem Drittel aus Frauen zusammen und<br />
gehört damit zu den schwedischen Unternehmen<br />
mit dem höchsten Frauenanteil im Vorstand.<br />
Da überrascht es nicht, dass ich für die<br />
För<strong>der</strong>ung von Frauen bin. Allerdings bin ich<br />
gegen Quoten. Zum Beispiel führt <strong>der</strong> Druck in<br />
Schweden, Frauen in die Vorstandsebene berufen<br />
zu müssen, dazu, dass Managerinnen ihre<br />
Posten im Betriebsablauf aufgaben, um Ausschussmitglie<strong>der</strong><br />
zu werden. <strong>Die</strong>s könnte die<br />
Anzahl an Frauen im operativen Prozess verringern.<br />
Dabei ist Electrolux noch in einer guten<br />
Position. Wir haben uns von einer Industrieorganisation<br />
zu einem verbraucherorientierten<br />
Vertriebsunternehmen gewandelt, was dazu<br />
führte, dass mehr Frauen zu uns kommen. <strong>Die</strong>ser<br />
Trend, so hoffe ich, setzt sich fort.”<br />
Frauen hätten hohe soziale Kompetenzen<br />
und schafften ein gutes Arbeitsklima. In<br />
Entscheidungsprozessen achteten sie stärker<br />
auf die Qualität <strong>der</strong> Entscheidungen,<br />
wogegen es bei Männern oft heißt: Hauptsache,<br />
Entscheidung gefällt. Außerdem seien<br />
Frauen oft besser vorbereitet.<br />
Für Huse macht allerdings vor allem die<br />
Vielfalt aller Mitglie<strong>der</strong> die Qualität eines<br />
Boards aus. Dabei zähle Persönlichkeit mehr<br />
als das Geschlecht. „Ich glaube, es gibt<br />
größere Unterschiede innerhalb eines Geschlechts<br />
als zwischen Frau und Mann.“<br />
Dennoch befürwortet auch er das Gesetz.<br />
„Vorher gab es eine Menge freiwilliger Versuche,<br />
aber es hat sich nichts geän<strong>der</strong>t.“ Das<br />
Gesetz habe zur Entwicklung wertschaffen<strong>der</strong><br />
Vorstände beigetragen..<br />
47
p business-culture<br />
48<br />
BUSINESS IM BILD<br />
Was treibt die guten Unternehmer?<br />
Rachel Sterne ist ein „Social Entrepreneur“. Wie sie versuchen immer mehr junge Menschen, die<br />
Welt mit innovativen Projekten zu verän<strong>der</strong>n. Was dahintersteckt, erklärt Rachel Sterne in diesem<br />
Gastbeitrag. Punkt eins: Je<strong>der</strong> innovative Prozess beginnt mit den richtigen Fragen.<br />
: Sozialunternehmer sind teils Aktivist, teils<br />
Erneuerer und versuchen, gesellschaftliche<br />
Probleme mit neuen Ideen zu lösen.<br />
Dahinter steht die Logik von Albert Einsteins<br />
Behauptung, dass man Probleme „niemals<br />
mit <strong>der</strong>selben Denkweise lösen kann,<br />
durch die sie entstanden sind“. Wie Unternehmer<br />
setzen sich Social Entrepreneurs<br />
leidenschaftlich für ihre Ideen ein, allerdings<br />
mit an<strong>der</strong>en Zielen. Für sie besteht <strong>der</strong><br />
Erfolg in anpassbaren und nachhaltigen globalen<br />
Verän<strong>der</strong>ungen, während Wirtschaftsunternehmer<br />
nach Profiten streben.<br />
Das institutionalisierte Sozialunternehmertum<br />
ist in den vergangenen Jahren gewaltig<br />
gewachsen, und Unternehmen wie Ashoka<br />
und Echoing Green verzeichnen einen<br />
Rekordzulauf. Wichtiger Anstoß war <strong>der</strong><br />
Friedensnobelpreis 2006 für Muhammad<br />
Yunus und seine Arbeit mit Kleinstkrediten.<br />
Meine ersten Erfahrungen mit dem sozialen<br />
Unternehmertum sammelte ich als 20-jährige<br />
Praktikantin des US-Außenministeriums.<br />
Frustriert von eigennützigen Bestrebungen<br />
und Bürokratie, entschied ich mich für eine<br />
Karriere als Unternehmensentwicklerin im<br />
Technologiesektor. Doch auch das erfüllte<br />
mich nicht, eskalierende globale Krisen<br />
ließen mich nicht zur Ruhe kommen. Hing<br />
nicht alles miteinan<strong>der</strong> zusammen?<br />
Aufgrund mangelnden öffentlichen Drucks<br />
konnten sich Staaten aus <strong>der</strong> Verantwortung<br />
in internationalen Stabilitätsfragen stehlen.<br />
Wenn man mit Technologie stärker auf Probleme<br />
aufmerksam machen könnte, würden<br />
besser informierte Bürger dann nicht grundlegende<br />
außenpolitische Än<strong>der</strong>ungen bewir-<br />
Rachel Sterne ist Grün<strong>der</strong>in <strong>der</strong> demokratischen Newsplattform<br />
GroundReport. Sie beschreibt, was sie und<br />
an<strong>der</strong>e Social Entrepreneurs antreibt.<br />
ken? <strong>Die</strong>se Überlegungen ließen mich<br />
GroundReport.com gründen (siehe Seite 51).<br />
Im September 2007 nahm ich mit elf Gleichgesinnten<br />
an einem inspirierenden Programm<br />
des Waldzell Institute mit dem Titel<br />
„Architekten <strong>der</strong> Zukunft“ teil. <strong>Die</strong>ser Workshop<br />
eröffnete mir ein völlig neues Verständnis<br />
von sozialem Unternehmertum. Was<br />
einen Sozialunternehmer auszeichnet, ist<br />
nicht die Fähigkeit, Antworten zu geben, son<strong>der</strong>n<br />
<strong>der</strong> Mut, Fragen zu stellen. Als die jungen<br />
Social Entrepreneurs im Raum umhergingen<br />
und von ihren Anfängen erzählten,<br />
stellte sich heraus, dass sie alle eines gemeinsam<br />
hatten: Immer begann es mit einer<br />
Frage. Es ist diese Frage, die den Unterschied<br />
macht, die Einsicht, dass es sich um ein Pro-<br />
blem handelt, das alle angeht und das daher<br />
von allen – gemeinsam – gelöst werden muss.<br />
Das bringt uns wie<strong>der</strong> zu Einstein und <strong>der</strong><br />
Erkenntnis, dass wir das Problem „geschaffen“<br />
haben und keine fremde Macht.<br />
Der Privatsektor könnte vom leidenschaftlichen<br />
Engagement des Sozialunternehmers<br />
für einen höheren Zweck profitieren, denn<br />
dieses könnte Ordnung in das Chaos bringen<br />
und zu einer Kultur des Respekts und <strong>der</strong><br />
Zweckmäßigkeit führen. Das soziale Unternehmertum<br />
ist aber kein Allheilmittel und<br />
muss sich den Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> Geschäftswelt<br />
stellen. Ein brillanter Innovator<br />
ist nicht immer auch ein erfolgreicher Manager.<br />
Mitunter ist es schwer, das Ziel nicht aus<br />
den Augen zu verlieren. Wie bei allen unternehmerischen<br />
Unterfangen gehen auch Sozialunternehmen<br />
ein kalkuliertes Risiko ein,<br />
und die meisten ihrer Bemühungen scheitern.<br />
Das ist aber gut so. Erfolgreiche Unternehmer<br />
respektieren das Überleben des Stärkeren<br />
und verstehen es als Teil ihrer Entwicklung.<br />
Sie wissen, dass die kühne Frage nur<br />
den Anfang bildet. Wir müssen stets ein Ohr<br />
für diese Fragen haben – und entsprechend<br />
reagieren. Wenn wir die Verantwortung für<br />
das Problem übernehmen und unsere Denkweise<br />
umgestellt haben, können wir uns<br />
dem Teil widmen, <strong>der</strong> Spaß macht – dem<br />
Finden einer Lösung.<br />
Überall auf dem Planeten verwirklichen Sozialunternehmer<br />
gute Ideen für eine bessere Welt.<br />
Auf den nächsten Seiten stellt think:act einige<br />
<strong>der</strong> interessantesten Projekte vor.
[Gisha]<br />
ÜBER GRENZEN HINWEG<br />
<strong>Die</strong> in den USA geborene Israelin Sari Bashi ist Grün<strong>der</strong>in <strong>der</strong> Initiative Gisha. Hauptanliegen<br />
des Projekts ist die uneingeschränkte Bewegung von Menschen und Waren über die<br />
israelisch-palästinensische Grenze. <strong>Die</strong>s bedeutet den Zugang zu Ressourcen und för<strong>der</strong>t<br />
damit die Entwicklung <strong>der</strong> palästinensischen Gesellschaft. Gisha ist das hebräische Wort<br />
für „Zutritt“ und stellt Berichte von Palästinensern ins Netz, die den Aufbau einer gesunden<br />
Gesellschaft för<strong>der</strong>n. Antrieb für Bashi sind die Verantwortung den palästinensischen<br />
Nachbarn gegenüber und <strong>der</strong> Wunsch, „den Menschenrechten Geltung zu verschaffen“.<br />
www.gisha.org, E-Mail: sari@gisha.org<br />
49
p business-culture<br />
50<br />
[Be!]<br />
UNTERNEHMERGEIST IN JUNGEN INDERN ENTWICKELN<br />
Lisa Heydlauff ist Grün<strong>der</strong>in von Be!, einem Projekt <strong>der</strong> in Neu-Delhi ansässigen gemeinnützigen<br />
Organisation „Going To School“. <strong>Die</strong> Initiative entwickelt kreative Medien, um<br />
unterprivilegierten Kin<strong>der</strong>n und Jugendlichen in Indien den Schulbesuch schmackhaft zu<br />
machen und sie zur Gründung von Unternehmen zu motivieren, die den sozialen Wandel<br />
herbeiführen. Mit Anschauungsmaterial bringt Be! ihnen das Einmaleins des Unternehmertums<br />
bei. Wer die Voraussetzungen erfüllt, erhält vom Be! Entrepreneurial Fund eine<br />
finanzielle Starthilfe als Seed-Capital zur Unternehmensgründung.<br />
www.goingtoschool.com/be!.html, E-Mail: lisa@goingtoschool.com
[GroundReport]<br />
DEMOKRATIE IN DIE MEDIEN BRINGEN<br />
Nachrichten demokratisch verbreiten – das will Rachel Sterne mit GroundReport.com.<br />
In dem Internetportal können Menschen aus aller Welt Artikel, Fotos und Videos veröffentlichen,<br />
die von Webnutzern gesehen und gelesen werden. Als finanziellen Anreiz<br />
bezahlt GroundReport alle Autoren nach <strong>der</strong> Menge des Datenverkehrs zu ihren Einträgen.<br />
GroundReport trägt sich durch Einnahmen aus gezielter Werbung. Anliegen des auftragsgestützten<br />
Profitunternehmens GroundReport ist die Demokratisierung <strong>der</strong> Medien durch<br />
Umgehung <strong>der</strong> Zensur und infrastruktureller Einschränkungen.<br />
www.groundreport.com, E-Mail: rachel@groundreport.com<br />
51
52<br />
HILFE DURCH BÜHNENKUNST<br />
Hua Dan wurde 2004 von Caroline Watson, einer in Hongkong geborenen Britin mit Erfahrungen<br />
in <strong>der</strong> Theaterwelt, in Peking gegründet. Das soziale Unternehmen Hua Dan setzt in<br />
China Theater und an<strong>der</strong>e kreative Künste für das „persönliche, soziale und wirtschaftliche<br />
Empowerment“ <strong>der</strong> Teilnehmenden ein. Eine beson<strong>der</strong>e Zielgruppe ist die wachsende Bevölkerungsschicht<br />
<strong>der</strong> Wan<strong>der</strong>arbeiter. Hua Dan entwickelt ein nachhaltiges soziales Unternehmensmodell,<br />
das den Mitarbeitern multinationaler Konzerne kreative Ausbildungsmöglichkeiten<br />
anbietet und so die gemeinnützige Arbeit <strong>der</strong> Organisation finanziert.<br />
www.hua-dan.org, E-Mail: info@hua-dan.org<br />
[Hua Dan]
[Black Tent]<br />
EINE 5000 JAHRE ALTE ERFINDUNG<br />
<strong>Die</strong> in Österreich von Kristina Ambrosch gegründete Forschungsorganisation Black Tent<br />
dokumentiert die wissenschaftliche und historische Bedeutung des Schwarzzelts. <strong>Die</strong>se<br />
Erfindung <strong>der</strong> Nomadenstämme im Nahen Osten und Nordafrika gibt es seit 5000 Jahren.<br />
Zwischen globaler Klimakrise und dem Schutz einheimischer Kulturen hofft die Organisation,<br />
energiesparende Lösungen zur Temperaturregulierung zu finden, die auf den natürlichen<br />
Kühlungseigenschaften des Schwarzzelts beruhen. Black Tent arbeitet gegenwärtig<br />
an einem Dokumentarfilm über die Arbeit <strong>der</strong> Organisation.<br />
www.blacktent.at, E-Mail: research@blacktent.at<br />
business-culture f<br />
53
p business-culture<br />
54<br />
[Mercado Global]<br />
HILFE FÜR LANDFRAUEN<br />
<strong>Die</strong> Non-Profit-Organisation Mercado Global wurde 2002 von Ruth DeGolia (rechts) und<br />
Benita Singh gegründet und hilft wirtschaftlich benachteiligten Frauen in ländlichen Gebieten<br />
Lateinamerikas, ihre Produkte in den USA zu verkaufen. <strong>Die</strong>s ist ein erster Schritt,<br />
um sich und ihre Familien aus <strong>der</strong> Armut zu befreien, neue Fertigkeiten zu erwerben<br />
und Unterstützung zu finden. Mercado Global hilft den Frauen bei ihrer Handwerksausbildung,<br />
bei Produktdesign und Logistik. Gleichzeitig arbeitet Mercado Global mit US-Unternehmen<br />
zusammen, damit diese die Produkte direkt von den Frauen beziehen.<br />
www.mercadoglobal.org, E-Mail: ruth@mercadoglobal.org
[Namaa]<br />
DIE LÜCKE SCHLIESSEN<br />
Weil vielen jungen Leuten, die Interesse an <strong>der</strong> Mitarbeit im Non-Profit-Sektor zeigen, die<br />
notwendige Ausbildung fehlt, gründet Ola Shahba in Kairo die Organisation Namaa Association<br />
for Sustainable Development. Namaa will die Chancen von Bewerbern für Jobs im<br />
Entwicklungssektor verbessern und die Lücke zwischen dem Personalbedarf von Nichtregierungsorganisationen<br />
und dem vorhandenen Talente- und Fachkräftepool schließen.<br />
Im Mittelpunkt <strong>der</strong> Arbeit stehen die nationale Entwicklung und <strong>der</strong> internationale Dialog<br />
als Instrumente zum Brückenschlag.<br />
www.nahdetmasr.org/namaa, E-Mail: olashahba@gmail.com<br />
55
56<br />
<strong>Die</strong>bstahl am helllichten Tag<br />
Ein Geschäft ohne Preisschil<strong>der</strong>, Kassen o<strong>der</strong> zahlende Kunden – ökonomischer Wahnsinn?<br />
Nein, glauben japanische Trendforscher. Sie sehen im „Tryvertising“ vielmehr die Zukunft des<br />
Marketings. David McNeill berichtet für think:act aus Tokio.<br />
: Auf den ersten Blick sieht im Sample Lab<br />
alles ganz normal aus: Produkte hier,<br />
interessierte Kunden da und zwischendrin<br />
das höfliche, tadellos gestylte Personal, das<br />
so typisch ist für den Einzelhandel in Japan.<br />
Doch auf den zweiten Blick fallen merkwürdige<br />
Details auf. <strong>Die</strong> meisten Produkte<br />
haben keine Preisschil<strong>der</strong>. Auch Kassen<br />
sucht man vergeblich. Und anstatt Konsumenten<br />
zu beraten, scheint das Personal<br />
eher die Flucht zu ergreifen. Das Merkwürdigste<br />
ist jedoch, dass die Kunden nicht<br />
bezahlen müssen.<br />
Ein Geschäft, das Produkte verschenkt?<br />
Hört sich nicht gerade lukrativ an. Doch das<br />
Ganze ist ein riesiger Erfolg, behauptet<br />
jedenfalls Melposnet, <strong>der</strong> Betreiber des<br />
Shops Sample Lab. „Wir denken darüber<br />
nach, ins Franchisegeschäft einzusteigen“,<br />
erklärt Präsident Takahiro Kono. „Aus aller<br />
Welt erhalten wir Anfragen, ob man die<br />
Sample-Lab-Idee nutzen könne.“<br />
Kono denkt darüber nach – aus gutem Grund.<br />
Seit Eröffnung des Geschäfts im vergangenen<br />
Juli haben mehr als 50 000 Besucher<br />
Produkte wie Sake o<strong>der</strong> Nylonstrumpfhosen<br />
gratis aus dem Laden geschleppt. Melposnet<br />
verdient trotzdem. Das Unternehmen ist<br />
eine Marketingagentur, die für Konsumgüterhersteller<br />
dem Feedback von Käufern<br />
nachspürt.<br />
<strong>Die</strong> müssen, wollen sie Sample Lab nutzen,<br />
dort Mitglied werden und bei jedem Shoppingbesuch<br />
Fragebögen zu den Produkten<br />
ausfüllen, von denen sich dann die Produzenten<br />
tiefe Einblicke in die Kundenwünsche<br />
erhoffen. „Das System nennt sich ‚Tryvertising‘<br />
und könnte zum Marketingtrend<br />
<strong>der</strong> Zukunft werden“, meint Kono. „Das<br />
Marketing muss mehr auf die Verbraucher<br />
reagieren. Bisher ging es meistens nur<br />
darum, die Produkte an die Verbraucher zu<br />
bringen. Wir müssen aber mehr von ihnen<br />
erfahren, wollen wissen, was ihnen gefällt.<br />
Wir möchten weniger Push und stattdessen<br />
mehr Pull, mehr Überzeugung.“<br />
Wie funktioniert das System genau? Neukunden<br />
zahlen eine Jahresgebühr von 1000 Yen<br />
und eine Einstiegspauschale von 300 Yen. Sie<br />
müssen mindestens 15 Jahre alt sein, Japanisch<br />
lesen können und ein Mobiltelefon<br />
besitzen. Werden Sie Lab-Mitglied, erhalten<br />
sie einen zweidimensionalen Barcode auf ihr<br />
Handy, <strong>der</strong> sie im Geschäft identifiziert.<br />
Wer dann gratis einkaufen möchte, braucht<br />
etwas Geduld. Denn nur siebenmal am Tag<br />
gibt es die kostenlosen Kaufrunden. Anfänglich<br />
dürfen maximal fünf Artikel gleichzeitig<br />
im Austausch gegen Kundenmeinung mitgenommen<br />
werden. Das Feedback wird nach<br />
einem Punktesystem belohnt. Wer genügend<br />
Punkte gesammelt hat und häufig kommt,<br />
kann bis zu zehn Produktproben pro Besuch<br />
mitnehmen. Kono ist davon überzeugt, dass<br />
die Sample-Lab-Methode <strong>der</strong> nächste logische<br />
Entwicklungsschritt im Verkauf ist. „Es
Oben: Testkäufer wählen aus dem Regal ein Produkt aus, das sie interessiert. Vor allem junge Frauen sind von dem<br />
Free-Shopping-Konzept begeistert. Unten: <strong>Die</strong> Idee stammt von Takahiro Kono, dem Präsidenten von Sample Lab, <strong>der</strong><br />
das Konzept weltweit einführen möchte. Junge Frauen sind die primäre Zielgruppe dieser Marketinginnovation.<br />
ist doch ganz normal, dass Menschen etwas<br />
ausprobieren möchten, bevor sie es kaufen.<br />
<strong>Die</strong>se Chance bieten wir.“<br />
<strong>Die</strong> Antwortrate für Produkte mit Fragenbögen<br />
liegt nach Angaben von Melposnet bei<br />
90 Prozent. „Ganz wichtig ist es jedoch, erst<br />
einmal Begeisterung für die neuen Produkte<br />
zu wecken“, sagt Manager Erika Awata.<br />
„Deshalb haben die meisten Artikel keine<br />
Fragebögen. <strong>Die</strong> Unternehmen vertrauen<br />
darauf, dass ihr Produkt durch Mundpropaganda<br />
und Weblogs bekannt gemacht wird.<br />
Vor allem die Mitglie<strong>der</strong> <strong>der</strong> wichtigen Konsumentengruppe<br />
<strong>der</strong> jungen Frauen erzählen<br />
einan<strong>der</strong> gern, was ihnen gefällt.“<br />
IM ERSTEN SCHRITT IST ES WICHTIG, NEUGIER<br />
BEI DEN TESTKUNDEN ZU WECKEN UND<br />
NICHT MIT FRAGEBÖGEN ABZUSCHRECKEN<br />
Vor allem Kosmetika, Nahrungsmittel und<br />
Getränke wie grüner Tee, Honig, Barbecue-<br />
Soße o<strong>der</strong> Zigaretten finden sich in den<br />
Ladenregalen. Einige Produkte sind völlig<br />
neu und noch nicht erhältlich, an<strong>der</strong>e sind<br />
nicht teurer als 1000 Yen, manche kosten<br />
dagegen mehr, etwa die Feuchtigkeitscreme<br />
für 11550 Yen.<br />
Melposnet rechnet mit den Herstellern nach<br />
Regalplatz ab. Der Preis ist von <strong>der</strong> Höhe und<br />
Größe <strong>der</strong> Stellfläche abhängig: Ganz oben<br />
ist die Regalfläche zum Preis von 300 000 Yen<br />
für zwölf Tage zu haben. Eine Platzierung in<br />
Augenhöhe kostet 350 000 Yen, im Bodenregal<br />
200 000 Yen. <strong>Die</strong> Kosten für Werbeplätze<br />
in den Fernsehmonitoren des Geschäfts reichen<br />
von 30 000 Yen für eine halbe Minute bis<br />
zu 100 000 Yen für einen 180-Sekunden-Spot.<br />
Marketingexperten überzeugt die Sample-<br />
Lab-Taktik. „Bei <strong>der</strong> Ausgabe von Gratisproben<br />
kommt es vor allem darauf an, dass die<br />
Kunden kommen und sich das nehmen, was<br />
sie wollen. Dadurch wird Sample Lab auf<br />
alle Fälle zur wirksamsten Form von Marketings“,<br />
sagt Akira Ishihara, <strong>der</strong> Grün<strong>der</strong> und<br />
Leiter <strong>der</strong> Denkfabrik Japan Institute for<br />
Management Education. Seiner Meinung<br />
nach macht dieses Geschäft die Grenzen des<br />
Internets deutlich. „<strong>Die</strong> Nutzung des Webs<br />
ist vielleicht kostengünstiger, doch Kunden<br />
möchten die Produkte in die Hand nehmen,<br />
direkt vor Ort und vor dem Kauf ausprobieren<br />
und nicht tagelang auf ihre Bestellung<br />
warten müssen.“ Das genau bietet ihnen das<br />
Einkaufslabor.<br />
Dessen Erfin<strong>der</strong> Kono arbeitete in <strong>der</strong> Kommunalverwaltung<br />
von Tokio, bevor er sein<br />
eigenes Logistik- und Speditionsunternehmen<br />
gründete und dabei das Direktmarketing<br />
kennenlernte. Dabei machte er die Erfahrung,<br />
so <strong>der</strong> japanische Marketingrevoluzzer,<br />
dass Kunden es nicht mögen, auf <strong>der</strong> Straße<br />
nach ihrer Meinung befragt zu werden.<br />
Ergo seien die Angaben oft ungenau und unzuverlässig.<br />
Nach dieser Beobachtung kam<br />
Kono die Idee zu Sample Lab.<br />
Dabei macht er es sich zunutze, dass viele<br />
japanische Unternehmen von jeher regelmäßig<br />
Produktproben ausgeben. Melposnet bat<br />
diese Hersteller um eine kontinuierliche<br />
Belieferung und bot ihnen im Gegenzug ein<br />
detailliertes Kundenfeedback an. Und die<br />
Kunden <strong>der</strong> Agentur wie die Nahrungsmittelkonzerne<br />
Nissin und P&G o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Elektronikriese<br />
Sony sehen ihren Vorteil. „Für<br />
business-culture f<br />
<strong>Die</strong>sen Beitrag können Sie auch<br />
auf unserer Audio-CD (Seite 63) hören.<br />
uns ist das sehr nützlich, denn wir können<br />
uns dadurch noch besser auf die Produktentwicklung<br />
für bestimmte Personengruppen<br />
konzentrieren, vor allem auf junge Frauen“,<br />
erläutert ein Sprecher des Kaffeegiganten<br />
UCC. Mehr als 80 Prozent <strong>der</strong> Sample-Lab-<br />
Kunden kommen aus dieser Käufergruppe.<br />
IM ZWEITEN SCHRITT FÜLLEN ÜBERZEUGTE<br />
LAB-SHOPPER DIE FRAGEBÖGEN ZU<br />
NOCH NICHT KÄUFLICHEN PRODUKTEN AUS<br />
Dass Melposnet Waren kostenlos abgibt,<br />
findet mancher selbst nach mehreren Besuchen<br />
immer noch überraschend. „Zu den<br />
meisten Sachen gibt es nicht einmal einen<br />
Fragebogen“, wun<strong>der</strong>t sich Yoko Hashitate,<br />
eine Studentin, die das Geschäft zum fünften<br />
Mal durchforstet. In ihrer Hand hält sie<br />
einen Korb mit einer Flasche Wasser, Dosenkaffee<br />
und Badesalz. „Man muss für nichts<br />
etwas bezahlen. Da ist doch bestimmt ein<br />
Trick dabei, o<strong>der</strong>?“<br />
Ja, und <strong>der</strong> heißt eben Bezahlung durch Informationen.<br />
Hat Kono damit ein Monster<br />
ins Leben gerufen? Könnte es sein, dass<br />
Sample Lab durch die Ausgabe von Gratisprodukten<br />
das traditionelle Marketing bei<br />
seiner Suche nach neuen und wirkungsvollen<br />
Mitteln in Wahrheit zerstört? „Wenn sich<br />
die Gesellschaft so verän<strong>der</strong>n würde, dass<br />
sich sehr viel mehr Leute nichts mehr leisten<br />
könnten, müssten wir uns tatsächlich Sorgen<br />
machen. Aber solange so viele Menschen<br />
dazu bereit und in <strong>der</strong> Lage sind, für Produkte<br />
auch zu bezahlen, sehe ich wirklich<br />
keinen Grund zur Sorge“, wehrt <strong>der</strong> Agenturchef<br />
solche Bedenken ab.<br />
Sample Lab, ein Beitrag zur Weiterentwicklung<br />
des Marketings? „Ja, natürlich“, so Kono.<br />
„Wir kombinieren einfach clever die Notwendigkeit,<br />
an verlässliche Daten über Kaufentscheidungen<br />
und Produkttrends zu kommen,<br />
mit dem Bedürfnis nach Konsum und<br />
<strong>der</strong> Neugier auf neue Produkte. Wir helfen<br />
also Produzenten und Konsumenten gleichzeitig.<br />
Mehr nicht!“ .<br />
57
p business-culture<br />
58<br />
WORK IN PROGRESS<br />
Im Zeichen <strong>der</strong> Wachstumsmärkte stehen viele <strong>Roland</strong>-<strong>Berger</strong>-Projekte in diesen Monaten.<br />
Fragen, denen die Berater nachgehen: Wie tickt <strong>der</strong> chinesische Konsument, wie mächtig ist<br />
Russland? Ein weiteres Thema ist die Zukunft <strong>der</strong> Pharmaindustrie.<br />
Verlockungen <strong>der</strong> Konsumkultur in Shanghai. Doch was wollen Chinas Konsumenten?<br />
WACHSTUMSMARKT<br />
China kennt man – aber wie<br />
ticken die Chinesen?<br />
Vom boomenden China reden alle. Nur <strong>der</strong><br />
chinesische Konsument stellt für viele Unternehmen<br />
noch ein ziemlich unbeschriebenes<br />
Blatt dar. Das will <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy<br />
Consultants nun än<strong>der</strong>n und führt daher<br />
die bisher größte Umfrage unter chinesischen<br />
Konsumenten durch. 11000 Menschen<br />
in den 65 größten Städten <strong>der</strong> Volksrepublik<br />
interviewten die Forscher zu ihrem Konsumverhalten.<br />
<strong>Die</strong> Untersuchung beleuchtet<br />
die Markenpräferenzen <strong>der</strong> Chinesen bei<br />
Finanzdienstleistern, Automobilherstellern,<br />
Reiseveranstaltern, Kosmetikprodukten und<br />
alkoholischen Getränken. Noch wichtiger<br />
aber: Sie liefert einen bisher gänzlich ungewohnten<br />
Einblick in die Lebens- und<br />
Arbeitsweisen <strong>der</strong> Chinesen. Damit können<br />
Unternehmen weltweit auf die Tatsache<br />
reagieren, dass Chinas Konsumenten, nicht<br />
zuletzt dank wachsen<strong>der</strong> Kaufkraft, inzwischen<br />
immer differenziertere Konsumentscheidungen<br />
treffen.<br />
Und diese Tendenz dürfte sich künftig<br />
noch verstärken. Denn während in <strong>der</strong> restlichen<br />
Welt die Rezessionsangst umgeht,<br />
wächst die chinesische Wirtschaft unbeeindruckt<br />
weiter, um 10,8 Prozent im zweiten<br />
Quartal des Jahres.<br />
Wie aber sehen europäische Unternehmen<br />
den Wachstumsmarkt im Reich <strong>der</strong> Mitte?<br />
Antworten darauf wird eine Umfrage liefern,<br />
die im November in Zusammenarbeit<br />
mit <strong>der</strong> europäischen Handelskammer in<br />
China veröffentlicht wird. Hun<strong>der</strong>te von Firmen<br />
nahmen im letzten Jahr an <strong>der</strong> Befragung<br />
teil. Sie äußerten sich durchaus auch<br />
kritisch. Vor allem die vielen bürokratischen<br />
Hürden, die sie in puncto Investitionen und<br />
Akquisitionen immer noch überwinden<br />
müssen, sorgen bei den Entschei<strong>der</strong>n nach<br />
wie vor für Unmut.<br />
STUDIE<br />
Service und Kooperation<br />
in <strong>der</strong> Pharmaindustrie<br />
Chancen und Herausfor<strong>der</strong>ungen <strong>der</strong> globalen<br />
Pharmaindustrie untersucht die jüngst<br />
erschienene Studie „Pharma at the Crossroads<br />
– Choosing Directions in a Transforming<br />
Healthcare World“. Darin analysieren<br />
<strong>Roland</strong>-<strong>Berger</strong>-Experten, wie die Pharmaindustrie<br />
ihre Geschäftsmodelle an Chancen<br />
und Risiken einer sich verän<strong>der</strong>nden Gesundheitswelt<br />
anpassen muss und anpasst.<br />
Pharmapartner Stephan Danner und sein<br />
Autorenteam haben Interviews mit führenden<br />
Pharmamanagern von über 30 Topunternehmen<br />
<strong>der</strong> Branche geführt. Und die<br />
zeigen sich durchaus optimistisch. <strong>Die</strong><br />
größten Zukunftschancen sehen die Befragten<br />
in <strong>der</strong> Expansion produzieren<strong>der</strong> Unternehmen<br />
durch mehr Serviceangebote –<br />
und in innovativen Kooperationsmodellen.<br />
Risiken liegen laut Studie vor allem im<br />
Markteintritt. Probleme bereitet auch <strong>der</strong><br />
zunehmende Preis- und Kostendruck. Als<br />
schwierigste Märkte weltweit gelten die<br />
USA und Europa.<br />
Gerade was den Markteintritt angeht, gibt<br />
es große Unterschiede zwischen den einzelnen<br />
Regionen. So gilt in den USA die Zulas-
sung als größte Hürde. In Europa und den<br />
BRIC-Staaten (Brasilien, Russland, Indien<br />
und China) bereitet vor allem die Preisfindung<br />
vielen Managern Kopfzerbrechen.<br />
<strong>Die</strong> Studie zeigt auch, wie Unternehmen mit<br />
diesen und weiteren Herausfor<strong>der</strong>ungen umgehen.<br />
Beispielsweise gilt die eigene Forschung<br />
und Entwicklung nach wie vor als<br />
die größte Innovationsquelle. Gleichzeitig<br />
finden aber auch an<strong>der</strong>e Formen wie In-<br />
Licensing o<strong>der</strong> Akquisition vermehrt Anklang.<br />
<strong>Die</strong> Ergebnisse zum Thema Profitabilität<br />
stehen dagegen in <strong>der</strong> Tradition bisheriger<br />
Kostensparprogramme: Hier bieten<br />
Marketing und Verkauf das größte Potenzial.<br />
Eher vorsichtig gehen die Unternehmen bisher<br />
mit dem Thema Outsourcing um. Lediglich<br />
Distribution und Logistik lagern mehr<br />
als die Hälfte <strong>der</strong> Befragten aus.<br />
RUSSLAND<br />
Hinter den Kulissen <strong>der</strong><br />
neuen, alten Supermacht<br />
Nach dem Zerfall <strong>der</strong> Sowjetunion war das<br />
einst mächtige Russland nur noch ein Schatten<br />
seiner selbst. Doch die politische und<br />
wirtschaftliche Schwächeperiode währte<br />
nur kurz. Vor allem sein Energiereichtum<br />
und die Abhängigkeit des Westens von<br />
russischen Ressourcen haben aus dem Land<br />
rasch wie<strong>der</strong> einen wichtigen Akteur auf<br />
dem internationalen Parkett gemacht.<br />
Doch wie mächtig ist Russland wirklich?<br />
<strong>Die</strong>ser Frage geht das zehnte Summernight<br />
Forschungslabor <strong>der</strong><br />
Firma Roche. In <strong>der</strong><br />
Pharmaindustrie<br />
herrscht alles in allem<br />
Optimismus.<br />
Symposium von <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy<br />
Consultants in Wien nach. Der österreichische<br />
Bundeskanzler Alfred Gusenbauer,<br />
Gulzhan Moldazhanova (Vorstandsvorsitzen<strong>der</strong>,<br />
Basic Element), Magna-International-<br />
Chef Siegfried Wolf und Fe<strong>der</strong>ico Ghizzoni<br />
(Vorstand, Bank Austria UniCredit Group)<br />
diskutieren mit Firmengrün<strong>der</strong> <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>.<br />
Anlässlich des Jubiläums gibt <strong>Roland</strong><br />
<strong>Berger</strong> Österreich auch eine Festschrift zum<br />
Thema heraus. 20 prominente Topmanager,<br />
Politiker und Journalisten – Russen wie<br />
Österreicher – reflektieren in ihren Beiträgen<br />
das Verhältnis Russlands zum Westen.<br />
Entstehen soll ein Russlandbild abseits von<br />
Klischees. Der rasant wachsende russische<br />
Markt bietet westlichen Unternehmen unzählige<br />
Chancen. Doch wer in dem Riesen-<br />
Russische Pipeline: Der Energiesektor gehört zu Russlands stärksten Branchen<br />
business-culture f<br />
reich investieren will, darf politische Spannungen,<br />
administrative und bürokratische<br />
Hürden sowie die auf allen Ebenen anzutreffende<br />
Korruption nicht ignorieren.<br />
Mehr Klarheit tut daher dringend not.<br />
Russland ist das größte Land <strong>der</strong> Welt, eine<br />
Nuklearmacht, ein Land mit erheblichem<br />
wirtschaftlichem Potenzial. Es hat fast<br />
150 Millionen Einwohner und ist ständiges<br />
Mitglied im UNO-Sicherheitsrat. An<strong>der</strong>erseits<br />
gibt es abseits von Energiesektor, Rüstungs-<br />
und Transportkomplex kaum einen<br />
Bereich, in dem Russland heute international<br />
konkurrenzfähig ist. In Schlüsselsektoren<br />
wie <strong>der</strong> IT- und <strong>der</strong> Automobilindustrie ist<br />
das Land auf den Weltmärkten nicht vertreten.<br />
Auch im Bildungs- und Kulturbereich<br />
liegt Russland nicht im Spitzenfeld.<br />
59
Keine Angst vor Afrika<br />
Vor zehn Jahren gründete Mohamed Ibrahim die Mobilfunkfirma Celtel. Inzwischen ist er ein<br />
Vorbild afrikanischen Unternehmertums – und <strong>der</strong> größte Spen<strong>der</strong> des Kontinents.<br />
:<br />
Der Mann liebt klare Worte: „Ich misstraue<br />
<strong>der</strong> Wohltätigkeit“, sagt Mohamed<br />
Ibrahim. Er sagt das so freundlich, dass ihm<br />
das Publikum seine Provokation nicht übel<br />
nimmt. Dabei lauschen an diesem Abend<br />
vor allem Leute, die von <strong>der</strong> Entwicklungspolitik,<br />
also vom Geschäft mit <strong>der</strong> Wohltätigkeit<br />
leben. Mo Ibrahim ist ihr Stargast. Das<br />
ergibt Sinn. Denn <strong>der</strong> Multimillionär ist<br />
nicht nur einer <strong>der</strong> erfolgreichsten Unternehmer<br />
Afrikas – son<strong>der</strong>n zugleich sein<br />
größter Spen<strong>der</strong>.<br />
Klein, ein rundlicher Kopf, eine starke Brille<br />
auf <strong>der</strong> Nase, dahinter ein freundliches Blinzeln:<br />
Mo Ibrahim gibt sich gelassen. Ohne<br />
Rage, aber mit Enthusiasmus redet er über<br />
sein Lieblingsthema, über Afrika, den verkannten<br />
Kontinent. Über dessen verkehrtes<br />
Image. Darüber, dass alle immer nur über<br />
Hilfe reden. Über die Chancen, die Unternehmer<br />
dort verpassen. Über sich redet er<br />
erst ganz am Ende. „Ich“, sagt er, „ich will<br />
ja nicht predigen.“ Dann lächelt er, denn er<br />
weiß ganz genau, dass er exakt das wie<strong>der</strong><br />
einmal getan hat. Eine sympathische, ungelenke<br />
Koketterie ist das, schließlich sind es<br />
seine Reden, die ihn zum begehrten Gast<br />
werden lassen.<br />
Lange war Ibrahim „nur“ ein erfolgreicher<br />
Unternehmer. Dem Nubier mit sudanesischem<br />
und britischem Pass ist gelungen,<br />
woran an<strong>der</strong>e scheiterten. In 15 afrikanischen<br />
Län<strong>der</strong>n hat er ein Mobilfunksystem<br />
aufgebaut – und es dann vor zwei Jahren für<br />
stolze 3,4 Milliarden weiterverkauft. Danach<br />
hätte sich <strong>der</strong> heute 61-Jährige eigentlich
zur Ruhe setzen können. Doch Ibrahim<br />
hatte etwas Besseres vor: Er stiftete den „Mo<br />
Ibrahim Prize“, die am höchsten dotierte<br />
Ehrung <strong>der</strong> Welt. Mit dem Preis zeichnet<br />
Ibrahim ehemalige afrikanische Politiker<br />
aus, die gute Regierungschefs waren. Fünf<br />
Millionen Euro bekommt <strong>der</strong> Preisträger in<br />
den ersten zehn Jahren, danach jährlich<br />
200 000 Dollar und zusätzliche 200 000 Dollar<br />
pro Jahr für Projekte. <strong>Die</strong> Idee, unterstützt<br />
von Prominenten wie Bill Clinton, Nelson<br />
Mandela und Kofi Annan, katapultierte Ibrahim<br />
in die Bill-Gates-Liga <strong>der</strong> Wohltäter.<br />
MEHR ANREIZE, MEHR VORBILDER UND<br />
WENIGER VORURTEILE<br />
Warum er sich als Spen<strong>der</strong> betätigt und mit<br />
seiner „Mo Ibrahim Foundation“ die demokratische<br />
Entwicklung Afrikas för<strong>der</strong>t, wo er<br />
doch <strong>der</strong> Wohltätigkeit misstraut? Ibrahim<br />
schaut nachdenklich auf seine Hände. Sie<br />
gehören einem Mann, <strong>der</strong> zupackt. Das sind<br />
keine Hände, die nur Gläser schwenken –<br />
auch wenn er sich nicht scheut, abends an<br />
<strong>der</strong> Bar den besten Cognac des Hauses zu<br />
or<strong>der</strong>n. Ebenso unprätentiös nimmt er dann<br />
hin, dass es nur gängige Sorten gibt. Verglichen<br />
mit an<strong>der</strong>en Millionären, die ihr Geld<br />
für Autos, Jachten und Flugzeuge verprassen,<br />
wird er später sagen: „Ich kann nur in<br />
einem Bett schlafen und dreimal am Tag<br />
essen.“ Dagegen gibt Ibrahim ganz offen zu:<br />
Es macht Spaß, mit dem eigenen Geld die<br />
Welt zu verbessern.<br />
Ibrahim will mit seinem Preis neue Leistungsanreize<br />
für Politiker schaffen. Das<br />
fehle in Afrika bislang. „Sie wissen gar nicht,<br />
wie schwer es ist, in Afrika ein guter Politiker<br />
zu sein. Man kämpft gegen Hunger, Aids,<br />
den Mangel an Schulen. Dagegen ist <strong>der</strong> Job<br />
europäischer Regierungschefs ein Zuckerschlecken“,<br />
sagt Ibrahim. Sein Preis soll<br />
außerdem Vorbil<strong>der</strong> schaffen, indem die<br />
Preisträger, wie <strong>der</strong> ehemalige Präsident<br />
Mosambiks Joaquin Chissano, bekannter<br />
werden. Mit Wohltätigkeit habe das nichts<br />
zu tun. Eher damit, dass Ibrahim seinem<br />
Kontinent etwas zurückgeben will.<br />
Der Nubier verdankt Afrika viel. Er wurde<br />
1946 als Sohn eines Baumwollhändlers im<br />
Nordsudan geboren, wuchs aber in Ägypten<br />
auf. Als Fernmeldetechniker kehrte er<br />
22-jährig in den Sudan zurück und arbeitete<br />
dort bei <strong>der</strong> staatlichen Telefongesellschaft.<br />
Ein Stipendium brachte ihn 1974 nach Großbritannien,<br />
er machte seinen Doktor und<br />
arbeitete anschließend als Mobilfunkingenieur<br />
bei British Telecom. Dort begann seine<br />
steile Karriere. Er hatte den richtigen Riecher<br />
für den neuen Boommarkt und baute<br />
das erste Mobilfunknetz Großbritanniens<br />
auf. Doch <strong>der</strong> große Konzern war ihm zu<br />
bürokratisch. Und Ibrahim war unternehmungslustig.<br />
1989 stieg <strong>der</strong> Mann, <strong>der</strong> nie<br />
eine Businessschule besucht hat, aus und<br />
gründete MSI, sein eigenes Beratungs- und<br />
Softwareunternehmen für Mobilfunkbetreiber.<br />
„Ich konnte anfangs nicht mal einen<br />
Businessplan lesen“, erinnert er sich. Das Geschäft<br />
florierte dennoch, er baute Netzwerke<br />
in Deutschland, Italien, Frankreich, Singapur<br />
und Japan mit auf. 1998, als das Unternehmen<br />
620 Millionen Dollar wert war, verkaufte<br />
er es. Längst reizte Ibrahim etwas bis<br />
dahin Unmögliches: Mobilfunk in Afrika.<br />
Kurz vor <strong>der</strong> Jahrtausendwende funktionierten<br />
Mobilfunknetze zwar längst in vielen<br />
Län<strong>der</strong>n <strong>der</strong> Welt. Doch in Afrika<br />
herrschte weitgehend Funkstille. Mit Partnern<br />
gründete Ibrahim das Mobilfunkunternehmen<br />
Celtel und startete in Uganda und<br />
Sambia. Weitere Län<strong>der</strong> kamen hinzu. Vor<br />
zwei Jahren verkaufte er Celtel schließlich<br />
für 3,4 Milliarden Dollar an ein kuwaitisches<br />
Unternehmen – und rät nun an<strong>der</strong>en, in<br />
Afrika einzusteigen.<br />
„Afrika hat bei Unternehmern ein viel zu<br />
schlechtes Image“, sagt Ibrahim. Dabei habe<br />
sich auf dem Kontinent vieles zum Besseren<br />
verän<strong>der</strong>t. Junge Leute wollten auch in Afrika<br />
etwas erreichen, in <strong>der</strong> Politik ebenso wie<br />
ten years after f<br />
in <strong>der</strong> Wirtschaft. Nur fehle es häufig an den<br />
nötigen Anreizen – und am Kapital. Zu genau<br />
erinnert sich Ibrahim noch daran, dass Banken<br />
<strong>der</strong> sehr erfolgreichen Celtel höchstens<br />
190 Millionen Dollar als Kredit gewährten.<br />
Als die Kuwaitis das Unternehmen kauften,<br />
konnten sie dagegen Milliarden investieren.<br />
Mit einem Fonds in Höhe von <strong>der</strong>zeit<br />
200 Millionen Dollar för<strong>der</strong>t Ibrahim daher<br />
inzwischen auch interessante Start-ups –<br />
und so das afrikanische Unternehmertum.<br />
KLISCHEES ZERSTÖREN UND DIE ZUHÖRER<br />
ERSTAUNEN, DAS KANN IBRAHIM<br />
Trotz vieler Krisen in Afrika, etwa <strong>der</strong> jüngsten<br />
blutigen Unruhen in Kenia, hält Ibrahim<br />
die in Europa oft zitierten Risiken für<br />
Unternehmer für maßlos übertrieben: „Ich<br />
habe 15 Firmen in 15 Län<strong>der</strong>n aufgebaut,<br />
ohne einen Cent Schmiergeld zu zahlen“,<br />
sagt Ibrahim und erklärt: „Wer einmal anfängt,<br />
kann nicht mehr aufhören. Erst<br />
kommt <strong>der</strong> Minister, dann <strong>der</strong> Präsident,<br />
dann dessen Frau, dann die nächste Frau,<br />
und wenn alle etwas haben, wechselt die<br />
Regierung. Wer dann aufhören möchte, wird<br />
zum Staatsfeind. Also habe ich gar nicht<br />
erst angefangen.“<br />
Erstaunen auf Gesichter zaubern, Klischees<br />
zerstören – das macht Ibrahim Spaß, nicht<br />
nur in Bezug auf Afrika: „Europa redet gern<br />
und viel – über Korruption, über Entwicklungshilfe,<br />
über Menschenrechte.“ Europas<br />
Handeln sei damit aber nicht immer konsistent.<br />
„Nehmen wir die Korruption, über die<br />
Europäer in Afrika klagen. Dazu gehören<br />
zwei, Geber und Nehmer. Ich habe bisher<br />
aber von keiner Verurteilung in Deutschland<br />
gehört, weil in Afrika geschmiert wurde.<br />
Sie? Dabei ist Korruption auch dort ein<br />
Verbrechen.“ Wie<strong>der</strong> hat er sich in Fahrt geredet,<br />
appelliert, gepredigt. Als er das merkt,<br />
hält er inne und lächelt. Denn Mo Ibrahim<br />
ist kein verbitterter Mann. Er ist einer, <strong>der</strong><br />
etwas verän<strong>der</strong>n will. .<br />
61
p service impressum<br />
62<br />
FOLLOW-UP BUCHTIPPS<br />
Deripaska reichster Russe<br />
Ein Porträt in think:act 11<br />
war dem russischen<br />
Unternehmer Oleg Deripaska<br />
gewidmet. Wie<br />
lukrativ dessen Firmenimperium<br />
offenbar arbeitet,<br />
zeigt jetzt ein Ranking<br />
<strong>der</strong> russischen Wirt-<br />
schaftszeitung „Finans“.<br />
Danach ist Deripaska mit<br />
einem Vermögen von 40<br />
Milliarden US-Dollar <strong>der</strong><br />
reichste unter Russlands Oligarchen. Er besitzt<br />
damit fast so viel Geld wie Bill Gates. Weiter<br />
berichtet Finans, die Zahl <strong>der</strong> Dollarmilliardäre<br />
habe sich binnen eines Jahres vervierfacht. Fast<br />
40 neue Milliardäre hat das Land.<br />
Learning to fly<br />
An diesen legendären Pink-Floyd-Song denkt<br />
Sergey Zhuzhlin oft, wenn er Fallschirm springt<br />
(Bild auf Seite gegenüber). Und das tut <strong>der</strong> Berater<br />
aus dem Moskauer <strong>Roland</strong>-<strong>Berger</strong>-Office mit Leidenschaft.<br />
Im März entstand das Foto. Parallelen<br />
zwischen Fallschirmspringen und <strong>der</strong> Wirtschaftswelt?<br />
Das Wichtigste beim Springen, so Zhuzhlin,<br />
„sind persönliche Disziplin und Kontrolle. Man<br />
IMPRESSUM<br />
HERAUSGEBER<br />
Dr. Burkhard Schwenker, CEO<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants<br />
Am Sandtorkai 41, 20457 Hamburg<br />
Tel.: +49 40 37631-40<br />
LEITUNG<br />
Torsten Oltmanns<br />
REDAKTIONSBEIRAT<br />
<strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants<br />
Dr. Christoph Kleppel †, Felicitas<br />
Schnei<strong>der</strong><br />
VERLAG<br />
BurdaYukom Publishing GmbH<br />
Konrad-Zuse-Platz 11, 81829 München<br />
Tel.: +49 (0)89 30620-0<br />
GESCHÄFTSFÜHRER<br />
Manfred Hasenbeck,<br />
Andreas Struck<br />
VERLAGSLEITER<br />
Dr. Christian Fill<br />
CHEFREDAKTEUR<br />
Alexan<strong>der</strong> Gutzmer (V.i.S.d.P.)<br />
ART-DIREKTION<br />
Blasius Thätter<br />
CHEF VOM DIENST<br />
Marlies Viktorin<br />
REDAKTION<br />
Tobias Knauer, Tobias Birzer<br />
Oleg Deripaska ist fast so<br />
reich wie Bill Gates<br />
AUTOREN<br />
Stuart Crainer (London), Thomas Escritt<br />
(Budapest), Jens Flottau, Frank Grünberg,<br />
David McNeill (Tokyo), Petra Pinzler, Marcus<br />
Schick, Angelika Steffen, Rhea Wessel, Johannes<br />
Wiek, Jan Wilms, Morgen Witzel (Exeter)<br />
GASTAUTOREN<br />
Michael Jarrett (London), Rachel Sterne<br />
(New York)<br />
LEKTORAT<br />
Dr. Michael Petrow (Ltg.), Karin Schlipphak,<br />
Jutta Schreiner<br />
GRAFIK/GESTALTUNG<br />
Andrea Hüls, Olaf Puppe<br />
PRODUKTION<br />
Marlene Freiberger, Wolfram Götz (Ltg.), Franz<br />
Kantner, Silvana Mayrthaler, Cornelia Sauer<br />
BILDREDAKTION<br />
Beate Blank (Ltg.), Elke Maria Latinovic<br />
BILDNACHWEISE<br />
Titel: Illustration James Dawe, Liewig/corbis,<br />
Rea/laif; S. 8: B.S.P.I/corbis; S. 9: Back/laif;<br />
S. 10: Loreal pr, dpa/picture-alliance, Uni Witten/Herdecke<br />
pr; S. 12/13: Illustration James<br />
Dawe; S. 14: pr; S. 16: Paolo Tre/laif; S. 18:<br />
Michael Probst/AP Photo; S. 23: pr; S. 24: pr;<br />
S. 26: pr; S. 28/31: Phillipp Wente; S. 33: imago;<br />
S. 34/37: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants;<br />
S. 38: Illustration Sylvia Neuner; S. 40: pr; S. 42:<br />
Spn pr; S. 43: Jake Schoellkop/ap photo; S. 44:<br />
Dirschel/LOOK, ITAR-TASS; S. 45: seagate pr,<br />
lernt schnell, wie wichtig es ist, Emotionen zu<br />
managen und Situationen rasch zu bewerten.“<br />
Moloch und Meister <strong>der</strong> Improvisation<br />
Der nie<strong>der</strong>ländische Architekturdenker Rem<br />
Koolhaas und seine Feldforschung in <strong>der</strong> nigerianischen<br />
Metropole Lagos waren Thema in<br />
think:act 7. Der Beitrag zeigte auf, weshalb Koolhaas<br />
die spontane Entstehung von Märkten in<br />
<strong>der</strong> Millionenstadt fasziniert. Jetzt hat das deutsche<br />
Nachrichtenmagazin Focus dem Moloch<br />
eine Reportage gewidmet. <strong>Die</strong>se schil<strong>der</strong>t den<br />
täglichen Überlebenskampf <strong>der</strong> Menschen in<br />
Lagos. Auch auf Koolhaas nimmt <strong>der</strong> Beitrag<br />
Bezug. „Der nie<strong>der</strong>ländische Stararchitekt und<br />
Harvard-Professor“, schreibt das Magazin,<br />
„schwärmt von <strong>der</strong> Selbstorganisation und<br />
dem wirtschaftlichen Erfindungsreichtum“ <strong>der</strong><br />
Bewohner von Lagos.<br />
think:act holt Gold in New York<br />
Wie schon im Vorjahr, hat think:act auch in diesem<br />
Jahr bei den Mercury Awards in New York<br />
gewonnen. In <strong>der</strong> Kategorie „Executive“ holte das<br />
Magazin die Goldmedaille. Damit setzte es sich<br />
gegen Publikationen aus aller Welt durch, die<br />
die weltweite Entschei<strong>der</strong>community zur Zielleserschaft<br />
haben.<br />
Golden Section Graphics; S. 46: Illustration<br />
Sylvia Neuner; S. 47: pr (2), imagine china; S. 48:<br />
pr; S. 49: Gerald/laif, privat; S. 50: Christophe<br />
Boisveux/corbis, privat; S. 51: farooqi/groundreport,<br />
Mark Shenton; S. 52: Mark Henley/<br />
panos/laif, privat; S. 53: dpa/picture-alliance,<br />
privat; S. 54: Vu/laif, privat; S. 55: pixtal/f1online,<br />
privat; S. 56: Androniki Christodoulou; S. 57: pr;<br />
S. 58: chinaphoto/laif; S. 59: Christoph Edelhoff,<br />
colourbox; S. 60: Ian Teh/Vu/laif; S. 62: Nicholl/<br />
laif; U3: <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy Consultants<br />
DRUCK<br />
Pinsker Druck und Medien GmbH, 84048 Mainburg<br />
URHEBERRECHTE<br />
<strong>Die</strong> im Magazin enthaltenen Beiträge sind<br />
urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte werden<br />
vorbehalten.<br />
HINWEIS<br />
Redaktionelle Beiträge geben nicht unbedingt<br />
die Meinung des Herausgebers wie<strong>der</strong>.<br />
service@think-act.info<br />
Haben Sie Fragen an den Herausgeber<br />
o<strong>der</strong> das Redaktionsteam?<br />
Interessieren Sie sich für Studien<br />
von <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong> Strategy<br />
Consultants? Schreiben Sie an<br />
service@think-act.info<br />
Restrukturierung ist ein Dauerthema.<br />
Was zum erfolgreichen<br />
Umbau gehört, zeigt das aktuelle<br />
think:act Content „Agieren<br />
statt reagieren“. Dem Thema<br />
operativer Spitzenklasse widmet<br />
sich das erste Buch aus<br />
<strong>der</strong> neuen Publikationsreihe<br />
„think:act – International<br />
Management Knowledge“.<br />
<strong>Die</strong> verschiedenen Wachstumsstrukturen<br />
<strong>der</strong> Banken in<br />
Europa untersucht eine Studie<br />
von <strong>Roland</strong> <strong>Berger</strong>, EFMA und<br />
Nordea. Torsten Oltmanns zeigt<br />
neue Wege im Elitenmarketing<br />
auf. Ideen zu erfolgreicher Wertschöpfung<br />
schließlich liefert ein<br />
weiteres think:act Content.<br />
THINK:ACT<br />
CONTENT:<br />
Agieren statt<br />
reagieren<br />
AXEL SCHMIDT,<br />
ROLAND<br />
SCHWIENTEK:<br />
Operations Excellence.<br />
Smart Solutions<br />
for Business<br />
Success<br />
ROLAND<br />
BERGER, EFMA,<br />
NORDEA<br />
Retail Banking in<br />
Europe<br />
TORSTEN<br />
OLTMANNS:<br />
Eliten-Marketing.<br />
Wie Sie Entschei<strong>der</strong><br />
erreichen<br />
THINK:ACT<br />
CONTENT:<br />
<strong>Die</strong> Regeln des globalen<br />
Wettbewerbs<br />
verän<strong>der</strong>n sich
Highlights aus diesem Heft auf CD<br />
Sie können folgende<br />
Beiträge hören:<br />
kREZESSION DER CFOS (S. 14)<br />
<strong>Die</strong> Turbulenzen in <strong>der</strong> Wirtschaftswelt nehmen zu. Grundsätzlich<br />
vor Krisen sicher ist niemand.<br />
kIM STURM NEUE STÄRKE FINDEN (S. 16)<br />
Unser Beitrag zeigt: Wer sich richtig vorbereitet, kann durchaus<br />
als Gewinner aus einer Umbruchphase hervorgehen.<br />
k„PAKISTAN IST COOL“ (S. 28)<br />
Das islamische Land entdeckt das Musikfernsehen. Eine Erfolgsstory.<br />
kIM OSTEN VIEL NEUES (S. 38)<br />
Wie zwei Banken die Finanzwelt Osteuropas aufrollen<br />
kDIE JETCHAUFFEURE (S. 42)<br />
Ultraleichtflieger verän<strong>der</strong>n die Airline-Industrie.<br />
kDIEBSTAHL AM HELLLICHTEN TAG (S. 56)<br />
Ein Geschäft in Tokio verschenkt Produkte – die Zukunft des Marketings?