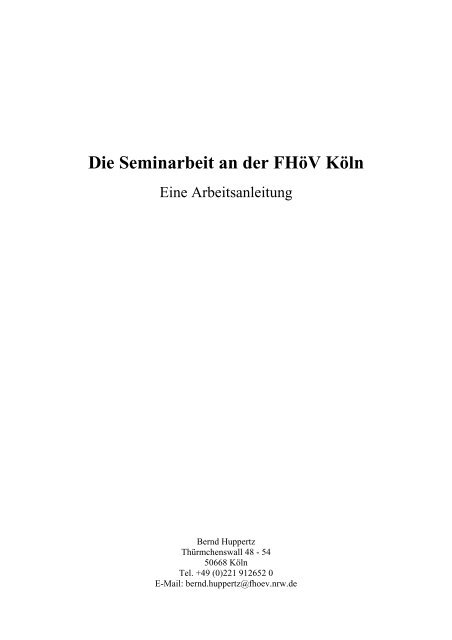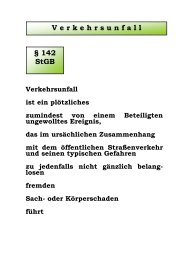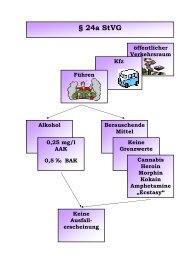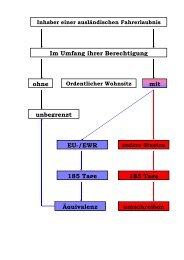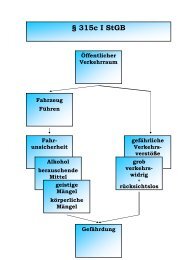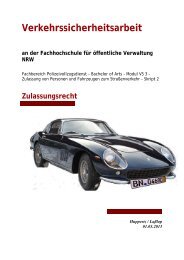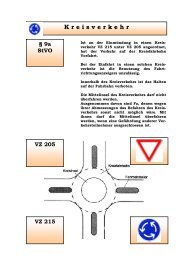Die Seminarbeit an der FHöV Köln - Bernd Huppertz
Die Seminarbeit an der FHöV Köln - Bernd Huppertz
Die Seminarbeit an der FHöV Köln - Bernd Huppertz
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Die</strong> <strong>Seminarbeit</strong> <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>FHöV</strong> <strong>Köln</strong><br />
Eine Arbeits<strong>an</strong>leitung<br />
<strong>Bernd</strong> <strong>Huppertz</strong><br />
Thürmchenswall 48 - 54<br />
50668 <strong>Köln</strong><br />
Tel. +49 (0)221 912652 0<br />
E-Mail: bernd.huppertz@fhoev.nrw.de
Inhaltsverzeichnis<br />
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Seminararbeit<br />
- Deckblatt<br />
- Inhaltsverzeichnis<br />
- Abkürzungsverzeichnis<br />
- Literaturverzeichnis<br />
- Quellenverzeichnis<br />
- Abbildungsverzeichnis<br />
- Verzeichnis <strong>der</strong> benutzten sonstigen Hilfsmittel und Anlagen<br />
- Schriftliche Ausarbeitung<br />
- Erklärung<br />
- Umf<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Arbeit<br />
- Zitate<br />
- Fußnoten<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite – I -<br />
1<br />
2<br />
2<br />
3<br />
3<br />
4<br />
4<br />
5<br />
5<br />
8<br />
9<br />
10<br />
11
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Seminararbeit<br />
Hier einige Hinweise zum Aufbau und <strong>der</strong> Gestaltung <strong>der</strong> Seminararbeit.<br />
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
<strong>Die</strong>se Ausarbeitung korrespondiert mit den seitens <strong>der</strong> Fachhochschule zur Verfügung<br />
gestellten „Hinweisen zu Seminaren“, <strong>der</strong> „H<strong>an</strong>dreichung zur Thesis-Arbeit“ 1 und<br />
weiteren Studienhilfen 2 . In einigen Punkten weicht <strong>der</strong> Dozent jedoch von den dort<br />
dargestellten Grundsätzen ab.<br />
1. Glie<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> Seminararbeit<br />
<strong>Die</strong> Seminararbeit glie<strong>der</strong>t sich in die nachfolgend näher beschriebenen Teile. Dabei ist<br />
die Reihenfolge zwingend.<br />
1.1 Deckblatt<br />
1.2 Inhaltsverzeichnis<br />
1.3 Abkürzungsverzeichnis<br />
1.4 Literaturverzeichnis<br />
1.5 ggf. Quellenverzeichnis<br />
1.6 ggf. Abbildungsverzeichnis<br />
1.7 Verzeichnis <strong>der</strong> benutzten sonstigen Hilfsmittel und Anlagen<br />
1.8 Schriftliche Ausarbeitung<br />
1.9 Erklärung<br />
1<br />
Jeweils downloadfähig vorgehalten auf www.fhoev.nrw.de (St<strong>an</strong>d: 01.03.2011).<br />
2<br />
Walkowiak/Haselow, Studienhilfe für wissenschaftliches Arbeiten <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>FHöV</strong> NRW, 1. Aufl.<br />
2010.<br />
Seite - 1 -
1.1 Deckblatt<br />
Das Deckblatt muss enthalten:<br />
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
- Thema <strong>der</strong> Seminararbeit „<strong>Die</strong> Fahrerlaubnis i.S.d. Dritten Führerscheinrichtlinie<br />
unter Berücksichtigung<br />
zulassungsrechtlicher Aspekte“.<br />
- Titel und ggf. Untertitel <strong>der</strong> Arbeit<br />
- Name des betreuenden Lehrenden<br />
- Name des Verfassers<br />
„PHK <strong>Bernd</strong> <strong>Huppertz</strong>“<br />
- Fachbereich „Polizeivollzugsdienst“<br />
- Kurs und Einstellungsjahrg<strong>an</strong>g „KP 2009 / (…)“<br />
- Einstellungsbehörde „Polizeipräsidium <strong>Köln</strong>“<br />
1.2 Inhaltsverzeichnis<br />
<strong>Die</strong>se Übersicht soll den Aufbau und die Disposition <strong>der</strong> Seminararbeit klar und vollständig<br />
erkennen lassen.<br />
Im vorliegenden Fall soll dem dezimalen Glie<strong>der</strong>ungssystem <strong>der</strong> Vorzug gegeben<br />
werden:<br />
Haupteinteilung: 1., 2., 3., ... ... Seite<br />
1. Unterglie<strong>der</strong>ung: 1.1, 1.2, 1.3, ... ... Seite<br />
2. Unterglie<strong>der</strong>ung: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ... ... Seite<br />
3. Unterglie<strong>der</strong>ung 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, ... ... Seite<br />
<strong>Die</strong> hier festgelegte Seite muss mit dem Kapitelbeginn in <strong>der</strong> eigentlichen Arbeit<br />
übereinstimmen.<br />
<strong>Die</strong> Seitennummerierung des Inhaltsverzeichnisses selbst ist mit römischen Ziffern<br />
vorzunehmen.<br />
Seite - 2 -
1.3 Abkürzungsverzeichnis<br />
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Hier werden die in <strong>der</strong> Arbeit verw<strong>an</strong>dten fachlich üblichen Abkürzungen erläutert.<br />
Abkürzungen <strong>der</strong> gewöhnlichen Umg<strong>an</strong>gssprache ( s.o., z.B. ) sind nicht aufzunehmen.<br />
<strong>Die</strong> Seitennummerierung des Abkürzungsverzeichnisses selbst ist mit römischen Ziffern<br />
vorzunehmen.<br />
1.4 Literaturverzeichnis<br />
In das Literaturverzeichnis gehören alle Werke, die Sie in Ihrer Seminararbeit zitieren.<br />
Nicht aufgeführt werden indes die Quellen, die Sie zwar bei <strong>der</strong> Recherche benutzt<br />
haben, aber nicht in den Fußnoten zitieren. Das Literaturverzeichnis dient ausschließlich<br />
zum leichteren Auffinden <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Seminararbeit zitierten Werke. Dagegen soll es<br />
keinen allgemeinen Überblick über die zum Thema vorh<strong>an</strong>dene Literatur bieten.<br />
<strong>Die</strong> Angaben über die benutzten Lehrbücher, Kommentare, Monografien,<br />
Dissertationen müssen enthalten:<br />
- Zunahme (und Vorname) des Verfassers<br />
- Titel des Buches ( u.ä. )<br />
- Auflage<br />
- (Erscheinungsort) und Erscheinungsjahr<br />
<strong>Die</strong> Angaben über die verwendeten Aufsätze und sonstigen Abh<strong>an</strong>dlungen müssen<br />
enthalten:<br />
- Zunahme und Vorname des Verfassers<br />
- Titel <strong>der</strong> Abh<strong>an</strong>dlung<br />
- in: Zeitschrift<br />
- Jahrg<strong>an</strong>g<br />
- Seitenzahl<br />
Seite - 3 -
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Nicht in das Literaturverzeichnis gehören Rechtsvorschriften, Urteile und amtliche<br />
Mitteilungen; diese sind in den Fußnoten zu zitieren. Ebenfalls nicht ins<br />
Literaturverzeichnis gehören Internetadressen. Wird ein Dokument zitiert, das nur im<br />
Internet veröffentlicht ist, ist dieses Dokument als selbständiger Punkt aufzunehmen.<br />
<strong>Die</strong> in Rede stehende Internetadresse ist als Fundstelle zu nennen:<br />
- <strong>Huppertz</strong>, <strong>Bernd</strong>, <strong>Die</strong> Seminararbeit <strong>an</strong> <strong>der</strong> <strong>FHöV</strong> <strong>Köln</strong> –Eine<br />
Arbeits<strong>an</strong>leitung-, http://www.bernd-huppertz.de (St<strong>an</strong>d: 01.03.2011)<br />
<strong>Die</strong> Seitennummerierung des Literaturverzeichnisses selbst ist mit römischen Ziffern<br />
vorzunehmen.<br />
1.5 Quellenverzeichnis<br />
Auf das in den „Hinweisen zur Erstellung von Seminararbeiten“ gen<strong>an</strong>nte Quellenverzeichnis<br />
wird hier verzichtet.<br />
1.6 Abbildungsverzeichnis<br />
Werden in <strong>der</strong> Seminararbeit Bil<strong>der</strong> verwendet o<strong>der</strong> auf Filme u.ä. Bezug genommen,<br />
so sind diese im Abbildungsverzeichnis aufzulisten.<br />
1.7 Verzeichnis <strong>der</strong> benutzten sonstigen Hilfsmittel und Anlagen<br />
Hier sind z.B. die Protokolle etwaiger durchgeführter Interviews sowie die Ausdrucke<br />
benutzter Internetseiten aufzulisten.<br />
Seite - 4 -
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Da es gerade im Bereich <strong>der</strong> Internetrecherche zur Verwendung von Plagiaten kommt,<br />
muss <strong>der</strong> vollständige Artikel o.ä. <strong>der</strong> betreffenden Internetseite als Ausdruck <strong>der</strong><br />
Seminararbeit beigefügt werden.<br />
1.8 Schriftliche Ausarbeitung<br />
Glie<strong>der</strong>ung<br />
<strong>Die</strong> Glie<strong>der</strong>ung sollte sich vorzugsweise am dezimalen Glie<strong>der</strong>ungssystem orientieren:<br />
Haupteinteilung: 1., 2., 3., ...<br />
1. Unterglie<strong>der</strong>ung: 1.1, 1.2, 1.3, ...<br />
2. Unterglie<strong>der</strong>ung: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, ...<br />
3. Unterglie<strong>der</strong>ung 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3, ...<br />
Einleitung / Einführung<br />
<strong>Die</strong> systematische Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung ( Problemeinstieg; <strong>der</strong> „Aufhänger“ ) mit <strong>der</strong><br />
Thematik k<strong>an</strong>n z.B. unter einer o<strong>der</strong> mehrerer <strong>der</strong> nachfolgenden Fragestellungen<br />
begonnen werden:<br />
- welche Bedeutung hat das Thema für Theorie und Praxis ?<br />
- wie aktuell ist es ?<br />
- wie ist die Problematik entst<strong>an</strong>den und wie hat sie sich entwickelt ?<br />
- welche Motive machen das Thema für den Bearbeiter selbst so wichtig ?<br />
- was war Anlass für die Wahl des Problemkreises ?<br />
- inwieweit k<strong>an</strong>n das Thema gegenüber benachbarten Themen abgegrenzt<br />
werden ?<br />
- welche Ergebnisse liegen in dem zu bearbeitenden Bereich bereits vor ?<br />
- inwiefern wird mit <strong>der</strong> Bearbeitung des Themas eine „Lücke“ geschlossen ?<br />
Seite - 5 -
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für die Formulierung <strong>der</strong> Fragestellung und die<br />
Zielsetzung und sprechen Sie sie mit Ihrem Dozenten und / o<strong>der</strong> Kommilitonen durch,<br />
bevor Sie <strong>an</strong> die Arbeit gehen, das spart im nach hinein sehr viel Zeit. Halten Sie sich<br />
d<strong>an</strong>n im Laufe <strong>der</strong> Arbeit immer wie<strong>der</strong> die zentrale Fragestellung vor Augen und<br />
stellen Sie so sicher, dass Sie das Ziel im Auge behalten und nicht unter Umständen<br />
hochinteress<strong>an</strong>te, aber nicht zum Thema gehörende Nebenwege verfolgen.<br />
<strong>Die</strong> Einleitung sollte einen Umf<strong>an</strong>g von ca. 1,5 Seiten haben.<br />
Hauptteil<br />
Hier erfolgt die eigentliche Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit dem Thema:<br />
- Formulierung des Problems<br />
- Darstellung <strong>der</strong> <strong>der</strong>zeitigen Rechtslage ( de lege lata )<br />
- Praktische Auswirkungen <strong>der</strong> Rechtslage<br />
- Entwicklung von Hypothesen<br />
- Herstellung des Literaturbezuges<br />
- Diskussion und Interpretation von Ergebnissen und Meinungen<br />
- Kritische Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung ( eigene Stellungnahme )<br />
- Alternativen<br />
- These – Antithese – Synthese<br />
- Frage – Sammlung von Materialen, Belegen und Argumenten – Fazit<br />
- Geschichte eines Phänomens – heutige Situation – Fazit<br />
Der Hauptteil sollte einen Umf<strong>an</strong>g von ca. 15 Seiten haben.<br />
Seite - 6 -
Zusammenfassung und Ausblick<br />
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Im Schlussteil kommt <strong>der</strong> Verfasser zur Gesamtwürdigung seines bearbeiteten Themas.<br />
Hierbei bieten sich folgende Möglichkeiten <strong>der</strong> Gestaltung <strong>an</strong>:<br />
- die wichtigsten Ergebnisse <strong>der</strong> Arbeit zusammenfassen<br />
- Erkenntnisse werden in ein übergeordnetes G<strong>an</strong>zes gebracht<br />
- auf Nützlichkeit <strong>der</strong> Arbeit für Theorie und Praxis wird hingewiesen<br />
- neue weiterführende Ged<strong>an</strong>ken ( Ausblick - de lege ferenda ) werden aufgezeigt<br />
o<strong>der</strong> es wird auf offene Fragen hingewiesen<br />
- alle Fragen, die in <strong>der</strong> Einleitung gestellt wurden, müssen im Schlussteil<br />
be<strong>an</strong>twortet werden. Das ist die beste Prüfung für Sie, ob die Arbeit wirklich<br />
rund ist.<br />
<strong>Die</strong> schriftliche Ausarbeitung selbst ist in arabischen Seitenzahlen zu nummerieren. Das<br />
beginnt mit <strong>der</strong> Seite 1, auch wenn vorher bereits etliche Seiten im Vorsp<strong>an</strong>n (= Inhalts-<br />
, Abkürzungs- und Literaturverzeichnis ) in römischen Ziffern durchnummeriert worden<br />
sind.<br />
<strong>Die</strong> Zusammenfassung sollte einen Umf<strong>an</strong>g von ca. 1,5 Seiten haben.<br />
Seite - 7 -
Bewertung<br />
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Bei <strong>der</strong> Bewertung einer Seminararbeit kommt es u.a. darauf <strong>an</strong>, ob nachfolgend<br />
gen<strong>an</strong>nten Kriterien erfüllt sind. <strong>Die</strong> Einhaltung <strong>der</strong> Kriterien fließt d<strong>an</strong>n grundsätzlich<br />
mit dem jeweils <strong>an</strong>gegebenen Prozentsatz in die Bewertung ein:<br />
- klare zielführende Glie<strong>der</strong>ung<br />
- schlüssiger Aufbau („<strong>der</strong> rote Faden“) 10%<br />
- wissenschaftliches Arbeiten<br />
o Quellennachweis<br />
o Methodik<br />
o Begriffsdefinition 10%<br />
- Sprache<br />
o Richtige Verwendung von Fachbegriffen 10%<br />
- Form<br />
o Zitierweise<br />
o Layout<br />
o Inhaltsverzeichnis u.a. 5%<br />
- Den Hauptteil macht jedoch die eigentliche Ausein<strong>an</strong><strong>der</strong>setzung mit dem<br />
Thema aus:<br />
o Deutlich erkennbare, präzise und begründete Zielsetzung<br />
o Erkennbarkeit einer zentralen Aussage<br />
o Logische und wi<strong>der</strong>spruchsfreie Argumentation<br />
o Abschließende Bewertung 65%<br />
Seite - 8 -
1.9 Erklärung<br />
Auf einer separaten Seite ist folgende Erklärung abzugeben:<br />
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
„Ich versichere, dass ich die vorstehende Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe<br />
<strong>an</strong>gefertigt und mich <strong>an</strong><strong>der</strong>er als <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Arbeit <strong>an</strong>gegebenen Hilfsmittel nicht<br />
bedient habe. Alle Stellen, die sinngemäß o<strong>der</strong> wörtlich aus Veröffentlichungen<br />
übernommen wurden, sind als solche kenntlich gemacht.<br />
<strong>Die</strong> Arbeit wurde bisher we<strong>der</strong> in Teilen noch insgesamt einer <strong>an</strong><strong>der</strong>en Prüfungsbehörde<br />
vorgelegt und auch nicht veröffentlicht“.<br />
Das Weitere ergibt sich aus dem zur Verfügung gestellten verpflichtenden Vordruck.<br />
<strong>Die</strong>se Seite ist nicht zu nummerieren.<br />
Seite - 9 -
2. Umf<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Arbeit<br />
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Der Text <strong>der</strong> eigentlichen Seminararbeit [= schriftliche Ausarbeitung ohne Vorsp<strong>an</strong>n<br />
(= Deckblatt; Inhalts-, Abkürzungs- und Literaturverzeichnis)] sollte ca. 15 DIN A 4 –<br />
Seiten umfassen.<br />
Dabei sollte schon beim Konzept ggf. z.B. durch Buchstabenaufzählung <strong>der</strong> Umf<strong>an</strong>g<br />
<strong>der</strong> einzuhaltenden Reinschrift im Auge behalten werden.<br />
<strong>Die</strong> <strong>an</strong>gegebenen Zahlen sind Richtwerte, keine absoluten Vorgaben. Es ist jedoch nicht<br />
ratsam, durch Layout – Tricks (größerer o<strong>der</strong> kleinerer Zeilenabst<strong>an</strong>d, Schriftart o.ä.)<br />
den tatsächlichen Umf<strong>an</strong>g <strong>der</strong> Arbeit zu verschleiern. Ein solcher Versuch wird leicht<br />
erk<strong>an</strong>nt und k<strong>an</strong>n zu einer Abwertung führen.<br />
<strong>Die</strong> Seminararbeit ist in Schreibmaschinenschrift abzufassen:<br />
- Times New Rom<strong>an</strong> 12 pt – o<strong>der</strong> - Arial 11 pt<br />
- Schriftgröße <strong>der</strong> Fußnoten = 9 pt<br />
- 1 zeiliger Zeilenabst<strong>an</strong>d (abweichend zu den o.g. Hinweisen)<br />
- Linker R<strong>an</strong>d = 2 cm<br />
- Rechter R<strong>an</strong>d = 4 cm<br />
- Oberer R<strong>an</strong>d = 2,5 cm<br />
- Unterer R<strong>an</strong>d = 2 cm<br />
- Blocksatz<br />
- Silbentrennung<br />
- Kopfzeile (Abst<strong>an</strong>d vom Seitenr<strong>an</strong>d 1,5 cm)<br />
- Fußzeile (Abst<strong>an</strong>d vom Seitenr<strong>an</strong>d 1,5 cm)<br />
- Überschrift 16 pt fett<br />
- Kapitelüberschriften 14 pt fett<br />
- Kapitelüberschriften zweite Ebene 11 bzw. 12pt fett<br />
- Seitenzahlen einfügen<br />
Seite - 10 -
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
<strong>Die</strong> gesamte Arbeit ist gebunden / geheftet innerhalb <strong>der</strong> vom betreuenden Lehrenden<br />
vorgegebenen Frist abzugeben: im vorliegenden Fall ist <strong>der</strong> Abgabeschluss 05.07.2011.<br />
3. Zitate<br />
Das Zitieren dient dem Belegen, welcher Quellen und welcher Sekundärliteratur m<strong>an</strong><br />
sich bei <strong>der</strong> Erstellung des Textes bedient hat. Belegt m<strong>an</strong> dies nicht, hat m<strong>an</strong> gegen die<br />
Grundsätze des wissenschaftlichen Arbeitens und eventuell gegen das Urheberrecht<br />
verstoßen.<br />
M<strong>an</strong> k<strong>an</strong>n direkt o<strong>der</strong> indirekt zitieren. Direkte Zitate, <strong>der</strong>en Text dem Original entspricht,<br />
werden durch Anführungszeichen gekennzeichnet. Weitere Hervorhebungen,<br />
wie z.B. Einrücken o<strong>der</strong> Kursivschrift, sind insbeson<strong>der</strong>e beim Zitieren g<strong>an</strong>zer Sätze<br />
und Absätze erwünscht. Auslassungen innerhalb von Zitaten werden durch ( ... )<br />
gekennzeichnet. Sollen Erläuterungen innerhalb <strong>der</strong> Zitate notwendig sein, werden diese<br />
in Fußnoten gegeben.<br />
Indirekte Zitate sind umformulierte Textstellen, die in den Stil des Verfassers <strong>der</strong> Arbeit<br />
übersetzt und eventuell in einen direkten Vergleich mit <strong>an</strong><strong>der</strong>en Quellen / Texten<br />
einbezogen sind. In diesem Fall wird am Ende des betreffenden Satzes bzw. Abschnitts<br />
das indirekte Zitat durch eine Literatur<strong>an</strong>gabe (= Fußnote gekennzeichnet.<br />
Es ist eine hohe Kunst, nicht zu viel Text in direkten Zitaten einzusetzen, son<strong>der</strong>n meist<br />
im Fluss <strong>der</strong> Arbeit direkt (in Sätze eingebaut) o<strong>der</strong> indirekt (zusammengefasst und in<br />
Zusammenh<strong>an</strong>g mit Vergleichbarem o<strong>der</strong> eigenen Überlegungen gebracht) zu zitieren.<br />
Am Ende eines (direkten o<strong>der</strong> indirekten) Zitates muss die Literatur<strong>an</strong>gabe stehen,<br />
welche belegt, aus welcher konkreten Ausgabe eines Werkes zitiert wurde 3 .<br />
Haben Sie im Internet recherchiert und die dort gewonnenen Erkenntnisse in <strong>der</strong><br />
Seminararbeit verwendet, ist die betreffende Internetseite zu zitieren. Dabei ist die<br />
vollständige Internetadresse <strong>an</strong>zugeben. Da es sich beim Internet um ein so gen<strong>an</strong>ntes<br />
3 Siehe hierzu Byrd/Lehm<strong>an</strong>n, Zitierfibel für Juristen, 1. Aufl. 2007, C.H. Beck München.<br />
Seite - 11 -
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
flüchtiges Medium h<strong>an</strong>delt, ist zusätzlich auch <strong>der</strong> Zeitpunkt <strong>der</strong> Internetrecherche<br />
<strong>an</strong>zugeben, denn: was heute im Internet zu finden ist, k<strong>an</strong>n morgen bereits gelöscht<br />
sein.<br />
Da es gerade in diesem Bereich zur Verwendung von Plagiaten kommt, muss <strong>der</strong><br />
vollständige Artikel o.ä. <strong>der</strong> betreffenden Internetseite als Ausdruck <strong>der</strong> Seminararbeit<br />
beigefügt werden.<br />
4. Fußnoten<br />
In den hier in Rede stehenden Seminararbeiten soll das Zitieren im Zuge des Setzens<br />
einer Fußnote erfolgen, in <strong>der</strong> d<strong>an</strong>n die vollständige Literatur<strong>an</strong>gabe aufgeführt wird<br />
und die bei Mehrfachzitierung durch Abkürzungen, wie z.B. „a.a.O.“ bzw „ebd.“ ersetzt<br />
wird.<br />
Es sind insbeson<strong>der</strong>e alle Stellen bzw. Passagen <strong>der</strong> Arbeit, die wörtlich o<strong>der</strong> <strong>an</strong>nähernd<br />
wörtlich aus Veröffentlichungen entnommen sind, durch Zitate (Fußnoten) als solche<br />
kenntlich zu machen.<br />
Der Nachweis <strong>der</strong> Fußnoten ist auf je<strong>der</strong> Seite separat vorzunehmen. Dabei sind die<br />
Fußnoten kapitelübergreifend über den gesamten Bearbeitungstext durchzunummerieren.<br />
Fußnoten haben grundsätzlich folgenden Zweck:<br />
- Quellen<strong>an</strong>gaben, z.B. zu Zitaten im Text wörtlich o<strong>der</strong> sinngemäß<br />
- Fußnoten bringen Erläuterungen und Modifizierungen des Textes, Ged<strong>an</strong>ken,<br />
die den Ged<strong>an</strong>keng<strong>an</strong>g im Text stören würden, die aber für<br />
bemerkenswert gehalten werden<br />
- Querverweise auf Stellen in <strong>der</strong> eigenen Arbeit<br />
- Nennung weiterer Literatur<br />
Seite - 12 -
Beispiele:<br />
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
- BVerwG, Beschluß vom 31.05.1995, NJW 1995, 2491 o<strong>der</strong> (Kurzform)<br />
BVerwG NJW 1995, 2491<br />
- Vgl. Pal<strong>an</strong>dt-<strong>Die</strong><strong>der</strong>ichsen, Anm. 4 zu § 1571<br />
- <strong>Die</strong>ckm<strong>an</strong>n FamRZ 1977, 81 (87)<br />
- Hentschel, Straßenverkehrsrecht, Rn. 4 zu § 1 StVO<br />
- Öffentliche Güter sind solche, bei denen die externen Effekte dominieren<br />
- Vgl. unten S. 7, 3. Absatz<br />
- Siehe auch Fn. 7<br />
- <strong>Die</strong> Verwendung des Wortes „ebenda“ (abgekürzt: ebd.) k<strong>an</strong>n nur in <strong>der</strong><br />
sofort nachfolgenden Fußnote geschehen, in <strong>der</strong> die Fundstelle bereits zitiert<br />
wurde.<br />
- <strong>Die</strong> Anfügung von „a.a.O.“ k<strong>an</strong>n nur erfolgen, wenn sich eindeutig ergibt,<br />
worauf sich die so ausgewiesene Fußnote bezieht.<br />
Seite - 13 -
Daraus ergibt sich folgendes Bild:<br />
Autor wird nur einmal<br />
zitiert<br />
Ulrich, Dr. Christoph<br />
Blaulicht im Straßenverkehr<br />
Diss. Gießen 1991<br />
Kommentator Verlag<br />
<strong>Huppertz</strong>, <strong>Bernd</strong><br />
Erlöschen <strong>der</strong> Betriebserlaubnis,<br />
in: Verkehrsdienst<br />
1992, 269<br />
Lütkes/Ferner/Kramer<br />
Straßenverkehr<br />
Losebl., St<strong>an</strong>d 8/2002<br />
Luchterh<strong>an</strong>d<br />
Wie<strong>der</strong>gabe in <strong>der</strong> zutreffenden<br />
ersten Fußnote<br />
Ulrich,<br />
Blaulicht im Straßenverkehr,<br />
Rn. ( ... )<br />
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Jede weitere Wie<strong>der</strong>gabe<br />
in nachfolgenden<br />
Fußnoten<br />
Ulrich, a.a.O., Rn. ( ... )<br />
<strong>Huppertz</strong> VD 2000, 269 <strong>Huppertz</strong> VD 2000, 269<br />
Lütkes/Ferner/Kramer<br />
Straßenverkehr, Rn. ( ... )<br />
Lütkes/Ferner/Kramer,<br />
a.a.O., Rn. ( ... )<br />
J<strong>an</strong>iszewski, Horst J<strong>an</strong>iszewski, Verkehrs- J<strong>an</strong>iszewski, a.a.O., Rn. ( …<br />
Verkehrsstrafrecht<br />
4. Aufl., Verlag C.H. Beck<br />
München 1994<br />
strafrecht, Rn. ( ... ) )<br />
Seite - 14 -
Autor wird mehrfach zitiert<br />
Hentschel, Peter<br />
Straßenverkehrsrecht<br />
32. Aufl., Verlag C.H. Beck<br />
München 2001,<br />
zitiert als:<br />
Hentschel, Straßenverkehrsrecht<br />
Hentschel, Peter<br />
Trunkenheit, Fahrerlaubnisentzug,<br />
Fahrverbot,<br />
8. Aufl., Werner Verlag<br />
Düsseldorf 2000, zitiert als:<br />
Hentschel, Trunkenheit<br />
Wie<strong>der</strong>gabe in <strong>der</strong> zutreffenden<br />
ersten Fußnote<br />
Hentschel, Straßenverkehrsrecht,<br />
Rn. ( ... )<br />
Hentschel, Trunkenheit ...,<br />
Rn. ( ... )<br />
Aufbau und Glie<strong>der</strong>ung<br />
Jede weitere Wie<strong>der</strong>gabe<br />
in nachfolgenden<br />
Fußnoten<br />
Hentschel, Straßenverkehrsrecht,<br />
Rn. ( ... )<br />
Hentschel, Trunkenheit, Rn.<br />
( ... )<br />
Seite - 15 -
Studienabschnitt S 3.2<br />
Fachbereich Polizeivollzugsdienst<br />
Verkehrsrecht<br />
Dozent: PHK <strong>Huppertz</strong><br />
<strong>Die</strong> Fahrerlaubnis i.S.d. Dritten Führerscheinrichtlinie unter<br />
Berücksichtigung zulassungsrechtlicher Aspekte<br />
hier: Führerscheintourismus<br />
Max Musterm<strong>an</strong>n<br />
Beispielweg 17<br />
55555 Wohnort<br />
Tel. (0815) 0815 Kurs: KP 2009/06<br />
E-Mail: meine@emailadresse.de Einstellungsjahrg<strong>an</strong>g: 2009
Matikelnummer: XXX XXX Abgabedatum: 29.04.2010
Inhaltsverzeichnis<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Verzeichnis <strong>der</strong> benutzten sonstigen Hilfsmittel und Anlagen<br />
Schriftliche Ausarbeitung<br />
- Checkliste zu (Fahrzeugart)<br />
- Klausur<br />
- Musterlösung<br />
Erklärung<br />
Inhaltsverzeichnis<br />
Seite - I -<br />
II<br />
VII<br />
X<br />
XI<br />
1<br />
4<br />
5<br />
6<br />
- ohne -
Abkürzungsverzeichnis<br />
a.A. <strong>an</strong><strong>der</strong>er Ansicht<br />
ABl. Amtsblatt<br />
a.F. alte Fassung<br />
ÄndVO Än<strong>der</strong>ungsverordnung<br />
AG Amtsgericht<br />
allg. allgemein(e)<br />
Alt. Alternative<br />
amtl. amtlich<br />
Anm. Anmerkung<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
BA Blutalkohol ( Zeitschrift, zitiert nach B<strong>an</strong>d und<br />
Seite )<br />
BAK Blutalkoholkonzentration<br />
BayObLG Bayerisches Oberstes L<strong>an</strong>dgericht<br />
BayVGH Bayerischer Verwaltungsgerichtshof<br />
bbH Bauart bedingte Höchstgeschwindigkeit<br />
Begr. Begründung<br />
BGBl. Bundesgesetzblatt<br />
BGH Bundesgerichtshof<br />
BGHSt Entscheidungen des Bundesgerichtshofs in Strafsachen<br />
(zitiert nach B<strong>an</strong>d und Seite)<br />
BKatVO Bußgeldkatalog Verordnung i.d.F. vom<br />
13.11.2001 (BGBl. I, 3033) i.d.F. vom 14.12.2001<br />
(BGBl. I, 3783)<br />
BMV(BW) Bundesministerium für Verkehr, seit 1999: Bundesministerium<br />
für Verkehr, Bauen und Wohnen<br />
BVerwG Bundesverwaltungsgericht<br />
bzw. beziehungsweise<br />
DA Durchführungs<strong>an</strong>weisung<br />
DB Durchführungsbestimmung<br />
DAR Deutsches Autorecht (Zeitschrift, zitiert nach Jahr<br />
und Seite)<br />
<strong>der</strong>s. <strong>der</strong>selbe<br />
d.h. das heißt<br />
DIN Deutsche Industrie Norm<br />
DÖV <strong>Die</strong> Öffentliche Verwaltung (Zeitschrift, zitiert<br />
nach Jahr und Seite)<br />
Seite - II -
Abkürzungsverzeichnis<br />
DPolBl Deutsches Polizeiblatt (Zeitschrift, zitiert nach<br />
Ausgabe, Jahr und Seite)<br />
Dritte Führerscheinrichtlinie Richtlinie 2006/126/EG vom 20.12.2006 ABl. EG<br />
Nr. L 403/18 vom 30.12.2006<br />
Drucks. Drucksache<br />
DVBl Deutsches Verwaltungsblatt (Zeitschrift, zitiert<br />
nach Jahr und Seite)<br />
ECE Economic Commission for Europe (UNO)<br />
EG Europäische Gemeinschaft<br />
et al. et aliter ( und <strong>an</strong><strong>der</strong>e )<br />
etc. et cetera<br />
EU Europäische Union<br />
EWR Europäischer Wirtschaftsraum<br />
f., ff. folgende(s)<br />
FeV Fahrerlaubnisverordnung vom 18.08.1998 (BGBl.<br />
I, 1998, 2214) i.d.F. vom 11.09.2002 (BGBl. I,<br />
3574)<br />
FeV-ReparaturVO VO zur Än<strong>der</strong>ung <strong>der</strong> FeV und <strong>an</strong><strong>der</strong>er straßenverkehrsrechtlicher<br />
Vorschriften vom 07.08.2002 (<br />
BGBl. I, 3267 )<br />
FmH Fahrrad mit Hilfsmotor<br />
Fn. Fußnote<br />
ggf. gegebenenfalls<br />
GVBl. Gesetz- und Verordnungsblatt<br />
i.d.F. in <strong>der</strong> Fassung<br />
i.d.R. in <strong>der</strong> Regel<br />
i.g.O. innerhalb geschlossener Ortschaften<br />
IM Innenminister<br />
i.S.d. im Sinne des (<strong>der</strong>)<br />
i.S.v. im Sinne von<br />
i.V.m. in Verbindung mit<br />
JR Juristische Rundschau ( Zeitschrift, zitiert nach<br />
Jahr und Seite )<br />
Jura Juristische Ausbildung (Zeitschrift, zitiert nach<br />
Jahr und Seite)<br />
JuS Juristische Schulung (Zeitschrift, zitiert nach Jahr<br />
und Seite)<br />
Seite - III -
Abkürzungsverzeichnis<br />
Justiz <strong>Die</strong> Justiz (Amtsblatt des Justizministers BW, zitiert<br />
nach Jahr und Seite)<br />
JZ Juristenzeitung (zitiert nach Jahr und Seite)<br />
KBA Kraftfahrbundesamt<br />
Kfz Kraftfahrzeug<br />
KG Kammergericht<br />
KKR Kleinkraftrad<br />
km/h Kilometer pro Stunde<br />
KOM Kraftomnibus<br />
Kriminalistik Zeitschrift ( zitiert nach Jahr und Seite )<br />
krit. kritisch<br />
kW Kilowatt<br />
lfd. laufend(e)<br />
LG L<strong>an</strong>dgericht<br />
lit. litera ( Buchstabe )<br />
Lkw Lastkraftwagen<br />
LoF L<strong>an</strong>d- o<strong>der</strong> Forstwirtschaft<br />
m Meter<br />
max. maximal<br />
m.E. meines Erachtens<br />
MBl. Ministerialblatt, amtliche Mitteilungen<br />
MDR Monatszeitschrift für Deutsches Recht (zitiert nach<br />
Jahr und Seite)<br />
m.w.N. mit weiteren Nachweisen<br />
n.F. neue Fassung<br />
NJW Neue Juristische Wochenschrift (Zeitschrift, zitiert<br />
nach Jahr und Seite)<br />
NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift / Rechtsprechungsreport<br />
(Zeitschrift, zitiert nach Jahr und<br />
Seite)<br />
NStZ Neue Zeitschrift für Strafrecht (zitiert nach Jahr<br />
und Seite)<br />
Nr. Nummer<br />
NTS NATO-Truppenstatut vom 19.07.1961 [ BGBl. II<br />
(1961), 1190 ]<br />
NTS-ZA Zusatzabkommen zum Nato – Truppenstatut vom<br />
03.08.1959 [ BGBl. II (1961), 1183, 1218 ) i.d.F.<br />
vom 18.03.1993 [BGBl. II (1994), 2598 ]<br />
n.v. nicht veröffentlicht<br />
Seite - IV -
Abkürzungsverzeichnis<br />
NVwZ Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht (zitiert nach<br />
Jahr und Seite)<br />
NVwZ-RR Neue Zeitschrift für Verwaltungsrecht / Rechtsprechungsreport<br />
(zitiert nach Jahr und Seite)<br />
NZV Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht (zitiert nach<br />
Jahr und Seite)<br />
o.g. oben gen<strong>an</strong>nte<br />
OLG Oberl<strong>an</strong>desgericht<br />
OVG Oberverwaltungsgericht<br />
OWi Ordnungswidrigkeit<br />
OWiG Ordnungswidrigkeitengesetz i.d.F. vom<br />
25.08.1998 (BGBl. I, 2432, 3127)<br />
Pkw Personenkraftwagen<br />
PolizeiInfo Polizei Info (Zeitschrift, zitiert nach Ausgabe, Jahr<br />
und Seite)<br />
PVT Polizei Verkehr Technik (Zeitschrift, zitiert nach<br />
Jahr und Seite)<br />
RdErl. Run<strong>der</strong>laß<br />
Rn. R<strong>an</strong>dnummer<br />
SAM Selbstfahrende Arbeitsmaschine<br />
SMBl. Sammelministerialblatt, amtliche Mitteilungen<br />
(zitiert nach Jahr und Seite)<br />
StGB Strafgesetzbuch i.d.F. vom 22.08.2002 (BGBl. I,<br />
3390)<br />
StVE Cramer/Berz/Gontard, Straßenverkehrs-<br />
Entscheidungen (Nummern ohne Paragraphen<strong>an</strong>gabe<br />
beziehen sich auf die erläuterte Vorschrift)<br />
StVG Straßenverkehrsgesetz i.d.F. vom 19.03.2003<br />
(BGBl. I, 310, 919)<br />
StVO Straßenverkehrsordnung i.d.F. vom 25.06.1998<br />
(BGBl. I, 1654)<br />
StVZO Straßenverkehrszulassungsordnung i.d.F. vom<br />
22.10.2003 (BGBl. I, 2085)<br />
Nr. 1, S. 6 )<br />
s.u. siehe unten<br />
t Tonnen<br />
TBNR Tatbest<strong>an</strong>dsnummer nach Tatbest<strong>an</strong>dskatalog<br />
Urt. Urteil<br />
Seite - V -
u.U. unter Umständen<br />
Abkürzungsverzeichnis<br />
VA Verwaltungsakt<br />
VD Verkehrsdienst (Zeitschrift, zitiert nach Jahr und<br />
Seite)<br />
VersR Versicherungsrecht (Zeitschrift, zitiert nach Jahr<br />
und Seite)<br />
VG Verwaltungsgericht<br />
VGH Verwaltungsgerichtshof<br />
vgl. vergleiche<br />
VkBl. Verkehrsblatt, Amtliche Mitteilungen des BMV<br />
(zitiert nach Jahr und Seite)<br />
VM Verkehrsrechtliche Mitteilungen (Zeitschrift, zitiert<br />
nach Jahr und Seite)<br />
VO Verordnung<br />
VR Verwaltungsrundschau (Zeitschrift, zitiert nach<br />
Jahr und Seite)<br />
VRS Verkehrsrechtssammlung (Zeitschrift, zitiert nach<br />
B<strong>an</strong>d und Seite)<br />
VwGO Verwaltungsgerichtsordnung<br />
VwV Verwaltungsvorschrift<br />
VwVfG Verwaltungsverfahrensgesetz<br />
VZR Verkehrszentralregister<br />
WÜ Übereinkommen über den Straßenverkehr ( Wiener<br />
Übereinkommen ) vom 08.11.1968 [ BGBl. II<br />
(1977), 811 ]<br />
z.B. zum Beispiel<br />
ZfS Zeitschrift für Schadensrecht (zitiert nach Jahr und<br />
Seite)<br />
zGM zulässige Gesamtmasse<br />
zHG zulässige Höchstgeschwindigkeit<br />
zust. zuständig, zustimmend<br />
Zweite Führerscheinrichtlinie Richtlinie 1991/439EWG des Rates vom<br />
29.07.1991 ABl. EG Nr. L 237 vom 24.08.1991<br />
Seite - VI -
Literaturverzeichnis<br />
Literaturverzeichnis<br />
Ba<strong>der</strong> Verkehrsrechtliche Würdigung des „Dreirades“ DUO 4/1,<br />
in: PVT 1992, 172<br />
Berr, Wolfg<strong>an</strong>g<br />
Berr, Wolfg<strong>an</strong>g /<br />
Hauser, Josef /<br />
Schäpe, Markus<br />
Wohnmobile und Wohn<strong>an</strong>hänger, Verlag C.H. Beck,<br />
München, 1. Aufl. 1985<br />
Das Recht des ruhenden Verkehrs, Verlag C.H. Beck,<br />
München, 2. Aufl. 2005<br />
Bouska, Wolfg<strong>an</strong>g Fahrerlaubnisrecht, Verlag C. H. Beck, München, 1. Aufl.<br />
1987, zitiert als: Bouska (Vorauflage)<br />
Bouska, Wolfg<strong>an</strong>g /<br />
Laeverenz, Judith<br />
Fahrerlaubnisrecht, Verlag C.H. Beck, München, 3. Aufl.<br />
2004<br />
Bouska, Wolfg<strong>an</strong>g Fahrberechtigung von Berufspendlern mit ausländischer<br />
Fahrerlaubnis im Inl<strong>an</strong>d, in: NZV 2000, 321<br />
Bouska, Wolfg<strong>an</strong>g Vorläufige Teilumsetzung <strong>der</strong> Führerscheinrichtlinie <strong>der</strong><br />
EU vom 29.07.1991, in: DAR 1996,276<br />
Bouska, Wolfg<strong>an</strong>g / Leue,<br />
Anke<br />
StVO, Verlag Jehle, München, 20. Aufl. 2002<br />
Burghardt/Gr<strong>an</strong>ow Das Abkommen zur Än<strong>der</strong>ung des Zusatzabkommens<br />
zum Nato – Truppenstatut (ZA-NTS), in: NJW 1995, 424<br />
Braun/Konitzer/<br />
Löffelholz/Wehrmeister<br />
StVZO, Kirschbaum Verlag, Bonn, Losebl. St<strong>an</strong>d:<br />
06/2003, zitiert als Braun et al.<br />
Brötel Haftungsausschluß für l<strong>an</strong>gsam fahrende Fahrzeuge, in:<br />
NZV 1997, 381<br />
Brutscher, <strong>Bernd</strong> Auslän<strong>der</strong> im deutschen Straßenverkehr, Verlag Deutsche<br />
Polizeiliteratur, Hilden, 2. Aufl. 1999<br />
Brutscher, <strong>Bernd</strong> / Baum,<br />
Carsten<br />
Verkehrsstraftaten, Verlag Deutsche Polizeiliteratur,<br />
Hilden, 6. Aufl. 2006<br />
Dickm<strong>an</strong>n Son<strong>der</strong>rechte mit privatem Pkw ? – Problematiken des §<br />
35 StVO für Mitglie<strong>der</strong> freiwilliger Feuerwehren, in:<br />
Seite - VII -
NZV 2003, 220<br />
Literaturverzeichnis<br />
Dvorak Liegenbleiben mit einem Kfz wegen Kraftstoffm<strong>an</strong>gel,<br />
in: DAR 1984, 313<br />
Europäische Kommission<br />
(Hrsg.)<br />
Führerscheine in <strong>der</strong> Europäischen Union, Amt für<br />
amtliche Veröffentlichungen <strong>der</strong> Europäischen<br />
Gemeinschaften, Luxemburg, 2. Aufl. 2005<br />
Filthaut <strong>Die</strong> Gefährdungshaftung für Schäden durch<br />
Oberleitungsbusse, in: NZV 1995, 52<br />
Geiger Rechtsschutz gegen Maßnahmen <strong>der</strong><br />
Fahrerlaubnisbehörden, in: DAR 2001, 488<br />
Geiger Neues Ungemach durch die 3. Führerscheinrichtlinie <strong>der</strong><br />
Europäischen Gemeinschaften?, in: DAR 2007, 126<br />
Göhler OWiG, Verlag C.H. Beck, München, 13. Aufl. 2002<br />
Grams Motorbetriebene Skateboards als Kfz im Straßenverkehr,<br />
in: NZV 1994, 172<br />
Grams Was sind Skater: Fahrzeuge o<strong>der</strong> Spielzeuge?, in: NZV<br />
1997, 65<br />
Greuel Abschleppen, Anschleppen, Schleppen aus<br />
strafrechtlicher Sicht, in: DAR 1980, 332<br />
Grohm<strong>an</strong>n Öffentlicher Straßenverkehr – Grundsätze und Problemfälle,<br />
in: PVT 1997, 213<br />
Grohm<strong>an</strong>n/Sibbel <strong>Die</strong> Tücken ausländischer Fahrerlaubnisse, in: VD 2000,<br />
245<br />
Grunewald, Christi<strong>an</strong> Zum Begriff des Kfz (Gleitschirmpropellermotor), in:<br />
NZV 2000, 384<br />
Heiler, Gebhard /<br />
Jagow, Joachim<br />
Führerschein, Heinrich Vogel Verlag, München, 4. Aufl.<br />
1998<br />
Heinrich, Ulrich Verkehrsrechtliche Beurteilung frisierter Mofas, in:<br />
PolizeiJournal 1999, 35<br />
Heinrich, Ulrich Motorisierte Tretroller, sog. GoPed im öffentlichen<br />
Straßenverkehr, in: PolizeiJournal 2004, 33<br />
Heinrich, Ulrich Mofa-Tuning: Verkehrsrechtliche Betrachtung, in:<br />
PolizeiInfo 2/2007, 28<br />
Seite - VIII -
Literaturverzeichnis<br />
Hentschel, Peter Straßenverkehrsrecht, Verlag C.H. Beck, München, 39.<br />
Aufl. 2007<br />
Seite - IX -
Abbildungsverzeichnis<br />
Hier ist Platz für ein etwaiges Abbildungsverzeichnis.<br />
Abbildungsverzeichnis<br />
Seite - X -
Verzeichnis sonstiger Hilfsmittel<br />
Verzeichnis <strong>der</strong> benutzten sonstigen Hilfsmittel und Anlagen<br />
Hier ist Platz für ein etwaiges weiteres Verzeichnis.<br />
Seite - XI -
1 Grundsatz <strong>der</strong> Verkehrsfreiheit<br />
Verkehrsfreiheit<br />
Gemäß § 1 FeV ist zum Verkehr auf öffentlichen Straßen je<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n zugelassen, soweit<br />
nicht für die Zulassung zu einzelnen Verkehrsarten ein Erlaubnisverfahren<br />
vorgeschrieben ist.<br />
1.1 Inhalt <strong>der</strong> Vorschrift<br />
§ 1 FeV beinhaltet den Grundsatz <strong>der</strong> allgemeinen Verkehrsfreiheit. 1<br />
<strong>Die</strong>se besteht jedoch nicht:<br />
- für verkehrsschwache Personen ( § 2 FeV ) 2<br />
- soweit für einzelne Verkehrsarten eine Erlaubnis vorgeschrieben ist (§ 4 FeV)<br />
1.1.1 Öffentlicher Verkehrsraum<br />
<strong>Die</strong> Verhaltensvorschriften <strong>der</strong> StVO beziehen sich grundsätzlich nur auf den<br />
öffentlichen Verkehrsraum. Darunter fallen alle für den Straßenverkehr o<strong>der</strong> für<br />
einzelne Arten des Straßenverkehrs bestimmten Flächen 3 .<br />
1.1.2 Verkehrsteilnehmer<br />
Das Recht <strong>der</strong> allgemeinen Verkehrsfreiheit besteht dabei für Je<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n.<br />
Darunter versteht m<strong>an</strong> zunächst alle Verkehrsteilnehmer, die sich im öffentlichen<br />
Straßenverkehr aufhalten und sich körperlich und unmittelbar durch Tun o<strong>der</strong><br />
Unterlassen verkehrserheblich verhalten, ohne dass es dabei auf Absicht und Zweck<br />
<strong>an</strong>kommt. 4<br />
Zu diesen aktiven Verkehrsteilnehmern zählen insbeson<strong>der</strong>e 5 :<br />
- Kraftfahrzeugführer i.S.d. § 1 II StVG<br />
- Fahrlehrer ( § 3 StVG ) 6<br />
1 Hentschel, Rn. 1 zu § 1 FeV; Bouska, Rn. 2 zu § 1 FeV.<br />
2 Bouska, Rn. 2 zu § 1 FeV.<br />
3 So noch § 1 Satz 2 StVZO a.F.<br />
4 Hentschel, Rn. 17 zu § 1 StVO; Bouska/Leue, Rn. 4 zu § 1 StVO; Mindorf, Kap. 3.1, S. 2.<br />
5 Hentschel, Rn. 17 zu § 1 StVO; Bouska/Leue, Rn. 4 zu § 1 StVO; Mindorf, Kap. 3.1, S. 2, 3.<br />
6 Bouska/Leue, Rn. 4 zu § 1 StVO.<br />
Seite - 1 -
Verkehrsfreiheit<br />
- Straßenbahnfahrer 7<br />
- Lenker eines abgeschleppten Fahrzeugs 8<br />
- Sonstige Fahrzeugführer ( also Radfahrer, Gesp<strong>an</strong>nfahrer )<br />
- Lenker <strong>der</strong> Hinterachse bei L<strong>an</strong>gfahrzeugen 9<br />
- Fußgänger 10<br />
- Reiter, Tierführer<br />
- Beifahrer auf Zweirä<strong>der</strong>n 11<br />
- <strong>der</strong>jenige, <strong>der</strong> sein Fahrzeug ordnungsgemäß o<strong>der</strong> auch ordnungswidrig geparkt<br />
hat, da er durch sein parkendes Fahrzeug auf den öffentlichen Straßenverkehr<br />
einwirkt 12<br />
Des Weiteren zählen jedoch auch die so gen<strong>an</strong>nten passiven Verkehrsteilnehmer<br />
hierzu 13 :<br />
- <strong>der</strong> auf einer B<strong>an</strong>k sitzende Pass<strong>an</strong>t<br />
- Fahrgast im ÖPNV<br />
- Insasse ( Beifahrer ) in einem Kfz<br />
<strong>Die</strong> Zuordnung k<strong>an</strong>n aber sehr schnell wechseln, z.B. durch:<br />
- Ablenkung o<strong>der</strong> Behin<strong>der</strong>ung des Kraftfahrzeugführers<br />
- Hineingreifen ins Lenkrad<br />
- Bereiten von Verkehrshin<strong>der</strong>nissen ( § 32 StVO )<br />
- Verkehrsbeeinträchtigungen ( § 33 StVO )<br />
- gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr ( § 315 b StGB )<br />
<strong>Die</strong> Unterscheidung zwischen aktivem und passivem Verkehrsteilnehmer ist<br />
hinsichtlich <strong>der</strong> Schutzbestimmung des § 1 StVO ( = ständige Vorsicht und Rücksicht<br />
sowie Ausschluss von vermeidbarer Belästigung und Behin<strong>der</strong>ung, Gefährdung und<br />
7 BGH VRS 5, 304 (= DAR 1953, 118)<br />
8 OLG Hamm VRS 22, 220<br />
9 Bouska/Leue, Rn. 4 zu § 1 StVO; Mindorf, Kap. 3.1, S. 2.<br />
10 OLG Koblenz StVE 103 zu § 142 StGB (= MDR 1993, 366).<br />
11 BGH VRS 18, 415; OLG Stuttgart VM 1960, 40.<br />
12 OLG Hamburg VRS 23, 139; BayObLG VRS 24, 460; BayObLG VRS 27, 220; OLG Celle VM 1972, 68;<br />
VGH Kassel NJW 1999, 3650; VG Berlin DAR 2001, 234.<br />
13 Mindorf, Kap. 3.1, S. 3.<br />
Seite - 2 -
Verkehrsfreiheit<br />
Schädigung ) nicht von Bedeutung. Jedoch muss <strong>der</strong> aktive Verkehrsteilnehmer die<br />
Eignungsvoraussetzungen des § 2 FeV erfüllen und den § 1 StVO beachten. 14<br />
14 Mindorf, Kap. 3.1.1, S. 3.<br />
Seite - 3 -
Checkliste für Fahrzeugart: (…)<br />
1 Zulassungsrecht<br />
1.1 Definitionen<br />
1.1.1 nach EG – Rili<br />
1.1.2 nach StVZO<br />
1.1.3 nach FZV<br />
1.1.4 Merkblätter des BMV<br />
1.2 Überg<strong>an</strong>gsbestimmungen<br />
1.3 Abgrenzungen<br />
1.4 Zulassung<br />
1.5 Betriebserlaubnis<br />
1.6 Kennzeichen<br />
1.7 TÜV<br />
1.8 AU<br />
2 Kraftfahrzeugsteuer<br />
3 Pflichtversicherung<br />
4 Fahrerlaubnisrecht<br />
4.1 Definitionen<br />
4.1.1 nach <strong>der</strong> 3. EG – Rührerscheinrichtlinie<br />
4.1.2 nach FeV<br />
4.1.3 Merkblätter des BMV<br />
4.2 Überg<strong>an</strong>gsbestimmung<br />
4.3 Abgrenzungen<br />
4.4 Fahrerlaubnis (FeV)<br />
4.5 Fahrerlaubnis (StVZO-alt)<br />
4.6 Auflagen und Beschränkungen<br />
5 StVO<br />
5.1 Helmpflicht<br />
5.2 Gurt<br />
5.3 Radwegbenutzung<br />
5.4 <strong>an</strong><strong>der</strong>e<br />
6 AusnahmeVO<br />
6.1 nach StVZO<br />
6.2 nach FeV<br />
6.3 nach StVO<br />
6.4 <strong>an</strong><strong>der</strong>e<br />
7 Weiteres<br />
7.1 GGVSE<br />
7.2 GüKG<br />
7.3 Berufsgenossenschaftliche Vorschriften<br />
7.4 Berufskraftfahrer Qualifizierungsgesetz /-verordnung<br />
7.5 Autobahnmautgesetz<br />
7.6 ECE – Regelung Nr. 69<br />
Checkliste<br />
Seite - 4 -
Klausur<br />
Ort - Ortsbezeichnung<br />
- i.g.O. / a.g.O.<br />
- Autobahn / Kraftfahrstraße / Bundesstraße<br />
Zeit - Wochentag, Uhrzeit<br />
- heute, Uhrzeit<br />
Klausur<br />
Person - (A), 17 Jahre – keine Fahrerlaubnis-<br />
- siehe beigefügte (Mofa-)Prüfbescheinigung<br />
- siehe beigefügte Prüfungsbescheinigung zum Begleiteten<br />
Fahren ab 17 Jahre<br />
- siehe beigefügten Führerschein<br />
Fahrzeug - siehe beigefügten Fahrzeugschein<br />
- siehe beigefügte Betriebserlaubnis<br />
Sachverhalt Zur o.g. Zeit befuhr <strong>der</strong> (A) mit seinem Fahrzeug die …<br />
Seite - 5 -
Lösungsskizze<br />
Lösung<br />
Bei <strong>der</strong> Lösung komplexer verkehrsrechtlicher Sachverhalte empfiehlt es sich zunächst<br />
die zulassungsrechtlichen Fragen zu erörtern. In <strong>der</strong> Regel zeichnet sich dabei bereits<br />
die fahrerlaubnisrechtliche Lösung ab. Erst d<strong>an</strong>ach sind etwaige Verstöße nach <strong>der</strong><br />
StVZO und StVO zu prüfen.<br />
Für das hier <strong>an</strong>stehende Seminar wird auszugsweise das Prüfungsschema des zulassungs-<br />
und fahrerlaubnisrechtlichen Teils abgedruckt.<br />
1 Zulassungsrecht<br />
<strong>Die</strong> methodische Lösung von zulassungsrechtlichen Sachverhalten sollte mit nachfolgen<strong>der</strong><br />
Begründung nach folgendem Schema zu erfolgen:<br />
Das Verkehrsstrafrecht nimmt innerhalb es Strafrechts einen beson<strong>der</strong>s breiten Raum<br />
ein.<br />
<strong>Die</strong> für den Straßenverkehr relev<strong>an</strong>ten strafrechtlichen Vorschriften befinden sich im<br />
allgemeinen Strafgesetzbuch. Hier bilden die das Fehlverhalten im Straßenverkehr betreffenden<br />
Strafvorschriften des § 142 StGB (Unfallflucht), § 315b (Gefährlicher Eingriff<br />
in den Straßenverkehr), § 315c StGB (Gefährdung des Straßenverkehrs), § 316<br />
StGB (Trunkenheit im Straßenverkehr) den eigentlichen Kern des Verkehrsstrafrechts.<br />
<strong>Die</strong>s alles wird in erheblichem Maße durch Straftatbestände des StVG [hier insbeson<strong>der</strong>e<br />
§ 21 StVG (Fahren ohne Fahrerlaubnis)], PflichtVersG und den Steuergesetzen ergänzt.<br />
Aus alledem folgt, dass das Verkehrsstrafrecht im heutigen Rechtssystem kein Nebenstrafrecht<br />
mehr ist, son<strong>der</strong>n eine überragende zentrale Bedeutung hat.<br />
Das bedeutet aber auch, dass verkehrsstrafrechtliche Sachverhalte im Einkl<strong>an</strong>g mit <strong>der</strong><br />
Ihnen vertrauten juristischen Methodik einer Lösung zugeführt werden müssen. Das<br />
Aufbauschema ist gleich.<br />
Dennoch gibt es gute Gründe, insbeson<strong>der</strong>e im Zusammenh<strong>an</strong>g mit <strong>der</strong> Lösung zulassungsrechtlicher<br />
Sachverhalte von dem Aufbauschema abzuweichen:<br />
In <strong>der</strong> Mehrheit <strong>der</strong> Fälle wird das Vorh<strong>an</strong>densein <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Zulassung im<br />
Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle o<strong>der</strong> <strong>der</strong> Verfolgung beispielsweise einer<br />
Verkehrsordnungswidrigkeit nach <strong>der</strong> StVO überprüft. Ihrem Wesen nach erfolgt die<br />
allgemeine Verkehrskontrolle verdachtsfrei. Aber auch bei <strong>der</strong> Verfolgung einer Verkehrsordnungswidrigkeit<br />
liegt nicht auch gleichzeitig <strong>der</strong> Verdacht Zulassungsverstoßes<br />
vor.<br />
Mit Blick auf die polizeiliche Verkehrsüberwachungspraxis wird m<strong>an</strong> also zu einer <strong>an</strong><strong>der</strong>en<br />
Prüfungsabfolge kommen müssen: am Beginn einer Kontrolle steht regelmäßig<br />
die Überprüfung <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Zulassung, ohne dass zu diesem Zeitpunkt ein Anf<strong>an</strong>gsverdacht<br />
etwa im Hinblick auf das Vorliegen eines Zulassungsverstoßes bestünde.<br />
Erst, wenn sich bei dieser Prüfung herausstellt, dass das Fahrzeug nicht ordnungsgemäß<br />
zugelassen o<strong>der</strong> in Betrieb gesetzt ist, ergibt sich gleichzeitig <strong>der</strong> Verdacht auf das Vorliegen<br />
zumindest einer Ordnungswidrigkeit i.S.d. Zulassungsrechts.<br />
Seite - 6 -
Lösung<br />
<strong>Die</strong> Aufgabenstellung beinhaltet bei strafrechtlichen Sachverhalten gemeinhin die Frage<br />
nach <strong>der</strong> Strafbarkeit <strong>der</strong> h<strong>an</strong>delnden Personen. Demgegenüber wird bei <strong>der</strong> Lösung <strong>der</strong><br />
hier in Rede stehenden Sachverhalte eine Beurteilung aus zulassungsrechtlicher Sicht<br />
gefor<strong>der</strong>t zunächst ohne Rücksicht darauf, ob sich er Kraftfahrzeugführer strafbar gemacht<br />
hat o<strong>der</strong> nicht. <strong>Die</strong>se Vorgehensweise ist <strong>der</strong> Praxis geschuldet, denn hier wie<br />
dort stellt sich g<strong>an</strong>z überwiegend heraus, dass das kontrollierte Fahrzeug sehr wohl ordnungsgemäß<br />
in Betrieb genommen wurde. <strong>Die</strong>s zu begründen aber ist auch Prüfungsleistung.<br />
Ergibt sich aus dem Sachverhalt jedoch eindeutig, dass ein zulassungsrechtlicher Verstoß<br />
vorliegt, springt also die Strafbarkeit des Kraftfahrzeugführers sozusagen ins Auge,<br />
so k<strong>an</strong>n <strong>der</strong> Bearbeiter weiterhin entsprechend dem ihm bek<strong>an</strong>nten strafrechtlichen Prüfungsschema<br />
vorgehen.<br />
<strong>Die</strong> Prüfung des subjektiven Tatbest<strong>an</strong>ds (Vorsatz / Fahrlässigkeit) sowie <strong>der</strong> Rechtswidrigkeit<br />
und <strong>der</strong> Schuld des Betroffenen k<strong>an</strong>n bei Ordnungswidrigkeiten ggf. auch<br />
unterbleiben. Sie ist deshalb hier nicht aufgeführt.<br />
Hinweis<br />
Im Falle zulassungsrechtlicher Ordnungswidrigkeiten genügt regelmäßig<br />
bereits die fahrlässige Tatbest<strong>an</strong>dsverwirklichung.<br />
Rechtfertigungs- und Schuldausschließungsgründe liegen im Sachverhalt<br />
regelmäßig nicht vor.<br />
1.1 Vorprüfung<br />
<strong>Die</strong> Überschrift k<strong>an</strong>n meist knapp gehalten werden:<br />
Beispiele<br />
„Fraglich ist, ob das in Rede stehende Fahrzeug / Kfz ordnungsgemäß<br />
zugelassen / in Betrieb gesetzt wurde?“<br />
„Fraglich ist, ob das Fahrzeug / Kfz des (A) i.S.d. zulassungsrechtlichen<br />
Vorschriften ordnungsgemäß in Betrieb gesetzt wurde.“<br />
1.2 Grundsatz <strong>der</strong> Zulassungspflicht<br />
Gemäß § 1 I StVG müssen Kfz und ihre Anhänger, die auf öffentlichen Straßen in Betrieb<br />
gesetzt werden sollen, von <strong>der</strong> zuständigen Behörde (Zulassungsbehörde) zum<br />
Verkehr zugelassen sein.<br />
Hier muss jetzt die Sachverhalts bezogene Prüfung erfolgen<br />
Seite - 7 -
- des öffentlichen Verkehrsraumes (2.1) ,<br />
- des Kraftfahrzeuges / Anhängers (2.2) und<br />
- ob das Kfz in Betrieb gesetzt (2.3) wird<br />
1.2.1 Öffentlicher Verkehrsraum<br />
Definition<br />
Lösung<br />
Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem Wegerecht<br />
des Bundes und <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> dem allgemeinen Verkehr gewidmeten<br />
Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher Verkehrsraum); zum<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>en gehören auch die Verkehrsflächen dazu, auf denen ohne Rücksicht<br />
auf eine verwaltungsrechtliche Widmung o<strong>der</strong> auf die Eigentumsverhältnisse<br />
(Privatgrundstück) auf Grund ausdrücklicher o<strong>der</strong> stillschweigen<strong>der</strong><br />
Duldung des Verfügungsberechtigten die Benutzung durch<br />
einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist [= tatsächlich-öffentlicher<br />
Verkehrsraum (BGH VRS 22, 185; BGH NZV 1998, 418)].<br />
Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung <strong>der</strong> in Rede<br />
stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für je<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n o<strong>der</strong> einer allgemein<br />
bestimmten Personengruppe dauernd o<strong>der</strong> zeitweise möglich ist und auch<br />
tatsächlich und nicht nur gelegentlich von je<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n o<strong>der</strong> einer allgemein<br />
bestimmten Personengruppe benutzt wird.<br />
1.2.2 Kraftfahrzeug<br />
Definition Als Kfz gelten L<strong>an</strong>dfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden,<br />
ohne <strong>an</strong> Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II StVG).<br />
Anhänger<br />
Definition Als Anhänger bezeichnet m<strong>an</strong> Fahrzeuge, die zum Anhängen <strong>an</strong> ein Kfz<br />
bestimmt und geeignet sind (Legaldefinition § 2 Nr. 2 FZV).<br />
1.2.3 In Betrieb setzen<br />
Definition In Betrieb setzen bedeutet die bestimmungsgemäße Verwendung des<br />
Fahrzeugs als Fortbewegungsmittel. D<strong>an</strong>ach ist ein Kfz in Betrieb, sol<strong>an</strong>ge<br />
<strong>der</strong> Motor das Kfz o<strong>der</strong> eine seiner Betriebseinrichtungen bewegt.<br />
Sachverhalts<strong>an</strong>nahme<br />
Es ist durchaus zulässig, vom in Betrieb setzen eines Fahrzeugs auf das<br />
Führen und umgekehrt zu schließen.<br />
1.2.4 Grundregel <strong>der</strong> Zulassung<br />
Zum Verkehr auf öffentlichen Straßen sind gemäß § 16 I StVZO alle Fahrzeuge zugelassen,<br />
die den Vorschriften <strong>der</strong> StVZO und <strong>der</strong> StVO entsprechen, sofern nicht für die<br />
Zulassung einzelner Fahrzeugarten ein Erlaubnisverfahren vorgeschrieben ist.<br />
Seite - 8 -
Lösung<br />
<strong>Die</strong>ser Grundsatz <strong>der</strong> allgemeinen Verkehrsfreiheit wird jedoch durch die Vorschriften<br />
<strong>der</strong> FZV eingeschränkt.<br />
1.2.5 Erlaubnis- und Ausweispflicht<br />
Inwieweit zur Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs eine Zulassung erfor<strong>der</strong>lich ist, ergibt<br />
sich aus § 1 I StVG und den ihn ausführenden Vorschriften <strong>der</strong> §§ 1, 3, 4 FZV.<br />
Wer ein Kfz ohne die erfor<strong>der</strong>liche Zulassung in Betrieb setzt, führt es entgegen den<br />
Bestimmungen des § 3 o<strong>der</strong> § 4 FZV.<br />
1.3 Ausnahmen von <strong>der</strong> Zulassungspflicht<br />
Hier erfolgt die Prüfung, ob eine Ausnahme von <strong>der</strong> Zulassungspflicht vorliegt.<br />
Ausnahmetatbest<strong>an</strong>d<br />
§ 1 FZV<br />
Ausnahmetatbest<strong>an</strong>d<br />
§ 3 II FZV<br />
Gemäß § 1 FZV ist diese Verordnung auf Kfz mit einer BbH ≤ 6 km/h<br />
und ihre Anhänger nicht <strong>an</strong>zuwenden. Lediglich „schnellere“ Fahrzeuge<br />
unterliegen nach näherer Maßgabe <strong>der</strong> §§ 3 und 4 FZV dem Zulassungsverfahren.<br />
<strong>Die</strong> Ausnahmen sind in § 3 II FZV abschließend geregelt.<br />
Liegt keine Ausnahme vor, k<strong>an</strong>n dieser Punkt knapp abgeh<strong>an</strong>delt werden.<br />
Beispiel „Im vorliegenden Fall ist die FZV aufgrund <strong>der</strong> entgegenstehenden Vorschrift<br />
des § 1 FZV nicht <strong>an</strong>wendbar.“<br />
„Im vorliegenden Fall liegt jedoch ersichtlich kein Ausnahmetatbest<strong>an</strong>d<br />
des § 3 II FZV vor.“<br />
1.4 Zulassungsrechtliche Bestimmung<br />
D<strong>an</strong>ach ist festzustellen, aus welcher Bestimmung sich die Zulassungspflicht bzw. die<br />
Zulassungsfreiheit für das in Rede stehende Fahrzeug ergibt. Hierzu ist folgendes festzustellen:<br />
- Welches Fahrzeug wird im Sachverhalt in Betrieb gesetzt?<br />
- Beschreibung <strong>der</strong> technischen Eckdaten und Definition des Fahrzeuges<br />
- Ist dafür eine Zulassung erfor<strong>der</strong>lich?<br />
- Siehe § 3 I FZV<br />
Seite - 9 -
Lösung<br />
- Ist das Fahrzeug von den Vorschriften über das Zulassungsverfahren<br />
ausgenommen?<br />
- Siehe § 3 II FZV<br />
- Liegt für das Fahrzeug eine Zulassung vor bzw. sind die Voraussetzungen<br />
für eine Inbetriebsetzung zulassungsfreier Fahrzeuge erfüllt?<br />
- Ausweislich <strong>der</strong> <strong>der</strong> Klausur beigefügten Fahrzeugpapiere<br />
1.5 Mitführ- und Aushändigungspflicht <strong>der</strong> Zulasungsbescheinigung<br />
<strong>Die</strong> Zulassung ist gemäß § 11 V FZV durch eine amtliche Bescheinigung (Zulassungsbescheinigung)<br />
nachzuweisen.<br />
<strong>Die</strong> Zulassungsbescheinigung ist beim Führen von Fahrzeugen mitzuführen und zuständigen<br />
Personen auf Verl<strong>an</strong>gen zur Prüfung auszuhändigen.<br />
Hinweis Wird die Zulassungsbescheinigung nicht mitgeführt o<strong>der</strong> zuständigen Personen<br />
auf Verl<strong>an</strong>gen nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht <strong>der</strong> Kraftfahrzeugführer<br />
lediglich eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 11 V FZV<br />
i.V.m. § 48 Nr. 5 i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 74; TBNR 811100 bzw.<br />
811106; VG 10,- €); die Zulassung selbst bleibt un<strong>an</strong>getastet.<br />
1.5.1 Zulassung<br />
Definition <strong>Die</strong> Zulassung ist <strong>der</strong> rechtstechnische Ausdruck für die behördlich erteilte<br />
Ermächtigung (= begünstigen<strong>der</strong> Verwaltungsakt) zum Betrieb eines<br />
Fahrzeugs.<br />
1.5.2 Zulassungsbescheinigung<br />
Definition <strong>Die</strong> Zulassungsbescheinigung ist das amtliche Dokument, das die Zulassung<br />
zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Erteilung bescheinigt.<br />
1.6 Beson<strong>der</strong>heiten (nur prüfen wenn relev<strong>an</strong>t)<br />
Z.B.: Brauchtumsver<strong>an</strong>staltung, Rote Kennzeichen u.ä.<br />
1.7 Zwischenergebnis<br />
Hier erfolgt die Feststellung, ob das Fahrzeug ordnungsgemäß zugelassen ist bzw. die<br />
Voraussetzungen für eine Inbetriebsetzung zulassungsfreier Fahrzeuge vorliegt.<br />
Ist dies nachgewiesen, ist die Prüfung beendet.<br />
Beispiel „(A) ist somit – nicht - im Besitz <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Zulassung / Voraus-<br />
Seite - 10 -
setzungen.“<br />
Lösung<br />
Hat er die erfor<strong>der</strong>liche(n) Zulassung / Voraussetzungen nicht nachgewiesen, erfolgt die<br />
Feststellung, dass <strong>der</strong> Betroffene nicht über die erfor<strong>der</strong>liche(n) Zulassung / Voraussetzungen<br />
verfügt.<br />
Beispiel „(A) ist somit nicht im Besitz <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Zulassung / Voraussetzungen.“<br />
1.8 Ordnungswidriges Verhalten des (A)<br />
1.8.1 Obersatz<br />
Der Obersatz besteht aus einer präskriptiven Aussage des Inhalts, dass bei Vorliegen<br />
bestimmter Voraussetzungen eine bestimmte Rechtsfolge eintreten soll: „<strong>Die</strong> Rechtsfolge<br />
tritt ein, wenn die im Tatbest<strong>an</strong>d beschriebenen Voraussetzungen vorliegen“.<br />
Der Obersatz muss folgende vier Elemente enthalten:<br />
-Täter Insbeson<strong>der</strong>e bei mehreren Beteiligten muss die Person genau bezeichnet<br />
werden.<br />
-H<strong>an</strong>dlung Welches Verhalten (Tun o<strong>der</strong> Unterlassen) wird strafrechtlich geprüft?<br />
-Delikt Genaue Bezeichnung des Delikts (z.B.: Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs<br />
ohne die erfor<strong>der</strong>liche Zulassung).<br />
-Strafnorm Welche Strafnorm wird geprüft. Dazu ist das Gesetz zu benennen (z.B.: §<br />
3 I FZV).<br />
Hier ist also klarzustellen, welches konkrete Verhalten welcher Person auf welche Tatbest<strong>an</strong>dsverwirklichung<br />
hin geprüft werden soll. Formuliert wird im Konjunktiv, da das<br />
Ergebnis ja noch nicht feststeht.<br />
Beispiele<br />
„Indem (A) mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erfor<strong>der</strong>liche Zulassung zu<br />
besitzen, könnte er sich <strong>der</strong> Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs gemäß § 3 I<br />
FZV schuldig gemacht haben.“<br />
„Indem (A) mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erfor<strong>der</strong>liche Zulassung zu<br />
besitzen, könnte er sich <strong>der</strong> Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs gemäß § 3 I<br />
FZV ordnungswidrig verhalten haben.“<br />
„(A) könnte durch die Inbetriebsetzung des Kfz (…) gegen § 3 I FZV verstoßen<br />
haben.“<br />
„<strong>Die</strong> Inbetriebsetzung des in Rede stehenden Fahrzeugs k<strong>an</strong>n eine Ordnungswidrigkeit<br />
des (A) nach § 3 I FZV begründen.“<br />
„(A) k<strong>an</strong>n durch die Inbetriebsetzung seines Lkw ohne die erfor<strong>der</strong>liche<br />
Seite - 11 -
Zulassung den Tatbest<strong>an</strong>d des § 3 I FZV verwirklicht haben.“<br />
Lösung<br />
„Möglicherweise hat (A) eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 3 I FZV beg<strong>an</strong>gen,<br />
als er seinen Lkw in Betrieb setzte.“<br />
1.8.2 Objektiver Tatbest<strong>an</strong>d<br />
Ordnungswidrig h<strong>an</strong>delt, wer fahrlässig o<strong>der</strong> vorsätzlich entgegen § 3 I Satz 1 FZV im<br />
öffentlichen Straßenverkehr ein Fahrzeug ohne die erfor<strong>der</strong>liche Zulassung in Betrieb<br />
setzt.<br />
<strong>Die</strong> einschlägigen Tatbest<strong>an</strong>dsmerkmale wurden bereits sämtlich mit folgendem Ergebnis<br />
geprüft: (A) hat gegen § 3 I FZV verstoßen.<br />
1.8.3 Schlusssatz (Ergebnis)<br />
Beispiele<br />
2 Fahrerlaubnis<br />
„(A) hat sich durch die Inbetriebsetzung eines Fahrzeugs gemäß § 3 I<br />
FZV schuldig gemacht.“<br />
„Indem (A) mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erfor<strong>der</strong>liche Zulassung zu<br />
besitzen, hat er sich gemäß § 3 I FZV ordnungswidrig verhalten.“<br />
„(A) hat durch die Inbetriebsetzung des Kfz (…) gegen § 3 I FZV verstoßen.“<br />
„<strong>Die</strong> Inbetriebsetzung des in Rede stehenden Fahrzeugs hat eine Ordnungswidrigkeit<br />
des (A) nach § 3 I FZV begründet.“<br />
„(A) hat durch die Inbetriebsetzung seines Lkw ohne die erfor<strong>der</strong>liche<br />
Zulassung den Tatbest<strong>an</strong>d des § 3 I FZV verwirklicht.“<br />
„(A) hat eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 3 I FZV beg<strong>an</strong>gen, als er seinen<br />
Lkw in Betrieb setzte.“<br />
<strong>Die</strong> methodische Lösung von fahrerlaubnisrechtlichen Sachverhalten sollte mit wie vor<br />
(vgl. Zulassungsrecht) beschriebener Begründung <strong>an</strong>alog nach folgendem Schema zu<br />
erfolgen:<br />
2.1 Vorprüfung<br />
<strong>Die</strong> Überschrift k<strong>an</strong>n meist knapp gehalten werden:<br />
Seite - 12 -
Beispiele<br />
Lösung<br />
„Fraglich ist, welche Fahrerlaubnisklasse i.S.d. § 6 FeV für (L) beim<br />
Führen <strong>der</strong> gen<strong>an</strong>nten Fahrzeugkombination einschlägig ist?“<br />
„Fraglich ist, ob (A) für das Führen des in Rede stehenden Kfz eine Fahrerlaubnis<br />
benötigt.“<br />
2.2 Grundsatz <strong>der</strong> Fahrerlaubnispflicht<br />
Gemäß § 2 I StVG bedarf <strong>der</strong>jenige, <strong>der</strong> auf öffentlichen Straßen ein Kraftfahrzeug<br />
führt <strong>der</strong> Erlaubnis (Fahrerlaubnis) <strong>der</strong> zuständigen Behörde (Fahrerlaubnisbehörde).<br />
Hier muss jetzt die Sachverhalts bezogene Prüfung erfolgen<br />
- des öffentlichen Verkehrsraumes,<br />
- des Kraftfahrzeuges und<br />
- ob das Kfz geführt wird<br />
2.2.1 Öffentlicher Verkehrsraum<br />
Definition Öffentlich i.S.d. Straßenverkehrsrechts sind zum einen alle nach dem Wegerecht<br />
des Bundes und <strong>der</strong> Län<strong>der</strong> dem allgemeinen Verkehr gewidmeten<br />
Straßen, Wege und Plätze (= öffentlich-rechtlicher Verkehrsraum); zum<br />
<strong>an</strong><strong>der</strong>en gehören auch die Verkehrsflächen dazu, auf denen ohne Rücksicht<br />
auf eine verwaltungsrechtliche Widmung o<strong>der</strong> auf die Eigentumsverhältnisse<br />
(Privatgrundstück) auf Grund ausdrücklicher o<strong>der</strong> stillschweigen<strong>der</strong><br />
Duldung des Verfügungsberechtigten die Benutzung durch<br />
einen unbestimmten Personenkreis zugelassen ist [= tatsächlich-öffentlicher<br />
Verkehrsraum (BGH VRS 22, 185; BGH NZV 1998, 418)].<br />
Öffentlicher Verkehrsraum ist gegeben, wenn die Benutzung <strong>der</strong> in Rede<br />
stehenden Fläche zu Verkehrszwecken für je<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n o<strong>der</strong> einer allgemein<br />
bestimmten Personengruppe dauernd o<strong>der</strong> zeitweise möglich ist und auch<br />
tatsächlich und nicht nur gelegentlich von je<strong>der</strong>m<strong>an</strong>n o<strong>der</strong> einer allgemein<br />
bestimmten Personengruppe benutzt wird.<br />
2.2.2 Kraftfahrzeug<br />
Definition Als Kfz gelten L<strong>an</strong>dfahrzeuge, die durch Maschinenkraft bewegt werden,<br />
ohne <strong>an</strong> Bahngleise gebunden zu sein (Legaldefinition § 1 II StVG).<br />
2.2.3 Führen eines Kfz<br />
Definition Ein Fahrzeug führt, wer es selbst unter bestimmungsgemäßer Anwendung<br />
seiner Antriebskräfte unter eigener Allein- o<strong>der</strong> Mitver<strong>an</strong>twortung in Bewegung<br />
setzt, um es unter H<strong>an</strong>dhabung seiner technischen Vorrichtungen<br />
während <strong>der</strong> Fahrbewegung durch den Verkehrsraum g<strong>an</strong>z o<strong>der</strong> wenigstens<br />
zum Teil zu leiten [BGH NJW 1962, 2069; BGHSt 36, 341 (= NJW<br />
1990, 1245); BGH NZV 1989, 32]. Minimalbewegung ist erfor<strong>der</strong>lich<br />
Seite - 13 -
Lösung<br />
(beim Soziusfahrer muss auch <strong>der</strong> Wille zum Führen muss vorh<strong>an</strong>den<br />
sein).<br />
2.2.4 Erlaubnis- und Ausweispflicht<br />
Inwieweit zum Führen eines Kfz eine Fahrerlaubnis erfor<strong>der</strong>lich ist, ergibt sich aus § 2<br />
StVG und den ihn ausführenden Vorschriften <strong>der</strong> §§ 4 ff. FeV. Wer das Kfz einer Klasse<br />
führt, für die seine Fahrerlaubnis nicht gilt, führt es i.S.d. § 21 StVG ohne Fahrerlaubnis.<br />
2.3 Ausnahmen von <strong>der</strong> Fahrerlaubnispflicht<br />
Hier erfolgt die Prüfung, ob eine Ausnahme von <strong>der</strong> Fahrerlaubnispflicht vorliegt. <strong>Die</strong><br />
Ausnahmen sind in § 4 I Nr. 1 - 3 FeV abschließend geregelt (siehe unten Nr. 3.1 bis<br />
3.3).<br />
Liegt keine Ausnahme vor, k<strong>an</strong>n dieser Punkt knapp abgeh<strong>an</strong>delt werden.<br />
Beispiel „Im vorliegenden Fall liegt jedoch ersichtlich kein Ausnahmetatbest<strong>an</strong>d<br />
des § 4 I FeV vor.“<br />
2.3.1 § 4 I Nr. 1 FeV (Mofa)<br />
In <strong>der</strong> polizeilichen Praxis ist die Ausnahme nach Nr. 1 am bedeutsamsten:<br />
Das Führen von Mofa25 ist fahrerlaubnisfrei, zu beachten ist allerdings § 5 FeV, wonach<br />
<strong>der</strong> Führer eines Mofa25 eine Prüfbescheinigung vorweisen muss.<br />
Keine Prüfbescheinigung brauchen Fahrerlaubnisinhaber und Personen, die vor dem<br />
01.04.1980 -15- Jahre alt geworden sind (Überg<strong>an</strong>gsrecht - § 76 Nr. 3 FeV)!<br />
Hinweis Wer ein Mofa ohne Prüfbescheinigung führt, begeht eine Ordnungswidrigkeit<br />
gemäß § 5 FeV i.V.m. § 75 FeV, § 24 StVG (Verwarnungsgeld<br />
20,- €); wer seine Prüfbescheinigung nicht mitführt o<strong>der</strong> nicht aushändigt,<br />
begeht ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit (Verwarnungsgeld 10,- €).<br />
2.3.2 § 4 I Nr. 2: FeV (Kr<strong>an</strong>kenfahrstühle)<br />
Kr<strong>an</strong>kenfahrstühle mit Elektro<strong>an</strong>trieb einer BbH von nicht mehr als 15 km/h, zGM 500<br />
kg, Leergewicht nicht mehr als 300 kg [Beachte altes Recht! (ab 02.09.2002, § 76 Nr.<br />
2 FeV und § 72 StVZO)].<br />
Definition Kr<strong>an</strong>kenfahrstühle sind nach <strong>der</strong> Bauart zum Gebrauch durch körperlich<br />
gebrechliche o<strong>der</strong> behin<strong>der</strong>te Personen bestimmte Kfz,<br />
- ein (!) Sitz,<br />
- Elektro<strong>an</strong>trieb,<br />
- Leergewicht von nicht mehr als 300 kg,<br />
Seite - 14 -
Lösung<br />
- zulässige Gesamtmasse (zGM) nicht mehr als 500 kg<br />
- bbH von nicht mehr als 15 km/h<br />
- Breite max.: 110 cm<br />
- Heckmarkierungstafel gemäß ECE-Regelung 69 oben <strong>an</strong> <strong>der</strong><br />
Fahrzeugrückseite ist nur zulassungs- nicht jedoch fahrerlaubnisrechtlich<br />
relev<strong>an</strong>t<br />
2.3.3 § 4 I Nr. 3 FeV<br />
Bestimmte Kfz mit bbH bis 6 km/h<br />
- Zugmaschinen für lof-Zwecke<br />
- SAM<br />
- Flurför<strong>der</strong>zeuge (z. B. Gabelstapler)<br />
und einachsige Zug- und Arbeitsmaschinen, die von Fußgängern <strong>an</strong> Holmen geführt<br />
werden.<br />
2.4 Einteilung <strong>der</strong> Fahrerlaubnisklassen<br />
<strong>Die</strong> Einteilung <strong>der</strong> Fahrerlaubnisklassen ergibt sich aus § 6 I FeV. Hierzu ist folgendes<br />
festzustellen:<br />
- Welches Kfz wird im Sachverhalt geführt?<br />
- Beschreibung <strong>der</strong> technischen Eckdaten und Definition des<br />
Kfz.<br />
- Welche Fahrerlaubnisklasse ist dafür erfor<strong>der</strong>lich?<br />
- Siehe § 6 I FeV<br />
- Welche Fahrerlaubnisklasse hat <strong>der</strong> Fahrer?<br />
- Ausweislich des <strong>der</strong> Klausur beigefügten Führerscheins<br />
Prüfen, ob <strong>der</strong> Kfz-Führer für das von ihm geführte Kfz die entsprechende Fahrerlaubnis<br />
gemäß § 6 FeV hat!<br />
2.5 Mitführ- und Aushändigungspflicht des Führerscheines<br />
<strong>Die</strong> Fahrerlaubnis ist gemäß § 4 II FeV durch eine amtliche Bescheinigung (Führerschein)<br />
nachzuweisen.<br />
Der Führerschein ist beim Führen von Kfz mitzuführen und zuständigen Personen auf<br />
Verl<strong>an</strong>gen zur Prüfung auszuhändigen.<br />
Hinweis Wird <strong>der</strong> Führerschein nicht mitgeführt o<strong>der</strong> zuständigen Personen auf<br />
Verl<strong>an</strong>gen nicht zur Prüfung ausgehändigt, begeht <strong>der</strong> Kraftfahrzeugführer<br />
lediglich eine Ordnungswidrigkeit i.S.d. § 4 II FeV i.V.m. § 75 Nr.<br />
Seite - 15 -
Lösung<br />
4 FeV i.V.m. § 24 StVG (BKat Nr. 168; TBNR 204100 bzw. 204106; VG<br />
10,- €); die Fahrerlaubnis selbst bleibt un<strong>an</strong>getastet.<br />
2.5.1 Fahrerlaubnis<br />
Definition <strong>Die</strong> Fahrerlaubnis ist <strong>der</strong> rechtstechnische Ausdruck für die behördlich<br />
erteilte Ermächtigung (= begünstigen<strong>der</strong> Verwaltungsakt) zum Führen<br />
von Kfz.<br />
2.5.2 Führerschein<br />
Definition Der Führerschein ist als öffentliche Urkunde [BGHSt 34, 299 (= NJW<br />
1987, 2243); BGHSt 37, 207 (= NJW 1991, 576)] das amtliche Dokument,<br />
das die Fahrerlaubnis zum Zeitpunkt <strong>der</strong> Erteilung bescheinigt.<br />
2.6 Beson<strong>der</strong>heiten (nur prüfen wenn relev<strong>an</strong>t)<br />
§ 6 (6, 7) FeV Fahrerlaubnis nach altem Recht<br />
§11, 46 FeV Auflagen und Beschränkungen<br />
§ 26 FeV <strong>Die</strong>nstfahrerlaubnis<br />
§§ 28 ff FeV Ausländische Fahrerlaubnis<br />
§ 48 FeV Son<strong>der</strong>fahrerlaubnis<br />
§ 48 a FeV Begleitetes Fahren ab 17<br />
2.7 Zwischenergebnis<br />
Hier erfolgt die Feststellung, ob <strong>der</strong> Fahrzeugführer laut Sachverhalt die erfor<strong>der</strong>liche<br />
Fahrerlaubnis nachweist.<br />
Hat er die erfor<strong>der</strong>liche Fahrerlaubnis nachgewiesen, ist die Prüfung beendet.<br />
Beispiel „(A) ist somit im Besitz <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Fahrerlaubnis.“<br />
Hat er die erfor<strong>der</strong>liche Fahrerlaubnis nicht nachgewiesen, z. B. reicht die Klasse B zum<br />
Führen des Kfz mit Anhänger nicht aus, erfolgt die Feststellung, dass <strong>der</strong> Beschuldigte<br />
i.S.d. § 21 StVG nicht über die erfor<strong>der</strong>liche Fahrerlaubnis verfügt.<br />
Beispiel „(A) ist somit nicht im Besitz <strong>der</strong> erfor<strong>der</strong>lichen Fahrerlaubnis.“<br />
2.8 Strafbarkeit des (A) nach § 21 StVG<br />
2.8.1 Obersatz<br />
Seite - 16 -
Lösung<br />
Der Obersatz besteht aus einer präskriptiven Aussage des Inhalts, dass bei Vorliegen<br />
bestimmter Voraussetzungen eine bestimmte Rechtsfolge eintreten soll: „<strong>Die</strong> Rechtsfolge<br />
tritt ein, wenn die im Tatbest<strong>an</strong>d beschriebenen Voraussetzungen vorliegen“.<br />
Der Obersatz muss folgende vier Elemente enthalten:<br />
-Täter Insbeson<strong>der</strong>e bei mehreren Beteiligten muss die Person genau bezeichnet<br />
werden.<br />
-H<strong>an</strong>dlung Welches Verhalten (Tun o<strong>der</strong> Unterlassen) wird strafrechtlich geprüft?<br />
-Delikt Genaue Bezeichnung des Delikts (z.B.: Fahren ohne die erfor<strong>der</strong>liche<br />
Fahrerlaubnis).<br />
-Strafnorm Welche Strafnorm wird geprüft. Dazu ist das Gesetz zu benennen (z.B.: §<br />
21 I Nr. 1 StVG).<br />
Hier ist also klarzustellen, welches konkrete Verhalten welcher Person auf welche Tatbest<strong>an</strong>dsverwirklichung<br />
hin geprüft werden soll. Formuliert wird im Konjunktiv, da das<br />
Ergebnis ja noch nicht feststeht.<br />
Beispiele<br />
„Indem A mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erfor<strong>der</strong>liche Fahrerlaubnis zu<br />
besitzen, könnte er sich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gemäß § 21 I Nr.<br />
1 StVG schuldig gemacht haben.“<br />
„Indem A mit seinem Kfz … fuhr, ohne die erfor<strong>der</strong>liche Fahrerlaubnis zu<br />
besitzen, könnte er sich des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gemäß § 21 I Nr.<br />
1 StVG strafbar gemacht haben.“<br />
„A könnte sich durch das Führen des Kfz (…) i.S.d. § 21 I Nr. 1 StVG<br />
strafbar gemacht haben.“<br />
„A könnte durch das Führen des Kfz (…) gegen § 21 (...) Nr. (…) StVG<br />
verstoßen haben.“<br />
„Das Fahren ohne Fahrerlaubnis k<strong>an</strong>n eine Strafbarkeit des A nach § 21<br />
(…) Nr. (…) StVG begründen.“<br />
„A k<strong>an</strong>n durch das Führen seines Lkw den Tatbest<strong>an</strong>d des § 21 (…) Nr.<br />
(…) StVG verwirklicht haben.“<br />
„Möglicherweise hat sich A i.S.d. § 21 (…) Nr. (…) StVG strafbar gemacht,<br />
als er mit seinem Lkw fuhr.“<br />
2.8.2 Objektiver Tatbest<strong>an</strong>d<br />
Dazu müsste er im öffentlichen Straßenverkehr ein Kfz geführt haben, ohne im Besitz<br />
<strong>der</strong> dazu erfor<strong>der</strong>lichen Fahrerlaubnis zu sein.<br />
Seite - 17 -
Lösung<br />
<strong>Die</strong> einschlägigen Tatbest<strong>an</strong>dsmerkmale wurden bereits sämtlich mit folgendem Ergebnis<br />
geprüft: (A) hat tatbest<strong>an</strong>dsmäßig gegen § 21 I Nr. 1 StVG verstoßen.<br />
2.8.3 Subjektiver Tatbest<strong>an</strong>d<br />
Der subjektive Tatbest<strong>an</strong>d des § 21 I Nr. 1 StVG ist erfüllt, wenn <strong>der</strong> Täter vorsätzlich<br />
geh<strong>an</strong>delt hat. Vorsatz ist <strong>der</strong> Wille zur Verwirklichung eines Straftatbest<strong>an</strong>des in<br />
Kenntnis aller seiner objektiven Tatumstände.<br />
Im Falle des § 21 II Nr. 1 StVG genügt jedoch bereits die fahrlässige Tatbest<strong>an</strong>dsverwirklichung.<br />
Wie bereits festgestellt, erfüllt die H<strong>an</strong>dlung des Täters die tatbest<strong>an</strong>dlichen Voraussetzungen<br />
des § 21 I Nr. 1 StVG.<br />
2.8.4 Rechtswidrigkeit und Schuld<br />
Rechtfertigungsgründe und Schuldausschließungsgründe sind zumeist nicht erkennbar:<br />
Beispiel „Der Täter h<strong>an</strong>delte rechtswidrig und schuldhaft“.<br />
2.8.5 Schlusssatz (Ergebnis)<br />
Beispiele<br />
„Somit hat sich A durch das Führen des Kfz (…), ohne dabei die erfor<strong>der</strong>liche<br />
Fahrerlaubnis zu besitzen, i.S.d. § 21 I Nr. 1 StVG strafbar gemacht.“<br />
„Daher hat A durch das Führen des Kfz (…), ohne die erfor<strong>der</strong>liche<br />
Fahrerlaubnis gegen § 21 I Nr. 1 StVG verstoßen.“<br />
„Demzufolge ist in <strong>der</strong> Fahrt des A ein Führen ohne die erfor<strong>der</strong>liche<br />
Fahrerlaubnis zu erblicken und <strong>der</strong> Tatbest<strong>an</strong>d des § 21 I Nr. 1 StVG ist<br />
durch das Verhalten des A verwirklicht.“<br />
Seite - 18 -
Erklärung<br />
Ich versichere, dass ich die vorstehende Arbeit eigenständig und ohne fremde Hilfe <strong>an</strong>gefertigt<br />
und mich <strong>an</strong><strong>der</strong>er als <strong>der</strong> in <strong>der</strong> Arbeit <strong>an</strong>gegebenen Hilfsmittel nicht bedient<br />
habe. Alle Stellen, die sinngemäß o<strong>der</strong> wörtlich aus Veröffentlichungen übernommen<br />
wurden, sind als solche kenntlich gemacht.<br />
<strong>Die</strong> Arbeit wurde bisher we<strong>der</strong> in Teilen noch insgesamt einer <strong>an</strong><strong>der</strong>en Prüfungsbehörde<br />
vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.<br />
Name, Vorname: ------------------------------------------------------------------------------------<br />
Matrikelnummer: -----------------------------------------------------------------------------------<br />
Ort/ Datum: ------------------------------------------------------------------------------------------<br />
Unterschrift: -----------------------------------------------------------------------------------------