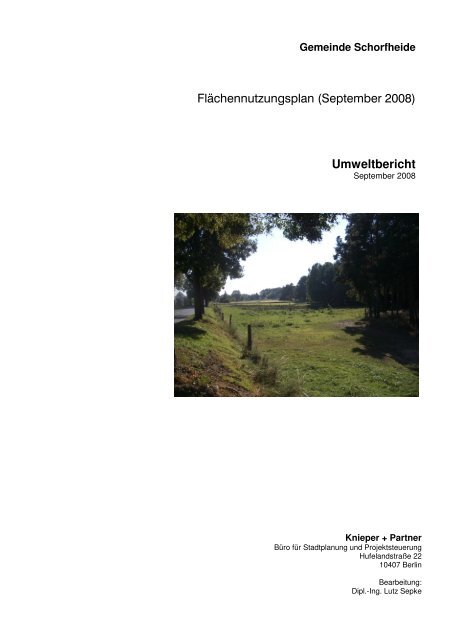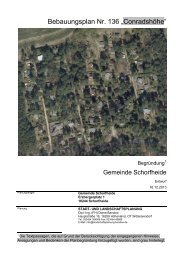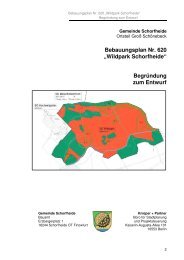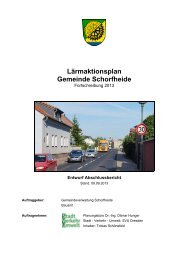Umweltbericht - Gemeinde Schorfheide
Umweltbericht - Gemeinde Schorfheide
Umweltbericht - Gemeinde Schorfheide
Erfolgreiche ePaper selbst erstellen
Machen Sie aus Ihren PDF Publikationen ein blätterbares Flipbook mit unserer einzigartigen Google optimierten e-Paper Software.
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong><br />
Flächennutzungsplan (September 2008)<br />
<strong>Umweltbericht</strong><br />
September 2008<br />
Knieper + Partner<br />
Büro für Stadtplanung und Projektsteuerung<br />
Hufelandstraße 22<br />
10407 Berlin<br />
Bearbeitung:<br />
Dipl.-Ing. Lutz Sepke
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
1 Vorbemerkung.............................................................................1<br />
1.1 Anlass................................................................................1<br />
1.2 Rechtliche Grundlagen.......................................................1<br />
1.3 Methodische Hinweise .......................................................3<br />
1.4 Verhältnis des <strong>Umweltbericht</strong>s zur örtlichen<br />
Landschaftsplanung...........................................................3<br />
2 Naturräumliche Grundlagen .......................................................4<br />
3 Verkehrliche Anbindungen .........................................................5<br />
4 Vorhabenbeschreibungen ..........................................................6<br />
4.1 Vorhaben ohne negative Auswirkungen auf den<br />
Naturhaushalt...................................................................12<br />
Ortsteil Altenhof<br />
4.1.1 Vorhaben 115 (Teilvorhaben 3).................................12<br />
Ortsteil Böhmerheide<br />
4.1.2 Vorhaben 124 ............................................................13<br />
Ortsteil Eichhorst<br />
4.1.3 Vorhaben 10 ..............................................................13<br />
4.1.4 Vorhaben 67 ..............................................................13<br />
4.1.5 Vorhaben 95 ..............................................................14<br />
4.1.23 Vorhaben 135 ............................................................14<br />
Ortsteil Finowfurt<br />
4.1.6 Vorhaben 7 ................................................................14<br />
4.1.7 Vorhaben 8a ..............................................................15<br />
4.1.8 Vorhaben 9 ................................................................15<br />
4.1.9 Vorhaben 12 ..............................................................16<br />
4.1.10 Vorhaben 32a ............................................................16<br />
4.1.11 Vorhaben 32b ............................................................16<br />
4.1.12 Vorhaben 32h ............................................................16<br />
4.1.13 Vorhaben 38 ..............................................................16<br />
4.1.14 Vorhaben 49 ..............................................................17<br />
4.1.15 Vorhaben 53 ..............................................................17<br />
4.1.16 Vorhaben 64 ..............................................................17<br />
4.1.17 Vorhaben 72, 73, 74 und 75......................................18<br />
4.1.18 Vorhaben 96 ..............................................................18<br />
4.1.19 Vorhaben 100, 101, 102 und 103..............................19<br />
4.1.20 Vorhaben 106 ............................................................19<br />
4.1.21 Vorhaben 114 ............................................................19<br />
4.1.21 Vorhaben 116 ............................................................19<br />
4.1.22 Vorhaben 146 ............................................................19<br />
Ortsteil Groß Schönebeck<br />
4.1.24 Vorhaben 66 ..............................................................20<br />
Ortsteil Klandorf<br />
4.1.25 Vorhaben 83 ..............................................................20<br />
Ortsteil Lichterfelde<br />
4.1.26 Vorhaben 56 ..............................................................21<br />
Ortsteil Werbellin<br />
4.1.27 Vorhaben 55 ..............................................................21<br />
I
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
4.2 Vorhaben mit rechtskräftiger verbindlicher<br />
Bauleitplanung .................................................................21<br />
Ortsteil Finowfurt<br />
4.2.1 Vorhaben 110............................................................21<br />
Ortsteil Altenhof<br />
4.2.2 Vorhaben 115 (Teilvorhaben 4).................................22<br />
4.3 Vorhaben mit verbindlicher Bauleitplanung im Verfahren.22<br />
Ortsteil Altenhof<br />
4.3.1 Vorhaben 115 (Teilvorhaben 1).................................22<br />
4.3.2 Vorhaben 115 (Teilvorhaben 2).................................23<br />
Ortsteil Böhmerheide<br />
4.3.3 Vorhaben 79 ..............................................................23<br />
4.4 Vorhaben mit potentiell negativen Auswirkungen<br />
auf den Naturhaushalt......................................................25<br />
Ortsteil Eichhorst<br />
4.4.1 Vorhaben 76 ..............................................................25<br />
4.4.2 Vorhaben 97 ..............................................................30<br />
4.4.3 Vorhaben 104b..........................................................35<br />
4.4.4 Vorhaben 145............................................................39<br />
Ortsteil Finowfurt<br />
4.4.5 Vorhaben 1 ................................................................43<br />
4.4.6 Vorhaben 3 ................................................................46<br />
4.4.7 Vorhaben 5 (entfallen)...............................................57<br />
4.4.8 Vorhaben 6 ................................................................56<br />
4.4.9 Vorhaben 20 ..............................................................62<br />
4.4.10 Vorhaben 44 ..............................................................65<br />
4.4.11 Vorhaben 50 ..............................................................69<br />
4.4.12 Vorhaben 52 ..............................................................75<br />
4.4.13 Vorhaben 54 ..............................................................78<br />
4.4.14 Vorhaben 65 ..............................................................82<br />
4.4.15 Vorhaben 68 ..............................................................86<br />
4.4.16 Vorhaben 92 ..............................................................90<br />
4.4.17 Vorhaben 105............................................................94<br />
4.4.18 Vorhaben 112............................................................98<br />
4.4.19 Vorhaben 117..........................................................101<br />
4.4.20 Vorhaben 126..........................................................106<br />
4.4.21 Vorhaben 133..........................................................114<br />
4.4.22 Vorhaben 134..........................................................118<br />
4.4.23 Vorhaben 137..........................................................122<br />
4.4.24 Vorhaben 138..........................................................128<br />
4.4.25 Vorhaben 139..........................................................132<br />
4.4.26 Vorhaben 140..........................................................135<br />
Ortsteil Groß Schönebeck<br />
4.4.27 Vorhaben 82 ............................................................138<br />
4.4.28 Vorhaben 91 ............................................................141<br />
4.4.29 Vorhaben 141..........................................................150<br />
4.4.30 Vorhaben 142 (entfallen).........................................156<br />
Ortsteil Klandorf<br />
4.4.31 Vorhaben 108..........................................................153<br />
4.4.32 Vorhaben 132..........................................................158<br />
4.4.33 Vorhaben 143..........................................................161<br />
Ortsteil Lichterfelde<br />
4.4.34 Vorhaben 4 ..............................................................164<br />
4.4.35 Vorhaben 57 ............................................................168<br />
4.4.36 Vorhaben 63 ............................................................170<br />
4.4.37 Vorhaben 88 ............................................................172<br />
II
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
4.4.38 Vorhaben 93 a und 93 b..........................................175<br />
4.4.39 Vorhaben 33 ............................................................179<br />
4.4.40 Vorhaben 147 ..........................................................182<br />
Ortsteil Schluft<br />
4.4.41 Vorhaben 69 ............................................................187<br />
4.4.42 Vorhaben 29, 46, 47, 48, 80....................................190<br />
4.4.43 Vorhaben 45 ............................................................196<br />
5 Kompensationsmaßnahmen...................................................201<br />
5.1 Zusammenstellung der Kompensationsbedarfe .............202<br />
5.2 Übernahme von Kompensationsflächen der Alt-FNPs....203<br />
5.3 Kompensationsmaßnahmen des WSA Eberswalde .......206<br />
5.4 Zusätzliche Kompensationsmaßnahmen........................207<br />
6 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz ....................................................218<br />
7 Maßnahmen zur Dokumentation der Entwicklung<br />
von Natur und Umwelt ............................................................220<br />
8 Beschreibung der wichtigsten Merkmale<br />
der verwendeten technischen Verfahren...............................220<br />
9 Zusammenfassung..................................................................221<br />
Anlage 1: Ermittlung der Kompensationsdefizite................................222<br />
Anlage 2: Untersetzung der Flächenermittlungen ..............................225<br />
Anlage 3: Quellenverzeichnis ............................................................227<br />
Anlage 4: Bewertungskriterien der Schutzgüter .................................229<br />
Anlage 5: Pflanzlisten ........................................................................233<br />
Anlage 6: Landschaftspflegerische Voruntersuchung<br />
Ortsteil Altenhof .................................................................235<br />
III
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
IV
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
1 Vorbemerkung<br />
1.1 Anlass<br />
Die beiden ehemals eigenständigen <strong>Gemeinde</strong>n Groß Schönebeck und<br />
Finowfurt beabsichtigen, ihre bestehenden Flächennutzungspläne (FNP) in<br />
einen gemeinsamen, nunmehr für die Gesamtgemeinde <strong>Schorfheide</strong> geltenden<br />
FNP aufzustellen. Die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> hat am 02.03.2005<br />
den Aufstellungsbeschluss für den Flächennutzungsplan gefasst.<br />
Die Neuaufstellung wird zum Anlass genommen, die Inhalte des FNP an<br />
veränderte Entwicklungsabsichten anzupassen, so dass eine Reihe von<br />
Änderungen der Darstellungen vorgenommen werden sollen.<br />
1.2 Rechtliche Grundlagen<br />
Der nationale Gesetzgeber hat mit Erlass des Gesetzes zur Anpassung<br />
des Baugesetzbuches an EU-Richtlinien (DER BUNDESTAG 2004)<br />
24.06.2004 der Richtlinie 2001/42/EG (EUROPÄISCHES PARLAMENT<br />
2001) über die Prüfung der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und<br />
Programme vom 27.06.2001 in nationales Recht umgesetzt. Das EAG-<br />
Bau regelt in § 2 Abs. 4 die Berücksichtigung von Umweltbelangen in<br />
der Bauleitplanung: Die Inhalte des demnach zu erstellenden <strong>Umweltbericht</strong>s<br />
werden in der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a näher spezifiziert.<br />
Der <strong>Umweltbericht</strong> stellt die Ergebnisse der Umweltprüfung dar, in dem<br />
die voraussichtlichen, erheblichen Umweltwirkungen beschrieben und<br />
bewertet werden. Die Ergebnisse der Umweltprüfung sind in die städtebauliche<br />
Abwägung einzustellen.<br />
Die <strong>Gemeinde</strong> legt fest, in welchem Detaillierungsgrad der <strong>Umweltbericht</strong><br />
zu erfolgen hat. Zu berücksichtigen ist insbesondere der Detaillierungsgrad<br />
des zugrunde liegenden städtebaulichen Plans. Im Falle des<br />
hier vorliegenden Flächennutzungsplans ist aufgrund der fehlenden Flächenschärfe<br />
eine exakte Beurteilung der Umweltwirkungen nicht im selben<br />
Maße möglich, wie auf Ebene von Bebauungsplänen. Der voraussichtliche<br />
Bedarf an Kompensationsmaßnahmen kann lediglich überschlägig<br />
anhand der überschlägig ermittelten Eingriffsgrößen benannt<br />
werden. Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffen in Natur und<br />
Landschaft können erst auf Ebene des Bebauungsplans rechtsverbindlich<br />
festgesetzt werden.<br />
Die §§ 1 und 2 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) geben die entsprechende<br />
Orientierung bei der Festsetzung der fachlichen Ziele und<br />
der Abwägung mit anderen Belangen. Unter Berücksichtigung der Konkretisierung<br />
dieser Vorgaben durch den § 1 Brandenburgisches Naturschutzgesetz<br />
ergeben sich folgende planerische Leitlinien für die Planaufstellung:<br />
� Arten- und Lebensgemeinschaften einschließlich ihrer Lebensräume<br />
sind in ihrer natürlichen oder gewachsenen Vielfalt zu schützen. Biotopverbundsysteme<br />
sind zu erhalten.<br />
� Beim Ausbau und der Unterhaltung von Gewässern haben ingenieur-biologische<br />
Maßnahmen Vorrang vor technischen Lösungen.<br />
� Gewässer dürfen nicht durch Schadstoffeintrag gefährdet werden.<br />
� Die Reduzierung der Aufnahmefähigkeit des Bodens ist zu vermeiden<br />
und seine Filterfunktion für Niederschlagswasser ist zu erhalten.<br />
1
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
� Baukörper sind den örtlichen landschaftlichen und siedlungsgeschichtlichen<br />
Gegebenheiten anzupassen. Dies gilt für die Art der<br />
Nutzung, die Wahl der Proportionen und die Mittel der Gestaltung.<br />
� Im besiedelten Bereich sind aufbauend auf den Vorhandenen Grünstrukturen<br />
ausreichend Frei- und Grünflächen zu gewährleisten.<br />
§ 12 Brandenburgisches Naturschutzgesetz bestimmt das Vermeidungsgebot.<br />
Vermeidbare Eingriffe sind zu unterlassen. Nicht zu vermeidende<br />
Eingriffe sind vom Verursacher in geeigneter Weise auszugleichen oder zu<br />
ersetzen. Sind Eingriffe nicht vermeidbar bzw. nicht kompensierbar, sind sie<br />
unzulässig. Im Rahmen der städtebaulichen Abwägung können solche<br />
Eingriffe zugelassen werden, wenn die Belange von Natur und Landschaft<br />
anderen Belangen nicht im Range vorgehen.<br />
Die Regelungen des § 42 Bundesnaturschutzgesetz zum besonderen<br />
Artenschutz sind unter Berücksichtigung neuerer europäischer Rechtsprechung<br />
auch im Rahmen von Eingriffen nach § 12 Brandenburgisches<br />
Naturschutzgesetz zu beachten.<br />
§ 48 Brandenburgisches Naturschutzgesetz bestimmt ein Bauverbot ein<br />
Bauverbot u.a. an Bundeswasserstraßen in einem Abstand von weniger<br />
als 50 m von der Uferlinie. Die Untere Naturschutzbehörde kann von<br />
diesem Verbot Ausnahmegenehmigungen erteilen.<br />
Der § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz und die Verbote der<br />
Beeinträchtigung geschützter Biotope ist beachtlich.<br />
2
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
1.3 Methodische Hinweise<br />
Untersuchungsgegenstand sind diejenigen Darstellungen des im Verfahren<br />
befindlichen FNP, die von den Darstellungen der beiden genehmigten<br />
FNP abweichen.<br />
Zunächst werden sämtliche Abweichungen unabhängig von ihren Regelungsinhalten<br />
benannt. In einem 2. Schritt werden diejenigen Änderungen<br />
von der weiteren Betrachtung ausgeschlossen, die mit einer Rücknahme<br />
von baulichen Entwicklungspotentialen oder zumindest nicht mit<br />
einer Intensivierung von Nutzungen verbunden sind.<br />
In einem 3. Schritt werden Vorhaben behandelt, für die auf Ebene der<br />
verbindlichen Bauleitplanung bereits im Rahmen von <strong>Umweltbericht</strong>en<br />
zum B-Planverfahren Aussagen bestehen. Diese Vorhaben werden in<br />
ihren Umweltauswirkungen anhand der Aussagen der vorhandenen<br />
<strong>Umweltbericht</strong>e kurz charakterisiert. Eine zusätzliche Prüfung der Umweltbelange<br />
erfolgt auf Ebene des FNP nicht.<br />
Im 4. Schritt werden die Vorhaben beschrieben, die mit erheblichen und<br />
nachhaltigen Eingriffen in Natur und Landschaft verbunden sein könnten<br />
und für die bislang keine umweltbezogenen Untersuchungen auf B-<br />
Plan-Ebene vorliegen. Die Bestandssituation der Schutzgüter wird dargestellt<br />
und bewertet sowie eine überschlägige Einschätzung der<br />
Schwere und des Umfanges der Eingriffe in die Schutzgüter des Naturhaushaltes<br />
vorgenommen. Es werden Hinweise auf Vermeidungsmaßnahmen<br />
gegeben und die voraussichtlich erforderlichen Qualitäten und<br />
Quantitäten der Kompensationsmaßnahmen ermittelt. Wenn innerhalb<br />
des jeweiligen Projektgebietes die Realisierung von Kompensationsmaßnahmen<br />
möglich und sinnvoll erscheint, werden diese als Ausgleichs-<br />
und Ersatzmaßnahmen formuliert und nummeriert. Sind Eingriffe<br />
innerhalb eines Projektgebietes nicht sinnvoll zu kompensieren, wird<br />
lediglich der qualitative und quantitative Kompensationsbedarf ermittelt.<br />
Parallel zur Ermittlung der Kompensationsbedarfe werden geeignete<br />
Kompensationsflächen im <strong>Gemeinde</strong>gebiet dargestellt und die Maßnahmen<br />
definiert, die geeignet sind, den Zustand von Natur- und Landschaft<br />
aufzuwerten.<br />
Ziel ist, dem Kompensationsbedarf den in der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong><br />
zur Verfügung stehenden Kompensationsflächen gegenüberzustellen,<br />
um abschätzen zu können, ob die geplanten Eingriffe in der Summe im<br />
<strong>Gemeinde</strong>gebiet ausgeglichen oder ersetzt werden können.<br />
1.4 Verhältnis des <strong>Umweltbericht</strong>s zur örtlichen Landschaftsplanung<br />
Der <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong><br />
ist ein vorhabenbezogenes Planwerk. Es werden für räumliche Ausschnitte<br />
des <strong>Gemeinde</strong>gebietes die Umweltauswirkungen planerisch<br />
vorbereiteter raumstruktureller Änderungen prognostiziert und gegebenenfalls<br />
Umfang und Beschaffenheit von Vermeidungs- bzw. Kompensationsmaßnahmen<br />
benannt. Eine flächenhafte Betrachtung des <strong>Gemeinde</strong>gebietes<br />
mit der Erarbeitung von Entwicklungsstrategien für Natur und<br />
Landschaft erfolgt nicht. Dies ist den bestehenden kommunalen Landschaftsplänen<br />
vorbehalten.<br />
3
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Für die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> gliedert sich die kommunale Landschaftsplanung<br />
in 2 geteilte Landschaftspläne der Altgemeinden Finowfurt<br />
und Groß Schönebeck. Bei der Beurteilung von Vorhaben mit potentiell<br />
negativen Auswirkungen auf Natur und Landschaft zieht der <strong>Umweltbericht</strong><br />
die Aussagen der Landschaftspläne zur lokalen Empfindlichkeit<br />
von Natur und Landschaft und der lokalen landschaftsplanerischen<br />
Zielsetzung heran.<br />
Im Abschnitt 9 „Zusammenfassung“ des <strong>Umweltbericht</strong>s erfolgt eine<br />
Einschätzung der summarischen Auswirkungen der auf Ebene des FNP<br />
planerisch vorbereiteten Eingriffsvorhaben auf die Entwicklung von Natur<br />
und Landschaft des <strong>Gemeinde</strong>gebietes. Sollte die Summe der Konflikte<br />
zwischen geplanten Eingriffsvorhaben und den Wertungen und<br />
Entwicklungszielen der kommunalen Landschaftsplanung die von der<br />
<strong>Gemeinde</strong> vorgesehene Entwicklung von Natur und Landschaft grundsätzlich<br />
in Frage stellen, wäre es erforderlich, begleitend zum Änderungsverfahren<br />
des FNP ein formelles Änderungsverfahren für den<br />
Landschaftsplan einzuleiten.<br />
Der Ortsteil Altenhof wird bislang nicht von einem Landschaftsplan planerisch<br />
bearbeitet. Es wurde allerdings eine gemeindeinterne landschaftsplanerische<br />
Voruntersuchung erstellt, die die wesentlichen Belange<br />
und gemeindlichen Entwicklungsziele von Natur und Landschaft<br />
für den Ortsteil Altenhof darstellt. Die Voruntersuchung ist dem <strong>Umweltbericht</strong><br />
als Anlage beigefügt.<br />
2 Naturräumliche Grundlagen<br />
Die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> liegt in nordöstlicher Richtung etwa 50 km<br />
vom Berliner Stadtzentrum entfernt im so genannten Brandenburgischen<br />
Wald- und Seengebiet sowie im Bereich der <strong>Schorfheide</strong>. Beide Naturräume<br />
gehören zur Mecklenburgischen Seenplatte, die sich aufgrund<br />
der geologischen Entstehung unterteilt in die <strong>Schorfheide</strong>, die Britzer<br />
Platte und das Eberswalder Urstromtal. Die geologische Formation der<br />
<strong>Schorfheide</strong> ist auf die Entwicklungen während der Hochphase der<br />
Weichseleiszeit vor ca. 20.000 Jahren zurückzuführen, in der sich mächtige<br />
Schichten eiszeitlicher Sedimente ablagerten. Während der Nacheiszeit<br />
bildeten sich am Rand der Endmoränen Schmelzwasserrinnen,<br />
die überwiegend in südwestliche Richtung entwässerten. So entstand<br />
das Eberswalder Urstromtal, welches für das <strong>Gemeinde</strong>gebiet um den<br />
Ortsteil Finowfurt kennzeichnend ist. Analog zum Eberswalder Urstromtal<br />
entstand die Werbellinseerinne, die als Schmelzwasserzufluss zum<br />
Eberswalder Urstromtal fungierte. Der Schmelzwasserabfluss trug zur<br />
Bildung markanter, gestreckter Seen wie Werbellinsee und Üdersee bei.<br />
Nördlich des Eberswalder Urstromtals und beiderseits der Werbellinseerinne<br />
liegt geomorphologisch die „Britzer Platte“, eine flachwellige, lehmige<br />
Grundmoränenplatte, die im Durchschnitt 50 - 90 Meter über NN<br />
liegt. Bedingt durch die geologische Entstehung weist das <strong>Gemeinde</strong>gebiet<br />
überwiegend ein leicht welliges bis ebenes Großrelief auf, dass<br />
durch die beiden Schmelzwasserrinnen unterbrochen wird.<br />
4
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Die potentielle natürliche Vegetation (PNV) der <strong>Gemeinde</strong> Groß Schönebeck<br />
besteht im Wesentlichen aus 6 Waldgesellschaften:<br />
1. Im Bereich der durchlässigen, nährstoffarmen Sanddünenbereiche<br />
entsprechen Kiefernwälder der planaren Stufe der PNV. Natürliche<br />
Kiefernwälder der planaren Stufe kommen nur noch auf<br />
selten im <strong>Gemeinde</strong>gebiet auf kleineren Teilflächen vor.<br />
2. Die Kiefernwälder werden auf Böden mit höherem Lehmanteil<br />
von Wärme liebenden, subkontinentalen Eichenwäldern abgelöst,<br />
die aber lediglich kleinflächig als Reliktstandorte erhalten<br />
geblieben sind.<br />
3. Auf Endmoränenablagerungen südlich der <strong>Schorfheide</strong> bestimmen<br />
Traubeneichen-Buchenwälder die PNV. Nördlich von Zerpenschleuse<br />
sind forstlich überprägte Traubeneichen-<br />
Buchenwälder erhalten geblieben.<br />
4. Im Eberswalder Urstromtal sollten auf frischen und mäßig feuchten<br />
Standorten vorwiegend Stieleichen-Hainbuchenwälder stocken.<br />
In stark feuchten Lagen würden Erlen-Eschenwälder dominieren,<br />
die zu den Erlenbruchwäldern der nassen Standorte<br />
überleiten.<br />
5. Auf Niedermoorstandorten dominierten Erlenbruchwälder die<br />
PNV. Diese sind heute vor allem als Säume an Gewässern erhalten<br />
geblieben und stellen aufgrund der fehlenden Flächenausdehnung<br />
nur in Ausnahmefällen tatsächlich Waldlebensräume<br />
dar.<br />
6. Auf grundwassernahen Standorten bilden Grundwasser beeinflusste<br />
Birken-Stieleichen und Stieleichen-Buchenwälder die<br />
PNV. Auch diese Waldform findet sich heute nur noch relikthaft<br />
im <strong>Gemeinde</strong>gebiet (vgl. HORTEC 1996, S. 30-31).<br />
Die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> hat eine stark subkontinentale Prägung. Das<br />
Klima ist gekennzeichnet durch eine relativ rasche Frühlingserwärmung,<br />
relativ heiße Sommer mit viel Sonnenschein, aber auch durch relativ<br />
kalte Winter. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 8,2°C, wobei<br />
im Januar und Februar das Monatsmittel unter 0°C liegt. Die Niederschläge<br />
pro Jahr liegen zwischen 500 und 560 mm. Die <strong>Gemeinde</strong><br />
<strong>Schorfheide</strong> gehört damit zu den niederschlagsärmsten Gebieten<br />
Deutschlands.<br />
3 Verkehrliche Anbindungen<br />
Die verkehrliche Anbindung erfolgt über die Bundesautobahn A11, die<br />
Bundesstraßen 109 und 167 sowie die Regionalbahnlinie Groß Schönebeck-Berlin/Karow.<br />
Das <strong>Gemeinde</strong>gebiet umfasst etwa 208 km².<br />
Der Oder-Havel-Kanal ist die wirtschaftlich wichtigste wassergebundene<br />
Transportverbindung, während Finow- und Werbellinkanal von besonderer<br />
Bedeutung für den Tourismus sind.<br />
Der Verkehrslandeplatz Eberswalde-Finow dient Flugzeugen bis zu 14 t<br />
Startmasse und steht zurzeit hauptsächlich der gewerblichen Luftfahrt<br />
und dem Geschäftsreiseverkehr zur Verfügung.<br />
5
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
4 Vorhabenbeschreibungen<br />
Tabelle 1 zeigt eine Übersicht der geplanten abweichenden Darstellungen<br />
des neuen FNP´s gegenüber den gültigen FNP´s. Nachfolgend<br />
werden diese Änderungen entsprechend ihrer absehbaren Umweltauswirkungen<br />
und der Erforderlichkeit einer eingehenderen Umweltprüfung<br />
näher beleuchtet.<br />
Für den Ortsteil Altenhof besteht kein FNP, so dass keine Änderungen<br />
eines bestehenden FNP vorgenommen werden können. Abweichend<br />
von der Beschreibung der Änderungen werden daher für den Ortsteil<br />
Altenhof diejenigen Flächendarstellungen geprüft, die zu einer wesentlichen<br />
Nutzungsintensivierung führen könnten. Damit werden Bestand<br />
sichernde Darstellungen und Darstellungen, denen rechtskräftige Bebauungspläne<br />
zugrunde liegen, nicht auf ihre Umweltauswirkungen überprüft.<br />
Tabelle 1: Überblick über die Änderungen zum FNP<br />
Nr. Vorhaben/Änderung Umweltauswirkungen B-Plan/VEP<br />
Ortsteil Altenhof<br />
115 Neudarstellungen im gesamten OT Altenhof:<br />
Darstellung von Sondergebieten, die in 2 Fällen (SO<br />
„Steganlage“ - Teilvorhaben 1 - , SO Badewiesen – Teilvorhaben<br />
2 - mit Erweiterungen der Nutzung im Außenbereich<br />
verbunden sind.<br />
Das SO „Freizeit und Erholung“ - Teilvorhaben 3 - am<br />
EJB-Standort sichert etwa zur Hälfte Bestandsgebäude<br />
ab, umfasst aber auch unbebaute Wiesenflächen am<br />
Werbellinsee.<br />
Darstellung eines Sondergebietes "Altenpflegeheim<br />
Altenhof", Teilvorhaben 4<br />
Änderung des SO „Freizeit und Erholung“ südlich der<br />
Ortslage zum Mischgebiet<br />
6<br />
Für die Teilvorhaben 1,<br />
2 und 4 Bestandserweiterungen<br />
im Außenbereich<br />
pot. negativ.<br />
Bestandssicherung,<br />
neutral<br />
SO Steg“ mit<br />
B-Plan Nr.<br />
29, in der<br />
Aufstellung<br />
Für SO<br />
„F+E“ nicht<br />
vorgesehen<br />
VEP Nr. 23<br />
"AltenpflegeheimAltenhof",<br />
in der<br />
Aufstellung<br />
Ortsteil Böhmerheide Umweltauswirkungen B-Plan/VEP<br />
79 Änderung der Darstellung Sondergebiet „Wochenendhäuser“,<br />
geringfügig Fläche für die Landwirtschaft und<br />
Wald in Wohnbauflächen und teilw. Sondergebiet „Wochenendhäuser“.<br />
124 Änderung der Darstellung von Sondergebiet „Reiterhof“<br />
in „Gemischte Baufläche“<br />
Intensivierung der baulichen<br />
Nutzung, potentiell<br />
negativ<br />
Bestandssicherung,<br />
neutral<br />
Änderung<br />
des B-Plan<br />
Nr. 1, Änderung<br />
in der<br />
Aufstellung<br />
VEP vorgesehen
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Ortsteil Eichhorst Umweltauswirkungen B-Plan/VEP<br />
10 Änderung der Darstellung „Wald“ in „Wohnbaufläche“. Bestandssicherung,<br />
neutral<br />
67 Änderung der Darstellung „Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr“<br />
in Gemeinbedarfsfläche „Zweckbestimmung Festplatz“<br />
76 Änderung der Darstellung Sondergebiet „Klinik“ in Sondergebiet<br />
„Wochenendhäuser“ und Sondergebiet „Freizeit<br />
+ Erholung“<br />
95 Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet<br />
„Campingplatz“<br />
97 Änderung der Darstellung „Wald“ in Grünfläche „Friedhof“<br />
104<br />
b<br />
Änderung der Darstellung „Wald“+ „Fläche f. Landwirtschaft“<br />
in Sondergebiet „Campingplatz“<br />
7<br />
Keine bauliche Entwicklung<br />
oder Nutzungsintensivierung,<br />
neutral<br />
Bauflächenerweiterung<br />
gegenüber Bestand<br />
möglich, potentiell negativ<br />
Bestandssicherung,<br />
neutral<br />
Nicht vorgesehen<br />
Nicht<br />
vorgesehen<br />
erforderlich<br />
nicht erforderlich<br />
Pot. negativ nicht vorgesehen<br />
Pot. negativ nicht vorgesehen<br />
135 Darstellung eines Symbols „Imbis“ Bestandssicherung,<br />
neutral<br />
145 Darstellung eines Sondergebietes „Freizeit und Erholung“<br />
anstelle von Grünfläche in Rosenbeck<br />
nicht erforderlich<br />
Pot. negativ nicht vorgesehen<br />
Ortsteil Finowfurt Umweltauswirkungen B-Plan/VEP<br />
1 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in „Gewerbe“<br />
3 Änderung der Darstellung Flugbetriebsfläche in Verschiedene<br />
Darstellungen gemäß Rahmenplanung für<br />
den künftigen Regionalflughafen<br />
6 Änderung der Darstellung Sondergebiet „Militär“ / Landwirtschaft<br />
in „Gewerbe“ und „Ausgleichsfläche“<br />
7 Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser“<br />
8a Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser“<br />
9 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in „Gemischte Baufläche“<br />
12 Änderung der Darstellung Sondergebiet „Pferdehof“ in<br />
„Gemischte Baufläche“<br />
20 Änderung der Darstellung Grünfläche, „Fläche für die<br />
Landwirtschaft“ in „Wohnbaufläche“<br />
29 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in „Verkehrsfläche“ gemäß Fachplanung / Anbindung an<br />
B167 – neu (Ortsumgehung Eberswalde-Finowfurt)<br />
32a Änderung der Darstellung Grünfläche „Kleingärten“ in<br />
„Wald“<br />
32b Änderung der Darstellung Grünfläche „Kleingärten“ in<br />
„Grünfläche“<br />
32h Änderung der Darstellung Grünfläche „Kleingärten“ in<br />
Sondergebiet „Wochenendhäuser“<br />
potentiell negativ erforderlich<br />
potentiell negativ erforderlich<br />
potentiell negativ erforderlich<br />
Bestandssicherung,<br />
neutral<br />
Bestandssicherung,<br />
neutral<br />
Bestandssicherung,<br />
neutral<br />
Bestandssicherung,<br />
neutral<br />
Erweiterung der baulichen<br />
Nutzung möglich,<br />
potentiell negativ<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
potentiell negativ Fachplanung<br />
Rücknahme von Entwicklungspotentialen,<br />
potentiell positiv<br />
Rücknahme von baulichenEntwicklungspotentialen,<br />
potentiell positiv<br />
Bestandssicherung,<br />
keine Erweiterung der<br />
baulichen Nutzung möglich,<br />
neutral<br />
nicht erforderlich<br />
nicht erforderlich<br />
nicht vorgesehen
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Ortsteil Finowfurt Umweltauswirkungen B-Plan/VEP<br />
38 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in Sondergebiet „Wochenendhäuser“<br />
44 Änderung der Darstellung Sondergebiet „Großflächige<br />
Handelsbetriebe“ in Grünfläche, Zweckbestimmung<br />
„Sportplatz“<br />
45/<br />
114<br />
Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“+<br />
„Wald“ in „Verkehrsfläche“ gemäß Fachplanung<br />
zur B 167 – neu<br />
46 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“+<br />
„Wald“ in „Verkehrsfläche“ gemäß Fachplanung<br />
zur B 167 - neu<br />
47 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“+<br />
„Wald“ in „Verkehrsfläche“ gemäß Fachplanung<br />
zur B 167 - neu<br />
48 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“+<br />
„Wald“ in „Verkehrsfläche“ gemäß Fachplanung<br />
zur B 167 - neu<br />
49 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in Sonderbaufläche „Floßplatz“<br />
50 Änderung der Darstellung Grünfläche „Friedhof“ und<br />
Fläche für die Landwirtschaft in „Wohnbaufläche“<br />
52 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in „Gemischte Baufläche“<br />
53 Änderung der Darstellung „Wohnbaufläche“ in „Grünfläche“<br />
54 Änderung der Darstellung Sondergebiet „Freizeit“ in<br />
„Gemischte Baufläche“<br />
64 Änderung der Darstellung Grünfläche „Kleingärten“ in<br />
Sondergebiet „Wochenendhäuser“<br />
65 Änderung der Darstellung „Wald“ in „Gemischte Baufläche“<br />
68 Änderung der Darstellung Flugbetriebsfläche + „Wald“ in<br />
Sondergebiet „Erlebnispark“<br />
8<br />
Bestandssicherung,<br />
keine Erweiterung der<br />
baulichen Nutzung möglich,<br />
neutral<br />
Umwandlung trockener<br />
Grünlandbrachen<br />
nicht vorgesehen<br />
erforderlich<br />
potentiell negativ im Verfahren<br />
potentiell negativ Fachplanung<br />
potentiell negativ Fachplanung<br />
potentiell negativ Fachplanung<br />
Bestandssicherung,<br />
keine baulichen<br />
Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
erhebliche Erweiterung<br />
baulicher Entwicklungspotentiale,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
erhebliche Erweiterung<br />
baulicher Entwicklungspotentiale,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Rücknahme von baulichenEntwicklungspotentialen,<br />
potentiell positiv<br />
bereits realisiert<br />
B-Plan vorgesehen<br />
B-Plan vorgesehen<br />
nicht erforderlich<br />
potentiell negativ VEP vorgesehen<br />
Bestandssicherung,<br />
keine baulichen<br />
Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
Im Wesentlichen Bestandssicherung<br />
mit<br />
geringfügigen baulichen<br />
Entwicklungspotentialen,<br />
potentiell negativ<br />
Im Wesentlichen Bestandssicherung<br />
mit<br />
geringfügigen baulichen<br />
Entwicklungspotentialen,<br />
potentiell negativ<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
VEP- in der<br />
Aufstellung
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Ortsteil Finowfurt Umweltauswirkungen B-Plan/VEP<br />
72 Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser“<br />
73 Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser“<br />
74 Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser“<br />
75 Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser“<br />
80 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
+ „Wald“ in „Verkehrsfläche“ gemäß Fachplanung zur B<br />
167 - neu<br />
92 Änderung der Darstellung „Wald“+ „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in Sondergebiet „Freizeit + Erholung“<br />
96 Änderung der Darstellung Grünfläche „Zeltplatz“ in Sondergebiet<br />
„Campingplatz<br />
100 Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser<br />
101 Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser<br />
102 Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser<br />
103 Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser<br />
105 Änderung der Darstellung Grünfläche „Sportplatz“ und<br />
„Grabeland“ in Wohnbaufläche<br />
106 Änderung der Darstellung „Gemischte Baufläche“ in<br />
„Gemeinbedarfsfläche“ (Kita, Bauhof)<br />
110 Änderung der Darstellung „Gemischte Baufläche“ und<br />
„Grünfläche „ in „Gemischte Baufläche“<br />
9<br />
Bestandssicherung,<br />
keine baulichen<br />
Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
Bestandssicherung,<br />
keine baulichen Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
Bestandssicherung,<br />
keine baulichen Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
Bestandssicherung,<br />
keine baulichen Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
potentiell negativ, Prüfung<br />
obliegt der Fachplanung<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen <br />
NachrichtlicheÜbernahme<br />
Pot. negativ VEP vorgesehen<br />
Bestandssicherung,<br />
keine baulichen Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
Bestandssicherung,<br />
keine baulichen Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
Bestandssicherung,<br />
keine baulichen Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
Bestandssicherung,<br />
keine baulichen Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
Bestandssicherung,<br />
keine baulichen Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
Geringfügiges bauliches<br />
Entwicklungspotential,<br />
potentiell negativ<br />
Konkretisierende Bestandssicherung,<br />
keine<br />
baulichen<br />
Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
Bauliches Entwicklungspotential<br />
auf<br />
Grundlage eines rechtskräftigen<br />
B-Planes<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
B-Plan vorgesehen<br />
nicht vorgesehen <br />
rechtskräftiger<br />
B-Plan<br />
liegt vor
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Ortsteil Finowfurt Umweltauswirkungen B-Plan/VEP<br />
112 Änderung der Darstellung Grünfläche in „Gemischte<br />
Baufläche“<br />
116 Änderung der Darstellung Flugbetriebsfläche in „Gewerbliche<br />
Baufläche“<br />
117 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“+<br />
„Gemeinbedarf“ in „Gemischte Baufläche“<br />
126 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in „Bahnanlagen“<br />
133 Änderung der Darstellung Flugbetriebsfläche in „Gewerbliche<br />
Baufläche“<br />
134 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
und „Wald“ in Sondergebiet „Fotovoltaik“<br />
136 Änderung der Darstellung „Wohnen“ in „Gemischte Baufläche“<br />
137 Darstellung eines Sondergebiets „Wassertourismus“ an<br />
Stelle von „Flächen für die Landwirtschaft“<br />
138 Finowfurt: Änderung der Darstellung „Wald“ in „Gemischte<br />
Baufläche“<br />
139 Finowfurt: Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in<br />
„Gemischte Baufläche“.<br />
140 Finowfurt: Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in<br />
„Gemischte Baufläche“.<br />
10<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Bestandssicherung,<br />
keine baulichen<br />
Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
Zu etwa gleichen Teilen<br />
Bestandssicherung und<br />
Erweiterung baulicher<br />
Potentiale, potentiell<br />
negativ<br />
Erhebliches bauliches<br />
Entwicklungspotential,<br />
potentiell negativ<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Kein zusätzliches Entwicklungspotential,neutral<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
B-Plan vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
B-Plan/VEP<br />
vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
potentiell negativ nicht vorgesehen<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
B-Plan/VEP<br />
vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
Ortsteil Groß Schönebeck Umweltauswirkungen B-Plan/VEP<br />
66 Änderung der Darstellung Grünfläche „Wiese“ in Sondergebiet<br />
„Sport und Freizeit“<br />
82 Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in „Wohnbaufläche“<br />
91 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
+ „Wald“ in Sondergebiet „Seniorenresidenz“<br />
141 Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in „Gemischte<br />
Baufläche“<br />
Umnutzung einer Gewerbebrache,<br />
kein baulichesEntwicklungspotential,<br />
neutral<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Erhebliches bauliches<br />
Entwicklungspotential,<br />
potentiell negativ<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
VEP vorgesehen<br />
nicht vorgesehen
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Ortsteil Klandorf Umweltauswirkungen B-Plan/VEP<br />
83 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in „Gemischte Baufläche“<br />
108 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
und „Grünfläche“<br />
132 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in „Gemischte Baufläche“<br />
143 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in „Gemischte Baufläche“<br />
11<br />
Bestandssicherung,<br />
keine Entwicklungspotentiale,<br />
neutral<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
Ortsteil Lichterfelde Umweltauswirkungen B-Plan/VEP<br />
4 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
+ „Versorgung“ in Sondergebiet „Fotovoltaik“<br />
33 Änderung der Darstellung Sondergebiet „Freizeit“ in<br />
„Gemischte Baufläche“<br />
56 Änderung der Darstellung Sondergebiet „Ferienhäuser“<br />
in „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
57 Änderung der Darstellung „Wohnbaufläche“ in Sondergebiet<br />
„Freizeit + Erholung“<br />
63 Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in „Wohnbaufläche“<br />
88 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in „Wohnbaufläche“<br />
93 Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
in „Gemischte Baufläche“<br />
147 Änderung der Darstellung von „Flächen für die Landwirtschaft“<br />
in „Sondergebiet Biogasanlage“<br />
Konversion eines Altstandortes,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Bestandssicherung mit<br />
Entwicklungspotentialen,<br />
potentiell negativ<br />
Rücknahme von Entwicklungspotentialen,<br />
potentiell positiv<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht erforderlich<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
nicht vorgesehen<br />
VEP in der<br />
Aufstellung<br />
erforderlich<br />
Ortsteil Schluft Umweltauswirkungen B-Plan/VEP<br />
69 Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in „Gemischte<br />
Baufläche<br />
Bauliches Entwicklungspotential,<br />
potentiell<br />
negativ<br />
nicht vorgesehen<br />
Ortsteil Werbellin Umweltauswirkungen B-Plan/VEP<br />
55 Änderung der Darstellung „Wohnbaufläche“ in „Fläche<br />
für die Landwirtschaft“<br />
Rücknahme von baulichenEntwicklungspotentialen,<br />
potentiell positiv<br />
nicht erforderlich
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
4.1 Vorhaben ohne negative Auswirkungen auf d. Naturhaushalt<br />
An dieser Stelle werden Vorhaben benannt, die entweder eine Rücknahme<br />
von hinfälligen Entwicklungsabsichten bedeuten oder bestehende<br />
Entwicklungsabsichten konkretisieren, ohne eine Intensivierung der<br />
zukünftigen Nutzung zu ermöglichen.<br />
Diese Vorhaben bzw. Änderungen gegenüber den gültigen Flächennutzungsplänen<br />
werden im Weiteren nicht näher begutachtet.<br />
Ortsteil Altenhof<br />
4.1.1 Vorhaben 115 (Teilvorhaben 3)<br />
Altenhof: Darstellung eines Sondergebietes „Freizeit und Erholung“. Ziel<br />
ist die planungsrechtliche Sicherung des Gebäudebestandes und die<br />
Umnutzung der derzeit zu Wohnzwecken genutzten ehemaligen Jugendherberge<br />
„Brunholdhaus“ zu Freizeit- und Erholungszwecken im<br />
Kontext mit der Wassersportnutzung am Bootsliegeplatz. Das Gebiet mit<br />
einer Flächenausdehnung von etwa 9.000 m² liegt am östlichen Ortsrand<br />
von Altenhof und grenzt an den Sportplatz der europäischen Jugenderholungs-<br />
und Begegnungsstätte Werbellinsee (EJB). an. Neben<br />
dem repräsentativen ehemaligen Herbergshaus weist das Gelände eine<br />
eigene Badestelle mit Bootsliegeplatz und Bootshaus unmittelbar am<br />
Ufer des Werbellinsees auf.<br />
Die Freiflächen werden von intensiv genutzten Wiesen und Trittrasen im<br />
Bereich der Badewiese und verwilderten Ziergärten im Umfeld des Gästehauses<br />
geprägt. Deren Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz ist<br />
prinzipiell von untergeordneter Bedeutung. Im Zusammenhang mit dem<br />
Werbellinseeufer und damit dem FFH-Gebiet 347 „Webellinkanal“ erlangt<br />
der Bereich jedoch besondere Schutzwürdigkeit.<br />
Für die Flächen im 50-m-Bereich des Werbellinsees besteht zudem ein<br />
Bauverbot gem. § 48 Brandenburgisches Naturschutzgesetz.<br />
Eine Beeinträchtigung der Freiflächen des Sondergebietes durch eine<br />
Ausweitung der Siedlungstätigkeit steht damit im Konflikt mit dem Natur-<br />
und Landschaftsschutz. Der Konflikt wird unter der Bezeichnung K 115.1<br />
geführt und ist unbedingt zu vermeiden. Die Regelung wird als Vermeidungsmaßnahme<br />
V 115.1 vorgeschlagen:<br />
„Die Anlage zusätzlicher baulicher Anlagen im Plangebiet ist zu<br />
vermeiden.“<br />
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 115.1 sind erhebliche<br />
und nachhaltige Eingriffe in Natur und Landschaft nicht zu erwarten.<br />
12
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Ortsteil Böhmerheide<br />
4.1.2 Vorhaben 124<br />
Böhmerheide: Änderung der Darstellung von Sondergebiet „Reiterhof“ in<br />
„Gemischte Baufläche“. Östlich des Ortsteils Böhmerheide direkt an der<br />
Landesstraße 212 soll ein ehemaliger landwirtschaftlicher Betriebs- und<br />
Unterkunftsstandort im Sinne einer Erholungs- und Tourismusnutzung,<br />
wird die Fläche für die Nutzung in den Bereichen Landwirtschaft, Handwerk<br />
und Kunst gesichert werden. Der Bereich wird teilweise bewohnt,<br />
der Gebäudebestand entspricht überschlägig der im Rahmen der zukünftigen<br />
„Gemischten Baufläche“ möglichen Grundflächenzahl (GRZ).<br />
Außerhalb der bebauten und versiegelten Flächen finden sich Hausgärten,<br />
von Landreitgras dominierten Brachweiden sowie im Bereich der<br />
Lagerhallen Aufschüttungen mit nitrophilen Staudensäumen. Entlang der<br />
L212 stehen Baumreihen mit älteren Stieleichen. Die inneren Flächen<br />
sind frei von Bäumen. Es wird davon ausgegangen, dass die in den<br />
Randbereichen des Gebietes vorhandenen Gehölzstrukturen erhalten<br />
bleiben, zumal sie für die zukünftige Nutzung des Geländes aufgrund<br />
ihrer ästhetischen Potentiale und ihrer abgrenzenden Funktion zur L 212<br />
bedeutsam sind und ihr Erhalt im Interesse des Projektträgers ist.<br />
Aufgrund des bestehenden Versiegelungsgrades und der für den Arten-<br />
und Biotopschutz kaum bedeutsamen Freiflächenstruktur mit in Brandenburg<br />
häufigen Biotoptypen sind erhebliche und nachhaltige Eingriffe<br />
in Natur und Landschaft nicht zu erwarten.<br />
Ortsteil Eichhorst<br />
4.1.3 Vorhaben 10<br />
Eichhorst: Änderung der Darstellung „Wald“ in „Wohnbaufläche“. Ziel ist<br />
die Herstellung von Planungsrecht für die vorhandene Bungalow-<br />
Bebauung am Rande eines Eichen-Kiefern-Forstes. Die Erschließung<br />
erfolgt über die Straße „An der Ablage“. Es handelt sich um zwei<br />
Grundstücke mit einer Gesamtfläche von etwa 4.500 m², die mit jeweils<br />
einem Bungalow ohne nennenswerte Nebenanlagen bebaut sind. Die<br />
Freiflächen werden von Ziergärten ohne Altbaumbestand eingenommen.<br />
Durch die Änderung der FNP-Darstellung zu einer „Wohnbaufläche“<br />
eröffnet sich grundsätzlich ein zusätzliches Versiegelungspotential, das<br />
im Konflikt mit dem Natur- und Landschaftsschutz steht. Der Konflikt<br />
wird unter der Bezeichnung K 10.1 geführt und ist unbedingt zu vermeiden.<br />
Die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> will allerdings keine zusätzliche bauliche<br />
Tätigkeit zulassen. Die Regelung wird als Vermeidungsmaßnahme<br />
V 10.1 vorgeschlagen.<br />
„Die Anlage zusätzlicher baulicher Anlagen im Plangebiet ist<br />
unzulässig“<br />
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 10.1 sind erhebliche<br />
und nachhaltige Eingriffe in Natur und Landschaft nicht zu erwarten.<br />
4.1.4 Vorhaben 67<br />
Eichhorst: Änderung der Darstellung „Gemeinbedarfsfläche Feuerwehr“<br />
in Gemeinbedarfsfläche „Zweckbestimmung Festplatz“. Ziel ist die planungsrechtliche<br />
Sicherung des geplanten Festplatzes, die südlich an den<br />
13
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
bestehenden Feuerwehrstandort angrenzt. Die zentral gelegenen, erschlossenen<br />
Flächen sollen der Durchführung von Dorffesten dienen. Derzeit<br />
ist die Fläche von relativ intensiv als Bolzplatz genutzten Trittrasen<br />
eingenommen. In den Randbereichen befindet sich teilweise markanter<br />
Altbaumbestand, der allerdings von den temporären Nutzungen der Wiesenflächen<br />
nicht beeinträchtigt wird.<br />
Eine strukturelle Änderung des Bereichs wird durch die Änderung der Darstellung<br />
im FNP nicht vorbereitet, Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes sind entsprechend nicht zu erwarten.<br />
4.1.5 Vorhaben 95<br />
Eichhorst: Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Campingplatz“.<br />
Ziel ist die planungsrechtliche Sicherung der Dauercamping-<br />
Stellplätze nordwestlich des Campingplatzes „Süßer Winkel“. Der Campingplatzbereich<br />
liegt im Bereich einer Waldlichtung unmittelbar am Werbellinsee.<br />
Die Fläche ist mit Ausnahme einer kleinen Baumgruppe im Zentrum<br />
der Anlage frei von Gehölzen und weist überwiegend intensiv genutzte<br />
Wiesen und Trittrasen auf. Die Stellplätze sind vollständig belegt, so dass<br />
strukturelle Änderungen durch die Änderung der Darstellung im FNP nicht<br />
vorbereitet werden. Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes<br />
sind entsprechend nicht zu erwarten.<br />
4.1.23 Vorhaben 135<br />
Eichhorst: An der Überquerung des Werbellinkanals durch die Eberswalder<br />
Straße südlich des geplanten Festplatzes soll der durch eine<br />
bestehende Baugenehmigung gesicherte Neubau eines Imbisses errichtet<br />
werden. Der vorhandene, weiter südlich gelegene temporäre Imbissstandort<br />
soll hierher verlegt.<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP somit nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
Ortsteil Finowfurt<br />
4.1.6 Vorhaben 7<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser“.<br />
Ziel ist die planerische Sicherung des Bestandes der im<br />
Wald gelegenen Wochenendhaussiedlung Konradshöhe nördlich des<br />
Oder-Havel-Kanals mit einer Ausdehnung von knapp 6.000 m². Die Wochenendhaussiedlung<br />
befindet sich auf einer ausgeprägten Binnendüne<br />
mit relativ dichtem Altbaumbestand aus überwiegend Kiefer mit einzelnen<br />
Birken und Jungpflanzungen von fichten und Stiel-Eichen. Die Freiflächen<br />
werden überwiegend von Ziergärten eingenommen. Der<br />
Gebäudebestand entspricht überschlägig des im Rahmen des<br />
zukünftigen „Sondergebietes“ Zulässigen.<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP somit nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
14
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
4.1.7 Vorhaben 8a<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser“.<br />
Ziel ist die planerische Sicherung des Bestandes der im<br />
Wald gelegenen Wochenendhaussiedlung zwischen Finow-Kanal und<br />
Fichtenweg mit einer Fläche von etwa 5 ha. Die Grundstücke sind fast<br />
vollständig von Kiefern bestanden, rund um die Gebäude finden sich<br />
kleinflächig Ziergartenbereiche.<br />
Für die Flächen im 50-m-Bereich des Finow-Kanals besteht ein Bauverbot<br />
gem. § 48 Brandenburgisches Naturschutzgesetz. Die Ufer des Finow-Kanals<br />
sind gem. § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz geschützte<br />
Biotope. Das Mosaik von naturnahen, standortgemäßen Gehölzsäumen<br />
am Ufer des Finow-Kanals und offener Frischwiesen bzw.<br />
teilweise feuchter Grünlandbrachen ist von hoher Bedeutung für den<br />
Arten und Biotopschutz als Lebensräume insbesondere für Amphibien,<br />
Vögel, Tag- und Nachtfalter sowie Biber und Fischotter. Eine Beeinträchtigung<br />
dieser Bereiche durch eine Ausweitung der Siedlungstätigkeit<br />
steht im Konflikt mit dem Natur- und Landschaftsschutz. Der Konflikt<br />
wird unter der Bezeichnung K 8.1 geführt und ist unbedingt zu vermeiden.<br />
Die Regelung wird als Vermeidungsmaßnahme V 8.1 vorgeschlagen.<br />
„Die Anlage zusätzlicher baulicher Anlagen im Plangebiet ist<br />
unzulässig“<br />
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 8.1 sind erhebliche<br />
und nachhaltige Eingriffe in Natur und Landschaft nicht zu erwarten.<br />
Die westliche Hälfte des Gebietes ist relativ klein parzelliert, so dass der<br />
vorhandene Gebäudebestand überschlägig des im Rahmen des zukünftigen<br />
Sondergebietes „Wochenendhäuser“ Zulässigen entspricht. Die<br />
östliche Hälfte weist sehr große Grundstücke auf, die entsprechend erhebliches<br />
Versiegelungspotential aufweisen was im Konflikt mit dem<br />
Natur- und Landschaftsschutz steht. Der Konflikt wird unter der Bezeichnung<br />
K 8.2 geführt und ist zu vermeiden. Es wird die Festsetzung<br />
der Vermeidungsmaßnahme V 8.2 empfohlen:<br />
„Die Anlage zusätzlicher baulicher Anlagen im Plangebiet ist<br />
unzulässig“<br />
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 8.2 sind erhebliche<br />
und nachhaltige Eingriffe in Natur und Landschaft nicht zu erwarten.<br />
4.1.8 Vorhaben 9<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
„Gemischte Baufläche“. Ziel ist die planerische Sicherung des Bestandes<br />
auf der Fläche. Es handelt sich um ein mit einem Einfamilienhaus<br />
bebautes Grundstück von etwa 1.200 m² an der Lichterfelder Straße am<br />
nördlichen Ortsausgang von Finowfurt. Die Freiflächen sind im vorderen<br />
Bereich überwiegend Trittrasen, im hinteren Bereich findet sich eine<br />
Gartenstruktur mit einzelnen Obst-Gehölzen. Der Gebäudebestand entspricht<br />
überschlägig des im Rahmen der „Gemischten Baufläche“ Zulässigen.<br />
15
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP somit nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
4.1.9 Vorhaben 12<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Sondergebiet „Pferdehof“ in „Gemischte<br />
Baufläche“. Ziel ist die planerische Sicherung des Bestandes<br />
auf der Fläche. Es handelt sich um mit Einfamilienhäusern und einer<br />
ehemals landwirtschaftlich genutzten Hofanlage bebaute Grundstücke<br />
von insgesamt etwa 14.000 m² an der Biesenthaler Straße am südlichen<br />
Ortsausgang von Finowfurt. Die Freiflächen der Grundstücke der Einfamilienhäuser<br />
sind weitgehend gehölzfreie Ziergärten. Der Gebäudebestand<br />
entspricht überschlägig des im Rahmen der „Gemischten Baufläche“<br />
Zulässigen.<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP somit nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
4.1.10 Vorhaben 32a<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Grünfläche „Kleingärten“ in „Wald“.<br />
Die Rücknahme der Entwicklungsabsicht betrifft eine Fläche von etwa<br />
13.000 m². Die Änderung der Plandarstellung verhindert Entwicklungen<br />
mit Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.<br />
4.1.11 Vorhaben 32b<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Grünfläche „Kleingärten“ in „Grünfläche“.<br />
Die Rücknahme der Entwicklungsabsicht betrifft eine Fläche von<br />
etwa 9.800 m². Die Änderung der Plandarstellung verhindert Entwicklungen<br />
mit Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.<br />
4.1.12 Vorhaben 32h<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Grünfläche „Kleingärten“ in Sondergebiet<br />
„Wochenendhäuser“. Ziel ist die planerische Sicherung des<br />
Bestandes der Wochenendhaussiedlung nördlich der Walzwerkstraße<br />
mit einer Ausdehnung von etwa 11.300 m². Die Wochenendhaussiedlung<br />
weist eine ausgeprägte Gehölzstruktur mit einer Mischung aus<br />
Nutz- und Ziergärten auf. Der Gebäudebestand entspricht überschlägig<br />
des im Rahmen des zukünftigen „Sondergebietes“ Zulässigen.<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP somit nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
4.1.13 Vorhaben 38<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
Sondergebiet „Wochenendhäuser“. Ziel ist die planerische Sicherung<br />
des Bestandes der im Wald gelegenen Wochenendhaussiedlung nördlich<br />
des Üdersees mit einer Fläche von etwa 13,5 ha. Die Grundstücke<br />
sind fast vollständig von Kiefern bestanden, rund um die Gebäude finden<br />
sich kleinflächig Ziergartenbereiche. Der Gebäudebestand entspricht<br />
überschlägig des im Rahmen des zukünftigen „Sondergebietes“<br />
Zulässigen.<br />
16
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP somit nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
4.1.14 Vorhaben 49<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
Sonderbaufläche „Floßplatz“. Ziel ist die planerische Sicherung der Bestandsnutzung<br />
als Floßplatz am Finow-Kanal mit einer Ausdehnung von<br />
knapp 1.000 m². Das Gelände wird über eine eingeschossige Hütte in<br />
Holzbauweise, einen umlaufenden Schotterweg und Trittrasenflächen<br />
für Lager- und Bewegungsflächen genutzt. Durch die Festsetzung des<br />
Sondergebietes sind zusätzliche bauliche Entwicklungspotentiale denkbar.<br />
Die Fläche liegt im 50-m-Bereich des Finow-Kanals für den ein Bauverbot<br />
gem. § 48 Brandenburgisches Naturschutzgesetz besteht. Die Ufer<br />
des Finow-Kanals sind gem. § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz<br />
geschützte Biotope. Die derzeitige gehölzfreie Flächenstruktur mit<br />
einem Zierteich und Trittrasen ist allerdings für standortgemäße Tier-<br />
und Pflanzenarten ungeeignet, so dass der Bereich faktisch von untergeordneter<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz ist.<br />
Aufgrund der bestehenden gesetzlichen Schutzbestimmungen stünde<br />
eine weitere Verdichtung der baulichen Nutzung im Konflikt mit dem<br />
Natur- und Landschaftsschutz. Der Konflikt wird unter der Bezeichnung<br />
K 49.1 geführt und ist durch Festsetzung einer entsprechenden Vermeidungsmaßnahme<br />
zu unterbinden. Die Regelung wird als Vermeidungsmaßnahme<br />
V 49.1 vorgeschlagen:<br />
„Die Anlage zusätzlicher baulicher Anlagen im Plangebiet ist<br />
unzulässig.“<br />
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 49.1 sind erhebliche<br />
und nachhaltige Eingriffe in Natur und Landschaft nicht zu erwarten.<br />
4.1.15 Vorhaben 53<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Wohnbaufläche“ in „Grünfläche“.<br />
Die Rücknahme der Entwicklungsabsicht betrifft eine Fläche von etwa<br />
13.800 m². Die Änderung der Plandarstellung verhindert Entwicklungen<br />
mit Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft.<br />
Für die Bilanzierung der Auswirkungen der Änderung des FNP bezüglich<br />
der Bauflächenentwicklung bedeutet die Planänderung auf Basis der<br />
Vorgaben der Baunutzungsverordnung für die in reinen Wohngebieten<br />
zulässige maximale Grundflächenzahl (GRZ) eine Reduktion des im<br />
bestehenden Flächennutzungsplan angesetzten Entwicklungspotentials<br />
von etwa 8.300 m² (13.800 m² x 0,4 GRZ x 0,2 Überschreitungs-GRZ).<br />
4.1.16 Vorhaben 64<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Grünfläche „Kleingärten“ in Sondergebiet<br />
„Wochenendhäuser“. Ziel ist die planerische Sicherung des<br />
Bestandes der Wochenendhaussiedlung nördlich des Finow-Kanals mit<br />
einer Ausdehnung von etwa 11.600 m². Die Freiflächen werden von gehölzarmen<br />
Ziergärten eingenommen. Die Gebäude werden überwiegend<br />
17
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
als Wohnhäuser genutzt. Der Gebäudebestand entspricht überschlägig<br />
des im Rahmen des zukünftigen Sondergebietes Zulässigen.<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP somit nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
4.1.17 Vorhaben 72, 73, 74 und 75<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser“<br />
auf einer Fläche von 2,8 ha. Ziel ist die planerische Sicherung<br />
des Bestandes der von Kiefernforsten eingefassten Wochenendhaussiedlung<br />
an der B167 am West-Ende des Ortsteils Finowfurt. Der<br />
zentrale Bereich des Sondergebietes wird derzeit nur geringfügig als<br />
Wochenendhausgebiet in Anspruch genommen, es dominieren Kiefernforststrukturen.<br />
Hier entstünden durch die Änderung der Darstellung<br />
bauliche Entwicklungspotentiale, die im Konflikt mit dem Natur- und<br />
Landschaftsschutz stehen. Der Konflikt wird unter der Bezeichnung K<br />
72.1 geführt.<br />
Die westlich und östlich gelegenen Bereiche weisen eine Nutz- und<br />
Ziergartenstruktur mit lichtem, teilweise altem Baumbestand auf. Der<br />
Gebäudebestand in diesen eigentlichen Wochenendhausbereichen entspricht<br />
überschlägig des im Rahmen des zukünftigen „Sondergebietes“<br />
Zulässigen.<br />
Da gemeindlich eine Ausweitung der baulichen Nutzung nicht gewünscht<br />
ist und mit Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft durch<br />
Flächenversiegelung und Baumverlusten verbunden ist, wird die Festsetzung<br />
der Vermeidungsmaßnahme V 72.1 empfohlen:<br />
„Die Anlage zusätzlicher baulicher Anlagen im Plangebiet ist<br />
unzulässig“<br />
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 72.1 sind erhebliche<br />
und nachhaltige Eingriffe in Natur und Landschaft nicht zu erwarten.<br />
4.1.18 Vorhaben 96<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Grünfläche „Zeltplatz“ in Sondergebiet<br />
„Camping- und Ferienhausplatz“. Ziel ist die planerische Sicherung<br />
des Bestandes des Campingplatzes zwischen Oder-Havel-Kanal und<br />
Üdersee mit einer Fläche von etwa 10,5 ha. Die Fläche ist kleinteilig in<br />
Dauercampingplätze parzelliert. Die Wohnwagen stehen unter einem<br />
Altbaumbestand aus Stieleiche und Wald-Kiefer. Entlang der westlichen<br />
Grenze des Sondergebietes befindet sich eine Reihe von Einfamilienhäusern<br />
mit entsprechenden Ziergartenbereichen. Im zentralen Bereich<br />
am Ufer des Üdersees erstreckt sich ein großflächiger Badestrand. Der<br />
aktuelle Versiegelungsgrad entspricht überschlägig des im Rahmen des<br />
zukünftigen Sondergebietes Zulässigen.<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP somit nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
18
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
4.1.19 Vorhaben 100, 101, 102 und 103<br />
Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser.<br />
Ziel ist die planerische Sicherung des Bestandes der nördlich des Fichtenweges<br />
gelegenen Wochenendhaussiedlung mit einer Ausdehnung<br />
von etwa 19.400 m². Die Wochenendhaussiedlung befindet sich innerhalb<br />
einer Kiefernforstes. Die Wochenendhaussiedlung wurde erheblich<br />
ausgelichtet, so dass nur vereinzelt Altbaumbestand erhalten ist. Die<br />
Freiflächen werden überwiegend von Ziergärten eingenommen. Der<br />
Gebäudebestand entspricht überschlägig der gemäß Baunutzungsverordnung<br />
in Wochenendhausgebieten zulässigen Grundflächenzahl von<br />
0,3.<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP somit nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
4.1.20 Vorhaben 106<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Gemischte Baufläche“ in „Gemeinbedarfsfläche“<br />
(Kita, Bauhof). Ziel ist die planerische Sicherung der<br />
Nutzung des Gebäudebestandes. Die Baufläche ist mit etwa 6 überwiegend<br />
großflächigen Gebäuden/Hallen bestanden. Die Freiflächen sind<br />
zum größten Teil befestigte Hofflächen. Gehölze fehlen, kleinflächig finden<br />
sich extensiv genutzte Wiesenflächen.<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung der<br />
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
4.1.21 Vorhaben 114<br />
Finowfurt: Darstellung der verkehrlichen Anbindung von Werbellin an die<br />
BAB 11. Ziel ist die korrekte Darstellung einer bestehenden Straßenverbindung.<br />
Bauliche Veränderungen impliziert die Änderung nicht.<br />
4.1.21 Vorhaben 116<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Flugbetriebsfläche in „Gewerbliche<br />
Baufläche. Ziel ist die planerische Sicherung des Bestandes des etwa<br />
4,4 ha großen Gewerbegebietes an der Biesenthaler Straße im Süden<br />
Finowfurts. Die Baufläche ist hochgradig versiegelt und intensiv gewerblich<br />
genutzt.<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP somit nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
4.1.22 Vorhaben 146<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Wald“ in Sondergebiet „Wochenendhäuser.<br />
Ziel ist die planerische Sicherung des Bestandes des nördlich<br />
des Moospfuhls unweit der Eberswalder Straße gelegenen Teilbereichs<br />
der Wochenendhaussiedlung. Die zusätzliche Wochenendhausgebietsdarstellung<br />
betrifft Teile der Flurstücke 123 bis 126. Diese sind<br />
bereits nahezu vollständig in die rechtswirksame Sondergebietsdarstellung<br />
einbezogen. Eine Differenz zwischen der Flurstücks- und Flächennutzungsplanabgrenzung<br />
ergibt sich im westlichen Bereich der Fläche.<br />
Hier wird die bisherige Abgrenzung des Sondergebietes „Wochenend-<br />
19
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
häuser“ entsprechend der Flurstücksgrenzen begradigt. Ein zusätzlicher<br />
Eingriff in Natur und Landschaft entsteht nicht, da die neu als SO „Wochenendhäuser“<br />
dargestellte Fläche bereits als Wochenendhausgebiet<br />
genutzt ist und im Gegenzug der bisher als SO „Wochenendhäuser“<br />
dargestellte Grundstücksteil Waldfläche wird. Der Gebäudebestand entspricht<br />
überschlägig der gemäß Baunutzungsverordnung in Wochenendhausgebieten<br />
zulässigen Grundflächenzahl von 0,3.<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP somit nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
Ortsteil Groß Schönebeck<br />
4.1.24 Vorhaben 66<br />
Groß Schönebeck: Änderung der Darstellung Grünfläche „Wiese“ in<br />
Sondergebiet „Sport und Freizeit“. Ziel ist die Konversion einer Gewerbebrache.<br />
Der Bereich liegt an der Kannegießer Straße und hat eine<br />
Ausdehnung von etwa 15.000 m². Die Fläche ist mit einer Reihe von<br />
Lager- und Produktionshallen bestanden und weißt großflächige, versiegelte<br />
Hof- und Lagerflächen auf. Mit Ausnahme einiger Gehölzinseln ist<br />
das Gebiet frei von Grünstrukturen.<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung der<br />
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
Ortsteil Klandorf<br />
4.1.25 Vorhaben 83<br />
Klandorf: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
„Gemischte Baufläche“. Ziel ist die planerische Sicherung des Bestandes<br />
der beiderseits der Marienwerder Straße gelegenen Siedlungsfläche<br />
mit einer Ausdehnung von etwa 27.500 m². Die Grundstücke werden<br />
überwiegend dienen überwiegend dem Wohnen, vereinzelt finden sich<br />
auch Wochenendhäuser. Die Freiflächen werden von Zier- und Nutzgärten<br />
eingenommen. Die Grundstücke sind überwiegend intensiv mit Gehölzen<br />
eingegrünt. Zur Straße überwiegen Ziergehölze, auf den hinteren<br />
Grundstücksflächen überwiegen Obst- und Wildgehölze. Die nördlich<br />
der Marienwerder Straße gelegene Teilsiedlung ist baulich hochgradig<br />
verdichtet, weitere bauliche Entwicklungspotentiale bestehen hier nicht.<br />
Die südlich der Marienwerder Straße liegenden Grundstücke werden<br />
baulich weniger intensiv genutzt, so dass sich bei der Festsetzung einer<br />
„Gemischten Baufläche“ zunächst bauliche Entwicklungspotentiale ergeben.<br />
Allerdings könnten zusätzliche Baukörper lediglich in zweiter<br />
Reihe ohne gesicherte Erschließung erfolgen. Dadurch reduzieren sich<br />
die theoretischen Baupotentiale vollständig.<br />
Zusätzliche Versiegelungspotentiale werden durch die Änderung der<br />
Darstellung im FNP somit nicht entwickelt, so dass eine Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes nicht zu erwarten ist.<br />
20
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Ortsteil Lichterfelde<br />
4.1.26 Vorhaben 56<br />
Lichterfelde: Änderung der Darstellung Sondergebiet „Ferienhäuser“ in<br />
„Fläche für die Landwirtschaft“. Eine Entwicklungsabsicht für die 59.500<br />
m² umfassende Fläche besteht nicht mehr, so dass Eingriffe in Natur-<br />
und Landschaft planerisch nicht mehr vorbereitet werden.<br />
Für die Bilanzierung der Auswirkungen der Änderung des FNP bezüglich<br />
der Bauflächenentwicklung bedeutet die Planänderung auf Basis der<br />
Vorgaben der Baunutzungsverordnung für die in Ferienhausgebieten<br />
zulässige maximale Grundflächenzahl (GRZ) eine Reduktion des im<br />
bestehenden Flächennutzungsplan angesetzten Entwicklungspotentials<br />
von etwa 17.900 m² (17.900 m² x 0,2 GRZ x 0,1 Überschreitungs-GRZ).<br />
Ortsteil Werbellin<br />
4.1.27 Vorhaben 55<br />
Werbellin: Änderung der Darstellung „Wohnbaufläche“ in „Fläche für die<br />
Landwirtschaft“. Eine Entwicklungsabsicht für die etwa 14.500 m² große<br />
Fläche besteht nicht mehr, so dass Eingriffe in Natur- und Landschaft<br />
planerisch nicht mehr vorbereitet werden.<br />
Für die Bilanzierung der Auswirkungen der Änderung des FNP bezüglich<br />
der Bauflächenentwicklung bedeutet die Planänderung auf Basis der<br />
Vorgaben der Baunutzungsverordnung für die in reinen Wohngebieten<br />
zulässige maximale Grundflächenzahl (GRZ) eine Reduktion des im<br />
bestehenden Flächennutzungsplan angesetzten Entwicklungspotentials<br />
von etwa 8.700 m² (14.500 m² x 0,4 GRZ x 0,2 Überschreitungs-GRZ).<br />
4.2 Vorhaben mit rechtskräftiger verbindlicher Bauleitplanung<br />
An dieser Stelle werden Änderungen zusammengefasst, für die ein<br />
rechtsverbindlicher Bebauungsplan besteht. Da für diese Vorhaben bereits<br />
im Rahmen des B-Planverfahrens die Auswirkungen auf Natur und<br />
Landschaft untersucht wurden und entsprechende Kompensationsmaßnahmen<br />
festgesetzt wurden, ist eine Prüfung der Umweltverträglichkeit<br />
der Vorhaben auf FNP-Ebene nicht sinnvoll und nicht erforderlich.<br />
Ortsteil Finowfurt<br />
4.2.1 Vorhaben 110<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Gemischte Baufläche“ und „Grünfläche“<br />
in „Gemischte Baufläche“. Die Umweltprüfung ist rechtsverbindlich<br />
in einem Bebauungsplan geregelt. Kompensationsflächen sind entsprechend<br />
ebenfalls rechtskräftig nachgewiesen und sind der Gesamtbilanz<br />
der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen nicht mehr hinzuzurechnen.<br />
21
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Ortsteil Altenhof<br />
4.2.2 Vorhaben 115 (Teilvorhaben 4)<br />
Altenhof: Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 23 "Altenpflegeheim<br />
Altenhof"<br />
Nutzung<br />
Das Vorhaben schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die<br />
Entwicklung eines Altenpflegeheimes mit insgesamt 140 Plätzen. Die<br />
Flächendarstellung des FNP wird in die städtebauliche Kategorie „Allgemeines<br />
Wohngebiet“ mit einer GRZ von 0,5 geändert.<br />
Konflikte<br />
Mit der Durchführung des Bauleitverfahrens als Bebauungsplan der Innenentwicklung<br />
nach § 13 a BauGB entfallen die Abarbeitung der Eingriffsregelung<br />
und die Kompensationspflicht.<br />
Es kommt zu einer baulichen Verdichtung, die in der Bilanz zu einer<br />
Mehrversiegelung von etwa 1.400 m² Boden führt.<br />
Die Belange der Schutzgebiete „Biosphärenreservat <strong>Schorfheide</strong>-<br />
Chorin“ und des FFH-Gebietes 347 „Werbellinkanal“ werden nicht tangiert.<br />
Im Zuge der Vorhabenrealisierung geht eine Reihe von Altbäumen verlustig.<br />
Kompensation<br />
Innerhalb des Geltungsbereichs werden Grünflächen mit Bindungen für<br />
Pflanzungen getroffen. Ziel ist u.a. die Schaffung parkartiger<br />
Aufenthaltsflächen für die Heimbewohner.<br />
4.3 Vorhaben mit verbindlicher Bauleitplanung im Verfahren<br />
An dieser Stelle werden Vorhaben zusammengefasst, für die bereits im<br />
Rahmen eines B-Planverfahrens die Auswirkungen auf Natur und Landschaft<br />
untersucht wurden. Die Ergebnisse werden in diesem <strong>Umweltbericht</strong><br />
nur auszugsweise dargestellt. Die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen<br />
werden Bestandteil der Gesamtbilanz der aufgrund der<br />
FNP-Änderungen erforderlichen Kompensationsmaßnahmen.<br />
Ortsteil Altenhof<br />
4.3.1 Vorhaben 115 (Teilvorhaben 1)<br />
Altenhof: B-Plan Nummer 29 „Steganlage“.<br />
Nutzung<br />
Das Vorhaben schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die<br />
landseitige Entwicklung von Ver- und Entsorgungsinfrastruktur für eine<br />
kommunale Steganlage im Werbellinsee außerhalb des Geltungsbereichs<br />
des B-Planes.<br />
22
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Konflikte<br />
Mit dem Vorhaben sind erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Boden<br />
durch die Versiegelung von 1.100 m² Fläche sowie das Schutzgut Landschaftsbild<br />
verbunden. Das Landschaftsbild wird einerseits durch die<br />
Anlage von technischer Infrastruktur, Versorgungsgebäuden und Verkehrsanlagen<br />
in einer attraktiven, intensiv zur naturbezogenen Naherholung<br />
genutzten Parkanlage beeinträchtigt. Andererseits erfolgt eine mit<br />
den Anforderungen der ruhigen Naturerholung nicht vereinbaren Nutzungsänderung<br />
und –Intensivierung durch die Erschließung des Plangebietes<br />
für den Kfz-Verkehr. Hierdurch kommt es zudem zu Verlusten<br />
von gemäß Brandenburgischer Baumschutzverordnung zu erhaltener<br />
Bäumen.<br />
Kompensation<br />
Während die Eingriffe in das Schutzgut Boden durch Entsiegelungsmaßnahmen<br />
im Umfang von 1.100 m² außerhalb des Geltungsbereichs<br />
kompensierbar sind, sind die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes<br />
und der Erholungsvorsorge nur teilweise ausgleichbar.<br />
4.3.2 Vorhaben 115 (Teilvorhaben 2)<br />
Altenhof: B-Plan Nummer 30 „Badewiese“.<br />
Nutzung<br />
Das Vorhaben schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die<br />
landseitige Entwicklung von Ver- und Entsorgungsinfrastruktur für eine<br />
öffentliche Badewiese am Werbellinsee.<br />
Konflikte<br />
Mit dem Vorhaben sind erhebliche Eingriffe in das Schutzgut Boden und<br />
das Schutzgut Arten- und Biotopschutz durch die Versiegelung von 500<br />
m² Fläche verbunden.<br />
Kompensation<br />
Die Anlage zweier zusätzlicher gastronomischer Einrichtungen an der<br />
Badewiese kann durch die Entsiegelung von 500 m² versiegelter Bodenflächen<br />
außerhalb des Plangebietes kompensiert werden.<br />
Ortsteil Böhmerheide<br />
4.3.3 Vorhaben 79<br />
Böhmerheide: 1. Änderung des B-Plan Nummer 1 „Böhmerheide“.<br />
Nutzung<br />
Durch die 1. Änderung des Bebauungsplans Nr. 5 „Böhmerheide“ werden<br />
bauliche Verdichtungen und Nutzungsintensivierungen vorhandener<br />
Siedlungsflächen ermöglicht. U.A. werden bisherige Wochenendhausgebiete<br />
als „Allgemeine Wohngebiete“ festgesetzt.<br />
Konflikte<br />
Die mit der baulichen Nutzunsintensivierung verbundenen Eingriffe in<br />
den Naturhaushalt werden insbesondere durch die zusätzlichen Versiegelungs-Optionen<br />
und die zusätzlich erforderlichen Baumfällungen in<br />
der „Waldsiedlung“ hervorgerufen.<br />
23
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Auf Flurstück 89 erfolgt die flächenmäßige Ausweitung einer Wochenendhaussiedlung<br />
auf bisherige Freiflächen. Die Beeinträchtigung des<br />
Landschaftsbildes an dieser visuell sensiblen Hanglage zum Weißen<br />
See ist nicht kompensierbar. Teile des neu beplanten Flurstsücks 89<br />
sind rudimentäre Sandtrockenrasen, die dem Schutz des § 32 Brandenburgisches<br />
Naturschutzgesetz unterliegen. Der Verlust dieser Biotopflächen<br />
wird durch die Festsetzung von Trockenrasen-Entwicklungsflächen<br />
kompensiert.<br />
Die Eröffnung von baulichen Entwicklungspotentialen betrifft auch<br />
Grundstücke, die in weniger als 50 m Entfernung von Binnengewässern<br />
mit einer Größe von mehr als 1 ha liegen. Damit sind die Verbote des §<br />
48 Brandenburgisches Naturschutzgesetz einschlägig. Die Untere Naturschutzbehörde<br />
kann von diesen Verboten Ausnahmen zulassen,<br />
wenn – wie in diesem Falle gegeben- die Auswirkungen auf Natur- und<br />
Landschaft unerheblich sind.<br />
Kompensation<br />
Es werden Entsiegelungsmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs<br />
in einer Größenordnung von etwa 22.000 m² und Baumersatzpflanzungen<br />
auf den Grundstücken festgesetzt.<br />
Außerhalb des Geltungsbereichs werden Trockenrasenentwicklungsflächen<br />
vorgesehen.<br />
24
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 76, SO „Wochenendhäuser“ und „Freizeit + Erholung“<br />
4.4 Vorhaben mit potentiell negativen Auswirkungen auf<br />
den Naturhaushalt<br />
Diese Vorhaben/Änderungen werden einer näheren Überprüfung hinsichtlich<br />
ihrer voraussichtlichen Umweltwirkungen unterzogen. Ein Verfahren<br />
der verbindlichen Bauleitplanung ist noch nicht eingeleitet worden<br />
bzw. ist nicht vorgesehen.<br />
Es erfolgt eine Beschreibung und Bewertung der Biotoptypen im jeweiligen<br />
Vorhabenraum. Weitere Schutzgüter werden beschrieben und bewertet,<br />
wenn absehbar ist, dass die Vorhabenrealisierung mit erheblichen<br />
und nachhaltigen Eingriffen in die betreffenden Schutzgüter verbunden<br />
ist.<br />
Ortsteil Eichhorst<br />
4.4.1 Vorhaben 76<br />
Eichhorst: Darstellung eines Sondergebiets “Wochenendhäuser“ und<br />
„Freizeit und Erholung“ sowie „Flächen für die Landwirtschaft“: Die Ursprünglich<br />
vorgesehene Entwicklung eines Klinikstandortes wird aufgegeben.<br />
Ziel ist nunmehr die Sicherung des Bestandes an Wochenendhäuser<br />
und die Konversion des Gebäudebestandes für das Sondergebiet<br />
„Freizeit und Erholung“.<br />
Die bestehenden Wochenendhäuser und sonstigen Gebäude genießen<br />
unabhängig von der Änderung der Flächendarstellung des FNP Bestandsschutz.<br />
4.4.1.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.1.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am süd-westlichen Ende des Werbellinsees<br />
im Einmündungsbereich des Werbellinkanals. Es ist Teil des Siedlungssplitters<br />
„Wildau“. Das Gelände wird über die Straße Hubertusstock<br />
erschlossen. Die Straße hat unmittelbaren Anschluss an die westlich<br />
verlaufende L 220. Zwischen Vorhabenraum und L 220 liegen zwei Teiche.<br />
Am südlichen Teich endet das Vorhaben unmittelbar an der Uferlinie.<br />
Östlich liegt dem Bereich eine gewerbliche Freizeit- und Erholungseinrichtung<br />
gegenüber. Nach Nord-Osten schließen sich naturnahe<br />
Laubwälder an. Im Nord-Westen findet sich eine kleinteilige, landwirtschaftlich<br />
genutzte Wiesenlandschaft.<br />
4.4.1.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Die Grundstücksnutzung teilt sich in die Hauptnutzungstypen des Wochenendhausgebietes<br />
(102502 „Wochenendhausbebauung mit Bäumen“)<br />
in der nördlichen Hälfte und einer südlich anschließenden Gewerbebrache<br />
(12320 „Industrie- und Gewerbebrachen“) mit relativ großen<br />
Einzelgebäuden.<br />
Die Wochenendhausgrundstücke weisen eine intensive Strukturierung<br />
durch ältere Bäume und Gehölzen auf. Auf den Freiflächen überwiegt<br />
die Nutzgartenfunktion vor Rasenflächen und Ziergärten. Zur freien<br />
Feldflur nach Westen sind die Grundstücke durch eine geschnittene<br />
Hecke von Ziersträuchern eingefasst. Die Hecke ist nur bedingt geeignet,<br />
das Wochenendhausgebiet landschaftsgerecht einzubinden.<br />
25
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 76, SO „Wochenendhäuser“ und „Freizeit + Erholung“<br />
Aufgrund der überwiegend standortgemäßen Gehölzstrukturen und des<br />
relativ hohen Nutzgartenanteils spielen die Wochenendhausgrundstücke<br />
eine Rolle für kulturfolgende Singvogelarten und für Fledermäuse (Jagdreviere,<br />
Baumquartiere). Sehr wahrscheinlich hat der Vorhabenraum<br />
Bedeutung als Sommerlebensraum für eine Reihe von Amphibien, die<br />
im nahen Werbellinsee bzw. den westlich gelegenen Weihern Laichgewässer<br />
vorfinden.<br />
Die Gewerbebrache weist kaum Gehölzstrukturen auf. Es überwiegen<br />
Rasenflächen. Es handelt sich um in Brandenburg häufige Biotoptypen,<br />
die in erster Linie euryöken Tier- und Pflanzenarten („Allerweltsarten“)<br />
Lebensraum bieten.<br />
Zwischen der Gewerbebrache und dem Gehölzsaum der westlich gelegenen<br />
Weiher ziehen sich ruderalisierte Staudenfluren nährstoffreicher,<br />
frischer Standorte (Biotoptyp 051422) im engen Verbund mit Gehölzaufwuchs.<br />
Biotoptypen Vorhaben 76 (Eichhorst)<br />
Entlang der Uferlinie zum südlichen Weiher findet sich ein standortgemäßer<br />
Gehölzsaum (07190) mit altem Erlenbestand sowie Baum- und<br />
Strauchweiden. Der Gewässersaum unterliegt dem Schutz des § 32<br />
Brandenburgisches Naturschutzgesetz. In Verbindung mit dem angrenzenden<br />
FFH-Gebiet „Werbellinkanal“ ist der Bereich zudem als FFH-<br />
26
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 76, SO „Wochenendhäuser“ und „Freizeit + Erholung“<br />
Lebensraum des Anhangs 1 der FFH-Richtlinie von besonderer Bedeutung.<br />
Es ist sehr wahrscheinlich, dass die an das Vorhabengebiet angrenzenden<br />
Uferbereiche von Relevanz für nach Anhang 2 der FFH-<br />
Richtlinie geschützte Tierarten sind. Hierzu gehören Arten, die Schutzziel<br />
des FFH-Gebietes 347 „Werbellinkanal“ sind:<br />
� Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)<br />
� Großes Mausohr (Myotis myotis)<br />
� Biber (Castor fiber) (nur Uferbereich)<br />
� Fischotter (Lutra lutra) (nur Uferbereich)<br />
� Kammmolch (Triturus cristatus)<br />
� Rotbauchunke (Bombina bombina)<br />
Nach Auskunft der Unteren Naturschutzbehörde kommt zudem eine<br />
Population des Europäischen Laubfrosches (Hyla arborea) in den angrenzenden<br />
Teichen und deren Uferbereiche vor. Der Laubfrosch ist<br />
ebenfalls Schutzziel des FFH-Gebietes „Werbellinkanal“.<br />
4.4.1.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Die Wochenendhausnutzung entspricht in den Bestandsflächen überschlägig<br />
der im Rahmen der Flächenkategorie „Sondergebiet Wochenendhausgebiet“<br />
möglichen baulichen Nutzungsintensität. Zusätzliche<br />
Versiegelungsmöglichkeiten dürfte die Änderung der Plandarstellung bei<br />
einer für die Flächenkategorie üblichen GRZ von 0,2 nicht eröffnen.<br />
Die derzeitige Gewerbebrache weist aktuell durch die ehemaligen Gewerbebauten<br />
und deren Nebenflächen überschlägig eine Flächenversiegelung<br />
von 2.500 m² auf. Die zukünftige Fläche des Sondergebietes<br />
„Freizeit und Erholung“ weist etwa 6.700 m² auf. Damit besteht derzeit<br />
ein Versiegelungsgrad von etwa 35%. Damit ist eine Erhöhung des Versiegelungsgrades<br />
im Rahmen der Entwicklung des „Sondergebietes<br />
Freizeit und Erholung“ nicht zu erwarten.<br />
Die Gehölzsäume der Weiher und die ruderalen Staudenfluren sollen als<br />
„Fläche für die Landwirtschaft“ dargestellt werden. Eine Wiederaufnahme<br />
der landwirtschaftlichen Nutzung ist ausgeschlossen, so dass strukturelle<br />
Änderungen der Flächen nicht zu erwarten sind.<br />
4.4.1.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
Eine Beeinträchtigung der oben genannten Zielarten des FFH-Gebietes<br />
„Werbellinkanal“ ist unwahrscheinlich, da bauliche Veränderungen ausschließlich<br />
im Bereich des Gebäudebestandes möglich sind. Die bestehenden<br />
Staudenfluren zwischen den Ufersäumen der Teiche und der<br />
Sondergebietsgrenzen bleiben als Pufferzonen vollständig erhalten<br />
(Ausweisung als Flächen für die Landwirtschaft). Der räumliche Status<br />
Quo bleibt somit erhalten, so dass keine direkten Eingriffe aus Bautätigkeit<br />
die Uferbereiche beeinträchtigen können.<br />
K 76.1: Negative Folgen könnte dagegen eine Nutzungsintensivierung<br />
der bislang brachliegenden Gebäude und Flächen des Sondergebietes<br />
27
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 76, SO „Wochenendhäuser“ und „Freizeit + Erholung“<br />
Freizeit und Erholung haben. Eine „wilde“ Ausdehnung der Freizeitaktivitäten<br />
der Besucher in Richtung Teichlandschaft kann nicht ausgeschlossen<br />
werden. Damit würden erhebliche Störpotentiale in die für den Arten-<br />
und Biotopschutz sehr wertvollen Bereiche getragen. Die geschützten<br />
Biotope würden in ihrer Habitateignung für eine ganze Reihe von<br />
störanfälligen Tierarten erheblich beeinträchtigt werden. Besonders hervorzuheben<br />
sind hierbei die Tierarten, die Schutzziel des FFH-Gebietes<br />
347 „Werbellinkanal“ sind und auf Störungen aus Freizeitnutzungen<br />
empfindlich reagieren:<br />
� Biber (Castor fiber) (nur Uferbereich)<br />
� Fischotter (Lutra lutra) (nur Uferbereich)<br />
� Laubfrosches (Hyla arborea)<br />
� Kammmolch (Triturus cristatus)<br />
Aufgrund der attraktiveren Freizeitangebote am wenige Meter entfernten<br />
Werbellinsee ist der Entwicklungsdruck in Richtung der Teiche allerdings<br />
voraussichtlich gering.<br />
4.4.1.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
Aufgrund der fehlenden Mehrversiegelung und der geringen zu erwartenden<br />
Baumassen sind keine erheblichen Beeinträchtigungen der<br />
Schutzgüter Klima, Boden und Wasser zu besorgen.<br />
4.4.1.2.3 Landschaftsbild<br />
Landschaftsästhetisch bedeutsame strukturelle Änderungen des Bestandes<br />
sind im Bereich des Sondergebietes Freizeit und Erholung zu<br />
erwarten. Der überwiegend desolate Gebäudealtbestand stellt z.Z. allerdings<br />
eine Belastung des Landschaftsbildes dar. Eine Verschlechterung<br />
der landschaftsästhetischen Situation durch Sanierung oder Abriss und<br />
Neubau der Gebäude ist nicht anzunehmen.<br />
4.4.1.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 76.1<br />
Die Inanspruchnahme der Pufferflächen zwischen dem Sondergebiet<br />
Freizeit und Erholung und den Uferbereichen der Teiche im Westen des<br />
Vorhabengebietes durch Freizeitaktivitäten sollte verhindert werden, um<br />
die Beeinträchtigung wertvoller Lebensräume für besonders und streng<br />
geschützter Tierarten zu verhindern. Die erforderliche Vermeidungsmaßnahme<br />
V 76.1 sollte wie folgt formuliert werden:<br />
„Die Kultivierung der Staudenfluren zwischen den<br />
Sondergebietsgrenzen und den Uferstrukturen der Teiche<br />
westlich des Vorhabens durch Anlage von Rasenflächen,<br />
Badestellen, Wegen, Aufstellen von Spielgeräten<br />
oder sonstigen Vorrichtungen, die eine Freizeitnutzung<br />
befördern, ist unzulässig.“<br />
Da das Projektgebiet im geltenden Flächennutzungsplan als Sondergebiet<br />
„Klinik“ vorgesehen wurde, ergibt sich für die Bilanzierung der durch<br />
die Änderung des FNP vorgesehenen Änderungen der baulichen Entwicklungspotentiale<br />
eine Reduktion. Für das Sondergebiet „Klinik“ ist<br />
28
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 76, SO „Wochenendhäuser“ und „Freizeit + Erholung“<br />
auf Basis der Vorgaben der Baunutzungsverordnung von einer zulässigen<br />
maximale Grundflächenzahl (GRZ) von 0,4 zuzüglich Überschreitungs-GRZ<br />
von 0,2 auszugehen. Bei einer Grundfläche von etwa 11.400<br />
m² bedeutet dies etwa 6.800 m² Baufläche. Die zu ändernde Darstellung<br />
in „Wochenendhausgebiet“ und „Freizeit- und Erholungsgebiet“ erlaubt<br />
eine Gesamt-GRZ von 0,3, womit etwa 3.400 m² Baufläche möglich<br />
sind. Damit ergibt sich eine Reduktion zum im bestehenden Flächennutzungsplan<br />
angesetzten baulichen Entwicklungspotentials von etwa<br />
3.400 m².<br />
29
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 97, SO „Friedhof“<br />
4.4.2 Vorhaben 97<br />
Eichhorst: Darstellung eines Sondergebiets „Friedhof“ an Stelle von<br />
„Wald“.<br />
Ziel ist die Bereitstellung einer Fläche für die Anlage eines Naturfriedhofs.<br />
Diese Form des Friedhofs kommt ohne die Errichtung oberirdischer<br />
Einbauten aus. Es werden biologisch kurzfristig abbaubare Urnen<br />
frei auf der Fläche vergraben, ohne dass die Stellen durch Kreuze oder<br />
Grabsteine markiert werden. Die Bestattung wird ausschließlich durch<br />
amtlich bestallte Bestatter vorgenommen. Die Bestattungen erfolgen auf<br />
Naturfriedhöfen i.d.R. ohne Trauergäste.<br />
4.4.2.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.2.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich etwa 800 m südlich von Eichhorst auf<br />
der westlichen Seite des Werbellinkanals. Das Gelände wird über einen<br />
Waldweg in Verlängerung der Schulstraße fußläufig bzw. für forst- und<br />
landwirtschaftliche Fahrzeuge erschlossen. In Verlängerung der Straße<br />
Am Werbellinkanal verläuft darüber hinaus ein unwegsamer Trampelpfad<br />
unmittelbar am Werbellinkanal zum Projektgebiet. Das Projektgebiet<br />
wird nach Süden und Westen von jüngeren Kiefern-Forsten eingefasst.<br />
Nach Norden schließt sich der bewaldete Ortsrand von Eichhorst<br />
an. Nach Osten auf der gegenüberliegenden Seite des Werbellinkanals<br />
findet die Wiesenfläche eine Fortsetzung.<br />
Das Projektgebiet liegt innerhalb der Schutzzone III des Biosphärenreservats<br />
<strong>Schorfheide</strong>-Chorin sowie innerhalb des FFH-Gebietes 347<br />
„Werbellinkanal“.<br />
4.4.2.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet umfasst eine Fläche von etwa 1,7 ha. Das Gelände ist<br />
zum größten Teil eine landwirtschaftlich genutzte Wiese. Der Boden ist<br />
ein humusreicher Sandboden. Nach Westen steigt das Gelände leicht<br />
an, so dass sich ein Feuchtegradient vom Werbellinkanal als tiefstem<br />
Punkt und dem auf einer flachen Binnendüne gelegenen Waldmantel<br />
ergibt. Das Grundwasser steht zwischen weniger als 0,5 m am Werbellinkanal<br />
und etwa 1,5 m am Waldmantel unter Flur an. Entlang des Werbellinkanals<br />
- außerhalb des Projektgebietes – verläuft ein Biotopkomplex<br />
aus einem standortgemäßen Gehölzsaum an Ufern (Biotoptyp<br />
07190) mit vorwiegend Erlenbestand und einem Saum von Schilfröhrichten<br />
(Biotoptyp 012111). Dieser Biotopkomplex unterliegt dem Schutz<br />
des § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz und ist von sehr hoher<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Westlich des Ufersaums schließt sich eine Feuchtwiese in einer floristisch<br />
artenarmen Ausprägung an (Biotoptyp 051032). Seggen und Binsen<br />
treten regelmäßig auf, ohne den Bestand jedoch zu dominieren. Der<br />
Feuchtwiesenbereich liegt ebenfalls nicht innerhalb der geplanten Naturfriedhofsfläche.<br />
Die Feuchtwiese geht mit ansteigendem Gelände in eine<br />
Frischwiese nährstoffreicher Standorte in ebenfalls floristisch verarmter<br />
Ausprägung über. Neben den kennzeichnenden Süßgräsern bestimmen<br />
in Brandenburg häufige, schnittverträgliche Kräuter wie Kleines Habichtskraut,<br />
Wiesen-Schafgarbe, Kriechendem Hahnenfuß, Spitzwege-<br />
30
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 97, SO „Friedhof“<br />
rich und Löwenzahn die Frischwiese. Die Lebensraumqualität der Wiesen<br />
ist für die Charakterarten der Wiesen und Weiden aufgrund der kurzen<br />
Mahdintervalle als suboptimal zu bezeichnen. Insbesondere für wiesenbrütende<br />
Vogelarten stellen zu kurze Mahdintervalle bzw. jahreszeitlich<br />
zu frühe Schnitttermine einen limitierenden Faktor dar. Für Greifvögel,<br />
Weißstorch (Ciconia ciconia, RL 1; VSchRL) und auch Kraniche<br />
(Grus grus, RL 1; VSchRL) bieten die Wiesen allerdings störungsarme<br />
Nahrungshabitate. Auch Rehwild und Wildschweine nutzen die Wiesen<br />
als Äsungsfläche bzw. graben nach Wurzeln und Knollen. Im Zusammenspiel<br />
mit den Uferstrukturen und dem Wasserkörper des Werbellinkanals<br />
erlangen v.a. die Feuchtwiesen Bedeutung als Teillebensräume<br />
für Biber, Fischotter, Ringelnatter, Zwergspitzmaus (Sorex minutus<br />
(BArtSchV), Schafstelze (Motacilla flava, RL 3), Braunkehlchen (Saxicola<br />
rubetra, RL 2), Moorfrosch (Rana arvalis, RL 3; FFH IV), Grasfrosch<br />
(Rana temporaria, RL 3; BArtSchV).<br />
Biotoptypen Vorhaben 97 (Eichhorst)<br />
Der westlich und südlich an die Frischwiese anschließende, etwa 10 m<br />
breite Waldmantel (07120) vermittelt zu den anschließenden, ausgedehnten<br />
Kiefernforsten und wird von der Birke (B. pendula), der Stiel-<br />
Eiche (Q. robur) und der Wald-Kiefer (P. sylvestris) bestimmt. Die Altersstruktur<br />
umfasst sowohl starkes Baumholz als auch Jungwuchs der<br />
genannten Baumarten, die ebenfalls die Strauchschicht bilden. Die<br />
Krautschicht im inneren des Waldmantels wird von Adlerfarn und Landreitgras<br />
dominiert. Beim faunistischen Artenspektrum kommt es zu Ü-<br />
31
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 97, SO „Friedhof“<br />
berschneidungen von reinen Gehölz-/Waldbewohnern, die z.B. nur zeitweise<br />
die durchwärmten Waldränder zur Paarfindung nutzen, bis zu<br />
typischen Offenlandarten, die hier z.T. die Deckung bietenden Strukturen<br />
benötigen. Typische Besiedler unter den Wirbeltieren sind verschiedene<br />
Hecken- und Buschbrüter wie Gartengrasmücke, Dorngrasmücke,<br />
Neuntöter, Goldammer u.a. Das Vorkommen von Waldeidechse (Lacerta<br />
vivipara, RL 2; BArtSchV) und Blindschleiche Anguis fragilis<br />
(BArtSchV) ist zu erwarten. Besonders artenreich ist die Insektenfauna<br />
der warmen Waldränder über den trockenwarmen Sandböden. Derartige<br />
Waldmäntel stellen als Grenzbereiche zwischen stark divergierenden<br />
Ökosystemen wertvolle Lebensräume dar.<br />
Die Bedeutung des Projektgebietes für den Arten- und Biotopschutz ist<br />
im Zusammenwirken der einzelnen Biotoptypen als hoch zu bewerten.<br />
Zu Bedenken ist in diesem Zusammenhang auch die Lage im FFH-<br />
Gebiet 347 „Werbellinkanal“. Der Schutzzweck des FFH-Gebietes ergibt<br />
sich zum einen aufgrund seiner Bedeutung als wichtiges Element<br />
im Biotop-Verbund Oder, Havel und Havel-Seengebiete und zum anderen<br />
aus den im Gebiet signifikant vorkommenden Lebensraumtypen<br />
und Arten nach Anhang I und II der FFH-Richtlinie (RAT DER<br />
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1992). Im FFH-Gebiet „Werbellinkanal“<br />
kommen signifikant folgende Lebensraumtypen nach Anhang<br />
I der FFH-Richtlinie vor:<br />
• Oligo- bis mesotrophe Gewässer mit benthischer Vegetation aus<br />
Armleuchteralgen (32 % Anteil),<br />
• Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion<br />
oder Hydracharition (14 %)<br />
• Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen<br />
Stufe (1 %)<br />
• Übergangs- und Schwingrasenmoore (1 %)<br />
• Hainsimsen-Buchenwälder (12 %)<br />
• Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (2 %)<br />
Damit sind die außerhalb des Projektgebietes liegenden Uferstrukturen<br />
als FFH-relevant einzustufen. Die Feuchtwiese würde sich bei Auflassen<br />
der Nutzung relativ rasch zu einer feuchten Hochstaudenflur entwickeln<br />
und damit ebenfalls als Lebensraum unmittelbar FFH-relevant werden.<br />
Im FFH-Gebiet „Werbellinkanal“ kommen darüber hinaus signifikant<br />
folgende Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie vor:<br />
• Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)<br />
• Großes Mausohr (Myotis myotis)<br />
• Biber (Castor fiber)<br />
• Fischotter (Lutra lutra)<br />
• Rotbauchunke (Bombina bombina)<br />
• Kammmolch (Triturus cristatus)<br />
• Rapfen (Aspius aspius)<br />
• Steinbeißer (Cobitis taenia)<br />
• Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)<br />
• Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)<br />
• Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)<br />
• Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)<br />
32
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 97, SO „Friedhof“<br />
Mit Sicherheit Habitatfunktion hat das Projektgebiet für Biber und Fischotter.<br />
Unter Umständen könnten in feuchten Frühjahren mit lang anhaltendem<br />
Wasserstau auf den Feuchtwiesen Laichgewässer für die Rotbauchunke<br />
auftreten. Auch das Vorkommen der Großen Moosjungfer ist<br />
nicht auszuschließen. Die Fischfauna ist im Zusammenhang mit dem<br />
Vorhaben nicht beachtlich.<br />
4.4.2.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
4.4.2.2.2 Arten- und Biotopschutz<br />
Die Einrichtung eines Naturfriedhofes erzeugt keine erheblichen und nachhaltigen<br />
strukturellen Änderungen der Bodennutzung. Eingriffe im Sinne des<br />
§10 Brandenburgisches Naturschutzgesetz liegen somit nicht vor.<br />
Naturfriedhöfe werden nicht in vergleichbarem Ausmaß von Trauergästen<br />
frequentiert, wie dies auf „klassischen“ Friedhöfen der Fall ist. Es<br />
kann davon ausgegangen werden, dass die Besucherfrequenz gegenüber<br />
der üblichen Naturerholungsnutzung nicht erheblich erhöht wird.<br />
Damit ist auch für die oben genannten störungssensitiven und gleichzeitig<br />
tagaktiven Tierarten wie Kranich und Weisstorch keine Einschränkung<br />
der Biotopqualitäten zu erwarten.<br />
Da die Feuchtwiesen und Uferstrukturen am Werbellinkanal nicht Teil<br />
des Naturfriedhofes sind, sind die oben genannten semi-aquatischen<br />
Tierarten ebenfalls nicht vom Vorhaben betroffen. Eine Beeinträchtigung<br />
des Erhaltungszustandes von signifikanten Tierarten des FFH-Gebietes<br />
347 „Werbellinkanal“ ist daher auszuschließen.<br />
K 97.1: Eine Erschließung des Friedhofs u.a. über den Trampelpfad<br />
entlang des Werbellinkanals beeinträchtigte den dortigen, nach § 32<br />
geschützten Ufergehölzsaum.<br />
K 97.2: Eine Verbringung von Urnen innerhalb der Forstflächen, insbesondere<br />
des Waldmantels führt zu Wurzelverletzungen an Bäumen und<br />
beeinträchtigt Bodenlebensräume von Kleinsäugern und Wirbellosen.<br />
4.4.2.2.3 Boden und Wasser<br />
Die Verbringung von Urnen innerhalb der Forstflächen, insbesondere<br />
des Waldmantels führt zu zusätzlichen Nährstoffeinträgen, die mangels<br />
laufender Bewirtschaftung der Forstflächen zu punktuellen Eutrophierungserscheinungen<br />
mit einer Verschiebung des floristischen Artenspektrums<br />
hin zu nitrophytischen „Allerweltsarten“ führen können.<br />
Im Bereich der Frischwiese erscheint die Problematik des zusätzlichen<br />
Nährstoffeintrages aufgrund der Mahd der Fläche mit entsprechendem<br />
Nährstoffentzug nicht erheblich zu sein. Im Vergleich zur landwirtschaftlich<br />
bedingten Verbringung von Dünger auf der Frischwiese erreicht die<br />
Nährstoffversorgung auch bei Annahme einer extensiven landwirtschaftlichen<br />
Nutzung keine relevanten Größenordnungen.<br />
Es ist nicht auszuschließen, dass über die Urnenasche Schadstoffe in<br />
den geplanten Naturfriedhof eingetragen werden. Da die so genannte<br />
33
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 97, SO „Friedhof“<br />
Holzasche des Sarges während des Einäscherungsvorganges aufgrund<br />
ihres geringeren spezifischen Gewichts von der Entrauchungsanlage<br />
abgesaugt wird, verbleiben lediglich die nicht brennbaren Schadstoffe<br />
innerhalb der Leichen als Kontaminationsquelle. Hierbei sind in erster<br />
Linie Schwermetalle und Dioxine zu erwarten. Das aufgrund der weit<br />
verbreiteten Amalganfüllungen in erster Linie zu erwartende Quecksilber<br />
verflüchtigt sich während des Brennvorgangs. Die Füllungen selbst werden<br />
der Asche vor dem Einbringen in die Urne entnommen. In wie fern<br />
menschliche Aschereste geeignet sind, signifikante Auswirkungen auf<br />
die Schwermetall- und Dioxinbelastung zu verursachen, kann im Rahmen<br />
dieser Untersuchung nicht abschließend geklärt werden. Die<br />
Schadstoffdiskussion beim Ausbringen von Asche wird v.a. um die<br />
Verbringung von Holzasche aus landwirtschaftlichen Flächen geführt.<br />
Hier wird empfohlen, die Feinstflugasche nicht auszubringen, während<br />
die mittleren und groben Fragmente die Grenzwerte der Klärschlammverordnung<br />
einhalten (für Holz-Hackschnitzel-Asche) bzw. die Bodenrichtwerte<br />
erfüllen (Einjahrespflanzen- und Strohasche). Zu berücksichtigen<br />
ist hierbei, dass im Rahmen der landwirtschaftlichen Düngung von<br />
3.000 bis 6.000 kg/ha und Jahr auszugehen ist (vgl.<br />
RUCKENBAUER/OBERNBERGER/HOLZNER 1997). Im Falle des Naturfriedhofes<br />
werden bei angenommenen 50 Bestattungen jährlich etwa<br />
25 kg Asche auf 1,5 ha ausgebracht (entspricht etwa 16 kg/ha und<br />
Jahr). Damit beträgt der Ascheeintrag des Naturfriedhofes 0,35% einer<br />
durchschnitllichen landwirtschaftlichen Aschedüngung. Damit dürfte<br />
selbst bei deutlich höheren Schadstoffkonzentrationen in menschlichen<br />
Verbrennungsrückständen gegenüber Holzasche die Erheblichkeitsschwelle<br />
nicht überschritten werden.<br />
Die Schadstoffproblematik im Rahmen der Feuerbestattung wird daher<br />
ausschließlich im Zusammenhang mit der gasförmigen Schadstoffemission<br />
der Krematorien geführt.<br />
Schadstoffeinträge am Ort der Bestattung in den Boden werden bezogen<br />
auf die Erdbestattung diskutiert.<br />
4.4.2.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 97.1:<br />
Die Beeinträchtigung des geschützten Ufergehölzes entlang des Werbellinkanals<br />
durch die potentielle Intensivierung der Wegeverbindung<br />
zwischen dem zukünftigen Friedhofsbereich und der Ortslage Eichhorst<br />
sollte durch Übernahme der Vermeidungsmaßnahme V 97.1 vermieden<br />
werden:<br />
„Die fußläufige Nutzbarkeit des Trampelpfades entlang des<br />
Werbellinkanals wird durch waldbauliche Maßnahmen erschwert.“<br />
K 97.2:<br />
Die Beeinträchtigung der Forstflächen und Waldmäntel durch Nährstoffeinträge<br />
und punktuelle Bodenhorizontverschiebungen durch Grabeaktivitäten<br />
sollte durch Übernahme der Vermeidungsmaßnahme V 97.2 vermieden<br />
werden:<br />
„Die Bestattung von Urnen im Traufbereich von Gehölzen ist zu<br />
vermeiden.“<br />
34
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 104 b, SO „Campingplatz“<br />
4.4.3 Vorhaben 104b<br />
Groß Schönebeck: Darstellung eines Sondergebiets „Camping“ an Stelle<br />
von „Wald“. Ziel ist die Sicherung bestehender Campingplatzflächen<br />
sowie die Sicherung der bestehenden Erschließung eines Ausfluglokals<br />
bzw. von Steganlagen am Horn des „Süßen Winkels“ über den Uferwanderweg<br />
des Werbellinsees.<br />
4.4.3.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.3.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am südlichen Westufer des Werbellinsees<br />
im so genannten „Süßen Winkel“. Das Gelände ist über eine Stichstraße<br />
erschlossen, die von der Radwegeverbindung zwischen Altenhof<br />
und Eichhorst abgeht.<br />
Das Projektgebiet ist nach Norden durch den Werbellinsee begrenzt und<br />
landseitig vollständig von Buchenwäldern umschlossen.<br />
Das Gelände liegt im Außenbereich in der Schutzzone III des Biosphärenreservats<br />
„<strong>Schorfheide</strong>-Chorin“. Der Werbellinsee ist Teil des FFH-<br />
Gebietes 347 „Werbellinkanal“.<br />
4.4.3.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das westlich gelegene Teilgebiet der Nummer 104 b befindet sich außerhalb<br />
der Hangkante zum Werbellinsee. Die grundwassernahen,<br />
ebenen Flächen werden von Buchenforsten (Biotoptyp 08320) eingenommen.<br />
Aufgrund der intensiven Frequentierung des Uferwanderweges<br />
in diesem Abschnitt fehlt eine Strauch- und Krautschicht vollständig.<br />
Im Teilgebiet konzentrieren sich zahlreiche Freizeitnutzungen. Der<br />
Uferweg wird hier als Erschließungsweg für zahlreiche Steganlagen<br />
am Werbellinsee und das Ausflugslokal genutzt und mit KFZ befahren.<br />
Parallel zum Weg wird die gesamte Waldfläche als Kfz-Stellplatz genutzt.<br />
Aufgrund der intensiven Störeinflüsse spielt der Buchenforst<br />
eine geringe Rolle für den Arten- und Biotopschutz. Es ist allerdings<br />
davon auszugehen, dass Baumquartiere von verschiedenen Fledermausarten<br />
bestehen.<br />
Ohne die Nutzung der Forstflächen als Kfz-Stellplätze würde sich voraussichtlich<br />
eine Krautschicht einstellen, die Buchenwälder mittlerer<br />
Standorte kennzeichnet (Biotoptyp 08172). Solche Buchenwälder<br />
schließen sich südlich an das Projektgebiet an und unterliegen hier als<br />
standortgemäßer, der natürlichen Klimaxgesellschaft entsprechende<br />
Waldgesellschaft dem Schutz des § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz.<br />
Die östliche Teilfläche des Vorhabens 104 b umfasst einen Campingplatz<br />
unter einem Buchen-Altbestand (Biotoptyp 10182). Eine Kraut-<br />
und Strauchschicht fehlt entsprechend vollständig und ist ersetzt durch<br />
Wege, Terrassen, kleinere Rasen- und Pflanzflächen. Die intensive<br />
Nutzung sorgt dafür, dass der Biotoptyp für den Arten und Biotopschutz<br />
eine geringe Rolle spielt. Auch hier ist allerdings in den Altbäumen<br />
mit Baumquartieren von Fledermäusen zu rechnen.<br />
35
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 104 b, SO „Campingplatz“<br />
Das Projektgebiet hat in seiner Gesamtheit einen hohen Funktionswert<br />
für den regionalen Biotopverbund. Der Werbellinsee hat innerhalb des<br />
ökologisch wirksamen Freiraumverbundsystems eine zentrale Verbindungsfunktion.<br />
Hier sind insbesondere Biber (Castor fiber, FFH IV) und<br />
Fischotter (Lutra lutra, FFH IV) als Zielarten zu benennen.<br />
Zu Bedenken ist in diesem Zusammenhang auch die Lage im FFH-<br />
Gebiet 347 „Werbellinkanal“. Der Schutzzweck des FFH-Gebietes ergibt<br />
sich zum einen aufgrund seiner Bedeutung als wichtiges Element<br />
im Biotop-Verbund Oder, Havel und Havel-Seengebiete und zum anderen<br />
aus den im Gebiet signifikant vorkommenden Lebensraumtypen<br />
und Arten nach Anhang I und II der FFH-Richtlinie (RAT DER<br />
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1992). Im FFH-Gebiet „Werbellinkanal“<br />
kommen signifikant folgende Lebensraumtypen nach Anhang<br />
I der FFH-Richtlinie vor:<br />
• Oligo- bis mesotrophe Gewässer mit benthischer Vegetation<br />
aus Armleuchteralgen (32 % Anteil),<br />
• Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ<br />
Magnopotamion oder Hydracharition (14 %)<br />
• Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen<br />
Stufe (1 %)<br />
• Übergangs- und Schwingrasenmoore (1 %)<br />
• Hainsimsen-Buchenwälder (12 %)<br />
• Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (2 %)<br />
Damit sind die Ufer des Werbellinsees des Projektgebietes als FFHrelevant<br />
einzustufen.<br />
Im FFH-Gebiet „Werbellinkanal“ kommen darüber hinaus signifikant<br />
folgende Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie vor:<br />
• Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)<br />
• Großes Mausohr (Myotis myotis)<br />
• Biber (Castor fiber)<br />
• Fischotter (Lutra lutra)<br />
• Rotbauchunke (Bombina bombina)<br />
• Kammmolch (Triturus cristatus)<br />
• Rapfen (Aspius aspius)<br />
• Steinbeißer (Cobitis taenia)<br />
• Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)<br />
• Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)<br />
• Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)<br />
• Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)<br />
Mit Sommerquartieren von Mopsfledermaus und Großem Mausohr ist in<br />
Altbäumen des Laubholzforstes zu rechnen.<br />
Für den Kammmolch bieten die ufernahen Waldstrukturen generell geeignete<br />
Sommer- und Winterhabitate, die aber aufgrund der Stellplatznutzung<br />
nicht zur Wirkung kommt.<br />
36
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 104 b, SO „Campingplatz“<br />
Biber und Fischotter dürften das unmittelbare Projektgebiet aufgrund der<br />
Entfernung vom Ufer (Biber) bzw. aufgrund der anthropogenen Störeinflüsse<br />
aus den angrenzenden Campingplatzflächen meiden.<br />
Die rein aquatischen Tierarten werden nicht weiter betrachtet, da ein<br />
Einfluss des Vorhabens auf diese nicht ersichtlich ist.<br />
Biotoptypen Vorhaben und 104 b (Eichhorst)<br />
4.4.3.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Die bestehenden Camping-Flächen sind vollständig in Parzellen aufgeteilt,<br />
eine weitere Intensivierung der Nutzung ist nicht möglich. Die Son-<br />
37
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 104 b, SO „Campingplatz“<br />
dergebietsflächen um den Uferweg dienen der Kfz-Erschließung von<br />
Steganlagen und eines Ausflugslokals sowie als Kfz-Stellplätze auf<br />
Waldboden. Nach Aussage der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> handelt es sich<br />
um eine mit der zuständigen Forstbehörde abgestimmte Nutzung.<br />
4.4.3.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
Die Kfz-Stellplatznutzung im westlichen Teilgebiet des Vorhabens 104 b<br />
verhindert die Entwicklung einer für Buchenwälder mittlerer Standorte<br />
typische Strauch- und Krautschicht. Die potentiell für den Arten- und<br />
Biotopschutz wertvollen Waldflächen weisen aufgrund dieser Nutzung<br />
ihre derzeit geringe Biotopwertigkeit auf. Betroffen ist eine Fläche von<br />
durchschnittlich etwa 5 m Tiefe auf einer Länge des Erschließungsweges<br />
von etwa 350 m (entspricht etwa 1.750 m²). Da durch die Änderung<br />
der planerischen Darstellung keine zusätzlichen Eingriffe in den Zustand<br />
von Natur und Landschaft ermöglicht werden, wird die Beeinträchtigung<br />
nicht als Konflikt geführt. Dies gilt gleichermaßen für den östlichen Teil<br />
von 104b.<br />
4.4.3.2.2 Schutzgut Boden, Wasser und Klima<br />
Die Nutzung des Uferwanderweges stellt eine erhebliche Beeinträchtigung<br />
der Leistungsfähigkeit des Bodens durch Verdichtung sowie eine<br />
potentielle Gefährdung des Schutzgutes Wasser durch Eindringende<br />
Motoröle bzw. Kraftstoffe dar. Betroffen sind aufgrund der Nähe zum<br />
Werbellinsee und des geringen Grundwasserflurabstandes Schutzgüter<br />
mit besonderen Funktionsausprägungen. Da durch die Änderung der<br />
planerischen Darstellung keine zusätzlichen Eingriffe in den Zustand von<br />
Natur und Landschaft ermöglicht werden, wird die Beeinträchtigung nicht<br />
als Konflikt geführt.<br />
4.4.3.2.3 Landschaftsbild/Landschaftserleben<br />
Die Kfz-Stellplatznutzung der Waldflächen (104 b) führt aufgrund des<br />
Verlustes der natürlichen Strauch- und Krautschicht zu einer erheblichen,<br />
ganzjährig wirksamen Monotonisierung des Landschaftsbildes.<br />
Die v.a. im Sommerhalbjahr abgestellten KFZ sorgen durch den ruhenden<br />
Verkehr für eine technische Überformung eines für die landschaftsbezogene<br />
Erholung herausragenden Naturraums. In Verbindung mit der<br />
Erschließungsfunktion des Waldweges für die Steganlagen und des<br />
Ausflugslokals und den damit verbundenem Verkehrsaufkommen ist<br />
dieser Abschnitt des Werbellinsee-Uferwanderweges erheblich als Naturerlebnisraum<br />
entwertet. Da durch die Änderung der planerischen<br />
Darstellung keine zusätzlichen Eingriffe in den Zustand von Natur und<br />
Landschaft ermöglicht werden, wird die Beeinträchtigung nicht als Konflikt<br />
geführt.<br />
4.4.3.2.4 Schutzgebiete<br />
Da durch die Änderung der planerischen Darstellung keine zusätzlichen<br />
Eingriffe in den Zustand von Natur und Landschaft ermöglicht werden,<br />
wird die bestehende Beeinträchtigung nicht als Konflikt geführt.<br />
4.4.3.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
Da keine zusätzlichen Beeinträchtigungen festgestellt wurden, sind keine<br />
Kompensationen erforderlich.<br />
38
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 145, SO Freizeit u. Erholung<br />
4.4.4 Vorhaben 145<br />
Eichhorst: Darstellung eines Sondergebiets „Freizeit und Erholung“ an<br />
Stelle von SO „WSA“, „Grünfläche“ und „Landwirtschaft“.<br />
Ziel ist die Entwicklung eines Beherbergungsbetriebes für Rad- und<br />
Wasserwanderer mit ergänzendem Freizeitangebot. Entwicklungskern<br />
sind drei Alt-Gebäude an der Schleuse Rosenbeck.<br />
4.4.4.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.4.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am westlichen Ortsausgang von Rosenbeck<br />
an der Schleuse zwischen Werbellinkanal und Schleusenteich. Die<br />
Erschließung erfolgt über die Dorfstraße, die unmittelbar hinter dem Projektgebiet<br />
für den Kraftfahrzeugverkehr gesperrt ist. Nördlich des Projektgebietes<br />
liegt der Rosenbecker Schleusenteich. Südlich schließt sich<br />
eine kleine Wochenendhaussiedlung an. Östlich liegt der Ortskern von<br />
Rosenbeck. In westliche Richtungen erstrecken sich ausgedehnte Kiefernforste.<br />
Das Projektgebiet liegt innerhalb der Schutzzone III des Biosphärenreservats<br />
<strong>Schorfheide</strong>-Chorin sowie innerhalb des FFH-Gebietes 347<br />
„Werbellinkanal“. Die bebauten Bereiche des Projektgebietes sind vom<br />
FFH-Gebiet ausgenommen.<br />
4.4.4.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet umfasst eine Fläche von etwa 3.000 m². An der Dorfstraße<br />
liegt ein derzeit ungenutztes Gebäudeensemble mit einem Haupt<br />
und 2 Nebengebäuden (Biotoptyp 12290). Es ist anzunehmen, dass die<br />
Gebäude Sommerquartiere von Fledermäusen beherbergen. Alle einheimischen<br />
Fledermausarten unterliegen dem strengen Schutz der Bundesartenschutzverordnung<br />
und sind teilweise im Anhang IV der FFH-<br />
Richtlinie geführt. Es ist daher nicht auszuschließen, dass es sich bei<br />
dem Gebäudeensemble um geschützte Lebensstätten nach § 42 Bundesnaturschutzgesetz<br />
in Verbindung mit Artikel 12 der FFH-Richtlinie<br />
handelt. In diesem Falle wäre der Biotoptyp trotz der anthropogenen<br />
Überformung von sehr hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Südlich der Dorfstraße wird der größte Teil der Fläche von einer Gartenbrache<br />
eingenommen (Biotoptyp 10113). In der Baumschicht finden sich<br />
v.a. einige Obstbäume. Die Strauchschicht weist hohe Anteile von verwildernden<br />
Ziersträuchern auf (Schneebeere, Flieder). Den größten Flächenanteil<br />
beanspruchen allerdings thermophile, ruderale Wiesenflächen.<br />
Es handelt sich um einen in Brandenburg relativ häufigen und<br />
ungefährdeten Biotoptyp. Insgesamt wird dem Biotoptyp eine mittlere<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz beigemessen.<br />
39
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 145, SO Freizeit u. Erholung<br />
Biotoptypen Vorhaben 145 (Eichhorst)<br />
Das Projektgebiet ist vom Flächenschutz des FFH-Gebietes 347<br />
„Werbellinkanal“ ausgenommen. Aufgrund der eingebetteten Lage im<br />
FFH-Gebiet sind die Belange des Schutzgebietes dennoch für die Beurteilung<br />
der Umweltwirkungen des Vorhabens relevant. Der Schutzzweck<br />
des FFH-Gebietes ergibt sich zum einen aufgrund seiner Bedeutung<br />
als wichtiges Element im Biotop-Verbund Oder, Havel und<br />
Havel-Seengebiete und zum anderen aus den im Gebiet signifikant<br />
vorkommenden Lebensraumtypen und Arten nach Anhang I und II der<br />
FFH-Richtlinie (RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1992).<br />
Im FFH-Gebiet „Werbellinkanal“ kommen signifikant folgende Lebensraumtypen<br />
nach Anhang I der FFH-Richtlinie vor:<br />
• Oligo- bis mesotrophe Gewässer mit benthischer Vegetation aus<br />
Armleuchteralgen (32 % Anteil),<br />
• Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion<br />
oder Hydracharition (14 %)<br />
• Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen<br />
Stufe (1 %)<br />
• Übergangs- und Schwingrasenmoore (1 %)<br />
• Hainsimsen-Buchenwälder (12 %)<br />
• Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (2 %)<br />
Damit sind nur die außerhalb des Projektgebietes liegenden Uferstrukturen<br />
als FFH-relevant einzustufen.<br />
40
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 145, SO Freizeit u. Erholung<br />
Im FFH-Gebiet „Werbellinkanal“ kommen darüber hinaus signifikant<br />
folgende Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie vor:<br />
• Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)<br />
• Großes Mausohr (Myotis myotis)<br />
• Biber (Castor fiber)<br />
• Fischotter (Lutra lutra)<br />
• Rotbauchunke (Bombina bombina)<br />
• Kammmolch (Triturus cristatus)<br />
• Rapfen (Aspius aspius)<br />
• Steinbeißer (Cobitis taenia)<br />
• Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)<br />
• Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)<br />
• Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)<br />
• Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)<br />
Mit Sicherheit unmittelbare Habitatfunktion außerhalb des Projektgebietes<br />
hat der Laubholzforst nördlich der Dorfstraße für Biber und Fischotter.<br />
Da Biber und Fischotter auf Wanderschaft die Schleuse Rosenbeck<br />
umgehen müssen, dürften auch die Randbereiche des Projektgebietes<br />
entlang der Schleuse für den Biotopverbund unmittelbare Bedeutung<br />
haben.<br />
Mit Sommerquartieren von Mopsfledermaus und Großem Mausohr ist<br />
sowohl im Gebäudebestand als auch in Altbäumen des Laubholzforstes<br />
zu rechnen.<br />
Die rein aquatischen Tierarten werden nicht weiter betrachtet, da ein<br />
Einfluss des Vorhabens auf Schleusenteich und Werbellinkanal nicht<br />
ersichtlich ist.<br />
4.4.4.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Bei einer Fläche von 3.000 m² und einer angenommenen GRZ von 0,4<br />
zzgl. 50% Überschreitungs-GRZ für Nebenanlagen ergibt sich maximal<br />
mögliche Versiegelung von ca. 1.800 m². Derzeit sind etwa 500 m² versiegelt.<br />
Damit ergibt sich ein Entwicklungspotential von etwa 1.300 m².<br />
4.4.4.2.2 Arten- und Biotopschutz<br />
Die Habitatfunktion des Laubmischwaldes und der Gartenbrachenstrukturen<br />
nördlich der Dorfstraße wird für Populationen von Reptilien und<br />
Amphibien sowie von Fledermäusen bleiben auch bei Vorhabenrealisierung<br />
erhalten.<br />
Die zu vermutenden Sommerquartiere in Gebäuden sind im Zuge der<br />
Sanierung der Altgebäude bedroht.<br />
4.4.4.2.3 Boden, Wasser, Klima<br />
K 145.2: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 1.300 m² Boden geht<br />
einher mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktio-<br />
41
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eichhorst; Vorhaben Nr. 145, SO Freizeit u. Erholung<br />
nen des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 145.3: Die Versieglung von 1.300 m² Boden reduziert Menge und<br />
Qualität der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Aufgrund der klimatisch unbelasteten Situation in Rosenbeck ist die Beeinträchtigungen<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes durch die<br />
zusätzlichen baulichen Anlagen nicht erheblich.<br />
4.4.4.2.4 Schutzgebiete<br />
Die Projektentwicklung beschränkt sich auf den Altstandort, der von den<br />
Schutzwirkungen der genannten Schutzgebiete ausgenommen ist. Eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung der Schutzgebiete ist nicht zu erwarten.<br />
4.4.4.2.5 Landschaftsbild<br />
Das Projektgebiet südlich der Dorfstraße ist eindeutig als anthropogen<br />
vorgeprägt zu identifizieren. Eine eigene, wertgebende Landschaftsbildcharakteristik<br />
besteht hier nicht, so dass die Entwicklung des Projekts<br />
keine erheblichen Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild an dieser<br />
Stelle hervorrufen würde.<br />
4.4.4.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 145.1 Arten- und Biotopschutz:<br />
Durch die Reaktivierung der Nutzung der Bestandsgebäude ist mit dem<br />
Verlust von Sommerquartieren von Fledermausarten zu rechnen. Zur<br />
Kompensation wird die Ausgleichsmaßnahme A 145.1 empfohlen:<br />
„Beim Ausbau der Dachstühle der Bestandsgebäude ist zwischen<br />
Dachgiebel und Decke ein mindestens 40 cm hoher Freiraum<br />
zu erhalten, der über eine Öffnung an beiden Giebelwandseiten<br />
für Fledermäuse zugänglich zu halten ist.“<br />
K 145.2 und K 145.3 (Boden und Wasser)<br />
Die zusätzliche Versiegelung von 1.300 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse<br />
außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 1.300 m² versiegelten Bodens außerhalb des<br />
Plangebietes<br />
Es sind Biotope von allgemeiner Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz<br />
betroffen, deren Biotopqualitäten sich auf entsiegelten Flächen<br />
ohne zusätzliche Entwicklungsmaßnahmen wiederherstellen.<br />
42
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 1 „Gewerbe“<br />
Ortsteil Finowfurt<br />
4.4.5 Vorhaben 1<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
„Gewerbe“. Ziel ist die Erweiterung des bestehenden Gewerbegebietes<br />
in Richtung Osten. Die weitere planerische Vorbereitung wird über ein<br />
verbindliches B-Planverfahren weiter betrieben.<br />
4.4.5.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.5.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich östlich des bestehenden Gewerbegebiets<br />
unmittelbar nördlich des Finow-Kanals. Das Gewerbegebiet hat<br />
über die interne Haupterschließung der „Magistrale“ Anschluss an die<br />
B167, die westlich am Gewerbegebiet vorbei führt. Nördlich schließen<br />
sich die Grundstücke der Siedlungsachse entlang der Walzwerkstraße<br />
an. Im Osten wird das Gebiet von der Kanalstraße begrenzt, die den<br />
Anschluss an die Walzwerkstraße herstellt. Östlich der Kanalstraße<br />
beginnen Grundwasser beeinflusste Laubwaldstrukturen. Ganz im Süd-<br />
Osten liegt auf der östlichen Seite der Kanalstraße ein kleines Mischgebiet<br />
an, deren Bebauung bis fast an den Finowkanal heranreicht. Der<br />
gesamte Erweiterungsbereich liegt im Außenbereich.<br />
Biotoptypen Vorhaben 1 (Finowfurt)<br />
43
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 1 „Gewerbe“<br />
4.4.5.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Der gesamte Projektbereich ist ein intensiv genutzter Lehmacker (Biotoptyp<br />
09133) ohne jegliche Strukturierung über naturnahe Landschaftselemente.<br />
Die Magistrale teilt die Ackerfläche in eine nördliche<br />
und südliche Hälfte. Der ausgeräumte Intensivacker am Rande des<br />
intensiv genutzten Gewerbegebietes ist von geringer Bedeutung für<br />
den Arten- und Biotopschutz.<br />
4.4.5.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Auf einer bislang unbebauten Ackerfläche mit einer Ausdehnung von<br />
etwa 33.000 m² ermöglicht die städtebauliche Nutzungsbestimmung<br />
„Gewerbegebiet“ insgesamt eine Flächenversiegelung von bis zu 80%.<br />
Dies entspricht einem Versiegelungspotential von 26.400 m².<br />
4.4.5.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 1.1: Als wesentliche Eingriffsursache sind die zusätzlichen baulichen<br />
Entwicklungsmöglichkeiten in einer Größenordnung von 26.400 m² zu<br />
sehen. Dies ist ein erheblicher Eingriff in die Belange des Arten- und<br />
Biotopschutzes. Da der Eingriffsraum von geringer Bedeutung für das<br />
Schutzgut ist, ist der Eingriff aber im Rahmen von Entsiegelungsmaßnahmen<br />
kurzfristig ausgleichbar.<br />
4.4.5.2.2 Schutzgut Boden, Wasser und Klima<br />
K 1.2: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 26.400 m² Boden geht einher<br />
mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 1.3: Die Versieglung von 26.400 m² Boden reduziert ohne entsprechende<br />
Vermeidungsmaßnahmen Menge und Qualität der Grundwasserneubildung.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 1.4: Die Realisierung von Baumassen in erheblichem Umfang trägt zu<br />
einer erheblichen Beeinflussung des Mikroklimas im Vorhabenraum bei.<br />
Die Baukörper speichern erhebliche Wärmemengen, die insbesondere<br />
in den Nachtstunden zu einer Erhöhung der Umgebungstemperaturen<br />
führen. Die Kaltluftentstehungsfunktion der bisherigen Ackerflächen geht<br />
vollständig verloren. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in<br />
das Schutzgut Klima. Aufgrund der klimatisch unbelasteten Situation in<br />
Finowfurt ist die Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes<br />
durch Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet und Entsiegelungsmaßnahmen<br />
außerhalb des Plangebietes zu kompensieren.<br />
44
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 1 „Gewerbe“<br />
4.4.5.2.3 Landschaftsbild<br />
K 1.5: Aufgrund der erheblichen Vorschädigung des Landschaftsbildes<br />
im Raum mit einem Konglomerat von großflächigen Gewerbegebieten,<br />
Siedlungssplittern unterschiedlichster Funktionen und ausgeräumten<br />
Ackerflächen stellt die Entwicklung des Gewerbegebietes einen durch<br />
Entsiegelungsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes und Ausgleichsmaßnahmen<br />
im Plangebiet einen kompensierbaren Eingriff in das<br />
Schutzgut Landschaftsbild dar.<br />
4.4.5.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 1.1 bis K 1.3<br />
Die zusätzliche Versiegelung von 26.400 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse<br />
außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 26.400 m² versiegelten Bodens<br />
Zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Wasser wird die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 1.1 empfohlen:<br />
„Oberflächlich anfallende Niederschläge sollen im Plangebiet<br />
durch ein Mulden-/Rigolen-System mit Anschluss an retentionsfähige<br />
Grünanlagen versickert werden. Die Maßnahme ermöglicht<br />
den weitgehenden Erhalt der Grundwasserneubildung und<br />
reduziert die über das Kanalsystem abzuführenden Wassermengen.“<br />
K 1.4 und K 1.5<br />
Zur Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Klima sollte innerhalb<br />
des Plangebietes die Minderungsmaßnahme A 1.1 durchgeführt werden:<br />
„Entlang der inneren Erschließungsstraßen des Gewerbegebietes<br />
sind beidseitig Straßenbaumpflanzungen mit Baumarten der<br />
Pflanzliste 2 vorzunehmen. Der Abstand der Baumpflanzungen<br />
beträgt in der Reihe 10-12 m. Auf den Gewerbegrundstücken<br />
sind auf den nicht versiegelten Flächen pro m² Freifläche insgesamt<br />
ein Strauch der Pflanzliste 4 zu pflanzen.“<br />
Diese Maßnahmen reduzieren die Wärmeentwicklung und Wärmespeicherung<br />
der Baukörper und tragen durch die erhöhte Evapotranspiration<br />
zu einer Verdunstungskühlung der Umgebungsluft bei.<br />
Die oben genannten Maßnahmen zur Durchgrünung des Gewerbegebietes<br />
tragen zudem dazu bei, die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes<br />
zu minimieren.<br />
4.4.5 Vorhaben 5 (entfallen)<br />
45
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 3 „Flugverkehrsflächen“ u. „Gewerbe“<br />
4.4.6 Vorhaben 3<br />
Finowfurt: Darstellung von Flugverkehrsflächen und Gewerbeflächen.<br />
Ziel ist die Entwicklung des Verkehrslandeplatzes Eberswalde-Finow<br />
und die großflächige Ansiedlung von Gewerbe südlich des Flughafengeländes.<br />
Die bisherige Flugbetriebsnutzung und die bestehenden baulichen Anlagen<br />
genießen unabhängig von der Änderung der Darstellung des FNP<br />
Bestandsschutz. Die geplante Intensivierung des Flugbetriebes u.a.<br />
durch die Erhöhung der maximal zulässigen Abflugmasse auf 85 t<br />
MTOM ist Gegenstand des Raumordnungsverfahrens Regionalflughafen<br />
Eberswalde-Finow. Im Zuge des Raumordnungsverfahrens werden die<br />
umweltrelevanten Auswirkungen der Flugbetriebsintensivierung ermittelt.<br />
Die <strong>Gemeinde</strong> übernimmt die Ergebnisse nachrichtlich, so dass im Zuge<br />
des Änderungsverfahrens des Flächennutzungsplanes keine eigenständige<br />
Prüfung der Umweltauswirkungen der Flugbetriebsintensivierung<br />
vorgenommen wird.<br />
Die Ausweisung von Gewerbeflächen auf der Flugbetriebsfläche ist<br />
demgegenüber eine gemeindliche Aufgabe und wird daher im Rahmen<br />
des Änderungsverfahrens des Flächennutzungsplanes auch unter dem<br />
Aspekt der Umweltauswirkung beleuchtet.<br />
4.4.6.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.6.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich südlich von Finowfurt und erstreckt sich<br />
über eine Fläche von ca. 300 ha. Der Verkehrslandeplatz Eberswalde-<br />
Finow ist lediglich über 3 untergeordnete Straßen erschlossen. Eine<br />
direkte Anbindung an die unmittelbar westlich verlaufende E28 besteht<br />
nicht.<br />
Nördlich des Verkehrslandeplatzes beginnt der südliche Ortsrand von<br />
Finowfurt. Nach Westen, Süden und Osten schließen sich ausgedehnte,<br />
überwiegend jüngere Aufforstungen von Alterklassen-Kiefernforste.<br />
4.4.6.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Auf den trockenwarmen Sandböden des Projektraumes dominieren<br />
entsprechend Pflanzengesellschaften trockenwarmer Standorte. Die<br />
weitaus größten Flächenanteile nehmen ruderale Wiesen (Biotoptyp<br />
05113) ein. Diese sind das Ergebnis der regelmäßigen Nutzung durch<br />
Befahren und Vertritt sowie eines Mahdregimes im Bereich der Landebahn<br />
und der Einflugschneise. Es handelt sich um einen in Brandenburg<br />
relativ häufigen Biotoptyp. Aufgrund der Flächenausdehnung ist<br />
das Vorkommen spezialisierter Offenlandarten trotz des derzeitigen<br />
Flugbetriebes denkbar. Hierzu gehören Brachpieper (Anthus campestris,<br />
RL 1; VSchRL), Neuntöter Lanius collurio (RL 3; VSchRL),<br />
Grauammer (Emberiza calandra, RL 2), Wachtel (coturnix coturnix, RL<br />
2), Haubenlerche (Galerida cristata, RL 3), Braunkehlchen (Saxicola<br />
rubetra, RL 3) und Heidelerche (Lullula arborea, RL 2; BArtSchV). Insgesamt<br />
ist der Biotoptyp von mittlerer bis hoher Bedeutung für den<br />
Arten- und Biotopschutz.<br />
46
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 3 „Flugverkehrsflächen“ u. „Gewerbe“<br />
Kleinflächig finden sich innerhalb der Offenlandflächen Sandtrockenrasen<br />
(Biotoptyp 05121), teilweise im engen Mosaik mit trockenen Sandheiden<br />
(Biotoptyp 06102). Kennzeichnende Pflanzenart der Sandheide<br />
ist die Besenheide (Calluna vulgaris), die Sandtrockenrasen werden<br />
bestimmt von Frühlingsspark (Spergula morisonii), Bauernsenf (Teesdalia<br />
nudicaulis), Silbergras (Corynephorus canescens), Sandstrohblume<br />
(Helichrysum arenarium), Bergglöckchen (Jasione montana), Grasnelke<br />
(Armeria elongata), Feldbeifuß (Artemisia campestris), Rotes Straußgras<br />
(Agrostis tenuis), Kleiner Sauerampfer (Rumex acetosella), Kleines Habichtskraut<br />
(Hieracium pilosella) sowie standorttypische Moose und<br />
Flechten.<br />
Die Biotoptypen sind auch unter faunistischen Gesichtspunkten von sehr<br />
hoher Bedeutung. Das Vorkommen vorgenannten Vogelarten des Offenlandes<br />
und das Vorkommen u.a. der Zauneidechse (Lacerta agilis, RL 3;<br />
FFH IV), der Knoblauchkröte (Pelobates fuscus, FFH IV) oder der<br />
Blauflügligen Ödlandschrecke (Oedipoda caerulescens, RL 3;<br />
BArtSchV) ist sehr wahrscheinlich. Die Insektenfauna der Biotoptypen ist<br />
generell artenreich und beherbergt i.d.R. eine Reihe streng geschützter<br />
Arten.<br />
Beide Biotoptypen unterliegen dem Schutz des § 32 Brandenburgisches<br />
Naturschutzgesetz.<br />
Teilweise haben sich Herden von gebietsfremden Spiersträuchern<br />
dominant auf ursprünglichen Trockenrasenstandorten ausgebreitet<br />
(Biotoptyp 071032, Laubgebüsche trockenwarmer Standorte, überwiegend<br />
nicht heimische Arten). Diese Entwicklung ist für den Arten- und<br />
Biotopschutz als negativ zu bewerten. Die gebietsfremden Spierstrauch-Gebüsche<br />
sind faunistisch und floristisch von geringer Bedeutung.<br />
Insbesondere entlang der südlichen Projektgebietsgrenze befinden sich<br />
im Übergangsbereich vom trockenwarmen Offenland zu den Kiefern-<br />
Monokulturen Kiefern-Vorwälder trockenwarmer Standorte (Biotoptyp<br />
082819). Der Kronenschluss der Kiefern und vereinzelten Birken und<br />
Espen ist in den meisten Bereichen noch nicht erfolgt. Florenelemente<br />
der Sandtrockenrasen und der ruderalen Wiesen durchdringen die Vorwälder<br />
in der Krautschicht. Als räumlicher Übergangsbiotop stellen die<br />
Vorwälder für eine ganze Reihe der vorgenannten Offenlandarten wichtige<br />
Teillebensräume dar. Dies gilt insbesondere für Zauneidechse Lacerta<br />
agilis (RL 3; FFH IV). Das Vorkommen der Waldeidechse Lacerta<br />
vivipara (RL 2; BArtSchV) und der Blindschleiche Anguis fragilis<br />
(BArtSchV) ist ebenfalls dokumentiert (TRAUTMANN u. GOETZ, S. 88).<br />
Vorwälder trockener Standorte unterliegen dem Schutz des § 32 Brandenburgisches<br />
Naturschutzgesetz.<br />
Entlang der südlichen Grenze des Projektgebietes befinden sich<br />
Grundwasser beeinflusste Senken, die je nach Grundwasserstand<br />
temporäre Tümpel bilden (Biotoptyp 02131: temporäre Kleingewässer,<br />
unbeschattet). Die tiefstgelegenen Bereiche sind als kleinere Weiher<br />
ganzjährig Wasser führend (Biotoptyp 02121: perennierende Kleingewässer,<br />
unbeschattet). Die Ufer werden von standortgemäßen<br />
47
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 3 „Flugverkehrsflächen“ u. „Gewerbe“<br />
Weidengebüschen und Espen-Vorwäldern eingefasst. Die Wasserstellen<br />
sind Laichhabitate für Knoblauchkröte (Pelobates fuscus; FFH IV),<br />
Moorfrosch Rana arvalis (RL 3; FFH IV), Grasfrosch Rana temporaria<br />
(RL 3; BArtSchV), Kammmolch Triturus cristatus cristatus (RL 2; FFH<br />
II + IV), Erdkröte Bufo bufo (RL 3; BArtSchV) und Teichmolch Triturus<br />
vulgaris (BArtSchV). Der Europäische Laubfrosch Hyla arborea (FFH<br />
Anhang IV) hat seinen Vorkommensschwerpunkt im westlichen Flugplatzgelände<br />
(REICHLING 2006). Die Ringelnatter (Natrix natrix , RL<br />
2; BArtSchV) dürfte an nahezu allen Kleingewässern des Gebietes<br />
anzutreffen sein. Das Vorkommen des Zwergtauchers Podiceps ruficollis<br />
(RL R) ist ebenfalls bemerkenswert. Bedeutsam dürfte zudem<br />
die Libellenfauna sein. Im Umfeld des angrenzenden Walpurgisbruch<br />
ist das Vorkommen einer Reihe von gefährdeten und überwiegend<br />
streng geschützten Brutvögel dokumentiert: Rohrweihe (Circus aeruginosus),<br />
Kranich (Grus grus), Schellente (Bucephala clangula), Wasserralle<br />
(Rallus aquaticus) und Waldschnepfe (Scolopax rusticola)<br />
(TRAUTMANN u. GOETZ, S. 86).<br />
Über die Flugbetriebsfläche verstreut befinden sich 20 weitere Kleingewässer,<br />
die ebenfalls überwiegend von Espen-Vorwäldern frischer<br />
Standorte eingefasst werden. Die Kleingewässer wurden Anfang der<br />
80ger Jahre ausgehoben, um Abdeckmaterial für Flugzeugshelter zu<br />
gewinnen. Sie stellen wichtige Biotopstrukturen innerhalb der Offenlandbereiche<br />
dar und dürften trotz der größeren Nähe zu den betriebsbedingten<br />
Störeinflüssen des Flugplatzes von Bedeutung als Laichgewässer<br />
verschiedener Amphibienarten sein (s. Bemerkungen zum Biotoptyp<br />
02131). Teilweise beherbergen Sie Bestände von Armleuchteralgen<br />
(REICHLING 2006). Alle Gewässer haben daher eine hohe Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz und unterliegen zudem dem<br />
Schutz des § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz.<br />
In den frischeren, westlichen und nördlichen Randbereichen des Projektgebietes<br />
befinden sich Espen-Vorwälder frischer Standorte (Biotoptyp<br />
082827). In unterschiedlichen Deckungsgraden beigemischt sind<br />
weitere Pionierbaumarten wie Birke, Eschen-Ahorn, Späte Traubenkirsche<br />
und Wald-Kiefer. Insbesondere die nördlich in der Flugbetriebsfläche<br />
gelegenen Vorwälder zeichnen sich durch eine mehr oder weniger<br />
starke Prägung durch bestehende oder vergangene menschliche<br />
Nutzungen und einer gewissen Ruderalisierung. Es handelt sich insgesamt<br />
um in Brandenburg häufig anzutreffende Biotoptypen von mittlerer<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Am westlichen Ende der Landebahn befindet sich ein strukturreicher<br />
Kiefernforst (Biotoptyp 08480) mit Wald-Kiefern unterschiedlicher Altersklassen<br />
unter Beimischung von Birken in der Baumschicht und Espen<br />
sowie Später Traubenkirsche in der Strauchschicht. Der Biotop hat Bedeutung<br />
für eine Reihe von Vogelarten wie Trauerschnäpper, Waldlaubsänger,<br />
Gartenbaumläufer, Kleiber und Meisenarten. Zudem ist insbesondere<br />
in den lichten südexponierten Randbereichen das Vorkommen<br />
der Waldeidechse und der Blindschleiche anzunehmen. Im Zusammenwirken<br />
mit den trockenwarmen Offenlandbiotopen und den angrenzenden<br />
Kiefern-Vorwäldern hat der Kiefernforst eine wichtige Lebensraumfunktion<br />
im Biotopkomplex und wird daher als für den Arten- und Biotopschutz<br />
von hoher Bedeutung bewertet.<br />
48
Biotoptypen Vorhaben 3 (Finowfurt)<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 3 „Flugverkehrsflächen“ u. „Gewerbe“<br />
49
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 3 „Flugverkehrsflächen“ u. „Gewerbe“<br />
Im Projektgebiet finden sich neben den mehr oder weniger naturnahen<br />
Biotopen großflächig anthropogen überformte und gestörte Flächen.<br />
Dies sind die strukturell den Industrie- und Gewerbebrachen (Biotoptyp<br />
12320) gleichgestellten ungenutzten Betriebsgebäude, durch Gebäuderückbau<br />
hervorgegangene vegetationsarme Schotterflächen und die<br />
versiegelten Flächen der Wege, Lagerplätze und Landebahnen. Diese<br />
Bereiche sind für den Arten- und Biotopschutz von geringer Bedeutung<br />
bzw. ohne Bedeutung.<br />
Im Süden der Flugbetriebsfläche konzentrieren sich Shelter, Bunker und<br />
Keller, die als Winterquartiere für die Fledermausarten Zwergfledermaus<br />
(Pipistrellus pipistrellus), Braunes Langohr (Plecotus auritus), Mopsfledermaus<br />
(Barbarstelle barbarstellus), Breitflügelfledermaus (Eptesicus<br />
serotinus) und Fransenfledermaus (Myotis nattereri) fungieren<br />
(TRAUTMANN u. GOETZ 2007, S. 85). Für alle 5 Artenbestehen zudem<br />
Sommernachweise, potentielle Sommerquartiere sind Altgebäude und<br />
Altbäume (ebd.). Damit sind diese Strukturen von sehr hoher Bedeutung<br />
für den Artenschutz. Sie stellen geschützte Lebensstätten nach § 42<br />
Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung mit Artikel 12 der FFH-<br />
Richtlinie dar.<br />
4.4.6.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Der überwiegende Teil des Projektgebietes soll weiterhin als Flugbetriebsfläche<br />
fungieren (Teilfläche 3a). Die derzeit versiegelten Flächen<br />
summieren sich für die Landebahnen, Gebäude und ehemaligen Hangar<br />
auf etwa 370.000 m². Eine Querlandebahn mit einer versiegelten Fläche<br />
von etwa 30.000 m² ist nach Aussage der UNB zur Entsiegelung vorgesehen.<br />
Damit kann davon ausgegangen werden, dass für eventuell erforderliche<br />
bauliche Neuanlagen für den Flugbetrieb ausreichend Entsiegelungspotentiale<br />
innerhalb der Flugbetriebsfläche vorhanden sind.<br />
Im südlichen Bereich des Projektgebietes soll ein großflächiges Gewerbegebiet<br />
entstehen (Teilfläche 3 d). Die Gesamtfläche des Gewerbegebietes<br />
umfasst etwa 78,2 ha. Unter Annahme einer zulässigen maximalen<br />
GRZ einschließlich Nebenanlagen von 0,8 könnten nach Änderung<br />
der Flächendarstellung etwa 625.600 m² Boden versiegelt werden. Hinzu<br />
kommt eine geplante Erschließungsstraße mit Anschluss an die Bundesautobahn<br />
westlich des Projektgebietes. Diese hat eine Gesamtlänge<br />
von etwa 3,5 km. Bei einer Breite von 8,00 m ergibt dies eine versiegelte<br />
Fläche von 28.000 m². Unter Berücksichtigung der derzeitigen Versiegelung<br />
durch ehemalige Hangar und deren Verbindungswege von etwa<br />
30.000 m² ergibt sich eine potentielle Mehrversiegelung von 627.600 m².<br />
Ein zweites Gewerbegebiet mit einer Fläche von 13,8 ha soll im Norden<br />
des Flugplatzgeländes entwickelt werden (Teilfläche 3 c). Unter Annahme<br />
einer zulässigen maximalen GRZ einschließlich Nebenanlagen von<br />
0,8 könnten nach Änderung der Flächendarstellung etwa 110.400 m²<br />
Boden versiegelt werden. Das Gewerbegebiet soll zu großen Teilen im<br />
Bereich eines anthropogen überformten Rohbodenstandortes mit Beton-<br />
50
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 3 „Flugverkehrsflächen“ u. „Gewerbe“<br />
schotter und entsprechend reduzierten Bodenfunktionen entstehen. Die<br />
Fläche mit einer Ausdehnung von etwa 72.000 m² muss als teilversiegelt<br />
(50%) bewertet werden. Rechnerisch ergibt sich somit eine vollversiegelte<br />
Fläche von 36.000 m². Die tatsächliche Mehrversiegelung bei Realisierung<br />
des Gewerbegebietes beträgt somit 74.400 m².<br />
Ein drittes Gewerbegebiet soll angrenzend an das Flugverkehrsmuseum<br />
entstehen (Teilfläche 3 b). Es hat eine geplante Ausdehnung von 7,3 ha.<br />
Unter Annahme einer zulässigen maximalen GRZ einschließlich Nebenanlagen<br />
von 0,8 könnten nach Änderung der Flächendarstellung etwa<br />
58.400 m² Boden versiegelt werden.<br />
Für alle drei Gewerbegebiete zusammen entsteht damit eine potentielle<br />
Mehrversiegelung von 760.400 m².<br />
4.4.6.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
Durch die Beibehaltung der Flugplatznutzung im zentralen Projektgebiet<br />
(Teilfläche 3 a) ist davon auszugehen, dass es nicht zu wesentlichen<br />
strukturellen Änderungen der Biotoptypen kommen wird. Die Neuanlage<br />
von Betriebsflächen und Betriebsgebäuden wird voraussichtlich aus<br />
funktionalen Gesichtspunkten automatisch mit dem Rückbau nicht mehr<br />
benötigter, versiegelter Altflächen einhergehen.<br />
K 3.1: Es befindet sich wesentliche Teile der nach § 32 geschützten<br />
Kiefern-Vorwälder innerhalb des geplanten südlichen Gewerbegebiets<br />
(Teilfläche 3 d). Es muss davon ausgegangen werden, dass sämtliche<br />
Biotope innerhalb dieses Gewerbegebietes zerstört werden. Die Zerstörung<br />
dieser Biotope ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in die<br />
Belange des Arten- und Biotopschutzes. Betroffen wären etwa 16 ha<br />
Kiefern-Vorwälder sowie etwa 1,5 ha feuchter Biotopkomplexe bzw.<br />
Weiher. Die Populationen der oben genannten, teilweise streng geschützten<br />
Tierarten würden erlöschen.<br />
Der Verlust von Fledermauswinterquartieren durch die Entwicklung des<br />
Gewerbegebietes (Teilfläche 3 d) ist als erheblicher und möglicherweise<br />
nicht kompensierbarer Eingriff in den Artenschutz zu bewerten.<br />
Auch die nordwestlich, außerhalb der Teilfläche 3 d gelegenen Kiefern-<br />
Vorwälder werden aufgrund der unmittelbaren Nähe des Gewerbegebietes<br />
durch das Störpotential des Betriebs des Gewerbegebietes und insbesondere<br />
durch die Trennung der Kiefern-Vorwälder von den Forst-<br />
und Feuchtflächen südlich des Gewerbegebietes erheblich und nachhaltig<br />
beeinträchtigt. Die Verinselung der Flächen wird auch hier zum Erlöschen<br />
der Populationen teilweise streng geschützter Tierarten führen.<br />
Betroffen wären insbesondere alle Amphibien- und Reptilienpopulationen.<br />
Da die Teilfläche 3 d unmittelbar an die ebenfalls nach § 32 Brandenburgisches<br />
Naturschutzgesetz geschützten Feucht-Biotope des „Walpurgisbruch“<br />
grenzt, sind auch hier erhebliche Beeinträchtigungen von<br />
Biotopen mit sehr hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz zu<br />
erwarten. Auch hier kommt es zu Verinselungsprozessen, da die<br />
Feuchtbiotope von den wichtigen, nördlich gelegenen Teillebensräumen<br />
der Kiefern-Vorwäldern und der trockenwarmen Offenlandbereiche iso-<br />
51
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 3 „Flugverkehrsflächen“ u. „Gewerbe“<br />
liert würden. Insbesondere das Erlöschen der Populationen von Knoblauchkröte<br />
und Wechselkröte ist damit auch auf Flächen außerhalb des<br />
eigentlichen Eingriffsraumes anzunehmen. Die unmittelbare Nähe des<br />
Gewerbegebietes dürfte den Walpurgisbruch für eine Reihe störungssensibler<br />
und streng geschützter Vogelarten wie Kranich, Rohrweihe<br />
und Waldschnepfe als Brutlebensraum entwerten.<br />
Das nördliche Gewerbegebiet (Teilfläche 3 c) überplant mit seinem<br />
westlichen Randbereich kleinere, gemäß § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz<br />
geschützte Feuchtbereiche mit Gehölzen und Kleingewässern<br />
(ca. 0,5 ha) sowie einem Kiefernforst (ca. 2,2 ha) mit hoher<br />
bzw. mittlerer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Auch dies<br />
sind erhebliche Eingriffe in die Belange des Arten- und Biotopschutzes,<br />
deren Kompensation weitergehende Entwicklungsmaßnahmen erfordern<br />
würde.<br />
K 3.2: Im Bereich der drei geplanten Gewerbeflächen sind eine der wesentlichen<br />
Eingriffsursachen die zusätzlichen baulichen Entwicklungsmöglichkeiten<br />
in einer Größenordnung von zusammen 760.400 m². Es<br />
sind neben den unter K 3.1 beschriebenen besonders wertvollen Habitatstrukturen<br />
überwiegend Biotope mit mittlerer oder geringer Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz betroffen. Auf der Teilfläche 3 b sind<br />
ausschließlich Biotope mit mittlerer und geringer Wertigkeit betroffen.<br />
Dies ist dennoch ein erheblicher Eingriff in die Belange des Arten- und<br />
Biotopschutzes. Die betroffenen Biotope sind kurz- bis mittelfristig durch<br />
reine Entsiegelungsmaßnahmen ohne zusätzliche Entwicklungsmaßnahmen<br />
wiederherstellbar.<br />
4.4.6.2.2 Schutzgut Boden, Wasser und Klima<br />
K 3.3: Das östliche Drittel des Vorhabengebietes liegt in der Schutzzone<br />
III B des in der Aufstellung befindlichen Wasserschutzgebietes Eberswalde<br />
(Finow). Der Entwurf der Verordnung vom 06.06.07 weist Verbote<br />
auf, die im Rahmen der Vorhabenentwicklung beachtlich werden dürften.<br />
Verboten sind u.a.:<br />
• das Errichten, ……. von Abwasser...leitungen (§ 3 Nr. 27)<br />
• das Errichten oder Erweitern von Straßen (§ 3 Nr. 33).<br />
Die Verordnung eröffnet Möglichkeiten, wie von diesen Verboten abgewichen<br />
werden kann (s. Vermeidungs- und Kompensationsbedarfe).<br />
Generell ist die Errichtung von Anlagen, die grundwassergefährdende<br />
Stoffe im Produktionszyklus aufweisen verboten. Es wird davon ausgegangen,<br />
dass derartige gewerbliche oder industrielle Nutzungen nicht<br />
vorgesehen sind.<br />
K 3.4: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 760.400 m² Boden geht<br />
einher mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 3.5: Die Versieglung von 760.400 m² Boden reduziert ohne entsprechende<br />
Vermeidungsmaßnahmen Menge und Qualität der Grundwas-<br />
52
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 3 „Flugverkehrsflächen“ u. „Gewerbe“<br />
serneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 3.6: Die Realisierung von Baumassen in erheblichem Umfang trägt zu<br />
einer erheblichen Beeinflussung des Mikroklimas im Vorhabenraum bei.<br />
Die Baukörper speichern erhebliche Wärmemengen, die insbesondere<br />
in den Nachtstunden zu einer Erhöhung der Umgebungstemperaturen<br />
führen. Die Kaltluftentstehungsfunktion der bisherigen Freiflächen geht<br />
vollständig verloren. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in<br />
das Schutzgut Klima. Aufgrund der klimatisch unbelasteten Situation in<br />
Finowfurt ist die Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes<br />
durch Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet und Entsiegelungsmaßnahmen<br />
außerhalb des Plangebietes zu kompensieren.<br />
4.4.6.2.3 Landschaftsbild<br />
K 3.7: Aufgrund der erheblichen Vorschädigung des Landschaftsbildes<br />
im Raum mit einem Konglomerat von großflächigen Hallen und Funktionsgebäuden,<br />
zentraler Landebahn und diversen bunkerähnlichen Flugzeug-Hangar<br />
stellt die Entwicklung des Gewerbegebietes einen durch<br />
Entsiegelungsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes und Ausgleichsmaßnahmen<br />
im Plangebiet einen kompensierbaren Eingriff in das<br />
Schutzgut Landschaftsbild dar.<br />
4.4.6.2.4 Schutzgut Mensch<br />
Die Intensivierung des Flugbetriebs wird voraussichtlich zu einer Erhöhung<br />
der Lärmbelastung von Wohngebieten im Umfeld der Landebahn<br />
und der Einflugschneisen führen. Diese Untersuchungen werden im<br />
Rahmen des Planfeststellungsverfahrens zum Verkehrslandeplatz Eberswalde-Finow<br />
detailliert untersucht. Im Rahmen der Ermittlungen<br />
zum Flächennutzungsplan können den Ergebnissen dieser komplexen<br />
Untersuchung nicht vorgegriffen werden.<br />
4.4.6.2.5 Örtliche Landschaftsplanung<br />
K 3.8: Der Landschaftsplan für die Alt-<strong>Gemeinde</strong> Finowfurt sieht für den<br />
überwiegenden Flächenanteil der Flugbetriebsfläche die Aufwertung des<br />
Landschaftsbildes und der Biotopqualität durch die Pflege der Offenlandbereiche<br />
mittels Beweidung und der Aufwertung der vorhandenen<br />
Stillgewässer mit ihren Übergangsbiotopen vor. Trockenbiotope sollen<br />
freigehalten werden.<br />
Ausgenommen von diesen Entwicklungszielen sind im Wesentlichen die<br />
vollversiegelten Teilflächen der Flugbetriebsfläche. Wesentliche Flächenanteile<br />
des geplanten südlichen Gewerbegebietes und die gesamte<br />
Trasse des Straßenanschlusses an die Bundesautobahn im Westen<br />
stehen damit im Konflikt zu den Zielen des Landschaftsplans.<br />
4.4.6.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 3.2 bis 3.6<br />
Zur Kompensation der zu erwartenden Beeinträchtigung von Flächen mit<br />
für den Arten- und Biotopschutz geringer bis mittlerer Bedeutung und die<br />
Beeinträchtigung von Boden- und Wasserfunktionen durch Versiegelung<br />
53
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 3 „Flugverkehrsflächen“ u. „Gewerbe“<br />
ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 760.400 m² versiegelten Bodens<br />
Zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Wasser wird die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 3.1 empfohlen:<br />
„Oberflächlich anfallende Niederschläge sollen im Plangebiet<br />
durch ein Mulden-/Rigolen-System mit Anschluss an retentionsfähige<br />
Grünanlagen versickert werden. Die Maßnahme ermöglicht<br />
den weitgehenden Erhalt der Grundwasserneubildung und<br />
reduziert die über das Kanalsystem abzuführenden Wassermengen.“<br />
K 3.1<br />
Der Erhalt funktionsfähiger Fledermaus-Winterquartiere innerhalb des<br />
geplanten Gewerbegebietes ist unter städtebaulichen Gesichtspunkten<br />
und unter Berücksichtigung des hohen, unmittelbaren Störeinflusses als<br />
unwahrscheinlich einzustufen. Die Umweltvertäglichkeitsstudie zum<br />
Raumordnungsverfahren des Regionalflughafens Eberswalde-Finow<br />
weist die sonstigen als Winterquartiere geeigneten Bunker und Shelter<br />
der Umgebung bereits als Kompensationsobjekte für die Beeinträchtigung<br />
von Fledermausquartieren durch die Erweiterung des Flugbetriebes<br />
aus. Es ist fraglich, ob eine zusätzliche Aufwertung der Habitatqualitäten<br />
der verbleibenden Quartiere geeignet ist, den zu erwartenden<br />
massiven Verlust von Winterquartieren im Bereich des geplanten Gewerbegebietes<br />
ausgleichen zu können. Da die Definition geeigneter<br />
Ausgleichsmaßnahmen stark von den spezifischen Situationen der potentiell<br />
geeigneten Ausweichquartiere abhängig ist, ist die Benennung<br />
der Ausgleichsmaßnahme A 3.1 lediglich in Form einer pauschalen Definition<br />
möglich:<br />
„Es ist erforderlich, in erheblichen Umfang Bunker, Keller oder<br />
Shelter im engeren Bezugsraum des Flughafengeländes durch<br />
geeignete Maßnahmen wie die Beschränkung der Zugänglichkeit,<br />
die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit oder die Erhöhung der<br />
Zahl von Spaltenverstecken als Winterquartiere für Fledermausarten<br />
aufzuwerten.“<br />
K 3.1 (Besonderer Arten- und Biotopschutz)<br />
Zur Sicherung der im Bereich der Flugbetriebsfläche und der geplanten<br />
Gewerbeflächen befindlichen Biotope mit hoher bzw. sehr hoher Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz wird empfohlen, die Vermeidungsmaßnahme<br />
V 3.2 festzusetzen:<br />
„Sandtrockenrasen, Kiefern-Vorwälder einschließlich ein den<br />
Kiefern-Vorwäldern vorgelagerter Saumbereich von 25 m Breite<br />
als Abstandsfläche und der Kiefernforst im Bereich der geplanten<br />
nördlichen Gewerbefläche sowie sämtliche Gewässer, deren<br />
Uferbereich und Gehölzmantel sind nicht durch bauliche<br />
Anlagen oder sonstige Nutzungen in Anspruch zu nehmen, die<br />
zu Beeinträchtigungen der geschützten Biotope führen könnten.<br />
Während der Bauphase dürfen die Flächen nicht als Flächen<br />
54
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 3 „Flugverkehrsflächen“ u. „Gewerbe“<br />
der Baustelleneinrichtung, Erdlagerplätze oder für sonstige<br />
Maßnahmen in Anspruch genommen werden, die zu einer temporären<br />
oder dauerhaften Beeinträchtigung der Biotope führen<br />
könnten. Der Saumbereich ist extensiv durch einschürige Mahd<br />
mit Abfuhr der Streu zu pflegen und zu strukturreichen Trockenbiotopen<br />
zu entwickeln.“<br />
K 3.3 (Wasserschutzgebiet im Verfahren)<br />
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen der Schutzziele des geplanten<br />
Wasserschutzgebietes Eberswalde (Finow) sollte folgende Vermeidungsmaßnahme<br />
V 3.3 berücksichtigt werden:<br />
„Beim das Errichten oder Erweitern von Straßen sind die Richtlinien<br />
für bautechnische Maßnahmen an Straßen in Wassergewinnungsgebieten,<br />
Ausgabe 2002 (RiStWag) 3 der Forschungsgemeinschaft<br />
für Straßen- und Verkehrswesen zu beachten.<br />
Beim Errichten von Abwasserleitungen ist das Arbeitsblatt ATV-<br />
DVWK-A 142 der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft,<br />
Abwasser und Abfall e. V. vom November 2002 2 zu beachten.“<br />
K 3.6 und K 3.7 (Klima und Landschaftsbild)<br />
Zur Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Klima sowie der Beeinträchtigung<br />
des Landschaftsbildes sollte innerhalb des Plangebietes die<br />
Minderungsmaßnahme A 3.2 durchgeführt werden:<br />
„Entlang der inneren Erschließungsstraßen der Gewerbegebiete<br />
sind beidseitig Straßenbaumpflanzungen mit Baumarten der<br />
Pflanzliste 2 vorzunehmen. Der Abstand der Baumpflanzungen<br />
beträgt in der Reihe 10-12 m. Auf den Gewerbegrundstücken<br />
sind auf den nicht versiegelten Flächen pro m² Freifläche insgesamt<br />
ein Strauch der Pflanzliste 4 zu pflanzen.“<br />
Diese Maßnahmen reduzieren die Wärmeentwicklung und Wärmespeicherung<br />
der Baukörper und tragen durch die erhöhte Evapotranspiration<br />
zu einer Verdunstungskühlung der Umgebungsluft bei.<br />
Die oben genannten Maßnahmen zur Durchgrünung des Gewerbegebietes<br />
tragen zudem dazu bei, die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes<br />
zu minimieren.<br />
K 3.8 (Örtliche Landschaftsplanung)<br />
Die <strong>Gemeinde</strong> muss die vorgesehene Änderung der gemeindlichen Planungsabsicht<br />
bezüglich des Umgangs mit den Trockenbiotopen im Süden<br />
der Flugbetriebsfläche, wie sie im Landschaftsplan festgehalten<br />
wurde städtebaulich begründen. Durch diese Erläuterung dokumentiert<br />
die <strong>Gemeinde</strong> den Abwägungsprozess, der zur Änderung der gemeindlichen<br />
Planungsabsicht geführt hat, so dass keine Zielkonflikte innerhalb<br />
der gemeindlichen Planwerke verbleiben.<br />
55
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 6, „Gewerbe“ und „Ausgleichsflächen“<br />
4.4.8 Vorhaben 6<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Sondergebiet „Militär“ und „Flächen<br />
für die Landwirtschaft“ in „Gewerbe“ und „Ausgleichsfläche“. Ziel ist die<br />
Konversion eines ehemaligen Kasernengeländes im nördlichen Bereich<br />
auf einer Fläche von etwa 12,3 ha sowie die Umsetzung von Ausgleichsmaßnahmen<br />
im südlichen, etwa 9,4 ha großen Teilbereich.<br />
4.4.8.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.8.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Finowfurt<br />
etwa 350 m nördlich der westlichen Einflugschneise des Flugplatzes<br />
Eberswalde-Finow. Das Gelände wird über die Biesenthaler Straße erschlossen.<br />
Die E28 verläuft westlich des Projektgebietes in einer Entfernung<br />
von etwa 400 m.<br />
Nach Westen und Nordwesten schließt sich eine kleinteilige Agrarlandschaft<br />
an. Im Nord-Osten beginnt unmittelbar der Ortsrand von Finowfurt.<br />
Nach Osten und Südosten liegt auf der gegenüberliegenden Straßenseite<br />
ein Gewerbegebiet, dahinter beginnt die Flugplatzfläche. Im<br />
Süden schließen sich Kiefernforste an.<br />
4.4.8.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Es handelt sich um einen nach 1990 aufgegebenen Kasernenstandort<br />
mit teilweise verfallenem Gebäudebestand, der sich gleichmäßig über<br />
das gesamte Areal in überwiegend großflächigen Unterkunftsgebäuden<br />
und Lagerhallen verteilt. Lediglich das südliche Drittel ist mit Ausnahme<br />
einiger kleinerer Baracken frei von Gebäuden. Das Gesamte<br />
Areal ist durch eine Umzäunung vor unbefugtem Betreten geschützt.<br />
Die Bodenstruktur entspricht einem anthropogen stark überformten,<br />
humosen Sandboden. Im Bereich der Kernnutzung des Kasernengeländes<br />
zeugt das Vorkommen einer Reihe nitrophiler Stauden in den<br />
Freiflächen eine Eutrophierung durch die jahrzehntelange anthropogene<br />
Nutzung auf. Die südlichen, ehemals kaum genutzten Flächen sind<br />
deutlich nährstoffärmere Standorte.<br />
Der überwiegende Flächenanteil ist als Gewerbebrache zu kartieren<br />
(Biotoptyp 12320). Die Freiflächen zwischen den Gebäuden, Wegen<br />
und Lagerplätzen werden überwiegend von Landreitgrasfluren eingenommen.<br />
Teilweise konnten sich Gehölzinseln mit Birken, Kiefern und<br />
Stiel-Eiche etablieren. Verwilderte Schneeberen in der Strauchschicht<br />
der Gehölzinseln sind Relikte der Grünflächengestaltung des Militärstandortes.<br />
Die Gehölzinseln haben eine gewisse Bedeutung für kulturfolgende<br />
Singvogelarten. Die Aufgrund des Wechsels von Gehölzbeständen,<br />
Waldstrukturen und Offenland kommt der Grünspecht Picus<br />
viridis (Vogelschutzrichtlinie Anhang 1, BArtSchV Novellierung) als<br />
Nahrungsgast auch im Bereich der Gewerbebrache vor. Für Wald- und<br />
Zauneidechse sind die dominierenden, dichten Landreitgrasfluren<br />
suboptimale Lebensräume, so dass keine Populationen zu erwarten<br />
sind.<br />
Insgesamt spielt die Gewerbebrache für den Arten- und Biotopschutz<br />
eine geringe Rolle.<br />
56
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 6, „Gewerbe“ und „Ausgleichsflächen“<br />
Von sehr hoher Bedeutung ist allerdings der ehemalige Lagerkeller der<br />
Bäckerei, der als Winterquartier für Fledermausarten fungiert<br />
(TRAUTMANN u. GOETZ 2007, S. 85). Der Lagerkeller muss als geschützte<br />
Lebensstätten nach § 42 Bundesnaturschutzgesetz in Verbindung<br />
mit Artikel 12 der FFH-Richtlinie bewertet werden.<br />
Biotoptypen Vorhaben 6 (Finowfurt). Die blaue Linie trennt die Darstellungen „Gewerbe“<br />
und „Ausgleichsfläche“<br />
Im Süden geht die Landreitgrasflur auf nährstoffärmeren Substraten in<br />
den Biotoptyp der leicht ruderalisierten Grünlandbrachen trockener<br />
Standorte (Biotoptyp 051332) über. Der Biotop wird durch Pflanzenarten<br />
wie Landreitgras Calamagrostis epigeios, Rainfarn Tanacetum<br />
vulgare, Grau-Kresse Berteroa incana, Wiesenflockenblume Centaurea<br />
jacea, Schafgarbe Achillea millefolium, Johanniskraut Hypericum<br />
perforatum bestimmt. Arten der Trockenrasen kommen nur kleinflächig<br />
in untergeordneten Deckungsgraden vor. Zu nennen sind Bergglöckchen<br />
Jasione montana, Feldbeifuß Artemisia campestris, Grasnelke<br />
Armeria elongata und Schaf-Schwingel Festuca ovina.<br />
57
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 6, „Gewerbe“ und „Ausgleichsflächen“<br />
An der Südgrenze des Projektgebietes steht ein strukturreicher, forstlich<br />
nicht genutzter Kiefernforst (Biotoptyp 08480). Die Baumschicht wird von<br />
alten Wald-Kiefern beherrscht. Einzelne Espen, Sand-Birken und Stiel-<br />
Eichen ergänzen den Bestand. Die Kraut- und Moosschicht ist aufgrund<br />
des lichten Charakters des Kiefernforstes stark ausgeprägt und beherbergt<br />
viele Pflanzenarten der angrenzenden Grünlandbrache.<br />
Der Kiefernforst beginnt sich durch Sämlinge nach Norden auszubreiten<br />
und hat abschnittsweise einen vorgelagerten Saum als Kiefern-Vorwald<br />
(Biotoptyp 082819) entwickelt.<br />
Vorwälder trockener Standorte unterliegen dem Schutz des § 32 Brandenburgisches<br />
Naturschutzgesetz.<br />
Insgesamt ist der südliche, weitgehend ungenutzte Bereich des Kasernenstandortes<br />
aufgrund des Strukturreichtums, der Naturnähe und<br />
der hohen Grenzlinieneffekte durch das eng verzahnte Nebeneinander<br />
unterschiedlicher Biotopstrukturen von hoher Bedeutung für den Arten-<br />
und Biotopschutz. Das Vorkommen einer Reihe gefährdeter, streng<br />
oder besonders geschützter Tierarten ist zu erwarten. Exemplarisch<br />
sind zu nennen:<br />
Grauammer Emberiza calandra (RL 1; BArtSchV), Sperbergrasmücke<br />
Sylvia nisoria (RL 2; VSchRL), Neuntöter Lanius collurio (RL 3;<br />
VSchRL), Heidelerche (Lullula arborea, RL 2; BArtSchV),<br />
Zauneidechse (Lacerta agilis, RL 3; FFH IV), Waldeidechse (Lacerta<br />
vivipara, RL 2; BArtSchV), Blindschleiche Anguis fragilis (BArtSchV),<br />
Gelbhalsmaus Apodemus flavicollis (BArtSchV),<br />
Entlang der Biesenthaler Straße befindet sich ein lichter, von Birken<br />
bestimmter Kiefernforst, wobei die Kiefer nur vereinzelt beigemischt ist<br />
und sich meist nur in der kaum ausgeprägten Strauchschicht als Naturverjüngung<br />
wieder findet. Die Krautschicht wird vom Landreitgras<br />
dominiert. Aufgrund der monostrukturierten Krautschicht und der unmittelbaren<br />
Nähe zur Biesenthaler Straße mit den angrenzenden Gewerbegebieten<br />
ist der Biotoptyp lediglich von mittlerer Bedeutung für<br />
den Arten- und Biotopschutz.<br />
4.4.8.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Derzeit weist das Projektgebiet versiegelte Flächen in einer Größenordnung<br />
von etwa 55.000 m² auf. Im geplanten Gewerbegebiet befinden<br />
sich hiervon 42.800 m². Das Gewerbegebiet soll eine Fläche von 12,3<br />
ha einnehmen. Unter Annahme einer üblicherweise zulässigen baulichen<br />
Gesamt-Verdichtung im Rahmen der städtebaulichen Nutzungskategorie<br />
„Gewerbe“ von 0,8 ergäbe sich eine zukünftige Versiegelung von<br />
98.400 m². Dies entspricht einer Mehrversiegelung von etwa 55.600 m².<br />
58
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 6, „Gewerbe“ und „Ausgleichsflächen“<br />
Die verbleibenden 12.200 m² versiegelte Fläche werden in die Bilanzierung<br />
der geplanten Ausgleichsmaßnahmen eingestellt.<br />
Innerhalb der Ausgleichsfläche aufwertungsfähige Flächen sind die trockenen<br />
Grünlandbrachen mit einer Fläche von 61.500 m² und die Kiefern-Forste<br />
mit einer Fläche von 21.000 m². Diese werden ebenfalls in<br />
die Bilanzierung der geplanten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen aufgenommen.<br />
4.4.8.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 6.1: Es muss davon ausgegangen werden, dass der Erhalt funktionsfähiger<br />
Fledermaus-Winterquartiere innerhalb des geplanten Gewerbegebietes<br />
unter Berücksichtigung des hohen, unmittelbaren Störeinflusses<br />
nicht möglich ist. Damit gehen nach § 34 Brandenburgisches Naturschutzgesetz<br />
geschützte Habitate verloren.<br />
K 6.2: Durch die zusätzliche Überbauung in einer Größenordnung von<br />
54.800 m² gehen Biotope mit geringer Bedeutung für den Arten- und<br />
Biotopschutz verloren. Ohne entsprechende Vermeidungsmaßnahmen<br />
wird auch der Gehölzbestand im Bereich des projektierten Gewerbegebietes<br />
beeinträchtigt. Dies sind erhebliche Eingriffe in die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes.<br />
K 6.3: Der Verlust nach Brandenburgischer Baumschutzverordnung zu<br />
erhaltender Bäume ist im Zuge der Realisierung des Gewerbegebietes<br />
nicht zu vermeiden. Damit sind erhebliche Eingriffe in die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes verbunden.<br />
4.4.8.2.2 Schutzgut Boden, Wasser und Klima<br />
K 6.4: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 55.600 m² Boden geht einher<br />
mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 6.5: Die Versieglung von 55.600 m² Boden reduziert ohne entsprechende<br />
Vermeidungsmaßnahmen Menge und Qualität der Grundwasserneubildung.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 6.6: Die Realisierung von Baumassen in erheblichem Umfang trägt zu<br />
einer erheblichen Beeinflussung des Mikroklimas im Vorhabenraum bei.<br />
Die Baukörper speichern erhebliche Wärmemengen, die insbesondere<br />
in den Nachtstunden zu einer Erhöhung der Umgebungstemperaturen<br />
führen. Die Kaltluftentstehungsfunktion der Freiflächen innerhalb des<br />
geplanten Gewerbegebietes geht vollständig verloren. Dies ist ein erheblicher<br />
und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut Klima. Aufgrund der<br />
klimatisch unbelasteten Situation in Finowfurt ist die Beeinträchtigungen<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes durch Ausgleichsmaßnahmen<br />
im Plangebiet und Entsiegelungsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes<br />
zu kompensieren.<br />
59
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 6, „Gewerbe“ und „Ausgleichsflächen“<br />
4.4.8.2.3 Landschaftsbild<br />
K 6.7: Aufgrund der erheblichen Vorschädigung des Landschaftsbildes<br />
im Raum mit einem Konglomerat von großflächigen Gewerbegebieten,<br />
Siedlungssplittern, Flugplatz-Infrastruktur und der nahen Bundesautobahn<br />
stellt die Entwicklung des Gewerbegebietes einen durch Entsiegelungsmaßnahmen<br />
außerhalb des Plangebietes und Ausgleichsmaßnahmen<br />
im Plangebiet einen kompensierbaren Eingriff in das Schutzgut<br />
Landschaftsbild dar.<br />
4.4.8.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 6.1<br />
Die Umweltvertäglichkeitsstudie zum Raumordnungsverfahren des Regionalflughafens<br />
Eberswalde-Finow weist die sonstigen als Winterquartiere<br />
geeigneten Bunker und Shelter der Umgebung bereits als Kompensationsobjekte<br />
für die Beeinträchtigung von Fledermausquartieren<br />
durch die Erweiterung des Flugbetriebes aus. Es ist fraglich, ob eine<br />
zusätzliche Aufwertung der Habitatqualitäten der verbleibenden Quartiere<br />
geeignet ist, den zu erwartenden massiven Verlust von Winterquartieren<br />
im Bereich des geplanten Gewerbegebietes ausgleichen zu können.<br />
Da die Definition geeigneter Ausgleichsmaßnahmen stark von den spezifischen<br />
Situationen der potentiell geeigneten Ausweichquartiere abhängig<br />
ist, ist die Benennung der Ausgleichsmaßnahme A 6.1 lediglich<br />
in Form einer pauschalen Definition möglich:<br />
„Es ist erforderlich, in erheblichen Umfang Bunker, Keller oder<br />
Shelter im engeren Bezugsraum des Vorhabengebietes durch<br />
geeignete Maßnahmen wie die Beschränkung der Zugänglichkeit,<br />
die Erhöhung der Luftfeuchtigkeit oder die Erhöhung der<br />
Zahl von Spaltenverstecken als Winterquartiere für Fledermausarten<br />
aufzuwerten.“<br />
K 6.3<br />
Die Beeinträchtigung der Gehölz-Inseln innerhalb des Gewerbegebietes<br />
ist größtenteils vermeidbar. Insbesondere entlang der Randbereiche<br />
sollten die Gehölzbestände erhalten bleiben, um die bestehende Eingrünung<br />
des Standortes weiterhin zu gewährleisten. Es wird daher die<br />
Übernahme der Vermeidungsmaßnahme V 6.1 empfohlen:<br />
„Die vorhandenen Gehölzstrukturen im Bereich der Gewerbebrache<br />
sind nicht durch bauliche Anlagen in Anspruch zu nehmen.“<br />
K 6.3: Der unvermeidliche Verlust von nach Brandenburgischer Baumschutzverordnung<br />
zu erhaltender Bäume kann durch die Maßnahme E<br />
6.1 ersetzt werden:<br />
„Entlang der inneren Erschließungsstraßen des Gewerbegebietes<br />
sind beidseitig Straßenbaumpflanzungen mit Baumarten der<br />
Pflanzliste 2 vorzunehmen. Der Abstand der Baumpflanzungen<br />
beträgt in der Reihe 10-12 m. Für jeden gem. Brandenburgischer<br />
Baumschutzverordnung zu erhaltenden Baum, der gefällt<br />
wird, sind 4 Straßenbäume zu pflanzen.“<br />
60
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 6, „Gewerbe“ und „Ausgleichsflächen“<br />
K 6.2, K 6.4 bis K 6.6<br />
Die zusätzliche Versiegelung von 55.600 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse<br />
außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 55.600 m² versiegelten Bodens<br />
Zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Wasser wird die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 6.2 empfohlen:<br />
„Oberflächlich anfallende Niederschläge sollen im Plangebiet<br />
durch ein Mulden-/Rigolen-System mit Anschluss an retentionsfähige<br />
Grünanlagen versickert werden. Die Maßnahme ermöglicht<br />
den weitgehenden Erhalt der Grundwasserneubildung und<br />
reduziert die über das Kanalsystem abzuführenden Wassermengen.“<br />
K 6.6<br />
Zur Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Klima sollte innerhalb<br />
des Plangebietes die Minderungsmaßnahme A 6.2 durchgeführt werden:<br />
„Entlang der inneren Erschließungsstraßen des Gewerbegebietes<br />
sind beidseitig Straßenbaumpflanzungen mit Baumarten der<br />
Pflanzliste 2 vorzunehmen, soweit dies nicht bereits im Rahmen<br />
der Ersatzmaßnahme E 6.1 erfolgt. Der Abstand der Baumpflanzungen<br />
beträgt in der Reihe 10-12 m. Auf den Gewerbegrundstücken<br />
sind auf den nicht versiegelten Flächen pro m²<br />
Freifläche insgesamt ein Strauch der Pflanzliste 4 zu pflanzen.“<br />
Diese Maßnahmen reduzieren die Wärmeentwicklung und Wärmespeicherung<br />
der Baukörper und tragen durch die erhöhte Evapotranspiration<br />
zu einer Verdunstungskühlung der Umgebungsluft bei.<br />
Die oben genannten Maßnahmen zur Durchgrünung des Gewerbegebietes<br />
tragen zudem dazu bei, die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes<br />
zu minimieren.<br />
61
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 20, „Wohnbaufläche“<br />
4.4.9 Vorhaben 20<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
„Wohnbaufläche“. Ziel ist nunmehr die Sicherung des Bestandes an<br />
Wohngebäuden und untergeordnet die Entwicklung eines Wohngrundstücks.<br />
Die bestehenden Wohnhäuser und sonstigen Gebäude genießen unabhängig<br />
von der Änderung der Flächendarstellung des FNP Bestandsschutz.<br />
4.4.9.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.9.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am süd-westlichen Ortsrand von Finowfurt.<br />
Das Projektgebiet wird von der Biesenthaler Straße über die Mühlenstraße<br />
erschlossen.<br />
Westlich schließt sich die Niederungslandschaft im Umfeld des Finow-<br />
Kanals an. Im Norden und Osten liegen durchgrünte Einzelhausgrundstücke.<br />
Im Süden liegt ein ehemaliges Bahngelände an.<br />
4.4.9.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Die Grundstücksnutzung teilt sich in die Hauptnutzungstypen des Wochenendhausgebietes<br />
(102502 „Wochenendhausbebauung mit Bäumen“)<br />
im nördlichen Drittel und einer südlich anschließenden Einzelhausbebauung<br />
mit Obstbaumbestand (Biotoptyp 12262).<br />
Die Wochenendhausgrundstücke weisen eine intensive Strukturierung<br />
durch ältere Bäume und Gehölzen auf. Auf den Freiflächen überwiegt<br />
eine extensive Gartenstruktur. Zur freien Feldflur nach Westen sind die<br />
Grundstücke durch ein standortgemäßes Laubgebüsch visuell gut eingebunden.<br />
Aufgrund der alten, standortgemäßen Gehölzstrukturen und<br />
der extensiven Gartennutzung spielen die Wochenendhausgrundstücke<br />
eine Rolle für kulturfolgende Singvogelarten. Dem Biotop wird aber aufgrund<br />
der unmittelbaren, störintensiven Lage im Siedlungsgebiet nur<br />
eine geringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz beigemessen.<br />
Die Einzelhausgrundstücke weisen relativ große Gartengrundstücke auf,<br />
die überwiegend als Nutzgärten mit Grabeland und Obstbaumbestand<br />
genutzt werden. Altbaumbestände fehlen weitgehend. Ziergartenfunktionen<br />
bleiben im Hintergrund. Dem Biotop wird aufgrund der unmittelbaren,<br />
störintensiven Lage im Siedlungsgebiet nur eine geringe Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz beigemessen.<br />
Südlich der Einzelhausbebauung befindet sich eine Grünlandbrache<br />
trockener Standorte in artenarmer Ausprägung (Biotoptyp 05132). Es<br />
handelt sich um eine Restfläche zwischen einem Feldweg und der Siedlungsfläche,<br />
die intensiven anthropogenen Störeinflüssen ausgesetzt ist.<br />
Der Biotoptyp ist in Brandenburg häufig und ungefährdet. Die Bedeutung<br />
für den Arten und Biotopschutz ist gering.<br />
62
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 20, „Wohnbaufläche“<br />
Biotoptypen Vorhaben 20 (Finowfurt)<br />
4.4.9.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 10.500 m². Die Einzelhausbebauung<br />
mit einem Flächenanteil von ca. 7.700 m² entspricht in<br />
den Bestandsflächen überschlägig der im Rahmen der Flächenkategorie<br />
„Wohnbaufläche“ möglichen baulichen Nutzungsintensität.<br />
Bauliche Entwicklungspotentiale ergeben sich im Bereich des gegenwärtig<br />
als Wochenendhausgrundstück genutzten, etwa 1.300 m² großen<br />
Teilbereichs sowie in der etwa 2.600 m² großen Grünlandbrache. Unter<br />
Annahme einer üblichen GRZ von 0,4 und einer Überschreitungs-GRZ<br />
von 50% wäre die bauliche Inanspruchnahme von etwa 2.300 m² eröffnet.<br />
Abzüglich des aktuellen Bestands versiegelter Flächen von ca. 100<br />
m² wäre mit einer Mehrversiegelung von 2.200 m² zu rechnen.<br />
4.4.9.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 20.1: Die Versiegelung von 2.200 m² Boden reduziert die zur Verfügung<br />
stehenden Lebensräume mit geringer Bedeutung für den Arten-<br />
und Biotopschutz. Dieser Eingriff ist erheblich und nachhaltig und muss<br />
kompensiert werden.<br />
63
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 20, „Wohnbaufläche“<br />
K 20.2: Der Verlust von Altbäumen ist im Zuge der Realisierung der<br />
Wohnbebauung möglich. Damit sind erhebliche Eingriffe in die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes verbunden.<br />
4.4.9.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 20.3: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 2.200 m² Boden geht einher<br />
mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 20.4: Die Versieglung von 2.200 m² Boden reduziert Menge und Qualität<br />
der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.9.2.3 Landschaftsbild<br />
K 20.5:<br />
Der Verlust von nach Brandenburgischer Baumschutzverordnung zu<br />
erhaltender Bäume im Bereich des derzeitigen Wochenendhausgrundstücks<br />
stellt eine Beeinträchtigung der landschaftsästhetischen Qualitäten<br />
dar, die als erheblicher Eingriff bewertet werden muss.<br />
4.4.9.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 20.1, K 20.3 und K 20.4<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope,<br />
Boden und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung von 2.200 m²<br />
Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 2.200 m² versiegelten Bodens<br />
K 20.2 und K 20.5:<br />
Die Verluste von Altbäumen dürften aufgrund der insgesamt eher großzügigen<br />
Raumsituation vermeidbar sein. Es wird daher empfohlen, eine<br />
Vermeidungsmaßnahme V 20.1 zu übernehmen:<br />
„Bäume mit einem Stammdurchmesser von mehr als 60 cm sind<br />
nicht durch bauliche Anlagen in Anspruch zu nehmen. Die Bäume<br />
sind während der Bauphase vor mechanischer Beschädigung sowohl<br />
im Stammbereich als auch im Wurzelbereich zu schützen.“<br />
Sollten Verluste von Altbäumen unvermeidbar sein, wird die Festsetzung<br />
einer Ersatzmaßnahme E 20.1 vorgeschlagen:<br />
„Entlang der westlichen Grundstücksgrenze sind Baumpflanzungen<br />
mit Baumarten der Pflanzliste 1 vorzunehmen. Für jeden zu erhaltenden<br />
Baum, der gefällt wird, sind 4 Ersatzbäume zu pflanzen.“<br />
64
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 44, „Grünfläche (Sportplatz)“<br />
4.4.10 Vorhaben 44<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Sondergebiet „Großflächige Handelsbetriebe“<br />
in Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Sportplatz“. Die<br />
Entwicklung weiterer Flächen für großflächige Handelsbetriebe wird an<br />
dieser Stelle nicht weiter verfolgt. Ziel ist nunmehr die Errichtung eines<br />
ungedeckten Sportplatzes. Der bestehende Sportplatz unweit des Projektgebietes<br />
soll aufgrund der geplanten Entwicklung eines Wohngebietes<br />
(s. Vorhaben Nr. 105) verlegt werden.<br />
4.4.10.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.10.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am östlichen Ortsausgang von Finowfurt<br />
und liegt unmittelbar an der B167.<br />
Das Projektgebiet schließt an die großflächigen Gewerbegebiete im Osten<br />
Finowfurts an. Nördlich der B167 liegen Kiefernaufforstungen. Östlich<br />
bildet ein Kiefernforst eine Landschaftszäsur, bevor der Stadtrand<br />
von Eberswalde beginnt.<br />
4.4.10.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet hat eine Flächenausdehnung von 44.000 m², davon<br />
werden 40.000 m² von leicht ruderalisierten Grünlandbrachen trockener<br />
Standorte (Biotoptyp 051332) eingenommen. Der Biotop wird mit einem<br />
Deckungsgrad von 60-70% vom Schaf-Schwingel Festuca ovina bestimmt.<br />
Arten der Trockenrasen wie Sandstrohblume Helichrysum arinarium<br />
, Kleinem Habichtskraut Hieracium pilosella und Feld-Beifuß Artemisia<br />
campestris kommen nur kleinflächig in untergeordneten Deckungsgraden<br />
vor. Vereinzelt kommt Eschen-Ahorn Acer negundo als<br />
Strauchwuchs auf. Der Biotoptyp ist insgesamt artenarm und von geringer<br />
mikrostruktureller Vielfalt. Aufgrund der isolierten Lage im Raum und<br />
der intensiven Störeinflüsse der unmittelbar angrenzenden Gewerbegebiete<br />
und der Bundestrasse 167 entfaltet das Projektgebiet seine potentielle<br />
Rolle für den Arten- und Biotopschutz nicht. Insgesamt wird der<br />
Biotop daher mit einer geringen Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz<br />
bewertet.<br />
Innerhalb der Grünlandbrache liegen inselartig einzelne Laubgebüsche<br />
mittlerer Standorte (Biotoptyp 07102). Es handelt sich um Aufwuchs des<br />
neophytischen Eschen-Ahorns. Auch für die Laubgebüsche gelten die<br />
einschränkenden Bedingungen der erhöhten Störeinflüsse aufgrund der<br />
Lageungunst, so dass in Verbindung mit dem geringen Alter des nicht<br />
heimischen Eschen-Ahorns auch diese Biotope lediglich von geringer<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz sind.<br />
Entlang der B167 verläuft ein Feldgehölz mittlerer Standorte (Biotoptyp<br />
07113). Es wird bestimmt von alten Hybrid-Pappeln. Ergänzend finden<br />
sich einzelne Wald-Kiefern. Eine Strauchschicht fehlt vollständig. Auch<br />
dieser Biotoptyp leidet in seiner Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz<br />
unter der unmittelbaren Nähe der B167. Aufgrund der erheblichen<br />
Störeinflüsse, der nicht heimischen Hybrid-Pappeln und der geringen<br />
Strukturvielfalt wird die Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz<br />
mit „gering“ eingestuft“.<br />
65
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 44, „Grünfläche (Sportplatz)“<br />
Biotoptypen Vorhaben 44 (Finowfurt)<br />
4.4.10.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Da das Vorhaben Ersatz für eine bestehende Sportfläche sein soll, orientiert<br />
sich die Eingriffsabschätzung an der Nutzungsstruktur der aufzugebenden<br />
Sportfläche. Hierbei handelt es sich um einen in erster Linie<br />
für Fußball genutzte Sportrasenfläche. Eine umlaufende Leichtathletik-<br />
Bahn besteht nicht. Mit Ausnahme eines kleineren Multifunktionsgebäudes<br />
befinden sich keine weiteren baulichen Anlagen auf dem Gelände.<br />
Es wird daher davon ausgegangen, dass nennenswerte Bodenversiegelungen<br />
nicht vorgenommen werden. Die Sportrasenfläche hat derzeit<br />
eine Fläche von etwa 10.000 m² bei einer Ausdehnung von etwa 115 m<br />
x 85 m.<br />
4.4.10.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 44.1: Die Umwandlung der Grünlandbrachen in intensiv genutzte<br />
Sportrasenflächen im Umfang von etwa 7.000 m² ist ein erheblicher Eingriff<br />
in die Belange des Arten- und Biotopschutz.<br />
K 44.2: Die Umwandlung der Laubgebüsche in intensiv genutzte Sportrasenflächen<br />
im Umfang von etwa 3.000 m² ist ein erheblicher Eingriff in<br />
die Belange des Arten- und Biotopschutz.<br />
K 44.3: Der Verlust von alten Wald-Kiefern des Feldgehölzes wäre mit<br />
erheblichen Eingriffen in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes<br />
verbunden.<br />
66
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 44, „Grünfläche (Sportplatz)“<br />
4.4.10.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
Die Umwandlung der Grünlandbrache in Sportrasenfläche zeigt keine<br />
erheblichen Beeinträchtigungen der Schutzgüter Boden, Wasser und<br />
Klima.<br />
Da das Projektgebiet im geltenden Flächennutzungsplan als Sondergebiet<br />
„Großflächige Handelsbetriebe“ vorgesehen wurde, ergibt sich für die<br />
Bilanzierung der durch die Änderung des FNP vorgesehenen Änderungen<br />
der baulichen Entwicklungspotentiale eine Reduktion. Für das Sondergebiet<br />
„Großflächige Handelsbetriebe“ ist auf Basis der Vorgaben der<br />
Baunutzungsverordnung von einer zulässigen maximale Grundflächenzahl<br />
(GRZ) von 0,8 auszugehen. Bei einer Grundfläche von etwa 44.000<br />
m² bedeutet dies etwa 35.200 m² Baufläche. Damit ergibt sich eine Reduktion<br />
zum im bestehenden Flächennutzungsplan angesetzten baulichen<br />
Entwicklungspotential von etwa 35.200 m².<br />
4.4.10.2.3 Landschaftsbild<br />
K 44.4: Der Verlust insbesondere der Wald-Kiefern des Feldgehölzes<br />
wäre eine Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, die als erheblicher<br />
Eingriff bewertet werden muss.<br />
4.4.10.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 44.1:<br />
Der Verlust von 7.000 m² Grünlandbrachen durch die Umwandlung in<br />
Sportrasenflächen ist durch die Entwicklung der verbleibenden Grünlandbrachen<br />
zu Sandtrockenrasen innerhalb des Projektgebietes ausgleichbar.<br />
Es wird die Übernahme der Ausgleichsmaßnahme A 44.1<br />
empfohlen:<br />
„Innerhalb des Projektgebietes sind 3.500 m² Grünlandbrachen<br />
zu Sandtrockenrasen zu entwickeln. Durch regelmäßige Mahd<br />
der Flächen und Verzicht auf Düngung können in der Regel innerhalb<br />
weniger Jahre auf Sandböden ausreichend Nährstoffe<br />
entzogen werden, um typische Gesellschaften der Sandtrockenrasen<br />
entstehen zu lassen.<br />
Pflegemaßnahme: Mahd zweimal jährlich. 1. Mahd zwischen<br />
30.06. und 15.07., 2. Mahd zwischen 01.10.und 15.10. Abfuhr<br />
der Streu. Nach Erreichen des Zielzustandes (s.u.) kann auf ein<br />
einschüriges Mahdregime mit einer Mahd im Zeitraum 30.06.<br />
bis 15.07. umgestellt werden.<br />
Zielzustand: schwachwüchsiger Sandtrockenrasen mit geringem<br />
lebenden und toten Phytomassenaufkommen. Vorkommen<br />
insbesondere der folgenden Pflanzenarten: Grasnelke (Armeria<br />
elongata), Sand-Strohblume (Helichrysum arenarium), Feld-<br />
Beifuß (Artemisia campestre), Kleines Habichtskraut (Hieracium<br />
pilosella), Berg-Sandglöckchen (Jasione montana), Hasen-Klee<br />
(Trifolium arvense), Skabiosen-Flockenblume (Centaurea scabiosa).<br />
67
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 44, „Grünfläche (Sportplatz)“<br />
Fehlen insbesondere folgender Pflanzenarten: Gemeiner Beifuß<br />
(Artemisia vulgaris), Kanadische Goldrute (Solidago canadensis),<br />
Land-Reitgras (Calamagrostis epigeios), Kanadisches<br />
Berufskraut (Erigeron canadensis).“<br />
Der Ausgangszustand der Ausgleichsfläche ist durch eine<br />
pflanzensoziologische Ansprache mit Angabe von Orientierungswerten<br />
zu den Deckungsgraden der einzelnen Arten zu<br />
dokumentieren.<br />
Aufgrund der geringen Bedeutung der Grünlandbrache für den Arten<br />
und Biotopschutz und des entsprechend hohen Aufwertungspotentials<br />
durch die Entwicklung zu Sandtrockenrasen ist ein Eingriffs-<br />
Ausgleichsflächenverhältnis von 1:0,5 ausreichend.<br />
K 44.2:<br />
Der Verlust von 3.000 m² Laubgebüschen durch die Umwandlung in<br />
Sportrasenflächen ist durch die Entwicklung einer Baumhecken entlang<br />
der Bundesstraße 167 innerhalb des Projektgebietes ausgleichbar. Es<br />
wird die Übernahme der Ausgleichsmaßnahme A 44.2 empfohlen:<br />
„Zwischen der Bundesstraße 167 und dem bestehenden linearen<br />
Feldgehölz ist die Anlage einer einseitigen Baumhecke vorzusehen.<br />
In einem durchschnittlich 10,00 m breiten Streifen<br />
werden 60 Bäume der Pflanzliste 3 als zukünftige Überhälter<br />
gesetzt (s. Anhang 3). Pro m² Pflanzfläche sind zusätzlich 2<br />
Sträucher der Pflanzliste 4 zu pflanzen (s. Anhang 3). Zur Verbesserung<br />
der Strukturvielfalt der Pflanzung sind sowohl Bäume<br />
als auch Sträucher in unterschiedlichen Dichten zu setzen,<br />
so dass auch vereinzelt lichte oder offene Bereiche entstehen.<br />
Die Pflanzfläche umfasst insgesamt etwa 3.000 m².<br />
K 44.3:<br />
Die Verluste von erhaltenswerten Wald-Kiefern des Feldgehölzes dürften<br />
aufgrund der insgesamt sehr großzügigen Raumsituation vermeidbar<br />
sein. Es wird daher empfohlen, eine Vermeidungsmaßnahme V 44.1 zu<br />
übernehmen:<br />
„Das Feldgehölz entlang der B167 ist nicht durch Sportplatzanlagen<br />
in Anspruch zu nehmen.“<br />
68
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 50, „Wohnbaufläche“<br />
4.4.11 Vorhaben 50<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Grünfläche (Friedhof)“ und „Fläche<br />
für die Landwirtschaft“ in „Wohnbaufläche“ und „Grünfläche“. Ziel die<br />
Schaffung der planerischen Voraussetzung für die Entwicklung eines<br />
etwa 2,8 ha großen Neubaugebietes für die Wohnungsnutzung.<br />
Die teilweise bereits bestehenden Wohnhäuser und sonstigen Gebäude<br />
genießen unabhängig von der Änderung der Flächendarstellung des<br />
FNP Bestandsschutz.<br />
4.4.11.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.11.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am süd-westlichen Ortsrand von Finowfurt.<br />
Das Projektgebiet wird von der Biesenthaler Straße über die Mühlenstraße<br />
und die verlängerte Maulbeerstraße erschlossen.<br />
Westlich schließt sich die Niederungslandschaft des Finow-Kanals an.<br />
Im Norden schließen sich landwirtschaftliche Brachflächen und schließlich<br />
der Ortskern von Finowfurt an. Im Osten erstreckt sich die dörfliche<br />
Kernbebauung entlang der Biesenthaler Straße. Im Süden liegen Einzelhausgrundstücke.<br />
4.4.11.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Der Projektraum besteht im Wesentlichen aus einer ehemals intensiv<br />
genutzten Ackerfläche, die mittlerweile brach gefallen ist (Biotoptyp<br />
09140). Das Brachestadium ist geringen Alters. Charakteristische Vegetationsbestände<br />
haben sich noch nicht etabliert. Es handelt sich um gut<br />
mit Nährstoffen versorgte, frische Lehmböden. Im Laufe des weiteren<br />
Brachstadiums werden sich innerhalb weniger Jahre nitrophile Staudenfluren<br />
frischer Standorte entwickeln. Der Biotop hat aufgrund seiner<br />
Strukturarmut eine geringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
An seiner Südgrenze umfasst der Projektraum bereits als Wohngrundstücke<br />
genutzte Einzelhausbebauungen mit teilweise alten Waldbaumarten<br />
(Biotoptyp 12263). Auf den Freiflächen überwiegt eine extensive<br />
Gartenstruktur. Der Übergang zur freien Feldflur der Ackerbrache<br />
nach Norden ist durch einen standortgemäßen, alten Gehölzbestand<br />
gekennzeichnet. Aufgrund der alten, standortgemäßen Gehölzstrukturen<br />
und der extensiven Gartennutzung spielen die Grundstücke eine Rolle<br />
für kulturfolgende Singvogelarten. Dem Biotop wird aber aufgrund der<br />
unmittelbaren, störintensiven Lage im Siedlungsgebiet nur eine geringe<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz beigemessen.<br />
An der Ostgrenze integriert der Projektraum typische Grünstrukturen des<br />
Überganges von der Feldflur in den Siedlungsbereich. Es überwiegen<br />
Grabelandnutzungen mit einzelnen Gärten und Gartenbrachen (Biotoptyp<br />
10110). Derartige Flächen haben Bedeutung für eine Reihe kulturfolgender<br />
Singvogelarten. Aufgrund der guten Strukturierung der Flächen<br />
mit Gehölzen und der überwiegend extensiven Nutzung wird dem<br />
Biotop trotz der Nähe zum Siedlungsbereich eine mittlere Bedeutung für<br />
den arten- und Biotopschutz beigemessen.<br />
69
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 50, „Wohnbaufläche“<br />
Biotoptypen Vorhaben 50 (Finowfurt)<br />
Richtung Osten fällt das Gelände zum Finowkanal deutlich ab und reicht<br />
außerhalb des Projektraumes an Grundwasser beeinflusste Standorte<br />
mit Schilfröhrichten (Biotoptyp 12111) heran. Schilfröhrichte unterliegen<br />
dem Schutz des § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz, die<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz ist entsprechend sehr hoch.<br />
Sie sind Lebensraum für eine Vielzahl spezialisierter sowie streng oder<br />
besonders geschützter Tierarten. Aufgrund der unmittelbaren Nähe der<br />
geplanten Wohnnutzung ist mit Störeinflüssen insbesondere auf folgende<br />
Arten zu rechnen:<br />
Drosselrohrsänger (Acrocephalus arundinaceus RL 3; BArtSchV), Teichrohrsänger<br />
Acrocephalus scirpaceus, Teichralle (Gallinula chloropus<br />
BArtSchV), Wasserspitzmaus (Neomys fodiens RL 2; BArtSchV), Ringelnatter<br />
(Natrix natrix , RL 2; BArtSchV).<br />
Das Schilfröhricht ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Sommerlebensraum<br />
für Kammmolch (Triturus cristatus cristatus RL 2; FFH II + IV), Teichmolch<br />
(Triturus vulgaris), Moorfrosch (Rana arvalis, RL 3; FFH IV),<br />
Grasfrosch (Rana temporaria, RL 3; BArtSchV), Erdkröte (Bufo bufo<br />
BArtSchV).<br />
Bedeutsam ist der Biotop zudem als Nahrungs- und Ausbreitungsraum<br />
von Biber Castor fiber (FFH II + IV) und Fischotter Lutra lutra (RL 1; FFH<br />
II + IV) entlang des Finow-Kanals.<br />
70
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 50, „Wohnbaufläche“<br />
4.4.11.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 2,8 ha. Der Projektraum<br />
ist weitgehend frei von versiegelten Flächen und Bebauung. Die<br />
kleinflächigen, nur schwach verdichteten Einzelhausgrundstücke haben<br />
ebenfalls bauliche Entwicklungspotentiale. Unter Annahme einer üblichen<br />
GRZ von 0,4 und einer Überschreitungs-GRZ von 50% wäre die<br />
bauliche Inanspruchnahme von etwa 16.800 m² eröffnet.<br />
4.4.11.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 50.1: Die Versiegelung von 16.800 m² Boden reduziert die zur Verfügung<br />
stehenden Lebensräume mit geringer und in geringem Umfang<br />
mittlerer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Dieser Eingriff ist<br />
erheblich und nachhaltig und muss kompensiert werden.<br />
K 50.2: Die Wohnnutzung beeinträchtigt das Schilfröhricht außerhalb<br />
des Projektraumes durch anthropogene Störeinflüsse (Lagerung von<br />
Gartenabfällen, Auslauf von Haustieren, generell die menschliche Nähe).<br />
Damit werden Schilfröhrichte erheblich und nachhaltig beeinträchtigt.<br />
Hiervon werden insbesondere störungsanfällige Tierarten wie Biber,<br />
Fischotter und die Brutvögel der Röhrichte erheblich beeinträchtigt.<br />
K 50.3: Der Verlust nach Brandenburgischer Baumschutzverordnung zu<br />
erhaltender Bäume ist im Zuge der Realisierung der Wohnbebauung<br />
möglich. Damit sind erhebliche Eingriffe in die Leistungsfähigkeit des<br />
Naturhaushaltes verbunden.<br />
4.4.11.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 50.4: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 16.800 m² Boden geht<br />
einher mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 50.5: Die Versieglung von 16.800 m² Boden reduziert Menge und<br />
Qualität der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 50.6: Die Realisierung von Baumassen in erheblichem Umfang trägt<br />
zu einer erheblichen Beeinflussung des Mikroklimas im Vorhabenraum<br />
bei. Die Baukörper speichern erhebliche Wärmemengen, die insbesondere<br />
in den Nachtstunden zu einer Erhöhung der Umgebungstemperaturen<br />
führen. Die Kaltluftentstehungsfunktion der Freiflächen geht vollständig<br />
verloren. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Klima. Aufgrund der klimatisch unbelasteten Situation in Fi-<br />
71
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 50, „Wohnbaufläche“<br />
nowfurt ist die Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes<br />
durch Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet und Entsiegelungsmaßnahmen<br />
außerhalb des Plangebietes zu kompensieren.<br />
4.4.11.2.3 Landschaftsbild<br />
K 50.7: Der Verlust von nach Brandenburgischer Baumschutzverordnung<br />
zu erhaltender Bäume im Bereich der derzeitigen Gärten und Einzelhausgrundstücke<br />
stellt eine Beeinträchtigung der landschaftsästhetischen<br />
Qualitäten dar, die als erheblicher Eingriff bewertet werden muss.<br />
K 50.8: Der Vorhabenraum hat derzeit eine wichtige Funktion für die<br />
wohnortnahe Naherholung. Der strukturreiche, landschaftstypische Übergang<br />
zwischen Feldflur und Siedlungsraum weist besondere ästhetische<br />
Qualitäten auf. Die Wegeverbindung im Grenzbereich von Grabeland/Gärten<br />
und Feldflur bietet aufgrund der erhöhten Lage im Gelände<br />
einen reizvollen Ausblick in die Weiten der Niederungslandschaft des<br />
Finow-Kanals. Damit wird durch das Vorhaben eine landschaftsästhetisch<br />
reizvolle Raumsituation zerstört, was als erheblicher Eingriff in Natur-<br />
und Landschaft zu werten ist.<br />
4.4.11.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 50.1, K 50.4 und K 50.5<br />
Die zusätzliche Versiegelung von 16.800 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse<br />
außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 16.800 m² versiegelten Bodens.<br />
Zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Wasser wird die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 50.1 empfohlen:<br />
„Oberflächlich anfallende Niederschläge sollen im Plangebiet<br />
durch ein Mulden-/Rigolen-System mit Anschluss an retentionsfähige<br />
Grünanlagen versickert werden. Die Maßnahme ermöglicht<br />
den weitgehenden Erhalt der Grundwasserneubildung und<br />
reduziert die über das Kanalsystem abzuführenden Wassermengen.“<br />
K 50.2<br />
Zum Schutz der angrenzenden Schilfröhrichte wird empfohlen, die Vermeidungsmaßnahme<br />
V 50.2 zu übernehmen:<br />
„Schilfröhrichte sind zu erhalten. Während der Bauphase dürfen<br />
die Schilfröhrichte nicht als Lager- oder Rangierflächen genutzt<br />
werden. Zur Vermeidung von erheblichen Störeinflüssen auf<br />
störungsempfindliche, besonders und streng geschützte Tierarten<br />
des Schilfröhrichts sollte ein mindestens 10 m breiter Grünstreifen<br />
zwischen Schilfröhricht und dem ersten Wohngrundstück<br />
vorgesehen werden. Der Grünstreifen ist als Baumhecke<br />
anzulegen. Es werden 20 Bäume der Pflanzliste 3 als zukünftige<br />
Überhälter gesetzt (s. Anhang 3). Pro m² Pflanzfläche sind<br />
zusätzlich 2 Sträucher der Pflanzliste 4 zu pflanzen (s. Anhang<br />
3). Zur Verbesserung der Strukturvielfalt der Pflanzung sind<br />
sowohl Bäume als auch Sträucher in unterschiedlichen Dichten<br />
72
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 50, „Wohnbaufläche“<br />
zu setzen, so dass vereinzelt lichtere Bereiche entstehen. Die<br />
Pflanzfläche umfasst insgesamt etwa 1.300 m² und sollte mit<br />
einem Zaun vor Vertritt und Wildverbiss in den ersten 5 Jahren<br />
geschützt werden.“<br />
K 50.3 und K 50.7<br />
Die Verluste von nach Brandenburgischer Baumschutzverordnung zu<br />
erhaltender Bäume sollte vermieden werden. Es wird empfohlen, eine<br />
Vermeidungsmaßnahme V 50.3 zu übernehmen:<br />
„Die nach Brandenburgischer Baumschutzverordnung zu erhaltenden<br />
Bäume“ sind nicht durch bauliche Anlagen in Anspruch<br />
zu nehmen. Die Bäume sind während der Bauphase vor mechanischer<br />
Beschädigung sowohl im Stammbereich als auch im<br />
Wurzelbereich zu schützen.“<br />
Sollten Verluste von nach Brandenburgischer Baumschutzverordnung<br />
zu erhaltender Bäume unvermeidbar sein, wird die Festsetzung einer<br />
Ersatzmaßnahme E 50.1 vorgeschlagen:<br />
„Für jeden gem. Brandenburgischer Baumschutzverordnung zu<br />
erhaltenden Baum, der gefällt wird, sind 4 Ersatzbäume zu<br />
pflanzen, soweit dies nicht bereits im Rahmen der Ausgleichsmaßnahme<br />
A 50.1 geschieht.“<br />
K 50.6<br />
ur Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Klima sollte innerhalb<br />
des Plangebietes die Minderungsmaßnahme A 50.1 durchgeführt werden:<br />
„Entlang der inneren Erschließungsstraßen des Wohngebietes<br />
sind beidseitig Straßenbaumpflanzungen mit Baumarten der<br />
Pflanzliste 2 vorzunehmen. Der Abstand der Baumpflanzungen<br />
beträgt in der Reihe 10-12m.“<br />
Diese Maßnahmen reduzieren die Wärmeentwicklung und Wärmespeicherung<br />
der Baukörper und tragen durch die erhöhte Evapotranspiration<br />
zu einer Verdunstungskühlung der Umgebungsluft bei.<br />
Die oben genannten Maßnahmen zur Durchgrünung des Gewerbegebietes<br />
tragen zudem dazu bei, die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes<br />
zu minimieren.<br />
K 50.8<br />
Zum Ausgleich der vollständigen Beeinträchtigung der gewachsenen<br />
Ortsrandsituation werden die Ausgleichsmaßnahmen A 50.2 und A 50.3<br />
vorgeschlagen:<br />
A 50.2:<br />
„Entlang der Wegeverbindung zwischen dem nördlichen Ende<br />
der Wohnsiedlung und dem Sondergebiet „Floßplatz“ am Finowkanal<br />
ist eine Allee mit Baumarten der Pflanzliste 2 herzustellen.<br />
Der Abstand der Bäume in der Reihe beträgt 10-12 m.“<br />
73
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 50, „Wohnbaufläche“<br />
A 50.3:<br />
„Die süd-westlich an das Projektgebiet anschließende Ackerfläche<br />
außerhalb der gemäß V18 anzulegenden Baumhecke ist<br />
als Streuobstwiese zu entwickeln. Auf der etwa 13.700 m² großen<br />
Fläche sind 400 hochstämmige Obstbäume zu pflanzen.“<br />
Pflanzqualitäten: mittlere Baumschulqualität, 2x verpflanzt, StU<br />
12-14 cm. Fertigstellungs- und Entwicklungspflegearbeiten sind<br />
nach DIN 18916 bis 18918 bzw. DIN 18919 auszuführen. Der<br />
abnahmefähige Zustand ist 5 Jahre nach der Pflanzung nachzuweisen.<br />
Die Brachflächen zwischen den Obstbäumen sind der Selbstbegrünung<br />
zu überlassen und zweimal jährlich zu mähen. Das<br />
Streugut ist abzufahren.“<br />
74
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 52, „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.12 Vorhaben 52<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
„Gemischte Baufläche“<br />
4.4.12.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.12.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am äußersten östlichen Ortsrand von<br />
Finowfurt. Die Erschließung erfolgt über die Walzwerkstraße. Das Gebiet<br />
liegt innerhalb eines von alten Abgrabungsseen bestimmten Landschaftsraums.<br />
Rund um die Seen bestimmen diverse Wochenendhaussiedlungen<br />
die Landnutzung. Westlich der geplanten gemischten Baufläche<br />
liegt ein Bauwirtschafts-Betrieb mit großflächig versiegelten Lagerflächen<br />
und großformatigem Gebäudebestand. Aufgrund der Verarbeitung<br />
und Lagerung von Kies kommt es zu Staubemissionen. Der<br />
Vorhabenraum liegt im Außenbereich.<br />
Biotoptypen Vorhaben 52 (Finowfurt)<br />
4.4.12.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Der gesamte Projektbereich ist eine ehemals intensiv genutzte Ackerbrache,<br />
auf der sich im Laufe des jahrelangen Brachestadiums ruderalisierte<br />
Staudenfluren nährstoffreicher, frischer Standorte etabliert haben<br />
(Biotoptyp 051422). Das Phytomassenaufkommen der Vegetation<br />
ist hoch. Es dominieren konkurrenzstarke und in Brandenburg häufige<br />
Arten wie Rainfarn, Gemeiner Beifuß und Schafgarbe. Die Bedeutung<br />
des Biotops für den Arten- und Biotopschutz ist gering.<br />
Südlich der Walzwerkstraße soll ein kleiner Teil einer als Garten (Biotoptyp<br />
10110) in die gemischte Baufläche einbezogen werden. Dieser<br />
Teilbereich liegt vollständig innerhalb des 50-Meter-Bereichs eines<br />
größeren Abgrabungsgewässers.<br />
Entlang der Walzwerstraße verläuft eine Allee aus nach Brandenburgischer<br />
Baumschutzverordnung zu erhaltenden Bäumen (Biotoptyp<br />
07141, ohne Darstellung in der Karte).<br />
75
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 52, „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.12.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Im bislang unbebauten Projektgebiet mit einer Ausdehnung von etwa<br />
17.300 m² ermöglicht die städtebauliche Nutzungsbestimmung „Gemischte<br />
Baufläche“ insgesamt eine Flächenversiegelung von bis zu<br />
80%. Dies entspricht einem Versiegelungspotential von 13.800 m².<br />
4.4.12.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 52.1: Als wesentliche Eingriffsursache sind die zusätzlichen baulichen<br />
Entwicklungsmöglichkeiten in einer Größenordnung von 13.800 m² zu<br />
sehen. Dies ist ein erheblicher Eingriff in die Belange des Arten- und<br />
Biotopschutzes. Da der Eingriffsraum von geringer Bedeutung für das<br />
Schutzgut ist, ist der Eingriff aber im Rahmen von Entsiegelungsmaßnahmen<br />
kurzfristig ausgleichbar.<br />
4.4.12.2.2 Schutzgut Boden, Wasser und Klima<br />
K 52.2: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 13.800 m² Boden geht<br />
einher mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 52.3: Die Versieglung von 13.800 m² Boden reduziert ohne entsprechende<br />
Vermeidungsmaßnahmen Menge und Qualität der Grundwasserneubildung.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 52.4: Die Realisierung von Baumassen in erheblichem Umfang trägt<br />
zu einer erheblichen Beeinflussung des Mikroklimas im Vorhabenraum<br />
bei. Die Baukörper speichern erhebliche Wärmemengen, die insbesondere<br />
in den Nachtstunden zu einer Erhöhung der Umgebungstemperaturen<br />
führen. Die Kaltluftentstehungsfunktion der bisherigen Staudenflur<br />
geht vollständig verloren. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff<br />
in das Schutzgut Klima. Aufgrund der klimatisch unbelasteten Situation<br />
in Finowfurt ist die Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des<br />
Naturhaushaltes durch Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet und Entsiegelungsmaßnahmen<br />
außerhalb des Plangebietes zu kompensieren.<br />
4.4.12.2.3 Landschaftsbild<br />
K 52.5: Aufgrund der erheblichen Vorschädigung des Landschaftsbildes<br />
im Raum mit einem Konglomerat von großflächigen Gewerbegebieten,<br />
erheblichen Zersiedelungsschäden infolge ungelenkter Entwicklung von<br />
Wochenendhausgrundstücken und Brachflächen stellt die Entwicklung<br />
des Gewerbegebietes einen zwar erheblichen, aber durch Ausgleichsmaßnahmen<br />
im Plangebiet kompensierbaren Eingriff in das Schutzgut<br />
Landschaftsbild dar.<br />
76
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 52, „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.12.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 52.1, K 52.2, K 52.3 und K 52.4<br />
Die zusätzliche Versiegelung von 13.800 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse<br />
außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 13.800 m² versiegelten Bodens.<br />
Zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Wasser wird die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 52.1 empfohlen:<br />
„Oberflächlich anfallende Niederschläge sollen im Plangebiet<br />
durch ein Mulden-/Rigolen-System mit Anschluss an retentionsfähige<br />
Grünanlagen versickert werden. Die Maßnahme ermöglicht<br />
den weitgehenden Erhalt der Grundwasserneubildung und<br />
reduziert die über das Kanalsystem abzuführenden Wassermengen.“<br />
K 52.4 und K 52.5<br />
Zur weiteren Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Klima und der<br />
Kompensation der Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sollte innerhalb<br />
des Plangebietes die Minderungsmaßnahme A 52.1 durchgeführt<br />
werden:<br />
„Entlang der inneren Erschließungsstraßen des Mischgebietes<br />
sind beidseitig Straßenbaumpflanzungen mit Baumarten der<br />
Pflanzliste 2 vorzunehmen. Der Abstand der Baumpflanzungen<br />
beträgt in der Reihe 10-12m.“<br />
Diese Maßnahmen reduzieren die Wärmeentwicklung und Wärmespeicherung<br />
der Baukörper und tragen durch die erhöhte Evapotranspiration<br />
zu einer Verdunstungskühlung der Umgebungsluft bei.<br />
Die oben genannten Maßnahmen zur Durchgrünung des Gewerbegebietes<br />
tragen zudem dazu bei, die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes<br />
auszugleichen.<br />
77
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 54, „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.13 Vorhaben 54<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Sondergebiet „Freizeit und Erholung“<br />
in „Gemischte Baufläche“.<br />
4.4.13.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.13.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am süd-westlichen Ortsrand von Finowfurt.<br />
Die Erschließung erfolgt über die Mühlenstraße zur Biesenthaler<br />
Straße. Der Projektraum grenzt im Westen an die Niederungslandschaft<br />
des Finow-Kanals mit Frischwiesen, Hochstaudenfluren und Erlenbruchwäldern.<br />
Nach Norden beginnt der Ortsrand von Finowfurt mit Wocheendhausgrundstücken<br />
und Einzelhausgrundstücken. Im Süden und<br />
Osten schließt sich die Dorkern- bzw. Einzelhausbebauung im Umfeld<br />
der Biesenthaler Straße an. Der Vorhabenraum liegt im Außenbereich.<br />
4.4.13.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das gesamte Projektgebiet liegt im Bereich eines ehemaligen Güterbahnhofs<br />
mit Resten von Lagerhallen und Lagerplätzen sowie Betonplattenwegen<br />
und entspricht strukturell dem Biotoptyp der Gewerbebrache<br />
(12320). Die Bodenstruktur ist nahezu flächendeckend anthropogen<br />
stark überformt, natürliche Bodenhorizonte liegen nicht vor.<br />
Stattdessen sind auch die nicht offenkundig versiegelten Flächen überwiegend<br />
Schotterflächen zurück gebauter Gleisanlagen. Auf diesen<br />
hat sich eine ruderalisierte Staudenflur nährstoffreicher, frischer<br />
Standorte etabliert haben (Biotoptyp 051422). Das Phytomassenaufkommen<br />
der Vegetation ist hoch. Es dominieren konkurrenzstarke und<br />
in Brandenburg häufige Arten wie Landreitgras, Rainfarn, Gemeiner<br />
Beifuß und Schafgarbe. Das Aufkommen einzelner Birken- und Kiefernsämlinge<br />
deutet die Richtung der Sukzession zum birkenreichen<br />
Kiefernwald an. Die Bedeutung des Biotops für den Arten- und Biotopschutz<br />
ist gering.<br />
Im Randbereich der Gewerbebrache liegen zwei kleinere Baumgruppen<br />
(Biotoptyp 07152) mit Birken- und Kiefernverjüngungen. Die<br />
Baumgruppen geben dem Gelände eine gewisse strukturelle Aufwertung,<br />
sie dienen kulturfolgenden Singvogelarten als Bruthabitate. Aufgrund<br />
der geringen Größe und der Lage innerhalb eines stark gestörten<br />
Raumes ist die Bedeutung der Baumgruppen für den Arten- und<br />
Biotopschutz reduziert und wird mit „mittel“ bewertet.<br />
Ein kleiner Bereich des Projektgebietes wird für Wochenendhausgrundstücke<br />
genutzt (Biotoptyp 102501). Bäume fehlen weitgehend,<br />
es überwiegen Ziergartennutzungen. Der Biotoptyp ist von geringer<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
78
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 54, „Gemischte Baufläche“<br />
Biotoptypen Vorhaben 54 (Finowfurt)<br />
4.4.13.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Im etwa 19.500 m² großen Projektgebiet bestehen derzeit vollversiegelte<br />
Flächen in einer Größenordnung von 5.000 m². Hinzu kommen etwa<br />
10.000 m² anthropogen stark überformter Oberbodenhorizonte. Diese<br />
werden aufgrund der eingeschränkten Bodenfunktionen als teilversiegelte<br />
Flächen mit dem Faktor 0,3 angesetzt (entspricht etwa 3.000 m² vollversiegelter<br />
Flächen). Damit ergibt sich eine rechnerische Vollversiegelung<br />
von etwa 8.000 m².<br />
Die städtebauliche Nutzungsbestimmung „Gemischte Baufläche“ ermöglicht<br />
insgesamt eine Flächenversiegelung von bis zu 80%. Dies entspricht<br />
einem Versiegelungspotential von 15.600 m². Die maximal mögliche<br />
Mehrversiegelung bei Realisierung des Vorhabens beträgt somit<br />
7.600 m².<br />
Da das Projektgebiet im geltenden Flächennutzungsplan als Sondergebiet<br />
„Freizeit und Erholung“ vorgesehen wurde, ergibt sich für die Bilanzierung<br />
der durch die Änderung des FNP vorgesehenen Änderungen<br />
der baulichen Entwicklungspotentiale ein geringerer Bauflächenzuwachs<br />
als die oben kalkulierte Mehrversiegelung. Für das Sondergebiet „Freizeit<br />
und Erholung“ ist auf Basis der Vorgaben der Baunutzungsverordnung<br />
von einer zulässigen maximale Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3<br />
auszugehen. Bei einer Grundfläche von etwa 19.500 m² bedeutet dies<br />
etwa 6.000 m² Baufläche. Damit ergibt sich ein Zuwachs zum im bestehenden<br />
Flächennutzungsplan angesetzten baulichen Entwicklungspotential<br />
von etwa 1.600 m².<br />
79
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 54, „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.13.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 54.1: Als wesentliche Eingriffsursache sind die zusätzlichen baulichen<br />
Entwicklungsmöglichkeiten in einer Größenordnung von 7.600 m² zu<br />
sehen. Dies ist ein erheblicher Eingriff in die Belange des Arten- und<br />
Biotopschutzes. Da der Eingriffsraum überwiegend von geringer Bedeutung<br />
für das Schutzgut ist, ist der Eingriff aber im Rahmen von Entsiegelungsmaßnahmen<br />
kurzfristig ausgleichbar. Der Verlust der beiden<br />
Baumgruppen des Projektgebietes als Biotopstruktur mittlerer Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz bedürfte über die Entsiegelung<br />
hinaus zusätzlicher Kompensationsmaßnahmen.<br />
4.4.13.2.2 Schutzgut Boden, Wasser und Klima<br />
K 54.2: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 7.600 m² Boden geht einher<br />
mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 54.3: Die Versieglung von 7.600 m² Boden reduziert ohne entsprechende<br />
Vermeidungsmaßnahmen Menge und Qualität der Grundwasserneubildung.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 54.4: Die Realisierung von Baumassen in erheblichem Umfang trägt<br />
zu einer erheblichen Beeinflussung des Mikroklimas im Vorhabenraum<br />
bei. Die Baukörper speichern erhebliche Wärmemengen, die insbesondere<br />
in den Nachtstunden zu einer Erhöhung der Umgebungstemperaturen<br />
führen. Die Kaltluftentstehungsfunktion der bisherigen Staudenflur<br />
geht vollständig verloren. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff<br />
in das Schutzgut Klima. Aufgrund der klimatisch unbelasteten Situation<br />
in Finowfurt ist die Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des<br />
Naturhaushaltes durch Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet und Entsiegelungsmaßnahmen<br />
außerhalb des Plangebietes zu kompensieren.<br />
4.4.13.2.3 Landschaftsbild<br />
Die Gewerbebrache stellt in ihrem gegenwärtigen Erscheinungsbild eine<br />
Belastung für das örtliche Landschaftsbild dar. Die Entwicklung einer<br />
geordneten städtebaulichen Struktur mit angemessener Durchgrünung<br />
und grünplanerische Gestaltung des Übergangs insbesondere in die<br />
westliche Niederungslandschaft ist daher nicht als erheblicher Eingriff in<br />
das Schutzgut Landschaftsbild zu bewerten.<br />
4.4.13.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 54.1<br />
Zur Minimierung von Eingriffen in die Gehölzstrukturen des Projektgebietes<br />
wird die Festsetzung der Vermeidungsmaßnahme V 54.1 empfohlen:<br />
„Die beiden Baumgruppen in den Randbereichen des Projektgebietes<br />
sind nicht durch bauliche Anlagen in Anspruch zu<br />
80
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 54, „Gemischte Baufläche“<br />
nehmen. Die Bäume sind während der Bauphase vor mechanischer<br />
Beschädigung sowohl im Stammbereich als auch im<br />
Wurzelbereich zu schützen.“<br />
K 54.1, K 54.2, K 54.3 und K 54.4<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Lebensgemeinschaften,<br />
Boden, Wasser und Klima (teilweise) durch die zusätzliche<br />
Versiegelung von 7.600 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse<br />
außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 7.600 m² versiegelten Bodens.<br />
Zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Wasser wird die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 54.2 empfohlen:<br />
„Oberflächlich anfallende Niederschläge sollen im Plangebiet<br />
versickert werden. Die Maßnahme ermöglicht den weitgehenden<br />
Erhalt der Grundwasserneubildung und reduziert die über<br />
das Kanalsystem abzuführenden Wassermengen.“<br />
K 54.4<br />
Zur weiteren Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Klima und der<br />
Aufwertung des Landschaftsbildes sollte innerhalb des Plangebietes die<br />
Minderungsmaßnahme A 54.1 durchgeführt werden:<br />
„Entlang der inneren Erschließungsstraßen des Mischgebietes<br />
sind beidseitig Straßenbaumpflanzungen mit Baumarten der<br />
Pflanzliste 2 vorzunehmen. Der Abstand der Baumpflanzungen<br />
beträgt in der Reihe 10-12 m.“<br />
Diese Maßnahmen reduzieren die Wärmeentwicklung und Wärmespeicherung<br />
der Baukörper und tragen durch die erhöhte Evapotranspiration<br />
zu einer Verdunstungskühlung der Umgebungsluft bei.<br />
Die oben genannten Maßnahmen zur Durchgrünung des Gewerbegebietes<br />
tragen zudem dazu bei, die landschaftsästhetische Situation aufzuwerten.<br />
Empfehlung<br />
Der Übergang zur freien Feldflur westlich des Projektgebietes sollte<br />
durch die Anlage eines Gehölzrandes mit Gehölzen der Pflanzlisten 3<br />
und 4 landschaftsgerecht gestaltet werden, um das Mischgebiet in seinem<br />
Erscheinungsbild aufzuwerten und das Gebiet zukünftig harmonischer<br />
in die Landschaft einzubetten.<br />
81
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 65, „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.14 Vorhaben 65<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Wald“ in „Gemischte Baufläche“.<br />
4.4.14.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.14.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am süd-westlichen Ortsrand von Finowfurt.<br />
Die Erschließung erfolgt über den Hubertusweg mit Anschluss an<br />
die Biesenthaler Straße. Der Projektraum grenzt im Westen an die Niederungslandschaft<br />
des Finow-Kanals mit Frischwiesen, Hochstaudenfluren<br />
und Erlenbruchwäldern. Nördlich liegen Wocheendhausgrundstücken<br />
und ein ehemaliger Güterbahnhof. Im Osten schließt sich die Dorkern-<br />
bzw. Einzelhausbebauung im Umfeld der Biesenthaler Straße an.<br />
Südlich liegt ein ehemaliges Kasernengelände. Der Vorhabenraum liegt<br />
im Außenbereich.<br />
4.4.14.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet ist überwiegend mit ruderalisierten Staudenfluren<br />
nährstoffreicher, frischer Standorte etabliert haben (Biotoptyp 051422).<br />
Das Phytomassenaufkommen der Vegetation ist relativ hoch. Es dominieren<br />
konkurrenzstarke und in Brandenburg häufige Arten wie<br />
Landreitgras, Rainfarn, Gemeiner Beifuß und Schafgarbe. Innerhalb<br />
der südlichen Teilfläche steht eine Überdachung zur Lagerung von<br />
Gerätschaften. Die Bedeutung des Biotops für den Arten- und Biotopschutz<br />
ist gering.<br />
Etwa ein Drittel der Fläche wird von Waldrandartigen Gehölzstrukturen<br />
eingenommen (Biotoptyp 07120), wobei die Waldinnenbereiche als<br />
naturgemäßen Komplementär des Biotoptyps fehlen. Der Waldmantel<br />
ist naturnah strukturiert und wird von standortgemäßen Baumarten<br />
aller Altersklassen aufgebaut. Esche, Stiel-Eiche, Espe, Sand-Birke<br />
und Wald-Kiefer haben in etwa gleichgroßen Anteil am Aufbau. Typische<br />
Besiedler unter den Wirbeltieren sind verschiedene Hecken- und<br />
Buschbrüter wie Gartengrasmücke, Dorngrasmücke, Goldammer u.a.<br />
Das Vorkommen von Populationen der Waldeidechse Lacerta und der<br />
Blindschleiche sowie anderer höherer Wirbeltiere ist aufgrund der geringen<br />
Größe des Biotops und der relativ isolierten Lage in Bezug auf<br />
geeignete Kontaktbiotope im Raum nicht wahrscheinlich. Zudem wirken<br />
die Störeinflüsse aus der unmittelbar angrenzenden Siedlung und<br />
der Straße intensiv und aufgrund der geringen Tiefe des Grundstücks<br />
auch flächendeckend auf das Gehölz ein. Dies schränkt auch die Rolle<br />
des Biotops für die grundsätzlich besonders artenreiche Insektenfauna<br />
der Waldränder ein. Aufgrund des natürlichen Vegetationsaufbaus ist<br />
der Waldmantel trotz der benannten Einschränkungen der faunistischen<br />
Bedeutung von hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
82
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 65, „Gemischte Baufläche“<br />
Biotoptypen Vorhaben 65 (Finowfurt)<br />
4.4.14.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Im etwa 4.500 m² großen Projektgebiet bestehen derzeit vollversiegelte<br />
Flächen in einer Größenordnung von etwa 100 m².<br />
Die städtebauliche Nutzungsbestimmung „Gemischte Baufläche“ ermöglicht<br />
insgesamt eine Flächenversiegelung von bis zu 80%. Dies entspricht<br />
einem Versiegelungspotential von 3.600 m². Die maximal mögliche<br />
Mehrversiegelung bei Realisierung des Vorhabens beträgt somit<br />
3.500 m².<br />
4.4.14.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 65.1: Die Überbauung oder sonstige Beeinträchtigung der Waldmantel-Biotope<br />
würde zu erheblichen Eingriffen in das Schutzgut Arten- und<br />
Biotopschutz führen. Potentiell betroffen sind Waldmantel-Biotope mit<br />
einer Fläche von etwa 1.600 m². Der Biotop würde bei nur teilweiser<br />
Überbauung auch im Bereich der Restflächen erheblich beeinträchtigt<br />
werden, da eine weitere Flächenreduzierung und Zerschneidung des<br />
Biotops den Waldmantel-Charakter vollends beseitigen würde und entsprechend<br />
Lebensraumfunktion für entsprechend angepasste Tierarten<br />
verlieren würde. Betroffen wäre hier v.a. die Insektenfauna, aber auch<br />
die erwähnten Brutreviere von Gebüschbrütern. Die Beeinträchtigung<br />
des Waldmantels wäre nicht im Rahmen reiner Entsiegelungsmaßnahmen<br />
an anderer Stelle zu gewährleisten.<br />
K 65.2: Als weitere Eingriffsursache ist die Überbauung von nitrophilen<br />
Staudenfluren zu betrachten. Dies ist ein erheblicher Eingriff in die Be-<br />
83
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 65, „Gemischte Baufläche“<br />
lange des Arten- und Biotopschutzes. Da die Staudenfluren von geringer<br />
Bedeutung für das Schutzgut sind, ist der Eingriff aber im Rahmen von<br />
Entsiegelungsmaßnahmen kurzfristig ausgleichbar.<br />
4.4.14.2.2 Schutzgut Boden, Wasser und Klima<br />
K 65.3: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 3.500 m² Boden geht einher<br />
mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 65.4: Die Versieglung von 3.500 m² Boden reduziert ohne entsprechende<br />
Vermeidungsmaßnahmen Menge und Qualität der Grundwasserneubildung.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.14.2.3 Landschaftsbild<br />
K 65.5: Die Waldmäntel stellen derzeit eine landschaftsästhetisch sehr<br />
ansprechende Einbindung des Ortsrandes von Finowfurt dar. Dies gilt<br />
sowohl für die Einfahrt vom Hubertusweg als auch für die Ansicht aus<br />
den Finow-Kanalwiesen. Als Störfaktor erweist sich der bestehende Unterstand<br />
für Gerätschaften. Eine vollständige Entwicklung des Projektgebietes<br />
als Mischgebiet würde die landschaftsästhetische Funktionen<br />
beseitigen und durch die zusätzlichen Baukörper weitere visuelle Störelemente<br />
verursachen.<br />
4.4.14.2.4 Schutzgut Mensch<br />
Das Vorhaben soll an einer stillgelegten Bahnlinie realisiert werden. Sollte<br />
die Bahnlinie zukünftig reaktiviert werden, ergeben sich Beeinträchtigungen<br />
der Wohn- und Aufenthaltsqualität in der geplanten gemischten<br />
Baufläche durch Lärmimmissionen. Es ist anzunehmen, dass der Bahnbetrieb<br />
nur unter immissionsschutzrechtlichen Auflagen wieder aufgenommen<br />
werden kann. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt besteht allerdings<br />
diesbezüglich kein Konflikt.<br />
4.4.14.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 65.1<br />
Zur Vermeidung von Eingriffen in die Gehölzstrukturen des Projektgebietes<br />
wird die Übernahme der Vermeidungsmaßnahme V 65.1 empfohlen:<br />
„Die vorhandenen Gehölzstrukturen des Projektgebietes sind<br />
nicht durch bauliche Anlagen in Anspruch zu nehmen. Aufgrund<br />
des engen funktionalen Zusammenhangs zwischen Waldmantel<br />
und angrenzenden Staudenfluren ist zwischen den Waldmänteln<br />
und dem Beginn der eigentlichen Mischgebietsnutzung ein<br />
84
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 65, „Gemischte Baufläche“<br />
Grünstreifen als Pufferbiotop freizuhalten. Gehölze sind während<br />
der Bauphase vor mechanischer Beschädigung sowohl im<br />
Stammbereich als auch im Wurzelbereich zu schützen.“<br />
K 65.2, K 65.3 und K 65.4<br />
Bei Umsetzung der Vermeidungsmaßnahem V 65.1 reduziert sich die<br />
realisierbare Überbauung auf eine Grundfläche von etwa 1.700 m². Die<br />
daher im Mischgebiet zu erzielende Gesamtversiegelung beträgt somit<br />
nur noch 1.360 m² was unter Berücksichtigung der bestehenden<br />
Überbauung zu gerundet 1.300 m² Mehrversiegelung führen könnte.<br />
Diese zusätzliche Versiegelung von 1.300 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse<br />
außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 1.300 m² versiegelten Bodens.<br />
Zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Wasser wird die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 65.2 empfohlen:<br />
„Oberflächlich anfallende Niederschläge sollen im Plangebiet<br />
versickert werden. Die Maßnahme ermöglicht den weitgehenden<br />
Erhalt der Grundwasserneubildung und reduziert die über<br />
das Kanalsystem abzuführenden Wassermengen.“<br />
K 65.5<br />
Die Vermeidungsmaßnahme V 65.1 trägt wesentlich zur Reduzierung<br />
der Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild bei. Zur Kompensation<br />
der visuellen Eingriffe in Folge der Errichtung weiterer baulicher Anlagen<br />
wird die Festsetzung der Ausgleichsmaßnahme A 65.1 vorgeschlagen:<br />
„Der Übergang zur freien Feldflur entlang der nördlichen Grenze<br />
des Projektgebietes wird durch die Anlage eines mindestens<br />
2 m breiten Gehölzrandes landschaftsgerecht gestaltet. Auf den<br />
insgesamt etwa 100 laufenden Metern Gehölzrand sind 15<br />
Bäume der Pflanzliste 3 und pro m² Pflanzfläche 2 Sträucher<br />
der Pflanzliste 4 zu pflanzen.“<br />
85
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 68, Sondergebiet „Erlebnispark“<br />
4.4.15 Vorhaben 68<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Flugbetriebsfläche + „Wald“ in<br />
Sondergebiet „Erlebnispark“. Ziel ist die Konversion eines Teils der ehemaligen<br />
Betriebsflächen des Flugplatzes Eberswalde-Finow. Geplant<br />
ist die Sicherung und Entwicklung einer Ausstellungsfläche für Fluggeräte.<br />
4.4.15.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.14.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am südlichen Ortsrand von Finowfurt<br />
unmittelbar nördlich des Flugplatzes Eberswalde-Finow. Das Gelände<br />
wird über eine Erschließungsstraße an die Biesenthaler Straße angebunden.<br />
Nach Westen und Nordwesten schließt sich der Ortsrand von Finowfurt<br />
entlang der Biesenthaler Straße an. Im Osten beginnt eine relativ kleinteilige<br />
Agrarlandschaft mit kleineren Forstflächen. Im Süden liegt unmittelbar<br />
die Betriebsfläche des Flugplatzes Eberswalde-Finow.<br />
4.4.15.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Es handelt sich um eine ehemalige Hangar-Anlage, die als Ausstellungsfläche<br />
für Luftfahrzeuge genutzt wird. Das Gelände wird bestimmt<br />
durch die erdgedeckten, bunkeränlichen Hangar, die sich bis zu 15 m<br />
über die Geländeoberfläche erheben. Die Mehrzahl der Hangar sind<br />
mit Bäumen bestanden, teilweise aber auch lediglich mit ruderalen<br />
Staudenfluren trockenwarmer Standorte (Biotoptyp 051432). Diese<br />
Staudenfluren bedecken etwa 2/3 der Geländeflächen. Es handelt sich<br />
um einen in Brandenburg häufigen Biotoptyp mit geringer Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz, zumal der intensive Ausstellungsbetrieb<br />
mit den damit verbundenen Störeinwirkungen verhindert, dass<br />
sich anspruchsvollere Offenlandarten ansiedeln.<br />
Die Randbereiche werden von älteren Kiefern-Forsten eingenommen,<br />
die dadurch das Gelände unauffällig in die umgebende Landschaft<br />
einbinden. Die Kiefern-Forste weisen einen verhältnismäßig dichten<br />
Kronenschluss auf, so dass die Strauch- und Krautschicht überwiegend<br />
spärlich entwickelt ist. Bei den von der Kiefer bestimmten Waldflächen<br />
auf den Hangar dürfte es sich um spontane, natürliche Gehölzansiedlungen<br />
handeln, die daher in der Zusammensetzung und<br />
Aufbau der Bestandsschichten einen für trockenwarme Wälder typischen<br />
Strukturreichtum aufweisen. Das auf die Hangar aufgebrachte<br />
Erdsubstrat ist allerdings nährstoffreich, so dass in der Krautschicht<br />
konkurrenzstarke, teilweise ruderale Arten dominieren. An sickerfeuchten<br />
Stellen der Schattenseiten der Hangar finden sich kleinflächig auch<br />
Schilfröhrichte und von Farnen bestimmte Pflanzengesellschaften.<br />
Neben der Kiefer spielen Sand-Birke, Stiel-Eiche und Espe eine gewisse<br />
Rolle im Bestandsaufbau. In der Strauchschicht erreicht die<br />
Späte Traubenkirsche neben dem Jungwuchs der zuvor genannten<br />
Baumarten hohe Deckungsgrade. Die strukturreichen Gehölzdecken<br />
der Hangars spielen sicherlich eine hohe Bedeutung für die Insekten-<br />
und Spinnenfauna sowie als Nahrungs- und Bruthabitat für störungstolerante,<br />
gebüschbrütende Singvögel. Das Vorkommen von Waldeidechse<br />
(Lacerta vivipara, RL 2; BArtSchV) und Blindschleiche Anguis<br />
86
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 68, Sondergebiet „Erlebnispark“<br />
fragilis (BArtSchV) ist wahrscheinlich. Den Gehölzdecken der Hangar<br />
wird daher trotz der intensiven Störeinflüsse aus dem Museumsbetrieb<br />
eine hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz beigemessen,<br />
während die eigentlichen Kiefernforste lediglich eine mittlere Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz haben.<br />
Biotoptypen Vorhaben 68 (Finowfurt)<br />
4.4.15.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Derzeit weist das Projektgebiet einschließlich der erdbedeckten Hangar<br />
versiegelte Flächen in einer Größenordnung von etwa 40.000 m² auf.<br />
Das projektierte Sondergebiet hat eine Fläche von etwa 7,8 ha. Unter<br />
Annahme einer zulässigen baulichen Gesamt-Verdichtung im Rahmen<br />
der städtebaulichen Nutzungskategorie „Sondergebiet Erlebnispark“ von<br />
0,6 einschließlich Überschreitungs-GRZ von 50% ergäbe sich eine maximale<br />
Versiegelung von etwa 46.800 m². Dies entspricht einer Mehrversiegelung<br />
von etwa 6.800 m².<br />
4.4.15.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 68.1: Die Überbauung oder sonstige Beeinträchtigung der Forstflächen<br />
und insbesondere der Gehölzdecken der Hangar-Biotope würde zu<br />
erheblichen Eingriffen in das Schutzgut Arten- und Biotopschutz führen.<br />
Die Beeinträchtigung dieser Biotope wäre nicht im Rahmen reiner Entsiegelungsmaßnahmen<br />
an anderer Stelle zu gewährleisten, sondern<br />
erforderte zusätzliche Biotopentwicklungsmaßnahmen.<br />
87
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 68, Sondergebiet „Erlebnispark“<br />
K 68.2: Als weitere Eingriffsursache ist die Überbauung von ruderalen<br />
Staudenfluren zu betrachten. Dies ist ein erheblicher Eingriff in die Belange<br />
des Arten- und Biotopschutzes. Da die Staudenfluren von geringer<br />
Bedeutung für das Schutzgut sind, ist der Eingriff aber im Rahmen von<br />
Entsiegelungsmaßnahmen kurzfristig ausgleichbar.<br />
4.4.15.2.2 Schutzgut Boden, Wasser und Klima<br />
K 68.3: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 6.800 m² Boden geht einher<br />
mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 68.4: Die Versieglung von 6.800 m² Boden reduziert ohne entsprechende<br />
Vermeidungsmaßnahmen Menge und Qualität der Grundwasserneubildung.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Mit der Realisierung von Baumassen in erheblichem Umfang ist nicht zu<br />
rechnen. Eine erhebliche Beeinflussung des Mikroklimas im Vorhabenraum<br />
ist nicht zu besorgen.<br />
4.4.15.2.3 Landschaftsbild<br />
K 68.5: Der Verlust von Kiefernforsten und Gehölzdecken der Hangar<br />
wäre eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes, da die<br />
Gehölzflächen eine wichtige Funktion bei der Einbettung der dem Landschaftsbild<br />
abträglichen Ausstellungsbereiche einnehmen. Aufgrund der<br />
erheblichen Vorschädigung des Landschaftsbildes im Raum mit einem<br />
Konglomerat von großflächigen Gewerbegebieten, Siedlungssplittern<br />
und Flugplatz-Infrastruktur stellt die bauliche Weiter-Entwicklung des<br />
Erlebnisparks außerhalb der Forstflächen keinen Eingriff in das Schutzgut<br />
Landschaftsbild dar.<br />
4.4.15.2.4 Schutzgut Mensch<br />
K 68.6: Die den Erlebnispark umgebenden Forstflächen wirken als<br />
Lärmschutzwald für die Wohngrundstücke entlang der Biesenthaler<br />
Straße vor den Lärmimmissionen des Flugplatzes Eberswalde-Finow.<br />
Eine auch nur teilweise Beseitigung der Forstflächen wäre als erhebliche<br />
Beeinträchtigung der Wohnqualität am Ortsrand von Finowfurt zu werten.<br />
4.4.15.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 68.1 und K 68.5<br />
Die Beeinträchtigung der Forstflächen, Gehölzdecken der Hangars und<br />
sonstigen Gehölzstrukturen ist zu vermeiden. Es wird daher die Übernahme<br />
der Vermeidungsmaßnahme V 68.1 empfohlen:<br />
„Die vorhandenen Forste und sonstigen Gehölzstrukturen im<br />
sind nicht durch bauliche Anlagen in Anspruch zu nehmen oder<br />
durch sonstige Nutzungsintensivierungen zu beeinträchtigen.“<br />
88
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 68, Sondergebiet „Erlebnispark“<br />
K 68.2, K 68.3, K 68.4<br />
Die zusätzliche Versiegelung von 6.800 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse<br />
außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 6.800 m² versiegelten Bodens.<br />
Zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Wasser wird die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 68.2 empfohlen:<br />
„Oberflächlich anfallende Niederschläge sollen im Plangebiet<br />
versickert werden. Die Maßnahme ermöglicht den weitgehenden<br />
Erhalt der Grundwasserneubildung.“<br />
89
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 92, Sondergebiet „Freizeit und Erholung“<br />
4.4.16 Vorhaben 92<br />
Eichhorst: Darstellung eines Sondergebiets „Freizeit und Erholung“ an<br />
Stelle von „Wald“ und „Flächen für die Landwirtschaft“.<br />
Die bestehenden Gebäude genießen unabhängig von der Änderung der<br />
Flächendarstellung des FNP Bestandsschutz.<br />
4.4.16.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.16.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich etwa 2,5 km südlich von Eichhorst am<br />
Moospfuhl. Das Gelände wird über einen Feldweg zur L 220 erschlossen.<br />
Der Moospfuhl mit seinen umgebenden Erlenbruchwäldern grenzt<br />
unmittelbar nördlich an das Projektgebiet. Nach Norden, Westen und<br />
Süden schließen sich Kiefernforsten an.<br />
Das Projektgebiet liegt innerhalb der Schutzzone III des Biosphärenreservats<br />
<strong>Schorfheide</strong>-Chorin.<br />
4.4.16.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet entwickelt sich in einem relativ schmalen Streifen entlang<br />
eines Betonplattenweges. Dieser verläuft zwischen einer mit Kiefern-<br />
und teilweise Laubholzforsten bewaldeten Binnendüne als markanter<br />
Geländeerhebung und der Muldenlage des Moospfuhls. Das Gelände<br />
wird überwiegend als Gewerbebrache (12320 „Industrie- und Gewerbebrachen“)<br />
mit relativ großen Einzelgebäuden genutzt. Die nicht versiegelten<br />
Bereiche werden kleinflächig von ruderalen Staudenfluren eingenommen.<br />
Entlang des Weges steht eine lückige Reihe erhaltenswerter<br />
Apfelbäume. Das Gelände ist mit Ausnahme kulturfolgender Singvogelarten<br />
für den Arten- und Biotopschutz von geringer Bedeutung.<br />
Teile des Projektgebietes umfassen Erlenbruchwaldflächen als Klimaxstadium<br />
der fortgeschrittenen Verlandung des Moospfuhls. Aufgrund<br />
der offensichtlich starken Wasserstandsschwankungen fehlte im September<br />
2006 eine krautige Bodenflora weitgehend. Erlenbruchwälder<br />
unterliegen dem Schutz des § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz.<br />
Sie sind von sehr hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Sie bieten wichtige Lebensräume für diverse Amphibienarten<br />
und der Ringelnatter. Ferner sind die biotopkennzeichnenden Rötelmaus,<br />
Waldspitzmaus, Gelbhalsmaus und Weidenmeise zu erwarten.<br />
Des Weiteren liegen Teile des Projektgebietes im Bereich der Kiefern-<br />
und Laubholzforsten im Hangbereich der Binnendüne. Diese sind aufgrund<br />
der ausgeprägten Geländemorphologie und des relativ alten,<br />
strukturreichen Baumbestandes von hoher Bedeutung für den Arten-<br />
und Biotopschutz. Durch die Hanglage und die damit verbundene geringere<br />
Überdeckung der Baumkronen ist eine teilweise artenreiche Kraut-<br />
und Moosschicht ausgebildet. Unter faunistischen Gesichtspunkten ist<br />
u.a. mit dem Vorkommen von Sommerquartieren verschiedener Fledermausarten<br />
zu rechnen, die die Wasserflächen des Moospfuhls als Jagdrevier<br />
nutzen. Zudem bieten die Baumbestände einer waldtypischen<br />
Vogelzönose u.a. mit Baumläufer, verschiedenen Spechten, Kleiber,<br />
Meisen, Waldlaubsänger, Rotkehlchen und Mönchsgrasmücke Lebensräume.<br />
Funktional spielen die Forstflächen außerdem eine wichtige Rol-<br />
90
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 92, Sondergebiet „Freizeit und Erholung“<br />
le als Pufferzonen für die geschützten Bereiche der Moospfuhlsenke vor<br />
den Einwirkungen der angrenzenden Ackerflächen.<br />
Biotoptypen Vorhaben 92 (Eichhorst)<br />
4.4.16.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet umfasst eine Fläche von etwa 16.700 m². Die geplante<br />
Sondergebietsfläche umfasst 11,600 m². Davon sind aktuell etwa<br />
3.400 m² mit Gebäuden, Betonplattenwegen und Hofflächen versiegelt.<br />
Dies entspricht einem Flächenanteil von 30%. Unter Annahme einer für<br />
den Gebietstyp „Sondergebiet Freizeit und Erholung“ üblichen GRZ von<br />
0,2 und einer Überschreitungs-GRZ von 50% entstehen somit keine<br />
weiteren baulichen Verdichtungsmöglichkeiten.<br />
91
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 92, Sondergebiet „Freizeit und Erholung“<br />
4.4.3.16.2 Arten- und Biotopschutz<br />
K 92.1: Das Projektgebiet umfasst nach § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz<br />
geschützte Erlenbruchwälder. Eine Beeinträchtigung dieser<br />
Flächen wäre mit erheblichen, nachhaltigen und vermeidbaren Eingriffen<br />
in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes verbunden. Die<br />
Untere Naturschutzbehörde kann Ausnahmen von den Verboten des §<br />
32 erteilen, wenn die Eingriffe ausgeglichen werden können. Dies ist im<br />
näheren Umfeld des Projektgebietes nicht möglich. Zwingende Gründe<br />
des Allgemeinwohls, die eine Befreiung von den Verboten des § 32<br />
ermöglichen würden, können an dieser Stelle nicht beurteilt werden.<br />
Auch die Erweiterung baulicher Anlagen in die Kiefer- und Laubholzforste<br />
wäre mit erheblichen und nachhaltigen Eingriffen verbunden.<br />
K 92.2: Der nördliche Bereich des Projektgebietes liegt innerhalb des<br />
50-m-Bereichs der Uferlinie des Moospfuhls. Aufgrund der Flächenausdehnung<br />
des Moospfuhls von etwa 1,5 ha greifen somit die Verbote des<br />
§ 48 Brandenburgisches Naturschutzgesetz für diese Abschnitte. Die<br />
Untere Naturschutzbehörde kann eine Ausnahme von diesen Verboten<br />
erteilen, wenn die Eingriffe unbedeutend oder aus überwiegenden<br />
Gründen des Allgemeinwohls notwendig sind. Die Errichtung baulicher<br />
Anlagen im 50-Meter-Bereich hätte erhebliche und nachhaltige negative<br />
Auswirkungen für den Arten- und Biotopschutz (Beeinträchtigung von<br />
Erlenbruchwäldern). Das Vorliegen überwiegender Gründe des Allgemeinwohls<br />
kann an dieser Stelle nicht beurteilt werden.<br />
K 92.3: Der Moospfuhl liegt innerhalb eines als ökologisch wirksamen<br />
Freiraumverbundsystems eingestuften Großraumes. Der Moospfuhl mit<br />
seinen umgebenden, naturnahen Waldstrukturen hat als Trittsteinbiotop<br />
mit vergleichsweise großer räumlicher Ausdehnung besondere Funktionen<br />
für den Biotopverbund. Eine deutliche Ausweitung der Freizeit- und<br />
Erholungsnutzung in Verbindung mit zusätzlichem motorisiertem Individualverkehr<br />
würde zu einer deutlichen Reduzierung der Biotopverbindungsfunktionen<br />
führen.<br />
4.4.16.2.3 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
Da keine baulichen Entwicklungsmöglichkeiten entstehen, sind keine<br />
erheblichen und nachhaltigen Eingriffe in die Schutzgüter Boden Wasser<br />
und Klima zu erwarten.<br />
4.4.16.2.4 Schutzgebiete<br />
K 92.4: Das Projektgebiet liegt innerhalb der Schutzzone III des Biosphärenreservates<br />
<strong>Schorfheide</strong> Chorin (Zone der wirtschaftlich genutzten<br />
harmonischen Kulturlandschaft). Die Schutzzone III ist als Landschaftsschutzgebiet<br />
rechtlich gesichert. Das Vorhaben widerspricht den<br />
Zielen des Landschaftsrahmenplans des Biosphärenreservates für den<br />
Projektraum. Die Anlage soll zurück gebaut werden und der Moorstatus<br />
des Moospfuhls gesichert werden, indem nutzungsfreie Pufferzonen im<br />
Umfeld des Moospfuhls anthropogene Störungen und Stoffeinträge<br />
(Euthrophierung) erhalten bzw. geschaffen werden. Ziel ist die rechtliche<br />
Sicherung als Schutzgebiet.<br />
92
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 92, Sondergebiet „Freizeit und Erholung“<br />
Sollte die Errichtung zusätzlicher Gebäude vorgesehen sein, kollidiert<br />
das Vorhaben mit dem Schutzzweck des Biosphärenreservates gem. §<br />
4 Absatz 2 und 3 (Landschaftsbild und Naherholung) sowie Verboten<br />
des § 6 Abs. 1 der Schutzgebietsverordnung (MUNRE 1990):<br />
• bauliche Anlagen außerhalb der im Zusammenhang bebauten<br />
Ortsteile oder des Geltungsbereiches rechtskräftiger Bebauungspläne<br />
zu errichten oder zu erweitern.<br />
4.4.16.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 92.1 / K 92.2 / K 92.3<br />
Aufgrund der genannten zwingenden naturschutzrechtlichen Schutzbestimmungen,<br />
die im Projektgebiet einschlägig sind, wird daher empfohlen,<br />
die Vermeidungsmaßnahme V 92.1 zu übernehmen:<br />
„Erlenbruchwälder, Kiefern- und Laubholzforste sowie der 50-<br />
Meter-Bereich der Uferlinie des Moospfuhls sind nicht durch<br />
bauliche Anlagen oder sonstige Nutzungen des Sondergebietes<br />
„Freizeit und Erholung“ in Anspruch zu nehmen. Die bauliche<br />
Entwicklung des Vorhabens soll sich auf die vorhandenen Bestandsgebäude<br />
im Osten des Plangebietes beschränken. Die<br />
bestehenden Baracken im westlichen Abschnitt des Projektgebietes<br />
sollen zurück gebaut werden.“<br />
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 92.1 können die<br />
Konflikte K 92.1 / K 92.2 / K 92.3 auf ein unerhebliches Maß gemindert<br />
werden.<br />
K 92.7<br />
Die Aufsichtsbehörde der Biosphärenreservatsverwaltung kann von den<br />
oben genannten Verboten Befreiungen nach § 8 der Schutzgebietsverordnung<br />
erteilen, u.a.<br />
• wenn die Durchführung der Vorschrift zu einer nicht beabsichtigten<br />
Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen<br />
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist<br />
oder<br />
• überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Befreiung erfordern.<br />
Alternativ kann die Durchführung eines verbindlichen Bauleitplanverfahrens<br />
den Konflikt formal auflösen. Im Rahmen des B-Planverfahrens<br />
wären auch die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen zu ermitteln,<br />
wenn die <strong>Gemeinde</strong> die Vermeidungsmaßnahme V 92.1 nicht verfolgen<br />
will und eine wesentliche Erweiterung der Erholungsinfrastruktur angestrebt<br />
wird. Die Kompensation sollte in diesem Fall insbesondere auf die<br />
Sicherung und Entwicklung des hydrologischen Einzugsgebietes des<br />
Moospfuhls (Minimierung von Eutrophierungsprozessen) und der Sicherung<br />
und Entwicklung störungsarmer Räume für störungsanfällige Tierarten<br />
abzielen.<br />
93
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 105, „Wohnbaufläche“<br />
4.4.17 Vorhaben 105<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Grünfläche „Sportplatz“ und „Grabeland“<br />
in „Wohnbaufläche“.<br />
4.4.17.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.17.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Finowfurt.<br />
Das Projektgebiet wird über die Spechthausener Straße erschlossen.<br />
Westlich schließt sich die Ortskernbebauung von Finowfurt an. Im Norden<br />
und Nord-Osten die großflächige Gewerbeflächen. Nach Süden<br />
folgt die Straßenrandbebauung der Spechthausener Straße.<br />
4.4.17.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Die Hauptnutzung des Geländes stellt die Sportplatzfläche dar, die fast<br />
vollständig von einer Sportrasenfläche eingenommen wird (Biotoptyp<br />
10171). Die Intensivrasenfläche ist von sehr geringer Bedeutung für den<br />
Arten- und Biotopschutz.<br />
Der Sportplatz wird allseitig von Baumgruppen aus Wald-Kiefer und<br />
Sand-Birke eingefasst (Biotoptyp 07153). Während die nördlichen Gehölze<br />
vermutlich Reste eines ehemals großflächigeren Kiefern-Forstes<br />
sind, ist die Baumgruppe entlang der Süd-Grenze des Sportplatzgeländes<br />
aus der freien Sukzession hervorgegangen. Diese Baumgruppe<br />
zeichnet sich entsprechend durch eine stärkere Mischung der Altersklassen<br />
und der ausgeprägteren Strukturierung der Baum- und Strauchschicht<br />
aus. Aufgrund der erheblichen Störeinflüsse, die sich aus der<br />
geringen Breite der Baumgruppen bei gleichzeitiger Lage innerhalb des<br />
besiedelten Bereichs ergeben, bleiben die Biotoppotentiale auf wenige<br />
störungstolerante Singvogelarten beschränkt. Das Biotoppotential insbesondere<br />
der im Bereich der aus natürlicher Sukzession hervorgegangenen<br />
Gehölzstruktur für die Insekten- und Spinnenfauna wird erheblich<br />
durch die geringe Flächengröße und die fehlenden Kontaktbiotope reduziert.<br />
Insgesamt wird dem Biotoptyp im Projektgebiet eine mittlere Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz beigemessen.<br />
Südlich des Sportplatzes liegt ein ungenutztes Grundstück, auf dem sich<br />
eine ruderalisierte Staudenflur nährstoffreicher, frischer Standorte eingestellt<br />
hat (Biotoptyp 051422). Das Landreitgras erreicht einen Deckungsgrad<br />
von etwa 80%. Vereinzelt hat sich Kiefern- und Birkenjungwuchs<br />
etablieren können. Die Entwicklung zum Kiefern-Vorwald ist damit<br />
vorgezeichnet. Aufgrund der geringen Flächenausdehnung und der<br />
intensiven Störeinflüsse hat die Fläche für Offenlandarten keine Habitateignung.<br />
Auch unter floristischen Gesichtspunkten handelt es sich um<br />
ein in Brandenburg häufigen Biotop mit geringer Bedeutung für den Arten-<br />
und Biotopschutz.<br />
Südlich des brachliegenden Grundstücks schließen die rückwärtigen<br />
Gärten (Biotoptyp 10111) der Einzelhausbebauung entlang der<br />
Spechthausener Straße an. Diese sind mit kleineren Gartenhäusern<br />
ausgestattet und weisen eine gewisse Grünstruktur durch Obstgehölze<br />
und einzelne größere Sand-Birken auf. Die Gärten werden überwiegend<br />
94
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 105, „Wohnbaufläche“<br />
als Nutzgärten unterhalten. Die Bedeutung für den Arten und Biotopschutz<br />
ist gering.<br />
Biotoptypen Vorhaben 105 (Finowfurt)<br />
4.4.17.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 30.000 m². Die derzeit<br />
versiegelten Flächen machen etwa 1.000 m² aus.<br />
Unter Annahme einer für Wohnbauflächen gemäß Baunutzungsverordnung<br />
möglichen Versiegelungsgrades von 60% (einschl. Verkehrswegen)<br />
wäre die bauliche Inanspruchnahme von etwa 18.000 m² eröffnet.<br />
Abzüglich des aktuellen Bestands versiegelter Flächen von ca. 1.000 m²<br />
wäre mit einer Mehrversiegelung von 17.000 m² zu rechnen.<br />
4.4.17.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 105.1: Der Verlust der Gehölzstrukturen und hier insbesondere die<br />
Baumgruppen aus Kiefer und Birke wären ein erheblicher Eingriffe in die<br />
Belange des Arten- und Biotopschutz.<br />
K 105.2: Die Versiegelung von 17.000 m² Boden reduziert die zur Verfügung<br />
stehenden Lebensräume mit geringer Bedeutung für den Arten-<br />
und Biotopschutz. Dieser Eingriff ist dennoch erheblich und nachhaltig<br />
und muss kompensiert werden.<br />
95
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 105, „Wohnbaufläche“<br />
4.4.17.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 105.3: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 17.000 m² Boden geht<br />
einher mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 105.4: Die Versieglung von 17.000 m² Boden reduziert Menge und<br />
Qualität der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 105.5: Die Realisierung von Baumassen in erheblichem Umfang trägt<br />
zu einer erheblichen Beeinflussung des Mikroklimas im Vorhabenraum<br />
bei. Die Baukörper speichern erhebliche Wärmemengen, die insbesondere<br />
in den Nachtstunden zu einer Erhöhung der Umgebungstemperaturen<br />
führen. Die Kaltluftentstehungsfunktion der bisherigen Freiflächen<br />
geht vollständig verloren. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff<br />
in das Schutzgut Klima. Aufgrund der klimatisch unbelasteten Situation<br />
in Finowfurt ist die Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des<br />
Naturhaushaltes durch Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet und Entsiegelungsmaßnahmen<br />
außerhalb des Plangebietes zu kompensieren.<br />
4.4.17.2.3 Landschaftsbild<br />
K 105.6: Der Verlust der Gehölzstrukturen im Projektgebiet durch Überbauung<br />
würde eine erhebliche Beeinträchtigung der landschaftsästhetischen<br />
Qualitäten darstellen, die als erheblicher Eingriff bewertet werden<br />
müssten.<br />
Die Errichtung der baulichen Anlagen selbst stellt keinen Eingriff in das<br />
örtliche Landschaftsbild dar, weil die aktuelle Nutzungssituation keine<br />
eigenständigen visuellen Qualitäten zu entfalten vermag. Die Nutzung<br />
als Wohngebiet ist dem Raum ästhetisch und funktional angemessen.<br />
4.4.17.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 105.1 und K 105.6<br />
Die Verluste von Gehölzstrukturen im Zuge der Vorhabenrealisierung<br />
dürften vermeidbar sein. Es wird daher empfohlen, eine Vermeidungsmaßnahme<br />
V 105.1 festzusetzen:<br />
„Die Gehölzstrukturen sind nicht durch bauliche Anlagen in Anspruch<br />
zu nehmen. Die Bäume sind während der Bauphase vor<br />
mechanischer Beschädigung sowohl im Stammbereich als auch<br />
im Wurzelbereich zu schützen.“<br />
K 105.2, K 105.1, K 105.3 und K 105.4<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope,<br />
Boden und Wasser sowie teilweise des Schutzgutes Klima ist durch die<br />
zusätzliche Versiegelung von 17.000 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse<br />
außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 17.000 m² versiegelten Bodens.<br />
96
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 105, „Wohnbaufläche“<br />
K 105.5<br />
Zur Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Klima sollte innerhalb<br />
des Plangebietes die Minderungsmaßnahme A 105.1 durchgeführt werden:<br />
„Entlang der inneren Erschließungsstraßen des Wohngebietes<br />
sind beidseitig Straßenbaumpflanzungen mit Baumarten der<br />
Pflanzliste 2 vorzunehmen. Der Abstand der Baumpflanzungen<br />
beträgt in der Reihe 10-12 m.“<br />
Diese Maßnahmen reduzieren die Wärmeentwicklung und Wärmespeicherung<br />
der Baukörper und tragen durch die erhöhte Evapotranspiration<br />
zu einer Verdunstungskühlung der Umgebungsluft bei.<br />
Die oben genannten Maßnahmen zur Durchgrünung des Gewerbegebietes<br />
tragen zudem dazu bei, die landschaftsästhetische Situation aufzuwerten.<br />
97
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 112, „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.18 Vorhaben 112<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in „Gemischte Baufläche“.<br />
4.4.18.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.18.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand von Finowfurt.<br />
Das Projektgebiet wird über die Werbelliner Straße erschlossen.<br />
Westlich liegt ein kleiner Kiefernforst, nach Süden schließen trockene<br />
Grünlandbrachen mit teilweise Sandtrockenrasen-Qualitäten und lichten<br />
Kiefern-Vorwäldern an. Östlich grenzt die Straßenrandbebauung der<br />
Werbelliner Straße. Nördlich liegt in unmittelbarer Nachbarschaft ein<br />
Tiermastbetrieb der industriellen Landwirtschaft.<br />
4.4.18.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet ist überwiegend eine lockere Einzelhausbebauungen<br />
mit Ziergartennutzung. Aus den angrenzenden Siedlungsbereichen wirken<br />
intensive anthropogene Störfaktoren auf das Projektgebiet ein. Die<br />
Bedeutung für den Arten und Biotopschutz wird daher insgesamt als<br />
gering erachtet.<br />
Westlich des Feldweges haben sich im nördlichen Drittel kleinflächig<br />
Sandtrockenrasen (Biotoptyp 05121) mit zwei kleineren Eichengebüschen<br />
etabliert. Sandtrockenrasen unterliegen dem Schutz des § 32<br />
Brandenburgisches Naturschutzgesetz. Sandtrockenrasen und auch die<br />
südlich des Projektgebietes angrenzenden trockenwarmen Kiefern-<br />
Vorwälder sind Lebensraum für eine Vielzahl von geschützten Tierarten.<br />
Im Projektgebiet ist das Habitatpotential aufgrund der unmittelbaren Nähe<br />
zum Siedlungsgebiet begrenzt. Dennoch ist u.a. Vorkommen u.a. der<br />
Zauneidechse (Lacerta agilis, RL 3; FFH IV), der Waldeidechse Lacerta<br />
vivipara (RL 2; BArtSchV) und der Blindschleiche Anguis fragilis<br />
(BArtSchV) sehr wahrscheinlich. Die Insektenfauna der beiden Biotoptypen<br />
ist generell artenreich und beherbergt i.d.R. eine Reihe geschützter<br />
Arten. Die Bedeutung des Sandtrockenrasens und des Kiefern-<br />
Vorwaldes für den Arten- und Biotopschutz ist entsprechend hoch.<br />
4.4.18.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das bebaubare Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 10.000 m².<br />
Die derzeit versiegelten Flächen machen etwa 2.000 m² aus.<br />
Unter Annahme einer für gemischte Bauflächen gemäß Baunutzungsverordnung<br />
möglichen GRZ von 0,6 und einer Überschreitungs-GRZ von<br />
0,2 wäre die bauliche Inanspruchnahme von etwa 8.000 m² eröffnet.<br />
Abzüglich des aktuellen Bestands versiegelter Flächen von ca. 2.000 m²<br />
wäre mit einer Mehrversiegelung von bis zu 6.000 m² zu rechnen.<br />
98
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 112, „Gemischte Baufläche“<br />
Biotoptypen Vorhaben 112 (Finowfurt)<br />
4.4.18.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 112.1: Die maximale zusätzliche Versiegelung von 6.000 m² Boden<br />
reduziert die zur Verfügung stehenden Lebensräume mit geringer Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz. Dieser Eingriff ist dennoch<br />
erheblich und nachhaltig und muss kompensiert werden.<br />
K 112.2: Die Überbauung oder Umwandlung von geschützten Sandtrockenrasen<br />
führt zu erheblichen Eingriffen in das Schutzgut. Die Untere<br />
Naturschutzbehörde kann Ausnahmen von den Verboten des § 32<br />
Brandenburgisches Naturschutzgesetz erteilen.<br />
4.4.18.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 112.3: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 6.000 m² Boden geht<br />
einher mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K112.4: Die Versieglung von 6.000 m² Boden reduziert Menge und Qualität<br />
der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
99
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 112, „Gemischte Baufläche“<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.18.2.3 Landschaftsbild<br />
Die Errichtung der baulichen Anlagen stellt keinen Eingriff in das örtliche<br />
Landschaftsbild dar, weil die aktuelle Nutzungssituation keine eigenständigen<br />
visuellen Qualitäten zu entfalten vermag. Die Nutzung als<br />
Wohngebiet ist dem Raum ästhetisch und funktional angemessen.<br />
4.4.18.2.3 Schutzgut Mensch<br />
Durch die unmittelbare Lage des Vorhabens an einem Tiermastbetrieb<br />
der industriellen Landwirtschaft sind erhebliche Geruchsbelästigungen<br />
im Projektgebiet zu erwarten. Das Nebeneinander der beiden Nutzungen<br />
ist unverträglich. Eine Minderung der Beeinträchtigungen ist nicht<br />
möglich, eine Kompensation nicht erforderlich, weil die Ursache des<br />
Konflikts unabhängig vom Vorhaben besteht.<br />
4.4.18.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 112.2<br />
Vor dem Hintergrund der geringen Eignung des Projektgebietes zu<br />
Wohnzwecken aufgrund der Emissionsproblematik und der sehr hohen<br />
Bedeutung der Sandtrockenrasen sollte die Vermeidungsmaßnahme V<br />
112.1 übernommen werden:<br />
„Zum Schutz von Sandtrockenrassen ist die Errichtung baulicher<br />
Anlagen westlich des Feldweges und nördlich des bestehenden<br />
Einzelhauses zu vermeiden.“<br />
K 112.1, K 112.3 und K 112.4<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope,<br />
Boden und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung von bis zu 6.000<br />
m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 6.000 m² versiegelten Bodens.<br />
100
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 117, „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.19 Vorhaben 117<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“+<br />
„Gemeinbedarf“ in „Gemischte Baufläche“.<br />
4.4.19.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.19.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am unmittelbar nördlich des Finow-<br />
Kanals im Osten von Finowfurt. Das Projektgebiet wird über die Kanalstraße<br />
erschlossen und liegt im Außenbereich.<br />
Westlich liegen bis zur Bundesstraße 167 die Frisch- und kleinflächig<br />
auch Feuchtwiesen der Finow-Kanalniederung. Nach Nord-Westen<br />
schließt ein großflächiges Gewerbegebiet an. Unmittelbar angrenzend<br />
befindet sich ein relativ hoch verdichtetes Mischgebiet, das überwiegend<br />
zu Wohnzwecken genutzt wird. Im Osten liegt ein relativ ausgedehnter<br />
Feuchtbiotop-Komplex mit Kleingewässern, nassen Strauchweidengebüschen<br />
und Erlenbruchwald. Innerhalb dieses Komplexes finden sich<br />
immer wieder kleinere isolierte Wochenendhaussiedlungen. Südlich liegt<br />
in gut 50 m Entfernung von der Projektgebietsgrenze der Finowkanal mit<br />
seinem standortgemäßen Gehölzsaum aus Erlen und dem uferbegleitenden<br />
Wanderweg.<br />
4.4.19.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet ist zum Finowkanal hin als Wohnstandort mit einem<br />
villenartigen Gebäude und einigen Nebengebäuden genutzt worden.<br />
Das Hauptgebäude ist derzeit baufällig. Die Gartenflächen liegen brach<br />
und weisen einen relativ dichten Gehölzbestand auf (Biotoptyp 12260).<br />
Die Einzelhausbebauung hat aufgrund anthropogener Überformung des<br />
Geländes mit Ziersträuchern und Koniferen nur eine geringe Habitateignung<br />
für eine Reihe gebüschbrütender und kulturfolgernder Vogelarten.<br />
Insgesamt hat der Biotoptyp eine geringe Bedeutung für den Arten- und<br />
Biotopschutz.<br />
Der Wohnstandort wird über einen Stichstraße der verlängerten Kanalstraße<br />
erschlossen. Der Weg ist derzeit durch eine Absperrung für KFZ<br />
unpassierbar und ist weitgehend zugewachsen. Die beidseitig wegebegleitenden<br />
Sträucher u.a. mit Schneebeere zeigen die Zugehörigkeit der<br />
Flächen zur ehemaligen Gartennutzung (Gartenbrache, Biotoptyp<br />
10113) des Wohnstandortes an. Der versiegelte, aber teilweise bereits<br />
überwachsene Weg nimmt den wesentlichen Flächenanteil ein. Deshalb<br />
und aufgrund des recht hohen Anteils gebietsfremder oder standortfremder<br />
Gehölze wird dem Biotop nur eine geringe Bedeutung für den<br />
Arten- und Biotopschutz beigemessen.<br />
Das nördliche Drittel des Projektgebietes wird von einer Frischweide mit<br />
(Biotoptyp 05111) eingenommen. Sie dient als Pferdekoppel. In den<br />
Randbereichen der Koppel stehen einzelne Baumweiden. Aufgrund der<br />
geringen Größe der Weidefläche hat diese für den überwiegenden Teil<br />
der charakteristischen Wiesenbrüter der offenen Weidelandschaften<br />
keine Habitatfunktion. Geeignet ist die Fläche dagegen als Bruthabitat<br />
für Schafstelze Motacilla flava (RL 3). Aufgrund der unmittelbaren Nähe<br />
zu Amphibien-Laichgewässer hat die Weide sehr wahrscheinlich eine<br />
Sommerlebensraumfunktion für Moorfrosch Rana arvalis (RL 3; FFH IV),<br />
101
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 117, „Gemischte Baufläche“<br />
Grasfrosch Rana temporaria (RL 3; BArtSchV) und Erdkröte Bufo bufo<br />
(BArtSchV). Durch die enge Verzahnung mit dem Feuchtbiotop-Komplex<br />
der Finow-Kanalniederung und ihrer Pufferfunktion für nach § 32 Brandenburgisches<br />
Naturschutzgesetz geschützte Biotope (s.u.) erhält die<br />
Weide eine Aufwertung der Habitatfunktionen, so dass ihre Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz als hoch gewertet wird.<br />
Südlich grenzt das Projektgebiet auf den in Richtung Finowkanal zunehmend<br />
feuchter werdenden Böden an den standortgemäßen Ufergehölzsaum<br />
des Finow-Kanals aus vorgelagerten Strauchweiden und Erlen<br />
an. Der Biotop unterliegt dem Schutz des § 32 Brandenburgisches<br />
Naturschutzgesetz. Er hat wichtige Habitatfunktionen für eine Reihe<br />
streng und besonders geschützter und auf feuchte Lebensraumbedingungen<br />
angewiesene Tierarten wie Gelbhalsmaus Apodemus flavicollis<br />
(BArtSchV), Rötelmaus Clethrionomys glareolus, Waldspitzmaus Sorex<br />
araneus (BArtSchV), Weidenmeise Parus montanus, Sumpfmeise Parus<br />
palustris, Moorfrosch Rana arvalis (RL 3; FFH IV), Grasfrosch Rana<br />
temporaria (RL 3; BArtSchV) oder Erdkröte Bufo bufo (BArtSchV). Der<br />
Biotop hat daher eine sehr hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
4.4.19.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 10.000 m². Die derzeit<br />
versiegelten Flächen machen etwa 1.800 m² aus. Die als Mischgebiet<br />
ausgewiesene überbaubare Grundfläche soll 6.600 m² betragen.<br />
Unter Annahme einer für Mischgebiete üblichen Versiegelungsgrades<br />
von 80% (einschl. Verkehrswegen) wäre die bauliche Inanspruchnahme<br />
von etwa 5.280 m² eröffnet. Abzüglich des aktuellen Bestands versiegelter<br />
Flächen von ca. 1.800 m² wäre mit einer Mehrversiegelung von bis<br />
zu 3.480 m² zu rechnen.<br />
4.4.19.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 117.1: Die im Rahmen der Entwicklung eines Mischgebietes zu erwartenden<br />
baulichen bzw. flächenstrukturellen Veränderungen führen mittelbar<br />
zu einer Beeinträchtigung von nach § 32 geschützten Biotopen<br />
außerhalb des Projektgebietes am Finow-Kanal mit hoher Bedeutung für<br />
den Arten- und Biotopschutz. Dies ist ein erheblicher Eingriff in die Belange<br />
des Arten- und Biotopschutzes.<br />
102
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 117, „Gemischte Baufläche“<br />
Biotoptypen Vorhaben 117 (Finowfurt)<br />
K 117.2: Die Überbauung oder strukturelle Änderung der Frischweide<br />
als wichtiger Pufferbiotop und Teillebensraum für geschützte Tierarten<br />
der benachbarten Feuchtbiotope im Rahmen der Entwicklung des<br />
Mischgebietes wäre ein erheblicher Eingriff in ein Biotop mit hoher Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz.<br />
K 117.3: Die maximale zusätzliche Versiegelung von bis zu 3.480 m²<br />
Boden reduziert außerdem die zur Verfügung stehenden Lebensräume<br />
mit geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz im Bereich der<br />
Gartenbrachen und Einzelhausbebauung. Dieser Eingriff ist dennoch<br />
erheblich und nachhaltig und muss kompensiert werden.<br />
4.4.19.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 117.4: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 3.480 m² Boden geht<br />
einher mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
103
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 117, „Gemischte Baufläche“<br />
K 117.5: Die Versieglung von 3.480 m² Boden reduziert Menge und<br />
Qualität der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.19.2.3 Landschaftsbild<br />
K 117.6: Die Entwicklung der Weiden zu einer gemischten Baufläche<br />
führt zu erheblichen Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes. Die Flächen<br />
sind Bestandteil eines typischen, naturnahen Nutzungsmusters der<br />
Finow-Kanalniederung. Das Nebeneinander offener Weideflächen,<br />
standortgerechten Weidengebüschen als Vorflächen der umliegenden<br />
Erlenbruchwälder und der markanten Baumweiden am Rand der Pferdekoppel<br />
sind von hohem landschaftsästhetischen Wert. Durch den Verlust<br />
der Strauchweidenbestände wären bauliche Anlagen zudem vom<br />
Wanderweg entlang des Finow-Kanals aus einsehbar, was die herausragende<br />
Funktion des Finow-Kanalwanderweges für die Naherholungsfunktion<br />
und das Landschaftserleben im betroffenen Abschnitt erheblich<br />
beeinträchtigen würde.<br />
K 117.7: Von der offenen Feldflur westlich des Projektgebiet aus betrachtet<br />
ist das Vorhaben durch die vorhandenen Gehölzstrukturen landschaftlich<br />
gut eingebunden. Ein Verlust dieser Gehölzstrukturen würde<br />
zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes führen.<br />
Die Wiederherstellung der teilweise verfallenen Gebäudestruktur im Bereich<br />
des alten Wohnstandortes würde nicht zu erheblichen visuellen<br />
Eingriffen führen, da das gegenwärtige Erscheinungsbild des Altstandortes<br />
bereits als visuelle Beeinträchtigung bewertet werden muss.<br />
4.4.19.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 117.2 (besonderer Artenschutz)<br />
Der Verlust der Frischweiden mit hoher Bedeutung als Komplementär-<br />
Biotop für die nach § 32 geschützten, angrenzenden Biotope sollte<br />
durch Übernahme der Vermeidungsmaßnahme V 117.1 vermieden werden:<br />
„Die Frischweide sowie die Gehölzstrukturen im Übergangsbereich<br />
zum uferbegleitenden Gehölzmantel des Finowkanals sollen<br />
nicht durch bauliche Anlagen oder sonstige Nutzungen, die<br />
zu einer nachhaltigen oder auch nur temporären Änderung der<br />
Flächenstruktur führen könnten, in Anspruch genommen werden.“<br />
104
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 117, „Gemischte Baufläche“<br />
K 117.3, K 117.4 und K 117.5 (Allgemeiner Artenschutz, Boden u.<br />
Wasser)<br />
Die Kompensation der Eingriffe in Flächen mit geringer Bedeutung für<br />
den Arten- und Biotopschutz sowie die Schutzgüter Boden und Wasser<br />
durch die zusätzliche Versiegelung von bis zu 3.480 m² Boden ruft folgende<br />
Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 3.480 m² versiegelten Bodens.<br />
K 117.7 (Landschaftsbild)<br />
Die Beseitigung der Gehölzstrukturen entlang der westlichen Projektgebietsgrenze<br />
sollte durch Festsetzung der Vermeidungsmaßnahme V<br />
117.2 vermieden werden:<br />
„Die für die landschaftsgerechte Einbindung des Vorhabenstandortes<br />
bedeutsamen Gehölzstrukturen entlang der<br />
westlichen Projektgebietsgrenze sollen nicht beseitigt oder<br />
durch sonstige Nutzungen beeinträchtigt werden.“<br />
K 117.1 (besonderer Artenschutz) und 117.6 (Landschaftsbild)<br />
Die Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V 117.1 und V<br />
117.2 führt zur Auflösung des Konfliktes K 117.1.<br />
105
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 126, „Bahnanlagen“<br />
4.4.20 Vorhaben 126<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
„Bahnanlagen“. Ziel ist die Herstellung eines Gleisanschlusses mit entsprechenden<br />
Einrichtungen des Logistik-Gewerbes für das im nördlichen<br />
Bereich des Flugplatzes Eberswalde-Finowfurt geplante Gewerbegebiet.<br />
4.4.20.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.20.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich im äußersten Osten von Finowfurt unmittelbar<br />
nördlich des Flugplatzes Eberswalde-Finow. Das Gelände ist z.Z.<br />
verkehrlich nicht erschlossen. Der bestehende Gleisanschluss ist stillgelegt.<br />
Nördlich setzt sich ein Mosaik von Kiefernforsten und trockenwarmen<br />
Offenlandfluren fort. Östlich liegt ein größerer Weiher mit natürlichen<br />
Uferstrukturen sowie Laubholzforste. Im Süden liegt die Betriebsfläche<br />
des Flugplatzes mit vegetationsarmen, schotterreichen Rohbodenstandorten,<br />
frischen und trockenen Grünlandbrachen sowie brachliegenden<br />
Gewerbeflächen mit Hallengebäuden.<br />
4.4.20.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Es handelt sich um eine vor Jahrzehnten anthropogen hergestellte<br />
Offenlandschaft, auf der sich über die Jahre alle Sukzessionsstadien<br />
von der Offenlandschaft zu Waldstadien in kleinteiligem Biotopmosaik<br />
finden.<br />
Im westlichen Drittel des Projektgebietes befinden sich relativ strukturreiche<br />
Kiefernforste (Biotoptyp 08480) mit Wald-Kiefern unterschiedlicher<br />
Altersklassen unter Beimischung von Birken in der Baumschicht<br />
sowie Später Traubenkirsche in der Strauchschicht. Der Biotop hat<br />
Bedeutung für eine Reihe von Vogelarten wie Trauerschnäpper, Waldlaubsänger,<br />
Gartenbaumläufer, Kleiber und Meisenarten. Zudem ist<br />
insbesondere in den lichten südexponierten Randbereichen das Vorkommen<br />
der Waldeidechse und der Blindschleiche anzunehmen. Im<br />
Zusammenwirken mit den trockenwarmen Offenlandbiotopen und den<br />
angrenzenden Kiefern-Vorwäldern hat der Kiefernforst eine wichtige<br />
Lebensraumfunktion im Biotopkomplex und wird daher als für den Arten-<br />
und Biotopschutz von hoher Bedeutung bewertet.<br />
Den Kiefernforsten ist ein aus freier Sukzession hervorgegangener<br />
Waldmantel vorgelagert (Biotoptyp 07120). Dieser zeichnet sich aufgrund<br />
des Nebeneinanders der Hauptbaumarten Wald-Kiefer und Sand-<br />
Birke in allen Altersklassen vom Jungwuchs bis zum starken Baumholz<br />
als auch aufgrund des teilweise dichten, teilweise lichten Kronenschlusses<br />
durch eine erhebliche Strukturvielfalt aus. Der Biotop dürfte im<br />
Randbereich von Kiefernforsten zu gerodeten Kiefernforsten entstanden<br />
sein, in denen einzelne Kiefern als Überhälter stehen geblieben sind. In<br />
den Bestandslücken haben sich vorwaldartige Kiefern-Birken-Strukturen<br />
etabliert. In der Strauchschicht hält die gebietsfremde Späte Traubenkirsche<br />
hohe Deckungsgrade. Beim faunistischen Artenspektrum kommt<br />
es zu Überschneidungen von reinen Gehölz-/Waldbewohnern, die z.B.<br />
nur zeitweise die durchwärmten Waldränder zur Paarfindung nutzen, bis<br />
zu typischen Offenlandarten, die hier z.T. die Deckung bietenden Struk-<br />
106
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 126, „Bahnanlagen“<br />
turen benötigen. Typische Besiedler unter den Wirbeltieren sind verschiedene<br />
Hecken- und Buschbrüter wie Gartengrasmücke, Dorngrasmücke,<br />
Neuntöter, Goldammer u.a. Das Vorkommen von Waldeidechse<br />
(Lacerta vivipara, RL 2; BArtSchV) und Blindschleiche Anguis fragilis<br />
(BArtSchV) ist zu erwarten. Besonders artenreich ist die Insektenfauna<br />
der warmen Waldränder über den trockenwarmen Sandböden. Derartige<br />
Waldmäntel stellen als Grenzbereiche zwischen stark divergierenden<br />
Ökosystemen wertvolle Lebensräume dar. Der Biotoptyp hat eine hohe<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Das östliche Drittel des Projektgebietes wird von ruderalen Pionier-<br />
und Halbtrockenrasen eingenommen (Biotoptyp 03229). Mosaikartig<br />
überwiegen kleinflächig auch die Florenelemente der ruderalen Staudenfluren<br />
wie Rainfarn Tanacetum vulgare, Grau-Kresse Berteroa incana<br />
oder Schafgarbe Achillea millefolium oder reine Landreitgrasfluren<br />
in annähernden Einart-Beständen des Landreitgrases Calamagrostis<br />
epigeios (dann eigentlich Biotoptyp 03210). Das Landreitgras<br />
erreicht flächendeckend hohe Deckungsgrade. Dort, wo die konkurrenzstarken<br />
ruderalen Florenelemente in den Deckungsgraden zurücktreten,<br />
finden sich auch Pflanzenarten der Sandtrockenrasen wie<br />
Bergglöckchen Jasione montana, Feldbeifuß Artemisia campestris,<br />
Grasnelke Armeria elongata und auch verschiedene Rentier- und Geweihflechten.<br />
Auch Wiesenflockenblume Centaurea jacea oder Tüpfel-<br />
Johanniskraut Hypericum perforata als Vertreter trockenwarmer Grünlandbrachen<br />
erreichen hohe Stetigkeit. Innerhalb der Pionier- und<br />
Halbtrockenrasen sind einzelne kleinere Baumgruppen und Vorwaldinseln<br />
eingestreut, die die Strukturvielfalt wesentlich erhöhen. Aufgrund<br />
der erheblichen Flächenausdehnung des Biotops auch in Verbindung<br />
mit der Fortsetzung jenseits der Projektgebietsgrenze haben die Offenlandbereiche<br />
Habitatqualitäten auch für typische Arten der offnen<br />
Brachflächen. Stark positiv auf die Bedeutung des Offenlandes für die<br />
Fauna wirkt sich das weiträumige Vorkommen von komplementären<br />
Kontaktbiotopen wie Waldmäntel, Kiefern- und Laubwaldforsten und<br />
angrenzend an das Projektgebiet eines naturnahen Weihers mit Schilfröhricht<br />
und standortgemäßen Gehölzmantel aus. Das Vorkommen<br />
einer Vielzahl geschützter und/oder gefährdeter Tierarten ist anzunehmen.<br />
Nachfolgende Arten sind als Leitarten des Biotoptyps mit<br />
Vorkommen zu erwarten:<br />
Reptilien:<br />
Schlingnatter Coronella austriaca (FFH IV)<br />
Zauneidechse (Lacerta agilis, RL 3; FFH IV), Waldeidechse (Lacerta<br />
vivipara, RL 2; BArtSchV), Blindschleiche Anguis fragilis (BArtSchV)<br />
Säugetiere:<br />
Feldhase Lepus europaeus (RL 2), Mauswiesel Mustela nivalis (RL 3)<br />
Vögel:<br />
Brachpieper Anthus campestris (RL 1; VSchRL), Neuntöter Lanius<br />
collurio (RL 3; VSchRL), Feldschwirl Locustella naevia (RLR),<br />
Heidelerche Lullula arborea (RL 2; BArtSchV), Steinschmätzer<br />
Oenanthe oenanthe (RL 2), Braunkehlchen Saxicola rubetra (RL 2),<br />
107
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 126, „Bahnanlagen“<br />
Grünspecht Picus viridis (Vogelschutzrichtlinie Anhang 1, BArtSchV),<br />
Sperbergrasmücke Sylvia nisoria (RL 2; VSchRL)<br />
Tagfalter:<br />
Mauerfuchs Lasiommata megera, Schwalbenschwanz Papilio machaon<br />
(RL 3; BArtSchV).<br />
Für nachfolgende Tierarten dürfte der Biotop wichtige Habitatfunktionen<br />
haben:<br />
Amphibien:<br />
Aufgrund der potentiell geeigneten Laichgewässer nord-östlich des Projektgebiets<br />
und im südlich angrenzenden Flugplatzgelände ist das Vorkommen<br />
von Kreuzkröte Bufo calamita (RL 1; FFH IV) und Wechselkröte<br />
Bufo viridis (RL 2; FFH IV) im Sommerlebensraum möglich.<br />
Fledermäuse (Nahrungshabitat):<br />
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus (FFH IV), Zwergfledermaus<br />
Pipistrellus pipistrellus (FFH IV) und Braunes Langohr Plecotus auritus<br />
(FFH IV).<br />
Die ruderalen Pionier- und Halbtrockenrasen haben entsprechend eine<br />
hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Des Weiteren findet sich eine kleine Birkenwald-Insel innerhalb der Offenlandfläche.<br />
Etwa 30-40 Jahre alte Birken bilden einen lichten Hain mit<br />
ausgeprägter Krautschicht, die im Wesentlichen von den Arten der angrenzenden<br />
Pionier- und Halbtrockenrasen dominiert wird. In der<br />
Strauchschicht findet sich in kleineren Herden die gebietsfremde<br />
Schneebeere. Aufgrund der relativ geringen Strukturvielfalt des Altersklassen-Birkenforstes<br />
und der gebietsfremden Strauchschicht wird dem<br />
Biotop lediglich eine mittlere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz<br />
beigemessen.<br />
4.4.20.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Gesamtfläche von etwa 9,2 ha. Es muss davon<br />
ausgegangen werden, dass aufgrund der Logistik-Funktionen, die<br />
die „Bahnanlage“ für die Gewerbegebiete auf dem Verkehrslandeplatz<br />
Eberswalde-Finow übernehmen soll eine hohe bauliche Auslastung angestrebt<br />
wird. Unter Annahme einer baulichen Gesamt-Verdichtung im<br />
Rahmen der städtebaulichen Nutzungskategorie „Bahnanlage“ von 0,8<br />
ergäbe sich eine zukünftige Versiegelung von 73.600 m².<br />
108
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 126, „Bahnanlagen“<br />
Biotoptypen Vorhaben 126 (Finowfurt)<br />
4.4.20.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 126.1: Durch die Gebietsentwicklung gehen Biotope mit überwiegend<br />
hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz verloren. Da die Wertigkeit<br />
der Einzelbiotope stark vom Zusammenwirken mit der Gesamtheit<br />
der Biotope verbunden ist, führt auch die Beeinträchtigung von Teilbereichen<br />
zu Entwertungen der naturschutzfachlichen Wertigkeit gegebenenfalls<br />
nicht beanspruchter Teilbereiche. In Verbindung mit den erheblichen<br />
betriebsbedingten Störeinflüssen ist davon auszugehen, dass das<br />
Projektgebiet seine Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz vollständig<br />
verliert. Die Vorkommen geschützter und gefährdeter Tierarten im<br />
Projektgebiet werden erlöschen. Dies ist ein erheblicher Eingriff in die<br />
Belange des Arten- und Biotopschutzes.<br />
4.4.20.2.2 Schutzgut Boden, Wasser und Klima<br />
K 126.2: Das gesamte Vorhabengebiet liegt in der Schutzzone III A des<br />
in der Aufstellung befindlichen Wasserschutzgebietes Eberswalde (Finow).<br />
Der Entwurf der Verordnung vom 06.06.07 weist Verbote auf, die<br />
im Rahmen der Vorhabenentwicklung beachtlich werden dürften. Verboten<br />
sind insbesondere:<br />
• das Errichten oder Erweitern von Bahnhöfen oder Schienenwegen<br />
der Eisenbahn,<br />
• die Ausweisung neuer Baugebiete im Rahmen der Bauleitpla-<br />
109
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 126, „Bahnanlagen“<br />
nung, wenn damit eine Neubebauung bisher unbebauter Gebiete<br />
oder eine Erhöhung der Grundflächenzahl im Sinne des § 19 der<br />
Baunutzungsverordnung zugelassen wird.<br />
K 126.3: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 73.600 m² Boden geht<br />
einher mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 126.4: Die Versieglung von 73.600 m² Boden reduziert ohne entsprechende<br />
Vermeidungsmaßnahmen Menge und Qualität der Grundwasserneubildung.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 126.5: Die Realisierung von Baumassen in erheblichem Umfang trägt<br />
zu einer erheblichen Beeinflussung des Mikroklimas im Vorhabenraum<br />
bei. Die Baukörper speichern erhebliche Wärmemengen, die insbesondere<br />
in den Nachtstunden zu einer Erhöhung der Umgebungstemperaturen<br />
führen. Die Kaltluftentstehungsfunktion der Freiflächen innerhalb des<br />
geplanten Gewerbegebietes geht vollständig verloren. Dies ist ein erheblicher<br />
und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut Klima. Aufgrund der<br />
klimatisch unbelasteten Situation in Finowfurt ist die Beeinträchtigungen<br />
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes durch Ausgleichsmaßnahmen<br />
im Plangebiet und Entsiegelungsmaßnahmen außerhalb des Plangebietes<br />
zu kompensieren.<br />
4.4.20.2.3 Landschaftsbild<br />
K 126.6: Der Projektraum bietet ein abwechslungsreiches Landschaftserleben<br />
mit einem reizvollen Wechsel von offenen, horizontalen Flächen<br />
und Gehölzstrukturen mit vertikaler Ausrichtung. Der anthropogene Ursprung<br />
des Projektraumes als ursprünglich gestörte Fläche ist dem unvoreingenommenen,<br />
durchschnittlich informierten Naturnutzer mittlerweile<br />
kaum noch ersichtlich. Entsprechend wird der Raum als Naherholungsgebiet<br />
für naturbezogene Aktivitäten frequentiert. Durch die geht<br />
die landschaftsästhetischen Funktionen und die Naherholungsfunktion<br />
vollständig verloren. Dies ist ein erheblicher Eingriff in das Schutzgut<br />
Landschaftsbild.<br />
4.4.20.2.4 Landschaftsplanung<br />
K 126.7: Der Landschaftsplan der <strong>Gemeinde</strong> Finowfurt sieht die Ausweisung<br />
des Projektgebietes als südlichen Teil des Geschützen Landschaftsbestandteils<br />
„Tongruben/Menningfließ“ vor. Ziel ist insbesondere<br />
der Erhalt von Altholzbeständen, das Freihalten von Trockenbiotopen,<br />
die Anlage von Pufferbiotopen zum westlich gelegenen Gewerbegebiet<br />
und die Verbesserung des Biotopverbundes Richtung Norden und Osten.<br />
4.4.20.4 Alternativen-Prüfung<br />
Aufgrund der Erheblichkeit der Eingriffe in Natur und Landschaft wird<br />
zunächst geprüft, ob zumutbare Alternativen der Vorhabenrealisierung<br />
110
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 126, „Bahnanlagen“<br />
bestehen, die mit geringeren Eingriffen in die Schutzgüter verbunden<br />
sind.<br />
Aufgrund der räumlichen Nähe bietet sich die Überprüfung einer Verlagerung<br />
des Vorhabens in den Randbereich des Verkehrslandeplatzes<br />
Eberswalde-Finow an. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der „Bahnanlage“<br />
bereits südlich unmittelbar ein geplantes Gewerbegebiet auf dem<br />
Flugplatzgelände gegenüberliegen soll. Die „Bahnanlage“ hat eine geplante<br />
Fläche 9,2 ha, das Gewerbegebiet ist mit einer Fläche von 14,5<br />
ha projektiert. Der gemeinsame Flächenbedarf beträgt somit etwa 23,7<br />
ha. Unten stehende Karte zeigt eine aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutz<br />
wesentlich günstigere Verortung von Bahnanlage und<br />
Gewerbegebiet mit einer Fläche von 24 ha (blau umrandeter Bereich).<br />
Betroffen wären vegetationsarme Schotterflächen, ruderale Wiesen,<br />
gewerbliche Brachen und in geringem Umfang Espen-Vorwälder mit<br />
überwiegen sehr geringer bis geringer Bedeutung für den Arten und Biotopschutz.<br />
Die Kompensationserfordernisse würden sich im Wesentlichen auf die<br />
Entsiegelung der Mehrversiegelung von 73.600 m² (ohne Berücksichtigung<br />
der Mehrversiegelung aus dem Gewerbegebiet, s. hier Vorhaben<br />
3) außerhalb des Projektgebietes beschränken.<br />
Es wird daher empfohlen, die vorgeschlagene Standortalternative unter<br />
funktionalen und städtebaulichen Gesichtspunkten auf ihre Realisierbarkeit<br />
zu prüfen.<br />
Beachtlich ist hierbei, dass auch die vorgeschlagene Alternativfläche<br />
vollständig in der Schutzzone III A des geplanten Wasserschutzgebietes<br />
Eberswalde (Finow) liegen würde. Die Konflikte mit den Verboten des<br />
Wasserschutzgebietes (s.o.) bestünden somit unverändert fort.<br />
111
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 126, „Bahnanlagen“<br />
Alternativ-Standort Vorhaben 126 in Verbindung mit einem geplanten Gewerbegebiet<br />
aus dem Vorhaben 3 (Blaue Linie). Maßstab ca. 1:10.000<br />
4.4.20.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
Sollte der vorgeschlagene Alternativstandort keine Berücksichtigung<br />
finden wären die nachfolgend dargestellten Konflikte zu kompensieren.<br />
K 126.1 und K 126.6<br />
Es wird ein Biotopkomplex mit hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz<br />
und hohen landschaftsästhetischen Potentialen mit einer Fläche<br />
von etwa 9,2 ha vollständig entwertet. Betroffen sind etwa 3,5 ha<br />
trocken-warmer Pionier- und Halbtrockenrasen und 5,7 ha Waldflächen.<br />
Um den erheblichen zeitlichen Verzug bei der Wiederherstellung der<br />
verlorenen Biotopqualitäten angemessen zu berücksichtigen, ist es erforderlich,<br />
ein Verhältnis von 1:3 für Eingriffsfläche zu Maßnahmenfläche<br />
anzusetzen. Damit entsteht außerhalb des Projektgebietes folgender<br />
Kompensationsbedarf:<br />
• Entwicklung und nachhaltige Pflege von 276.000 trockenen<br />
Grünland- bzw. Ackerbrachen, jungen Kiefernaufforstungen oder<br />
trockene Sandäcker zu einem Biotopmosaik aus trockenen Magerrasen<br />
und standortgerechten, naturnahen Wäldern.<br />
K 126.3 und K 126.4<br />
Die zusätzliche Versiegelung von 73.600 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse<br />
außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 73.600 m² versiegelten Bodens.<br />
Zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Wasser wird die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 126.1 empfohlen:<br />
„Oberflächlich anfallende Niederschläge sollen im Plangebiet<br />
durch ein Mulden-/Rigolen-System mit Anschluss an retentionsfähige<br />
Grünanlagen versickert werden. Die Maßnahme ermöglicht<br />
den weitgehenden Erhalt der Grundwasserneubildung und<br />
reduziert die über das Kanalsystem abzuführenden Wassermengen.“<br />
K 126.2<br />
Eine Kompensation des Konfliktes des Vorhabens mit den Verboten des<br />
Wasserschutzgebietes Eberswalde (Finow) ist nicht möglich. Eine Vermeidung<br />
des Konfliktes wäre nur im Rahmen des Verzichts auf das Vorhaben<br />
möglich.<br />
K 126.5<br />
Zur Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Klima sollte innerhalb<br />
des Plangebietes die Minderungsmaßnahme A 126.1 durchgeführt werden:<br />
112
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 126, „Bahnanlagen“<br />
„Entlang der inneren Erschließungsstraßen des Bahngeländes<br />
sind beidseitig Straßenbaumpflanzungen mit Baumarten der<br />
Pflanzliste 2 vorzunehmen. Der Abstand der Baumpflanzungen<br />
beträgt in der Reihe 10-12 m.“<br />
Diese Maßnahmen reduzieren die Wärmeentwicklung und Wärmespeicherung<br />
der Baukörper und tragen durch die erhöhte Evapotranspiration<br />
zu einer Verdunstungskühlung der Umgebungsluft bei.<br />
K 126.7<br />
Der Widerspruch zu den Zielen des Landschaftsplans ist bei Realisierung<br />
des Vorhabens nicht durch Kompensationsmaßnahmen aufzulösen.<br />
Es ist erforderlich, dass die <strong>Gemeinde</strong> die Abweichung von ihren<br />
landschaftsplanerischen Zielen städtebaulich begründet.<br />
113
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 133 „Gewerbliche Baufläche“<br />
4.4.21 Vorhaben 133<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung Flugbetriebsfläche in „Gewerbliche<br />
Baufläche“<br />
4.4.21.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.21.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am süd-westlichen Ortsrand von Finowfurt.<br />
Die Erschließung erfolgt rückwärtig, d.h. östlich hinter dem bestehenden<br />
Gewerbegebiet über eine Privatstraße. Der Projektraum grenzt<br />
im Westen an Kiefernforste. Im Norden grenzen aktive Gewerbegebiete<br />
und Gewerbebrachen. Im Süden und Osten schließt sich die Flugbetriebsfläche<br />
des Flugplatzes Eberswalde-Finow an. Der Vorhabenraum<br />
liegt im Außenbereich.<br />
4.4.21.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
An der Biesenthaler Straße steht bis in eine Grundstückstiefe von etwa<br />
50 m ein strukturreicher, alter Kiefernforst mit Anteilen von Robinie und<br />
Birke in der Baumschicht. In der Strauchschicht dominieren Ebereschen,<br />
ergänzt von Stiel-Eichen-Verjüngungen. Richtung Flugplatzgelände<br />
tritt die Birke stärker in den Vordergrund. Trotz des hohen<br />
Strukturreichtums der Forstfläche kann diese nicht als naturnahe<br />
Waldgesellschaft kartiert und damit unter den Schutz des § 32 Brandenburgisches<br />
Naturschutzgesetz gestellt werden. Die Baumartenzusammensetzung<br />
entspricht nicht den natürlichen Standortbedingungen.<br />
Die Standortbedingungen weisen keine Extreme in der Wasser-<br />
und Nährstoffversorgung auf. Weder handelt es sich um extrem nährstoffarme<br />
Böden, noch handelt es sich um reinen Sandboden mit entsprechend<br />
geringer Wasserhaltefähigkeit. Der Standort ist auch nicht<br />
vom Grundwasser beeinflusst. Im Klimaxstadium der Waldentwicklung<br />
hätte die Rotbuche demnach dominante Anteile auf der Fläche, in<br />
Randbereichen möglicherweise ergänzt durch einzelne Lichtbaumarten<br />
wie die Stiel-Eiche. Die Bedeutung für den Arten und Biotopschutz<br />
wird aufgrund des hohen Anteils alter Kiefern dennoch als hoch eingeschätzt.<br />
Auch die nach Osten und Süden orientierten Waldrandstrukturen<br />
mit den implizierten Randlinieneffekten werten den Biotop als Lebensraum<br />
auf. Da die Fläche insgesamt klein ist und von der Gewerbefläche<br />
und der Biesenthaler Straße ausgehende anthropogene<br />
Störeinflüsse den gesamten Biotop beeinflussen, spielt er als Lebensraum<br />
für störungsemfindliche typische Waldarten allerdings keine bedeutsame<br />
Rolle.<br />
Richtung Osten schließt sich eine ruderale Staudenflur auf eher frischen,<br />
nährstoffreicheren Standorten an. Es dominieren konkurrenzstarke,<br />
in Brandenburg weit verbreitete Pflanzenarten wie Gemeiner<br />
Beifuß, Landreitgras oder den Neophyten Kanadisches Berufskraut<br />
und Kanadische Goldrute. Vereinzelt kommen Birken und Kiefer als<br />
Sämlinge in der Fläche auf. Im Randbereich stehen etwa 10-15 Jahre<br />
alte Gehölzstreifen. Bestands bildend ist im Wesentlichen die Sand-<br />
Birke. Der Biotoptyp ist in Brandenburg häufig und von geringer Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz.<br />
114
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 133 „Gewerbliche Baufläche“<br />
Biotoptypen Vorhaben 133 (Finowfurt)<br />
4.4.21.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Im etwa 17.000 m² großen Projektgebiet sollen 3.200 m² als „Wald“ und<br />
13.800 m² als „Gewerbe“ dargestellt werden. Die städtebauliche Nutzungsbestimmung<br />
„Gewerbliche Baufläche“ ermöglicht insgesamt eine<br />
Flächenversiegelung von bis zu 80%. Dies entspricht einem Versiegelungspotential<br />
von 11.000 m².<br />
4.4.21.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 133.1: Der Kiefern-Mischforst weist eine Gesamtfläche von etwa<br />
4.500 m² auf. Die Beseitigung des süd-östlichen Waldrandes mit einer<br />
Flächenausdehnung von etwa 1.300 m² wäre mit erheblichen Beeinträchtigungen<br />
in das Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften verbunden.<br />
Betroffen Lebensräume mit hoher Bedeutung als Lebensraum<br />
von Singvögeln und Insekten der warmen Waldränder. Ein Ausgleich<br />
des Biotopverlustes im naturschutzfachlichen Sinne ist aufgrund der<br />
langen Entstehungszeit alter Wälder und Forsten nicht möglich. Notwendig<br />
würden Ersatzmaßnahmen.<br />
K 133.2: Als wesentliche Eingriffsursache sind außerdem die zusätzlichen<br />
baulichen Entwicklungsmöglichkeiten in einer Größenordnung von<br />
11.000 m² zu sehen, die Biotope von geringer Bedeutung für das<br />
Schutzgut betreffen. Dies ist dennoch ein erheblicher Eingriff in die Belange<br />
des Arten- und Biotopschutzes. Der Eingriff ist aber im Rahmen<br />
von Entsiegelungsmaßnahmen kurzfristig ausgleichbar.<br />
4.4.21.2.2 Schutzgut Boden, Wasser und Klima<br />
K 133.3: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 11.000 m² Boden geht<br />
einher mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
115
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 133 „Gewerbliche Baufläche“<br />
K 133.4: Die Versieglung von 11.000 m² Boden reduziert ohne entsprechende<br />
Vermeidungsmaßnahmen Menge und Qualität der Grundwasserneubildung.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 133.5: Die Realisierung von Baumassen in erheblichem Umfang trägt<br />
zu einer erheblichen Beeinflussung des Mikroklimas im Vorhabenraum<br />
bei. Die Baukörper speichern erhebliche Wärmemengen, die insbesondere<br />
in den Nachtstunden zu einer Erhöhung der Umgebungstemperaturen<br />
führen. Die Kaltluftentstehungsfunktion der bisherigen Staudenflur<br />
geht vollständig verloren. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff<br />
in das Schutzgut Klima. Aufgrund der klimatisch unbelasteten Situation<br />
in Finowfurt ist die Beeinträchtigungen der Leistungsfähigkeit des<br />
Naturhaushaltes durch Ausgleichsmaßnahmen im Plangebiet und Entsiegelungsmaßnahmen<br />
außerhalb des Plangebietes zu kompensieren.<br />
4.4.21.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 133.1<br />
Zur Minimierung von Eingriffen in die strukturreichen Forstflächen des<br />
Projektgebietes wird die Festsetzung der Vermeidungsmaßnahme V<br />
133.1 empfohlen:<br />
„Der Kiefern-Mischforst an der Biesenthaler Straße und die vorgelagerten<br />
Waldsaumbereiche sind nicht durch bauliche Anlagen<br />
oder sonstige beeinträchtigende Nutzungen in Anspruch zu<br />
nehmen.“<br />
K 133.2 bis K133.5<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Lebensgemeinschaften,<br />
Boden, Wasser und Klima (teilweise) durch die zusätzliche<br />
Versiegelung von 13.600 m² Boden ruft folgende<br />
Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 11.000 m² versiegelten Bodens.<br />
Zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Wasser wird die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 133.2 empfohlen:<br />
„Oberflächlich anfallende Niederschläge sollen im Plangebiet<br />
versickert werden. Die Maßnahme ermöglicht den weitgehenden<br />
Erhalt der Grundwasserneubildung und reduziert die über<br />
das Kanalsystem abzuführenden Wassermengen.“<br />
K133.5<br />
Zur weiteren Kompensation der Eingriffe in das Schutzgut Klima und der<br />
Aufwertung des Landschaftsbildes sollte innerhalb des Plangebietes die<br />
Minderungsmaßnahme A 133.1 durchgeführt werden:<br />
„Die südliche Grenze des geplanten Gewerbegebietes soll<br />
durch Anlage einer mindestens 3 m breiten Baumhecke einge-<br />
116
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 133 „Gewerbliche Baufläche“<br />
fasst werden. Auf 5 m Hecke sind 1 Baum der Pflanzliste 3 als<br />
zukünftige Überhälter zu setzen (s. Anhang 3). Pro m² Pflanzfläche<br />
sind zusätzlich 2 Sträucher der Pflanzliste 4 zu pflanzen<br />
(s. Anhang 3). Es ist auf die Verwendung autochthonen Pflanzgutes<br />
zu achten.“<br />
Diese Maßnahmen reduzieren die Wärmeentwicklung und Wärmespeicherung<br />
der Baukörper und tragen durch die erhöhte Evapotranspiration<br />
zu einer Verdunstungskühlung der Umgebungsluft bei.<br />
Die oben genannten Maßnahmen zur Durchgrünung des Gewerbegebietes<br />
tragen zudem dazu bei, die landschaftsästhetische Situation aufzuwerten.<br />
117
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 134 „Sondergebiet Fotovoltaik“<br />
4.4.22 Vorhaben 134<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ und<br />
„Wald“ in Sondergebiet „Fotovoltaik“.<br />
4.4.22.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.22.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am westlichen Ortsrand von Finowfurt<br />
unmittelbar an der Autobahnabfahrt „Finowfurt“ der Bundesautobahn A<br />
11. Im Norden wird das Projektgebiet von der Ausfahrt der A 11 und im<br />
Westen von der A 11 selbst begrenzt. Nach Süden liegen zwischen Projektgebiet<br />
und Fichtenweg ein Kiefernforst bzw. Gärten und Einzelhausgrundstücke.<br />
Im Osten setzt sich die ruderale Grünlandbrache bis<br />
zum Ortsrand von Finowfurt fort. Der Vorhabenraum liegt im Außenbereich.<br />
4.4.22.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet wird fast vollständig von ruderalen Grünlandbrachen<br />
frischer, nährstoffreicher Standorte eingenommen (Biotoptyp 05132).<br />
Auf dem lehmigen Sandboden entwickelt sich eine wüchsige, von konkurrenzstarken<br />
Pflanzenarten wie Gemeiner Beifuß, Rainfarn, Wolliges<br />
Honiggras, Graukresse, Tüpfel-Johanniskraut, Wiesen-Schafgarbe,<br />
Großer Sauerampfer und Wiesen-Flockenblume. Vereinzelt konnten<br />
sich Arten der trockenwarmen Rasen wie Feld-Beifuß und Jasione<br />
halten. Der Biotoptyp ist in Brandenburg häufig und ungefährdet. Aufgrund<br />
der großen Nähe der Bundesautobahn und der Siedlungen Finowfurts<br />
spielt der Biotop für störungsempfindliche Offenlandarten<br />
trotz der insgesamt großen Ausdehnung eine geringe Rolle. Auch weniger<br />
störungsanfällige Offenlandarten, unter den Vögeln z.B. die Feldlerche,<br />
finden aufgrund des erheblichen Phytomassenaufkommens<br />
keine optimalen Habitatbedingungen vor. Damit bilden im Projektgebiet<br />
v.a. wenig spezialisierte und ungefährdete Wirbeltiere wie z.B.<br />
Wühlmaus und Kaninchen das Artenspektrum. Diese stellen aber zumindest<br />
geeignete Nahrungstiere für eine Reihe von Greifvögeln dar.<br />
Insgesamt spielt der Biotop eine geringe bis mittlere Rolle für das<br />
Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften.<br />
An der westlichen Grenze des Projektgebietes liegt eine ehemalige<br />
Lagerhalle mit einer angegliederten, Gehölz dominierten Gartenbrache<br />
(Biotoptyp 10113). Die Gehölze stellen eine für eine Reihe von kulturfolgenden<br />
Singvogelarten bedeutsame Habitatstruktur. Die Gartenbrache<br />
ist von mittlerer Bedeutung für den Arten und Biotopschutz.<br />
118
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 134 „Sondergebiet Fotovoltaik“<br />
Biotoptypen Vorhaben 134 (Finowfurt)<br />
4.4.22.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Im etwa 2,0 ha großen Projektgebiet sollen flächendeckend Sonnenkollektoren<br />
aufgestellt werden. Da die Kollektoren mit Punktfundamenten<br />
im Erdreich verankert werden, ist die zu berechnende Flächenversiegelung<br />
vergleichsweise gering. Da technische Ausführungspläne nicht vorliegen,<br />
wird hilfsweise angenommen, dass sich die Fläche der Punktfundamente<br />
auf insgesamt etwa 590 m² summiert. 1 . Da im Projektgebiet<br />
eine alte Lagerhalle mit einer Grundfläche von etwa 900 m² befindet,<br />
könnte die Versiegelung durch Entsiegelungsmaßnahmen im Plangebiet<br />
ausgeglichen werden.<br />
4.4.22.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 134.1: Die Grünlandbrache verliert ihre Eignung als Jagdgebiet für<br />
Greifvögel weitgehend. Zwar werden sich Nahrungstiere wie Wühlmaus<br />
und Kaninchen weiterhin in kaum reduzierter Populationsstärke vorkommen,<br />
jedoch versperren die Kollektoren Greifvögeln den Zugriff. Die<br />
ist ein erheblicher Eingriff in die Belange des Arten- und Biotopschutz.<br />
1 Pro 4 m lfd. m Sonnenkollektor 2 Punktfundamente mit zusammen 0,3 m². Bei<br />
einer Breite des Projektgebietes von 136 m entspricht dies 34x0,3 m² = 10,2 m²<br />
pro Reihe. Bei einer Länge des Projektgebietes von etwa 145 m und einer Aufstellfläche<br />
von 2,5 m pro Kollektor-Reihe ermöglicht dies 58 Kollektorreihen.<br />
Damit ergibt sich eine Gesamtfläche der Punktfundamente von 10,2 m² x 58 =<br />
592 m².<br />
119
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 134 „Sondergebiet Fotovoltaik“<br />
4.4.22.2.2 Schutzgut Boden, Wasser und Klima<br />
K 134.2: Die Versiegelung von etwa 590 m² Boden geht einher mit dem<br />
Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut Boden.<br />
Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes Boden von allgemeiner<br />
Bedeutung betroffen.<br />
K 134.3: Die Versieglung von 590 m² Boden reduziert ohne entsprechende<br />
Vermeidungsmaßnahmen Menge und Qualität der Grundwasserneubildung.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Die Flächenversiegelung und die zu realisierenden Baumassen sind zu<br />
gering, um einen erheblichen Einfluss auf das lokale Klima nehmen zu<br />
können.<br />
4.4.22.2.3 Landschaftsbild<br />
K 134.4: Die Errichtung eines Solar-Kollektoren-Feldes hat die technische<br />
Überformung des betroffenen Landschaftsraumes zur Folge. Das<br />
Projektgebiet liegt von Norden und Süden vollständig in der Flucht von<br />
Gehölzbeständen. Von der A 11 aus ist die Anlage vollständig einsehbar.<br />
Vom Fichtenweg aus wäre die Anlage nur innerhalb eines schmalen<br />
Blickwinkels einzusehen. Von Osten haben die etwa 300 m entfernt liegenden<br />
Grundstücke Einsicht in die Anlage. Als erhebliche Beeinträchtigung<br />
des Landschaftsbildes wird die Einsehbarkeit des Projektgebietes<br />
von den östlichen Siedlungsbereichen aus gewertet, die vermieden oder<br />
kompensiert werden sollte.<br />
4.4.22.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 134.1<br />
Die Beeinträchtigung des Projektgebietes als Nahrungshabitat für Greifvögel<br />
erzeugt folgenden Kompensationsbedarf:<br />
• Aufwertung von 2,3 ha artenarmer Grünlandbrachen durch<br />
zweimal jährliche Mahd mit Abfuhr der Streu zu artenreichen<br />
Magerwiesen mit hohem Anteil von Arten der Sand-<br />
Trockenrasen zu entwickeln. Auf eine Düngung der Flächen ist<br />
zu verzichten. Der erste Mahdtermin soll nicht vor dem 15.06. eines<br />
Jahres erfolgen.<br />
Ziel ist, neben der Etablierung typischer, wenig störungsempfindlicher<br />
Offenlandarten die Verbesserung der Eignung der zukünftigen Wiesen<br />
als Nahrungshabitat für Greifvögel durch die Reduzierung des Grünaufwuchs<br />
und damit die Minderung der Deckung für Nahrungstiere wie Kaninchen<br />
und Wühlmäuse.<br />
Durch die Überführung der Brachflächen in extensive Wiesen wird zusätzlich<br />
eine historische Landnutzungsform mit hohem landschaftsästhetischem<br />
Wert wieder hergestellt.<br />
120
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 134 „Sondergebiet Fotovoltaik“<br />
K 134.2 und 134.3<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Boden und Wasser<br />
durch die Versiegelung von 590 m² Boden ist durch die Durchführung<br />
der Ausgleichsmaßnahme A 134.1 möglich:<br />
„Die im Projektgebiet befindliche Lagerhalle mit einer Grundfläche<br />
von etwa 900 m² ist zu beseitigen und die Fundamente abzubrechen.“<br />
K113<br />
Zur Minderung der durch die Realisierung der Anlage hervorgerufenen<br />
technischen Überformung des Landschaftsbildes wird die Eingrünung<br />
der Anlage nach Osten durch die Ausgleichsmaßnahme A 134.2 vorgeschlagen:<br />
„Entlang der östlichen Grenze des Projektgebietes sollte durch<br />
Anlage einer mindestens 3 m breiten Strauchhecke eingefasst<br />
werden. Pro m² Pflanzfläche sind 2 Sträucher der Pflanzliste 4<br />
zu pflanzen (s. Anhang 3). Es ist auf die Verwendung autochthonen<br />
Pflanzgutes zu achten.“<br />
121
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 137 „Sondergebiet Wassertourismus“<br />
4.4.23 Vorhaben 137<br />
Finowfurt: Darstellung eines Sondergebiets „Wassertourismus“ an Stelle<br />
von „Flächen für die Landwirtschaft“.<br />
Ziel ist die Entwicklung sanitärer Ver- und Entsorgungsanlagen für Wasserwanderer<br />
mit Qualifizierung der Ein- und Ausstiegsstelle sowie Stellplätze<br />
für PKW’s und Busse für Schifffahrtsgäste sowie Bootslagerplätze<br />
im Winter.<br />
4.4.23.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.23.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet etwa 2 km Luftlinie westlich des Ortsrandes<br />
von Finowfurt und etwa 800 m westlich der Bundesautobahn 11 am Finowkanal.<br />
Südlich und süd-östlich grenzen die Gewerbeflächen der<br />
„Hubertusmühle“ an. Im Norden schließt das Projektgebiet an die saumartigen<br />
Erlenbruchwälder entlang des Finowkonals.<br />
Etwa 150 m westlich beginnt das FFH-Gebiet 3147 „Finowtal<br />
Pregnitzfließ“. dass im Wesentlichen durch das Naturschutzgebiet „Finowtal<br />
Pregnitzfließ“ rechtlich gesichert ist.<br />
4.4.23.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet umfasst eine Fläche von etwa 9.000 m². Es ist Teil<br />
einer kleinteilig strukturierten Niederungslandschaft mit extensiver Grünlandnutzung<br />
und hohem Anteil gliedernder Gehölzstrukturen.<br />
Den größten Flächenanteil innerhalb des Projektgebietes nehmen Grünlandbrachen<br />
frischer Standorte ein (Biotoptyp 05132). Es handelt sich<br />
um relativ artenarme Brachestadien mit zahlreichen eingesprengten<br />
anthropogenen Nutzungsspuren. Es handelt sich um einen in Brandenburg<br />
häufigen und ungefährdeten Biotoptyp. Die Bedeutung für den<br />
Arten- und Biotopschutz ist auch unter Berücksichtigung der Nähe zum<br />
Gewerbestandort „Hubertusmühle“ als gering einzustufen.<br />
Das Gelände wird über unbefestigte Wege erschlossen, die sich stellenweise<br />
zu größeren Stellplatzflächen aufweiten (Biotoptyp 12651).<br />
Diese Wegeflächen sind Störfaktoren des Landschaftshaushaltes und<br />
für den Arten- und Biotopschutz ohne Wertigkeit.<br />
Wesentliche Teile des Gebietes zeugen von der ehemaligen Lagerflächennutzung<br />
aus dem angrenzenden Gewerbebetrieb heraus. Insbesondere<br />
am Stichgraben zum Finowkanal sind einzelne Lagerflächen<br />
erhalten geblieben (Biotoptyp 12740). Die Landnutzungsform stellt eine<br />
Belastung des Landschaftshaushaltes dar und hat für den Arten- und<br />
Biotopschutz keine Wertigkeit.<br />
In zentraler Lage des Gebietes liegt ein in Baum- und Strauchschicht gut<br />
ausgeprägtes, standortgerechtes Feldgehölz (Biotoptyp 07113). Dieses<br />
bietet prinzipiell einer Vielzahl von Tierarten (Teil-)Lebensräume. Aufgrund<br />
des intensiven anthropogenen Störeinflusses ist seine Habitatfunktion<br />
auf weniger störanfällige Tierarten beschränkt. Zu erwähnen ist<br />
insbesondere die Sommer- und Winterlebensraumfunktion für Amphibien.<br />
Es dient zudem einigen kulturfolgenden Gebüschbrütern als Brut-<br />
122
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 137 „Sondergebiet Wassertourismus“<br />
lebensraum. Die Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz ist als mittel<br />
einzustufen.<br />
Im Nordwesten greift das Projektgebiet kleinflächig auf die kanalbegleitenden<br />
Erlenbruchwälder über (Biotoptyp 08103). Diese unterliegen dem<br />
Schutz des § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz und sind entsprechend<br />
von sehr hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Die östliche Begrenzung des Vorhabens bildet ein Stichgraben (Biotoptyp<br />
01132), der ursprünglich die Anlieferung von Gütern für die „Hubertusmühle“<br />
ermöglichte, indem er die schifffahrtstaugliche Verbindung<br />
zum Finowkanal herstellte. Im Bereich des Projektgebietes weist der<br />
Graben eine weitgehend gehölzfreie, naturferne Böschung auf. Außerhalb<br />
des Projektgebietes ist der Stichgraben in den Erlenbruchwald des<br />
Finowkanals eingebunden. Mit Ausnahme des kurzen Abschnittes im<br />
Projektgebiet weist der graben eine sehr hohe Naturnähe auf. Er ist in<br />
Verbindung mit den umgebenden naturnahen Erlenbrüchen und dem<br />
Finowkanal von hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz. Dies<br />
ist insbesondere vor dem Hintergrund der Biotopverbundfunktion zu betrachten.<br />
Das Finowtal hat in seiner Gesamtheit einen hohen Funktionswert<br />
für den regionalen Biotopverbund. Hier sind insbesondere Biber<br />
(Castor fiber, FFH IV) und Fischotter (Lutra lutra, FFH IV) als Zielarten<br />
zu benennen.<br />
Biotoptypen Vorhaben 137 (Finowfurt)<br />
Das Vorhaben liegt im potentiellen Einwirkungsbereich des FFH Gebietes<br />
3147 „Finowtal-Pregnitzfließ“. Der Schutzzweck des FFH-Gebietes<br />
ergibt sich aus den im Gebiet signifikant vorkommenden Lebensraumtypen<br />
und Arten nach Anhang I und II der FFH-Richtlinie (RAT DER<br />
EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1992). Im FFH-Gebiet „Finowtal-<br />
123
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 137 „Sondergebiet Wassertourismus“<br />
Pregnitzfließ“ kommen signifikant folgende Lebensraumtypen und Arten<br />
nach Anhang I und II der FFH-Richtlinie vor:<br />
Lebensraumtypen:<br />
� Dünen mit offenen Grasflächen mit Corynephorus und Agrostis (Flächenanteil:<br />
1%)<br />
� Oligo- bis mesotrophe Gewässer mit benthischer Vegetation aus<br />
Armleuchteralgen (Flächenanteil: 2%)<br />
� Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion<br />
oder Hydracharition (Flächenanteil: 5%)<br />
� Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit einer Vegetation des<br />
Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion (Flächenanteil:<br />
1%)<br />
� Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonigschluffigen<br />
Böden (Flächenanteil: 1%)<br />
� Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen<br />
Stufe (Flächenanteil: 1%)<br />
� Übergangs- und Schwingrasenmoore (Flächenanteil: 1%)<br />
� Torfmoor-Schlenken (Flächenanteil: 1%)<br />
� Kalkreiche Niedermoore(Flächenanteil: 2%)<br />
� Hainsimsen-Buchenwald (Flächenanteil: 9%)<br />
Tierarten:<br />
� Biber (Castor fiber)<br />
� Fischotter (Lutra lutra)<br />
� Rapfen (Aspius aspius)<br />
� Steinbeißer (Cobitis taenia)<br />
� Schlammpeitzger (Misgurnus fossilis)<br />
� Westgroppe (Cottus gobio)<br />
� Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)<br />
� Großer Feuerfalter (Lycaena dispar)<br />
� Unio crassus (Kleine Flussmuschel)<br />
• Des Weiteren wird auf das Vorkommen der Zauneidechse (Lacerta<br />
agilis) und des Springfrosches (Rana agilis) hingewiesen.<br />
Die signifikanten Lebensraumtypen finden sich innerhalb oder in der<br />
Nähe des Vorhabenraumes nicht, sodass keine Beeinträchtigung zu<br />
erwarten ist.<br />
Für Biber und Fischotter spielen die Uferbereiche des Projektgebietes<br />
eine Rolle als Teillebensraum und Biotopverbindungsstruktur. Auch mit<br />
dem Vorkommen der genannten aquatischen Tierarten ist zu rechnen.<br />
4.4.23.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Aus Sicht des Arten- und Biotopschutzes wären zur Stabilisierung des<br />
Biotopverbundes ein Rückbau der Nutzung und die Renaturierung des<br />
Projektgebietes wünschenswert, um eine Pufferzone zwischen Gewer-<br />
124
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 137 „Sondergebiet Wassertourismus“<br />
bestandort und den Biotopkomplexen entlang des Finowkanals zu generieren.<br />
Der Vorhabenträger benötigt für sein Vorhaben eine Wege- und Stellplatzfläche<br />
für Busse und PKW in den Sommermonaten bzw. für Sportboote<br />
in den Wintermonaten von etwa 1.250 m². Zusätzlich soll ein Sanitärcontainer<br />
mit einer Stellfläche von 50 m² aufgestellt werden. Die Einstiegsstelle<br />
für die Wasserwanderer und die Anlegestelle (Spundwand)<br />
für die Fahrgastschifffahrt besteht bereits und befindet sich am südlichen<br />
Ende des Stichgrabens. Die derzeitige teilversiegelte Fläche beträgt<br />
etwa 1.750 m². Der Vorhabenträger beabsichtigt einen Rückbau der<br />
teilversiegelten Flächen in einer Größenordnung von 400 m².<br />
4.4.23.2.2 Arten- und Biotopschutz<br />
K 137.1: Innerhalb des Projektgebietes befinden sich Teilflächen von<br />
Erlenbruchwäldern und strukturreichen Feldgehölzen. Eine Nutzung<br />
dieser Flächen würde zu erheblichen Eingriffen in das Schutzgut Arten-<br />
und Biotope führen.<br />
K 137.2: Die Etablierung einer wassertouristischen Nutzung am Standort<br />
führt zu einer Verschlechterung der Biotopverbindungsfunktion für Elbe-<br />
Biber und Fischotter.<br />
4.4.23.2.3 Boden, Wasser, Klima<br />
Der Vorhabenträger plant eine Reduzierung der teilversiegelten Flächen.<br />
Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser und Klima wären somit nicht<br />
zu besorgen.<br />
4.4.23.2.4 Schutzgebiete<br />
FFH-Gebiet 3147 „Finowtal-Pregnitzfließ“<br />
Aufgrund der bestehenden Vorschädigungen im Gebiet sind keine so<br />
erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten, dass die Biber- und Fischotterpopulationen<br />
in ihrem Erhaltungszustand beeinträchtigt würden und<br />
somit die Ziele des FFH-Gebietes gefährdet würden.<br />
Die zu vermutenden Vorkommen der genannten aquatischen Tierarten<br />
im Bereich des Grabens werden durch das Befahren des Wasserkörpers<br />
mit Paddel- und Sportbooten voraussichtlich nicht erheblich beeinträchtigt.<br />
Eingriffe in die Gewässersohle oder die Uferböschung sind nicht<br />
vorgesehen.<br />
4.4.23.2.5 Landschaftsbild<br />
K 137.3: Das Projektgebiet ist eindeutig als anthropogen vorgeprägt zu<br />
identifizieren. Lagerflächen und Stellflächen sind landschaftsästhetische<br />
Störfaktoren. Dennoch bestehen aufgrund der umgebenden naturnahen<br />
Erlenbruchwälder und des Feldgehölzes im Zentrum des Projektgebietes<br />
landschaftsästhetisch reizvolle Grenzlinien zwischen vertikalen und<br />
horizontalen Elementen. Die Etablierung von Busstellplätzen und Sportbootliegeplätzen<br />
führt daher zu einer weiteren Steigerung der technischen<br />
Überformung des Landschaftsraumes.<br />
125
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 137 „Sondergebiet Wassertourismus“<br />
4.4.23.2.6 Landschaftsplanung<br />
K 137.4: Der Landschaftsplan der <strong>Gemeinde</strong> Finowfurt sieht die Ausweisung<br />
des Projektgebietes als Teil des Geschützen Landschaftsbestandteils<br />
„Finowkanalwiesen“ vor. Ziel ist insbesondere der Rückbau<br />
von Gewerbesiedlungen und Erholungseinrichtungen am Finowkanal im<br />
Außenbereich, die Regulierung des Bootsverkehrs und die Prüfung von<br />
Tabuzonen in besonders sensiblen Lebensbereichen geschützter Arten.<br />
4.4.23.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 137.1: (besonderer Artenschutz)<br />
Die Beeinträchtigung der Arten- und Biotopschutzfunktionen sollte<br />
durch die Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahme V 137.1 gemindert<br />
werden:<br />
„Die Gehölzstrukturen des Projektgebietes einschließlich des<br />
Übergangsbereiches zu Wiesenflächen sind nicht durch Nutzungen<br />
in Anspruch zu nehmen sondern zu erhalten.“<br />
Unter Berücksichtigung der Maßnahme V 145.1 können Verluste von<br />
Amphibien- und Vogellebensräumen vermieden werden.<br />
K 137.2: (besonderer Artenschutz)<br />
Die Beeinträchtigung der Biotopverbindungsfunktion sollte durch die<br />
Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahme A 137.1 gemindert werden:<br />
„Die Einstiegsstelle für Wasserwanderer und Sportboote bzw.<br />
die Anlegestelle für Fahrgastschiffe ist auf den südlichsten Abschnitt<br />
des Stichgrabens zu minimieren. Die Brachflächen zwischen<br />
Einstiegsstelle und dem Rand des nördlich anschließenden<br />
Erlenbruchwaldes sind mit Schwarz-Erlen (Alnus glutinosa,<br />
gebietsheimische Herkünfte, Qualität: Heister, Höhe 80-100 cm,<br />
mittlere Baumschulqualität) zu bepflanzen und von jeglicher<br />
Nutzung frei zu halten. Die Fläche umfasst etwa 2.500 m². Die<br />
Pflanzung soll in Gruppen von 3-20 Heister mit 2 Heistern pro<br />
10 m² vorgenommen werden. Die Lagerfläche im Norden des<br />
Projektgebietes soll beräumt werden und wie vorhergehend beschrieben<br />
mit Erlen bepflanzt werden.“<br />
Ziel ist die Entwicklung einer Pufferfläche zwischen den bestehenden<br />
Erlenbrüchen und der touristischen Nutzung, um die Biotopverbindungsfunktion<br />
des Raumes langfristig erhalten zu können.<br />
K 137.3: (Landschaftsbild)<br />
Zur Vermeidung von Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes durch<br />
bauliche Anlagen ist die Vermeidungsmaßnahme V 137.2 zu empfehlen:<br />
„Die Errichtung von baulichen Anlagen mit Ausnahme eines<br />
Sanitärcontainers mit bis zu 50 m² Grundfläche ist unzulässig“.<br />
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Busstellplätze und<br />
Sportbootliegeplätze sollte durch die Berücksichtigung der Ausgleichsmaßnahme<br />
A 137.2 und A 137.3 gemindert werden:<br />
126
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 137 „Sondergebiet Wassertourismus“<br />
A 137.2<br />
„Entlang der südlichen Projektgebietsgrenze ist auf der gesamten<br />
Länge (ca. 125 m) eine mindestens 3 m breite Baumhecke<br />
anzulegen. Auf 5 m Hecke sind 1 Baum der Pflanzliste 3 als<br />
zukünftige Überhälter zu setzen (s. Anhang 3). Pro m² Pflanzfläche<br />
sind zusätzlich 2 Sträucher der Pflanzliste 4 zu pflanzen<br />
(s. Anhang 3). Es ist auf die Verwendung autochthonen Pflanzgutes<br />
zu achten.“<br />
A 137.3<br />
„Die teilversiegelten Flächen sind um 400 m² zu reduzieren. Die<br />
verdichteten Bereiche sind bis 40 cm Tiefe zu lockern und als<br />
Teilflächen der Maßnahmen A 137.1 und A 137.2 zu bepflanzen<br />
oder der Selbstbegrünung zu überlassen.“<br />
K 137.4<br />
Der Widerspruch zu den Zielen des Landschaftsplans ist bei Realisierung<br />
des Vorhabens nicht durch Kompensationsmaßnahmen aufzulösen.<br />
Es ist erforderlich, dass die <strong>Gemeinde</strong> die Abweichung von ihren<br />
landschaftsplanerischen Zielen städtebaulich begründet.<br />
127
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 138 „Gemischte Baufläche““<br />
4.4.24 Vorhaben 138<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Wald“ in „Gemischte Baufläche“. Der<br />
Vorhabenträger möchte ein Seniorenpflegeheim errichten.<br />
4.4.24.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.24.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand von Finowfurt unmittelbar<br />
südlich des Finowkanals. Die Erschließung erfolgt über die Schlossgutsiedlung.<br />
In südlichen Richtungen schließen gewerbliche Nutzungen an. Im Norden<br />
liegen die strukturreichen uferbegleitenden Gehölzsäume des Finowkanals.<br />
Westlich setzt sich zunächst die von Altbaumbestand geprägte, parkartige<br />
Waldfläche fort um in eine kleinteilige, von Wiesen und Feldgehölzen geprägte<br />
Niederungslandschaft überzugehen. Eingesprengt liegen Einzelhausgrundstücke<br />
und Kleingärten.<br />
4.4.24.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Aufgrund der kurzfristigen Nachmeldung des Vorhabens ist keine Vor-Ort-<br />
Begehung erfolgt. Die Biotoptypenbeschreibung beruht allein auf der Auswertung<br />
von Luftbildern.<br />
Das Projektgebiet wird vollständig von einer kleineren Parkanlage mit vielfältigem<br />
und strukturreichen Altbaumbestand eingenommen. Die Anlage setzt sich<br />
östlich des Projektgebietes fort und ist als Teil einer kleinteilig strukturierten<br />
Kulturlandschaft zu betrachten. Das enge Nebeneinander von Parkflächen,<br />
Feldgehölzen, Kleingewässern sowie Grünland zieht sich als Biotopkomplex in<br />
einem etwa 100 m breiten Korridor entlang des Finowkanals. Diese Niederungsband<br />
zieht sich als charakteristisches Landschaftselement über den gesamten<br />
nördlichen Ortsrand von Finowfurt hinweg und ist wesentlicher Bestandteil<br />
der Biotopverbindungsfunktion des Finowkanals im Bereich der Ortlage Finowfurt.<br />
In diesem Zusammenhang bieten die Altholzbestände des Projektgebietes<br />
einer Vielzahl von Tierarten (Teil-) Lebensräume. Es ist aufgrund der<br />
Nähe zum Finowkanal und angrenzender Kleingewässer mit Laichgewässereignung<br />
davon auszugehen, dass das Projektgebiet wichtiger Sommer- und<br />
Winterlebensraum von Amphibien ist. Das Vorkommen insbesondere von<br />
Kammmolch (Triturus cristatus cristatus RL 2; FFH II + IV), Teichmolch (Triturus<br />
vulgaris), Moorfrosch (Rana arvalis, RL 3; FFH IV), Grasfrosch (Rana temporaria,<br />
RL 3; BArtSchV), Erdkröte (Bufo bufo, BArtSchV) ist zu erwarten.<br />
Charakteristische Kleinsäuger mit deren Vorkommen zu rechnen ist sind z.B.<br />
Zwergspitzmaus (Sorex minutus, BArtSchV), Siebenschläfer Glis glis<br />
(BArtSchV), Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis, BArtSchV), Rötelmaus<br />
(Clethrionomys glareolus), Europäischer Maulwurf (Talpa europaea, BArtSchV),<br />
Igel (Erinaceus concolor, BArtSchV), Europäisches Eichhörnchen (Sciurus vulgaris,<br />
BArtSchV ) und Feldhase (Lepus europaeus, BArtSchV). Außerdem ist<br />
das Vorkommen von Sommerquartieren von Fledermäusen in Altbäumen zu<br />
rechnen. Alle in Frage stehenden Fledermausarten sind Arten des Anhangs IV<br />
der FFH-Richtlinie und genießen damit einen strengen artenschutzrechtlichen<br />
Schutz.<br />
Insbesondere für Elbebiber aber mit hoher Wahrscheinlichkeit auch für den<br />
Fischotter dürfte das Projektgebiet aufgrund der Entfernung zum Finowkanal<br />
(etwa 50 m) und der anthropogenen Störeinflüsse der Ortsrandlage keine Rolle<br />
als Lebensraum spielen.<br />
128
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 138 „Gemischte Baufläche““<br />
Das Projektgebiet ist Brut- und Nahrungshabitat für eine Vielzahl von Vogelarten.<br />
Neben diversen waldbewohnenden Singvögeln sind auch die Spechtarten<br />
Mittelspecht (Dendrocopos medius, RL 3; VSchRL) und Grünspecht (Picus<br />
viridis, (Vogelschutzrichtlinie Anhang 1, BArtSchV) zu nennen.<br />
Insgesamt weist das Projektgebiet eine hohe Bedeutung für den Arten- und<br />
Biotopschutz auf.<br />
Biotoptypen Vorhaben 138 (Finowfurt)<br />
4.4.24.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine erhebliche<br />
Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar ist. Schutzgüter,<br />
die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden, werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 1,4 ha. Die überbaubare<br />
Grundfläche beträgt ca. 6.000 m². Unter Annahme einer Gesamt-GRZ von 0,6<br />
entstehen bauliche Entwicklungspotentiale in einer Größenordnung von 3.600<br />
m².<br />
4.4.24.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 138.1: Im Zuge der Vorhabenrealisierung gehen etwa 20 % der Altbaumbestände<br />
durch Überbauung unmittelbar verloren. Die Restflächen werden als<br />
Park- und Gartenanlage hergerichtet. Damit gehen Biotopstrukturen mit hoher<br />
129
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 138 „Gemischte Baufläche““<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz verloren bzw. werden durch Nutzungsintensivierung<br />
erheblich beeinträchtigt. Besonders betroffen sind Sommer-<br />
und Winterlebensräume von Amphibien, die in ihrer Flächenausdehnung<br />
erheblich reduziert werden. Damit wird ein wichtiges Trittsteinbiotop im übergeordneten<br />
Biotopverbundsystem des Finowkanals erheblich beeinträchtigt.<br />
Für störungssensiblere Vogelarten wie die genannten Spechtarten verliert das<br />
Gebiet seine Habitatfunktionen. Die Eignung des Gebietes als Bruthabitat wird<br />
sich auf anpassungsfähige Kulturfolger reduzieren.<br />
Für eine Vielzahl von Kleinsäugern gehen durch Überbauung erhebliche Habitatflächen<br />
verloren. Durch die Nutzungsintensivierung der Restflächen verliert<br />
das Gebiet seine Habitateignung für störungssensiblere Säuger.<br />
Der Verlust von Sommerquartieren von Fledermäusen durch Fällung von Altbäumen<br />
ist zu befürchten.<br />
4.4.24.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 138.2: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 3.600 m² Boden geht einher mit<br />
dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut Boden.<br />
K 138.3: Die Versieglung von 3.600 m² Boden reduziert Menge und Qualität der<br />
Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in<br />
das Schutzgut Wasser.<br />
K 138.4: Das Projektgebiet hat aufgrund seines Baumbestandes einen ausgleichenden<br />
Einfluss auf die Temperaturentwicklung insbesondere auf die südlich<br />
angrenzenden, verdichteten Mischgebietsflächen. Zudem hat er Lufthygienische<br />
Funktionen durch die Filterung von Staubemissionen der umgebenden<br />
Verkehrs- und Gewerbeflächen. Diese Funktionen werden durch die Reduktion<br />
des Baumbestandes erheblich beeinträchtigt.<br />
4.4.24.2.3 Landschaftsbild u. Naherholung<br />
Die Niederung des Finowkanals spielt eine herausragende Rolle für die örtliche<br />
und überörtliche Naherholung. Da sich der bauliche Entwicklungsbereich an die<br />
Ortsrandsituation von Finowfurt anschließt ist eine erhebliche Beeinträchtigung<br />
der Erholungseignung des Landschaftsraumes nicht zu erwarten.<br />
4.4.24.2.4 Landschaftsplanung<br />
K 138.6: Der Landschaftsplan der <strong>Gemeinde</strong> Finowfurt sieht die Ausweisung<br />
des Projektgebietes als Teil des Geschützen Landschaftsbestandteils „Tongruben“<br />
vor. Ziel ist insbesondere die Stärkung der Biotopvebindungsfunktion.<br />
130
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 138 „Gemischte Baufläche““<br />
4.4.24.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 138.1und 138.5<br />
Die Bebauung von 3.600 m² Altbaumbestand ist aufgrund des langen Wiederherstellungszeitraumes<br />
nicht ausgleichbar. Zu Berücksichtigen ist ferner die<br />
Nutzungsintensivierung von weiteren etwa 10.400 m² Altbaumbestand, die zur<br />
Verdrängung störanfälliger Wirbeltiere führen wird und die strukturelle Eignung<br />
als Sommer- und Winterlebensraum für Amphibien beschränkt.. Es entsteht<br />
folgender, über Ersatzmaßnahmen zu leistender Kompensationsbedarf außerhalb<br />
des Projektgebietes:<br />
• Entwicklung von 23.200 m² Laubmischwäldern.<br />
Der Kompensationsflächenermittlung liegt für den Verlust durch Überbauung<br />
ein Eingriffs-Kompensationsflächenverhältnis von 1:5 (vgl. MLUR 2003) und für<br />
die Nutzungsintensivierung von 1:0,5 zugrunde.<br />
Im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung ist besonderes Augenmerk auf<br />
das Vorkommen von Sommerquartieren und Wochenstuben von Fledermäusen<br />
in den Altbäumen zu legen. Die Beeinträchtigung von Fledermausquartieren ist<br />
durch die Hängung von Fledermauskästen gem. Ausgleichsmaßnahme A 138.1<br />
zu kompensieren:<br />
„Für jedes durch Baumfällungen verlustiges Fledermausquartier ist<br />
die Anlage von 2 Fledermauskästen vorzusehen. Die Fledermauskästen<br />
werden in Gruppen von 5 - 7 Stück in einer idealen Hanghöhe<br />
zwischen 3 und 5 Metern angebracht. Vorzugsweise sollte der<br />
Kasten nach Süden orientiert sein, ohne dabei schutzlos der prallen<br />
Sonne ausgesetzt zu sein. Der Kasten heizt sich andernfalls zu<br />
stark auf und wird von Fledermäusen gemieden. Es ist darauf zu<br />
achten, dass die Fledermäuse den Kasten frei anfliegen können; es<br />
dürfen keine Äste vor das Anflugbrett ragen.<br />
• Maße: ca. 450 x 250 x 80 mm.<br />
• Holzstärke: 20 - 25 mm, sägerauh (Fichte/Kiefer), unbehandelt,<br />
Ummantelung aus Teerpappe.<br />
• Einschlupfspalt 20-25 mm. Kasten selbstreinigend.“<br />
K 138.2 bis K 138.4<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Boden, Wasser und Klima<br />
durch die zusätzliche Versiegelung von bis zu 3.600 m² Boden ruft folgende<br />
Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 3.600 m² versiegelten Bodens.<br />
K 138.6<br />
Der Widerspruch zu den Zielen des Landschaftsplans ist bei Realisierung des<br />
Vorhabens nicht durch Kompensationsmaßnahmen aufzulösen. Es ist erforderlich,<br />
dass die <strong>Gemeinde</strong> die Abweichung von ihren landschaftsplanerischen<br />
Zielen städtebaulich begründet.<br />
131
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 139 „Gemischte Baufläche““<br />
4.4.25 Vorhaben 139<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in „Gemischte Baufläche“.<br />
Ein bisher nicht baulich in Anspruch genommenes Grundstück im Außenbereich<br />
soll als gemischte Baufläche einer Wohnnutzung zugeführt<br />
werden.<br />
4.4.25.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.25.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich etwa 250 m östlich des Ortskerns von<br />
Finowfurt auf der Nordseite des Finowkanals und wird über die Straße<br />
„Am Treidelsteig“ erschlossen.<br />
Westlich grenzt das Grundstück an die auslaufende dörfliche Bebauung<br />
von Finowfurt. Östlich befindet sich eine schmale Kleingartensiedlung.<br />
Das Projektgebiet soll die Lücke zwischen Dorfrand und Kleingartengrundstücke<br />
schließen. Nördlich setzt sich die Grünlandbrache des Projektgebietes<br />
fort.<br />
4.4.25.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet wird vollständig von einer Grünlandbrache frischer<br />
Standorte in artenarmer Ausprägung eingenommen (Biotoptyp 05132).<br />
Aufgrund der intensiven anthropogenen Störeinflüsse aus den angrenzenden<br />
Siedlungsstrukturen und der geringen Flächenausdehung wird<br />
die Bedeutung für den Arten und Biotopschutz insgesamt als gering erachtet.<br />
Die unmittelbar südllich an das Projektgebiet angrenzenden Ufergehölze<br />
unterliegen dem Schutz des § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz<br />
und sind von hoher Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
4.4.25.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 1.100 m². Unter Annahme<br />
einer für Einzelhausbebauungen üblichen Versiegelungsgrades<br />
von 60% einschließlich Nebenanlagen wäre die bauliche Inanspruchnahme<br />
von etwa 660 m² eröffnet.<br />
132
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 139 „Gemischte Baufläche““<br />
Biotoptypen Vorhaben 139 (Finowfurt)<br />
4.4.25.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 139.1: Die zusätzliche bauliche Entwicklung von 660 m² beeinträchtigt<br />
Habitatfunktionen von geringer Bedeutung. Im Zuge der Entsiegelung<br />
von versiegelten Flächen stellen sich entsprechende Habitatqualitäten<br />
ohne gesonderte Entwicklungsmaßnahmen ein.<br />
4.4.25.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 139.2: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 660 m² Boden geht einher<br />
mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein Eingriff in das Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Boden von allgemeiner Bedeutung<br />
betroffen.<br />
K 139.2: Der nördliche Bereich des Projektgebietes liegt innerhalb des<br />
50-m-Bereichs der Uferlinie des Finowkanals. Dadurch sind die Verbote<br />
des § 48 Brandenburgisches Naturschutzgesetz einschlägig. Die Untere<br />
Naturschutzbehörde kann eine Ausnahme von diesen Verboten erteilen,<br />
wenn die Eingriffe unbedeutend oder aus überwiegenden Gründen des<br />
Allgemeinwohls notwendig sind. Aufgrund der anthropogenen Überformung<br />
des Abschnittes und des zwischen Projektgebiet und Ufergehölz<br />
verlaufenden Weges sind die Einwirkungen auf den Uferbereich des<br />
Finowkanals vermutlich nicht erheblich.<br />
K 139.3: Die Versieglung von 660 m² Boden reduziert Menge und Qualität<br />
der Grundwasserneubildung. Dies ist ein Eingriff in das Schutzgut<br />
Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes Wasser von<br />
allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
133
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 139 „Gemischte Baufläche““<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.25.2.3 Landschaftsbild<br />
Das Projektgebiet hat in seiner bisherigen Nutzungsform keine wertbildenden<br />
Funktionen für das Schutzgut Landschaftsbild. Soweit die vorhandenen<br />
Gehölzstrukturen südlich des Projektgebietes erhalten bleiben,<br />
ist nicht von einer erheblichen Verschlechterung der<br />
landschaftsästhetischen Situation auszugehen. .<br />
4.4.25.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 139.1 bis 139.3<br />
Der Verlust von etwa 660 m² Grünlandbrache durch bauliche Verdichtung<br />
erfordert folgenden Kompensationsbedarf außerhalb des Projektgebietes:<br />
• Entsiegelung von 660 m² versiegelten Bodens.<br />
Zur vorsorglichen Sicherung der Ufergehölze am Finowkanal sollte die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 139.1 Berücksichtigung finden:<br />
„Die entlang des Finowkanals stehenden Ufergehölze sind<br />
nicht durch bauliche Anlagen oder sonstige Maßnahmen<br />
(auch während der Bauphase) zu beeinträchtigen. Dies gilt<br />
auch für Gehölze, die im Projektgebiet stocken bzw. in das<br />
Projektgebiet hineinragen.“<br />
134
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 140 „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.26 Vorhaben 140<br />
Finowfurt: Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in „Gemischte Baufläche“.<br />
Die bisher als Kleingärten genutzte Fläche soll als gemischte Baufläche<br />
einer Wohnnutzung zugeführt werden.<br />
4.4.26.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.26.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am nördlichen Ortsrand von Finowfurt<br />
südlich des Oder-Havel-Kanals und wird über die Lichterfelder Straße<br />
erschlossen.<br />
Westlich ist das Projektgebiet an die dörfliche Mischbebauung entlang<br />
der Werbelliner Straße angeschlossen. Nach Nord-Osten und Osten<br />
öffnet sich eine intensiv ackerbaulich genutzte Agrarlandschaft<br />
4.4.26.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet wird vollständig von einer Kleingartennutzung mit<br />
kleingartentypischer Vegetationsstruktur eingenommen (Biotoptyp<br />
10250). Die bauliche Dichte ist relativ hoch, die Nutzungsintensität entsprechend.<br />
Derartige Siedlungsstrukturen habe eine gewisse Bedeutung<br />
für kulturfolgende Singvögel und anpassungsfähige, ungefährdete Kleinsäuger.<br />
Die Bedeutung für den Arten und Biotopschutz wird insgesamt<br />
als gering erachtet.<br />
Biotoptypen Vorhaben 140 (Finowfurt)<br />
135
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 140 „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.26.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 2.000 m². Unter Annahme<br />
einer für Einzelhausbebauungen üblichen Versiegelungsgrades<br />
von 60% einschließlich Nebenanlagen wäre die bauliche Inanspruchnahme<br />
von etwa 1.200 m² eröffnet. Gegenwärtig sind etwa 800 m² versiegelt.<br />
Damit ergibt sich ein bauliches Entwicklungspotential von 400<br />
m².<br />
4.4.26.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 140.1: Die zusätzliche bauliche Entwicklung von 400 m² beeinträchtigt<br />
Habitatfunktionen von geringer Bedeutung. Im Zuge der Entsiegelung<br />
von versiegelten Flächen stellen sich entsprechende Habitatqualitäten<br />
ohne gesonderte Entwicklungsmaßnahmen ein.<br />
4.4.26.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 140.2: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 400 m² Boden geht einher<br />
mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein Eingriff in das Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Boden von allgemeiner Bedeutung<br />
betroffen.<br />
K 140.3: Die Versieglung von 400 m² Boden reduziert Menge und Qualität<br />
der Grundwasserneubildung. Dies ist ein Eingriff in das Schutzgut<br />
Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes Wasser von<br />
allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.26.2.3 Landschaftsbild<br />
Das Projektgebiet hat in seiner bisherigen Nutzungsform keine wertbildenden<br />
Funktionen für das Schutzgut Landschaftsbild. Soweit die vorhandenen<br />
Gehölzstrukturen an der Ost- und Nord-Grenze des Projektgebietes<br />
erhalten bleiben, ist nicht von einer erheblichen Verschlechterung<br />
der landschaftsästhetischen Situation auszugehen. .<br />
136
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 140 „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.26.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 140.1 bis 140.3<br />
Der Verlust von etwa 400 m² Kleingartenstrukturen durch bauliche Verdichtung<br />
erfordert folgenden Kompensationsbedarf außerhalb des Projektgebietes:<br />
• Entsiegelung von 400 m² versiegelten Bodens.<br />
137
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 82 „Wohnbaufläche“<br />
Ortsteil Groß Schönebeck<br />
4.4.27 Vorhaben 82<br />
Groß Schönebeck: Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in „Wohnbaufläche“.<br />
4.4.27.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.27.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am östlichen Ortsrand von Groß Schönebeck<br />
und wird über die Mühlenstraße erschlossen.<br />
Westlich liegt eine kleinteilige Agrarlandschaft mit Grabelandcharakter.<br />
Südlich schließt ein kleiner Kiefernforst an, Nördlich und östlich liegen<br />
Einzelhausbebauungen an der Mühlenstraße an.<br />
4.4.27.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet wird vollständig von einer Grünlandbracher trockener<br />
Standorte (Biotoptyp 05133) eingenommen. Die Nährstoffversorgung<br />
des Sandbodens ist mäßig aber keinesfalls handelt es sich um einen<br />
nährstoffarmen Standort. Aus den angrenzenden Siedlungsbereichen<br />
wirken relativ intensive anthropogene Störfaktoren auf das Projektgebiet<br />
ein, so dass der Anteil ruderaler Arten wie Natternkopf, Nachtkerze, Kanadisches<br />
Berufskraut und Arten der Trittrasen wie Spitz-Wegerich hohe<br />
Deckungsgrade erreichen. Aus dem nahen Birkenforst dringt das Landreitgras<br />
mit Ausläufern in das Projektgebiet ein. Neben typischen Wiesenarten<br />
wie Schafgarbe und Großer Sauerampfer finden sich auch<br />
Arten der Sandtrockenrasen wie Jasione, Gras-Nelke oder Silbergras.<br />
Die Trockenrasen-Vertreter profitieren von offensichtlich regelmäßig<br />
eintretenden, kleinflächigen Verletzungen der Vegetationsnarbe durch<br />
anthropogene Einflüsse. Ohne diesen Einfluss könnten sich die Trockenrasenarten<br />
nicht in der Fläche behaupten. Es handelt sich um einen<br />
in Brandenburg häufigen Biotoptyp, der aufgrund der Lage im Siedlungsbereich<br />
für höhere Tierarten keine Rolle als Lebensraum darstellt.<br />
Aufgrund des Blütenreichtums und des leicht erwärmbaren Sandbodens<br />
hat der Biotop aber eine hohe Bedeutung für Blüten besuchende Insekten<br />
und grabende Stechimmen. Die Bedeutung für den Arten und Biotopschutz<br />
wird insgesamt als mittel erachtet.<br />
4.4.27.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 3.800 m². Unter Annahme<br />
einer für Einzelhausbebauungen üblichen Versiegelungsgrades<br />
von 60% wäre die bauliche Inanspruchnahme von etwa 2.300 m² eröffnet.<br />
138
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 82 „Wohnbaufläche“<br />
Biotoptypen Vorhaben 82 (Groß Schönebeck)<br />
4.4.27.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 82.1: Durch die Entwicklung der Wohngrundstücke gehen trockene,<br />
blütenreiche Grünlandbrachen mit insgesamt mittlerer Bedeutung für<br />
den Arten- und Biotopschutz verloren. Unter Berücksichtigung des vollständigen<br />
Lebensraumverlustes für eine vielfältige und spezialisierte<br />
Insektenfauna ist dies als erheblicher Eingriff zu bewerten. Da Biotope<br />
von mittlerer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz betroffen sind,<br />
sind über reine Entsiegelungsmaßnahmen hinaus biotoppflegende bzw.<br />
–entwickelnde Maßnahmen erforderlich.<br />
4.4.27.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 82.2: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 2.300 m² Boden geht einher<br />
mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 82.3: Die Versieglung von 2.300 m² Boden reduziert Menge und Qualität<br />
der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
139
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 82 „Wohnbaufläche“<br />
4.4.27.2.3 Landschaftsbild<br />
Von der Mühlenstraße aus in Richtung Süd-Westen betrachtet bietet<br />
sich z.Z. eine attraktive Blickachse über einen von Wiesen, Felder und<br />
Gärten bestimmten Landschaftsausschnitt. Durch die Entwicklung der<br />
Wohnbaufläche geht dieser Ausblick verloren. Da die Mühlenstraße keine<br />
Funktion für die Naherholung hat, ist dies allerdings nicht als erheblicher<br />
Eingriff zu bewerten. Von Westen aus betrachtet gliedert sich das<br />
Projektgebiet zwanglos in die bestehende Bebauung entlang der Mühlenstraße<br />
ein, so dass sich an der landschaftsästhetischen Situation<br />
nichts ändert.<br />
4.4.27.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 82.1<br />
Der Verlust von etwa 3.800 m² Grünlandbrachen trockener Standorte<br />
erfordert folgenden Kompensationsbedarf:<br />
• Entwicklung und nachhaltige Pflege von 3.800 m² trockenen<br />
Grünland- oder Ackerbrachen zu Sandtrockenrasen.<br />
K 82.1, K 82.2 und K 82.3<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope<br />
(teilweise), Boden und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung von<br />
bis zu 2.300 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb<br />
des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 2.300 m² versiegelten Bodens.<br />
140
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 91, SO „Seniorenresidenz“<br />
4.4.28 Vorhaben 91<br />
Groß Schönebeck: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“<br />
+ „Wald“ in Sondergebiet „Seniorenresidenz“. Ziel ist die Entwicklung<br />
einer großflächigen Wohn- und Wellnessanlage des gehobenen<br />
Standards mit der Zielgruppe der Senioren.<br />
4.4.28.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.28.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am nördlichen Ortsausgang von Groß<br />
Schönebeck an der Bundesstraße 109.<br />
Westlich und nördlich schließen sich ausgedehnte Kiefernforste an. Direkt<br />
nördlich angrenzend befindet sich eine Brachfläche, die als gestörter<br />
Standort anzusehen ist. Östlich auf der gegenüberliegenden Seite<br />
der L 100 und südlich des Projektgebietes liegt die Straßenrandbebauung<br />
des Ortsausganges von Groß Schönebeck.<br />
4.4.28.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet weist ein sanftes Geländeprofil mit Hangkuppen und<br />
Senken auf. Die flächendeckend anstehenden Sandböden sind auf<br />
den Kuppenlagen trockenwarm und mehr oder weniger Nährstoffarm.<br />
In den feuchten Senken ist der Anteil an Humusstoffen hoch, was zu<br />
einer deutlich günstigeren Nährstoffversorgung führt. Die durch das<br />
Geländeprofil vorgegebene Standortvielfalt wird durch unterschiedliche<br />
Nutzungsarten und –intensitäten weiter erhöht.<br />
Das Projektgebiet wird nördlich und westlich von Wald- und Forstflächen<br />
eingerahmt. Im Übergang zu den zentralen Offenlandflächen<br />
stoßen die Waldränder auf frische bis feuchte Senken. Die die höher<br />
gelegenen Forstflächen dominierende Kiefer tritt in diesen Randbereichen<br />
zurück und teilt sich die Deckungsgrade mit Sand-Birke, Stieleiche<br />
und in Bereichen mit sehr hohem Grundwasserstand auch der<br />
Schwarz-Erle (Biotoptyp 08300). Stellenweise erreicht die Sand-Birke<br />
auch die Herrschaft in der Baumschicht. Die Mischkulturen sind licht<br />
und lassen neben einer von Später Traubenkirsche, Faulbaum und<br />
Holunder bestimmten Strauchschicht eine artenreiche Krautschicht mit<br />
Landreitgras, Adlerfarn, Brombeere, Großer Brennnessel, Himbeere<br />
und Wurmfarn zu. Der Struktur- und floristische Artenreichtum der<br />
Misch-Forste in Verbindung mit der gut ausgeprägten Grenzlinie zu<br />
naturnahen oder extensiv genutzten Feuchtwiesen und –Weiden gibt<br />
dem Biotop eine hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Limitierende anthropogene Störeinflüsse wirken auf den Biotop nicht<br />
ein. Es ist davon auszugehen, dass er wichtige Habitatfunktionen für<br />
eine Reihe von geschützten und/oder gefährdeten Tierarten hat. Exemplarisch<br />
wären zu benennen:<br />
Grünspecht Picus viridis (Vogelschutzrichtlinie Anhang 1, BArtSchV),<br />
Waldeidechse (Lacerta vivipara, RL 2; BArtSchV), Blindschleiche Anguis<br />
fragilis (BArtSchV), Waldspitzmaus Sorex araneus (BArtSchV), Gelbhalsmaus<br />
Apodemus flavicollis (BArtSchV).<br />
Außerdem dürften der Biotop aufgrund der Nähe zu geeigneten Laichgewässern<br />
Sommerlebensraum von Moorfrosch Rana arvalis (RL 3;<br />
141
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 91, SO „Seniorenresidenz“<br />
FFH IV), Grasfrosch Rana temporaria (RL 3; BArtSchV) und Erdkröte<br />
Bufo bufo (BArtSchV) sein.<br />
Ebenfalls vielfältig ist das Artenspektrum der Singvögel wie Trauerschnäpper,<br />
Waldbaumläufer, Wald-Laubsänger, Fitis, Mönchsgrasmücke<br />
u.a., die den Mischforst besiedeln.<br />
Die rückwärtigen Kiefernforsten (Biotoptyp 08480) sind überwiegend<br />
Altersklassen-Forste mit relativ geringer struktureller Vielfalt. In der<br />
Strauchschicht findet sich überwiegend die gebietsfremde Späte Traubenkirsche,<br />
die Krautschicht ist relativ artenarm. Als Kontakt- und Pufferbiotop<br />
zu den aus Sicht des Natur- und Landschaftsschutzes wertvolleren<br />
Kiefern-Mischforsten der Randbereiche wird den Kiefern-Forsten<br />
eine mittlere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz beigemessen.<br />
Den größten Flächenanteil im Projektgebiet nehmen offene<br />
Grünlandbiotope ein. Diese bilden ein engmaschiges Netz von Wiesen,<br />
Weiden und Brachen unterschiedlicher Nutzunsintensitäten,<br />
Feuchtigkeitsstufen und divergierender Nährstoffversorgung. Im<br />
Zusammenspiel dieses Biotopmosaiks erreichen die großflächigen<br />
Offenlandbereiche des Projektgebietes Lebensraumqualitäten, die über<br />
die Bedeutung der Einzelbiotope hinausreicht. Der gesamte Bereich ist<br />
relativ störungsarm, sodass auch anspruchsvollere Wiesenbrüter wie<br />
Grauammer Emberiza calandra (RL 1; BArtSchV), Brachpieper (Anthus<br />
campestris, RL 1; VSchRL), Neuntöter Lanius collurio (RL 3; VSchRL),<br />
Schafstelze (Motacilla flava, RL 3) und Braunkehlchen Saxicola rubetra<br />
(RL 2) vorkommen dürften. Unter den Säugetieren ist der Feldhase<br />
Lepus europaeus (RL 2) zu nennen.<br />
Als Nahrungsgast ist der Weißstorch (Ciconia ciconia, RL 1; VSchRL) zu<br />
beobachten.<br />
Den größten Flächenanteil nehmen trockene, floristisch verarmte Grünlandbrachen<br />
(Biotoptyp 051332) und frische floristisch verarmte Grünlandbrachen<br />
(Biotoptyp 051322) ein. Sie nehmen das südliche Drittel<br />
des Projektgebietes nahezu vollständig ein. In unterschiedlichen Deckungsgraden<br />
bestimmen Gemeiner Beifuß, Acker-Kratzdiestel, Schafgarbe,<br />
Großer Sauerampfer und Landreitgras das Erscheinungsbild.<br />
Bereiche mit hoher und dichter Vegetation wechseln sich mit spärlicher<br />
bewachsenen Teilflächen, die zu Grünlandbrachen trockener Standorte<br />
mit einzelnen Trockenrasenarten (Biotoptyp 051331) überleiten. Aufgrund<br />
des Biotopverbundes mit den nördlich anschließenden wertvolleren<br />
Grünlandbiotopen wird den beiden in Brandenburg häufigen und<br />
ungefährdeten Biotoptypen eine mittlere Bedeutung für den Arten- und<br />
Biotopschutz zugewiesen.<br />
Die zentrale Kuppenlage wird von Grünlandbrachen trockener, nährstoffarmer<br />
Standorte mit Vorkommen einzelner Trockenrasenarten (Biotoptyp<br />
051331). Diese gehen nach Norden in gut entwickelte, artenreiche<br />
Sandtrockenrasen (Biotoptyp 05121) der Grasnelkenfluren über. Die<br />
Sandtrockenrasen werden bestimmt von Frühlingsspark (Spergula morisonii),<br />
Bauernsenf (Teesdalia nudicaulis), Silbergras (Corynephorus<br />
canescens), Sandstrohblume (Helichrysum arenarium), Bergglöckchen<br />
(Jasione montana), Grasnelke (Armeria elongata), Feldbeifuß (Artemisia<br />
142
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 91, SO „Seniorenresidenz“<br />
campestris), Rotes Straußgras (Agrostis tenuis), Kleiner Sauerampfer<br />
(Rumex acetosella), Kleines Habichtskraut (Hieracium pilosella) sowie<br />
standorttypische Moose und Flechten. Sandtrockenrasen unterliegen<br />
dem Schutz des § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz. Die Insektenfauna<br />
der warmen und blütenreichen Biotoptypen ist generell artenreich<br />
und beherbergt i.d.R. eine Reihe streng geschützter Arten. Die<br />
beiden Biotope haben eine hohe bzw. sehr hohe Bedeutung für den Arten-<br />
und Biotopschutz.<br />
Westlich der Kuppe fällt das Gelände in eine Senke, deren tiefsten Bereiche<br />
von einer Grünlandbrache feuchter Standorte (Biotoptyp 05131)<br />
eingenommen werden. Ein Mosaik feuchter Hochstaudenfluren mit Kohl-<br />
Kratzdiestel und Groß-Seggen-Röhrichte mit Schlank-Segge, Sumpf-<br />
Schwertlilie, Blutweiderich, Kuckucks-Lichtnelke und Sumpf-Dotterblume<br />
kennzeichnet den nach § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz geschützten<br />
Biotop. Der Biotop hat Habitatqualitäten für eine Reihe geschützter<br />
und gefährdeter Arten wie Brandmaus Apodemus agrarius<br />
(BArtSchV), Waldspitzmaus Sorex araneus (BArtSchV), Zwergspitzmaus<br />
Sorex minutus (BArtSchV), Nordische Wühlmaus Microtus oeconomus<br />
(RL 1; BArtSchV), Moorfrosch Rana arvalis (RL 3; FFH IV), Grasfrosch<br />
Rana temporaria (RL 3; BArtSchV), Ringelnatter Natrix natrix (RL<br />
2; BArtSchV), Bekassine Gallinago gallinago (RL 1), Rohrweihe Circus<br />
aeruginosus (RL 1; VSchRL) u.a.<br />
Innerhalb einer vom Landreitgras dominierten frischen Grünlandbrache<br />
an der L 100 befindet sich eine weitere feuchte Brache, die pflanzensoziologisch<br />
als Kohldistel-Wiese mit Schlank-Segge, Mädesüß, Wiesen-<br />
Bärenklau und Beinwell. Auch dieser Biotop unterliegt dem Schutz des §<br />
32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz.<br />
Die zur L 100 höher gelegenen Weiden (Biotoptyp 05112, artenarme<br />
Fettweiden) werden von den Weidetieren intensiver frequentiert und<br />
haben in erster Linie eine Pufferfunktion für die wertvollen Feuchtweiden.<br />
Dies gilt auch für die als Frischwiese (Biotoptyp 051122, artenarme<br />
Frischwiesen) genutzten Streifen an der L 100. Aufgrund des Biotopverbundes<br />
der Frischwiesen und Frischweiden mit wertvollen Grünlandstandorten<br />
werden den beiden in Brandenburg häufigen Biotoptypen<br />
eine mittlere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz beigemessen.<br />
143
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 91, SO „Seniorenresidenz“<br />
Biotoptypen Vorhaben 91 (Groß Schönebeck)<br />
4.4.28.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Die Gesamtfläche des Sondergebietes umfasst etwa 9,7 ha. Hiervon<br />
werden 4,6 ha als eigentliches Entwicklungsgebiet und 5,1 ha als östlich<br />
und nördlich anschließende Parkanlage ausgewiesen. Da die „Seniorenresidenz“<br />
eine relativ lockere Siedlungsstruktur erhalten soll, wird von<br />
einer GRZ von 0,3 und 50% Überschreitungs-GRZ ausgegangen. Damit<br />
könnten nach Änderung der Flächendarstellung etwa 20.700 m² Boden<br />
versiegelt werden.<br />
4.4.28.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 91.1: Der städtebauliche Entwurf sieht eine erhebliche Umgestaltung<br />
des Projektgebietes vor. Die Sondergebietsfläche befindet sich v.a. im<br />
Bereich frischer bis trockenen, mehr oder weniger artenarmen Grünlandes.<br />
Im Übergangsbereich zum zentralen Sandtrockenrasen sind zudem<br />
artenreiche, trockene Grünlandbrachen betroffen. Im Nordwesten werden<br />
strukturreiche Waldmäntel als potentielle Bauflächen dargestellt. Die<br />
Entwicklung des Sondergebietes wird etwa 20.700 m² Biotopfläche mit<br />
überwiegend mittlerer, teilweise aber auch hoher Bedeutung für den<br />
144
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 91, SO „Seniorenresidenz“<br />
Arten- und Biotopschutz unmittelbar durch Überbauung entwerten. Die<br />
verbleibenden Freiflächen innerhalb des Sondergebietes sollen einer<br />
parkartigen Gestaltung zugeführt werden. Unter Berücksichtigung landschaftsgerechter<br />
Gestaltungsprinzipien muss dies nicht zwingend ebenfalls<br />
zu einer Entwertung führen (s. Vermeidungs- und Kompensationserfordernisse).<br />
Dennoch muss davon ausgegangen werden, dass die<br />
Vorkommen sämtlicher genannter Offenlandarten im Zuge der Projektrealisierung<br />
erlöschen werden.<br />
Die Sondergebietsfläche grenzt mit ihren potentiellen Bauflächen unmittelbar<br />
an nach § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz geschützte<br />
Biotope (feuchte Grünlandbrachen und Sandtrockenrasen). Insbesondere<br />
die feuchte Grünlandbrache ist potentieller Lebensraum für störanfällige<br />
Tierarten, die durch die unmittelbare Nähe zu einer menschlichen<br />
Siedlung verdrängt würden. Dies wäre als erheblicher artenschutzrechtlicher<br />
Konflikt zu bewerten.<br />
Die extensive landwirtschaftliche Nutzung der Feucht- und Trockenbiotope<br />
ist zur Aufrechterhaltung der Lebensraumqualitäten der nach § 32<br />
Brandenburgisches Naturschutzgesetz geschützten Lebensräume erforderlich.<br />
Sowohl die Aufgabe als auch die Intensivierung der Nutzung<br />
führt zu erheblichen Verschlechterungen der Habitatqualitäten.<br />
Des Weiteren ist eine „parkartige“ Umgestaltung von Freiflächen mit<br />
einem in ihrer Gesamtheit hohem bis sehr hohem Funktionswert für den<br />
Arten- und Biotopschutz vorgesehen. Jede landschaftsgestaltende<br />
Maßnahme ist hier als potentieller erheblicher Eingriff zu bewerten. Es<br />
ist erforderlich, die Art- und Weise der Parkgestaltung zu spezifizieren.<br />
Die erforderliche Anlage eines Wegenetzes führt zu weiteren Bodenversiegelungen<br />
und direkten, vollständigen Funktionsverlusten der betroffenen<br />
Biotope. Es wird angenommen, dass innerhalb der Parkanlage ein<br />
Wegenetz mit etwa 500 m Länge neu hergestellt werden wird. Bei einer<br />
durchschnittlichen Wegbreite von 2,5 m ergibt dies eine zusätzliche Versiegelung<br />
von 1.250 m². Der größte Teil des Wegenetzes dürfte innerhalb<br />
von Kiefernforsten mit mittlerer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz<br />
anfallen. Es ist anzunehmen, dass umfängliche Baumfällarbeiten<br />
erforderlich werden. Die Anlage des Wegenetzes trägt zudem zusätzliche<br />
anthropogene Störeinflüsse in die Landschaft, die zu einer<br />
Entwertung der Kiefernforste für störungssensible Tierarten führen. Die<br />
Anlage des Wegenetzes ist somit ein erheblicher Eingriff in Natur und<br />
Landschaft.<br />
4.4.28.2.2 Schutzgut Boden, Wasser und Klima<br />
K 91.2: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 21.950 m² Boden geht<br />
einher mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 91.3: Die Versieglung von 21.950 m² Boden reduziert ohne entsprechende<br />
Vermeidungsmaßnahmen Menge und Qualität der Grundwasserneubildung.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
145
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 91, SO „Seniorenresidenz“<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Das Schutzgut Klima weist im Plangebiet keine Belastungsfaktoren oder<br />
besondere Funktionen für klimatisch belastete Räume auf. Unter Berücksichtigung<br />
der geplanten flächenextensiven, lockeren Bebauung<br />
erreichen die zu erwartenden Baumassen voraussichtlich keine Größenordnungen,<br />
die eine erhebliche Änderung des Lokal-Klimas erwarten<br />
ließen.<br />
4.4.28.2.3 Landschaftsbild<br />
K 91.4: Das Projektgebiet weist insbesondere in den Offenlandbereichen<br />
und in den Übergangsbereichen zu den Forstflächen überdurchschnittliche<br />
Landschaftsbildqualitäten auf. Betroffen ist eine Fläche von<br />
etwa Es zeigt eine vielfältige, extensiv genutzte Kulturlandschaft und<br />
einen prägnanten Übergang zum Ortsrand von Groß Schönebeck. Das<br />
Projektgebiet bietet durch den offenen, weiträumigen Charakter in Verbindung<br />
mit der Begrenzung durch natürlich anmutende Waldränder und<br />
einzelne Obstgehölz bzw. Kiefern-Gruppen zahlreiche Blickachsen und<br />
Blickfänge. Das leicht wellige Geländeprofil schafft zudem eine subtile<br />
Raumbildung. Die Realisierung des Projekts wäre mit dem weitgehenden<br />
Verlust dieser visuellen Qualitäten des Raumes verbunden, was als<br />
erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild zu bewerten ist.<br />
4.4.28.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
Die flächenhaft angedachte, lockere Siedlungsstruktur führt zu erheblichen<br />
Konflikten mit den Belangen des Natur- und Landschaftsschutzes.<br />
Die parkartige Entwicklung der verbleibenden Offenlandbereiche im<br />
Nordosten führt zu weiteren Konflikten. Sowohl unter ökologischen,<br />
städtebaulichen und finanziellen Gesichtspunkten wird empfohlen, die<br />
Projektkonzeption zu überarbeiten.<br />
K 91.1, K 91.4<br />
Es wird hierfür empfohlen, die Grenzen des Sondergebietes nach Norden<br />
zu reduzieren, um wertvolle Biotope nicht überbauen zu können und<br />
ausreichend Pufferflächen zwischen der „Seniorenresidenz“ und den<br />
gesetzlich geschützten Biotopen gewährleisten zu können. Ziel ist, die<br />
Bebauung auf artenarme Grünlandbrachen trockener Standorte zu begrenzen.<br />
Die betroffenen südlichen Offenlandbereiche haben aufgrund<br />
der Nähe zu menschlichen Siedlungen für Offenlandarten eine geringere<br />
Bedeutung. Ein Verlust dieser Flächen würde voraussichtlich nicht zu<br />
einer erheblichen Beeinträchtigung der Habitateignung der zentralen,<br />
wertvollen extensiven Wiesen und Brachen führen. Die konzeptionellen<br />
Änderungen sollten als Vermeidungsmaßnahme V 91.1 und V 91.2 formuliert<br />
werden:<br />
V 91.1<br />
„Die baulichen Anlagen der Seniorenresidenz sind im Bereich<br />
zwischen Prenzlauer Straße und Birkenallee zu konzentrieren.<br />
Die nördliche Grenze der Bebauung sollte die Flucht der beiden<br />
bestehenden südlichen Wohngrundstücke des Projektgebietes<br />
aufnehmen.“<br />
146
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 91, SO „Seniorenresidenz“<br />
V 91.2<br />
„Eine intensive Umgestaltung der nord-östlichen Wiesenlandschaft<br />
zu einer „Parklandschaft“ soll vermieden werden. Die bestehende<br />
Landschaftsstruktur weist hervorragende landshcaftsästhetische<br />
Möglichkeiten für die naturbezogene Naherholung<br />
auf. Die Anlage von Wegen soll ausschließlich auf außerhalb<br />
der von Sandtrockenrasen und Feuchtbrachen erfolgen. Die<br />
Anlage von künstlichen Still- und Fließgewässern soll unterlassen<br />
werden, da dies den topographischen Bedingungen des<br />
Plangebietes widerspricht bzw. die vorhandenen Feuchtbiotope<br />
bedroht. Die Errichtung von Bauwerken wie Pergolengängen,<br />
Pavillons, Skulpturen, Lichtquellen etc. soll unterlassen werden.“<br />
Zum Erhalt der Biotopqualitäten der gesetzlich geschützten Feucht- und<br />
Trockenbiotope wird die Übernahme der Vermeidungsmaßnahme V<br />
91.3 empfohlen:<br />
„Feuchtweiden und feuchte Grünlandbrachen sowie Trockenrasen<br />
sind einmal jährlich nach dem 01.08. eines Jahres<br />
zu mähen. Das Mähgut ist abzufahren.“<br />
Durch die Vermeidungsmaßnahme V 91.1 reduziert sich die überbaubare<br />
Grundfläche auf etwa 2,1 ha, die bei einer GRZ von 0,6 in kompakterer<br />
Bauweise eine überbaubare Fläche von 12.600 m² ermöglichen würden.<br />
Dies scheint eine ausreichende und wirtschaftlich realistische Größenordnung<br />
für eine Seniorenresidenz zu sein.<br />
Die weiteren Konfliktbetrachtungen erfolgen auf Basis der unter Berücksichtigung<br />
der Vermeidungsmaßnahme V 91.1 möglichen Mehrversiegelung<br />
von 13.850 m² (12.600 m² + 1.250 m² Waldwege).<br />
K 91.1 bis K 91.3<br />
Zur Kompensation der zu erwartenden Beeinträchtigung von Flächen mit<br />
für den Arten- und Biotopschutz geringer bis mittlerer Bedeutung und die<br />
Beeinträchtigung von Boden- und Wasserfunktionen durch Versiegelung<br />
ist folgende Maßnahme außerhalb des Projektgebietes erforderlich:<br />
• Entsiegelung von 13.850 m² versiegelten Bodens.<br />
Zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Wasser wird die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 91.3 empfohlen:<br />
„Oberflächlich anfallende Niederschläge sollen im Plangebiet<br />
durch ein Mulden-/Rigolen-System mit Anschluss an retentionsfähige<br />
Grünanlagen versickert werden. Die Maßnahme ermöglicht<br />
den weitgehenden Erhalt der Grundwasserneubildung und<br />
reduziert die über das Kanalsystem abzuführenden Wassermengen.“<br />
147
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 91, SO „Seniorenresidenz“<br />
K 91.4<br />
Durch die Vermeidungsmaßnahme V 91.1 beschränken sich die Landschaftsbildbeeinträchtigungen<br />
auf die neu entstehende Baukörperlinie.<br />
Aufgrund der hohen visuellen Qualität des Landschaftsraumes und des<br />
bislang landschaftsästhetisch ansprechenden Übergangs zum Ortsrand<br />
von Groß Schönebeck ist diese Entwicklung als erheblicher Eingriff zu<br />
werten. Zur Kompensation werden die Ausgleichsmaßnahmen A 91.1<br />
und A 91.2 vorgeschlagen:<br />
A 91.1:<br />
„Der Übergang zwischen den baulichen Anlagen der „Seniorenresidenz“<br />
und der freien Landschaft ist innerhalb der Sondergebietsfläche<br />
durch Gehölzpflanzungen der Pflanzlisten 3 und 4<br />
(s. Anhang 3) landschaftsgerecht zu gestalten.“<br />
A 91.2:<br />
„Die verbleibenden Grünlandbrachen trockener und frischer<br />
Standorte mit einer Fläche von etwa 25.000 m² sind zweimal<br />
jährlich nach dem 30.06. zu mähen, das Mahdgut ist abzufahren,<br />
um eine langfristige Aushagerung der Fläche zu ermöglichen.“<br />
Ziel ist die Entwicklung einer extensiven Wiesenlandschaft mit hohem<br />
landschaftsästhetischem Wert.<br />
K117:<br />
Zur Kompensation der Anlage von Wegen innerhalb der nord-westlich<br />
gelegenen Kiefernforste und den damit verbundenen Baumverlusten<br />
sowie dem erhöhten anthropogenen Störeintrag soll für die Kiefernforste<br />
des Projektgebietes die Ausgleichsmaßnahme A 91.3 festgesetzt werden:<br />
„Die Kiefernforste des Projektgebietes sollen langfristig zu<br />
standortgemäßen Mischwäldern mit hohem Anteil an Laubbaumarten<br />
(insbesondere Rotbuche Fagus sylvestica) ökologisch<br />
umgebaut werden.“<br />
Sollte die <strong>Gemeinde</strong> am bisherigen Konzept festhalten und die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 91.1 nicht berücksichtigen ergeben sich<br />
veränderte Vermeidungs- und erhöhte Kompensationserfordernisse:<br />
K 91.1<br />
Zur Reduzierung der Beeinträchtigungen des Schutzgutes Arten- und<br />
Lebensgemeinschaften durch die flächenhafte Siedlungsentwicklung<br />
wird die Vermeidungsmaßnahme V 91.1b vorgeschlagen:<br />
„Die nach § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz geschützten<br />
Biotope sind nicht durch bauliche Anlagen, Nebenanlagen<br />
oder Parkwege in Anspruch zu nehmen. Zum<br />
Erhalt der Biotopqualitäten der Feuchtweiden und feuchten<br />
Grünlandbrachen sowie Trockenrasen sind diese einmal<br />
jährlich nach dem 01.08. eines Jahres zu mähen. Das Mähgut<br />
ist abzufahren.“<br />
148
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 91, SO „Seniorenresidenz“<br />
K 91.1 bis K 91.3<br />
Zur Kompensation der zu erwartenden Beeinträchtigung von Flächen mit<br />
für den Arten- und Biotopschutz geringer bis mittlerer Bedeutung und die<br />
Beeinträchtigung von Boden- und Wasserfunktionen durch Versiegelung<br />
ist folgende Maßnahme außerhalb des Projektgebietes erforderlich:<br />
• Entsiegelung von 21.950 m² versiegelten Bodens.<br />
Zur weiteren Minimierung der Eingriffe in das Schutzgut Wasser wird die<br />
Vermeidungsmaßnahme V 91.3 empfohlen:<br />
„Oberflächlich anfallende Niederschläge sollen im Plangebiet<br />
durch ein Mulden-/Rigolen-System mit Anschluss an retentionsfähige<br />
Grünanlagen versickert werden. Die Maßnahme ermöglicht<br />
den weitgehenden Erhalt der Grundwasserneubildung und<br />
reduziert die über das Kanalsystem abzuführenden Wassermengen.“<br />
K 91.4<br />
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes auf einer Fläche von etwa<br />
10 ha ist nicht ausgleichbar. Die verbleibenden „Parkflächen“ innerhalb<br />
des Projektgebietes sind landschaftsästhetisch nicht auszuwerten. Die<br />
flächenhafte Siedlungsentwicklung führt zu einer nicht zu mindernden<br />
Zersiedelung des nord-westlichen Ortsrandes von Groß Schönebeck. Im<br />
Rahmen des <strong>Umweltbericht</strong>es zum FNP ist nicht zu klären, ob andere<br />
Ortsrandsituationen von Groß Schönebeck in einer Größenordnung von<br />
etwa 10 ha zur Verfügung stehen, um landschaftsästhetisch aufgewertet<br />
zu werden. Dieses Kompensationsdefizit muss im Rahmen der verbindlichen<br />
Bauleitplanung bearbeitet werden. Als potentieller Suchraum für<br />
defizitäre Ortsrandsituationen ist insbesondere der südliche Ortsrand<br />
von Groß Schönebeck zwischen der Landestraße 212 als westliche und<br />
der Eichhorster Straße als östliche Begrenzung heranzuziehen.<br />
149
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 141 “Gemischte Baufläche“<br />
4.4.29 Vorhaben 141<br />
Groß Schönebeck: Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in „Gemischte<br />
Baufläche“.<br />
4.4.29.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.29.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich unmittelbar angrenzend an den östlichen<br />
Ortsausgang von Groß Schönebeck an der Landesstraße 212 Richtung<br />
Liebenwalde. Östlich schließt sich entsprechend die dörfliche Kernbebauung<br />
Groß Schönebecks an. Nach Norden und Süden liegen angrenzend<br />
weitere mit Einzelhäusern bebaute Außenbereichsgrundstücke.<br />
Richtung Westen öffnet sich die freie Feldflur.<br />
4.4.29.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das gesamte Grundstück wird als Lagerfläche für überwiegend landwirtschaftliche<br />
Gerätschaften genutzt (Biotoptyp 12740). Das Gelände ist<br />
unbebaut, aufgrund der intensiven Lagerflächennutzung ist der Oberboden<br />
stark verdichtet und etwa zur Hälfte vegetationsfrei. Diese Flächen<br />
sind als teilversiegelt (50%) zu bewerten. Die Vegetationsstrukturen auf<br />
den verbleibenden Flächen sind artenarme Trittrasen. Insgesamt handelt<br />
es sich um einen in Brandenburg häufigen und ungefährdeten Biotoptyp.<br />
Die Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz ist sehr gering.<br />
Biotoptypen Vorhaben 141 (Groß Schönebeck)<br />
150
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 141 “Gemischte Baufläche“<br />
4.4.29.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt. Soweit sich im Rahmen der nachfolgenden<br />
Konfliktermittlungen für die einzelnen Schutzgüter Konflikte durch<br />
die vorgesehenen Planungen ergeben, werden dies mit „K133“ bis „K n“<br />
durchnummeriert.<br />
Das Projektgebiet hat eine Flächenausdehnung von etwa 2.000 m².<br />
Hiervon sind etwa 300 m² als teilversiegelt zu bewerten. Dies entspricht<br />
rechnerisch einer Vollversiegelung von 150 m². Bei einer möglichen<br />
GRZ von 0,8 inklusive Überschreitungs-GRZ für die städtebauliche Kategorie<br />
„Gemischte Baufläche“ würde ein bauliches Entwicklungspotential<br />
von etwa 1.600 m² eröffnet. Dies entspricht einer Mehrversiegelung<br />
von 1.450 m².<br />
4.4.29.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 141.1: Die Versiegelung von 1.450 m² Lagerfläche ist trotz der sehr<br />
geringen Bedeutung des Biotops für den Arten- und Biotopschutz ein<br />
erheblicher Eingriff, der kompensiert werden muss. Die beeinträchtigten<br />
Habitatqualitäten sind durch Entsiegelungsmaßnahmen ohne zusätzliche<br />
Biotopentwicklungsmaßnahmen kurzfristig wiederherstellbar.<br />
4.4.29.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 141.2: Die Versiegelung von etwa 1.450 m² Boden geht einher mit<br />
dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut<br />
Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes Boden von<br />
allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 141.3: Die Versieglung von 1.450 m² Boden reduziert Menge und<br />
Qualität der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.29.2.3 Landschaftsbild<br />
K 141.4: Das Projektgebiet ist Teil des Übergangs Groß Schönebecks in<br />
die freie Landschaft. Der nordwestliche Ortsrand ist reich an Grünstrukturen<br />
der rückwärtigen Gärten und bietet eine landschaftsästhetisch ansprechende<br />
Situation, die über die Kastanienallee auf attraktive Weise<br />
erschlossen wird. Der nord-westliche Ortsrand hat somit eine wichtige<br />
Funktion für das Landschaftserleben und die Naherholung. Insbesonde-<br />
151
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Groß Schönebeck; Vorhaben Nr. 141 “Gemischte Baufläche“<br />
re durch die zu erwartenden Herstellung von Lagerhallen bzw. Maschinen-Unterständen<br />
sind visuelle Beeinträchtigungen der Erholungseignung<br />
dieses Landschaftsraumes zu besorgen.<br />
4.4.29.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 141.1, K 141.2 und K 141.3<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope,<br />
Boden und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung von bis zu 1.450<br />
m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 1.450 m² versiegelten Bodens.<br />
K 141.4<br />
Zur Minderung der im Rahmen der Errichtung anzeige- oder genehmigungspflichtiger<br />
baulicher Anlagen zu erwartenden Beeinträchtigung des<br />
Schutzgutes Landschaftsbild wird die Minderungsmaßnahme V 141.1<br />
vorgeschlagen:<br />
„Die Höhe der zu errichtenden baulichen Anlagen darf 6,00 m<br />
über Oberkante Oberboden nicht überschreiten“.<br />
Ziel ist, eine landschaftsgerechte Einbindung des Vorhabengebietes<br />
durch Grünstrukturen zu ermöglichen.<br />
Zur Kompensation der verbleibenden, im Rahmen der Errichtung anzeige-<br />
oder genehmigungspflichtiger baulicher Anlagen zu erwartenden<br />
Landschaftsbildbeeinträchtigungen wird die Ausgleichsmaßnahme A<br />
141.1 zur Umsetzung empfohlen:<br />
„Entlang der westlichen und nördlichen Grenzen des geplanten<br />
Mischgebietes soll die Anlage einer mindestens 3 m breiten<br />
Baumhecke erfolgen. Auf 5 m Hecke sind 1 Baum der Pflanzliste<br />
3 als zukünftige Überhälter zu setzen (s. Anhang 3). Pro m²<br />
Pflanzfläche sind zusätzlich 2 Sträucher der Pflanzliste 4 zu<br />
pflanzen (s. Anhang 3).“<br />
4.4.30 Vorhaben 142 (entfallen)<br />
152
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Klandorf; Vorhaben Nr. 108 “Gemischte Baufläche“<br />
Ortsteil Klandorf<br />
4.4.31 Vorhaben 108<br />
Klandorf: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ und<br />
„Grünfläche“ in „Gemischte Baufläche.<br />
4.4.31.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.31.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am nord-westlichen Ortsrand von Klandorf<br />
und wird über die Dorfstraße erschlossen.<br />
Klandorf liegt innerhalb einer großräumigen Ackerlandschaft. Süd-östlich<br />
grenzt das Projektgebiet an den Ortskern von Klandorf.<br />
4.4.31.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet ist derzeit als typischer Übergangsbereich von einer<br />
dörflichen Siedlung in die freie Feldflur zu bezeichnen. Feldgehölze und<br />
unterschiedlich intensiv genutzte Grünflächen charakterisieren den Bereich.<br />
An die dörfliche Kernbebauung (Biotoptyp 12290), die die im Süd-Osten<br />
gelegenen Teile des Projektgebietes umfassen, schließt sich eine extensiv<br />
als Garten (Biotoptyp 10111) genutzte Fläche, die in Teilen auch<br />
brach liegt. Gehölze weist die Fläche nicht auf, es überwiegen extensive<br />
Rasen und kleinere Lagerflächen. Die beiden Biotoptypen sind für den<br />
Arten- und Biotopschutz von geringer Bedeutung.<br />
An die Gartenflächen grenzt ein Sandtrockenrasen (Biotoptyp 05121) in<br />
der Ausprägung eines Grasnelken-Sandtrockenrasens. Die blütenreiche<br />
Fläche über den leicht erwärmbaren Sandböden bietet einer Vielzahl<br />
spezialisierter Insekten und Spinnenarten Lebensraum. Der Biotop fällt<br />
unter den Schutz des § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz und<br />
hat entsprechend eine hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Die Biotopwertigkeit ist aufgrund der geringen Flächengröße und<br />
der direkten Nähe des besiedelten Bereichs leicht reduziert, weil die<br />
Fläche von anspruchsvolleren, störungsempfindlicheren Wirbeltieren<br />
nicht besiedelt wird.<br />
Zur freien Ackerflur nach Norden ist der Siedlungsrand durch ein strukturreiches,<br />
standortgemäßes Feldgehölz mit dominantem Altbaumbestand<br />
landschaftsgerecht abgegrenzt. Feldgehölze sind wichtige Trittsteinbiotope<br />
in der Agrarlandschaft, die einer Vielzahl von Tierarten eine<br />
Besiedlung der Feldflur ermöglichen. Das Feldgehölz hat eine hohe Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Östlich des Feldgehölzes, außerhalb des Projektgebietes befindet sich<br />
eine Grünlandbrache trockener Standorte über (Biotoptyp 051332).<br />
Nach Norden schließen Intensiv-Acker an.<br />
4.4.31.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
153
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Klandorf; Vorhaben Nr. 108 “Gemischte Baufläche“<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 9.200 m². Unter Annahme<br />
einer für „Gemischte Bauflächen“ gemäß Baunutzungsverordnung<br />
möglichen Grundflächenzahl von insgesamt 0,8 wäre die bauliche<br />
Inanspruchnahme von etwa 7.400 m² eröffnet. Unter Berücksichtigung<br />
der bereits überbauten Flächen von etwa 2.200 m² ergibt sich eine tatsächliche<br />
Mehrversiegelung von 5.200 m².<br />
Biotoptypen Vorhaben 108 (Klandorf)<br />
4.4.31.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 108.1: Durch die Entwicklung der Wohngrundstücke gehen nach § 32<br />
geschützte Trockenrasen mit einer Fläche von etwa 2.000 m² verloren.<br />
Für den Eingriff ist eine Ausnahmegenehmigung der Unteren Naturschutzbehörde<br />
von den Verboten des § 32 erforderlich. Der Nachweis<br />
der Ausgleichbarkeit des Eingriffes wäre hierfür erforderlich.<br />
K 108.2: Die Beseitigung des Feldgehölzes mit einer Fläche von etwa<br />
1.300 m² wäre ebenfalls ein erheblicher Eingriff in die Belange des Arten-<br />
und Biotopschutzes. Der Eingriff wäre aufgrund der langen Wiederherstellungszeiträume<br />
von alten Gehölzstrukturen nicht ausgleichbar,<br />
sondern müsste über Ersatzmaßnahmen kompensiert werden.<br />
K 108.3: Durch die Überbauung von Biotopen mit geringer Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz gehen weitere Lebensräume verloren.<br />
Ein Ausgleich ist kurzfristig im Rahmen der Entsiegelung versiegelter<br />
Bodenflächen möglich, da sich die beeinträchtigten Habitatqualitäten<br />
ohne weitere Entwicklungsmaßnahmen einstellen.<br />
154
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Klandorf; Vorhaben Nr. 108 “Gemischte Baufläche“<br />
4.4.31.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 108.4: Die Versiegelung von zusätzlich etwa 5.200 m² Boden geht<br />
einher mit dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen<br />
des Bodens. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 108.5: Die Versieglung von 5.200 m² Boden reduziert Menge und<br />
Qualität der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.31.2.3 Landschaftsbild<br />
K 108.6: Eine flächendeckende bauliche Entwicklung des Projektgebietes<br />
beeinträchtigt die derzeit visuell ansprechende Einbindung des Ortsrandes<br />
von Klandorf. Insbesondere die Beseitigung des Feldgehölzes<br />
oder eine dem Feldgehölz nord-östlich vorgelagerte Bebauung hätte<br />
eine erhebliche Beeinträchtigung des Landschaftsbildes zur Folge.<br />
4.4.31.2.4 Schutzgebiete<br />
K 108.7: Das Projektgebiet liegt innerhalb der Schutzzone III des Biosphärenreservates<br />
<strong>Schorfheide</strong> Chorin (Zone der wirtschaftlich genutzten<br />
harmonischen Kulturlandschaft). Die Schutzzone III ist als Landschaftsschutzgebiet<br />
rechtlich gesichert. Die Errichtung zusätzlicher Gebäude<br />
im Außenbereich kollidiert das Vorhaben mit dem Schutzzweck<br />
des Biosphärenreservates gem. § 4 Absatz 2 und 3 (Landschaftsbild<br />
und Naherholung) sowie Verboten des § 6 Abs. 1 der Schutzgebietsverordnung<br />
(MUNRE 1990):<br />
• bauliche Anlagen außerhalb der im Zusammenhang bebauten<br />
Ortsteile oder des Geltungsbereiches rechtskräftiger Bebauungspläne<br />
zu errichten oder zu erweitern.<br />
4.4.31.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 108.1<br />
Die Überbauung der Sandtrockenrasen sollte vermieden werden und<br />
entsprechend die Vermeidungsmaßnahme V 108.1 übernommen werden:<br />
„Die Inanspruchnahme von gesetzlich geschützten Sandtrockenrasen<br />
durch bauliche Anlagen soll unterbleiben.“<br />
K 108.2<br />
Die Beseitigung des Feldgehölzes sollte durch Übernahme der Vermeidungsmaßnahme<br />
V 108.2 vermieden werden:<br />
155
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Klandorf; Vorhaben Nr. 108 “Gemischte Baufläche“<br />
„Die Inanspruchnahme des Feldgehölzes durch bauliche Anlagen<br />
soll unterbleiben.“<br />
K 108.3, K 108.4 und K 108.5<br />
Unter Berücksichtigung der Vermeidungsmaßnahmen V 108.1 und V<br />
108.2 reduziert sich die zusätzlich überbaubare Grundfläche auf etwa<br />
2.000 m². Bei einer Gesamtversiegelung von 80% wäre damit eine<br />
Mehrversiegelung von etwa 1.600 m² möglich. Für die Kompensation<br />
der Eingriffe in die Schutzgüter Arten und Lebensgemeinschaften, Boden<br />
und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung ruft folgende Kompensationserfordernisse<br />
außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 1.600 m² versiegelten Bodens.<br />
K 108.7<br />
Die Aufsichtsbehörde der Biosphärenreservatsverwaltung kann von den<br />
oben genannten Verboten Befreiungen nach § 8 der Schutzgebietsverordnung<br />
erteilen, u.a.<br />
• wenn die Durchführung der Vorschrift zu einer nicht beabsichtigten<br />
Härte führen würde und die Abweichung mit den Belangen<br />
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu vereinbaren ist<br />
oder<br />
• überwiegende Gründe des Gemeinwohls die Befreiung erfordern.<br />
Alternativ kann die Durchführung eines verbindlichen Bauleitplanverfahrens<br />
den Konflikt formal auflösen. Im Rahmen des B-Planverfahrens<br />
wären auch die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen zu ermitteln,<br />
wenn die <strong>Gemeinde</strong> die Vermeidungsmaßnahme V 108.1 nicht verfolgen<br />
will und eine wesentliche Erweiterung der Erholungsinfrastruktur<br />
angestrebt wird. Die Kompensation sollte in diesem Fall insbesondere<br />
auf die Sicherung und Entwicklung des hydrologischen Einzugsgebietes<br />
des Moospfuhls (Minimierung von Eutrophierungsprozessen) und der<br />
Sicherung und Entwicklung störungsarmer Räume für störungsanfällige<br />
Tierarten abzielen.<br />
Da der Bauantrag für die neu zu errichtenden Gebäude auf Standorte<br />
innerhalb des Sandtrockenrasens zurückgreift, wird davon ausgegangen,<br />
dass die <strong>Gemeinde</strong> die Vermeidungsmaßnahme V 108.1<br />
nicht berücksichtigen möchte. Dadurch ergeben sich veränderte<br />
Kompensationsbedarfe:<br />
K 108.1<br />
Es ist der Verlust von etwa 2.000 m² Sandtrockenrasen außerhalb des<br />
Projektgebietes zu kompensieren:<br />
• Entwicklung und nachhaltige Pflege von 9.000 m² trockenen<br />
Grünlandbrachen zu Sandtrockenrasen<br />
Es wird ein Eingriffs-Ausgleichsflächenverhältnis von 1:4,5 angenommen.<br />
156
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Klandorf; Vorhaben Nr. 108 “Gemischte Baufläche“<br />
K 108.4 und K 108.5<br />
Die Beeinträchtigung der Schutzgüter Boden und Wasser durch die Versiegelung<br />
von bis zu 5.200 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse<br />
außerhalb des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 5.200 m² versiegelten Bodens.<br />
157
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Klandorf; Vorhaben Nr. 132 “Gemischte Baufläche “<br />
4.4.32 Vorhaben 132<br />
Klandorf: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
„Gemischte Baufläche“<br />
4.4.32.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.32.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am süd-östlichen Ortsrand von Klandorf<br />
und wird über die Marienwerder Straße erschlossen.<br />
Das Projektgebiet schließt eine Lücke zwischen der südlich anschließenden<br />
Straßenrandbebauung und dem nördlich angrenzenden Friedhof.<br />
Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befinden sich Gärten.<br />
Nach Osten öffnet sich die Agrarlandschaft.<br />
4.4.32.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet wird vollständig von einem intensiv genutzten Acker<br />
(Biotoptyp 09133) eingenommen. Die Bedeutung für den Arten und Biotopschutz<br />
ist gering.<br />
Biotoptypen Vorhaben 132 (Klandorf)<br />
4.4.32.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 2.700 m². Unter Annahme<br />
einer für „Gemischte Bauflächen“ üblichen Versiegelungsgrades<br />
von 80% wäre die bauliche Inanspruchnahme von etwa 2.100 m² eröffnet.<br />
158
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Klandorf; Vorhaben Nr. 132 “Gemischte Baufläche “<br />
4.4.32.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 132.1: Die Versiegelung von 2.100 m² Intensivacker ist trotz der geringen<br />
Bedeutung des Biotops für den Arten- und Biotopschutz ein erheblicher<br />
Eingriff, der kompensiert werden muss. Die beeinträchtigten<br />
Habitatqualitäten sind durch Entsiegelungsmaßnahmen ohne zusätzliche<br />
Biotopentwicklungsmaßnahmen kurzfristig wiederherstellbar.<br />
Die nicht überbauten Flächen des Projektgebietes werden zukünftig als<br />
Gärten genutzt. Mit dieser Nutzungsänderung gehen keine Eingriffe in<br />
das Schutzgut einher.<br />
4.4.32.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 132.2: Die Versiegelung von etwa 2.100 m² Boden geht einher mit<br />
dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut<br />
Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes Boden von<br />
allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 132.3: Die Versieglung von 2.100 m² Boden reduziert Menge und<br />
Qualität der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.32.2.3 Landschaftsbild<br />
K 132.4: Von der Marienwerder Straße aus in Richtung Osten öffnet sich<br />
durch das „Fenster“ zwischen Friedhof und südlicher Straßenrandbebauung<br />
eine reizvolle Blickachse in die Freie Feldflur. Diese Blickachse<br />
wird durch das Vorhaben verbaut. Dies ist ein erheblicher Eingriff in das<br />
Landschaftserleben.<br />
4.4.32.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 132.1, K 132.2 und K 132.3<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope,<br />
Boden und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung von bis zu 2.100<br />
m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 2.100 m² versiegelten Bodens.<br />
K 132.4<br />
Der Verlust der Blickachse ist nicht auszugleichen. Es wird daher die<br />
Festsetzung der Ersatzmaßnahme E 132.1 vorgeschlagen:<br />
159
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Klandorf; Vorhaben Nr. 132 “Gemischte Baufläche “<br />
„Entlang der nach Osten liegenden Projektgebietsgrenze ist eine<br />
Baumhecke mit Baumhecke mit Baum- und Straucharten<br />
der Pflanzlisten 1 bzw. 4 (s. Anlage 5) mit einer Gesamtlänge<br />
von etwa 90 m angelegt. Auf 10 m Hecke sind 1 Baum als zukünftige<br />
Überhälter sowie 2 Sträucher pro m² Pflanzfläche zu<br />
setzen. Die Mindestbreite der Hecke soll 2,50 m betragen.“<br />
Ziel ist, ersatzweise die Ansicht des neuen Gebäudebestandes von der<br />
freien Feldflur aus landschaftsgerecht einzupassen.<br />
160
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Klandorf; Vorhaben Nr. 143 “Gemischte Baufläche “<br />
4.4.33 Vorhaben 143<br />
Klandorf: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
„Gemischte Baufläche“.<br />
4.4.33.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.33.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich etwa 500 m westlich des Ortsrandes von<br />
Klandorf gegenüber des Bahnhofs Klandorf an der Kreisstraße 6010, die<br />
einen knappen Kilometer westlich Anschluss hat an die B 109.<br />
Zwischen dem Innenbereich von Klandorf und dem Projektgebiet liegen<br />
eine Reihe von bebauten Grundstücken. Zwei der Drei Grundstücke des<br />
Projektgebietes selbst sind ebenfalls mit Einzelhausanlagen bebaut. Es<br />
wird davon ausgegangen, dass es sich um Altbestand mit entsprechendem<br />
Bestandsschutz handelt.<br />
Nach Norden und Westen begrenzt eine Geländeanhöhe mit Kiefernforst<br />
das Projektgebiet. Südlich schließt sich eine offene Wiesenlandschaft<br />
an.<br />
4.4.33.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das nördliche Grundstück ist mit einem Einzelgebäude einschließlich<br />
umfänglicher Nebenanlagen bebaut (Biotoptyp 12290). Die Gartenflächen<br />
sind mit Ausnahme des nördlichen Abschlusses zur Kreisstraße<br />
weitgehend baum- und gehölzfrei.<br />
Das südliche Grundstück ist ebenfalls mit einem Einzelgebäude und<br />
diversen Nebengebäuden und sonstigen Nebenanlagen bebaut (12290).<br />
Die Gartenbereiche sind entlang der Kreisstraße von Bäumen und Gehölzen<br />
dominiert. Die hinteren Gartenflächen sind weitgehend gehölzfrei.<br />
Beide Grundstücke stellen einen in Brandenburg häufigen und ungefährdeten<br />
Biotoptyp dar. Er spielt als Lebensraum eine Rolle für eine<br />
Reihe von kulturfolgenden Ubiquisten. Insgesamt ist die Bedeutung für<br />
den Arten und Biotopschutz gering.<br />
Das zentrale Grundstück mit einer Flächenausdehnung von etwa 2.300<br />
m² ist unbebaut und weist eine artenarme Grünlandbrache frischer<br />
Standorte auf (Biotoptyp 05132). Aufgrund der geringen Flächenausdehnung<br />
und der direkten anthropogenen Störeinflüsse spielt der Biotop<br />
für Arten des Offenlandes keine Rolle als Lebensraum. Die floristische<br />
Vielfalt ist gering, so dass auch unter den Wirbellosen Artengruppen<br />
lediglich ungefährdete Generalisten zu erwarten sind. Die Bedeutung für<br />
den Arten- und Biotopschutz ist mithin gering.<br />
161
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Klandorf; Vorhaben Nr. 143 “Gemischte Baufläche “<br />
Biotoptypen Vorhaben 143 (Klandorf)<br />
4.4.33.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Es wird angenommen, dass entsprechend der ortsüblichen Nutzung die<br />
im Rahmen der städtebaulichen Kategorie „Gemischte Baufläche“ möglichen<br />
baulichen Dichten nicht erreicht werden. Eine Orientierung an den<br />
ortsüblichen baulichen Dichten legt eine durchschnittliche GRZ von 0,4<br />
zzgl 50% Überschreitungs-GRZ nahe. Da die beiden bebauten<br />
Grundstücke diese Werte bereits erreicht haben, erfolgt die Konfliktermittlung<br />
lediglich für das unbebaute, zentrale Grundstück mit einer Fläche<br />
von etwa 2.300 m². Hier würde ein bauliches Entwicklungspotential<br />
von 1.260 m² eröffnet.<br />
4.4.33.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 143.1: Die Versiegelung von 1.260 m² artenarmer Grünlandbrache ist<br />
trotz der geringen Bedeutung des Biotops für den Arten- und Biotopschutz<br />
ein erheblicher Eingriff, der kompensiert werden muss. Die beeinträchtigten<br />
Habitatqualitäten sind durch Entsiegelungsmaßnahmen ohne<br />
zusätzliche Biotopentwicklungsmaßnahmen kurzfristig wiederherstellbar.<br />
Die nicht überbauten Flächen des Projektgebietes werden zukünftig als<br />
Gärten genutzt. Mit dieser Nutzungsänderung gehen keine Eingriffe in<br />
das Schutzgut einher.<br />
162
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Klandorf; Vorhaben Nr. 143 “Gemischte Baufläche “<br />
4.4.26.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 143.2: Die Versiegelung von etwa 1.260 m² Boden geht einher mit<br />
dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut<br />
Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes Boden von<br />
allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 143.3: Die Versieglung von 1.260 m² Boden reduziert Menge und<br />
Qualität der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.26.2.3 Landschaftsbild<br />
In der örtlichen Situation mit den vorhandenen Baugrundstücken und<br />
dem gegenüber liegenden Bahnhof würde eine Schließung der Baulücke<br />
keine landschaftsästhetisch auffällige Nutzungsform darstellen. Da das<br />
Projektgebiet keine überdurchschnittlichen visuellen Qualitäten aufweist,<br />
ist kein erheblicher Eingriff in das Schutzgut Landschaftsbild zu erwarten.<br />
4.4.26.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 143.1, K 143.2 und K 143.3<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope,<br />
Boden und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung von bis zu 1.260<br />
m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 1.260 m² versiegelten Bodens.<br />
163
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 4 “Sondergebiet Fotovoltaik“ und „Sondergebiet Windkraft“<br />
Ortsteil Lichterfelde<br />
4.4.34 Vorhaben 4<br />
Lichterfelde: Übernahme des Windnutzungs-Eignungsgebietes aus dem<br />
sachlichen Teilplan „Windnutzung, Rohstoffsicherung- und Gewinnung“<br />
des Regionalplans Uckermark-Barnim durch Änderung der Darstellung<br />
des FNP von „Fläche für die Landwirtschaft“ und „Versorgung“ in Sondergebiet<br />
„Windkraft - Konzentrationszone“. Das Sondergebiet Windkraft<br />
übernimmt die Grenzen des Windeignungsgebietes. Neben den bereits<br />
bestehenden Windenergie-Anlagen sind innerhalb des Sondergebietes<br />
weitere Anlagen realisierbar.<br />
Die Fotovoltaikanlage soll als zusätzliches Element der regenerativen<br />
Energiegewinnung in das Windeignungsgebiet integriert werden.<br />
4.4.34.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.34.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich nord-östlichen von Lichterfelde ohne<br />
unmittelbaren Anschluss an den Ortsrand und wird über den Blütenberger<br />
Weg erschlossen.<br />
Das Projektgebiet liegt in exponierter Kuppenlage. Nach Süden fällt das<br />
Gelände deutlich ab und geht in das Licherfelder Bruch über. Südlich an<br />
das Projektgebiet schließt sich ein gewerblich genutzter Standort an.<br />
Nach Norden, Osten und Westen öffnet sich die freie, intensiv bewirtschaftete<br />
Feldflur.<br />
4.4.34.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Den Kern des Projektgebietes bildet die ehemalige Gülleanlage der örtlichen<br />
LPG. Kennzeichnend sind die Beckenstrukturen, die heute von<br />
nitrophytischen Satudenfluren (Biotoptyp 05142) und Laubgebüschen<br />
frischer Standorte (07102) überwachsen werden. Es handelt sich in beiden<br />
Fällen um in Brandenburg häufige Biotoptypen. Aufgrund ihrer Lage<br />
innerhalb einer intensiv genutzten Agrarlandschaft und der vergleichsweise<br />
großen Flächenausdehnung entwickelt die Struktur Bedeutung für<br />
den Arten- und Biotopschutz als Trittsteinbiotop für diverse Tierarten der<br />
Agrarlandschaft. Hervorzuheben sind insbesondere, Moorfrosch (Rana<br />
arvalis, RL 3; FFH IV), Grasfrosch (Rana temporaria, RL 3; BArtSchV),<br />
Kammmolch Triturus cristatus cristatus (RL 2; FFH II + IV), Erdkröte<br />
Bufo bufo (RL 3; BArtSchV) und Teichmolch Triturus vulgaris<br />
(BArtSchV). Der Europäische Laubfrosch (Hyla arborea, RL 2, FFH Anhang<br />
IV) hat gemäß Hinweis der Unteren Naturschutzbehörde eine Population<br />
im Gebiet. Die Biotope weisen außerdem Brutreviere von<br />
Schafstelze (Motacilla flava, RL 3) und häufigeren Begleitern der Agrarlandschaft<br />
wie Goldammer und Feldlerche auf. Die Biotope sind aufgrund<br />
der bestehenden Windkraftanlagen von geringerer Bedeutung als<br />
Nahrungshabitat für Greifvogelarten.<br />
Eines der Güllebecken am Nordrand der Anlage ist heute teilweise<br />
Wasser gefüllt. Durch Verlandungsprozesse hat sich ein relativ naturnahes,<br />
besonntes Kleingewässer entwickelt, dass geeignete Reproduktionsbedingungen<br />
für die oben genannten Amphibienarten aufweist. Es ist<br />
164
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 4 “Sondergebiet Fotovoltaik“ und „Sondergebiet Windkraft“<br />
daher trotz seines anthropogenen, technischen Ursprungs von sehr hoher<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Nord-westlich und süd-östlich umfasst das Projektgebiet intensiv genutzte<br />
Ackerflächen (Biotoptyp 09133). Deren Bedeutung für den Arten und<br />
Biotopschutz ist gering.<br />
Biotoptypen Vorhaben 4 (Lichterfelde)<br />
4.4.34.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 30,0 ha. Die ehemalige<br />
Gülleanlage mit ihrem hohen Anteil versiegelter Flächen macht hiervon<br />
etwa 15,0 ha aus. Da die Fotovoltaikanlage mit den entsprechend<br />
erforderlichen Punktfundamenten vollständig im Bereich der ehemaligen<br />
Güllebecken angelegt wird, sind keine zusätzlichen Bodenversiegelungen<br />
zu erwarten.<br />
Die projektierte Zahl der zusätzlichen Windenergieanlagen ist unbekannt.<br />
Derzeit sind 5 Anlagen errichtet.<br />
165
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 4 “Sondergebiet Fotovoltaik“ und „Sondergebiet Windkraft“<br />
4.4.34.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 4.1: Im Zuge der Errichtung der Fotovoltaikanlage wird es zu einer<br />
Kultivierung der Standflächen kommen. Diese sind Sommer- und Winterlebensräume<br />
für eine Reihe von Amphibienarten. Während die Qualität<br />
der Fläche als Sommerlebensraum unter den Sonnenkollektoren<br />
voraussichtlich erhalten werden kann, dürften Spalten, Risse, Altgebäude,<br />
Mauerreste und sonstige Ablagerungen beräumt werden. Diese bieten<br />
aber wichtige Überwinterungsquartiere. Bei einem Beginn der Arbeiten<br />
während des Winterhalbjahres sind zudem erhebliche Individuenverluste<br />
durch die Beseitigung der Winterquartiere zu befürchten. Damit ist<br />
eine erhebliche Beeinträchtigung der Biotopqualität für Amphibien zu<br />
erwarten.<br />
Feldlerche und Schafstelze brüten am Rand der Flächen im Übergang<br />
zu den Ackerflächen. Eine Beeinträchtigung der Brutreviere ist nicht anzunehmen.<br />
Der Goldammer als einzigem Brüter in der Fläche stehen<br />
nord-östlich ausreichend geeignete Ausweich-Brutreviere zur Verfügung,<br />
so dass ein Brutrevierverlust nicht zu erwarten ist. Es ist nicht auszuschließen,<br />
dass Vögel des Offenlandes zwischen den Kollektorenfeldern<br />
eingeschränkt auf Nahrungssuche gehen. Diese Beeinträchtigung des<br />
Nahrungshabitats dürfte aber dadurch aufgefangen werden, dass vermehrt<br />
Fluginsekten aufgrund des „Wasserspiegel-Effektes“ der Kollektoren<br />
in das Projektgebiet gelenkt werden.<br />
4.4.34.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
Soweit weitere Windkraftanlagen im Bereich der Ackerflächen errichtet<br />
werden, ist mit zusätzlicher Versiegelung durch die Fundamente der<br />
Anlagen zu rechnen. Es ist aber davon auszugehen, dass die bestehenden<br />
Güllebecken im Bereich der geplanten Sonnenkollektoren zunächst<br />
flächendeckend entsiegelt werden. Nach Abzug der Neuversiegelung<br />
dieses Bereichs durch die Fundamente der Kollektoren dürfte ausreichend<br />
offene Bodenflächen hergestellt worden sein, um mit zukünftigen<br />
Fundamenten von Windkraftanlagen verrechnet werden zu können.<br />
4.4.34.2.3 Landschaftsbild<br />
Der Projektraum liegt in einer landschaftlich exponierten Stellung mit<br />
entsprechend weitreichenden Blickbeziehungen. Insbesondere die<br />
Windkraftanlagen sind als technische Überformungen der Landschaft<br />
weithin sichtbar. Auch Sonnenkollektorenfelder vermitteln ein massiv<br />
technisches Gepräge. Aufgrund der bereits bestehenden erheblichen<br />
visuellen Beeinträchtigungen des Projektgebietes durch die Gülleanlage,<br />
die bestehenden Windkraftanlagen und eine Hochspannungs-<br />
Überlandleitung sind die erzielbaren Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes<br />
allerdings nicht erheblich.<br />
166
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 4 “Sondergebiet Fotovoltaik“ und „Sondergebiet Windkraft“<br />
4.4.34.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 4.1<br />
Um den Verlust von Amphibien-Individuen während der Bauphase zu<br />
minimieren sollte die Vermeidungsmaßnahme V 4.1 berücksichtigt werden:<br />
„Die Abbrucharbeiten an den Güllebecken zur Vorbereitung der<br />
Aufstellung der Sonnenkollektoren sollten nach dem 01.04. beginnen<br />
und vor dem 30.09. abgeschlossen sein.“<br />
K 4.1<br />
Zur Kompensation des Verlustes von Winterquartieren von Amphibien<br />
soll die Ausgleichsmaßnahme A 4.1 zur Ausführung kommen:<br />
„Die Beton-Armierung des nord-östlich an das geplante Sondergebiet<br />
Fotovoltaik anschließenden Güllebeckens sollte mit<br />
geeigneten technischen Mitteln zusätzliche Risse und Spalten<br />
erhalten. Die Ausführung sollte nach dem 01.04. beginnen und<br />
vor dem 30.09. abgeschlossen sein.“<br />
167
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 57 Sondergebiet „Freizeit + Erholung“<br />
4.4.35 Vorhaben 57<br />
Lichterfelde: Änderung der Darstellung „Wohnbaufläche“ in Sondergebiet<br />
„Freizeit + Erholung“. Die Konversion eines Alt-Standortes soll<br />
nunmehr nicht mehr durch die Entwicklung eines Wohnstandortes sondern<br />
durch die Realisierung einer Freizeit- und Erholungs-Anlage erfolgen.<br />
4.4.35.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.35.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich außerhalb der Ortslage Lichterfelde am<br />
Fuß der so genannten Karlshöhe. Die Erschließung erfolgt über die<br />
Straße „Unter den Buchen“.<br />
Das Projektgebiet liegt innerhalb einer intensiv genutzten Ackerlandschaft.<br />
Es wird eingefasst von einem Kiefernforst. Westlich liegt ein<br />
Fußballplatz. Südlich der Straße unter den Buchen befindet sich eine<br />
großflächige Einfamilienhaus-Siedlung (Clara-Zetkin-Siedlung).<br />
4.4.35.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Es handelt sich um einen mit einer Reihe von ungenutzten Bungalows<br />
und Gemeinschaftsgebäuden bestandenen Alt-Standort am Südhang<br />
einer Binnendüne. Der zentrale Bereich ist offen und wird von einer<br />
Grünlandbrache trockener Standorte (Biotoptyp 051332) eingenommen.<br />
Ein altes Wegesystem durchzieht die Fläche. Die Brache ist ein in Brandenburg<br />
häufiger und ungefährdeter Biotoptyp. Für anspruchsvollere<br />
Offenlandarten hat der Biotop aufgrund der unmittelbaren Lage am Siedlungsrand<br />
und der relativ geringen Flächenausdehnung keine nennenswerte<br />
Habitateignung. Der Biotop hat insgesamt eine geringe Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Die Ränder des Projektgebietes sind von strukturreichen Lärchen-<br />
Birken-Kiefern-Forsten bestanden. Innerhalb der Forstflächen liegen<br />
eine Reihe von Bungalows, die über ein Wegenetz miteinander verbunden<br />
sind. Die Forstflächen sind insgesamt von mittlerer Bedeutung für<br />
den Arten und Biotopschutz.<br />
4.4.35.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt. Soweit sich im Rahmen der nachfolgenden<br />
Konfliktermittlungen für die einzelnen Schutzgüter Konflikte durch<br />
die vorgesehenen Planungen ergeben, werden dies mit „K132“ bis „K n“<br />
durchnummeriert.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 27.000 m². Unter Annahme<br />
eines für die städtebauliche Nutzungskategorie „Sondergebiet<br />
Freizeit und Erholung“ üblichen Versiegelungsgrades von insgesamt<br />
30% wäre die bauliche Inanspruchnahme von etwa 8.100 m² eröffnet.<br />
Unter Berücksichtigung der bereits überbauten Flächen von etwa 8.000<br />
m² ergibt sich eine tatsächliche Mehrversiegelung von 100 m². Unter<br />
Berücksichtigung der lediglich überschlägigen Ermittlung der Nutzungsintensitäten<br />
ist diese Abweichung im Weiteren zu vernachlässigen.<br />
168
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 57 Sondergebiet „Freizeit + Erholung“<br />
Biotoptypen Vorhaben 57 (Lichterfelde)<br />
Im Zuge der Wiederinbetriebnahme des Standortes wird es zu einer<br />
veränderten Raumstruktur kommen. Wegebeziehungen und die Verteilung<br />
von Gebäuden wird voraussichtlich den heutigen Anforderungen<br />
angepasst werden. Dabei kommt es zur Inanspruchnahme von bislang<br />
unbebauten Grünlandbrachen und auch Forstflächen. Im Gegenzug<br />
werden die bestehenden Baracken und Gemeinschaftsgebäude zurückgebaut.<br />
Die dabei entstehenden Freiflächen kompensieren die vorgenannten<br />
Flächenverluste ohne dass es weiterer Biotopentwicklungsmaßnahmen<br />
bedarf. Es sind somit keine Konflikte mit den Belangen des<br />
Natur- und Landschaftsschutz erkennbar.<br />
169
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 63 „Wohnbaufläche“<br />
4.4.36 Vorhaben 63<br />
Lichterfelde: Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in „Wohnbaufläche“.<br />
Ziel ist die Ermöglichung einer 2. Baureihe auf relativ großen Einzelhausgrundstücken.<br />
4.4.36.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.36.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am nördlichen Rand von Lichterfelde<br />
Siedlung, einer Ausbausiedlung östlich des Hauptortes Lichterfelde. Die<br />
Erschließung erfolgt über den Pehlmannring und einen hiervon abgehenden<br />
Feldweg.<br />
Nördlich des Projektgebietes öffnet sich eine großräumige Agrarlandschaft<br />
mit überwiegend intensiver Grünlandnutzung. Westlich, südlich<br />
und östlich liegen Einzelhausgrundstücke von Lichterfelde Siedlung.<br />
4.4.36.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das südliche Drittel des Projektgebietes ist mit einem Einfamilienhaus<br />
einschließlich Nebenanlagen und Gartennutzung bebaut (Biotoptyp<br />
12262). Hieran schließen nördlich Grünlandbrachen frischer Standorte in<br />
artenarmer Ausprägung (Biotoptyp 051322) und ein Laubgebüsch aus<br />
verwilderten Kulturpflaumen (Biotoptyp 07103) an. Die Bedeutung beider<br />
Biotop für den Arten und Biotopschutz ist gering.<br />
Biotoptypen Vorhaben 63 (Lichterfelde)<br />
4.4.36.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 4.000 m². Unter Annahme<br />
einer für „Wohnbauflächen“ üblichen Versiegelungsgrades von<br />
170
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 63 „Wohnbaufläche“<br />
60% wäre die bauliche Inanspruchnahme von etwa 2.400 m² eröffnet.<br />
Da im Bereich der bereits bestehenden Einzelhausbebauung bereits<br />
etwa 900 m² versiegelt oder teilversiegelt sind, ergibt sich eine tatsächliche<br />
maximale Mehrversiegelung von 1.500 m².<br />
4.4.36.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 63.1: Die zusätzliche Versiegelung von 1.500 m² artenarmer Grünlandbrachen<br />
und Laubgebüsche nicht heimischer Sträucher ist trotz der<br />
geringen Bedeutung des Biotops für den Arten- und Biotopschutz ein<br />
erheblicher Eingriff, der kompensiert werden muss. Die beeinträchtigten<br />
Habitatqualitäten sind durch Entsiegelungsmaßnahmen ohne zusätzliche<br />
Biotopentwicklungsmaßnahmen kurzfristig wieder herstellbar.<br />
Die nicht überbauten Flächen des Projektgebietes werden zukünftig als<br />
Gärten genutzt. Mit dieser Nutzungsänderung gehen keine Eingriffe in<br />
das Schutzgut einher.<br />
4.4.36.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 63.1: Die Versiegelung von etwa 1.500 m² Boden geht einher mit dem<br />
Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut Boden.<br />
Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes Boden von allgemeiner<br />
Bedeutung betroffen.<br />
K 63.1: Die Versieglung von 1.500 m² Boden reduziert Menge und Qualität<br />
der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.36.2.3 Landschaftsbild<br />
Die derzeitige undefinierte Brachflächensituation hat keine eigenen visuellen<br />
Qualitäten. Die Entwicklung von Einzelhausbebauungen mit entsprechender<br />
beigeordneter Gartennutzung ist der örtlichen Situation<br />
angemessen. Eingriffe in das Schutzgut Landschaftsbild entstehen somit<br />
nicht.<br />
4.4.36.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 63.1, K 63.2 und K 63.3<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope,<br />
Boden und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung von bis zu 1.500<br />
m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 1.500 m² versiegelten Bodens.<br />
171
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 88 „Wohnbaufläche“<br />
4.4.37 Vorhaben 88<br />
Lichterfelde: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
„Wohnbaufläche“. Ziel ist die Ermöglichung einer 2. Baureihe auf einem<br />
relativ tiefen Einzelhausgrundstück.<br />
4.4.37.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.37.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am nördlichen Rand von Lichterfelde.<br />
Die Erschließung des bebauten Hauptgrundstücks erfolgt über die Oderberger<br />
Straße. Die vorgesehene 2. Reihe wird über einen Feldweg<br />
erschlossen, der von der Oderberger Straße abgeht.<br />
Nördlich des Projektgebietes öffnet sich eine großräumige Agrarlandschaft<br />
mit überwiegend intensiver Ackernutzung. Westlich, südlich und<br />
östlich liegt die Dorfkernbebauung von Lichterfelde.<br />
4.4.37.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet wird bislang vollständig als Gartengrundstück mit<br />
Obstgehölzen, Gemüsebeeten, einem untergeordneten Ziergartenanteil<br />
und einzelne kleinere Unterstände und Lauben. Die kleinteilige Nutzungsstruktur<br />
bietet einer Reihe kulturfolgender Singvogelarten und verbreiteten<br />
Tagfaltern wie Tagpfauenauge, Admiral, Kohlweißlinge und<br />
Kleinem Fuchs geeignete Lebensraumbedingungen. Hierbei handelt es<br />
sich jedoch um in Brandenburg ungefährdete Arten, so dass der Biotopwert<br />
des Projektgebietes als mittel bewertet wird.<br />
Biotoptypen Vorhaben 88 (Lichterfelde)<br />
4.4.37.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
172
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 88 „Wohnbaufläche“<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 1.400 m². Unter Annahme<br />
eines für „Wohnbauflächen“ üblichen Versiegelungsgrades von<br />
60% wäre die bauliche Inanspruchnahme von etwa 840 m² eröffnet. Da<br />
im Projektgebiet bereits etwa 300 m² versiegelt oder teilversiegelt sind,<br />
ergibt sich eine tatsächliche maximale Mehrversiegelung von gerundet<br />
500 m².<br />
4.4.37.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 88.1: Die zusätzliche Versiegelung von 500 m² Garten ist ein erheblicher<br />
Eingriff, der kompensiert werden muss. Die beeinträchtigten Habitatqualitäten<br />
sind durch Entsiegelungsmaßnahmen ohne zusätzliche<br />
Biotopentwicklungsmaßnahmen kurzfristig wieder herstellbar.<br />
Die nicht überbauten Flächen des Projektgebietes werden zukünftig weiterhin<br />
als Gärten genutzt. Über die bauliche Entwicklung hinaus werden<br />
daher keine weiteren Eingriffe in das Schutzgut angenommen.<br />
4.4.37.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 88.2: Die Versiegelung von etwa 500 m² Boden geht einher mit dem<br />
Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut Boden.<br />
Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes Boden von allgemeiner<br />
Bedeutung betroffen.<br />
K 88.3: Die Versieglung von 500 m² Boden reduziert Menge und Qualität<br />
der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.37.2.3 Landschaftsbild<br />
Das Projektgebiet ist durch die direkte Grenzlage zum Dorfkern von<br />
Lichterfelde und die visuelle Einbindung über umgebende Gehölze aus<br />
der freien Landschaft nicht einsehbar oder als eigenständiger Flächentypus<br />
zu identifizieren. Die bestehende Gartennutzung mit kleinerem<br />
Gebäudebestand erfährt eine Intensivierung der Nutzung, ohne dass<br />
jedoch eine grundsätzliche Strukturänderung zu erwarten ist. Die Entwicklung<br />
von Einzelhausbebauungen mit entsprechender beigeordneter<br />
Gartennutzung ist der örtlichen Situation angemessen. Eingriffe in das<br />
Schutzgut Landschaftsbild entstehen somit nicht.<br />
173
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 88 „Wohnbaufläche“<br />
4.4.37.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 88.1, K 88.2 und K 88.3<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope,<br />
Boden und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung von bis zu 500<br />
m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 500 m² versiegelten Bodens.<br />
174
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 93 „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.38 Vorhaben 93 a und 93 b<br />
Lichterfelde: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
„Gemischte Baufläche“ (93 a) und „Sondergebiet REiterhof“ (93 b). Ziel<br />
ist im Wesentlichen die Erweiterung der Betriebsfläche für einen bestehenden<br />
Gewerbe- und Handelsbetrieb sowie die Errichtung einer Hofstelle<br />
zur Pferdeunterbringung.<br />
4.4.38.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.38.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am südwestlichen Rand von Lichterfelde.<br />
Die Erschließung erfolgt über die Messingwerkstraße bzw. eine<br />
Stichstraße von der Messingwerkstraße, die hinter dem Gewerbe- und<br />
Handelsstandort in einen Feld- und Wanderweg übergeht.<br />
Das Projektgebiet befindet sich innerhalb einer ortsrandnahen Weidelandschaft,<br />
die sich in die Siedlungsachsen Lichterfeldes entlang der<br />
Messingwerkstraße im Süden und der Steinfurter Straße im Norden bis<br />
unmittelbar an die rückwärtigen Gärten und Grabeländereien der dörflichen<br />
Kernbebauung entlang der Eberswalder Straße hineinzieht. Nach<br />
Westen treten neben die Weidenutzung auch Acker- und Gemüseanbauflächen.<br />
Unmittelbar südlich angrenzend befinden sich zwei Gewerbe-<br />
und Handelsstandorte.<br />
4.4.38.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet befindet sich in einer grundwassernahen, über ein<br />
Grabensystem entwässerten Niederung mit humosen Sandböden.<br />
Das Projektgebiet wird mit Ausnahme des Gewerbestandortes (93 a)<br />
und zweier Lagerhallen (93 b) als Intensiv-Weide für die Pferdehaltung<br />
genutzt. Floristisch sind die Weiden aufgrund des relativ hohen Viehbesatzes<br />
verarmt und entsprechen dem Biotoptyp 05112. Der Biotop ist<br />
aufgrund der unmittelbaren Nähe zum Ortsrand und der intensiven Beweidung<br />
von geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Entlang der westlichen Projektgebietsgrenze verläuft ein Feldweg mit<br />
einem wegebegleitenden linearen Feldgehölz standortgemäßer, heimischer<br />
Gehölze (Biotoptyp 07112). Das Feldgehölz bereichert die Wiesenlandschaft<br />
um ein wichtiges Strukturelement. Aufgrund der unmittelbaren<br />
Lage an einem frequentierten Wanderweg in Ortsrandlage und die<br />
geringe Breite kommt es als Bruthabitat nur für einige wenige störungsunempfindliche<br />
Singvogelarten sowie als Teillebensraum für ungefährdete<br />
Nager wie Kaninchen und Feldmaus. Greifvögel nutzen das Gehölz<br />
regelmäßig als Ansitz bei der Nahrungssuche. Insgesamt hat das Feldgehölz<br />
eine mittlere Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
175
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 93 „Gemischte Baufläche“<br />
Biotoptypen Vorhaben 93 (Lichterfelde)<br />
4.4.38.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 3,7 ha. Die in 93a als<br />
Bauflächen dargestellten Bereiche umfassen etwa 1,2 ha. Hiervon sind<br />
0,4 ha bereits rechtsverbindlich als Mischgebiet festgesetzt. Der Eigentümer<br />
der Flächen beabsichtigt eine GRZ von 0,26 zu realisieren. Unter<br />
Berücksichtigung einer 50%igen Überschreitung für Nebenanlagen ergibt<br />
sich für die zusätzlichen 0,8 ha Mischgebiet der 93 a versiegelte<br />
Fläche von etwa 3.100 m². Das Sondergebiet „Reiterhof“ der 93 b hat<br />
eine Fläche von etwa 3.100 m². Unter Annahme einer GRZ von 0,8<br />
einschl. Überschreitungs-GRZ ermöglichte dies versiegelte Flächen in<br />
einer Größenordnung von 2.500 m². Im Bestand nehmen die vorhandenen<br />
Hallen etwa 400 m² ein. Die potentielle Mehrversiegelung beträgt<br />
somit etwa 2.100 m². Gemeinsam entstehen im Rahmen der Projekte 93<br />
a und 93 b 5.200 m² zusätzliche Versiegelungspotentiale.<br />
176
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 93 „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.38.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 93.1: Die zusätzliche Versiegelung von bis zu 5.200 m² Intensiv-<br />
Weiden ist ein erheblicher Eingriff, der kompensiert werden muss. Die<br />
beeinträchtigten Habitatqualitäten sind durch Entsiegelungsmaßnahmen<br />
ohne zusätzliche Biotopentwicklungsmaßnahmen kurzfristig wieder herstellbar.<br />
4.4.38.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 93.3: Die Versiegelung von etwa 5.200 m² m² Boden geht einher mit<br />
dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes ist das Projektgebiet<br />
besonders anfällig für Verunreinigungen. Dies ist ein erheblicher<br />
und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 93.4: Die Versieglung von 5.200 m² Boden reduziert Menge und Qualität<br />
der Grundwasserneubildung. Der bereits erwähnte geringe Grundwasserflurabstand<br />
im Planungsraum setzt eine besondere Sorgfalt bei<br />
der Entwicklung zusätzlicher Bodenversiegelung insbesondere in Verbindung<br />
mit potentiell grundwassergefährdenden gewerblichen Nutzungen<br />
voraus. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.38.2.3 Landschaftsbild<br />
K 93.5: Das Projektgebiet ist ein landschaftsästhetisch attraktiver Landschaftsraum<br />
mit besonderen Funktionen für die siedlungsnahe Naherholung.<br />
Die offene Weidelandschaft in Verbindung mit eingestreuten Gehölzstrukturen<br />
wie Feldhecken, Baumweidengruppen und Kopfbaumreihen<br />
entlang von Gräben bietet vor dem im Hintergrund aufragenden gut<br />
strukturierten Ortsrand von Lichterfelde einen ästhetisch hochwertiges<br />
Landschaftserleben. Die Entwicklung des Sondergebietes „Reiterhof“<br />
verfestigt die bestehende landschaftsästhetische Beeinträchtigung durch<br />
die großflächigen, landwirtschaftlichen Lagerhallen. In Verbindung mit<br />
der Mischgebietsentwicklung parallel zur Messingwerkstraße ist der<br />
reizvolle Übergang des Ortsrandes von Lichterfelde in die freie Landschaft<br />
zukünftig stark eingeschränkt erlebbar. Hierbei handelt es sich um<br />
einen erheblichen Eingriff in die Erholungsfunktion der Landschaft. Der<br />
Eingriff ist nicht ausgleichbar.<br />
177
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 93 „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.38.2.4 Schutzgut Mensch<br />
K 93.6: Durch die Entwicklung Gewerbe- und Handelsfunktion des Projektgebietes<br />
wird voraussichtlich nicht unerhebliches zusätzliches motorisiertes<br />
Verkehrsaufkommen hervorgerufen, das die angrenzende<br />
Wohnfunktion durch Lärm- Abgas- und Staubemissionen beeinträchtigt.<br />
Zudem grenzt ein Teil des Mischgebietes unmittelbar an Wohngrundstücke,<br />
deren Schutzbedürfnis durch die überwiegend gewerbliche Nutzung<br />
des Projektgebietes tangiert wird.<br />
4.4.38.2.5 Landschaftsplanung<br />
K 93.7: Der Landschaftsplan der <strong>Gemeinde</strong> Finowfurt sieht die Erhaltung<br />
und Entwicklung der gewachsenen Ortsrandsituation vor.<br />
4.4.38.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 93.1, K 93.2, K 93.3<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope,<br />
Boden und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung von bis zu 2.500<br />
m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 5.200 m² versiegelten Bodens.<br />
K 93.5 und K 93.6<br />
Die Konflikte mit dem Schutzgut Landschaftsbild bei Realisierung des<br />
Vorhabens sind lokal nicht vollständig zu kompensieren. Zur landschaftsgerechten<br />
Eingliederung des Mischgebietes und zur Trennung<br />
der Wohnnutzung von der Mischnutzung wird die Ausgleichsmaßnahme<br />
A 93.1 vorgeschlagen:<br />
„Die zur freien Landschaft orientierte Grenzen des geplanten<br />
Mischgebietes und des Sondergebietes „Pferdehof“ sollten<br />
durch Anlage einer mindestens 3 m breiten Baumhecke eingefasst<br />
werden. Auf 5 m Hecke sind 1 Baum der Pflanzliste 3 als<br />
zukünftige Überhälter zu setzen (s. Anhang 3). Pro m² Pflanzfläche<br />
sind zusätzlich 2 Sträucher der Pflanzliste 4 zu pflanzen<br />
(s. Anhang 3).“<br />
K 93.7<br />
Der Widerspruch zu den Zielen des Landschaftsplans ist bei Realisierung<br />
des Vorhabens nicht durch Kompensationsmaßnahmen aufzulösen.<br />
Es ist erforderlich, dass die <strong>Gemeinde</strong> die Abweichung von ihren<br />
landschaftsplanerischen Zielen städtebaulich begründet.<br />
178
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 33 „Gemischte Baufläche“<br />
4.4.39 Vorhaben 33<br />
Lichterfelde: Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in „Gemischte Baufläche“.<br />
Ziel ist im Wesentlichen die Sicherung der Betriebsfläche für<br />
einen bestehenden Gewerbebetrieb.<br />
4.4.39.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4.39.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am südwestlichen Rand von Lichterfelde.<br />
Die Erschließung erfolgt über die Messingwerkstraße.<br />
Nördlich und westlich des Projektgebietes öffnet sich eine Agrarlandschaft.<br />
Im Osten schließen sich Einfamilienhausgrundstücke der Siedlungsausläufer<br />
von Lichterfelde an.<br />
Auf dem Projektgelände bestehen bereits bauliche Anlagen, die unabhängig<br />
von der Änderung des FNP Bestandsschutz genießen.<br />
4.4.39.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Das Projektgebiet befindet sich in einer grundwassernahen, über ein<br />
Grabensystem entwässerten Niederung mit humosen Sandböden.<br />
Das Projektgebiet unterteilt sich in einen aktiven Gewerbebetrieb mit<br />
einem großen Lagergebäude und Parkplatzflächen (Biotoptyp 12312)<br />
und den umgebenden Restflächen, die als frische, artenarme Grünlandbrache<br />
(Biotoptyp 051322). Vertretbar wäre auch eine Einstufung als<br />
ruderale Wiese (Biotoptyp 05113). Die Einstufung ist für die Beurteilung<br />
der Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz unerheblich. Es dominieren<br />
konkurrenzkräftige Stauden und Gräser. Der Biotop ist aufgrund der<br />
unmittelbaren Nähe zum Ortsrand und der intensiven Nutzung des Gewerbestandortes<br />
Beweidung von geringer Bedeutung für den Arten- und<br />
Biotopschutz.<br />
Der bestehende Gewerbestandort ist vollständig versiegelt und ohne<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Entlang der westlichen sowie der nord-östlichen Projektgebietsgrenzen<br />
liegen zwei mehr oder weniger lineare Feldgehölz standortgemäßer,<br />
heimischer Gehölze (Biotoptyp 07112). Die Feldgehölze bereichern die<br />
Wiesenlandschaft um ein wichtiges Strukturelement. Aufgrund der unmittelbaren<br />
Lage am Gewerbestandort kommen sie als Bruthabitat nur<br />
für einige wenige störungsunempfindliche Singvogelarten sowie als Teillebensraum<br />
für ungefährdete Nager wie Kaninchen und Feldmaus.<br />
Greifvögel nutzen das Gehölz regelmäßig als Ansitz bei der Nahrungssuche.<br />
Insgesamt haben die Feldgehölze eine mittlere Bedeutung für<br />
den Arten- und Biotopschutz.<br />
179
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 33 „Gemischte Baufläche“<br />
Biotoptypen Vorhaben 33 (Lichterfelde)<br />
4.4.39.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 9.500 m². Unter Annahme<br />
eines für „Gemischte Bauflächen“ üblichen Versiegelungsgrades<br />
von 80% wäre die bauliche Inanspruchnahme von etwa 7.600 m² möglich.<br />
Unter Berücksichtigung der bereits versiegelten 2.300 m² ergibt sich<br />
eine rechnerische maximale Mehrversiegelung von 5.300 m².<br />
4.4.39.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 33.1: Die zusätzliche Versiegelung von bis zu 5.300 m² Intensiv-<br />
Weiden ist ein erheblicher Eingriff, der kompensiert werden muss. Die<br />
beeinträchtigten geringwertigen Habitatqualitäten sind durch Entsiegelungsmaßnahmen<br />
ohne zusätzliche Biotopentwicklungsmaßnahmen<br />
kurzfristig wieder herstellbar.<br />
K 33.2: Der Verlust der Feldgehölze entlang der westlichen und nordöstlichen<br />
Grenzen des Projektgebietes wäre ebenfalls ein erheblicher<br />
Eingriff, der aufgrund der langen Wiederherstellungszeiträume für alte<br />
Gehölzstrukturen nicht ausgleichbar ist, sondern über Ersatzmaßnahmen<br />
kompensiert werden müsste.<br />
4.4.39.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 33.3: Die Versiegelung von etwa 5.300 m² Boden geht einher mit dem<br />
Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Aufgrund des geringen Grundwasserflurabstandes ist das Projektgebiet<br />
besonders anfällig für Verunreinigungen. Dies ist ein erheblicher und<br />
nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut Boden. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Boden von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
180
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 33 „Gemischte Baufläche“<br />
K 33.4: Die Versieglung von 5.300 m² Boden reduziert Menge und Qualität<br />
der Grundwasserneubildung. Der bereits erwähnte geringe Grundwasserflurabstand<br />
im Planungsraum setzt eine besondere Sorgfalt bei<br />
der Entwicklung zusätzlicher Bodenversiegelung insbesondere in Verbindung<br />
mit potentiell grundwassergefährdenden gewerblichen Nutzungen<br />
voraus. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das<br />
Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes<br />
Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4.39.2.3 Landschaftsbild<br />
K 33.5: Von besonderer landschaftsästhetischer Funktion sind die beiden<br />
randständigen Feldgehölze. Sie stellen eine wichtige Einbindung<br />
des großflächigen Lagergebäudes dar. Ein Verlust dieser Gehölze würde<br />
zu einer erheblichen Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch<br />
die Schaffung von massiven Ansichtsflächen unproportionierter Gewerbegebäude.<br />
Grundsätzlich ist die Anlage von gewerblich dominierten<br />
Mischgebieten im Projektgebiet aufgrund der Lage an einer Ausfallstraße<br />
landschaftsräumlich nicht fern liegend. Die bestehenden randständigen<br />
Feldgehölze gewährleisten eine konfliktfreie Einbindung auch neuer<br />
Gebäude in das Projektgebiet.<br />
4.4.39.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 33.2<br />
Aufgrund der langen Wiederherstellungszeiträume alter Gehölzstrukturen<br />
und ihrer insbesondere in diesem Fall herausragenden Bedeutung<br />
für die Einbindung eines unproportionierten Gebäudes im Projektgebiet<br />
wird die Übernahme der Vermeidungsmaßnahme V 33.1 vorgeschlagen:<br />
„Die bauliche Inanspruchnahme der beiden Feldgehölze am<br />
Rande des Projektgebietes und alle sonstigen Maßnahmen oder<br />
Nutzungen, die zur erheblichen und nachhaltigen Beeinträchtigungen<br />
führen könnten, sind zu unterlassen. Während der Bauphase<br />
sind geeignete Schutzvorkehrungen zu treffen, um sowohl<br />
Stamm als auch Wurzelbereich vor mechanischen Schäden zu<br />
bewahren.“<br />
K 33.1, K 33.3 und K 33.4<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope,<br />
Boden und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung von bis zu 5.300<br />
m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 5.300 m² versiegelten Bodens.<br />
181
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 147 „Sondergebiet Biomasseanlage“<br />
4.4.40 Vorhaben 147<br />
Lichterfelde: Änderung der Darstellung „Fläche für die Landwirtschaft“ in<br />
„Sondergebiet Biomasseanlage“.<br />
4.4.40.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4. 40.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am süd-östlichen Rand von Lichterfelde.<br />
Die Erschließung erfolgt über die Straße „Lichterfelder Bruch“.<br />
Das Projektgebiet liegt am Fuße der markanten Hangkante von Lichterfelde,<br />
an deren Südhang die Straße „Lichterfelder Bruch“ verläuft. Östlich,<br />
westlich und südlich des Projektgebietes öffnet sich eine weiträumige,<br />
intensiv genutzte Agrarlandschaft. Die tiefer gelegenen landwirtschaftlichen<br />
Flächen sind unter Dauergrünlandnutzung.<br />
4.4. 40.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Der gesamte Projektbereich ist ein intensiv genutzter Lehmacker (Biotoptyp<br />
09133) ohne jegliche Strukturierung über naturnahe Landschaftselemente.<br />
Der ausgeräumte Intensivacker in erweiterter Ortsrandlage<br />
und angrenzend an eine Erschließungsstraße ist von geringer Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Biotoptypen Vorhaben 147 (Lichterfelde)<br />
182
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 147 „Sondergebiet Biomasseanlage“<br />
4.4. 40.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 3,6 ha. Unter Annahme<br />
einer Versiegelungsgrades von 50% wäre die bauliche Inanspruchnahme<br />
von etwa 18.000 m² möglich.<br />
Die Anlage soll eine Nennleistung von 499 MW erreichen. Als Bioenergieträger<br />
sind Raps, Mais, Roggen, Grünschnitt und Festmist vorgesehen.<br />
Der jährliche Bedarf an nachwachsenden Rohstoffen ist mit 7.500<br />
bis 8.000 to zu veranschlagen. Die dafür benötigte landwirtschaftliche<br />
Fläche beträgt ca. 200 bis 250 ha. Dies entspricht rechnerisch der landwirtschaftlichen<br />
Fläche im Umkreis von 1.500 m um die geplante Anlage.<br />
Die Biogasanlage soll Lagerflächen für einen Jahresbedarf an nachwachsenden<br />
Rohstoffen sowie eine Lagerkapazität von 2.300 m³ für<br />
Gärreste erreichen.<br />
Der Vorhabenträger hat eine Vorprüfung der Umweltverträglichkeit gem.<br />
§ 3 c Abs. 1 Satz 2 vorgenommen. Das Landesumweltamt, Regionalabteilung<br />
Ost, Genehmigungsverfahrensstelle – Herr Rademann - bestätigt<br />
mit Schreiben vom 19.03.2008, dass keine UVP-Pflicht besteht.<br />
Das Immissionsschutzrechtliche Verfahren ist eingeleitet, der Vorhabenträger<br />
hat Lärm- und Immissionsgutachten eingereicht.<br />
4.4. 40.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 40.1: Die zusätzliche Versiegelung von etwa 18.000 m² Intensiv-<br />
Ackerflächen ist ein erheblicher Eingriff, der kompensiert werden muss.<br />
Die beeinträchtigten geringwertigen Habitatqualitäten sind durch Entsiegelungsmaßnahmen<br />
ohne zusätzliche Biotopentwicklungsmaßnahmen<br />
kurzfristig wieder herstellbar.<br />
Der Betrieb von Biogasanlagen sorgt insbesondere unter Einsatz von<br />
Feldfrüchten wie Mais, Raps und Roggen in der Regel für eine Intensivierung<br />
der Landnutzung im Umkreis der Anlage mit entsprechenden<br />
Folgen für den Arten- und Biotopschutz. Es ist nicht auszuschließen,<br />
dass es im vergleich zum Nahrungspflanzenanbau zu einem erhöhten<br />
Einsatz von Mineraldünger und Pestiziden kommt. Hier wirken allerdings<br />
auch gegenläufige Mechanismen (z.B. geringere Ansprüche an die Qualität<br />
der Feldfrüchte und damit höhere Toleranz gegenüber Pilzbefall,<br />
Möglichkeit des Verzichts auf die Spätdüngung, Toleranz gegenüber<br />
Unkrautaufkommen aufgrund der möglichen Mitvergärung) zum Tragen,<br />
so dass generalisierende Aussagen zur tatsächlichen Beeinträchtigung<br />
von Flora und Fauna nicht möglich sind. Es bestehen Tendenzen zum<br />
Grünlandumbruch während die Kultivierung von Brach- und Stilllegungsflächen<br />
für den Energiepflanzenanbau bislang noch keine signifikanten<br />
Bezüge aufweist (vgl. Institut für Ländliche Räume 2008, S. 16-17). Insgesamt<br />
lässt die unzureichende Datenlage und die widerstreitenden<br />
183
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 147 „Sondergebiet Biomasseanlage“<br />
Intensivierungs-/Extensivierungsmechanismen keine belastbare Prognose<br />
zu, ob es im Zuge der teilweisen Umstellung vom Nahrungspflanzenanbau<br />
zum Energiepflanzenanbaus tatsächlich zu einer Intensivierung<br />
der landwirtschaftlichen Nutzung kommt und ob dies mit erheblichen<br />
und nachhaltigen Beeinträchtigungen für den Arten- und Biotopschutz<br />
verbunden ist. Die vergleichsweise kleine Anlage mit ihrem entsprechend<br />
geringen Flächenbedarf für den Feldfruchtanbau und die Lage<br />
in einer nach brandenburgischen Maßstäben intensiv genutzen Agrarlandschaft<br />
legt nicht den Schluss nahe, dass es zu gravierenden Veränderungen<br />
der landwirtschaftlichen Nutzungsstruktur kommt.<br />
In Gebieten mit hohem Viehbesatz („Veredelungsregionen“) sorgt der<br />
Energiepflanzenanbau für eine ausgeprägte Einschränkung der Fruchtfolge<br />
auf Raps- und Maiskulturen. In Brandenburg sind diese Voraussetzungen<br />
so nicht gegeben, so dass nicht mit negativen Auswirkungen der<br />
Fruchtfolgenverschiebung auf den Arten und Biotopschutz zu rechnen<br />
ist.<br />
4.4. 40.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 40.2: Die Versiegelung von etwa 18.000 m² Boden geht einher mit<br />
dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut<br />
Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes Boden von<br />
allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Der Anbau von Mais geht in der Regel mit deutlichen Bodendegradationen<br />
einher, da Maiskulturen aufgrund der geringen Bodendeckung stark<br />
erosionsanfällig sind und zudem als starke Humuszehrer eingestuft werden.<br />
Aufgrund der bestehenden intensiven ackerbaulichen Nutzung des<br />
umgebenden Anbaugebietes ist ein erheblicher Einfluss auf die Nutzungsintensität<br />
mit erheblichen Eingriffen in die Bodenfruchtbarkeit allerdings<br />
nicht anzunehmen.<br />
K 40.3: Die Versieglung von 18.000 m² Boden reduziert Menge und<br />
Qualität der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Der Anbau insbesondere von Raps und Mais sorgt für starke Stickstoffeinträge<br />
in den Wasserhaushalt. Bei Mais tritt die Eintragsspitze v.a. im<br />
Zuge der Erstdüngung nach der Aussaat aus, da in der Regel eine einmalige<br />
Düngung mit entsprechend hoher Konzentration erfolgt. Bei Raps<br />
tritt die Spitze des Nährstoffverfügbarkeit nach der Ernte ein (vgl. Institut<br />
für Ländliche Räume 2008, S. 24/25). Aufgrund der bestehenden intensiven<br />
ackerbaulichen Nutzung des umgebenden Anbaugebietes ist ein<br />
erheblicher Einfluss auf die Nutzungsintensität mit erheblichen Eingriffen<br />
in den Wasserhaushalt allerdings nicht anzunehmen. Es ist zu empfehlen,<br />
bodenschonende Anbauverfahren wie Mulchsaat (bei Mais), Zwischenfruchtanbau<br />
und Untersaaten, querliegende Grünlandstreifen in<br />
Hanglagen, Engsaat (bei Mais) einzusetzen.<br />
184
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 147 „Sondergebiet Biomasseanlage“<br />
Die unsachgemäße Ausbringung von Gärresten auf umliegenden Ackerflächen<br />
ist verbunden mit einer unkontrollierten Zunahme insbesondere<br />
des Stickstoffeintrages in Grund- und Oberflächenwasser, da die Menge<br />
des pflanzenverfügbaren Stickstoffes in Gärresten im Vergleich zur tierischen<br />
Gülle oft unterschätzt wird bzw. generell aufgrund produktionstechnischer<br />
Variablen schwer einzuschätzen ist (vgl. . Institut für Ländliche<br />
Räume 2008, S. 38). Unter der Prämisse einer guten landwirtschaftlichen<br />
Praxis kann im intensiv ackerbaulich genutzten Einzugsgebiet der<br />
Anlage aber nicht davon ausgegangen werden, dass der verstärkte Einsatz<br />
von Gärresten in Verbindung mit der entsprechenden Substitution<br />
von Flüssiggülle und Mineraldünger zu einer erheblichen Verstärkung<br />
des Eintrages von Stickstoff in den Landschaftswasserhaushalt führt.<br />
Eine günstige Nutzung von Gärresten wird erleichtert durch ausreichend<br />
dimensionierte Lagerkapazitäten. Hierdurch ist es möglich, die Verbringung<br />
zeitlich am tatsächlichen Bedarf zu orientieren.<br />
K 40.4: Bei unsachgemäßer Lagerung von Gärresten oder Leckagen in<br />
den Gärtürmen besteht die Gefahr des Eintrages von hohen Nährstofffrachten<br />
in Grund- und Oberflächengewässer. Diese Risiken sind auf der<br />
Ebene des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens und<br />
der späteren betrieblichen Kontrollsysteme zu minimieren. Auf der Ebene<br />
der Bauleitplanung bestehen – mit Ausnahme des Vorhabenverzichts<br />
- keine Instrumente der Risiko-Minderung oder Kompensation.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
4.4. 40.2.3 Landschaftsbild<br />
K 40.5: Das Projektgebiet weist aufgrund der markanten Geländeerhebung<br />
im Norden und der ausgeprägten Tallage hohe landschaftsästhetische<br />
Potentiale auf. Diese werden allerdings durch eine 110-kv-<br />
Überlandleitung mit einer naturfernen Schneise durch die Kiefernforste<br />
der eiszeitlichen Geländeerhebung erheblich beeinträchtigt. Dem Landschaftserleben<br />
ist zudem die Vielzahl von Standorten der industriellen<br />
Landwirtschaft im näheren Umfeld abträglich. Die Errichtung von Lagerhallen,<br />
Faultürmen und Klärbecken führt dennoch zu einer erheblichen<br />
Beeinträchtigung des Landschaftsbildes. Die Anlagen ragen weithin<br />
sichtbar in die offene Feldflur hinein und sorgen für eine erhebliche Verstärkung<br />
der technischen Überformung des Raumes.<br />
4.4.40.2.4 Schutzgut Mensch<br />
Der Transport der Energieträger in die Anlage wird zum Teil über die<br />
Ortsdurchfahrung von Lichterfelde erfolgen. Da die Ortsdurchfahrt aber<br />
auch gegenwärtig bereits wesentliche Teile des Abtransportes der für<br />
die Nahrungsmittelindustrie bestimmten Feldfrüchte aus dem Osten der<br />
Gemarkung Lichterfelde aufnehmen muss, ist eine Verschärfung der<br />
verkehrlichen Belastung Lichterfeldes nicht zu erwarten. Soweit sich der<br />
Bezug der nachwachsenden Rohstoffe tatsächlich auf Herkünfte der<br />
östlichen Britzer Platte konzentriert, könnte für die Ortsdurchfahrt Lichterfelde<br />
sogar eine Reduzierung der Verkehrsbelastung aus Transporten<br />
landwirtschaftlicher Güter ergeben.<br />
185
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Lichterfelde; Vorhaben Nr. 147 „Sondergebiet Biomasseanlage“<br />
Die Anlage selbst verursacht betriebsbedingte Lärmemmissionen (Verladen<br />
von Gütern, Rangieren von LKW). Aufgrund der Entfernung zur<br />
nächsten Wohnbebauung am Ortsrand von Lichterfelde (600 m Luftlinie)<br />
ist eine erhebliche Beeinträchtigung der Wohnqualität nicht zu erwarten.<br />
Olfaktorisch relevante Emissionen können beim Entweichen relevanter<br />
Mengen von Biogasen oder der Zwischenlagerung von Flüssiggülle entstehen.<br />
Im Regelbetrieb ist das Entweichen von Prozessgasen nicht<br />
vorgesehen, da dies die Wirtschaftlichkeit der Anlage beeinträchtigen<br />
würde. Biogasanlagen sind daher als geschlossene Systeme aufgebaut,<br />
deren Kreislauf nur in seltenen Ausnahmefällen geöffnet wird. Diese<br />
seltenen Ereignisse sind temporär erheblich, wirken jedoch nicht nachhaltig,<br />
so dass ein Eingriff in das Schutzgut Mensch nicht anzunehmen<br />
ist. Der Einsatz von Flüssiggülle soll nach Aussagen des Vorhabenentwicklers<br />
nicht erfolgen.<br />
4.4. 40.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 40.1, K 40.2 und K 40.3<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope,<br />
Boden und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung von bis zu<br />
18.000 m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb<br />
des Projektgebietes hervor:<br />
• Entsiegelung von 18.000 m² versiegelten Bodens.<br />
K 40.4<br />
Die Risiken eines Betriebsunfalles mit Eindringen von Schadstoffen in<br />
Grund- und Oberflächenwasser sind auf der Ebene des immissionsschutzrechtlichen<br />
Genehmigungsverfahrens und der späteren betrieblichen<br />
Kontrollsysteme zu minimieren. Auf der Ebene der Bauleitplanung<br />
bestehen – mit Ausnahme des Vorhabenverzichts - keine Instrumente<br />
der Risiko-Minderung oder Kompensation.<br />
K 40.5<br />
Die technische Überformung der Landschaft kann durch die landschaftsgerechte<br />
Einbindung der Anlage gemindert werden. Es wird daher<br />
die Ausgleichsmaßnahme A 40.1 vorgeschlagen:<br />
„Die südliche, westliche und östliche Grenze des geplanten<br />
Sondergebietes soll durch Anlage einer mindestens 5 m<br />
breiten Baumhecke eingefasst werden. Auf 5 m Hecke sind<br />
1 Baum der Pflanzliste 3 als zukünftige Überhälter zu setzen<br />
(s. Anhang 3). Pro m² Pflanzfläche sind zusätzlich 2 Sträucher<br />
der Pflanzliste 4 zu pflanzen (s. Anhang 3). Es ist auf<br />
die Verwendung autochthonen Pflanzgutes zu achten.“<br />
186
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Schluft; Vorhaben Nr. 69 „Gemischte Baufläche“<br />
Ortsteil Schluft<br />
4.4.41 Vorhaben 69<br />
Schluft: Änderung der Darstellung „Grünfläche“ in „Gemischte Baufläche“.<br />
Ziel ist die bessere bauliche Ausnutzung eines großen Einzelhausgrundstücks<br />
mit bestehender Wohnnutzung.<br />
4.4. 41.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4. 41.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Das Projektgebiet befindet sich am süd-östlichen Rand der Ortslage<br />
Schluft. Die Erschließung erfolgt über die Hauptstraße bzw. den Scheunenweg.<br />
Nördlich grenzt die dörfliche Kernbebauung von Schluft an das Projektgebiet.<br />
Westlich und östlich befinden sich locker bebaute Einzelhausgrundstücke<br />
und auch Gartenbrachen. Schluft liegt insgesamt innerhalb<br />
eines großflächigen Kiefernforstes innerhalb der Zone III des Biosphärenreservats<br />
„<strong>Schorfheide</strong>-Chorin“.<br />
Biotoptypen Vorhaben 69 (Schluft)<br />
4.4. 41.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Der hintere östliche Teil des Grundstücks wird als Einzelhausgrundstück<br />
mit umgebenden, sehr extensiv unterhaltenen Gartenflächen genutzt. Es<br />
bestehen bauliche Anlagen einschließlich Nebenanlagen in einer Größenordnung<br />
von 700 m². Nennenswerte Gehölzstrukturen liegen nicht<br />
vor. Die Gartenflächen bieten Lebensräume für einige wenige anspruchslose<br />
Kulturfolger, die Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz<br />
ist gering.<br />
Der vordere Teil des Grundstücks liegt brach (Biotoptyp 10113 „Gartenbrachen“),<br />
von den Rändern wachsen Gehölze ein. Die offenen Flächen<br />
werden von einer Landreitgras-Flur beherrscht. Die Gartenbrache bietet<br />
187
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Schluft; Vorhaben Nr. 69 „Gemischte Baufläche“<br />
wie die oben beschriebenen Gartenflächen lediglich anpassungsfähigen,<br />
in Brandenburg häufigen und ungefährdeten Tieren Lebensraum. Die<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz ist gering.<br />
Südlich umfasst das Projektgebiet einen schmalen Streifen eines ehemaligen<br />
Fußballplatzes, der heute jedoch brach liegt und ebenfalls nahezu<br />
Reinbestände des Landreitgrases entwickelt hat (Biotoptyp<br />
051332). Auch dieser in Brandenburg häufige und durch die absolute<br />
Dominanz des Landreitgrases monostrukturierte Biotop ist von geringer<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
4.4. 41.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Das Projektgebiet hat eine Ausdehnung von etwa 5.300 m². Unter Berücksichtigung<br />
der ortsüblichen lockeren baulichen Nutzung der Einzelhausgrundstücke<br />
wird von einem maximalen Versiegelungsgrad von<br />
50% einschließlich Nebenanlagen ausgegangen. Damit wäre die bauliche<br />
Inanspruchnahme von etwa 2.650 m² eröffnet. Da im Projektgebiet<br />
bereits etwa 700 m² versiegelt oder teilversiegelt sind, ergibt sich eine<br />
tatsächliche maximale Mehrversiegelung von gerundet 2.000 m².<br />
4.4. 41.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 69.1: Die zusätzliche Versiegelung von 2.000 m² Garten ist ein erheblicher<br />
Eingriff, der kompensiert werden muss. Die beeinträchtigten Habitatqualitäten<br />
sind durch Entsiegelungsmaßnahmen ohne zusätzliche<br />
Biotopentwicklungsmaßnahmen kurzfristig wieder herstellbar.<br />
Die nicht überbauten Flächen des Projektgebietes werden zukünftig weiterhin<br />
als Gärten genutzt. Über die bauliche Entwicklung hinaus werden<br />
daher keine weiteren Eingriffe in das Schutzgut angenommen.<br />
4.4. 41.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 69.2: Die Versiegelung von etwa 2.000 m² Boden geht einher mit dem<br />
Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut Boden.<br />
Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes Boden von allgemeiner<br />
Bedeutung betroffen.<br />
K 69.3: Die Versieglung von 2.000 m² Boden reduziert Menge und Qualität<br />
der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen liegen im Plangebiet nicht vor, besondere<br />
klimatische Funktionen für angrenzende Belastungsräume bestehen<br />
nicht. Die aufgrund der geringen absoluten Größe der Mehrversiegelung<br />
und der geringen zu erwartenden Baumassen sind keine erheblichen<br />
Beeinträchtigungen des Schutzgutes Klima zu besorgen.<br />
188
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Schluft; Vorhaben Nr. 69 „Gemischte Baufläche“<br />
4.4. 41.2.3 Landschaftsbild<br />
Das Projektgebiet ist durch die direkte Grenzlage zum Dorfkern von<br />
Schluft und die visuelle Einbindung in umgebende Einzelhausgrundstücke<br />
aus der freien Landschaft nicht einsehbar und erscheint als integraler<br />
Bestandteil der Ortslage von Schluft. Die bestehende Gartennutzung<br />
mit kleinerem Gebäudebestand erfährt eine Intensivierung der Nutzung,<br />
ohne dass jedoch eine grundsätzliche Strukturänderung zu erwarten ist.<br />
Die Entwicklung von Einzelhausbebauungen mit entsprechender beigeordneter<br />
Gartennutzung ist der örtlichen Situation angemessen. Eingriffe<br />
in das Schutzgut Landschaftsbild entstehen somit nicht.<br />
4.4. 41.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 69.1, K 69.2 und K 69.3<br />
Die Kompensation der Eingriffe in die Schutzgüter Arten- und Biotope,<br />
Boden und Wasser durch die zusätzliche Versiegelung von bis zu 2.000<br />
m² Boden ruft folgende Kompensationserfordernisse außerhalb des Projektgebietes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 2.000 m² versiegelten Bodens.<br />
189
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 29, 46, 47, 48, 80 „Verkehrsflächen“<br />
4.4.42 Vorhaben 29, 46, 47, 48, 80<br />
Finowfurt: Entwicklung einer verkehrlichen Anbindung von Gewerbegebieten<br />
im Umfeld des Flugplatzes Eberswalde-Finowfurt an die Ortsumgehung<br />
Finowfurt der Bundesstraße 167 sowie die Bundesautobahn 11.<br />
4.4. 42.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4. 42.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Die Verkehrsanbindung soll von der neu herzustellenden Abfahrt der<br />
A11 westlich des Flugplatzes nördlich des Flugplatzes zum östlichen<br />
Teil des Flugplatzes geführt werden, um von hier aus östlich um den<br />
Ortskern von Finowfurt nach Norden zur Anschlussstelle mit der B167<br />
zu schwenken.<br />
4.4. 42.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Aufgrund der Länge der geplanten Verkehrsanbindung tangiert diese<br />
eine Vielzahl von Biotoptypen. Zur besseren Übersicht ist der Trassenverlauf<br />
gem. unten stehender Karte in Abschnitte unterteilt worden.<br />
Nachfolgend wird für die einzelnen Abschnitte eine Kurzbeschreibung<br />
der vorgefundenen Bestandssituation vorgenommen:<br />
Abschnitt 1<br />
Westlich des Flughafens verläuft die Trasse entlang der in diesem Bereich<br />
einspurigen Biesenthaler Straße. Der Trassenabschnitt tangiert<br />
strukturarme Kiefernforste und Vorwälder frischer Standorte. Es handelt<br />
sich ausschließlich um Biotope von geringer Bedeutung für den Arten-<br />
und Biotopschutz.<br />
Abschnitt 2:<br />
Die Trasse folgt hier der nunmehr zweispurigen Biesenthaler Straße<br />
nach Norden bis zur bereits hergestellten Abzweigung nach Westen<br />
zum Flugverkehrsmuseum. Biotopflächen werden hier nicht in Anspruch<br />
genommen.<br />
Abschnitt 3:<br />
Die Trasse verläuft hier unmittelbar nördlich des Flugplatzgeländes<br />
durch ruderale Wiesen, frische Grünlandbrachen, frische Vorwälder und<br />
junge Kiefernforste. Die Straße wird in diesem Bereich vollständig neu<br />
hergestellt. Es handelt sich ausschließlich um Biotope von geringer Bedeutung<br />
für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Abschnitt 4:<br />
Die Trasse schwenkt hier nach Norden ab. Sie führt zunächst am Rand<br />
einer trockenen Grünlandbrache mit einzelnen Trockenrasenarten (Biotoptyp<br />
05133) um dann nördlich der ehemaligen Bahnlinie durch relativ<br />
strukturreiche Kiefernforste zu führen. Die Wegeführung folgt Forstwegen<br />
und baumfreien Schneisen im Forst. Die Grünlandbrache hat aufgrund<br />
ihrer relativen Größe Bedeutung als potentieller Lebensraum für<br />
einige geschützte und/oder gefährdete Arten der trockenen Offenländer:<br />
Vögel:<br />
Brachpieper Anthus campestris (RL 1; VSchRL), Neuntöter Lanius collurio<br />
(RL 3; VSchRL), Feldschwirl Locustella naevia (RLR), Heidelerche<br />
Lullula arborea (RL 2; BArtSchV), Steinschmätzer Oenanthe oenanthe<br />
(RL 2), Braunkehlchen Saxicola rubetra (RL 2), Grünspecht Picus viridis<br />
190
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 29, 46, 47, 48, 80 „Verkehrsflächen“<br />
(Vogelschutzrichtlinie Anhang 1, BArtSchV), Sperbergrasmücke Sylvia<br />
nisoria (RL 2; VSchRL)<br />
Für nachfolgende Tierarten dürfte der Biotop wichtige Habitatfunktionen<br />
haben:<br />
Amphibien:<br />
Aufgrund der potentiell geeigneten Laichgewässer nord-östlich des Projektgebiets<br />
und im südlich angrenzenden Flugplatzgelände ist das Vorkommen<br />
von Kreuzkröte Bufo calamita (RL 1; FFH IV) und Wechselkröte<br />
Bufo viridis (RL 2; FFH IV) im Sommerlebensraum möglich.<br />
Fledermäuse (Nahrungshabitat):<br />
Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus (FFH IV), Zwergfledermaus<br />
Pipistrellus pipistrellus (FFH IV) und Braunes Langohr Plecotus auritus<br />
(FFH IV).<br />
Der Biotop hat entsprechend eine hohe Bedeutung für den Arten- und<br />
Biotopschutz.<br />
Der strukturreiche Kiefernforst hat insbesondere als Teil eines naturnahen<br />
Biotopmosaiks (vgl. auch die Ausführungen zum Vorhaben Nr. 126)<br />
eine hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Abschnitt 5:<br />
Der Abschnitt 5 nutzt eine bestehende Straßenverbindung entlang des<br />
östlichen Randes eines Gewerbegebietes.<br />
Abschnitt 6<br />
Die Trasse führt in diesem Bereich durch monostrukturierte Kiefern-<br />
Forste mit geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Abschnitt 7<br />
Die Trasse tangiert im Bereich der Niederung des Finow-Kanals Forste<br />
aus Hybrid-Pappeln mit geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
191
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 29, 46, 47, 48, 80 „Verkehrsflächen“<br />
Trassenführung und Konflikte Vorhaben 29, 46,47 und 48 (Finowfurt)<br />
Schwarze Schraffuren definieren Streckenabschnitte mit Eingriffen in Schutzgütern<br />
ohne besondere Funktionsausprägung.<br />
Rote Schraffuren definieren Eingriffe in Schutzgüter mit besonderer Funktionsausprägung.<br />
Rote Kreismarkierungen kennzeichnen Eingriffe in geschützte Biotope.<br />
Abschnitt 8<br />
Entlang des Nord- und Süd-Ufers des Finow-Kanals quert die Trasse<br />
gemäß § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz geschützte Erlenbruchwälder.<br />
Diese bieten einer Vielzahl geschützter und/oder gefährdeter<br />
Tierarten Lebensraum und sind von sehr hoher Bedeutung für den<br />
Arten- und Biotopschutz. Beeinträchtigt werden u.a. Lebensräume von<br />
192
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 29, 46, 47, 48, 80 „Verkehrsflächen“<br />
Fischotter Lutra lutra (FFH II und IV), Biber Castor Fiber (FFH II und IV),<br />
Kammmolch Triturus cristatus (FFH II und IV), Drosselrohrsänger Acrocephalus<br />
arundinaceus (RL 3; BArtSchV), Teichrohrsänger Acrocephalus<br />
scirpaceus, Teichralle Gallinula chloropus (BArtSchV), Wasserspitzmaus<br />
Neomys fodiens (RL 2; BArtSchV), (BArtSchV), Ringelnatter<br />
Natrix natrix (RL 2; BArtSchV), Moorfrosch (Rana arvalis, RL 3; FFH IV),<br />
Grasfrosch (Rana temporaria, RL 3; BArtSchV), Erdkröte Bufo bufo<br />
(BArtSchV).<br />
Abschnitt 9<br />
Nördlich des Finow-Kanals führt dieser kurze Abschnitt über floristisch<br />
verarmte Frischwiesen zur Kanalstraße. Der Biotop ist aufgrund der intensiven<br />
Bewirtschaftung und der Nähe von Wohn- und Gewerbesiedlungen<br />
von geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Abschnitt 10<br />
Der Abschnitt 10 nutzt die Kanalstraße entlang des östlichen Randes<br />
eines neu zu entwickelnden Gewerbegebietes.<br />
Abschnitt 11<br />
Nördlich der Walzwerkstraße soll die Trasse zwischen einem Kieswerk<br />
und einer wasserführenden Tongrube mit standortgemäßem Gehölzstreifen<br />
geführt werden. Der Uferbereich der Tongrube ist trotz der Nähe<br />
zum Gewerbestandort und Walzwerkstraße von hoher Bedeutung für<br />
den Arten- und Biotopschutz und unterliegt dem Schutz des § 32 Brandenburgisches<br />
Naturschutzgesetz. Die Tongruben bieten geeignete Lebensräume<br />
für eine Reihe geschützter und/oder gefährdeter Tierarten<br />
wie Drosselrohrsänger Acrocephalus arundinaceus (RL 3; BArtSchV),<br />
Teichralle Gallinula chloropus (BArtSchV), (BArtSchV), Ringelnatter<br />
Natrix natrix (RL 2; BArtSchV), Moorfrosch (Rana arvalis, RL 3; FFH IV),<br />
Grasfrosch (Rana temporaria, RL 3; BArtSchV), Erdkröte Bufo bufo<br />
(BArtSchV).<br />
Abschnitt 12<br />
Abschnitt 12 führt über intensiv genutzte Ackerflächen einer ausgeräumten<br />
Agrarlandschaft zum Anschluss an die neue Trasse der Bundesstraße<br />
167. Es werden Ackerflächen mit geringer Bedeutung für den Arten-<br />
und Biotopschutz in Anspruch genommen.<br />
4.4. 42.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Die konzipierte Verkehrsanbindung hat eine Gesamtlänge von ca. 7.500<br />
m. Bei einer durchschnittlichen Breite der Fahrbahn von 8,00 m bedeutet<br />
dies eine versiegelte Fläche von etwa 60.000 m². Auf etwa 1.750 m<br />
Länge nutzt die Trasse bestehende Straßen (14.000 m²). Auf weiteren<br />
800 m besteht eine 4 m breite Fahrspur bereits (3.300 m²). Die tatsächliche<br />
Mehrversiegelung durch die Verkehrswege beträgt damit etwa<br />
42.700 m².<br />
193
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 29, 46, 47, 48, 80 „Verkehrsflächen“<br />
4.4. 42.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 29.1: Die zusätzliche Versiegelung von 42.700 m² Bodenfläche mit<br />
überwiegend geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz ist als<br />
erheblicher Eingriff in das Schutzgut zu bewerten. Die beeinträchtigten<br />
Habitatqualitäten sind durch Entsiegelungsmaßnahmen ohne zusätzliche<br />
Biotopentwicklungsmaßnahmen kurzfristig wieder herstellbar.<br />
K 29.2: Die Straßenplanung führt allerdings auch zur Zerstörung und<br />
Beeinträchtigung von Biotopen mit hoher und sehr hoher Bedeutung für<br />
den Arten- und Biotopschutz. Bei der Ermittlung der Fläche der beeinträchtigten<br />
Biotope ist neben der unmittelbar durch die Straße und deren<br />
Seitenräume in Anspruch genommenen Fläche auch ein darüber hinaus<br />
gehender Wirkraum zu berücksichtigen. Durch die Trennwirkung der<br />
Straße, Lärm- und Abgasimmissionen sowie die verstärkten Störeinflüsse<br />
ist davon auszugehen, dass im Bereich der hochwertigen Biotopstrukturen<br />
ein 100-Meter-Korridor erheblich in seiner Funktion für den<br />
Arten- und Biotopschutz beeinträchtigt wird. Betroffen sind damit insbesondere<br />
folgende Habitate:<br />
• 34.500 m² trockene Grünlandbrachen mit Trockenrasenarten innerhalb<br />
als wichtige Teilfläche eines Biotopmosaiks und Bedeutung<br />
für geschützte und gefährdete Tierarten des Offenlandes.<br />
• 29.000 m² strukturreicher Kiefern-Mischforste als Bestandteil eines<br />
Biotopmosaiks und bedeutsamer Teillebensraum für geschützte<br />
und gefährdete Tierarten.<br />
• 14.600 m² Erlenbruchwälder und feuchte Begleitbiotope am Finowkanal<br />
mit bedeutsamen Habitatqualitäten für geschützte und<br />
gefährdete Tierarten.<br />
• 21.000 m² naturnahe Uferstrukturen und Wasserfläche von<br />
Kleingewässern<br />
4.4. 42.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 29.3: Die Versiegelung von etwa 42.700 m² Boden geht einher mit<br />
dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut<br />
Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes Boden von<br />
allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 29.4: Die Versieglung von 42.700 m² Boden reduziert Menge und<br />
Qualität der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen durch die Mehrversiegelung sind aufgrund<br />
der Verteilung der Flächenversiegelung auf ein sehr großen Eingriffsraum<br />
nicht zu erwarten.<br />
194
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 29, 46, 47, 48, 80 „Verkehrsflächen“<br />
4.4. 42.2.3 Landschaftsbild<br />
Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind in den Abschnitten<br />
4 und 8 zu erwarten, verbunden mit erheblichen Beeinträchtigungen<br />
der Naherholungsfunktion.<br />
K 29.5: Abschnitt 4 zeichnet sich durch ein reizvolles Wechselspiel trockener<br />
Grünlandbrachen und strukturreicher Forst- und Gehölzstrukturen<br />
aus, deren visueller Bezug durch die Realisierung der Straßenverbindung<br />
verloren geht. Abschnitt 4 hat Funktionen für die Naherholung,<br />
die durch das vorhaben ebenfalls erheblich beeinträchtigt werden.<br />
K 29.6: Abschnitt 8 wird geprägt durch naturnahe Erlenbruchwälder mit<br />
besonderem ästhetischen Gewicht und hoher Erlebnisvielfalt. Die Realisierung<br />
der Straßenplanung mit dem erforderlichen Brückenbauwerk<br />
führt zu einer technischen Überformung des Landschaftsraumes. Die<br />
herausragende Naherholungsfunktion des Landschaftsraumes wird<br />
durch das Vorhaben erheblich beeinträchtigt.<br />
K 29.7: Die Naherholungsfunktion in Abschnitt 1 wird ebenfalls erheblich<br />
beeinträchtigt. Der bislang weitgehend verkehrsfreie, einspurige Abschnitt<br />
der Biesenthaler Straße wird durch den Ausbau und den Verkehrszuwachs<br />
in seiner Funktion als Radwander-Strecke entwertet.<br />
4.4. 42.2.3 Schutzgut Mensch<br />
Die geplante Trasse führt durch unbesiedelte oder ausschließlich gewerblich<br />
genutzte Bereiche. Die Entfernungen zu nächstgelegenen<br />
Wohnquartieren lassen eine Beeinträchtigung der Wohnqualität durch<br />
Lärm- und Abgasimmissionen nicht befürchten.<br />
4.4. 42.3 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 29.1, K 29.3 und K 29.4<br />
Die Eingriffe in Biotope mit geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz,<br />
die Schutzgüter Boden und Wasser durch die zusätzliche<br />
Versiegelung ruft folgenden Kompensationsbedarf außerhalb des Eingriffsraumes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 42.700 m² versiegelter Boden<br />
K 29.2, K 29.5, K 29.6 und K 29.7<br />
Aus diesem Konflikt ergeben sich folgende Kompensationsbedarfe außerhalb<br />
des Eingriffsraumes:<br />
• Nachhaltige Aufwertung von 34.500 m² trockener Brachen, Acker-<br />
oder Grünlandflächen mit geringer Bedeutung für den Arten-<br />
und Biotopschutz zu extensiv genutzten Mager- und Trockenrasen,<br />
• Aufwertung von 29.000 m² Kiefern-Altersklassen-Forste mit geringer<br />
Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz zu standortgemäßen<br />
Mischwäldern durch Unterpflanzung mit heimischen,<br />
standortgerechten Laubbaumarten,<br />
• Entwicklung von 35.600 m² von Erlen und standortgemäßen<br />
Weiden bestandene Feuchtbiotope.<br />
Die Entwicklung dieser Biotopqualitäten führt gleichermaßen zu einer<br />
Aufwertung der visuellen Landschaftsqualitäten mit entsprechenden<br />
Erlebnis- und Naherholungsfunktionen.<br />
195
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 45 „Ortsumgehung Eberswalde/Finowfurt der B167“<br />
4.4.43 Vorhaben 45<br />
Finowfurt: Nachrichtliche Übernahme der Trasse der neuen Ortsumgehung<br />
Eberswalde / Finowfurt der Bundesstraße 167. Die erforderlichen<br />
Planverfahren zur planerischen Vorbereitung des Vorhabens sind eingeleitet.<br />
In diesem Verfahren werden die umweltbezogenen Auswirkungen<br />
des Vorhabens detailliert erhoben. Im Rahmen des Flächennutzungsplans<br />
werden lediglich überschlägig die Umweltauswirkungen ermittelt,<br />
um eine Größenordnung des zu erwartenden Kompensationsbedarfs<br />
feststellen zu können. Vermeidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen werden<br />
nicht benannt, um Widersprüche mit den Ergebnissen der Straßenplanungen<br />
zu verhindern.<br />
4.4. 43.1 Bestandsbeschreibung und -bewertung<br />
4.4. 43.1.1 Räumliche Lage und Einbindung<br />
Die neue Trasse der Ortsumgehung beginnt westlich an der Anbindung<br />
der Bundesstraße 198 und verläuft zukünftig entlang der nördlichen Uferseite<br />
des Oder-Havel-Kanals. Östlich der Bundesautobahn A11<br />
schwenkt die Trasse nach Süden und quert außerhalb Finowfurts den<br />
Oder-Havel-Kanal. Im Weiteren folgt die Trasse dem Oder-Havel-Kanal<br />
auf der südlichen Uferseite bis zur Grenze des <strong>Gemeinde</strong>gebietes.<br />
4.4. 43.1.2 Biotoptypenkartierung<br />
Aufgrund der Länge der geplanten Verkehrsanbindung tangiert diese<br />
eine Vielzahl von Biotoptypen. Zur besseren Übersicht ist der Trassenverlauf<br />
gem. unten stehender Karte in Abschnitte unterteilt worden.<br />
Nachfolgend wird für die einzelnen Abschnitte eine Kurzbeschreibung<br />
der vorgefundenen Bestandssituation vorgenommen:<br />
Abschnitt 1<br />
Die Trasse folgt hier dem Verlauf eines teilversiegelten Feldweges, der<br />
der Erschließung des Camping-Platzes am Üdersee dient. Die Verbreiterung<br />
des Weges führt zur Inanspruchnahme frischer ruderaler Staudenfluren.<br />
Es handelt sich um Biotope von geringer Bedeutung für den<br />
Arten- und Biotopschutz.<br />
Abschnitt 2:<br />
Die Trasse folgt hier ebenfalls dem Erschließungsweg des Campingplatzes.<br />
Die Trasse verläuft durch wegebegleitende Gehölzstrukturen mit<br />
hohem Anteil an Altbaumbestand. Die Alt-Gehölze haben aufgrund der<br />
intensiven anthropogenen Störeinflüsse (Campingplatz, Erschließungsweg<br />
und Querung der A11) lediglich eine mittlere Bedeutung für den<br />
Arten- und Biotopschutz.<br />
Abschnitt 3:<br />
Die Trasse verläuft östlich der Querung der A11 über intensiv genutzte<br />
Ackerflächen und wird in diesem Bereich vollständig neu hergestellt. Es<br />
handelt sich um Biotope von geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
Abschnitt 4:<br />
Dieser Abschnitt schneidet relativ strukturreiche Kiefernforste des Binnendünenhanges<br />
und frische Laubholzforste in den tieferen Lagen am<br />
196
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 45 „Ortsumgehung Eberswalde/Finowfurt der B167“<br />
Oder-Havel-Kanal. Beide Biotope sind von mittlerer Bedeutung für den<br />
Arten- und Biotopschutz.<br />
Abschnitt 5:<br />
Die Trasse verläuft östlich der Querung des Oder-Havel-Kanals über<br />
intensiv genutzte Ackerflächen und wird in diesem Bereich vollständig<br />
neu hergestellt. Es handelt sich um Biotope von geringer Bedeutung für<br />
den Arten- und Biotopschutz.<br />
Trassenführung und Konflikte Vorhaben 45 (Finowfurt)<br />
Schwarze Schraffuren definieren Streckenabschnitte mit Eingriffen in Schutzgütern<br />
ohne besondere Funktionsausprägung.<br />
Rote Schraffuren definieren Eingriffe in Schutzgüter mit besonderer Funktionsausprägung.<br />
4.4. 43.2 Konflikte<br />
Nachfolgend werden diejenigen Schutzgüter thematisiert, für die eine<br />
erhebliche Beeinträchtigung nach überschlägiger Vorprüfung denkbar<br />
ist. Schutzgüter, die offenkundig nicht vom Vorhaben beeinträchtigt werden,<br />
werden nicht dargestellt.<br />
Die konzipierte Verkehrsanbindung hat eine Gesamtlänge von ca. 4.000<br />
m. Bei einer angenommenen durchschnittlichen Breite der Fahrbahn von<br />
10,00 m bedeutet dies eine versiegelte Fläche von etwa 40.000 m².<br />
4.4. 43.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
K 45.1: Die zusätzliche Versiegelung von 40.000 m² Bodenfläche mit<br />
überwiegend geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz ist als<br />
erheblicher Eingriff in das Schutzgut zu bewerten. Die beeinträchtigten<br />
Habitatqualitäten sind durch Entsiegelungsmaßnahmen ohne zusätzliche<br />
Biotopentwicklungsmaßnahmen kurzfristig wieder herstellbar.<br />
K 45.2: Das Vorhaben zerstört auf einer Länge von etwa 1.300 m etwa<br />
200 wegebegleitende, alte Bäume. Der Wirkraum beschränkt sich aufgrund<br />
des Verlaufs entlang des Oder-Havel-Kanals südlich und des<br />
Campingplatzes unmittelbar nördlich auf die tatsächlich in Anspruch<br />
genommenen Gehölzflächen. Dieser Eingriff ist aufgrund der langen<br />
197
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 45 „Ortsumgehung Eberswalde/Finowfurt der B167“<br />
Wiederherstellungszeiträume der beeinträchtigten Biotopqualitäten nicht<br />
ausgleichbar, sondern kann nur ersetzt werden.<br />
K 45.3: Abschnitt 4 führt durch relativ gut strukturierte Forstflächen. Bei<br />
der Ermittlung der Fläche der beeinträchtigten Biotope ist neben der<br />
unmittelbar durch die Straße und deren Seitenräume in Anspruch genommenen<br />
Fläche auch ein darüber hinaus gehender Wirkraum zu berücksichtigen.<br />
Durch die Trennwirkung der Straße, Lärm- und Abgasimmissionen<br />
sowie die verstärkten Störeinflüsse ist davon auszugehen,<br />
dass im Bereich der Biotopstrukturen mit mittlerer Bedeutung für den<br />
Arten- und Biotopschutz ein 100-Meter-Korridor erheblich in seiner<br />
Funktion für den Arten- und Biotopschutz beeinträchtigt wird. Betroffen<br />
sind damit insbesondere folgende Habitate:<br />
• 45.000 m² strukturreicher Kiefernforste.<br />
• 35.000 m² frische Laubholz-Forste.<br />
4.4. 43.2.2 Abiotische Schutzgüter<br />
Boden, Wasser und Klima<br />
K 45.4: Die Versiegelung von etwa 40.000 m² Boden geht einher mit<br />
dem Verlust der Puffer-, Reinigungs- und Retentionsfunktionen des Bodens.<br />
Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger Eingriff in das Schutzgut<br />
Boden. Es sind Funktionsausprägungen des Schutzgutes Boden von<br />
allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
K 45.5: Die Versieglung von 40.000 m² Boden reduziert Menge und<br />
Qualität der Grundwasserneubildung. Dies ist ein erheblicher und nachhaltiger<br />
Eingriff in das Schutzgut Wasser. Es sind Funktionsausprägungen<br />
des Schutzgutes Wasser von allgemeiner Bedeutung betroffen.<br />
Klimatische Belastungssituationen durch die Mehrversiegelung sind aufgrund<br />
der Verteilung der Flächenversiegelung auf ein sehr großen Eingriffsraum<br />
nicht zu erwarten.<br />
4.4. 43.2.3 Landschaftsbild<br />
Erhebliche Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sind in den Abschnitten<br />
2, 4 und 5 zu erwarten, teilweise verbunden mit erheblichen<br />
Beeinträchtigungen der Naherholungsfunktion.<br />
K 45.6: Die wegebegleitenden Gehölzstrukturen in Abschnitt 2 stellen<br />
aufgrund ihres teilweise hohen Alters eine landschaftsästhetisch bedeutsame<br />
Bereicherung des Landschaftsbildes dar.<br />
K 45.7: In Abschnitt 4 führt die Realisierung der Straßenplanung mit<br />
dem erforderlichen Brückenbauwerk über den Oder-Havel-Kanal zu einer<br />
technischen Überformung des Landschaftsraumes.<br />
K 45.8: In Abschnitt 3 und 5 verläuft die Umgehungsstraße der B167<br />
durch eine ausgeräumte Agrarlandschaft mit geringem Landschaftsästhetischem<br />
Eigenwert. Die Realisierung des Vorhabens wird jedoch aufgrund<br />
der Weiträumigkeit und damit Transparenz der betroffenen Agrar-<br />
198
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 45 „Ortsumgehung Eberswalde/Finowfurt der B167“<br />
landschaft zu einer weithin sichtbaren technischen Überformung des<br />
Raumes führen.<br />
K 45.9: Die Naherholungsfunktion in Abschnitt 1 und 2 wird ebenfalls<br />
erheblich beeinträchtigt. Der bislang weitgehend verkehrsfreie Schotterweg<br />
zur Erschließung des Campingplatzes wird intensiv als Wander-<br />
und Radwanderweg genutzt. Die Uferböschung des Oder-Havel-Kanals<br />
dient als Angelstelle. Die Naherholungsfunktion geht vollständig verloren.<br />
4.4. 43.2.3 Schutzgut Mensch<br />
K 45.10: Die Aufenthaltsqualität im Bereich des Campingplatzes wird<br />
durch die zukünftig unmittelbar an den Campinglatz angrenzende Bundesstraße<br />
durch Lärm- und Abgasimmissionen erheblich beeinträchtigt.<br />
Die geplante Trasse führt ansonsten durch unbesiedelte Bereiche. Die<br />
Entfernungen zu nächstgelegenen Wohnquartieren lassen eine Beeinträchtigung<br />
der Wohnqualität durch Lärm- und Abgasimmissionen nicht<br />
befürchten.<br />
4.4. 43.4 Vermeidungs- Kompensationserfordernisse<br />
K 45.1, K 45.4 und K 45.5 (Allg. Artenschutz, Boden u. Wasser)<br />
Die Eingriffe in Biotope mit geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz,<br />
die Schutzgüter Boden und Wasser durch die zusätzliche<br />
Versiegelung ruft folgenden Kompensationsbedarf außerhalb des Eingriffsraumes<br />
hervor:<br />
• Entsiegelung von 40.000 m² versiegelter Boden<br />
K 45.2 und K 45.6 (Baumverluste und Landschaftsbild)<br />
Aus dem Verlust von etwa 200 Altbäumen entlang des Abschnittes 2<br />
ergeben sich folgende Kompensationsbedarfe:<br />
• Pflanzung von ca. 800 Bäumen<br />
Das Verhältnis von 1:4 von Baumverlusten zu Baumpflanzungen ist aufgrund<br />
der erheblichen zeitlichen Verzögerung bis zur Wiederherstellung<br />
der ursprünglichen Baumsubstanz erforderlich.<br />
K 45.6 (Allg. Artenschutz)<br />
Aus der Zerschneidung von Forstflächen in Abschnitt 5 ergeben sich<br />
folgende Kompensationsbedarfe außerhalb des Eingriffsraumes:<br />
• Entwicklung von 70.000 m² standortgemäße Laubmischwälder<br />
auf Standorten mit geringer Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz.<br />
K 45.8 (Landschaftsbild)<br />
Die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes in den Abschnitten 3 und 5<br />
auf einer Trassenlänge erfordert folgende landschaftsgestaltende Maßnahmen:<br />
199
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Finowfurt; Vorhaben Nr. 45 „Ortsumgehung Eberswalde/Finowfurt der B167“<br />
• Anlage von Baumhecken in einer Größenordnung von 2.600 m<br />
Länge und einer Breite von 5 m (13.000 m²).<br />
K 45.9 und K 45.10 (Naherholung und Mensch)<br />
Im Rahmen der übergeordneten Planverfahren sollte die <strong>Gemeinde</strong> darauf<br />
drängen, die Beeinträchtigung der Aufenthaltsqualität des Campingplatzes<br />
zwischen Üdersee und Oder-Havel-Kanal durch geeignete<br />
Lärmminderungsmaßnahmen zu reduzieren.<br />
200
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
5 Kompensationsmaßnahmen<br />
Tabelle 2 bilanziert die baulichen Entwicklungspotentiale, die im Zuge der Änderung<br />
und der Integration der Flächennutzungspläne der ehemaligen <strong>Gemeinde</strong>n<br />
Groß Schönebeck und Finowfurt zum gemeinsamen FNP der <strong>Gemeinde</strong><br />
<strong>Schorfheide</strong> aufgegeben bzw. neu entwickelt wurden. Im Saldo erhöhen<br />
sich die baulichen Entwicklungspotentiale der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> um<br />
ca. 112ha. Der Hauptanteil an diesen zusätzlichen Entwicklungsmöglichkeiten<br />
mit insgesamt etwa 90ha versiegelter Flächen entfällt auf Vorhaben im unmittelbaren<br />
Umfeld des Flugplatzes Eberswalde-Finow.<br />
Tabelle 2: Überblick über die Bilanz der Bauflächenentwicklung<br />
Vorhaben Mehr-/Minderpotentiale<br />
115 (1) 1.100 m²<br />
115 (2) 500 m²<br />
79 22.000 m²<br />
76 - 3.400 m²<br />
145 1.300 m²<br />
1 26.400 m²<br />
3 760.400 m²<br />
6 55.600 m²<br />
20 2.200 m²<br />
44 - 35.200 m²<br />
50 16.800 m²<br />
52 13.800 m²<br />
54 7.600 m²<br />
65 1.300 m²<br />
68 6.800 m²<br />
105 17.000 m²<br />
112 6.000 m²<br />
117 3.480 m²<br />
126 73.600 m²<br />
133 11.000 m²<br />
137 - 400 m²<br />
138 3.600 m²<br />
139 660 m²<br />
140 660 m²<br />
82 2.300 m²<br />
91 13.850 m²<br />
141 1.450 m²<br />
147 18.000 m²<br />
108 5.200 m²<br />
132 1.260 m²<br />
143 2.100 m²<br />
63 1.500 m²<br />
88 500 m²<br />
93 5.200 m²<br />
33 5.300 m²<br />
69 2.000 m²<br />
29, 46,47,48, 80 42.700 m²<br />
45 40.000 m²<br />
Bilanz: 1.134.160 m²<br />
201
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
5.1 Zusammenstellung der Kompensationsbedarfe<br />
Diese Intensivierung der Nutzungen führt zu einer Reihe von Eingriffen<br />
in die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes, die nur zu geringen Anteilen<br />
innerhalb der Projektgebiete kompensiert werden können. In Anhang<br />
1 werden die Vermeidungs- und Kompensationsmaßnahmen, die<br />
innerhalb der Projektgebiete realisiert werden können den tatsächlichen<br />
Kompensationsbedarfen gegenübergestellt.<br />
Es zeigt sich, dass die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen nur zu<br />
einem untergeordneten Anteil innerhalb der Projektgebiete vorgenommen<br />
werden können. Tabelle 3 zeigt die Kompensationsbedarfe, die<br />
außerhalb der Projektgebiete zu realisieren sind. Die ausführliche,<br />
vorhabenbezogene Ermittlung der Kompensationsbedarfe kann der Anlage<br />
1 entnommen werden.<br />
Tabelle 3: Überblick Maßnahmeerfordernisse außerhalb der Projektgebiete<br />
Nr. Maßnahmetyp Umfang<br />
M1 Bodenentsiegelung 113,4 ha<br />
M2 Trockenrasenentwicklung<br />
Waldumbau Kiefern-Monokulturen in<br />
1,7 ha<br />
M3 Laubmischwälder 16,7 ha<br />
M4<br />
Biotopentwicklung auf trockenen Brachen<br />
und Sandäckern 19,6 ha<br />
M6 Entwicklung v. Feuchtbiotopen 3,6 ha<br />
M7 Baumpflanzungen 800,0 Stk<br />
M8 Erstaufforstung v. Laubmischwäldern 9,3 ha<br />
M9 Anlage v. Baumhecken 1,3 ha<br />
Tabelle 4 berechnet für diese außerhalb der Projektgebiete erforderlichen<br />
Kompensationsbedarfe die bei einer idealerweise vorzunehmenden<br />
1:1-Kompensation anfallenden Wiederherstellungskosten. Die Einzelpreise<br />
basieren im Wesentlichen auf den Kostentabellen im Anhang<br />
zum „Flächenpool – das Barnimer Modell“ (Landkreis Barnim 2005). Den<br />
„idealen“ Wiederherstellungskosten werden die Kosten der tatsächlich<br />
vorgenommenen Kompensationsmaßnahmen gegenüber gestellt (s.<br />
Tab. 5). Es ergeben sich Wiederherstellungskosten in Höhe von 13 Mio.<br />
€.<br />
202
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
Tabelle 4: Kosten der erforderlichen Kompensationsmaßnahmen<br />
Nr. Maßnahme Menge LP EP/€ GP/€<br />
M 1 Entsiegelung in m² 1.134.160<br />
M 2 Trockenrasenentwicklung (m²) 16.800<br />
M 3<br />
M 4<br />
M 6<br />
Waldumbau: Kiefern-<br />
Monokulturen in Laubmischwälder<br />
(m²) 167.000<br />
Biotopentwicklung auf trockenen<br />
Brachen und 195.500<br />
Abriss und Flächenentsiegelung<br />
10,00 11.341.600<br />
Gesamt: 10,00 11.341.600<br />
25 Jahre Entwicklungspflege<br />
m. 2 Pflegeschnitten/a 1,50 25.200<br />
Gesamt: 1,50 25.200<br />
Auslichten d. Altbestandes,<br />
Unterpflanzung m. Laubbaumarten,<br />
Zäunung 1,00 167.000<br />
5 Jahre Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege 0,50 83.500<br />
Gesamt: 1,50 250.500<br />
25 Jahre Entwicklungspflege<br />
m. 2 Pflegeschnitten/a 1,50 293.250<br />
Sandäckern (m²) Gesamt: 1,50 293.250<br />
Entwicklung v. Feuchtbiotopen<br />
(m²) 35.600 Neuanlage und Entkrautung 3,00 106.800<br />
Gesamt: 3,00 106.800<br />
M 7 Baumpflanzung an Straßen 800 Pflanzgrube 100/100/80 cm 20,00 16.000<br />
(Stück) Hochstamm, 16/18 cm StU 185,00 148.000<br />
Pflanzung 30,00 24.000<br />
Baumpfahl 35,00 28.000<br />
F/E-Pflege (3 Jahre) 68,00 54.400<br />
M 8<br />
Erstaufforstung v. Laubmischwäldern<br />
(m²) 93.200<br />
Gesamt: 338,00 270.400<br />
Herstellung naturnaher Wälder<br />
einschl. Waldrandgestaltung<br />
und Zäunung 2,00 186.400<br />
5 Jahre Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege 0,50 46.600<br />
20 Jahre Jungwuchspflege 0,40 37.280<br />
Gesamt:<br />
Baum- und Strauchpflanzun-<br />
2,90 270.280<br />
M 9 Anlage von Baumhecken (m²) 13.000 gen 2,50 32.500,00<br />
3 Jahre Entwicklungspflege 2,00 26.000,00<br />
lfd. m 2.200 Erstellung Wildschutzzaun 5,00 11.000,00<br />
Gesamt: 9,50 123.500<br />
Gesamtsumme M 1 bis M 10 12.681.530<br />
5.2 Übernahme von Kompensationsflächen der Alt-FNPs<br />
Die gültigen Flächennutzungspläne der Alt-<strong>Gemeinde</strong> Finowfurt und der<br />
Amtsgemeinde Groß Schönebeck weisen bereits Flächen zur Durchführung<br />
von Kompensationsmaßnahmen aus. Für die <strong>Gemeinde</strong> Finowfurt<br />
wird für die zu erwartenden Beeinträchtigungen aus dem gültigen FNP<br />
ein Kompensationsflächenbedarf von 81,0 ha ermittelt (Begründung zum<br />
FNP, Anlage 3, S. 17). Die Flächen und Maßnahmen Nummer 1 bis 13<br />
werden aus dem gültigen FNP unverändert übernommen. In der Summe<br />
werden hiermit etwa 415,2 ha Flächen für Kompensationsmaßnahmen<br />
dargestellt. Damit ist es möglich, ausreichend Flächen für die Durchführung<br />
von Kompensationsmaßnahmen für die Eingriffe in Natur und<br />
203
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
Landschaft bereit zu stellen, die vom FNP der <strong>Gemeinde</strong> Finowfurt planerisch<br />
vorbereitet wurden.<br />
Der FNP der Amtsgemeinde Groß Schönebeck stellt ebenfalls Flächen<br />
für die Entwicklung von Natur und Landschaft dar. Diese werden vollständig<br />
in den neuen FNP übernommen (Nummern 14 und 15).<br />
Nr. 1: Grünflächen am Finowkanal unmittelbar am alten Dorfkern von<br />
Finowfurt: (vormals Nr. 2.1).<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und der Biotopqualität.<br />
Maßnahmen: Entwicklung zum extensiven Dauergrünland (ungedüngte<br />
Feuchtwiesenbrachen, kräuterreiche Mähwiesen, Weiden mit begrenztem<br />
Viehbesatz) / Erhalt und Pflege der ortsnahen Streuobstwiesen und<br />
des Grabelandes. Flächengröße: 7 ha.<br />
Nr. 2: Grünland nördlich des Flugplatzes sowie ehemaliger Militärflächen:<br />
(vormals Nr. 2.5).<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und der Biotopqualität.<br />
Maßnahmen: Entwicklung zum extensiven Dauergrünland (ungedüngte<br />
Feuchtwiesenbrachen, kräuterreiche Mähwiesen, Weiden mit begrenztem<br />
Viehbesatz) / Freihalten von Trockenbiotopen / landschaftsgerechte<br />
Einbindung und Eingrünung von Siedlungsrändern und des geplanten<br />
Regionalflughafens (hier auch zum Immissionsschutz) / Erhaltung und<br />
Aufwertung naturnaher Kleingewässer und Übergangsbereiche. Flächengröße:<br />
53 ha.<br />
Nr. 3: Grünland und Landwirtschaftsfläche zwischen Messingwerkstraße<br />
und Oder-Havel-Kanal: (vormals Nr. 2.9).<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und der Biotopqualität.<br />
Maßnahmen: Entwicklung zum extensiven Dauergrünland (ungedüngte<br />
Feuchtwiesenbrachen, kräuterreiche Mähwiesen, Weiden mit begrenztem<br />
Viehbesatz) / Eingrünung von Gebäuden im Außenbereich / Mähen<br />
von extensivem Grünland / Anlage eines standortgerechten Waldmantels<br />
an dem östlichen Waldstück. Flächengröße: 70 ha.<br />
Nr. 4: Grünland und Waldfläche südlich von Hubertusmühle: (vormals<br />
Nr. 2.10).<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und der Biotopqualität.<br />
Maßnahmen: Extensivierung des Grünlandes / Entwicklung der Waldmäntel.<br />
Flächengröße: 16,4 ha.<br />
Nr. 5: Fläche südlich von Eichhorst am Werbellinkanal: (vormals Nr.<br />
4.4).<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Entwicklung für das Erholungspotenzial<br />
am Werbellinkanal.<br />
Maßnahmen: Renaturierung ausgebauter Kanalabschnitte / Ausweisung<br />
eines mehrstämmigen Altbaumes am Werbellinkanal als Naturdenkmal<br />
südlich des bestehenden Naturdenkmals „Alte Eiche“ in direktem Ortszusammenhang<br />
und einer alten Eiche als Naturdenkmal am Kanal am<br />
südlichen Ortsausgang. Flächengröße: 11,1 ha<br />
Nr. 6: Grünland, Gärten und Uferzonen des nördlichen Werbellinkanals:<br />
(vormals Nr. 4.6).<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und der Biotopqualität<br />
204
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
Maßnahmen: Verbesserung geschützter Kanalabschnitte (Sohle, Ufer,<br />
Bewuchs) / Entwicklung zum extensiven Dauergrünland (ungedüngte<br />
Feuchtwiesenbrache) im nördlichen Bereich zu den Fliegner Teichen.<br />
Flächengröße:13,5 ha.<br />
Nr. 7: Grünland südlich von Rosenbeck am Werbellinkanal: (vormals Nr.<br />
4.8).<br />
Ziel: Erhalt und Verbesserung der Biotopqualität.<br />
Maßnahmen: landschaftsgerechte Einbindung von Siedlungsrändern /<br />
Eingrünung von Gebäuden im Außenbereich / Verbesserung geschützter<br />
Kanalabschnitte (Sohle, Ufer, Bewuchs) / Entwicklung zum extensiven<br />
Dauergrünland (ungedüngte Feuchtwiesenbrache). Flächengröße:13,7<br />
ha.<br />
Nr. 8: Landwirtschaftsfläche zwischen Üdersee und A 11: (vormals Nr.<br />
5.4).<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und der Biotopqualität.<br />
Maßnahmen: Entwicklung zu extensivem Dauergrünland (ungedüngte<br />
Feuchtwiesenbrachen, kräuterreiche Mähwiesen, Weiden mit begrenztem<br />
Viehbesatz) als Pufferzone zur A 11. Flächengröße:19 ha.<br />
Nr. 9: Grünland- und Ackerflächen an der A 11 nördlich des Großen<br />
Buckowsees: (vormals Nr. 5.10).<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und der Biotopqualität.<br />
Maßnahmen: Entwicklung zu extensivem Dauergrünland (ungedüngte<br />
Feuchtwiesenbrachen, kräuterreiche Mähwiesen, Weiden mit begrenztem<br />
Viehbesatz) als Pufferzone zur A 11. Flächengröße: 11,6 ha.<br />
Nr. 10: entfällt<br />
Nr. 11: Grünland- und Landwirtschaftsflächen südwestlich von Lichterfelde:<br />
(vormals Nr. 7.1).<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Erhaltung bzw. Wiederherstellung<br />
der Boden- und Biotopqualität.<br />
Maßnahmen: landschaftsgerechte Einbindung von Siedlungsformen,<br />
Entwicklung zu extensivem Dauergrünland (ungedüngte Feuchtwiesenbrachen,<br />
kräuterreiche Mähwiesen, Weiden mit begrenztem Viehbesatz)<br />
/ Eingrünung von Gebäuden im Außenbereich / Schließung oder Aufhebung<br />
von Flächendrainagen soweit es die vorhandene Bebauung zulässt.<br />
Flächengröße: 68 ha.<br />
Nr. 12: Grünland- und Landwirtschaftsflächen südöstlich von Lichterfelde:<br />
(vormals Nr. 7.3)<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Erhaltung bzw. Wiederherstellung<br />
der Boden- und Biotopqualität.<br />
Maßnahmen: landschaftsgerechte Einbindung von Siedlungsrändern,<br />
Entwicklung zu extensivem Dauergrünland (ungedüngte Feuchtwiesenbrachen,<br />
kräuterreiche Mähwiesen, Weiden mit begrenztem Viehbesatz)<br />
/ Eingrünung von Gebäuden im Außenbereich / Erhalt und Pflege der<br />
Streuobstwiesen und Gärten am südöstlichen und östlichen Dorfrand /<br />
Schließung oder Aufhebung von Flächendrainagen soweit es die vorhandene<br />
Bebauung zulässt / Eingrünung von störenden Ver- und Entsorgungsanlagen.<br />
205
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
Die Fläche reduziert sich durch die planerische Darstellung des Sondergebietes<br />
„Biomasseanlage“ (Vorhaben-Nummer 147) um 3,6 ha von<br />
93,5 ha auf nunmehr 89,9 ha.<br />
Nr. 13: Grünland- und Landwirtschaftsflächen südlich von Lichterfelde:<br />
(vormals Nr. 7.4).<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Erhaltung bzw. Wiederherstellung<br />
der Boden- und Biotopqualität.<br />
Maßnahmen: landschaftsgerechte Einbindung von Siedlungsrändern,<br />
Entwicklung zu extensivem Dauergrünland (ungedüngte Feuchtwiesenbrachen,<br />
kräuterreiche Mähwiesen, Weiden mit begrenztem Viehbesatz)<br />
/ Eingrünung von Gebäuden im Außenbereich. Flächengröße: 42 ha.<br />
Nr. 14: Zehdenicker Feld südlich von Groß Schönebeck.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Erhaltung bzw. Wiederherstellung<br />
der Boden- und Biotopqualität.<br />
Maßnahmen: Extensivierung der landwirtschaftlichen Nutzung.<br />
Nr. 15: Schönebecker Fließ nordöstlich von Groß Schönebeck.<br />
Ziel: Sicherung des uneingeschränkten Durchflusses sowie der Erhalt<br />
und die Entwicklung der Vegetation im Uferbereich.<br />
5.3 Kompensationsmaßnahmen des WSA Eberswalde<br />
Als weitere Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur<br />
Entwicklung von Natur und Landschaft werden Flächen für Kompensationsmaßnahmen<br />
des WSA Eberswalde dargestellt. Die auf diesen Flächen<br />
durchzuführenden Maßnahmen sind als Ausgleich für Eingriffe in<br />
Natur und Landschaft durch das WSA (z.B. Ausbau des Oder-Havel-<br />
Kanals, Neubau der Ausweichstelle Eberswalde, Neubau von Straßenbrücken)<br />
vorgesehen:<br />
Nr. 16.1: Fläche östlich der Feuerwehr in Eichhorst<br />
Maßnahme: Anpflanzung von Weichhölzern (0,33 ha) – Los D / E4<br />
Nr. 16.2: Zwischenlagerfläche 3 nordöstlich der Ortslage Finowfurt<br />
Maßnahme: Rekultivierung der Zwischenlagerfläche (22,95 ha) – Los E /<br />
A4<br />
Nr. 17: Grünland zwischen Ortslage Lichterfelde und Oder-Havel-Kanal.<br />
Maßnahme: Erstaufforstung auf 9 ha (standort- und landschaftsgerecht,<br />
vorrangig Laubhölzer, Waldrandgestaltung) – Los E / A5<br />
Nr. 18.1: Grünland an der B167 (Bereich Langer Grund)<br />
Maßnahme: Entwicklung von Trockenbiotopen und Anlage einer Benjes-<br />
Hecke (3,79 ha, 150 m) zur Bundesstraße b 167 – Los E / E1<br />
Nr. 18.2: Fläche südwestlich Lichterfelde, Maßnahmen für den neubau<br />
der Straßenbrücke Mäckersee<br />
Maßnahme: Pflanzungen, Entsiegelung – Los F / EF 1-10<br />
Nr. 19: Fläche im Ortsteil Altenhof mit Lage an der Autobahn A 11.<br />
Maßnahme: Erstaufforstung auf 36,55 ha- Los F / E1<br />
206
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
Nr. 20: Feuchtbereich „Schwabensluch“ südlich von Klein Dölln in Groß<br />
Schönebeck (an der L 100).<br />
Maßnahme: Wiedervernässung des Schwabensluchs durch Rückbau<br />
des vorhandenen Schöpfwerkes (25 ha) – Los H / E6<br />
Nr. 21: Grünland östlich der Ortslage Lichterfelde.<br />
Maßnahme: Maßnahmen am Lichterfelder Hauptgraben: Pflanzungen,<br />
Grabenaufweitung, Entschlammung des Kleingewässers, Extensivierung<br />
und Pflege<br />
Planfestgestellte Kompensationsmaßnahmen des WSA Eberswald, die<br />
aufgrund ihrer geringen Größe nicht in der Planzeichnung dargestellt<br />
sind:<br />
� Baustelleneinrichtungsfläche südwestlich des Üdersees<br />
Maßnahme: Rekultivierung der Baustelleneinrichtungsfläche Kanal-<br />
Südseite km 57,7 (530m²) – Los E / A4<br />
� Rohrdurchlässe Nähe Schleuse Grafenbrück<br />
Maßnahme: Tieferlegung Rohrdurchlässe am Steinfurther Wiesengraben<br />
zur Verbesserung der Durchgängigkeit – Los E / A 7/1 und A<br />
7/2<br />
� Maßnahmen Kaiserwegbrücke, südwestlich des Üdersees<br />
Maßnahme: Entsiegelung, verschiedene Pflanzungen – Los E / KK 1-<br />
7<br />
� Maßnahmen Steinfurther Brücke, Finowfurt, Werbelliner Straße<br />
Maßnahme: verschiedene Pflanzungen, Entsiegelung, Gehweg anlegen<br />
– LOS E / KS 1-6<br />
5.4 Zusätzliche Kompensationsmaßnahmen<br />
Durch die Neuaufstellung des FNP werden bislang unberücksichtigte<br />
Eingriffe in den Naturhaushalt planerisch vorbereitet, für die nachfolgend<br />
die erforderlichen Kompensationsmaßnahmen und Kompensationsflächen<br />
dargestellt werden.<br />
Es ist nicht auszuschließen, dass zu gegenwärtigen Zeitpunkt nicht alle<br />
der vorgesehenen Flächen für Kompensationsmaßnahmen zur Verfügung<br />
stehen. Da der FNP einen zeitlichen Horizont von 25 Jahren sowohl<br />
für die Eingriffsrealisierung als auch für die Kompensation aufweist,<br />
ist die aktuelle Nicht-Verfügbarkeit kein Ausschlusskriterium für die<br />
Ausweisung von Kompensationsflächen. Sollte im Laufe der gemeindlichen<br />
Entwicklung dennoch ein faktisches Defizit der Kompensationsflächen<br />
entstehen, bestehen im Rahmen der durch den Alt-FNP der <strong>Gemeinde</strong><br />
Finowfurt ausgewiesenen Kompensationsflächen ausreichend<br />
Flächenreserven, um dies aufzufangen.<br />
Landwirtschaftliche Flächen, die derzeit in Flächenstilllegungsprogramme<br />
oder landwirtschaftliche Extensivierungsprogramme eingebunden<br />
sind, haben dennoch Aufwertungspotential im Sinne des Naturschutzrechts,<br />
da die Realisierung naturschutzfachlicher Kompensationsmaßnahmen<br />
erstens die temporäre Extensivierung der Landwirtschaftsprogramme<br />
in eine nachhaltige Extensivierung überführt und v.a. gezielte<br />
Pflegemaßnahmen mit Ziel-Biotopqualitäten benannt werden.<br />
207
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
Nr. 22: Finowfurt: Südlicher Bereich des Kasernenstandortes an der<br />
Biesenthaler Str.<br />
Ziel: Rekultivierung des Kasernengeländes. Wiederherstellung von Boden-,<br />
Wasser- und Biotopfunktionen.<br />
Maßnahmen: Rückbau vorhandener Gebäude und versiegelter Flächen<br />
(1,2 ha), Anlage naturnaher Laubwälder und Laub-Mischwälder heimischer<br />
Baumarten mittlerer Standorte (Biotoptyp 08293: 1,85 ha) und<br />
Waldmäntel (Biotoptyp 07120) auf Grünlandbrachen einschließlich Wildschutzzaun,<br />
5 Jahren Entwicklungs- und 20 Jahren Jungwuchspflege<br />
sowie Umbau von älteren Kiefernforsten zu strukturreichen Laubmischwälder<br />
einschließlich Zäunung und 5 Jahren Entwicklungspflege (Biotoptyp<br />
08293; 7,9 ha).<br />
Nr. 23: Altenhof, Ferienhäuser am Werbellinsee an der südlichen Verlängerung<br />
der Dorfstraße.<br />
Ziel: Rekultivierung der Ferienhausanlage, Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Wiederherstellung von Boden-, Wasser- und Biotopfunktionen.<br />
Maßnahmen: Rückbau vorhandener Gebäude und versiegelter Flächen<br />
(300 m²).<br />
Nr. 24: Döllner Siedlung.<br />
Ziel: Wiederherstellung von Boden-, Wasser- und Biotopfunktionen.<br />
Maßnahmen: Rückbau nicht mehr benötigter Gebäude und versiegelter<br />
Flächen (1 ha).<br />
Nr. 25: Querbahn Verkehrslandeplatz Eberswalde-Finow.<br />
Ziel: Wiederherstellung von Boden-, Wasser- und Biotopfunktionen.<br />
Maßnahmen: Rückbau der nicht mehr benötigten Querlandebahn (3,3<br />
ha).<br />
Nr. 26: Gr. Schönebeck nördlich der Mühlenstraße.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Grünland.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Trockenrasen durch Aushagerung der<br />
Flächen mittels zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach<br />
erreichen des Zielzustandes „Sandtrockenrasen“ (Biotoptyp 051212)<br />
kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Abfuhr der Streu umgestellt<br />
werden (1 ha).<br />
Nr. 27: Böhmerheide nord-westlich des Weißen Sees.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Grünland.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Trockenrasen durch Aushagerung der<br />
Flächen mittels zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach<br />
erreichen des Zielzustandes „Sandtrockenrasen“ (Biotoptyp 051212)<br />
kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Abfuhr der Streu umgestellt<br />
werden (11 ha).<br />
Nr. 28: Böhmerheide südlich des Weißen Sees.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Grünland.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Trockenrasen durch Aushagerung der<br />
Flächen mittels zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach<br />
erreichen des Zielzustandes „Sandtrockenrasen“ (Biotoptyp 051212)<br />
208
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Abfuhr der Streu umgestellt<br />
werden (5,5 ha).<br />
Nr. 29: Südlich von Altenhof an der BAB 11.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Grünland.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Trockenrasen durch Aushagerung der<br />
Flächen mittels zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach<br />
erreichen des Zielzustandes „Sandtrockenrasen“ (Biotoptyp 051212)<br />
kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Abfuhr der Streu umgestellt<br />
werden (8,3 ha).<br />
Nr. 30: Östlich Groß Schönebeck („Mühlenfeld“).<br />
Ziel: Komplexmaßnahme „Mühlenfeld“ mit dem Ziel der ökologischen<br />
und landschaftsästhetischen Aufwertung der Agrarlandschaft mittels<br />
naturnaher Strukturelemente.<br />
Maßnahmen: Umbau von Kiefernforsten zu strukturreichen Laubmischwäldern<br />
(Biotoptyp 08293; 2,32 ha) einschließlich Wildschutzzaun und 5<br />
Jahren Entwicklungspflege. Anlage naturnaher Laubwälder und Laub-<br />
Mischwälder heimischer Baumarten mittlerer Standorte (Biotoptyp<br />
08293: 1,85 ha) und Waldmäntel (Biotoptyp 07120) auf Acker-, Grünland-<br />
und Brachflächen (0,49 ha) einschließlich Wildschutzzaun, 5 Jahren<br />
Entwicklungs- und 20 Jahren Jungwuchspflege. Anlage von Baumhecken<br />
gebietsheimischer Gehölze durch Pflanzung von Sträuchern und<br />
Bäumen einschließlich Wildschutzzaun und 3 Jahren Entwicklungspflege.<br />
Entwicklung von Magerrasen durch Aushagerung der Flächen mittels<br />
zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach erreichen der<br />
standortabhängigen Zielzustände (Biotoptypen 051121, 051131 und<br />
051212) kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Abfuhr der Streu<br />
umgestellt werden (12,52 ha). Anlage von Ackerwildkrautstreifen durch<br />
Einstellung des Fruchtanbaus und jährliches Grubbern der Ackerrandstreifen<br />
(1,42 ha). Aufwertung und Entwicklung von Feuchtbiotopen<br />
durch Neuanlage sowie Entkrautung und Entschlammung vorhandener<br />
Gewässer (0,79 ha).<br />
Nr. 31: Süd-östlich des Großen Lotzinsees.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Grünland.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Magerrasen durch Aushagerung der Flächen<br />
mittels zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach erreichen<br />
der standortabhängigen Zielzustände (Biotoptypen 051121,<br />
051131 und 051212) kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Abfuhr<br />
der Streu umgestellt werden (9,8 ha). Das Aufkommen heimischer<br />
Gehölze mittels Naturverjüngung kann durch eine entsprechende Modifizierung<br />
des Mahdregimes, Bodenvorbereitung zur Verbesserung der<br />
Keimungsvorausssetzungen von Gehölzen oder durch Initialpflanzungen<br />
in Verbindung mit Wildschutzzäunen unterstützt werden.<br />
Nr. 32: "Großer Berg" östlich von Liebenthal.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Grünland.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Magerrasen durch Aushagerung der Flächen<br />
mittels zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach erreichen<br />
der standortabhängigen Zielzustände (Biotoptypen 051121,<br />
051131 und 051212) kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Abfuhr<br />
der Streu umgestellt werden (39,1 ha). Das Aufkommen heimischer<br />
Gehölze mittels Naturverjüngung kann durch eine entsprechende Modi-<br />
209
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
fizierung des Mahdregimes, Bodenvorbereitung zur Verbesserung der<br />
Keimungsvorausssetzungen von Gehölzen oder durch Initialpflanzungen<br />
in Verbindung mit Wildschutzzäunen unterstützt werden.<br />
Nr. 33: Nördlich von Groß Schönebeck.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Grünland.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Magerrasen durch Aushagerung der Flächen<br />
mittels zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach erreichen<br />
der standortabhängigen Zielzustände (Biotoptypen 051121,<br />
051131 und 051212) kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Abfuhr<br />
der Streu umgestellt werden (9,05 ha). Das Aufkommen heimischer<br />
Gehölze mittels Naturverjüngung kann durch eine entsprechende Modifizierung<br />
des Mahdregimes, Bodenvorbereitung zur Verbesserung der<br />
Keimungsvorausssetzungen von Gehölzen oder durch Initialpflanzungen<br />
in Verbindung mit Wildschutzzäunen unterstützt werden.<br />
Nr. 34: Nord-östlich von Groß Schönebeck.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Grünland.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Magerrasen durch Aushagerung der Flächen<br />
mittels zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach erreichen<br />
der standortabhängigen Zielzustände (Biotoptypen 051121,<br />
051131 und 051212) kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Abfuhr<br />
der Streu umgestellt werden (6,7 ha). Das Aufkommen heimischer<br />
Gehölze mittels Naturverjüngung kann durch eine entsprechende Modifizierung<br />
des Mahdregimes, Bodenvorbereitung zur Verbesserung der<br />
Keimungsvorausssetzungen von Gehölzen oder durch Initialpflanzungen<br />
in Verbindung mit Wildschutzzäunen unterstützt werden.<br />
Nr. 35: Südlich von Böhmerheide.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Grünland.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Magerrasen durch Aushagerung der Flächen<br />
mittels zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach erreichen<br />
der standortabhängigen Zielzustände (Biotoptypen 051121,<br />
051131 und 051212) kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Abfuhr<br />
der Streu umgestellt werden (16,7 ha). Das Aufkommen heimischer<br />
Gehölze mittels Naturverjüngung kann durch eine entsprechende Modifizierung<br />
des Mahdregimes, Bodenvorbereitung zur Verbesserung der<br />
Keimungsvorausssetzungen von Gehölzen oder durch Initialpflanzungen<br />
in Verbindung mit Wildschutzzäunen unterstützt werden.<br />
Nr. 36: Nördl. B167, Höhe Marienwerder.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Entwicklung natürlicher<br />
Waldhabitate.<br />
Maßnahmen: Anlage naturnaher Laubwälder und Laub-Mischwälder<br />
heimischer Baumarten mittlerer Standorte (Biotoptyp 08293: 6,2 ha) und<br />
Waldmäntel (Biotoptyp 07120) auf Brachflächen einschließlich Wildschutzzaun,<br />
5 Jahren Entwicklungs- und 20 Jahren Jungwuchspflege.<br />
Nr. 37: Östlich des Moospfuhls.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Grünland.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Magerrasen durch Aushagerung der Flächen<br />
mittels zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach erreichen<br />
der standortabhängigen Zielzustände (Biotoptypen 051121,<br />
051131 und 051212) kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Ab-<br />
210
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
fuhr der Streu umgestellt werden (7,8 ha). Das Aufkommen heimischer<br />
Gehölze mittels Naturverjüngung kann durch eine entsprechende Modifizierung<br />
des Mahdregimes, Bodenvorbereitung zur Verbesserung der<br />
Keimungsvorausssetzungen von Gehölzen oder durch Initialpflanzungen<br />
in Verbindung mit Wildschutzzäunen unterstützt werden.<br />
Nr. 38: Nördlich des Üdersees.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Grünland.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Magerrasen durch Aushagerung der Flächen<br />
mittels zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach erreichen<br />
der standortabhängigen Zielzustände (Biotoptypen 051121,<br />
051131 und 051212) kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Abfuhr<br />
der Streu umgestellt werden (7,2 ha). Das Aufkommen heimischer<br />
Gehölze mittels Naturverjüngung kann durch eine entsprechende Modifizierung<br />
des Mahdregimes, Bodenvorbereitung zur Verbesserung der<br />
Keimungsvorausssetzungen von Gehölzen oder durch Initialpflanzungen<br />
in Verbindung mit Wildschutzzäunen unterstützt werden.<br />
Nr. 39: NSG Rarangsee.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Feuchtgrünland, Gräben und<br />
Standgewässern.<br />
Maßnahmen: Wiedervernässung von Feuchtwiesen und Feuchtbiotopen<br />
durch Verfüllung des Hauptgrabens sowie Einbau von Sohlgleiten zur<br />
Erhöhung des Grundwasserspiegels (Anhebung des Grundwasserspiegels<br />
auf einer Fläche von 59,6 ha).<br />
Nr. 40:. Gr. Schönebeck, Jochimsthaler Straße.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 2.000 m, ca. 222 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 41:. Gr. Schönebeck, Triftstraße.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 450 m, ca. 75 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 42:. Böhmerheide Feldweg nördlich des Weißen Sees.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 650 m, ca. 65 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 43:. Klandorf, Bergstraße.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 800 m, ca. 133 Baumpflanzungen.<br />
211
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
Nr. 44:. Klandorf, Weg Richtung "Papenwinkel".<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 700 m, ca. 117 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 45:. Verbindungsstraße zur B167 nördl. Flugplatz.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 2.800 m, ca. 467 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 46:. Verbindungsstraße zur B167 im Sondergebiet „Handel“.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 110 m, ca. 18 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 47:. Finowfurt, südlich verlängerte Kanalstraße.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 300 m, ca. 50 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 48:. Finowfurt, nördlich verlängerte Kanalstraße.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 1.000 m, ca. 167 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 49:. Finowfurt, Feldweg nördl. Walzwerkstraße.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 350 m, ca. 58 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 50: Finowfurt, Straße zw. Konradshöhe und Buckow.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 4.300 m, ca. 717 Baumpflanzungen.<br />
212
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
Nr. 51: Lichterfelde, Blütenberger Weg.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 2.000 m, ca. 308 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 52: Lichterfelde, Lichterfelder Bruch.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 1.200 m, ca. 200 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 53: Feldweg im NSG Buckowsee-Rinne.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Wegen durch beidseitig wegebegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 1.600 m, ca. 200 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 54: Feldweg zw. Altenhof u. Werbellin.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Wegen durch beidseitig wegebegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 1.100 m, ca. 183 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 55: B167 neu nördl. d. Oder-Havel-Kanals.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Alleen an Straßen durch beidseitig straßenbegleitende<br />
Baumreihen mit einem Pflanzabstand von ca. 12 m bzw.<br />
Ergänzung lückiger Alleen einschließlich 5 Jahren Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 2.800 m, ca. 467 Baumpflanzungen.<br />
Nr. 56: Freifläche zwischen Üdersee u. Oder-Havel-Kanal.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Entwicklung natürlicher<br />
Waldhabitate.<br />
Maßnahmen: Anlage naturnaher Laubwälder und Laub-Mischwälder<br />
heimischer Baumarten mittlerer Standorte (Biotoptyp 08293: 4,1 ha) und<br />
Waldmäntel (Biotoptyp 07120) auf Brachflächen einschließlich Wildschutzzaun,<br />
5 Jahren Entwicklungs- und 20 Jahren Jungwuchspflege.<br />
Nr. 57: Finowfurt, nördl. der Walzwerkstraße.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Entwicklung natürlicher<br />
Waldhabitate.<br />
Maßnahmen: Anlage naturnaher Laubwälder und Laub-Mischwälder<br />
heimischer Baumarten mittlerer Standorte (Biotoptyp 08293: 3,4 ha) und<br />
213
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
Waldmäntel (Biotoptyp 07120) auf Brachflächen einschließlich Wildschutzzaun,<br />
5 Jahren Entwicklungs- und 20 Jahren Jungwuchspflege.<br />
Nr. 58: Lichterfelde, Alt-Deponie Oderberger Straße.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Entwicklung natürlicher<br />
Waldhabitate.<br />
Maßnahmen: Anlage naturnaher Laubwälder und Laub-Mischwälder<br />
heimischer Baumarten mittlerer Standorte (Biotoptyp 08293: 7,9 ha) und<br />
Waldmäntel (Biotoptyp 07120) auf Brachflächen einschließlich Wildschutzzaun,<br />
5 Jahren Entwicklungs- und 20 Jahren Jungwuchspflege.<br />
Nr. 59: Gr. Schönebeck, Feldweg nördlich Triftstraße.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Entwicklung naturnaher,<br />
gehölzdominierter Saumbiotope als Strukturhabitate in der Agrarlandschaft.<br />
Maßnahmen: Anlage von beidseitig wegebegleitenden, jeweils etwa<br />
5,00 m breiten Baumhecken gebietsheimischer Gehölze durch Pflanzung<br />
von Sträuchern und Bäumen einschließlich Wildschutzzaun und 3<br />
Jahren Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 500 m, ca. 5.000 m² Fläche.<br />
Nr. 60: Nördl. Klandorf entlang d. Klanfließes.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Entwicklung naturnaher,<br />
gehölzdominierter Saumbiotope als Strukturhabitate in der Agrarlandschaft.<br />
Maßnahmen: Anlage von einseitig grabenbegleitenden, jeweils etwa<br />
5,00 m breiten Baumhecken gebietsheimischer Gehölze durch Pflanzung<br />
von Sträuchern und Bäumen einschließlich Wildschutzzaun und 3<br />
Jahren Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 600 m, ca. 6.000 m² Fläche.<br />
Nr. 61: Feldweg nördl. des Moospfuhls.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Entwicklung naturnaher,<br />
gehölzdominierter Saumbiotope als Strukturhabitate in der Agrarlandschaft.<br />
Maßnahmen: Anlage von beidseitig wegebegleitenden, jeweils etwa<br />
5,00 m breiten Baumhecken gebietsheimischer Gehölze durch Pflanzung<br />
von Sträuchern und Bäumen einschließlich Wildschutzzaun und 3<br />
Jahren Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 1.300 m, ca. 13.000 m²<br />
Fläche.<br />
Nr. 62: B167 neu südl. des Oder-Havel-Kanals.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Entwicklung naturnaher,<br />
gehölzdominierter Saumbiotope als Strukturhabitate in der Agrarlandschaft.<br />
Maßnahmen: Anlage von beidseitig wegebegleitenden, jeweils etwa<br />
5,00 m breiten Baumhecken gebietsheimischer Gehölze durch Pflanzung<br />
von Sträuchern und Bäumen einschließlich Wildschutzzaun und 3<br />
Jahren Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 970 m, ca. 9.700 m² Fläche.<br />
214
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
Nr. 63: Feldweg nördlich Lichterfelde.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Entwicklung naturnaher,<br />
gehölzdominierter Saumbiotope als Strukturhabitate in der Agrarlandschaft.<br />
Maßnahmen: Anlage von beidseitig wegebegleitenden, jeweils etwa<br />
5,00 m breiten Baumhecken gebietsheimischer Gehölze durch Pflanzung<br />
von Sträuchern und Bäumen einschließlich Wildschutzzaun und 3<br />
Jahren Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 1.400 m, ca. 14.000 m²<br />
Fläche.<br />
Nr. 64:. Feldwege nördl. Buckow<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Entwicklung naturnaher,<br />
gehölzdominierter Saumbiotope als Strukturhabitate in der Agrarlandschaft.<br />
Maßnahmen: Anlage von beidseitig wegebegleitenden, jeweils etwa<br />
5,00 m breiten Baumhecken gebietsheimischer Gehölze durch Pflanzung<br />
von Sträuchern und Bäumen einschließlich Wildschutzzaun und 3<br />
Jahren Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 1.400 m, ca. 14.000 m²<br />
Fläche.<br />
Nr. 65:. Südl. Altenhof, Feldweg nahe der BAB 11.<br />
Ziel: Aufwertung des Landschaftsbildes und Entwicklung naturnaher,<br />
gehölzdominierter Saumbiotope als Strukturhabitate in der Agrarlandschaft.<br />
Maßnahmen: Anlage von beidseitig wegebegleitenden, jeweils etwa<br />
5,00 m breiten Baumhecken gebietsheimischer Gehölze durch Pflanzung<br />
von Sträuchern und Bäumen einschließlich Wildschutzzaun und 3<br />
Jahren Entwicklungspflege. Abschnittslänge: 1.400 m, ca. 12.500 m²<br />
Fläche.<br />
Nr. 66:. Südl. Groß Schönebeck „Staudammer Luch“.<br />
Ziel: Erhöhung des Wasserrückhaltes und Anhebung des Grundwasserstandes.<br />
Maßnahmen: Einbau von Sohlrampen.<br />
Nr. 67:. Westlich Klandorf, Entwässerungssystem Klanfließ.<br />
Ziel: Erhöhung des Wasserrückhaltes und Anhebung des Grundwasserstandes.<br />
Maßnahmen: Einbau von Sohlrampen.<br />
Nr. 68:. Kiefernforste südlich des Verkehrslandeplatzes Eberswalde-<br />
Finow.<br />
Ziel: Entwicklung naturnaher Waldbiotope.<br />
Maßnahmen: Umbau von Kiefernforsten zu strukturreichen Laubmischwäldern<br />
(Biotoptyp 08293; 426,9 ha) einschließlich Wildschutzzaun und<br />
5 Jahren Entwicklungspflege.<br />
Nr. 69: Finowfurt, Grünlandbrache östlich der Autobahnabfahrt Finowfurt.<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen von Grünland.<br />
Maßnahmen: Entwicklung von Magerrasen durch Aushagerung der Flächen<br />
mittels zweimaliger Mahd pro Jahr mit Abfuhr der Streu. Nach erreichen<br />
der standortabhängigen Zielzustände (Biotoptypen 051121,<br />
051131 und 051212) kann auf eine einmalige Mahd pro Jahr unter Ab-<br />
215
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Kompensationsmaßnahmen<br />
fuhr der Streu umgestellt werden (6,7 ha). Das Aufkommen heimischer<br />
Gehölze mittels Naturverjüngung kann durch eine entsprechende Modifizierung<br />
des Mahdregimes unterstützt werden.<br />
Nr. 70: Finowfurt, Altbauten westlich des Üdersees (Altstandort Ferien-<br />
und Erholungsheim)<br />
Ziel: Wiederherstellung von Boden-, Wasser- und Biotopfunktionen.<br />
Aufwertung des Landschaftsbildes.<br />
Maßnahmen: Rückbau nicht mehr benötigter Gebäude und sonstiger<br />
versiegelter Flächen einschließlich der umlaufenden Betonmauer (0,5<br />
ha).<br />
Nr. 71: Finowfurt, Grünlandbrachen trockener Standorte und Verbuschungsstadien<br />
der Späten Traubenkirsche westlich des Üdersees (Altstandort<br />
Ferien- und Erholungsheim)<br />
Ziel: Aufwertung der Habitatfunktionen für Amphibien und Aufwertung<br />
der Biotopverbindungsfunktion des Üdersees für Biber und Fischotter.<br />
Maßnahmen: Langfristige, sukzessive Entwicklung naturnaher Laubmischwälder<br />
durch jährliche mechanische Bekämpfung der Späten<br />
Traubenkirsche und Naturverjüngung standortgemäßer Baumarten (5,5<br />
ha)<br />
216
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eingriffs-Ausgleichsbilanz<br />
6 Eingriffs-Ausgleichs-Bilanz<br />
Für die von den gültigen Flächennutzungsplänen der beiden Alt-<br />
<strong>Gemeinde</strong> planerisch vorbereiteten Eingriffe in den Naturhaushalt werden<br />
entsprechend die Kompensationsflächen in den neu aufgestellten<br />
FNP übernommen, die als Kompensationserfordernis definiert wurden.<br />
Diese Eingriffe sind damit kompensierbar. Dies gilt gleichermaßen für<br />
die vom Wasser- und Schifffahrtsamt Eberswalde verursachten Eingriffe.<br />
Für die gegenüber den gültigen Flächennutzungsplänen zusätzlich planerisch<br />
vorbereiteten Eingriffe in den Naturhaushalt sind in Tabelle 4 die<br />
erforderlichen Kompensationsmaßnahmen und deren Kosten dargestellt<br />
worden.<br />
Mit Ausnahme der Entsiegelungsmaßnahmen sind alle Maßnahmen in<br />
den erforderlichen Umfängen innerhalb des <strong>Gemeinde</strong>gebietes umsetzbar.<br />
An nennenswerten Entsiegelungspotentialen bestehen in der <strong>Gemeinde</strong><br />
<strong>Schorfheide</strong> etwa 60.600 m². Die Entsiegelungspotentiale des<br />
Verkehrslandeplatzes Eberswalde-Finow sind hier mit Ausnahme der<br />
Querlandebahn nicht berücksichtigt, weil wie zum Vorhaben Nr. 3 dargelegt,<br />
davon ausgegangen wird, dass die Entwicklung des Flugplatzes<br />
diese Entsiegelungspotentiale neutralisieren.<br />
Die Entsiegelungsflächen befinden sich in der so genannten „Döllner<br />
Heide“ (etwa 10.000 m²), der oben bereits erwähnten Querlandebahn<br />
des Verkehrslandeplatzes Eberswalde-Finow (etwa 32.800 m²), dem<br />
ehemaligen Militärstandort an der Biesenthaler Straße (etwa 12.000 m²)<br />
sowsie dem ehemaligen Ferien- und Erholungsstandort am Westufer<br />
des Üdersees (5.000 m²). Da es sich z.T. um massive Hochbauten bzw.<br />
bei der Landebahn um außergewöhnlich mächtige Fundamente handelt,<br />
sind die Kosten der Entsiegelung pro m² mit durchschnittlich 18,50 €<br />
höher anzusetzen als die üblichen 10 € für reine Flächenentsiegelung.<br />
In der Summe verbleibt ein nicht ausgleichbarer Entsiegelungsbedarf<br />
von etwa 1,0 Mio. m². Die im Kapitel 5 vorgeschlagenen Kompensationsmaßnahmen<br />
weisen daher neben den in Tabelle 4 dargestellten<br />
Kompensationsbedarfen zusätzliche Maßnahmen und Maßnahmeumfänge<br />
auf, um den aus der unzureichenden Flächenentsiegelung resultierenden<br />
Fehlbedarf aufzufangen. Die berechneten Wiederherstellungskosten<br />
(s. Tabelle 5) überschreiten die errechneten erforderlichen<br />
Kompensationskosten (s. Tabelle 4) um knapp 2 Mio Euro. Damit ist die<br />
Kompensation der planerisch vorbereiteten Eingriffe in den Naturhaushalt<br />
im <strong>Gemeinde</strong>gebiet prinzipiell kompensierbar.<br />
Die Ermittlung der Flächen der Kompensationsmaßnahmen kann der<br />
Anlage 2 entnommen werden.<br />
217
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Eingriffs-Ausgleichsbilanz<br />
Tabelle 5: Kosten der tatsächlichen Kompensationsmaßnahmen<br />
Nr. Maßnahme Menge LP (1) EP/€ (2) GP/€ (3)<br />
M 1 Entsiegelung in m² 60.600<br />
M 2 Trockenrasenentwicklung (m²) 259.000<br />
M 3<br />
M 4<br />
Waldumbau: Kiefern-<br />
Monokulturen in Laubmischwälder<br />
(m²) 4.310.700<br />
Entwicklung v. Extensiv-<br />
Grünland auf trockenen Brachen<br />
und Sandäckern (m²) 1.155.700<br />
218<br />
Abriss und Flächenentsiegelung<br />
18,50 1.121.100<br />
Gesamt: 18,50 1.121.100<br />
25 Jahre Entwicklungspflege<br />
m. 2 Pflegeschnitten/a 1,50 388.500<br />
Gesamt: 1,50 388.500<br />
Auslichten d. Altbestandes,<br />
Unterpflanzung m. Laubbaumarten,<br />
Zäunung 1,00 4.310.700<br />
5 Jahre Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege 0,50 2.155.350<br />
Gesamt: 1,50 6.466.050<br />
25 Jahre Entwicklungspflege<br />
m. 2 Pflegeschnitten/a 1,50 1.733.550<br />
Gesamt: 1,50 1.733.550<br />
M 5 Entwicklung v. 14.200 25 Jahre Grubbern 0,30 4.260<br />
M<br />
6.1<br />
M<br />
6.2<br />
Ackerwildkrautstreifen (m²) Gesamt: 0,30 4.260<br />
Entwicklung v. Feuchtbiotopen<br />
(m²) 603.900 Neuanlage und Entkrautung 3,00 1.811.700<br />
Wiedervernässung v. Grünland<br />
(m²) 596.000 Grabenverfüllung 0,02 11.920<br />
Sohlgleiten 0,01 5.960<br />
Gesamt: 3,00 1.829.580<br />
M 7 Baumpflanzung an Straßen 3.447 Pflanzgrube 100/100/80 cm 20,00 68.932<br />
(Stück) Hochstamm, 16/18 cm StU 185,00 637.618<br />
Pflanzung 30,00 103.397<br />
Baumpfahl 35,00 120.630<br />
F/E-Pflege (3 Jahre) 68,00 234.368<br />
M 8<br />
Aufforstung v. Laubmischwäldern<br />
(m²) 325.600<br />
Gesamt: 338,00 1.164.944<br />
Herstellung naturnaher Wälder<br />
einschl. Waldrandgestaltung<br />
und Zäunung 2,00 651.200<br />
5 Jahre Fertigstellungs- und<br />
Entwicklungspflege 0,50 162.800<br />
20 Jahre Jungwuchspflege 0,40 130.240<br />
Gesamt:<br />
Baum- und Strauchpflanzun-<br />
2,90 944.240<br />
M 9 Anlage von Baumhecken (m²) 88.700 gen 2,50 221.750,00<br />
3 Jahre Entwicklungspflege 2,00 177.400,00<br />
lfd. m 18.140 Erstellung Wildschutzzaun 5,00 90.700,00<br />
Gesamt: 9,50 842.650<br />
M<br />
10 Anlage von Sohlrampen in 50 Steinschüttung 750,00 37.500<br />
Vorflutern (Stück) Gesamt: 750,00 37.500<br />
Gesamtsumme M 1 bis M 10 14.532.374
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
7 Maßnahmen zur Dokumentation der Entwicklung<br />
von Natur und Umwelt<br />
Der § 4 c des EAG-Bau verpflichtet die <strong>Gemeinde</strong>, die bei der Umsetzung<br />
von B-Plänen entstehenden Umweltauswirkungen formalisiert zu<br />
überwachen. Ziel ist, erhebliche Umweltauswirkungen und insbesondere<br />
unvorhergesehene Umweltauswirkungen erkennen und entsprechende<br />
Maßnahmen zur Abhilfe ergreifen zu können.<br />
Mit der Ausführung der Baum- und Strauchpflanzungen sollte eine Fachfirma<br />
des Garten- und Landschaftsbaus einschließlich der Fertigstellungs-<br />
und Entwicklungspflege beauftragt werden. Die Durchführung der<br />
Entwicklungspflege sollte von der <strong>Gemeinde</strong> kontrolliert werden. Sollte<br />
keine ordnungsgemäße Fertigstellungs- und Entwicklungspflege durchgeführt<br />
werden, ist damit zu rechnen, dass die Pflanzungen zum festgesetzten<br />
Zeitpunkt der Abnahme in keinem abnahmefähigen Zustand sein<br />
werden.<br />
Die Entwicklung der anzulegenden Ufergehölze an Fließgewässern sollte<br />
jährlich kontrolliert werden. Insbesondere ist darauf zu achten, dass<br />
sich Neophyten wie Späte Traubenkirsche, Kanadische Goldrute und<br />
Großblütiges Springkraut nicht in den Beständen etablieren können.<br />
8 Beschreibung der wichtigsten Merkmale der<br />
verwendeten technischen Verfahren<br />
Die Beschreibung der Biotoptypen erfolgt auf der Grundlage der Biotopkartierung<br />
Brandenburg (LANDESUMWELTAMT 2003).<br />
Die vorgenommenen Wertsetzungen für die einzelnen Schutzgüter und<br />
die Ableitung von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen basieren auf den<br />
„Vorläufigen Hinweisen zum Vollzug der Eingriffsregelung“ (MLUR<br />
2003). Die Gefährdungsursachen für Lebensräume und Arten der Anhänge<br />
I und II der FFH-Richtlinie sind aus dem „Katalog der natürlichen<br />
Lebensräume und Arten der Anhänge I und II der FFH-Richtlinie in<br />
Brandenburg“ (LANDESUMWELTAMT 2002) abgeleitet. Die Pflanzlisten<br />
beruhen auf den Empfehlungen von GROTH/SEITZ/RISTOW 2003.<br />
219
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
9 Zusammenfassung<br />
Die geplanten Änderungen des FNP der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> führen<br />
aufgrund der Vielzahl der Vorhabenplanungen und Entwicklungsziele zu<br />
erheblichen und umfänglichen Eingriffen in Natur und Landschaft. Insbesondere<br />
die potentielle Mehrversiegelung von mehr als 100 ha verdient<br />
Beachtung. Dabei ist festzuhalten, dass die Mehrversiegelung als<br />
Gradmesser für die Eingriffintensität in die Schutzgüter von Natur und<br />
Landschaft zu über 90% auf einige wenige Großprojekte zurückzuführen<br />
ist:<br />
• Straßenbauvorhaben in Verbindung mit Entwicklung einer verkehrlichen<br />
Anbindung von Gewerbegebieten im Umfeld des<br />
Flugplatzes Eberswalde-Finowfurt an die Ortsumgehung Finowfurt<br />
der Bundesstraße 167 sowie die Bundesautobahn 11 und die<br />
Ortsumgehung Finowfurt der B 167 (ca. 8 ha),<br />
• Gewerbeentwicklungen im Umfeld des Flugplatzes Eberswalde-<br />
Finowfurt (ca. 83 ha).<br />
Einige Projekte kollidieren mit den Zielen der örtlichen Landschaftsplanung<br />
oder/und den Zielen des Biosphärenreservats <strong>Schorfheide</strong>-Chorin.<br />
Dies sind im Einzelnen die Vorhaben:<br />
• Nr. 3 , Gewerbegebietsentwicklung südlich der Flugbetriebsfläche<br />
(Zieldifferenzen mit dem gemeindlichen Landschaftsplan),<br />
• Nr. 126, Entwicklung eines Güterbahnhofes nördlich der Flugbetriebsfläche<br />
des Flugplatzes Eberswalde-Finow (Zieldifferenzen<br />
mit dem gemeindlichen Landschaftsplan),<br />
• Nr. 137, Errichtung eines Sondergebietes „Wassertourismus“ am<br />
Finowkanal nördlich von Hubertusmühle (Zieldifferenzen mit dem<br />
gemeindlichen Landschaftsplan),<br />
• Nr. 138, Errichtung einer Seniorenresidenz an der Schlossgutsiedlung<br />
in Finowfurt (Zieldifferenzen mit dem gemeindlichen<br />
Landschaftsplan),<br />
• Nr. 92, Ausbau eines Sondergebietes „Freizeit und Erholung“ am<br />
Moospfuhl (Zieldifferenzen mit den Entwicklungsleitlinien des<br />
Biosphärenreservats),<br />
• Nr. 93, Erweiterung von Gewerbe- und Wohnnutzungen am südwestlichen<br />
Ortsrand von Lichterfelde (Zieldifferenzen mit dem<br />
gemeindlichen Landschaftsplan),<br />
Diese Vorhaben wurden im Laufe des Aufstellungsverfahrens zum Flächennutzungsplan<br />
zur Entschärfung der Konfliktsituation modifiziert und<br />
sind städtebaulich begründet. Soweit Konflikte durch das Planungsinstrument<br />
des Flächennutzungsplans nicht gelöst werden können, muss<br />
dies auf der nächsten Planungsebene über Vermeidungs- und Kompensationsmaßnehmen<br />
erfolgen.<br />
Bei der überwiegenden Mehrheit der Projekte handelt es sich um die<br />
Um- oder Wiedernutzung von Altstandorten mit geringem Eingriffspotential<br />
aufgrund der in der Regel hohen anthropogenen Überformung der<br />
Projektflächen. Dabei handelt es sich im Außenbereich in einigen Fällen<br />
um Splittersiedlungen, deren Rückbau aus Sicht der Landschaftsplanung<br />
oder sonstiger Naturschutzfachplanungen angestrebt wird. Die<br />
Mehrheit der Vorhaben im Außenbereich hat jedoch einen mehr oder<br />
weniger eindeutigen Bezug zu den Ortslagen.<br />
220
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> <strong>Umweltbericht</strong> zum Flächennutzungsplan – September 2008<br />
Insgesamt ist aus landschaftsplanerischer Sicht festzuhalten, dass die<br />
Konversion von Altstandorten gegenüber der Entwicklung von Neustandorten<br />
zu bevorzugen ist. Wenn für die <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> eine<br />
städtebauliche Entwicklung befürwortet wird, muss die Landschaftsplanung<br />
die Konversion von Altstandorten als prinzipiell unschädlichere<br />
Variante ansehen.<br />
Damit bleibt festzuhalten, dass die Inhalte der Änderung des FNP der<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> nicht dazu geeignet sind, die Ziele der örtlichen<br />
Landschaftsplanung grundsätzlich in Frage zu stellen.<br />
221
Anlage 1: Ermittlung der Kompensationsdefizite<br />
Nr. Eingriffsbeschreibung<br />
Versiegelung<br />
in m² Vermeidung Kompensation Maßnahmendefizit m²<br />
115 (3) Bodenversiegelung - ja - - -<br />
115 (1) Bodenversiegelung 1.100 - - Bodenentsiegelung (M1) 1.100<br />
115 (2) Bodenversiegelung 500 - - Bodenentsiegelung (M1) 500<br />
115 (4) Bodenversiegelung 1.400 - nicht erforderlich<br />
10 Bodenversiegelung - ja - - -<br />
8a<br />
49<br />
Bodenversiegelung im 50-m-Bereich<br />
des Finowkanals - ja - - -<br />
Bodenversiegelung im 50-m-Bereich<br />
des Finowkanals - ja - - -<br />
72-75 Bodenversiegelung - ja - - -<br />
79 Bodenversiegelung 22.000 - - Bodenentsiegelung (M1) 22.000<br />
Trockenrasenentwicklung (M2) 500<br />
76 Bodenversiegelung<br />
Intensivierung anthropogener Störun-<br />
- 3.400 - - Bodenentsiegelung (M1) - 3.400<br />
97 gen - ja - - -<br />
145 Bodenversiegelung 1.300 - - Bodenentsiegelung (M1) 1.300<br />
1 Bodenversiegelung 26.400 - - Bodenentsiegelung (M1) 26.400<br />
3 Bodenversiegelung 760.400 - - Bodenentsiegelung (M1)<br />
Entwicklung Fledermausquar-<br />
760.400<br />
Beeinträchtigung § 34 - -<br />
tiere<br />
Beeinträchtigung §32 ja -<br />
6 Bodenversiegelung 55.600 - - Bodenentsiegelung (M1) 55.600<br />
Baumverluste teilweise ja -<br />
Entwicklung Fledermausquar-<br />
Beeinträchtigung § 34 - -<br />
tiere<br />
20 Bodenversiegelung 2.200 Bodenentsiegelung (M1) 2.200<br />
44 Bodenversiegelung - 35.200 - - Bodenentsiegelung (M1) - 35.200<br />
Nutzungsintensivierung trockener<br />
Grünlandbrachen 7.000 teilweise ja Trockenrasenentwicklung (M2) 3.500<br />
50 Bodenversiegelung 16.800 - - Bodenentsiegelung (M1) 16.800<br />
52 Bodenversiegelung 13.800 - - Bodenentsiegelung (M1) 13.800<br />
54 Bodenversiegelung 7.600 Bodenentsiegelung (M1) 7.600<br />
65 Bodenversiegelung 1.300 - - Bodenentsiegelung (M1) 1.300<br />
222<br />
Anlage 1
Nr. Eingriffsbeschreibung<br />
Versiegelung<br />
in m² Vermeidung Kompensation Maßnahmendefizit m²<br />
68 Bodenversiegelung 6.800 - - Bodenentsiegelung (M1) 6.800<br />
92 Bodenversiegelung - ja<br />
Beeinträchtigung §32 u. 48 ja<br />
105 Bodenversiegelung 17.000 - - Bodenentsiegelung (M1) 17.000<br />
112 Bodenversiegelung 6.000 - Bodenentsiegelung (M1) 6.000<br />
Beeinträchtigung §32 ja<br />
117 Bodenversiegelung 3.480 - - Bodenentsiegelung (M1) 3.480<br />
Beeinträchtigung §32 ja<br />
126 Bodenversiegelung 73.600 - - Bodenentsiegelung (M1) 73.600<br />
Beeinträchtigung v. Waldrändern, Forsten<br />
Beeinträchtigungv. trockenen Grünlandbrachen<br />
- -<br />
223<br />
Entwicklung v. Mischwäldern i.<br />
Kiefern-Monokulturen (M3) 138.000<br />
Biotopentwicklung auf trockenen<br />
Brachen, Sandäckern (M4) 138.000<br />
133 Bodenversiegelung 11.000 - 11.000<br />
134 Bodenversiegelung 590 - ja<br />
Biotopentwicklung auf trocke-<br />
Entwertung v. Lebensraumeigenschafnen<br />
Brachen und Sandäckern<br />
ten v. Grünlandbrachen 23.000<br />
(M4) 23.000<br />
137 Bodenversiegelung - 400 - ja Bodenentsiegelung (M1) - 400<br />
138 Bodenversiegelung 3.600 - - Bodenentsiegelung (M1) 3.600<br />
Verlust u. Beeinträchtigung v. Altbaumbeständen<br />
10.400<br />
Entwicklung v. Laubmischwäldern<br />
(M8) 23.200<br />
139 Bodenversiegelung 660 - - Bodenentsiegelung (M1) 660<br />
140 Bodenversiegelung 660 - - Bodenentsiegelung (M1) 660<br />
82 Bodenversiegelung 2.300 - - Bodenentsiegelung (M1) 2.300<br />
Entwertung v. trockenen Grünlandbrachen<br />
3.800 Trockenrasenentwicklung (M2) 3.800<br />
91 Bodenversiegelung 21.950 teilweise - Bodenentsiegelung (M1) 13.850<br />
Landschaftsbildbeeinträchtigung 10.000 - Definition auf B-Plan-Ebene<br />
Beeinträchtigung §32, Artenschutzkonflikte<br />
ja<br />
141 Bodenversiegelung 1.450 - - Bodenentsiegelung (M1) 1.450<br />
147 Bodenversiegelung 18.000 - - Bodenentsiegelung (M1) 18.000<br />
Anlage 1
Nr. Eingriffsbeschreibung<br />
Versiegelung<br />
in m² Vermeidung Kompensation Maßnahmendefizit m²<br />
147 Landschaftsbildbeeinträchtigung - ja<br />
4 Artenschutzkonflikte - -<br />
108 Bodenversiegelung 5.200 - - Bodenentsiegelung (M1) 5.200<br />
Beeinträchtigung §32 u. Gehölze 2.000 Gehölze - Trockenrasenentwicklung (M2) 9.000<br />
132 Bodenversiegelung 1.260 - - Bodenentsiegelung (M1) 1.260<br />
143 Bodenversiegelung 2.100 - - Bodenentsiegelung (M1) 2.100<br />
63 Bodenversiegelung 1.500 - - Bodenentsiegelung (M1) 1.500<br />
88 Bodenversiegelung 540 - Bodenentsiegelung (M1) 500<br />
93 Bodenversiegelung 5.200 - - Bodenentsiegelung (M1) 5.200<br />
Landschaftsbildbeeinträchtigung teilweise<br />
33 Bodenversiegelung 5.300 - Bodenentsiegelung (M1) 5.300<br />
69 Bodenversiegelung 2.000 - Bodenentsiegelung (M1) 2.000<br />
29,<br />
46,47,48 Bodenversiegelung 42.700 - Bodenentsiegelung (M1) 42.700<br />
Beeinträchtigung §32, Gehölz- und<br />
Forstverluste<br />
224<br />
Biotopentwicklung auf trockenen<br />
Brachen, Sandäckern und<br />
Kiefernmonokulturen (M4) 34.500<br />
Entwicklung v. Mischwäldern i.<br />
Kiefern-Monokulturen (M3) 29.000<br />
Entwicklung v. Feuchtbiotopen<br />
m. standortgem. Ufergehölzen<br />
(M6) 35.600<br />
45 Bodenversiegelung, 40.000 - Bodenentsiegelung (M1) 40.000<br />
Beeinträchtigung §32, Gehölz- und<br />
Forstverluste Baumpflanzungen (M7; Stück) 800<br />
Entwicklung v. Laubmischwäldern<br />
(M8) 70.000<br />
Anlage v. Baumhecken (M9) 13.000<br />
Anlage 1
Anlage 2 Maßnahmenbeschreibungen<br />
Anlage 2: Untersetzung der Flächenermittlungen<br />
Die für die Berechnung der Kosten der Kompensationsmaßnahme<br />
in Tabelle 5 herangezogenen Flächen und Massen ergeben<br />
sich im Detail wie folgt:<br />
M 1 Entsiegelung Ist-Fläche<br />
22 Kasernenstandort a.d. Biesenthaler Str. 12.200<br />
23 Altenhof, Ferienhäuser am Werbellinsee 300<br />
24 Döllner Siedlung 10.300<br />
25 Querbahn Flugplatz Ebersw./Finow 32.800<br />
70 Freizeit- und Erholungsheim am Üdersee 5.000<br />
Summe: 60.600<br />
M 2 Trockenrasenentwicklung Ist-Fläche<br />
26 Gr. Schönebeck nördl. Mühlenstraße 10.500<br />
27 Böhmerheide nord-westl. Weißer See 110.000<br />
28 Böhmerheide südl. Weißer See 55.000<br />
29 Südl. Böhmerheide an der BAB 11 83.500<br />
Summe: 259.000<br />
M 3 Entwicklung v. Mischwäldern i. Kiefern-Monokulturen<br />
Ist-Fläche<br />
22 Südl. Kasernenstandort a.d. Biesenthaler Str. 18.500<br />
30 Gr. Schönebeck, "Mühlenfeld" 23.200<br />
68 Kiefernforste südlich d. Verkehrslandeplatzes 4.269.000<br />
Summe: 4.310.700<br />
M 4 Biotopentwicklung auf trockenen Brachen und Sandäckern<br />
Ist-Fläche<br />
31 Süd-östl. Großer Lotzinsee 98.000<br />
32 "Großer Berg" östl. Liebenthal 391.000<br />
33 Nördl. Döllner Siedlung 90.500<br />
34 6.5 km nord-östl. Gr. Schönebeck 67.000<br />
35 Südlich von Böhmerheide 167.000<br />
37 Nördl. des Üdersees 78.000<br />
38 Nördl. des Üdersees 72.000<br />
30 Gr. Schönebeck, "Mühlenfeld" 125.200<br />
69 Finowfurt, östlich Abfahrt Finowfurt A11 67.000<br />
Summe: 1.155.700<br />
M 6 Entwicklung v. Feuchtbiotopen Ist-Fläche<br />
30 Gr. Schönebeck, "Mühlenfeld" 7.900<br />
39 NSG "Rarangsee" 596.000<br />
Summe: 603.900<br />
225
Anlage 2 Maßnahmenbeschreibungen<br />
7. Baumpflanzungen an Straßen<br />
lfd. Meter Bäume<br />
40 Gr. Schönebeck, Jochimsthaler Str. 2.000 222<br />
41 Gr. Schönebeck, Triftstr.. 450 75<br />
42 Böhmerheide nord-westl. Weißer See 650 65<br />
43 Klandorf, Bergstraße 800 133<br />
44 Klandorf, Weg Richtung "Papenwinkel" 700 117<br />
45 Verbindungsstraße zur B167 nördl. Flugplatz 2.800 467<br />
46 Verbindungsstraße zur B167 im SO Handel 110 18<br />
47 Finowfurt, Kanalstraße 300 50<br />
48 Finowfurt, verlängerte Kanalstraße zur B167 1.000 167<br />
49 Finowfurt, Feldweg nördl. Walzwerkstraße 350 58<br />
50 Straße zw. Konradshöhe und Buckow 4.300 717<br />
51 Lichterfelde, Blütenberger Weg 2.000 308<br />
52 Lichterfelde, Lichterfelder Bruch 1.200 200<br />
53 Feldweg im NSG Buckowsee-Rinne 1.600 200<br />
54 Feldweg zw. Altenhof u. Werbellin 1.100 183<br />
55 B167 neu nördl. d. Oder-Havel-Kanals 2.800 467<br />
Summe: 22.160 3.447<br />
M 8 Entwicklung von Laubmischwäldern Fläche<br />
56 Zwischen Üdersee u. Oder-Havel-Kanal 32.700<br />
57 Finowfurt, nördl. der Walzwerkstraße 34.000<br />
22 Südl. Kasernenstandort a.d. Biesenthaler Str. 79.000<br />
58 Lichterfelde, Deponie Oderberger Straße 58.000<br />
30 Gr. Schönebeck, "Mühlenfeld" 4.900<br />
36 Nördl. B167, Höhe Marienwerder 62.000<br />
71 Westufer des Üdersees (Altstandort Ferienheim) 55.000<br />
Summe: 325.600<br />
9. Anlage von Baumhecken Fläche lfd. m<br />
59 Gr. Schönebeck, Feldweg nördlich Triftstraße 5.000 500<br />
60 Nördl. Klandorf entlang d. Klanfließes 6.000 600<br />
61 Feldweg nördl. des Moospfuhls 13.000 1.300<br />
62 B167 neu südl. des Oder-Havel-Kanals 8.000 800<br />
63 Feldweg nördlich Lichterfelde 14.000 1.400<br />
64 Feldwege nördl. "Buckow" 14.000 1.400<br />
65 Südl. Altenhof, Feldweg nahe der BAB 11 12.500 1.400<br />
30 Gr. Schönebeck, "Mühlenfeld" 14.500 1.500<br />
Summe: 87.000 8.900<br />
10. Anlage von Sohlrampen Stück<br />
66 Südl. Groß Schönebeck „Staudammer Luch“<br />
Westlich Klandorf, Entwässerungssystem<br />
25<br />
67 Klanfließ 25<br />
Summe: 50<br />
226
Anlage 3 Quellenverzeichnis<br />
Anlage 3: Quellenverzeichnis<br />
DER BUNDESTAG 2004: Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuches<br />
an EU-Richtlinien vom 24.06.2004. Bundesgesetzblatt<br />
Jahrgang 2004 Teil I Nr. 31. Bonn<br />
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1992:<br />
Richtlinie 92/43 EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung<br />
der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere<br />
und Pflanzen. Amtsblatt Europäische Gemeinschaft, Reihe L<br />
206: 7-50<br />
EUROPÄISCHES PARLAMANT 2001: Richtlinie 2001/42/EG<br />
des Europäischen Parlamentes und des Rates über die Prüfung<br />
der Umweltauswirkungen bestimmter Pläne und Programme<br />
vom 27.06.2001.<br />
GROTH, B., SEITZ, B., RISTOW, M. 2003: Naturschutzfachlich<br />
geeignete Baum- und Straucharten bei Kompensationsmaßnahmen<br />
in der freien Landschaft in Brandenburg. In: Naturschutz<br />
und Landschaftspflege in Brandenburg 12 (1) 2003, S.<br />
28-30, Potsdam<br />
HORTEC GbR 1996: Landschaftsplan Amt Groß Schönebeck,<br />
Berlin.<br />
Institut für Ländliche Räume 2008: Aspekte des Gewässerschutzes<br />
und der Gewässernutzung beim Anbau von Energiepflanzen.<br />
Braunschweig.<br />
LANDKREIS BARNIM (Hrsg.), 2005: Flächenpool – das Barnimer<br />
Modell. Eberswalde.<br />
LUA Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2002: Lebensräume<br />
und Arten der FFH-Richtlinie in Brandenburg. In: Naturschutz<br />
und Landschaftspflege in Brandenburg, Heft 1,2 2002.<br />
Potsdam<br />
LUA Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2002a: Standard-<br />
Datenbogen zum geplanten FFH-Gebiet „Finowtal-<br />
Pregnitzfließ“ (unveröffentlichtes Gutachten)<br />
LUA Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2002b: Standard-<br />
Datenbogen zum FFH-Gebiet „Werbellinkanal“ (unveröffentlichtes<br />
Gutachten)<br />
LUA Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2003: Liste der<br />
Biotoptypen. Neufassung. Vorläufige Ausgabe, Stand<br />
15.04.2003. Landesumweltamt Brandenburg. Potsdam<br />
Minister für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz<br />
2007: Verordnung zur Festsetzung des Wasserschutzgebietes<br />
Eberswalde (Finow), Entwurf vom 06.06. 2007<br />
227
Anlage 3 Quellenverzeichnis<br />
MLUR Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und<br />
Raumordnung (Hrsg.) 2000: Landschaftsprogramm Brandenburg.<br />
Potsdam<br />
MLUR Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und<br />
Raumordnung 2003: Vorläufige Hinweise zum Vollzug der Eingriffsregelung.<br />
Potsdam<br />
MUNR Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung<br />
1999: Verwaltungsvorschrift des Ministerium für Umwelt, Naturschutz<br />
und Raumordnung Brandenburg zum Vollzug der §§<br />
32, 36 des Brandenburgischen Gesetzes über Naturschutz und<br />
Landschaftspflege. Potsdam<br />
MUNR Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Raumordnung<br />
1990: Verordnung über die Festsetzung von Naturschutzgebieten<br />
in einem Landschaftsschutzgebiet von zentraler Bedeutung<br />
mit der Gesamtbezeichnung Biosphärenreservat <strong>Schorfheide</strong> -<br />
Chorin vom 12. September 1990, Potsdam.<br />
REICHLING, Andreas 2006: Faunistische Besonderheiten am<br />
südlichen Randbereich des Flugplatzes und am Walpurgisbruch.<br />
Naturschutz und Landschaftspflege in Brandenburg 15<br />
(3) 2006; 93-97.<br />
RUCKENBAUER/OBERNBERGER/HOLZNER 1997: Erforschung<br />
der Verwendungsmöglichkeiten von Aschen aus Hackgut<br />
und Rindenfeuerungen. In: Berichte aus Energie- und Umweltforschung<br />
12a/1997. Wien<br />
TRAUTMANN u. GOETZ: Raumordnungsverfahren Regionalflughafen<br />
Eberswalde-Finow, Umweltverträglichkeitsstudie, Berlin<br />
2007.<br />
228
Anlage 4 Bewertungskriterien der Schutzgüter<br />
Anlage 4: Bewertungskriterien der Schutzgüter<br />
A) Schutzgut Arten- und Lebensgemeinschaften<br />
Für die Beurteilung der Bedeutung von Biotopen für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes sind die Kriterien Schutzwürdigkeit<br />
und Schutzbedürftigkeit heranzuziehen. Die Einstufung<br />
der Biotoptypen in 6 Wertkategorien erfolgt unter paritätischer<br />
Berücksichtigung dieser beiden Grundkriterien. Dabei ergibt sich<br />
die Schutzwürdigkeit paritätisch aus den Parametern:<br />
� Entwicklungsgrad,<br />
� Natürlichkeit,<br />
� Strukturreichtum,<br />
� Artenvielfalt,<br />
� Intensität anthropogener Störeinflüsse.<br />
Die Schutzbedürftigkeit wird paritätisch durch die Parameter<br />
� Seltenheit des Biotops,<br />
� Seltenheit dort vorkommender Arten,<br />
� Empfindlichkeit,<br />
� ungünstiger Entwicklungstendenz bestimmt.<br />
Die Wertstufe 1 (sehr hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz)<br />
ergibt sich demnach wenn das Biotop:<br />
� eine hohe Naturnähe aufweist<br />
und<br />
� eine dem Idealzustand des Biotoptyps nahe kommende Struktur<br />
und Artenvielfalt aufweist<br />
und<br />
� von anthropogenen Störungen weitgehend frei ist<br />
und<br />
� nach Eingriffen oder bei Neuschaffung mehr als 25 Jahre bis<br />
zur Wiederherstellung des Ausgangszustandes benötigt würden<br />
oder<br />
� in Brandenburg sehr selten oder nur sehr kleinflächig vorkommt<br />
und<br />
� mehrere geschützte/Gefährdete Tier- und Pflanzenarten beherbergt<br />
bzw. als Verbindungsbiotop für solche Arten unverzichtbar<br />
ist<br />
Die Wertstufe 5 (sehr geringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz)<br />
ergibt sich demnach wenn das Biotop:<br />
� durch anthropogene Nutzungen überprägt wird<br />
und<br />
� eine geringe Struktur- und Artenvielfalt aufweist<br />
und<br />
� von anthropogenen Störungen beeinträchtigt wird<br />
und<br />
� nach Eingriffen oder bei Neuschaffung weniger als 3 Jahre bis<br />
zur Wiederherstellung des Ausgangszustandes benötigt würden<br />
oder<br />
� in Brandenburg sehr häufig oder nur großflächig vorkommt<br />
und<br />
229
Anlage 4 Bewertungskriterien der Schutzgüter<br />
� keine geschützte/Gefährdete Tier- und Pflanzenarten beherbergt<br />
bzw. als Verbindungsbiotop für solche Arten verzichtbar<br />
ist<br />
Die Wertstufen 2-4 vermitteln abgestuft zwischen den beschriebenen<br />
Extremen der Wertstufen 1 und 5.<br />
Die Wertstufe 0 (ohne Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz)<br />
bezieht sich auf überbaute und versiegelte Flächen.<br />
B) Schutzgut Boden<br />
Für die Beurteilung der Bedeutung von Böden für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes werden folgende Kriterien zu gleichen<br />
Teilen herangezogen:<br />
� Puffer- und Filterfunktion (Grundwasserschutz),<br />
� Infiltrationsfunktion (Grundwasserneubildung),<br />
� Erosionsschutzfunktion/Bodenschutzfunktion,<br />
� Lebensraumfunktion,<br />
� Biotische Ertragsfunktion,<br />
� Funktion als Lagerstättenressource,<br />
� Dokumentationsfunktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte.<br />
Böden, die der Wertstufe 1 (sehr hohe Bedeutung für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes) zugewiesen werden, erfüllen<br />
mindestens 3 der obigen Kriterien in überdurchschnittlicher Weise.<br />
Böden, die der Wertstufe 5 (sehr geringe Bedeutung für die<br />
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes) zugewiesen werden, erfüllen<br />
die oben genannten Kriterien nicht bzw. in weit unterdurchschnittlicher<br />
Weise. Die Wertstufen 2-4 vermitteln abgestuft zwischen<br />
den beschriebenen Extremen der Wertstufen 1 und 5. Die<br />
Wertstufe 0 (ohne Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes)<br />
bezieht sich auf überbaute und versiegelte Flächen.<br />
Besondere Bodenfunktionen sind anzunehmen, wenn folgende<br />
Situationen vorliegen:<br />
� Vorkommen von Mooren, Flugsandfelder/Binnendünen, Auenablagerungen,<br />
Endmoränen u.ä.,<br />
� Vorkommen von Naturdenkmalen gemäß § 23 BbgNatSchG,<br />
soweit es sich um pedologisch oder geowissenschaftlich bedeutsame<br />
Einzelschöpfungen handelt,<br />
� Bodenschutzwälder im Sinne der Waldfunktionskartierung.<br />
In diesem Falle wird generell die Wertstufe 1 angesetzt.<br />
C) Schutzgut Wasser<br />
Für die Beurteilung der Bedeutung von Böden für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes werden folgende Kriterien zu gleichen<br />
Teilen herangezogen:<br />
� Grundwasserneubildungsfunktion,<br />
� Grundwasserschutzfunktion,<br />
� Oberflächenwasserschutzfunktion,<br />
� Abflussregulations- und Retentionsfunktion,<br />
Flächen, die der Wertstufe 1 (sehr hohe Bedeutung für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes) zugewiesen werden, erfüllen<br />
mindestens 2 der obigen Kriterien in überdurchschnittlicher Wei-<br />
230
Anlage 4 Bewertungskriterien der Schutzgüter<br />
se. Flächen, die der Wertstufe 5 (sehr geringe Bedeutung für die<br />
Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes) zugewiesen werden, erfüllen<br />
die oben genannten Kriterien nicht bzw. in weit unterdurchschnittlicher<br />
Weise. Die Wertstufen 2-4 vermitteln abgestuft zwischen<br />
den beschriebenen Extremen der Wertstufen 1 und 5. Die<br />
Wertstufe 0 (ohne Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes)<br />
bezieht sich auf überbaute und versiegelte Flächen.<br />
Besondere Funktionen für das Schutzgut Wasser sind anzunehmen,<br />
wenn folgende Situationen vorliegen:<br />
� Naturnahe Oberflächengewässer und Gewässersysteme,<br />
� sauerstoffreiche und nährstoffarme Oberflächengewässer,<br />
� Quellen und Mineralbrunnen,<br />
� natürliche Überschwemmungsgebiete<br />
� Fließgewässerschutzsysteme,<br />
� Wasserschutzwälder,<br />
� Wasserschutzgebiete Zone I-III<br />
In diesem Falle wird generell die Wertstufe 1 angesetzt.<br />
D) Schutzgut Klima/Luft<br />
Für die Beurteilung der Bedeutung von Flächen für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes werden folgende Kriterien zu gleichen<br />
Teilen herangezogen:<br />
� Bedeutung als bioklimatische Ausgleichsfunktion für anthropogen<br />
negativ beeinflussten klimatische Zuständen,<br />
� Immissionsschutz- und Luftregenerationsfunktion.<br />
Flächen, die der Wertstufe 1 (sehr hohe Bedeutung für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes) zugewiesen werden, erfüllen<br />
alle obigen Kriterien in überdurchschnittlicher Weise. Flächen,<br />
die der Wertstufe 5 (sehr geringe Bedeutung für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes) zugewiesen werden, erfüllen die<br />
oben genannten Kriterien nicht bzw. in weit unterdurchschnittlicher<br />
Weise. Die Wertstufen 2-4 vermitteln abgestuft zwischen<br />
den beschriebenen Extremen der Wertstufen 1 und 5. Die Wertstufe<br />
0 (ohne Bedeutung für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes)<br />
bezieht sich auf überbaute und versiegelte Flächen.<br />
Besondere Funktionen für das Schutzgut Klima/Luft sind anzunehmen,<br />
wenn folgende Situationen vorliegen:<br />
� Luftaustauschbahnen bzw. Frischluftleitbahnen, insbesondere<br />
zwischen Gebieten unterschiedlicher Belastungen,<br />
� klimaaktive Gebiete mit frischluftproduzierender oder luftverbessernder<br />
Wirkung,<br />
� Gebiete mit besonderen standortspezifischen Strahlungsverhältnissen<br />
(Hang- und Kuppenlage),<br />
� Klima- und Immissionsschutzwälder.<br />
In diesem Falle wird generell die Wertstufe 1 angesetzt.<br />
E) Schutzgut Landschaftsbild/Erholung<br />
Für die Beurteilung der Bedeutung von Räumen für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes werden folgende Kriterien zu<br />
gleichen Teilen herangezogen:<br />
� Optische Naturerfahrungsmöglichkeiten (Vielfalt, Eigenart und<br />
Schönheit der Landschaft),<br />
� Möglichkeiten der praktischen Naturaneignung,<br />
� Vorkommen anthropogener Störreize,<br />
� Dokumentations- und Informationsfunktion.<br />
231
Anlage 4 Bewertungskriterien der Schutzgüter<br />
Flächen, die der Wertstufe 1 (sehr hohe Bedeutung für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes) zugewiesen werden, erfüllen<br />
mindestens 1 der obigen Kriterien in herausragender Weise. Flächen,<br />
die der Wertstufe 5 (sehr geringe Bedeutung für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes) zugewiesen werden, erfüllen<br />
die oben genannten Kriterien nicht bzw. in weit unterdurchschnittlicher<br />
Weise. Die Wertstufen 2-4 vermitteln abgestuft zwischen<br />
den beschriebenen Extremen der Wertstufen 1 und 5. Die Wertstufe<br />
0 wird für das Schutzgut Landschaftsbild/Erholung nicht<br />
vergeben.<br />
Besondere Funktionen für das Schutzgut Landschaftsbild/Erholung<br />
sind anzunehmen, wenn folgende Situationen vorliegen:<br />
� markante geländemorphologische Ausprägungen wie z. B.<br />
Hangkanten; Hügel,<br />
� naturhistorisch bzw. geologisch bedeutsame Elemente wie z.<br />
B. Binnendünen, Findlinge, Sölle<br />
� kulturhistorisch bedeutsame Landnutzungs- und Siedlungsformen<br />
wie Niederwälder, Ackerterrassen, Rundlinge , Angerdörfer,<br />
� historische Park- und Gartenanlagen als Werke der Gartenbaukunst,<br />
� Sichtachsenbeziehungen und Aussichtspunkte,<br />
� Historische Straßen-, Platz- oder Ortsbilder,<br />
� strukturbildende Elemente wie z. B. Alleen, markante Baumgruppen,<br />
Hecken, Moordämme, Hohlwege,<br />
� Gebiete mit kleinflächigem Wechsel der Nutzung,<br />
� Erholungswald<br />
232
Anlage 5 Bewertungskriterien der Schutzgüter<br />
Anlage 5 Pflanzlisten<br />
Pflanzliste 1: Baumpflanzungen auf priv. Grundstücken<br />
Botanischer Name Deutscher Name<br />
Carpinus betulus Hainbuche<br />
Malus domestica Kultur-Apfel<br />
Prunus avium-kultivare Süßkirsche<br />
Prunus cerasifera Kirschpflaume<br />
Prunus cerasus Weichsel-Kirsche<br />
Prunus domestica Gewöhnliche Kultur-Pflaume<br />
Fagus sylvatica Rot-Buche<br />
Fraxinus excelsior Gemeine Esche<br />
Quercus petraea Trauben-Eiche<br />
Quercus robur Stiel-Eiche<br />
Tilia cordata Winterlinde<br />
Pinus silvestris Wald-Kiefer<br />
Pflanzliste 2: Bäume an Wegen<br />
Botanischer Name Deutscher Name<br />
Quercus petraea Trauben-Eiche<br />
Quercus robur Stiel-Eiche<br />
Tilia cordata Winterlinde<br />
Sorbus intermedia Schwedische Mehlbeere<br />
Sorbus aria Mehlbeere<br />
Pflanzliste 3: Bäume in der freien Landschaft<br />
Botanischer Name Deutscher Name<br />
Quercus petraea Trauben-Eiche<br />
Quercus robur Stiel-Eiche<br />
Tilia cordata Winterlinde<br />
Carpinus betulus Hainbuche<br />
Fagus sylvatica Rot-Buche<br />
Fraxinus excelsior Gemeine Esche<br />
Quercus robur Stiel-Eiche<br />
Pinus silvestris Wald-Kiefer<br />
Alnus Glutinosa (1) Schwarz-Erle<br />
(1) Nur auf grundwassernahen Standorten in Gewässernähe oder Niederungslandschaften<br />
233
Anlage 5 Bewertungskriterien der Schutzgüter<br />
Pflanzliste 4: Sträucher<br />
Botanischer Name Deutscher Name<br />
Corylus avellana Haselnuß<br />
Crategus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn<br />
Euonymus europaeus Europäisches Pfaffenhütchen<br />
Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn<br />
Rosa canina Hundsrose<br />
Prunus spinosa Schlehe<br />
Botanischer Name Deutscher Name<br />
Sorbus aucuparia Gew. Eberesche<br />
Prunus spinosa Schlehe<br />
234
Anlage 6<br />
<strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong><br />
Beitrag zum Flächennutzungsplan<br />
Landschaftsplanerische Voruntersuchung<br />
Ortsteil Altenhof<br />
-Vorentwurf-<br />
Knieper + Partner<br />
Büro für Stadtplanung und Projektsteuerung<br />
Hufelandstraße 22<br />
10407 Berlin<br />
Bearbeitung:<br />
Dipl.-Ing. Lutz Sepke<br />
Dezember 2007
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Inhalt<br />
0 Anlass ........................................................................................1<br />
1 Allgemeine Gebietsbeschreibung............................................1<br />
1.1 Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft..................1<br />
1.1.1 Naturräumliche Gliederung/Geomorphologie.................1<br />
1.1.2 Böden............................................................................2<br />
1.1.3 Grund- und Oberflächenwasser.....................................2<br />
1.1.4 Klima .............................................................................3<br />
1.1.5 Arten- und Biotopschutz ................................................3<br />
1.1.5.1 Geschützte Biotope nach §32 BNatSchG ......................4<br />
1.1.5.2 Geschützte Biotope nach §31 BNatSchG ......................6<br />
1.1.5.3 Sonstige wertvolle Biotope ............................................6<br />
1.1.5.4 Fauna............................................................................7<br />
1.1.5.5 Flora..............................................................................9<br />
2 Aktuelle Flächennutzungen und Konflikte ............................11<br />
2.1 Landschaftsbild und Erholungsnutzung.....................................11<br />
2.1.1 Landschaftsbildbewertung ...........................................11<br />
2.1.1.1 Ortslage.......................................................................11<br />
2.1.1.2 Gemarkung..................................................................11<br />
2.1.2 Landschaftsbezogene Erholungsinfrastruktur..............11<br />
2.2 Siedlungsentwicklung................................................................12<br />
2.2.1 Bestehende Siedlungen...............................................12<br />
2.2.2 Geplante Siedlungsentwicklungen...............................13<br />
2.3 Verkehr .....................................................................................14<br />
2.4 Ver- und Entsorgung .................................................................14<br />
2.5 Landwirtschaft/Fischerei............................................................14<br />
2.6 Forstwirtschaft und Jagd ...........................................................15<br />
3 Landschaftspflegerisches Entwicklungskonzept (Altenhof)15<br />
3.1 Vorgaben aus Fachplanungen des Natur- und<br />
Landschaftsschutzes.................................................................15<br />
3.1.1 Landschaftsprogramm.................................................15<br />
3.1.1.1 Boden..........................................................................15<br />
3.1.1.2 Wasser........................................................................15<br />
3.1.1.3 Klima und Luft .............................................................15<br />
3.1.1.4 Arten- und Biotopschutz ..............................................15<br />
3.1.1.5 Landschaftsbild und Erholung......................................15<br />
3.1.1.6 Biosphärenreservat <strong>Schorfheide</strong>-Chorin ......................16<br />
3.1.1.7 FFH-Gebiet 347 „Werbellinkanal“ ................................18<br />
3.2 Leitlinien und Maßnahmen für die Ortsteilentwicklung...............19<br />
3.2.1 Arten- und Biotopschutz ..............................................20<br />
3.2.1.1 Sicherungsmaßnahmen:..............................................20<br />
3.2.1.2 Entwicklungsmaßnahmen:...........................................21
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
3.2.2 Boden, Wasser, Klima und Luft ...................................22<br />
3.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen: ..........................................22<br />
3.2.3 Landschaftsbild, Erholung und Tourismus...................22<br />
3.2.3.1 Sicherungsmaßnahmen ..............................................22<br />
3.2.3.2 Entwicklungsmaßnahmen ...........................................22<br />
Literaturverzeichnis ..............................................................................24<br />
Bewertungskriterien des Arten- und Biotopschutzes.............................25<br />
Pflanzliste.............................................................................................26<br />
KARTE 1: BESTAND DER BIOTOPTYPEN UND ZIELARTEN<br />
KARTE 2: BEWERTUNG DER RAUMBEDEUTUNG FÜR DEN ARTEN- UND<br />
BIOTOPSCHUTZ<br />
KARTE 3: NAHERHOLUNGSFUNKTIONEN – POTENTIALE UND<br />
BEEINTRÄCHTIGUNGEN<br />
KARTE 4: SICHERUNG UND ENTWICKLUNG VON NATUR- UND<br />
LANDSCHAFT
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
0 Anlass<br />
Der Ortsteil Altenhof der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> wird bislang nicht von den<br />
beiden bestehenden Landschaftsplänen der Altgemeinden Finowfurt und<br />
Groß Schönebeck erfasst. Um für die Änderung des Flächennutzungsplanes<br />
der fusionierten <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> eine geeignete landschaftsplanerische<br />
Grundlage zur Beurteilung der Entwicklungsabsichten des FNP zur<br />
Verfügung zu haben, werden im Rahmen dieser landschaftsplanerischen<br />
Voruntersuchung die notwendigen Grundlagen, Erfordernisse und Ziele von<br />
Natur und Landschaft im Ortsteil Altenhof ermittelt. Vor dem Hintergrund<br />
dieser Erkenntnisse ist zu beurteilen, ob die vorgesehenen Änderungen des<br />
Flächennutzungsplanes zu Konflikten mit den grundlegenden Zielen der<br />
Landschaftsplanung führen.<br />
1 Allgemeine Gebietsbeschreibung<br />
Altenhof befindet sich im nördlich von Berlin gelegenen Teil des Landes<br />
Brandenburg im Landkreis Barnim und liegt als einziger Werbellinsee-<br />
Anrainerort mit der Ortslage unmittelbar am See. Das <strong>Gemeinde</strong>gebiet hat<br />
eine Fläche von etwa 202 ha. Von Berlin Mitte ist Altenhof in nordöstlicher<br />
Richtung ca. 60 km entfernt und liegt damit im Einzugsbereich der Berliner<br />
Naherholung. Über die Bundesautobahn 11 (Ausfahrt „Werbellinsee“ in 2.3<br />
km Entfernung) und der Landesstraße 238 (Eberswalder Straße) wird Altenhof<br />
verkehrlich erschlossen.<br />
Der Ortsteil Altenhof mit seinen knapp 600 Einwohnern hat durch die exponierte<br />
Ortslage unmittelbar am Südufer des Werbellinsees ein exklusives<br />
Alleinstellungsmerkmal innerhalb der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong>. Die etwa 200<br />
ha Ortsteilgebietsfläche wird zu etwa einem Drittel von der eigentlichen Ortslage<br />
zwischen Werbellinsee und Hangkante des Werbellinsees, zu einem<br />
guten Drittel von überwiegend naturnahen Buchenmischwäldern und zu einem<br />
knappen Drittel von intensiven Acker- bzw. Grünlandnutzungen eingenommen.<br />
Insbesondere in den Sommermonaten ist Altenhof Anlaufpunkt für einen<br />
erheblichen Teil der Ausflugsgäste in der <strong>Gemeinde</strong>. Entsprechend sieht die<br />
Regionalplanung mit dem sektoralen Teilplan „Zentralörtliche Gliederung,<br />
<strong>Gemeinde</strong>funktionen (1995)“ für Altenhof die Übernahme überörtlicher Funktionen<br />
in Fremdenverkehr und Erholung vor. Zentrumsfunktionen werden<br />
Altenhof nicht zugeschrieben, die Wohnfunktion ist entsprechend nicht zu<br />
entwickeln, sondern lediglich zu sichern.<br />
Wirtschaftsstrukturell ist Altenhof von traditioneller Landnutzung in Land-,<br />
Forstwirtschaft und Fischerei geprägt. Die Bedeutung des Fremdenverkehrssektors<br />
steigt, ist aufgrund seines bislang saisonalen Charakters aber<br />
noch keine Dominante des Wirtschaftslebens. Industrielle Produktionsstandorte<br />
fehlen im Ortsteil Altenhof.<br />
1.1 Erfassung und Bewertung von Natur und Landschaft<br />
1.1.1 Naturräumliche Gliederung/Geomorphologie<br />
Der Ortsteil Altenhof liegt vollständig im Naturraum „Britzer Platte“ (758) in<br />
der naturräumlichen Großeinheit des Nordbrandenburgischen Wald- und<br />
Seengebietes. In Altenhof geht die traditionell intensiv ackerbaulich genutzte<br />
östliche Britzer Platte in die von größeren Waldflächen bestimmte westliche<br />
Britzer Platte über. Der Übergang fällt mit der von Buchenwäldern bestandenen<br />
Hangkante des Werbellinsees zusammen. Die Grenze zwischen den<br />
für die ackerbauliche Nutzung günstigen östlichen Grundmoränen- und<br />
Stauchendmoränenstandorte und den westlich angrenzenden Sandern der<br />
wird heute durch die Bundesautobahn 11 markiert. Altenhof liegt damit fast<br />
1
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
vollständig auf von kiesigen und sandigen Bodensubstrat bestimmten Sanderflächen.<br />
Die Ortslage selbst ist auf einer schmalen Zunge von Nord-<br />
Osten hereinstreifenden Beckensanden erbaut. Die ausgeprägte Hangkante<br />
zum Werbellinsees vermittelt in eine Schmelzwasserrinne, die sich von Joachimsthal<br />
kommend über den Werbellinsee und den heutigen Verlauf des<br />
Werbellinkanals bis Marienwerder erstreckt.<br />
Die potentielle natürliche Vegetation stellen für den übergroßen Flächenanteil<br />
von Altenhof Kiefern-Buchenwälder auf durchlässigen, überwiegend sickerwasserbestimmten<br />
Böden wie Podsol-Braunerden und Braunerde-<br />
Podsolen und Traubeneichen-Buchenwälder auf den etwas reicheren<br />
Standorten dar. Auf den Niedermoorstandorten der Schmelzwasserrinne<br />
stellen Erlenbruchwälder die Klimax der Vegetationsentwicklung dar. Diese<br />
finden sich in Altenhof heute als Restbestände in den von Erlen gesäumten<br />
Ufern des Werbellinsees. Ihre räumliche Ausdehnung ist aber auch unter<br />
natürlichen Bedingungen stark eingeschränkt gewesen und auf die nur wenige<br />
Dezimeter über dem Wasserspiegel des Werbellinsees gelegenen Teilbereiche<br />
der heutigen Ortslage von Altenhof beschränkt.<br />
1.1.2 Böden<br />
Die Böden des überwiegend ackerbaulich genutzten Offenlandes werden<br />
von durchgehend sickerwasserbestimmten Braunerden, Fahlerden und<br />
Rosterden eingenommen. Es handelt sich ursprünglich um trockene, nährstoffarme<br />
Böden, die im Zuge der ackerbaulichen Nutzung stark eutrophiert<br />
sind. Wesentlich zur Nährstoffanreicherung hat die Praxis der Gülleverregnung<br />
in Altenhof beigetragen.<br />
Unter Wald finden sich überwiegend sickerwasserbestimmte Podsol-<br />
Braunerden, Braunerde-Podsole und Braunerden. Es handelt sich um relativ<br />
nährstoffarme, mäßig trockene bis mäßig frische Böden.<br />
1.1.3 Grund- und Oberflächenwasser<br />
Durch den Bau des Werbellinkanals und der Pegelhaltung bei Eichhorst ist<br />
der Wasserspiegel des Werbellinsees künstlich abgesenkt worden mit entsprechenden<br />
Folgen für den Grundwasserflurabstand im gesamten Landschaftsraum<br />
<strong>Schorfheide</strong>.<br />
Die überwiegend sandigen und kiesigen Substrate der Böden in Altenhof<br />
verursachen in Verbindung mit dem relativ hohen Grundwasserflurabstand<br />
im Bereich der Sanderflächen unter Wald eine relativ geringe Verschmutzungsempfindlichkeit<br />
und unter ackerbaulicher Nutzung eine mittlere Verschmutzungsempfindlichkeit<br />
des Grundwassers. Die sickerfreudigen Böden<br />
erreichen aufgrund der geringeren Evapotranspiration unter Ackernutzung in<br />
eine relativ hohe Grundwasserneubildungsrate von mehr als 150 mm/a. Unter<br />
Wald sinkt die Grundwasserneubildungsrate auf 100-150 mm/a.<br />
Oberflächengewässer befinden sich in Altenhof selbst nicht. Der Ortsteil<br />
spielt aber aufgrund seiner Lage am Werbellinsee eine wichtige Rolle für die<br />
Hydrologie und Nutzung des Sees. Der Werbellinsee stellt mit einer maximalen<br />
Tiefe von 51 m einen der tiefsten Seen Brandenburgs dar. Er gehört zu<br />
den Hartwasserseen der norddeutschen Jungmoränenlandschaft mit Klarwasserstadien<br />
in Herbst und Frühjahr und sommerlichen Sichttiefen von 2,0<br />
bis 3,0 m. Der aktuelle Trophiegrad ist als mesotroph zu bezeichnen. Unter<br />
natürlichen Umständen wäre der Werbellinsee potentiell als oligotropher<br />
Klarwassersee einzustufen. Die wesentlichen Eutrophierungsquellen sind<br />
der Zufluss aus dem Grimnitzsee. Dessen Stickstoff- und Phosporlast<br />
scheint sich aber seit 1989 etwa halbiert zu haben (vgl. BTU 2001, S. 148).<br />
2
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Weitere aktuelle Belastungen der Gewässergüte rühren von den drei Campingplätzen<br />
am Seeufer, Badestellen und Abwassereinleitungen aus den<br />
anliegenden Ortschaften. Wesentliche Eutrophierungsquellen der Vergangenheit<br />
– Netzkäfighaltung VEB-Binnenfischerei Altenhof, Abwassereinleitungen<br />
VEB Schnittholz und Holzwaren und FDGB Ferienheim – sind bereits<br />
Ende der achtziger Jahre versiegt.<br />
1.1.4 Klima<br />
Altenhof wird vom so genannten mecklenburgisch-brandenburgischen Übergangsklima<br />
bestimmt. Die kontinentalen Klimaeinflüsse mit warmen Sommern<br />
und kalten Wintern sind stärker ausgeprägt. Aufgrund der überwiegenden<br />
leichten Böden kommt es zu einer relativ schnellen Frühjahrserwärmung.<br />
Die Vegetationsperiode beginnt daher bereits um den 26.März und<br />
endet um den 06. November. Spätrost gefährdete Gebiete finden sich in<br />
Altenhof nicht. Der Kaltluftabfluss von der Hochfläche über die Hangkante in<br />
die Ortslage von Altenhof wird im März/April von der nivellierenden Wirkung<br />
des Wasserkörpers des Werbellinsees ausgeglichen. Die Jahresmitteltemperatur<br />
liegt bei 8,3° C.<br />
Die Niederschläge liegen mit etwa 580 mm/a deutlich unterhalb des bundesdeutschen<br />
Durchschnitts. Im Trend der letzten Jahre nimmt die Jahresniederschlagsmenge<br />
kontinuierlich ab, insbesondere durch eine Verringerung<br />
der Sommerniederschläge.<br />
Die Hauptwindrichtungen West und Südwest. Im Jahresdurchschnitt herrschen<br />
Windgeschwindigkeiten von 3 bis 4 m/s (in 10 m Höhe über Grund).<br />
Die offene Agrarlandschaft südlich von Altenhof in Verbindung mit den leichten<br />
Sandböden begünstigt die Winderosion. Es ist daher für die Ackerflächen<br />
von Altenhof von einer sehr hohen Winderosionsgefährdung auszugehen.<br />
1.1.5 Arten- und Biotopschutz<br />
Für die Beurteilung der Bedeutung von Biotopen für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes sind die Kriterien Schutzwürdigkeit und Schutzbedürftigkeit<br />
heranzuziehen. Die Einstufung der Biotoptypen in 6 Wertkategorien<br />
erfolgt unter paritätischer Berücksichtigung dieser beiden<br />
Grundkriterien. Dabei ergibt sich die Schutzwürdigkeit paritätisch aus den<br />
Parametern:<br />
� Entwicklungsgrad,<br />
� Natürlichkeit,<br />
� Strukturreichtum,<br />
� Artenvielfalt,<br />
� Intensität anthropogener Störeinflüsse.<br />
Die Schutzbedürftigkeit wird paritätisch durch die Parameter<br />
� Seltenheit des Biotops,<br />
� Seltenheit dort vorkommender Arten,<br />
� Empfindlichkeit,<br />
� ungünstiger Entwicklungstendenz bestimmt.<br />
Die Kriterien für die Zuordnung zu den einzelnen Wertstufen können der<br />
Anlage entnommen werden.<br />
Die Kartierung der Biotoptypen für den Ortsteil Altenhof basiert auf einer<br />
Auswertung von Schwarz-Weiß-Luftbildaufnahmen im Maßstab 1:10.000 (2.<br />
Landesbefliegung 1996-1998) sowie einer eigenen flächendeckenden Nachkartierung<br />
im September und Oktober 2004.<br />
3
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Nachfolgend werden die in Altenhof vorkommenden Biotope kurz charakterisiert,<br />
die für den Arten- und Biotopschutz eine sehr hohe bis hohe Bedeutung<br />
(Wertstufen 1-2) haben. Vorkommende Biotope, denen eine geringere<br />
Wertstufe zugewiesen wurde, werden beschrieben, soweit standörtliche Besonderheiten<br />
dies erforderlich machen.<br />
Die Ansprache der Biotoptypen erfolgt auf Basis der Biotopkartierung Brandenburg<br />
(LUA 2007).<br />
Die Karte des Bestandes der Biotope bzw. deren Bewertung findet sich im<br />
Anhang unter der laufenden Kartennummer 1 bzw. 2.<br />
1.1.5.1 Geschützte Biotope nach §32 BNatSchG<br />
Erlenbruchwälder (08103)<br />
Hierbei handelt es sich um eine Restfläche des ursprünglich das gesamte<br />
Werbellinseeufer einfassenden Erlenbruchwaldes im Nordosten des Ortsteils.<br />
Die etwa 2.600 m² große Fläche wird vom Werbellinsee, der Uferpromenade<br />
und dem Lagerschuppen der Fa. Blossin begrenzt. Es dominieren<br />
in der Baumschicht Erlen und Birken, in der Strauchschicht Himbeere (Rubus<br />
idaeus), Hopfen (Humulus lupulus), Pfaffenhütchen (Euonymus europeaus),<br />
Weißem Hartriegel (Cornus alba) und Schwarzem Holunder (Sambucus<br />
nigra). Das Ufer ist unbefestigt, mit Ausnahme eines schmalen, von<br />
Seggenarten bestimmten Uferkrautsaumes fehlt ein vorgelagerter Röhrichtgürtel<br />
aufgrund des Schattenwurfs der Baumschicht. Aufgrund der geringen<br />
Flächenausdehnung und der intensiven Nutzung der umgebenden Flächen<br />
ist die faunistische Bedeutung des Biotops auf weniger störanfällige Tierarten<br />
beschränkt. Unter den biotopkennzeichnenden Wirbeltieren sind Vorkommen<br />
von Rötelmaus, Waldspitzmaus, Gelbhalsmaus, Weidenmeise,<br />
Ringelnatter und verschiedene Lurchen zu erwarten.<br />
Der Biotop wird der Wertstufe 1 (sehr hohe Bedeutung für den Arten- und<br />
Biotopschutz) zugeordnet.<br />
Standortgemäße Gehölze an Gewässern (07190)<br />
Die gehölzbestandenen, unbefestigten Bereiche des Werbellinsee-Ufers<br />
unterliegen ebenfalls dem Schutz des § 32 Brandenburgisches Naturschutzgesetz.<br />
Die Biotope zeichnen sich insbesondere durch das Vorkommen der<br />
standortgemäßen Baumarten Schwarz-Erle (Alnus glutinosa) und verschiedener<br />
Baumweiden (Salix spec.) aus. Aufgrund der intensiven anthropogenen<br />
Störeinflüsse aus den unmittelbar angrenzenden Nutzungen (Uferpromenade,<br />
Gastronomische Einrichtungen, Wohn- und Wochenendhausgrundstücke)<br />
haben die Gehölzsäume für störungsanfällige Tierarten nur<br />
eine geringe Habitateignung. Aufgrund der generellen Bedeutung des Werbellinsees<br />
insbesondere als Lebensraum von Elbe-Biber (Castor fiber, FFH<br />
IV) und Fischotter (Lutra lutra, FFH IV) sind die verbliebenen naturnahen<br />
Uferstrukturen in Altenhof dennoch von hoher Bedeutung für die Sicherung<br />
der Biotopverbindungsfunktion des südlichen Werbellinseeufers. Zudem<br />
spielen die Ufergehölze eine bedeutende Rolle als Sommer- und Winterlebensraum<br />
von Amphibien.<br />
Erlen-Eschenwälder (08110) / Rotbuchenwälder mittlerer Standorte<br />
(08172)<br />
An der Seepromenade findet sich auf einer Fläche von etwa 1.650 m²<br />
Restbestockungen natürlicher Waldgesellschaften. Die tiefer gelegenen<br />
Bereiche, die nur durch die Seepromenade vom Ufer des Werbellinsees<br />
getrennt sind werden von einer Erlen-Eschenbruchwaldgesellschaft einge-<br />
4
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
nommen, der nach Süden mit ansteigender Geländehöhe gleitend in eine<br />
Gesellschaft des Buchenwaldes mittlerer Standorte übergeht. Auf der<br />
Hangkante des Werbellinsees außerhalb des Geltungsbereiches gesellt<br />
sich die Schwarzkiefer zur Buche und weist auf den Übergang zu bodensauren<br />
Buchenwäldern hin. Die Erlen-Eschenbruchwaldgesellschaft wird in<br />
der Baumschicht von Schwarz-Erlen und Birken dominiert, in der Strauchschicht<br />
finden sich v.a. Echte Brombeere (Rubus fruticosus), Himbeere<br />
(Rubus idaeus), Hopfen (Humulus lupulus), Schwarzer Holunder (Sambucus<br />
nigra) sowie Eberesche (Sorbus aucuparia). In der Krautschicht überwiegt<br />
die Große Brennessel (Urtica dioica) in Begleitung des Kleinblütigen<br />
Springkrautes (Impatiens parviflora) des Gewöhnlichen Gierschs (Aegopodium<br />
podagraria), des Buschwindröschens (Anemone nemorosa), des<br />
Scharbockskrauts (Ranunculus ficaria) und des Wald-Ziests (Stachys sylvatica).<br />
Unter den biotopkennzeichnenden Wirbeltieren sind Vorkommen<br />
von Rötelmaus, Waldspitzmaus, Gelbhalsmaus, Weiden- und Sumpfmeise<br />
und Teichfrosch (Sommer- und Winterlebensraum) zu erwarten. Aufgrund<br />
der geringen Größe des Biotops und dem intensiven Störeinfluss aus der<br />
unmittelbaren Nachbarschaft zur Seepromenade und zur Liegewiese ist<br />
das Tierartenspektrum auf weniger störanfällige Tierarten beschränkt. Dies<br />
gilt auch für die von Buchen bestimmten, grundwasserferneren Bereiche.<br />
Strauch- und Krautschicht sind in der Artenzusammensetzung dem Erlenbruchbereich<br />
ganz ähnlich. Unter den kennzeichnenden Tierarten des Biotoptyps<br />
treten zusätzlich Maulwurf, typische Brutvögel wie Trauerschnäpper,<br />
Zwergschnäpper und Gartenbaumläufer hinzu.<br />
Der schrittweise Übergang vom mäßig frischen Hangbereich zum feuchten<br />
Hangfuß ermöglicht auf relativ engem Raum vielfältige Habitatstrukturen,<br />
die eine hohe floristische Artenvielfalt bedingt und insbesondere einem<br />
weiten Spektrum wirbelloser Tierarten (insbesondere Lauf-, Bock- und<br />
Schnellkäfer) Lebensräume eröffnet.<br />
Die floristische Artenzusammensetzung der Erlen-<br />
Eschenbruchwaldgesellschaft als auch des Buchenwaldes sowie die Strukturvielfalt<br />
beider Teilbereiche sind als annähernd idealtypisch zu bezeichnen.<br />
die Fläche wird trotz des intensiven Störeinflusses aus den angrenzenden<br />
Erholungsnutzungen der Wertstufe 1 (sehr hohe Bedeutung für den Arten-<br />
und Biotopschutz) zugeordnet.<br />
Südlich der Ortslage Altenhof stockt auf der Hangkante des Werbellinsees<br />
und der anschließenden Hochfläche ein in Baum-, Strauch- und Krautschicht<br />
naturnaher Buchenmischwald. Die Rotbuche wird in den westlichen Bereichen<br />
von Traubeneiche und Winterlinde begleitet. Nach Osten tritt die<br />
Schwarzkiefer als Begleiter zunehmend in den Vordergrund. Das Baumartenspektrum<br />
entspricht der potentiellen natürlichen Vegetation, sodass die<br />
Buchenwälder der Hangkante des Werbellinsees als Restbestockungen natürlicher<br />
Waldgesellschaften aufzufassen sind. Stehendes Totholz als wichtiges<br />
Strukturelement ist stetiger Bestandteil der Baumschicht. In den ortsnahen<br />
Lagen verjüngt sich die Baumschicht aufgrund des fehlenden Verbisses<br />
durch Schalwild natürlich. Die Strauchschicht wird ausschließlich von<br />
Jungbäumen mit klarer Dominanz der Rotbuche gebildet. Die Krautschicht<br />
erreicht nur relativ geringe Deckungsgrade.<br />
Der Biotoptyp hat generell eine sehr hohe Bedeutung für den Arten- und<br />
Biotopschutz. Er bietet einer Reihe von geschützten Tierarten Lebensraum.<br />
Charakteristische Tierarten sind insbesondere:<br />
5
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Siebenschläfer (Glis glis, BArtSchV), Gelbhalsmaus (Apodemus flavicollis,<br />
BArtSchV), Rötelmaus (Clethrionomys glareolus), Mittelspecht (Dendrocopos<br />
medius, RL 3; VSchRL), Schwarzspecht (Dryocopus martius, VSchRL),<br />
Grünspecht (Picus viridis, BArtSchV) sowie einige Landschneckenarten und<br />
Käfer. In den alten Baumbeständen ist regelmäßig mit dem Vorkommen von<br />
Fledermausquartieren (sämtlich Anhang IV FFH-Richtlinie) zu rechnen.<br />
Der südexponierte Waldrand stellt als Übergangslebensraum eine besondere<br />
Strukturqualität dar, die auch Wärme liebenden Pflanzen und Tierarten<br />
Lebensraum bietet. Das Vorkommen von Waldeidechse (Lacerta vivipara,<br />
RL 2; BArtSchV) und der Blindschleiche (Anguis fragilis, BArtSchV) ist zu<br />
erwarten.<br />
Mit zunehmender Nähe zum Ortsrand von Altenhof steigt der anthropogene<br />
Nutzungsdruck merklich an. Für störungssensiblere Tierarten erfüllen diese<br />
Bereiche daher nur Teilhabitatfunktionen.<br />
1.1.5.2 Geschützte Biotope nach §31 BNatSchG<br />
Alleen (071321)<br />
Die Landesstraße 238 ist südlich der Ortslage mit Austritt aus den Forstflächen<br />
bis zur Grenze des Ortsteils beidseitig von überwiegend vitalen Kastanien-Altbäumen<br />
bestanden. Einzelne alte Roteichen sind eingestreut. Der<br />
Saumbereich ist teilweise mit heimischen, standortgerechten Sträuchern wie<br />
Pfaffenhütchen, Schwarzem Holunder, Weißdorn, Vogelkirsche und Schlehe<br />
bewachsen. Die Allee ist v.a. als kulturhistorisches Zeugnis und Raum bildendes<br />
Element bedeutsam.<br />
1.1.5.3 Sonstige wertvolle Biotope<br />
Eichenforstgesellschaften auf gut mit Nährstoffen versorgten Böden<br />
(08310)<br />
Dieser Eichenforst aus Stiel-Eichen (Quercus robur) überwiegend starken<br />
Baumholzes ist den östlich gelegenen Rotbuchenwäldern Altenhofs als etwa<br />
50 m breiter Saum vorgelagert. Aufgrund der Süd-West-Exponierung zur<br />
offenen Feldflur und des verhältnismäßig geringen Schattendrucks der Stiel-<br />
Eiche ist der Biotop thermisch begünstigt. Die relativ dichte Krautschicht<br />
bilden v.a. das Land-Reitgras (Calamagrostis epigeios), Giersch (Agrimonia<br />
podagraria), Große Brennnessel (Urtica dioica) an tiefer gelegenen, feuchteren<br />
Standorten und stellenweise Adlerfarn (Pteridium aguilinum). In der<br />
Strauchschicht dominiert der Schwarze Holunder (Sambucus nigra). Insgesamt<br />
deuten die überwiegend nitrophytischen Pflanzenarten in der Kraut-<br />
und Strauchschicht auf eine erhebliche Verfrachtung von Nährstoffen aus<br />
der angrenzenden Ackerflur. Hier dürfte insbesondere die Praxis der Güllerverregnung<br />
erheblichen Einfluss genommen haben. Die windexponierte Lage<br />
des Saumbiotops begünstigt diese Eutrophierung maßgeblich. Unter den<br />
gegebenen Standortbedingungen bildeten buchenreiche Traubeneichen-<br />
Buchenwälder die natürliche Waldgesellschaft mit hohem Anteil der Rotbuche<br />
(Fagus sylvatica) unter Beimischung der Trauben-Eiche (Quercus<br />
petrea) und vereinzelten Stiel-Eichen.<br />
Der Saum wird von Reh- und Damwild intensiv als Rückzugsraum frequentiert.<br />
Aufgrund des relativ hohen Alters der Bestands bildenden Stiel-Eichen<br />
ist von einer hohen Bedeutung des Forstes für höhlenbrütende Vogelarten,<br />
xylobionte Kerbtiere und Kleinsäuger auszugehen. Es steht außerdem zu<br />
vermuten, dass sich in den Alt-Eichen Wochenstuben verschiedener Fledermausarten<br />
finden. Der Eichensaum erfüllt außerdem eine wichtige Pufferfunktion<br />
für die rückwärtigen Buchenwälder gegenüber den Einwirkungen<br />
Agrarlandschaft. Der Eichenforst hat somit trotz der Störeinwirkungen aus<br />
6
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
der angrenzenden landwirtschaftlichen Nutzung eine hohe Bedeutung für<br />
den Arten- und Biotopschutz (Wertstufe 2).<br />
Intensivacker (09130)<br />
Die offenen Intensivackerflächen südlich der Gemarkung Altenhof sind wichtige<br />
Nahrungshabitate für Bleß- und Saatgänse, die diese in großen Verbänden<br />
im Frühjahr und Herbst aufsuchen. In der Gemarkung Altenhof<br />
selbst wird allerdings nur ein geringer Teil der Ackerflächen im Südosten mit<br />
einem Abstand von mindestens 200 m von der Waldgrenze von Gänsen<br />
aufgesucht.<br />
Hecken und Windschutzstreifen (071321)<br />
Entlang der Südgrenze der Gemarkung Altenhof verläuft ein beidseitig von<br />
alten Eichen bestandener Feldweg. Durch den dichten und artenreichen<br />
Saum aus Sträuchern wie Pfaffenhütchen, Schwarzem Holunder, Flieder,<br />
Brombeere, Vogelkirsche und Espe entsteht in einzelnen Abschnitten ein<br />
Hohlwegcharakter. Neben der Lebensraumfunktion insbesondere für eine<br />
Vielzahl von Vogelarten, Kleinsäugern und Kerbtieren ist dieses Biotop von<br />
großer Bedeutung für die visuelle Raumstrukturierung.<br />
1.1.5.4 Fauna<br />
Das Biosphärenreservat <strong>Schorfheide</strong> ist aufgrund der Vielzahl der Lebensraumtypen<br />
und des hohen Anteils vergleichsweise störungsarmer, unzerschnittener<br />
Räume Lebensraum einer ganzen Reihe von überregional bemerkenswerten<br />
Tierarten. Hierzu zählen insbesondere störungssensitive<br />
Großvogelarten (u.a. Fischadler, Pandion haliaetus Rote Liste Brandenburgs<br />
2, RL BRD 2, Seeadler Haliaeetus albicilla RL Bbg. 1, BRD 2, Schwarzstorch<br />
Ciconia nigra RL Bbg. 1, BRD 1, Kranich Grus grus RL Bbg. 2, BRD<br />
2), semi-aquatisch lebende Säugetiere (Elbe-Biber Castor fiber RL Bbg. 1,<br />
BRD 1 und Fischotter Lutra lutra RL Bbg. 1, BRD 1) und Amphibien des Offenlandes<br />
(Rotbauch-Unke Bombina bombina RL Bbg. 1, BRD 1, Europäischer<br />
Laubfrosch Hyla arborea RL Bbg. 1, BRD 2).<br />
Das gesamte Gebiet des Ortsteils Altenhof ist mehr oder weniger intensiven<br />
anthropogenen Störeinflüssen ausgesetzt. Die faunistische Bedeutung Altenhofs<br />
insbesondere für störungssensible Tierarten ist daher deutlich eingeschränkt.<br />
Nachfolgend wird die Bedeutung der vier Hauptnutzungseinheiten<br />
Wälder/Forste, Agrarflächen, Seeufer und Ortslage von Altenhof als Lebensraum<br />
für die Zielarten des Biosphärenreservates <strong>Schorfheide</strong>-Chorin<br />
erörtert (vgl. MLUR 2001, S. 200-202). Zielarten, die auf Lebensräume angewiesen<br />
sind, die in Altenhof nicht vorkommen – Fließgewässer, Kleingewässer,<br />
Moore und Trockenrasen - werden nicht beschrieben. Das potentielle<br />
oder tatsächliche Vorkommen anderer Tierarten ist im Rahmen der Biotopbeschreibungen<br />
erfolgt.<br />
Wälder<br />
Die Wälder und Forste dienen aufgrund ihrer Ortsrandlage und der Bedeutung<br />
Altenhofs für Tourismus und Naherholung insbesondere zur Hauptvegetationszeit<br />
intensiv der landschaftsbezogenen Erholungsnutzung. Lediglich<br />
die östlichsten Forstflächen weisen keine merklich erhöhte Besucherfrequentierung<br />
auf. Für anspruchsvolle Waldarten stellt die ausgeprägte Grenzlage<br />
der Wälder und Forste von Altenhof eine ungünstige Habitateigenschaft<br />
dar. Dies betrifft insbesondere die als etwa 200 m breiten Streifen ausgebildeten<br />
Buchenwaldflächen zwischen Ortsrand und Agrarlandschaft. Aber<br />
auch die östlichen Wald- und Forstflächen sind klimatisch und stofflich erheblich<br />
von den angrenzenden Agrarlandschaften beeinflusst.<br />
7
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Damit sind die Wälder und Forste Altenhofs als Lebensräume für waldbrütende<br />
Großvogelarten und den Rothirsch aufgrund der anthropogenen Störeinflüsse<br />
ungeeignet.<br />
Mittelspecht (Dendrocopos medius, RL Bbg. 3, BRD V, FFH Anhang I) und<br />
Zwergschnäpper (Ficedula parva, RL Bbg. P, BRD V, FFH Anhang I ) bevorzugen<br />
Alt-Eichenbestände und ältere bis sehr alte Buchenwälder (Mittelspecht:<br />
Buchenwälder über 200 Jahre) in der Nähe von Feuchtbereichen.<br />
Potentielle Habitateignung insbesondere für den Mittelspecht haben daher<br />
aufgrund des hohen Anteils alter Stiel-Eichen die Wald- und Forstflächen im<br />
Osten der Gemarkung. In Folge der beschriebenen Störeinflüsse aus der<br />
angrenzenden Agrarlandschaft und des geringen Anteils feuchter Flächen<br />
handelt es sich allerdings um einen suboptimalen, entwicklungsfähigen<br />
Standort. Da der Zwergschnäpper auch in älteren Wäldern mit Buchendominanz<br />
vorkommt, weisen auch die Buchenwälder im Süd-Westen der Gemarkung<br />
potentielle Habitateignungen auf. Allerdings gelten auch hier die Einschränkungen<br />
der anthropogenen Störeinflüsse und die fehlenden Feuchtflächen.<br />
Es steht zu vermuten, dass die Buchenwälder Altenhofs für den<br />
Zwergschnäpper eher Pufferfunktionen für die günstiger ausgestatteten,<br />
süd-westlich angrenzenden Buchen-Mischwälder haben.<br />
Für den Eisvogel (Alcedo atthis, RL Bbg. 2, BRD 3) stellen die Buchenwälder<br />
der Hangkante zum Werbellinsee gut geeignete Brutstätten dar. Der<br />
Eisvogel brütet dort in selbst gegrabenen Brutröhren. Entsprechende Brutnachweise<br />
liegen für die südlichen Hangkanten-Wälder vor (vgl. MLUR<br />
2001, Karte 31).<br />
Der Eremit (Osmoderma eremita, RL Bbg. 2, BRD -, FFH Anhang I) bewohnt<br />
große, schwarzmullreiche Hohlräume in Bäumen. Diese treten v.a. in Alt-<br />
Bäumen auf, insbesondere Eichen bilden überdurchschnittlich viele Hohlräume<br />
aus. Alt-Eichen-Bestände stellen daher eines der Haupthabitate des<br />
Eremiten dar. Dieser ist aber grundsätzlich in der Baumartenwahl nicht spezialisiert.<br />
Damit sind potentiell alle alten Laubbäume potentielle Brutbäume.<br />
Schwerpunktmäßig sind dabei insbesondere die Alt-Eichen-Bestände im<br />
Osten der Gemarkung, aber auch die Alt-Bäume der Kastanienallee entlang<br />
der Eberswalder Straße oder die Alt-Bäume in der Baumhecke entlang des<br />
Feldweges an der süd-östlichen <strong>Gemeinde</strong>grenze.<br />
Der Große Abendsegler (Nyctalus noctula, RL Bbg. 3, BRD 3) ist auf Wochenstuben<br />
in Baumhöhlen in altholzreichen Wäldern und Forsten angewiesen.<br />
Die Jagdreviere befinden sich über Wasserflächen und insektenreichen<br />
Wiesen. Geeignete Habitatbedingungen dürften in den alten Buchenwaldbeständen<br />
und Stiel-Eichen-Forste vorzufinden sein. Hier ist mit dem Vorkommen<br />
von Sommerquartieren weiterer Fledermausarten zu rechnen.<br />
Agrarflächen<br />
Die offene Kulturlandschaft Altenhofs wird ausschließlich mehr oder weniger<br />
intensiv ackerbaulich genutzt. Alle Zielarten, die auf strukturreiche, extensiv<br />
genutzte Flächenanteile angewiesen sind, finden daher in Altenhof keine<br />
geeigneten Lebensräume. Da auch außerhalb der Gemarkung Altenhof die<br />
angrenzende Kulturlandschaft von intensiver Ackerbaulicher Nutzung mit<br />
ausgeprägt großräumigen Schlägen bestimmt wird, können für Zielarten wie<br />
Raubwürger, Wachtel, Rebhuhn und Sperbergrasmücke durch landschaftsgestaltende<br />
Maßnahmen in Altenhof auch keine realistischen Entwicklungsperspektiven<br />
eröffnet werden.<br />
8
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Dagegen hat die Grauammer (Emberiza calandra, RL Bbg. 1, BRD 2) einen<br />
Siedlungsschwerpunkt in den offenen Ackerfluren der Britzer Platte. Damit<br />
ist auch die Agrarlandschaft Altenhofs potentieller Brutraum der Grauammer<br />
bzw. weist Entwicklungspotentiale auf. Bestimmende Defizite der Habitatausstattung<br />
sind die Monostrukturierung der angebauten Feldfrüchte in Folge<br />
der großen Ackerschläge. Zusätzliche Feldgehölze insbesondere im Süd-<br />
Osten der Gemarkung würden die Habitateignung ebenfalls verbessern.<br />
Seeufer<br />
Die Ufer des Werbellinsees sind in Altenhof nahezu vollständig durch die<br />
touristische Nutzung und Siedlungsentwicklung anthropogen gestört. Dies<br />
gilt auch für die verbliebenen Restflächen naturnaher Erlenbruchwälder, die<br />
aufgrund ihrer geringen Flächenausdehnung und der unmittelbaren Nähe<br />
intensiver menschlicher Nutzungsformen für störungssensible Tierarten nur<br />
Teil-Habitatfunktionen übernehmen können.<br />
Für Elbe-Biber (Castor fiber RL Bbg. 1, BRD 1) und Fischotter (Lutra lutra<br />
RL Bbg. 1, BRD 1) bestehen Vorkommensnachweise im Werbellinsee. Die<br />
Ufer Altenhofs spielen für beide Tierarten eine Rolle im Rahmen der Biotopverbindungsfunktion<br />
des Ufers des östlichen Werbellinsees. Beeinträchtigungen<br />
stellen befestigte Uferabschnitte, menschliche Aktivitäten in den<br />
Dämmerungs- und Nachtstunden und generell die überwiegend naturferne<br />
Ausgestaltung der landseitig angrenzenden Flächen dar.<br />
Die Kleine Maräne (Coregonus albula, RL Bbg. 2, BRD 4) als Tiefwasserfisch<br />
laicht in den Herbstmonaten in seichteren Uferbereichen ab. Die wenigen<br />
Fachwasserzonen und Röhrichte in der Uferzone des Werbellinsees in<br />
Altenhof spielen damit eine potentielle Rolle als Laichhabitate und Schutzräume<br />
für Jungfische der Kleinen Maräne.<br />
Der Hecht (Esox lucius, RL Bbg. 3) als klassischer Stoßräuber nutzt die Deckung<br />
von Röhrichten, um seine überwiegend aus Weißfischen bestehende<br />
Nahrung zu erbeuten. Die Röhrichte vor Altenhof spielen somit eine Rolle<br />
als Nahrungshabitat des Hechtes. Charakteristische Laichhabitate sind im<br />
Frühjahr überflutete Wiesen und ausgedehnte, sich schnell erwärmende<br />
Flachwasserzonen. Beides findet sich vor Altenhof nicht.<br />
Für die auf offene Kleingewässer spezialisierten Amphibienarten Rotbauch-<br />
Unke (Bombina bombina) und Europäischer Laubfrosch (Hyla arborea) ist<br />
der Werbellinsee im Allgemeinen ein suboptimaler Lebensraum und am<br />
Ostufer bei Altenhof ein ungeeigneter Lebensraum (Nord-West-Exposition,<br />
fehlende Flachwasserbereiche).<br />
Ortslage<br />
Die Zielarten des Landschaftsrahmenplanes sind auf agrarisch strukturierte<br />
Dorflagen ausgerichtet und auf Strukturen der bäuerlichen Landwirtschaft<br />
angewiesen. Derartige Betriebsstrukturen existieren in Altenhof nicht, so<br />
dass Schleiereule und Weißstorch ungeeignete Habitatbedingungen in Altenhof<br />
vorfinden. Bruthabitate der Rauchschwalbe an Gebäuden sind in Altenhof<br />
nicht ausgeschlossen, die Habitatbedingungen sind aber insgesamt<br />
suboptimal, eine aktive Entwicklung der Habitateignung scheint wenig erfolgversprechend<br />
zu sein.<br />
1.1.5.5 Flora<br />
Die floristischen Zielarten des Landschaftsrahmenplans sind mit Ausnahme<br />
der Wasserpflanzen auf Standorte mit extremen Ausprägungen der Parameter<br />
Boden, Wasser oder Klima angewiesen bzw. von extensiven Landnut-<br />
9
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
zungsformen abhängig. Derartige Strukturen weist die Gemarkung Altenhof<br />
nicht auf.<br />
An sandigen, flacher abfallenden Uferbereichen des Werbellinsees bei Altenhof<br />
ist das Vorkommen von verschiedene Armleuchteralgen (Characeen)<br />
zu erwarten. Beeinträchtigungen ergeben sich insbesondere im Bereich von<br />
Badestellen (Vertritt, Schwebstoffe) und Steganlagen (Verschattung). Die<br />
Habitatsituation ist insgesamt vermutlich suboptimal. Dichte Characeen-<br />
Rasen, wie sie am Westufer des WErbellinsees abschnittsweise vorkommen,<br />
sind daher nicht zu erwarten (vgl. BTU 2001, S. 147).<br />
Das Vorkommen von submersen, d.h. untergetauchten Beständen der<br />
Krebsschere (Stratoides aloides, RL Bbg. 2, BRD 3) ist an geschützten, ungenutzten<br />
Flachwasserbereichen vor Altenhof ebenfalls nicht auszuschließen.<br />
Die Habitatbedingungen für die in der Normalform schwimmend vorkommende<br />
Krebsschere sind vor Altenhof eindeutig suboptimal.<br />
10
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
2 Aktuelle Flächennutzungen und Konflikte<br />
2.1 Landschaftsbild und Erholungsnutzung<br />
Die Fremdenverkehrsfunktion Altenhofs ist innerhalb der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong><br />
von überlokaler Bedeutung. Altenhof ist mit seiner touristischen Infrastruktur<br />
überwiegend auf Tagesgäste gesetzten Alters ausgerichtet. In den<br />
Sommermonaten frequentieren darüber hinaus Familien und Jugendliche<br />
die Seebadestellen Altenhofs.<br />
2.1.1 Landschaftsbildbewertung<br />
2.1.1.1 Ortslage<br />
Die ästhetische Relevanz des Ortes Altenhof begründet sich einerseits auf<br />
der unmittelbaren Lage am Werbellinsee und die beeindruckenden Ausblicke<br />
über den See. Darüber hinaus ist Altenhof in eine reizvolle Waldlandschaft<br />
eingebettet mit der Hangkante des Werbellinsees als visueller Dominante.<br />
Die Dorfstruktur selbst ist überwiegend vorstädtisch überprägt. Ein<br />
historisch gewachsener Dorfmittelpunkt ist nur mit Mühe im Bereich des<br />
zentralen Parkplatzes auszumachen. Es überwiegen vorstädtische Einzelhausbebauungen<br />
mit villenartigem Charakter im Südwesten und Wochenendhauscharakter<br />
im nordöstlichen Bereich. Koniferen in den Vorgärten und<br />
als Begrenzung zur Uferpromenade verstärken die relative Beliebigkeit des<br />
Ortsbildes.<br />
2.1.1.2 Gemarkung<br />
Die Gemarkung Altenhof zeichnet sich durch eine Landschaftscharakteristik<br />
aus, die der regionaltypischen Ausbildung der Kulturlandschaft der <strong>Schorfheide</strong><br />
in besonderer Weise gerecht wird. Das Zusammenspiel von naturnahen<br />
Wäldern und der weiträumiger, aber nicht ausgeräumter Agrarlandschaft<br />
eröffnet reizvolle visuelle Naturerlebnisse. Von besonderer Bedeutung<br />
sind die beeindruckenden Raumwirkungen, die die Raumkanten der Waldränder,<br />
der Allee entlang der L 238 und der Baumhecke entlang des Feldweges<br />
an der südlichen Gemarkungsgrenze. Das leicht bewegte Relief der<br />
Ackerflächen unterstützt die Raumbildung, die durch das Verdecken und<br />
Freigeben von Raumeinblicken die Neugierde des Betrachters weckt.<br />
Störende Elemente sind forstliche Monokulturen auf Kahlschlagsflächen, die<br />
allerdings durch die überwiegende Einbettung in naturnähere Waldsäume<br />
visuell von geringer negativer Auswirkung sind.<br />
Die klare Raumkonturierung wird stark durch Splittersiedlungen entlang des<br />
südlichen Waldrandes beeinträchtigt. Hierzu zählt auch eine von einer dominanten<br />
Zaunanlage eingefasste Ruderalfläche an der südwestlichen Gemarkungsgrenze.<br />
Die Lärmemmissionen der Bundesautobahn A 11 sind im äußersten Südwesten<br />
der Gemarkung noch wahrnehmbar und beeinträchtigen die Erholungseignung<br />
in diesem Bereich leicht.<br />
2.1.2 Landschaftsbezogene Erholungsinfrastruktur<br />
Die Gemarkung Altenhof ist v.a. am Werbellinsee und innerhalb der Waldflächen<br />
mit Wanderwegen, Radwanderwegen und Kremserrouten recht gut<br />
für die Naherholungsnutzung erschlossen. Bedeutsamste Wegeverbindungen<br />
ist der Uferweg entlang des Südufers des Werbellinsees, der in Altenhof<br />
in die Uferpromenade übergeht und hier die touristische Kernnutzung des<br />
Ortsteils konzentriert.<br />
Touristisch relevant ist darüber hinaus die ursprünglich als Radweg konzipierte<br />
Verbindung zwischen Altenhof und Eichhorst, die allerdings relativ<br />
11
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
stark von Kraftfahrzeugen frequentiert wird und entsprechend nur eingeschränkt<br />
nutzbar ist. Zusätzlich fehlt eine attraktive Fortführung der Verbindung<br />
Richtung Joachimsthal.<br />
Die Offenlandbereiche südlich von Altenhof sind fußläufig kaum erschlossen.<br />
Der grundsätzlich attraktive Feldweg an der südlichen Gemarkungsgrenze<br />
ist als Rundweg nur über die viel befahrene L 238 nutzbar. Der fehlende<br />
Anschluss an das Wegenetz an dieser Stelle reduziert die Attraktivität<br />
der Wegebeziehungen für ganz Altenhof, da Erholungssuchende mit Start-<br />
Ziel in Altenhof auf allen Routen immer gezwungen sind, auf Hin- und<br />
Rückweg gleiche Wegstrecken zurückzulegen, wenn sie die L 238 meiden<br />
wollen.<br />
Die Kremserroute Werbellin-Joachimsthal tangiert Altenhof nur randlich über<br />
die L 238 und „Unter den Buchen“. Eine Haltestelle in der eigentlichen Ortslage<br />
fehlt.<br />
Außerhalb der Ortslage befinden sich keine weiteren Einrichtungen der<br />
landschaftsbezogenen Erholungsnutzung.<br />
Entlang der Uferpromenade bestehen Sitzmöglichkeiten, gestaltete Plätze<br />
und zwei Liegewiesen mit Seebad.<br />
2.2 Siedlungsentwicklung<br />
2.2.1 Bestehende Siedlungen<br />
Bestehende Siedlungsnutzungen genießen Bestandsschutz, soweit Ihre<br />
Errichtung nicht bereits zum Zeitpunkt der Errichtung rechtswidrig erfolgt ist.<br />
Entsprechend entwickeln die nachfolgenden Feststellungen praktische Konsequenz<br />
nur, wenn bestehende Nutzungen aufgegeben werden.<br />
Konflikte mit dem Schutzgut „Landschaftsbild“ rufen die Splittersiedlungen<br />
am Feldweg „Unter den Buchen“ hervor. Sie beeinträchtigen die klare<br />
Raumstrukturierung und durchbrechen die Hangkante des Werbellinsees mit<br />
seiner Waldbestockung als natürliche Siedlungsgrenze Altenhofs. Die Zersiedelung<br />
der Landschaft ist hier weithin sichtbar.<br />
Der rechtskräftige Bebauungsplan Nr. 2 sieht eine Wohnbebauung westlich<br />
der L 238 entlang des Weges „Unter den Buchen“ zwischen den beiden bestehenden<br />
Splittersiedlungen vor. Die Wohnbebauung umfasst den gesamten<br />
bislang als Weideland genutzten Bereich. Damit gehen erhebliche Eingriffe<br />
in das Landschaftsbild einher. Der bisher raumdominante Waldrand<br />
geht als visuelle Komponente verloren. Dies gilt gleichermaßen für die Naturerlebnisfunktion<br />
der Weidetiere Die biotisch wertvollen Waldsaumbiotope<br />
gehen durch den Ausbau des Weges „Unter den Buchen“ und die Zunahme<br />
der anthropogenen Nutzungsintensität verloren. Die Weideflächen sind für<br />
die Grundwasserneubildung von besonderer Bedeutung. Diese Funktion<br />
wird erheblich beeinträchtigt. Der Grünordnungsplan zum Bebauungsplan<br />
Nr. 2 kommt zum Ergebnis, dass die festgestellten Eingriffe durch Vermeidungsmaßnahmen<br />
(Versickerung von Oberflächenwasser), die Eingrünung<br />
des Wohngebietes und weiterer Ersatzmaßnahmen außerhalb des Geltungsbereichs<br />
ausgleichbar bzw. ersetzbar sind. Hauptmaßnahme außerhalb<br />
des Geltungsbereichs ist die Anlage einer Streuobstwiese am Südwestrand<br />
des Wohngebietes und die Vornahme von Strauchpflanzungen entlang<br />
des Feldweges an der südöstlichen Gemarkungsgrenze sowie auf Ackerflächen<br />
zwischen der L238 und der Gemarkungsgrenze. Durch diese Maßnahmen<br />
ist allerdings die vollständige Eingrünung des Wohngebietes nicht<br />
12
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
gewährleistet, da die anzulegende Streuobstwiese nur knapp der Hälfte des<br />
Siedlungsrandes vorgelagert wird.<br />
Entlang des Werbellinsees grenzen Einzelbebauungen teilweise unmittelbar<br />
an die Uferlinie. Außerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile besteht<br />
ein gesetzliches Bauverbot in einem Abstand von 50 m zur Uferlinie.<br />
Im Bereich der südlichen Dorflage ist darüber hinaus der Seezugang öffentlich<br />
nicht zugänglich und damit dem Naturerlebnis nur privaten Nutzern möglich.<br />
Private Eigentümer unterhalten hier teilweise großzügige Bootsanlegestellen<br />
und Ziergärten im Uferbereich, die eine erhebliche Beeinträchtigung<br />
der biotischen Potentiale darstellen.<br />
Nach Nordosten erstreckt sich zwischen Ortskern und dem Gelände der EJB<br />
ein Siedlungsbereich, der Waldflächen als Standort von Wochenendhäusern,<br />
Ferienlagern und größeren Einzelobjekten nutzt. Die planmäßige Entwicklung<br />
dieses Bereiches ist nicht zu erkennen, die Zersiedelung der Waldflächen<br />
führt zu nachhaltigen Beeinträchtigungen der biotischen Potentiale.<br />
2.2.2 Geplante Siedlungsentwicklungen<br />
Die aufgestellten oder im Aufstellungsverfahren befindlichen Bebauungspläne<br />
befinden sich mit Ausnahme des Bebauungsplanes Nr. 2 in unmittelbarer<br />
Nähe der im Zusammenhang bebauten Ortsteile von Altenhof.<br />
B-Plan Nummer 29 „Steganlage“.<br />
Entwicklungsziele<br />
Das Vorhaben schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die<br />
landseitige Entwicklung von Ver- und Entsorgungsinfrastruktur für eine<br />
kommunale Steganlage im Werbellinsee außerhalb des Geltungsbereichs<br />
des B-Planes.<br />
Konflikte<br />
Mit dem Vorhaben sind Eingriffe in das Schutzgut Boden durch die<br />
Versiegelung von 1.100 m² Fläche sowie das Schutzgut Landschaftsbild<br />
verbunden. Das Landschaftsbild wird einerseits durch die Anlage von<br />
technischer Infrastruktur, Versorgungsgebäuden und Verkehrsanlagen in<br />
einer attraktiven, intensiv zur naturbezogenen Naherholung genutzten<br />
Parkanlage beeinträchtigt. Andererseits erfolgt eine mit den Anforderungen<br />
der ruhigen Naturerholung nicht vereinbaren Nutzungsänderung und –<br />
Intensivierung durch die Erschließung des Plangebietes für den Kfz-Verkehr.<br />
Hierdurch kommt es zudem zu Verlusten von gemäß Brandenburgischer<br />
Baumschutzverordnung zu erhaltener Bäumen.<br />
Kompensation<br />
Während die Eingriffe in das Schutzgut Boden durch Entsiegelungsmaßnahmen<br />
im Umfang von 1.100 m² außerhalb des Geltungsbereichs kompensierbar<br />
sind, sind die Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes und der<br />
Erholungsvorsorge nur teilweise ausgleichbar.<br />
B-Plan Nummer 30 „Badewiese“.<br />
Entwicklungsziele<br />
Das Vorhaben schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die<br />
landseitige Entwicklung von Ver- und Entsorgungsinfrastruktur für eine öffentliche<br />
Badewiese am Werbellinsee.<br />
13
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Konflikte<br />
Mit dem Vorhaben sind Eingriffe in das Schutzgut Boden und das Schutzgut<br />
Arten- und Biotopschutz durch die Versiegelung von 500 m² Fläche verbunden.<br />
Kompensation<br />
Die Anlage zweier zusätzlicher gastronomischer Einrichtungen an der Badewiese<br />
kann durch die Entsiegelung von 500 m² versiegelter Bodenflächen<br />
außerhalb des Plangebietes kompensiert werden.<br />
2.3 Verkehr<br />
Die Landesstraße 238 erschließt die Gemarkung Altenhof. Das Verkehrsaufkommen<br />
ist insbesondere in den Sommermonaten und an den Wochenenden<br />
relativ hoch. Die Zerschneidungswirkung der L 238 ist im Bereich<br />
der Gemarkung Altenhof gering, da sie ausschließlich durch die Feldflur<br />
und die Ortslage Altenhofs führt. Es bestehen nicht näher konkretisierte<br />
Überlegungen, eine Ortsumfahrung Altenhofs zu projektieren.<br />
Das hohe Besucheraufkommen führt in Altenhof zu teilweise erheblichen<br />
Beeinträchtigungen der Wohn- und Erholungsfunktion durch Parksuchverkehr.<br />
Die zentralen Parkplätze sind teilweise qualifiziert und in ein Parkleitsystem<br />
eingebunden worden.<br />
Die als Radwegeverbindung projektierte Straße zwischen Altenhof und<br />
Eichhorst wird stark von Kfz-Verkehr beansprucht. Die Erholungswirkung<br />
und Naturerlebniswirkung der Strecke wird dadurch bedeutend gemindert,<br />
zumal die Straße aufgrund des geringen Querschnitts, des bewegten Reliefs<br />
und der Kurvenführung das Überholen von Radfahrern durch Kraftfahrzeuge<br />
zu einem für alle Beteiligten beschwerlichen Vorgang macht. Neben den<br />
Belastungen der Erholungsfunktion erschließt die Verbindung naturnahe<br />
Waldgebiete für den Kraftfahrzeugsverkehr und bedingt dadurch Zerschneidungseffekte<br />
insbesondere für die Wanderbewegungen von Lurchen zwischen<br />
Sommer- und Winterlebensräumen.<br />
Der Werbellinsees ist Bundeswasserstraße. Es besteht die Gefahr, dass mit<br />
zunehmendem Motorbootverkehr die Wasserverschmutzung in einem Maß<br />
zunimmt, das die auf nährstoffarme Klarwasserbedingungen angewiesene<br />
Kleine Maräne langfristig im Besand gefährdet werden könnte. Durch den<br />
Status als Bundeswasserstraße ist eine Regulierung des Motorbootverkehrs<br />
erheblich erschwert.<br />
2.4 Ver- und Entsorgung<br />
Die Belange der Ver- und Entsorgung werden im Rahmen dieser Voruntersuchung<br />
nicht bearbeitet.<br />
2.5 Landwirtschaft/Fischerei<br />
Südlich der Ortslage Altenhofs liegt ein Wasserschutzgebiet. Die intensive<br />
ackerbauliche Nutzung auf den sorbtionsschwachen, anlehmigen Sandböden<br />
gefährdet die Qualität des Grundwassers und damit des Werbellinsees,<br />
der die Vorflut für die landwirtschaftliche Entwässerung der Britzer Platte mit<br />
entsprechend hohen Nährstoffeinträgen aufnimmt.<br />
Die großräumigen Ackerschläge südlich der Gemarkung Altenhof sind durch<br />
ihre feinsandige Bodenstruktur der Winderosion verstärkt ausgesetzt. Es<br />
kommt zu Verfrachtungen des Oberbodens, die das biotische Ertragspotential<br />
der Ackerflächen reduzieren und in angrenzenden Biotopstrukturen (ins-<br />
14
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
besondere Wald- und Gehölzstrukturen) zu unerwünschten<br />
Nährstoffanreicherungen führen.<br />
2.6 Forstwirtschaft und Jagd<br />
Der insbesondere in den östlichen Forstflächen in Teilbereichen praktizierte<br />
Kahlschlagsbetrieb mit Aufforstungen nicht standortgemäßer und/oder nicht<br />
heimischer Baumarten in Monokultur stellt eine wesentliche Beeinträchtigung<br />
der biotischen und landschaftsästhetischen Potentiale dar.<br />
Als ehemaliges herrschaftliches Jagdrevier weist die gesamte <strong>Schorfheide</strong><br />
überhöhte Schalenwildbestände auf. In Verbindung mit fehlenden natürlichen<br />
Prädatoren (Wolf, Luchs, Braunbär) ist die Naturverjüngung von Laubhölzern<br />
dadurch erheblich beeinträchtigt und erschwert eine naturnahe<br />
Waldbewirtschaftung.<br />
3 Landschaftspflegerisches Entwicklungskonzept (Altenhof)<br />
3.1 Vorgaben aus Fachplanungen des Natur- und Landschaftsschutzes<br />
3.1.1 Landschaftsprogramm<br />
3.1.1.1 Boden<br />
Die Böden der Gemarkung Altenhof werden als überwiegend sorptionsschwach<br />
und durchlässig bezeichnet. Die land- und forstwirtschaftliche<br />
Bewirtschaftung soll zum Schutz der biotischen Ertragskraft und der Filterfunktion<br />
des Bodens gegen eindringende Schadstoffe in das Grundwasser<br />
bodenschonend erfolgen. Forstwirtschaftliche Flächen solle zu möglichst<br />
naturnahen Wäldern entwickelt werden.<br />
3.1.1.2 Wasser<br />
Zur Sicherung der Grundwasserbeschaffenheit unter den durchlässigen<br />
Deckschichten der Gemarkung sind Waldflächen zu erhalten und landwirtschaftliche<br />
Nutzungsintensitäten den Erfordernissen der Grundwasserreinhaltung<br />
anzupassen. Die landwirtschaftlichen Flächen werden als Gebiete<br />
mit überdurchschnittlicher Grundwasserneubildungsrate definiert. Der<br />
Grundwasserschutz hat hier Priorität. Maßnahmen, die zu einer Reduzierung<br />
der Grundwasserneubildung führen, sind zu vermeiden.<br />
3.1.1.3 Klima und Luft<br />
Der Landschaftsrahmenplan trifft keine klimabezogenen Aussagen für die<br />
Gemarkung Altenhof.<br />
3.1.1.4 Arten- und Biotopschutz<br />
Die naturnahen Laub- und Mischwälder sollen geschützt werden. In den ackerbaulich<br />
genutzten Flächen sollen die charakteristischen Landschaftselemente<br />
erhalten bzw. wieder eingebracht werden und die Stoffeinträge<br />
aus Düngung und Biozideinsatz reduziert werden.<br />
3.1.1.5 Landschaftsbild und Erholung<br />
Der hochwertige Eigencharakter der Waldflächen ist zu schützen und zu<br />
pflegen. Dazu gehören insbesondere die Vermeidung von Zersiedelung und<br />
die Zerschneidung durch Verkehrstrassen. Damit wird der Erhalt der besonderen<br />
Erlebnisqualität der Landschaft in der Gemarkung Altenhof gesichert.<br />
Die gesamte Gemarkung ist als Schwerpunktraum der Erholungsnutzung<br />
ausgewiesen.<br />
15
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Für den Werbellinsee gilt, dass die Erholungsnutzung in ihrer Ausdehnung<br />
und Intensität mit den Zielen des Natur- und Landschaftsschutzes abzustimmen<br />
ist.<br />
3.1.1.6 Biosphärenreservat <strong>Schorfheide</strong>-Chorin<br />
Altenhof liegt vollständig innerhalb der Schutzzone III des Biosphärenreservates<br />
<strong>Schorfheide</strong>-Chorin (Zone der wirtschaftlich genutzten harmonischen<br />
Kulturlandschaft). Die Schutzzone III ist als Landschaftsschutzgebiet rechtlich<br />
gesichert. Die Schutzgebietsverordnung (MUNRE 1990) enthält eine<br />
Reihe von Ge- und Verboten, die auf den Ortsteil Altenhof anzuwenden sind:<br />
§ 5 Gebote, Absatz 1, Nummern:<br />
3) Die Landschaft ist schrittweise als ökologischer Landbau zu entwickeln.<br />
5) Die Ackerflächen entlang von Seeufern sind in einer Breite von mindestens<br />
100 m in extensiv zu bewirtschaftendes Grünland umzuwandeln.<br />
6) 6. Zur Schonung der Schilfbestande ist beim Befahren der Gewässer<br />
und beim Angeln ein Mindestabstand von 20 m einzuhalten.<br />
8) Die Bestandsregulierung von Tierarten ist entsprechend der Zielstellung<br />
für das Biosphärenreservat in den Schutzzonen I und II nach<br />
Maßgabe und in der Schutzzone III im Einver-nehmen mit der Reservatsverwaltung<br />
vorzunehmen.<br />
9) Die jagdlichen Einrichtungen sind auf das notwendige Maß zurückzuführen<br />
und in das Landschaftsbild einzufügen. Ein- zelheiten werden<br />
die Pflege- und Entwicklungspläne regeln.<br />
11) Alte Einzelbäume (Überhälter) sind soweit freizustellen, dass ein weiteres<br />
Überleben gesichert ist.<br />
12) Ästhetisch auffällige oder ungewöhnlich gestaltete Bäume sind als<br />
Überhälter auszuwählen.<br />
13) Die land- und forstwirtschaftliche Nutzung richtet sich nach den Pflege-<br />
und Entwicklungsplänen. Die Forsteinrichtung hat sich nach den<br />
Pflege- und Entwicklungsplänen zu richten.<br />
Absatz 2:<br />
Auf den devastierten, ackerbaulich und forstwirtschaftlich genutzten Flächen<br />
der Britzer Platte … ist durch geeignete wissenschaftlich begleitete<br />
Maßnahmen die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts wiederherzustellen.<br />
Absatz 3:<br />
Für die Benutzung der Wasserstraßen über die Berufs-schifffahrt hinaus<br />
ist ein Benutzungskonzept zu erstellen.<br />
§ 6 Verbote, Absatz 1, Nummern:<br />
Im Biosphärenreservat ist es verboten,<br />
1) bauliche Anlagen außerhalb der im Zusammenhang bebauten<br />
Ortsteile oder des Geltungsbereiches rechtskräftiger Bebauungspläne<br />
zu errichten oder zu erweitern; ausgenommen sind Melkstände,<br />
Viehunterstände, Viehtränken, ortsübliche Weidezäune sowie baugenehmigungsfreie<br />
Vorhaben im Haus- und Hofbereich, forstliche<br />
Kulturzäune, Wildfuttersteilen und Jagdsitze; darüber hinaus kann die<br />
Neuansiedlung von landwirtschaftlichen Betrieben im Einvernehmen<br />
mit der Leitung des Biosphärenreservats zugelassen werden.<br />
2) Motorfahrzeuge aller Art, Anhänger, Wohnwagen, Kutschen außerhalb<br />
der befestigten Wege, Park- oder Stellplätze oder Hofräume zu<br />
führen oder abzustellen; ausgenommen sind der land- oder forstwirt-<br />
16
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
schaftliche Verkehr sowie der Wartungsdienst für Ver- und Entsorgungsanlagen,<br />
3) jeglicher Motorsport- und Modellsportbetrieb,<br />
4) außerhalb öffentlicher Straßen und Wege und der besonders dafür<br />
gekennzeichneten Wege oder der Feuerschutzstreifen zureiten,<br />
5) die Gewässer mit Fahrzeugen aller Art zu befahren; ausgenommen<br />
ist das Fahren mit nichtmotorbetriebenen -Wasserfahrzeugen auf<br />
dem Werbellinsee …<br />
6) außerhalb der gekennzeichneten Stellen zu baden,<br />
7) nicht heimische Tierarten in die Gewässer einzusetzen und Fische<br />
anzufüttern.<br />
8) vom 1. Februar bis 31. Juli eines jeden Jahres … im Umkreis von<br />
150 m um die Fortpflanzungs- und Vermehrungsstätten anderer vom<br />
Aussterben bedrohter Tierarten ohne Genehmigung der Reservatsverwaltung<br />
Wirtschafts- oder Pflegemaßnahmen durchzuführen,<br />
9) Fischintensivhaltungen ...<br />
10) Kahlhiebe anzulegen anzulegen (Saum- und Femelhiebe sowie Hiebe<br />
bis zu 0,3 ha gelten nicht als Kahlhiebe),<br />
11) die Erstaufforstung sowie die Wiederaufforstung mit nicht heimischen<br />
Baumarten …<br />
12) Forstwirtschaftswege neu anzulegen oder in eine höhere Aus- baustufe<br />
zu überführen,<br />
13) Holzrücken mit Fahrzeugen außerhalb der Wege und Rücke- gassen,<br />
14) die Bodengestalt zu verändern,<br />
15) Meliorationsmaßnahmen durchzuführen (ausgenommen sind Maßnahmen<br />
auf Grund von Pflege- und Entwicklungsplänen),<br />
17) Anlagen des Luftsports zu errichten, mit Fluggeräten zu star-ten oder<br />
zu landen,<br />
18) Ufergehölze, Röhricht- oder Schilfbestände, Büsche, Feld-hecken,<br />
Wallhecken, Feldgehölze, Einzelbäume, Baumreihen, Alleen oder<br />
Baumgruppen außerhalb des Waldes zu roden oder zu beschädigen;<br />
ausgenommen sind Pflegemaßnahmen und unvermeidbare Maßnahmen<br />
zur Unterhaltung der Wege und Gewässer,<br />
19) im übrigen alle Handlungen, die den Charakter des Gebietes verändern<br />
oder dem Schutzzweck zuwiderlaufen.<br />
Die Entwicklungsziele des Biosphärenreservates werden im Landschaftsrahmenplan<br />
und den Pflege- und Entwicklungsplänen definiert. Für Altenhof<br />
sind nachfolgende Ziele des Landschaftsrahmenplanes von Relevanz:<br />
Arten- und Biotopschutz<br />
• Erhalt und langfristige Ausweitung von Alt- und Totholzvorkommen<br />
als Lebensräume für Höhlenbrüter und holzbewohnende Insekten.<br />
• Förderung der naturnahen forstlichen Nutzung und des ökologischen<br />
Waldumbaus.<br />
• Erhalt von Offenlandschaften im Wald durch Verzicht auf Aufforstungen.<br />
• Förderung des Biotopverbundes von Wald- und Offenlandbiotopen.<br />
• Erhalt weitgehend ungestörter Bereiche als Rückzugsraum empfindlicher<br />
Tierarten durch Besucherlenkung und Gestaltung des Wegenetzes.<br />
• Die Lebensraumfunktion ackerbaulich genutzter Flächen soll durch<br />
eine teilweise Extensivierung der Nutzung verbessert werden.<br />
• Entwicklung ungestörter Laich- und Uferzonen am Werbellinsee.<br />
17
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Boden, Wasser, Klima<br />
• Schutz des Reliefs, insbesondere markanter Hangkanten.<br />
• Förderung erosionsmindernder und ressourcenschonender landwirtschaftlicher<br />
Bewirtschaftung.<br />
• Schutz der Wasserqualität des Werbellinsees durch Vermeidung von<br />
Nährstoffeinträgen.<br />
• Schutz der Uferbereiche des Werbellinsees vor Sog und Wellenschlag<br />
durch Einschränkung bzw. Verbot des Motorbootverkehrs.<br />
Tourismus und Naherholung<br />
• Der Werbellinsee und hier speziell der Ortsteil Altenhof stellen einen<br />
wesentlichen Schwerpunkt der touristischen und Naherholungsnutzung<br />
des Biosphärenreservates dar. Die Erholungsinfrastruktur Altenhofs<br />
für den Wasser- und Bootssport ist einschließlich notwendiger<br />
Ver- und Entsorgungsanlagen zu entwickeln.<br />
• Im Rahmen detaillierter Nutzungskonzeptionen soll ein verträgliches<br />
Nebeneinander von Naturschutz und Erholung ermöglicht werden.<br />
• Realisierung grünordnerischer Maßnahmen zur landschaftsgerechten<br />
Einbindung von Splittersiedlungen.<br />
• Verbesserung des Informationsangebotes.<br />
• Förderung der Vermarktung regionaler Fischereiprodukte.<br />
• Konzentration des Angel-, Boots- und Badebetriebes auf (Sammel)-<br />
Steganlagen.<br />
• Der Werbellinsee soll seines Status als Bundeswasserstraße enthoben<br />
werden.<br />
Siedlungen<br />
• Förderung der Innenverdichtung und Unterbindung weiterer Zersiedelung<br />
des Außenbereichs.<br />
Der Pflege- und Entwicklungsplan des Biosphärenreservates <strong>Schorfheide</strong>-<br />
Chorin bestimmt für einige der oben genannten Ziele des Landschaftsrahmenplanes<br />
weitergehende Konkretisierungen:<br />
• Beendigung der Fäkalieneinleitung durch die Fahrgast- und Sportschiffahrt.<br />
• Erhalt extensiver Fischerei ohne Netzkäfighaltung auf dem Werbellinsee.<br />
• Förderung der naturnahen Waldentwicklung durch Reduktion der<br />
Schalenwildbestände bzw. Zäunung besonders gefährdeter Waldbereiche<br />
und Naturverjüngung.<br />
• Erhalt der Erlenbruchwälder als Biotopverbundstrukturen.<br />
3.1.1.7 FFH-Gebiet 347 „Werbellinkanal“<br />
Das FFH-Gebiet 347 „Werbellinkanal“ verläuft außerhalb des Ortsteils Altenhof<br />
entlang der Uferlinie des Werbellinsees. Aufgrund der unmittelbaren<br />
Grenzlage ist davon auszugehen, dass zumindest Teile des Ortsteils Altenhof<br />
für die Erhaltungsziele des FFH-Gebietes relevant sind. Damit können<br />
Projekte in Altenhof unter Umständen trotz Lage außerhalb des<br />
Schutzgebietes negative Auswirkungen auf die Schutzzwecke des FFH-<br />
Gebietes haben und daher als FFH-unverträglich einzustufen sein.<br />
Der Schutzzweck des FFH-Gebietes ergibt sich zum einen aufgrund seiner<br />
Bedeutung als wichtiges Element im Biotop-Verbund Oder, Havel und Havel-Seengebiete<br />
und zum anderen aus den im Gebiet signifikant vorkommenden<br />
Lebensraumtypen und Arten nach Anhang I und II der FFH-<br />
Richtlinie (RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFT 1992). Im FFH-<br />
18
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Gebiet „Werbellinkanal“ kommen signifikant folgende Lebensraumtypen<br />
nach Anhang I der FFH-Richtlinie vor:<br />
• Oligo- bis mesotrophe Gewässer mit benthischer Vegetation aus<br />
Armleuchteralgen (32 % Anteil),<br />
• Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation vom Typ Magnopotamion<br />
oder Hydracharition (14 %)<br />
• Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen<br />
Stufe (1 %)<br />
• Übergangs- und Schwingrasenmoore (1 %)<br />
• Hainsimsen-Buchenwälder (12 %)<br />
• Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (2 %)<br />
Damit sind die Buchenwälder und die Erlenbruchwälder des Ortsteils Altenhof<br />
als FFH-relevant einzustufen.<br />
Im FFH-Gebiet „Werbellinkanal“ kommen darüber hinaus signifikant folgende<br />
Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie vor:<br />
• Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)<br />
• Großes Mausohr (Myotis myotis)<br />
• Biber (Castor fiber)<br />
• Fischotter (Lutra lutra)<br />
• Rotbauchunke (Bombina bombina)<br />
• Kammmolch (Triturus cristatus)<br />
• Rapfen (Aspius aspius)<br />
• Steinbeißer (Cobitis taenia)<br />
• Bitterling (Rhodeus sericeus amarus)<br />
• Schmale Windelschnecke (Vertigo angustior)<br />
• Bauchige Windelschnecke (Vertigo moulinsiana)<br />
• Große Moosjungfer (Leucorrhinia pectoralis)<br />
Mit Sommerquartieren von Mopsfledermaus und Großem Mausohr ist in<br />
Altbäumen der angrenzenden Wälder und Forsten zu rechnen.<br />
Für den Kammmolch bieten die strukturreichen Waldbiotope Altenhofs geeignete<br />
Sommer- und Winterhabitate.<br />
Für Biber und Fischotter sind die Ufer des Werbellinsees im Abschnitt Altenhof<br />
von gewisser Funktion als Biotopverbindung. Allerdings schränkt die<br />
intensive anthropogene Nutzung der Ufer in Altenhof die Habitatbedeutung<br />
erheblich ein.<br />
Für die aquatischen Tierarten ist der Werbellinsee außerhalb des Gebietes<br />
der <strong>Gemeinde</strong> <strong>Schorfheide</strong> von Bedeutung.<br />
3.2 Leitlinien und Maßnahmen für die Ortsteilentwicklung<br />
Die Leitlinien- und Maßnahmen für den Ortsteil Altenhof ergeben sich aus<br />
den Vorgaben der übergeordneten Fachplanungen des Natur- und Landschaftsschutzes<br />
und den im Rahmen der Analyse des Zustandes des lokalen<br />
Naturhaushaltes ermittelten, ortsteilspezifischen Notwendigkeiten.<br />
Leitlinie für die Ortsteilentwicklung ist das verträgliche Miteinander von landschaftsbezogener<br />
Erholungsnutzung und der Erhalt und Entwicklung der<br />
lokalen Potentiale des Arten- und Biotopschutzes.<br />
Die trotz bestehender Beeinträchtigungen weiterhin hohe Naturerlebnisfunktion<br />
im Ortsteil Altenhof ist die wesentliche Grundlage für die qualifizierte<br />
19
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
und nachhaltige Entwicklung des Fremdenverkehrs als eine der bedeutenden<br />
wirtschaftlichen Entwicklungspotentiale Altenhofs.<br />
Nachfolgend werden für die einzelnen Schutzgüter die notwendigen Maßnahmen<br />
dargestellt. Diese sind als direkte Umsetzung der unter Punkt<br />
4.1.1.6 als relevant eingestuften Entwicklungsleitlinien des Landschaftsrahmenplanes<br />
des Biosphärenreservates <strong>Schorfheide</strong>-Chorin bzw. des Pflege-<br />
und Entwicklungsplanes für den Teilraum „Werbellinseegebiet“ zu verstehen.<br />
Diese Leitlinien werden nachfolgend daher nicht erneut dargestellt.<br />
Die Mehrheit der vorgeschlagenen Maßnahmen hat positive Auswirkungen<br />
auf mehrere Schutzgüter. Die Zuordnung der Maßnahmen zu einzelnen<br />
Schutzgütern ist als Hinweis auf die Hauptwirkungsrichtung zu begreifen.<br />
Die Verortung der Maßnahmen ist in der Karte „K4 Sicherung und Entwicklung<br />
von Natur und Landschaft“ übersichtlich nachzuvollziehen. Auf eine<br />
verbale Verortung wird in der Maßnahmenbeschreibung daher verzichtet.<br />
3.2.1 Arten- und Biotopschutz<br />
3.2.1.1 Sicherungsmaßnahmen:<br />
Maßnahme S1:<br />
Erhalt naturnaher Waldbestände mit hohem Alt- und Totholzanteil im Rahmen<br />
der nachhaltigen forstlichen Nutzung.<br />
Ziele:<br />
• Sicherung und langfristige Ausweitung von Alt- und Totholzvorkommen<br />
als Lebensräume für Höhlenbrüter und holzbewohnende Insekten.<br />
Maßnahme S2:<br />
Soweit Altbäume im Rahmen der forstlichen Nutzung eingeschlagen werden<br />
sollen, sind die Altbäume auf das Vorhandensein von Wochenstuben v. Fledermäusen<br />
oder Bruthöhlen des Eremits zu überprüfen. Altbäume mit derartigen<br />
Lebensstätten sollen erhalten bleiben.<br />
Ziele:<br />
• Erhalt von Fledermaus- und Eremit-Populationen im Ortsteil.<br />
Maßnahme S3:<br />
Die Feldgehölze und Allen des Ortsteils sind zu erhalten. Maßnahmen, die<br />
zu einer Beeinträchtigung dieser Landschaftsgehölze führen sind zu unterlassen.<br />
Ziele:<br />
• Sicherung der Lebensraumfunktionen der Feldhecken für Kleinsäuger,<br />
Singvögel und Insekten.<br />
• Sicherung der landschaftsästhetisch bedeutsamen Raumbildungsfunktion<br />
der Hecken und Alleen.<br />
Maßnahme S4:<br />
Erhalt unverbauter Uferbereiche und Röhrichte am Werbellinsee.<br />
Ziele:<br />
• Sicherung der Lebensraumfunktionen der Röhrichte für Fische und<br />
Amphibien.<br />
20
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
• Sicherung des Ufers vor Erosion durch Sog und Wellenschlag (Motorbootverkehr).<br />
• Sicherung der landschaftsästhetischen Funktionen und Naturerlebnispotentiale<br />
naturnaher Uferabschnitte<br />
Maßnahme S5:<br />
Vermeidung baulicher Entwicklungen in siedlungsnahen Wäldern.<br />
Ziele:<br />
• Sicherung der Lebensraumfunktionen naturnaher Buchenwälder für<br />
Kleinsäuger, Fledermäuse und Singvögel<br />
• Sicherung der landschaftsästhetischen Funktionen und Naturerlebnispotentiale<br />
naturnaher Waldstrukturen.<br />
4.2.1.2 Entwicklungsmaßnahmen:<br />
Maßnahme M1:<br />
Anlage eines mindestens 30 m tiefen Waldmantels durch Zäunung und<br />
Pflanzung von standortgemäßen, heimischen Baum- und Straucharten gemäß<br />
Pflanzliste (Leitart: Mittelspecht).<br />
Ziele:<br />
• Pufferfunktion für Waldbestände gegenüber Ackerflächen.<br />
• Ausweitung von Grenzlinien an Saumbiotopen mit Entwicklung vielfältiger<br />
Habitatstrukturen für eine Vielzahl von Tier- und Pflanzenarten.<br />
• Landschaftsästhetische Aufwertung durch strukturreiche und naturnahe<br />
Raumübergänge.<br />
Maßnahme M2:<br />
Anlage von Baumhecken beidseitig an Wegen durch Zäunung und Pflanzung<br />
von standortgemäßen, heimischen Baum- und Straucharten gemäß<br />
Pflanzliste .<br />
Ziele:<br />
• Ausweitung von Grenzlinien an Saumbiotopen mit Entwicklung<br />
Rückzugs- und Trittsteinbiotopen innerhalb ausgeräumter Agrarlandschaften<br />
zur Stärkung der individuellen Regeneration von Tieren der<br />
Agrarlandschaft und Verbesserung der Reproduktionsmöglichkeit<br />
von Tierpopulationen durch stabile (Brut-)Habitate (Leitart: Grauammer).<br />
• Landschaftsästhetische Aufwertung durch die raumbildende Wirkung<br />
linearer Gehölzstrukturen<br />
• Minderung der Erosionsanfälligkeit offener Ackerlandschaften<br />
Maßnahme M3:<br />
Entwicklung gebietsheimischer und standortgerechter Wälder in forstlichen<br />
Monokulturen durch Zäunung und Pflanzung von standortgemäßen, heimischen<br />
Baumarten gemäß Pflanzliste.<br />
Ziele:<br />
• Langfristige Entwicklung naturnaher Biotopstrukturen mit vielfältigen<br />
Lebensräumen für heimische Tier- und Pflanzenarten.<br />
• Beseitigung landschaftsästhetisch beeinträchtigender Fehlnutzungen<br />
und Entwicklung von Naturerlebnisräumen.<br />
21
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
3.2.2 Boden, Wasser, Klima und Luft<br />
3.2.2.1 Entwicklungsmaßnahmen:<br />
Maßnahme M4:<br />
Umwandlung von Ackerflächen auf leichten Sandböden in extensive Weiden<br />
oder Wiesen.<br />
Ziele:<br />
• Schutz winderosionsgefährdeter Böden,<br />
• Schutz angrenzender Buchenwälder vor Nährstoffverfrachtungen mit<br />
entsprechenden Eutrophierungserscheinungen der Kraut- und<br />
Strauchschicht,<br />
• Sicherung der Grundwasserqualität unter quantitativ leistungsfähigen<br />
Grundwasserneubildungsflächen,<br />
• Erschließung zusätzlicher Lebensräume für nutzungssensitive Floren-<br />
und Faunenelemente (Leitart: Grauammer).<br />
Maßnahme M5:<br />
Extensivierung intensiv genutzter Ackerflächen auf leichten Sandböden oder<br />
Umwandlung in Grünlandbewirtschaftung<br />
Ziele:<br />
• Schutz winderosionsgefährdeter Böden,<br />
• Schutz angrenzender Buchenwälder vor Nährstoffverfrachtungen mit<br />
entsprechenden Eutrophierungserscheinungen der Kraut- und<br />
Strauchschicht,<br />
• Sicherung der Grundwasserqualität unter quantitativ leistungsfähigen<br />
Grundwasserneubildungsflächen,<br />
• Erschließung zusätzlicher Lebensräume für nutzungssensitive Floren-<br />
und Faunenelemente (Leitart: Grauammer).<br />
3.2.3 Landschaftsbild, Erholung und Tourismus<br />
3.2.3.1 Sicherungsmaßnahmen<br />
Maßnahme S6:<br />
Erhalt der Grünstrukturen, insbesondere die parkartigen Abschnitte mit altem<br />
Baumbestand des öffentlichen Grünzuges am Werbellinseeufer. Erhalt<br />
der wassergebundenen Wegedecke der Uferpromenade oder Verwendung<br />
regionaltypischer Naturmaterialien bei der Anlage von Pflasterflächen.<br />
Ziele:<br />
• Sicherung der Landschaftserlebnisfunktion der Uferpromenade.<br />
3.2.3.2 Entwicklungsmaßnahmen<br />
Maßnahme M6:<br />
Landschaftsgerechte Einbindung von Splittersiedlungen durch Anlage von<br />
typischen Grünstrukturen gewachsener Siedlungsränder wie Streuobstwiesen,<br />
Feldgehölze, Grabeland. Pflanzung von standortgemäßen, heimischen<br />
Baum- und Straucharten gemäß Pflanzliste oder Obstbaum-Hochstämme.<br />
Ziele:<br />
• Entwicklung von kulturhistorisch bedeutsamen und ästhetisch wirksamen<br />
Landschaftselementen und Gestaltung eines harmonischen<br />
Übergangs von Siedlungsflächen zur freien Landschaft.<br />
• Minderung landschaftsästhetisch beeinträchtigender Fehlnutzungen<br />
(ahistorische Splittersiedlungen).<br />
• Entwicklung von Habitatstrukturen für kulturfolgende Tierarten.<br />
22
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Maßnahme M7:<br />
Anschluss des nördlichen Endes der Uferpromenade an das Waldwegenetz<br />
östlich der Eberswalder Straße.<br />
Ziele:<br />
• Aufwertung der Nutzbarkeit der Uferpromenade durch Ermöglichen<br />
einer attraktiven, landschaftlich abwechslungsreichen Rundwanderweg-Option.<br />
23
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Literaturverzeichnis<br />
BTU 2001 Brandenburgische Technische Universität Cottbus: Dokumentation<br />
von Zustand und Entwicklung der wichtigsten Seen<br />
Deutschlands. Teil 5 Brandenburg. Cottbus 2001<br />
DER RAT DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN 1992: Richtlinie<br />
92/43 EWG des Rates vom 21.Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen<br />
Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen. Amtsblatt<br />
Europäische Gemeinschaft, Reihe L 206: 7-50<br />
EUROPÄISCHES PARLAMANT 2001: Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen<br />
Parlamentes und des Rates über die Prüfung der Umweltauswirkungen<br />
bestimmter Pläne und Programme vom 27.06.2001.<br />
GROTH, B., SEITZ, B., RISTOW, M. 2003: Naturschutzfachlich geeignete<br />
Baum- und Straucharten bei Kompensationsmaßnahmen in der<br />
freien Landschaft in Brandenburg. In: Naturschutz und Landschaftspflege<br />
in Brandenburg 12 (1) 2003, S. 28-30, Potsdam<br />
LUA Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2002: Lebensräume und<br />
Arten der FFH-Richtlinie in Brandenburg. In: Naturschutz und Landschaftspflege<br />
in Brandenburg, Heft 1,2 2002. Potsdam<br />
LUA Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2002b: Standard-<br />
Datenbogen zum FFH-Gebiet „Werbellinkanal“ (unveröffentlichtes<br />
Gutachten)<br />
LUA Landesumweltamt Brandenburg (Hrsg.) 2003: Liste der Biotoptypen.<br />
Neufassung. Vorläufige Ausgabe, Stand 15.04.2003. Landesumweltamt<br />
Brandenburg. Potsdam<br />
MLUR Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung<br />
(Hrsg.) 2000: Landschaftsprogramm Brandenburg. Potsdam<br />
MLUR Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung<br />
(Hrsg.) 2001: Biosphärenreservat <strong>Schorfheide</strong> Chorin Landschaftsrahmenplan.<br />
Potsdam<br />
MLUR Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Raumordnung<br />
(Hrsg.) 2001: Biosphärenreservat <strong>Schorfheide</strong> Chorin Pflege-<br />
und Entwicklungsplan. Potsdam<br />
24
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Bewertungskriterien des Arten- und Biotopschutzes<br />
Für die Beurteilung der Bedeutung von Biotopen für die Leistungsfähigkeit<br />
des Naturhaushaltes sind die Kriterien Schutzwürdigkeit<br />
und Schutzbedürftigkeit heranzuziehen. Die Einstufung der Biotoptypen<br />
in 6 Wertkategorien erfolgt unter paritätischer Berücksichtigung<br />
dieser beiden Grundkriterien. Dabei ergibt sich die Schutzwürdigkeit<br />
paritätisch aus den Parametern:<br />
� Entwicklungsgrad,<br />
� Natürlichkeit,<br />
� Strukturreichtum,<br />
� Artenvielfalt,<br />
� Intensität anthropogener Störeinflüsse.<br />
Die Schutzbedürftigkeit wird paritätisch durch die Parameter<br />
� Seltenheit des Biotops,<br />
� Seltenheit dort vorkommender Arten,<br />
� Empfindlichkeit,<br />
� ungünstiger Entwicklungstendenz bestimmt.<br />
Die Wertstufe 1 (sehr hohe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz)<br />
ergibt sich demnach wenn das Biotop:<br />
� eine hohe Naturnähe aufweist<br />
und<br />
� eine dem Idealzustand des Biotoptyps nahe kommende Struktur und<br />
Artenvielfalt aufweist<br />
und<br />
� von anthropogenen Störungen weitgehend frei ist<br />
und<br />
� nach Eingriffen oder bei Neuschaffung mehr als 25 Jahre bis zur<br />
Wiederherstellung des Ausgangszustandes benötigt würden<br />
oder<br />
� in Brandenburg sehr selten oder nur sehr kleinflächig vorkommt<br />
und<br />
� mehrere geschützte/Gefährdete Tier- und Pflanzenarten beherbergt<br />
bzw. als Verbindungsbiotop für solche Arten unverzichtbar ist<br />
Die Wertstufe 5 (sehr geringe Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz)<br />
ergibt sich demnach wenn das Biotop:<br />
� durch anthropogene Nutzungen überprägt wird<br />
und<br />
� eine geringe Struktur- und Artenvielfalt aufweist<br />
und<br />
� von anthropogenen Störungen beeinträchtigt wird<br />
und<br />
� nach Eingriffen oder bei Neuschaffung weniger als 3 Jahre bis zur<br />
Wiederherstellung des Ausgangszustandes benötigt würden<br />
oder<br />
� in Brandenburg sehr häufig oder nur großflächig vorkommt<br />
und<br />
� keine geschützte/Gefährdete Tier- und Pflanzenarten beherbergt bzw.<br />
als Verbindungsbiotop für solche Arten verzichtbar ist<br />
Die Wertstufen 2-4 vermitteln abgestuft zwischen den beschriebenen<br />
Extremen der Wertstufen 1 und 5.<br />
Die Wertstufe 0 (ohne Bedeutung für den Arten- und Biotopschutz) bezieht<br />
sich auf überbaute und versiegelte Flächen.<br />
25
Anlage 6: Landschaftsplanerische Voruntersuchung Ortsteil Altenhof<br />
Pflanzliste<br />
Bäume in der freien Landschaft<br />
Botanischer Name Deutscher Name<br />
Quercus petraea Trauben-Eiche<br />
Quercus robur Stiel-Eiche<br />
Tilia cordata Winterlinde<br />
Carpinus betulus Hainbuche<br />
Fagus sylvatica Rot-Buche<br />
Fraxinus excelsior Gemeine Esche<br />
Alnus Glutinosa (1) Schwarz-Erle<br />
(1) nur an Gewässerufern<br />
Sträucher in der freien Landschaft<br />
Botanischer Name Deutscher Name<br />
Corylus avellana Haselnuß<br />
Crategus laevigata Zweigriffeliger Weißdorn<br />
Euonymus europaeus Europäisches Pfaffenhütchen<br />
Rhamnus cathartica Purgier-Kreuzdorn<br />
Rosa canina Hundsrose<br />
Prunus spinosa Schlehe<br />
Sorbus aucuparia Gew. Eberesche<br />
26